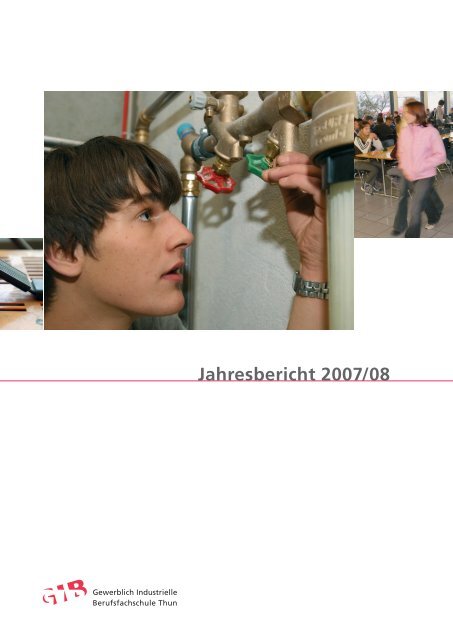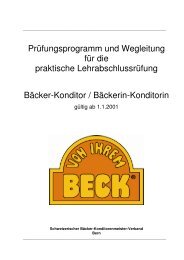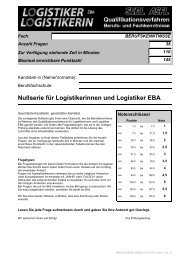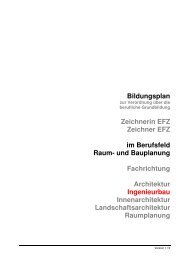Jahresbericht 2007/08 - Gewerblich Industrielle Berufsfachschule ...
Jahresbericht 2007/08 - Gewerblich Industrielle Berufsfachschule ...
Jahresbericht 2007/08 - Gewerblich Industrielle Berufsfachschule ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
2 Vorwort<br />
3 Organigramm<br />
4 in Kürze<br />
5 Personelles Lehrerschaft und Verwaltung<br />
Ehrungen<br />
Eintritte<br />
Austritte<br />
Lehrpersonen im Ruhestand<br />
12 Schülerchronik<br />
Auszeichnungen<br />
15 Schulbetrieb<br />
Schwerpunkte des Schuljahres <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Abteilung Bauberufe<br />
Abteilung Technische Berufe<br />
Abteilung Dienstleistungsberufe und PFM<br />
(pädagogische Fördermassnahmen)<br />
Abteilung Berufsmaturität /<br />
Fort- und Weiterbildung<br />
Berichte der Ressortleiter<br />
Verwaltung<br />
Bericht Lehrervertreter<br />
Spenden<br />
39 Jahresrechnung<br />
40 Danke
Vorwort<br />
Die Schnittstelle am Übergang Sekundarstufe I –<br />
Sekundarstufe II wird zur Nahtstelle!<br />
Wir an der GIB Thun sind einhellig der Auffassung,<br />
dass diese Forderung kein leerer Slogan<br />
bleiben darf und alle Beteiligten, die Lehrpersonen<br />
der Oberstufen-Klassen der Volksschule wie<br />
auch jene der <strong>Berufsfachschule</strong>n und die Ausbildungsverantwortlichen<br />
der Lehrbetriebe, noch<br />
stärker als heute zusammenarbeiten müssen.<br />
Aussagen wie «Die Lernenden können immer<br />
weniger» oder «Die Volksschule erfüllt ihren<br />
Auftrag nicht mehr» bringen uns nicht weiter.<br />
Schon zu meiner Ausbildungszeit machten ähnliche<br />
Sprüche die Runde.<br />
Tatsache ist, dass<br />
die Volksschule einen sehr allgemeinen und<br />
breiten Bildungsauftrag hat, der nicht auf alle<br />
speziellen Bedürfnisse und Wünsche der <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />
und der Wirtschaft Rücksicht<br />
nehmen kann,<br />
die Anforderungen in allen Berufen massiv gestiegen<br />
sind,<br />
in den Bildungsverordnungen konkrete Ziele<br />
und Kompetenzen festgehalten werden, die es<br />
absolut zu erreichen gilt,<br />
der Empfehlung (Volksschule) und der Auswahl<br />
(Lehrbetriebe) von zukünftigen Lernenden<br />
höchste Priorität zukommt und ein professionelles<br />
Auswahlverfahren, in dem ein<br />
«Multicheck-Test» höchstens gewisse Anhaltspunkte<br />
geben kann, zwingend notwendig ist.<br />
Volksschule und Ausbildungsbetriebe haben näher<br />
aufeinander zuzugehen. Das gegenseitige<br />
Verständnis von Schule und Wirtschaft muss gestärkt<br />
werden. Auch die <strong>Berufsfachschule</strong>n sind<br />
gefordert.<br />
Die GIB Thun hat die Zusammenarbeit mit der<br />
Volksschule zu einem ihrer wichtigsten Ziele erklärt.<br />
Dies nicht erst seit bekannt wurde, dass im<br />
Kanton Bern jeder 5. Lernende (20%) die Lehre<br />
– in vielen Fällen wegen ungenügenden Noten in<br />
der <strong>Berufsfachschule</strong> – abbrechen muss.<br />
Mit drei Massnahmen hoffen wir zu erreichen,<br />
dass die Schnittstelle noch stärker als heute zur<br />
Nahtstelle wird:<br />
Wir anerkennen, dass es nicht nur eine Bringschuld<br />
der Volksschule, sondern auch eine Holschuld<br />
der <strong>Berufsfachschule</strong> ist, und nehmen<br />
die Arbeit und Veränderungen an der Volksschule<br />
aktiv wahr.<br />
Wir informieren die Volksschule rechtzeitig<br />
und stufengerecht über unsere Ausbildungsgänge<br />
und Ziele.<br />
Wir stellen für Lehrpersonen und Schülerinnen<br />
und Schüler der Volksschule verschiedene Angebote<br />
zur Verfügung, die einen Übertritt in<br />
die <strong>Berufsfachschule</strong> unterstützen und erleichtern.<br />
Diese Angebote können unter www.gibthun.ch<br />
jederzeit abgerufen werden.<br />
Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen<br />
Weg sind. Im Quervergleich mit dem kantonalen<br />
Durchschnitt liegt die Quote der Lehrabbrechenden<br />
im Einzugsgebiet der GIB Thun in den letzten<br />
Jahren lediglich zwischen zwei bis fünf Prozent.<br />
Für dieses gute Resultat sind auch unsere<br />
Ausbildungsbetriebe verantwortlich.<br />
Hansrudolf Gerber, Direktor<br />
Organigramm<br />
Q-Entwicklung<br />
Hans-Heini Winterberger<br />
Bauberufe<br />
Organigramm<br />
Qualitätsmanagement<br />
Urs Gugger<br />
Schulentwicklung<br />
Markus Birchler<br />
Hans-Heini Winterberger<br />
Peter von Allmen<br />
Fachgruppe<br />
Bau<br />
Daniel Suter<br />
Fachgruppe<br />
Gärtner/Floristen<br />
Heinz Bähler<br />
Fachgruppe<br />
Haustechnik<br />
Hermann Ryter<br />
Technische Berufe<br />
Thomas Stucki<br />
Direktionssekretariat<br />
Silvia Fink<br />
Fachgruppe Anlagen-<br />
und Metallbau<br />
Heinz Peter<br />
Fachgruppe<br />
Autotechnik<br />
Marcel Wyler<br />
Fachgruppe<br />
Landtechnik<br />
Niklaus Röthlisberger<br />
Fachgruppe<br />
Maschinenbau<br />
Markus Birchler<br />
Direktor<br />
Hansrudolf Gerber<br />
Fortbildung/LEFO<br />
Markus Birchler<br />
Hans-Heini Winterberger<br />
Dienstleistungsberufe<br />
und PFM<br />
Ueli Brügger<br />
Fachgruppe Bäcker-<br />
Konditor/Köche<br />
René Fäh<br />
Fachgruppe<br />
Coiffeure<br />
Andrea Gasser<br />
Fachgruppe<br />
Informatik<br />
Patrick Ackermann<br />
Fachgruppe<br />
Logistik<br />
Hans Erni<br />
Fachgruppe PFM<br />
Sibylle Michel<br />
René Fäh<br />
Direktor Stellvertreter<br />
Ueli Brügger<br />
Ressort ABU<br />
Hans Huggler<br />
Stefan von Niederhäusern<br />
Ressort Informatik<br />
Thomas Fahrni<br />
Ressort Sport<br />
Jürg Künzler<br />
Kommunikation/<br />
Information<br />
Markus Wenger<br />
Beratungsdienst<br />
Lernende<br />
Susanna Thierstein<br />
Mediothek<br />
Stefan von Niederhäusern<br />
BMS, Fort- und<br />
Weiterbildung<br />
Urs Gugger<br />
Fachgruppe<br />
Mathematik/ Naturwissenschaften<br />
Martin Zahler<br />
Fachgruppe<br />
Sprachen/Geschichte<br />
Bruno Zingg<br />
2 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 3 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Verwaltung<br />
Béatrice Klossner<br />
Rechnungswesen<br />
Philipp Langhart<br />
Schulsekretariat<br />
Silvia Fink<br />
Gebäude/Hausdienst<br />
Walter Heim<br />
Bibliothek<br />
Barbara Schafroth<br />
Dezember <strong>2007</strong>
in Kürze<br />
Kennzahlen<br />
Schülerzahlen<br />
Kollegium<br />
Freifachkurse<br />
Behörden<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Pensum >10 Lektionen
Eintritte<br />
Folgende Lehrpersonen wurden auf Beginn des Schuljahres 20<strong>08</strong>/09 gewählt:<br />
Befristeter Lehrauftrag<br />
Gerber Bernhard Kurse Landmaschinenmechaniker<br />
Hodler André Fachunterricht Logistiker<br />
Ilg Markus Fachunterricht Logistiker<br />
Kummer Stephan Fachunterricht Bauzeichner<br />
Liniger Marco (Okt. 07) Fachunterricht Logistiker<br />
Marti Bruno Freifachkurse<br />
Meier Nick Sport, Allgemeinbildung<br />
Negro Toni Fachunterricht Konstrukteure<br />
Rothenbühler Urs Fachunterricht Sanitärmonteure<br />
Schneebeli Louis Sport<br />
Wyttenbach Martin Fachunterricht Landmaschinenmechaniker<br />
Unbefristeter Lehrauftrag<br />
Bögli Markus Sport, Allgemeinbildung<br />
Kasteler Patrick Fachunterricht Anlagen- und Apparatebauer<br />
Schluchter Susanne Allgemeinbildung<br />
Willi Peter Fachunterricht Spengler<br />
Austritte<br />
Folgende Lehrpersonen traten während des Schuljahres bzw. per Ende Schuljahr <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> aus dem<br />
Schuldienst aus:<br />
Baumann Paul Fachunterricht Gärtner<br />
Karolyi Martin Fachunterricht Köche<br />
Liniger Marco Fachunterricht Logistiker<br />
Rüegg Stefan Fachunterricht Logistiker<br />
Ryter Hermann Fachunterricht Sanitärmonteure<br />
Schneebeli Jürg Allgemeinbildung<br />
Sinzig Bruno Fachunterricht Automobiltechnik<br />
Rücktritt Paul Baumann<br />
Mitte der 80er-Jahre, anlässlich meines Eintritts in<br />
die Schule, lernte ich Paul in der für ihn typischen<br />
Doppelrolle als versierten Geschäftsmann und<br />
engagierten Fachlehrer mit beachtlichem Unterrichtspensum<br />
kennen. Zwischenzeitlich längst als<br />
Geschäftsführer der Fuhrer Gartenbau AG wirkend,<br />
ist er uns glücklicherweise noch über Jahre<br />
mit einem Kleinpensum als respektierter Landschaftsgärtner-Doyen<br />
erhalten geblieben. Nach<br />
32 Jahren Unterricht an Fachklassen Gärtner ist<br />
Paul Baumann Ende Juli dieses Jahres von seiner<br />
Lehrtätigkeit an der GIB Thun zurückgetreten.<br />
Aus einer Gärtnerfamilie stammend, absolvierte<br />
Paul seine Lehre als Landschaftsgärtner bereits<br />
im Betrieb seines späteren Mentors Ernst Fuhrer.<br />
Nach der Meisterprüfung blieb er als Kadermitarbeiter<br />
in der zwischenzeitlich zur AG gewandelten<br />
Unternehmung tätig, der er nun bereits seit<br />
1991 als Geschäftsführer vorsteht. Die Verbindung<br />
zur <strong>Berufsfachschule</strong> steht bei Paul und seiner<br />
Firma exemplarisch für die tief verwurzelte<br />
Überzeugung, wonach Nachwuchsförderung des<br />
Tatbeweises bedarf und nicht bloss Lippenbekenntnis<br />
bleiben darf.<br />
Nebst der geschätzten Lehrtätigkeit von Paul gilt<br />
es denn auch, das über Jahrzehnte erbrachte<br />
überdurchschnittliche Engagement seiner Firma<br />
für die Berufsbildung zu erwähnen. Dieses darf<br />
als Ausdruck einer Grundhaltung gesehen werden,<br />
die sich um die tatkräftige Unterstützung<br />
junger Berufsleute in einer wegweisenden Lebensphase<br />
bemüht. Derselben Gesinnung ist die<br />
Tatsache zuzuordnen, dass Paul Baumann wiederholt<br />
auch dafür mitverantwortlich zeichnete,<br />
dass sich geeignete Berufsleute nebenamtlich als<br />
neue Fachlehrer gewinnen liessen. Nebst dem<br />
längst bewährten Fachgruppenleiter Heinz Bähler<br />
betrifft dies auch Philipp Geissbühler, der vor<br />
dem Eintritt ins EHB-Studium berufskundlicher<br />
Richtung steht und dann wohl als erster hauptamtlicher<br />
Gärtner-Fachlehrer bei uns seine Lehrtätigkeit<br />
fortsetzen wird.<br />
6 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 7 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Paul Baumann wird sich mitnichten bereits aufs<br />
Altenteil zurückziehen, denn vorderhand bleibt<br />
er noch voll im Betrieb tätig. Er sah bloss den<br />
Zeitpunkt gekommen, sich aus dem Schuldienst<br />
zurückzuziehen, und er will die dadurch frei werdende<br />
Zeit künftig der Familie zukommen lassen.<br />
Lieber Paul, wir danken dir für dein langjähriges<br />
Wirken an unserer Schule, für die engagierte und<br />
kompetente Tätigkeit zur Förderung der jungen<br />
Berufsleute, für den geleisteten Einsatz und die<br />
geschätzte Zusammenarbeit. Wir wünschen dir<br />
und deiner Familie herzlich alles Gute für die Zukunft.<br />
Pensionierung Martin Karolyi<br />
Peter von Allmen, Vorsteher<br />
Lieber Martin<br />
30 Jahre bernischer Schuldienst! Die ganze Zeit<br />
hast du der Gewerbeschule/Berufsschule resp.<br />
<strong>Berufsfachschule</strong> Thun die Treue gehalten. In dieser<br />
Zeit hast du viele Wechsel erlebt, drei Namensänderungen<br />
der Schule, zwei Direktoren,<br />
zwei direkte Vorgesetzte als Abteilungsvorsteher,<br />
viele Gesichter von neu eingetretenen oder<br />
von der Schule weggegangenen Kolleginnen<br />
und Kollegen.<br />
Dein Weg zum Berufsschullehrer verlief bei dir<br />
lehrbuchmässig. Du hast zuerst eine berufliche<br />
Top-Qualifikation geholt. Du hast diese reiche<br />
Erfahrung als Fachlehrer eingebracht und an viele<br />
angehende Berufskollegen und -kolleginnen<br />
weitergeben können.<br />
Du hast eine wichtige Zeit an unserer Schule mitgestaltet.<br />
Bei deiner Wahl fand dein Unterricht in<br />
einem Normzimmer statt. In einer Ecke eines Vorbereitungszimmers<br />
stand ein Haushaltkochherd<br />
mit vier Platten und wenig Kochgeschirr. Das genügte<br />
dir für einen aktuellen und gehaltvollen<br />
Unterricht, wie du ihn gerne halten wolltest,<br />
nicht. Du hast eine Profi-Küche gefordert, die sowohl<br />
dem Unterricht wie auch dem Einführungskurs<br />
genügte und in der auch die Lehrabschluss-
Werdegang von Martin Karolyi<br />
1963–1966 Kochlehre in Laichingen<br />
(Baden-Württemberg)<br />
Lehr- und Wanderjahre als Koch mit Stellen<br />
von Schweden bis Adelboden<br />
1971–1979 Küchenchef im Spital Frutigen<br />
1971 Lehrmeisterkurs<br />
1977 Meisterprüfung an der Gewerbeschule<br />
der Stadt Bern<br />
1.4.1978 Wahl zum nebenamtlichen<br />
Kochfachlehrer an der GIB Thun<br />
1.4.1979 Wahl zum hauptamtlichen<br />
Fachlehrer<br />
1981–83 SIBP: Ausbildung zum Berufsschullehrer<br />
in fachkundlicher Richtung<br />
1988–1992 Fachreferent an der HFG<br />
(Höhere Fachschule für Gastronomie)<br />
prüfung abgelegt werden konnte. Du hast sie 12<br />
Jahre später erhalten. Das war dann «deine» Küche.<br />
Du hast zu ihr geschaut, wie wenn es deine<br />
eigene wäre, so dass sie noch heute den hohen<br />
Anforderungen von Demo-Küche, Freifachkursen,<br />
üKs (überbetrieblichen Kursen) und für das<br />
QV (Qualifikationsverfahren) genügt. Niemand<br />
würde ihr das Alter von fast 20 Jahren geben.<br />
Du suchtest immer den Kontakt mit den Ausbildnerinnen<br />
und Ausbildnern. Du engagierst dich<br />
noch heute in der Beratung und Aufsicht des<br />
MBA. Du organisiertest Ausbildungsnachmittage<br />
für Ausbildner. Du erkanntest die Nöte in den<br />
Lehrbetrieben und hast Kurse organisiert, wo du<br />
Lücken in der praktischen Ausbildung geortet<br />
hast. Wie mühsam war doch anfangs der 90-er<br />
Jahre der Start in deinem Kurszyklus. Du warst<br />
hartnäckig und hast einen zunehmend grösseren<br />
Teil deiner Küchenchefs an der Front überzeugt,<br />
dass diese Kurse nicht nur nötig, sondern auch<br />
sehr gut sind. Heute hast du das Dilemma, dass<br />
sie überfüllt sind und du sie vielfach doppelt führen<br />
musst. In diesen Kursen blühte auch der verhinderte<br />
Gastronom auf.<br />
Zusammen haben wir die Widerstände der Ausbildner<br />
gegen Auslandexkursionen gebrochen.<br />
Du hast in Südfrankreich so interessante Programme<br />
zusammengestellt, dass die Lernenden<br />
viel profitierten und bei späteren Begegnungen<br />
immer noch davon schwärmen. Mit Lehrmeisterabenden<br />
vor und nach den Exkursionen erreichten<br />
wir schon bald die Akzeptanz für diese Form<br />
Unterricht.<br />
Dein Lehrmeister in Laichingen (D) hat dir 1966<br />
im Lehrabgangszeugnis, das du mit dem Gehilfenbrief<br />
erhalten hast, geschrieben: «Während<br />
seiner Lehrzeit hat Martin keinen Anlass zu Zurechtweisungen<br />
gegeben, er war stets ein williger,<br />
arbeitsamer und ehrlicher Mitarbeiter».<br />
Martin, das bist du geblieben. Ich danke dir für<br />
die grosse Arbeit an unserer Schule. Du hinterlässt<br />
bei uns Spuren.<br />
Ein Trost bleibt mir. Du hast deine Pensionierung<br />
mit 60 eingegeben. Wir verlieren dich aber noch<br />
nicht ganz. Du hilfst uns als Nebenamtlehrer, den<br />
erwarteten Rückgang bei den Kochlernenden zu<br />
überbrücken. Ich freue mich weiterhin auf deine<br />
kompetente Mitarbeit zählen zu dürfen, auch<br />
wenn du nicht mehr jeden Tag anzutreffen sein<br />
wirst.<br />
Pensionierung Hermann Ryter<br />
Ueli Brügger, Vorsteher<br />
In seinem Demissionsschreiben nennt Hermann<br />
Ryter Zahlen: 2900 Lernende seien während insgesamt<br />
40’000 gehaltenen Lektionen durch «seine<br />
Schule» gegangen. Wahrlich eindrückliche<br />
Summen, resultierend aus 35 Jahren hingebungsvoller<br />
Lehrtätigkeit. Ziffern, die ein weit herum<br />
geschätztes und gewürdigtes Engagement für<br />
die Gebäudetechnikbranche abbilden und vom<br />
Einsatz zugunsten des beruflichen Nachwuchses<br />
zeugen.<br />
Seit 1973 unterrichtete Hermann an der GIB<br />
Thun. Zuvor hatte der in Frutigen als Sohn eines<br />
Spenglermeisters aufgewachsene Silbermedaillen-Gewinner<br />
der Berufsweltmeisterschaft 1966<br />
(Utrecht, Holland; Hermann als erster Schweizer<br />
WM-Teilnehmer in der Sparte Haustechnik) die<br />
Ausbildungen zum Bauspengler und zum Sanitärinstallateur<br />
in den Lehrwerkstätten der Stadt<br />
Bern von der Pike auf gelernt. Nach Abschluss der<br />
Meisterausbildung wechselte der junge Handwerkermeister<br />
von der Baustelle in die Werkstatt<br />
und war von da an auch als Leiter von Einführungskursen<br />
tätig. 1972 meldete er sich auf eine<br />
Vakanz an der damaligen Gewerbeschule Thun<br />
und wurde als vollamtlicher Hauptlehrer gewählt.<br />
Anfänglich betreute Hermann Ryter Klassen<br />
in den Sparten Sanitär, Spenglerei und Heizung.<br />
Mit der Wahl weiterer Fachlehrer fielen<br />
erst die Heizungsklassen und später auch die<br />
Spengler weg. Von da an unterrichtete Hermann<br />
ausschliesslich im Bereich Sanitär, nachdem der<br />
Mitte der 90er Jahre ins Leben gerufene Lehrgang<br />
«Haustechnik» Episode geblieben war.<br />
Streng und wohlwollend kritisch, fordernd wie<br />
auch fördernd, so lässt sich Hermanns Umgang<br />
mit den Lernenden umschreiben. Meister Ryter<br />
sah seine Berufung darin, den «Stiften» zu helfen,<br />
in einer entscheidenden Lebensphase einen<br />
wesentlichen Schritt nach vorne zu tun, und dies<br />
nicht allein im Beruf. In Ergänzung zu seiner Unterrichtstätigkeit<br />
leitete er während langer Jahre<br />
die Fachgruppe Haustechnik an der GIB Thun.<br />
Dass Hermann Ryter daneben auch noch für den<br />
Kanton in mehreren Funktionen tätig war – u.a.<br />
als Fachgruppen-Verantwortlicher sowie als Prüfungsexperte<br />
– ist als Ausdruck seines Selbstverständnisses,<br />
seiner Identifikation mit der ihm<br />
übertragenen Aufgabe zu verstehen.<br />
Loslassen fällt schwer, wenn man seine Arbeit als<br />
Berufung erfahren und sich mit Leib und Seele in<br />
die Lehrtätigkeit eingebracht hat. Und so erfordert<br />
jeder Lebensabschnitt eine neue Orientierung.<br />
Glücklicherweise hat Hermann rechtzeitig<br />
dafür gesorgt, dass ihm die Zeit nach der Pensionierung<br />
nicht lang wird. Nebst dem Motorrad bezeichnet<br />
er seine Homepage, mit der er seit dem<br />
Jahr 2000 im Internet präsent ist, als eine Passion,<br />
die er noch lange weiterzupflegen gedenke. Erholsame<br />
Töff-Touren, aber auch weiterhin Betriebsbesuche<br />
im Auftrag des MBA sowie die<br />
Website-Gestaltung für den Verband der Haustechnik-Fachlehrer<br />
sind nur einige der geplanten<br />
Aktivitäten. Und ganz sicher wird das gute Gedeihen<br />
der Haustechnik am Standort Thun für Hermann<br />
weiterhin ein Herzensanliegen bleiben,<br />
nachdem er jahrelang engagiert für den Verbleib<br />
der Berufe an der GIB Thun gekämpft hat.<br />
Lieber Hermann, wir danken dir für deine von<br />
Hingabe, Kompetenz und Ausdauer geprägte<br />
Arbeit an unserer Schule, für deinen unermüdlichen<br />
Einsatz und deine Verlässlichkeit. Für den<br />
anstehenden Lebensabschnitt wünschen wir alles<br />
Gute und viele frohe Stunden im Kreis der geliebten<br />
Familie. Bleibe verwitterungsbeständig<br />
wie dein Bergkristall. Und weiterhin «bonne route»,<br />
wenn du der in diesem Haus verbreiteten<br />
Motorrad-Leidenschaft frönen wirst.<br />
Peter von Allmen, Vorsteher<br />
Pensionierung Jürg Schneebeli<br />
8 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 9 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Gemeinsam repräsentieren die abtretenden Kollegen<br />
der Bauabteilung mehr als 100 Jahre engagierter<br />
Lehrtätigkeit, wovon Jürg Schneebeli<br />
alleine für 40 Jahre Dienst auf verschiedenen<br />
Schulstufen zeichnet. Eine stolze Zahl, die auch als<br />
Symbol für ein gerüttelt Mass an Erfahrung sowie<br />
für markante, unverwechselbare Persönlichkeitsmerkmale<br />
steht. In Thun aufgewachsen und in<br />
Hofwil zum Primarlehrer ausgebildet, hat Jürg seine<br />
Schulmeister-Sporen während einiger Wanderjahre<br />
an mehreren Wirkungsstätten abverdient,<br />
bevor er am Sekundarlehramt das Studium naturwissenschaftlicher<br />
Richtung aufnahm. Nach erfolgreichem<br />
Abschluss trat er im April 1977 an der<br />
GIB Thun eine Hauptlehrerstelle für Allgemeinbildung<br />
und Sport an, die er bis zu seinem Rücktritt<br />
im vergangenen Sommer innehatte.<br />
Während Jahren funktionierte Jürg Schneebeli<br />
zusammen mit Max Lüthi als bewährtes Lehrer-<br />
Tandem für allgemeinbildenden und fachlichen<br />
Unterricht an Schreinerklassen. Nachdem die<br />
«Hölzigen» aber nach Frutigen weggezogen waren,<br />
bildete er in der Folge mit Renato Valli die<br />
gut harmonierende Maler-Crew. Dass Jürg stets<br />
daran gelegen war, seine körperliche und geistige<br />
Fitness zu erhalten, zeigt sich darin, dass es<br />
ihm Anliegen und Herausforderung zugleich<br />
war, seine Klassen bis zur Pensionierung auch im<br />
Sportunterricht selber zu betreuen. Auch gehörten<br />
Tennis und Skifahren während Jahrzehnten<br />
zu seinen konstanten Freizeitaktivitäten, und die<br />
älteren Kollegen erinnern sich als Mitglieder eines<br />
damals gut «gekitteten» und von Jürg klar<br />
und umsichtig geführten Leiterteams mit Freude<br />
und auch etwas Wehmut an die jeweils turbulenten<br />
Skilagerwochen in Saas Fee.<br />
Ein weiteres starkes Duo bildete Jürg zusammen<br />
mit Erich Kobel, sowohl im Rahmen der «autonomen<br />
Republik 215» als auch in der Informatik. Als<br />
PC-Freaks der ersten Stunde absolvierten die beiden<br />
Ende der 80er-Jahre ein Nachdiplomstudium<br />
in Informatik. Anschliessend standen sie dann<br />
vor der herkulischen Aufgabe, mit viel Geduld
die blütenweissen Amateure aus dem Kollegium<br />
in die Geheimnisse der ersten PC-Modelle von<br />
IBM und Olivetti einzuführen. In der Folge bemühte<br />
sich Jürg auch um die Anwendung der<br />
neuen Technologien im Schulzimmer, wobei die<br />
Möglichkeiten der staatlichen Schule seinen Qualitätsansprüchen<br />
kaum je zu genügen vermochten.<br />
Um für die Lernenden bestmögliche Arbeitsbedingungen<br />
zu erreichen, war Jürg trotzdem<br />
immer um eine gute Ressourcen-Versorgung bemüht.<br />
Diesbezüglich vertrat er klare Ideen, die er<br />
stets pointiert vorzubringen wusste.<br />
Stets offen für Neues, dabei aber auf klare Überzeugungen<br />
bauend, klopfte Jürg die diversen<br />
Neuerungen im bernischen Bildungswesen jeweils<br />
kritisch auf Nutzen und Notwendigkeit ab.<br />
Mit gewissen Veränderungen hat er sich denn<br />
auch schwer getan. So sieht er mit den teilautonomen<br />
Schulen beispielsweise die Gewaltenteilung<br />
in den Bildungsinstitutionen gefährdet.<br />
Und weil er eine Zunahme der Abhängigkeiten<br />
für die Lehrpersonen sowie eine Erosion der Mitbestimmung<br />
fürchtet, steht Jürg der neuen Kompetenzfülle<br />
der Schulleitungen grundsätzlich<br />
skeptisch gegenüber. Gleichzeitig schätzte er jedoch<br />
die an der GIB Thun geförderte Potentialentwicklung<br />
bei den Mitarbeitenden.<br />
Dass sich Jürg diesen Sommer von der GIB Thun<br />
ein Arbeitszeugnis ausstellen liess, zeugt von der<br />
Absicht, auch in den kommenden Jahren beruflich<br />
aktiv zu bleiben, wobei es sich um zeitlich<br />
klar umrissene Engagements handeln soll, damit<br />
die nun für Camper-Reisen gewonnene Zeitautonomie<br />
nicht gleich wieder entfällt.<br />
Lieber Jürg, für dein Wirken an unserer Schule,<br />
für dein von Hartnäckigkeit und klaren Werthaltungen<br />
geprägtes Engagement zugunsten der<br />
Berufslernenden gebührt dir unser herzlichster<br />
Dank. Für die kommenden Jahre wünschen wir,<br />
dass es dir gelingt, die Segel für die Zukunft passend<br />
zu setzen. Dazu braucht es eine gute Brise,<br />
die auch dein neues «Windredli» in Gang halten<br />
soll. Geniesse die elegante, lautlose Bewegung<br />
des Rades und nimm dir seine spielerische Leichtigkeit<br />
als Vorbild, wenn es mal vonnöten sein<br />
sollte, sich gegen den Wind zu stemmen.<br />
Peter von Allmen, Vorsteher<br />
Pensionierung Bruno Sinzig<br />
Bruno Sinzig ist weit über die Grenzen des Schulhauses<br />
hinaus als Lehrperson für die Autotechnik<br />
bekannt. Er hat ganze Generationen von Fachleuten<br />
aus dem Autogewerbe begeistert.<br />
Am 1.10.1974 wurde Bruno an die damalige<br />
Gewerbeschule Thun gewählt. Zuletzt unterrichtete<br />
er in der Autotechnik die Automobil-Fachmänner,<br />
Automechaniker und Fahrzeugelektriker.<br />
Vom 1.8.2000 bis am 31.7.<strong>2007</strong> leitete er<br />
zudem die Fachgruppe Autotechnik.<br />
Im Bereich der Weiterbildung bereitete er engagiert<br />
und mit grossem Erfolg die gelernten Berufsleute<br />
auf die Berufsprüfung der Automobildiagnostiker<br />
vor.<br />
Neben seiner Lehrtätigkeit engagierte sich Bruno<br />
Sinzig stark im Verband des AGVS (Auto Gewerbe<br />
Verband Schweiz). Er war massgeblich an der<br />
Planung des Ausbildungszentrums Mülenen beteiligt.<br />
Als fundierter Kenner der Branche und<br />
dank seiner guten Beziehungen zu den Lehrbetrieben<br />
konnten viele Probleme von Lernenden<br />
rasch gelöst werden.<br />
Mit seinem enormen Fachwissen verstand er es,<br />
die Lernenden und Kursteilnehmer zu motivieren<br />
und für den Autoberuf zu begeistern. Auch<br />
sein nebenamtliches Engagement als Journalist<br />
und Fotograf in der Welt des Automobilrennsports<br />
und die damit gemachten Erfahrungen<br />
und Erlebnisse belebten den Unterricht.<br />
Bruno Sinzig geht nach knapp 34 Jahren Schuldienst<br />
in die verdiente Pension.<br />
Bruno, ich danke dir für deine langjährige, professionelle<br />
Arbeit und dein Engagement zugunsten<br />
der Berufslernenden im Autogewerbe. Ich<br />
wünsche dir im neuen Lebensabschnitt viel Freude,<br />
ruhigere, aber nicht weniger erfüllte Stunden<br />
und gute Gesundheit, um deine Interessen weiter<br />
pflegen zu können.<br />
Thomas Stucki, Vorsteher<br />
Lehrpersonen im Ruhestand<br />
Peyer Hans Hauptlehrer Allgemeinbildung 1988<br />
Bühlmann Walter Hauptlehrer Berufskunde 1989<br />
Wyler Erhard Direktor 1990<br />
Hämmerli Gustav Hauptlehrer Berufskunde 1991<br />
Egli Kurt Hauptlehrer Berufskunde 1992<br />
Hänni Louis Hauptlehrer Berufskunde 1992<br />
Kruger Marianne Hauptlehrerin Hauswirtschaft 1992<br />
Zimmermann Silvia Hauptlehrerin Hauswirtschaft 1992<br />
Hertig Hanspeter Hauptlehrer Berufskunde 1994<br />
Kunz Samuel Hauptlehrer Berufskunde 1994<br />
Nagel Max Hauptlehrer Berufskunde 1997<br />
Gerber Henriette Hauptlehrerin Berufsmittelschule 1998<br />
Inglin Hansueli Hauptlehrer Allgemeinbildung 1998<br />
Baumann Martha Hauptlehrerin Hauswirtschaft 2000<br />
Luginbühl Samuel Hauptlehrer Allgemeinbildung 2000<br />
Spring Willy Hauptlehrer Berufskunde 2000<br />
Hadorn Fritz Hauptlehrer Berufskunde 2001<br />
Kobel Erich Hauptlehrer Allgemeinbildung 2001<br />
Stähli Walter Hauptlehrer Berufskunde 2002<br />
Wernli Ernst Hauptlehrer Berufskunde 2002<br />
Wiedmer Ernst Hauptlehrer Berufskunde 2002<br />
Liggenstorfer Hans Hauptlehrer Berufskunde 2003<br />
Luginbühl Bernhard Hauptlehrer Berufskunde 2003<br />
Bichsel Paul Hauptlehrer Berufskunde 2004<br />
Fischer Günter Hauptlehrer Allgemeinbildung 2004<br />
Kohli Hans-Rudolf Hauptlehrer Allgemeinbildung 2005<br />
Bolliger Elisabeth Hauptlehrerin Berufsmaturität 2006<br />
Rieder Heinz Hauptlehrer Berufskunde 2006<br />
Tschabold Martin Hauptlehrer Berufskunde 2006<br />
Ziegler Hans Peter Vorsteher mechanisch-technische Berufe 2006<br />
Blatti Kurt Hauptlehrer Berufskunde <strong>2007</strong><br />
Fischer Marc Hauptlehrer Allgemeinbildung <strong>2007</strong><br />
Oppliger Vincenz Vorsteher Bauberufe <strong>2007</strong><br />
Baumann Paul Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />
Karolyi Martin Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />
Ryter Hermann Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />
Schneebeli Jürg Hauptlehrer Allgemeinbildung 20<strong>08</strong><br />
Sinzig Bruno Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />
10 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 11 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Schülerchronik<br />
Auszeichnungen<br />
Am 25. Juni 20<strong>08</strong> wurden ausserordentliche Leistungen<br />
während der Lehrzeit im Rahmen einer<br />
schlichten Feier ausgezeichnet. Dem Leitbild getreu<br />
werden Leistungen gefordert – aber auch<br />
gewürdigt!<br />
Die Feier wurde von der Bläsergruppe Blasonett,<br />
einer Band der Musikschule Region Thun, musikalisch<br />
umrahmt.<br />
KABA-Preis<br />
Ernst Keller, Obmann der KABA-Stiftung, konnte<br />
in 23 Lehrberufen die besten Berufslernenden<br />
mit einem Zinnteller auszeichnen. Er ermunterte<br />
die jungen Berufsleute ebenso initiativ zu sein,<br />
wie das Handwerker und Gewerbetreibende im<br />
Jahre 1949 waren, als sie als Antwort auf wirtschaftlich<br />
schlechte Zeiten zusammenstanden<br />
und die KABA (Kantonal-Bernische Ausstellung)<br />
in Thun organisierten. Er dankte für die überdurchschnittlichen<br />
Leistungen und brachte der<br />
Hoffnung Ausdruck, dass sie nachhaltig wirken<br />
werden.<br />
GIBT-Medaille<br />
Hansrudolf Gerber, Direktor GIB Thun, dankte<br />
den Geehrten für die aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft.<br />
In seiner Kurzansprache forderte<br />
er die jungen Berufsleute auf, Verantwortung<br />
zu übernehmen und ihren Leistungswillen<br />
zu Gunsten einer florierenden Wirtschaft einzubringen.<br />
Rotary<br />
Der Rotary Club Thun zeichnete Berufslernende<br />
für ausserordentliche Arbeiten aus. Ein Ausschuss<br />
aus zwei Vertretern des Rotary Clubs und Lehrpersonen<br />
der GIB Thun bewerteten in einem aufwändigen<br />
Beurteilungsverfahren die neun eingereichten<br />
Arbeiten. Das Sieger-Team konnte am<br />
19. Mai anlässlich einer Veranstaltung des Rotary<br />
Clubs im Hotel Holiday in Thun die Preise in Empfang<br />
nehmen. Alle Berufslernenden, welche eine<br />
Arbeit einreichten, wurden an der KABA-Feier<br />
für ihre aussergewöhnlichen Arbeiten mit der<br />
GIBT-Medaille geehrt.<br />
Ueli Brügger, Direktor-Stellvertreter<br />
ulrich.bruegger@gibthun.ch<br />
Preisträger<br />
Allgemeinbildung VA Daniel Steiner<br />
(Vertiefungsarbeit) Daniel Thönen<br />
Polymechaniker Daniel Weiss<br />
Timon Willen<br />
Weiter haben Arbeiten eingereicht:<br />
Berufsmatur, IdPA Benjamin Ernst<br />
(Interdisziplinäre Michel Gauch<br />
Projektarbeit) Thomas Rytz<br />
Andreas Affolter<br />
Stefan Remund<br />
Projektarbeit Dominique Beer<br />
Hochbauzeichner Roger Kübli<br />
Allgemeinbildung, VA Patrik Burkhalter<br />
Cirill Huber<br />
Thomas Messerli<br />
Daniel Schmid<br />
Philemon Schmutz<br />
Michèle Hochuli<br />
Melanie Molder<br />
Franziska Zenger<br />
Martina Aerni<br />
Jan Hirschi<br />
Simon Hunziker<br />
Aron Stauffer<br />
Mirjam Megert<br />
Monika Zingg<br />
Manuela Zumbrunnen<br />
Todesfälle<br />
Leider verstarben auch in diesem Jahr vier hoffnungsvolle<br />
junge Berufsleute:<br />
Melissa Davis, Floristin 3. Lehrjahr,<br />
am 29.11.<strong>2007</strong><br />
Michael Hauswirth, Spengler Zusatzlehre,<br />
am 7.5.20<strong>08</strong><br />
Rolf Zürcher, Anlagen- und Apparatebauer<br />
2. Lehrjahr, am 29.6.20<strong>08</strong><br />
Janik Wäfler, Automechaniker 3. Lehrjahr,<br />
am 7.8.20<strong>08</strong><br />
Den betroffenen Familien sprechen wir auch an<br />
dieser Stelle nochmals unser herzliches Beileid<br />
aus.<br />
Hansrudolf Gerber, Direktor<br />
Artikel aus dem Thuner Tagblatt<br />
vom 30. Juni 20<strong>08</strong><br />
« Wo kämen wir hin, wenn alle sagten,<br />
wo kämen wir hin und niemand ginge,<br />
um einmal zu schauen, wohin man käme,<br />
wenn man ginge. Kurt Marti »<br />
12 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 13 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Die KABA-Preisträgerinnen und -träger<br />
Beruf Vorname Name Lehrbetrieb<br />
Anlagen- und Apparatebauer Fredi Moser Laserschnitt AG, Uetendorf<br />
Automechaniker, (Leichte Motorwagen) Marco Jordi Elite Autocenter AG, Matten b. Interlaken<br />
Automonteur, (Leichte Motorwagen) Kevin Feuz Pichler GFG AG, Feutersoey<br />
Bäckerin-Konditorin Jasmin Eicher Peter Galli, Steffisburg<br />
Bauzeichner Reto Lucek Mätzener + Wyss, Interlaken<br />
Betriebspraktiker Andreas Beutler Domicil für Senioren Alexandra, Bern<br />
Coiffeuse, Damen Karin Lanz Maria Nava, Thun<br />
Fahrzeug-Elektriker-Elektroniker Matthias Kurth Renato Schüpbach, Aarwangen<br />
Floristin Mirjam Megert Fritz Kaspar-Reusser, Thun<br />
Gärtnerin, Zierpflanzen Regula Salzmann Werner Kunz, Brienz BE<br />
Heizungsmonteur Kevin Rohrer Bacher AG Thun, Thun<br />
Hochbauzeichner Christoph Mesmer Lanzrein & Partner, Thun<br />
Informatiker Thomas Lenzin Swisscom AG, Bern<br />
Köchin Jasmin Huber Gwatt-Zentrum AG, Gwatt (Thun)<br />
Küchenangestellter Sandro Hubacher Reg. Spitalzentrum Oberdiessbach<br />
Landmaschinenmechaniker Bruno Zurbrügg von Niederhäusern AG, Erlenbach im Simmental<br />
Logistikassistentin Lara Bresnik RUAG Ammotec, Thun<br />
Logistikpraktiker Rolf Tröhler Band-Genossenschaft, Bern<br />
Malerin Cornelia Graf Maler Koller AG, Oberhofen am Thunersee<br />
Metallbauer Simon Schmid Minder + Zysset AG, Seftigen<br />
Polymechaniker, Niveau E Thomas Rytz Meyer & Burger AG, Thun<br />
Sanitärmonteur Johny Christen Wenger Sanitär Heizung GmbH, Heimberg<br />
Spengler Reto Gerber Kurt Marti, Frutigen<br />
GIBT-Medaille, für einen Notendurchschnitt von 5.6 und mehr während der ganzen Lehrzeit<br />
Beruf Vorname Name Lehrbetrieb Note<br />
Betriebspraktiker Andreas Beutler Domicil Alexandra, 3006 Bern 5.656<br />
Betriebspraktiker Kilian Portmann Regionalspital Emmental AG, Burgdorf 5.625<br />
Coiffeuse, Damen Karin Lanz Maria Nava, Thun 5.842<br />
Coiffeuse, Damen Daniela Zurbrügg Adrian & Verena Hänni, Thun 5.816<br />
Coiffeuse, Damen Sarah Kaufmann Barbara Hadorn-Portner, Thun 5.711<br />
Coiffeuse, Damen Daniela Zenger Coiffure Blatter, Meiringen 5.711<br />
Coiffeuse, Damen Katharina Michel Haarstudio, Brienz 5.632<br />
Floristin Mirjam Megert Fritz Kaspar-Reusser, Thun 5.833<br />
Floristin Franziska Zenger Doris Aebi, Meiringen 5.600<br />
Gärtner, Garten- und Landschaftsbau Nicolas Pfister Zysset + Partner AG, Thun 5.656<br />
Gärtnerin, Zierpflanzen Regula Salzmann Werner Kunz, Brienz 5.909<br />
Gärtnerin, Zierpflanzen Sarah Schenk Blumen Gerber & Co., Steffisburg 5.886<br />
Köchin Jasmin Huber Gwatt-Zentrum AG, Gwatt 5.679<br />
Landmaschinenmechaniker Bruno Zurbrügg von Niederhäusern AG, Erlenbach i.S. 5.628<br />
Logistikassistentin Lara Bresnik RUAG Ammotec, Thun 5.850<br />
Logistikassistentin Maria Krummenacher Die Schweizerische Post, Langnau i.E. 5.795<br />
Logistikassistent Daniel Anderegg Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau 5.725<br />
Logistikassistent Marc-André Lambrigger login Berufsbildung Olten, Olten 5.692<br />
Logistikassistentin Melanie Jakob MailSource AG, Bern 5.682<br />
Logistikassistent Adrian Schläpfer Emmi Frischprodukte AG, Ostermundigen 5.650<br />
Logistikassistentin Karin Lauber Die Schweizerische Post, Köniz 5.615<br />
Logistikassistent Christoph Reinhard Die Schweizerische Post, Thun 5.615<br />
Metallbauer Simon Schmid Minder + Zysset AG, Seftigen 5.658<br />
Schulbetrieb<br />
Einige Schwerpunkte des<br />
Schuljahres <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Mit dem Kompetenzenraster Mathematik von<br />
der Schnitt- zur Nahtstelle<br />
Damit Schulaustretende besser wissen, welche<br />
mathematischen Fähigkeiten nötig sind, um einen<br />
Beruf zu erlernen, wurde in dreijähriger Arbeit<br />
ein Kompetenzenraster ausgearbeitet.<br />
Eine Weiterbildungsveranstaltung vor vier Jahren<br />
war die Initialzündung, die schliesslich zum<br />
heutigen Ergebnis führte. Hansrudolf Gerber, Direktor<br />
GIB Thun, meint denn auch folgerichtig:<br />
«Der Kompetenzenraster Mathematik wird eine<br />
entscheidende Erleichterung für die Beurteilung<br />
der mathematischen Anforderungen in den jeweiligen<br />
Berufsfeldern darstellen.»<br />
Die Ausarbeitung des Kompetenzenrasters durch<br />
Fachgruppenleiter nahm drei Jahre in Anspruch.<br />
Das Grundprinzip beruht darauf, dass ein direkter<br />
Bezug zum jeweils gewählten Beruf hergestellt<br />
wird.<br />
Auf der Homepage der GIB Thun (www.gibthun.<br />
ch) kann für alle Berufsfelder das entsprechende<br />
Fenster mit jeweiligen Rechnungsbeispielen angeklickt<br />
werden. Nicht zuletzt ist dieses intelligente<br />
Instrumentarium auch eine Hilfe für Schulaustretende.<br />
Hier können sich künftige Lernende<br />
orientieren und sich bewusst werden, was in etwa<br />
der (Wunsch)beruf mathematisch verlangt.<br />
Ziel ist es, die ehemalige Schnitt- künftig zur<br />
Nahtstelle Sek I Sek II werden zu lassen. Stufengerechtes<br />
Abholen wird sicherlich vermehrt dazu<br />
führen, dass Lehrabbrüche zukünftig noch mehr<br />
eingedämmt werden können, weil man sich<br />
schon vor Lehrantritt über die Voraussetzungen<br />
orientieren kann.<br />
Die Lehrabbrüche an der GIB Thun betrugen im<br />
Jahr <strong>2007</strong> 2,82% (gemäss Bericht liegt die Rate<br />
kantonal um die 20%!).<br />
Rückmeldung Progymatte Thun<br />
Von Kurt Leiser und Ulrich Christen, Schulleiter<br />
der Oberstufenschule Progymatte, erhielt unsere<br />
Schulleitung die unterstützende Rückmeldung:<br />
«Wir sind erfreut über die sich entwickelnden<br />
Qualitätsstandards, wie sie an der GIB Thun als<br />
Grundlagenpapier für die Schnittstelle Lehrbeginn/<strong>Berufsfachschule</strong><br />
entwickelt wurden und<br />
René Fäh, Fachgruppenleiter<br />
werden.» Dieser gemeinsame Weg von Volksschule<br />
und <strong>Berufsfachschule</strong> ist bedeutend und<br />
zielt in die richtige Richtung.<br />
Zusammenarbeit GIB Thun mit BZ Interlaken<br />
Auch zwischen der GIB Thun und dem BZI (Berufsbildungszentrum<br />
Interlaken) geht man einen<br />
gemeinsamen Weg, wie Ernst Meier (BZI, Ressort<br />
Weiterbildung) betont. In Interlaken ist man<br />
auch daran, Kompetenzenraster für die Mathematik<br />
zu erstellen. Man kann aber das Raster<br />
nicht einfach von Thun übernehmen, denn dieses<br />
setzt einen andern Ansatz des Unterrichtens voraus.<br />
Die Lehrpersonen müssen zuerst eingearbeitet<br />
werden, um die neuen Möglichkeiten kennen<br />
zu lernen. In dieser Phase ist man momentan am<br />
BZI.<br />
Theo Ninck, Vorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt,<br />
hat sich zum Ziel gesetzt, den Kompetenzenraster<br />
(wird an der GIB Thun bereits sehr<br />
oft angeklickt und gebraucht!) im ganzen Kanton<br />
Bern zu verbreiten.<br />
Eine gelungene Innovation, die hoffentlich dazu<br />
führen wird, dass man künftig nur noch von der<br />
Nahtstelle Sek I Sek II sprechen wird.<br />
Neuer Rahmenlehrplan<br />
allgemein bildender Unterricht (ABU)<br />
Vereinheitlichung führt zu mehr Qualität<br />
Standardisierte Themen, Inhalte und Schlüsselbegriffe<br />
für alle <strong>Berufsfachschule</strong>n im Kanton<br />
Bern sollen mehr Transparenz und Qualität garantieren.<br />
Auf der Grundlage des vom BBT<br />
(Bundesamt für Berufsbildung und Technologie)<br />
erlassenen, gesamtschweizerischen Rahmenlehrplans<br />
(RLP 2006) haben alle Schulen und Kantone<br />
ihre Schullehrpläne in der Allgemeinbildung per<br />
20<strong>08</strong> anzupassen. Ab diesem Schuljahr sind die<br />
nachfolgenden Themen für alle Berner <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />
verbindlich geregelt:<br />
Berufliche Grundbildung<br />
Geld und Kauf<br />
Risiko und Sicherheit<br />
14 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 15 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Demokratie und Mitgestaltung<br />
Kunst und Kultur<br />
Schweiz in Europa und der Welt<br />
Markt und Konsum<br />
Globale Herausforderungen<br />
Wohnen und Zusammenleben<br />
Arbeit und Zukunft<br />
Die bisherigen schuleigenen Lehrpläne, die sogenannten<br />
Schullehrpläne, mussten alle entsprechend<br />
– innerhalb des vorgegebenen Rahmens<br />
und der Standards – während der letzten zwei<br />
Jahre revidiert werden. Diese Verantwortung<br />
liegt weiterhin bei den <strong>Berufsfachschule</strong>n selber.<br />
Die GIB Thun hat ihren ABU-Schullehrplan ebenfalls<br />
per Sommer 20<strong>08</strong> angepasst.<br />
Alle neuen im ersten Lehrjahr Lernenden werden<br />
ab sofort nach dem neuen SLP (Schullehrplan)<br />
20<strong>08</strong> unterrichtet.<br />
Kompetenzenmanagement –<br />
eigene Fähigkeiten erkennen ist lernbar<br />
Kompetenzenmanagement in der Grundbildung:<br />
Anlässlich einer öffentlichen Orientierung über<br />
dieses besondere, gemeinsame Unterrichts-Projekt<br />
zogen die Verantwortlichen des Bildungszentrums<br />
Interlaken (BZI) und der GIB Thun nach<br />
drei Jahren vor einem interessierten Publikum ein<br />
erstes Fazit.<br />
Vom dokumentierten Prozess zum<br />
Laufbahnbegleiter CH-Q<br />
Die beiden Projektleiter, Christian Borter (BZI)<br />
und Hans-Heini Winterberger (GIB Thun) sind<br />
sich bewusst, dass die Umsetzung des Kompetenzenmanagements<br />
nach dem System der Gesellschaft<br />
CH-Q (Laufbahnbegleiter/Kompetenzenmanagement)<br />
im Unterricht nicht einfach ist. So<br />
v.l.n.r. Hans-Heini Winterberger, Projektverantwortlicher GIB Thun, Urs Burri, Rektor BZI,<br />
Urs Gugger, Abteilungsvorsteher Weiterbildung GIB Thun, Christian Borter, Projektverantwortlicher<br />
BZI und Ernst Meier, Ressort Weiterbildung, BZI<br />
be tonen die beiden Berufsschullehrer denn auch,<br />
dass die Jugendlichen sich zuerst darin üben<br />
müssten, Prozesse – zum Beispiel Lernabläufe –<br />
zu beschreiben, um dann in der Lage zu sein, daraus<br />
auch eigene Kompetenzen, Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten abzuleiten.<br />
Die jungen Auszubildenden verfügen nach Abschluss<br />
ihrer obligatorischen Schulzeit zwar über<br />
Zeugnisse, Noten und Ausweise, die aber über<br />
ihre spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten nur<br />
wenig aussagen. In einem ersten Schritt geht es<br />
nun darum, bereits vorhandenes Knowhow und<br />
Fertigkeiten sichtbar zu machen und zu dokumentieren.<br />
Daraus abgeleitete Kompetenzen<br />
werden systematisch gegliedert und bilden so<br />
das Potential der jungen Menschen ab. Das Dokument,<br />
das daraus entsteht, ist ein sogenannter<br />
Laufbahnbegleiter, der sowohl die Ausbildungsprozesse<br />
wie auch die daraus erworbenen Kompetenzen<br />
systematisch dokumentiert. Diese<br />
Mappe bildet die Grundlage für spätere Bewerbungen<br />
auf dem Arbeitsmarkt nach Abschluss<br />
der Grundbildung. Es geht auch darum, dass die<br />
jungen Berufsfachleute das Management ihres<br />
Potentials, ihrer Kompetenzen und Qualifikationen<br />
selber an die Hand nehmen und daraus ihre<br />
weitere Laufbahn gezielt entwickeln.<br />
Kompetenzenmanagement flächen deckend für<br />
alle Lernenden im ersten Lehrjahr?<br />
Die beiden Schulleitungen in Interlaken und<br />
Thun werden nun gemeinsam er örtern, inwieweit<br />
dieses Modell flächendeckend ab dem ersten<br />
Lehrjahr eingesetzt werden soll.<br />
Borter und Winterberger sind sich einig, dass viele<br />
Jugendliche sich gar nicht bewusst sind, «was<br />
sie alles auch noch können…», über welche spezifischen<br />
Kompetenzen und Fähigkeiten sie verfügen.<br />
Deshalb würden sich die jungen Frauen<br />
und Männer eher unterschätzen und sich am Arbeitsmarkt<br />
entsprechend schlecht behaupten.<br />
Und gerade auch hier schaffe das Kompetenzenmanagement<br />
neue Mög lichkeiten.<br />
Vorbereitungskurs auf die höhere<br />
Berufsprüfung als Warehouse- und<br />
Distributionslogistiker (WDL)<br />
Nebst dem Angebot der beruflichen Grundbildung<br />
für Logistiker EBA und Logistiker EFZ führt<br />
die GIB Thun neu einen modular aufgebauten<br />
Vorbereitungskurs zur Erlangung des eidgenössischen<br />
Fachausweises als Warehouse- und Distri-<br />
butionslogistiker. Diese Ausbildung zur Berufsprüfung<br />
wird in der Schweiz nur an fünf Orten,<br />
im Kanton Bern neben Thun auch am BWZ Lyss<br />
angeboten, umfasst 340 Lektionen und dauert<br />
1¼ Jahre. Sie führt zum eidg. diplomierten<br />
Warehouse- und Distributionslogistiker.<br />
Bikes im Sportunterricht an der GIB Thun<br />
Nachfolgend macht sich Sportlehrer Jürg Künzler<br />
als Ressortverantwortlicher ein paar Gedanken<br />
und beleuchtet Hintergründe, weshalb sich die<br />
GIB Thun für den Sportunterricht Bikes angeschafft<br />
hat.<br />
Markus Bögli, Sportlehrer, machts vor.<br />
Geht man davon aus, dass infolge Turnhallenmangels<br />
(seit vielen Jahren!) an der GIB Thun gerade<br />
einmal 50% der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen<br />
Turnstunden stattfinden können,<br />
kommen den erlebnisorientierten Angeboten<br />
besondere Bedeutung zu. Ob beim Inlineskaten,<br />
beim Kajakfahren, beim Windsurfen, beim Lauftraining,<br />
beim Schwimmen oder im Spielbetrieb:<br />
die Menschen lernen sich ganz neu kennen. Begegnung,<br />
aber auch Mut, Anstrengung und Lebensfreude<br />
sind Themen.<br />
Während im Schulzimmer berufsspezifische und<br />
allgemeinbildende Themen und Aspekte durch<br />
Rezeption und Produktion im Vordergrund stehen,<br />
kann im Sport ein weiteres Feld von Sinneswahrnehmungen<br />
und Interaktion weit über den<br />
kognitiven Bereich hinaus angesprochen werden.<br />
Die Bilder im Kopf, die Bewegung noch in den<br />
Beinen, den Rhythmus im Körper, den erlebten<br />
Energiefluss im Blut, die Liebe zur Bewegung im<br />
Herzen neu entdeckt – das sind Hinweise auf eine<br />
nachhaltige Sportstunde – vor allem auch auf einem<br />
der neu zur Verfügung stehenden schuleigenen<br />
Bikes!<br />
Folgende Einsatzbereiche wie etwa eine geführte<br />
Tour im Klassenverband, Bike OL in Kleingruppen,<br />
Bewegungs- und Begegnungsspiele auf<br />
Plätzen und im Wald, Technikparcours als Einstieg<br />
ins sportliche Bikeerlebnis, Grenzerfahrung<br />
für Material und Mensch in unwegsamem Gelände<br />
sind möglich. Ziel des Sportunterrichts ist immer<br />
eine Verhaltensänderung:<br />
Die Einstellung des Körpers auf Bewegung<br />
und Aktivität fördert die Leistung und<br />
Aufmerksamkeit<br />
Verbesserte Energiebereitstellung<br />
Effizientere Nutzung der Energie durch<br />
Verbesserung der Technik<br />
Angepasste Übungs- und Belastungsformen,<br />
die zu neuer Leistungsfähigkeit führen<br />
Reflektierende Grundhaltung zum Erlebten<br />
und Geleisteten und damit Aufbau einer<br />
Werthaltung gegenüber dem Tun, dem Körper<br />
und der Gesundheit<br />
Ein Rad ist also mehr als nur Stahl, Alu oder Karbon!<br />
Defibrillator an zentralem Standort<br />
Verwaltungsmitarbeitende der benachbarten<br />
Thuner Wirtschaftsschule und der GIB Thun haben<br />
sich kürzlich im Rahmen eines gemeinsam<br />
besuchten Ausbildungskurses in lebensrettenden<br />
Sofortmassnahmen, Reanimation und Herzmassage<br />
schulen lassen. Dabei ist ebenfalls der wirkungsvolle<br />
und korrekte Einsatz des neu angeschafften<br />
Defibrillators geübt worden. Das Gerät<br />
befindet sich einsatzbereit im Sekretariat im<br />
1. Stock und kann von vier Personen fachgerecht<br />
bedient werden.<br />
v.l.n.r. Walter Heim, Hauswart, Silvia Fink, Leiterin<br />
Sekretariat, Beatrice Klossner, Verwalterin<br />
und Philipp Langhart, Leiter Rechnungswesen<br />
16 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 17 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Gewaltandrohung – Amoklauf – an der GIB Thun<br />
Artikel aus dem Thuner Tagblatt<br />
vom 19. und 20. Dezember <strong>2007</strong><br />
Abteilung Bauberufe<br />
Von wegen Bildungsmisere!<br />
Immer noch treten in der Deutschschweiz annähernd<br />
70% der Jugendlichen nach der Volksschule<br />
in eine Berufslehre ein. Und dank erstklassiger<br />
Arbeitsqualität, die nicht zuletzt auf das Berufsbildungssystem<br />
zurückzuführen ist, geniesst die<br />
Schweizer Wirtschaft eine starke Stellung, und<br />
dies trotz hohen Preisen und Löhnen. Und: von<br />
allen OECD-Ländern hat die Schweiz die geringste<br />
Arbeitslosigkeit.<br />
Obschon sich alle zur Berufsbildung bekennen,<br />
lässt einen zuweilen der Eindruck nicht los, massgebende<br />
Teile des wirtschaftspolitischen Establishments<br />
verkennen deren Stellenwert und seien<br />
einseitig auf die Anhebung der gymnasialen<br />
Maturandenquoten fixiert. Häufig wird die Bedeutung<br />
der Berufsbildung für die Standortqualität<br />
der Schweiz ignoriert, weil das Wissen bezüglich<br />
Organisation des Systems nur rudimentär<br />
vorhanden ist: Wer nie in einem Betrieb gearbeitet<br />
hat, verkennt leicht die Bedeutung der Lehre<br />
als Schlüsselqualifikation für eine Mehrheit der<br />
Volksschulabgänger. Eine hohe Maturitätsquote<br />
allein garantiert aber keine Vollbeschäftigung: In<br />
Genf, wo bloss 22% der Jugendlichen eine Berufslehre<br />
machen, liegen die Arbeitslosenquoten<br />
fast dreimal so hoch wie in St. Gallen, wo 75% in<br />
eine Berufslehre eintreten. Der Schluss liegt nahe,<br />
dass auch eine grundsolide berufspraktische<br />
Aus- und Weiterbildung die Arbeitsmarktfähigkeit<br />
der Jugendlichen nachhaltig zu fördern vermag.<br />
Ein Indikator, der diese These stützt, mögen<br />
die Löhne von Fachhochschul-Graduierten sein,<br />
die beim Berufseinstieg in gewissen Branchen<br />
sig nifikant über denjenigen von Hochschulabsolventen<br />
liegen.<br />
Folglich wäre es angebracht, wenn unser Berufsbildungssystem<br />
allmählich die Anerkennung und<br />
Wertschätzung erfahren würde, die ihm zusteht.<br />
Dieses einmalige System muss erhalten und weiterentwickelt<br />
werden. Unter anderem braucht es<br />
in der Berufslehre eine Stärkung des allgemeinbildenden<br />
Teils: Sprachen, Informatik, ökonomische<br />
Bildung. Bereits steht ein breites Spektrum<br />
an Instrumentarien zur Verfügung, um den<br />
Jugendlichen den Übertritt in die Berufslehre<br />
bzw. die <strong>Berufsfachschule</strong> zu erleichtern, um allfällige<br />
Defizite zu eruieren und in der Folge abzubauen.<br />
Immer wieder sind beim Eintritt in die Berufslehre<br />
Schuldzuweisungen zu vernehmen, müssige<br />
Vorwürfe bezüglich festgestellter Wissenslücken.<br />
Dabei können heutige Lernende nicht weniger<br />
als ihre Vorgänger. Im Gegenteil: Gemäss Vergleichstests<br />
sind die Jungen intellektuell leistungsfähiger<br />
geworden. Unter anderem werden<br />
Leistungssteigerungen im Sprachverständnis und<br />
beim abstrakt-logischen Denken festgestellt (nebenbei:<br />
mit 21% Leseschwachen schnitt die Generation<br />
der über 45-Jährigen in den Tests am<br />
schlechtesten ab – gegenüber bloss 9% bei den<br />
16- bis 25-Jährigen!). Die Anforderungen im beruflichen<br />
und gesellschaftlichen Leben sind gesamthaft<br />
gestiegen: leichter haben’s die Jungen<br />
bestimmt nicht. Und doch ist, trotz starker Zunahme<br />
von ausländischen Schulkindern, die Zahl<br />
der Ungelernten pro Jahrgang prozentual gesunken.<br />
<strong>2007</strong>/<strong>08</strong> in der Bauabteilung<br />
Gesamthaft bot das vergangene Schuljahr keine<br />
spektakulären Umwälzungen und Ereignisse –<br />
von der kurzzeitigen weihnächtlichen «Bombenstimmung»<br />
mal abgesehen –, dafür die Fortsetzung<br />
eines stetig sich vollziehenden Wandels<br />
ebenso wie die Weiterführung einer konstruktiven<br />
Zusammenarbeit in der Abteilung.<br />
Erstmals in einem Jahrgang drei Parallelklassen<br />
bei den Gärtnern und beim Betriebsunterhalt:<br />
Vor dem prognostizierten Rückgang der Lehrverhältnisse<br />
wurde bezüglich Klassenzahl noch eine<br />
neue Marke gesetzt. Daneben nimmt die gemäss<br />
BBT-Masterplan ablaufende Inkraftsetzung der<br />
angepassten Bildungsverordnungen ihren Fortgang.<br />
In den vergangenen Monaten haben die<br />
Fachlehrkräfte der Floristinnen und der Haustechnikberufe<br />
mit viel Elan die Umsetzung der<br />
neuen Bildungspläne an die Hand genommen.<br />
Auf dass sie zu Schuljahresbeginn bereit waren,<br />
die neu eintretenden Lernenden nach Massgabe<br />
der angepassten Anforderungen zu unterrichten.<br />
Was den Mediations- und Betreuungsbedarf für<br />
Lernende angeht, war im vergangenen Jahr eine<br />
irritierende Zunahme des zeitlichen Aufwands<br />
festzustellen, wobei sich Probleme im persönlichen<br />
Umfeld und Konflikte am Arbeitsplatz in<br />
etwa die Waage hielten.<br />
Und wie jedes Jahr ergaben sich in allen drei<br />
Fachgruppen Veränderungen im Lehrkörper, wobei<br />
der Umbruch in der Fachgruppe Haustechnik<br />
am tiefsten geht: Mit dem langjährigen Sanitärfachlehrer<br />
und Fachgruppenleiter Hermann Ry-<br />
18 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 19 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
ter schied innerhalb eines Jahres die zweite vollamtliche<br />
Lehrkraft aus dem Haustechnik-Team.<br />
Markus Baumgartner rückt an seine Position, sowohl<br />
in der Berufsgruppe als in der Fachgruppenleitung.<br />
Hans Stucki seinerseits übernimmt –<br />
neu im Vollamt – die Verantwortung für den<br />
Lehrberuf/Lehrdauer Kollegium Fachausschuss<br />
Anzahl Lernende<br />
Bauzeichner/in<br />
4 Lehrjahre BK Stephan Kummer, Matthias Meyer, Ernst Steiger kein Fachausschuss<br />
58 Lernende ABU Stefan Heusser, Erich Marti<br />
T+S Martin Christen, Hans Ruef<br />
Fachleute für Betriebsunterhalt<br />
3 Lehrjahre BK Heinz Bähler, Markus Baumgartner, Hans Stucki kein Fachausschuss<br />
122 Lernende ABU Martin Christen, Anna Hirsig, Hans Huggler,<br />
Sibylle Michel<br />
T+S Markus Bögli<br />
Florist/in<br />
3 Lehrjahre BK Peter Fleischli siehe Gärtner<br />
74 Lernende ABU Barbara Monti di Sopra, Sabine Wüthrich<br />
T+S Jürg Künzler, Barbara Monti di Sopra<br />
Gärtner/in<br />
3 Lehrjahre BK Heinz Bähler, Paul Baumann, Philipp Geissbühler, Hansruedi Gosteli, Matten, AG<br />
155 Lernende Hans-Peter Liebi, Stephan Nyffeler Albert Heim, Thun, AG<br />
ABU Markus Binggeli, Hans Huggler Edith Hofmann, Konolfingen, AG<br />
T+S Markus Bögli, Hans Huggler, Barbara Monti di Sopra Andreas Jost, Uetendorf, AN<br />
Hans Stähli, Thun, AN<br />
Heizungsinstallateur/in<br />
3 Lehrjahre BK Ernst Dunkel Gottfried Trachsel, Zweisimmen, AG<br />
49 Lernende ABU Martin Berger, Sascha Stanisic Peter Zwahlen, Steffisburg, AN<br />
T+S Markus Bögli, Sascha Stanisic<br />
Hochbauzeichner/in<br />
4 Lehrjahre BK Christoph Hürlimann, Lothar Straubhaar, Daniel Suter kein Fachausschuss<br />
132 Lernende ABU Stefan Heusser, Erich Marti<br />
T+S Martin Christen, Hans Ruef<br />
Maler/in<br />
3 Lehrjahre BK Jürg Lüthi, Renato Valli Jürg Hansen, Interlaken, AG<br />
95 Lernende ABU Jürg Schneebeli Hansueli Hubacher, Thierachern, AN<br />
T+S Markus Bögli, Hans Ruef, Jürg Schneebeli Martin Lüthi, Hünibach, AN<br />
Martin Schwarz, Aeschi, AG<br />
Louis Werren, Gstaad, AG<br />
Sanitärinstallateur/in<br />
3 Lehrjahre BK Markus Baumgartner, Heinz Isler, Hermann Ryter Urs Klopfenstein, Thun, AN<br />
115 Lernende ABU Stefan Heusser, Sascha Stanisic Reto Messerli, Thun, AG<br />
T+S Jürg Künzler, Barbara Monti di Sopra Hans-Jakob Rieder, Wiler, AG<br />
Spengler/in<br />
3 Lehrjahre BK René Liechti Paul Michel, Unterseen, AG<br />
59 Lernende ABU Sascha Stanisic, Sabine Wüthrich<br />
T+S Jürg Künzler, Hans Ruef<br />
BK = Berufskunde, ABU = Allgemeinbildender Unterricht, T+S = Turnen und Sport, AG = Arbeitgeber, AN = Arbeitnehmer<br />
Zweig Betriebsunterhalt. Der bevorstehende Eintritt<br />
von Spenglerfachlehrer Peter Willi wird diesen<br />
Rochaden vorerst einmal ein Ende setzen und<br />
eine fällige Phase der Kondsolidierung einleiten.<br />
Peter von Allmen, Vorsteher<br />
peter.vonallmen@gibthun.ch<br />
Sekundarstufe I<br />
Allgemeinbildung<br />
Breite Basis<br />
Abteilung Technische Berufe<br />
«Die Lernenden in den ersten Lehrjahren können<br />
immer weniger». So tönt es zwischendurch im<br />
Volksmund. Vergessen wird dabei, dass die heutigen<br />
Jugendlichen in einer sich viel rascher verändernden<br />
und somit vielseitigeren Berufs- und<br />
Umwelt zurechtfinden müssen. Der Übergang<br />
von der Volksschule zur <strong>Berufsfachschule</strong> bringt<br />
für die Jugendlichen tatsächlich einige einschneidende<br />
Umstellungen:<br />
Strenge Arbeitswoche ohne freie<br />
Nachmittage<br />
Hohe Qualitätsanforderungen an die<br />
gemachte Arbeit<br />
Lernen von viel Fachwissen<br />
Weniger Freizeit<br />
Ablösung von zu Hause<br />
Lernen, auf eigenen Beinen zu stehen<br />
Wie kommt es zu diesem Wechsel?<br />
Die Schwergewichte der Volksschule liegen richtigerweise<br />
auf einem breiten Wissen in verschiedensten<br />
Kompetenzbereichen. Erst nach dem<br />
Abschluss der Sekundarstufe I werden unterschiedliche<br />
Wege verfolgt:<br />
Berufsausbildung<br />
Gymnasiale Ausbildung<br />
Andere Wege<br />
Die Schwergewichte der Sekundarstufe II können<br />
nun nicht mehr so pauschal über alle Ausbildungsangebote<br />
definiert werden. In der Vertiefung<br />
der fachlichen Kompetenzen unterscheiden<br />
sich die Angebote sehr stark.<br />
Sekundarstufe II Ziel<br />
Starke Prägung<br />
durch Berufsfeld<br />
Vertiefte<br />
Allgemeinbildung<br />
Brückenangebote<br />
Berufsleute/<br />
Fachpersonen<br />
Ich stelle die These auf, dass die Lernenden gleich<br />
viel können und wissen wie wir Älteren und die<br />
Berufsbildner damals mit 16 Jahren. Wir beherrschten<br />
aber andere Fähigkeiten. So wird als<br />
Beispiel der uns bekannte Dreisatz in der Volksschule<br />
heute nicht mehr vermittelt. Dafür lernen<br />
die Jugendlichen, Proportionen mit Hilfe von Tabellen,<br />
Kennlinien, Grafiken, Preislisten und anderem<br />
Zahlenmaterial zu berechnen. Alter Wein<br />
zwar, aber verpackt in neuen Schläuchen.<br />
Was bleibt unverändert?<br />
Am Ende der Lehre müssen alle Lernenden ein<br />
von den Verbänden vorgegebenes Qualifikationsverfahren<br />
bestehen. Diese Prüfung wird für<br />
die <strong>Berufsfachschule</strong> fremdbestimmt. Deshalb<br />
müssen alle Beteiligten konzentriert und zielgerichtet<br />
arbeiten. Allfälliger Freiraum muss oft zur<br />
Vertiefung des Prüfungsstoffes eingesetzt werden.<br />
Wo liegt die Herausforderung?<br />
Die <strong>Berufsfachschule</strong>n müssen sich einerseits auf<br />
die neuen, veränderten Kompetenzen der Volksschulabgänger<br />
einstellen. Andererseits sind der<br />
Stoffumfang und die Anforderungen an die Lernenden<br />
in den technischen Berufen in den letzten<br />
Jahren gestiegen.<br />
Was tun wir konkret für die Schnitt-/Nahtstelle?<br />
Die Lehrpersonen müssen die Kompetenzen der<br />
Volksschule im fachlichen und sozialen Bereich<br />
verstehen. Im Bereich Mathematik wurden unsere<br />
Lehrpersonen mit den neuen Lehrmitteln geschult.<br />
Um den Lernenden den Übergang auf die Sekundarstufe<br />
II zu erleichtern, bieten wir eine Nachholbildung<br />
in der Mathematik an. Damit soll erreicht<br />
werden, dass sich der Fachunterricht nach<br />
dem ersten Semester auf die Vermittlung der für<br />
den Beruf notwendigen Theorie beschränken<br />
kann und die Lernenden das Handwerk beherrschen.<br />
In der Landtechnik wurde der Kurs bereits<br />
einmal erfolgreich durchgeführt. Die ersten Resultate<br />
zeigen eine positive Wirkung. Im laufenden<br />
Schuljahr folgen solche Kurse für die Autotechnik<br />
und den Maschinenbau.<br />
Wir stehen in diesem Prozess erst am Anfang. Neben<br />
Mathematik gibt es noch andere Fähigkeiten,<br />
die in der Berufsausbildung von tragender<br />
Bedeutung sind. Nach den Auswertungen der Erfahrungen<br />
mit der Nachholbildung werden wir<br />
andere Bereiche schrittweise dazunehmen.<br />
20 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 21 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Studium<br />
Berufslehre<br />
Thomas Stucki, Vorsteher<br />
thomas.stucki@gibthun.ch
Lehrberuf/Lehrdauer Kollegium Fachausschuss<br />
Anzahl Lernende<br />
Anlagen- und BK Patrick Ackermann, David Aebersold, Marietta Gugger, siehe Metallbauer<br />
Apparatebauer/in Anna Hirsig, Patrick Kasteler, Heinz Peter,<br />
4 Lehrjahre Markus Wenger<br />
93 Lernende ABU Markus Binggeli, Fritz Knecht<br />
T+S Martin Christen, Barbara Monti di Sopra, Markus Bögli<br />
Automechaniker/in BK Bernhard Hilber, Bruno Sinzig, Marcel Wyler Erich Beeler, Ringgenberg, AN<br />
2., 3., 4. Lehrjahr ABU Georg Fivian, Anna Hirsig, Stefan von Niederhäusern Rolf Linder, Linden, AG<br />
120 Lernende T+S Jürg Künzler Manfred Pieren, Thierachern, AG<br />
Albin Rüger, Meiringen, AG<br />
Beat Salzmann, Zweisimmen, AN<br />
Fritz Spichiger, Langenthal, AN<br />
Automobil-Assistent BK Werner Karolin<br />
1. Lehrjahr ABU Leandro Manazza<br />
14 Lernende T+S Leandro Manazza<br />
Automobil-Fachmann BK Werner Karolin, Bruno Sinzig<br />
1. Lehrjahr ABU Anna Hirsig<br />
35 Lernende T+S Jürg Künzler<br />
Automobil-<br />
Mechatroniker BK Werner Karolin, Rudolf J. Schmid, Beat Theiler<br />
1. Lehrjahr ABU Georg Fivian, Thomas Köhli<br />
29 Lernende T+S Thomas Köhli, Hans Ruef<br />
Automonteur/in BK Rudolf J. Schmid<br />
2., 3. Lehrjahr ABU Georg Fivian<br />
47 T+S Barbara Monti di Sopra<br />
Fahrzeug-Elektriker/in<br />
-Elektroniker/in<br />
4. Lehrjahr BK Bruno Sinzig<br />
12 Lernende ABU Georg Fivian<br />
Konstrukteur/in BK Markus Birchler, Thomas Fahrni, Marietta Gugger, Felix Kneubühl, Steffisburg, AN<br />
4 Lehrjahre Hans Rudolf Hari, Anna Hirsig, Manfred Röthlisberger, Manfred Röthlisberger, Thun, AN<br />
74 Lernende Peter Schlatter, Jürg Schwander, Markus Wenger, Bruno Schweizer, Thun, AN<br />
Mario Wymann Peter Spielmann, Thun, AN<br />
ABU Rita Leutwyler Mario Wymann, Oppligen, AN<br />
T+S Markus Bögli, Hans Ruef<br />
Landmaschinen- BK Niklaus Röthlisberger, Bendicht Schweizer Toni Michel, Bönigen, AN<br />
mechaniker/in ABU Fritz Knecht, Thomas Köhli, Leandro Manazza Ernst Weber, Rümligen, AG<br />
4 Lehrjahre T+S Markus Bögli, Thomas Köhli, Jürg Künzler, Martin Wyttenbach, Heimberg, AN<br />
172 Lernende Barbara Monti di Sopra, Hans Ruef Richard Wyttenbach, Laupen, AN<br />
Metallbauer/in BK Thomas Wüthrich Kurt Schären, Thun, AG<br />
4 Lehrjahre ABU Georg Fivian, Fritz Knecht, Stefan von Niederhäusern Hans Stoll, Schwarzenburg, AN<br />
93 Lernende T+S Barbara Monti di Sopra Kurt Zahler, Fahrni, AN<br />
Alexander Zwahlen, Brienz, AN<br />
Polymechaniker/in BK Markus Birchler, Thomas Fahrni, Marietta Gugger, Alfred Bachmann, Uebeschi, AN<br />
4 Lehrjahre Hans Rudolf Hari, Anna Hirsig, Barbara Mühlemann, Kurt Messerli, Belp, AN<br />
212 Lernende Peter Schlatter, Jürg Schwander, Hansueli Schürch, Jürg Schmitter, Steffisburg, AN<br />
Gottfried Straub, Katharina Straub, Verena Straub,<br />
Markus Wenger, Marcel Witschi, Stefan Wyler<br />
ABU Markus Binggeli, Anna Hirsig, Thomas Köhli,<br />
Rita Leutwyler, Leandro Manazza,<br />
Stefan von Niederhäusern<br />
T+S Markus Bögli, Thomas Köhli, Jürg Künzler, Hans Ruef<br />
BK = Berufskunde, ABU = Allgemeinbildender Unterricht, T+S = Turnen und Sport, AG = Arbeitgeber, AN = Arbeitnehmer<br />
Abteilung Dienstleistungs -<br />
berufe und PFM (pädagogische<br />
Fördermassnahmen)<br />
Seit meinem Einstieg als Lehrer in die Berufsbildung<br />
hatten immer einige Schulabgängerinnen<br />
und Schulabgänger Wissenslücken. Viele meiner<br />
Kollegen – damals keine einzige Kollegin – klagten<br />
die Lehrpersonen der Volksschule an und beschwerten<br />
sich über das nicht vorhandene Wissen,<br />
auf der gewerblich-industriellen Seite meist<br />
in Mathematik. Das war aber nicht so tragisch, da<br />
der Lehrplan im 1. Lehrjahr dem «Vorbereitenden<br />
Rechnen» noch eine Jahreslektion einräumte.<br />
Die Anforderungen waren auch nicht so hoch,<br />
wie sie es heute sind.<br />
Unterdessen hat sich nicht nur in der Volksschule<br />
vieles geändert, sondern auch in der Berufsbildung.<br />
So treten heute nicht 20 sondern 40% eine<br />
weitergehende Schulausbildung an. Entsprechend<br />
ist die Quote der Lernenden im 1. Lehrjahr von 80<br />
auf unter 60% gesunken. Die Anforderungen sind<br />
zudem durchwegs gestiegen. Das «Vorbereitende<br />
Rechnen» wurde gestrichen.<br />
Die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) haben<br />
reagiert und die Ausbildungsgänge angepasst. In<br />
vielen Berufsfeldern gibt es neu nicht nur eine<br />
« Helfen statt Vorwürfe<br />
machen und sich über mangelndes<br />
Schulwissen beklagen! »<br />
drei- respektive vierjährige Ausbildung. Der Leistung<br />
und dem Tempo der Auszubildenden gemäss<br />
kann mit einer zwei- oder dreijährigen<br />
Grundbildung gestartet werden mit der Option,<br />
nach der kürzeren (in der Regel EBA) eine um ein<br />
Jahr verkürzte längere Ausbildung (EFZ) anzuhängen.<br />
Leider sträuben sich Eltern und viele Ausbildner<br />
diesen Weg einzuschlagen. Als Resultat scheitern<br />
viele Berufslernende. Der Kanton Bern beklagt unterdessen<br />
eine Lehrabbruchquote von über 20%<br />
(Randbemerkung: an der GIB Thun 2–5%!).<br />
Ueli Brügger<br />
Anstatt die Volksschule anzuklagen, haben Verantwortliche<br />
der GIB Thun eine breite Palette<br />
von Hilfsangeboten für die Sekundarstufe I bereitgestellt:<br />
22 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 23 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Tandem<br />
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse können<br />
nach Abschluss des Lehrvertrages einen Tag in<br />
der Klasse des 1. Lehrjahres ihres Lehrberufes<br />
schnuppern.<br />
Rent a stift<br />
Lehrpersonen der Volksschule können im Berufswahlunterricht<br />
ein Team von Berufslernenden<br />
anfordern. Diese berichten von ihren Erfahrungen<br />
beim Übertritt in die Lehre.<br />
Schnuppertage<br />
Lehrpersonen der Sekundarstufe I können anlässlich<br />
von Unterrichtsbesuchen die Anforderungen<br />
in einem Berufsfeld kennen lernen.<br />
Nahtstellen-Kurs<br />
Jedes Jahr organisieren die <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />
(BFS) des Berner Oberlandes einen Anlass, an<br />
dem über Anforderungen und Nöte im Nahtstellenbereich<br />
von Sekundarstufe I und II orientiert<br />
wird und Kontakte gepflegt werden.<br />
Kompetenzenraster<br />
Auf der Homepage der <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />
des Berner Oberlandes (www.gibthun.ch und<br />
www.bzi-interlaken.ch) können Anforderungsprofile<br />
mit entsprechenden Aufgaben-Beispielen<br />
heruntergeladen werden.<br />
Im Bericht von H.H. Winterberger (siehe Seite 35)<br />
sind einige Angebote ausführlich beschrieben.<br />
Sie können auch auf den Websites beider <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />
genauer studiert werden.
Neu diplomierte Berufsfachlehrpersonen: v.l.n.r. Martin Christen, Sibylle Michel,<br />
Boris Seiler, Andrea Gasser und Martin Berger<br />
Wenn ich jetzt über ein «normales Jahr» aus der<br />
Abteilung berichte heisst das, wie in den letzten<br />
<strong>Jahresbericht</strong>en immer wieder erwähnt, eine Zunahme<br />
der Stützkurse und vermehrte Aufwendungen<br />
im Betreuen von Lernenden, welche Probleme<br />
im sozialen Umfeld haben.<br />
Neu bietet die GIB Thun Nachholkurse für Lehrbeginnende<br />
an. Hier können die nötigen Kompetenzen,<br />
welche für den Lehrbeginn im gewählten<br />
Beruf notwendig sind, aufgearbeitet werden.<br />
Die Kurse leiten je eine Lehrperson der Sekundarstufe<br />
I und eine der GIB Thun, welche im entsprechenden<br />
Beruf unterrichtet.<br />
Den Schritt in die neue dreijährige Ausbildung im<br />
Coiffeurgewerbe gemäss neuer BIVO (Bildungsverordnung)<br />
haben viele ältere Ausbildnerinnen<br />
und Ausbildner nicht mehr mitmachen wollen<br />
und bieten keinen Ausbildungsplatz mehr an.<br />
Das führt dazu, dass wir um die Parallelklasse<br />
bangen müssen. Bei den Logistikern (ehemals Logistikassistenten)<br />
steigt die Anzahl der Lehrverhältnisse<br />
immer noch an. Diesen Sommer bemerken<br />
wir erste Anzeichen der Abnahme bei den<br />
Lehrverhältnissen im Bäckereigewerbe und bei<br />
den Hotel-/Gastroberufen. Die demographische<br />
Entwicklung der Schülerzahlen zeigt an, dass jedes<br />
Jahr bis 2015 ein Rückgang zu erwarten ist.<br />
Ueli Brügger, Vorsteher<br />
ulrich.bruegger@gibthun.ch<br />
Lehrberuf/Lehrdauer Kollegium Fachausschuss<br />
Anzahl Lernende<br />
Bäcker/in Konditor/in BK René Fäh, Kurt Oswald Hans-Jörg Jenni, AN<br />
3 Lehrjahre ABU Martin Christen, Roman Gimmel, Michael Jaggi Peter Linder, Gwatt, AG<br />
110 Lernende T+S Martin Christen, Barbara Monti di Sopra, Hans Ruef Markus Mohler, Unterseen<br />
Martin Rupp, Thun<br />
Coiffeuse/Coiffeur BK Andrea Gasser, Eva Schneider, Evelyn Siegenthaler Max Berger, Heimberg, AG<br />
3 Lehrjahre ABU Markus Wenger Irène Moser, Beatenberg, AG<br />
91 Lernende T+S Jürg Künzler, Barbara Monti di Sopra Urs Munzinger, Interlaken, AG<br />
Erika Wyss, Wilderswil, AG<br />
Informatiker/in BK Patrick Ackermann, Susanne Annen, kein Fachausschuss<br />
4 Lehrjahre Gino Colombo, Ursula Kälin, Jürg Schwander,<br />
71 Lernende Andreas Stämpfli, Thomas Stucki, Bruno Zingg<br />
ABU Markus Binggeli, Stefan von Niederhäusern<br />
T+S Markus Binggeli, Martin Christen<br />
Koch/Köchin BK Hansueli Käch, Martin Karolyi, Silvio Ludwig, Fachausschuss Gastgewerbe<br />
3 Lehrjahre Andy Wiedmer Berner Oberland<br />
102 Lernende ABU Jürg Künzler, Sibylle Michel, Hans Ruef<br />
T+S Jürg Künzler, Hans Ruef<br />
Küchenangestellte/r BK Hansueli Käch, Martin Karolyi kein Fachausschuss<br />
2 Lehrjahre ABU Susanna Thierstein, Sabine Wüthrich<br />
22 Lernende T+S Martin Christen<br />
Logistiker/in BK Hans Erni, Martin Gerber, Marco Liniger, Stefan Rüegg, Roger Aregger, Bern, Lager<br />
Logistikassistent/in Beat Schütz, Boris Seiler Hans Gerber, Belp, Lager<br />
3 Lehrjahre ABU Martin Berger, Markus Binggeli, Christian Schläppi, Jean-Claude Reusser, Thun, Lager<br />
207 Lernende Kathrin Schweizer Pius Venetz, Naters, Verkehr<br />
T+S Markus Bögli, Jürg Künzler, Barbara Monti di Sopra, Anita Willimann, Bern, Distribution<br />
Hans Ruef Ernst Zürcher, Schliern, Distribution<br />
Logistikpraktiker/<br />
Logistiker EBA BK Hansueli Steiner<br />
2 Lehrjahre ABU Susanna Thierstein<br />
21 Lernende T+S Jürg Künzler<br />
Anlehre<br />
Fahrzeugwart BK Hansrudolf Willener kein Fachausschuss<br />
2. Lehrjahr ABU Andreas Grassi<br />
7 T+S Hans Ruef<br />
Gartenbearbeiter BK Hanspeter Liebi kein Fachausschuss<br />
2 Lehrjahre ABU Leandro Manazza<br />
21 Lernende T+S Barbara Monti di Sopra<br />
Stützkurse<br />
24 Kurse Patrick Ackermann, Markus Baumgartner, Markus Binggeli, Kurt Blatti, René Fäh, Roman Gimmel,<br />
Andreas Grassi, Hans Rudolf Hari, Christoph Hürlimann, Michael Jaggi, Werner Karolin,<br />
Martin Karolyi, Erich Marti, Sibylle Michel, Heinz Peter, Hans Ruef, Rudolf J. Schmid, Jürg Schwander,<br />
Bendicht Schweizer, Susanna Thierstein, Hansrudolf Willener, Marcel Witschi, Yolanda Zitz<br />
Fit für die berufliche Grundbildung<br />
1 Lehrjahr Roman Gimmel<br />
Ø 12 Lernende<br />
BK = Berufskunde, ABU = Allgemeinbildender Unterricht, T+S = Turnen und Sport, AG = Arbeitgeber, AN = Arbeitnehmer<br />
24 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 25 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Abteilung Berufsmaturität /<br />
Fort- und Weiterbildung<br />
Fort- und Weiterbildung<br />
Seit dem 1. Februar <strong>2007</strong> läuft das Projekt<br />
«Weiterbildung Berner Oberland», geleitet von<br />
Hans-Heini Winterberger von unserer Schule<br />
und Christian Borter vom Bildungszentrum Interlaken.<br />
Folgende Ziele wurden der Projektleitung von<br />
Seiten der Schulen vorgegeben:<br />
Grundsatz<br />
Es geht darum, die Weiterbildung für Berufsleute<br />
und Erwachsene im Berner Oberland unter Einbezug<br />
aller Angebote zu überprüfen, mit dem<br />
Ziel, diese zu stärken und für die Zukunft geeignete<br />
Gefässe zu finden.<br />
Dabei sind<br />
die Weiterbildungssituationen am BZI und an<br />
der GIB Thun in Bezug auf ihre Angebote und<br />
ihre Absichten zu klären.<br />
gemeinsame (gegenwärtige und zukünftige)<br />
Weiterbildungs-Angebote im Berner Oberland<br />
aufzulisten, auszuarbeiten und durchzuführen.<br />
Vor- und Nachteile möglicher Formen der Zusammenarbeit<br />
und Organisation darzustellen<br />
und zu bewerten.<br />
Damit reagieren wir auf die veränderten Wei terbildungsbedürfnisse<br />
von Berufs- und Personengruppen.<br />
Die Anfragen nach Nachholbildungs-<br />
Angeboten für Erwachsene, nach individuell-<br />
massgeschneiderten Kursen nehmen stark zu, die<br />
Nachfrage nach Standardkursen immer mehr ab.<br />
Diese Situation kann aber ein Anbieter alleine<br />
nicht mehr bewältigen, es braucht eine umfassende<br />
Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen.<br />
Nur gemeinsam haben wir die nötigen<br />
fachlichen und personellen Ressourcen, die es<br />
braucht, um diese zum Teil sehr komplexen Anforderungen<br />
zu bewältigen. Dazu kommt, dass<br />
wir für die Region Berner Oberland solche Kursangebote<br />
aufbauen und aufrechterhalten wollen,<br />
so dass die Interessentinnen und Interessenten<br />
nicht noch längere Anreisewege (sei es nach<br />
Bern oder Zürich) in Kauf nehmen müssen.<br />
Das Projekt wird im Juni 2009 abgeschlossen; die<br />
konkreten Ergebnisse und deren Umsetzung<br />
werden dann veröffentlicht werden.<br />
Schulbetrieb BMS<br />
74 der 79 zur Prüfung angetretenen Kandidatinnen<br />
und Kandidaten haben am Ende ihrer<br />
Ausbildung das eidgenössische Berufsmaturitätszeugnis<br />
erhalten. Ich gratuliere allen erfolgreichen<br />
Berufsmaturandinnen und -maturanden<br />
zu ihrem Erfolg herzlich und wünsche ihnen weiterhin<br />
viel Erfolg und Befriedigung in Beruf und<br />
Alltag.<br />
Ich danke all meinen Lehrerinnen und Lehrern für<br />
ihre hervorragende Arbeit an der BMS Thun. Besten<br />
Dank auch dem Sekretariats- und Verwaltungspersonal<br />
für seine Unterstützung und Hilfe,<br />
dem Schulleitungsteam und der Schulbehörde für<br />
die grossartige Zusammenarbeit. Vor allem ganz<br />
herzlichen Dank an all unsere Lernenden für ihre<br />
Bereitschaft, Neues zu lernen, die Ideen der Lehrpersonen<br />
aufzunehmen und umzusetzen.<br />
Urs Gugger, Vorsteher<br />
urs.gugger@gibthun.ch<br />
Dr. Jon Keller, Stadtarchivar, im Element<br />
Mit viel Geschick, Humor und Pointen vermochte<br />
Jon Keller die Maturanden mit seiner Ansprache<br />
«Ja, damals – Schlussfeiern zu Urgross vaters<br />
Zeiten», anlässlich einer schlichten Maturafeier<br />
zu begeistern und für eine Weile in seinen Bann<br />
zu ziehen.<br />
Bruno Maurer, Zimmermann<br />
Benjamin Ernst, Automatiker<br />
André Reusser, Konstrukteur<br />
Thomas Rytz, Polymechaniker<br />
Fabian Pauli, Hochbauzeichner<br />
Manuel Kunz, Metallbaukonstrukteur<br />
Die Preisträger<br />
Für ihre hervorragenden Noten wurden die besten BMS-Absolventen ausgezeichnet.<br />
Lehrpersonen BMS 1 und BMS 2<br />
Kollegium<br />
Markus Gugger<br />
Othmar Fassbind<br />
Peter Fleischli<br />
Jürg Hostettler<br />
Ursula Kälin<br />
Martin Karolyi<br />
Barbara Küenzi<br />
Erich Marti<br />
Barbara Nyffeler<br />
Werner Rohrbach<br />
Schäfer Nicole<br />
Marc Stalder<br />
Andreas Stämpfli<br />
Verena Straub<br />
Ueli von Allmen<br />
26 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 27 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Kollegium<br />
Fächer<br />
Patrick Ackermann Informatik<br />
Martina Baumann Deutsch<br />
Markus Birchler Physik<br />
Daniel Blaser Spanisch<br />
Markus Bögli Sport<br />
Rolf Eichmann Mathematik, Physik<br />
Urs Gugger Physik<br />
Samuel Hasler Mathematik<br />
Michael Jaggi Rechts-/Wirtschaftskunde<br />
Ursula Kälin Englisch, Geschichte/<br />
Staatslehre<br />
Marcel Kunz Freies Gestalten<br />
Barbara Küenzi Geschichte/Staatslehre<br />
Walter Meyer Chemie<br />
Barbara Nyffeler Deutsch, Englisch<br />
Reinhard Peyer Deutsch, Kulturgeschichte<br />
Hans Ruef Sport<br />
Nicole Schäfer Französisch<br />
Marc Stalder Mathematik<br />
Thomas Stucki Informatik<br />
Peter von Allmen Rechts-/Wirtschaftskunde<br />
Martin Zahler Mathematik, Physik<br />
Bruno Zingg Englisch<br />
Lehrpersonen Freifachkurse<br />
Fächer<br />
Schweissen<br />
Zuckerartistik<br />
Blumensteckkurse<br />
Baukonstruktion<br />
Englisch<br />
Kochkurse<br />
Deutsch, Französisch<br />
Englisch<br />
Deutsch, Englisch,<br />
Französisch<br />
Hydraulik<br />
Französisch<br />
Mathematik<br />
Mathematik<br />
Englisch<br />
Baukonstruktion
Berichte der Ressortleiter<br />
Ressort Allgemeinbildung (ABU)<br />
Der neue SLP für den allgemeinbildenden<br />
Unterricht<br />
Ab dem neuen Schuljahr 20<strong>08</strong>/09 wird an der GIB<br />
Thun einlaufend ab dem 1. Lehrjahr nach dem<br />
neuen Lehrplan für die Allgemeinbildung unterrichtet.<br />
Im folgenden Text stellen wir die wichtigsten<br />
Änderungen und Neuerungen in Bezug<br />
auf den alten Schullehrplan (SLP) zusammenfassend<br />
vor. Damit sollen vor allem Aussenstehende<br />
und interessierte Fachlehrkräfte einen Zusammenzug<br />
über die wichtigsten Eckdaten des neuen<br />
SLP erhalten.<br />
Gesetzliche Grundlage und Rahmenlehrplan<br />
Das Bundesamt für Berufsbildung (BBT) verordnet,<br />
gestützt auf Art. 10 der Berufsbildungsverordung<br />
vom 19. November 2003, die allgemeinverbindlichen<br />
Rahmenbedingungen für den<br />
Rahmenlehrplan, Schullehrplan und das entsprechende<br />
Qualifikationsverfahren in der Allgemeinbildung<br />
für die Attest- und die Berufslehre.<br />
Der Rahmenlehrplan ist somit die Grundlage für<br />
den allgemeinbildenden Unterricht aller beruflichen<br />
Grundbildungen, welche die Allgemeinbildung<br />
in ihrer Verordnung (Bildungsverordnung,<br />
BIVO) nicht selber regeln. Innerhalb dieses Rahmens<br />
sind Konkretisierungen für die unterschiedlichen<br />
Bedürfnisse der verschiedenen Bildungsbereiche<br />
möglich.<br />
Eine kantonale Gruppe, bestehend aus PLUR-<br />
Vertretern (PLUR = Projektleitung Umsetzung/<br />
Rahmenlehrplan) verschiedener <strong>Berufsfachschule</strong>n,<br />
konkretisierte die Vorgaben des BBT und bestimmte<br />
unter anderem die neu geltenden Standards<br />
für den allgemeinbildenden Unterricht.<br />
Diese Standards definieren die verbindlichen<br />
Themen, Inhalte und Schlüsselbegriffe des allgemeinbildenen<br />
Unterrichts, das Qualifikationsverfahren,<br />
den Lernbereich Sprache & Kommunikation<br />
und die Schulhaus übergreifende Validierung<br />
der Schullehrpläne. Aufsichtsorgan war dabei<br />
die Steuergruppe, in welcher auch Hansrudolf<br />
Gerber Einsitz hatte. Die Kernbereiche der Arbeit<br />
dieser Gruppe umfassten insbesondere die Umsetzung<br />
des Lernbereiches Sprache & Kommunikation.<br />
Dieser Bereich erfährt denn auch die<br />
grössten Neuerungen im Vergleich zum alten<br />
SLP. Im Weiteren wurde die Förderung der Kompetenzen<br />
im allgemeinbildenen Unterricht neu<br />
definiert.<br />
Der neue Schullehrplan (SLP) 20<strong>08</strong><br />
Der neue SLP wurde im vergangenen Jahr unter<br />
Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen<br />
vom ABU-Team der GIB Thun unter der Leitung<br />
des PLUR-Teams an unserer Schule erarbeitet.<br />
Diese Arbeit verlangte von allen Beteiligten ein<br />
hohes Mass an Einsatz. Viel Bewährtes wird im<br />
neuen SLP beibehalten. So werden beispielsweise<br />
auch künftig, wann immer möglich, die beiden<br />
Lernbereiche Gesellschaft und Sprache & Kommunikation<br />
thematisch verknüpft. Auch das gesamte<br />
Layoutkonzept wurde weitgehend beibehalten,<br />
damit sich alle möglichst rasch im neuen<br />
SLP zurechtfinden.<br />
Was ist neu?<br />
Die Themengebiete für die drei- und vierjährige<br />
Grundbildung wurden neu definiert und diesen<br />
Themen S&K-Lernreihen zugeordnet. Für die<br />
zweijährige Grundbildung wurden die Themen<br />
1, 2, 3, 4, 9 und 10 für verbindlich erklärt.<br />
Aufwertung der Sprache & Kommunikation<br />
In diesem Teilbereich sind die grössten Neuerungen<br />
umgesetzt worden. Die Bildungs- und Lernziele<br />
im Lernbereich Sprache und Kommunikation<br />
beschreiben, welche Sprach- & Kommunikationskompetenzen<br />
im Unterricht eingeführt, gefördert<br />
und weiterentwickelt werden. Im Mittelpunkt<br />
stehen dabei kommunikative Sprachkompetenzen,<br />
wie sie im persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen<br />
Kontext der Lernenden erforderlich<br />
sind. Gezielte Schwerpunkte hinsichtlich der<br />
verschiedenen Berufe und Grundbildungen sind<br />
dabei möglich. Neu werden auf der Basis des gemeinsamen<br />
europäischen Referenzrahmens für<br />
Sprachen (GER) die Sprach- und Kommunikationskompetenzen<br />
der Lernenden geschult.<br />
Jedem Gesellschaftsthema wurden im Bereich<br />
Sprache und Kommunikation curricular aufgebaute<br />
S&K-Lernreihen zugeordnet. Im ABU wird<br />
somit zukünftig in jedem Thema mit einem klar<br />
definierten Förderfokus im Bereich Sprache und<br />
Kommunikation unterrichtet werden. Die ent-<br />
sprechenden Lernreihen führen in drei Schritten<br />
über den mündlichen und schriftlichen elementaren<br />
Sprachgebrauch zur selbständigen Sprachverwendung<br />
hin und weiter zu einer kompetenten,<br />
meisterlichen Sprachverwendung. Hierzu<br />
wurde von Frau Ruth Schori Bondeli (Eidg. Hochschule<br />
für Berufsbildung, EHB) basierend auf<br />
dem GER ein ausführliches Hilfsinstrument entwickelt.<br />
Die Sprache wird somit konkret zum<br />
Thema im Unterricht und entsprechende Normen<br />
und Strategien werden gelernt und gefördert. Es<br />
ist dabei aber nicht das Ziel in einem Fachunterricht<br />
Deutsch zu landen. Vielmehr soll wie bisher<br />
wann immer möglich vernetzt zum Gesellschaftsthema<br />
unterrichtet werden. Strategische und<br />
normative Deutschkompetenzen werden aber<br />
fokussierter bearbeitet. Um die doch recht hohen<br />
Anforderungen und Ziele im Sprachbereich<br />
des neuen SLP erreichen zu können, wurde der<br />
zeitliche Sprachanteil auf 50% der Unterrichtszeit<br />
angehoben (RLP).<br />
Die Themengebiete und die zugeordneten<br />
Lernreihen (Standards)<br />
1. Berufliche Grundbildung<br />
Interaktion/Gespräch/Korrespondenz<br />
2. Geld und Kauf<br />
Produktion/Sprechen/Schreiben<br />
3. Risiko & Sicherheit<br />
Rezeption/Hören/Lesen<br />
4. Demokratie & Mitgestaltung<br />
Interaktion<br />
5. Kunst & Kultur<br />
frei<br />
6. Schweiz in Europa und der Welt<br />
Produktion<br />
7. Markt & Konsum<br />
Rezeption<br />
8. Globale Herausforderungen<br />
Interaktion<br />
9. Wohnen & Zusammenleben<br />
Produktion<br />
10. Arbeit & Zukunft<br />
Rezeption<br />
Der neue SLP der GIB Thun gibt eine sinnvolle<br />
Reihenfolge der Themen für die drei- und vierjährige<br />
Grundbildung vor. Der Lehrkraft steht es<br />
aber weiterhin frei, die Themen in einer individuellen<br />
Reihenfolge anzugehen. Dies kann sinnvolle<br />
Synergien mit dem Fachunterricht ermöglichen.<br />
Die Verknüpfung von Themengebiet und<br />
Lernreihe ist standardisiert.<br />
Aspekte<br />
Der Lernbereich Gesellschaft wird im Vergleich<br />
zum Rahmenlehrplan 1996 von bislang neun auf<br />
acht verbindliche Aspekte reduziert. Auf den Aspekt<br />
«Arbeit» wird zukünftig verzichtet. Dafür<br />
kommen neu sogenannte weitere Blickwinkel<br />
wie Gender, Nachhaltigkeit und Geschichte dazu.<br />
Methodenkompetenzen<br />
Den PLUR-Verantwortlichen der GIB Thun ist es<br />
ein grosses Anliegen, dass neben den Sprachkompetenzen<br />
auch die Methodenkompetenzen<br />
gezielt gefördert werden. Die Methodenkompetenzen<br />
sind deshalb im SLP explizit aufgeführt.<br />
Die Methodenkompetenzen beinhalten unter anderem<br />
Kompetenzen wie Informationsbeschaffung,<br />
Internetnutzung, Zeitmanagement, Arbeits-<br />
und Lerntechnik etc. In diesem Bereich wird es<br />
sehr wichtig sein, dass sich ABU- und Fachlehrkräfte<br />
absprechen, um Synergien zu nutzen und<br />
Parallelläufe zu verhindern.<br />
Ausblick und Fazit<br />
Die PLUR-Verantwortlichen verstehen den nun<br />
vorliegenden SLP als ein nicht in Stein gemeisseltes<br />
Werk. In den kommenden Jahren wollen wir<br />
den SLP handlungsorientiert im ABU-Team einführen<br />
und rasch auf Verbesserungsvorschläge<br />
reagieren. In einem Schulhaus übergreifenden<br />
Evaluationsverfahren wird der vorliegende SLP<br />
auch extern kritisch überprüft werden.<br />
Wir hoffen, dass die kommende Einführungsphase<br />
für alle Beteiligten ein Erfolg wird und wünschen<br />
allen Lehrkräften mit diesem Instrument<br />
viel Erfolg für ihren allgemeinbildenen Unterricht.<br />
28 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 29 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Stefan von Niederhäusern und Hans Huggler,<br />
Leitung Ressort ABU/PLUR<br />
stefan.vonniederhäusern@gibthun.ch<br />
hans.huggler@gibthun.ch
Ressort Mediothek<br />
Am 1. August 2006 wurde ich mit der Betreuung<br />
der Mediothek an der GIB Thun beauftragt. Das<br />
entsprechende Pflichtenheft umfasst die folgenden<br />
Punkte:<br />
Betreut und aktualisiert die Sammlung<br />
der wichtigsten auf dem Markt erhältlichen<br />
Lehrmittel<br />
Beschafft und betreut wichtige Nachschlagewerke<br />
in Buch- oder elektronischer Form<br />
Betreut Videos und nimmt wichtige Sendungen<br />
auf und organisiert deren Verfügbarkeit<br />
unter Einhaltung der Urheberrechte<br />
Betreut und schafft in Zusammenarbeit mit<br />
dem Biblio-Team Klassensätze an<br />
Gewährleistet die Zusammenarbeit mit<br />
dem Biblio-Team<br />
Eine hohe Verfügbarkeit der Mediothek soll<br />
angestrebt werden, damit die Ausleihe<br />
über EDV oder in Papierform gewährleistet ist<br />
Kommuniziert dem Kollegium in geeigneter<br />
Form den Bestand, Neuanschaffungen oder<br />
die Liquidation von Medien<br />
Schwerpunkt Mediaserver<br />
Der Einsatz von Filmmaterial ist heute aus einem<br />
modernen Unterricht kaum mehr wegzudenken.<br />
Die audiovisuellen Medien bieten, nebst vielen<br />
Chancen für den Unterricht, auch gewisse Risiken.<br />
So sollten sie beispielsweise nicht zum reinen<br />
Selbstzweck und nur selten zur reinen Unterhaltung<br />
eingesetzt werden. Mir ist wichtig, dass<br />
die Lernenden durch den schulischen Einsatz dieser<br />
Medien nebst den Inhalten auch die Methodenkompetenz<br />
erwerben, wie man Informationen<br />
aus Filmbeiträgen herausarbeiten kann.<br />
Gerade bei der Umsetzung des neuen Schullehrplanes<br />
für die Allgemeinbildung, insbesondere<br />
bei den Neuerungen im Bereich Sprache & Kommunikation,<br />
sehe ich grosse Chancen für den Einsatz<br />
von aktuellem Filmmaterial. So kann beispielsweise<br />
ein Teil der Rezeption mündlich sehr<br />
gut mit audiovisuellen Medien bestritten werden.<br />
In den letzten beiden Jahren baute ich in Zusammenarbeit<br />
mit der Arbeitsgruppe Informatik im<br />
Bereich audiovisueller Medien das Medialaufwerk<br />
auf. Dieses ermöglicht allen Lehrkräften an<br />
unserer Schule den raschen Zugriff auf aktuelle<br />
TV-Beiträge über das Intranet. Mittlerweile stehen<br />
weit über hundert Stunden Filmmaterial zur<br />
Verfügung. Viele der Beiträge sind didaktisch<br />
aufbereitete Ausschnitte aus Sendungen wie 10<br />
vor 10, Tagesschau, Rundschau, DOK und Spuren<br />
der Zeit. Es stehen aber auch zahlreiche Spielfilme<br />
zu den unterschiedlichsten Themen zur Verfügung.<br />
Diese Beiträge ermöglichen es ABU- und<br />
Fachlehrkräften zu den verschiedensten Themen<br />
und Aspekten aktuelle Beiträge als «Expertenmeinung»<br />
in den Unterricht einzubauen. Gerade<br />
in Bereichen wie Umwelt, Gesellschaft und Politik<br />
ist der Filmbeitrag ein hervorragendes Instrument,<br />
Inhalte in neutraler Form den Lernenden<br />
zu vermitteln, ohne dass die Lehrkraft als Übermittler<br />
der Botschaft im Zentrum steht.<br />
Technisch wird der Mediaserver fortlaufend verbessert.<br />
Zur Zeit ist es noch nicht immer möglich,<br />
die Beiträge störungsfrei direkt ab Server auf den<br />
Beamer zu spielen. Um solchen Schwierigkeiten<br />
auszuweichen, muss vorgängig der entsprechende<br />
Beitrag heruntergeladen und lokal gespeichert<br />
werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass in<br />
naher Zukunft das direkte Abspielen der Filmsequenzen<br />
zum Standard wird.<br />
Projekte für das kommende Schuljahr<br />
In Zusammenarbeit mit Lernenden der Informatik<br />
werden wir in Form eines Projekts die Oberflächengestaltung<br />
des Mediaservers benutzerfreundlicher<br />
gestalten. Ziel ist es, dass zukünftig<br />
Suchfunktionen und Verlinkungen mit Unterlagen<br />
und Arbeitsmaterialien dem Kollegium zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der Betreuung<br />
und Aufbereitung der zur Verfügung stehenden<br />
Klassensätze. Ich möchte in diesem Bereich<br />
Transparenz schaffen, wo an unserer Schule<br />
überall Klassensätze eingelagert sind, die allen<br />
Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden<br />
könnten. Hierbei werde ich auf die Zusammenarbeit<br />
des Kollegiums angewiesen sein. Im Weiteren<br />
gilt es, die in der Bibliothek vorhandenen<br />
Klassensätze zu modernisieren. Anschaffungen<br />
von genügend Duden und neuen Staatslexika<br />
sind geplant.<br />
Fazit<br />
Ich bin überzeugt, mit meiner Arbeit den Bedürfnissen<br />
meiner Kolleginnen und Kollegen an der<br />
GIB Thun grundsätzlich zu entsprechen. Viele positive<br />
Rückmeldungen bestätigen mich in dieser<br />
Annahme und motivieren mich, den eingeschlagenen<br />
Weg weiterzugehen.<br />
Besonders gefreut hat mich die Tatsache, dass<br />
nebst vielen ABU-Lehrpersonen vermehrt auch<br />
die Fachlehrpersonen den Mediaserver nutzen<br />
und mir entsprechende Aufträge erteilen.<br />
Stefan von Niederhäusern, Leitung Ressort Mediothek<br />
stefan.vonniederhäusern@gibthun.ch<br />
Ressort Beratung – the next step<br />
Im vergangenen Jahr nahmen nebst den Lernenden<br />
der GIB Thun vermehrt betroffene Lehrmeister<br />
und Eltern unser Angebot in Anspruch. Die<br />
häufigsten Themen waren<br />
Motivationsfragen<br />
Belastbarkeit<br />
Selbständigkeit<br />
Eigeninitiative<br />
Schulische Leistungen / Lernverhalten<br />
Disziplinarische Schwierigkeiten<br />
Gesundheitliche Probleme<br />
Selbstbild / Fremdwahrnehmung<br />
Erinnern wir uns, welche Entwicklungsaufgaben<br />
im Jugendalter – also während der Lehrzeit – für<br />
unsere Lernenden zu meistern sind. Nachfolgend<br />
ein ganz kurzer Überblick:<br />
Aufbau einer persönlichen Orientierung, d.h.<br />
ein Selbstbild entwickeln und Identitätsarbeit<br />
leisten.<br />
Umbau der sozialen Beziehungen, verändern<br />
der Eltern-Kind-Beziehung, Zurechtfinden in<br />
der Welt der Gruppen und Cliquen.<br />
Integration in die Arbeitswelt mit ihren Vorgaben,<br />
Anforderungen und verbindlichen Erwartungen.<br />
Integration in die Gesellschaft, eine eigene<br />
moralische, politische und religiöse Meinung<br />
vertreten, urteilsfähig werden.<br />
Die Vielfalt der Problemstellungen überfordert<br />
unsere Ratsuchenden. Diese Verunsicherung<br />
führt zu Problemen in den genannten Themenkreisen.<br />
In diesem komplexen Spannungsfeld arbeiten<br />
wir vom «Next step Team» hauptsächlich mit der<br />
Sichtweise der systemischen Beratung, welche<br />
folgende wesentliche Betrachtungsweisen beinhaltet:<br />
Fokus auf Beziehungen / Wechselwirkungen /<br />
Kommunikationsmuster<br />
ressourceorientiert<br />
lösungsorientiert<br />
Systeme sind nicht nach dem einfachen «Ursache<br />
– Wirkungsprinzip» zu betrachten. Vielmehr bestimmen<br />
die wechselseitigen Beziehungen der<br />
Teilprozesse die Abläufe.<br />
Probleme lösen können wir mit unserem «Next<br />
step Angebot» nicht, aber es gelingt uns immer<br />
wieder, zusammen mit den Betroffenen einen<br />
Weg zu finden, der Zuversicht, Erleichterung, Ermutigung<br />
und dauerhaften Erfolg beinhaltet.<br />
Ressort Informatik<br />
30 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 31 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Susanna Thierstein und Leandro Manazza,<br />
Ressort Beratung<br />
susanna.thierstein@gibthun.ch<br />
leandro.manazza@gibthun.ch<br />
Nach einer Reorganisation der AGI (Arbeitsgruppe<br />
Informatik) im Frühjahr 07 ist unter der neuen<br />
Leitung von Thomas Fahrni die Gruppe, die sich<br />
neu RI (Ressort Informatik) nennt, in das neue<br />
Schuljahr 07/<strong>08</strong> gestartet. Nach einer vorgängig<br />
erfolgten Bedarfsanalyse haben die Mitglieder<br />
die Verantwortlichkeitsbereiche neu zugeteilt<br />
und dank zusätzlichen Entlastungslektionen<br />
wurden die offenen Pendenzen abgetragen und<br />
die neu aufgetretenen Probleme konnten rasch<br />
angegangen werden. Bald einmal hat sich gezeigt,<br />
dass die neu wöchentlich stattfindende<br />
Ressortsitzung die erhoffte Wirkung für eine<br />
schnellere Erledigung der Aufgaben dank regelmässigem<br />
Informationsaustausch nicht verfehlt.<br />
Schnell in die Gruppe integrieren konnte sich zudem<br />
der Lernende Dominik Gyger, der nach erfolgtem<br />
Basislehrjahr seine drei weiteren Jahre<br />
an unserer Schule absolvieren wird. Praktika Aufenthalte<br />
bei externen Kunden sollen die Ausbildung<br />
zusätzlich anreichern und vervollständigen.<br />
Mit Weitsicht wird bereits seine IPA geplant, wo<br />
er voraussichtlich eine Applikation für das Projekt<br />
Q2E entwickeln und von Susanne Annen<br />
(QS-Mitglied) betreut werden wird.<br />
Erfolgreich gestaltete sich auch die Zusammenarbeit<br />
mit der Firma Netaccess, die neu an einem
Tag in der Woche im Hause ist, sich dabei um die<br />
etwas kniffligeren Aufgaben kümmert und uns<br />
zudem mit viel Geduld weiterbildet. In den Bereichen<br />
Netzwerk, Server und Backup stellen sie das<br />
wichtige Rückgrat dar und beraten den Ressortleiter<br />
in strategischen Fragen bezüglich neuer<br />
Ausrichtungen.<br />
Spleissen (mit Lichtbogen zusammenschweissen) von<br />
Glasfasern mit einem Durchmesser von 125 μm.<br />
Zusammen mit der Erziehungsdirektion und<br />
dem Amt für Grundstücke und Gebäude hat sich<br />
nach einer Standortbegehung ergeben, dass die<br />
GIB Thun wegen der zentralen Lage und der Nähe<br />
zu möglichen LWL (Lichtwellenleiter) Providern<br />
(z. B. SBB Bahnhof Thun, andere Schulen<br />
etc.) prädestiniert ist für einen zentralen<br />
Netzwerk standort. Da der bestehende Serverraum<br />
vollständig belegt und die klimatischen<br />
Verhältnisse ungenügend waren, wurde die Verlegung<br />
an einen neuen Standort geprüft und<br />
Ende Jahr bewilligt. Die Umbauarbeiten, die mit<br />
gleichzeitigen Erneuerungen einiger Netzwerkkomponenten<br />
stattfanden, waren in den Sommerferien<br />
<strong>08</strong> abgeschlossen.<br />
Dank Investitionen konnten auch in diesem Jahr<br />
die Informatikzimmer mit PCs und Beamerprojektoren<br />
der neuesten Generation ausgerüstet<br />
werden.<br />
Thomas Fahrni, Ressort Informatik<br />
thomas.fahrni@gibthun.ch<br />
Ressort Kommunikation/Information<br />
Nach meiner Rückkehr aus dem sechsmonatigen<br />
Sabbatical im April dieses Jahres übernahm ich<br />
wieder das Ressort Kommunikation und Information<br />
von meinem Stellvertreter, Erich Marti. Befriedigt<br />
konnte ich feststellen, dass alles reibungslos<br />
verlaufen war.<br />
Die Planung für das Schuljahr 20<strong>08</strong>/09 konnte<br />
alsbald in Angriff genommen werden. Die Schulleitung<br />
und ich merkten schnell, dass im kommenden<br />
Jubiläumsjahr zusätzliche Arbeiten auf<br />
uns warten. Es wurde entschieden, dass Erich<br />
Marti und ich die anfallenden Aufgaben, die unser<br />
Ressort betreffen, aufteilen und zusammen<br />
bewältigen werden. Offiziell seit dem 1.8.20<strong>08</strong><br />
erledigen wir die vielfältigen Arbeiten im Team.<br />
Eine sehr gute, in weiten Teilen sehr befruchtende<br />
und sich ergänzende Lösung.<br />
An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich<br />
für die hervorragende Zusammenarbeit mit<br />
dem Büroteam der GIB Thun, der Schulleitung<br />
und Verwaltung, dem Kollegium, der Presse –<br />
insbesondere dem Thuner Tagblatt – der Werbe-<br />
Linie für die Gestaltung und Realisation der GIB<br />
Infos und des <strong>Jahresbericht</strong>es sowie der Firma<br />
Frei Offset für das Drucken unserer Erzeugnisse<br />
bedanken. Die vielgepriesene Zusammenarbeit<br />
ist eine imminent wichtige Voraussetzung für erfolgreiche<br />
Resultate, in der heutigen Zeit aber<br />
nicht immer selbstverständlich. Diese Voraussetzungen<br />
sind aber an den oben erwähnten Stellen<br />
zum Glück nach wie vor erfüllt!<br />
Markus Wenger, Ressort Kommunikation und Information<br />
markus.wenger@gibthun.ch<br />
Ressort LEFO (Lehrer/innen Fortbildung)<br />
Auf Anregung des Kollegiums und der Schulleitung<br />
konnten wir wiederum eine Auswahl von<br />
Kursen anbieten.<br />
Die Anzahl der digitalen Bilder nimmt auch im<br />
Bereich der Bildung stark zu. Mit Theorie und<br />
praktischen Arbeiten vermittelte der Kurs «Photoshop<br />
Elements» die Grundlagen zur Organisation<br />
und Verwaltung der Bilder und der digitalen<br />
Bildbearbeitung.<br />
Im Kurs «Sicher Fahren» übten wir unter Anleitung<br />
der Instruktoren im Verkehrssicherheitszentrum<br />
Stockental verschiedene Lenk- und Bremsmanöver.<br />
Ziel war die realistische Einschätzung<br />
der eigenen Grenzen und die Verbesserung des<br />
Fahrstils. Dieser Kurs wurde zusammen mit dem<br />
BZI durchgeführt.<br />
Sibylle Michel und Markus Binggeli am Office <strong>2007</strong> Kurs.<br />
Den Ergänzungskurs «Sicher Fahren im Schnee»<br />
mussten wir leider bereits zum zweiten Mal infolge<br />
Schneemangels absagen.<br />
Weiter konnten folgende Kurse durchgeführt<br />
werden:<br />
Auffrischung der Gerätekenntnisse im Medienraum:<br />
Die Teilnehmenden erhielten eine Übersicht<br />
und einen Einblick in die Handhabung der<br />
vorhandenen Geräte.<br />
Nothelfer-/Reanimationskurs: Mitarbeitende<br />
aus den Verwaltungen der GIB Thun und der<br />
WS Thun liessen sich in der Handhabung von<br />
Defibrillator-Geräten ausbilden.<br />
Office <strong>2007</strong>: An drei Kursabenden lernte das<br />
Kollegium die wichtigsten Neuerungen von<br />
Word und Excel <strong>2007</strong> kennen.<br />
Das LEFO-Team besuchte kantonale und schweizerische<br />
Schilf- (schulinterne Lehrerfortbildung)<br />
Tagungen und konnte sich über Angebote und<br />
Aktivitäten an anderen Schulen der Sekundarstufe<br />
II informieren.<br />
Markus Birchler, Hans-Heini Winterberger<br />
Ressort Lehrer/innen Fortbildung<br />
markus.birchler@gibthun.ch<br />
hansheini.winterberger@gibthun.ch<br />
Ressort Turnen und Sport<br />
Die letzte Turnstunde<br />
Beim Handschlag mit einem Lernenden bedankte<br />
sich dieser und sagte: «Merci, äs het öppis bracht.»<br />
Da überlegt man sich natürlich, wovon er jetzt<br />
spricht. Von der Biketour? Vom Schwimmen? Vom<br />
Klettern? Vom Spielen in der Halle oder von den<br />
Erklärungen zum Badmintonspiel? Sind es die<br />
Kommentare zum Krafttraining oder ist es das unbekannte<br />
Curling?<br />
Am ehesten ist es eine Botschaft aus dem Bauchgefühl<br />
und zeigt, dass wir mit unseren Zielsetzungen<br />
aus dem Lehrplan nahe an der Realität<br />
stehen und den Berufslernenden sportlich aber<br />
auch persönlich etwas bieten können.<br />
Wo stehen Berufslernende beim Eintritt?<br />
Sind sie fit?<br />
Bringen sie etwas im Sportrucksack mit?<br />
Sind sie in einem regelmässigen Training?<br />
oder<br />
Sind sie Teil einer trägen Masse?<br />
Haben sie kaum Fähigkeiten und Fertigkeiten?<br />
Ist der Berufsschulsport der einzige Grund, die<br />
Turnschuhe aus dem Schrank zu nehmen?<br />
Grob gesehen gibt es fast nur die Aktiven und die<br />
Inaktiven. Die Turnstunde wird aber vom allergrössten<br />
Teil als positiv und sinnvoll erlebt. Ob<br />
daraus Nachhaltigkeit entsteht, liegt schliesslich<br />
in der Verantwortung der lernenden Person.<br />
3 für 2, eine Realität<br />
Der knappe Turnraum greift immer mehr in die<br />
Planung des Unterrichts ein. So müssen oder dürfen<br />
zwei Klassen abwechslungweise stets Outdooraktivitäten<br />
durchführen. Im Winter hat sich<br />
die Kletterhalle Thun als ideale Alternative zur<br />
Turnhalle gezeigt. Wenige Schüler sind aber auch<br />
hier nicht begeisterungsfähig oder stossen sofort<br />
an die Grenzen ihrer motorischen Fähigkeiten.<br />
Leistungsmässige Limiten beobachten wir auch<br />
im Kraft- und Ausdauerbereich sowie beim<br />
Schwimmen oder etwa dem Willen, der Selbstdisziplin…<br />
einfach überall dort, wo man mit etwas<br />
Biss die nächste Stufe erreicht oder eben daneben<br />
steht.<br />
Unsere Lehrpersonen<br />
Hans und Jürg sind bereits fünfzig und von der<br />
Fitness der jungen Leute nicht gross zu irritieren.<br />
Barbara geht auch in ihrer Schwangerschaft mit<br />
oder noch vorab. Markus ist mit seinem breiten<br />
Sportverständnis topaktuell. Martin, der junge<br />
Sportlehrer bringt neben seinem Zug im Unter-<br />
32 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 33 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Jürg Künzler, Sportlehrer<br />
richt noch Tätigkeiten und Beziehungen in die<br />
Sportwelt der GIB Thun, die längerfristige Bedeutung<br />
haben werden. So ist er im BVSS (Bernischer<br />
Verband für Sport in der Schule) neu Leitfigur<br />
im Berufsfachschulsport und damit auch<br />
Kontaktperson zum Schweizerischen Verband.<br />
Ein politisch sportlicher Schritt<br />
Jeder gute Sportunterricht ist letztlich auch<br />
politisches Handeln. Wir hoffen, dass die Überweisung<br />
der Motion Zryd dazu führt, dass irgendwann<br />
der gesetzlich vorgeschriebene Sportunterricht<br />
ganz stattfindet. Mittel und Infrastruktur<br />
müssen zur Verfügung gestellt werden. Der Regierungsrat<br />
muss handeln. Das ist sein Auftrag.<br />
Jürg Künzler, Ressort Sport<br />
juerg.kuenzler@gibthun.ch<br />
Ressort Schul- und Qualitätsentwicklung<br />
Auf dem Weg zur Q2E-Zertifizierung<br />
Wie im letzten <strong>Jahresbericht</strong> erwähnt, hat die GIB<br />
Thun das Qualitätsmanagementmodell Q2E (Qualität<br />
durch Evaluation und Entwicklung) als ganzheitliches<br />
Orientierungsmodell gewählt, welches<br />
auf den folgenden sechs Komponenten aufbaut:<br />
Qualitätsleitbild der Schule<br />
Individualfeedback und persönliche Qualitätsentwicklung<br />
Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung<br />
der Schule<br />
Steuerung der Qualitäts-Prozesse durch die<br />
Schulleitung<br />
Externe Schulevaluation<br />
Q2E-Zertifizierung<br />
Damit eine Zertifizierung möglich wird, müssen<br />
wir unsere bisherige Qualitätsarbeit nicht komplett<br />
neu ausrichten, eine hohe, ja höchste Qualität<br />
wurde an der GIB Thun schon immer von<br />
allen Lehrpersonen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
gelebt, als Selbstverständlichkeit und<br />
nicht um des Qualitäts-Zertifikates Willens.<br />
Einige Anpassungen und vor allem eine Systematisierung<br />
ist aber in folgenden Bereichen nötig:<br />
Individualfeedback<br />
Selbstevaluation<br />
Steuerung der Qualitäts-Prozesse durch die<br />
Schulleitung<br />
Individualfeedback<br />
Anlässlich von Schulentwicklungstagen (<strong>2007</strong>)<br />
wurden die bisher erfolgreich durchgeführten,<br />
aber noch informell und persönlich gestalteten<br />
Rückmeldungen der Lernenden an die Lehrpersonen<br />
systematisiert. Verbindliche Rahmenvorgaben<br />
wurden erarbeitet und Richtlinien erlassen,<br />
welche ab Frühjahr 20<strong>08</strong> gültig sind.<br />
Neben einer Weisung zur Durchführung von<br />
Feedbacks wurden ein Konzept zum Umgang mit<br />
Qualitätsdefiziten und ein Leitfaden zur Konfliktlösung<br />
erarbeitet.<br />
Selbstevaluationen<br />
Seit der Einführung der Leistungsvereinbarung<br />
(1998) wurden an der GIB Thun systematische<br />
Selbstevaluationen durchgeführt.<br />
Sie umfassten vor allem<br />
den Ausbildungserfolg der Lernenden auf Sek<br />
Stufe II und der Tertiärstufe.<br />
die Zufriedenheit der Lernenden / Kursteilnehmerinnen<br />
und Kursteilnehmer mit der Ausbildungsqualität.<br />
Rückmeldungen in Bezug auf ein förderliches<br />
Lernklima.<br />
die Erwartung der Arbeitswelt und der Ausbildungsbetriebe<br />
an die Zusammenarbeit mit<br />
der GIB Thun.<br />
Zur zeitlich optimalen Steuerung der Selbst- und<br />
der Fremdevaluation wurden nun für die kommenden<br />
Jahre Qualitäts-Zyklen geschaffen, in welchen<br />
Art und Häufigkeit,<br />
Verantwortlichkeit und Durchführung,<br />
Massnahmenplanung und Umsetzung,<br />
externe Unterstützung und Ressourcen<br />
beschrieben und geregelt sind.<br />
Steuerung der Qualitäts-Prozesse durch die<br />
Schulleitung<br />
Die Schulleitung hat folgende Unterlagen, welche<br />
die Qualitäts-Prozesse steuern, erarbeitet<br />
und verabschiedet:<br />
Qualitätsgrundsätze als Kern der<br />
Strategieplanung<br />
Konzept Qualitätsmanagement<br />
Konzept Umgang mit Qualitäts-Defiziten inkl.<br />
Leitfaden zur Konfliktlösung<br />
Weisung zur Durchführung von Feedbacks<br />
Qualitäts-Zyklus für Lehrpersonen<br />
Qualitäts-Zyklus Schulevaluation<br />
All diese Dokumente werden dem Kollegium zur<br />
Konsultation vorgelegt. Sollten die Lehrpersonen<br />
mit Teilen dieser Konzepte nicht einverstanden<br />
sein, werden die Schulleitung und die Kollegiumskonferenz<br />
in gemeinsamen Gesprächen diese<br />
Differenzen bereinigen. Dieses Verfahren garantiert,<br />
dass die Grundlagenpapiere zum Qualitätsmanagement<br />
von allen betroffenen Personen verstanden<br />
und akzeptiert werden. Diese Akzeptanz<br />
ist die Grundvoraussetzung, dass ein Qualitäts-<br />
System nicht ein Papiertiger, sondern Grundlage<br />
für eine weiterhin erfolgreiche und qualitativ<br />
hoch stehende Alltagsarbeit sein wird.<br />
Dank und Ausblick<br />
Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich<br />
allen Lehrpersonen<br />
dem Verwaltungspersonal<br />
der Schulleitung<br />
für die konstruktive und engagierte Mitarbeit bei<br />
den Qualitätsentwicklungsarbeiten der GIB Thun.<br />
Ganz speziell bedanken möchte ich mich beim<br />
Q-Team:<br />
Susanne Annen<br />
Heinz Peter<br />
Christian Schläppi<br />
Hans-Heini Winterberger<br />
Sie haben im letzten Jahr grossartige und hochprofessionelle<br />
Arbeit geleistet. Dank ihrem Einsatz<br />
konnten die Weiterentwicklungsarbeiten<br />
rund um das Qualitätsmanagement der GIB Thun<br />
termingerecht abgeschlossen werden.<br />
Wir alle sind gespannt, wie unsere Arbeit durch<br />
die Evaluatoren der Interkantonalen Fachstelle<br />
für externe Schulevaluation (IFES) beurteilt wird.<br />
Diese Beurteilung, welche anlässlich einer externen<br />
Evaluation Ende Oktober 20<strong>08</strong> erfolgt, wird<br />
Grundlage für die Zertifizierung nach Q2E im<br />
nächsten Jahr sein.<br />
Urs Gugger, Verantwortlicher Q-Management<br />
urs.gugger@gibthun.ch<br />
Ressort Schulentwicklung<br />
Schulentwicklungstage an der GIB Thun<br />
Jedes Jahr im Juni verlassen uns die Lernenden<br />
nach erfolgreichem Abschluss der Qualifikationsverfahren,<br />
um als junge Arbeitnehmende in die<br />
Berufswelt – den Arbeitsmarkt – einzutreten.<br />
Jedes Jahr im August betreten Lernende für den<br />
ersten Schultag die GIB Thun, treten ein in die<br />
berufliche Grundbildung mit dem Ziel, ein eidgenössiches<br />
Fähigkeitszeugnis oder ein eidgenössisches<br />
Attest zu erwerben.<br />
Die GIB Thun arbeitet seit Jahren für diesen Übertritt<br />
und stellt verschiedene Angebote zuhanden<br />
der Jugendlichen, gesetzlichen Vertretern und<br />
den Lehrpersonen der Sek I zur Verfügung.<br />
Berufswahl/Übertritt Sek I – Sek II<br />
(Details siehe Homepage)<br />
Die GIB Thun unterstützt die Lehrpersonen der<br />
Sek-Stufe I, indem sie<br />
1. die Schulabgängerinnen und Schulabgänger<br />
dort abholt, wo sie gemäss Lehrplan des 9.<br />
Schuljahres sein müssen,<br />
2. den Lehrpersonen der Sek Stufe I Einblick in<br />
die Ausbildung der verschiedenen Berufe,<br />
welche an der GIB Thun ausgebildet werden,<br />
ermöglicht,<br />
3. den Schülerinnen und Schülern nach abgeschlossener<br />
Berufswahl (Lehrvertrag unterzeichnet)<br />
die Möglichkeit bietet, den Unterricht<br />
des entsprechenden Berufes zu besuchen<br />
und sich dadurch für die verbleibende obligatorische<br />
Schulzeit neu zu orientieren und<br />
4. Kompetenzenraster (Mathematik) für die<br />
Orientierung im individuellen Unterricht des<br />
9. Schuljahres anbietet.<br />
Mathematik – von der Volksschule in die<br />
berufliche Grundbildung<br />
Mit dem Eintritt in die <strong>Berufsfachschule</strong> beginnt<br />
für die Lernenden mit der Mathematik-Standortbestimmung<br />
der erste Schritt des Früherfassungskonzeptes.<br />
34 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 35 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>
Konzept: Standortbestimmung Mathematik<br />
Vor den Herbstferien <strong>2007</strong>/20<strong>08</strong> starten die 1. Lehrjahre<br />
mit der Standortbestimmung Mathematk.<br />
Die Resultate werden drei Gruppen zugeordnet:<br />
1. Kompetenzen vorhanden<br />
keine Stütz- und Fördermassnahmen<br />
notwendig<br />
2. Kompetenzen teilweise vorhanden<br />
(November–März/Juni)<br />
können während dem 1. Lehrjahr in Nachholbildungskursen<br />
nachgearbeitet werden,<br />
so dass ab dem 2. Lehrjahr keine weiteren<br />
Stütz- und Fördermassnahmen notwendig<br />
sind<br />
3. Kompetenzen wenig gesichert<br />
(ab Herbstferien)<br />
sofortiger Besuch von Stütz- und Förderkurs<br />
Erste Zahlen und Erfahrungen zeigen auf, dass<br />
bei den Standortbestimmungen durchschnittlich<br />
ca. 75% zur ersten Gruppe, 15–20% zur zweiten<br />
Gruppe und 5–10% zur dritten Gruppe gehören.<br />
Bei einzelnen Berufsgruppen beträgt die Anzahl<br />
der Gruppe 1 lediglich 50%.<br />
Lernende der Gruppe 2 besuchen einen befristeten<br />
Kurs. Dort treffen sie auf je eine Lehrperson<br />
mit Math.bu-Erfahrungen aus der Oberstufe der<br />
Sek I und eine Lehrperson aus der beruflichen<br />
Grundbildung. Gezielt können in diesem Kurs die<br />
aktuellen Aufgaben aus dem berufskundlichen<br />
Mathematik-Unterricht bearbeitet und die individuellen<br />
Kompetenzlücken aufgearbeitet werden,<br />
welche sich in der Standortbestimmung offenbarten.<br />
Ausbildung der Lehrpersonen aus der Sek I für<br />
den Auftrag an der <strong>Berufsfachschule</strong><br />
In einem ersten Kurs wurden Lehrpersonen aus<br />
der Sek I auf die Arbeit in der <strong>Berufsfachschule</strong><br />
vorbereitet. Dieser Kurs wurde in Zusammenarbeit<br />
mit dem bzi-Interlaken konzipiert.<br />
Ziele/Inhalte<br />
Die Grundlagen-Konzeption der beruflichen<br />
Grundbildung erläutern<br />
Die Grundlagen von Bund und Kanton Bern<br />
für die Pädagogischen Fördermassnahmen<br />
(PFM) beschreiben<br />
Die Rahmenbedingungen für die Stütz-<br />
und Förderkonzepte der GIB Thun und des<br />
BZI-Interlaken beschreiben<br />
Die Anstellungsbedingungen für das Tandemprojekt<br />
erläutern<br />
Hans-Heini Winterberger, Kompetenzenraster<br />
Mathematik<br />
Die Instrumente/Formulare im Stütz- und Förderunterricht<br />
erklären<br />
Stütz- und Förderkurs während einem Praxisbesuch<br />
erleben<br />
Die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen<br />
aus diesen Kursen sind erfreulich, einerseits profitieren<br />
die Jugendlichen vom Erfahrungshintergrund<br />
der Lehrpersonen beider Schulsysteme,<br />
zugleich profitieren die Lehrpersonen durch die<br />
konkrete Zusammenarbeit und erhalten einen<br />
Einblick in die Arbeitswelt des anderen.<br />
Die GIB Thun wird bei Bedarf diesen Kurs im<br />
Frühjahr 2009 wieder ausschreiben.<br />
Erste Rückmeldungen<br />
Im Mai 20<strong>08</strong> orientierte ein engagiertes Team<br />
über seine NDS-Math-Diplomarbeit. Dabei wurde<br />
aus der Optik der Sek I ein Anforderungsprofil in<br />
Bezug auf die Kompetenzen eines Beruf entwickelt.<br />
Auskünfte dazu sind erhältlich bei ulrich.<br />
bruegger@gibthun.ch.<br />
Im Juni 20<strong>08</strong> erhielt die GIB Thun zuhanden aller<br />
Lehrpersonen ein Schreiben von der Schulleitung<br />
OS Progymatte, Thun, Ulrich Christen und Kurt<br />
Leiser, schulleitung@progy-thun.ch<br />
«…wir gestatten uns, Sie über ein Papier zu informieren,<br />
das wir allen austretenden 9. Klässlerinnen<br />
und 9. Klässlern als Beilage «Mathkompetenzen<br />
Ende der 9. Klasse» mitgeben…»<br />
So macht Schulentwicklung Freude.<br />
SE-Team Urs Gugger, Markus Birchler,<br />
Hans-Heini Winterberger<br />
Verwaltung<br />
Die Schulverwaltung ist Schnitt- und Nahtstelle<br />
In diesem Jahr wird neben den üblichen Berichterstattungen<br />
das Thema «Die Schnittstelle am<br />
Übergang Sekundarstufe I / Sekundarstufe II wird<br />
zur Nahtstelle» näher beleuchtet. Die Hauptbeteiligten<br />
sind vor allem die Lehrpersonen der<br />
Oberstufen-Klassen der Volksschule wie auch die<br />
Lehrpersonen der <strong>Berufsfachschule</strong>n und die<br />
Ausbildungsverantwortlichen. Wir «Bürofachleute»<br />
kommen deshalb nicht umhin, uns zu diesem<br />
Thema etwas genereller zu äussern.<br />
Beleuchten wir die administrativen Tätigkeiten<br />
in der Verwaltung etwas genauer, finden wir bei<br />
der Verwalterin, beim Leiter Rechnungswesen<br />
und im Schulsekretariat Prozesse, die vom Ablauf<br />
her an mehreren «Orten» bearbeitet werden =<br />
Schnittstellen:<br />
Jahr für Jahr werden an der GIB Thun während<br />
der Schulferien Bauprojekte und / oder Sanierungsarbeiten<br />
realisiert bzw. durchgeführt.<br />
Wenn die Bauvorhaben geplant, bearbeitet<br />
und ausgeführt werden, bringt die Verwalterin<br />
die Vorgaben, Interessen und Wünsche der<br />
<strong>Berufsfachschule</strong> gegenüber dem Amt für<br />
Grundstück und Gebäude (AGG), den beteiligten<br />
Architekten und Ingenieuren ein.<br />
Bei den Lehrpersonen nimmt der Leiter Rechnungswesen<br />
die Gehaltseinstufung nach der<br />
Lehreranstellungsgesetzgebung in Absprache<br />
mit dem Vorsteher und dem Amt für zentrale<br />
Dienste des Kantons Bern vor. Diese Daten<br />
werden einerseits in der Anstellungsverfügung<br />
festgehalten und anderseits im PERSISKA Gehaltssystem<br />
gepflegt.<br />
Die Daten der neueintretenden Lernenden<br />
werden vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt<br />
an die entsprechenden Schulsekretariate<br />
elektronisch übermittelt. Die Sachbearbeiterinnen<br />
nehmen mit der Schuladministrationssoftware<br />
Evento aufgrund der Vorgaben durch<br />
die Vorsteher die weitere Verarbeitung vor.<br />
Dies sind lediglich drei Beispiele um aufzuzeigen,<br />
wie die Fäden in der Verwaltung zusammenlaufen<br />
und weshalb unsere täglichen Arbeiten so<br />
vielseitig, abwechslungsreich und verantwortungsvoll<br />
sind.<br />
Als administrative Nahtstelle (Ort der Verbindung)<br />
dürfen dann vielleicht die Ergebnisse bezeichnet<br />
werden, wenn Mitte August<br />
alle Lernenden und Lehrpersonen in einem in<br />
Stand gehaltenen Schulhaus mit funktionaler<br />
Infrastruktur ein- und ausgehen können.<br />
jede Lehrperson angestellt und versichert ist<br />
und über eine schriftliche Anstellungsverfügung,<br />
welche die Verbindlichkeiten beider<br />
Seiten (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) regelt,<br />
verfügt sowie ihr dementsprechendes Gehalt<br />
erhält.<br />
rund 700 Lernende ihre Ausbildung an der GIB<br />
Thun beginnen und wissen, wann und wo der<br />
Berufsfachschulunterricht beginnt und den<br />
Lehrpersonen bekannt ist, welche Klassen mit<br />
wie vielen Auszubildenden in welchen Zimmern<br />
zu unterrichten sind.<br />
36 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 37 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Silvia Fink, Leiterin Schulsekretariat<br />
silvia.fink@gibthun.ch<br />
Philipp Langhart, Leiter Rechnungswesen<br />
philipp.langhart@gibthun.ch<br />
Béatrice Klossner Leutwyler, Verwalterin<br />
beatrice.klossner@gibthun.ch
Bericht Lehrervertreter<br />
Soll der Übergang von der Sekundarstufe I zur<br />
Sekundarstufe II eher als Schnitt- oder als Nahtstelle<br />
bezeichnet werden?<br />
Technisch gesehen bezeichnen die Begriffe<br />
Schnittstelle und Nahtstelle (englisch: interface)<br />
den Teil bzw. den Grenzbereich, der zwei Systeme<br />
miteinander verknüpft.<br />
Umgangssprachlich wird Schnittstelle als Ort der<br />
Trennung verstanden. Die Nahtstelle ist ein Ort<br />
der Verbindung, eine Berührungsstelle. Zwei Teile<br />
werden verbunden und ergänzen sich zu einem<br />
neuen Ganzen. Es handelt sich darum bestenfalls<br />
um die halbe Wahrheit, wenn der<br />
Übertritt von der Volksschule in die <strong>Berufsfachschule</strong><br />
ausschliesslich als Schnittstelle bezeichnet<br />
wird. Die <strong>Berufsfachschule</strong> ist kein völlig neues<br />
System und baut ihre Angebote auf den Vorleistungen<br />
der Volksschule auf.<br />
Der Übergang zwischen den Sekundarstufen I<br />
und II wird dadurch unwillkürlich sowohl zur<br />
Schnitt- als auch zur Nahtstelle.<br />
Aus der Perspektive der Jugendlichen gesehen,<br />
ist der Übertritt von der Volksschule ins Berufsleben<br />
zweifellos ein anstrengender Einschnitt in<br />
ihr Leben. Die Arbeitstage werden länger. Die Arbeit<br />
ist noch ungewohnt und wird deshalb oft als<br />
streng empfunden. Die Müdigkeit ist grösser als<br />
gewohnt. Freizeit wird zum raren Gut. Für Kontakte<br />
mit Gleichaltrigen verbleibt weniger Zeit<br />
und Hobbys müssen möglicherweise sogar aufgegeben<br />
werden. Zum ersten Mal sind die Jugendlichen<br />
zudem Teil in einer Hierarchie und<br />
spüren, dass sie zuunterst stehen, d.h. sich unterordnen<br />
müssen. Gleichzeitig tragen sie ungleich<br />
mehr Verantwortung im Ausbildungsbetrieb, als<br />
sie es von der obligatorischen Schulzeit her<br />
gewohnt waren. Die Anpassung an die neuen<br />
Ansprüche ist eine Herausforderung. Die ver-<br />
Spenden<br />
Barspenden<br />
Spar + Leihkasse Steffisburg CHF 2’500.–<br />
Amtsersparniskasse Thun CHF 1’500.–<br />
schiedenen neu zu bewältigenden Situationen<br />
be deuten für die Berufslernenden, dass die ihnen<br />
bisher vertrauten Strukturen aufgeweicht<br />
werden. Sie müssen sich an neue Strukturen anpassen<br />
bzw. ihre bestehenden erweitern. Dieser<br />
Veränderungsprozess führt zu zwischenzeit lichen<br />
Orientierungsschwierigkeiten und löst dementsprechende<br />
Verunsicherung aus.<br />
Die Aufgabe der BerufsfachschullehrerInnen in<br />
dieser bewegten Zeit besteht u.a. darin, am<br />
Übergang von der Vollzeitschule in die Teilzeitschule<br />
mit geschärfter Wahrnehmung präzis zu<br />
beobachten und «den Suchenden» Orientierung<br />
zu geben.<br />
Das sichtbare Verhalten der Neueintretenden in<br />
unterschiedlichen (Lern)Situationen lässt Rückschlüsse<br />
auf ihre Kompetenzen zu. Kompetenzen<br />
sind Fähigkeiten (Wissen und Können) und die<br />
Bereitschaft, diese einzusetzen.<br />
Es gilt, die vorhandene Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz<br />
der Lernenden zu Beginn der<br />
Lehre rasch zu erfassen und während der Ausbildung<br />
zu stärken beziehungsweise weiter zu fördern.<br />
Bei erheblichen Kompetenzdefiziten muss<br />
frühzeitig der Besuch von zusätzlichen Förderangeboten<br />
oder eine Lehrumwandlung angeregt<br />
werden. Das erfordert, nebst grossem Einsatz,<br />
viel Sorgfalt und pädagogisches Fingerspitzengefühl.<br />
Wenn es den BerufsfachschullehrerInnen gelingt,<br />
die Kompetenzen der Lernenden nachhaltig zu<br />
fördern, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur<br />
Integration der Jugend in die Erwachsenenwelt.<br />
Das ist durchaus eine schöne, aber auch eine sehr<br />
anspruchsvolle Aufgabe.<br />
Denn, Hand auf’s Herz, haben Sie als Teenager<br />
den Erwachsenen alles geglaubt und war Integration<br />
in die Erwachsenenwelt damals Ihr oberstes<br />
Ziel?<br />
Christian Schläppi, Lehrervertreter<br />
christian.schlaeppi@gibthun.ch<br />
Naturalspenden<br />
RINGSPANN AG, Zug Maschinenelemente als Anschauungsmaterial<br />
für den Unterricht (Wert CHF 3’000.–)<br />
Lachsräucherei Dyhrberg AG, Klus-Balsthal Reichhaltiges Räucherfischsortiment als<br />
Degustations-Material (Wert CHF 300.–)<br />
Jahresrechnung <strong>2007</strong><br />
Aufwand<br />
Personalaufwand CHF CHF<br />
Besoldung Verwaltung 814’006.50<br />
Besoldung Lehrpersonen 10’570’473.20<br />
Sozial-, Personal-, Unfallversicherungsprämien 2’278’348.95<br />
Übriger Personalaufwand 40’715.95<br />
Sachaufwand<br />
Büro-, Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur 211’331.18<br />
Anschaffungen Lehrmittel, Mobiliar, Maschinen 207’220.01<br />
Wasser, Energie, Heizmaterialien 182’932.50<br />
Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40’912.20<br />
Dienstleistungen Dritter, Unterhalt 88’103.59<br />
Mieten und Benutzungskosten 205’177.12<br />
Spesenentschädigungen und Exkursionen 24’559.30<br />
Entschädigungen Dienstleistungen Dritter 254’015.90<br />
Übriger Sachaufwand 39’839.05<br />
Abschreibungen Sachgüter 110’140.22<br />
38 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 39 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Ertrag<br />
Dauermieten, Benutzungsgebühren und Dienstleistungen 66’564.80<br />
Schul- und Kursgelder 226’870.50<br />
Verkauf Lehrmittel 47’833.30<br />
Rückerstattungen Dritter (Besoldungen) 242’825.54<br />
Übrige Entgelte 5’714.70<br />
Rückerstattungen von Kantonen 1’101’195.00<br />
Bundesbeitrag 1’512’000.00<br />
Aufwandüberschuss (Restfinanzierung Kt. Bern) 11’864’771.83<br />
Total 15’067’775.67 15’067’775.67<br />
Investitionsrechnung<br />
Anschaffungen Maschinen, Geräte usw. 46’607.80<br />
Anschaffungen Informatikmittel 197’038.35<br />
Total 243’646.15<br />
Schulfonds<br />
Metzger 797.88<br />
Spenden 39’640.94<br />
Neumöblierung 21’445.55<br />
2%-Fonds 141’372.48<br />
Materialgeld 76’143.86<br />
Legat Kieswerk Heimberg 17’203.21<br />
Total 296’603.92
Danke<br />
Schnitt- und Nahtstellen gibt es nicht nur gegen<br />
aussen sondern auch im Innern einer Institution.<br />
Ob in der Zusammenarbeit der verschiedenen<br />
Organe der GIBT, beim minutiösen Überarbeiten<br />
des neuen Schullehrplanes in der Allgemeinbildung<br />
oder beim aufwändigen Erstellen der Mathematikkompetenzenraster<br />
durch die involvierten<br />
Lehrpersonen, überall hängt der Erfolg von<br />
vielen Faktoren ab:<br />
Gegenseitige Achtung, ein erspriessliches Klima<br />
und ein Denken und Handeln im Gesamtrahmen<br />
sind Voraussetzung zum Erreichen hoher<br />
Ziele.<br />
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung<br />
aller Funktionsträger müssen klar definiert und<br />
aufeinander abgestimmt sein.<br />
Ich danke allen Lehrpersonen, dem Verwaltungs-<br />
und dem Schulleitungsteam für die erspriessliche<br />
und zukunftsweisende Zusammenarbeit.<br />
Impressum<br />
Texte Schulleitung, Kollegium,<br />
Verwaltung<br />
Redaktion Silvia Fink, Markus Wenger,<br />
Bruno Zingg<br />
Fotos Erich Marti, Markus Wenger<br />
Gestaltung, Realisation WerbeLINIE AG, Gwatt-Thun<br />
Druck Frei Offset, Thun<br />
Auflage 1’700 Expl.<br />
Dem Hauswarts-, Mensa- und Bibliotheksteam<br />
danke ich für die fachkundige und unermüdliche<br />
Arbeit welche für uns alle tagein tagaus geleistet<br />
wird.<br />
Mein Dank für die Begleitung und Unterstützung<br />
geht auch an die zuständigen Stellen des<br />
Mittelschul- und Berufsbildungsamtes und der<br />
Erziehungsdirektion.<br />
40 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />
Hansrudolf Gerber, Direktor<br />
hansrudolf.gerber@gibthun.ch
<strong>Gewerblich</strong> <strong>Industrielle</strong><br />
<strong>Berufsfachschule</strong> Thun<br />
Mönchstrasse 30 B<br />
3600 Thun<br />
Telefon 033 227 33 44<br />
Fax 033 227 33 66<br />
www.gibthun.ch<br />
mailbox@gibthun.ch<br />
Eine Institution des Kantons Bern