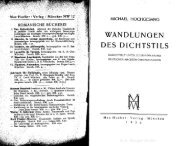Die soziale Herkunft - Leben und Werk des Dichters Gottfried August ...
Die soziale Herkunft - Leben und Werk des Dichters Gottfried August ...
Die soziale Herkunft - Leben und Werk des Dichters Gottfried August ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der Nachprüfung standhalten. Wenn z.B. Wolfgang Friedrich ohne Nachweis<br />
falsch angibt: „Bürger wird in Molmerswende als [...] Enkel zweier Bauernfamili<br />
en geboren“, hat es die Literaturwissenschaft eben nicht mit einer Quelle zu tun.<br />
Dessen ungeachtet übernehmen Autoren ungeprüft diese Angabe <strong>und</strong> vermerken<br />
in ihrer Fußnote ‚s. Friedrich‘.<br />
Ähnlich verhält es sich mit Anmerkungen, denen keine tatsächlichen Sachver<br />
halte aus Bürgers <strong>Leben</strong> zu entnehmen sind. Abgesehen davon, daß häufig diesel<br />
ben Zitate fortgeschrieben werden, muß, ohne die genannten Autoren diskreditie<br />
ren zu wollen, die Frage gestattet sein, wie Äußerungen von Heinrich Heine,<br />
Friedrich Engels <strong>und</strong> Franz Mehring in biographischen Darstellungen zu Bürger<br />
die Quellen ersetzen können.<br />
Wie falsch solche Aussagen in ihrer Gr<strong>und</strong>tendenz sein können, verdeutlicht<br />
Heines viel zitiertes Urteil über Bürger in seiner Romantischen Schule. Dabei geht<br />
es nicht allein um Heines falsche <strong>und</strong> <strong>und</strong>ifferenzierte Feststellung, daß den Dich<br />
ter „eine Aristokratie von hannövrischen Junkern <strong>und</strong> Schulpedanten zu Tode<br />
quälte[n]“, sondern um das Verhältnis zwischen Bürger <strong>und</strong> <strong>August</strong> Wilhelm<br />
Schlegel. Nein, Bürger muß nicht vor „den reaktionären Zügen der Schlegelschen<br />
Kritik“ in Schutz genommen werden, denn gerade <strong>des</strong>sen Fre<strong>und</strong>schaft war es, die<br />
dem Dichter in seinen letzten <strong>Leben</strong>sjahren über Mißachtung <strong>und</strong> Diffamierung<br />
<strong>des</strong> Göttinger Universitätskollegiums hinweghalf. Schlegels Parteinahme für Bür<br />
ger im Streit mit Friedrich Schiller, ihre gemeinsame Übersetzertätigkeit von<br />
Shakespeares Sommernachtstraum, Schlegels Rezensionen zu Bürgers Gedichten,<br />
ihr liebevoller Briefwechsel, die einander gewidmeten Gedichte An <strong>August</strong> Wil<br />
helm Schlegel <strong>und</strong> An Bürger sind ebenso wie der Aufsatz Bürger aus dem Jahre<br />
1800 ein beredtes Zeugnis für seine fre<strong>und</strong>schaftliche Verb<strong>und</strong>enheit mit dem<br />
Dichter. <strong>Die</strong>s ist etliche Male ausführlich dargestellt worden. Um so mehr ver<br />
w<strong>und</strong>ert es, daß Heines Urteil widerspruchslos weitergetragen wird. Heines Ver<br />
öffentlichung, die 41 Jahre nach Bürgers Tod erschien (1835), wird von „vehe<br />
menten, ja bösartigen Angriffen“ auf die romantische Bewegung getragen <strong>und</strong><br />
scheut auch nicht „persönliche Diffamierungen“. Sie ist für die BürgerForschung<br />
keine Quelle <strong>und</strong> kann „am Kriterium objektiver, wissenschaftlicher Distanz nicht<br />
gemessen werden“.<br />
Zum Thema Anmerkungen <strong>und</strong> Quellen sei auch auf die unzulässige Begren<br />
zung, die ausschließliche Verwendung von schnell zugänglicher Literatur verwie<br />
sen. Wie wichtig das Heranziehen von abseits publizierten Forschungsergebnissen<br />
ist, kann beispielhaft an der <strong>Werk</strong>ausgabe von Günter <strong>und</strong> Hiltrud Häntzschel ge<br />
zeigt werden. <strong>Die</strong> Zurkenntnisnahme sorgfältig recherchierter Aufsätze von Max<br />
Berbig, Erich Ebstein <strong>und</strong> Stefan Hock hätte die Herausgeber davor bewahren<br />
können, Bürgers Lied der Georgia <strong>August</strong>a an Se. Königliche Hoheit den Herzog<br />
von Glocester aus ihrer Ausgabe zu verbannen, weil es — ihren Angaben zufolge<br />
— nicht von Bürger stamme.<br />
Als 1992 nach 25 Jahren im Kröner Verlag Gero von Wilperts <strong>und</strong> Adolf Güh<br />
rings Erstausgaben deutscher Dichtung in 2. Auflage erschien, konnte man ge<br />
spannt sein, welche neuen Erkenntnisse das ‚vollständig überarbeitete‘ <strong>Werk</strong> brin<br />
gen würde, zumal der Verlag diesmal „nahezu sämtliche Bibliographien an Fach<br />
leute <strong>und</strong> Spezialisten für die einzelnen Dichter zur Überprüfung <strong>und</strong> Bearbeitung<br />
vergeben“ hatte. Doch die Erwartungen wurden, zumin<strong>des</strong>t was den Dichter Bür<br />
ger betrifft, enttäuscht.<br />
So muß festgestellt werden: Bereits Bürgers Pseudonym ist unkorrekt wieder<br />
gegeben. Auch findet sich nach einem Vierteljahrh<strong>und</strong>ert noch die gleiche Anzahl<br />
von Titelaufnahmen, wo doch eine Erweiterung längst fällig gewesen wäre. Der<br />
einzige Zusatz gegenüber der ersten Auflage, Daniel Chodowiecki als Illustrator<br />
der MünchhausenAusgabe zu bezeichnen, ist falsch. <strong>Die</strong> Wiedergabe nahezu al<br />
2


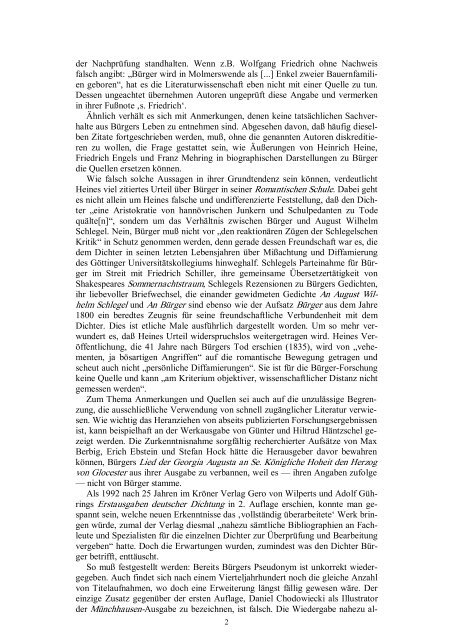

![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)