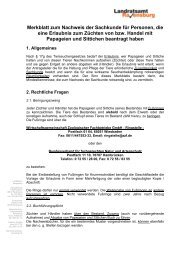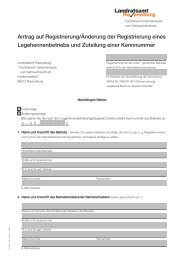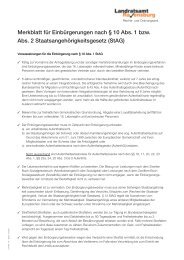Hitler meets Rötenbach - im Landkreis Ravensburg
Hitler meets Rötenbach - im Landkreis Ravensburg
Hitler meets Rötenbach - im Landkreis Ravensburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deckengemälde in der Pfarrkirche von <strong>Rötenbach</strong>, Gemeinde Wolfegg.<br />
Im Oberland 2008, Heft 2<br />
46
<strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />
Von Michael Barczyk<br />
In der Pfarrkirche St. Jakobus<br />
von <strong>Rötenbach</strong> (Gemeinde Wolf -<br />
egg) sind auf einem Deckengemälde,<br />
das der Wangener<br />
Maler August Braun 1944 –<br />
noch während des letzten Krieges<br />
also – gemalt hat, offensichtlich<br />
Adolf <strong>Hitler</strong> und<br />
Winston Churchill dargestellt.<br />
Im folgenden Artikel werden<br />
Entdeckung und Hintergründe<br />
geschildert.<br />
Eine Entdeckung<br />
Halt in <strong>Rötenbach</strong> bei Wolfegg. Auf einer Velotour durch Oberschwaben<br />
besuchten wir die dortige Pfarrkirche St. Jakobus. Da<br />
ruft meine Frau: ,,Da oben ist der <strong>Hitler</strong> abgebildet!“ Ich: ,,Das<br />
kann gar nicht sein!“ Auf dem Deckengemälde des Schiffs konnte<br />
ich aber <strong>im</strong>merhin Churchill ausmachen (Abb. 1).<br />
Neugierig geworden blätterte ich die greifbare Literatur durch:<br />
Nichts, gar nichts stand in den „Klassikern“ von P. Gebhard Spahr<br />
(„Oberschwäbische Barockstraße“) und Alfons Kasper („Kunstwanderungen“)<br />
darüber, auch nicht <strong>im</strong> „Schahl“ („Kunstbrevier“) oder<br />
begreiflicherweise in den „Kunstdenkmälern“.<br />
Der Kirchenführer „200 Jahre St. Jakobus <strong>Rötenbach</strong>“ (1985)<br />
sprach lediglich von „modernen Atheisten, Interessenlosen und<br />
Genußmenschen“, die Festschrift „Altarweihe am 19. März 2000“<br />
erhärtete aber den Verdacht meiner Frau. Unter der Abbildung<br />
„Deckenfresko von August Braun 1943“ steht: „Ausschnitt mit<br />
<strong>Hitler</strong> und Churchill als Feinde des Kreuzes“. Auch der „Kleine<br />
Führer durch die Pfarrkirche St. Jakobus <strong>Rötenbach</strong>“ (2000) führt<br />
<strong>Hitler</strong> als „Lästerer“ an: „Unverkennbar, mit Brille etwas verfremdet,<br />
Adolf <strong>Hitler</strong> mit Winston Churchill.“ Also war die Vermutung<br />
ein Volltreffer, der später durch Pfarrer Otto Schmid und<br />
Altbürgermeister Manfred Konnes bestätigt worden ist.<br />
Um es zu betonen: In den Artikeln <strong>im</strong> Rheinischen Merkur (26.<br />
Juli 2007), der Süd westpresse Ulm (27. Juni 2007) und in der Ausstrahlung<br />
<strong>im</strong> Fernsehen (S 3, 27. Juni 2007) haben wir also nicht<br />
als Erste <strong>Hitler</strong> identifiziert, sondern sein Konterfei an dieser Stelle<br />
als „Zeichen des passiven Widerstands“ definiert. Diese<br />
Interpre tation hat<br />
in den Flyern<br />
„Zwischen H<strong>im</strong>mel<br />
und Hölle“<br />
und „<strong>Hitler</strong> in<br />
<strong>Rötenbach</strong>“ ihren<br />
Niederschlag gefunden.<br />
1<br />
Abb. 2 Georg Rösch, Boschers, Privatbesitz.<br />
Freunde und<br />
Feinde der Kirche<br />
– die Ikonografie<br />
Jedes noch so<br />
schöne Deckengemälde<br />
in unserenoberschwäbischen<br />
Barockkir-<br />
Im Oberland 2008, Heft 2<br />
47
chen muss eine „message“, also eine Botschaft<br />
an die Gläubigen vermitteln können.<br />
Dies n<strong>im</strong>mt <strong>im</strong> Deckenfresko der Pfarrkirche<br />
<strong>Rötenbach</strong> besonders klare Konturen an.<br />
Man ist schon einigermaßen erstaunt, wenn<br />
man die Kirche ahnungslos betritt und mit<br />
diesem Deckengemälde konfrontiert wird.<br />
Die Ikonografie, das Bildprogramm, leitet<br />
sich vom Bibelspruch des ersten Korintherbriefs<br />
her (1 Kor 1, 18): „Denn das Wort vom<br />
Kreuz ist zwar denen, die verloren gehen,<br />
eine Torheit; uns aber, die wir gerettet werden,<br />
ist es eine Kraft Gottes.”<br />
Entstehung des Deckengemäldes<br />
Die Umsetzung dieser Worte ins Bild verdanken<br />
wir laut Signatur 1944 dem Wangener<br />
Maler August Braun. Dabei handelt es sich<br />
um eine Stiftung des Ehepaars Friedrich und<br />
Anna Rösch aus Boschers, die das Bild in Erinnerung<br />
an ihren am 26. Dezember 1942 in<br />
Russland gefallenen einzigen Sohn Georg<br />
(Abb. 2) in Auftrag gegeben hatten. 4000<br />
Reichsmark hat Braun als Honorar erhalten.<br />
Das war damals viel Geld, wenn man bedenkt,<br />
dass der Stunden lohn eines Industriearbeiters<br />
bei 0,81 Reichsmark lag.<br />
Braun hat <strong>im</strong> Sommer 1944 einen Monat lang<br />
in <strong>Rötenbach</strong> gemalt; gewohnt hat er solange<br />
<strong>im</strong> Pfarrhaus bei Pfarrer Hagenmayer. Die<br />
Pfarrchronik begnügt sich in der Deutung mit<br />
Im Oberland 2008, Heft 2<br />
48<br />
allgemeinen Ausdrücken, auf dem Bild seien<br />
„Genussmenschen, Interessenlose, moderne<br />
Atheisten und ein Ball“ abgebildet. Genauer<br />
bezeichnet werden nur Kaiphas, Judas und<br />
die Pharisäer. Kein Wunder, man schreibt das<br />
Jahr 1944. Aber auch nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg taucht nirgendwo eine detaillierte<br />
Bezeichnung auf. Die sibyllinischen Angaben<br />
wirken aber fort, zum Beispiel auf einem<br />
Kommunionbildchen von 1969 und in dem<br />
erwähnten Kirchenführer von 1985.<br />
Das Konzept der Ikonografie<br />
Das biblische Motto ist also der Schlüssel zur<br />
Interpretation des Bildes: Den Gerechten, beginnend<br />
links mit dem hl. Georg, stehen<br />
rechts die Feinde des Kreuzes gegenüber, die<br />
letztendlich auch für den sinnlosen „Helden -<br />
tod“ des Georg Rösch verantwortlich waren.<br />
Das Deckenfresko ist durch den streng vertikal<br />
gemalten „Gnadenstuhl“ (Gottvater, der<br />
Heilige Geist und Jesus Christus) in zwei Hälften<br />
geteilt (Abb. 3). Vom Hochaltar aus gesehen,<br />
befinden sich die Geretteten rechts, also<br />
auf der „guten Seite“, links die Verdammten.<br />
In der christlichen Kunst ist diese Einteilung<br />
üblich: rechts das Gute, links das Böse. Man<br />
denke hierbei nur an die vielen Bilder des<br />
Jüngsten Gerichts aus dem Mittelalter.<br />
Diese Wertung wird auch in der Struktur<br />
deutlich: Die Gruppen der von uns aus links<br />
Abb. 3 Vom Hochaltar aus befinden sich die Geretteten rechts, also auf der „guten Seite“, links die Verdammten.
stehenden „Freunde“ ragen in einem Halbkreis<br />
konvex in die Bildmitte hinein, die<br />
Gruppen der „Feinde“ aber konkav heraus.<br />
Dies schafft eine Dynamik des Bildes, zumal<br />
die einzelnen konträren Gruppen, einmal<br />
in M<strong>im</strong>ik und Gestik Richtung Kreuz orientiert,<br />
das andere Mal aber abweisend dar -<br />
gestellt sind.<br />
Die Freunde des Kreuzes<br />
Links oben befinden sich die Bauernheilige<br />
Notburga, ein Bischof (oft als der Rottenburger<br />
Bekennerbischof Johann Baptist Sproll<br />
identifiziert, der von den Nazis nach Krumbach<br />
in Bayern ins Exil geschickt worden<br />
war) und der hl. Georg, der Drachentöter, hier<br />
als der Namenspatron und mit viel Fantasie<br />
das Konterfei des Georg Rösch aus Boschers<br />
zeigend. Als Bindeglied zur nächsten Heiligengruppe<br />
steht eine Kleinfamilie, die uns<br />
den Rücken zuwendet. Wie schön wäre es gewesen,<br />
hierin die Stifterfamilie zu erkennen,<br />
wie bei August Braun sonst üblich. Haben<br />
sich Friedrich und Anna Rösch aus Bescheidenheit<br />
dagegen gewehrt? Den zeitgenössischen<br />
Bezug findet man zum Beispiel sehr<br />
ausgeprägt in Eriskirch 2 oder auf Schloss Zeil.<br />
Darunter sieht man von links nach rechts<br />
die selige Gute Beth von Reute (Bad Waldsee),<br />
eine der letzten Mystikerinnen des Mittelalters.<br />
Rechts daneben eine „Barmherzige<br />
Schwester vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal“,<br />
so die offizielle Bezeichnung<br />
der Vinzentinerinnen, die in Oberschwaben<br />
segensreich gewirkt haben und wirken. Die<br />
Zuschreibung den Kirchenführern als „Ludovica<br />
de Marillac“ ist nicht haltbar, da diese<br />
Heilige ikonographisch ausschließlich <strong>im</strong><br />
schwarzen Habit mit Witwenschleier dargestellt<br />
wird. 3 Der hl. Franziskus folgt mit der<br />
hl. Theresia vom Kinde Jesu, einer Lieblingsheiligen<br />
des 19. und beginnenden 20. Jhs.<br />
Darunter St. Jakobus, der Kirchenpatron, der<br />
seinen Blick als einziger auf das Kirchenvolk<br />
richtet, dann der Apostel Paulus, Papst Sylvester,<br />
der Nebenpatron der Kirche, darunter<br />
der Evangelist Johannes – ausnahmsweise<br />
nicht <strong>im</strong> grünen Gewand – und der Apostel<br />
Petrus mit seinen Schlüsseln als Stellvertreter<br />
Christi und erster Papst. Alle Heiligen<br />
haben irgendeinen regionalen Bezug. Der hl.<br />
Michael Barczyk – <strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />
Im Oberland 2008, Heft 2<br />
49<br />
Abb. 4 Die Seite der „Feinde des Kreuzes“.<br />
Paulus trägt das Antlitz des Malers. Er hat<br />
voller Wut entschlossen seine Hände um den<br />
Schwertknauf geklammert. Bereit zum<br />
Kampf. Das führt uns zur Frage, wer A.<br />
Braun eigentlich gewesen ist.<br />
August Brauns Lebensstationen<br />
Als jüngstes von 13 Kindern des künstlerisch<br />
begabten Wangener Arztes Dr. Josef Braun<br />
wird August am 16. Mai 1876 geboren. Nach<br />
dem Abitur studiert er in München an der<br />
Kunstakademie. Dort pflegt er den Kontakt<br />
mit Prof. Gebhard Fugel und dem Maler Carl<br />
Caspar. Sie verkehren mit ihren Malerkollegen<br />
Hermann Anton Bantle, Franz Martin<br />
und dem Restaurator Baur am so genannten<br />
Schwabenstammtisch. A. Pfeffer aus Rottenburg,<br />
ein weiterer Stammtischler, erinnert<br />
sich: „Während wir anderen redeten, schwieg<br />
Braun und während wir tranken, blieb er ein
Asket. Seichte Unterhaltung lag ihm nicht,<br />
aber wenn er einem armen Droschkengaul<br />
ein gutes Wort geben konnte, tat er es ... Im<br />
Hofgarten liebten ihn die Vögel und Tauben,<br />
und am Trefflerstammtisch liebten ihn die<br />
Menschen. Denn August Braun trug kein<br />
Falsch in der Brust, war weder ein Streber<br />
noch ein Nörgler, nur grundernst in allen<br />
Dingen.“ 4<br />
1898 unterbricht Braun sein Studium für einen<br />
mehrmonatigen Leipzig-Aufenthalt und<br />
begibt sich danach 1899 nach Paris, um sich<br />
in der Kunstmetropole weiter zu bilden und<br />
seinen eigenen Stil zu finden. Wieder in<br />
München, wird er Schüler von Prof. Heinrich<br />
von Zügel, bei dem er große Meisterschaft in<br />
der Tiermalerei erlangt. Nach dem Studium,<br />
von 1908 bis 1914, ist er freischaffender<br />
Künstler, illustriert mehrere Bücher und<br />
lithografiert bekannte Sehenswürdigkeiten in<br />
München. He<strong>im</strong>gekehrt aus dem Ersten<br />
Weltkrieg, zieht er 1918 endgültig in seine<br />
He<strong>im</strong>atstadt um, wo er erst bei seinem Bruder<br />
Carl, später be<strong>im</strong> Neffen Josef lebt. Dort<br />
wendet er sich verstärkt religiösen Themen<br />
zu. Ab 1922 arbeitet er in Oberschwaben und<br />
<strong>im</strong> Allgäu als Kirchenmaler. Insgesamt hat er<br />
knapp 50 kirchliche und auch weltliche Gebäude<br />
aus- und angemalt. Dabei gelingt es<br />
ihm einerseits, das Wesentliche der Barockmalerei<br />
zu verinnerlichen, andererseits einen<br />
eigenen Duktus zu verwirklichen, der von<br />
Fugel und der Neuen Sachlichkeit – man<br />
denke an Otto Dix – beeinflusst ist. So charakterisiert<br />
ihn der zeitgenössische Wangener<br />
Oberstudienrat Dr. Franz Nassal als den<br />
„bes ten Barockmaler unserer Zeit“. 5 Anzumerken<br />
ist, dass Braun stets bescheiden und<br />
unpolitisch gelebt und dementsprechend keiner<br />
Partei angehört hat. Sein erster Weg führte<br />
ihn morgens stets zur Frühmesse. Kurz<br />
vor seinem 80. Geburtstag stirbt August<br />
Braun am 8. April 1956, inzwischen Ehrenbürger<br />
von Wangen. Begraben liegt er <strong>im</strong> Familiengrab<br />
auf dem Wangener Friedhof.<br />
Die Feinde des Kreuzes<br />
Die rechte Seite des Deckengemäldes wird<br />
von den Feinden des Kreuzes beherrscht<br />
(Abb. 4 u. 5). Dies ist ein Zeugnis des bekennenden<br />
Katholiken Braun für die zeitgenössi-<br />
Michael Barczyk – <strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />
Im Oberland 2008, Heft 2<br />
50<br />
Abb. 4 An dieser Stelle folgt die BU.<br />
sche Geisteshaltung, ein seltenes Zeugnis für<br />
passiven Widerstand gegen <strong>Hitler</strong> und den<br />
National sozialismus. Und dies <strong>im</strong> Jahre<br />
1944, in dem der für die Nazis verlorene<br />
Krieg erneut eskalierte und tausende Blut -<br />
opfer forderte. Oben stehen die „Bonzen“,<br />
die Unternehmer, die Kriegsgewinnler <strong>im</strong><br />
schwarzen Anzug, <strong>im</strong> Frack, <strong>im</strong> Abendkleid,<br />
Champagnergläser haltend. Ein kleiner Teufel<br />
versucht bereits, einen Kapitalisten an<br />
den Frackschößen in den Höllenschlund zu<br />
ziehen. Unter diesen sehen wir einen mit<br />
Zwicker leicht verfremdeten Adolf <strong>Hitler</strong><br />
und Sir Winston Chur chill, dahinter einen<br />
Zeitung lesenden jüdischen Intellektuellen,<br />
wie die hebräischen Buchstaben dies vermuten<br />
lassen. <strong>Hitler</strong> als Urheber allen Unglücks<br />
braucht nicht näher erläutert zu werden.<br />
Und Churchill? Wäre nicht Stalin angebrachter?<br />
Dennoch: Versetzen wir uns in die Jahre<br />
1943/1944! Auf Churchills Initiative hin<br />
kam es Anfang des Jahres 1943 zur Friedenskonferenz<br />
der Anti-<strong>Hitler</strong>-Koalition in Casablanca.<br />
Dort wurde „the unconditional sur-
ender“ (die bedingungslose Kapitulation)<br />
Deutschlands beschlossen, wenige Monate<br />
später die Invasion in Frankreich. Die totale<br />
Bombardierung deutscher Städte sollte konsequent<br />
durchgeführt werden.<br />
Unter <strong>Hitler</strong> und Churchill sieht man zwei<br />
Arbeiter, Proletarier, die den Sozialismus-<br />
Kommunismus repräsentieren sollen, wieder<br />
darunter die biblische Gruppe mit Judas und<br />
seinen 30 Silberlingen, diskutierende Juden<br />
(Pharisäer) und den Hohen Priester Kaiphas,<br />
denen zur Last gelegt wird, Jesus ans Kreuz<br />
auszuliefern.<br />
Bleibt die Frage, wieso das alles ohne Auf -<br />
sehen zu erregen über die Bühne gehen<br />
konnte? Die Pfarrchronik hütet sich wohlweislich,<br />
eine Interpretation zu liefern, und<br />
die damaligen Zeitungen berichten nicht<br />
über das <strong>Rötenbach</strong>er Deckenfresko. Aber<br />
die <strong>Rötenbach</strong>er Gläubigen haben es jeden<br />
Sonntag sehen können. Haben sie die Tragweite<br />
der Aussage deuten können?<br />
Anmerkungen zur Rezeptionsgeschichte<br />
Von Pfarrer Otto Schmid und auch von Altbürgermeister<br />
Manfred Konnes wurde die<br />
umstrittene Person als Adolf <strong>Hitler</strong> gedeutet.<br />
Dies hat seinen Niederschlag nur in der lokalen<br />
Literatur gefunden. Und in der Tat passt<br />
nur <strong>Hitler</strong> in den Kontext und die Auslegung<br />
der Ikonografie. Tatsächlich haben aber<br />
Braun selbst und der damalige Pfarrer Hagenmayer<br />
die Identität mit <strong>Hitler</strong> nie offen gelegt.<br />
Auch bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde<br />
von Wangen 1946 an den Künstler<br />
war das kein Thema.<br />
Völlig unklar ist die Meinung der <strong>Rötenbach</strong>er<br />
Gläubigen. Standardfrage: „Wissen Sie,<br />
dass <strong>Hitler</strong> in der Kirche abgebildet ist?“<br />
Anmerkungen<br />
1 Beide können bei der Wolfegg lnformation, Röten -<br />
bacher Str. 13, 88364 Wolfegg, bestellt werden.<br />
2 Carmen Witt-Schnäcker: Malereien von August und<br />
Josef Braun in der Kath. Pfarrkirche in Eriskirch am<br />
Bodensee, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg<br />
(2007) H. 2, S. 116–121.<br />
3 Freundliche Mitteilung von Sr. Dr. Margarita Beitl,<br />
Kloster Untermarchtal, vom 30. August 2007.<br />
4 Argenbote (Wangen) vom 4. September 1930: Die<br />
erneuerte Kirche von Arnach. Freundliche Mitteilung<br />
von Dr. Rainer Jensch, Stadtarchiv Wangen, vom<br />
10. September 2007.<br />
Michael Barczyk – <strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />
Standardantwort: „Hoi, moinet sie, der mit<br />
dem Bärtle? Kennt’ sei!“ Seit Publizierung<br />
der Zeitungsartikel und Flyer schlagen die<br />
Wellen hoch. Der eine: „Das ist eindeutig der<br />
H<strong>im</strong>mler!“ Und der andere: „Das kann nur<br />
der Chamberlain sein.“ Und verallgemeinernd:<br />
„Auf der rechten Seite sieht man<br />
Kaufleute.“ Schön und gut. Wer aber passt<br />
nun wirklich in das Raster der Ikonografie?<br />
Hintergründe<br />
Im Oberland 2008, Heft 2<br />
51<br />
Vernetzen wir einmal den „<strong>Hitler</strong>typus <strong>Rötenbach</strong>“.<br />
Josef Karl Huber (1902–1996) 6 gestaltete<br />
1940 in der Peter-und-Pauls-Kirche<br />
zu Weil der Stadt ein Christusfenster. „In der<br />
Versucherszene hat er dem Satan die Gesichtszüge<br />
Adolf <strong>Hitler</strong>s gegeben ... 1941<br />
wurde Huber zum Kriegsdienst eingezogen.“<br />
Und in den 20er-Jahren hat Peter Hecker in<br />
St. Mechtern in Köln-Ehrenfeld ein Fresko<br />
gemalt, das stark an <strong>Rötenbach</strong> erinnert:<br />
„Die Verworfenen aber, die sich den heiligen<br />
Worten verschließen, sammeln sich <strong>im</strong> oberen<br />
Teil des Bildes, fahren <strong>im</strong> Auto vor einer<br />
Bar vor, in der Teufelchen servieren, sind<br />
Elegants mit Monokel und leichtsinnige<br />
Mädchen. Entsprechend der thematischen<br />
Mehrschichtigkeit des Bildes (Vertrauen,<br />
Gleichgültigkeit, Abwendung) folgte Hecker<br />
den Kompositionsprinzipien barocker Wandbilder.“<br />
7<br />
Zum Schluss möchte ich eine Interpretation<br />
nicht vorenthalten, die besagt, August Braun<br />
habe dem „braunen Sumpf” ein Paradigma<br />
göttlicher Gerechtigkeit vorhalten wollen.<br />
Bei H. Dekan C. Blessing, Pfarrer von <strong>Rötenbach</strong>, und<br />
den Drs. W. und M. Braun, Wangen, bedanke ich mich<br />
für ihr großes Interesse.<br />
5 Maria Braun: August Braun. 1876 bis 1956. Ein<br />
Wangener Maler. Wangen 1996.<br />
6 Franz X. Schmid: Bischof Sproll und die Kunst,<br />
Lindenberg: Fink 2004, S. 22 f.<br />
7 Adam C. Oellers: Übergänge, Alfter 1993, S. 135 f.<br />
Bildnachweis<br />
Sämtliche Abbildungen vom Stadtarchiv Bad Waldsee.<br />
S. XX Franz X. Schmid. Mit freundlicher Genehmigung<br />
des Kunstverlags Josef Fink, Lindenberg.