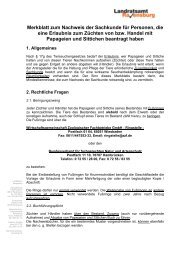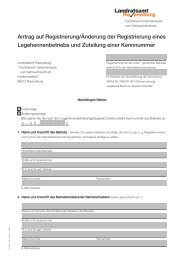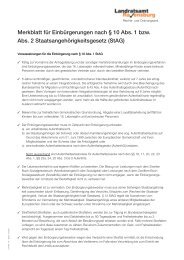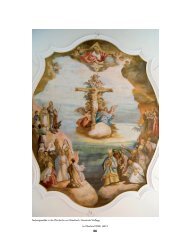Ausweisung eines Landschaftsschutzgebiets - im Landkreis ...
Ausweisung eines Landschaftsschutzgebiets - im Landkreis ...
Ausweisung eines Landschaftsschutzgebiets - im Landkreis ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Landschaftsschutzgebiets</strong><br />
„Moor- und Hügelland südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu“<br />
- Würdigung -<br />
Entwurf Juli 2010<br />
Auftraggeber:<br />
Landratsamt Ravensburg<br />
Umweltamt<br />
Auftragnehmer:<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll<br />
Häfeleweg 5<br />
88145 Hergatz
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 2<br />
Inhalt<br />
1.00 Anlass ................................................................................................................. 3<br />
2.00 Untersuchungsgebiet .............................................................................................. 3<br />
2.10 Geographische und naturräumliche Lage .............................................................. 3<br />
2.20 Abgrenzung und Größe ...................................................................................... 4<br />
2.30 Geologie, Boden ............................................................................................... 5<br />
2.31 Geologie .......................................................................................................... 5<br />
2.32 Boden ............................................................................................................... 7<br />
2.40 Morphologie und Gewässernetz ........................................................................... 8<br />
2.41 Fließgewässer .................................................................................................... 8<br />
2.42 Stillgewässer ...................................................................................................... 9<br />
2.50 Kl<strong>im</strong>a .............................................................................................................. 10<br />
2.60 Natürliche Vegetation ....................................................................................... 10<br />
2.70 Schutzgebiete .................................................................................................. 10<br />
2.71 Naturschutzgebiete ........................................................................................... 10<br />
2.72 Biotope nach §32 NatSchG und Waldbiotopkartierung ........................................ 11<br />
2.73 NATURA 2000-Gebiete .................................................................................... 11<br />
2.80 Aktuelle Landnutzung, Nutzungsgeschichte .......................................................... 13<br />
2.81 Landwirtschaft .................................................................................................. 13<br />
2.82 Wald und Forstwirtschaft ................................................................................... 15<br />
2.83 Sonstige Nutzungen .......................................................................................... 16<br />
3.00 Schutzwürdigkeit .................................................................................................. 17<br />
3.10 Landschaftsbild ................................................................................................ 17<br />
3.20 Erholungspotenzial ........................................................................................... 18<br />
3.30 Gewässer ........................................................................................................ 19<br />
3.31 Stillgewässer .................................................................................................... 19<br />
3.32 Fließgewässer .................................................................................................. 21<br />
3.40 Moore, Nass- und Streuwiesen .......................................................................... 22<br />
3.50 Steillagen, Streuobstwiesen ................................................................................ 22<br />
3.60 Tier- und Pflanzenwelt ....................................................................................... 23<br />
3.61 Flora .............................................................................................................. 23<br />
3.62 Fauna ............................................................................................................. 23<br />
3.70 Wälder, Gehölzbestandene Biotope ................................................................... 24<br />
3.80 Kulturlandschaftselemente ................................................................................. 25<br />
4.00 Schutzbedürftigkeit, Gefährdungen ........................................................................ 25<br />
4.10 Gefährdungen, Vorbelastungen des Landschaftsbildes .......................................... 25<br />
4.20 Gefährdungen Gewässer .................................................................................. 27<br />
4.30 Gefährdung der Nass- und Streuwiesen, Moore ................................................... 27<br />
4.40 Gefährdung der Steillagen und Streuobstwiesen .................................................. 27<br />
4.50 Gefährdungen Pflanzen- und Tierwelt ................................................................. 28<br />
4.60 Gefährdung der Wälder .................................................................................... 29<br />
5.00 Schutzzweck und Schutzziele ................................................................................. 30<br />
5.10 Allgemeiner Schutzzweck ................................................................................... 30<br />
5.20 Schutzziele ................................................................................................... 31<br />
5.30 Verbote und Erlaubnisvorbehalte ........................................................................ 32<br />
6.00 Anhang .............................................................................................................. 33<br />
6.10 Literatur .......................................................................................................... 33<br />
6.20 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen ............................................................... 34<br />
6.30 Anlagen Karten ..................................................................................................... 35<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 3<br />
1.00 Anlass<br />
Zum Schutz und zur nachhaltigen Sicherung des landschaftsästhetischen und naturkundlichen<br />
Wertes und der geomorphologischen und kulturhistorischen Besonderheiten<br />
der Jungmoränenlandschaft südlich von Wangen, will das Landratsamt<br />
Ravensburg ein Landschaftsschutzgebiet mit einem Flächenumfang von ca. 1600<br />
ha ausweisen. Die vorgeschlagene Schutzgebietsabgrenzung umfasst einen einheitlichen<br />
Landschaftsausschnitt, der nur in seiner Gesamtheit den Wert und die<br />
Besonderheiten der Landschaft zur Geltung bringen kann.<br />
Teil dieses Landschaftsauschnitts ist das Landschaftsschutzgebiet Schwarzensee<br />
(Verordnung vom 30.03.1960) mit einem Flächenumfang von ca. 250 ha. Durch<br />
einen Auslegungsfehler erhielt dieses Landschaftsschutzgebiet allerdings nie<br />
Rechtskraft.<br />
Die Würdigung soll die Schutzwürdigkeit, Schutzbedürftigkeit und Gefährdungen<br />
des Landschaftsausschnitts aufzeigen und Schutzzweck und Schutzziele für das<br />
Landschaftsschutzgebiet formulieren. Sie dient als Grundlage für die rechtsgültige<br />
<strong>Ausweisung</strong> als Landschaftsschutzgebiet.<br />
2.00 Untersuchungsgebiet<br />
2.10 Geographische und naturräumliche Lage<br />
Das geplante Landschaftsschutzgebiet (zukünftig kurz LSG) liegt ganz <strong>im</strong> Süden des<br />
<strong>Landkreis</strong>es Ravensburg auf dem Gebiet der Stadt Wangen und umfasst Teile der<br />
Gemarkungen Niederwangen, Schomburg und Neuravensburg. Südöstlich wird das<br />
geplante LSG durch die Landesgrenze zu Bayern begrenzt. Das Gebiet ist<br />
naturräumlich Teil des Westallgäuer Hügellandes.<br />
Nach der Agrarökologischen Gliederung Baden-Württemberg ist das Gebiet<br />
innerhalb der Großlandschaft Südwestdeutsches Alpenvorland vollständig der<br />
Teillandschaft Östliches Bodenseegebiet zuzuordnen. Das Östliche Bodenseegebiet<br />
gliedert sich innerhalb der Teillandschaft in 3 Standortskomplexe auf, die in der<br />
folgenden Tabelle charakterisiert sind.<br />
Tab. 1: Die Standortskomplexe nach der agrarökologischen Gliederung<br />
Standortkomplex Anteil am Untersuchungsgebiet<br />
Neukirch-Neuravensburger<br />
Moor-und Hügelland<br />
Charakterisierung und landbauliche Eignung<br />
1289 ha Vorwiegend mittlere bis geringe Eignung für<br />
Ackerbau, Grünland und Obstbau (für Grünland<br />
teilweise besser)<br />
Degermoos 187 ha Vorwiegend mittlere bis geringe Eignung für<br />
Grünland<br />
Wangener Argentäler 145 ha Vorwiegend mittlere bis gute Eignung für Grünland,<br />
teilweise ackerfähig<br />
Summe 1621 ha<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 4<br />
Abb. 1: Abgrenzung des LSG und Übersicht agrarökologische Gliederung<br />
2.20 Abgrenzung und Größe<br />
Das LSG wurde soweit möglich parzellenscharf abgegrenzt. Wo eine Abgrenzung<br />
entlang Flurstücksgrenzen nicht sinnvoll war, wurde versucht entlang Straßen,<br />
Wegen oder Waldrändern die Grenze des LSG zu ziehen. In wenigen Einzelfällen<br />
läuft die Abgrenzung quer über Flurstücke. Bestehende größere Siedlungen die<br />
randlich liegen wie Wangen, Neuravensburg, Schwarzenbach und Elitz und das <strong>im</strong><br />
Gebiet liegende Roggenzell wurden vom LSG ausgegrenzt. Kleinere Weiler und<br />
Einzelgehöfte wurden vom LSG nicht ausgeklammert.<br />
Das abgegrenzte Gebiet umfasst die eiszeitlich geformte Moor- und Hügellandschaft<br />
südlich Wangen mit einem Flächenumfang von 1621 ha. Im Nordwesten<br />
wurde die Obere Argen als Abgrenzung gewählt weil diese die Moor – und Hügellandschaft<br />
auch optisch als einheitlichen Raum begrenzt. Südlich Hiltensweiler<br />
wurde die alte B18 als westliche Abgrenzung gewählt, da die Straße hier den<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 5<br />
Talraum durchschneidet, der Bereich zwischen Straße und Obere Argen hinsichtlich<br />
Landschaftsbild und Naturhaushalt nicht von besonderer Schutzwürdigkeit ist und<br />
weiter südlich Schwarzenbach und Neuravensburg sowieso vom LSG ausgegrenzt<br />
werden. Südlich Neuravensburg wurden die L 2374 und die Gemarkungsgrenze zu<br />
Achberg als Abgrenzung des LSG gewählt. Hier setzt sich zwar nach Südwesten die<br />
Moor- und Hügellandschaft fort, aber die hier die Landschaft zerschneidende Autobahn<br />
A 96 und die Gemeindegrenze sprachen für eine Zäsur an dieser Stelle.<br />
Ebenfalls nicht in das LSG einbezogen wird die Hügel- und Moorlandschaft westlich<br />
des Tals der Oberen Argen zwischen Hatzenweiler und Mindbuch da sie vom<br />
Argental vom übrigen Teil des LSG getrennt ist und ebenfalls durch die Autobahn<br />
zerschnitten ist.<br />
In Uhrzeigerrichtung verläuft die Abgrenzung des LSG, beginnend an der B32<br />
südlich Wangen wie folgt:<br />
B32 bis zur bayerischen Landesgrenze bei Schwarzenberg<br />
Bayerische Landesgrenze bis zum Bettensweiler Moos südlich Rogggenzell<br />
Gemeindegrenze zu Achberg bis zur L 2374 an der A96 zwischen Baindt und<br />
Neuravensburg<br />
L 2374 bis zum Neuravensburger Weiher<br />
Alte B18 bis Ortsrand Neuravensburg<br />
Östlicher Ortsrand Neuravensburg mit potenziellen Erweiterungsflächen bis zur<br />
alten B 18 nördlich Neuravensburg bei Reute<br />
Alte B18 bis zur Oberen Argen bei Hiltensweiler<br />
Westliches Ufer der Oberen Argen von Hiltensweiler bis nördlich Elitz mit<br />
Ausgrenzung der Siedlungsfläche bei Elitz<br />
Südlicher Waldrand bei Schindbüchel<br />
Südlicher Stadtrand Wangen mit potenziellen Erweiterungsflächen<br />
Bahnlinie Wangen-Hergatz bis südlich Friedhof Wangen<br />
Nördlich Niedermoor Wolfgangweiher bis B32<br />
2.30 Geologie, Boden<br />
2.31 Geologie<br />
Das Gebiet ist wie das übrige Westallgäu eine ausgesprochen junge Landschaft die<br />
vom Eis und Schmelzwasser der letzten Eiszeit geprägt ist. Es dominieren<br />
oberflächlich unsortiertes Moränenmaterial wie schluffige Geschiebemergel unterschiedlichster<br />
Be<strong>im</strong>engungen, oder Schmelzwassersed<strong>im</strong>ente, d. h. nach Korngrößen<br />
sortierte Kiese, Sande und Tone alpiner Herkunft. Jüngste Ablagerungen<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 6<br />
sind Hoch- und Niedermoortorfe, die in fast allen Senken und Rinnen des Gebietes<br />
zu finden sind. Das Relief und die Gewässer spiegeln das Geschehen am Ende des<br />
Eiszeitalters noch heute wider: Typisch sind dabei die bewegte, von Witterungseinflüssen<br />
noch wenig eingeebnete Oberflächengestalt, die zahlreichen, häufig<br />
natürlicherweise abflußlosen Hohlformen und das kleinräumige, scheinbar regellose<br />
Fließgewässernetz.<br />
Bemerkenswert sind die zahlreichen Drumlins, die <strong>im</strong> gesamten Untersuchungsraum<br />
vorkommen. Drumlins sind regelmäßige und stromlinienförmige Erosionskörper<br />
(wenige Dutzend m hoch und wenige 100 m lang) die <strong>im</strong> unmittelbaren Vorfeld der<br />
Gletscherzunge durch Ablagerung von Material und Eisdruck entstanden sind.<br />
Neben den Drumlins <strong>im</strong> Bereich des Inn-Chiemsee-Gletschers dürfte es sich um das<br />
beste Beispiel einer Drumlinlandschaft in Deutschland handeln (AHNERT 1996).<br />
Abb. 2: Blick über die Drumlinlandschaft südlich Roggenzell<br />
Zwischen den Drumlins befinden sich in Senken, aus denen das Wasser nicht<br />
abfließen konnte, kleine Seen oder Moorflächen die meist aus verlandeten Seen<br />
entstanden sind. Teilweise dürfte es sich auch um Toteisbildungen handeln. Dabei<br />
handelt es sich um riesige Eisblöcke die von Grundmoränen- oder Schmelzwassermaterial<br />
überdeckt wurden und erst <strong>im</strong> Laufe der Jahrhunderte langsam<br />
abschmolzen. So entstanden mit zeitlicher Verzögerung glaziale Hohlformen, die je<br />
nach Durchlässigkeit des Untergrundes als trockene oder vermoorte Mulden oder<br />
„Toteis“ - Seen wie der Elitzer See die Landschaft bereichern.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 7<br />
Das größte Moor, das Degermoos, setzt sich auf bayrischem Gebiet fort. Vermoort<br />
ist in diesem Fall ein Teil <strong>eines</strong> Gletscherzungenbeckens (sog. Laiblach-Lobus).<br />
Der heutige Argenverlauf zum Bodensee ist erst nacheiszeitlich entstanden. In der<br />
Argenaue hat die Argen ein mehrere hundert Meter breites Band mit Niederterrasseschottern<br />
aufgeschüttet.<br />
2.32 Boden<br />
Braunerden unterschiedlichster Ausprägung sind die charakteristischen Böden auf<br />
den lehmigen (lehmig-kiesig bis lehmig-sandigen) Geschiebemergeln der Grundmoräne.<br />
Hauptsächlich in den Senken finden sich Nieder- und Anmoorböden, die<br />
von besonderem naturschutzfachlichem Interesse sind. Ihr Wert ergibt sich aus ihrer<br />
Seltenheit, ihrer Empfindlichkeit und dem hohen Potenzial zur Entwicklung wertvoller<br />
Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Moorböden sind <strong>im</strong> Laufe von ca.<br />
10.000 Jahren entstanden und sind nicht wiederherstellbar.<br />
Nieder- und Anmoorböden entstehen bei einem hohen Grundwasserstand, da<br />
durch den damit verbundenen Sauerstoffmangel die Zersetzung organischer Anteile<br />
(Laub, Gras etc.) nicht mehr möglich ist. Die Nieder- und Anmoore sind damit auf<br />
einen hohen Grundwasserzufluss und gleichzeitig einen geringen Grundwasserabfluss<br />
angewiesen. Aufgrund dieser speziellen hydrologischen Voraussetzungen<br />
gehören Nieder- und Anmoore zu den seltensten Bodentypen überhaupt. Gleichzeitig<br />
sind sie gegen Entwässerungsmaßnahmen sehr empfindlich (Moorsackung,<br />
Mineralisierung).<br />
Intakte Nieder- und Anmoore weisen eine sehr hohe Wasserspeicherfähigkeit auf<br />
und tragen damit zur Wasserrückhaltung und zum Hochwasserschutz bei. Der hohe<br />
Wert der Nieder- und Anmoore für Arten und Lebensräume ergibt sich aus den<br />
extremen Standortverhältnissen (nass, relativ nährstoffarm) auf die zahlreiche<br />
seltene Tier- und Pflanzenarten angewiesen sind.<br />
Die Moore <strong>im</strong> Untersuchungsgebiet haben insgesamt eine Größe von ca. 270 ha,<br />
davon 256 ha Niedermoore. 13,8 ha Niedermoore und 0,4 ha Hochmoore (nach<br />
Moorkarte Göttlich). Insgesamt liegen damit auf 16,5 % der Gesamtfläche <strong>im</strong><br />
Untersuchungsgebiet Moorböden vor, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 8<br />
Abb. 3: Hochmoor-, Niedermoor- und Anmoorstandorte<br />
2.40 Morphologie und Gewässernetz<br />
Das Gebiet liegt zwischen ca. 520 m NN (an der Oberen Argen bei Hiltensweiler<br />
und südwestlich Hüttenweiler an der bayerischen Landesgrenze) und gut 580 m NN<br />
auf den höchsten Drumlins (bei Roggenzell, bei Herzmanns und bei Dorreite).<br />
2.41 Fließgewässer<br />
Das Gebiet entwässert überwiegend zur Oberen Argen. Wichtigster Zulauf ist der<br />
Schwarzenbach, der als Ablauf des Schwarzensees beginnt, und dann mehrere<br />
Kilometer lang die Landesgrenze zu Bayern markiert und bei Neuravensburg in die<br />
Obere Argen einmündet. Weitere wichtige Zuläufe sind der Zipfelgraben und der<br />
Moosbach die beide in den Neuravensburger Weiher fließen. Unterhalb Neu-<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 9<br />
ravensburg mündet der Ablauf des Neuravensburger Weihers, der Wiesenbach, in<br />
die Obere Argen. Der südlichste Bereich des Gebiets um den Hüttenweiler Weiher<br />
entwässert in Richtung Süden zur Oberreitnauer Ach.<br />
Abb. 4: links Schwarzenbach bei Obermooweiler und rechts Obere Argen bei Hiltensweiler<br />
Die Obere Argen gilt hinsichtlich der biologische Gewässergüte in diesem Bereich<br />
als mäßig belastet (Stufe II). Für die übrigen Fließgewässer liegen keine Daten vor.<br />
Das Gewässerentwicklungskonzept sieht für die Entwicklung der Argen folgende<br />
Leitlinien vor:<br />
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen und damit funktions- und<br />
regenerationsfähigen Gewässerlandschaft, die in Zukunft nachhaltig nutzbar<br />
sein soll.<br />
Erhalt bzw. Regeneration aller derzeit noch vorhandenen Lebensgemeinschaften<br />
feuchtgebietstypischer Tier- und Pflanzenarten an der Argen und in ihrem<br />
Talraum.<br />
Sicherung und Verbesserung der Grundwasserspeicher als regional bedeutsames<br />
Trinkwasserreservoir durch Stärkung der Flussdynamik zur Erhöhung der<br />
Grundwasseranreicherung und durch extensive landwirtschaftliche Nutzung der<br />
nur gering belastbaren Böden über Grundwasserspeichern als geeignetster<br />
Schutz vor Nährstoffeintrag.<br />
Erhaltung und Entwicklung einer reichstrukturierten, abwechslungsreichen,<br />
naturraumtypischen Kulturlandschaft als Lebens- und Wohnraum des Menschen<br />
mit besonderer Betonung der Erholungswirkung.<br />
Entlang der Oberen Argen sind <strong>im</strong> Untersuchungsraum ca. 50 ha <strong>im</strong> Bereich von<br />
Jussenweiler und Welbrechts als Überschewmmungsflächen ausgewiesen.<br />
2.42 Stillgewässer<br />
Die Seen und Weiher Oberschwabens sind Zeugen der letzten Eiszeit und der<br />
historischen Weiherwirtschaft. Sie prägen das Landschaftsbild, dienen der Erholung<br />
und sind für den Arten- und Biotopschutz von großer Bedeutung. Im Gebiet liegen<br />
vier größere Stillgewässer (Schwarzensee, Elitzer See, Neuravensburger Weiher,<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 10<br />
Hüttenweiler Weiher) sowie wenige Kleingewässer. Schwarzensee und Elitzer See<br />
sind natürlichen Ursprungs. Der Neuravensburger Weiher und der Hüttenweiler<br />
Weiher wurden <strong>im</strong> Mittelalter durch die Anlage von Dämmen zu Weihern<br />
aufgestaut.<br />
Der Schwarzensee und der Neuravensburger Weiher wurden in das Aktionsprogramm<br />
zur Sanierung Oberschwäbischer Seen aufgenommen. Ziel ist es, der<br />
bedrohlichen Entwicklung (Eutrophierung und Verlandung) der Gewässer durch<br />
Reduzierung der Nährstoffeinträge zumindest teilweise Einhalt zu gebieten und die<br />
l<strong>im</strong>nologischen und ökologischen Gegebenheiten zu verbessern. Für den Neuravensburger<br />
Weiher ist eine Entschlammung geplant.<br />
2.50 Kl<strong>im</strong>a<br />
Das Kl<strong>im</strong>a des Untersuchungsgebiets ist durch mäßig warme Sommer und kühle<br />
Winter charakterisiert. Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag vor 1990 bei ca.<br />
7,5° C, dürfte aber seither um mindestens 1° C gestiegen sein. Die hohen Niederschläge<br />
(über 1200 mm, davon rund ein Drittel in der Vegetationsperiode Mai bis<br />
Juli) sind durch die Stauwirkung der Alpen bedingt. Die Hauptwindrichtungen sind<br />
Südwest und Nordost.<br />
2.60 Natürliche Vegetation<br />
Das Gebiet ist hinsichtlich der potenziellen natürlichen Vegetation der Haupteinheit<br />
des Tannen-Buchenwald-Gebietes zuzuordnen. Entlang der Argen stellt ein frischer<br />
Grauerlen-Auwald die potenzielle natürliche Vegetation dar.<br />
2.70 Schutzgebiete<br />
2.71 Naturschutzgebiete<br />
Im Gebiet liegen 2 Naturschutzgebiete (NSG): das NSG Rothasweiher-Degermoos<br />
mit 53 ha (Verordnung vom 12.07.1993) und das NSG Neuravensburger Weiher<br />
mit 38 ha (Verordnung vom 15.09.2000).<br />
Das NSG „Rotasweiler – Degermoos“ stellt den auf württembergischer Seite<br />
liegenden Teil <strong>eines</strong> großflächigen Nieder- und Übergangsmoores dar. Die<br />
Moorlandschaften von der Größe und Differenziertheit des NSG besitzen in der<br />
landwirtschaftlich intensiv genutzten Landschaft einen außerordentlich hohen<br />
Biotopwert.<br />
Der Schutzzweck des NSG „Neuravensburger Weiher“ mit seiner Verlandungszone<br />
ist es, das Gewässer in seiner Eigenschaft als Brut- und Rastplatz für seltene und<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 11<br />
bedrohte Vogelarten von zum Teil europäischer Bedeutung zu erhalten und zu<br />
opt<strong>im</strong>ieren. Dazu gehören auch die Feucht-, Naß- und Streuwiesen sowie der<br />
Quellbereiche als Standort seltener oder gefährdeter Pflanzenarten.<br />
Weitere 5 Gebiete die in der folgenden Tabelle dargestellt sind, sind zur<br />
<strong>Ausweisung</strong> als Naturschutzgebiet vorgesehen.<br />
Tab. 2: Geplante Naturschutzgebiete<br />
Bezeichnung ca. Größe<br />
Kolbenmoos-Schwarzensee-Wolfgangweiher 66 ha<br />
Elitzer See 16 ha<br />
Kl<strong>eines</strong> Mösle 22 ha<br />
Hüttenweiler Weiher 22 ha<br />
Obere und Untere Argen 33 ha<br />
Summe 159 ha<br />
2.72 Biotope nach §32 NatSchG und Waldbiotopkartierung<br />
Bei der Biotopkartierung nach §32 wurden <strong>im</strong> Untersuchungsgebiet 122 Biotope<br />
mit einer Gesamtfläche von 172 ha erfasst. Die flächenmäßig größten Anteile<br />
nehmen dabei die Feuchtgebiete mit Nass- und Streuwiesen und Feuchtgebüsch<br />
den Verlandungsbereichen der Stillgewässer mit Tauch- und Schw<strong>im</strong>mblattvegetation,<br />
Röhricht und Riede ein. Weitere Biotoptypen <strong>im</strong> Gebiet sind u.a.<br />
naturnahe Fließgewässer mit begleitendem Auwaldstreifen, Feldgehölze, Feldhecken,<br />
Quellen und Hochstaudenfluren. Von der Waldbiotopkartierung wurden <strong>im</strong><br />
Untersuchungsgebiet 40 ha erfasst.<br />
2.73 NATURA 2000-Gebiete<br />
Einziges NATURA 2000-Gebiet ist die Obere Argen und ihre Seitentäler mit 284 ha<br />
Schutzgebietsflächen <strong>im</strong> Gebiet des geplanten LSG. Das Gebiet Schwarzensee-<br />
Kolbenmoos ist zusätzlich als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Alle geschützten<br />
Flächen sind in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt.<br />
Tab. 3: Übersicht über die geschützten Gebiete (Überlagerungen möglich)<br />
Nutzung Fläche <strong>im</strong><br />
Untersuchungsgebiet<br />
Flächenanteil <strong>im</strong><br />
Untersuchungsgebiet<br />
<strong>Landkreis</strong><br />
Ravensburg<br />
Flächenanteil<br />
Land Baden-<br />
Württemberg<br />
Bestand Naturschutzgebiete 90 ha 5,5 % 3,6 % 2,4 %<br />
Geplante<br />
Naturschutzgebiete<br />
154 ha 9,4 % - -<br />
§32-Biotope 172 ha 10,5 % 3,0 % 1,9 %<br />
Waldbiotopkartierung 40 ha 2,4 % 4,0 % 1,6 %<br />
Bestand<br />
Landschaftsschutzgebiete<br />
0 ha 0 % 18,3 % 22,8 %<br />
NATURA 2000-Gebiete 284 ha 17,3 % 10,5 % 17,3 %<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 12<br />
Insgesamt unterliegen derzeit 311 ha (=19,0 %), nach <strong>Ausweisung</strong> auch der<br />
geplanten Naturschutzgebiete 348 ha (= 21,2 %), <strong>im</strong> Untersuchungsraum einem<br />
Schutzstatus. Die Schutzgebiete sind in der folgenden Abbildung dargestellt.<br />
Abb. 5: Bestehende und geplante Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Biotope und<br />
NATURA 2000-Gebiete<br />
Auf bayerischer Seite sind angrenzende Flächen <strong>im</strong> Bereich Degermoos und<br />
Schwarzensee ebenfalls als NATURA 2000-Gebiete ausgewiesen. Das Degermoos<br />
ist auf bayerischer Seite ebenfalls als Naturschutzgebiet ausgewiesen.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 13<br />
2.80 Aktuelle Landnutzung, Nutzungsgeschichte<br />
Der Großteil des Gebiets wird landwirtschaftlich genutzt. Der Anteil der<br />
Waldflächen und der Siedlungs- und Verkehrsflächen ist auch <strong>im</strong> regionalen<br />
Vergleich gering wie folgende Tabelle zeigt.<br />
Tab. 4: Flächenanteile Nutzungen<br />
Nutzung Fläche <strong>im</strong><br />
Untersuchungsgebiet<br />
Siedlungs- und<br />
Verkehrsfläche<br />
Flächenanteil <strong>im</strong><br />
Untersuchungsgebiet<br />
Flächenanteil Region<br />
Bodensee /<br />
Oberschwaben<br />
Flächenanteil<br />
Land Baden-<br />
Württemberg<br />
87 ha 5,4 % 10,8 % 14,1%<br />
Wald 301 ha 18,5 % 32,0 % 38,3 %<br />
landwirtschaftliche<br />
Nutzungen<br />
davon Grünland<br />
davon Acker<br />
davon Sonderkulturen<br />
(Obstbau, Hopfen)<br />
davon Streuobst<br />
davon Feucht- und<br />
Streuwiesen<br />
1167ha<br />
915 ha<br />
41 ha<br />
8 ha<br />
96 ha<br />
107 ha<br />
72,0 % 55,4 % 45,8 %<br />
Gewässer 25 ha 1,5 % 1,1 % 1,1 %<br />
sonstige naturnahe<br />
Bereiche (Brache, Gehölze)<br />
Sonstiges (Kiesgrube,<br />
Deponie)<br />
14 ha 0,9 %<br />
27 ha 1,7 % 0,7 % 0,7 %<br />
Summe 1621 ha 100,0 % 100 % 100 %<br />
Quelle: Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Baden-Württemberg<br />
2.81 Landwirtschaft<br />
Die intensive Grünlandnutzung (5-6 schnittige Wiesen mit Gülledüngung) n<strong>im</strong>mt<br />
mit fast 80 % den Großteil der landwirtschaftlichen Flächen ein. Bemerkenswert<br />
sind der hohe Flächenanteil der Streuobstwiesen (ca. 8 % der landwirtschaftlichen<br />
Fläche) und der Feucht- und Streuwiesen (ca. 9 % der landwirtschaftlichen Fläche)<br />
<strong>im</strong> Gebiet. Streuobstwiesen sowie Feucht- und Streuwiesen haben in diesem Gebiet<br />
einen regionalen Schwerpunkt.<br />
Bemerkenswert auch die Zunahme der Ackerflächen in den letzten Jahren. Im<br />
Untersuchungsgebiet liegt der Anteil der Ackerflächen (inkl. Sonderkulturen) an der<br />
landwirtschaftlichen Nutzfläche inzwischen deutlich über 5 %. Er dürfte sich damit<br />
innerhalb der letzten 5 Jahre mehr als verdoppelt haben. Im Gebiet der Stadt<br />
Wangen nahmen Ackerflächen in den letzten 10 Jahren um mehr als 50 % zu wie<br />
die folgende Tabelle zeigt.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 14<br />
Tab. 5: Änderung der Hauptnutzungsarten in der Gemeinde Wangen<br />
Hauptnutzungsarten Wangen<br />
1979 2001 2007<br />
Ackerland in % 2,9 3,9 5,9<br />
Dauergrünland in % 96,3 95,7 93,8<br />
Obstanlagen/Baumschulen in % 0,4 0,3 0,2<br />
Quelle: Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Baden-Württemberg<br />
Auf den Ackerflächen wird fast ausschließlich Mais zur Herstellung von Maissilage<br />
angebaut. Zumindest teilweise wird die Maissilage auch zur Energiergewinnung in<br />
Biogasanlagen genutzt.<br />
Abb. 6: Ackerflächen auf ehemaligem Grünlandstandort bei Roggenzell<br />
Der Strukturwandel innerhalb der Landwirtschaft ist insbesondere an der Zahl der<br />
Betriebsaufgaben deutlich abzulesen. In Wangen ging z.B. die Zahl der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe zwischen 1979 und 2007 von 454 auf 240 zurück. Dies<br />
entspricht einem Rückgang um fast 50 %.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 15<br />
2.82 Wald und Forstwirtschaft<br />
Der Waldanteil mit 18 % ist gegenüber dem Landesdurchschnitt sehr gering und<br />
liegt auch deutlich unter dem regionalen Durchschnitt (<strong>Landkreis</strong> Ravensburg 27 %).<br />
Der Wald wurde <strong>im</strong> Zuge der alemannischen Siedlungsphase auf die<br />
landwirtschaftlich nicht nutzbaren Standorte zurückgedrängt (zu nasse, zu steile<br />
Lagen, zu arme Böden). Als natürlich vorkommende Hauptbaumarten auf nassen<br />
bis moorigen Standorten sind Roterle, Birke, Fichte, Kiefer und Spirke zu nennen,<br />
auf den nährstoffreicheren, durchlüfteten Böden Buche und Tanne (Hinweis auf<br />
hohe Niederschläge), auf schattigen Hängen Bergahorn und Esche. Die Waldkiefer<br />
könnte auf sonnseitigen Drumlins und Schotterflächen der Argen natürliche<br />
Vorkommen besitzen.<br />
Abb. 7: Waldflächen an Drumlinrücken und in Senke bei Dorreite<br />
Niederwaldnutzung (zur Brennholzgewinnung) und Waldweide waren früher die<br />
vorherrschenden Nutzungsformen; dadurch wurden ausschlagkräftige Baumarten<br />
wie Eiche und Hainbuche gefördert. Bereits <strong>im</strong> 16. Jahrhundert wurden <strong>im</strong> Allgäu<br />
Nadelhölzer, zunächst v.a. die Tanne, gefördert, ab dem 18. Jahrhundert v.a.<br />
Fichte und z.T. auch Kiefer. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erreichte der Anteil<br />
der Fichte über 80 Prozent.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 16<br />
2.83 Sonstige Nutzungen<br />
Kiesgrube<br />
Bei Grub östlich Neuravensburg besteht eine kleinere Kiesgrube, hauptsächlich auf<br />
einem ehemaligen Waldstandort, in der in kleinerem Umfang Kies abgebaut wird.<br />
Die abgebauten Bereich ewerden überwiegend wieder mit Wald aufgeforstet.<br />
Entsorgungszentrum Obermooweiler<br />
Das Entsorgungszentrum Obermooweiler besteht aus einem Deponieteil, einer<br />
Wertstofferfassungsstation, einer Sickerwasserfassung, einer Deponiegaserfassung<br />
und Gasverwertung, Kompost- und Lagerplätzen und einer Umladestation für den<br />
Haus- und Sperrmülltransport. Der Deponieteil befindet sich 2005 in der<br />
Stilllegungsphase, d. h. es werden dort keine Abfälle mehr deponiert.<br />
Einen Überblick über die Flächennutzungen <strong>im</strong> Gebiet gibt folgende Karte<br />
(zusammengestellt aus ATKIS-Daten und Landschaftsplan Wangen, tw. aktualisiert):<br />
Abb. 8: Flächennutzungen <strong>im</strong> geplanten LSG<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 17<br />
3.00 Schutzwürdigkeit<br />
Die Schutzwürdigkeit des Gebiets beruht auf seiner landschaftlichen Vielfalt und<br />
Eigenart und der naturnahen Ausprägung vieler Teilbereiche mit einer hohen<br />
Strukturvielfalt, die Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen darstellen.<br />
Die Landschaft erscheint dadurch abwechslungsreich und reizvoll.<br />
Nach dem vom Alpenforschungsinstitut (2000) vorgelegten Entwicklungskonzept<br />
‘Westallgäuer Hügelland‘ kommt weiten Teilen des Landschaftsraumes aufgrund<br />
seiner naturräumlichen Ausstattung eine besondere Bedeutung sowohl aus ökologischer<br />
Sicht als auch <strong>im</strong> Hinblick auf das Landschaftsbild und der Erholung zu. Für<br />
den Bereich Wangen werden <strong>im</strong> Konzept folgende Leitziele vorgeschlagen:<br />
- Schutz, Pflege und Erhalt der wertvollen Natur- und Kulturlandschaft<br />
- Erhalt des attraktiven Landschaftsbildes und der Erholungsvorsorge<br />
- Erhalt und Entwicklung der Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren und ihrer<br />
Lebensräume<br />
- Schutz des Boden und Wasserhaushaltes<br />
Das Westallgäuer Hügelland ist mit einem Anteil der landwirtschaftlichen Fläche<br />
von 65 % an der Gesamtfläche überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Daraus<br />
resultiert die besondere Bedeutung der Landwirtschaft in Bezug auf die Erreichung<br />
der oben genannten Leitziele. Auf Basis der Bestandsaufnahme Landwirtschaft wird<br />
folgender Zielkatalog für das Gebiet vorgeschlagen:<br />
- Erhalt und Förderung einer leistungsfähigen Landwirtschaft, die standortgerecht,<br />
nachhaltig und umweltgerecht wirtschaftet<br />
- Erhalt einer möglichst flächendeckenden Bewirtschaftung der Kulturlandschaft<br />
- Sicherung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen<br />
- Sicherung der Existenz möglichst vieler bäuerlicher Betriebe<br />
3.10 Landschaftsbild<br />
Das Moor- und Hügelland südlich Wangen und östlich der Oberen Argen<br />
repräsentiert einen besonders typischen Ausschnitt der eiszeitlich geformten<br />
Jungmoränenlandschaft mit Moränehügeln, Schmelzwasserrinnen, Toteislöchern<br />
und Mooren. Eine geomorphologische Besonderheit stellen die Drumlins dar. Das<br />
Hügelland ist Teil dieser einzigartigen „Drumlinlandschaft“ zwischen Wangen,<br />
Tettnang und Lindau. Durch seine geomorphologische Ausstattung besitzt die<br />
Landschaft einen abwechslungsreichen und reizvollen Charakter mit einem hohen<br />
Maß an Eigenart und landschaftlicher Vielfalt. Dieser wird durch kulturhistorische<br />
Besonderheiten wie die (historische) Weiherwirtschaft, eine hohe Dichte an<br />
Moorflächen, eine dezentrale, ländliche Siedlungsstruktur mit zahlreichen<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 18<br />
Einzelgehöften und Weilern und dem Ausblick auf die nahen Alpen noch deutlich<br />
gesteigert.<br />
Abb. 9: Blick in die Hügellandschaft bei Neuravensburg mit den Alpen <strong>im</strong> Hintergrund<br />
Das Moor- und Hügelland stellt einen Landschaftsausschnitt von hohem naturkundlichem,<br />
kulturhistorischem und landschaftsästhetischem Wert dar.<br />
3.20 Erholungspotenzial<br />
Durch seine natürlichen Voraussetzungen, seine ländliche Struktur und die Lage<br />
abseits von großen Verkehrsachsen bzw. Siedlungen ist das Gebiet ideal für eine<br />
landschaftsgebundene, sanfte Erholung. Sowohl für Einhe<strong>im</strong>ische als auch für<br />
Urlauber bieten sich Freizeitaktivitäten wie Radfahren, Inline-Skaten, Wandern,<br />
Reiten, Angeln, Boot fahren und Baden an. Durch das Gebiet führen mehrere<br />
regionale Rad- und Wanderwege. Das Gästeamt Wangen bietet Vorschläge für<br />
Wanderungen und Radtouren die durch das Gebiet führen. Dass das Erholungspotenzial<br />
des Gebiets bereits genutzt wird lässt sich am Quartierangebot ablesen.<br />
Neben einzelnen Privatvermietern mit Z<strong>im</strong>mern und Ferienwohnungen, bieten<br />
einige landwirtschaftliche Betriebe (derzeit mind. 7 Betriebe) Ferien auf dem<br />
Bauernhof an. Im Gebiet befinden sich auch 2 Reiterhöfe (Untermooweiler,<br />
Degetsweiler) mit der Möglichkeit von Reiterferien.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 19<br />
Abb. 10: Radfahrer zwischen Wangen und Herzmanns und Pferdeweide bei Untermooweiler<br />
3.30 Gewässer<br />
3.31 Stillgewässer<br />
Im LSG liegen 2 Seen (Elitzer See und Schwarzensee) und 2 größere Weiher<br />
(Neuravensburger Weiher und Hüttenweiler Weiher) die zu einem unverwechselbaren<br />
charakteristischen Landschaftsbild beitragen.<br />
Der Schwarzensee mit ca. 6,8 ha wird durch Entwässerungsgräben und den<br />
Schwarzenbach gespeist. Aufgrund seiner geringen max. Wassertiefe von 1,6 m<br />
wird er als Flachsee bezeichnet. Diese geringe Tiefe führt zur schnelleren<br />
Erwärmung und bedingt einen geringen Sauerstoffgehalt. Mit der Nährstoffzufuhr<br />
führt dies zu einer raschen Verlandung des Sees. Es findet nur eine extensive<br />
fischereiliche Nutzung und keine Badenutzung statt.<br />
Abb. 11: links Schwarzensee und rechts Senke mit Elitzer See<br />
Der Elitzer See mit ca. 2,8 ha ist ein übertiefes Toteisloch, dadurch sind die Ufer<br />
sehr steil. Die größte Wassertiefe liegt bei ca. 6 m. Er wird durch Entwässerungsgräben,<br />
Hangquellen und evtl. auch Quellen am Seeboden gespeist. Der Ablauf<br />
erfolgt über einen wasserführenden Graben. Am bewaldeten Ostufer des Sees<br />
findet eine weitgehend ungeregelte Badenutzung statt. Diese Uferseite ist über einen<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 20<br />
Feldweg und Trampelpfade erschlossen. Der Elitzer See wurde um 1935 durch eine<br />
Tieferlegung des Abzugsgrabens um mindestens 70 cm abgesenkt.<br />
Der Neuravensburger Weiher hat eine Größe von ca. 9,6 ha, erreicht eine mittlere<br />
Tiefe von 1,80 m und ist max<strong>im</strong>al 4,1 m tief. Er wird von 2 kleinen Bächen, dem<br />
Zipfelgraben und dem Moosbach gespeist. Der Ablauf erfolgt über den<br />
Wiesenbach in die Obere Argen. Der Weiher ist stark mit Nährstoffen belastet und<br />
verschlammt. Das Gewässer wird fischereilich von einem Angelsportverein genutzt.<br />
Die Badenutzung ist auf einen Bereich am Nordufer (Liegewiese mit Steg)<br />
beschränkt.<br />
Der Hüttenweiler Weiher hat eine Größe von ca. 0,8 ha. Er wird von einem kleinen<br />
Bachlauf gespeist. Der Weiher ist stark mit Nährstoffen belastet und verschlammt.<br />
Das Gewässer wird von einem Privatmann fischereilich genutzt.<br />
Abb. 12: links Neuravensburger Weiher, rechts Hüttenweiler Weiher<br />
Allen Gewässern fehlen insbesondere auch <strong>im</strong> Bereich der Zuläufe breite natürliche<br />
Schutzgürtel, so dass Nährstoffe und Sed<strong>im</strong>ente eingeleitet werden und zu einer<br />
Verlandung führen.<br />
Der <strong>im</strong> Kolbenmoos liegende ehemalige Kolbensee (1850 noch ca. 2,5 ha groß)<br />
verlandete innerhalb weniger Jahrzehnte nach dem Bau <strong>eines</strong> Abzugsgrabens in<br />
den Schwarzensee <strong>im</strong> Jahre 1929.<br />
Zu den heute vorhandenen Weiherflächen prägten in historischer Zeit mindestens<br />
13 weitere Weiher mit einer Größe zwischen ca. 1 und 11 ha das Landschaftsbild<br />
<strong>im</strong> Gebiet. Die alten Weiherböden werden heute, sofern nicht Streuwiesen (4) oder<br />
Waldflächen (1), landwirtschaftlich intensiv genutzt (8). Sie stellen ein Potenzial zur<br />
Entwicklung weiterer Stillgewässer und Biotopflächen dar. Die historischen Weiher<br />
standorte sind in der folgenden Karte dargestellt.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 21<br />
Abb. 13: Karte historischer Weiherstandorte<br />
3.32 Fließgewässer<br />
Die größeren (Obere Argen) und kleineren Fließgewässer (Schwarzenbach,<br />
Moosbach, Zipfelgraben, Wiesenbach, etc.) <strong>im</strong> Gebiet stellen wichtige Biotopverbundachsen<br />
in der Landschaft dar. Die Argen besitzt dabei überregionale<br />
Bedeutung für den Biotopverbund zwischen dem Bodenseebecken, dem Westallgäuer<br />
Hügelland und dem Voralpengebiet. Die vorhandenen Gehölzsäume<br />
entlang der Fließgewässer tragen zur Gliederung des Landschaftsbildes bei. Die<br />
Fließgewässer wurden in der Vergangenheit über weite Strecken ausgebaut und<br />
begradigt. Nur wenige Abschnitte weisen insgesamt noch einen naturnahen Verlauf<br />
auf. Die Durchgängigkeit der Gewässer ist nur auf Teilstrecken gegeben. Die<br />
Obere Argen ist bei Hilpertshofen aufgrund <strong>eines</strong> Wehres nicht durchgängig.<br />
Moosbach und Zipfelgraben sind über kürzere Abschnitte sogar verrohrt.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 22<br />
3.40 Moore, Nass- und Streuwiesen<br />
Das geplante Landschaftsschutzgebiet zeichnet sich durch eine hohe Dichte an<br />
Moorstandorten mit den moortypischen Lebensräumen aus. Die Nass- und Streuwiesen<br />
als Teil dieser Moorstandorte stellen Lebensräume für zahlreiche gefährdete<br />
Tier- und Pflanzenarten dar. Aufgrund der in diesem Raum außerordentlich engen<br />
Verzahnung der Feuchtgebiete z.B. <strong>im</strong> Bereich Kolbenmoos-Wolfgangweiher-<br />
Schwarzensee–Elitzer See finden sich hier noch Vorkommen von Arten die in weiten<br />
Teilen von Oberschwaben und Westallgäu bereits ausgestorben sind.<br />
Abb. 14: links Blick auf den Moorstandort Kolbenmoos, rechts typische Nass- und Streuwiese mit<br />
Trollblumen und Orchideen<br />
3.50 Steillagen, Streuobstwiesen<br />
Extensiver genutzte Grünlandstandorte wie beweidete Steillagen finden sich nur an<br />
den Talhängen der Oberen Argen und teilweise an Drumlins. Streuobstwiesen<br />
finden sich <strong>im</strong> geplanten LSG noch häufig, vor allem um Einzelgehöfte und Weiler<br />
und sind teilweise landschaftsbildprägend.<br />
Abb. 15: links Blick auf beweideten Drumlinhang, rechts landschaftsbildprägende Streuobstwiese<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 23<br />
3.60 Tier- und Pflanzenwelt<br />
Das Gebiet zeichnet sich durch eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt vor allem<br />
der Moorgebiete und der Gewässer aus. Im Folgenden wird das Vorkommen<br />
einiger naturschutzfachlich wertvoller Artengruppen und Arten dokumentiert.<br />
3.61 Flora<br />
Allein für das Naturschutzgebiet Rotasweiher-Degermoos sind ebenso wie für das<br />
geplante Naturschutzgebiet Wolfgangweiher-Kolbenmoos-Schwarzensee über 250<br />
Arten höherer Pflanzen nachgewiesen. Davon stehen mehr als 30 Arten auf der<br />
Roten Liste der gefährdeten Arten. Darunter sind auch stark gefährdete Arten und<br />
floristische Besonderheiten der Kleinseggen-Rieder und Pfeifengras-Streuwiesen wie<br />
Mehlpr<strong>im</strong>el (Pr<strong>im</strong>ula farinosa), Lungenenzian (Gentiana pneumonanthe), Sibirische<br />
Schwertlilie (Iris sibirica), Kl<strong>eines</strong> Knabenkraut (Orchis morio) und Glanzstendel<br />
(Liparis loeselii).<br />
Abb. 16: links Mehlpr<strong>im</strong>el, rechts Kl<strong>eines</strong> Knabenkraut<br />
3.62 Fauna<br />
Vögel<br />
Eine besonders reichhaltige Vogelwelt findet sich in den Verlandungsbereichen der<br />
Stillgewässer und in den Moorgebieten. Allein <strong>im</strong> Vogelschutzgebiet und geplanten<br />
Naturschutzgebiet Wolfgangweiher-Kolbenmoos-Schwarzensee wurden 168 Arten<br />
beobachtet (v.a durch Mitglieder Naturschutzbund Wangen). Davon sind mehr als<br />
50 Arten regelmäßige Brutvögel <strong>im</strong> Gebiet. Darunter sind auch vom Aussterben<br />
bedrohte bzw. stark gefährdete Arten wie Drossel-Rohrsänger (Acrocephalus<br />
arundinaceus), Tafelente (Aythya ferina), Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana),<br />
Wasserralle (Rallus aquaticus), Zwergdommel (Ixobrychus minutus), Zwergtaucher<br />
(Tachybaptus ruficollis) und der Nahrungsgast Eisvogel (Alcedo atthis). Das Gebiet<br />
ist außerdem ein wichtiges Nahrungs- und Rastquartier durchziehender Vögel.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 24<br />
Amphibien, Reptilien<br />
Bei den Amphibien und Reptilien gibt es u.a. Nachweise von Gelbbauchunke<br />
(Bombina variegata), Laubfrosch (Hyla arborea), Kreuzotter (Vipera berus) und<br />
Ringelnatter (Natrix natrix).<br />
Schmetterlinge<br />
Besonders über die Tagfalter des Gebiets liegen einige Daten vor. Stark gefährdete<br />
Arten die <strong>im</strong> Gebiet vorkommen sind z.B. Goldener Scheckenfalter (Eurodryas<br />
aurinia), Hochmoos-Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris) und der Lungenenzian-<br />
Ameisenbläuling (Maculinea alcon). Auch der vom Aussterben bedrohte Heilziest-<br />
Dickkopffalter (Carcharodus flocciferus) kommt <strong>im</strong> Gebiet vor.<br />
Heuschrecken<br />
Bei den Heuschrecken kommen z.B. die gefährdeten Arten Sumpf-Grashüpfer<br />
(Chortippus montanus), Sumpf-Schrecke (Stethophyma grossum) und Warzenbeißer<br />
(Decticus verrucivorus) als wertgebende Arten vor.<br />
Libellen<br />
Bei den Libellen kommen ebenfalls vom Aussterben bedrohte bzw. stark gefährdete<br />
Arten wie Kleine Binsenjungfer (Lestes virens vestalis), Kleine Moosjungfer<br />
(Leucorrhinia dubia) und Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) vor.<br />
Muscheln<br />
Als bemerkenswerteste Art der Fließgewässer ist das Vorkommen der vom<br />
Aussterben bedrohten Kleinen Flußmuschel (Unio crassus) <strong>im</strong> Schwarzenbach<br />
anzusehen. Für den Schwarzenbach existiert ein Gewässerunterhaltungsplan (Fürst,<br />
2002), der besonders das Vorkommen der Bachmuschel berücksichtigt.<br />
3.70 Wälder, Gehölzbestandene Biotope<br />
Das Gebiet zeichnet sich durch einen insgesamt geringen Waldanteil aus, der auf<br />
viele kleinere Waldflächen verteilt ist. Große zusammenhängende Waldflächen<br />
finden sich nicht. Die Waldflächen werden von der Fichte dominiert. Der<br />
landschaftliche Reiz liegt in der Verteilung der Waldflächen, die die Landschaft<br />
gliedern und dadurch kleinteilig und vielgestaltig erscheinen lassen.<br />
Hecken und Feldgehölze sind <strong>im</strong> Gebiet eher wenig zu finden. Sie sind aber z.B.<br />
entlang Fließgewässern ein wichtiges die Landschaft gliederndes Element.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 25<br />
3.80 Kulturlandschaftselemente<br />
Die (Kultur-)Landschaft ist durch die (landwirtschaftliche) Nutzung des Menschen in<br />
der Vergangenheit geprägt. Neben den Streuwiesen und Streuobstwiesen gehören<br />
auch die <strong>im</strong> Mittelalter angelegten Weiher dazu. Kleinere Sehenswürdigkeiten und<br />
Kulturdenkmale sind Kapellen, Kreuze und Bildstöcke in der Feldflur aber auch alte<br />
Mühlen an Fließgewässern wie z.B. am Schwarzenbach. Erwähnenswert ist die<br />
Nikolauskapelle in Untermooweiler. Sie ist der älteste sakrale Bau in Wangen und<br />
wurde <strong>im</strong> romanischen Stil erbaut.<br />
Abb. 17: links Nikolauskapelle Untermooweiler, rechts Feldkreuz bei Obermooweiler<br />
4.00 Schutzbedürftigkeit, Gefährdungen<br />
Die besondere Schutzbedürftigkeit des noch naturnahen Landschaftsraums liegt vor<br />
allem in seiner Empfindlichkeit gegenüber Änderungen in der landwirtschaftlichen<br />
Flächennutzung. Durch großflächige Intensivierung und Umbruch, aber auch durch<br />
Nutzungsaufgabe gehen Kleinräumigkeit und Strukturreichtum verloren.<br />
4.10 Gefährdungen, Vorbelastungen des Landschaftsbildes<br />
Vorbelastungen hinsichtlich des Landschaftsbildes bestehen durch die vorhandenen<br />
Stromleitungen, die in Zusammenhang mit dem 380 kV Umspannwerk Obermooweiler<br />
stehen, durch das Entsorgungszentrum Obermooweiler mit dem<br />
Deponiestandort und durch einzelne Siedlungsteile wie das landschaftlich<br />
exponierte Neuravensburg-Berg.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 26<br />
Abb. 18: links 380 kV Stromleitung, rechts exponierter Siedlungsteil Neuravensburg-Berg<br />
Gefährdungen für das Landschaftsbild bestehen vor allem durch Veränderungen in<br />
der landwirtschaftlichen Flächennutzung. Vor allem der Umbruch von traditionellen<br />
Grünlandstandorten wie Drumlins oder vermoorten Senken zu Ackerland und<br />
insbesondere zu Maisäckern wirkt sich hier am gravierendsten aus. Aber auch die<br />
weitere Intensivierung von Feuchtgrünland, vermoorten Senken und Kuppen oder<br />
Hangflächen <strong>im</strong> Bereich der Drumlins, die Aufgabe und Beseitigung von Streuobstbeständen<br />
und von Kleinstrukturen in der Landschaft, und die Nutzungsaufgabe<br />
und Verbuschung von extensiv genutzten Standorten in der Landschaft wirken sich<br />
unmittelbar auf das Landschaftsbild aus.<br />
Abb. 19: Anlage von Ackerflächen auf Drumlin und in teils anmooriger Senke bei Roggenzell<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 27<br />
4.20 Gefährdungen Gewässer<br />
Gefährdungen und Beeinträchtigungen für Fließ- und Stillgewässer bestehen v.a.<br />
durch eine veränderte Gewässerbewirtschaftung und durch Eutrophierung aufgrund<br />
einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung <strong>im</strong> Einzugsgebiet. Eutrophierung<br />
durch Düngereintrag begünstigt in den Stillgewässern eine größere Menge<br />
an Biomasse, die wiederum Verschlammung und Verlandung des Gewässers<br />
fördern. Dies führt zu einem Rückgang der Wasserpflanzenbestände und wirkt sich<br />
zusammen mit anderen Faktoren wie Störungsdruck durch Angler, Badegäste, etc.<br />
verarmend auf die Wasservogelfauna aus.<br />
Defizite für die Fließgewässer ergeben sich hinsichtlich der Gewässergüte vor allem<br />
durch eine intensive Landbewirtschaftung mit ungenügendem Abstand zu den<br />
Gewässerläufen, durch die Entwässerung von Moorflächen und durch einen<br />
naturfernen Ausbau der Gewässer in der Vergangenheit.<br />
4.30 Gefährdung der Nass- und Streuwiesen, Moore<br />
In der Vergangenheit waren vor allem Entwässerung und nachfolgende<br />
Nutzungsintensivierung die Hauptgefährdungsursachen für die Moore. Heute<br />
müssen vor allem die Nutzungsaufgabe und die Eutrophierung (Nährstoffeintrag<br />
aus benachbarten Flächen und evtl. aus der Luft) als wichtigste Gefährdungsursachen<br />
angesehen werden.<br />
Die grundlegenden Veränderungen und Beeinträchtigungen der Moore vor allem<br />
durch Entwässerung und (Teil-)Abtorfung geschahen bereits in den letzten beiden<br />
Jahrhunderten. Durch Entwässerungen und der damit verbundenen Grundwasserabsenkung<br />
kommt es zu Moorsackungen und zu einer Mineralisation der<br />
Moorböden sowie zu begrenzter lokaler Moorversauerung. Die Nieder- und<br />
Anmoore verlieren dadurch ihre Speichereigenschaften bzw. Durchlässigkeit. Die<br />
Beeinträchtigung z. B. des Wasserhaushalts dauert bis heute an. Nur durch eine<br />
Wiedervernässung können die Moorflächen regeneriert werden. Das Potenzial für<br />
eine Regeneration entwässerter Moorstandorte <strong>im</strong> Gebiet liegt bei ca. 150 ha.<br />
Die Nass- und Streuwiesen sind durch Nutzungsaufgabe, die in der Regel zu einer<br />
Verbuschung der Flächen führt, gefährdet. Eine Gefährdung stellt auch die<br />
Eutrophierung der Flächen vor allem durch intensive Düngung angrenzender<br />
Wirtschaftsgrünlandflächen dar. Die intensive Landnutzung führt zu einer<br />
Nivellierung der Standortunterschiede und zum Rückgang der für die Pflanzen- und<br />
Tierwelt und für das Landschaftsbild wichtigen Übergangsbereiche (Ökotone).<br />
4.40 Gefährdung der Steillagen und Streuobstwiesen<br />
Die offenen Steillagen sind gefährdet durch weitere Intensivierung des<br />
Düngereinsatzes auf diesen Flächen und durch Aufforstung dieser Flächen.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 28<br />
Die Streuobstwiesen sind durch fehlende Pflege und Nachpflanzung gefährdet, was<br />
auch eine Folge der Unwirtschaftlichkeit der Nutzung des Streuobsts ist.<br />
4.50 Gefährdungen Pflanzen- und Tierwelt<br />
Der Landschaftsausschnitt bietet einer großen Anzahl von Tier- und Pflanzenarten<br />
Lebensraum. In der jüngsten Vergangenheit sind bei vielen Arten die Bestände<br />
innerhalb weniger Jahre stark zurückgegangen, so dass mit ihrem Aussterben schon<br />
kurzfristig oder doch mittelfristig zu rechnen ist. Die bisherigen Maßnahmen des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege konnten diesen Trend nicht stoppen. Die<br />
Ursachen dieser Entwicklung sind:<br />
Lebensraumverlust<br />
Nach ABT (1991) gingen <strong>im</strong> württembergischen Allgäu die Streuwiesenflächen seit<br />
etwa 1950 um ca. 80% zurück. Die ehemaligen Streuwiesen wurden überwiegend<br />
in Intensivgrünland umgewandelt. Teilweise fielen die Flächen auch brach oder<br />
wurden aufgeforstet. Durch den Rückgang und die Verkleinerung der Streuwiesen<br />
hat sich das Verhältnis zwischen Fläche und Umfang als Maß für Randeffekte<br />
deutlich verschlechtert.<br />
Auch aufgegebene Nutzungsformen wie die Handtorfstiche oder die Streuegewinnung<br />
an den Ufern der Weihen und Seen führten zu Lebensraumverlusten.<br />
Durch die Aufgabe der Nutzung verschilften und verbuschten diese Flächen.<br />
Mindestlebensraumgrößen / Verinselung<br />
Bestände von Tier- und Pflanzenarten können nur dann langfristig überleben wenn<br />
Ihr Lebensraum eine ausreichende Größe aufweist, bzw. ein Austausch mit anderen<br />
Lebensräumen möglich ist. Viele Arten reagieren auf eintretende Gefährdungsfaktoren<br />
erst mit einiger Verzögerung, z. B. bei Unterschreiten der für stabile<br />
Bestände erforderlichen Mindestlebensraumgrößen und/oder Mindestvernetzung.<br />
(Verinselung, Zerschneidung). Das Min<strong>im</strong>umareal für z.B. Populationen von Tagfaltern<br />
liegt bei 3 ha, bei Heuschrecken bei 1 ha.<br />
Die Erhaltung und Vernetzung der Nass- und Streuwiesen und die Regeneration von<br />
Streuwiesenflächen ist für die Erhaltung der typischen Tier- und Pflanzenwelt dieser<br />
Lebensräume von entscheidender Bedeutung. Die folgende Abbildung zeigt als<br />
Beispiel Potenzialflächen für die Wiedervernässung von An- und Niedermoorflächen.<br />
Allein <strong>im</strong> Gebiet des geplanten LSG ergaben sich dabei ca. 140 ha.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 29<br />
Abb. 20: Potenzialflächen für die Wiedervernässung von intensivierten Moorflächen<br />
4.60 Gefährdung der Wälder<br />
In der Vergangenheit wurden monostrukturierte Fichtenwälder bevorzugt. Diese<br />
zeichnen sich durch Artenarmut aus. Die Standortbedingungen wurden oft nur<br />
unzureichend berücksichtigt, z.B. bei Moorwäldern die entwässert und in Fichtenwälder<br />
umgewandelt wurden, oder entlang Gewässern wo Fichten bis an die<br />
Gewässerränder gepflanzt wurden.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 30<br />
Abb. 21: Fichtenwald in kuppiger Lage<br />
5.00 Schutzzweck und Schutzziele<br />
Ziel des LSG ist die Erhaltung einer offenen, abwechslungs- und strukturreichen<br />
Kulturlandschaft.<br />
5.10 Allgemeiner Schutzzweck<br />
Wesentliche Schutzzwecke für dieses Landschaftsschutzgebiet sind:<br />
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft zu erhalten und<br />
wieder herzustellen und die Leistungsfähigkeit, Regenerationsfähigkeit und nachhaltige<br />
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter zu erhalten und wieder herzustellen. Damit<br />
sind insbesondere gemeint:<br />
- die Erhaltung und Wiederherstellung als Gebiet von besonderer landschaftlicher<br />
Schönheit mit hoher Dichte landschaftsbildprägender Bestandteile wie<br />
freier und unverbauter Drumlins, Moore, Stillgewässer, Fließgewässer und<br />
Streuobstwiesen.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 31<br />
- die Erhaltung als kulturhistorisches Zeugnis einer jahrhundertealten Weiherwirtschaft<br />
und extensiver Grünlandbewirtschaftung von Nass- und Streuwiesen,<br />
Hangweiden und Streuobstwiesen.<br />
- die Erhaltung und Entwicklung als Gebiet mit hohem Erholungswert für eine<br />
naturnahe und sanfte Erholung.<br />
- die Erhaltung und Wiederherstellung als Lebensraum für eine artenreiche<br />
Flora und Fauna, insbesondere für spezialisierte Arten die auf nicht oder<br />
extensiv genutzte Flächen angewiesen sind.<br />
- die Erhaltung als wichtiger Bestandteil <strong>im</strong> Lebensraumverbund von Feuchtgebieten<br />
<strong>im</strong> württembergischen Allgäu.<br />
- die Erhaltung und Wiederherstellung als Landschaftsraum mit hoher Dichte<br />
an entwicklungsfähigen bzw. regenerierbaren Standorten wie Mooren,<br />
Stillgewässern und Steillagen der Moränen.<br />
- Die Erhaltung und Wiederherstellung von naturnahen Fließ- und<br />
Stillgewässern.<br />
5.20 Schutzziele<br />
Schutzziele für das Landschaftsbild<br />
Die Erhaltung und Wiederherstellung aller landschaftsbildrelevanten Strukturelemente<br />
der Jungmoränenlandschaft, wie Moore und Feuchtgebiete, naturnahen<br />
Stillgewässern, extensiv genutzten Grünland-Steillagen, Streuobstwiesen und<br />
gehölzbestandenen Bachläufe, etc. und die Erhaltung der offenen und unverbauten<br />
Drumlins als Kennzeichen für die Identität und Maßstäblichkeit des<br />
Landschaftsbildes<br />
Schutzziele für die Weiher und Seen<br />
Die Anpassung der Gewässerbewirtschaftung und der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
<strong>im</strong> Einzugsgebiet an die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit<br />
der Gewässer.<br />
Schutzziele für die Fließgewässer<br />
Eine naturnahe Gewässerentwicklung und eine extensive landwirtschaftliche<br />
Nutzung der Uferrandstreifen und der begleitenden Gewässeraue.<br />
Schutzziele für die Nass- und Streuwiesen und die Moore<br />
Die Erhaltung und Wiederherstellung der Nass- und Streuwiesen durch geeignete<br />
Nutzung und Pflege und Erhaltung der standörtlichen Bedingungen; die Anpassung<br />
der Nutzung der Moorstandorte an die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige<br />
Nutzungsfähigkeit des Standorts; die Verbesserung der Moorwasserhaushalte durch<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 32<br />
Wiedervernässung u.a. zur Wasserrückhaltung in der Landschaft und zur<br />
Erweiterung wassergebundener Lebensräume<br />
Schutzziele für die offenen Grünlandstandorte<br />
Die Erhaltung nicht bewaldeter Steillagenflächen als landschaftsbildprägende Landschaftsbestandteile;<br />
die Erhaltung und Wiederherstellung von Streuobstwiesen, die<br />
Erhaltung von Feldrainen und Böschungen.<br />
Schutzziele für die Wälder<br />
Die nachhaltige Erhaltung und Wiederherstellung bestehender Waldbiotope; die<br />
Wiedervernässung von Moorwäldern; die Anpassung der forstlichen Nutzung an die<br />
standörtlichen Bedingungen und die Erhaltung und Entwicklung artenreicher Waldbestände.<br />
5.30 Verbote und Erlaubnisvorbehalte<br />
In der <strong>Landschaftsschutzgebiets</strong>verordnung bedürfen Handlungen die den<br />
Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen<br />
können der Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde. Die in Verordnungen<br />
üblichen Erlaubnisvorbehalte umfassen in der Regel nicht Änderungen der<br />
landwirtschaftlichen Flächennutzungen.<br />
Änderungen der landwirtschaftlichen Flächennutzung, z.B. großflächiger<br />
Grünlandumbruch können den Charakter des Gebietes erheblich ändern und sind<br />
bisher durch eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung zulässig.<br />
Nach §5 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 hat die landwirtschaftliche<br />
Nutzung standortangepasst zu erfolgen, Landschaftselemente sollen erhalten und<br />
vermehrt werden.<br />
Es wird vorgeschlagen den Grünlandumbruch generell unter Erlaubnisvorbehalt zu<br />
stellen und nur bei standortangepasster Nutzung zu erteilen. Hierfür wären nachvollziehbare<br />
und transparente Kriterien aufzustellen, z.B. kein Grünlandumbruch auf<br />
Moorböden, entlang Gewässern, auf landschaftsbildprägenden Drumlins und auf<br />
Hangflächen ab einer best<strong>im</strong>mten Hangneigung.<br />
Der Erlaubnisvorbehalt für die Beseitigung oder Änderung von Landschaftselementen<br />
sollte auch Streuobstwiesen und kleinere Landschaftselemente wie<br />
Feldraine umfassen.<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 33<br />
6.00 Anhang<br />
6.10 Literatur<br />
ABT, KARLHEINZ (1991): Landschaftsökologische Auswirkungen des Agrarstrukturwandels<br />
<strong>im</strong> württembergischen Allgäu, Verlag Dr. Kovac Hamburg<br />
AHNERT, F. (1996): Einführung in die Geomorphologie, Stuttgart<br />
ALPENFORSCHUNGSINSTITUT (2000): Entwicklungskonzept Westallgäuer Hügelland –<br />
Synergieeffekte Landschaftsschutz, Landwirtschaft und Tourismus<br />
BANZHAF, ROLAND (1999): Würdigung des geplanten Naturschutzgebietes<br />
“Wolfgangweiher-Kolbenmoos-Schwarzensee“, <strong>im</strong> Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz<br />
und Landschaftspflege Tübingen, unveröffentlicht<br />
BANZHAF, R. und WOLL, A. (2003): Projekt Landschaftsanalyse und Leitbildentwicklung<br />
Württembergisches Allgäu südlich der Argen, <strong>im</strong> Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz<br />
und Landschaftspflege Tübingen, unveröffentlicht<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND<br />
FORSTEN (1994): Planung von lokalen Biotopverbundsystemen, Band 1: Grundlagen und<br />
Methoden; Schriftenreihe Materialien zur Ländlichen Entwicklung 31/1994<br />
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND<br />
FORSTEN (1994): Planung von lokalen Biotopverbundsystemen, Band 2: Anwendung in<br />
der Praxis; Schriftenreihe Materialien zur Ländlichen Entwicklung 32/1996;<br />
BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE TÜBINGEN (1998):<br />
Würdigung NSG Neuravenbsurger Weiher, unveröffentlicht<br />
BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE TÜBINGEN (1991):<br />
Würdigung NSG Rotasweiher-Degermoos, unveröffentlicht<br />
DECHERT, CH. und G. (1994): Pflegekonzeption NSG Rotasweiher-Degermoos, <strong>im</strong><br />
Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen, unveröffentlicht<br />
DETZEL, PETER (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs, Eugen Ulmer Verlag<br />
DURWEN, K.-J., F. WELLER, CHR. TILK, H. BECK, A. BEUTTLER und S. KLEIN, 1996:<br />
Digitaler Landschaftsökologischer Atlas Baden-Württemberg. IAF, Ministerium Ländlicher<br />
Raum u. Umweltministerium B.-W. (Hrsg.): CD-Rom mit 37 Karten (1 : 200.000), 50 S.<br />
Hypertext, 21 Tab., 2 Abb. sowie Booklet<br />
EBERT, GÜNTHER (1993): Die Tagfalter Baden-Württembergs, Band 1: Tagfalter I; Eugen<br />
Ulmer Verlag<br />
EBERT, GÜNTHER (1993): Die Tagfalter Baden-Württembergs, Band 2: Tagfalter II; Eugen<br />
Ulmer Verlag<br />
FÜRST, JOACHIM (2002): Gewässerunterhaltungspläne für Steinenbach, ……,<br />
Schwarzenbach, … und Argenseebach – unter besonderer Berücksichtigung der Kleinen<br />
Flussmuschel, <strong>im</strong> Auftrag der PRO REGIO Oberschwaben GmbH; unveröffentlicht<br />
GEWÄSSERDIREKTION DONAU/BODENSEE, BEREICH RAVENSBURG (2000): Entwurf<br />
Gewässerentwicklungskonzept Argen, unveröffentlicht<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 34<br />
HACK, SAPPER, WOLL (1990): Biotopvernetzungskonzept Wangen-Kolbenmoos; <strong>im</strong><br />
Auftrag der Stadt Wangen, unveröffentlicht<br />
KOBERT, RALF (1991): Das geplante Naturschutzgebiet Neuravensburger Weiher, <strong>im</strong><br />
Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen, unver-öffentlicht<br />
KONOLD, WERNER (1987): Oberschwäbische Weiher und Seen, Teil I - Geschichte -<br />
Kultur. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 52(1), Karlsruhe<br />
SEIFFERT, PETER, K. SCHWINEKÖPER und W. KONOLD, W. (1994): Analyse und<br />
Entwicklung von Kulturlandschaften, Das Beispiel Westallgäuer Hügelland;<br />
Umweltforschung in Baden Württemberg, Ecomed-Verlagsgesellschaft<br />
STERNBERG, KLAUS und R. BUCHWALD (2000a): Die Libellen Baden Württembergs,<br />
Band 1 Allgemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera); Verlag Eugen Ulmer<br />
- (2000b): Die Libellen Baden Württembergs, Band 2 Großlibellen (Anisoptera), Literatur;<br />
Verlag Eugen Ulmer<br />
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT WANGEN, ACHBERG UND AMTZELL (2003)<br />
Landschaftsplan, Bearbeitung: Schmelzer und Friedemann<br />
6.20 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen<br />
Tab. 2: Die Standortskomplexe nach der agrarökologischen Gliederung<br />
Tab. 2: Geplante Naturschutzgebiete<br />
Tab. 3: Übersicht über die geschützten Gebiete (Überlagerungen möglich)<br />
Tab. 4: Flächenanteile Nutzungen<br />
Tab. 5: Änderung der Hauptnutzungsarten in der Gemeinde Wangen<br />
Abb. 1: Abgrenzung des LSG und Übersicht agrarökologische Gliederung<br />
Abb. 2: Blick über die Drumlinlandschaft südlich Roggenzell<br />
Abb. 3: Hochmoor-, Niedermoor- und Anmoorstandorte<br />
Abb. 4: links Schwarzenbach bei Obermooweiler und rechts Obere Argen bei Hiltensweiler<br />
Abb. 5: Bestehende und geplante Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,<br />
geschützte Biotope und NATURA 2000-Gebiete<br />
Abb. 6: Ackerflächen auf ehemaligem Grünlandstandort bei Roggenzell<br />
Abb. 7: Waldflächen an Drumlinrücken und in Senke bei Dorreite<br />
Abb. 8: Flächennutzungen <strong>im</strong> geplanten LSG<br />
Abb. 9: Blick in die Hügellandschaft bei Neuravensburg mit den Alpen <strong>im</strong> Hintergrund<br />
Abb. 10: Radfahrer zwischen Wangen und Herzmanns und Pferdeweide bei<br />
Untermooweiler<br />
Abb. 11: links Schwarzensee und rechts Senke mit Elitzer See<br />
Abb. 12: links Neuravensburger Weiher, rechts Hüttenweiler Weiher<br />
Abb. 13: Karte historischer Weiherstandorte<br />
Abb. 14: links Blick auf den Moorstandort Kolbenmoos, rechts typische Nass- und<br />
Streuwiese mit Trollblumen und Orchideen<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010
<strong>Ausweisung</strong> <strong>eines</strong> Landschaftsschutzgebietes südlich Wangen <strong>im</strong> Allgäu - Würdigung Seite 35<br />
Abb. 15: links Blick auf beweideten Drumlinhang, rechts landschaftsbildprägende<br />
Streuobstwiese<br />
Abb. 16: links Mehlpr<strong>im</strong>el, rechts Kl<strong>eines</strong> Knabenkraut<br />
Abb. 17: links Nikolauskapelle Untermooweiler, rechts Feldkreuz bei Obermooweiler<br />
Abb. 18: links 380 kV Stromleitung, rechts exponierter Siedlungsteil Neuravensburg-Berg<br />
Abb. 19: Anlage von Ackerflächen auf Drumlin und in teils anmooriger Senke bei<br />
Roggenzell<br />
Abb. 20: Potenzialflächen für die Wiedervernässung von intensivierten Moorflächen<br />
Abb. 21: Fichtenwald in kuppiger Lage<br />
6.30 Anlagen Karten<br />
Karte 1 Abgrenzungsvorschlag Landschaftsschutzgebiet und Agrarökologische<br />
Gliederung<br />
Karte 2 Moorstandorte nach Göttlich<br />
Karte 3 Geschützte Flächen und Schutzgebiete<br />
Karte 4 Flächennutzungen<br />
Karte 5 Historische Weiherstandorte<br />
Karte 6 Potenzialflächen Wiedervernässung<br />
Landschaftsarchitekt Armin Woll Juli 2010