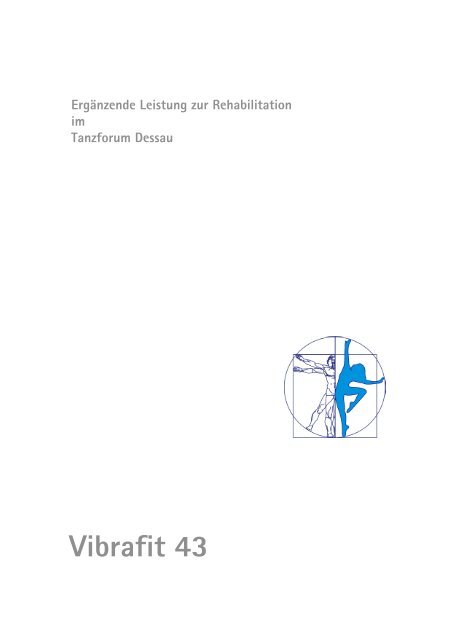Vibrafit 43 - Tanzforum Dessau
Vibrafit 43 - Tanzforum Dessau
Vibrafit 43 - Tanzforum Dessau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ergänzende Leistung zur Rehabilitation<br />
im<br />
<strong>Tanzforum</strong> <strong>Dessau</strong><br />
<strong>Vibrafit</strong> <strong>43</strong>
© <strong>Tanzforum</strong> <strong>Dessau</strong> 2010<br />
Beratung und Begleitung: Dr. med. Lutz Vogel. Facharzt für Orthopädie. Sportmedizin u. Chirotherapie
Angebot als ergänzende Leistung zur Rehabilitation nach § <strong>43</strong> SGB V<br />
Thema: Senkung der Sturzneigung zur Verringerung des Frakturrisikos bei Osteoporosepatienten<br />
durch Vibrationstraining.<br />
Bedarf: Nach Informationen des Kuratoriums für Knochengesundheit e. V, leiden<br />
bereits 5 - 7 Millionen Deutsche an Knochenschwund. Vor allem Frauen nach<br />
der Menopause sind betroffen. Sie machen 8o% der Osteoporosepatienten<br />
aus. Nach vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der durch Behandlung der<br />
Spätfolgen entstandene volkswirtschaftliche Schaden allein in Deutschland<br />
auf 5 Mrd. Euro pro Jahr.<br />
Zielgruppe: Postmenopausale Frauen ( 65 - 80 Jahre ) und männliche Osteoporosepatienten<br />
mit Bewegungsdefiziten durch erhöhtes Sturzrisiko.<br />
Ziel: Positive Beeinflussung (Steigerung) der Knochendichte, sowie Verbesserung<br />
des neuromuskulären Funktionszustandes zur Senkung der Sturzneigung und<br />
damit des Frakturrisikos bei Osteoporosepatienten.<br />
Inhalt: gründliche Anamnese, Basisuntersuchung, Grundparameter erheben. Ausschluss<br />
von Kontraindikationen Erläuterung des <strong>Vibrafit</strong>prinzips Motivation<br />
zur allgemeinen Bewegungsstimulation zur weiteren Risikoverringerung.<br />
Methodik: fallindizierte Einzelberatung und Einzel-Training in Zusammenarbeit mit dem<br />
Orthopäden Dr. med Lutz Vogel und dem Diplomsportlehrer Andreas Meyer.<br />
24 Einheiten inkl. Eingangs- und Abschlussbeurteilung a 20 min.<br />
Das Trainingsprogramm wird über 4 Stufen hinsichtlich der Übungsdauer<br />
und -intensität gesteigert bzw. angepasst und dokumentiert.Trainingsprinzipien<br />
vom Einfachen zum Speziellen, von der Muskelgruppe zum Muskel<br />
vom Statischen zum Dynamischen.<br />
Preis: 24 Einheiten a 12,- Euro = 288,- Euro<br />
Anlagen: Berliner BedRest Studie - Prof. Dr. med Dieter Felsenberg, Charite Berlin<br />
2004<br />
Einfluß von 6 Monaten Vibrationstraining auf die Knochendichte am<br />
gesunden Menschen - Steven Boonen, Universität Leuven 2004<br />
Mögliche Einflussfaktoren von Vibrationstraining - Y. Haleva Sporthochschule<br />
Köln 2005<br />
Einfluß von Ganzkörpervibration auf das Frakturrisiko - Stengel, Kemmler,<br />
Engelke, Kalender Universität Erlangen<br />
Die Erlanger Längsschnitt Vibrations-Studie (ELVIS)<br />
Simon von Stengel, Wolfgang Kemmler, Klaus Engelke, Willi A. Kalender<br />
Osteoporoseforschungszentrum am Institut für Medizinische Physik
ft,^<br />
(cr-r AnrrE (SlMpus BENJAMTN FRANKLTN<br />
\--,<br />
Kontakt:<br />
lnes Landschek, Tel.: 030 - 8554 47 <strong>43</strong>, Mail: ines.landschek@charite.de<br />
Download aller Texte unter www.medizin.fu-berlin.de/zmUdownload.htm<br />
"^-.*i*:Pg3;,gi<br />
,,Knochen & Muskeln - Neue Welten" eRESSEKoNFERENz 18. November2oo4<br />
2. lnterdisziplinäres Forum mit Workshops<br />
Prof. Dr. med. Dieter Felsenberg, Berlin Statement<br />
Itiiu Die Ergebnisse Berliner BedRest-Studie<br />
Ziel:<br />
Unter simulierter Schwerelosigkeit sollten die Mechanismen, die zu<br />
Muskel- und Knochenschwund führen, untersucht und Strategien zu<br />
ihrer Verhinderung entwickelt werden. Strikte Bettruhe mit streng<br />
limitierter Kraftentwicklung in den unteren Extremitäten stellte dabei<br />
ein geeignetes Modell zur physiologischen Simulation von<br />
Schwerelosigkeit in Bezug auf Arme und Beine dar. Ahnlich wie bei<br />
Astronauten im Weltraum beobachtet, verändert sich unter diesen<br />
Bedingungen nicht nur das Herzkreislaufsystem und der<br />
Flüssigkeitshaushalt, sondern auch der Bewegungsapparat mit<br />
Muskulatur und Knochen.<br />
Schwerpunkte des Forsch ungsprojektes :<br />
o Testung eines Trainingssystems zur Verhinderung des Muskel- und<br />
Knochenabbaus unter simu lierter Schwerelosig keit<br />
. Untersuchung der muskulären Erregbarkeit unter dem Vibrationstraining<br />
. Psychologische Anpassungsfähigkeit in Grenzsituationen<br />
. Einflüsse auf das Gleichgewichtsorgan<br />
e Veränderungen und Anpassungsfähigkeit des Hez-Kreislaufsystems<br />
. Anderung der Muskelzusammensetzung, morphologisch und<br />
histochemisch<br />
. Anderung der Tagesrhythmik des Knochenstoffrruechsels<br />
. Einfluss auf den Calciumhaushalt<br />
. Veränderungen der Thermoregulation<br />
o Messung der Knochenveränderungen mittels Ultraschall<br />
Die 8wöchige Studie zur Überwindung der muskuloskelettalen Defizite bei<br />
einer Langzeitmission in der simulierten Schwerelosigkeit lief zu je fünf<br />
Staffeln im Jahr 2003 erfolgreich. Keine der 20 Probanden - aus einer<br />
sorgfältigen Auswahl von mehr als Tausend Interessenten - hat die Station<br />
vozeitig verlassen.<br />
Die Hälfte der Kontrollpersonen erhielt im Bett ein Muskel-Vibrationstraining<br />
mit dem "Space-Galileo", die andere Hälfte blieb völlig immobil.<br />
Statement - Prof. Dr. med. Dieter Felsenberq
Ergebnisse:<br />
Das wichtigste Ergebnis: Es wurde eine Trainingsmethode entwickelt<br />
und bestätigt, um die Muskeln und Knochen zu erhalten.<br />
llluskelkraft:<br />
Probanden ohne Krafttraining verloren im Einzelfall bis zu 30 Prozent ihrer<br />
Muskelquerschnittsfläche am Unterschenkel. Das ist Ausdruck des<br />
M uskelkraftverlustes wäh rend der achtwöchigen I mmobi I isation.<br />
Bei den Nicht-Trainierenden hatten wir mehr Homogenität erwartet. Sie<br />
verloren aber sehr unterschiedlich an Muskelkraft - zwischen 12 und 25o/o.<br />
Die 10 Probanden, die tägliches Vibrationstraining erhielten, hatten im<br />
Einzelfall sogar einen Gewinn von 8% der Muskelquerschnittsfläche. lm<br />
Durchschnitt verloren sie 9.5% der Muskulatur.<br />
Knochenverlust:<br />
Bei den Trainierenden ist der Knochen bis auf 0,6% erhalten geblieben, bei<br />
den nicht trainierenden Probanden gab es einen durchschnittlichen Verlust<br />
von 4,6To. Einige verloren knapp 2o/o afi Knochenmasse, andere 8%.<br />
Aber: Die Muskulatur und der Knochen erholten sich nach der BedRest-<br />
Phase ziemlich zügig: Die Kraft kommt nach 7 bis 10 Tagen vollständig<br />
zurück - und das OHNE Training.<br />
Knochenmasseverlust und Muskelkraftverlust standen in einer Relation von<br />
0,76. Der Zuwachs an Muskelkraft geht relativ zügig und der Knochen folgt<br />
dem langsam nach.<br />
Damit ist der Zusammenhang zwischen Muskelkraft und Knochenmasse<br />
relativ deutlich: Mit der Muskelkraftsunahme nimmt auch die<br />
Knochenmasse zu.<br />
Die beiden wichtigsten Ergebnisse:<br />
1. Zusammenhang Muskel - Knochen wurde bewiesen.<br />
2. Muskel kann erhalten werden durch Vibrationstraining. Muskel geht<br />
verloren durch Nichtstun.<br />
Muskelzusammensetzun g :<br />
Histologisch konnte gezeigt werden, dass unter dem Vibrationstraining die<br />
Typ ll-Fasern, verantwortlich für die dynamische Muskelkraft, an Querschnitt<br />
und Zahl zugenommen haben. Diese Daten sind belegt mit histologischen<br />
Befunden.<br />
Statement - Prof. Dr. med. Dieter Felsenbero
Bei den Nichttrainierenden konnte nachgewiesen werden, dass der Muskelstofhrechsel<br />
,,heruntergefahren" war. lnsgesamt ist es das beste je<br />
publizierte Ergebnis zum Erhalt von Knochen und Muskeln, das diesen<br />
Zusammenhang so eindeutig festgestellt hat.<br />
Damit konnte die Effizienz des Galileo-Trainings belegt werden. (Während<br />
eines 3-minütigen Trainings wird in etwa die für einen 10.000 m Lauf<br />
erforderliche Anzahl von Muskelzyklen erreicht.)<br />
Thermoregulation:<br />
Wahrscheinlich durch eine Flüssigkeitsverlagerung bedingt, wies die mit<br />
Thermokameras gemessene Temperaturverteilung im Körper nach wenigen<br />
Tagen eine Temperaturabnahme an den Füßen auf.<br />
Sauerctoffaufnahme:<br />
Es konnte gezeigt werden, dass die Sauerstoffaufnahme der Muskulatur<br />
unter dem Training verbessert wurde.<br />
Konsequenzen der Bedrest-Studie für Prävention von Sturzrisiken und<br />
Therapie von Muskel- und Knochenerkrankungen<br />
1. Ein Muskelkraft- und Koordinationstraining ist die wirksamste Prävention<br />
von Stüzen!<br />
2. Bei Osteoporosepatienten muss zur medikamentösen Behandlung immer<br />
ein dem Gesundheitszustand entsprechendes Krafttraining von Rumpf-,<br />
Becken-, Ober- und Unterschenkelmuskulatur dazukommen, um das<br />
Stuz- und damit Frakturrisiko zu vermindern.<br />
3. Es müssen Bewegungsprogramme entwickelt werden, die ein<br />
entsprechendes dynamisches Krafttrain i ng auch fü r 70jäh rige bein halten.<br />
4. Die Krankenkassen sollten diese Präventions- und Bewegungstherapieprogramme<br />
unterstützen.<br />
Offene Fragen<br />
In der Fortsetzung der Berliner BedRest- Studie BBR 2-2 (voraussichtlich im<br />
Jahr 2006) sollen folgende Fragen geklärt werden:<br />
. Nimmt während der lmmobilisation die Gesamtmuskelmasse ab?<br />
. Wie verändern sich Gelenkspalt und -knorpel?<br />
o Wie ist der Knochenabbau verteilt?<br />
. Welchen Einfluss haben spezielle Muskelgene?<br />
r Wie verändert sich das lmmunsystem?<br />
Prof. Dr. med. Dieter Felsenberg<br />
ZMK Zentrum für Muskel- und Knochenforschung<br />
Charit6 - Universitätsmedizin Berlin<br />
Campus Benjamin Franklin<br />
Tel.: 030 / 8445 30 46<br />
Fax: 030 / 8440 99 42<br />
E-Mail: dieter.felsenberg@charite.de<br />
Statement - Prof. Dr. med. Dieter Felsenberg
frnARrrE GMPUS<br />
Kontakt:<br />
lnes Landschek, Tel.: 030 - 8554 47 <strong>43</strong>, Mail: ines.landschek@charite.de<br />
Download aller Texte unter www.medizin-fu-berlin.de/zmUdownload.htm<br />
BENJAMIN FRANKTIN<br />
'"""'**'****tfii,F,<br />
,,Knochen & Muskeln - Neue Welten" tB. bis 20. November2oo4<br />
2. lnterdisziplinäres Forum mit Workshops<br />
Absch I ussberic ht Kong ress<br />
Knochen und Muskeln 2004<br />
Das 2. Interdisziplinäre Forum ,,Knochen und Muskeln - Neue Welten" fand<br />
vom 18. bis 20.11.2004 in Berlin statt. Auf diesem kleinen, aber hochkarätig<br />
besetzten Kongress mit 200 Teilnehmern wurden unter anderem die<br />
Ergebnisse der weltraummedizinischen Studie, die das Zentrum für Muskelund<br />
Knochenforschung (ZMK) in Kooperation mit der ESA durchführte, der<br />
öffentlich keit vorgestel lt u nd mög I iche Konsequenzen dis kutiert.<br />
Die Auswertung der Berliner BedRest-Studie bestätigt die Hypothese, dass das<br />
neuartige Vibrations-Muskel-Trainingssystem, das unter simulierter<br />
Schwerelosigkeit getestet wurde, die im All auftretenden Muskel- und<br />
Knochenatrophien wirksam verhindert. Während der achtwöchigen Bettruhe<br />
verloren die Probanden ohne Krafttraining zwischen 12 und 25 Prozent ihrer<br />
Muskelquerschnittsfläche am Unterschenkel, im Einzelfall bis zu 30 Prozent. Die<br />
10 Probanden, die tägliches Vibrationstraining erhielten, verloren im<br />
Durchschnitt 9,5 Prozent der Muskulatur, hatten allerdings im Einzelfall sogar<br />
einen Gewinn von 8 Prozent der Muskelquerschnittsfläche. Bezüglich des<br />
Knochenverlustes gab es folgende Ergebnisse: Bei den Trainierenden ist<br />
durchschnittlich nur 0,6 Prozent des Knochens abgebaut worden, bei den nicht<br />
trainierenden Probanden gab es einen durchschnittlichen Verlust von 4,6<br />
Prozent.<br />
Knochenmasseverlust und Muskelkraftverlust standen in einer Relation von 0,76.<br />
Nach der BedRest-Phase erholten sich Muskulatur und Knochen ziemlich zügig:<br />
Die Kraft kommt nach 7 bis 10 Tagen vollständig zurück - und das ohne Training.<br />
Der Zuwachs an Muskelkraft geht relativ zügig und der Knochen folgt dem<br />
langsam nach, betonte Prof. Dr. Dieter Felsenberg, der Leiter des ZMK.<br />
Damit wurde der Zusammenhang zwischen Muskelkraft und Knochenmasse<br />
relativ deutlich: Mit der MuskelkrafEunahme nimmt auch die Knochenmasse<br />
zu,<br />
Histologisch konnte gezeigt werden, dass unter dem Vibrationstraining die Typ ll-<br />
Muskelfasern, verantwortlich für die dynamische Muskelkraft, an Querschnitt und<br />
Zahl zugenommen haben. Bei den Nichttrainierenden konnte nachgewiesen<br />
werden, dass der M uskelstoftwechsel,,heru ntergefah ren" war.<br />
Kongressbericht<br />
Konoressbericht - .,Knochen & Muskeln -Neue Welten"
Mit dieser Studie konnte die Effizienz des Galileo-Trainings belegt werden:<br />
Während eines 1-minütigen Trainings wird in etwa die für einen 10.000 m Lauf<br />
erforderliche Anzahl von M uskelbeweg u ngen erreicht.<br />
Konsequenzen für die Prävention von Sturzrisiken<br />
Die Ergebnisse aus der simulierten Raumfahrt werden die Medizin bezüglich der<br />
Knochen- und Muskelerkrankungen beeinflussen. ,,Wir wissen, dass<br />
Vibrationstraining beim jungen Menschen funktioniert. Die wissenschaftlichen<br />
Grundlagen sind also vorhanden. Sind diese Erkenntnisse aber auch auf den<br />
geriatrischen Patienten, z. B. den älteren Menschen mit Knochenschwund zu<br />
übertragen? fragte Felsenberg. Die endgültige Antwort werden weitere Studien<br />
bringen, die das ZMK mit Unterstützung der Bonhoff-Stiftung im Jahre 2005<br />
durchführen wird.<br />
Ebenso innovative wie einfache Methoden der Prädiktion von Stuzrisiken<br />
wurden in den letzten zwei Jahren entwickelt: neuromuskuläre Tests (2.8.<br />
Aufstehtest, Tandemstand) lassen Defizite in der Muskelleistung oder der<br />
Balance erkennen und somit das Stuzrisiko von Patienten einschätzen. Diese<br />
können dann einer vorbeugenden Therapie zugeführt werden. Die wirksamste<br />
Prävention von möglichen Stüzen und zugleich Therapie ist dabei ein effektives<br />
Muskelkraft- und Koordinationstraining, betonte Dr. Martin Runge, Esslingen. Um<br />
das Stuzrisiko zu mindern, müsse - anders als beim Hezkreislauf-Training, bei<br />
dem Ausdauer trainiert wird. zur Reduktion des Stuzrisikos die Muskelkraft<br />
trainiert werden.<br />
Gleichzeitig muss das Zusammenspiel der Muskulatur trainiert werden, um die<br />
Balance und die Koordination zu verbessern.<br />
Eine höhere Muskelkraft ezeugt eine höhere Verformung im Knochen, dadurch<br />
wird Knochen aufgebaut. Alle Störungen der Wahrnehmung, insbesondere die<br />
Einschränkung der Sehfähigkeit, die zu einem Stolpern führt, sollten behandelt<br />
werden.<br />
Felsenberg fasste zusammen :<br />
1. Bei Osteoporosepatienten muss zur medikamentösen Behandlung immer<br />
ein dem Gesundheitszustand entsprechendes Kraftraining von Rumpf-,<br />
Becken-, Ober- und Unterschenkelmuskulatur dazukommen, um das<br />
Stuz- und damit Frakturrisiko zu vermindern.<br />
2. Es müssen Bewegungsprogramme entwickelt werden, die ein<br />
entsprechendes dynamisches Kraftraining auch für 70jährige beinhalten.<br />
3. Die Krankenkassen sollten diese Präventions- und<br />
Bewegungstherapieprogramme unterstützen.<br />
VorausseEunqen für lnteraktion Muskel-Knochen<br />
Auf dem Forum wurden die Zusammenhänge zwischen Biomechanik des<br />
Knochens und hormonellen Einflüssen auf die Interaktion Muskel-Knochen und<br />
Muskeltraining neu diskutiert. Die wissenschaftlichen Grundlagen für die<br />
Anpassung des Knochens sind aber immer noch nicht gänzlich geklärt. In den<br />
60er Jahren des letzten Jahrhunderts beschrieb Harald Frost die Mechanostat-<br />
Kongressbericht - ,,Knochen & Muskeln -Neue $fu|&rt'
Hypothese. Der Mechanostat, wahrscheinlich basiert im Ne?werk der<br />
Osteozyten, misst die Kräfte, die auf den Knochen einwirken und regelt die<br />
Anpassung des Skelettsystems.<br />
Den Einfluss von Hormon-Defiziten beschrieb Dr. Laurant Dukas, Basel, am<br />
Beispiel des Vitamin D-Hormons. Ein Vitamin-D-Hormon-Mangel führt zu<br />
Fallneigung und erhöhter Frakturinzidenz. Abhilfe schaft eine 36wöchige<br />
Therapie mit Alfacalcidol, wobei eine tägliche Einnahme von 500 mg Calcium<br />
vorausgesetzt wird. Die Stuzrate wurde signifikant um 45 Prozent gesenkt. Für<br />
die Stuzreduktion sei eine Vitamin-D-Hormongabe effizienter als die<br />
Östrogengabe. lm übrigen sei bei Niereninsuffizienz bei einer Kreatininclearance<br />
kleiner 65 ml/min immer mit einem erhöhten Stuzrisiko zu rechnen.<br />
Auf dem Forum wurde ebenso gezeigt, wie z. B. die genetisch bedingte<br />
Glasknochenkrankheit bei Kindern, die bereits mit lnfusionen von<br />
Bisphosphonaten behandelt, vom Vibrations-Muskeltraining positiv beeinflusst<br />
werden kann. Über das Muskeltraining sollen Kräfte so vermittelt werden, dass<br />
ein anderes Stoffrrechselniveau erreicht wird, bei dem es gelingt, eine günstigere<br />
Zusammensetzung des Knochens zu ezielen. Langfristig könnte wieder neuer<br />
Knochen aüfgebaut werden. Erste Erfahrungen aus der Universität Köln mit der<br />
erst küzlich begonnenen Studie zur Behandlung von Kindern mit Glasknochen<br />
wurden dargestellt. Wie Dr. Oliver Semler, Köln; ausführte, soll das<br />
Muskelvibrationstraining bei Kindern mit Osteogenesis imperfecta mit Hilfe eines<br />
am Kipptisch befestigten Galileo jeweils zweimal 3 Minuten pro Tag, 6 Monate<br />
lang, bisher nicht stehfähige Kinder zum Stehen und bisher nicht gehfähige<br />
Kinder aus dem Rollstuhl bringen.<br />
Ein weiteres Thema war auch der Zusammenhang zwischen Frakturheilung und<br />
genetischen Einflüssen auf den Knochenstoffirvechsel. Eine Arbeitsgruppe des<br />
Max-Planck-lnstituts für Molekulare Genetik um Prof. Stefan Mundlos berichtete<br />
über ihre Untersuchungen zum Knochenstofhryechsel aus genetischer Sicht,<br />
dabei ging es um Fragestellungen nach speziellen Muskelgenen, genetischen<br />
Konstellationen und Dispositionen.<br />
Einbeziehung von Praktikern<br />
Die Vorstellung zur Osteoporoseprävention und Bewegungstherapie wird sich in<br />
der Praxis verändern müssen, so Felsenberg, das sei die logische Konsequenz<br />
aus der bisherigen Forschung. 80 Physiotherapeuten, Krankengymnasten,<br />
Fitnesstrainer, Sport- und Bewegungstherapeuten waren der Einladung zu einer<br />
offenen Diskussion gefolgt. Das Ziel des Meinungsaustauschs war, gemeinsame<br />
Positionen zu finden, um neueste wissenschaftlich erprobte Trainingskonzepte in<br />
die Praxis der physikalischen Therapie zur Verbesserung der Knochenfestigkeit<br />
zu implementieren, mit dem Ziel, Stuzinzidenzen zu reduzieren bzw. Muskelund<br />
Knochenerkrankungen vozubeugen.<br />
Kongressbericht - ,,Knochen & Muskeln -Neue U,tt$rt'
Der Leiter der Arbeitsgemeinschaft ,,Prävention" des Verbandes der<br />
Physiotherapeuten (ZVK), Günter Lehmann, begrüßte die Zusammenkunft<br />
zwischen Grundlagenwissenschaftlern und Bewegungsanbietern.,,Endlich haben<br />
wir einen wissenschaftlichen Hintergrund, wie Knochen gestärkt werden können."<br />
Er plädierte für eine intensive Zusammenarbeit, um entsprechende Programme,<br />
die besonders die dynamische Muskelkraft bei Alteren stärken, gemeinsam zu<br />
entwickeln. Vertreter aus Fitnessstudios merkten an, dass es nicht nur darum<br />
gehen könnte, die Leute zweimal in der Woche auf den Galileo zu stellen, man<br />
müsse auch die Motivation stärken. Das ginge durch das Gemeinschaftserlebnis<br />
,,Bewegung", durch Musik oder das Training an frischer Luft.<br />
Neben der Erarbeitung spezieller Trainingsprogramme müssten auch die<br />
Bewegungsanbieter qualifiziert werden, was durch die Verbände durch<br />
entsprechende Fortbildungscurricula möglich wäre. Bei Fitnessstudios gäbe es<br />
bisher noch kein Qualitätsmanagement.<br />
,,Das große Interesse signalisiert Handlungsbedarf, ich hatte bisher keine<br />
Ahnung, auf welche Antenne man bei den Physiotherapeuten und<br />
Bewegungsanbietern trifft", so Prof. Felsenberg, für ihn ein positives Erlebnis: 80<br />
lnteressenten signalisierten einen \Mllen zum gemeinschaftlichen Handeln.<br />
Die Diskussion war konkret und konstruktiv, jeder habe die Probleme aus seiner<br />
Sicht beschrieben und die Erwartung geäußert, dass man sich in Zukunft<br />
gemeinschaftlich an einen Tisch setzt und Programme ausarbeitet, die in der<br />
Praxis umgesetzt werden können. ,,Auch wir \Mssenschaftler erhoffen uns<br />
Erkenntnisse über die Umsetzbarkeit der gewonnen Ergebnisse in<br />
Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten und Bewegungsanbietern," so<br />
Felsenberg.<br />
Voraussichtlich im nächsten Jahr wird es ein Treffen aller lnteressensvertreter<br />
der beteiligten Verbände geben, um erste Programme zur Prävention von<br />
Knochenschwu nd auszuarbeiten<br />
In zwei Jahren soll dann der nächste Kongress zum Thema ,,Knochen und<br />
Muskeln-Neue Welten (3)" stattfinden.<br />
,j* b*fr1.+1"4-<br />
lnes Landschek<br />
Media- and PublicRelations<br />
Kongressbericht - ,,Knochen & Muskeln -Neue Welten"
Osteoporose-Prävention m it Ganzkörper-Vi brationstra i n i n g<br />
Wissenschaftlern der Universität Leuven, Belgien, gelang nun in einer jetzt<br />
veröffentlichten Langzeit-Pilotstudie ,,Effect of 6-Month Whole Body<br />
Vibration Training on Bone Density) über sechs Monate der sensationelle<br />
Nachweis, dass Ganzkörper-Vibrationstraining den altersbedingten Abbau<br />
der Knochensubstanz nicht nur verlangsamt oder stoppt, sondern sogar die<br />
Knochendichte wieder erhöht. Das ursprünglich für den Einsatz bei<br />
russischen Weltraummissionen entwickelte Prinzip des Vibrationstrainings<br />
könnte damit die derzeit wirkungsvollste Osteoporose-Prävention<br />
sein.<br />
Nach Informationen des Kuratoriums für Knochengesundheit e.V. leiden<br />
bereits fünf bis sieben Millionen Deutsche an Knochenschwund. Vor allem<br />
Frauen nach der Menopause sind betroffen, sie machen B0 o/o der Osteoporosepatienten<br />
aus. Weltweit sind das rund 200 Millionen Frauen. Nach<br />
vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der durch Behandlung der Spätfolgen<br />
entstehende volkswirtschaftliche Schaden allein in Deutschland auf<br />
fünf Milliarden Euro pro Jahr. Bisher wird vorbeugend zwar vitamin- und<br />
kalziumreiche Ernährung und viel Bewegung empfohlen, aber eine getestete,<br />
erfolgreiche Prophylaxe oder,,Erfolgsgarantie" existiert nicht.<br />
be<br />
Bons Minard Density {BMDI Ergehrisse<br />
Blrrf)-Vsändwung nach 24 Wochcn pro Gruppc<br />
1<br />
E 0,5<br />
o<br />
tr<br />
E0<br />
{tt<br />
fr -0,5<br />
I<br />
Power Plale KraElralning Kontroll<br />
GrupPe<br />
Die vorab im Fachmagazin Journal of Bone and Mineral Research (Volume<br />
19, Nummer 3, 2004) veröffentlichte Studie dauerte 24 Wochen und war<br />
folgendermaßen konzipiert: 70 gesunde, weibliche Probanden im Alter<br />
zwischen 58 bis 74 lahren wurden in drei Gruppen aufgeteilt
(Zufallsprinzip). 25 Personen trainierten auf dem Vibrationsgerät, 22<br />
probanden mit herkömmlichem Krafttraining, 23 Personen dienten als<br />
Kontrollgruppe. Die Vibrations-Gruppe führte dreimal wöchentlich auf<br />
der Vibrationsplattform statische und dynamische Kniebeugen ohne<br />
Zusatzgewicht aus. Dabei wurden die Probanden einer Frequenz von 35<br />
bis 40 Hz bei einer Amplitude zwischen I,7 und 2,5 mm ausgesetzt. Die<br />
konventionelle Krafttrainingsgruppe trainierte dynamisch an der Beinpresse<br />
(Krafttrainingsprogramm mit mäßiger Intensität für Menschen über<br />
60). Die Kontrollgruppe übte während der sechs Monate gar kein Training<br />
aus. Im Eingangs- und Ausgangstest wurde bei allen Probanden die<br />
Knochendichte am Oberschenkelknochen gemessen.<br />
Das erstaunliche Ergebnis: Die Vibrations-Gruppe konnte den altersbedingten<br />
Knochenschwund nicht nur stoppen, sondern über den Versuchszeitraum<br />
von sechs Monaten die Knochendichte sogar um 0,93 o/o erhöhen,<br />
während die Probanden der konventionellen Trainings Trainingsgruppe<br />
0,5!o/o an Knochendichte verloren. Bei der Kontrollgruppe betrug der Rückgang<br />
der Knochendichte 0,620/o. Die medizinische Erklärung für den Erfolg<br />
des Vibrationstrainings liegt in der kombinierten Wirkung der hohen<br />
Frequenz der Vibrationen und der hohen Belastungen, denen die Knochen<br />
ausgesetzt waren.<br />
Aufgrund des großen Erfolgs ihrer Pilotstudie, planen Dr. Sabine Verschueren<br />
und Prof. Dr. Steven Boonen derzeit eine Folgestudie: Ein Jahr lang soll<br />
an über 62-Jährigen untersucht werden, ob mit Vibrationstraining über<br />
einen noch längeren Zeitraum weitere Verbesserungen in Knochendichte<br />
und Muskelaufbau erzielt werden können.<br />
@Red. gesundheit.comiOM-svl
Y. Haleva<br />
Mög I iche Ei nfl ussfaktoren eines Vi brationstrai nin gs auf d ie Maximalkraft,<br />
Schnellkraft, Reaktivität und Kraftausdauer<br />
Die Suche nach neuen und effektiveren Kraftrainingsmethoden hat in den letzten<br />
Jahren verstärkt zugenommen. Mit ausgelöst wurde dies durch den Trend zu immer<br />
kürzeren Trainingszeiten sowie der Forderung nach einem noch effizient Kraftraining.<br />
Dies kann durch Vibrationskraftraining erreicht werden.<br />
In den letzten Jahren wurden mehrere Untersuchungen zur Bestimmung der Belastungsnormative<br />
durchgeführt. Mittels der Literatur sollten in der vorliegenden Arbeit<br />
die Grenzbereiche der Belastbarkeit für die Höhe der Belastungsnormative<br />
Amplitude und Frequenz definiert und Erkenntnisse für das Zusatzgewicht erzielt<br />
werden. Sportwissenschaftler haben unterschiedliche Vibrationsgeräte entwickelt<br />
und mit diesen Untersuchungen mit Amplituden im Bereich von 0,2 bis 10 mm<br />
durchgeführt. In der Sportwissenschaft gibt es immer noch Unklarheit in der Frage<br />
nach der angemessenen Amplitude.<br />
In der vorliegenden Arbeit sollte der Versuch unternommen werden, die Einflussfaktoren<br />
eines Krafttrainings unter Vibrationsbelastung auf die Kraftkomponenten<br />
zu untersuchen.<br />
Zu diesem Zweck wurde ein klassischer Gruppenvergleich mit Eingangs- und<br />
Endtest durchgeführt. lm Gruppenvergleich führten 44 Probanden ein Training (4<br />
Wochen, 12 Trainingseinheiten) der Beinmuskulatur mittels Kniebeugen (30 s, ca.<br />
12-15 Wdhl.,60 s Pa,6 Se.) miteinersog. Jochhantel (Gewicht: 40o/o des 1 RM)<br />
durch. Die frobanden der Vibrationsgruppe (VL: n=12, VH: n=12) wurden während<br />
der Ausführung der Kniebeugen zusätzlich einer Vibrationsbelastung von 30 bis 40<br />
Hz und einer 2 oder 4 mm Amplitude ausgesetzt. Vor und nach der Trainingsphase<br />
wurde mit allen Probanden Tests zur Bestimmung der Kraftkomponenten bzw. der<br />
Maximalkraft, Kraftausdauer, Schnellkraft und Reaktivkraft ausgeführt. Aus der Befindlichkeitsskala<br />
geht hervor, dass die Vibrationsmethode ein gemäßigtes Positivgefühl<br />
bei den Probanden verursacht hat und in keinen Fall unangenehm war.<br />
Bei allen drei verschiedenen Gruppen konnte eine Verbesserung zwischen Eingangs-<br />
und Endtest (lsometrische Maximalkraft und Kraftausdauer, Squat Jump,<br />
Counter Movement Jump, Drop Jump) festgestellt werden. Dabei erreicht die<br />
Trainingsgruppe, die mit der höchsten Amplitude von 4 mm trainiert hatte, die<br />
höchsten prozentualen Verbesserungen.<br />
Beim Drop Jump steigerten sich nur die beiden Vibrationsgruppen, während beim<br />
traditionellen Training keine Verbesserung eintrat. Diese Resultate zeigen eine<br />
Interaktionssignifikanz zwischen den Methoden. Das bedeutet, dass nur die Vibrationsbelastungen<br />
die Reaktivkraft beeinflusst haben. Die positiven Anpassungen<br />
ausgewählter Probanden in allen Kraftkomponenten, vor allem im Bereich der<br />
Reaktivkraft, unterstützen die Resultate des Gruppenvergleichs.<br />
Die biomechanische Stimulation scheint sich daher besonders positiv auf das<br />
Reaktivkraftverhalten auszuwirken, was damit erklärt werden könnte, dass Reaktivkraft<br />
als eine relativ selbständige Dimension und somit auch eine eigens zu<br />
trainierende motorische Eigenschaft angesehen wird.
Für Sportler sind weitere Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Kraftkomponenten<br />
besonders wichtig. lm letzten Teil der Arbeit wurde ein Modell zur Verbesserung<br />
der Reaktivkraft mit dem Ziel der Verbindung des Vibrationskrafttrainings mit den<br />
konventionellen Krafü rain ingsmethoden entwickelt.<br />
Eine Anwendung des Vibrationskraftrainings wurde in der Vorbereitungsphase<br />
vorgeschlagen. Auf Grundlage des Modells bedarf es für eine individuelle Trainingssteuerung<br />
weiterer Untersuchungen verschiedener Trainingsstufen und<br />
Trainingsphasen in Abhängigkeit des Anforderungsprofils der jeweiligen Sportart.<br />
Auszeichnung: Die Dissertation wurde mit "cum laude" ausgezeichnet.<br />
Sporthochschule Köln, Dissertation / Doktorarbeit Juni 2005
Einfluss von Ganzkörpervibration auf das Frakturrisiko.<br />
Erste Ergebnisse der ELVIS-Studie<br />
1 Simon von Stengel, 2 Wolfgang Kemmler, 2 Klaus Engelke, 2 Willi A. Kalender<br />
1 Osteoporoseforschungszentrum, Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland, 2 Institut<br />
für Medizinische Physik, Universität Erlangen-Nürnberg<br />
Einleitung: Das Frakturrisiko lässt sich über ein körperliches Training einerseits<br />
durch eine Senkung der Sturzneigung, andererseits durch eine positive Beeinflussung<br />
der Knochenfestigkeit senken. Die Applikation von Vibrationen über Plattformen<br />
stellt im Zusammenhang mit Osteoporose einen neuen Ansatz dar, der sowohl<br />
die Knochendichte als auch den neuromuskulären Funktionszustand und damit die<br />
Sturzneigung positive beeinflussen könnte. In der ELVIS-Studie (Erlanger längsschnitt<br />
Vibrations-Studie) untersuchen wir, ob die Effektivität eines herkömmlichen<br />
Trainings durch die Applikation von Vibrationen gesteigert warden kann.<br />
Methoden: 151 postmenopausale Frauen (65-80 J.) wurden randomisiert in drei<br />
Gruppen aufgeteilt: 1. Konventionelles Training; 2. Vibrationstraining; 3. Wellnessgruppe.<br />
Das konventionelle Training besteht aus 20 min Aerobic (65-80%<br />
HFmax), 25 min Funktionsgymnastik und 15 min Beinkrafttraining auf Plattformen<br />
ohne Vibration (2 TE/Wo über 18 Monate). Das Vibrationstraining unterscheidet<br />
sich nur dadurch, dass die Übungen des Beinkrafttrainings unter Vibration (25-35<br />
Hz) ausgeführt werden. Die Wellnessgruppe absolviert ein 60-minütiges „sanftes“<br />
Gymnastik- und Entspannungsprogramm (4 x 10 TE über 18 Monate). Alle Gruppen<br />
werden gemäß einem 4-tägigen Ernährungsprotokoll optimal mit Kalzium und<br />
Vit. D substituiert. Nach 12 und 18 Monaten wird die Knochendichte (BMD) an der<br />
Hüfte und LWS mit DEXA und QCT gemessen, Sturzereignisse werden über ein<br />
Sturztagebuch täglich protokolliert.<br />
Ergebnisse: Unsere ersten Analysen nach einem Jahr zeigen in beiden Trainingsgruppen<br />
einen signifikanten Zuwachs der BMD der LWS festzustellen. Nur der Unterschied<br />
zwischen konventioneller Trainingsgruppe und Wellnessgruppe war signifikant.<br />
Im Bereich der Hüfte war ein Verlust der BMD in der Wellnessgruppe festzustellen.<br />
Die Vibrationtrainingsgruppe wies innerhalb der ersten 12 Monate eine signifikant<br />
geringere Sturzhäufigkeit auf als die Wellnessgruppe.<br />
Diskussion: Während die Applikation von Vibrationen die Effekte am Knochen<br />
nicht verstärkte, erwies sich das Vibrationstraining als erfolgreicher die Sturzinzidenz<br />
zu senken. Nähere Erkenntnisse erwarten wir von den QCT-Messungen, die<br />
wir auf dem Kongress präsentieren werden.
Einleitung<br />
Die Erlanger Längsschnitt Vibrations-Studie (ELVIS)<br />
Untersuchung des Einflusses von<br />
Ganzkörpervibrationen auf das Osteoporoserisiko -<br />
Simon von Stengel, Wolfgang Kemmler, Klaus Engelke, Willi A. Kalender<br />
Osteoporoseforschungszentrum am Institut für Medizinische Physik<br />
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg<br />
Osteoporose stellt eine systemische Skeletterkrankung mit einer Verminderung der Knochendichte und einer<br />
Verschlechterung der Knochenarchitektur mit entsprechend reduzierter Festigkeit und erhöhter<br />
Frakturneigung dar (1). Man geht von ca. 6-8 Mio. Osteoporosepatienten in Deutschland aus (2-4), von<br />
denen ca. 80 Prozent Frauen sind (5). Jährlich ereignen sich in Deutschland schätzungsweise 459.000<br />
osteoporotisch bedingte Frakturen (5), davon ca. 130.000 proximale Femurfrakturen (6). Auf Grund der<br />
steigenden Lebenserwartung und der hohen Geburtenrate in der Nachkriegszeit und der damit verbundenen<br />
Überalterung unserer Gesellschaft geht man in der EU von einem Anstieg der Oberschenkelhalsbrüche um<br />
132 Prozent in den nächsten 50 Jahren aus. Deutschland gehört infolge der Bevölkerungsstruktur neben<br />
England, Frankreich und Italien zu den Ländern, in denen die höchste Zunahme innerhalb der EU erwartet<br />
wird (7).<br />
Vor dem Hintergrund dieser Daten wird deutlich, dass ein großer Handlungsbedarf besteht, der die Suche<br />
nach effektiven Strategien für Prävention, Diagnose und Therapie beinhaltet. Im Rahmen der Konzeption<br />
von flächendeckenden Präventionsstrategien gewinnen spezifische Sport- und Bewegungsprogramme<br />
zunehmend an Bedeutung. Entsprechende Programme streben eine Reduzierung des Osteoporoserisikos<br />
einerseits durch die Verminderung der Sturzneigung durch eine Verbesserung des neuromuskulären<br />
Leistungszustandes, andererseits durch die Erhöhung der Knochenfestigkeit über eine positive Beeinflussung<br />
der Knochendichte an.<br />
Während zur Realisation des Trainingsziels „Sturzreduktion“ auch sanfte Inhalte wie Tai Chi eine Wirkung<br />
zeigen, bedarf es zur Beeinflussung von Knochenparametern überwiegend intensiver Reize.<br />
Ganzkörpervibrationstraining, bei dem man auf oszillierenden Platten stehend Übungen ausführt, stellt einen<br />
„sanften“ neuen Ansatz dar, der über beide Pfade einen Einfluss auf das Frakturrisiko ausüben könnte. Der<br />
Wissensstand zur Wirkung von Vibrationstraining auf osteoporotische Risikofaktoren ist jedoch noch äußerst<br />
defizitär, so dass auf der Basis bisheriger Studienergebnisse weder eine pauschale Empfehlung für diese neue<br />
Methode noch trainingsmethodische Richtlinien ausgesprochen werden können (8, 9, 10, 11, 12-14). In der<br />
ELVIS-Studie (Erlanger Längsschnitt Vibrations-Studie) untersuchten wir, ob die Effektivität eines<br />
ganzheitlich ausgerichteten Trainingsprogrammes bei postmenopausalen Frauen durch die Applikation von<br />
Vibrationen gesteigert werden kann. Speziell gingen wir der Frage nach, ob die Wirkung des unspezifischen,<br />
multimodalen Programms auf die Knochendichte und neuromuskuläre Leistungsparameter erhöht werden<br />
kann.
Methoden: 151 postmenopausale Frauen (65-76 J.) wurden randomisiert in drei Gruppen aufgeteilt:<br />
1. Konventionelles Training (KT); 2. Vibrationstraining (VT); 3. Wellness-Kontrollgruppe (KG). Das KT<br />
bestand aus 20 min Aerobic (65-80% HFmax), 25 min Funktionsgymnastik und 15 min Beinkrafttraining auf<br />
Vibrationsplattformen ohne Vibration (2 Trainingseinheiten/Woche (TE/Wo) über 18 Monate). Das VT<br />
unterschied sich nur dadurch, dass die Übungen des Beinkrafttrainings unter Vibration (25-35 Hz) ausgeführt<br />
wurden. Die KG absolvierte ein 60-minütiges „sanftes“ Gymnastik- und Entspannungsprogramm (4 x 10 TE,<br />
1x/Wo). Alle Gruppen wurden gemäß einem 4-tägigen Ernährungsprotokoll mit Kalzium und Vitamin D<br />
substituiert. Zu Beginn, nach 12 und nach 18 Monaten wurde die Knochendichte (BMD) an der Hüfte und<br />
der Lendenwirbelsäule (LWS) mit DXA gemessen. An der LWS erfolgte ferner eine Messung mit<br />
quantitativem CT (QCT). Zu Baseline und nach 18 Monaten erfolgte ferner eine QCT-Messung des<br />
proximalen Femurs. Sturzereignisse wurden täglich über ein Sturztagebuch protokolliert. Folgende<br />
sturzrelevante Parameter der neuromuskulären Leistungsfähigkeit wurden zu Beginn, nach 12 und nach 18<br />
Monaten bestimmt: Isometrische maximale Kraft der Beine (Beinpresse), isometrische Maximalkraft der<br />
Rumpfbeuger und -strecker und die Sprungleistung.<br />
Ergebnisse: Nach Studienende gingen insgesamt die<br />
Ergebnisse von 46 Frauen der VT-Gruppe, 47 Frauen<br />
der KT-Gruppe und 48 Frauen der KG-Gruppe in die<br />
Auswertung ein. Nach 18 Monaten zeigten beide<br />
Trainingsgruppen einen signifikanten Zuwachs der<br />
BMD an der LWS (KT: +2,1%; VT: +1,5%), während<br />
die Werte in der KG konstant blieben. Im Bereich des<br />
Schenkelhalses wies die KG einen signifikanten<br />
Verlust von -1,3% auf. Die KT-Gruppe gewann in<br />
dieser Region tendenziell (+0,9%), während die Werte<br />
in der VT-Gruppe konstant blieben (+0,15%).<br />
Signifikante Gruppenunterschiede waren zwischen der<br />
KT- und Kontrollgruppe im Bereich der LWS und des<br />
Schenkelhalses zu verzeichnen. Die QCT-Daten werden<br />
noch ausgewertet.<br />
Die VT-Gruppe wies innerhalb des Interventionszeitraums<br />
mit durchschnittlich 0,7 (±0,8) Stürzen pro<br />
Teilnehmerin die geringste Sturzhäufigkeit auf, wobei<br />
der Unterschied zur KG-Gruppe (1,5 ± 2,0) signifikant<br />
war. Auch die KT-Gruppe stürzte mit 1,0 (±1,1)<br />
Stürzen/Teilnehmerin weniger häufig als die KG,<br />
wobei der Unterschied nicht signifikant war.<br />
Stürze/Pers 0,7 (±0,8)<br />
RR = 0,47<br />
Stürze/Pers<br />
mit Verletzung<br />
Vib.Train. klass. Train. Wellness<br />
0,33 (±0,4)<br />
RR = 0,72<br />
01,0 (±1,1)<br />
RR = 0,64<br />
0,4 (±0,7)<br />
RR = 0,87<br />
1,5 (±2,0)<br />
RR = 1,0<br />
0,46 (±1,0)<br />
RR = 1,0
Hinsichtlich neuromuskulärer Leistungsparameter zeigten sich nur in den beiden Sportgruppen signifikante<br />
Verbesserungen. Während die VT-Gruppe die Rumpfkraft und die Maximal- und Schnellkraft der Beine<br />
steigern konnte, zeigte die KT-Gruppe nur eine Steigerung der Maximalkraft der Beine. Der Zugewinn der<br />
Maximalkraft der Beine war in der VT-Gruppe tendenziell größer (+19%) als der in der KT-Gruppe (+10%).<br />
Die Gruppenunterschiede bezüglich der neuromuskulären Leistungsparameter erreichten das<br />
Signifikanzniveau jedoch nicht.<br />
Zusammenfassung: Ein ganzheitlich ausgerichtetes Trainingsprogramm mit postmenopausalen Frauen<br />
zeigte nach 18 Monaten Wirkung auf die Knochendichte der LWS und der Hüfte, wobei die Applikation von<br />
Vibrationen den Effekt nicht verstärkte. Hinsichtlich des extraossären Risikofaktors Sturzhäufigkeit erwies<br />
sich das Training mit Vibration im Gegensatz zum konventionellen Training als wirksam, die Sturzinzidenz<br />
im Vergleich zur Kontrollgruppe zu senken. Die Entwicklung der neuromuskulären Leistungsparameter war<br />
in der VT Gruppe nur tendenziell am günstigsten.<br />
Diskussion: Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein unspezifisches multifunktionelles Trainingsprogramm, das<br />
konzipiert wurde, um dem komplexen Risikoprofil älterer Menschen gerecht zu werden, und das auf Grund<br />
des geringen Geräteaufwandes eine gute Übertragbarkeit in die Trainingspraxis der Vereine gewährleist,<br />
geeignet ist, das Osteoporoserisiko zu senken. Auch wenn die Unterschiede zwischen den Trainingsgruppen<br />
nicht das Signifikanzniveau erreichen, geben die Ergebnisse dennoch Anlass zu der Vermutung, dass die<br />
Effektivität entsprechender Trainingsprogramme auf die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit durch die<br />
Applikation von Vibrationen gesteigert werden kann. Eine mögliche Erklärung für die ausbleibende Wirkung<br />
des Vibrationsreizes auf die Knochendichte könnte eine zu kurze Expositionszeit sein. Die<br />
Applikationsdauer betrug pro Teilnehmerin 6 Min. pro Trainingseinheit bei durchschnittlich 1,6 absolvierten<br />
Trainingseinheiten pro Woche.<br />
Es ist erstrebenswert, die Wirkung von Vibrationstraining auf das Osteoporoserisiko in weiteren Studien zu<br />
untersuchen. Eingeschlossen werden sollte dabei die Frage, welches Vibrations- bzw. Trainingsprotokoll den<br />
höchsten Grad an Wirksamkeit erzielt. In der ELVIS Folgestudie, die soeben angelaufen ist, wollen wir<br />
einen weiteren Beitrag leisten, die Wissenslücken hier zu schließen. In dieser Studie vergleichen wir die<br />
Wirkung eines dreimal wöchentlich durchgeführten 15-minütigen Vibrationstrainings auf zwei<br />
unterschiedlichen Plattenkonstruktionen.<br />
Danksagung: Besonderen Dank möchten wir der Elsbeth-Bonhoff Stiftung aussprechen, welche an der<br />
Förderung der vorliegenden Untersuchung beteiligt war. Für die Bereitstellung von Kalzium und Vitamin-D<br />
danken wir der Opfermann GmbH (Berlin, Deutschland). Besonderer Dank gilt auch der Firma MTD-<br />
Systems (Neuburg v.W., Deutschland) für die Überlassung von Messgeräten.<br />
Bisherige Veröffentlichungen/Präsentationen:<br />
1.Von Stengel, S.; Kemmler, W.; Engelke, K.; Kalender, W.A. Erste Ergebnisse der Erlanger Longitudinalen<br />
Vibrations-Studie (ELVIS). Presented at "Osteologie 2007", Vienna, Austria. In: Osteologie. 2007;16(Suppl 1):20.<br />
2.Von Stengel, S.; Kemmler, W.; Engelke, K.; Kalender, W.A. Langfristiger Einfluss von Ganzkörpervibration auf die<br />
neuromuskuläre Leistungsfähigkeit. Presented at „18. DVS Hochschultag“, Hamburg, Germany. In: Backhaus, Funke-<br />
Wieneke, ed. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. Vol. 168. Hamburg: Czwalina; 2007:317.<br />
3.Von Stengel, S.; Kemmler, W.; Engelke, K.; Kalender, W.A. Einfluss von Ganzkörpervibration auf das Frakturrisiko<br />
– erste Ergebnisse der ELVIS-Studie. Presented at „18. DVS Hochschultag“, Hamburg, Germany. In: Backhaus,<br />
Funke-Wieneke, ed. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. Vol. 168. Hamburg: Czwalina;<br />
2007:180.<br />
4.Von Stengel, S.; Kemmler, W.; Engelke, K.; Kalender, W.A. Einfluss eines 18-monatigen Ganzkörpervibrationstrainings<br />
auf Frakturrisikofaktoren älterer Frauen. Vorläufige Ergebnisse der Erlanger Longitudinalen<br />
Vibrations-Studie (ELVIS). Presented at "Osteologie 2008", Hannover, Germany. In: Osteologie. 2008;17(Suppl 1):7.
Flow Chart<br />
Allocated to VTG (n = 50)<br />
Participated at the training<br />
(n= <strong>43</strong>)<br />
Discontinued intervention<br />
(n = 7)<br />
• Personal reasons (n = 5)<br />
• Health problems (n = 2)<br />
Lost to follow-up (n =4)<br />
• Personal reasons (n = 4)<br />
Analyzed (ITT) (n=46)<br />
randomized (n =151)<br />
Allocated to TG (n = 50)<br />
Participated at the training<br />
(n= 45)<br />
Discontinued intervention<br />
(n = 5)<br />
• Personal reasons (n = 3)<br />
• Health problems (n = 2)<br />
Lost to follow-up (n = 3)<br />
• Personal reasons (n = 3)<br />
Analyzed (ITT) (n=47)<br />
Allocated to WG (n = 51)<br />
Participated at the training<br />
(n= 47)<br />
Discontinued intervention<br />
(n =4 )<br />
• Personal reasons (n = 3)<br />
• Death (n = 1)<br />
Lost to follow-up (n = 3)<br />
• Personal reasons (n = 2)<br />
• Death (n = 1)<br />
Analysed (ITT) (n=48)<br />
Flow of participants through the trial (first year analysis). VTG: Vibration Training Group; TG: Training<br />
Group; WG: Wellness Group.<br />
Literatur<br />
1. Anonymous. Consensus Development Conference: Diagnosis, prophylaxis, and treatment of osteoporosis. Am J Med.<br />
1993;94:646-650.<br />
2. Bartl R. Osteoporose - Prävention, Diagnose, Therapie Stuttgart: Thieme Verlag; 2001.<br />
3. Goettke S, Dittmar K. Epidemiologie und Kosten der Osteoporose. Orthopäde. 2001;30(7):202-4.<br />
4. Krappweis J, Rentsch A, Schwarz UI, Krobot KJ, Kirch W. Outpatient costs of osteoporosis in a national health insurance<br />
population. Clin Ther. 1999;21(11):2001-14.<br />
5. Ringe JD. Osteoporose - Differentialdiagnose und Differentialtherapie Stuttgart: Thieme; 1997.<br />
6. Pfeifer M, Wittenberg R, Würtz R, Minne HW. Schenkelhalsfrakturen in Deutschland. Dt Ärzteblatt. 2001;26(6):1751-7.<br />
7. Anonymous. Osteoporose-Bericht zur Lage in Europa liegt vor. Dt Ärzteblatt. 1998;44(10):2724.<br />
8. Gilsanz V, Wren TA, Sanchez M, Dorey F, Judex S, Rubin C. Low-level, high-frequency mechanical signals enhance<br />
musculoskeletal development of young women with low BMD. J Bone Miner Res. 2006;21(9):1464-74.<br />
9. Gusi N, Raimundo A, Leal A. Low-frequency vibratory exercise reduces the risk of bone fracture more than walking: a<br />
randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2006;7:92.<br />
10. Rubin C, Recker R, Cullen D, Ryaby J, McCabe J, McLeod K. Prevention of postmenopausal bone loss by a lowmagnitude,<br />
high-frequency mechanical stimuli: a clinical trial assessing compliance, efficacy, and safety. J Bone Miner<br />
Res. 2004;19(3):3<strong>43</strong>-51.<br />
11. Russo CR, Lauretani F, Bandinelli S, et al. High-frequency vibration training increases muscle power in postmenopausal<br />
women. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84(12):1854-7.<br />
12. Torvinen S, Kannus P, Sievanen H, et al. Effect of 8-month vertical whole body vibration on bone, muscle performance,<br />
and body balance: a randomized controlled study. J Bone Miner Res. 2003;18(5):876-84.<br />
13. Verschueren SM, Roelants M, Delecluse C, Swinnen S, Vanderschueren D, Boonen S. Effect of 6-month whole body<br />
vibration training on hip density, muscle strength, and postural control in postmenopausal women: a randomized controlled<br />
pilot study. J Bone Miner Res. 2004;19(3):352-9.<br />
14. Ward K, Alsop C, Caulton J, Rubin C, Adams J, Mughal Z. Low magnitude mechanical loading is osteogenic in children<br />
with disabling conditions. J Bone Miner Res. 2004;19(3):360-9.