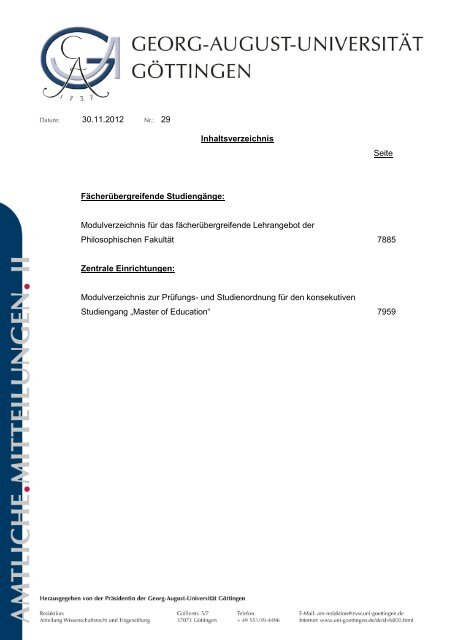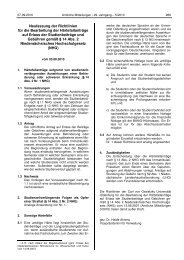Amtliche Mitteilungen II Ausgabe 29 - Georg-August-Universität ...
Amtliche Mitteilungen II Ausgabe 29 - Georg-August-Universität ...
Amtliche Mitteilungen II Ausgabe 29 - Georg-August-Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
30.11.2012 <strong>29</strong>InhaltsverzeichnisSeiteFächerübergreifende Studiengänge:Modulverzeichnis für das fächerübergreifende Lehrangebot derPhilosophischen Fakultät 7885Zentrale Einrichtungen:Modulverzeichnis zur Prüfungs- und Studienordnung für den konsekutivenStudiengang „Master of Education“ 7959
<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> Seite 7885Fächerübergreifende Studiengänge:Nach Beschluss des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät vom 15.08.2012 hat das Präsidiumder <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen am 30.10.2012 die Neufassung des Modulverzeichnisseszur Prüfungs- und Studienordnung für den Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang für das fächerübergreifendeLehrangebot der Philosophischen Fakultät genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHGin der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durchArtikel 1 des Gesetzes vom 20.06.2012 (Nds. GVBl. S. 186); § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG,§ 44 Abs. 1 Satz 3 NHG).Die Neufassung tritt rückwirkend zum 01.10.2012 in Kraft.
<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong>GöttingenModulverzeichnisfür das fächerübergreifende Lehrangebotder Philosophischen Fakultät - zu Anlage<strong>II</strong>I.2 der Prüfungs- und Studienordnung fürden Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang(<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> I 39/2012 S. 2037)<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7886
<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7887
InhaltsverzeichnisModuleSK.IKG-ISZ.01: Ausbildung zum/zur Schreibberater_in: Theoretische Einführung.................................... 7894SK.IKG-ISZ.02: Vom Lesen zum Schreiben akademischer Texte für Bachelor-Studierende..................... 7896SK.IKG-ISZ.03: Vom Lesen zum Schreiben akademischer Texte für Master-Studierende........................ 7897SK.IKG-ISZ.04: Vorbereiten und Halten von Referaten für Bachelor-Studierende.....................................7898SK.IKG-ISZ.05: Vorbereiten und Halten von Referaten für Master-Studierende........................................7899SK.IKG-ISZ.06: Mitschreiben, Protokollieren und Berichten im Studium....................................................7900SK.IKG-ISZ.07: Klausuren vorbereiten und schreiben............................................................................... 7901SK.IKG-ISZ.08: Bewerbungen schreiben I................................................................................................. 7902SK.IKG-ISZ.09: Akademisches Schreiben und Präsentieren für Naturwissenschaftler/innen - ein Vergleichdeutscher und englischer Schreibtraditionen..............................................................................................7903SK.IKG-ISZ.10: Akademisches Schreiben für Studierende der Rechtswissenschaften............................. 7905SK.IKG-ISZ.11: Akademisches Schreiben für Geisteswissenschaftler/innen in Bachelor-Studiengängen. 7906SK.IKG-ISZ.12: Akademisches Schreiben für Geisteswissenschaftler/innen in Master-Studiengängen.....7907SK.IKG-ISZ.13: Akademische Schreibpartnerschaften...............................................................................7908SK.IKG-ISZ.14: Akademisches Schreiben für Sozialwissenschaftler/innen................................................7909SK.IKG-ISZ.15: Journalistisches Schreiben I............................................................................................. 7910SK.IKG-ISZ.16: Web-spezifisches Schreiben............................................................................................. 7911SK.IKG-ISZ.17: Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- undSozialwissenschaften.................................................................................................................................. 7912SK.IKG-ISZ.18: Wissenschaftssprache für das akademische Schreiben................................................... 7913SK.IKG-ISZ.19: Verfassen von Exposés.................................................................................................... 7914SK.IKG-ISZ.20: Effizient und adressatenorientiert Schreiben im Beruf...................................................... 7915SK.IKG-ISZ.21: Populärwissenschaftliches Schreiben............................................................................... 7916SK.IKG-ISZ.22: Essays schreiben für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften......................7917SK.IKG-ISZ.23: Zusammenfassungen, Abstract, Rezensionen schreiben................................................. 7918SK.IKG-ISZ.24: Bewerbungen schreiben <strong>II</strong>................................................................................................ 7919SK.IKG-ISZ.25: Journalistisches Schreiben <strong>II</strong>............................................................................................ 7920SK.IKG-ISZ.26: Schreiben im Lehrer_innen-Beruf..................................................................................... 7921SK.IKG-ISZ.27: Vergleich akademischer Schreibtraditionen für Studierende der Sozialwissenschaften:Deutsch und Englisch................................................................................................................................. 7922SK.IKG-ISZ.28: Wissenschaftlicher Stil...................................................................................................... 7923<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7888
InhaltsverzeichnisSK.IKG-ISZ.<strong>29</strong>: Akademisches Schreiben erforschen................................................................................7924SK.IKG-ISZ.30: ProText: Einführung ins Texten im Beruf..........................................................................7925SK.IKG-ISZ.31: ProText: Praxisstudien...................................................................................................... 7926SK.IKG-ISZ.32: Ausbildung zum/zur Schreibberater_in: Praxisstudien......................................................7927SK.NL.1: Niederländisch I........................................................................................................................... 7928SK.NL.2: Niederländisch <strong>II</strong>.......................................................................................................................... 79<strong>29</strong>SK.NL.3: Niederländisch <strong>II</strong>I......................................................................................................................... 7930SK.NL.4: Ausprache- und Übersetzungsübung Niederländisch................................................................. 7931SK.NL.5: Niederländischsprachige Literatur............................................................................................... 7932SK.Phil.01: Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung der Philosophischen Fakultät....................... 7933SK.Phil.02: Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung der Philosophischen Fakultät...................... 7934SK.Phil.03: Tätigkeit als studentische(r) Tutor(in) an der Philosophischen Fakultät...................................7935SK.Phil.04: Tätigkeit als Tutor(in) während der Orientierungsphase an der Philosophischen Fakultät.......7936SK.Phil.05: Studentisches Mentoring..........................................................................................................7937SK.Phil.20: Kommunikation und Geschlecht.............................................................................................. 7938SK.Phil.21: Konfliktmanagement.................................................................................................................7939SK.Phil.22: Moderationstechniken...............................................................................................................7940SK.Phil.23: Diversity-Kompetenz.................................................................................................................7941SK.Phil.24: Studentische Filme planen, umsetzen und veröffentlichen......................................................7943SK.Phil.50: Berufsqualifizierendes Praktikum für Geisteswissenschaftler/innen I...................................... 7945SK.Phil.51: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- und Geisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong>................... 7946SK.Phil.52: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- und Geisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong>I.................. 7947SK.Phil.53: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- und Geisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong><strong>II</strong>................. 7948SK.Phil.54: Praxismodul Projektmanagement I: Planung und Organisation der Berufsinformations- undFirmenkontaktmesse für Geisteswissenschaftler/innen.............................................................................. 7949SK.Phil.55: Praxismodul Projektmanagement <strong>II</strong>: Durchführung der Berufsinformations- undFirmenkontaktmesse PraxisBörse für Geisteswissenschaftler/innen..........................................................7950SK.Phil.56: Ehrenamtliche Tätigkeit............................................................................................................7952SK.Phil.70: Berufseinstieg I: Kompetenzanalyse und Bewerbung..............................................................7954SK.Phil.71: Berufseinstieg <strong>II</strong>: KOMPASS - Kompetenzen, Perspektiven, Ausblicke.................................. 7955SK.Phil.72: Betriebswirtschaftslehre für Geisteswissenschaftler/innen.......................................................7957SK.Phil.73: Zeitmanagement.......................................................................................................................7958<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7889
InhaltsverzeichnisÜbersicht nach Modulgruppen1) Überfachliches Lehrangebot der Philosophischen Fakultät (Hauptebene)a) Angebote der FakultätFolgende Module können von Studierenden der Philosophischen Fakultät imProfessionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.Phil.01: Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung der Philosophischen Fakultät (4 C).....7933SK.Phil.02: Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung der Philosophischen Fakultät (5 C)....7934SK.Phil.03: Tätigkeit als studentische(r) Tutor(in) an der Philosophischen Fakultät (6 C, 2 SWS)...7935SK.Phil.04: Tätigkeit als Tutor(in) während der Orientierungsphase an der Philosophischen Fakultät(3 C, 2 SWS)..................................................................................................................................... 7936SK.Phil.05: Studentisches Mentoring (4 C, 1 SWS)......................................................................... 7937SK.Phil.20: Kommunikation und Geschlecht (3 C, 2 SWS).............................................................. 7938SK.Phil.21: Konfliktmanagement (3 C, 2 SWS)................................................................................ 7939SK.Phil.22: Moderationstechniken (3 C, 2 SWS)..............................................................................7940SK.Phil.23: Diversity-Kompetenz (3 C, 2 SWS)................................................................................7941SK.Phil.24: Studentische Filme planen, umsetzen und veröffentlichen (6 C, 3 SWS)......................7943SK.Phil.50: Berufsqualifizierendes Praktikum für Geisteswissenschaftler/innen I (4 C)................... 7945SK.Phil.51: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- und Geisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong> (8 C,2 SWS).............................................................................................................................................. 7946SK.Phil.52: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- und Geisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong>I (10 C,2 SWS).............................................................................................................................................. 7947SK.Phil.53: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- und Geisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong><strong>II</strong> (12 C,2 SWS).............................................................................................................................................. 7948SK.Phil.54: Praxismodul Projektmanagement I: Planung und Organisation der Berufsinformations- undFirmenkontaktmesse für Geisteswissenschaftler/innen (6 C, 6 SWS)..............................................7949SK.Phil.55: Praxismodul Projektmanagement <strong>II</strong>: Durchführung der Berufsinformations- undFirmenkontaktmesse PraxisBörse für Geisteswissenschaftler/innen (3 C, 3 SWS)..........................7950SK.Phil.56: Ehrenamtliche Tätigkeit (6 C, 2 SWS)........................................................................... 7952SK.Phil.70: Berufseinstieg I: Kompetenzanalyse und Bewerbung (3 C, 2 SWS)..............................7954SK.Phil.71: Berufseinstieg <strong>II</strong>: KOMPASS - Kompetenzen, Perspektiven, Ausblicke (3 C, 2 SWS)...7955SK.Phil.72: Betriebswirtschaftslehre für Geisteswissenschaftler/innen (3 C, 2 SWS)...................... 7957SK.Phil.73: Zeitmanagement (3 C, 2 SWS)......................................................................................7958<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7890
Inhaltsverzeichnisb) NiederländischFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten Studiengänge imProfessionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.NL.1: Niederländisch I (4 C, 2 SWS).......................................................................................... 7928SK.NL.2: Niederländisch <strong>II</strong> (4 C, 2 SWS)......................................................................................... 79<strong>29</strong>SK.NL.3: Niederländisch <strong>II</strong>I (4 C, 2 SWS)........................................................................................ 7930SK.NL.4: Ausprache- und Übersetzungsübung Niederländisch (2 C, 1 SWS)................................. 7931SK.NL.5: Niederländischsprachige Literatur (4 C, 2 SWS)...............................................................79322) Angebote des Internationalen Schreibzentrums (Hauptebene)a) für alle StudiengängeFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten Studiengänge imProfessionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.IKG-ISZ.01: Ausbildung zum/zur Schreibberater_in: Theoretische Einführung (10 C, 6 SWS)...7894SK.IKG-ISZ.06: Mitschreiben, Protokollieren und Berichten im Studium (4 C, 1 SWS)....................7900SK.IKG-ISZ.07: Klausuren vorbereiten und schreiben (3 C, 1 SWS)............................................... 7901SK.IKG-ISZ.08: Bewerbungen schreiben I (3 C, 1 SWS).................................................................7902SK.IKG-ISZ.13: Akademische Schreibpartnerschaften (4 C, 2 SWS).............................................. 7908SK.IKG-ISZ.15: Journalistisches Schreiben I (3 C, 1 SWS)............................................................. 7910SK.IKG-ISZ.16: Web-spezifisches Schreiben (3 C, 1 SWS).............................................................7911SK.IKG-ISZ.18: Wissenschaftssprache für das akademische Schreiben (3 C, 1 SWS)................... 7913SK.IKG-ISZ.20: Effizient und adressatenorientiert Schreiben im Beruf (3 C, 1 SWS)...................... 7915SK.IKG-ISZ.21: Populärwissenschaftliches Schreiben (3 C, 1 SWS)...............................................7916SK.IKG-ISZ.23: Zusammenfassungen, Abstract, Rezensionen schreiben (4 C, 1 SWS)................. 7918SK.IKG-ISZ.25: Journalistisches Schreiben <strong>II</strong> (3 C, 1 SWS)............................................................ 7920SK.IKG-ISZ.26: Schreiben im Lehrer_innen-Beruf (3 C, 1 SWS).....................................................7921SK.IKG-ISZ.28: Wissenschaftlicher Stil (3 C, 1 SWS)......................................................................7923SK.IKG-ISZ.<strong>29</strong>: Akademisches Schreiben erforschen (12 C, 6 SWS)............................................. 7924SK.IKG-ISZ.30: ProText: Einführung ins Texten im Beruf (6 C, 2 SWS)..........................................7925SK.IKG-ISZ.31: ProText: Praxisstudien (6 C, 1 SWS)......................................................................7926SK.IKG-ISZ.32: Ausbildung zum/zur Schreibberater_in: Praxisstudien (8 C, 6 SWS)......................7927<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7891
Inhaltsverzeichnisb) für alle Bachelor-StudiengängeFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten Bachelor-Studiengänge imProfessionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.IKG-ISZ.02: Vom Lesen zum Schreiben akademischer Texte für Bachelor-Studierende (4 C,1 SWS).............................................................................................................................................. 7896SK.IKG-ISZ.04: Vorbereiten und Halten von Referaten für Bachelor-Studierende (4 C, 1 SWS)..... 7898c) für alle Master-StudiengängeFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten Master-Studiengänge imProfessionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.IKG-ISZ.03: Vom Lesen zum Schreiben akademischer Texte für Master-Studierende (4 C,1 SWS).............................................................................................................................................. 7897SK.IKG-ISZ.05: Vorbereiten und Halten von Referaten für Master-Studierende (4 C, 1 SWS)........ 7899SK.IKG-ISZ.19: Verfassen von Exposés (3 C, 1 SWS)....................................................................7914SK.IKG-ISZ.24: Bewerbungen schreiben <strong>II</strong> (3 C, 1 SWS)................................................................7919d) für alle naturwissenschaftlichen StudiengängeFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten naturwissenschaftlichen Studiengängeim Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.IKG-ISZ.09: Akademisches Schreiben und Präsentieren für Naturwissenschaftler/innen - einVergleich deutscher und englischer Schreibtraditionen (4 C, 2 SWS)..............................................7903e) für alle rechtswissenschaftlichen StudiengängeFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten rechtswissenschaftlichen Studiengängeim Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.IKG-ISZ.10: Akademisches Schreiben für Studierende der Rechtswissenschaften (3 C,1 SWS).............................................................................................................................................. 7905f) für alle geisteswissenschaftlichen Bachelor-StudiengängeFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten geisteswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge im Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.IKG-ISZ.11: Akademisches Schreiben für Geisteswissenschaftler/innen in Bachelor-Studiengängen (4 C, 1 SWS)............................................................................................................7906SK.IKG-ISZ.17: Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- undSozialwissenschaften (3 C, 1 SWS)................................................................................................. 7912SK.IKG-ISZ.22: Essays schreiben für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften (4 C,1 SWS).............................................................................................................................................. 7917g) für alle geisteswissenschaftlichen Master-Studiengänge<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7892
InhaltsverzeichnisFolgende Module können von Studierenden aller geeigneten geisteswissenschaftlichen Master-Studiengänge im Professionalisierungsbereich (Schlüsselkompetenzen) absolviert werden:SK.IKG-ISZ.12: Akademisches Schreiben für Geisteswissenschaftler/innen in Master-Studiengängen(4 C, 2 SWS)..................................................................................................................................... 7907SK.IKG-ISZ.17: Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- undSozialwissenschaften (3 C, 1 SWS)................................................................................................. 7912SK.IKG-ISZ.22: Essays schreiben für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften (4 C,1 SWS).............................................................................................................................................. 7917h) für alle sozialwissenschaftlichen StudiengängeSK.IKG-ISZ.14: Akademisches Schreiben für Sozialwissenschaftler/innen (4 C, 1 SWS)............... 7909SK.IKG-ISZ.17: Empirische Daten verschriftlichen für Studierende der Geistes- undSozialwissenschaften (3 C, 1 SWS)................................................................................................. 7912SK.IKG-ISZ.22: Essays schreiben für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften (4 C,1 SWS).............................................................................................................................................. 7917SK.IKG-ISZ.27: Vergleich akademischer Schreibtraditionen für Studierende der Sozialwissenschaften:Deutsch und Englisch (4 C, 2 SWS).................................................................................................7922<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7893
Modul SK.IKG-ISZ.01<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.01: Ausbildung zum/zur Schreibberater_in: TheoretischeEinführungEnglish title: Writing Tutor Training: Introduction and TheoryLernziele/Kompetenzen:Fortgeschrittene Studierende lernen wissenschaftliche Erkenntnisse derSchreibprozessforschung und Schreibdidaktik kennen sowie deren Bedeutung fürdie Schreibberatung. Vertiefend können außerdem Kenntnisse zum Schreiben in derMehrsprachigkeit erworben werden. Des Weiteren werden Beratungsansätze und –strategien vermittelt, auf den Kontext der Schreibberatung bezogen und in Übungen undRollenspielen erprobt.10 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:216 StundenLernziele: Kenntnisse schreibdidaktischer und beratungspsychologischer Grundlagen,Verständnis der Prinzipien und Aufgaben von Schreibberatung, Beratungskompetenzen,Kenntnisse akademischer Textsorten und SchreibprozesseLehrveranstaltungen:1. Schreiben in der Mehrsprachigkeit (Option 2: Schreiben in interkulturellenKontexten)Studierende, die Option 1 wählen, müssen an diesem Seminar nicht teilnehmen, da siedurch die Teilnahme an den beiden anderen Seminaren bereits Lehrveranstaltungen imUmfang von 6 SWS haben.2 SWS2. Beratung und Schreibberatung 2 SWS3. Einführung in die Schreibprozessforschung und -didaktik 2 SWS4. Übung zu Beratung und Schreibberatung (Option 1: Schreiben in derErstsprache Deutsch)An dieser Übung nehmen nur Studierende teil, die Option 1 wählen.5. Übung zu Einführung in die Schreibprozessforschung und -didaktik (Option 1:Schreiben in der Erstsprache Deutsch)An dieser Übung nehmen nur Studierende teil, die Option 1 (Schreiben in derErstsprache Deutsch) wählen.1 SWS1 SWSPrüfung: Hausarbeit, (max. 15 S.), bei Option 1: zusätzlich Portfolio (max. 15 S.)Prüfungsvorleistungen:aktive Teilnahme an den Veranstaltungen, konzipierende und reflektierendeSchreibaufgaben (max. 15 S.)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse aus der Schreibprozessforschung, Schreibdidaktik undBeratungspsychologie, Beratungskompetenzen, Verständnis von Grundlagen derSchreibberatung, Kenntnisse akademischer Schreibprozesse und TextsortenZugangsvoraussetzungen:Empfohlene Vorkenntnisse:keine<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7894
Modul SK.IKG-ISZ.01Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-NiveauC1, akademische Schreiberfahrung, linguistischeGrundkenntnisseSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteElla GrieshammerDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 3Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7895
Modul SK.IKG-ISZ.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.02: Vom Lesen zum Schreiben akademischer Textefür Bachelor-StudierendeEnglish title: Reading and writing academic texts for undergraduate studentsLernziele/Kompetenzen:In diesem Modul erlernen Studierende unterschiedliche Lesestrategien und wendendiese an, um zu einem effizienten Rezipieren wissenschaftlicher Literatur zu gelangen.Zudem erlernen sie die gelesene Literatur in angemessener Weise aufzubereiten, umsie funktional in eigene akademische Texte einzubinden.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Lese-Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in akademischen Lesestrategien, Textartenkenntnisse zur Vorbereitungkomplexerer akademischer Texte, Kompetenzen im Umsetzen von gelesenerwissenschaftlicher Literatur in eigene akademische Teiltexte.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Empfohlene Vorkenntnisse:Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 6Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7896
Modul SK.IKG-ISZ.03<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.03: Vom Lesen zum Schreiben akademischer Textefür Master-StudierendeEnglish title: Reading and writing academic texts for graduate studentsLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop erlernen Studierende Lesestrategien und wenden diese an, um zueinem fortgeschrittenen, effizienten Rezipieren wissenschaftlicher Literatur zu gelangen.Zudem erlernen sie die gelesene Literatur in angemessener Weise aufzubereiten, umsie funktional in eigene komplexe, akademische Texte einzubinden und eigenständigeakademische Argumentationen entwickeln zu können.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Lese-Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in akademischen Lesestrategien, Textartenkenntnisse zur Vorbereitungkomplexerer akademischer Texte, Kompetenzen im Umsetzen von gelesenerwissenschaftlicher Literatur in eigene akademische Teiltexte.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7897
Modul SK.IKG-ISZ.04<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.04: Vorbereiten und Halten von Referaten für Bachelor-StudierendeEnglish title: Preparing and giving academic presentations for undergraduate studentsLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop erlernen Studierende (wissenschafts-)sprachliche Anforderungen,die sie beim Halten erster Referate in einer deutschsprachigen universitärenLehrveranstaltung erfüllen müssen. Obwohl Referate mündlich vorgetragen werden,basieren sie auf schriftlichen Vorlagen und schriftlich fixierten Begleitmaterialien, wiez.B. Handout, Powerpoint-Präsentationen. Die Studierenden erlernen grundlegendeKenntnisse dieser schriftlich konzipierten Mündlichkeit und wenden Sie auf Kurzvorträgean.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten); Referat (ca. 20 Minuten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in Bereichen der akademischen mündlichen Rhetorik, schriftlichkonzipierten Mündlichkeit, der funktionalen Medienerstellung und –nutzung für einenakademischen Vortrag, Kompetenzen zur Reflexion akademischer Präsentationen.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 6Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7898
Modul SK.IKG-ISZ.05<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.05: Vorbereiten und Halten von Referaten für Master-StudierendeEnglish title: Preparing and giving academic presentations for graduate studentsLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop erlernen Studierende (wissenschafts-)sprachliche Anforderungen,die sie beim Halten wissenschaftlicher Referate in einer deutschsprachigenuniversitären Lehrveranstaltung erfüllen müssen. Obwohl Referate mündlichvorgetragen werden, basieren sie auf schriftlichen Vorlagen und schriftlich fixiertenBegleitmaterialien, wie z.B. Handout, Powerpoint-Präsentationen. Die Studierendenerlernen vertiefende Kenntnisse dieser schriftlich konzipierten Mündlichkeit und wendenSie auf Kurzvorträge an.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten); Referat (ca. 20 min)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in Bereichen der akademischen mündlichen Rhetorik, schriftlichkonzipierten Mündlichkeit, der funktionalen Medienerstellung und –nutzung für einenakademischen Vortrag, Kompetenzen zur Reflexion akademischer PräsentationenZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7899
Modul SK.IKG-ISZ.06<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.06: Mitschreiben, Protokollieren und Berichten imStudiumEnglish title: Taking notes, minutes, and writing reportsLernziele/Kompetenzen:In diesem Modul erlernen Studierende studienrelevante Textarten kennen, diezum erfolgreichen Abschließen eines Bachelor-Studiums beitragen. Zum einenerlernen Studierende effizient in Vorlesungen mitzuschreiben, um ihre Mitschriften fürPrüfungsvorbereitungen aufzubereiten. Daher setzen sich die Studierenden analytischmit authentischen Vorlesungsmitschnitten auseinander, um ihre Hörstrategien zuschulen und um entscheiden zu können, welche Inhalte sie wie notieren möchten.Zudem werden Mitschreib-Techniken geübt. Zudem lernen Studierende die beidenTextarten des Berichtens und Protokollierens in ihrem Aufbau, ihrer Funktionalität undsprachlichen Realisierung kennen und wenden das Gelernte auf die Anforderungen inihren Studienfächern an. Hierfür werden zunächst in analytischen AufgabenstellungenProtokolle und Berichte analysiert und anschließend fachspezifisch umgesetzt, so dassdie Teilnehmenden ein Wissen über das Schreiben wissenschaftlicher Protokolle undBerichte erlangen.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in akademischen Hörverstehensstrategien, funktionaler Mitschreib-Strategien und –Techniken; Kompetenzen in den Textarten ‚akademisches Protokollund Bericht’, im Projektmanagement zur Erstellung akademischer Protokolle undBerichte.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7900
Modul SK.IKG-ISZ.07<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.07: Klausuren vorbereiten und schreibenEnglish title: Preparing for and taking final written examinationsLernziele/Kompetenzen:In diesem Modul lernen Studierende verschiedene Klausurformen mit ihrencharakteristischen Fragestilen kennen und wie sie sie diese angemessen beantwortenkönnen. Zudem erlernen die Studierenden relevante Aspekte des Zeitmanagements undsowie ausgewählte Lern- und Mnemotechniken für eine effiziente Klausurvorbereitungund wenden sie auf die eigene Klausurvorbereitung an.Lehrveranstaltung: WorkshopAngebotshäufigkeit: jedes Semester3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:reflektiertes Wissen über verschiedene Klausurformen, Lern- und Memotechniken;Kompetenzen im Zeitmanagement.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jährlichWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7901
Modul SK.IKG-ISZ.08<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.08: Bewerbungen schreiben IEnglish title: Writing job applications ILernziele/Kompetenzen:In diesem Modul erlernen Studierende notwendige Kenntnisse zum Verfassen vonBewerbungen für Praktikumsplätze und Masterstudiengänge. Hierzu gehören dieAuswertung von Anforderungsprofilen, das Verfassen von Initiativbewerbungen,Grundkenntnisse über den Aufbau und die sprachliche Realisierung vonBewerbungsanschreiben und Motivationsschreiben. Zudem erlernen die Studierendeneinen (deutschsprachigen) Lebenslauf zu verfassen, der den Standards für eineBewerbung entspricht sowie einführende Kenntnisse in deutscher Zeugnissprache.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen im Verfassen von Bewerbungen, reflektiertes Wissen über deutscheZeugnissprache.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7902
Modul SK.IKG-ISZ.09<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.09: Akademisches Schreiben und Präsentierenfür Naturwissenschaftler/innen - ein Vergleich deutscher und englischerSchreibtraditionenEnglish title: Academic writing and presentation in the natural sciencesLernziele/Kompetenzen:In diesem Modul lernen Studierende das akademische Schreiben und Präsentierenin den beiden Schreibtraditionen des Deutschen und Englischen kennen. Hierfürwerden unterschiedliche Textarten (z.B. wissenschaftlicher Artikel, Essay, Protokoll,Bericht) sowie akademische Teiltexte (z.B. Einleitung – Introduction) in den beidenSchreibtraditionen analysiert und miteinander verglichen. Die Studierenden verfassenselbst Texte in beiden Schreibtraditionen und erhalten ein Feedback auf ihrenSchreibprozess.4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 StundenZudem erlernen sie akademische Präsentationen in beiden Traditionen effizient und denAnforderungen entsprechend vorzubereiten und zu halten. Die erworbenen Kenntnissewenden die Studierenden an, indem sie selbst ausgewählte naturwissenschaftlicheTexte verfassen und kurze Präsentationen halten.Das Schreiben in der Wissenschaftssprache Englisch wird betreut und begleitet durchMitarbeiter/innen des Writing Centres der London Metropolitan University, mit dem dasInternationale Schreibzentrum der <strong>Universität</strong> Göttingen eine Kooperation pflegt. DieVeranstaltung wird zum Teil von Mitarbeiter/innen des Writing Centres durchgeführt undim Anschluss an die Lehrveranstaltung können Studierende an einem online tutorialteilnehmen, um eine weiterführende Begleitung in akademischen Schreibprojekten inder Wissenschaftssprache Englisch zu erhalten.Lehrveranstaltung: Workshop1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten); Präsentation (ca. 10 Minuten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in Bereichen naturwissenschaftlich relevanter Textarten, derakademischen mündlichen Rhetorik, schriftlich konzipierten Mündlichkeit, derfunktionalen Medienerstellung und –nutzung für einen akademischen Vortrag,Kompetenzen zur Reflexion akademischer Präsentationen.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7903
Modul SK.IKG-ISZ.09Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7904
Modul SK.IKG-ISZ.10<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.10: Akademisches Schreiben für Studierende derRechtswissenschaftenEnglish title: Academic writing for law studentsLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop erlernen Studierende verschiedene, während des Studiums derRechtswissenschaften relevante Textarten (z.B. Fallösungen, Seminararbeiten) kennenund erlernen diese (wissenschafts-)sprachlich angemessen zu verfassen.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in rechtswissenschaftlich relevanten akademischen Textarten,reflektiertes Wissen über akademische Schreibprozesse, Feedbackstrategien.Zugangsvoraussetzungen:SK.IKG-ISZ.10/11/12Empfohlene Vorkenntnisse:keineDeutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7905
Modul SK.IKG-ISZ.11<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.11: Akademisches Schreiben für Geisteswissenschaftler/innenin Bachelor-StudiengängenEnglish title: Academic writing for undergraduate students in the humanitiesLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop erlernen Studierende verschiedene, während desStudiums der Geisteswissenschaften relevante Textarten (z.B. Seminararbeiten,Referatsausarbeitungen) kennen und erlernen diese (wissenschafts-)sprachlichangemessen zu verfassen.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in geisteswissenschaftlich relevanten akademischen Textarten,reflektiertes Wissen über akademische Schreibprozesse, Feedbackstrategien.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 6Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7906
Modul SK.IKG-ISZ.12<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.12: Akademisches Schreiben für Geisteswissenschaftler/innenin Master-StudiengängenEnglish title: Academic writing for graduate students in the humanitiesLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop erlernen Studierende mit akademischer Schreiberfahrungverschiedene, während des Master-Studiums der Geisteswissenschaften relevanteTextarten (z.B. Seminararbeiten, Referatsausarbeitungen) wissenschaftlich undwissenschaftssprachlich angemessen zu verfassen.Lehrveranstaltung: Workshop4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in geisteswissenschaftlich relevanten akademischen Textarten,reflektiertes Wissen über akademische Schreibprozesse, Feedbackstrategien.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7907
Modul SK.IKG-ISZ.13<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.13: Akademische SchreibpartnerschaftenEnglish title: Academic group-writingLernziele/Kompetenzen:Bikulturelle Studierende einer Studienfachrichtung bilden eine Schreibpartnerschaft,in der sie beim Verfassen akademischer Texte professionell angeleitet undbegleitet werden. Die Studierenden erhalten gezielte Aufgaben zum Verfassenakademischer Teiltexte, werden in Form von Schreibberatungen kontinuierlich in ihremSchreibprozess begleitet und erhalten Textrückmeldungen. Ziel ist es, nachhaltigeSchreibpartnerschaften multikultureller Studierender zu fördern, die zu einer Integrationausländischer Studierender beitragen. Dies ist ein durch den Deutschen AkademischenAustauschdienst gefördertes Projekt im Rahmen des Förderprogramms PROFIN.Lehrveranstaltung: Workshop4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:reflektiertes Wissen über unterschiedliche akademische Schreibtraditionen,Kompetenzen in wissenschaftskulturell verankerten akademischen Textarten,reflektiertes Wissen über Feedbackstrategien.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7908
Modul SK.IKG-ISZ.14<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.14: Akademisches Schreiben für Sozialwissenschaftler/innenEnglish title: Academic writing for social scientistsLernziele/Kompetenzen:In diesem Modul erlernen Studierende verschiedene, während des Studiumsder Sozialwissenschaften relevante Textarten (z.B. Seminararbeiten,Referatsausarbeitungen) kennen und erlernen diese (wissenschafts-)sprachlichangemessen zu verfassen. Weiterhin werden Arbeitstechniken wie z.B.Zeitmanagement, thematisiert, die für ein effektives akademisches Schreibennotwendig sind. Die Studierenden erlernen notwendige Handlungsschritte beimakademischen Schreiben, wie z.B. eine wissenschaftliche Fragestellung zu finden,wissenschafltiche Literatur kontextualisiert in den eigenen akademischen Texteinzubinden und wissenschaftliche zu argumentieren. Insofern werden die Studierendendazu angeleitet, akademische Schreibprozesse aufzudecken und zu reflektieren, umsich zu professionell handelnden Schreibenden zu entwickeln.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kompetenzen in sozialwissenschaftlich relevanten akademischen Textarten, reflektiertesWissen über akademische Schreibprozesse, Feedbackstrategien.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7909
Modul SK.IKG-ISZ.15<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.15: Journalistisches Schreiben IEnglish title: Writing for newspapers and magazines ILernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erlernen mit dieser berufsrelevanten Schlüsselkompetenz komplexeSachverhalte sprachlich so aufzubereiten, dass sie von einer breiten Zielgruppe rezipiertwerden können. Die Studierenden setzen sich hierfür mit informationsbezogenenTextarten aus dem Journalismus, wie z.B. Pressemitteilung, Reportage, auseinanderund probieren dieses Wissen anhand eigener Themen aus ihren Fachdisziplinen aus.Zudem erlernen sie, Texte medienspezifisch aufzubereiten.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden zeigen in einem Portfolio, dass sie Texte medienspezifisch aufbereitenkönnen.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7910
Modul SK.IKG-ISZ.16<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.16: Web-spezifisches SchreibenEnglish title: Writing for the webLernziele/Kompetenzen:Da Texte zunehmend mehr für die Veröffentlichung im Internet geschrieben werden,benötigen Studierende eine Kompetenz im Verfassen auf das Internet ausgerichteterTextarten.Die Studierenden erlernen mit dieser berufsrelevanten Schlüsselkompetenz webspezifischeTextarten kennen und setzen sich mit der sprachlichen Struktur dieserTextarten auseinander, z.B. sprachliche Gestaltung von Hypertexten. In einem Wikisetzen sie das Gelernte praktisch um.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden zeigen in einem Portfolio, dass sie Texte medienspezifisch aufbereitenkönnen.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7911
Modul SK.IKG-ISZ.17<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.17: Empirische Daten verschriftlichen für Studierendeder Geistes- und SozialwissenschaftenEnglish title: Presenting empirical data in written formLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden lernen die Anforderungen kennen, die beim Verschriftlichen quantitativund qualitativ erhobener Daten in akademischen Texten erfüllt werden müssen. Hierzugehört neben einer wissenschaftssprachlich angemessenen Darstellung der Ergebnisseder Datenauswertung auch die Verquickung der eigenen Ergebnisse mit Erkenntnissenaus zugrunde liegenden wissenschaftlichen Forschungen. Die Studierenden erlernencharakteristische wissenschaftssprachliche Merkmale der Darstellung der Ergebnisseund der Diskussion in empirischen Texten und wenden sie auf das Verschriftlicheneigener empirischer Daten an.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden zeigen in einem Portfolio, dass sie in der Lage sind, charakteristischewissenschaftssprachliche Merkmale der Darstellung der Ergebnisse und der Diskussionin empirischen Texten auf das Verschriftlichen eigener empirischer Daten anzuwenden.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7912
Modul SK.IKG-ISZ.18<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.18: Wissenschaftssprache für das akademischeSchreibenEnglish title: Terminology and style for the writing of academic textsLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop erlernen Studierende, sich wissenschaftssprachlich inakademischen Texten auszudrücken. Dazu werden zunächst in authentischenTexten Merkmale von Wissenschaftssprache durch verschiedene Analyseansätzeheraus kristallisiert. Dabei werden zum einen fachspezifische Merkmale herausgearbeitet und zum anderen Ausdrücke, die sich einer fächerübergreifenden(alltäglichen) Wissenschaftssprache zuordnen lassen. Als produktiver Schritt werdenwissenschaftssprachliche Formulierungen zielgerichtet in eigenen akademischen Textenumgesetzt.Lehrveranstaltung: Wissenschaftssprache für das akademische Schreiben(Workshop)3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse in fächerübergreifender (alltäglicher) und fachspezifischerWissenschaftssprache, Kompetenzen im zielgerichteten Umsetzenwissenschaftssprachlicher Kenntnisse in eigene akademische TeiltexteZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7913
Modul SK.IKG-ISZ.19<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.19: Verfassen von ExposésEnglish title: Writing proposalsLernziele/Kompetenzen:Dieses Modul richtet sich an Studierende, die für umfangreichere akademische Texte(z.B. eine Hausarbeit, eine Abschlussarbeit oder auch eine Promotion) ein Exposéverfassen wollen.Der Workshop hat zum Ziel, dass Studierende sich mit den Komponentenauseinandersetzen, die ein Exposé beinhaltet. Hierbei soll ihnen bewusst werden, dasssie durch das Exposé dazu gebracht werden, die geplante Arbeit zunächst vollständigzu durchdenken und in Teilarbeitsschritte zu zerlegen.Die Studierenden lernen die Elemente eines Exposés mit ihrer jeweiligen Funktionkennen, analysieren Beispiel-Exposés und wenden ihre Kenntnisse auf eigene geplanteTexte an. Zudem wird der komplexe wissenschaftliche Schreibprozess geübt, indemTeiltexte des Exposés verfasst und gegenseitig redigiert werden.3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 StundenLernziele: Kenntnisse über die Textart Exposé, Transfer der Kenntnisse auf die geplanteeigene Arbeit, Umsetzen wissenschaftlicher Schreibkenntnisse, Kenntnisse im Gebenund Nehmen von Feedback.Lehrveranstaltung: Workshop1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme; konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse über die Textart Exposé, Transfer der Kenntnisse auf eigene geplanteArbeiten, Umsetzen wissenschaftlicher Schreibkenntnisse, Kenntnisse im Geben undNehmen von FeedbackZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7914
Modul SK.IKG-ISZ.20<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.20: Effizient und adressatenorientiert Schreibenim BerufEnglish title: Written communication in professional contextsLernziele/Kompetenzen:Kenntnisse über ausgewählte berufsrelevante Textarten, Überblick über notwendigeArbeitsschritte zurRealisierung dieser Texte, Umsetzung von Kriterien adressatenorientierten SchreibensLehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:aktive Teilnahme am Workshop, konzipierende Schreibaufgaben (max. 20 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse über berufsrelevante Textsorten und Kriterien adressatenorientierterTexte, Überblick über notwendige Arbeitsschritte bei der Textproduktion, Transfer derKenntnisse auf eigene Texte, Kenntnisse im Geben und Nehmen von FeedbackZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 3Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7915
Modul SK.IKG-ISZ.21<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.21: Populärwissenschaftliches SchreibenEnglish title: Popular science writingLernziele/Kompetenzen:Dieses Modul richtet sich an Studierende, die komplexe fachwissenschaftliche Inhaltefür ein breiteres fachlich interessiertes Publikum aufbereiten möchten, wie es z.B. imspäteren Berufsleben notwendig wird.Es hat zum Ziel, dass sich die Teilnehmenden mit charakteristischen Stilelementensowie ihrer sprachlichen Realisierung populärwissenschaftlicher Texte auseinandersetzen, um diese selbst bewusst einsetzen zu können, wenn Sie für ein breiteresFachpublikum schreiben.3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 StundenHierfür werden wissenschaftliche Textarten mit ausgewählten populärwissenschaftlichenTextarten verglichen, um die Charakteristika und Lesewirkungen der letztgenanntenherauszuarbeiten. Des weiteren setzen die Studierenden die erlernten Stilmittelund sprachlichen Elemente produktiv um, indem sie eigene wissenschaftliche Textepopulärwissenschaftlich aufbereiten und einer Leserschaft zur Verfügung stellen.Lehrveranstaltung: Workshop1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Analyse-Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse über ausgewählte populärwissenschaftliche Textarten mit Stilmitteln undsprachlichen Realisierungen, Überblick über notwendige Arbeitsschritte zur Realisierungdieser Texte, Umsetzung von Kriterien adressatenorientierten Schreibens.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7916
Modul SK.IKG-ISZ.22<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.22: Essays schreiben für Studierende der Geistes-und SozialwissenschaftenEnglish title: Essay writing for students in the Humanities and Social SciencesLernziele/Kompetenzen:Der Essay als Textsorte findet einen zunehmend größeren Verbreitungsgrad in geistesundsozialwissenschaftlichen Disziplinen. Allerdings bleibt vielfach unklar, was unterdieser Textsorte im deutschsprachigen Kontext verstanden wird.Daher werden in diesem Modul Essays aus Wissenschaft und Feuilleton in ihremAufbau und ihrer Funktionalität bis hin zu Stilfragen thematisiert. Das Ziel bestehtdarin, dass sich die Studierenden über unterschiedliche Formen von Essays mit ihrencharakteristischen sprachlichen Realisierungsformen im Deutschen auseinander setzen.Neben der Analyse von Essays wird das erworbene Wissen auf das eigene Schreibenvon Essays angewandt, Verfahren des Schreibprozesses beim Verfassen von Essays,so dass die Studierenden ein reflektiertes Wissen über das Verfassen von Essayserlangen, das sie auf das Verfassen von Essay in ihren Fachdisziplinen übertragen undggf. anpassen können.Lehrveranstaltung: Workshop4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Analyse-Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse über den sprachlichen Aufbau, Stil und Funktionalität von Essays ausWissenschaft und Feuilleton, Wissen über das Verfassen von Essays, Überblick übernotwendige Arbeitsschritte zur Realisierung dieser TextsorteZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7917
Modul SK.IKG-ISZ.23<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.23: Zusammenfassungen, Abstract, RezensionenschreibenEnglish title: Summary, abstract and review writingLernziele/Kompetenzen:Zusammenfassungen, Abstracts und Rezensionen im akademischen Kontext sind einzentraler Bestandteil für wissenschaftliche Diskussionen und stellen somit eine derBasiskenntnisse dar, um erfolgreich am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen zukönnen. Insofern ist es erforderlich, dass Studierende die funktionalen Bestandteile,sprachlichen Realisierungen sowie Verfahren der Erstellung dieser Textartenkennenlernen, analytisch reflektieren und selbst produzieren können.4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 StundenDas Ziel des Moduls besteht darin, dass die Studierenden die wissenschaftlichkorrekte Wiedergabe von veröffentlichtem fachwissenschaftlichen Wissen in sprachlichangemessener Weise wiedergeben, kritisch Stellung beziehen und ihre Positionenherleiten und begründen können und zudem mit weiteren wissenschaftlichenErkenntnissen verknüpfen können, um einen Kontext im wissenschaftlichen Diskursherzustellen.Lehrveranstaltung: Workshop1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Analyse-Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse über den sprachlichen Aufbau, Stil und Funktionalität dieser Textarten imakademischen Kontext,Überblick über notwendige Arbeitsschritte zur Realisierung dieser Textarten, Umsetzungvon Kriterien adressatenorientierten SchreibensZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7918
Modul SK.IKG-ISZ.24<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.24: Bewerbungen schreiben <strong>II</strong>English title: Writing job applications <strong>II</strong>Lernziele/Kompetenzen:In diesem Modul erlernen Studierende hinreichende Kenntnisse zum Verfassen vonBewerbungen für erste Anstellungen nach Abschluss ihres Fachstudiums. Hierzugehören die Auswertung von Stellenanzeigen, vertiefte Kenntnisse über den Aufbauund die sprachliche Realisierung von Bewerbungsanschreiben. Zudem erlernen dieStudierenden einen (deutschsprachigen) Lebenslauf zu verfassen, der den Standardsfür eine Bewerbung entspricht sowie vertiefte Kenntnisse in deutscher Zeugnissprache.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige, aktive Teilnahme am WorkshopPrüfungsanforderungen:Kompetenzen im Verfassen von Bewerbungen, reflektiertes Wissen überStellenanzeigen und ZeugnisspracheZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7919
Modul SK.IKG-ISZ.25<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.25: Journalistisches Schreiben <strong>II</strong>English title: Writing for newspapers and magazines <strong>II</strong>Lernziele/Kompetenzen:In diesem Kurs zum journalistischen Schreiben als berufsrelevanterSchlüsselkompetenz erlernen die Studierende meinungsbezogene journalistischeTextarten, wie z.B. Kommentare in ihrem Aufbau und der sprachlichen Gestaltungkennen und selbst zu produzieren. Ziel ist es, dass sie diese Textarten auf Inhalte ihrerFachdisziplin anwenden, so dass sie komplexere Sachverhalte meinungsbezogen fürein breiteres Publikum aufbereiten können. Zudem erlernen Sie meinungsbzogeneTextarten medienspezifisch zu gestalten.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige, aktive Teilnahme am WorkshopPrüfungsanforderungen:systematische Kenntnisse über Aufbau und sprachliche Gestaltungmeinungsbezogener, journalistischer Texte, Schreibprozesswissen über das Erstellenmeinungsbezogner Texteregelmäßige Teilnahme; konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:Teilnahme am Modul Sk.IKG-ISZ. 15 (JouralistischesSchreiben I)Modulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7920
Modul SK.IKG-ISZ.26<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.26: Schreiben im Lehrer_innen-BerufLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erlernen relevante Textarten, wie z.B. Aufgabenstellungen,Lehrer_innenbriefe, Gutachten, in ihrem Aufbau und der sprachlichen Gestaltungkennen und diese anhand authentischer Beispiele adressatengerecht selbst zuproduzieren.Lehrveranstaltung: Workshop3 C (Anteil SK: 3C)1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio, Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsanforderungen:systematische Kenntnisse charakteristischer Textarten im Lehrer_innen-BerufZugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau B2Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7921
Modul SK.IKG-ISZ.27<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.27: Vergleich akademischer Schreibtraditionenfür Studierende der Sozialwissenschaften: Deutsch und EnglischLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erlernen in diesem Workshop verschiedene Schreibtraditionenund deren Umsetzung in sozialwissenschaftlichen Textarten kennen. Hierfür werdenenglische und deutsche sozialwissenschaftliche Texte hinsichtlich ihres Aufbaus,ihrer Leserorientierung, der Art der Argumentation und der sprachlichen Gestaltunganalysiert. Desweiteren setzen die Studierenden das erworbene Wissen um, indem siefür ihr Studienfach relevante Textarten in beiden Sprachen selbst produzieren.Lehrveranstaltung: Workshop4 C (Anteil SK: 4C)2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio, Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige, aktive Teilnahme am WorkshopPrüfungsanforderungen:Reflektiertes Wissen über sozialwissenschaftliche Schreibtraditionen in denWissenschaftssprachen Deutsch und EnglischZugangsvoraussetzungen:Deutsch- und Englischkenntnisse: mind. B2 (GER)Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7922
Modul SK.IKG-ISZ.28<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.28: Wissenschaftlicher StilEnglish title: Academic Writing StylesLernziele/Kompetenzen:In diesem Workshop analysieren die Studierenden unterschiedliche Formenwissenschaftlichen Stils und reflektieren ihren eigenen Ausdruck in akademischenTexten.Ziel ist, dass die Studierenden ein Bewusstsein für die Möglichkeiten wissenschaftlicherAusdrucksweise entwickeln und zu einem eigenen Stil finden, der sowohl denAnforderungen an wissenschaftliche Texte als auch den eigenen Ansprüchender Schreibenden entspricht. Hierzu werden neben der sprachlichen Analysewissenschaftlicher Texte eigene akademische Texte auf ihre sprachlichen Merkmale hinuntersucht, unterschiedliche Stile erprobt und kurze Texte geschrieben, zu denen sichdie Teilnehmenden untereinander Rückmeldungen geben.Lehrveranstaltung: Workshop3 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:76 Stunden1 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:unterschiedliche Varianten von wissenschaftlichem Stil kennen und einordnen können,den eigenen Stil reflektieren und variierenPrüfungsanforderungen:Portfolio (max. 20 Seiten; benotet)Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau C1Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7923
Modul SK.IKG-ISZ.<strong>29</strong><strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.<strong>29</strong>: Akademisches Schreiben erforschenEnglish title: Researching Academic WritingLernziele/Kompetenzen:In dieser Veranstaltung erforschen fortgeschrittene Bachelor-Studierende akademischeSchreibprozesse. Ziel ist es, dass sie sich mit verschiedenen wissenschaftlichenMethoden zur Erforschung von Schreibprozessen auseinandersetzen und diese aufeigene, kleinere Forschungsprojekte anwenden.12 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:72 StundenSelbststudium:288 StundenKompetenzen:Theoretische und praktische Vertiefung wissenschaftlicher Methoden im Themenfeld derSchreibdidaktikLehrveranstaltungen:1. Workshop2. ForschungsprojektPrüfung: Forschungsbericht (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:forschungsvorbereitende Aufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnis wissenschaftlicher Methoden zur Erforschung von Schreibprozessen undAnwendung von MethodenPrüfungsanforderungen:systematisches Wissen über Forschungsmethoden und -ansätze zur Erforschung vonSchreibkompetenzen und -prozessenPortfolio max. 20S.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau C1Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7924
Modul SK.IKG-ISZ.30<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.30: ProText: Einführung ins Texten im BerufEnglish title: ProText: Introduction to professional writingLernziele/Kompetenzen:In diesem Seminar erlernen Studierende linguistische Grundlagen zum Texten inverschiedenen Berufsfeldern, wenden die erlernten Kenntnisse auf ausgewähltePraxisbereiche an und geben sich gegenseitig ein Feedback.Kompetenzen:6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 Stundenlinguistische Erkenntnisse auf das Texten im Beruf anwendenLehrveranstaltung: Seminar2 SWSPrüfung: Portfolio (max. 15 Seiten)Prüfungsvorleistungen:konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Linguistisches Grundlagenwissen zum Texten im BerufPortfolio max. 20 S.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau C1Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7925
Modul SK.IKG-ISZ.31<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.31: ProText: PraxisstudienLernziele/Kompetenzen:In dem Workshop erhalten Studierende von Expert_innen aus der Praxis einen Einblickin das Texten in verschiedenen Berufsfeldern. In einem sich anschließenden Praktikumsetzen sich die Studierenden eigenständig mit dem Texten in ausgewählten beruflichenKontexten auseinander.6 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:166 StundenLehrveranstaltungen:1. Praktikum2. WorkshopPrüfung: Praktikumsbericht (max. 20 S.)Prüfungsvorleistungen:konzipierende Schreibaufgaben (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Reflexive Kenntnisse über die Anforderungen an das Schreiben und an Texte inverschiedenen BerufsfeldernPrüfungsanforderungen:Umsetzung von Kenntnissen zum berufsbezogenen TextenPraktikumsbericht max. 20 S.Zugangsvoraussetzungen:Deutschkenntnisse wenigstens auf GER-Niveau C1Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:AlleDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7926
Modul SK.IKG-ISZ.32<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.IKG-ISZ.32: Ausbildung zum/zur Schreibberater_in: PraxisstudienEnglish title: Writing Tutor Training <strong>II</strong>Lernziele/Kompetenzen:In diesem Modul vertiefen fortgeschrittene Studierende die in Modul SK.IKG-ISZ.1erworbenen Kenntnisse, indem sie das Erlernte in eigenen Beratungen erproben undreflektieren. In einem eigenen Projekt oder durch Teilnahme an vertiefenden Seminarensetzen sie jeweils eigene schreibdidaktische Schwerpunkte.8 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:156 StundenLernziele: Weiterentwicklung von Beratungskompetenzen im Bereich Schreibberatung,vertieftes Verständnis von Strategien zur Unterstützung von Schreibprozessen,eigenständige Umsetzung von LerninhaltenLehrveranstaltungen:1. eigenständiges Projekt (Option 1: Schreiben in der Erstsprache Deutsch)Dieses Projekt führen nur Studierende durch, die Option 1 gewählt haben.2. Methodik/Didaktik der Vermittlung interkultureller Kompetenz (Option 2:Schreiben in interkulturellen Kontexten)An diesem Seminar nehmen nur Studierende, die Option 2 wählen, teil.2 SWS3. Begleitseminar zum Praktikum 2 SWS4. Praktikum (30h)Prüfung: Projektbericht (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:aktive Teilnahme an Seminaren und Präsentation (10 Minuten)Prüfungsanforderungen:Vertiefte Beratungskompetenz im Bereich Schreibberatung, Reflexionsfähigkeit,eigenständige Umsetzung von Inhalten und StrategienZugangsvoraussetzungen:Erfolgreicher Abschluss des Moduls SK.IKG-ISZ.1Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Melanie BrinkschulteElla GrieshammerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 4Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7927
Modul SK.NL.1<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.NL.1: Niederländisch ILernziele/Kompetenzen:In dieser Übung wird den Teilnehmern die beinahe komplette niederländischeGrundgrammatik vermittelt, so dass bei erfolgreichem Abschluss das Sprachniveau A2 des europäischen Referenzrahmens erreicht wird. In der vorletzten Sitzung wird einezweistündige Klausur geschrieben.Lehrveranstaltung: Übung: Niederländisch I4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Klausur (120 Minuten), unbenotetPrüfungsanforderungen:Beherrschung der niederländischen Grundgrammatik. Aktive und passiveSprachkenntnisse des Niederländischen auf dem Niveau A2 des GemeinsamenEuropäischen Referenzrahmens.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Holger WiedenstriedDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:35Bemerkungen:Philosophische Fakultät – Studienangebote im ProfessionalisierungsbereichAnmeldemodalitäten: Anmeldung über StudIP<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7928
Modul SK.NL.2<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.NL.2: Niederländisch <strong>II</strong>Lernziele/Kompetenzen:In dieser Übung werden die noch fehlenden grundgrammatischen Kompetenzenvermittelt. Ebenfalls werden mit den Teilnehmern die in der vorangegangenen Übungerworbenen sprachlichen Kompetenzen vertieft und eingeübt. Durch Übersetzungs- undKonversationsübungen wird bei erfolgreichem Abschluss der Übung das SprachniveauB 1 des europäischen Referenzrahmens erreicht werden. In der vorletzten Sitzung wirdeine zweistündige Klausur geschrieben.Lehrveranstaltung: Übung: Niederländisch <strong>II</strong>4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Klausur (120 Minuten), unbenotetPrüfungsanforderungen:Aktive und passive Sprachkenntnisse des Niederländischen auf dem Niveau B1 desGemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.Zugangsvoraussetzungen:SK.NL.1oder vergleichbare Kenntnisse der niederländischenSpracheSprache:Deutsch, NiederländischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Holger WiedenstriedDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:35Bemerkungen:Philosophische Fakultät – Studienangebote im ProfessionalisierungsbereichAnmeldemodalitäten: Anmeldung über StudIP<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 79<strong>29</strong>
Modul SK.NL.3<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.NL.3: Niederländisch <strong>II</strong>ILernziele/Kompetenzen:In dieser Übung werden mit den Teilnehmern die in den vorangegangenen Übungenerworbenen sprachlichen Kompetenzen vertieft und eingeübt. Durch anspruchsvolleÜbersetzungs- und Konversationsübungen wird bei erfolgreichem Abschluss der Übungdas Sprachniveau B 2 des europäischen Referenzrahmens erreicht werden. In dervorletzten Sitzung wird eine zweistündige Klausur geschrieben.Lehrveranstaltung: Übung: Niederländisch <strong>II</strong>I4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Klausur (120 Minuten), unbenotetPrüfungsanforderungen:Aktive und passive Sprachkenntnisse des Niederländischen auf dem Niveau B2 desGemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.Zugangsvoraussetzungen:SK.NL.2oder vergleichbare Kenntnisse der niederländischenSpracheSprache:Niederländisch, DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Holger WiedenstriedDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:35Bemerkungen:Philosophische Fakultät – Studienangebote im ProfessionalisierungsbereichAnmeldemodalitäten: Anmeldung über StudIP<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7930
Modul SK.NL.4<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.NL.4: Ausprache- und Übersetzungsübung NiederländischLernziele/Kompetenzen:Diese Übung richtet sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, an die Teilnehmerder Übung „Niederländisch I“. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl an dieser Übungwerden zwei Termine zur Auswahl angeboten. In dieser Übung wird die Aussprache desNiederländischen anhand literarischer und journalistischer Texte trainiert. Die gelesenenTexte werden ohne Wörterbuch übersetzt, um ein größeres Globalverständnis derniederländischen Sprache zu fördern und die Angst vor einem fremdsprachlichen Textzu minimieren.Lehrveranstaltung: Übung: Aussprache- und Übersetzungsübung NiederländischAngebotshäufigkeit: jedes Semester2 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:46 Stunden1 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 15 Minuten), unbenotetPrüfungsanforderungen:Aktive und passive Sprachkenntnisse des Niederländischen auf dem Niveau A2 desGemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.Zugangsvoraussetzungen:Ehemalige oder aktuelle Teilnahme an der ÜbungNiederländisch I oder geringe Kenntnisse derniederländischen SpracheSprache:Deutsch, NiederländischAngebotshäufigkeit:jedes Semester zweimalWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Holger WiedenstriedDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:35Bemerkungen:Philosophische Fakultät – Studienangebote im ProfessionalisierungsbereichMaximale Studierendenzahl: Jeweils 17Anmeldemodalitäten: Anmeldung über StudIP<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7931
Modul SK.NL.5<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.NL.5: Niederländischsprachige LiteraturLernziele/Kompetenzen:In dieser Übung lernen die Studierenden die Literaturen der Nachbarländer Niederlandeund Belgien in Auswahl gründlich kennen. Den Studierenden werden damitkomparatistische und landeskundliche Kenntnisse vermittelt. Außerdem wird durchdiese Übung der Umgang mit umfangreichen fremdsprachigen Texten gefördert. Zu deneinzelnen Themen werden die Teilnehmer jeweils ein zweistündiges Referat halten.Lehrveranstaltung: Übung: Niederländischsprachige Literatur4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Referat (ca. 120 Minuten), unbenotetPrüfungsanforderungen:Überblickswissen über niederländische und belgische Literatur, landeskundliche undkomparatistische Kenntnisse.Zugangsvoraussetzungen:SK.NL.3oder vergleichbare Kenntnisse der niederländischenSpracheSprache:Deutsch, NiederländischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Drs. Reinder ZondergeldDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 1 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:20Bemerkungen:Philosophische Fakultät – Studienangebote im ProfessionalisierungsbereichAnmeldemodalitäten: Anmeldung über StudIP<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7932
Modul SK.Phil.01<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen4 CModul SK.Phil.01: Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltungder Philosophischen FakultätEnglish title: Membership in the faculty student body self administrationLernziele/Kompetenzen:Durchdringung und aktive Mitgestaltung der studentischen Selbstverwaltung an derPhilosophischen Fakultät.Arbeitsaufwand:Präsenzzeit:120 StundenSelbststudium:0 StundenPrüfung: Tätigkeitsbericht (max. 2 Seiten), unbenotetPrüfungsanforderungen:1. Mitgliedschaft im Fachschaftsrat oder2. Tätigkeit als Fachgruppensprecher(in)Prüfungsanforderungen:Durchdringung und aktive Mitgestaltung der studentischen Selbstverwaltung an derPhilosophischen Fakultät.Zugangsvoraussetzungen:Nachweis der Mitgliedschaft in einem Organ derstudentischen SelbstverwaltungSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:apl. Prof. Dr. Albert Busch(Studiendekan)Dauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7933
Modul SK.Phil.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen5 CModul SK.Phil.02: Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltungder Philosophischen FakultätEnglish title: Student membership in the Faculty self administrationLernziele/Kompetenzen:Durchdringung und aktive Mitgestaltung der akademischen Selbstverwaltung an derPhilosophischen Fakultät.Arbeitsaufwand:Präsenzzeit:150 StundenSelbststudium:0 StundenPrüfung: Tätigkeitsbericht (max. 2 Seiten), unbenotetPrüfungsanforderungen:1. Mitgliedschaft im Fakultätsrat oder2. Mitgliedschaft in der Studienkommission oder3. Mitgliedschaft in der Struktur- und Haushaltskommission oder4. Mitgliedschaft in der GleichstellungskommissionPrüfungsanforderungen:Durchdringung und aktive Mitgestaltung der akademischen Selbstverwaltung an derPhilosophischen Fakultät.Zugangsvoraussetzungen:Nachweis der Mitgliedschaft im Fakultätsrat,der Studienkommission, der StrukturundHaushaltskommission oder derGleichstellungskommission der PhilosophischenFakultätSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:apl. Prof. Dr. Albert Busch(Studiendekan)Dauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7934
Modul SK.Phil.03<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.03: Tätigkeit als studentische(r) Tutor(in) an der PhilosophischenFakultätEnglish title: Function as Student Tutor in the Humanities FacultyLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage, Vermittlungs- undPräsentationskompetenzen im Rahmen eines Tutoriums anwenden zu können.6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 StundenPrüfung: Tätigkeitsbericht (max. 6.400 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsvorleistungen:Bescheinigung über die Durchführung des Tutoriums, Bescheinigung über den Besucheiner Tutoriumsschulung.Prüfungsanforderungen:Besuch einer Tutoriumsschulung, Durchführung des Tutoriums, regelmäßigeBesprechung mit dem zuständigen Lehrpersonal.Prüfungsanforderungen:Selbständige Durchführung eines Tutoriums unter regelmäßiger Rücksprache mitdem zuständigen Lehrpersonal; Inhalte und Leistungsanforderungen richten sichnach der dazugehörigen Lehrveranstaltung. Die Studierenden weisen nach, dass sieVermittlungs- und Präsentationstechniken erläutern und anwenden können.Zugangsvoraussetzungen:Erfolgreiche Bewerbung als Tutor(in)Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:apl. Prof. Dr. Albert Busch(Studiendekan)Dauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7935
Modul SK.Phil.04<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.04: Tätigkeit als Tutor(in) während der Orientierungsphasean der Philosophischen FakultätEnglish title: Function as Student Tutor in the Humanities Faculty OrientationProgrammeLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage, ihre Sozialkompetenzpraktisch während der Orientierungsphase anwenden und einbringen zu können.Lehrveranstaltung: O-Phasen-Workshop3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:30 StundenSelbststudium:60 Stunden2 SWSPrüfung: Tätigkeitsbericht über die Durchführung der Orientierungsphase(max .12.800 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsanforderungen:Tätigkeit während der Orientierungsphase eines Fachs der Philosophischen Fakultätund Besuch des O-Phasen-Workshops.Prüfungsanforderungen:Die Studierenden geben Einführungen in die Prüfungs-/Studienordnung, dieAn- und Abmeldemodalitäten von FlexNow, unternehmen Führungen durch dieSeminarbibliothek und beteiligen sich in anderer Weise an der Planung undDurchführung der Orientierungsphase des jeweiligen Fachs. Die Tätigkeit dient derErlangung von Sozialkompetenzen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, FremdspracheAngebotshäufigkeit:nach AngebotWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7936
Modul SK.Phil.05<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.05: Studentisches MentoringEnglish title: Student mentoringLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage,• Peer-Meentoring zu organisieren und durchzuführen• für das Mentoring passende Organisations- und Lerntechniken zu identifizierenund anzuwenden4 C1 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:14 StundenSelbststudium:106 StundenSie sind in der Lage, Informationen und relevantes Wissen für ihre Zielgruppeaufzuarbeiten und fähig, mit den Grundlagen der Präsentations- und Medientechnikumzugehen. Sie können in Konfliktsituationen adäquat handeln und wendengrundlegende Techniken der Kommunikations- und Gesprächsführung an. Sie könnenselbstreflektiert im Team arbeiten und grundlegende Fragen zur Studienorganisationund zum wissenschaftlichen Arbeiten erläutern.Das Modul vermittelt Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Selbst-, Sach- undMethodenkompetenz.Lehrveranstaltungen:1. Qualifizierungsworkshop für Peer-Mentoring 1 SWS2. Praxisteil: Durchführung von Peer-MentoringPrüfung: Essay (max. 12.800 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsvorleistungen:Nachweis der aktiven Teilnahme an einer Mentoringqualifizierung und Durchführung vonPeer-Mentoring über 2 Semester hinweg.Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie• Mentoring verstehen und erklären können• grundlegendes Wissen über Kommunikationsansätze und Gesprächsführunghaben• ihre Rolle als Mentor/-in mit Hilfe des theoretischen Wissens reflektieren könnenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Nina GülcherDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Bachelor: 3 - 6; Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7937
Modul SK.Phil.20<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.20: Kommunikation und GeschlechtEnglish title: Communication and GenderLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage:• Kommunikationsprozesse bezüglich ihrer wichtigsten Formen und Technikenanalysieren und beschreiben zu können• gesellschaftliche Einflüsse auf die Art und Weise, wie Menschen miteinanderkommunizieren, erkennen zu können• geschlechtsspezifische Einflüsse und Wirkungen auf Kommunikation hinsichtlichder Lautstärke, Gestiken, der Körperhaltungen und der Blickrichtungen erkennenzu können• daraus resultierende geschlechtstypische Gesprächsstrukturen und ihre möglichenFallstricke im Studienalltag analysieren zu können• unterschiedliche Gesprächstaktiken und -techniken praktisch umzusetzen• Feedbackregeln zu verstehen und anwenden zu können3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:16 StundenSelbststudium:74 StundenLehrveranstaltungen:1. Workshop: Typische Gesprächsstrukturen 1 SWS2. Workshop: Geschlechtsspezifische Kommunikation 1 SWSPrüfung: Schriftliche Reflexion (max.16.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsvorleistungen:regelmäßige TeilnahmePrüfungsanforderungen:Kenntnisse über Kommunikationsformen und -techniken sowie die Fähigkeit,geschlechtsspezifische Strukturen in der Praxis zu erkennen; Fähigkeit, den eigenenKommunikationsstil kritisch zu reflektieren sowie Kompetenzen in der Selbstpräsentationsind nachzuweisenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7938
Modul SK.Phil.21<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.21: KonfliktmanagementEnglish title: Dealing with conflictsLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage, Konfliktsituationen zuerkennen, sie zu analysieren, kritisch zu reflektieren und Lösungsansätze aufzuzeigen.3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:16 StundenSelbststudium:74 StundenLehrveranstaltungen:1. Workshop: Konfliktsituationen im Uni-Alltag 1 SWS2. Workshop: Alternative Umgangsformen mit Konflikten entwickeln 1 SWSPrüfung: Schriftliche Reflexion (max.16.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsvorleistungen:regelmäßige TeilnahmePrüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung Kenntnisse praktischer Technikenund Methoden des Konfliktmanagements, Fähigkeit der kritischen Reflexionvon Konfliktsituationen in ausgewählten Praxisbereichen sowie Kenntnisse überHandlungskompetenzen im Kooperations- und Konfliktmanagement nach.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:10<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7939
Modul SK.Phil.22<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.22: ModerationstechnikenEnglish title: Techniques for chairing discussionsLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage, Grundlagen desModerierens, Moderations- und Gesprächstechniken zu beschreiben, zu erläutern undanzuwenden.3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:16 StundenSelbststudium:74 StundenLehrveranstaltungen:1. Workshop: Grundlagen des Moderierens 1 SWS2. Workshop: Moderationstechniken und -methoden 1 SWSPrüfung: Praktische Prüfung (Durchführung einer Moderation; ca. 10 Min.),unbenotetPrüfungsvorleistungen:regelmäßige TeilnahmePrüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung Kenntnisse in Moderationsgrundlagenund von Moderations-, Gesprächstechniken nach. Sie demonstrieren ihre Fähigkeit, eineModeration in verschiedenen praktischen Zusammenhängen durchzuführen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7940
Modul SK.Phil.23<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.23: Diversity-KompetenzEnglish title: Diversity CompetenceLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erwerben grundlegendes Wissen über das Konzept „Diversity“. Dazugehören Kenntnisse über die Geschichte und theoretische Einbettung des Konzepts wieauch das Wissen über verschiedene praktische Handlungsansätze zur Umsetzung von„Diversity Management“. Die Studierenden kennen zentrale Differenzkategorien wie z.B.Geschlecht, sexuelle Orientierung, sozialer Status, Ethnizität und Religion und wissenum deren Einfluss auf die Zugänge von einzelnen Menschen und Gruppen zu Räumen,Ressourcen und Chancen.3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:16 StundenSelbststudium:74 StundenDie Studierenden sind in der Lage, verschiedene Ansätze eines „DiversityManagements“ zu unterscheiden und ihre theoretischen Kenntnisse anhand vonkonkreten praktischen Umsetzungsbereichen (z.B. an der Hochschule, in Schulen,Wirtschaftsunternehmen oder Verwaltungen) zu reflektieren.Sie erwerben Grundlagen einer Diversity-Kompetenz (z.B. die Reflexion eigenerVorurteilsstrukturen) und können Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen, in denen„Diversity“ eine Rolle spielt, erarbeiten.Lehrveranstaltungen:1. Workshop oder Besuch einer Vorlesungsreihe zum Thema Diversity 1 SWS2. Kolloquium 1 SWSPrüfung: Schriftliche Reflexion eines Praxisbeispiels oder Hausarbeit (max. 32.000Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsvorleistungen:Nachweis der aktiven Teilnahme an Workshop und KolloquiumPrüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie- über grundlegende theoretische Kenntnisse über verschiedene Diversity-Ansätzeverfügen- selbständig Ansätze von Diversity-Management in der Praxis erkennen können- ihr theoretisches Wissen anhand eines Praxisbeispiels reflektieren könnenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Nina GülcherDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7941
Modul SK.Phil.23Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7942
Modul SK.Phil.24<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.24: Studentische Filme planen, umsetzen und veröffentlichenEnglish title: Student films: planning, shooting them and having them releasedLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden haben einen Überblick über den Ablauf einer Filmproduktion, könneneine Filmidee in einem Exposé oder in einem Drehbuch und bildsprachlich adäquatin Form eines Storyboards entwickeln, besitzen praktische Erfahrungen in der Arbeitmit einer Kamera, der Aufnahme von Ton und der Beleuchtung, sowie mit der PostProduction und dem Filmschnitt, sind für die Berücksichtigung urheberrechtlicherProblemstellungen sensibilisiert, kennen verschiedene Methoden der Veröffentlichungund Vervielfältigung von Filmen in Theorie und Praxis.6 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:42 StundenSelbststudium:138 StundenAm Lehrangebot in Form von Seminaren mit Übungen sind Tutorinnen und Tutoren ausder Praxis bzw. mit einschlägiger praktischer Erfahrung beteiligt.Lehrveranstaltung: Seminar2 SWSPrüfung: Praktische Prüfung, unbenotetPrüfungsanforderungen:Schriftliche Leistungen Umfang von insg. max. 10 Seiten, Präsentationen im Umfangvon ca. 15 Min., sowie Film von 3- 5 Min.Lehrveranstaltung: Übung1 SWSPrüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie• einen Überblick über den Ablauf einer Filmproduktion geben können,• eine Filmidee schriftlich in einem Exposé, in einem Drehbuch darstellen undbildsprachlich adäquat in Form eines Storyboards entwickeln können,• Filmtechniken wie die Arbeit mit einer Kamera, Tonaufnahme,Beleuchtungstechnik, Post Production und Filmschnitt erläutern und anwendenkönnen• die Berücksichtigung urheberrechtlicher Problemstellungen erklären können• verschiedene Methoden der Veröffentlichung und Vervielfältigung von Filmen inTheorie und Praxis einordnen können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Holger HowindDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7943
Modul SK.Phil.24Maximale Studierendenzahl:16<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7944
Modul SK.Phil.50<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen4 CModul SK.Phil.50: Berufsqualifizierendes Praktikum für Geisteswissenschaftler/innenIEnglish title: Professional internship for students in the HumanitiesLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden zeigen im Rahmen eines selbst gewählten Praktikums, dass sie dieim Studium erworbenen Kenntnisse und Techniken in einer Praktikumstätigkeit (z. B: imJournalismus, bei Bildungsträgern, in der Erwachsenenbildung, einer Kulturinstitution, inder Verwaltung oder im Dienstleistungsbereich) anwenden und den Prozess sowie dieeingesetzten Methoden reflektieren und in einen geeigneten theoretisch-methodischenBezugsrahmen stellen können.Arbeitsaufwand:Präsenzzeit:0 StundenSelbststudium:120 StundenLehrveranstaltung: Praktikum (120 Stunden)Prüfung: Praktikumsbericht (max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsanforderungen:Die Studierenden sollen zeigen, dass sie die während eines Praktikums erworbenenanwendungsbezogenen Kenntnisse und Erfahrungen reflektieren und in einengeeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen stellen können.Zugangsvoraussetzungen:Erfolgreiche Bewerbung als Praktikant/inSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7945
Modul SK.Phil.51<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.51: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- undGeisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong>English title: Professional internship for students in the HumanitiesLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage:• grundlegende Recherchetechniken zu Praktikums- und Berufsfindung anzuwenden• aus dem Arbeitsmarkt passende Angebote auszuwählen• die Bestandteile einer vollständigen schriftlichen Bewerbung zu erläutern undBewerbungsunterlagen zu erstellen• im Studium erlerntes Wissen in der Praxis zu reflektieren, anzuwenden und ineinen geeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen zu stellen8 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:174 StundenSelbststudium:66 StundenIm praktischen Teil (einschlägiges Praktikum) entwickeln die Studierenden Perspektivenzur Berufswahl.Das Praktikum kann während des Studiums und bis zu maximal einem Jahr vor Beginndes Studiums geleistet worden sein. Bis zu drei Praktika können kombiniert werden.Praktika können im In- und Ausland absolviert als auch in Voll- oder Teilzeit abgeleistetwerden.Lehrveranstaltungen:1. Workshop aus der KOMPASS-Reihe und 4 Expert-Talks ebenfalls aus derKOMPASS-Reihe2 SWS2. Praxisteil: Praktikum im Umfang von 160 StundenPrüfung: Praktikumsbericht (max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie die anwendungsbezogenenKenntnisse, Erfahrungen und Arbeitssituationen aus dem Praxisteil reflektieren und ineinen geeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen stellen können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 3Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7946
Modul SK.Phil.52<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.52: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- undGeisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong>IEnglish title: Professional internship for students in the HumanitiesLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage:• grundlegende Recherchetechniken zu Praktikums- und Berufsfindung anzuwenden• aus dem Arbeitsmarkt passende Angebote auszuwählen• die Bestandteile einer vollständigen schriftlichen Bewerbung zu erläutern undBewerbungsunterlagen zu erstellen• im Studium erlerntes Wissen in der Praxis zu reflektieren, anzuwenden und ineinen geeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen zu stellen10 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:234 StundenSelbststudium:66 StundenIm praktischen Teil (einschlägiges Praktikum) entwickeln die Studierenden Perspektivenzur Berufswahl.Das Praktikum kann während des Studiums und bis zu maximal einem Jahr vor Beginndes Studiums geleistet worden sein. Bis zu drei Praktika können kombiniert werden.Praktika können im In- und Ausland absolviert als auch in Voll- oder Teilzeit abgeleistetwerden.Lehrveranstaltungen:1. Workshop aus der KOMPASS-Reihe und 4 Expert-Talks ebenfalls aus derKOMPASS-Reihe2 SWS2. Praxisteil: Praktikum im Umfang von 220 StundenPrüfung: Praktikumsbericht (max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie die anwendungsbezogenenKenntnisse, Erfahrungen und Arbeitssituationen aus dem Praxisteil reflektieren und ineinen geeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen stellen können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 3Maximale Studierendenzahl:35<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7947
Modul SK.Phil.53<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.53: Berufsqualifizierendes Praktikum für Kultur- undGeisteswissenschaftler/innen <strong>II</strong><strong>II</strong>English title: Professional internship for students in the HumanitiesLernziele/Kompetenzen:Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage:• grundlegende Recherchetechniken zu Praktikums- und Berufsfindung anzuwenden• aus dem Arbeitsmarkt passende Angebote auszuwählen• die Bestandteile einer vollständigen schriftlichen Bewerbung zu erläutern undBewerbungsunterlagen zu erstellen• im Studium erlerntes Wissen in der Praxis zu reflektieren, anzuwenden und ineinen geeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen zu stellen12 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:<strong>29</strong>4 StundenSelbststudium:66 StundenIm praktischen Teil (einschlägiges Praktikum) entwickeln die Studierenden Perspektivenzur Berufswahl.Das Praktikum kann während des Studiums und bis zu maximal einem Jahr vor Beginndes Studiums geleistet worden sein. Bis zu drei Praktika können kombiniert werden.Praktika können im In- und Ausland absolviert als auch in Voll- oder Teilzeit abgeleistetwerden.Lehrveranstaltungen:1. Workshop aus der KOMPASS-Reihe und 4 Expert-Talks ebenfalls aus derKOMPASS-Reihe2 SWS2. Praxisteil: Praktikum im Umfang von 280 StundenPrüfung: Praktikumsbericht (max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie die anwendungsbezogenenKenntnisse, Erfahrungen und Arbeitssituationen aus dem Praxisteil reflektieren und ineinen geeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen stellen können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 3Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7948
Modul SK.Phil.54<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.54: Praxismodul Projektmanagement I: Planung undOrganisation der Berufsinformations- und Firmenkontaktmesse fürGeisteswissenschaftler/innenLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, übergreifende Kompetenzen im Bereich desProjektmanagements, d.h.• Methoden der Projektplanung, -dokumentation und -evaluation• Wissen um Anwendung der Entwicklungs- und Planungsinstrumente,• Zielorientierung und Selbstmanagementmethoden6 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:88 StundenSelbststudium:92 Stundenin die Praxis umzusetzen.Die Studierenden arbeiten bei der Planung und Organisation der BerufsinformationsundFirmenkontaktmesse PraxisBörse der <strong>Universität</strong> Göttingen mit. Sie entwickelnneue Konzepte und Formate speziell für GeisteswissenschaftlerInnen im Rahmen derGroßveranstaltung, prüfen die Umsetzungsmöglichkeiten, planen die Durchführung undevaluieren die Ergebnisse. Sie können produktive Kommunikationsmethoden in derArbeit mit Projektteams anwenden.Lehrveranstaltungen:1. Praxisteil: Vorbereitung der speziellen Angebote für die Geisteswissenschaftler/innen im Rahmen der PraxisBörse der <strong>Universität</strong> Göttingen2. 2-tägiger Workshop Projekt- und Zeitmanagement und 2-tägiger WorkshopTeamarbeit und Kommunikationskompetenz4 SWS2 SWSPrüfung: Bericht im Umfang von max. 16.000 Zeichen inkl. Leerzeichen,Präsentation des Berichts (10 Min.), unbenotetPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie die Kenntnisse und Erfahrungendes Projektmanagements und der Teamarbeit anwendungsbezogenen reflektieren undanwenden können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßig, über 2 Semester WiSe und SoSeWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffAnna KlobuchowskiDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:10<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7949
Modul SK.Phil.55<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.55: Praxismodul Projektmanagement <strong>II</strong>: Durchführungder Berufsinformations- und Firmenkontaktmesse PraxisBörsefür Geisteswissenschaftler/innenLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, übergreifende Kompetenzen im Bereich desProjektmanagements, d.h.• Methoden der Projektdokumentation und -evaluation• Wissen um Anwendung der Entwicklungs- und Planungsinstrumente,• Zielorientierung und Selbstmanagementmethoden3 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:52 StundenSelbststudium:38 Stundenin die Praxis umzusetzen.Die Studierenden arbeiten bei der Durchführung der Berufsinformations- undFirmenkontaktmesse PraxisBörse der <strong>Universität</strong> Göttingen mit. Sie betreuen dabei diespeziell für die GeisteswissenschaftlerInnen konzipierten Angebote. Dabei erlangensie übergreifende Sozialkompetenzen sowie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit.Sie sammeln wichtige Erfahrungen im Bereich teamorientiertes Arbeiten sowieKooperationsaufbau.Im Rahmen der PraxisBörse erhalten die Studierenden berufliche Orientierungshilfedurch eine qualifizierte Vor- und Nachbereitung des Messebesuchs.Lehrveranstaltungen:1. Praxisteil: Durchführung der geisteswissenschaftlichen PraxisBörse der<strong>Universität</strong> Göttingen2. Workshop Projektmanagement und Teamarbeit und WorkshopSelbstpräsentation1 SWS2 SWSPrüfung: Bericht im Umfang von max. 16.000 Zeichen inkl. Leerzeichen,Präsentation des Berichts (10 Min.), unbenotetPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie die Kenntnisse undErfahrungen des Projektmanagements, der Teamarbeit und der Selbstpräsentationanwendungsbezogenen reflektieren und anwenden können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßig, SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffAnna KlobuchowskiDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7950
Modul SK.Phil.55Maximale Studierendenzahl:10<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7951
Modul SK.Phil.56<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.56: Ehrenamtliche TätigkeitLernziele/Kompetenzen:Durch ehrenamtliche Tätigkeit erweitern Studierende nicht nur den eigenen Horizont,indem sie eigene Fähigkeiten erproben und weiterentwickeln, sondern erwerben durchdie praktische Erfahrung im bürgerschaftlichen Engagement auch Fähigkeiten imBereich der Sozial- und Selbstkompetenzen. Individuelle und kreative Kompetenzenund praktische Erfahrungen der Studierenden können so in einem ganzheitlich-aktivenLernprozess vereint werden.6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 StundenNach Abschluss des Moduls können Studierende sicher mit Personen ausunterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen kommunizieren und interagieren. Siekönnen Verantwortung gegenüber anderen übernehmen, soziale Räume mitgestalten,sich in neue Handlungsfelder einarbeiten und sie beweisen Teamfähigkeit.Studierende zeigen mit ehrenamtlichem Engagement Initiative und Zielstrebigkeit undverfügen über ein gutes Zeit- und Selbstmanagement.Lehrveranstaltungen:1. Workshop im Bereich der Selbst- und/oder SozialkompetenzenInhalte:(z.B. Diversity-Training, Interkulturelle Kompetenz, Konfliktmanagement, Kommunikationund Geschlecht, Social Justice, etc.)2 SWSAngebotshäufigkeit: nach Angebot2. Praxisteil: Ehrenamtliche Tätigkeit im Umfang von 150 StundenAngebotshäufigkeit: nach AngebotPrüfung: Anfertigung und Nachweis eines Studienbuchs/Lerntagebuchs (max.32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsvorleistungen:Teilnahme am Workshop und Nachweis über 150 h ehrenamtliche TätigkeitPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie die anwendungsbezogenenKenntnisse sowie ihre Erfahrungen aus dem Praxisteil reflektieren und in einengeeigneten theoretisch-methodischen Bezugsrahmen stellen können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:nach AngebotWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffNina GülcherDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7952
Modul SK.Phil.56Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7953
Modul SK.Phil.70<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.70: Berufseinstieg I: Kompetenzanalyse und BewerbungEnglish title: Career entry I: Competency analysis and job application formalitiesLernziele/Kompetenzen:Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden• sich auf dem Arbeitsmarkt orientieren• unterschiedliche Berufsfelder für Geisteswissenschaftler/innen kennenlernen• sich ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten bewusst werden3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:62 StundenDurch die Vortragsreihe können die Studierenden mögliche Berufsfelder unterscheiden.Aus Diskussionen mit Praktikerinnen/Praktikern der Arbeitswelt und ihrenInsiderinformationen zu Berufseinstieg und Karriere folgern sie individuelle beruflichePerspektiven. Nach der Übung wenden Studierende praktische Techniken undMethoden für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess und Berufseinstieg an.Lehrveranstaltung: WorkshopPrüfung: Präsentation (ca. 10 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung einesAnschreibens und eines Lebenslaufs (max. 9.600 Zeichen inkl. Leerzeichen),unbenotetPrüfungsvorleistungen:Nachweis/Zertifikat Kompetenzanalyse mit dem ProfilPASS und Workshop - Bewerbungfür Geisteswissenschaftlerinnen und GeisteswissenschaftlerPrüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie• praktische Techniken und Methoden für den Bewerbungsprozess und denBerufseinstieg, z.B. Recherchetechniken, anwenden können• ihr Bewerbungsmanagement organisieren können• ihre Selbstpräsentation einsetzen könnenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7954
Modul SK.Phil.71<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.71: Berufseinstieg <strong>II</strong>: KOMPASS - Kompetenzen, Perspektiven,AusblickeEnglish title: Career entry <strong>II</strong>: Compass. Competencies. Perspectives. Prospects. CareerEntry for students in the HumanitiesLernziele/Kompetenzen:Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden• sich auf dem Arbeitsmarkt orientieren• unterschiedliche Berufsfelder für Geisteswissenschaftlerinnen undGeisteswissenschaftler differenzieren• sich ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten bewusst werden3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:62 StundenAus Diskussionen mit Praktikerinnen und Praktikern aus der Arbeitswelt können Siewichtige Insiderinformationen zum Berufseinstieg erwerben und entwickeln beruflichePerspektiven.Die Studierenden sind in der Lage, praktische Techniken und Methoden für einenerfolgreichen Bewerbungs- und den Berufseinstiegsprozess anzuwenden. Themen derjeweiligen Übung:• Kommunikation und Netzwerke• Selbstpräsentation• Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen• Online-Bewerbung• Vorstellungsgespräch• Assessment-CenterLehrveranstaltung: Expert-Talks und WorkshopBesuch von 8 Expert-Talks und ein Workshop aus der KOMPASS-ReihePrüfung: Essay (max. 19.200 Zeichen inkl. Leerzeichen) oder Erstellen vonAnschreiben und Lebenslauf (max. 19.200 Zeichen inkl. Leerzeichen), unbenotetPrüfungsvorleistungen:Nachweis/Zertifikat Kompetenzanalyse mit dem ProfilPASS und Workshop ''Bewerbungfür Geisteswissenschaften''Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie praktische Technikenund Methoden (Bewerbungsmanagement, Selbstpräsentation; Networking) auf einenBewerbungsprozess anwenden können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:Empfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:apl. Prof. Dr. Albert Busch(Studiendekan)Dauer:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7955
Modul SK.Phil.71jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimalig1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7956
Modul SK.Phil.72<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.72: Betriebswirtschaftslehre für Geisteswissenschaftler/innenLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erwerben grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse überden Managementprozess, die Organisation, die Personalführung, Rechtsformen undUnternehmensverbindungen, die Funktionsbereiche Beschaffung, Produktion undAbsatz sowie das Rechnungswesen und die Finanzwirtschaft.3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:40 StundenSelbststudium:50 StundenDie Studierenden erwerben mit einer allgemeinen Einführung in dieBetriebswirtschaftslehre Kenntnisse für interdisziplinäre Arbeitsbereiche.Lehrveranstaltungen:1. Workshop: ''Betriebswirtschaftslehre für Geisteswissenschaftlerinnen undGeisteswissenschaftler''2. Independent StudiesPrüfung: Essay, oder Portfolio (max. 16.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen nach, dass sie die grundlegenden Begriffe derBetriebswirtschaftslehre beherrschen und die wesentlichen Probleme undLösungsansätze in den betriebswirtschaftlichen Teilgebieten verstanden haben.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 2Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7957
Modul SK.Phil.73<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.Phil.73: ZeitmanagementLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über verschiedene Ansätze vonZeitmanagementstrategien und –techniken, reflektieren im Zeitmanagementkontext dieeigene ZM-Persönlichkeit und entwickeln daraus ihre Zeitmanagementstrategie.Die Studierenden können situationsadäquat bezogen auf unterschiedliche Projekteeffektive Ziele formulieren und gehen mit den Instrumenten der Planung undDurchführung adäquat um. Sie wenden die Techniken der Reflexion und Revision, d.h.der Evaluation im Zeitmanagement souverän an.3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:62 StundenLehrveranstaltungen:1. Workshop zu Zeitmanagement2. Independent StudiesPrüfung: Schriftliche Ausarbeitung (max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) undFeedbackgespräch, unbenotetPrüfungsanforderungen:Die Studierenden müssen mit Durchführung und Analyse einer persönlichen Zeitinventuroder Anwendung einer spezifischen Zeitmanagementtechnik nachweisen, dasssie die grundlegenden Techniken des Zeitmanagements beherrschen und diewesentlichen Probleme und Lösungsansätze des Zeitmanagements analysieren undsituationsadäquat anwenden können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:unregelmäßigWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Eva WolffDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 1Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V4-WiSe12/13 Seite 7958
<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> Seite 7959Zentrale Einrichtungen:Nach Beschluss der Fakultätsräte der Philosophischen Fakultät vom 13.07.2011, 22.02.2012,21.03.2012 und 18.07.2012, der Biologischen Fakultät vom 19.10.2012, der Fakultät für Chemievom 30.03.2011 und der Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom <strong>29</strong>.02.2012, nach Stellungnahmedes Senats vom 13.06.2012 sowie nach Beschlüssen des Rates der ZELB vom 01.06.2012 und26.09.2012 und Eilentscheidung der Studiendekanin für Lehrerbildung vom 15.10.2012 hat dasPräsidium der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> am 13.11.2012 das Modulverzeichnis zur Prüfungs- undStudienordnung für den konsekutiven Studiengang „Master of Education“ genehmigt (§ 44 Abs. 1Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändertdurch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.06.2012 (Nds. GVBl. S. 186); § 41 Abs. 1 Satz 2 NHGi. V. m. Art. 2 § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 3 des Beschlusses des Präsidiums vom 20.03.2012 (<strong>Amtliche</strong><strong>Mitteilungen</strong> I 11/2012 S. 367); § 5 Abs. 5 Buchst. c), § 6 Abs. 7 Satz 2, § 7 Abs. 2 Satz 3 ZELB-O;§ 41 Abs. 2 Satz 2 NHG; § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b), § 44 Abs.1 Satz 3 NHG).Das Modulverzeichnis tritt rückwirkend zum 01.10.2012 in Kraft.
<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong>GöttingenModulverzeichniszu der Prüfungs- und Studienordnungfür den konsekutiven Studiengang"Master of Education" (<strong>Amtliche</strong><strong>Mitteilungen</strong> I 41/2012 S. 2130)<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7960
<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7961
InhaltsverzeichnisModuleB.Che.5103: Anorganische Chemie für Fortgeschrittene LG......................................................................7979B.Che.5203: Spezielle Organische Chemie LG..........................................................................................7981B.Che.5303: Physikalische Chemie <strong>II</strong>I LG: mikroskopische Beschreibung................................................ 7982B.Phy.551: Spezielle Themen der Astro- und Geophysik I........................................................................ 7984B.Phy.561: Spezielle Themen der Biophysik und Physik komplexer Systeme I.........................................7985B.Phy.571: Spezielle Themen der Festkörper- und Materialphysik I..........................................................7986B.Phy.581: Spezielle Themen der Kern- und Teilchenphysik I.................................................................. 7987M.Bio.201: Aktuelle Themen der Biologie...................................................................................................7988M.Bio.202: Humanphysiologie und Gesundheitslehre................................................................................ 7989M.Bio.210: Unterricht planen, gestalten und evaluieren............................................................................. 7990M.Bio.211: Biologiedidaktisches Forschungspraktikum.............................................................................. 7992M.Bio.220-2: Teaching in Biology <strong>II</strong>............................................................................................................7994M.BW.100: Bildungswissenschaftliche Forschung......................................................................................7995M.BW.200: Lehren, Lernen, Unterrichten................................................................................................... 7997M.BW.300: Diagnostizieren, Beurteilen und Fördern..................................................................................7999M.BW.400: Sozialisation und Erziehung.....................................................................................................8001M.BW.500: Bildung und Schulentwicklung................................................................................................. 8003M.Che.4802: Fachdidaktik Chemie............................................................................................................. 8005M.Che.4803: Praktikum zur Durchführung von Schulexperimenten........................................................... 8007M.Edu.100: Masterabschlussmodul............................................................................................................ 8008M.Edu-FD-Ger.01a: Fachdidaktik Deutsch 1a............................................................................................ 8009M.Edu-FD-Ger.01b: Fachdidaktik Deutsch 1b............................................................................................ 8011M.Edu-FD-Ger.02: Fachdidaktik - Fachwissenschaft Deutsch integrativ....................................................8013M.Edu-Ger.01: Literaturwissenschaft.......................................................................................................... 8015M.Edu-Ger.02: Germanistische Linguistik...................................................................................................8017M.EP.01a-L: Anglistische Literatur- und Kulturwissenschaft...................................................................... 8019M.EP.01b-L: Nordamerikastudien............................................................................................................... 8021M.EP.02a-L: Linguistik................................................................................................................................ 8023M.EP.02b-L: Mediävistik..............................................................................................................................8025<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7962
InhaltsverzeichnisM.EP.03-1a-L: Fachdidaktik des Englischen (mit 5-wöchigem Fachpraktikum)......................................... 8027M.EP.03-1b-L: Fachdidaktik des Englischen (mit 4-wöchigem Forschungspraktikum)...............................8028M.EP.03-2-L: Fachdidaktik des Englischen (Vertiefung)............................................................................ 80<strong>29</strong>M.EvRel.01: Fachliche Schwerpunktbildung...............................................................................................8030M.EvRel.02: Thematische Schwerpunktbildung..........................................................................................8031M.EvRel.03a: Planung und Reflexion von Religionsunterricht (a).............................................................. 8032M.EvRel.03b: Planung und Reflexion von Religionsunterricht (b).............................................................. 8033M.EvRel.04: Analyse und Entwicklung von religiösen Bildungsprozessen.................................................8034M.Frz.L-302: Vertiefungsmodul Fachwissenschaften................................................................................. 8035M.Frz.L-303: Fachdidaktik des Französischen (mit 5-wöchigem Fachpraktikum)...................................... 8037M.Frz.L-304: Fachdidaktik des Französischen (mit 4-wöchigem Forschungspraktikum)............................8038M.Frz.L-305: Fachdidaktik des Französischen (Vertiefung)....................................................................... 8039M.Geg.01: Analyse und Bewertung von Wasser und Boden..................................................................... 8040M.Geg.02: Ressourcennutzungsprobleme.................................................................................................. 8041M.Geg.03: Globaler Umweltwandel / Landnutzungsänderung....................................................................8042M.Geg.04: Globaler soziokultureller und ökonomischer Wandel................................................................ 8043M.Geg.31: Theoretische und praktische Geographiedidaktik..................................................................... 8044M.Geg.32: Geographiedidaktische Exkursion.............................................................................................8046M.Gesch.51: Modul Moderne......................................................................................................................8047M.Gesch.51a: Modul Moderne....................................................................................................................8048M.Gesch.52: Zeiten und Räume.................................................................................................................8049M.Gesch.52a: Zeiten und Räume...............................................................................................................8050M.GeschFD.01: Reflexion und Untersuchung von historischen Lernprozessen.........................................8051M.GeschFD.02: Analyse, Planung, Durchführung und Reflexion von Geschichtsunterricht.......................8052M.GeschFD.02a: Analyse, Planung und Reflexion von Geschichtsunterricht............................................ 8053M.Gri.11: Griechische Literatur................................................................................................................... 8054M.Gri.12: Griechische Sprache................................................................................................................... 8056M.Gri.13: Aufbaumodul Fachdidaktik Griechisch........................................................................................8057M.Gri.14 (Master of Education - Studienfach Griechisch): Griechisches Fachpraktikum............................8059M.Gri.15: Griechisches Forschungspraktikum............................................................................................ 8061M.Inf.1601: Informatikunterricht planen und gestalten................................................................................8063<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7963
InhaltsverzeichnisM.Inf.1602: Schulpraxis / Technische Informatik........................................................................................ 8065M.Lat.11: Lateinische Literatur....................................................................................................................8066M.Lat.12: Lateinische Sprache....................................................................................................................8068M.Lat.13: Aufbaumodul Fachdidaktik Latein...............................................................................................8069M.Lat.14: Lateinisches Fachpraktikum........................................................................................................8071M.Lat.15: Lateinisches Forschungspraktikum.............................................................................................8073M.Mat.0031: Höhere Analysis..................................................................................................................... 8075M.Mat.0032: Mathematische Grundlagen, Algebra, Zahlentheorie.............................................................8076M.Mat.0045: Seminar zum forschenden Lernen im Master of Education...................................................8077M.Mat.0046: Schulbezogene Analyse, Planung und Durchführung von Mathematikunterricht...................8078M.Mat.0048: Aktuelle Entwicklungen in der Fachdidaktik Mathematik....................................................... 8080M.OAW.CAF.01: Fachdidaktik Chinesisch <strong>II</strong>.............................................................................................. 8082M.OAW.CAF.02: Moderne Schriftsprache <strong>II</strong>............................................................................................... 8084M.OAW.CAF.03: Forschungen zur Fachdidaktik Chinesisch......................................................................8085M.OAW.MS.03: Modernes Chinesisch VI................................................................................................... 8086M.Phi.08: Theoretische Philosophie............................................................................................................8087M.Phi.09: Praktische Philosophie................................................................................................................8088M.Phi.09 (WuN): Themen der Philosophischen Ethik für den 'Werte und Normen'-Unterricht................... 8089M.Phi.10: Geschichte der Philosophie........................................................................................................ 8090M.Phi.21: Aufbaumodul Fachdidaktik..........................................................................................................8091M.Phi.22: Praxismodul Fachdidaktik........................................................................................................... 8093M.Phy.707: Aktuelle Themen der Physik....................................................................................................8095M.Phy.708: Physikunterricht planen und gestalten.....................................................................................8096M.Phy.709: Vertiefung experimenteller Techniken und Weiterentwicklung von Praxis an der Schule........8097M.Phy.710: Spezielle Themen der Physik.................................................................................................. 8098M.Pol.MEd-100: Politik und Wirtschaft: Strukturen, Entscheidungen, Ergebnisse..................................... 8099M.Pol.MEd-201: Praxis der Politischen Ökonomie..................................................................................... 8101M.Pol.MEd-300: Theorie und Praxis der politischen Bildung......................................................................8103M.Pol.MEd-400: Vorbereitung und Reflexion des Fachpraktikums/Forschungspraktikums........................8105M.Pol.MEd-500: Politischen Denken heute. Zivilgesellschaft, Globalisierung und Menschenrechte.......... 8107M.RelW.MEd-500: Religionswissenschaft...................................................................................................8108<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7964
InhaltsverzeichnisM.Rom.Frz.601: Sprachpraxis Französisch................................................................................................ 8109M.Rom.Spa.601: Sprachpraxis Spanisch....................................................................................................8111M.Russ.101a: Literatur/Kultur diachron (Vorlesung)................................................................................... 8113M.Russ.101b: Interpretation literarischer Werke aus diachroner Perspektive............................................ 8114M.Russ.101c: Gattung oder Epoche...........................................................................................................8115M.Russ.102a: Semantik (Vorlesung).......................................................................................................... 8116M.Russ.102b: Historische Phonetik und Morphologie................................................................................ 8118M.Russ.102c: Altkirchenslavisch.................................................................................................................8119M.Russ.119: Fachdidaktik Russisch und schulische Vermittlungskompetenz............................................8120M.Russ.128: Sprachpraxismodul Russisch C1...........................................................................................8121M.Soz.MEd-500: Kultursoziologie............................................................................................................... 8123M.Spa.L-302: Vertiefungsmodul Fachwissenschaften................................................................................ 8125M.Spa.L-303: Fachdidaktik des Spanischen (mit 5-wöchigem Fachpraktikum)..........................................8127M.Spa.L-304: Fachdidaktik des Spanischen (mit 4-wöchigem Forschungspraktikum)............................... 8128M.Spa.L-305: Fachdidaktik des Spanischen (Vertiefung)...........................................................................81<strong>29</strong>M.Spo-MEd.100: Sportunterricht analysieren und inszenieren ..................................................................8130M.Spo-MEd.200: Betreutes Fachpraktikum Sport.......................................................................................8132M.Spo-MEd.300: Betreutes Forschungspraktikum Sport............................................................................8134M.Spo-MEd.400: (Schul-)Sport im Kontext von Erziehung und Gesellschaft............................................. 8135M.Spo-MEd.500: (Schul-)Sport im Kontext von Gesundheit und Training..................................................8136M.WuN.11: Aufbaumodul Fachdidaktik.......................................................................................................8138M.WuN.12: Praxismodul Fachdidaktik........................................................................................................ 8140SK.EP.E10M: Interkulturelle Kompetenzen (A): <strong>Universität</strong>sbezogen........................................................ 8142SK.EP.E11M: Interkulturelle Kompetenzen (B): Schulbezogen..................................................................8143SK.EP.E12M: Interkulturelle Kompetenzen (C): Praktikumsbezogen.........................................................8144<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7965
InhaltsverzeichnisÜbersicht nach Modulgruppen1) Fachstudium zweier UnterrichtsfächerEs muss das Studium zweier Unterrichtsfächer im Umfang von jeweils insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabeder Nummern 2 - 21 erfolgreich absolviert werden.2) Unterrichtsfach "Biologie"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.Bio.201: Aktuelle Themen der Biologie (8 C, 8 SWS).................................................................. 7988M.Bio.202: Humanphysiologie und Gesundheitslehre (6 C, 4 SWS)................................................7989b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 15 C erfolgreich absolviert werden:M.Bio.210: Unterricht planen, gestalten und evaluieren (11 C, 6 SWS)...........................................7990M.Bio.211: Biologiedidaktisches Forschungspraktikum (4 C, 3 SWS)..............................................7992c) Freiwillige ZusatzprüfungenEs kann folgendes Modul im Rahmen einer freiwilligen Zusatzprüfung absolviert werden:M.Bio.220-2: Teaching in Biology <strong>II</strong> (3 C, 2 SWS)........................................................................... 79943) Unterrichtsfach "Chemie"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich Fachwissenschaftaa) WahlpflichtmoduleEs müssen zwei der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 12 C erfolgreichabsolviert werden, und zwar in den beiden auf Bachelor-Ebene noch nicht abgedeckten Bereichen:B.Che.5103: Anorganische Chemie für Fortgeschrittene LG (6 C, 7 SWS)................................ 7979B.Che.5203: Spezielle Organische Chemie LG (6 C, 7 SWS).................................................... 7981B.Che.5303: Physikalische Chemie <strong>II</strong>I LG: mikroskopische Beschreibung (6 C, 7 SWS)........... 7982bb) Weitere Leistungen<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7966
InhaltsverzeichnisWeitere 2 C werden durch Absolvierung des Moduls M.Che.4803 integrativ erworben.b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 17 C erfolgreich absolviert werden:M.Che.4802: Fachdidaktik Chemie (11 C, 6 SWS).......................................................................... 8005M.Che.4803: Praktikum zur Durchführung von Schulexperimenten (6 C, 10 SWS)......................... 80074) Unterrichtsfach "Chinesisch als Fremdsprache"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende Module im Umfang von insgesamt 12 C erfolgreich absolviert werden:M.OAW.CAF.02: Moderne Schriftsprache <strong>II</strong> (6 C, 4 SWS)...............................................................8084M.OAW.MS.03: Modernes Chinesisch VI (6 C, 8 SWS)...................................................................8086b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende Module im Umfang von insgesamt 17 C erfolgreich absolviert werden; davonwerden 2 C dem Kompetenzbereich Fachwissenschaft zugerechnet:M.OAW.CAF.01: Fachdidaktik Chinesisch <strong>II</strong> (5 C, 2 SWS).............................................................. 8082M.OAW.CAF.03: Forschungen zur Fachdidaktik Chinesisch (12 C, 6 SWS)................................... 80855) Unterrichtsfach "Deutsch"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich Fachwissenschaftaa) PflichtmoduleEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 12 C erfolgreich absolviert werden:M.Edu-Ger.01: Literaturwissenschaft (7 C, 4 SWS).................................................................... 8015M.Edu-Ger.02: Germanistische Linguistik (5 C, 4 SWS)............................................................. 8017bb) Weitere LeistungenWeitere 2 C werden durch Absolvierung des Moduls M.Edu-FD-Ger.02 integrativ erworben.b) Kompetenzbereich Fachdidaktik<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7967
InhaltsverzeichnisEs müssen Module im Umfang von insgesamt 17 C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden. Aus dem Modul M.Edu-FD-Ger.02 werden 2 C dem KompetenzbereichFachwissenschaft zugeordnet.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert werden:M.Edu-FD-Ger.02: Fachdidaktik - Fachwissenschaft Deutsch integrativ (6 C, 4 SWS)...............8013bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 11 C erfolgreich absolviert werden:M.Edu-FD-Ger.01a: Fachdidaktik Deutsch 1a (11 C, 6 SWS).....................................................8009M.Edu-FD-Ger.01b: Fachdidaktik Deutsch 1b (11 C, 6 SWS).....................................................80116) Unterrichtsfach "Englisch"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich Fachwissenschaftaa) Wahlpflichtmodule IEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert werden:M.EP.01a-L: Anglistische Literatur- und Kulturwissenschaft (6 C, 4 SWS)................................. 8019M.EP.01b-L: Nordamerikastudien (6 C, 4 SWS)..........................................................................8021bb) Wahlpflichtmodule <strong>II</strong>Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert werden:M.EP.02a-L: Linguistik (6 C, 4 SWS)...........................................................................................8023M.EP.02b-L: Mediävistik (6 C, 4 SWS)........................................................................................8025cc) Weitere LeistungenWeitere 2 C werden durch Absolvierung des Moduls M.EP.03-2-L integrativ erworben.b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen Module im Umfang von insgesamt 17 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden. Aus dem Modul M.EP.03-2-L werden 2 C dem KompetenzbereichFachwissenschaft zugeordnet.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert werden:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7968
InhaltsverzeichnisM.EP.03-2-L: Fachdidaktik des Englischen (Vertiefung) (6 C, 4 SWS)....................................... 80<strong>29</strong>bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 11 C erfolgreich absolviert werden:M.EP.03-1a-L: Fachdidaktik des Englischen (mit 5-wöchigem Fachpraktikum) (11 C, 6 SWS).. 8027M.EP.03-1b-L: Fachdidaktik des Englischen (mit 4-wöchigem Forschungspraktikum) (11 C,4 SWS)......................................................................................................................................... 8028c) Freiwillige ZusatzprüfungenStudierende können ferner folgende Module im Rahmen freiwilliger Zusatzprüfungen absolvieren:SK.EP.E10M: Interkulturelle Kompetenzen (A): <strong>Universität</strong>sbezogen (6 C, 2 SWS)........................8142SK.EP.E11M: Interkulturelle Kompetenzen (B): Schulbezogen (6 C, 2 SWS)..................................8143SK.EP.E12M: Interkulturelle Kompetenzen (C): Praktikumsbezogen (6 C, 2 SWS).........................81447) Unterrichtsfach "Erdkunde"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt 12 C erfolgreich absolviert werden;weitere 2 C werden durch Absolvierung des Modules M.Geg.32 integrativ erworben:M.Geg.01: Analyse und Bewertung von Wasser und Boden (6 C, 4 SWS)..................................... 8040M.Geg.02: Ressourcennutzungsprobleme (6 C, 4 SWS)................................................................. 8041M.Geg.03: Globaler Umweltwandel / Landnutzungsänderung (6 C, 4 SWS)................................... 8042M.Geg.04: Globaler soziokultureller und ökonomischer Wandel (6 C, 4 SWS)................................8043b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 17 C erfolgreich absolviert werden; ausdem Modul M.Geg.32 werden 2 C dem Kompetenzbereich Fachwissenschaft zugeordnet:M.Geg.31: Theoretische und praktische Geographiedidaktik (11 C, 4 SWS)...................................8044M.Geg.32: Geographiedidaktische Exkursion (6 C, 4 SWS)............................................................ 80468) Unterrichtsfach "Evangelische Religion"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.EvRel.01: Fachliche Schwerpunktbildung (8 C, 4 SWS).............................................................. 8030<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7969
InhaltsverzeichnisM.EvRel.02: Thematische Schwerpunktbildung (6 C, 4 SWS)......................................................... 8031b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen Module im Umfang von 15 C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen erfolgreichabsolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 7 C erfolgreich absolviert werden:M.EvRel.04: Analyse und Entwicklung von religiösen Bildungsprozessen (7 C, 4 SWS)............ 8034bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 8 C erfolgreich absolviert werden:M.EvRel.03a: Planung und Reflexion von Religionsunterricht (a) (8 C, 4 SWS)......................... 8032M.EvRel.03b: Planung und Reflexion von Religionsunterricht (b) (8 C, 2 SWS)......................... 80339) Unterrichtsfach "Französisch"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.Frz.L-302: Vertiefungsmodul Fachwissenschaften (8 C, 4 SWS).................................................8035M.Rom.Frz.601: Sprachpraxis Französisch (6 C, 4 SWS)................................................................8109b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen Module im Umfang von 15 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgreichabsolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden:M.Frz.L-305: Fachdidaktik des Französischen (Vertiefung) (4 C, 2 SWS).................................. 8039bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 11 C erfolgreich absolviert werden:M.Frz.L-303: Fachdidaktik des Französischen (mit 5-wöchigem Fachpraktikum) (11 C,6 SWS)......................................................................................................................................... 8037M.Frz.L-304: Fachdidaktik des Französischen (mit 4-wöchigem Forschungspraktikum) (11 C,4 SWS)......................................................................................................................................... 803810) Unterrichtsfach "Geschichte"<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7970
InhaltsverzeichnisEs müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen Module im Umfang von insgesamt 14 C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.aa) Wahlpflichtmodule IEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 7 C erfolgreich absolviert werden:M.Gesch.51: Modul Moderne (7 C, 2 SWS)................................................................................ 8047M.Gesch.51a: Modul Moderne (7 C, 4 SWS).............................................................................. 8048bb) Wahlpflichtmodule <strong>II</strong>Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 7 C erfolgreich absolviert werden:M.Gesch.52: Zeiten und Räume (7 C, 2 SWS)........................................................................... 8049M.Gesch.52a: Zeiten und Räume (7 C, 4 SWS)......................................................................... 8050b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen Module im Umfang von 15 C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen erfolgreichabsolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden:M.GeschFD.01: Reflexion und Untersuchung von historischen Lernprozessen (4 C, 2 SWS).... 8051bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 11 C erfolgreich absolviert werden:M.GeschFD.02: Analyse, Planung, Durchführung und Reflexion von Geschichtsunterricht (11 C,6 SWS)......................................................................................................................................... 8052M.GeschFD.02a: Analyse, Planung und Reflexion von Geschichtsunterricht (11 C, 6 SWS)......805311) Unterrichtsfach "Griechisch"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.Gri.11: Griechische Literatur (8 C, 4 SWS).................................................................................. 8054M.Gri.12: Griechische Sprache (6 C, 4 SWS).................................................................................. 8056<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7971
Inhaltsverzeichnisb) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen Module im Umfang von 15 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgreichabsolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 7 C erfolgreich absolviert werden:M.Gri.13: Aufbaumodul Fachdidaktik Griechisch (7 C, 4 SWS).................................................. 8057bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 8 C erfolgreich absolviert werden:M.Gri.14 (Master of Education - Studienfach Griechisch): Griechisches Fachpraktikum (8 C,4 SWS)......................................................................................................................................... 8059M.Gri.15: Griechisches Forschungspraktikum (8 C, 4 SWS).......................................................806112) Unterrichtsfach "Informatik"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen wenigstens zwei Vertiefungs- oder Spezialisierungsmodule der Informatik mitModulnummern der Formate M.Inf.11XX oder M.Inf.12XX im Umfang von insgesamt wenigstens12 C erfolgreich absolviert werden. Weitere 2 C werden durch Absolvierung des Moduls M.Inf.1602integrativ erworben.b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 17 C erfolgreich absolviert werden; ausdem Modul M.Inf.1602 werden 2 C dem Kompetenzbereich Fachwissenschaft zugeordnet:M.Inf.1601: Informatikunterricht planen und gestalten (11 C, 5 SWS)............................................. 8063M.Inf.1602: Schulpraxis / Technische Informatik (6 C, 5 SWS)........................................................806513) Unterrichtsfach "Latein"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.Lat.11: Lateinische Literatur (8 C, 4 SWS)................................................................................... 8066M.Lat.12: Lateinische Sprache (6 C, 4 SWS)...................................................................................8068b) Kompetenzbereich Fachdidaktik<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7972
InhaltsverzeichnisEs müssen Module im Umfang von insgesamt 15 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 7 C erfolgreich absolviert werden:M.Lat.13: Aufbaumodul Fachdidaktik Latein (7 C, 4 SWS)......................................................... 8069bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 8 C erfolgreich absolviert werden:M.Lat.14: Lateinisches Fachpraktikum (8 C, 4 SWS).................................................................. 8071M.Lat.15: Lateinisches Forschungspraktikum (8 C, 4 SWS)....................................................... 807314) Unterrichtsfach "Mathematik"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen Module im Umfang von insgesamt 14 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 5 C erfolgreich absolviert werden:M.Mat.0045: Seminar zum forschenden Lernen im Master of Education (5 C, 2 SWS).............. 8077bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 9 C erfolgreich absolviert werden:M.Mat.0031: Höhere Analysis (9 C, 6 SWS)............................................................................... 8075M.Mat.0032: Mathematische Grundlagen, Algebra, Zahlentheorie (9 C, 6 SWS)....................... 8076b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 15 C erfolgreich absolviert werden:M.Mat.0046: Schulbezogene Analyse, Planung und Durchführung von Mathematikunterricht (8 C,3 SWS).............................................................................................................................................. 8078M.Mat.0048: Aktuelle Entwicklungen in der Fachdidaktik Mathematik (7 C, 4 SWS)....................... 8080c) Freiwillige ZusatzprüfungenAus Modulen der Bachelor- und Master-Studiengänge "Mathematik" können in beliebigem Umfangfreiwillige Zusatzprüfungen abgelegt werden.15) Unterrichtsfach "Philosophie"<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7973
InhaltsverzeichnisEs müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.Phi.08: Theoretische Philosophie (7 C, 2 SWS)........................................................................... 8087M.Phi.09: Praktische Philosophie (7 C, 2 SWS)...............................................................................8088M.Phi.10: Geschichte der Philosophie (7 C, 2 SWS)....................................................................... 8090b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 15 C erfolgreich absolviert werden:M.Phi.21: Aufbaumodul Fachdidaktik (7 C, 2 SWS)......................................................................... 8091M.Phi.22: Praxismodul Fachdidaktik (8 C, 4 SWS).......................................................................... 809316) Unterrichtsfach "Physik"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen Module im Umfang von insgesamt 14 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden:aa) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert werden:B.Phy.551: Spezielle Themen der Astro- und Geophysik I (6 C, 6 SWS)................................... 7984B.Phy.561: Spezielle Themen der Biophysik und Physik komplexer Systeme I (6 C, 6 SWS).... 7985B.Phy.571: Spezielle Themen der Festkörper- und Materialphysik I (6 C, 6 SWS).....................7986B.Phy.581: Spezielle Themen der Kern- und Teilchenphysik I (6 C, 6 SWS)............................. 7987bb) Pflichtmodul IEs muss das folgende Modul im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden:M.Phy.710: Spezielle Themen der Physik (4 C, 3 SWS)............................................................ 8098cc) Pflichtmodul <strong>II</strong>Es muss das folgende Modul im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden:M.Phy.707: Aktuelle Themen der Physik (4 C, 2 SWS).............................................................. 8095b) Kompetenzbereich Fachdidaktik<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7974
InhaltsverzeichnisEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 15 C erfolgreich absolviert werden:M.Phy.708: Physikunterricht planen und gestalten (8 C, 3 SWS).................................................... 8096M.Phy.709: Vertiefung experimenteller Techniken und Weiterentwicklung von Praxis an der Schule(7 C, 5 SWS)..................................................................................................................................... 809717) Unterrichtsfach "Politik|Wirtschaft"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.Pol.MEd-100: Politik und Wirtschaft: Strukturen, Entscheidungen, Ergebnisse (10 C, 4 SWS)....8099M.Pol.MEd-201: Praxis der Politischen Ökonomie (4 C, 2 SWS).....................................................8101b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 15 C erfolgreich absolviert werden:M.Pol.MEd-300: Theorie und Praxis der politischen Bildung (7 C, 4 SWS)..................................... 8103M.Pol.MEd-400: Vorbereitung und Reflexion des Fachpraktikums/Forschungspraktikums (8 C,3 SWS).............................................................................................................................................. 810518) Unterrichtsfach "Russisch"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen Module im Umfang von insgesamt 14 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 8 C erfolgreich absolviert werden:M.Russ.128: Sprachpraxismodul Russisch C1 (8 C, 8 SWS)..................................................... 8121bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert werden:M.Russ.101a: Literatur/Kultur diachron (Vorlesung) (6 C, 2 SWS)..............................................8113M.Russ.101b: Interpretation literarischer Werke aus diachroner Perspektive (6 C, 2 SWS)....... 8114M.Russ.101c: Gattung oder Epoche (6 C, 2 SWS)..................................................................... 8115M.Russ.102a: Semantik (Vorlesung) (6 C, 2 SWS).....................................................................8116<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7975
InhaltsverzeichnisM.Russ.102b: Historische Phonetik und Morphologie (6 C, 2 SWS)...........................................8118M.Russ.102c: Altkirchenslavisch (6 C, 2 SWS)........................................................................... 8119b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs muss folgendes Modul im Umfang von 15 C erfolgreich absolviert werden:M.Russ.119: Fachdidaktik Russisch und schulische Vermittlungskompetenz (15 C, 4 SWS).......... 812019) Unterrichtsfach "Spanisch"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 14 C erfolgreich absolviert werden:M.Spa.L-302: Vertiefungsmodul Fachwissenschaften (8 C, 4 SWS)................................................8125M.Rom.Spa.601: Sprachpraxis Spanisch (6 C, 4 SWS)...................................................................8111b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen Module im Umfang von insgesamt 15 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden:M.Spa.L-305: Fachdidaktik des Spanischen (Vertiefung) (4 C, 2 SWS)......................................81<strong>29</strong>bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 11 C erfolgreich absolviert werden:M.Spa.L-303: Fachdidaktik des Spanischen (mit 5-wöchigem Fachpraktikum) (11 C, 6 SWS)...8127M.Spa.L-304: Fachdidaktik des Spanischen (mit 4-wöchigem Forschungspraktikum) (11 C,4 SWS)......................................................................................................................................... 812820) Unterrichtsfach "Sport"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 12 C absolviert werden; weitere 2 Cwerden durch Absolvierung des Moduls M.Spo-MEd.100 integrativ erworben:M.Spo-MEd.400: (Schul-)Sport im Kontext von Erziehung und Gesellschaft (6 C, 4 SWS)............. 8135M.Spo-MEd.500: (Schul-)Sport im Kontext von Gesundheit und Training (6 C, 4 SWS)..................8136<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7976
Inhaltsverzeichnisb) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen Module im Umfang von 17 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgreichabsolviert werden; aus dem Modul M.Spo-MEd.100 werden 2 C dem KompetenzbereichFachwissenschaft zugeordnet.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 9 C absolviert werden:M.Spo-MEd.100: Sportunterricht analysieren und inszenieren (9 C, 6 SWS)............................. 8130bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 8 C absolviert werden:M.Spo-MEd.200: Betreutes Fachpraktikum Sport (8 C, 2 SWS)................................................. 8132M.Spo-MEd.300: Betreutes Forschungspraktikum Sport (8 C, 2 SWS)...................................... 813421) Unterrichtsfach "Werte und Normen"Es müssen Module im Umfang von insgesamt <strong>29</strong> C nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.a) Kompetenzbereich FachwissenschaftEs müssen Module im Umfang von insgesamt 14 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungenerfolgreich absolviert werden.aa) PflichtmodulEs muss folgendes Modul im Umfang von 7 C erfolgreich absolviert werden:M.Phi.09 (WuN): Themen der Philosophischen Ethik für den 'Werte und Normen'-Unterricht (7 C,2 SWS)......................................................................................................................................... 8089bb) WahlpflichtmoduleEs muss eines der folgenden Module im Umfang von 7 C erfolgreich absolviert werden:M.Pol.MEd-500: Politischen Denken heute. Zivilgesellschaft, Globalisierung und Menschenrechte(7 C, 4 SWS)................................................................................................................................ 8107M.RelW.MEd-500: Religionswissenschaft (7 C, 4 SWS)............................................................. 8108M.Soz.MEd-500: Kultursoziologie (7 C, 5 SWS)..........................................................................8123b) Kompetenzbereich FachdidaktikEs müssen folgende zwei Module im Umfang von insgesamt 15 C erfolgreich absolviert werden:M.WuN.11: Aufbaumodul Fachdidaktik (7 C, 2 SWS)...................................................................... 8138M.WuN.12: Praxismodul Fachdidaktik (8 C, 4 SWS)........................................................................8140<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7977
Inhaltsverzeichnis22) BildungswissenschaftenEs müssen folgende fünf Module im Umfang von insgesamt 36 C erfolgreich absolviert werden:M.BW.100: Bildungswissenschaftliche Forschung (6 C, 3 SWS).......................................................... 7995M.BW.200: Lehren, Lernen, Unterrichten (9 C, 6 SWS)........................................................................7997M.BW.300: Diagnostizieren, Beurteilen und Fördern (6 C, 4 SWS)...................................................... 7999M.BW.400: Sozialisation und Erziehung (9 C, 6 SWS)......................................................................... 8001M.BW.500: Bildung und Schulentwicklung (6 C, 4 SWS)...................................................................... 800323) MasterabschlussmodulEs muss das Masterabschlussmodul im Umfang von 6 C absolviert werden; wird die Masterarbeitin den Kompetenzbereichen Fachwissenschaft oder Fachdidaktik geschrieben, muss dasMasterabschlussmodul in dem entsprechenden Unterrichtsfach absolviert werden; wird dieMasterarbeit in den Bildungswissenschaften geschrieben, muss das Masterabschlussmodul in denBildungswissenschaften absolviert werden.M.Edu.100: Masterabschlussmodul (6 C, 2 SWS).................................................................................800824) MasterarbeitDurch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 20 C erworben.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7978
Modul B.Che.5103<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul B.Che.5103: Anorganische Chemie für Fortgeschrittene LGLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden vertiefen ihre theoretischen Kenntnisse der GrundkonzepteTeilchenkonzept, Struktur-Eigenschaften-Konzept, Donator-Akzeptor-Konzept,Energie-Konzept und Gleichgewichtskonzept am Beispiel der Komplexchemie.Sie kennen wichtige chemisch-technische Prozesse (z.B. Aluminiumdarstellung),Naturstoffe und ihre Eigenschaften (z.B. Hämoglobin), alltägliche Stoffe mit ihrenReaktionen und Eigenschaften (z.B. Waschmittel) aus dem Bereich der Komplexchemie.Sie beherrschen Experimente zur qualitativen und quantitativen Bearbeitung desChemischen Gleichgewichts, (z.B. die Bestimmung von Stabilitätskonstanten) undder Kinetik, zur quantitativen und qualitativen Analyse mit Hilfe der Komplexchemie(z.B. Eisenbestimmung in Lebensmitteln oder Wasserhärteuntersuchungen). DesWeiteren beherrschen sie die schulisch wichtigsten Messtechniken, wie Konduktometrie,Thermometrie, Potentiometrie, Photometrie und Arbeiten mit Ionenaustauschern. Siekönnen die motivationsfördernde Wirkung der Versuche mit Komplexverbindungendurch ihre Farbigkeit und ihrer Verbreitung in Natur, Technik und Haushalt belegen.6 C7 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:98 StundenSelbststudium:82 StundenSie erlernen anhand eines Projekts die theoretische und praktische Erarbeitung eineskomplexchemischen Themas als Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten in derMasterarbeit. Anhand der Präsentation eines Themas im Seminar werden allgemeineVermittlungstechniken eingeübt und angewendet.Lehrveranstaltungen:1. "Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten/innen: Teil Anorganik"(Praktikum)2. "Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten/innen: Teil Anorganik"(Seminar)5 SWS2 SWSPrüfung: Praktische prüfungPrüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am Praktikum, Präsentation einer SeminarsitzungPrüfungsanforderungen:Komplexchemische Themen: Grundlagen der Komplexchemie, chemische Bindung inKomplexen, Stabilität von Komplexen, Kinetik, Komplexchemie in Labor, Technik undNatur. Grundlegende Mess- und Arbeitstechniken: Konduktometrie, Thermometrie,Potentiometrie, Photometrie und Arbeiten mit Ionenaustauschern.Zugangsvoraussetzungen:B.Che.4102B.Che.4102Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Dietmar StalkeDauer:1 Semester<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7979
Modul B.Che.5103Wiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:22<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7980
Modul B.Che.5203<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul B.Che.5203: Spezielle Organische Chemie LGLernziele/Kompetenzen:Vertiefung der chemischen Grundlagen wichtiger Stoffwechselprozesse,Einblicke in die Chemie und Biochemie ausgewählter Antibiotika, Bearbeitungdes Projekts „Acetylsalicylsäure“ aus chemischer und biochemischer Sicht,Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten, Anwendung und Einübung allgemeinerVermittlungstechniken in Seminaren sowie bei der Bearbeitung von Lernfragen/Übungsaufgaben.Lehrveranstaltungen:1. "Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten/innen: OrganischeChemie" (Praktikum)2. "Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten/innen: OrganischeChemie" (Seminar)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester6 C7 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:98 StundenSelbststudium:82 Stunden5 SWS2 SWSPrüfung: Klausur (120 Minuten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am Praktikum sowie Referat/Präsentation über einvorgegebenes Thema.Prüfungsanforderungen:Chemische und biochemische Grundlagen aus den Themenbereichen: Kohlenhydrate,Aminosäuren/Peptide, Lipide, Nucleinsäuren, Photosynthese, Antibiotika und Enzyme.Grundlegende Mess- und Arbeitstechniken.Isolierung von Naturstoffen, Auf- u. Abbaureaktionen, steriles Arbeiten,Reinheitskontrolle durch physikal. Konstanten und Dünnschichtchromatographie,Deutung von Spektren (UV, MS, NMR).Zugangsvoraussetzungen:B.Che.4201B.Che.4201Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:B.Che.4202, B.Che.4501Modulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Claudia SteinemDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7981
Modul B.Che.5303<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul B.Che.5303: Physikalische Chemie <strong>II</strong>I LG: mikroskopische Beschreibung6 C7 SWSLernziele/Kompetenzen:Verständnis der Zusammenhänge zwischen mikroskopischen Bausteinen (Atome,Moleküle) und makroskopischer Materie (Gase, Flüssigkeiten, Kristalle); Kenntnisseauf molekularer Ebene über die Vorgänge bei stofflichen Umsetzungen; Kenntnisseder theoretischen Grundlagen für die moderne instrumentelle Analytik (Spektroskopie).Ferner Verbesserung/Erweiterung der Fertigkeiten zur Arbeit in physikalischchemischenLaboratorien, insbesondere hinsichtlich der Verwendung modernerMesstechnik.Arbeitsaufwand:Präsenzzeit:98 StundenSelbststudium:82 StundenDie von den Studierenden zu erlangende Kompetenz besteht hauptsächlich darin,die oben genannten Erkenntnisse zur Lösung von Problemen/Fragen aus demmenschlichen Alltag, zumindest aber aus dem Alltag eines Chemielehrers, anwenden zukönnen.Die Studierenden üben dies anhand zahlreicher Aufgaben und vertiefen dabeiihre (theoretischen) Kenntnisse der folgenden Grundkonzepte: Teilchenkonzept,Struktur-Eigenschaften-Konzept, Energie-Konzept und Gleichgewichtskonzept.Ferner erhalten die Studierenden exemplarische Einblicke in das umfangreicheSpektrum experimenteller Verfahren, und zwar insbesondere solcher, die sich modernerMesstechnik bedienen. In diesem Rahmen kann auch sogleich die Kompetenz,verschiedene Themengebiete der Chemie miteinander zu verknüpfen, erlangtwerden. Auch grundlegende Kenntnisse aus der Mathematik und der benachbartenNaturwissenschaft Physik werden in diesem Modul erworben bzw. durch derenAnwendung bei der Lösung chemischer Fragestellungen vertieft.Lehrveranstaltungen:1. "Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten <strong>II</strong>" (Vorlesung) 2 SWS2. "Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten <strong>II</strong>" (Übung) 2 SWS3. "Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten <strong>II</strong>" (Praktikum)Angebotshäufigkeit: jedes Semester3 SWSPrüfung: Klausur (120 Minuten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme an den wöchentlichen Kurztests; erfolgreich bearbeiteteÜbungsaufgaben und erfolgreiche Teilnahme am PraktikumPrüfungsanforderungen:Aufbau der Materie (Atome und Moleküle): Wechselwirkung zwischen Licht und Materie,Grundzüge der Quantenmechanik, Grundlagen der Spektroskopie/Spektrometrie(AES, UV/VIS, IR, NMR, X-Diff, MS) und deren Anwendung zur Strukturbestimmung,Grundzüge der statistischen Thermodynamik, chemisches Gleichgewicht,Reaktionskinetik (u.a. Reaktionsmechanismen, Konzept der Quasistationarität,Stoßtheorie, Theorie des Übergangszustands), chemische Bindung, Transportprozesse.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7982
Modul B.Che.5303Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:B.Che.4301, B.Che.4302B.Che.4301 und B.Che.4302Modulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Martin SuhmDauer:1- 2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:17<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7983
Modul B.Phy.551<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul B.Phy.551: Spezielle Themen der Astro- und Geophysik ILernziele/Kompetenzen:Lernziele: Inhalte aktueller Forschung in der Astro- und Geophysik, Vertiefung des imWahlpflichtbereich angeeigneten Verständnisses von Methoden und Modellen.Kompetenzen: Die Studierenden sollen aktuelle Forschungsthemen verstehen undbewerten können.Lehrveranstaltung: Veranstaltung aus dem Lehrangebot der Astro- undGeophysik6 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:96 Stunden6 SWSPrüfung: Klausur (120 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.) oderSeminarvortrag (ca. 30 Min., 2 Wochen Vorbereitungszeit)Prüfungsanforderungen:Vertiefung der im Wahlpflichtbereich angeeigneten Kenntnisse in Astro- bzw.Geophysik.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:dreimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Andreas TilgnerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:90<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7984
Modul B.Phy.561<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul B.Phy.561: Spezielle Themen der Biophysik und Physik komplexerSysteme ILernziele/Kompetenzen:Lernziele: Inhalte aktueller Forschung in der Biophysik und Physik komplexer Systeme,Vertiefung des im Wahlpflichtbereich angeeigneten Verständnisses von Methoden undModellen.Kompetenzen: Die Studierenden sollen aktuelle Forschungsthemen verstehen undbewerten können.Lehrveranstaltung: Veranstaltung aus dem Lehrangebot der Biophysik und Physikkomplexer Systeme6 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:96 Stunden6 SWSPrüfung: Klausur (120 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.) oderSeminarvortrag (ca. 30 Min., 2 Wochen Vorbereitungszeit)Prüfungsanforderungen:Vertiefung der im Wahlpflichtbereich angeeigneten Kenntnisse in der Biophysik und derPhysik komplexer SystemeZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:dreimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Andreas TilgnerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:90<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7985
Modul B.Phy.571<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul B.Phy.571: Spezielle Themen der Festkörper- und MaterialphysikILernziele/Kompetenzen:Lernziele: Inhalte aktueller Forschung in der Festkörper- und Materialphysik, Vertiefungdes im Wahlpflichtbereich angeeigneten Verständnisses von Methoden und Modellen.Kompetenzen: Die Studierenden sollen aktuelle Forschungsthemen verstehen undbewerten können.Lehrveranstaltung: Veranstaltung aus dem Lehrangebot der Festkörper- undMaterialphysik6 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:96 Stunden6 SWSPrüfung: Klausur (120 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.) oderSeminarvortrag (ca. 30 Min., 2 Wochen Vorbereitungszeit)Prüfungsanforderungen:Vertiefung der im Wahlpflichtbereich angeeigneten Kenntnisse in Festkörper- undMaterialphysik.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:dreimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Andreas TilgnerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:90<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7986
Modul B.Phy.581<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul B.Phy.581: Spezielle Themen der Kern- und Teilchenphysik ILernziele/Kompetenzen:Lernziele: Inhalte aktueller Forschung in der Kern- und Teilchenphysik, Vertiefung desim Wahlpflichtbereich angeeigneten Verständnisses von Methoden und Modellen.Kompetenzen: Die Studierenden sollen aktuelle Forschungsthemen verstehen undbewerten können.Lehrveranstaltung: Veranstaltung aus dem Lehrangebot der Kern- undTeilchenphysik6 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:96 Stunden6 SWSPrüfung: Klausur (120 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.) oderSeminarvortrag (ca. 30 Min., 2 Wochen Vorbereitungszeit)Prüfungsanforderungen:Vertiefung der im Wahlpflichtbereich angeeigneten Kenntnisse in der Kern- undTeilchenphysik.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:dreimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Andreas TilgnerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:90<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7987
Modul M.Bio.201<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Bio.201: Aktuelle Themen der BiologieEnglish title: Current Topics in BiologyLernziele/Kompetenzen:M.Bio.201-1: Lernziel: Erlangung von theoretischen Kenntnisse, die es den Studentenerlauben aktuelle Themengebiete der Molekularbiologie zu verstehen. Beurteilung derRelevanz aktueller molekularbiologischer Themen für den Unterricht.M.Bio.201-2: In exemplarisch ausgewählten Versuchen werden grundlegende Themender Biologie praktisch behandelt und damit die Kenntnisse aus TM1 und dem ModulM.Bio.202 vertieft. Praktische Basisfertigkeiten werden erlernt.8 C8 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:150 StundenSelbststudium:90 StundenDie Studierenden erarbeiten Kompetenzen in der Planung, Durchführung undDokumentation von wissenschaftlichen Experimenten und Schulversuchen.Lehrveranstaltung: M.Bio.201-1 Genetik und Biotechnologie (Vorlesung)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2 SWSPrüfung: Klausur (90 Minuten)Lehrveranstaltung: M.Bio.201-2 Schulversuchspraktikum in der Biologie(Praktikum)Inhalte:Fünf Praktikumstage (jeweils 4 Stunden) zum Thema Molekularbiologie am Institutfür Mikrobiologie und Genetik, fünf Praktikumstage (jeweils 4 Stunden) Anatomiemit Präparationen von Schweineorganen im Zoologischen Institut und zwei WochenPraktikum mit Schulexperimenten zur Humanphysiologie im Zoologischen Institut.6 SWSAngebotshäufigkeit: jedes SommersemesterPrüfung: Portfolio, in Gruppenarbeit (3-4 Studierende) zu den erarbeitetenhumanphysiologischen Experimenten (25-50 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Aktive regelmäßige Teilnahme; Protokoll zu molekularbiologischen VersuchenZugangsvoraussetzungen:M.Bio.201-1 ist Voraussetzung für M.Bio.201-2Sprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:Vorlesung im WiSe, Praktikum jedes SoSeWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Stefanie PöggelerProf. Dr. Dieter Heineke, Prof. Dr. Ralf HeinrichDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:ab 1Maximale Studierendenzahl:28<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7988
Modul M.Bio.202<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Bio.202: Humanphysiologie und GesundheitslehreLernziele/Kompetenzen:Im TM1 (M.Bio.202-1) sollen vertiefte Kenntnisse der Humanphysiologie erworbenwerden. Die Themenbereiche sind: Atmung und Gasaustausch, Herz und Kreislauf,Ernährung/Verdauung/Energieumsatz, Niere und Wasserhaushalt, Hormonsystem,Nerv und Muskel, zentrales und peripheres Nervensystem, Riechen und Schmecken,auditorisches System, visuelles System, neuronale Plastizität und Lernen, kortikaleVerarbeitung und Schmerz.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenIm TM2 (M.Bio.202-2) werden Themen der aktuellen Gesundheitslehre in derklinischen Praxis erörtert: Themenkomplexe sind beispielsweise: Ernährung,Herzkreislauferkrankungen, Essstörungen, Schlaganfall etc., Infektionserkrankungen,Allergien, HIV, Grippeepidemien etc., Hormonhaushalt, Pubertät, Schwangerschaft,Reproduktionsmedizin.Lehrveranstaltung: Teilmodul 1: Humanphysiologie (Vorlesung)Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester2 SWSPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsanforderungen:Energetik, Organsysteme, Physiologie des Immun- und Hormonsystems,Sinnesphysiologie, Neurophysiologie, Verhalten.Lehrveranstaltung: Teilmodul 2: Aktuelle Themen der Gesundheitslehre(Vorlesung)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 5 Seiten)Prüfungsanforderungen:Themen der aktuellen Gesundheitslehre in der klinischen PraxisZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:TM1 im SoSe, TM2 im WiSeWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Dieter HeinekeDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:40<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7989
Modul M.Bio.210<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Bio.210: Unterricht planen, gestalten und evaluierenLernziele/Kompetenzen:M.Bio.210-1: Biologiedidaktische Forschungsarbeiten, -methoden und –ergebnissekennen und verstehen; biologiedidaktische (Forschungs-) Ansätze kritisch würdigenkönnen; relevante biologiedidaktische Forschungsergebnisse zur Weiterentwicklung vonUnterrichtskonzepten und Bildungsmaßnahmen nutzen können.M.Bio.210-2: Bildungsstandards/Kerncurricula für das Fach Biologie kennen;Unterrichtseinheiten kumulativ und kompetenzorientiert planen und begründenkönnen unter Einbezug relevanter Kontexte; Entwicklung und Einbindung vonGrundbildungsaufgaben in den Unterricht; Schaffung von Lernumgebungen für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen im Biologieunterricht; Schülerleistungen auf Basistransparenter Maßstäbe beurteilen können; Selbst- und Fremdevaluationsmethodenentwickeln, einsetzen und auswerten; eigenen und fremden Unterricht sowieUnterrichtskonzepte analysieren, theoriebezogen reflektieren und optimieren können.Lehrveranstaltung: M.Bio.210-1 Forschung rezipieren, bewerten und Praxisweiterentwickeln (Seminar)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:246 Stunden2 SWSPrüfung: Vortrag (ca. 15 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 15 Seiten)in GruppenPrüfungsvorleistungen:Aktive regelmäßige TeilnahmeLehrveranstaltung: M.Bio.201-2 Vorbereitung und Auswertung einesFachpraktikums (Praktikum, Seminar)Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester4 SWSPrüfung: Praktikumsbericht oder Evaluationsbericht (max. 15 Seiten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am Fachpraktikum; Regelmäßige Teilnahme am KursPrüfungsanforderungen:Praktikumsbericht in Einzelarbeit (max. 15 Seiten; bei 5-wöchigem Praktikum) oderEvaluationsbericht in Einzelarbeit (max. 15 Seiten; bei 4-wöchigem Praktikum)Prüfungsanforderungen:Ausarbeitung, Vorstellung (Vortrag) und Diskussion des Argumentationsstranges undder Kernergebnisse der Hausarbeiten von Gruppen mit entsprechender Literatur im Kurs(im Rahmen des 1. Teilmoduls).Pflicht bei 1. Fachpraktikum: Ausarbeitung und Simulation einer Einzel- oderDoppelstunde mit Unterrichtsentwurf als Paar- oder Gruppenarbeit und gemeinsameReflektion im Kurs während der Vorbereitung auf das Fachpraktikum; Ausarbeitungund Durchführung einer Unterrichtseinheit im Fachpraktikum und Reflexion(Fachpraktikumsbericht für 2. Teilmodul).Pflicht bei 2. Fachpraktikum: Ausarbeitung eines Evaluationskonzeptes mit direktemUnterrichtsbezug als Paar- oder Gruppenarbeit, Vorstellung und Diskussion im Kurs,<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7990
Modul M.Bio.210Umsetzung in der Schule sowie Anfertigung eines Berichtes über die empirischeEvaluation von unterrichtsbezogenen Aspekten.Zugangsvoraussetzungen:B.Bio.200 oder ÄquivalentSprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:M.Bio.210-1 im WiSe, M.Bio.210-2 im WiSe undSoSe bzw. SoSe und WiSeWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Susanne BögeholzDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:18<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7991
Modul M.Bio.211<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Bio.211: Biologiedidaktisches ForschungspraktikumLernziele/Kompetenzen:Forschende Auseinandersetzung mit biologiedidaktischen Fragestellungena) mit Praxisbezug Forschungspraktikum - Entwicklungsarbeit, z.B. biologiedidaktischeExperimente im Hinblick auf Kompetenzförderung entwickeln, erprobenund optimieren bzw. vorhandene Standardschulversuche auf auf weitere Zielgruppenanpassen und kompetenzorientiert weiterentwickeln; biologische Arbeitstechnikenadressatengerecht und Kompetenz fördernd einsetzen; Modelle entwickeln undbeurteilen; Aufgaben kompetenzorientiert (weiter-) entwickeln; biologiedidaktischeAufbereitung von fachbiologischer oder fachdidaktischer Originalliteratur als AdaptedPrimary Literature;b) Forschungspraktikum mit empirischer Studie, z.B. Untersuchungen von Lernprozessenbei Schüler(inne)n mit Hilfe von Lern- und Diagnoseaufgaben durchdie Methode des Lauten Denkens, Durchführung von Interviews zur Identifikationvon Schülervorstellungen, Untersuchungen zur Messung von z.B. motivationalenBedingungen naturwissenschaftlichen Lernens und kognitiven Kompetenzen,Untersuchungen zur motivationalen, kognitiven und metakognitiven Wirksamkeit vonAdapted Primary Literature im Biologieunterricht.Lehrveranstaltung: Biologiedidaktisches Forschungspraktikum (Praktikum)Angebotshäufigkeit: einmal im Studienjahr (im zweiten Semester)4 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:36 StundenSelbststudium:84 Stunden3 SWSPrüfung: Posterpräsentation und ForschungsberichtPrüfungsvorleistungen:Regelmäßige TeilnahmePrüfungsanforderungen:a) Posterpräsentation (ca. 10 Minuten) und Gestaltung eines Praktikumsteils (60Minuten) in Gruppen als zwei Teilelemente zur kumulativen Auseinandersetzung miteinem Entwicklungsvorhaben oderb) Posterpräsentation (ca. 10 Minuten) und Vortrag mit empirischen Ergebnissen (ca. 20Min.) in Gruppen als zwei Teilelemente zur kumulativen Auseinandersetzung mit einemspezifischen Forschungsvorhaben.Die Note setzt sich jeweils folgendermaßen zusammen: 33,3%:66,7%Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:jährlichWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Susanne BögeholzDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7992
Modul M.Bio.21128<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7993
Modul M.Bio.220-2<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Bio.220-2: Teaching in Biology <strong>II</strong>Lernziele/Kompetenzen:Das Modul kann in einem Kurs als eine der folgenden Varianten a), b), c) oder d)durchgeführt werden:• Variante a) Entwicklung einer Unterrichtseinheit für den bilingualen Unterricht imKurs,• Variante b) Entwicklung eines Projektes zum bilingualen Unterricht,• Variante c) Entwicklung von Adapted Primary Literature aus Primary ScientificLiterature für den bilingualen Unterricht oder• Variante d) Entwicklung und/ oder Durchführung und Auswertung einerempirischen Studie mit dem Kurs zum bilingualen Unterricht z.B. im Kontext von„Passungsverhältnisse biologischen Lernens verstehen und optimieren"Lehrveranstaltung: Teaching in Biology <strong>II</strong> (Seminar)3 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:62 Stunden2 SWSPrüfung: schriftliche Leistung (max. 50 Seiten als Gesamtkursleistung; max. 6Seiten pro Person)Prüfungsanforderungen:a) Bausteine für entwickelte Unterrichtseinheit, oderb) Projektbericht oderc) Adapted Primary Literature oderd) Bericht über empirische Studie.Zugangsvoraussetzungen:B.Bio.205Sprache:Englisch, DeutschAngebotshäufigkeit:alle zwei jahre im WiSe (z.B. WiSe 11/12)Wiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Susanne BögeholzDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:18<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7994
Modul M.BW.100<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.BW.100: Bildungswissenschaftliche ForschungEnglish title: Educational ResearchLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden· kennen ausgewählte empirische Studien im Bereich der historischenErziehungswissenschaft sowie der Schul-, Unterrichts-, Lern- undSozialisationsforschung und können diese rezipieren und bewerten,6 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:42 StundenSelbststudium:138 Stunden· kennen verschiedene Forschungsfelder der Bildungs-, Schul-, Unterrichts-, Lern- undSozialisationsforschung,· kennen methodologische Paradigmen und methodische Zugänge aus den Bereichender historischen Erziehungswissenschaft, der Schul-, Unterrichts- und Lern- undSozialisationsforschung,· kennen zentrale methodologische und methodische Aspekte quantitativer undqualitativer Forschung (Untersuchungsplanung, Untersuchungsdesigns, quantitative undqualitative Methoden der Datenerhebung) und können diese am Beispiel empirischerStudien konkret benennen,· können die Grundlagen einer Erhebungs- und Auswertungsmethode darstellen,· können Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Forschungsmethoden undVerfahren beurteilen und· können die Ergebnisse einer Untersuchung und ihr Zustandekommen schriftlichdarstellen.Lehrveranstaltungen:1. Einführung in die bildungswissenschaftliche Forschung (Vorlesung) 2 SWS2. Lehrforschungsprojekt im Bereich Bildungs-, Schul-, Unterrichts-, Lern- oderSozialisationsforschung (Seminar)1 SWSPrüfung: Forschungsbericht (Gruppenprüfung; max. 25 S.; max. 5 S. je Prüfling)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie exemplarisch in einemForschungsprojekt aus einem ausgewählten Bereich der Bildungswissenschaften in derLage sind,· ausgehend von der methodenkritischen Rezeption empirischer Studien geeignetetheoretische Zugänge auszuwählen,· Forschungsfragen zu formulieren,· ein Untersuchungsdesign für die Bearbeitung der Forschungsfragen zu entwickeln,· methodengeleitet mit Datenmaterial umzugehen und· Schlussfolgerungen aus den gewonnen Ergebnissenim Hinblick auf den Stand derForschung zum Untersuchungsfeld zu ziehen.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7995
Modul M.BW.100Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Jörg WittwerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1Maximale Studierendenzahl:15Bemerkungen:Die Angabe zur maximalen Studierendenzahl bezieht sich auf jedes im Rahmen des Moduls angeboteneSeminar; sie kann um maximal 10 v.H. überschritten werden.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7996
Modul M.BW.200<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.BW.200: Lehren, Lernen, UnterrichtenEnglish title: Teaching and LearningLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden· kennen die Grundlagen allgemeindidaktischer, erziehungswissenschaftlicher undpsychologischer Theorien von Unterricht und können sie unterscheiden,· kennen unterschiedliche Lehransätze, Unterrichtsmethoden, Aufgabenformate undMedien und können beschreiben, wie sie situations- und anforderungsgerecht imUnterricht einzusetzen sind,9 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:186 Stunden· besitzen vertiefte Kenntnisse über Lerntheorien und Formen des Lernens und derenBedeutung für Unterrichtshandeln,· kennen Theorien der Lern- und Leistungsmotivation und wissen, wie sie im Unterrichtanzuwenden sind,· verstehen, wie psychologische Lernvoraussetzungen (z.B. Vorwissen, Selbstkonzept)Lehren und Lernen beeinflussen, und wissen, wie sie beim Unterrichten zuberücksichtigen sind,· können didaktische Praktiken des Zeigens und Interaktionen im Unterricht differenziertbeschreiben,· können über die Bedeutung von Ergebnissen empirischer Forschung für dieGestaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsprozessen kritisch reflektieren und· können methodengeleitet Prozesse des Lehrens, Lernens und Unterrichtensanalysieren und die gewonnenen Ergebnisse für die Planung und Gestaltung vonUnterricht nutzbar machen.Lehrveranstaltungen:1. Lehren, Lernen, Unterrichten (Vorlesung)Inhalte:· Psychologie des Lehrens, Lernens und Unterrichtens2 SWS· Psychologie des Lernenden· Allgemeindidaktische und erziehungswissenschaftliche Theorien von Unterricht· Methoden zur Untersuchung von Prozessen des Lehrens, Lernens und UnterrichtensAngebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2. Psychologie des Lehrens und Lernens (Seminar)Inhalte:· Formen von Lernen2 SWS· Formen von Lehren· Lernvoraussetzungen von Lernenden· Lehren und Lernen mit Medien<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7997
Modul M.BW.200· Lehren und Lernen in Gruppen3. Unterricht als Interaktion und Lehrerforschung (Seminar)Inhalte:· Ordnungen des Unterrichts und dazugehörige Unterrichtspraktiken2 SWS· Theorien und Forschung zu Lehrerprofessionalität und Lehrerhandeln· Analyse von Materialien, Unterrichtsplanungen, Aufgabenstellungen und Interaktionenim UnterrichtModulprüfung:Es ist eine der folgenden Prüfungsleistungen erfolgreich zu absolvieren. Inhalte derKlausur beziehen sich zu gleichen Teilen auf Vorlesung und beide Masterseminare.Prüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsanforderungen:Prüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie Theorien und Methodendes Lehrens, Lernens und Unterrichtens sowie Ergebnisse und Methoden derempirischen Forschung in diesem Bereich kennen und anwenden sowie ihre Bedeutungfür Unterricht kritisch reflektieren können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Jörg WittwerDauer:1-2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:40Bemerkungen:Die Angabe zur maximalen Studierendenzahl bezieht sich auf jedes im Rahmen des Moduls angeboteneSeminar; sie kann um maximal 10 v.H. überschritten werden.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7998
Modul M.BW.300<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.BW.300: Diagnostizieren, Beurteilen und FördernEnglish title: Diagnosis, Evaluation and DevelopmentLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden· besitzen eine vertiefte Kenntnis der pädagogisch-psychologischen Funktionen vonLeistungsüberprüfungen und -rückmeldungen· kennen die Grundlagen der kriterienorientierten Entwicklung von Aufgabenstellungenin verschiedenen Prüfungsformaten und können sie umsetzen6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 Stunden· können differenziert verschiedene Bezugsnormen bei Leistungsbeurteilungen und -rückmeldungen anwenden· kennen Methoden der Beurteilung von Lernprozessen (d.h. der kontinuierlichenErfassung und Analyse des Lernzuwachses) und können sie anwenden· kennen die Grundlagen standardisierter Testung und deren Anwendungsgebiete· können die Rolle von pädagogisch-psychologischer Diagnostik im Kontextgesellschaftlicher, politischer und institutioneller Erfordernisse kritisch reflektieren unddiskutieren· verfügen über Kenntnisse spezifischer und übergreifender besonderer psychologischerLernvoraussetzungen (z.B. Hochbegabung, Störungen des Schriftspracherwerbs undrechnerischen Fähigkeiten, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit)· kennen die Grundlagen der Diagnostik und Prävention von Lernbeeinträchtigungensowie der Förderung Betroffener und können diese anwenden· sind in der Lage besondere Lernvoraussetzungen bei der Gestaltung vonUnterrichtssituationen und Lernstandsrückmeldungen zu berücksichtigen· können auf der Basis differenzierter Verhaltensbeobachtung die eigeneBeratungskompetenz einschätzen und kennen ggf. weitere DelegationsmöglichkeitenLehrveranstaltungen:1. Leistungsbeurteilung, Diagnostik und Intervention in der Schule (Vorlesung)Inhalte:Vermittlung von Grundlagenkenntnissen in den Bereichen2 SWS· Diagnostik, Beurteilung und Förderung individueller Lernprozesse· Leistungsmessungen und Leistungsbeurteilungen· Prävention von, Intervention und Beratung bei individuellen LernproblemenAngebotshäufigkeit: jedes Sommersemester2. Diagnostizieren, Beurteilen und Fördern im schulischen Kontext (Seminar)Inhalte:Vertiefung, Ergänzung und exemplarische Anwendung in den Bereichen2 SWS· Diagnostik, Beurteilung und Förderung individueller Lernprozesse,<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 7999
Modul M.BW.300· Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung· Prävention von, Intervention und Beratung bei individuellen LernproblemenPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie Kompetenzen inden Bereichen Diagnostik, Beurteilung und Förderung individueller Lernprozesse,Leistungsmessung, Leistungsbeurteilung sowie Prävention von, Intervention undBeratung bei individuellen Lernproblemen erworben haben.Klausurinhalte zu gleichen Teilen aus Seminar und Vorlesung.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Dipl.-Psych. Ella FizkeDauer:1-2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2 - 3Maximale Studierendenzahl:40Bemerkungen:Die Angabe zur maximalen Studierendenzahl bezieht sich auf jedes im Rahmen des Moduls angeboteneSeminar; sie kann um maximal 10 v.H. überschritten werden.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8000
Modul M.BW.400<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.BW.400: Sozialisation und ErziehungEnglish title: Socialization and EducationLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden· kennen grundlegende sozialisationstheoretische Erklärungsansätze· kennen grundlegende Studien und empirische Befunde der Sozialisationsforschungund können individuelle Entwicklungsprozesse mit dem Wandel von Kindheit undJugend in Verbindung bringen und mit Hilfe sozialisationstheoretischer Konzepteerklären9 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:186 Stunden· kennen grundlegende Theorien der Erziehung und können strukturelle und begrifflicheÄhnlichkeiten und Unterschiede zwischen Sozialisations- und Erziehungsprozessenerkennen· kennen pädagogische Konzepte zum Umgang und zur Arbeit mit Kindern undJugendlichen und können situations-, entwicklungs- und problemangemessenepädagogische Handlungsperspektiven entwickeln und reflektieren· kennen Theorien pädagogischer Professionalität und können Erziehungshandeln inunterschiedlichen Kontexten mit Bezug auf Professionalisierungsstandards beurteilenLehrveranstaltungen:1. Sozialisation und Erziehung (Vorlesung)Inhalte:· grundlegende sozialisationstheoretische Erklärungsansätze2 SWS· individuelle Entwicklungsprozesse unter dem Einfluss von Sozialisationsinstanzen(Familie, Peers, Schule, Medien)· grundlegende Theorien der Erziehung und Erziehungsvorstellungen· pädagogisches Handeln und pädagogische Arbeitsbeziehungen2. Erziehen in schulischen und außerschulischen Handlungskontexten (Vorlesung)Inhalte:· exemplarische Anwendung grundlegender Theorien der Erziehung undpädagogischer Handlungskonzepte auf besondere Probleme und Einzelfälle in nichtprofessionalisiertenund professionalisierten Handlungskontexten2 SWSAngebotshäufigkeit: jedes Sommersemester3. Kindheit und Jugend in gesellschaftlichen Kontexten (Seminar)Inhalte:· exemplarische Anwendung grundlegender sozialisationstheoretischerErklärungsansätze (unter Einbeziehung von Studien und empirischen Befunden) aufindividuelle Entwicklungsprozesse unter dem Einfluss von Sozialisationsinstanzen(Familie, Peers, Schule, Medien)2 SWSPrüfung: Portfolio (max. 20 Seiten) oder Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder Essay(max. 15 Seiten) oder Klausur (90 Min.) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Min.)<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8001
Modul M.BW.400Prüfungsanforderungen:Die Studierenden sollen in der Modulprüfung nachweisen, dass sie in einemspezifizierten Themenbereich des Moduls in der Lage sind, auf der Grundlage derbegrifflichen Unterscheidung von Sozialisation und Erziehung· individuelle Entwicklungsprozesse mit dem Wandel von Kindheit und Jugend inVerbindung bringen und mit Hilfe sozialisationstheoretischer Konzepte zu erklären,· Verhalten von Kindern und Jugendlichen bzw. von Erziehungspersonen theoriebasiertzu analysieren,· situations-, entwicklungs- und problemangemessene pädagogischeHandlungsperspektiven zu entwickeln und zu reflektieren,· Erziehungshandeln mit Bezug auf Professionalisierungsstandards zu beurteilen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Hermann VeithDauer:1-2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:40Bemerkungen:Die Angabe zur maximalen Studierendenzahl bezieht sich auf jedes im Rahmen des Moduls angeboteneSeminar; sie kann um maximal 10 v.H. überschritten werden.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8002
Modul M.BW.500<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.BW.500: Bildung und SchulentwicklungEnglish title: Literacy and school developmentLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden· kennen zentrale Etappen der Entwicklung des Bildungssystems in Deutschland undinternational vergleichender Perspektive,· können Entwicklungen im Bildungs- und Schulsystem bildungstheoretisch einordnen,6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 Stunden· können Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf Schule als Institutionund auf organisationales und pädagogisches Handeln in Schule unter besondererBerücksichtigung des Gymnasiums analysieren,· kennen empirische Forschungsbefunde zu aktuellen gesellschaftlichenHerausforderungen für Bildung, Schule und Unterricht,· kennen theoretische Ansätze und Instrumente zur Gestaltung und Steuerungvon Schulentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen des Bildungssystems(Bildungsadministration, Einzelschule, Unterricht),· können Modelle und Instrumente der Schul- und Unterrichtsentwicklung für diePlanung eines Schulentwicklungsvorhabens anwenden,· können unter Verwendung empirisch fundierten Wissens und unterschiedlichertheoretischer Ansätze ausgewählte Reformvorhaben auf verschiedenen Ebenen desSchulsystems hinsichtlich ihrer Effekte analysieren und bewerten.Lehrveranstaltungen:1. Das Schulsystem in Deutschland - Geschichte und Gegenwartssituation(Vorlesung)Inhalte:· Entwicklung des Schulsystems (mit Fokus auf gymnasialer Bildung) in Verbindung mitanderen Bildungsinstitutionen und mit Blick auf bildungstheoretische Hintergründe2 SWS· aktuelle Entwicklungen im Bereich des Bildungssystems und der Schule (mit Fokus aufdas Gymnasium)Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester2. Bildungsreform und Schulentwicklung (Seminar)Inhalte:· Es sollen ausgewählte Beispiele aktueller Reformvorhaben analysiert und bewertetwerden2 SWS· ausgehend von schultheoretischen Annahmen,· der empirischen Forschung zu ihrer Umsetzung,· unter eventueller Erprobung und Analyse der eingesetzten Verfahren und Instrumente- im Hinblick auf Transfermöglichkeiten von Schulentwicklungskonzepten in die Praxis.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8003
Modul M.BW.500Prüfung: Portfolio (max. 20 Seiten) oder Hausarbeit (max. 15 Seiten) oder Klausur(90 Min.) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Min.)Prüfungsanforderungen:Darstellung eines ausgewählten Reformansatzes und seine Analyse wahlweise aus· historischer Perspektive unter Berücksichtigung des Zusammenhangs vonBildungstheorien und Institutionalisierung von Bildung· schultheoretischer Perspektive unter Berücksichtigung der Bedingungen institutionellenund organisationalen Handelns in Schule· Perspektive der empirischen Bildungsforschung unter Berücksichtigung erwünschterund unerwünschter Effekte der ReformZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Kerstin RabensteinDauer:1-2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2Maximale Studierendenzahl:40Bemerkungen:Die Angabe zur maximalen Studierendenzahl bezieht sich auf jedes im Rahmen des Moduls angeboteneSeminar; sie kann um maximal 10 v.H. überschritten werden.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8004
Modul M.Che.4802<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Che.4802: Fachdidaktik ChemieEnglish title: Didactics in ChemistryLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sollen mit relevanten chemiedidaktischen Forschungsergebnissenvertraut sein und sie zum Aufbau von Lernstrukturen und zur Weiterentwicklungvon Unterrichtsmaßnahmen nutzen können. Dabei sollen auch chemiedidaktischeForschungsarbeiten berücksichtigt und hinsichtlich ihrer Aussagen und ihrerAnwendbarkeit bewertet werden.11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:204 StundenSelbststudium:126 StundenZur Umsetzung sollen die Studierenden chemiedidaktische Themen sachgerechtpräsentieren und im Hinblick auf den Unterrichtseinsatz theoriebezogenreflektieren. Hierzu zählen bspw. verschiedene Unterrichtsverfahren und Konzepte,Diagnoseinstrumente, Formen und Methoden der Leistungsbeurteilung, Sozialformen,Modell- und Medieneinsatz.Fachpraktikum:Planung und Gestaltung von Unterrichtsstunden aufgrund aktueller Bildungsstandardsund Kerncurricula, Planen und Gestalten von Unterrichtseinheiten unter Einbezugfachbezogener und inhaltsbezogener Kompetenzen in Hinblick auf selbstgesteuertesund schülerzentriertes Lernen (u.a. Berücksichtigung der naturwissenschaftlichenArbeitsweise, Projektarbeit, Lernstationen, Freiarbeit, Chemie im Kontext), Fähigkeit zurAnalyse und Reflexion eigener und fremder Unterrichtsplanung und -tätigkeit und daraufbezogener Schülerlernprozesse unter Berücksichtigung aktueller fachdidaktischerForschung und Positionen.Lehrveranstaltung: Fachdidaktik - Vertiefung (Seminar)Studienleistung: aktive und regelmäßige Teilnahme am SeminarPrüfung: Präsentation (ca. 50 min.) und schriftliche Ausarbeitung (ca. 10 Seiten)einer SeminarsitzungPrüfungsanforderungen:Umfassender Überblick über chemiedidaktische Themen und deren Anwendung imUnterricht2 SWS3 CLehrveranstaltungen:1. Vorbereitung des Fachpraktikums (Seminar) 2 SWS2. Fachpraktikum (5-wöchig) oder Fachpraktikum (4-wöchig)3. Nachbereitung des Fachpraktikums (Seminar) 2 SWSPrüfung: Praktikumsbericht (max. 8 S.; zzgl. Anhänge)Prüfungsvorleistungen:Ausarbeitung einer Lehreinheit; erfolgreiche Teilnahme am FachpraktikumPrüfungsanforderungen:wissenschaftliche Reflexion über das Praktikum8 CZugangsvoraussetzungen:Empfohlene Vorkenntnisse:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8005
Modul M.Che.4802B.Che.4801-1 oder ÄquivalenteSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligkeineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Thomas WaitzDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:17<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8006
Modul M.Che.4803<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Che.4803: Praktikum zur Durchführung von SchulexperimentenEnglish title: Teaching practice: accomplishment of experimentsLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, chemische Fachinhalte durch Schulexperimentezu vermitteln. Sie kennen Formen des Schulexperiments und besitzen ein breitesRepertoire an Versuchen.Im Einzelnen können sie chemische Experimente selbständig planen und mitschulüblichen Geräten und Chemikalien unter Beachtung sicherheitsrelevanter Faktorenselbständig durchführen und curricular einordnen. Weiterhin können die Studierendenunter Einbeziehung vorhandener Kommunikationstechnologien Schulexperimente unterBerücksichtigung von Wahrnehmungsregeln demonstrieren und in ihrer Aussagekraftkritisch bewerten als auch alternative Versuche diskutieren.Lehrveranstaltung: Schulversuche für Lehramtskandidaten (Praktikum)6 C10 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:140 StundenSelbststudium:40 Stunden10 SWSPrüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Min.)Prüfungsvorleistungen:Erfolgreiche Teilnahme am PraktikumPrüfungsanforderungen:Planung und Beurteilung von SchulexperimentenZugangsvoraussetzungen:B.Che.4102, B.Che.4202 und B.Che.4302 oderÄquivalenteSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Thomas WaitzDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2Maximale Studierendenzahl:17Bemerkungen:Es werden 2 C des Kompetenzbereichs Fachwissenschaft integrativ erworben.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8007
Modul M.Edu.100<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Edu.100: MasterabschlussmodulEnglish title: Graduation moduleLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können· selbständig und kritisch wissenschaftliche Positionen des Faches, derBildungswissenschaften und der Fachdidaktik würdigen und auf die Schulpraxisbeziehen.6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 Stunden· Themen des Faches, der Fachdidaktik und der Bildungswissenschaften in eigenerwissenschaftlicher Darstellung bearbeiten und auf die Schulpraxis beziehen.· sich am fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichenwissenschaftlichen Diskurs der Gegenwart mit einem eigenständigen Beitrag beteiligenund diese Diskurse aufeinander und auf die Schulpraxis beziehen.· Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung im Rahmen und Umfang einerMasterarbeit darstellen.Lehrveranstaltung: Seminar2 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 60 Minuten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige TeilnahmePrüfungsanforderungen:Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die Unterrichtsfächer und dieBildungswissenschaften. Studierende sollen nachweisen, dass sie die erforderlichenKompetenzen erworben haben, sie systematisch in Bezug zur Schulpraxis setzen und ineinen kritisch-diskursiven Dialog treten können. Fachwissenschaftliche, fachdidaktischeund methodische Kompetenzen werden unter Einbeziehung bildungswissenschaftlicherAspekte fächerübergreifend geprüft.Zugangsvoraussetzungen:Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen zurMasterarbeitSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Susanne SchneiderDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:3 - 4Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8008
Modul M.Edu-FD-Ger.01a<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Edu-FD-Ger.01a: Fachdidaktik Deutsch 1aEnglish title: Teaching Methodology German 1aLernziele/Kompetenzen:- Studierende erwerben die Kompetenz, Vermittlungsaufgaben des Faches in seinemGegenstandsbereich "Deutsche Sprache und Literatur" in Verantwortung gegenüberderen fachwissenschaftlicher Modellierung im gegenwärtigen Diskurs wahrzunehmen;sie können sich in wissenschaftlicher Arbeit an der Reflexion des Selbstverständnissesdes Faches, seiner Ziele in Gegenwart und Vergangenheit auch im Kontext desFächerkanons mit fachspezifischen und fächerübergreifenden Aspekten beteiligen.11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:164 StundenSelbststudium:166 Stunden- Studierende erwerben Kompetenzen in der Reflexion der Lehrerrolle als einerVermittlungsinstanz für den Gegenstandsbereich „Deutsche Sprache und Literatur“,können fachbezogen Interessen der Schüler und Schülerinnen erkennen, fördern undsie solche entwickeln lassen; sie erkennen die fachspezifischen Leistungspotenziale derSchülerinnen und Schüler und können sie differenziert weiterführen.- Studierende können kriterienorientiert, d.h. vor dem Hintergrund fachwissenschaftlicherGegenstandskonstitution und lerntheoretischer Modelle - Fachunterricht beobachten,- selbst Unterrichtskonzepte zu ausgewählten fachlichen Bereichen entwickeln,Fachunterricht planen und in angemessenen Situationen (Praktikumsschule)durchführen,- sowie die dabei gemachten Erfahrungen nach wissenschaftlichen Prinzipienangemessen darstellen.Lehrveranstaltung: Vorlesung mit integrierten Übungsanteilen(forschungsbezogen) oder SeminarPrüfung: Hausarbeit (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), auch in Formalternativer Formen wie Portfolio oder Lerntagebuch oder mit Essayanteilen (max.48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), oder Klausur (90 Min.)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme am Seminar2 SWS7 CLehrveranstaltungen:1. Seminar zur Vorbereitung des Fachpraktikums 2 SWS2. Fachpraktikum (Tätigkeit vor Ort an der Schule, 5 Wochen, 80 h)3. Seminar zur Auswertung des Fachpraktikums 2 SWSPrüfung: Bericht (max. 24.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) in 3.Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme an Vorbereitungsseminar und Praktikum, sowieBerichterstattung über Praktikumstätigkeit in Form von Zwischenberichten (max. 24.000Zeichen inkl. Leerzeichen) in 3.4 CPrüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Prüfung nach, dass sie<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8009
Modul M.Edu-FD-Ger.01a• fachspezifischen Interessen und Leistungspotenziale der Schülerinnen undSchüler erkennen und sie differenziert weiterführen können• in der Lage sind, der Lehrerrolle als eine Vermittlungsinstanz für denGegenstandsbereich „Deutsche Sprache und Literatur", zu reflektieren• selbst Unterrichtskonzepte zu ausgewählten fachlichen Bereichen entwickelnkönnen• in der Lage sind, Fachunterricht zu planen und in angemessenen Situationen(Praktikumsschule) durchzuführen• die dabei gemachten Erfahrungen nach wissenschaftlichen Prinzipienangemessen darzustellen vermögen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Christoph BräuerDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:84Bemerkungen:Maximale Studierendenzahl pro Seminar: 20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8010
Modul M.Edu-FD-Ger.01b<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Edu-FD-Ger.01b: Fachdidaktik Deutsch 1bEnglish title: Teaching Methodology German 1bLernziele/Kompetenzen:- Studierende erwerben die Kompetenz, Vermittlungsaufgaben des Faches in seinemGegenstandsbereich "Deutsche Sprache und Literatur" in Verantwortung gegenüberderen fachwissenschaftlicher Modellierung im gegenwärtigen Diskurs wahrzunehmen;sie können sich in wissenschaftlicher Arbeit an der Reflexion des Selbstverständnissesdes Faches, seiner Ziele in Gegenwart und Vergangenheit auch im Kontext desFächerkanons mit fachspezifischen und fächerübergreifenden Aspekten beteiligen.11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:164 StundenSelbststudium:166 Stunden- Studierende erwerben Kompetenzen in der Reflexion der Lehrerrolle als einerVermittlungsinstanz für den Gegenstandsbereich "Deutsche Sprache und Literatur",können fachbezogen Interessen der Schüler und Schülerinnen erkennen, fördern undsie solche entwickeln lassen; sie erkennen die fachspezifischen Leistungspotenziale derSchülerinnen und Schüler und können sie differenziert weiterführen.Die Studierenden können anhand eines von ihnen gewählten Erkenntnisinteresses- Fachunterricht beobachten und methodisch reflektiert beurteilen und/oder- Fachunterricht planen, durchführen und auf der Grundlageunterrichtswissenschaftlicher Methodologie reflektieren und/oder- eine Fallstudie zu einem fachdidaktischen Sachverhalt durchführen und dies inwissenschaftlich angemessener Form darstellen.Lehrveranstaltung: Vorlesung mit integrierten Übungsanteilen(forschungsbezogen) oder SeminarPrüfung: Hausarbeit (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), auch in Formalternativer Formen wie Portfolio oder Lerntagebuch oder mit Essayanteilen (max.48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), oder Klausur (90 Min.)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme am Seminar2 SWS7 CLehrveranstaltungen:1. Seminar zur Vorbereitung des Forschungspraktikums 2 SWS2. Forschungspraktikum (Tätigkeit vor Ort an der Schule, 4 Wochen, 80 h)3. Seminar zur Auswertung des Forschungspraktikums 2 SWSPrüfung: Bericht (max. 24.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) in 3.Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme an Vorbereitungsseminar und Praktikum, sowieBerichterstattung über Praktikumstätigkeit in Form von Zwischenberichten (max. 24.000Zeichen inkl. Leerzeichen) in 3.4 CPrüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen in der Prüfung nach, dass sie<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8011
Modul M.Edu-FD-Ger.01b• fachspezifischen Interessen und Leistungspotenziale der Schülerinnen und Schülererkennen und sie differenziert weiterführen können• in der Lage sind, der Lehrerrolle als eine Vermittlungsinstanz für denGegenstandsbereich „Deutsche Sprache und Literatur", zu reflektieren• selbst Unterrichtskonzepte zu ausgewählten fachlichen Bereichen entwickeln können• in der Lage sind, Fachunterricht zu planen und in angemessenen Situationen(Praktikumsschule) durchzuführen• die dabei gemachten Erfahrungen nach wissenschaftlichen Prinzipien angemessendarzustellen vermögen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Christoph BräuerDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:84Bemerkungen:Maximale Studierendenzahl pro Seminar: 20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8012
Modul M.Edu-FD-Ger.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Edu-FD-Ger.02: Fachdidaktik - Fachwissenschaft DeutschintegrativEnglish title: Teaching Methodology - Specialized Subject German integrativeLernziele/Kompetenzen:Studierende können an ausgewählten Bereichen aus dem Gegenstandskomplex"Deutsche Sprache und Literatur" fachwissenschaftliche und unterrichtsrelevanteAspekte miteinander verbinden und didaktische Entscheidungen theoriegeleitet und imWissen um die Verantwortung gegenüber Bildungstraditionen und -konzepten für diePraxis formulieren und dies in wissenschaftlich angemessener Form darstellen6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenLehrveranstaltungen:1. Fachwissenschaft (Vorlesung, Seminar, Blockveranstaltung) 2 SWS2. Seminar (Fachdidaktik), einschließlich themenrelevanten Praxisbezug (bspw.Hospitationen) (Seminar)2 SWSPrüfung: zu 2. mündliche und schriftliche Leistung (s.u.)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme am SeminarPrüfungsanforderungen:1) Mediengestützte mündliche Präsentation oder mündliche Unterrichtsreflexion oderModeration einer Seminarsitzung oder strukturierte Leitung der Gruppendiskussion(25% Notenanteil)2) Hausarbeit (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen, auch in Form alternativer Formenwie Portfolio oder Lerntagebuch oder mit Essayanteilen (max. 48.000 Zeichen inkl.Leerzeichen)) oder Klausur (60 Minuten) (75% Notenanteil)Die Studierenden zeigen in der Prüfung, dass sie• an ausgewählten Bereichen aus dem Gegenstandskomplex „Deutsche Spracheund Literatur" fachwissenschaftliche und unter-richtsrelevante Aspekte miteinanderverbinden können• didaktische Entscheidungen theoriegeleitet für die Praxis formulieren und dies inwissenschaftlich angemessener Form darstellen können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Ina KargDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:84<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8013
Modul M.Edu-FD-Ger.02Bemerkungen:Maximale Studierendenzahl pro Seminar: 20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8014
Modul M.Edu-Ger.01<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Edu-Ger.01: LiteraturwissenschaftEnglish title: Literary StudiesLernziele/Kompetenzen:Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls• können an die in den B.A.-Studiengängen erworbenen literaturwissenschaftlichen und/oder mediävistischen Kompetenzen anknüpfen und sind in der Lage, literarische Textegestützt auf fachspezifisches Wissen unter Beachtung ihrer ästhetischen Qualität sowiehistorischer und soziokultureller Zusammenhänge zu erschließen.7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 Stunden• erschließen auf der Basis intensiver und extensiver eigener Leseerfahrungenliterarischer Texte unterschiedlicher Epochen, Gattungen (verschiedene Genres) undAutoren• beschreiben die Merkmale und die Entwicklung literarischer Gattungen• analysieren Texte in ihrer ästhetischen Besonderheit• deuten literarische Texte unter Berücksichtigung des biografischen, historischen,sozialen und kulturellen Kontextes• wenden Methoden der Textanalyse und –interpretation unter Beherrschung dererforderlichen Fachbegriffe an• verfügen über literarisches Überblickswissen im Hinblick auf Epochen, Gattungen,Autoren, Werke, Motive und Genres.Lehrveranstaltungen:1. Master Seminar Literaturwissenschaft (NdL oder Mediävistik) (Seminar) 2 SWS2. Übung(Wenn das Seminar in NdL gewählt wird, muss die Übung in Mediävistik absolviertwerden und vice versa.)2 SWSPrüfung: zu 1. mündliche und schriftliche Leistung (s.u.)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme an Seminar und ÜbungPrüfungsanforderungen:1) Mediengestützte mündliche Präsentation oder mündliche Unterrichtsreflexion oderModeration einer Seminarsitzung oder strukturierte Leitung der Gruppendiskussion(25% Notenanteil)2) Hausarbeit im Seminar (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen, auch in Formalternativer Formen wie Portfolio oder Lerntagebuch oder mit Essayanteilen (max.48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen); 75% Notenanteil)Die Studierenden weisen in der Prüfung nach, dass sie• über Grundlagen der der gesamten Literaturgeschichte ab dem Mittelalter verfügen• literarische Texte unterschiedlicher Epochen, Gattungen (verschiedene Genres)und Autoren erschließen können,<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8015
Modul M.Edu-Ger.01• methodische Zugänge zu Literatur - Literaturtheorien im historisch-kulturellenKontext zu reflektieren in der Lage sind• literarische Texte in ihrer ästheti-schen Besonderheit analysieren können,• Methoden der Textanalyse und –interpretation – unter Beherrschung dererforderlichen Fachbegriffe anwenden können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:apl. Prof. Dr. Albert BuschDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:106<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8016
Modul M.Edu-Ger.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Edu-Ger.02: Germanistische LinguistikEnglish title: German LinguisticsLernziele/Kompetenzen:Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls• erbringen den Nachweis, dass sie über fortgeschrittene deskriptive undtheoretische Kenntnisse in den Kernbereichen der Grammatik des Deutschenverfügen (Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik)• kennen wesentliche Eigenschaften der gesprochenen und geschriebenenSprache, inklusive der grundlegenden Regularitäten der deutschen Graphematik• kennen wesentliche Dimensionen der sprachlichen Variation• können normative und deskriptive Aspekte kritisch reflektieren• können die wesentlichen linguistischen Merkmale von Texten und Diskursenbeschreiben• können eigenständig zentrale sprachliche Phänomene des Deutschen beschreibenund mithilfe etablierter linguistischer Theorien analysieren• sind in der Lage, am Beispiel ausgewählter Phänomene die grammatischenStrukturen des Deutschen vergleichend in Beziehung zu den grammatischenStrukturen anderer schulrelevanter Sprachen zu setzen.5 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:94 StundenLehrveranstaltungen:1. Masterseminar: Linguistik 2 SWS2. Mastervorlesung: Linguistik 2 SWSPrüfung: mündliche und schriftliche Leistung (im Seminar; siehe unten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive Teilnahme am SeminarPrüfungsanforderungen:1) Mediengestützte mündliche Präsentation oder mündliche Unterrichtsreflexion oderModeration einer Seminarsitzung oder strukturierte Leitung der Gruppendiskussion(25% Notenanteil)2) Hausarbeit (max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) oder äquivalente Leistung(praktisch/experimentelle Studie, Posterpräsentation) oder Klausur (60 Minuten) (75%Notenanteil).Die Art der Prüfungsleistungen wird jeweils zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.Die Studierenden weisen in der Prüfung nach, dass sie• grammatische Phänomene des Deutschen mithilfe etablierter linguistischerTheorien analysieren können• Grundkenntnisse der Eigenschaften gesprochener und geschriebener Spracheund der deutschen Graphematik haben• formale und funktionale Eigenschaften von Texten analysieren könnenZugangsvoraussetzungen:keineEmpfohlene Vorkenntnisse:keine<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8017
Modul M.Edu-Ger.02Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Markus SteinbachDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:53<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8018
Modul M.EP.01a-L<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EP.01a-L: Anglistische Literatur- und KulturwissenschaftEnglish title: Anglophone Literature and CultureLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Vertiefung und Festigung der im Bachelor-Studium erlangten literatur- undkulturwissenschaftlichen Inhalts- und Methodenkenntnisse im Bereich der britischenbzw. anglophonen Literaturen und Kulturen. Fähigkeit zum synergetischen Gebrauchvon literatur- und kulturwissenschaftlichen Methoden durch die Kombination diachronerund synchroner Ansätze in den unten genannten Veranstaltungen.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenKompetenzen:[Kompetenzbereich 2: Literaturwissenschaft/Umgang mit Texten] Studierende erläuternund reflektieren Theorien, Methoden und Begriffe der Analyse fiktionaler und nichtfiktionalerTexte sowie audiovisueller Medien. Sie können diese in ihren spezifischenliteraturwissenschaftlichen und historischen Kontext einordnen und beschreibenund beherrschen in Grundzügen die Literatur- und Kulturgeschichte von der FrühenNeuzeit bis zur Gegenwart. Sie können dabei Produktions-, Distributions- undRezeptionszusammenhänge der britischen bzw. anglophonen Literatur und Kultur imgrößeren europäischen Kontext analysieren und bewerten.[Kompetenzbereich 3: Vermittlung interkulturellen Wissens] Absolventen undAbsolventinnen reflektieren kulturelle, politische und soziale Aspekte und Strukturenanglophoner Länder. Sie entwickeln ein Problembewusstsein insbesondere im Hinblickauf multikulturelle Phänomene und deren Umsetzung in der Literatur und KulturGroßbritanniens und anglophoner Länder.Lehrveranstaltungen:1. Vorlesung zur anglistischen Literatur- und Kulturwissenschaft 2 SWS2. Seminar zur anglistischen Literatur- und Kulturwissenschaft 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 7500 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme in 2.Prüfungsanforderungen:Vertiefung und Festigung der im Bachelor-Studium erlangten literatur- undkulturwissenschaftlichen Inhalts- und Methodenkenntnisse im Fach British Studies.Fähigkeit zum synergetischen Gebrauch von literatur- und kulturwissenschaftlichenMethoden durch die Kombination diachroner und synchroner Ansätze in den untengenannten Veranstaltungen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:EnglischEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Barbara Schaff<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8019
Modul M.EP.01a-LAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8020
Modul M.EP.01b-L<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EP.01b-L: NordamerikastudienEnglish title: North American Literature and CultureLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Vertiefung und Festigung der im Bachelor-Studium erlangten literatur- undkulturwissenschaftlichen Inhalts- und Methodenkenntnisse im Fach American Studies.Fähigkeit zum synergetischen Gebrauch von literatur- und kulturwissenschaftlichenMethoden durch die Kombination diachroner und synchroner Ansätze inliteraturhistorischer oder literatur-, kultur- und medientheoretischer Vorlesung undamerikanistischem Hauptseminar.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenKompetenzen:[Kompetenzbereich 2: Literaturwissenschaft/Umgang mit Texten] Studierende erläuternund reflektieren Theorien, Methoden und Begriffe der Analyse fiktionaler und nichtfiktionalerTexte sowie audiovisueller Medien. Sie beherrschen in Grundzügen dieamerikanische Literatur- und Kulturgeschichte und können einzelne Texte in ihrenspezifischen literaturwissenschaftlichen und historischen Kontext einordnen undbeschreiben.[Kompetenzbereich 3: Vermittlung interkulturellen Wissens] Absolventen undAbsolventinnen reflektieren kulturelle, politische und soziale Aspekte und Strukturendes amerikanischen Kontinents. Sie entwickeln ein Problembewusstsein insbesondereim Hinblick auf multikulturelle Phänomene der Vereinigten Staaten und benachbarterLänder.Lehrveranstaltungen:1. Vorlesung zur amerikanischen Literatur- und Kulturgeschichte oder zurLiteratur-, Kultur- und Medientheorie2 SWS2. Amerikanistisches Hauptseminar 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 7500 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme in 2.Prüfungsanforderungen:Vertiefung und Festigung der im Bachelor-Studium erlangten literatur- undkulturwissenschaftlichen Inhalts- und Methodenkenntnisse im Fach American Studies.Fähigkeit zum synergetischen Gebrauch von literatur- und kulturwissenschaftlichenMethoden durch die Kombination diachroner und synchroner Ansätze inliteraturhistorischer oder literatur-, kultur- und medientheoretischer Vorlesung undamerikanistischem Hauptseminar.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:EnglischEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Frank Kelleter<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8021
Modul M.EP.01b-LAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8022
Modul M.EP.02a-L<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EP.02a-L: LinguistikEnglish title: English LinguisticsLernziele/Kompetenzen:• Vertiefung und Festigung der im Bachelor-Studium erlangten Kenntnisse undKompetenzen zum Sprachsystem (Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik)und zum Sprachgebrauch (Pragmatik, Soziolinguistik, Psycholinguistik) desEnglischen im Sinne der im Kompetenzbereich 4 formulierten Kompetenzen derNds. MasterVO-Lehr:• Die Studierenden können in eigenen Projekten sprachwissenschaftliche Methodenin den zentralen Forschungsfeldern der modernen Sprachwissenschaft anwendensowie Argumentationsstrategien kritisch analysieren (Kompetenz 1).• Die Studierenden können die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren und debattierenund die zentralen Gesetzmäßigkeiten der englischen Sprache und ihrer Varietätenexplizieren (Kompetenz 2).• Die Studierenden kennen die wichtigsten Konzepte des Fremdsprachenerwerbsund können die psycholinguistischen und soziolinguistischen Aspekte vonMehrsprachigkeit reflektieren (Kompetenzen 3 und 4).• Die Studierenden können die Relevanz des sprachwissenschaftlichenGegenstandes für das Unterrichtsfach Englisch erkennen und reflektieren (Bezugzur Fachdidaktik).6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenLehrveranstaltungen:1. Vorlesung 'English Linguistics: An Overview' (Vorlesung) 2 SWS2. Linguistisches Hauptseminar 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 7500 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive Teilnahme mit nicht mehr als zwei entschuldigten FehlsitzungenPrüfungsanforderungen:Nachweis der Fähigkeit, relevante Forschungsliteratur zu einem sprachwissenschaftlichinteressanten Thema zu recherchieren und zu rezipieren, die relevantenForschungsfragen zu extrahieren, den sprachlichen Gegenstand differenziert zuanalysieren und eine angemessene Theorie auszuwählen und zu evaluieren.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:EnglischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Regine EckardtDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8023
Modul M.EP.02a-LMaximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8024
Modul M.EP.02b-L<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EP.02b-L: MediävistikEnglish title: Medieval English StudiesLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Erweiterung und Verfestigung der im B.-A. erworbenen Kenntnisse zur englischenSprachgeschichte, zur mittelalterlichen englischen Literatur und Kultur sowie zur Alteritätmittelalterlicher Literatur; Kontextualisierung mittelalterlicher englischer Literatur undKultur in einem größeren europäischen Zusammenhang. Vermittlung der Fähigkeit,zentrale Aspekte der behandelten Thematik zu erkennen und zu reflektieren und überdie Grenzen des Teilfachs hinaus einen Bezug zur englischen Gegenwartssprachesowie zur späteren englischsprachigen Literatur und Kultur herzustellen.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenKompetenzen:[Kompetenzbereich 1.2 Sprache] Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnis vonwesentlichen sozialen und regionalen Sprachvarietäten des Englischen auf historischerBasis.[Kompetenzbereich 4.1: Sprachwissenschaft] Sie beschreiben und analysieren diehistorische Entwicklung der Gegenwartssprache theoriegeleitet und methodischangemessen und nutzen Begriffe und Verfahrensweisen der historischenSprachwissenschaft einschließlich ihrer Erläuterung und kritischen Reflexion.[Kompetenzbereich 2.1-3: Literaturwissenschaft/Umgang mit Texten] Sie erläutern undreflektieren Theorien, Methoden und Begriffe der Analyse fiktionaler und nicht-fiktionalerTexte sowie audiovisueller Medien. Sie können diese in ihren spezifischen historischenund literatur-historischen Kontext einordnen und beschreiben, analysieren und bewertendabei Produktions-, Distributions- und Rezeptionszusammenhänge der mittelalterlichenenglischen Literatur und Kultur im größeren europäischen Kontext.[Kompetenzbereich 3.1: Vermittlung interkulturellen Wissens] Absolventen undAbsolventinnen reflektieren kulturelle, politische und soziale Aspekte und StrukturenEnglands auf historischer Basis.Lehrveranstaltungen:1. Vorlesung zur mittelalterlichen englischen Literatur und Kultur oder zurenglischen Sprachgeschichte2 SWS2. Mediävistisches Hauptseminar 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 7500 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme in 2.Prüfungsanforderungen:Vertiefung und Festigung der im B.A.-Studium erlangten sprach-, literatur- undkulturwissenschaftlichen Inhalts- und Methodenkenntnisse im Fach englischeMediävistik. Ausbildung der Fähigkeit, diese Kenntnisse auf fortgeschrittener Ebene zur<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8025
Modul M.EP.02b-Lkritisch-analytischen Behandlung von Fragestellungen aus der englischen Mediävistikeinzusetzen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Dr. Dirk SchultzeDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8026
Modul M.EP.03-1a-L<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EP.03-1a-L: Fachdidaktik des Englischen (mit 5-wöchigemFachpraktikum)English title: EFL Theory (accompanied by a five-week practical training)Lernziele/Kompetenzen:Einübung in fachspezifische Unterrichtsplanung: Auswahl und Begründung von Themenund Texten; Formulierung von Lernzielen; Auswahl und Strukturierung von Materialien;Wahl geeigneter Methoden, Sozial- und Kommunikationsformen; Initiierung undFörderung interkultureller Lernprozesse; Dokumentation, Präsentation und Evaluationvon Unterrichtsergebnissen; Reflexion von eigenen Unterrichtserfahrungen (aus demPraktikum)11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:204 StundenSelbststudium:126 StundenLehrveranstaltungen:1. Vorlesung oder Übung zur englischen Fachdidaktik 2 SWS2. Begleitseminar zur Vor- und Nachbereitung des Fachpraktikums Englisch 4 SWS3. Fachpraktikum (5 Wochen)Prüfung: Mündlich (ca. 15 Minuten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme in 2.Prüfung: Praktikumsbericht (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme an 3.3 C8 CPrüfungsanforderungen:Einübung in fachspezifische Unterrichtsplanung: Auswahl und Begründung von Themenund Texten; Formulierung von Lernzielen; Auswahl und Strukturierung von Materialien;Wahl geeigneter Methoden, Sozial- und Kommunikationsformen; Initiierung undFörderung interkultureller Lernprozesse; Dokumentation, Präsentation und Evaluationvon Unterrichtsergebnissen; Reflexion von eigenen Unterrichtserfahrungen (aus demPraktikum)Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Carola SurkampDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8027
Modul M.EP.03-1b-L<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EP.03-1b-L: Fachdidaktik des Englischen (mit 4-wöchigemForschungspraktikum)English title: EFL Theory (accompanied by four-week research experience)Lernziele/Kompetenzen:Beobachtung und Analyse von Englischunterricht, d.h. schulischer Vermittlungsprozessein Bezug auf die englische Sprache, Literatur und Kultur nach allgemein- undfachdidaktischen Kategorien. Entwicklung von Kompetenzen zur empirisch arbeitendenSprachlehrforschung, zur fachdidaktischen Forschung in den Bereichen Sprache,Literatur, Medien und Kultur sowie zur Lehrerhandlungsforschung.11 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:176 StundenSelbststudium:154 StundenLehrveranstaltungen:1. Vorlesung oder Übung zur englischen Fachdidaktik 2 SWS2. Begleitseminar zum Forschungspraktikum Englisch 2 SWS3. Fachpraktikum (4 Wochen)Prüfung: Mündlich (ca. 15 Minuten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme in 2.Prüfung: Praktikumsbericht (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme an 3.3 C8 CPrüfungsanforderungen:Beobachtung und Analyse von Englischunterricht, d.h. schulischer Vermittlungsprozessein Bezug auf die englische Sprache, Literatur und Kultur nach allgemein- undfachdidaktischen Kategorien. Entwicklung von Kompetenzen zur empirisch arbeitendenSprachlehrforschung, zur fachdidaktischen Forschung in den Bereichen Sprache,Literatur, Medien und Kultur sowie zur Lehrerhandlungsforschung.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Carola SurkampDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8028
Modul M.EP.03-2-L<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EP.03-2-L: Fachdidaktik des Englischen (Vertiefung)English title: Advanced EFL TheoryLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Vertiefung und Festigung der im Bachelor-Studium erlangtenfremdsprachendidaktischen Kenntnisse. Verbindung von fachdidaktischen Theorien,Methoden und Fragestellungen mit fachwissenschaftlichen Inhalten und Theorien.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenKompetenzen (Kompetenzbereich 5):Kenntnis und Reflexion von Theorien, Methoden und Erträgen fachdidaktischerForschung (historische und aktuelle Modelle der Sprach-, Literatur- undKulturvermittlung, Medien- und Methodenkonzepte, Kompetenzmodelle, Steuerungvon Lernprozessen, Leistungsfeststellung und -bewertung) sowie bildungspolitischerMaßgaben. Reflexion über Einsatzmöglichkeiten und Anpassungsnotwendigkeitenfachwissenschaftlichen Materials für schulische Gegebenheiten.Lehrveranstaltungen:1. Seminar zur englischen Fachdidaktik 2 SWS2. Fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung 2 SWSPrüfung: Präsentation (ca. 30 Min.) mit Diskussionsleitung und schriftlicherAusarbeitung (max. 2000 Wörter; Unterrichtseinheit mit fachwissenschaftlichemFokus)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige TeilnahmePrüfungsanforderungen:Vertiefung und Festigung der im Bachelor-Studium erlangten fremdsprachendidaktischenKenntnisse. Verbindung von fachdidaktischen Theorien, Methodenund Fragestellungen mit fachwissenschaftlichen Inhalten und Theorien.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:EnglischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Carola SurkampDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 80<strong>29</strong>
Modul M.EvRel.01<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EvRel.01: Fachliche SchwerpunktbildungLernziele/Kompetenzen:Schwerpunktbildung in einem Teilfach der Theologie (AT, NT, KG oder ST) durcherfolgreiche Teilnahme an einem Hauptseminar und einer weiteren LV (wahlfrei) sowieAnfertigung einer wissenschaftlichen Hausarbeit (max. 25 S.)· Vertiefung der eigenen Kenntnisse sowie Ausweitung der Methoden- undUrteilskompetenz in einem der o. a. Teilfächer der Theologie8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 Stunden· Reflexion der wissenschaftlichen Aufgabenstellung dieses TeilfachesEigenständige Auseinandersetzung mit einem Thema aus diesem Teilfach in einer wiss.HausarbeitLehrveranstaltungen:1. Hauptseminar aus einem der Teilfächer AT, NT, KG oder ST(wahlfrei, aber nicht aus dem Fach der BA-Arbeit)2 SWS2. Lehrveranstaltung aus demselben Teilfach (Übung, Vorlesung, Hauptseminar) 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten)Prüfungsanforderungen:Fähigkeit, die wissenschaftliche Aufgabenstellung eines Teilfaches der Theologie zureflektieren und eigenständig zu bearbeiten; Erschließung eines Themas aus diesemTeilfach in einer wiss. Hausarbeit.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. theol. Reiner AnselmDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:60<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8030
Modul M.EvRel.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EvRel.02: Thematische SchwerpunktbildungLernziele/Kompetenzen:Schwerpunktbildung bei einem religionsunterrichtlich zentralen Thema (Gottesfrage,Schöpfung, Jesus Christus, Heilige Schriften, Kirche ...) durch erfolgreiche Teilnahme aneinem Hauptseminar aus einem Teilfach der Theologie (AT, NT, KG oder ST) (wahlfrei)und einer weiteren Lehrveranstaltung aus einem der Fächer RW, Jud. oder Ök./Ostk.(wahlfrei) zu diesem Thema – inklusive mündlicher Modulabschlussprüfung6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 Stunden· Vertiefung der eigenen Kenntnisse sowie Ausweitung der Reflexions- undUrteilsfähigkeit in Bezug auf ein Hauptthema der Theologie aus binnentheologischerund aus interkultureller bzw. interreligiöser Perspektive· Erschließung der Gegenwartsbedeutung dieses theologischen ThemasLehrveranstaltungen:1. Hauptseminar aus einem der Teilfächer AT, NT, KG oder ST(wahlfrei, aber nicht aus dem Teilfach des Moduls M.EvRel.01)2. Lehrveranstaltung aus einem der Fächer RW, Jud. oder Ök./Ostk. (Übung,Vorlesung, Hauptseminar)2 SWS2 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsanforderungen:Fähigkeit, ein religionsunterrichtliches Thema aus binnentheologischer wie ausinterkultureller bzw. interreligiöser Perspektive zu reflektieren, Anwendung dieserKompetenz in einer mdl. PrüfungZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jährlichWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. theol. Reiner AnselmDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:60<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8031
Modul M.EvRel.03a<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EvRel.03a: Planung und Reflexion von Religionsunterricht(a)Lernziele/Kompetenzen:Religionsunterricht auf der Grundlage eines Vorbereitungsschemas im Blick auf einespezifische Lerngruppe sowie ein spezifisches Thema planen und gestalten können;Religionsunterrichtliche Lehr-Lernprozesse und eigene Lehrerfahrungen reflektierenkönnen.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:176 StundenSelbststudium:64 StundenLehrveranstaltungen:1. Vor- und nachbereitende Lehrveranstaltung zum ersten Fachpraktikum 4 SWS2. Fachpraktikum (5 Wochen)Prüfung: Praktikumsbericht/Portfolio (max. 15 Seiten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am FachpraktikumPrüfungsanforderungen:Fähigkeit zur Planung und Reflexion von Religionsunterricht, Analyse und Reflexion desFachpraktikums in einer schriftlichen AusarbeitungZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd SchröderDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:60<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8032
Modul M.EvRel.03b<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EvRel.03b: Planung und Reflexion von Religionsunterricht(b)Lernziele/Kompetenzen:Religionsunterricht auf der Grundlage eines Vorbereitungsschemas im Blick auf einespezifische Lerngruppe sowie ein spezifisches Thema planen und reflektieren können;spezifische Aspekte des Religionsunterrichts (z.B. Verhalten der Lehrkraft) wahrnehmenund beurteilen können;8 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:148 StundenSelbststudium:92 StundenLernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler diagnostizieren können;empirische Methoden im Blick auf religiöse Lehr- und Lernprozesse elementaranwenden können.Lehrveranstaltungen:1. Seminar zum zweiten Fachpraktikum oder zum Forschungspraktikum 2 SWS2. Fachpraktikum / Forschungspraktikum (4 Wochen)Prüfung: Hausarbeit/Portfolio (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am Fachpraktikum/ForschungspraktikumPrüfungsanforderungen:Fähigkeit zur Planung und Reflexion von Religionsunterricht, Analyse und Reflexion desFach- bzw. Forschungspraktikums in einer schriftlichen AusarbeitungZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd SchröderDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:60<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8033
Modul M.EvRel.04<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.EvRel.04: Analyse und Entwicklung von religiösen BildungsprozessenLernziele/Kompetenzen:Die Religiosität von Schülerinnen und Schülern empirisch wahrnehmen unddiagnostizieren.Religiöse Bildungsprozesse analysieren und entwickeln unter besondererBerücksichtigung von Dialog/Diskurs im Rahmen religiöser Pluralität.7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 StundenLehrveranstaltungen:1. Lehr- und Lernprozesse im Bereich religiöser Bildung (Vorlesung) 2 SWS2. Exemplarische Vertiefung einer Grundfrage religiöser Bildungsprozesse(Seminar)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Prüfungsanforderungen:Fähigkeit zur Wahrnehmung der Religiosität von Schülerinnen und Schülern sowie zurAnalyse und Entwicklung religiöser Bildungsprozesse; Bearbeitung eines Bereichs derReligionspädagogik mit argumentativer Begründung eines eigenen Standpunktes ineiner Hausarbeit.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd SchröderDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2 - 3Maximale Studierendenzahl:60<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8034
Modul M.Frz.L-302<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Frz.L-302: Vertiefungsmodul FachwissenschaftenEnglish title: Advanced Topics in FrenchLernziele/Kompetenzen:Ausgewählte Probleme und Methoden der französischen Sprach-, Literatur- oderLandeswissenschaft: Vertiefung und Verbreiterung der fachwissenschaftlichenKenntnisse in zwei der Teilbereiche Sprach-, Literatur- oder Landeswissenschaft.Bearbeitung monographischer Themen unter kritischer Reflexion desForschungsstandes. Die Studierenden können fachwissenschaftliche undunterrichtsrelevante Aspekte miteinander verbinden und didaktische Entscheidungentheoriegeleitet für die Praxis formulieren und dies in wissenschaftlich angemessenerForm darstellen.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenLehrveranstaltungen:1. Masterseminar Sprachwissenschaft 2 SWS2. Masterseminar Literaturwissenschaft 2 SWS3. Masterseminar LandeswissenschaftEs sind zwei der genannten Lehrveranstaltungen zu absolvieren.2 SWSPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsvorleistungen:regemäßige aktive Teilnahme, Referat (ca. 30 Min) in demjenigen Seminar, in dem nichtdie Klausur geschrieben wirdPrüfungsanforderungen:Sprachwissenschaft: Die Studierenden beschreiben und analysieren die französischeGegenwartssprache theoriegeleitet und methodisch, beschreiben und reflektierenwesentliche Funktionen, Strukturen und Regeln, verstehen und reflektieren die Rolle derFremd- und Muttersprache in der internationalen und interkulturellen Kommunikation.Literaturwissenschaft: Die Studierenden analysieren Texte und audio-visuelle Werkeaus Frankreich und französischsprachigen Ländern oder Regionen methodischangemessen und begrifflich korrekt, ordnen sie in ihre spezifischen historischenKontexte ein, beschreiben, analysieren und bewerten sie im Rahmen ihrer jeweiligenProduktions-, Distributions- und Rezeptionszusammenhänge.Landeswissenschaft: Die Studierenden reflektieren geschichts-, kultur-, politik-, sozialundwirtschaftswissenschaftliche Aspekte Frankreichs und französischsprachigerLänder oder Regionen, erkennen multikulturelle Zusammenhänge und entwickelnProblembewusstsein im Umgang mit fremdkulturellen Phänomenen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, FranzösischAngebotshäufigkeit:Empfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Uta HelfrichDauer:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8035
Modul M.Frz.L-302jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimalig1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8036
Modul M.Frz.L-303<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Frz.L-303: Fachdidaktik des Französischen (mit 5-wöchigemFachpraktikum)English title: Advanced Teaching Methods in French (with 5-week educational practice)Lernziele/Kompetenzen:Einübung in fachspezifische Unterrichtsplanung: Auswahl und Begründung von Themenund Texten; Formulierung von Lernzielen; Auswahl und Strukturierung von Materialien;Wahl geeigneter Methoden, Sozial- und Kommunikationsformen; Initiierung undFörderung interkultureller Lernprozesse; Dokumentation, Präsentation und Evaluationvon Unterrichtsergebnissen; Reflexion von eigenen Unterrichtserfahrungen (aus demPraktikum).Lehrveranstaltungen:1. Grundlagen der Unterrichtsplanung(Vorlesung oder Übung)11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:204 StundenSelbststudium:126 Stunden2 SWS2. Begleitseminar zur Vor- und Nachbereitung des Fachpraktikums Französisch 4 SWS3. Fachpraktikum (5 Wochen)Prüfung: Praktikumsbericht (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige aktive Teilnahme an 1. (Übung) und 2.; Unterrichtsentwurf in 1.;erfolgreiche Teilnahme an 3.Prüfungsanforderungen:Auswahl und Begründung von Themen und Texten; Formulierung von Lernzielen;Auswahl und Strukturierung von Materialien; Wahl geeigneter Methoden, SozialundKommunikationsformen; Initiierung und Förderung interkultureller Lernprozesse;Dokumentation, Präsentation und Evaluation von Unterrichtsergebnissen; Reflexion voneigenen Unterrichtserfahrungen (aus dem Praktikum).Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, FranzösischAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Dr. phil. Birgit SchädlichDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8037
Modul M.Frz.L-304<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Frz.L-304: Fachdidaktik des Französischen (mit 4-wöchigemForschungspraktikum)English title: Advanced Teaching Methods in French (with 4-week research experience)Lernziele/Kompetenzen:Beobachtung und Analyse von Französischunterricht, d.h. schulischerVermittlungsprozesse in Bezug auf die französische Sprache, Literatur und Kulturnach allgemein- und fachdidaktischen Kategorien. Entwicklung von Kompetenzen zurempirisch arbeitenden Sprachlehrforschung, zur fachdidaktischen Forschung in denBereichen Sprache, Literatur, Medien und Kultur sowie zur Lehrerhandlungsforschung.Lehrveranstaltungen:1. Grundlagen der Unterrichtsplanung(Vorlesung oder Übung)11 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:176 StundenSelbststudium:154 Stunden2 SWS2. Begleitseminar zum Forschungspraktikum Französisch 2 SWS3. Forschungspraktikum (4 Wochen)Prüfung: Praktikumsbericht (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive Teilnahme an 1. (Übung) und 2.; Unterrichtsentwurf in 1.;erfolgreiche Teilnahme an 3.Prüfungsanforderungen:Kenntnis über schulische Vermittlungsprozesse in Bezug auf die französische Sprache,Literatur und Kultur nach allgemein- und fachdidaktischen Kategorien. Kompetenzenzur empirisch arbeitenden Sprachlehrforschung, zur fachdidaktischen Forschung in denBereichen Sprache, Literatur, Medien und Kultur sowie zur Lehrerhandlungsforschung.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, FranzösischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Dr. phil. Birgit SchädlichDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8038
Modul M.Frz.L-305<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Frz.L-305: Fachdidaktik des Französischen (Vertiefung)English title: Advanced Teaching Methods in FrenchLernziele/Kompetenzen:Kenntnis und Reflexion von Fragestellungen, Methoden und Erträgen fachdidaktischerForschung (aktuelle, empirische und historische Modelle der Sprach-, Literatur- undKulturvermittlung, Medien-Methodenkonzepte, Kompetenzmodelle, Lernförderung,Steuerung von Lernprozessen, Leistungsfeststellung und -bewertung).Lehrveranstaltung: Seminar zur französischen Fachdidaktik4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive TeilnahmePrüfungsanforderungen:Kenntnis und Reflexion von Fragestellungen, Methoden und Erträgen fachdidaktischerForschung (aktuelle, empirische und historische Modelle der Sprach-, Literatur- undKulturvermittlung, Medien-Methodenkonzepte, Kompetenzmodelle, Lernförderung,Steuerung von Lernprozessen, Leistungsfeststellung und -bewertung).Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Französisch, DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Dr. phil. Birgit SchädlichDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8039
Modul M.Geg.01<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Geg.01: Analyse und Bewertung von Wasser und BodenEnglish title: Analysis and Evaluation of Water and SoilLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden kennen theoretisch wichtige Methoden zur Analyse und Bewertungvon Boden- und Wasserqualität. Damit besitzen sie ein Verständnis der Bewertung vonBoden- und Wassergüte und der Analysen von Bodendegradation und Wassergüte.Mittels praktischer Kenntnisse in der Wasser- und Bodenanalytik sind sie befähigt,eigene Analysen durchzuführen und Laboranalysen einzuordnen und zu interpretieren.Sie können europäische Bewertungsnormen zur Bewertung von Boden- undWasserqualität anwenden (z.B. WRRL, EEA).6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenLehrveranstaltungen:1. Analyse und Bewertung von Wasser und Boden (Vorlesung) 2 SWS2. Feld- oder Laborpraktikum: Analyse und Bewertung von Wasser und Boden(Praktikum)2 SWSPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme am PraktikumPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie Folgendes beherrschen:Theoretische Grundlagen der Analyse und Bewertung vonBodenfruchtbarkeit, Bodenqualität, Bodendegradation und Wasserqualität(Oberflächenwasser und Grundwasser) sowie Kenntnisse über internationale(z.B. EPA, FAO, GLASOD) und europäische (z.B. WRRL, EEA) Standards undBewertungsnormen. Ferner: Kenntnis der feld- und/oder Laboranalyseverfahren zuBodenqualität/ Bodenkontamination und/oder Wasserqualität/-kontamination.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Gerhard GeroldDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8040
Modul M.Geg.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Geg.02: RessourcennutzungsproblemeEnglish title: Resource Use ProblemsLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden kennen die globalen Probleme von Nutzung und Degradationder Ressourcen Boden und Wasser. Sie besitzen ferner einen Überblick überinternationale Organisationen, die sich mit Ressourcennutzungsproblemenbeschäftigen, und deren Konventionen. Sie sind in der Lage, globale und regionaleRessourcennutzungsprobleme (Boden und Wasser) anhand von Literatur undQuellenauswertung fallspezifisch zu bearbeiten, zu bewerten und zu präsentieren.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenLehrveranstaltungen:1. Ressourcennutzungsprobleme (Vorlesung) 2 SWS2. Ressourcennutzungsprobleme (mit 3 Geländetagen) (Seminar) 2 SWSPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme am Seminar; Referat mit schriftl. Ausarbeitung bzw. mit Poster(30 Min., 12-20 S. bzw. 1 DIN A 0 Poster)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie globale Probleme derBoden- und Wasserressourcen überblicken und spezifische Degradations- undKontaminationsprozesse sowie zugehörige Rehabilitationsverfahren für BodenundWasserqualität (Bodendegradationsprozesse, Bodenfruchtbarkeits¬probleme,Bodenrehabilitation, Wasserübernutzung, Wasserverschmutzung,Wasserqualitätssanierung, nachhaltige Wassernutzung) kennen und verstehen.Ferner erbringen sie den Nachweis, dass sie relevante internationale Institutionen undderen Konventionen kennen sowie Ressourcennutzungsprobleme an Fallbeispielenanalysieren können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Gerhard GeroldDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:40<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8041
Modul M.Geg.03<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Geg.03: Globaler Umweltwandel / LandnutzungsänderungEnglish title: Global Change / Land Use ChangeLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden verfügen über ein Überblickswissen zur Forschung über Klimawandelund Global Change.Die Studierenden sind in der Lage:• Veränderungen der Umwelt unter dem Einfluss des Menschen zu analysieren,• typische Syndrome und Syndromkomplexe zu erkennen und zu verstehen,• Global Change als zentrales Thema der Geographie an der Schnittstelle von NaturundGesellschaftswissenschaften zu erkennen,• Adaptation- und Mitigation-Ansätze zu bewerten.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenLehrveranstaltungen:1. Globaler Umweltwandel (Global Change) (Vorlesung) 2 SWS2. Spezielle Fallbeispiele des Globalen Umweltwandels (Seminar) 2 SWSPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme am Seminar; Referat mit schriftl. Ausarbeitung (30 Min., 12-20S.)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie das Grundlagenwissen im Bereichdes globalen Klima- und Umweltwandels beherrschen und den Forschungsstand zuKlimawandel und Global Change überblicken. Ferner erbringen sie den Nachweis,dass sie die Veränderungen der Umwelt unter anthropogenen Einfluss analysieren,typische Syndrome und Syndromkomplexe erkennen und verstehen sowie AdaptionsundMitigationsansätze bewerten können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Martin KappasDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:40<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8042
Modul M.Geg.04<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Geg.04: Globaler soziokultureller und ökonomischer WandelEnglish title: Global Sociocultural and Economic ChangeLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden kennen die globalen Zusammenhänge des soziokulturellenund wirtschaftlichen Wandels. Sie verstehen Ursachen und Wirkungen derVeränderungsprozesse auf unterschiedlichen Maßstabsebenen aus der Perspektive derBevölkerungs-, Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie.Sie kennen den theoriegeleiteten kritischen Umgang mit aktuellen gesellschaftlichen,humanökologischen sowie politisch ökologischen Fragestellungen. Die Studierendensind in der Lage, Diskurse zu Bevölkerungsentwicklung und Ressour-cenverknappung,Urbanisierung und Fragmentierung, Armutsentwicklung und räumliche Disparitätensowie Regionalentwicklungen anhand von Fallbeispielen zu verstehen.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenLehrveranstaltungen:1. Globaler soziokultureller und ökonomischer Wandel (Vorlesung) 2 SWS2. Globaler soziokultureller und ökonomischer Wandel (Übung) 2 SWSPrüfung: Referat mit schriftl. Ausarbeitung (ca. 30 Min., max. 20 S.)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme an der ÜbungPrüfungsanforderungen:Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie den theoriegeleiteten kritischenUmgang mit aktuellen gesellschaftlichen, humanökologischen sowie politischökologischen Fragestellungen kennen und Diskurse zu Bevölkerungsentwicklung undRessourcenverknappung, Urbanisierung und Fragmentierung, Armutsentwicklungund räumliche Disparitäten sowie Regionalentwicklungen verstehen und einordnenkönnen. Ferner erbringen sie den Nachweis, dass sie die globalen Zusammenhängedes soziokulturellen und wirtschaftlichen Wandels sowie Ursachen und Wirkungen derVeränderungsprozesse auf unterschiedlichen Maßstabsebenen aus der Perspektive derBevölkerungs-, Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie verstehen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Heiko FaustDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:40<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8043
Modul M.Geg.31<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Geg.31: Theoretische und praktische GeographiedidaktikLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können:· das vertiefte Grundlagenwissen und die theoretischen Ansätze der Geographiedidaktikfür den Erdkundeunterricht und die empirische Schulforschung vollständig wiedergebenund kritisch reflektieren,11 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:176 StundenSelbststudium:154 Stunden· erdkundliche Unterrichtsinhalte und fachdidaktisches Material diskutieren undbewerten,· die eigene Unterrichtstätigkeit und darauf bezogene Schüler-Lernprozesse analysieren,· einzelne Erdkundeunterrichtsstunden bzw. fachdidaktische Untersuchungenunter Berücksichtigung der Bildungsstandards und Kerncurricula sachgerecht undadressatenorientiert planen, durchführen und auswerten,· Lernstrukturen entwerfen und umsetzen sowie Einzelstunden in größereUnterrichtseinheiten sinnvoll einbetten,· unterschiedliche Präsentationsformen und moderne schulrelevante Medien anwenden,· Unterrichtseinheiten dokumentieren, reflektieren und evaluieren.Lehrveranstaltung: Vertiefung der schulischen Geographiedidaktik (Seminar)Prüfung: Präsentation (ca. 30 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme am SeminarPrüfungsanforderungen:Vertieftes Grundlagenwissen und theoretische Forschungsansätze der Fachdidaktik fürden ErdkundeunterrichtLehrveranstaltungen:1. Vor- und Nachbereitung Fachpraktikum (Seminar)Angebotshäufigkeit: jedes Semester2 SWS3 C2 SWS2. Fachpraktikum (5-wöchig) oder Fachpraktikum (4-wöchig)Angebotshäufigkeit: jedes SemesterPrüfung: Praktikumsbericht (max. 10 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme am Seminar; erfolgreiche Teilnahme am FachpraktikumPrüfungsanforderungen:Fähigkeit, einzelne Erdkundeunterrichtsstunden bzw. fachdidaktische Untersuchungensachgerecht und adressatenorientiert zu planen, durchzuführen und auszuwerten.Entwurf und Umsetzung von Lernstrukturen. Sinnvolle Einbettung der Einzelstunden ingrößere Unterrichtseinheiten.8 CZugangsvoraussetzungen:keineEmpfohlene Vorkenntnisse:keine<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8044
Modul M.Geg.31Sprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligModulverantwortliche[r]:Dr. Tobias ReehDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8045
Modul M.Geg.32<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Geg.32: Geographiedidaktische ExkursionLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage:· die fachdidaktische Bedeutung außerschulischer Lernorte zu verstehen und zubewerten,· Exkursionen anhand der unterrichtsbezogenen Zielsetzung zu klassifizieren,6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 Stunden· Exkursionen bezüglich ihrer didaktischen Gestaltungsmöglichkeiten kritisch zureflektieren und zielgerichtet in erdkundliche Lehrpläne zu integrieren,· Exkursionen unter Berücksichtigung der jeweiligen Klassenstufe selbständig zu planen,durchzuführen und nachzubereiten,· exkursionsdidaktische Methoden anzuwenden sowie Fachinhalte durch dieAnwendung fachspezifischer Arbeitsweisen mit schulüblichem Material zu erschließen,· außerschulische Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler und ihre didaktischeAusgestaltung zu bewerten und Alternativen zu diskutieren.Lehrveranstaltungen:1. Vorbereitungsseminar zur Geographiedidaktischen Exkursion (Seminar) 1 SWS2. Geländekurs: Geographiedidaktische Exkursion 3 SWSPrüfung: Präsentation (ca. 30 Min.) mit schriftlicher Reflexion (max. 10 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme an Seminar und GeländekursPrüfungsanforderungen:Kritische Reflexion und Diskussion der didaktischen Exkursionsgestaltung. Fähigkeit derBewertung vorhandener Bildungsangebote und ihrer didaktischen Ausgestaltung.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Dr. Tobias ReehDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2 - 4Maximale Studierendenzahl:12<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8046
Modul M.Gesch.51<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gesch.51: Modul ModerneEnglish title: Modern HistoryLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können ihre methodischen Kenntnisse auf eine konkreteForschungssituation anwenden. Sie kennen die speziellen Strukturmerkmaleder Moderne (Neuzeit) und die einschlägigen historiographischen Debatten. Siedemonstrieren ihre Kompetenz in der kritischen Auseinandersetzung mit Quellen undSekundärliteratur in angemessener schriftlicher und mündlicher Form.7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 StundenSie können komplexe Sachverhalte schriftlich und/oder mündlich klar vermitteln.Lehrveranstaltung: Epochenseminar Neuzeit2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Präsentation (ca. 30 Min.) mit Handout (max. 3 S.)Prüfungsanforderungen:Anwendung methodischer Kenntnisse auf eine konkrete Forschungssituation,Kenntnis der speziellen Anforderungen der Strukturmerkmale der Moderne undeinschlägiger historiographischer Debatten; Fähigkeit zur selbständigen kritischenAuseinandersetzung mit Quellen und Sekundärliteratur in angemessener schriftlicherund mündlicher FormZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Rebekka HabermasDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8047
Modul M.Gesch.51a<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gesch.51a: Modul ModerneEnglish title: Modern HistoryLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können ihre methodischen Kenntnisse auf eine konkreteForschungssituation anwenden. Sie kennen die speziellen Strukturmerkmaleder Moderne (Neuzeit) und die einschlägigen historiographischen Debatten. Siedemonstrieren ihre Kompetenz in der kritischen Auseinandersetzung mit Quellen undSekundärliteratur in angemessener schriftlicher und mündlicher Form.7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 StundenSie können komplexe Sachverhalte schriftlich und/oder mündlich klar vermitteln.Lehrveranstaltungen:1. Epochenseminar Neuzeit 2 SWS2. Epochenvorlesung Neuzeit 2 SWSPrüfung: Essay (max. 15000 Zeichen)Prüfungsvorleistungen:Präsentation (ca. 30 Min.) mit Handout (max. 3 S.)Prüfungsanforderungen:Anwendung methodischer Kenntnisse auf eine konkrete Forschungssituation,Kenntnis der speziellen Anforderungen der Strukturmerkmale der Moderne undeinschlägiger historiographischer Debatten; Fähigkeit zur selbständigen kritischenAuseinandersetzung mit Quellen und Sekundärliteratur in angemessener schriftlicherund mündlicher FormZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Rebekka HabermasDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8048
Modul M.Gesch.52<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gesch.52: Zeiten und RäumeEnglish title: Times and PlacesLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können ihre methodischen und inhaltlichen Kenntnisse auf einekonkrete Forschungssituation übertragen. Sie kennen die Besonderheiten der jeweiligengewählten historischen Epoche (Alte Geschichte, Mittelalter, Frühe Neuzeit), Region(Osteuropa/Außereuropa) oder eines Fachgebietes (Wirtschafts- und Sozialgeschichte).Sie setzen sich kompetent mit Quellen und Sekundärliteratur in angemessener Formauseinander.7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 StundenSie können die spezifischen Konzepte, Methoden und historiographischen Debatten desgewählten Gebiets bzw. der Epoche benennen und erläutern.,Sie sind in der Lage, eigene Positionen zu entwickeln und fundiert zu vertreten. Siekönnen komplexe Sachverhalte schriftlich und/oder mündlich klar vermitteln.Lehrveranstaltung: Epochenseminar / Fachgebietsseminar2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Präsentation (ca. 30 Min.) mit Handout (max. 3 S.)Prüfungsanforderungen:Übertragen der inhaltlichen und methodischen Kenntnisse auf eine konkreteFoschungssituation. Kenntnis der Besonderheiten der jeweiligen historischen Epochebzw. des Fachgebiets; kompetente selbständige kritische Auseinandersetzung mitQuellen und Sekundärliteratur in angemessener schriftlicher und mündlicher FormZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Arnd ReitemeierDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8049
Modul M.Gesch.52a<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gesch.52a: Zeiten und RäumeEnglish title: Times and PlacesLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können ihre methodischen und inhaltlichen Kenntnisse auf einekonkrete Forschungssituation übertragen. Sie kennen die Besonderheiten der jeweiligengewählten historischen Epoche (Alte Geschichte, Mittelalter, Frühe Neuzeit), Region(Osteuropa/Außereuropa) oder eines Fachgebietes (Wirtschafts- und Sozialgeschichte).Sie setzen sich kompetent mit Quellen und Sekundärliteratur in angemessener Formauseinander.7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 StundenSie können die spezifischen Konzepte, Methoden und historiographischen Debatten desgewählten Gebiets bzw. der Epoche benennen und erläutern.,Sie sind in der Lage, eigene Positionen zu entwickeln und fundiert zu vertreten. Siekönnen komplexe Sachverhalte schriftlich und/oder mündlich klar vermitteln.Lehrveranstaltungen:1. Epochenseminar / Fachgebietsseminar 2 SWS2. Epochenvorlesung / Fachgebietsvorlesung 2 SWSPrüfung: Essay (max. 15000 Zeichen)Prüfungsvorleistungen:Präsentation (ca. 30 Min.) mit Handout (max. 3 S.)Prüfungsanforderungen:Übertragen der inhaltlichen und methodischen Kenntnisse auf eine konkreteFoschungssituation. Kenntnis der Besonderheiten der jeweiligen historischen Epochebzw. des Fachgebiets; kompetente selbständige kritische Auseinandersetzung mitQuellen und Sekundärliteratur in angemessener schriftlicher und mündlicher FormZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Arnd ReitemeierDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8050
Modul M.GeschFD.01<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.GeschFD.01: Reflexion und Untersuchung von historischenLernprozessenEnglish title: Reflection and Investigation of Historical Learning ProcessesLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden kennen Fragestellungen, Methoden und Erträge fachdidaktischer(insbesondere empirischer) Forschung. Sie können zentrale Forschungsprobleme derFachdidaktik (Geschichtsbewusstsein, Kompetenzmodelle, Medien-Methodenkonzepte,Leistungsmessung) theoretisch nachvollziehen und punktuell eigene empirischeErkundungen vornehmen.Lehrveranstaltung: Seminar4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Präsentation (ca. 30 Min.)Prüfungsanforderungen:Kenntnis von Fragestellungen, Methoden und Erträgen fachdidaktischer Forschung;theoretische Durchdringung von Forschungsproblemen der Fachdidaktik(Geschichtsbewusstsein, Kompetenzmodelle, Medien-Methodenkonzepte,Leistungsmessung)Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Michael SauerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8051
Modul M.GeschFD.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.GeschFD.02: Analyse, Planung, Durchführung und Reflexionvon GeschichtsunterrichtEnglish title: Analysis, Planning, Realization and Reflection of a History LessonLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können Geschichtsunterricht nach allgemein- und fachdidaktischenKategorien (Unterrichtsaufzeichnungen und -beobachtungen) analysieren. Siebeherrschen in Grundzügen folgende Aspekte fachspezifischer Unterrichtsplanung:Auswahl und Begründung von Themen, Formulierung von Lernzielen, Auswahl undStrukturierung von Materialien, Wahl geeigneter Sozial- und Kommunikationsformensowie fachspezifischer Methodenarrangements, Dokumentation und Präsentation vonUnterrichtsergebnissen, Wiederholung, Festigung und Übung. Sie können schulischeVermittlungsprozesse von Geschichte exemplarisch unter unterrichtsrelevantenthematischen (z.B. Epoche, Längsschnitt), methodischen oder medialen Aspekten oderan einem Problem der Geschichtskultur planen und reflektieren. Sie sind in der Lage, imRahmen des Praktikums begleitet eigenen Fachunterricht zu planen, zu realisieren undzu reflektieren.11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:204 StundenSelbststudium:126 StundenLehrveranstaltungen:1. Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar 4 SWS2. Seminar 2 SWS3. Fachpraktikum (5 Wochen)Prüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Absolvierung des Praktikums; Anfertigung von zwei Präsentationen (je ca. 30 Min.),einer Hausarbeit (max. 15 S.) und eines Praktikumsberichts (max. 15 S.)Prüfungsanforderungen:Kenntnis einzelner Aspekte der Planung und Analyse von Geschichtsunterricht;Planung und Reflexion schulischer Vermittlungsprozesse unter unterrichtsrelevantenmethodischen oder medialen Gesichtspunkten.7 CZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Michael SauerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:18<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8052
Modul M.GeschFD.02a<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.GeschFD.02a: Analyse, Planung und Reflexion von GeschichtsunterrichtEnglish title: Analysis, Planning, and Reflection on Teaching HistoryLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden können Geschichtsunterricht nach allgemein- und fachdidaktischenKategorien (Unterrichtsaufzeichnungen und -beobachtungen) analysieren. Siebeherrschen in Grundzügen folgende Aspekte fachspezifischer Unterrichtsplanung:Auswahl und Begründung von Themen, Formulierung von Lernzielen, Auswahl undStrukturierung von Materialien, Wahl geeigneter Sozial- und Kommunikationsformensowie fachspezifischer Methodenarrangements, Dokumentation und Präsentation vonUnterrichtsergebnissen, Wiederholung, Festigung und Übung. Sie können schulischeVermittlungsprozesse von Geschichte exemplarisch unter unterrichtsrelevantenthematischen (z.B. Epoche, Längsschnitt), methodischen oder medialen Aspekten oderan einem Problem der Geschichtskultur planen und reflektieren. Sie sind in der Lage, imRahmen des Praktikums eigenen Fachunterricht im Hinblick auf ein spezielles Themazu planen, zu realisieren und zu reflektieren oder Unterricht unter einer speziellenFragestellung vertiefend zu analysieren.11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:204 StundenSelbststudium:126 StundenLehrveranstaltungen:1. Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar 4 SWS2. Seminar 2 SWS3. Fachpraktikum (4 Wochen)Prüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Absolvierung des Praktikums; Anfertigung von zwei Präsentationen (je ca. 30 Min.),einer Hausarbeit (max. 15 S.) und eines Praktikumsberichts (max. 15 S.)Prüfungsanforderungen:Kenntnis einzelner Aspekte der Planung und Analyse von Geschichtsunterricht;Planung und Reflexion schulischer Vermittlungsprozesse unter unterrichtsrelevantenmethodischen oder medialen Gesichtspunkten. Durchführung und Reflexion selbständigdurchgeführten Unterrichts.7 CZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Michael SauerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:18<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8053
Modul M.Gri.11<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gri.11: Griechische LiteraturEnglish title: Greek LiteratureLernziele/Kompetenzen:Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, einschulrelevantes Gebiet der griechischen Literatur in einen literatur- undkulturgeschichtlichen Kontext einzuordnen sowie seine gattungstypologischenMerkmale zu benennen und seine Verknüpfung mit Werken der lateinischenLiteratur aufzuzeigen sowie sich selbstständig in einem solchen Gebiet differenzierteKenntnisse auf neuestem Forschungsstand anzueignen, kritisch zu reflektieren und imwissenschaftlichen Gespräch zu präsentieren.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenSie analysieren literarische Texte auf rhetorische und poetische Mittel hin. Sie erklärenantike Realien und Mythen und machen ihre Erklärung für das Textverständnisfruchtbar. Sie schlüsseln textkritische Apparate auf und erhellen die Auswirkung derTextkonstitution auf die Interpretation und tragen altgriechische Texte prosodisch korrektund sinnbetont vor.Zentrale Inhalte sind griechische Literatur- und Kulturgeschichte, Rezeptionsgeschichte,Gattungstypologie, Stilistik, Realienkunde und Mythologie sowie Textkritik und Metrik.Untersuchungsgegenstände sind schulrelevante Texte der griechischen Literaturin ihren inhaltlichen und formalen Eigenschaften und in ihrer kulturhistorischenKontextualisierung.Lehrveranstaltungen:1. Independent-Study-Einheit zum Seminarmindestens 6 Betreuungsgespräche mit Dozent/in des Seminars2. Seminar 2 SWS3. Vorlesung 2 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme am SeminarPrüfungsanforderungen:Literatur-, gattungs- und kulturgeschichtliche Kontextualisierung eines zentralenGebiets der griechischen Literatur; Kenntnis mythologischer Zusammenhängeund antiker Alltagsphänomene; differenzierte Kenntnis des Forschungsstandesunter Berücksichtigung verschiedener methodischer Ansätze; textkritisch fundierteTextinterpretation; Analyse auf rhetorische und poetische Mittel; prosodisch undmetrisch korrekter sinnbetonter Vortrag griechischer OriginaltexteZugangsvoraussetzungen:Graecum und LatinumSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Heinz-Günther Nesselrath<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8054
Modul M.Gri.11Angebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8055
Modul M.Gri.12<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gri.12: Griechische SpracheEnglish title: Greek LanguageLernziele/Kompetenzen:Durch das erfolgreiche Bestehen dieses Moduls weisen Studierende nach, dasssie in der Lage sind, anspruchsvolle griechische Originaltexte mit Hilfe einesAufbauwortschatzes aus allen relevanten Textgattungen sicher und in guter Stilisitik insDeutsche zu übersetzen, verschiedene Übersetzungstheorien und Übersetzungsartenzu reflektieren. Sie beurteilen griechische Originaltexte nach stilistischen Kriterien unddefinieren semantische Unterschiede und Probleme der Etymologie der griechischenSprache. Auf der Basis ihrer Sprachbeherrschung erfassen sie in griechischenOriginaltexten auch komplexere syntaktische Phänomene selbstständig und erklären siefachlich korrekt und formulieren sprachadäquate Auflösungen.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenZentrale Inhalte sind Übersetzungstheorien und -techniken sowie Stilistik, Semantik undEtymologie.Untersuchungsgegenstände sind anspruchsvolle griechische Originaltexte in ihrersprachlich-stilistischen Valenz.Lehrveranstaltungen:1. Lektüreübung für Fortgerschrittene 2 SWS2. Seminar "Techniken des Übersetzens" 2 SWSPrüfung: Klausur (180 Minuten)Prüfungsanforderungen:Sinntreffende Übersetzung anspruchsvoller griechischer Originaltexte ins Deutsche;theoretische Reflexion verschiedener Übersetzungsarten; stilistische Analyse vonOriginaltexten; Kenntnis eines Aufbauwortschatzes aus allen relevanten Textgattungender griechischen Literatur; korrekte Erfassung und Beschreibung komplexerersyntaktischer Phänomene in griechischen OriginaltextenZugangsvoraussetzungen:Graecum und LatinumSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jährlichWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Heinz-Günther NesselrathDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8056
Modul M.Gri.13<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gri.13: Aufbaumodul Fachdidaktik GriechischEnglish title: Intermediate module ¿ didactic ¿ GreekLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, die zentralen Forschungsansätze und Methodender griechischen Fachdidaktik im Kontext der aktuellen Bildungsstandards undKerncurricula im Fach Griechisch theoretisch zu reflektieren und Methoden undAnsätze des Griechischunterrichts in allgemeinere didaktisch-bildungswissenschaftlicheZusammenhänge einzuordnen und kritisch zu reflektieren. Sie binden fachliche Inhalteim Kontext der maßgeblichen Kompetenzbereiche des altsprachlichen UnterrichtsSprache-Text-Kultur an, reflektieren sie auf ihren Bildungswert für die Gesellschafthin theoretisch und setzen sie in unterrichtspraktische Konzepte um. TextbezogeneUnterrichtskonzepte und -methoden (Texterschließung; Übersetzungsmethoden;Interpretationsmodelle) reflektieren sie anhand didaktisierter und originaleraltgriechischer Texte und wenden diese theoriebezogen an. Sie erfassen undreflektieren didaktisch antike Texte in ihrer Modellhaftigkeit von Nähe und Distanz undumschreiben die Verwurzelung der modernen europäischen Kultur in der griechischrömischenim Sinne des kulturellen Gedächtnisses.7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 StundenZentrale Inhalte sind Forschungsansätze und Methoden der griechischen Fachdidaktikim spezifisch kurrikularen und allgemein bildungswissenschaftlichen Kontext und dieidentitätsstiftende Funktion griechisch-römischer Kultur.Untersuchungsgegenstände sind griechische Texte des Schulcurriculums undgriechisch-römische und europäische Kultur im vertikalen Vergleich.Lehrveranstaltungen:1. Lektüreübung für Fortgeschrittene 2 SWS2. Fachdidaktische Übung (Vertiefung) 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (Didaktische Analyse, max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)Prüfungsanforderungen:Kenntnis zentraler Forschungsansätze und Methoden der griechischen Fachdidaktik;Einordnung zentraler Methoden und Ansätze des Griechischunterrichts in allgemeineredidaktisch-bildungswissenschaftliche Zusammenhänge; Anbindung fachlicherInhalte an die maßgeblichen Kompetenzbereiche des altsprachlichen UnterrichtsSprache-Text-Kultur; Reflexion des Bildungswerts altsprachlicher Inhalte für dieGegenwart und Umsetzung in unterrichtspraktische Konzepte; theoriebezogeneUmsetzung textbezogener Unterrichtskonzepte und -methoden (Texterschließung;Übersetzungsmethoden; Interpretationsmodelle) anhand didaktisierter und originaleraltgriechischer TexteZugangsvoraussetzungen:Graecum und LatinumSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Peter Alois Kuhlmann<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8057
Modul M.Gri.13Angebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:5<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8058
Modul M.Gri.14 (Master of Education - StudienfachGriechisch)<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gri.14 (Master of Education - Studienfach Griechisch):Griechisches FachpraktikumLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, auf der Grundlage einer fundierten Kenntnisder griechischen Sprache und ihres Überblickswissens über die zentralen Bereicheder griechischen Literatur und Kultur die Relevanz fachlicher Inhalte für denGriechischunterricht zu bestimmen und nach den Maßgaben des KerncurriculumsGriechisch eigene Unterrichtseinheiten für verschiedene Altersstufen zu entwickelnund über geeignete Prüfungsformen zu reflektieren. Sie vermitteln unter Anleitungschulisch relevante Inhalte des Faches aus den Bereichen Sprache, Literatur, undKulturgeschichte in eigenen Unterrichtsversuchen und reflektieren hierüber didaktischund entwicklen und erproben unter Anleitung Prüfungs- und Evaluationsformen(Klassenarbeiten, Tests, Klausuren, Portfolio, Selbstevaluation).8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenZentrale Inhalte sind die schulische Relevanzbestimmung fachlicher Inhalte, didaktischeVermittlung und Reflexion sowie Prüfungs- und Evaluationsformen.Untersuchungsgegenstände sind die griechische Sprache, Literatur und Kultur, dasKerncurriculum Griechisch und die didaktische Praxis.Lehrveranstaltungen:1. Vorbereitung des Fachpraktikums 1 SWS2. Fachpraktikum (5 Wochen)3. Nachbereitung des Fachpraktikums 3 SWSPrüfung: Praktikumsbericht (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)Prüfungsvorleistungen:Planung und Gestaltung einer UnterrichtseinheitPrüfungsanforderungen:Didaktisierung fachlicher Inhalte für den Griechischunterricht auf der Grundlageeiner fundierten Kenntnis der griechischen Sprache und eines Überblickswissenüber die zentralen Bereiche der griechischen Literatur und Kultur; Entwurf eigenerUnterrichtseinheiten nach den Maßgaben des Kerncurriculums Griechisch; Vermittlungschulisch relevanter Inhalte des Faches aus den Bereichen Sprache, Literatur undKulturgeschichte in eigenen Unterrichtsversuchen unter Anleitung; Erprobung vonPrüfungs- und Evaluationsformen (Klassenarbeiten, Tests, Klausuren, Portfolio,Selbstevaluation) unter AnleitungZugangsvoraussetzungen:Graecum und LatinumSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Peter Alois KuhlmannDauer:2 Semester<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8059
Modul M.Gri.14 (Master of Education - StudienfachGriechisch)Wiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:5<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8060
Modul M.Gri.15<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Gri.15: Griechisches ForschungspraktikumEnglish title: Research experience in GreekLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, ihre fachdidaktische Kompetenz in die didaktischeTheorie und deren methodisch-empirische Grundprinzipien einzubinden und dieangeeigneten Sachkenntnisse didaktisch begründet zu reduzieren, in eigenenUnterrichtsversuchen zu vermitteln und über das Verhältnis von Inhalt und angewandterMethode zu reflektieren. Sie erschließen sich selbstständig und wissenschaftlichfundiert ein aktuelles Forschungsthema aus dem Bereich der Methodik oder den dreiKompetenzbereichen Sprache-Text-Kultur und setzen ausgewählte forschungsrelevanteBereiche aus den Kompetenzbereichen Sprache-Text-Kultur, die sich in besondererWeise für die Unterrichtspraxis eignen, in empirische Unterrichtsreihen um undevaluieren sie nach didaktisch-bildungswissenschatlichen Prinzipien.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenZentrale Inhalte sind die didaktische Theorie mit ihren methodisch-empirischenGrundprinzipien und ihre unterrichtsempirische Umsetzung und Evaluation.Untersuchungsgegenstände sind eigene Unterrichtsversuche sowie ein aktuellesForschungsthema aus dem Bereich "Methodik" oder aus den drei Bereichen Sprache-Text-Kultur.Lehrveranstaltungen:1. Schulisches Forschungspraktikum (4 Wochen)2. Nachbereitung des Forschungspraktikums 1 SWS3. Vorbereitung des Forschungspraktikums 3 SWSPrüfung: Praktikumsbericht (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)Prüfungsvorleistungen:Planung und Gestaltung einer UnterrichtseinheitPrüfungsanforderungen:Kontextualisierung eigener fachdidaktischer Kompetenz in die didaktische Theorieund deren methodisch-empirische Grundprinzipien; didaktisch begründete Reduktionfachlicher Inahlte sowie deren methodisch reflektierte Vermittlung in eigenenUnterrichtsversuchen; wissenschaftlich fundierter Überblick über ein aktuellesForschungsthema aus dem Bereich der Methodik oder den drei KompetenzbereichenSprache-Text-Kultur selbständig; Umsetzung ausgewählter forschungsrelevanterBereiche aus den Kompetenzbereichen Sprache-Text-Kultur, die sich in besondererWeise für die Unterrichtspraxis eignen, in empirische Unterrichtsreihen mitanschließender Evaluation nach bildungswissenschaftlichen Prinzipien.Zugangsvoraussetzungen:Graecum und LatinumSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Peter Alois Kuhlmann<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8061
Modul M.Gri.15Angebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:5<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8062
Modul M.Inf.1601<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Inf.1601: Informatikunterricht planen und gestaltenLernziele/Kompetenzen:• Exemplarisch: Grundlagen empirischer Unterrichtsforschung kennen• Bildungsziele des Informatikunterrichts formulieren können• Auswirkungen der Informationstechnologie kennen und beurteilen• Unterrichtsinhalte auf der Basis soliden und strukturierten Wissens überfachdidaktische Positionen definieren können• Exemplarisch: Planung und Gestaltung von Unterrichtseinheiten mit verschiedenenKompetenzbereichen und Anforderungsbereichen• Fähigkeit zur Analyse und Reflexion eigener Unterrichtstätigkeit und daraufbezogener Schülerlernprozesse.Lehrveranstaltung: Seminar zur Fachdidaktik InformatikPrüfung: Hausarbeit (max. 10 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Seminarbeitrag (ca. 45 Min.)Lehrveranstaltung: Vorbereitung des Fachpraktikums (Seminar)Prüfung: Seminarvortrag (ca. 45 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 10 S.)11 C5 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:70 StundenSelbststudium:260 Stunden2 SWS5 C2 SWS3 CLehrveranstaltungen:1. Fachpraktikum (5-wöchig) oder Fachpraktikum (4-wöchig)2. Nachbereitung des Fachpraktikums (Seminar) 1 SWSPrüfung: Praktikumsbericht (max. 15 Seiten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am Fachpraktikum3 CPrüfungsanforderungen:nformatikdidaktische Forschungsarbeiten kennen und in der Praxis umsetzen.Unterrichtseinheiten mit verschiedenen Kompetenz¬- und Anforderungsbereichenplanen, Unterricht analysieren und reflektieren. Soziale, ökonomische, rechtliche undgesellschaftliche Auswirkungen der Informationstechnologie kennen und beurteilen;Vorbereitung und Auswertung der Fachpraktika bzw. des Forschungspraktikums;Selbständige Erarbeitung und Durchführung und Evaluation einer Unterrichtseinheitunter Berücksichtigung der Bildungsstandards, Dokumentation und Reflexion undEvaluation der Unterrichtseinheit. Umgang mit Präsentationsmedien und methodischenKonzepten aus der Fachdidaktik.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Eckart Modrow<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8063
Modul M.Inf.1601Angebotshäufigkeit:jährlichWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8064
Modul M.Inf.1602<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Inf.1602: Schulpraxis / Technische InformatikLernziele/Kompetenzen:· Schultypische Informatikwerkzeuge kennen· Informatikunterricht mit schultypischen Informatikwerkzeugen selbständig planen unddurchführen können· Grundlagen der technischen Informatik kennen6 C5 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:70 StundenSelbststudium:110 Stunden· Unterrichtseinheiten aus dem Bereich der technischen Informatik planen könnenLehrveranstaltungen:1. Praxis im Informatikunterricht (Seminar) 2 SWS2. PraktikumPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Ergebnisse des Praktikums (ca. 8 Teilaufgaben)Lehrveranstaltung: Fragestellung und Methoden empirischer Bildungsforschung(Seminar)Prüfung: Präsentation (ca. 45 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 15 S.)3 C3 SWS3 CPrüfungsanforderungen:Schultypische Informatikwerkzeuge kennen, Informatikunterricht mit schultypischenInformatikwerkzeugen selbständig planen.Grundlagen der technischen Informatik kennen, Unterrichtseinheiten aus dem Bereichder technischen Informatik planen.Schultypische Informatikwerkzeuge u. a. bei Themen der technischen Informatikangemessen einsetzen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Eckart ModrowDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2Maximale Studierendenzahl:17<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8065
Modul M.Lat.11<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Lat.11: Lateinische LiteraturEnglish title: Latin LiteratureLernziele/Kompetenzen:Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, einschulrelevantes Gebiet der lateinischen Literatur in einen literatur- undkulturgeschichtlichen Kontext einzuordnen sowie seine gattungstypologischenMerkmale zu benennen und seine Verknüpfung mit Werken der griechischenLiteratur aufzuzeigen sowie sich selbstständig in einem solchen Gebiet differenzierteKenntnisse auf neuestem Forschungsstand anzueignen, kritisch zu reflektieren und imwissenschaftlichen Gespräch zu präsentieren.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenSie analysieren literarische Texte auf rhetorische und poetische Mittel hin. Sie erklärenantike Realien und Mythen und machen ihre Erklärung für das Textverständnisfruchtbar. Sie schlüsseln textkritische Apparate auf und erhellen die Auswirkung derTextkonstitution auf die Interpretation und tragen altgriechische Texte prosodisch korrektund sinnbetont vor.Zentrale Inhalte sind lateinische Literatur- und Kulturgeschichte, Rezeptionsgeschichte,Gattungstypologie, Stilistik, Realienkunde und Mythologie sowie Textkritik und Metrik.Untersuchungsgegenstände sind schulrelevante Texte der lateinischen Literaturin ihren inhaltlichen und formalen Eigenschaften und in ihrer kulturhistorischenKontextualisierung.Lehrveranstaltungen:1. Vorlesung 2 SWS2. Seminar 2 SWS3. Independent-Study-Einheit zum Themamind. 6 Betreuungsgespräche mit Dozent/in des SeminarsPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige Teilnahme am SeminarPrüfungsanforderungen:Literatur-, gattungs- und kulturgeschichtliche Kontextualisierung eines zentralenGebiets der lateinischen Literatur; Kenntnis mythologischer Zusammenhängeund antiker Alltagsphänomene; differenzierte Kenntnis des Forschungsstandesunter Berücksichtigung verschiedener methodischer Ansätze; textkritisch fundierteTextinterpretation; Analyse auf rhetorische und poetische Mittel; prosodisch undmetrisch korrekter sinnbetonter Vortrag lateinischer OriginaltexteZugangsvoraussetzungen:Latinum und GraecumSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Ulrike Egelhaaf-Gaiser<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8066
Modul M.Lat.11Angebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8067
Modul M.Lat.12<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Lat.12: Lateinische SpracheEnglish title: Latin LanguageLernziele/Kompetenzen:Durch das erfolgreiche Bestehen dieses Moduls weisen Studierende nach, dasssie in der Lage sind, anspruchsvolle lateinische Originaltexte mit Hilfe einesAufbauwortschatzes aus allen relevanten Textgattungen sicher und in guter Stilisitik insDeutsche zu übersetzen, verschiedene Übersetzungstheorien und Übersetzungsartenzu reflektieren. Sie beurteilen lateinische Originaltexte nach stilistischen Kriterien unddefinieren semantische Unterschiede und Probleme der Etymologie der lateinischenSprache. Auf der Basis ihrer Sprachbeherrschung erfassen sie in lateinischenOriginaltexten auch komplexere syntaktische Phänomene selbstständig und erklären siefachlich korrekt und formulieren sprachadäquate Auflösungen.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenZentrale Inhalte sind Übersetzungstheorien und -techniken sowie Stilistik, Semantik undEtymologie.Untersuchungsgegenstände sind anspruchsvolle lateinische Originaltexte in ihrersprachlich-stilistischen Valenz.Lehrveranstaltungen:1. Lektüreübung für Fortgeschrittene 2 SWS2. Seminar "Techniken des Übersetzens" 2 SWSPrüfung: Klausur (180 Minuten)Prüfungsanforderungen:Sinntreffende Übersetzung anspruchsvoller lateinischer Originaltexte ins Deutsche;theoretische Reflexion verschiedener Übersetzungsarten; stilistische Analyse vonOriginaltexten; Kenntnis eines Aufbauwortschatzes aus allen relevanten Textgattungender lateinischen Literatur; korrekte Erfassung und Beschreibung komplexerersyntaktischer Phänomene in lateinischen OriginaltextenZugangsvoraussetzungen:Latinum und GraecumSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Ulrike Egelhaaf-GaiserDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8068
Modul M.Lat.13<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Lat.13: Aufbaumodul Fachdidaktik LateinEnglish title: Intermediate Module Teaching Methodology LatinLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, die zentralen Forschungsansätze und Methodender lateinischen Fachdidaktik im Kontext der aktuellen Bildungsstandards undKerncurricula im Fach Latein theoretisch zu reflektieren und Methoden und Ansätze desLateinunterrichts in allgemeinere didaktisch-bildungswissenschaftliche Zusammenhängeeinzuordnen und kritisch zu reflektieren. Sie binden fachliche Inhalte im Kontext dermaßgeblichen Kompetenzbereiche des altsprachlichen Unterrichts Sprache-Text-Kultur an, reflektieren sie auf ihren Bildungswert für die Gesellschaft hin theoretisch undsetzen sie in unterrichtspraktische Konzepte um. Textbezogene Unterrichtskonzepteund -methoden (Texterschließung; Übersetzungsmethoden; Interpretationsmodelle)reflektieren sie anhand didaktisierter und originaler lateinischer Texte und wendendiese theoriebezogen an. Sie erfassen und reflektieren didaktisch antike Texte inihrer Modellhaftigkeit von Nähe und Distanz und umschreiben die Verwurzelung dermodernen europäischen in der griechisch-römischen Kultur im Sinne des kulturellenGedächtnisses.7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 StundenZentrale Inhalte sind Forschungsansätze und Methoden der lateinischen Fachdidaktikim spezifisch kurrikularen und allgemein bildungswissenschaftlichen Kontext und dieidentitätsstiftende Funktion griechisch-römischer Kultur.Untersuchungsgegenstände sind lateinische Texte des Schulcurriculums undgriechisch-römische und europäische Kultur im vertikalen Vergleich.Lehrveranstaltungen:1. Lektüreübung für Fortgeschrittene 2 SWS2. Fachdidaktische Übung (Vertiefung) 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (Didaktische Analyse; max. 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)Prüfungsanforderungen:Kenntnis zentraler Forschungsansätze und Methoden der lateinischen Fachdidaktik;Einordnung zentraler Methoden und Ansätze des Lateinunterrichts in allgemeineredidaktisch-bildungswissenschaftliche Zusammenhänge; Anbindung fachlicherInhalte an die maßgeblichen Kompetenzbereiche des altsprachlichen UnterrichtsSprache-Text-Kultur; Reflexion des Bildungswerts altsprachlicher Inhalte für dieGegenwart und Umsetzung in unterrichtspraktische Konzepte; theoriebezogeneUmsetzung textbezogener Unterrichtskonzepte und -methoden (Texterschließung;Übersetzungsmethoden; Interpretationsmodelle) anhand didaktisierter und originalerlateinischer TexteZugangsvoraussetzungen:Graecum und LatinumSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Peter Alois Kuhlmann<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8069
Modul M.Lat.13Angebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8070
Modul M.Lat.14<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Lat.14: Lateinisches FachpraktikumEnglish title: Latin Subject-Based Practical TrainingLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, auf der Grundlage einer fundierten Kenntnis derlateinischen Sprache und ihres Überblickswissens über die zentralen Bereiche derlateinischen Literatur und Kultur die Relevanz fachlicher Inhalte für den Lateinunterrichtzu bestimmen und nach den Maßgaben des Kerncurriculums Latein eigeneUnterrichtseinheiten für verschiedene Altersstufen zu entwickeln und über geeignetePrüfungsformen zu reflektieren. Sie vermitteln unter Anleitung schulisch relevanteInhalte des Faches aus den Bereichen Sprache, Literatur, und Kulturgeschichte ineigenen Unterrichtsversuchen und reflektieren hierüber didaktisch und entwicklenund erproben unter Anleitung Prüfungs- und Evaluationsformen (Klassenarbeiten,Tests, Klausuren, Portfolio, Selbstevaluation). Zentrale Inhalte sind die schulischeRelevanzbestimmung fachlicher Inhalte, didaktische Vermittlung und Reflexion sowiePrüfungs- und Evaluationsformen. Untersuchungsgegenstände sind die lateinischeSprache, Literatur und Kultur, das Kerncurriculum Latein und die didaktische Praxis.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenLehrveranstaltungen:1. Fachpraktikum (5 Wochen)2. Vorbereitung des Fachpraktikums 3 SWS3. Nachbereitung des Fachpraktikums 1 SWSPrüfung: Praktikumsbericht (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)Prüfungsvorleistungen:Planung und Gestaltung einer UnterrichtseinheitPrüfungsanforderungen:Didaktisierung fachlicher Inhalte für den Lateinunterricht auf der Grundlage einerfundierten Kenntnis der lateinischen Sprache und eines Überblickswissen überdie zentralen Bereiche der lateinischen Literatur und Kultur; Entwurf eigenerUnterrichtseinheiten nach den Maßgaben des Kerncurriculums Latein; Vermittlungschulisch relevanter Inhalte des Faches aus den Bereichen Sprache, Literatur undKulturgeschichte in eigenen Unterrichtsversuchen unter Anleitung; Erprobung vonPrüfungs- und Evaluationsformen (Klassenarbeiten, Tests, Klausuren, Portfolio,Selbstevaluation) unter AnleitungZugangsvoraussetzungen:Latinum und GraecumSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:Empfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Peter Alois KuhlmannDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8071
Modul M.Lat.14zweimaligMaximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8072
Modul M.Lat.15<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Lat.15: Lateinisches ForschungspraktikumEnglish title: Latin Research-Based Practical TrainingLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden sind in der Lage, ihre fachdidaktische Kompetenz in die didaktischeTheorie und deren methodisch-empirische Grundprinzipien einzubinden und dieangeeigneten Sachkenntnisse didaktisch begründet zu reduzieren, in eigenenUnterrichtsversuchen zu vermitteln und über das Verhältnis von Inhalt und angewandterMethode zu reflektieren. Sie erschließen sich selbstständig und wissenschaftlichfundiert ein aktuelles Forschungsthema aus dem Bereich der Methodik oder den dreiKompetenzbereichen Sprache-Text-Kultur und setzen ausgewählte forschungsrelevanteBereiche aus den Kompetenzbereichen Sprache-Text-Kultur, die sich in besondererWeise für die Unterrichtspraxis eignen, in empirische Unterrichtsreihen um undevaluieren sie nach didaktisch-bildungswissenschatlichen Prinzipien.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenZentrale Inhalte sind die didaktische Theorie mit ihren methodisch-empirischenGrundprinzipien und ihre unterrichtsempirische Umsetzung und Evaluation.Untersuchungsgegenstände sind eigene Unterrichtsversuche sowie ein aktuellesForschungsthema aus dem Bereich "Methodik" oder aus den drei Bereichen Sprache-Text-Kultur.Lehrveranstaltungen:1. Nachbereitung des Forschungspraktikums 1 SWS2. Vorbereitung des Forschungspraktikums 3 SWS3. Schulisches Forschungspraktikum (4 Wochen)Prüfung: Praktikumsbericht (max. 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)Prüfungsvorleistungen:Planung und Gestaltung einer UnterrichtseinheitPrüfungsanforderungen:Kontextualisierung eigener fachdidaktischer Kompetenz in die didaktische Theorieund deren methodisch-empirische Grundprinzipien; didaktisch begründete Reduktionfachlicher Inahlte sowie deren methodisch reflektierte Vermittlung in eigenenUnterrichtsversuchen; wissenschaftlich fundierter Überblick über ein aktuellesForschungsthema aus dem Bereich der Methodik oder den drei KompetenzbereichenSprache-Text-Kultur selbständig; Umsetzung ausgewählter forschungsrelevanterBereiche aus den Kompetenzbereichen Sprache-Text-Kultur, die sich in besondererWeise für die Unterrichtspraxis eignen, in empirische Unterrichtsreihen mitanschließender Evaluation nach bildungswissenschaftlich-empirischen Prinzipien.Zugangsvoraussetzungen:Latinum und GraecumSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Peter Alois Kuhlmann<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8073
Modul M.Lat.15Angebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8074
Modul M.Mat.0031<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Mat.0031: Höhere AnalysisEnglish title: Advanced AnalysisLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Erwerb von Grundwissen in einem über die Basismodule Analysis I und Analysis <strong>II</strong>hinausgehenden Gebiet der höheren Analysis.Kompetenzen:9 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:186 StundenBeherrschen von Begriffen und Methoden der Höheren AnalysisLehrveranstaltung: Vorlesung (4 SWS) mit Übungen (2 SWS)Inhalte:Wechselndes Angebot, z.B. „Funktionentheorie", „Differenzialgleichungen",„Funktionalanalysis" oder „Analysis <strong>II</strong>I"6 SWSPrüfung: Klausur (120 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Erreichen von mindestens 50% der Übungspunkte und zweimaliges Vorstellen vonLösungen in den ÜbungenPrüfungsanforderungen:Grundkenntnisse der höheren AnalysisZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:• B.Mat.0011• B.Mat.0021 oder B.Mat.0025Modulverantwortliche[r]:N. N.Studiengangsbeauftragte/rDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8075
Modul M.Mat.0032<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Mat.0032: Mathematische Grundlagen, Algebra, ZahlentheorieEnglish title: Foundations of Mathematics, Algebra, Number TheoryLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Erwerb von Grundwissen in einem der Gebiete Algebra, Zahlentheorie odermathematische Grundlagen oder einer Kombination dieser Gebiete.Kompetenzen:9 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:186 Stunden• Beherrschung von Begriffen und Methoden aus den genannten Gebieten,• Mathematisches AbstraktionsvermögenLehrveranstaltung: Vorlesung (4 SWS) mit Übungen (2 SWS)Inhalte:Wechselndes Angebot, z.B. "Algebra", "Zahlen und Zahlentheorie"6 SWSPrüfung: Klausur (120 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Erreichen von mindestens 50% der Übungspunkte und zweimaliges Vorstellen vonLösungen in den ÜbungenPrüfungsanforderungen:Grundkenntnisse in einem der Gebiete "Mathematische Grundlagen", "Algebra" oder"Zahlentheorie"Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:• B.Mat.0012• B.Mat.0022 oder B.Mat.0026Modulverantwortliche[r]:N. N.Studiengangsbeauftragte/rDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8076
Modul M.Mat.0045<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Mat.0045: Seminar zum forschenden Lernen im Master ofEducationEnglish title: Research Seminar in MathematicsLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Vertiefung der Kenntnisse in einem Fachgebiet der Mathematik;Erlernen von Methoden der mündlichen und schriftlichen Präsentation mathematischerThemen.5 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:122 StundenKompetenzen:Präsentation eines mathematischen Themas im Rahmen einer mündlichenPräsentation;Führen einer mathematischen Diskussion;Verfassen eines mathematischen Textes.Lehrveranstaltung: Mathematisches Seminar oder OberseminarAngebotshäufigkeit: jedes Semester2 SWSPrüfung: Vortrag (ca. 75 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 10 Seiten)Prüfungsanforderungen:Beherrschen von Methoden der mündlichen und schriftlichen Präsentationmathematischer ThemenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jährlichWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:• B.Mat.0021 oder B.Mat.0025• B.Mat.0022 oder B.Mat.0026Modulverantwortliche[r]:N. N.Studiengangsbeauftragte/rDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8077
Modul M.Mat.0046<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Mat.0046: Schulbezogene Analyse, Planung und Durchführungvon MathematikunterrichtLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Die Teilnehmenden nutzen stofflich übergreifende Angebote• zu Theorien und Methoden zur Beobachtung, Analyse und Auswertung von Lehr-Lern-Prozessen,• zu typischen Lernsituationen an Gymnasien/Gesamtschulen wie z.B.zu Argumentieren, Begründen und Beweisen in Mathematik oder zuModellbildungsprozessen und ihrer methodischen Umsetzung,• zu theoretischen Hintergründen zu Aspekten mathematischen Lehrens undLernens an Gymnasien/Gesamtschulen,• zur Diagnose von und zum Umgang mit individuellen Lernbedürfnissen anGymnasien/Gesamtschulen,• zu Aufgaben für den Mathematikunterricht an Gymnasien/Gesamtschulen.8 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:122 StundenSelbststudium:118 StundenKompetenzen:Die Teilnehmenden• kennen Theorien und Methoden zur Beobachtung und Analyse von Lehr-Lern-Prozessen an Gymnasien/Gesamtschulen,• verfügen über Methoden mathematischen Lehrens und Lernens an Gymnasien/Gesamtschulen kennen und wenden diese an,• arbeiten beispielbezogen diagnostisch,• kennen bereichsbezogene Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler undwenden diese an,• verfügen über ein Repertoire von Aufgabendesigns z.B. für das Argumentieren undBegründen im Mathematikunterricht an Gymnasien/Gesamtschulen.• antizipieren Prozesse mathematischen Lernens an Gymnasien/GesamtschulenLehrveranstaltungen:1. Seminar zur Vorbereitung des vier- und des fünf-wöchigen Schulpraktikums 2 SWS2. Fachpraktikum (vier- oder fünf-wöchig)3. Begleitseminar zum vier- oder fünf-wöchigen Schulpraktikum 1 SWSPrüfung: Portfolio, Portfolio zum vier- oder fünf-wöchigen Schulpraktikum imFach Mathematik im Umfang von maximal 6.000 WortenPrüfungsvorleistungen:Teilnahme am vier- oder fünf-wöchigen Schulpraktikum im Fach MathematikPrüfungsanforderungen:Vertiefte schulbezogene Grundlagen und Methoden der Fachdidaktik Mathematik;Planung einer Unterrichtseinheit<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8078
Modul M.Mat.0046Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jährlichWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:B.Mat.0033, B.Mat.0034, B.Mat.0041Modulverantwortliche[r]:N. N.Studiengangsbeauftragte/rDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Master: 1 - 4Maximale Studierendenzahl:nicht begrenztBemerkungen:Präsenzzeit• Seminare: 42 Stunden• Praktikum (Schulunterricht): 80 StundenSelbststudium• 118 Stunden<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8079
Modul M.Mat.0048<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Mat.0048: Aktuelle Entwicklungen in der Fachdidaktik MathematikLernziele/Kompetenzen:Lernziele:Planen und Gestalten von Forschungsprojekten in der Fachdidaktik MathematikKompetenzen:Die Teilnehmenden7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 Stunden• beherrschen zentrale Bereiche der Schulmathematik (Gymnasium/Gesamtschule),kennen ihre Phänomene und Lernwerkzeuge, denken diese fachwissenschaftlichund fachdidaktisch durch und bereiten Lehr-Lern-Prozesse auf,• nutzen zentrale Begriffe der Schulmathematik (Gymnasium/Gesamtschule),durchdenken ihre Grundvorstellungen und Erkenntnishürden und bereiten diese fürLehr-Lern-Prozesse auf,• gehen mit stoffbezogenen mathematikdidaktischen Theorien und Methoden zumLehren und Lernen an Gymnasien/Gesamtschulen wissenschaftlich um undbeziehen diese auf die Praxis des Lehrens und Lernens,• nutzen Konzepte neuer Medien in den jeweiligen Lernkontexten,• setzen stoffbezogene Elemente des Mathematikunterrichts für Diagnose undAnalyse, Planung und Bewertung von Lehr-Lern-Prozessen nutzbringend ein.Lehrveranstaltung: 2 Seminare zum forschenden LernenInhalte:Es werden je eine Veranstaltung (je 2 SWS) zu zweien der folgenden stoffbezogenenThemen belegt: "Didaktik der Mathematik", "Didaktik der Stochastik", "Didaktik derlinearen Algebra/Analytischen Geometrie", "Anwendungen im Mathematikunterricht"oder "Diagnose von Lernschwierigkeiten in Mathematik".4 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsvorleistungen:Mitwirkung bei der Gestaltung von je einer Seminarsitzung in den beidenLehrveranstaltungenPrüfungsanforderungen:Aktuelle schulbezogene Grundlagen und Methoden der Fachdidaktik MathematikZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterEmpfohlene Vorkenntnisse:M.Mat.0046Modulverantwortliche[r]:N. N.Studiengangsbeauftragte/rDauer:2 Semester<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8080
Modul M.Mat.0048Wiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlenes Fachsemester:Master: 2 - 4Maximale Studierendenzahl:nicht begrenzt<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8081
Modul M.OAW.CAF.01<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.OAW.CAF.01: Fachdidaktik Chinesisch <strong>II</strong>English title: Didactics Chinese <strong>II</strong>Lernziele/Kompetenzen:In diesem Seminar werden fortgeschrittene Kenntnisse der Fachdidaktik Chinesischals Fremdsprache und ihrer Anwendung im Chinesischunterricht an deutschen <strong>Universität</strong>enund Schulen vermittelt. Die Studierenden erwerben in diesem Modul zentraledidaktische Kompetenzen, so etwa Sprachmittlerkompetenzen, Planungsmanagementim Hinblick auf die Gestaltung von Lehrprozessen, Lehrfähigkeit, Methoden- undMedienkompetenzen, Reflexionskompetenz sowie Selbstkompetenz.5 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:122 StundenZentrale Inhalte sind die Grundlagen der schulischen Vermittlung sprachpraktischerKenntnisse in den Bereichen Wortschatz, Grammatik, Hör- und Leseverstehen,Sprech- und Schreibvermögen sowie historischer und kultureller Aspekte des Zielsprachenlandes.Die Studierenden erwerben Wissen über fachdidaktische Ansätze zur Konzeptionvon fremdsprachlichen Unterrichtsprozessen einschließlich Leistungsbeurteilung.Dies schließt die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Methoden und Medien imFremdsprachenunterricht ein. Unterrichtsgegenstände sind außerdem PersönlichkeitsundRollentheorien als Fachlehrerin oder Fachlehrer sowie Strategien zur Steuerungdes eigenen Sprachlernens.Sie nehmen für einige Stunden am Chinesischunterricht im BA-Studium oder an einemGymnasium teil, um sich in ein Spezialthema zu vertiefen und hierzu ein Referat zuhalten.Lehrveranstaltung: Fachdidaktik Chinesisch <strong>II</strong> (Hauptseminar)2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 8000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme, Referat (ca. 30 Min.), Teilnehmende Beobachtung imChinesischunterricht des BA-Studiums oder an einem GymnasiumPrüfungsanforderungen:Fortgeschrittene Kenntnis der Lern- und Kompetenzbereiche des Chinesischunterrichtsmit ihren Konzepten und Bildungszielen und Fähigkeit, diese auf die Schüler/innen zubeziehen; fortgeschrittene Kenntnis von Vermittlungsverfahren und -einrichtungen imaußerschulischen Bereich; fortgeschrittene Kenntnis von Praxisfeldern und zentralenKonzepten lebenslangen Lernens und kultureller Erwachsenenbildung; Anwendungdieser Fähigkeiten auf ein konkretes Forschungsprojekt inkl. eines Praxisanteils.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, ChinesischAngebotshäufigkeit:Empfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:N.N.Dauer:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8082
Modul M.OAW.CAF.01jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimalig1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:10<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8083
Modul M.OAW.CAF.02<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.OAW.CAF.02: Moderne Schriftsprache <strong>II</strong>English title: Modern written language <strong>II</strong>Lernziele/Kompetenzen:Dieses Modul dient der Vertiefung der Kenntnisse in der modernen chinesischenSchriftsprache. Es sind insgesamt zwei Übersetzungsübungen zu absolvieren. MitAbschluß dieses Moduls erreichen die Studierenden das Sprachniveau, das sie für denUnterricht schriftsprachlicher Texte benötigen.Lehrveranstaltungen:1. Moderne Schriftsprache <strong>II</strong>.1 (Übung)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2. Moderne Schriftsprache <strong>II</strong>.2 (Übung)Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 Stunden2 SWS2 SWSPrüfung: Schriftliche Übersetzung von max. fünf Seiten (A4) OriginaltextPrüfungsvorleistungen:regelmäßige TeilnahmePrüfungsanforderungen:Nachweis der Fähigkeit, anspruchsvolle akademische Texte ins Deutsche übersetzen zukönnen.Zugangsvoraussetzungen:B.OAW.MS.19 oder äquivalentSprache:Deutsch, ChinesischAngebotshäufigkeit:keine AngabeWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:N.N.Dauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:10<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8084
Modul M.OAW.CAF.03<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.OAW.CAF.03: Forschungen zur Fachdidaktik ChinesischEnglish title: Research on the didactics ChineseLernziele/Kompetenzen:In diesem Seminar werden die in den Modulen Fachdidaktik Chinesisch Iund <strong>II</strong> erworbenen Kenntnisse durch Projektierung und Umsetzung einzelnerForschungsprojekten weiter vertieft. Die Studierenden entwerfen Lösungsansätze,testen diese im Chinesischunterricht des Bachelorstudiums oder an Gymnasienund berichten abschließend im Unterricht über die Testergebnisse in einemForschungsbericht (Referat).12 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:84 StundenSelbststudium:276 StundenLehrveranstaltungen:1. Fachdidaktik Chinesisch (Hauptseminar) 2 SWS2. Fachdidaktisches Praktikum (Praktikum) 4 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 10000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige Teilnahme, Lesen der Pflichtlektüre, Referat (ca. 30 Min.)Prüfungsanforderungen:Projektierung und Umsetzung eines Forschungsprojekts auf Grundlage der in ModulM.OAW.CAF.01 erworbenen und vertieften Kenntnisse.Zugangsvoraussetzungen:M.OAW.CAF.01M.OAW.CAF.01Sprache:Deutsch, ChinesischAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:N.N.Dauer:1-2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:10<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8085
Modul M.OAW.MS.03<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.OAW.MS.03: Modernes Chinesisch VIEnglish title: Modern Chinese VILernziele/Kompetenzen:Mit Abschluss dieses Moduls können die Studierenden chinesischsprachigen Vorträgenfolgen bzw. im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen und sich anin der chinesischen Hochsprache durchgeführten Diskussionen beteiligen, die sich aufThemen wie Arbeit und aktuelle Ereignisse beziehen.6 C8 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:112 StundenSelbststudium:68 StundenSie können Nachrichtensendungen und aktuelle Reportagen (Fernsehen, Radio)verstehen, sowie Spielfilmen folgen, sofern Standardsprache gesprochen wird.Die Studierenden verfügen über ausreichende sprachliche Kompetenz, um sichüber allgemeine Themen klar zu äußern und eigene Standpunkte auszudrücken.Sie suchen nicht auffällig nach Worten, verwenden komplexe Satzstrukturen undzeigen eine recht gute Beherrschung der Grammatik. Sie begehen keine Fehler, die zuMissverständnissen führen.Lehrveranstaltungen:1. Sprechen und Hören (Übung) 4 SWS2. Lesen und Schreiben (Übung) 4 SWSPrüfung: Klausur (120 Min.) und mündliche Prüfung (ca. 20 Min.)Prüfungsanforderungen:Nachweis von sprachlichen Handlungskompetenzen in interkulturellen Kontextenunter Anwendung der vier Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben, d.h.Nachweis der Fähigkeit, in den rezeptiven Fertigkeiten auf eine dem Niveau B2.2 desGemeinsamen europäischen Referenzrahmens angemessene Art mit mündlichen undschriftlichen Kommunikationssituationen umzugehen.Zugangsvoraussetzungen:Bachelorabschluss, der ein dem Göttinger BAin Moderner Sinologie bzw. Chinesisch alsFremdsprache vergleichbares Sprachniveau erreicht.Sprache:Deutsch, ChinesischAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Lingling NiDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:24<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8086
Modul M.Phi.08<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phi.08: Theoretische PhilosophieEnglish title: Theoretical PhilosophyLernziele/Kompetenzen:Vertieftes Verständnis systematischer Problemstellungen und Kenntnis einschlägiger,für den gymnasialen Unterricht relevanter Positionen im Bereich der theoretischenPhilosophie, vorzugsweise auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie,Metaphysik, Sprachphilosophie oder Philosophie des Geistes. Die Studierendendurchdringen einen Themenbereich hinreichend gründlich, um im weiteren Studium diefachdidaktische Vermittlung als eine darauf aufbauende und die fachliche Kompetenzvoraussetzende Aufgabe auffassen und realisieren zu können. Fähigkeit der Rezeption,Darstellung und eigenständigen Behandlung eines systematischen Problems aufaktuellem fachwissenschaftlichem Niveau in schriftlicher Form.Lehrveranstaltung: Hauptseminar zu einem Thema der theoretischen Philosophie7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Vertiefte Bearbeitung eines Problems der theoretischen Philosophie mitBerücksichtigung und kritischer Abwägung relevanter fachwissenschaftlicher Positionenin Form einer Hausarbeit.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd LudwigDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8087
Modul M.Phi.09<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phi.09: Praktische PhilosophieEnglish title: Practical PhilosophyLernziele/Kompetenzen:Vertieftes Verständnis systematischer Problemstellungen und Kenntnis einschlägiger,für den gymnasialen Unterricht relevanter Positionen im Bereich der praktischenPhilosophie, vorzugsweise auf dem Gebiet der Normativen Ethik, der AngewandtenEthik oder der Politischen Philosophie. Die Studierenden durchdringen einenThemenbereich hinreichend gründlich, um im weiteren Studium die fachdidaktischeVermittlung als eine darauf aufbauende und die fachliche Kompetenz voraussetzendeAufgabe auffassen und realisieren zu können. Fähigkeit der Rezeption, Darstellungund eigenständigen Behandlung eines systematischen Problems auf aktuellemfachwissenschaftlichem Niveau in schriftlicher Form.Lehrveranstaltung: Hauptseminar zu einem Thema der praktischen Philosophie7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Vertiefte Bearbeitung eines Problems der praktischen Philosophie mit Berücksichtigungund kritischer Abwägung relevanter fachwissenschaftlicher Positionen in Form einerHausarbeit.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd LudwigDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8088
Modul M.Phi.09 (WuN)<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phi.09 (WuN): Themen der Philosophischen Ethik für den'Werte und Normen'-UnterrichtEnglish title: Issues of Philosophical Ethics for the "Values and Norms" CurriculumLernziele/Kompetenzen:Vertieftes Verständnis einschlägiger, für den Unterricht im Schulfach „Werte undNormen“ relevanter Positionen im Bereich der Praktischen Philosophie. Es soll ein imvorausgehenden Studium noch nicht behandelter Themenbereich der Normativen Ethik(aktuelle Theorien der Moralbegründung), der Angewandten Ethik (z.B. Medizinethik,ökologische Ethik) oder der Politischen Philosophie (z.B. Menschenrechte, sozialeGerechtigkeit) erarbeitet werden. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit derRezeption, Darstellung und eigenständigen Behandlung eines systematischenProblems auf aktuellem fachwissenschaftlichem Niveau in schriftlicher Form.Besondere Bedeutung kommt dabei der Fähigkeit zu, moralphilosophische Begriffe undTheorieansätze auf Beispiele aus der heutigen gesellschaftlichen Realität anzuwendenund daran ihre Leistungsfähigkeit zu erproben.Lehrveranstaltung: Hauptseminarzu einem Thema der Normativen Ethik, der Angewandten Ethik oder der PolitischenPhilosophie7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Prüfungsvorleistungen:kleinere mündliche oder schriftliche LeistungPrüfungsanforderungen:Fähigkeit der Rezeption, Darstellung und eigenständigen Behandlung eines fürden WuN-Unterricht relevanten moralphilosophischen Problems auf aktuellemfachwissenschaftlichem Niveau in schriftlicher Form.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Holmer SteinfathDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8089
Modul M.Phi.10<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phi.10: Geschichte der PhilosophieEnglish title: History of PhilosophyLernziele/Kompetenzen:Vertieftes Verständnis von Problemstellungen und Positionen im Bereich der Geschichteder Philosophie. Fähigkeit zur Behandlung texthermeneutischer und systematischerInterpretationsfragen an klassischen Texten der Philosophie, vorzugsweise an solchenTexten, die geeignet sind, im Gymnasialunterricht die Fähigkeiten der Schüler imLeseverständnis und in der Argumentationsanalyse zu schulen. Die Studierendenbeherrschen exegetische und systematische Probleme hinreichend gründlich undverfügen über ausreichende philosophiehistorische Kenntnisse, um im weiterenStudium die fachdidaktische Vermittlung als eine darauf aufbauende und die fachlicheKompetenz voraussetzende Aufgabe auffassen und realisieren zu können. Fähigkeit derRezeption, Darstellung und eigenständigen Behandlung eines systematischen Problemsauf aktuellem fachwissenschaftlichem Niveau in schriftlicher Form.Lehrveranstaltung: Hauptseminar zu einem Thema der Geschichte derPhilosophie7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Vertiefte Bearbeitung einer Fragestellung der Geschichte der Philosophie mitBerücksichtigung und kritischer Abwägung relevanter fachwissenschaftlicher Positionenin Form einer Hausarbeit.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd LudwigDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8090
Modul M.Phi.21<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phi.21: Aufbaumodul FachdidaktikEnglish title: Advanced Didactics of PhilosophyLernziele/Kompetenzen:- Aufbereitung fachwissenschaftlicher (philosophischer) Sachverhalte, Fragen undMethoden Inhalte unter didaktischen Gesichtspunkten; Erarbeiten philosophischerFragestellungen und Positionen mit Blick auf ihre Vermittlung in der Schule; Reflexiondes Verhältnisse des Schulfaches Philosophie zu anderen Schulfächern;7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 Stunden- Kenntnis der rechtlichen / institutionellen Rahmenbedingungen desPhilosophieunterrichts;- Kenntnis allgemeiner und philosophiebezogener Didaktiken;- Reflexion der aus klassischen Didaktikansätzen bekannten Modelle auf die Möglichkeitder Verwendung für philosophische Zusammenhänge sowie Vermittlung der Sacheangemessener didaktischer Kompetenzen;- Kenntnis besonders für den Philosophieunterricht geeigneter Methoden undSozialformen;- Exemplarische Erarbeitung und Planung einer Unterrichtsstunde;- Exemplarische Erarbeitung und Planung einer Unterrichtseinheit;- Exemplarische Erarbeitung und Planung eines Unterrichtshalbjahres;- Fähigkeit zu eigenständiger Textarbeit und kritischer Beurteilung philosophischerBegründungen;- Reflexion des Lehrerberufes und den speziellen Anforderungen an diePhilosophielehrer und -lehrerinnen.Lehrveranstaltung: Fachdidaktische Vertiefung (Seminar)Prüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:schriftliche Dokumentation und Erörterung der präsentierten und durchgeführtenUnterrichtssequenzPrüfung: Praktische PrüfungPrüfungsanforderungen:Präsentation und Durchführung einer Seminarsitzung in Form einer Unterrichtssequenzunter Berücksichtigung der jeweils aktuell geltenden Rahmenrichtlinien / EPA /Curricula2 SWS4 C3 CZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd LudwigDauer:1 Semester<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8091
Modul M.Phi.21Wiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8092
Modul M.Phi.22<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phi.22: Praxismodul FachdidaktikEnglish title: Practical Module Didactics of PhilosophyLernziele/Kompetenzen:- Praktische Anwendung und Vertiefung der bereits erworbenen fachdidaktischenKompetenzen im Schulbereich;- Kenntnis von Aufbau und Inhalt der curricularen Vorgaben des UnterrichtsfachesPhilo¬sophie;8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:176 StundenSelbststudium:64 Stunden- Kenntnis der in den Bundesländern für den Philosophieunter¬richt zugelassenenSchulbücher, ihres Aufbaus und ihrer Inhalte, Kenntnis sonstiger Lehr- undLernmaterialien;- Kriterien- und adressatengerechte Konzeption von Aufgabenstellungen;- Kenntnis der Möglichkeiten der Vermittlung von Methoden des selbstbestimm¬ten /eigenverantwortlichen / kooperativen Lernens und Arbeitens an Schülerinnen undSchüler;- Vertiefte Reflexion besonders für den Philosophieunterricht geeigneter Methoden undSozialformen;- Kenntnis und Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Medien/moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht;- Reflexion der Ergebnisse der fachdidak¬tischen Forschung auf pädagogischesHandeln;- Reflexion von Möglichkeiten der Leistungsmessung und -bewertung im FachPhilosophie;- Kenntnis und Reflexion der wichtigsten Techniken der Gesprächsführung im Unterricht;- Reflexion von Lernstrategien, Lernmethoden, Lehrmetho¬den für denPhilosophieunterricht;- Exemplarische Erarbeitung und Planung einer Unterrichtsstunde (Kurzentwurf),Präsentation im Seminar; Exemplarische Erarbeitung und Planung einerUnterrichts¬einheit, Präsentation im Seminar;- Exemplarische Erarbeitung und Planung eines Unterrichtshalbjahres, Präsentation imSeminar; Fähigkeit zur Analyse von Unterricht (Unterrichtsbeobachtung)Lehrveranstaltungen:1. Vorbereitung des Fachpraktikums (Seminar)2. Fachpraktikum3. Nachbereitung des Fachpraktikums (Seminar)Prüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am FachpraktikumPrüfungsanforderungen:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8093
Modul M.Phi.22- Planung einer Unterrichtsstunde im Zusammenhang a) einer Unterrichtseinheit, b)eines Schulhalbjahres;- Analyse und Dokumentation des besuchten Unterrichts (anhand ausgewählter Kriteriendes Beobachtungsbogens);- Analyse und Dokumentation einer ausgewählten, eigenständig durchgeführtenUnterrichtsstunde in Form eines ausführlichen Unterrichtsentwurfes nach Maßgabeniedersächsischer Studienseminare;- Übergreifende, persönliche Stellung-nahme/Reflexion zu den Ergebnissen undErfahrungen des Praktikums.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd LudwigDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8094
Modul M.Phy.707<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phy.707: Aktuelle Themen der PhysikLernziele/Kompetenzen:Lernziele: Selbstständige Erarbeitung der Inhalte naturwissenschaftlicher undfachdidaktischer Publikationen unter besonderer Berücksichtigung interdisziplinärersowie wissenschaftstheoretischer und historischer Kompetenzen. Umgang mitder Authentizität von Primärliteraur im Vergleich zu Schul- und LehrbüchernKontextbezogene und adressatenorientierte Präsentation physikalischer Sachverhalte,Kommunikation über und Bewertung von physikalische(n) Sachverhalte(n), Umgang mitPräsentationsmedien.Lehrveranstaltung: Seminar4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Präsentation (ca. 45 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 20 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse in einem selbständig erarbeiteten physikalischen Sachverhalt,Präsentation und schriftl. Ausarbeitung des Sachverhaltes unter Berücksichtigungwissenschaftstheoretischer, wissenschaftshistorischer und wissenschaftssoziologischerAspekte.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:N. N.Dauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8095
Modul M.Phy.708<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phy.708: Physikunterricht planen und gestaltenLernziele/Kompetenzen:Lernziele: Kenntnis ausgewählter Forschungsarbeiten aus der Physikdidaktik undAnwendung der Modelle und Ergebnisse in Unterrichtseinheiten.Kompetenzen: Selbständige Erarbeitung und Durchführung einer Unterrichtseinheitunter Berücksichtigung der Ergebnisse fachdidaktischer Forschung, der KMK-Bildungsstandards und Kerncurricula, Dokumentation, Reflexion und Evaluation derUnterrichtseinheit, sach- und adressatenorientierte Präsentation zentraler didaktischrelevanter Fragestellungen, Umgang mit Präsentationsmedien und methodischenKonzepten aus der Fachdidaktik.Lehrveranstaltung: Unterschiedliche Lehrveranstaltungen zur AuswahlInhalte:1. Seminar „Vorbereitung des Fachpraktikums“ mit Fachpraktikum (5-wöchig) oderSeminar „Fachdidaktik Physik – Vertiefung“ mit Fachpraktikum (4-wöchig) 3. Seminar„Nachbereitung des Fachpraktikums“8 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:42 StundenSelbststudium:198 Stunden3 SWSPrüfung: Praktikumsbericht (max. 20 Seiten) mit Präsentation (ca. 30 Min.)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am Fachpraktikum; Seminarbeitrag (ca. 45 Min.)Prüfungsanforderungen:Kenntnis der Inhalte ausgewählter fachdidaktischer Forschungsarbeiten, Methoden undKonzepteZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Susanne SchneiderDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8096
Modul M.Phy.709<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phy.709: Vertiefung experimenteller Techniken und Weiterentwicklungvon Praxis an der SchuleLernziele/Kompetenzen:Lernziele: Methoden und Grenzen der Erkenntnisgewinnung in denNaturwissenschaften, Modellbildung in der Physik, Kenntnis und Durchführungschulrelevanter Demonstrations- und Schülerexperimente.Kompetenzen: Anwendung von Erkenntnis- und Auswertemethoden, Präsentationvon Demonstrations- und Schülerexperimenten unter fachdidaktischen Aspekten undBewertung hinsichtlich ihrer erkenntnis – und wissenschaftstheoretischen Möglichkeitenund Grenzen. Selbstständige Planung und Aufbau von Demonstrationsexperimentenmit Apparaturen aus der Schule, Aufbau komplexerer Versuche zu schulrelevantenFragestellungen aus der modernen Physik,7 C5 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:70 StundenSelbststudium:140 StundenLehrveranstaltungen:1. Praktikum (10 Versuche) 3 SWS2. Seminar 2 SWSPrüfung: Portfolio (max. 50 Seiten)Prüfungsvorleistungen:: Präsentation eines Experiments (ca. 45 Min.)Prüfungsanforderungen:Fachdidaktische und fachwissenschaftliche Aspekte von Demonstrations- undSchülerexperimentenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Susanne SchneiderDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8097
Modul M.Phy.710<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Phy.710: Spezielle Themen der PhysikLernziele/Kompetenzen:Lernziele: Inhalte aktueller Forschung in der Astro- und Geophysik, Biophysikund Physik komplexer Systeme, Festkörper- und Materialphysik oder Kern- undTeilchenphysik. Vertiefung des im Wahlpflichtbereich angeeigneten Ver¬ständnissesvon Methoden und Modellen.4 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:42 StundenSelbststudium:78 StundenKompetenzen: Die Studierenden sollen aktuelle fachwissenschaftlicheOriginalpublikationen aus dem Fachgebiet curricular valide für den OberstufenunterrichtaufzubereitenLehrveranstaltung: Spezielle Themen der PhysikInhalte:Eine Veranstaltung aus dem Lehrangebot der Astro- und Geophysik, Biophysikund Physik komplexer Systeme, Festkörper- und Materialphysik oder Kern- undTeilchenphysik.3 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 15 S.) und Klausur 120 Min. oder mündl. (ca. 30 Min.)oder Seminarvortrag (ca. 30 Min.)Prüfungsanforderungen:Methoden und Modelle der Astro- und Geophysik, Biophysik und Physik komplexerSysteme, Festkörper- und Materialphysik oder Kern- und Teilchenphysik; Fähigkeit zurAufarbeitung für kontextbezogene und adressatenorientierte VermittlungZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:N. N.Dauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:90<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8098
Modul M.Pol.MEd-100<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Pol.MEd-100: Politik und Wirtschaft: Strukturen, Entscheidungen,ErgebnisseEnglish title: Politics and Economics: Structures, Decisions, ResultsLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden beschäftigen sich, aufbauend auf den im Bachelor-Studiengangerworbenen Kenntnissen über politische Systeme, mit der Rolle von Institutionen bei derSteuerung politischer und wirtschaftlicher Systeme.Die Studierenden erlangen Kompetenzen in:10 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:244 Stunden• der eigenständigen Anwendung des Instrumentariums der moderneninstitutionsorientierten• der Präsentation komplexer theoretischer und empirischer Zusammenhänge sowohlmündlich als auch schriftlich.Die Studierenden erwerben im ersten Hauptseminar Kenntnisse über:• die empirische Verfasstheit und Funktionsweise moderner liberaler Demokratien sowiedie Theorien, Methoden und Ansätze zu ihrer empirischen Analyse;• die Funktionsweisen von Marktprozessen;• die Funktionen von Verbänden im intermediären Raum;• die Interaktion zwischen Sozialstruktur und ökonomischen bzw. politischenEntscheidungen;• die Interdependenz politischen und wirtschaftlichen Handelns;• die Verflechtung der nationalen und internationalen Handlungsebenen.Die Studierenden wenden diese Kenntnisse im zweiten Hauptseminar an, um eigeneproblemorientierte, wissenschaftliche Fragestellungen zur Interaktion zwischen Politikund Wirtschaft zu entwickeln.Lehrveranstaltungen:1. Politik und Wirtschaft (Seminar)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2. Aktuelle Fragen zur politischen Ökonomie (Seminar)Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester2 SWS2 SWSPrüfung: Vortrag (ca. 20 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 20 S.)Prüfungsanforderungen:Anwendung institutionenorientierter Analyse auf Entscheidungsprozesse in denBereichen Politik und Wirtschaft.Präsentation theoretischer und empirischer Zusammenhänge sowohl mündlich als auchschriftlich.Beweisen von inhaltlichen Kenntnissen über empirische Verfasstheit undFunktionsweise moderner liberaler Demokratien und der Theorien und Methoden zuihrer Analyse; die Funktionsweisen von Marktprozessen; die Funktionen von Verbänden<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8099
Modul M.Pol.MEd-100im intermediären Raum; die Interaktion zwischen Sozialstruktur und ökonomischenbzw. politischen Entscheidungen; die Interdependenz politischen und wirtschaftlichenHandelns; die Verflechtung der nationalen und internationalen Handlungsebenen.Entwicklung eigener problemorientierter, wissenschaftlicher Fragestellung zurInteraktion zwischen Politik und Wirtschaft.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Andreas BuschDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8100
Modul M.Pol.MEd-201<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Pol.MEd-201: Praxis der Politischen ÖkonomieEnglish title: Political Economy in practiceLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden beschäftigen sich mit der Interaktion von Politik und Wirtschaft ineinem konkreten Wirtschaftssektor bzw. Politikfeld.Die Studierenden:• analysieren historisch, theoretisch und empirisch ein spezielles Politikfeld bzw.einen Wirtschaftssektor im Mehrebenen-Regierungskontext aus der Perspektiveder Volkswirtschaft und der Politikwissenschaft;• entwickeln und vertiefen das Bewusstsein für aktuelle Probleme der politischenSteuerung wirtschaftlichen Handelns;• gewinnen anhand dieses exemplarischen Falles ein Verständnis für die Chancenund Probleme interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen der Politikwissenschaftund den Wirtschaftswissenschaften sowie ein vertieftes Verständnis derbesonderen Logiken dieser beiden Wissenschaftsdisziplinen• analysieren und beurteilen aktuelle Entscheidungsprozesse eines Politikfeldsbzw. Wirtschaftssektors in einem praxisorientierten Seminar, das u.a. durch casestudy-Methoden, Interdiziplinarität und Aktualitätsbezug die gewöhnliche Distanzzwischen Politik, Wirtschaft, Studium und Praxis überbrückt.4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 StundenDie Studierenden erlangen Kompetenzen in• der eigenständigen Anwendung des Instrumentariums der moderneninstitutionsorientierten Analyse;• der theoretischen Unterscheidung und praktischen Anwendung einerpolitikwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Herangehensweise anein gesellschaftsrelevantes Phänomen;• der Präsentation komplexer theoretischer und empirischer Zusammenhängesowohl mündlich als auch schriftlich;• fachübergreifender und problemlösungsorientierter Kommunikation.Lehrveranstaltungen:1. Seminar: Theorie der politischen Ökonomie interdisziplinär 1 SWS2. Seminar: Praxis der politischen Ökonomie interdisziplinär 1 SWSPrüfung: Vortrag (ca. 20 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 10 Seiten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden• können ein Politikfeld analysieren und aktuelle Entscheidungsprozesse beurteilen• kennen aktuelle Probleme der politischen Steuerung wirtschaftlichen Handelns• kennen das Instrument der modernen institutionenorientierten Analyse• können komplexe theoretische und empirische Zusammenhänge mündlich undschriftlich präsentieren<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8101
Modul M.Pol.MEd-201Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Monika OberleDauer:1-2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8102
Modul M.Pol.MEd-300<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Pol.MEd-300: Theorie und Praxis der politischen BildungEnglish title: Political Education: theory and practiceLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden- kennen Traditionslinien, theoretische Modelle und Zugänge politischer undökonomischer Bildung- reflektieren Kategorien als heuristische Instrumente zur Gestaltung und Durchführungpolitisch-ökonomischen Unterrichts7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 Stunden- kennen spezifische didaktische Erfordernisse des Integrationsfaches Politik &Wirtschaft- rezipieren, beurteilen und bewerten fachdidaktische Forschungsarbeiten, -methodenund –ergebnisse- können Methoden empirischer fachdidaktischer Forschung anwenden- entwickeln Methoden- und Medienkompetenzen zur Gestaltung politischökonomischenUnterrichts- kennen Kriterien zur Auswahl von Gegenständen des politisch-ökonomischenUnterrichts- erfahren die Bedeutung außerschulischer Lernorte für die Planung und Durchführungdes politisch-ökonomischen Unterrichts- kennen etwaige sozialisationsbedingte Beeinträchtigungen von Schülerinnenund Schülern beim Lernprozess und Möglichkeiten der pädagogischen Hilfen undPräventionsmaßnahmenLehrveranstaltungen:1. Seminar 2 SWS2. Seminar 2 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse von Traditionslinien und theoretischen Zugängen politischer undökonomischer Bildung sowie von spezifischen didaktischen Erfordernissen desIntegrationsfaches Politik & Wirtschaft.Bewertung fachdidaktischer Forschungsarbeiten, -methoden und -ergebnisse sowieAnwendung empirischer Forschungsmethoden.Kenntnisse von Kriterien zur Auswahl von Gegenständen, von Kategorienals heuristische Instrumente politisch-ökonomischen Unterrichts sowie vonKompetenzmodellen der politisch-ökonomischen Bildung.Fähigkeit zur Gestaltung desselben geeignete Methoden und Medien auszuwählen unddie Bedeutung außerschulischer Lernorte aufzuzeigen.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8103
Modul M.Pol.MEd-300Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Monika OberleDauer:1-2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8104
Modul M.Pol.MEd-400<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Pol.MEd-400: Vorbereitung und Reflexion des Fachpraktikums/ForschungspraktikumsEnglish title: Preparation and Reflexion of Educational or Research PracticeLernziele/Kompetenzen:FachpraktikumDie Studierenden- kennen Kompetenzmodelle und Standarddefinitionen zur Erfassung und Beurteilungvon Schülerleistungen8 C3 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:42 StundenSelbststudium:198 Stunden- können Methoden der Lerndiagnose und der Leistungsbewertung anwenden- kennen und beurteilen fachdidaktische Ansätze für die Unterstützung vonLernprozessen- entwickeln die Fähigkeit zur Erläuterung fachlicher Sachverhalte unterBerücksichtigung des Vorverständnisses von Schülerinnen und Schülern- wählen Medien zur Gestaltung des politisch-ökonomischen Unterrichts aus- können schulpraxisbezogene Entscheidungen auf der Basis strukturierten fachlichenWissens und fachdidaktischer Theorien treffen- können Unterrichtsstunden und –sequenzen bezogen auf unterschiedlichenKompetenzen planen und gestalten- verfügen über Analyse- und Reflexionsfähigkeit der eigenen Unterrichtstätigkeit sowievon SchülerprozessenForschungspraktikumDie Studierenden- können Unterrichtsansätze und –methoden unter Berücksichtigung neuer fachlicherErkenntnisse weiterentwickeln;- kennen fachdidaktische Ansätze für die Unterstützung von Lernprozessen;- können schulpraxisbezogene Entscheidungen auf der Basis strukturierten fachlichenWissens und fachdidaktischer Theorie treffen;- kennen Methoden der empirischen fachdidaktischer Forschung und können dieseanwenden;- können Unterrichtsansätze und -methoden unter Berücksichtigung neuer fachlicherErkenntnisse weiterentwickeln;Lehrveranstaltungen:1. Vorbereitende Lehrveranstaltung 2 SWS2. Fachpraktikum (5-wöchig) oder Forschungspraktikum (4-wöchig)3. Nachbereitende Lehrveranstaltung 1 SWS<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8105
Modul M.Pol.MEd-400Abhängig von der Wahl des Praktikums ist eine der nachfolgenden Prüfungsleistungenzu absolvieren, und zwar im Falle des 5-wöchigen Fachpraktikums der Vortrag mitAusarbeitung, im Falle des 4-wöchigen Forschungspraktikums die Hausarbeit.Prüfung: Praktikumsbericht oder Portfolio (max. 10 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse über Kompetenzmodelle und Standarddefinitionen zur Erfassung undBeurteilung von Schülerleistungen. Fähigkeiten, Methoden der Lerndiagnose und derLeistungsbewertung anzuwenden, fachliche Sachverhalte unter Berücksichtigung desVorverständnisses von Schülerinnen und Schülern zu erläutern und geeignete Medienzur Gestaltung des politisch-ökonomischen Unterrichts auszuwählen.Planung und Gestaltung von Unterrichtsstunden und -sequenzen, die sich aufunterschiedliche Kompetenzen beziehen.Analyse- und Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf die eigene Unterrichtstätigkeit sowie imHinblick auf Schülerprozesse.Prüfung: Hausarbeit (max. 10 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse und Beurteilung von fachdidaktischen Ansätzen für die Unterstützung vonLernprozessen sowie die Fähigkeit schulpraxisbezogene Entscheidungen auf der Basisstrukturierten fachlichen Wissens und fachdidaktischer Theorien zu treffen.Kenntnisse eines Methodenrepertoires empirischer fachdidaktischer Forschung undAnwendung desselben.Fähigkeit Unterrichtsansätze und -methoden unter Berücksichtigung neuer fachlicherErkenntnisse weiterzuentwickeln.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Monika OberleDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2 - 3Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8106
Modul M.Pol.MEd-500<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Pol.MEd-500: Politischen Denken heute. Zivilgesellschaft,Globalisierung und MenschenrechteEnglish title: Political Thought Today. Civil Society, Globalization, and Human RightsLernziele/Kompetenzen:1. setzen sich mit den Besonderheiten der Entwicklungsprozesse und Debatten derpolitischen Theorie auseinander;2. vertiefen und fokussieren die im Bachelor-Studiengang erworbenenTheoriekenntnisse – besonders detailliert, kritisch und auf dem neuesten Stand in denThemenfeldern Zivilgesellschaft, Globalisierung und Menschenrechte;3. lernen selbstständig sich neues Wissen und Können anzueignen (insbesondere inden Grundlagen der Hermeneutik) und dieses in unvertrauten Situationen anzuwenden;4. schaffen und sichern im Team einen gemeinsamen Wissensstand;5. lernen mit der Komplexität der politischen Theorie umzugehen – dass theoretischeKenntnisse einem ständigen Prozesses der Debatte und der Entwicklung unterzogenwerden;6. schärfen ihre Fähigkeiten des schriftlichen und mündlichen Ausdrucks sowie derAnalyse, um forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte durchzuführen.7. wenden die erarbeiteten theoretischen Ansätze und Forschungsperspektiven aufFragestellungen im Werte und Normen Unterricht an und reflektieren diese.Lehrveranstaltung: Politischen Denken heute. Zivilgesellschaft, Globalisierungund Menschenrechte7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 Stunden4 SWSPrüfung: Referat (ca. 20 Min.) mit ModerationPrüfungsanforderungen:Kenntnisse über Entwicklungsprozesse und Debatten der politischen Theorie undIdeengeschichte. Anwendung hermeneutischer Grundlagen sowie kritische Reflexion zuden Themenfeldern Zivilgesellschaft, Globalisierung und Menschenrechte.Reflektion der erarbeiteten theoretischen Themenfelder auf Unterrichtssituation in Werteund Normen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Walter Reese-SchäferDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8107
Modul M.RelW.MEd-500<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.RelW.MEd-500: ReligionswissenschaftEnglish title: Religious StudiesLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden verfügen über vertiefte religionswissenschaftliche Kenntnisseund Analysefähigkeiten, die sie insbesondere durch die selbständige Explorationeiner religionswissenschaftlichen Fragestellung unter historischen und/odersystematischen Gesichtspunkten im Zusammenhang eines religionswissenschaftlichenHauptseminars nachweisen. Sie besitzen zudem eine breitere religionswissenschaftlicheAllgemeinbildung.Lehrveranstaltungen:1. Historisches oder systematisches Seminar in Religionswissenschaft (inkl.theologische Ethik)7 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:154 Stunden2 SWS2. Weitere LV aus der Religionswissenschaft nach Wahl (S, Üb, Vl, Koll) 2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 30 Seiten)Prüfungsanforderungen:Im Rahmen der umfangreichen Hausarbeit soll v.a. die Fähigkeit zur Identifizierungund historisch-analytischen Durchdringung von Problemen der religiösen Ethik bzw.Werte- und Normenbegründung demonstriert werden. – Beispiele: Interdependenz vonLaien- und Mönchsethik im Theravada-Buddhismus; Bewertung anderer Religionenim Kontext einzelner rel. Perspektiven (Akteure oder Texte); Einzelstudien zur Rolle/Stellung der Frau im Koran (Islam, Buddhismus, ...); religiöse Stellungnahmen zurGentechnologie oder zu Fragen der Ernährung; Ehe und Familie aus der Sicht einzelnerReligionen. Ferner: Themenbereiche von interreligiösem Dialog und Friedensarbeit oderEinstellungen zu Krieg bzw. Pazifismus; exemplarische Probleme und Diskussionenzur (psychosozialen) „Konfliktträchtigkeit" neureligiöser Bewegungen (Devianzdiskurse,Sektenmetaphorik), etc.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, EnglischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. theol. Andreas GrünschloßDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8108
Modul M.Rom.Frz.601<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Rom.Frz.601: Sprachpraxis FranzösischEnglish title: Practical Language Course FrenchLernziele/Kompetenzen:Ziel dieses Moduls ist es, eine möglichst kompetente Sprachverwendung in öffentlichen/gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen zu erreichen.In der Übung Français VI wird der Schwerpunkt auf die mündlichen RezeptionsundProduktionskompetenzen gelegt. Auf der Grundlage des EuropäischenReferenzrahmens (Niveau C1 bis C2 in Hörverstehen und mündlichem Ausdruck)verfügen die Studierenden über ein umfassendes und zuverlässiges Spektrumsprachlicher Mittel. Sie sind in der Lage, die französische Sprache im gesellschaftlichenund beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel zugebrauchen. In der mündlichen Interaktion handeln sie abwechselnd als Sprechendeund Hörende und verwenden adäquate Rezeptions- und Produktionsstrategien.Außerdem können sie sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhaltenäußern.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenIn der Übung Français V<strong>II</strong> sollen die schriftlichen Rezeptions- undProduktionskompetenzen vertieft und vervollständigt werden. Auf der Grundlagedes Europäischen Referenzrahmens (Niveau C1 bis C2 in Textverstehen undSchreibfertigkeit) verfügen die Studierenden über ein umfassendes und zuverlässigesSpektrum sprachlicher Mittel. Sie können ein breites Spektrum anspruchsvoller, längererTexte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Außerdem können sie sichschriftlich klar, gut strukturiert und flüssig ausdrücken und ihre Ansichten ausführlichdarstellen.Die Absolvierung des Moduls in zwei aufeinander folgenden Semestern wird empfohlen.Lehrveranstaltung: UE Französisch VILehrveranstaltung: UE Französisch V<strong>II</strong>2 SWS2 SWSPrüfung: Sprachkompetenzprüfung (210 Minuten)Prüfungsanforderungen:Nachweis der mündlichen Rezeptions- und Produktionskompetenzen auf der Stufe C1-C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Nachweis der schriftlichenRezeptions- und Produktionskompetenzen auf der Stufe C1-C2 des GemeinsamenEuropäischen Referenzrahmens.Zugangsvoraussetzungen:Französische Sprachkenntnisse im Umfang vonNiveau C1 des Gemeinsamen EuropäischenReferenzrahmensSprache:FranzösischEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Mélanie Gagnant<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8109
Modul M.Rom.Frz.601Angebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8110
Modul M.Rom.Spa.601<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Rom.Spa.601: Sprachpraxis SpanischEnglish title: Practical Language Course SpanishLernziele/Kompetenzen:Español V<strong>II</strong> Anspruchsvolle Einübung der Sprache zur Vertiefung der schriftlichenRezeptions- und Produktionskompetenzen. Auf der Grundlage des EuropäischenReferenzrahmens (Niveau C1 in Hörverstehen und mündlichem Ausdruck, C1+ inTextverstehen und Schreibfertigkeit) sind die Studierenden in der Lage, lange, komplexeSachtexte und literarische Texte zu verstehen und Stilunterschiede wahrzunehmen,sich schriftlich klar und gut strukturiert auszudrücken und ihre Ansichten ausführlichdarzustellen. Außerdem können sie in ihren schriftlichen Texten den Stil wählen, der fürdie jeweiligen Leser angemessen ist.6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:124 StundenEspañol V<strong>II</strong>I Anspruchsvolle Einübung der Sprache zur Vertiefung der mündlichenProduktionskompetenz und des Hörverstehens. Auf der Grundlage des EuropäischenReferenzrahmens (Niveau C1 in Hörverstehen und mündlichem Ausdruck, C1+ inTextverstehen und Schreibfertigkeit) können sich die Studierenden spontan undfließend verständigen, sich in vertrauten Situationen aktiv an einer Diskussion beteiligenund ihre Ansichten begründen und verteidigen, sowie aus ihren Interessengebieteneine detaillierte Darstellung geben. Die Studierenden sind auch in der Lage, lange,komplexe audiovisuelle Beiträge zu verstehen und Stilunterschiede wahrzunehmen. DieAbsolvierung des Moduls in zwei aufeinander folgenden Semestern wird empfohlen.Lehrveranstaltungen:1. UE Español V<strong>II</strong> 2 SWS2. UE Español V<strong>II</strong>I 2 SWSPrüfung: Sprachkompetenzprüfung (ca. 105 Min.)Prüfungsanforderungen:Nachweis der schriftlichen Rezeptions- und Produktionskompetenzen auf der StufeC1+ des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Nachweis der mündlichenProduktionskompetenz und des Hörverstehens der Stufe C1 des GemeinsamenEuropäischen Referenzrahmens.Zugangsvoraussetzungen:Spanische Sprachkenntnisse im Umfang vonNiveau C1 des Gemeinsamen EuropäischenReferenzrahmensSprache:SpanischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Carmen Mata CastroDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8111
Modul M.Rom.Spa.601Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8112
Modul M.Russ.101a<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.101a: Literatur/Kultur diachron (Vorlesung)English title: Diachronic Literary and Cultural Studies (lecture)Lernziele/Kompetenzen:Die Studierenden ergänzen ihr Wissen über die Charakteristik und Abfolge literarischerund kultureller Epochen. Sie werden befähigt, Epochen anhand von spezifischenMerkmalen zu unterscheiden. Sie lernen, Texte verschiedener Epochen entsprechendihren Epochenmerkmalen einander gegenüberzustellen und Epochenäquivalenzen zubilden.Lehrveranstaltung: Diachronie (Vorlesung)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 Stunden2 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsanforderungen:Kenntnisse von literarischen Epochenbeziehungen und ihren allgemeinenCharakteristika; Fähigkeit, Texte verschiedener Epochen anhand von Merkmalenaufeinander zu beziehen; Fähigkeit, ausgewählte Epochenbeziehungen alsÄquivalenzen zu beschreiben und zu analysieren.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Matthias FreiseDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8113
Modul M.Russ.101b<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.101b: Interpretation literarischer Werke aus diachronerPerspektiveEnglish title: Interpreting Literary Works from a Diachronic PerspectiveLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden lernen die spezifischen Dialogformen zwischen literarischenEpochen kennen und werden in die Lage versetzt, anhand von Textvergleichen interneMechanismen der literarischen Entwicklung zu erkennen. Sie werden befähigt, diediachrone Dimension literarischer Texte durch Analyse zu erschließen. Sie werdenbefähigt, verschiedene literaturwissenschaftliche Diachroniemodelle vergleichend zubewerten.Lehrveranstaltung: Interpretation literarischer Werke aus diachroner Perspektive(Seminar)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Prüfungsanforderungen:Es ist ein diachroner Textvergleich anzufertigen, der zeigt, dass die zu prüfende PersonEpochen sowie ihre Äquivalenzen anhand von Texten erkennen und letztere in derTextanalyse anwenden kann.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Matthias FreiseDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8114
Modul M.Russ.101c<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.101c: Gattung oder EpocheEnglish title: Literary Form or EraLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zu vertiefter Textanalyse. Dabei lernensie, Gattungs- und Epochenmerkmale in ihrer jeweiligen Funktion im konkretenText zu bestimmen. Sie lernen über längere Zeiträume produktive Gattungen undTopoi der Literatur kennen und erschließen sich deren kulturelle Konstanz wie auchihren Funktionswandel. Sie werden in die Lage versetzt, die Rolle der Gattungs- undEpochenzugehörigkeit für die Interpretation in konkreten Beispielen zu bewerten. Sieerwerben die Fähigkeit, die Funktion von Gattungen für die Literatur allgemein zubeurteilen.Lehrveranstaltung: Gattung oder Epoche (Seminar)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Prüfungsanforderungen:Fähigkeit, an einem selbstgewählten Textbeispiel innerhalb einer detailliertenTextanalyse entweder Epochencharakteristika und ihre Funktionen für den Text zubestimmen oder Gattungscharakteristika sowie die Funktion der Gattungszugehörigkeitfür den gewählten Text darzulegenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jährlich nach Bedarf WiSe oder SoSeWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Matthias FreiseDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8115
Modul M.Russ.102a<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.102a: Semantik (Vorlesung)English title: Semantics (lecture)Lernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse zur Semantik natürlicherSprachen.Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:• den Terminus Semantik definieren und linguistische Semantik als Disziplinbestimmen;• verschiedene Bedeutungsauffassungen darstellen und auf dieser Grundlage einigeZugänge zur semantischen Theorie charakterisieren;• zwischen Sätzen und Äußerungen differenzieren und den Zusammenhangzwischen Semantik und Pragmatik erläutern;• verschiedene Ansätze zur Erfassung der Wortbedeutung darstellen und jeweilsderen Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen;• Klassen von Verben benennen, Klassifikationskriterien erläutern und dieKlassifikationen bewerten;• die Repräsentation der Bedeutung von Verben charakterisieren und dieNotwendigkeit einer besonderen Variablen für Ereignisse (bzw. Situationen)begründen;• Grundlagen und Regeln der semantischen Komposition darstellen und mit Hilfesprachlichen Materials illustrieren.Lehrveranstaltung: Semantik (Vorlesung)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 Stunden2 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen durch die Modulprüfung nach, dass sie über Kenntnisse zurSemantik natürlicher Sprachen verfügen. Sie können Semantik als linguistische Disziplinbestimmen und kennen• verschiedene Zugänge zur semantischen Theorie;• Ansätze zur Erfassung der Wortbedeutung (z.B. Dekomposition der Bedeutung,Stereotypensemantik, Prototypensemantik);• Verbklassen und Kriterien der Klassifikation;• die Analyse der Verbbedeutung mit Hilfe einer Ereignis- bzw. Situationsvariablen;• Regeln der semantischen Komposition.Die Studierenden sind imstande, konkrete sprachliche Ausdrücke (Verben, Phrasen,Sätze) zur Illustration semantischer Analysen anzuführen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Uwe Junghanns<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8116
Modul M.Russ.102aAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8117
Modul M.Russ.102b<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.102b: Historische Phonetik und MorphologieEnglish title: Slavic Historical Phonetics and MorphologyLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kennntisse zur Historischen Phonetik undMorphologie.Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:• Methoden der historischen Sprachwissenschaft benennen und sie inhaltlichcharakterisieren;• die wesentlichen Perioden der Geschichte der slavischen Sprachen nennen undbegründen;• Phonologie und Morphologie des Urslavischen charakterisieren;• spezifische Entwicklungen im phonologischen und morphologischen System desOst-, West- und Südslavischen darstellen.Lehrveranstaltung: Historische Phonetik und Morphologie (Seminar)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 Stunden2 SWSPrüfung: Klausur (45 Minuten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen durch die Modulprüfung nach, dass sie Kenntnisse zurHistorischen Phonetik und Morphologie besitzen. Sie kennen• Methoden der historischen Sprachwissenschaft;• die Periodisierung der Geschichte der slavischen Sprachen;• Phonologie und Morphologie des Urslavischen;• Entwicklungen von Lautsystem und Morphologie, die zur Differenzierung desUrslavischen und zur Entstehung slavischer Einzelsprachen geführt haben.Die Studierenden weisen nach, dass sie imstande sind, sprachliches Material imRahmen der historischen Lautlehre und Morphologie zu analysieren.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Uwe JunghannsDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2 - 4Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8118
Modul M.Russ.102c<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.102c: AltkirchenslavischEnglish title: Old Church SlavonicLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse zum Altkirchenslavischen.Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:• den Begriff des Altkirchenslavischen (Aksl.) bestimmen, die Bedeutung desAksl. für das Studium der slavischen Sprachen darstellen, Aksl. und Urslavischbegrifflich differenzieren;• das Korpus kanonischer Texte des Aksl. charakterisieren und zum Korpusgehörende Texte benennen.6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 StundenDie Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse zur historischen Lautlehre sowiezur Morphologie und Syntax des Aksl. Sie erwerben insbesondere die Fähigkeit, aksl.Texte zu lesen, zu analysieren und zu übersetzen.Lehrveranstaltung: Altkirchenslavisch (Seminar)2 SWSPrüfung: Klausur (45 Minuten)Prüfungsanforderungen:Die Studierenden weisen durch die Modulprüfung nach, dass sie Kenntnisse zumAltkirchenslavischen besitzen. Sie kennen• die begriffliche Unterscheidung von Urslavisch und Aksl.;• die Bedeutung des Aksl. für das Studium der slavischen Sprachen;• Kriterien für die Zugehörigkeit eines Textes zum aksl. Kanon.Die Studierenden weisen nach, dass sie imstande sind, aksl. Texte mit entsprechendenHilfsmitteln (Wortlisten resp. Wörterbücher) zu übersetzen. Die Studierendendemonstrieren insbesondere ihre Befähigung zu Analysen im Rahmen der historischenLautlehre sowie der Morphologie und Syntax des Aksl.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Uwe JunghannsDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2 - 4Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8119
Modul M.Russ.119<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.119: Fachdidaktik Russisch und schulische VermittlungskompetenzEnglish title: Teaching Methods in Russian and Skills for the ClassroomLernziele/Kompetenzen:Definiert in: Nds. MasterVO-Lehr, Anlage 3, Kompetenzbereich 5Die Studierenden erwerben insbesondere vertiefte Kenntnisse von Methoden derFachdidaktik des Russischen und die Fähigkeit, diese in der schulischen Praxisanwenden zu können.Lehrveranstaltung: Seminar zur Fachdidaktik des Russischen (Seminar)15 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:394 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten)Lehrveranstaltung: Vorbereitung und Auswertung des Schulpraktikums (Seminar)2 SWSPrüfung: Praktikumsbericht (max. 20 Seiten)Lehrveranstaltung: Fachpraktikum (5 Wochen)Prüfungsanforderungen:Nds. MasterVO-Lehr, Anlage 3, Kompetenzbereich 5, insbesondere der Nachweis vonKenntnissen der Methoden der Fachdidaktik des Russischen; Nachweis der Fähigkeit,diese Kenntnisse in der schulischen Praxis anwenden zu können.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, RussischAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:A. DeichmannDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:15<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8120
Modul M.Russ.128<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Russ.128: Sprachpraxismodul Russisch C1Lernziele/Kompetenzen:Definiert in: Nds. MasterVO-Lehr, Anlage 3, Kompetenzbereich 1Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studierenden aktive und passiveKenntnisse des Russischen auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen EuropäischenReferenzrahmens erworben. Sie können u.a.:8 C8 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:112 StundenSelbststudium:128 Stunden• ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen sowie impliziteBedeutungen erfassen;• sich spontan und fließend ausdrücken;• das Russische im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung undStudium wirksam und flexibel gebrauchen;• sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern;• dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.Nach Absolvierung des Moduls verfügen die Studierenden über kommunikative sowiegrammatische Kenntnisse der russischen Sprache, die ihnen deren weitestgehendkompetenten Gebrauch ermöglichen.Die Studierenden haben ferner landeswissenschaftliche Kenntnisse über Staatenerhalten, in denen das Russische Amtssprache ist. Durch die landeswissenschaftlicheKomponente der Ausbildung kennen die Studierenden insbesondere deren Geschichte,heutige politische Organisation, den Aufbau und die Funktionsweise ihrer zentralenInstitutionen, ihres Bildungs- und Gesundheitswesens, ihrer Wirtschaft sowie ihrerSozialsysteme. Ferner haben sich die Studierenden einen Überblick über nichtstaatlicheOrganisationen und kulturräumliche Voraussetzungen aneignen können.Lehrveranstaltungen:1. Russisch (B2+) (Sprachkurs)Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2. Russisch (C1) (Sprachkurs)Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester4 SWS4 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 30 Minuten)Prüfungsanforderungen:Definiert in: Nds. MasterVO-Lehr, Anlage 3, Kompetenzbereich 1Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden in mündlicher Form nach, dasssie die russische Sprache weitestgehend kompetent beherrschen (Niveau C1 desGemeinsamen Europäischen Referenzrahmens). Sie weisen u.a. nach, dass sieanspruchsvolle längere Texte verstehen sowie implizite Bedeutungen erfassen,sich spontan, fließend, flexibel und wirksam ausdrücken und sich klar, strukturiertund ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern können. Ferner zeigen dieStudierenden, dass sie landeswissenschaftliche Kenntnisse über Staaten besitzen, indenen das Russische Amtssprache ist.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8121
Modul M.Russ.128Zugangsvoraussetzungen:B.Russ.125 bzw. Russischkenntnisse auf Niveau B2(GER) oder äquivalentSprache:RussischAngebotshäufigkeit:keine AngabeWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Dr. Olga LiebichDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 4Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8122
Modul M.Soz.MEd-500<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Soz.MEd-500: KultursoziologieEnglish title: Cultural SociologyLernziele/Kompetenzen:Das Modul „Kultursoziologie" führt an aktuelle Forschungsfragen der Kultur-soziologieheran; Kultursoziologie wird dabei sowohl als allgemeine Theorie-perspektive als auchim engeren Sinne als spezielle Soziologie verstanden, die sich auf Phänomene wieReligion, Ethnizität, Sprache, Wissen und Le-bensstile erstreckt. Die Studierenden desLehramts erlernen u.a. Methoden der Deutung und Erklärung kultureller Vorstellungen.Insbesondere das Ver-hältnis von Werten, Identitäten und Gesellschaft wird näherbeleuchtet. Ein erstes Lernziel des Moduls ist daher die Vermittlung von Kenntnissenneuerer theoretischer Entwicklungen in der Kultursoziologie, die einerseits dieAnalyse der sozialen Bestimmungsfaktoren von Kultur („sociology of culture") undandererseits die Analyse des kausalen Einflusses von Kultur auf soziales Handeln,Beziehungen und Ordnungen („cultural sociology") umfassen. Ein zweites Lernzielbesteht in der vertieften exemplarischen Erschließung spezieller kultursoziologischerForschungsfelder; die Studierenden sollen dabei insbesondere empirische Kenntnissein den Forschungsfeldern Religion und Säkularisierung bzw. Migration und Ethnizitäterwerben und dazu befähigt werden, hier eigenständige Forschungsfragen zuentwickeln.7 C5 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:70 StundenSelbststudium:140 StundenDas Modul gliedert sich in drei Veranstaltungen. In einem Seminar wird unterBerücksichtigung neuerer Entwicklungen der Kultursoziologie an den aktuellenForschungsstand der Religionssoziologie bzw. der Soziologie der Migration undEthnizität herangeführt. Im 2. Seminar werden ausgewählte For-schungsarbeitenexemplarisch diskutiert; im 3. Seminar werden diese auf Fragestellungen im Werte undNormen Unterricht bezogen und reflektiert.Lehrveranstaltungen:1. Seminar zur Migrations- und Religionssoziologie 2 SWS2. Migrations- und Religionssoziologie - Vertiefung (Seminar) 1 SWS3. Reflektionen im 'Werte und Normen'-Unterricht (Seminar) 2 SWSPrüfung: Referat (ca. 20 Min.) mit ModerationPrüfungsanforderungen:Kenntnisse neuerer theoretischer Entwicklungen in der Kultursoziologie, die einerseitsdie Analyse der sozialen Bestimmungsfaktoren von Kultur („sociology of culture") undandererseits die Analyse des kausalen Einflusses von Kultur auf soziales Handeln,Beziehungen und Ordnungen („cultural sociology") umfassen; vertiefte exemplarischeErschließung spezieller kultursoziologischer Forschungsfelder; die Studierendenverfügen insbesondere über empirische Kenntnisse in den Forschungsfeldern Religionund Säkularisierung bzw. Migration und Ethnizität und sind fähig eigenständigeForschungsfragen zu entwickeln.Reflektion der erarbeiteten theoretischen Themenfelder auf Unterrichtssituation in Werteund Normen.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8123
Modul M.Soz.MEd-500Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Matthias KoenigProf. Dr. Claudia DiehlDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8124
Modul M.Spa.L-302<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spa.L-302: Vertiefungsmodul FachwissenschaftenEnglish title: Advanced Topics in SpanishLernziele/Kompetenzen:Ausgewählte Probleme und Methoden der spanischen Sprach-, Literatur- oderLandeswissenschaft: Vertiefung und Verbreiterung der fachwissenschaftlichenKenntnisse in zwei der Teilbereiche Sprach-, Literatur- oder Landeswissenschaft.Bearbeitung monographischer Themen unter kritischer Reflexion desForschungsstandes. Die Studierenden können fachwissenschaftliche undunterrichtsrelevante Aspekte miteinander verbinden und didaktische Entscheidungentheoriegeleitet für die Praxis formulieren und dies in wissenschaftlich angemessenerForm darstellen.8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:56 StundenSelbststudium:184 StundenLehrveranstaltungen:1. Masterseminar Sprachwissenschaft 2 SWS2. Masterseminar Literaturwissenschaft 2 SWS3. Masterseminar LandeswissenschaftEs sind zwei der genannten Lehrveranstaltungen zu absolvieren.2 SWSPrüfung: Klausur (90 Minuten)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive Teilnahme; Referat (ca. 30 Min.) in demjenigen Seminar, in demnicht die Klausur geschrieben wirdPrüfungsanforderungen:Sprachwissenschaft: Die Studierenden beschreiben und analysieren die spanischeGegenwartssprache theoriegeleitet und methodisch, beschreiben und reflektierenwesentliche Funktionen, Strukturen und Regeln, verstehen und reflektieren die Rolle derFremd- und Muttersprache in der internationalen und interkulturellen Kommunikation.Literaturwissenschaft: Die Studierenden analysieren Texte und audiovisuelle Werkeaus Spanien und Hispanoamerika methodisch angemessen und begrifflich korrekt,ordnen sie in ihre spezifischen historischen Kontexte ein, beschreiben, analysierenund bewerten sie im Rahmen ihrer jeweiligen Produktions-, Distributions- undRezeptionszusammenhänge.Landeswissenschaft: Die Studierenden reflektieren geschichts-, kultur-, politik-, sozialundwirtschaftswissenschaftliche Aspekte Spaniens und Hispanoamerikas, erkennenmultikulturelle Zusammenhänge und entwickeln Problembewusstsein im Umgang mitfremdkulturellen Phänomenen.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Spanisch, DeutschAngebotshäufigkeit:Empfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Tobias BrandenbergerDauer:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8125
Modul M.Spa.L-302jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimalig1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8126
Modul M.Spa.L-303<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spa.L-303: Fachdidaktik des Spanischen (mit 5-wöchigemFachpraktikum)English title: Teaching Methodology Spanish (including a five-week subject-basedpractical training)Lernziele/Kompetenzen:Einübung in fachspezifische Unterrichtsplanung: Auswahl und Begründung von Themenund Texten; Formulierung von Lernzielen; Auswahl und Strukturierung von Materialien;Wahl geeigneter Methoden, Sozial- und Kommunikationsformen; Initiierung undFörderung interkultureller Lernprozesse; Dokumentation, Präsentation und Evaluationvon Unterrichtsergebnissen; Reflexion von eigenen Unterrichtserfahrungen (aus demPraktikum).Lehrveranstaltungen:1. Grundlagen der Unterrichtsplanung(Vorlesung oder Übung)11 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:204 StundenSelbststudium:126 Stunden2 SWS2. Begleitseminar zur Vor- und Nachbereitung des Fachpraktikums Spanisch 4 SWS3. Fachpraktikum (5 Wochen)Prüfung: Praktikumsbericht (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige aktive Teilnahme an 1. (Übung) und 2.; Unterrichtsentwurf in 1.;erfolgreiche Teilnahme an 3.Prüfungsanforderungen:Auswahl und Begründung von Themen und Texten; Formulierung von Lernzielen;Auswahl und Strukturierung von Materialien; Wahl geeigneter Methoden, SozialundKommunikationsformen; Initiierung und Förderung interkultureller Lernprozesse;Dokumentation, Präsentation und Evaluation von Unterrichtsergebnissen; Reflexion voneigenen Unterrichtserfahrungen (aus dem Praktikum).Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, SpanischAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Dr. phil. Birgit SchädlichDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 2Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8127
Modul M.Spa.L-304<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spa.L-304: Fachdidaktik des Spanischen (mit 4-wöchigemForschungspraktikum)English title: Teaching Methodology Spanish (including a four-week research-basedpractical training)Lernziele/Kompetenzen:Beobachtung und Analyse von Spanischunterricht, d.h. schulischerVermittlungsprozesse in Bezug auf die spanische Sprache, Literatur und Kultur nachallgemein- und fachdidaktischen Kategorien. Entwicklung von Kompetenzen zurempirisch arbeitenden Sprachlehrforschung, zur fachdidaktischen Forschung in denBereichen Sprache, Literatur, Medien und Kultur sowie zur Lehrerhandlungsforschung.Lehrveranstaltungen:1. Grundlagen der Unterrichtsplanung(Vorlesung oder Übung)11 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:176 StundenSelbststudium:154 Stunden2 SWS2. Begleitseminar zum Forschungspraktikum Spanisch 2 SWS3. Forschungspraktikum (4 Wochen)Prüfung: Praktikumsbericht (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:Regelmäßige aktive Teilnahme an 1. (Übung) und 2.; Unterrichtsentwurf in 1.;erfolgreiche Teilnahme an 3.Prüfungsanforderungen:Kenntnis über schulische Vermittlungsprozesse in Bezug auf die spanische Sprache,Literatur und Kultur nach allgemein- und fachdidaktischen Kategorien. Entwicklung vonKompetenzen zur empirisch arbeitenden Sprachlehrforschung, zur fachdidaktischenForschung in den Bereichen Sprache, Literatur, Medien und Kultur sowie zurLehrerhandlungsforschung.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Deutsch, SpanischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Dr. phil. Birgit SchädlichDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:120<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8128
Modul M.Spa.L-305<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spa.L-305: Fachdidaktik des Spanischen (Vertiefung)English title: Teaching Methodology Spanish (advanced module)Lernziele/Kompetenzen:Kenntnis und Reflexion von Fragestellungen, Methoden und Erträgen fachdidaktischerForschung (aktuelle, empirische und historische Modelle der Sprach-, Literatur- undKulturvermittlung, Medien-Methodenkonzepte, Kompetenzmodelle, Lernförderung,Steuerung von Lernprozessen, Leistungsfeststellung und -bewertung).Lehrveranstaltung: Seminar zur spanischen Fachdidaktik4 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:92 Stunden2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 4000 Wörter)Prüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive TeilnahmePrüfungsanforderungen:Kenntnis und Reflexion von Fragestellungen, Methoden und Erträgen fachdidaktischerForschung (aktuelle, empirische und historische Modelle der Sprach-, Literatur- undKulturvermittlung, Medien-Methodenkonzepte, Kompetenzmodelle, Lernförderung,Steuerung von Lernprozessen, Leistungsfeststellung und -bewertung).Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:Spanisch, DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Jun.-Prof. Dr. phil. Birgit SchädlichDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:1 - 3Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 81<strong>29</strong>
Modul M.Spo-MEd.100<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spo-MEd.100: Sportunterricht analysieren und inszenierenLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden- sind in der Lage, sportunterrichtliche Lehr-Lernprozesse vor dem Hintergrund einesfundierten (sport)pädagogischen und fachdidaktischen Wissens zu analysieren- kennen den fachwissenschaftlichen Diskurs zur Situation des Sportunterrichts9 C6 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:63 StundenSelbststudium:207 Stunden- besitzen vertiefte Kenntnisse über die für den Sportunterricht wesentlichen ‚Elemente’und ihrer Beziehung zueinander und können Sport- und Bewegungsangeboteangemessen, zweckmäßig und folgerichtig planen,- können ‚Unterrichtsstörungen‘ im Sport hinsichtlich ihrer Bedingungsstrukturen,auslösenden Faktoren etc. interpretieren,- können das Sportlehrer/innen- und Schüler/innenverhalten unter Berücksichtigung derRahmenbedingungen, jeweiligen Perspektiven sowie durch Explikation der normativenErwartungen begründet werten,- können sportunterrichtliche Angebote adressatengerecht inszenieren und das eigeneHandeln kritisch reflektieren,- sind in der Lage, ausgewählte sportmotorische Aufgaben in der Eigenrealisation zubewältigen, das Sportangebot unter interdisziplinär-sportwissenschaftlicher Perspektivezu analysierenLehrveranstaltung: 1a. Seminar: Sportunterricht didaktisch analysierenAngebotshäufigkeit: jedes Sommersemester2 SWSPrüfung: Mündlich (ca. 20 Minuten)Lehrveranstaltungen:1. 1b. Seminar mit Übung: Sportunterricht inszenierenAngebotshäufigkeit: jedes Sommersemester2. c Übung: Theorie und Praxis der Sportarten (Vertiefungsniveau)Angebotshäufigkeit: jedes Semester2 SWS2 SWSPrüfungsanforderungen:Kenntnis von- der Interdependenz der für den Sportunterricht wesentlichen ‚Sachverhalte’ (Ziele,Methoden, Inhalte, Organisationsformen etc.)- mehrperspektivischen Analyseverfahren von Sportunterricht- Planungsschritten im Kontext von Sportunterrichtsvorbereitung- zweckmäßigen und angemessenen Gestaltungsmöglichkeiten von Lehr/Lernsituationen Studierende sind in der Lage, sportmotorische Aufgaben zu bewältigenund das Sportangebot unter interdisziplinär- sportwissenschaftlicher Perspektive zuanalysieren<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8130
Modul M.Spo-MEd.100Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:1a/b. jedes Sommersemester c. jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Ina HungerDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30Bemerkungen:Im Studiengang "Master of Education" werden 2 C dem Kompetenzbereich Fachwissenschaft zugerechnet.<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8131
Modul M.Spo-MEd.200<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spo-MEd.200: Betreutes Fachpraktikum SportLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden- kennen fachdidaktische Konzepte, Lehrpläne des Faches Sport etc. und können- unter Berücksichtigung der interdisziplinären Erkenntnisse der Sportwissenschaft- Sportunterricht didaktisch fundiert planen8 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:21 StundenSelbststudium:219 Stunden- sind in der Lage, sportunterrichtliche Lehr-Lernprozesse didaktisch eigenverantwortlichzu initiieren und durchzuführen- können das eigene unterrichtliche Handeln kritisch reflektieren und Unterrichtevaluieren- können Erkenntnisse aus der Unterrichtsauswertung konstruktiv für weitereUnterrichtsplanungen einbringen- können die im Praktikum gesammelten Erfahrungen im Hinblick auf die eigeneBerufsperspektive reflexiv auswertenLehrveranstaltungen:1. Vor- und Nachbereitungsseminar des Fachpraktikums Sport 2 SWS2. Fachpraktikum (5 Wochen)Prüfung: Praktikumsbericht (max. 15 Seiten)Prüfungsvorleistungen:Erfolgreiche Teilnahme am PraktikumPrüfungsanforderungen:Kenntnis von- didaktischen Sportunterrichtskonzepten- unterschiedlichen Lerntheorien- rechtlichen, pädagogischen, curricularen Rahmenbedingungen des Sportunterrichts/- fachgerechter Aufbereitung von sportunterrichtlichen Inhalten - Instrumenten zurSportunterrichtsevaluationZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Ina HungerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8132
Modul M.Spo-MEd.200Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8133
Modul M.Spo-MEd.300<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spo-MEd.300: Betreutes Forschungspraktikum SportLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden- sind in der Lage ausgewählte Forschungskonzeptionen kritisch zu reflektieren undForschungsergebnisse evidenzbasiert zu analysieren,- sind in der Lage Forschungsfragen zu entwickeln und kleinere empirische Arbeiten ineinem sportpädagogischen Kontext durchzuführen,8 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:21 StundenSelbststudium:219 Stunden- können mit Hilfe ausgewählter Forschungsmethoden einen Beitrag zur empirischenErforschung ausgewählter sportpädagogischer Handlungsfelder leisten,- sind in der Lage, die Praxis schulischer und außerschulischer Sport- undBewegungsangebote fundiert zu analysieren und konstruktiv weiterzuentwickelnLehrveranstaltungen:1. Seminar: Empirische Analysen des Kinder-, Jugend- und Schulsports 2 SWS2. Forschungspraktikum (4 Wochen)Prüfung: Forschungsbericht (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnis von- qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden und ihren theoretischenGrundlegungen- forschungsstrategischen Vorgehen in der Forschungspraxis- der ‚Logik des Alltagshandelns’ in unterschiedlichen sportpädagogischen Settings- den theoretischen Konzeptionen ausgewählter Handlungsfelder im SportZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Ina HungerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:20<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8134
Modul M.Spo-MEd.400<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spo-MEd.400: (Schul-)Sport im Kontext von Erziehung undGesellschaftLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden- sind mit ausgewählten sportpädagogischen und sportsoziologischenProblemstellungen von (Schul-)Sport (z.B. Gender-Thematik, Außenseiter in Sport,Sportszenen, Doping) und den jeweiligen Diskursen vertraut und können daraus kritischkonstruktivKonsequenzen für den Schulsport ziehen,6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:42 StundenSelbststudium:138 Stunden- verfügen über spezialisierte Kenntnisse zum Thema „Erziehung im Sportund Erziehung durch Sport“ und haben ein fundiertes Wissen im Bereich der„körpertheoretischen Ansätze“ erworben,- können sportpädagogische und –soziologische Forschungsfragen entwickelnund Forschungsdesigns entwerfen - haben einen Überblick über die jüngeresportpädagogische und sportsoziologische Forschungsliteratur erworben und könnendiese Forschungsergebnisse angemessen interpretierenLehrveranstaltungen:1. Seminar: Ausgewählte sportpädagogische Fragestellungen 2 SWS2. Seminar: Ausgewählte sportsoziologische Fragestellungen 2 SWSPrüfung: Referat (ca. 45 Minuten) mit Handout (max. 6 S.) oder Hausarbeit (max.15 Seiten) in einem der SeminarePrüfungsanforderungen:Kenntnis von- ausgewählten sportpädagogischen und sportsoziologischen Problemstellungen des(Schul-)Sports (z.B. Gender) und den jeweiligen, aktuellen wissenschaftlichen Diskursen- theoretischen Grundlegungen zu den Rahmenthemen „Erziehung im Sport undErziehung durch Sport“, „Körper- und Bewegungssozialisation“ und „körpertheoretischeAnsätzen“Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Ina HungerDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:40<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8135
Modul M.Spo-MEd.500<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.Spo-MEd.500: (Schul-)Sport im Kontext von Gesundheitund TrainingLernziele/Kompetenzen:Die Studierenden- verfügen über einen Überblick über die aktuelle Forschungsliteratur im Bereich‚Training und Bewegung’ in schulischem und außerschulischem Kontext und könnendiese Forschungsergebnisse angemessen interpretieren,6 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:42 StundenSelbststudium:138 Stunden- kennen die trainingswissenschaftlichen Grundlagen für Planung und Durchführungsportiver Angebote in verschiedenen Settings,- sind in der Lage, schulische und außerschulische Sport- und Bewegungsangeboteunter trainings- und bewegungswissenschaftlicher Perspektive fundiert zu analysieren,- können trainings- und bewegungswissenschaftliche Forschungsdesigns erstellen undevaluieren,- verfügen über einen Überblick über die aktuelle Forschungsliteratur im Bereich ‚Sportund Gesundheit’ in schulischem und außerschulischem Kontext und können dieseForschungsergebnisse angemessen interpretieren,- sind in der Lage, schulische und außerschulische Sport- und Bewegungsangeboteunter sportmedizinischer Perspektive fundiert zu analysieren, - sind mit ausgewähltensportmedizinischen Problemstellungen im Bereich des schulischen undaußerschulischen Kontext vertraut.Lehrveranstaltungen:1. Seminar: Gesundheitsförderung durch Sport und BewegungAngebotshäufigkeit: jedes Wintersemester2. Seminar: Ausgewählte trainings- und bewegungswissenschaftlicheFragestellungenAngebotshäufigkeit: jedes Sommersemester2 SWS2 SWSPrüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsanforderungen:Kenntnis von- motorischer Entwicklung und Lebenslauf- Gesundheitserziehung im Sport- grundlegenden sportmedizinischen, trainings- und bewegungswissenschaftlichenForschungsmethodenZugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. med. et Dr. rer Andree Niklas<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8136
Modul M.Spo-MEd.500Angebotshäufigkeit:keine AngabeWiederholbarkeit:zweimaligDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:40<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8137
Modul M.WuN.11<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.WuN.11: Aufbaumodul FachdidaktikEnglish title: Advanced Teaching MethodsLernziele/Kompetenzen:- Aufbereitung fachwissenschaftlicher Sachverhalte, Fragen und Methoden Inhalte unterdidaktischen Gesichtspunkten; Erarbeiten ethischer Fragestellungen und Positionen mitBlick auf ihre Vermittlung in der Schule; Reflexion des Verhältnisse des Schulfaches„Werte und Normen“ zu anderen Schulfächern;7 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:182 Stunden- Kenntnis der rechtlichen / institutionellen Rahmenbedingungen des „Werte undNormen“-Unterrichts;- Kenntnis allgemeiner und philosophiebezogener Didaktiken;- Reflexion der aus klassischen Didaktikansätzen bekannten Modelle auf die Möglichkeitder Verwendung für praktisch-philosophische Zusammenhänge sowie Vermittlung derSache angemessener didaktischer Kompetenzen;- Kenntnis besonders für den Ethikunterricht geeigneter Methoden und Sozialformen;- Exemplarische Erarbeitung und Planung einer Unterrichtsstunde;- Exemplarische Erarbeitung und Planung einer Unterrichtseinheit;- Exemplarische Erarbeitung und Planung eines Unterrichtshalbjahres;- Fähigkeit zu eigenständiger Textarbeit und kritischer Beurteilung philosophischerBegründungen;- Reflexion des Lehrerberufes und den speziellen Anforderungen an die Lehrerinnenund Lehrer des Faches „Werte und Normen“Lehrveranstaltung: Fachdidaktisches Seminar (Vertiefung)2 SWSPrüfung: Praktische Prüfung ( Präsentation und Duchführung einerSeminarsitzung) und Hausarbeit (max. 15 S.)Prüfungsanforderungen:1. Präsentation und Durchführung einer Seminarsitzung in Form einerUnterrichtssequenz unter Berücksichtigung der jeweils aktuell geltendenRahmenrichtlinien / EPA / Curricula;2. Hausarbeit: schriftliche Dokumentation und Erörterung der präsentierten unddurchgeführten Unterrichtssequenz.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes WintersemesterWiederholbarkeit:Empfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd LudwigDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8138
Modul M.WuN.11zweimaligMaximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8139
Modul M.WuN.12<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul M.WuN.12: Praxismodul FachdidaktikEnglish title: Educational PracticeLernziele/Kompetenzen:- Praktische Anwendung und Vertiefung der bereits erworbenen fachdidaktischenKompetenzen im Schulbereich;- Kenntnis von Aufbau und Inhalt der curricularen Vorgaben des Unterrichtsfaches„Werte und Normen";8 C4 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:176 StundenSelbststudium:64 Stunden- Kenntnis der in den Bundesländern für den Unterricht zugelassenen Schulbücher,ihres Aufbaus und ihrer Inhalte, Kenntnis sonstiger Lehr- und Lernmaterialien;- Kriterien- und adressatengerechte Konzeption von Aufgabenstellungen;- Kenntnis der Möglichkeiten der Vermittlung von Methoden des selbstbestimmten /eigenverantwortlichen / kooperativen Lernens und Arbeitens an Schülerinnen undSchüler;- Vertiefte Reflexion besonders für den Ethikunterricht geeigneter Methoden undSozialformen;- Kenntnis und Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Medien/moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht;- Reflexion der Ergebnisse der fachdidaktischen Forschung auf pädagogisches Handeln;- Reflexion von Möglichkeiten der Leistungsmessung und -bewertung im Fach „Werteund Normen";- Kenntnis und Reflexion der wichtigsten Techniken der Gesprächsführung im Unterricht;- Reflexion von Lernstrategien, Lernmethoden, Lehrmethoden für den Ethikunterricht;- Exemplarische Erarbeitung und Planung einer Unterrichtsstunde (Kurzentwurf),Präsentation im Seminar; Exemplarische Erarbeitung und Planung einerUnterrichtseinheit, Präsentation im Seminar;- Exemplarische Erarbeitung und Planung eines Unterrichtshalbjahres, Präsentation imSeminar; Fähigkeit zur Analyse von Unterricht (Unterrichtsbeobachtung);Lehrveranstaltungen:1. Vorbereitung des Fachpraktikums (Seminar)2. Fachpraktikum3. Nachbereitung des Fachpraktikums (Seminar)Prüfung: Hausarbeit (max. 15 Seiten)Prüfungsvorleistungen:erfolgreiche Teilnahme am FachpraktikumPrüfungsanforderungen:- Planung einer Unterrichtsstunde im Zusammenhang a) einer Unterrichtseinheit, b)eines Schulhalbjahres;<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8140
Modul M.WuN.12- Analyse und Dokumentation des besuchten Unterrichts (anhand ausgewählter Kriteriendes Beobachtungsbogens);- Analyse und Dokumentation einer ausgewählten, eigenständig durchgeführtenUnterrichtsstunde in Form eines ausführlichen Unterrichtsentwurfes nach Maßgabeniedersächsischer Studienseminare;- Übergreifende, persönliche Stellung-nahme/Reflexion zu den Ergebnissen undErfahrungen des Praktikums.Zugangsvoraussetzungen:keineSprache:DeutschAngebotshäufigkeit:jedes SommersemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Bernd LudwigDauer:2 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:2 - 3Maximale Studierendenzahl:25<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8141
Modul SK.EP.E10M<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.EP.E10M: Interkulturelle Kompetenzen (A): <strong>Universität</strong>sbezogenEnglish title: Intercultural Skills: Studying abroadLernziele/Kompetenzen:Erwerb grundlegender interkultureller Kompetenzen im Hinblick auf dasZielsprachenland (z.B. Umgangsformen und Lebensweisen); Erwerb vertieftersprachpraktischer Kompetenzen im Hinblick auf die Zielsprache; Vertiefung von SozialundSelbstkompetenzen; Vertiefung von fachwissenschaftlichen Kompetenzen durch einAuslandsstudium im englischsprachigen Ausland (Dauer: mind. 3 Monate)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 StundenLehrveranstaltungen:1. Independent Study während des mind. 3-monatigen Auslandsstudiums2. Begleitseminar zum Auslandsaufenthalt 2 SWSPrüfung: Erfahrungsbericht (max. 3000 Wörter), unbenotetPrüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive Teilnahme mit nicht mehr als zwei entschuldigten FehlsitzungenPrüfungsanforderungen:Nachweis interkultureller Kompetenzen und deren ReflexionsfähigkeitZugangsvoraussetzungen:keineSprache:EnglischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Carola SurkampDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8142
Modul SK.EP.E11M<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.EP.E11M: Interkulturelle Kompetenzen (B): SchulbezogenEnglish title: Intercultural Skills: Teaching abroadLernziele/Kompetenzen:Erwerb grundlegender interkultureller Kompetenzen im Hinblick auf dasZielsprachenland (z.B. Umgangsformen und Lebensweisen); Erwerb vertieftersprachpraktischer Kompetenzen im Hinblick auf die Zielsprache; Vertiefung vonSozial- und Selbstkompetenzen; Vertiefung von fachspezifischen und fachdidaktischenKompetenzen durch Transfer an fremdkulturelle Schulen und Erwerb neuerfachdidaktischer Konzepte im Rahmen einer Assistant Teacher-Tätigkeit (Dauer: mind. 3Monate)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 StundenLehrveranstaltungen:1. Begleitseminar zum Auslandsaufenthalt 2 SWS2. Independent Study während des mind. 3-monatigen AuslandsaufenthaltsPrüfung: Erfahrungsbericht (max. 3000 Wörter), unbenotetPrüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive Teilnahme mit nicht mehr als zwei entschuldigten FehlsitzungenPrüfungsanforderungen:Nachweis interkultureller Kompetenzen und deren ReflexionsfähigkeitZugangsvoraussetzungen:keineSprache:EnglischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Carola SurkampDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8143
Modul SK.EP.E12M<strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> GöttingenModul SK.EP.E12M: Interkulturelle Kompetenzen (C): PraktikumsbezogenEnglish title: Intercultural Skills: Internship abroadLernziele/Kompetenzen:Erwerb grundlegender interkultureller Kompetenzen im Hinblick auf dasZielsprachenland (z.B. Umgangsformen und Lebensweisen); Erwerb vertieftersprachpraktischer Kompetenzen im Hinblick auf die Zielsprache; Vertiefung von SozialundSelbstkompetenzen; Erwerb grundlegender bzw. vertiefter berufsbezogenerKompetenzen durch ein Auslandspraktikum im englischsprachigen Ausland (Dauer:mind. 3 Monate)6 C2 SWSArbeitsaufwand:Präsenzzeit:28 StundenSelbststudium:152 StundenLehrveranstaltungen:1. Begleitseminar zum Auslandsaufenthalt 2 SWS2. Independent Study während des mind. 3-monatigen AuslandspraktikumsPrüfung: Erfahrungsbericht (max. 3000 Wörter), unbenotetPrüfungsvorleistungen:regelmäßige aktive Teilnahme mit nicht mehr als zwei entschuldigten FehlsitzungenPrüfungsanforderungen:Nachweis interkultureller Kompetenzen und deren ReflexionsfähigkeitZugangsvoraussetzungen:keineSprache:EnglischAngebotshäufigkeit:jedes SemesterWiederholbarkeit:zweimaligEmpfohlene Vorkenntnisse:keineModulverantwortliche[r]:Prof. Dr. Carola SurkampDauer:1 SemesterEmpfohlenes Fachsemester:Maximale Studierendenzahl:30<strong>Amtliche</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>II</strong> der <strong>Georg</strong>-<strong>August</strong>-<strong>Universität</strong> Göttingen vom 30.11.2012/Nr. <strong>29</strong> V3-WiSe12/13 Seite 8144