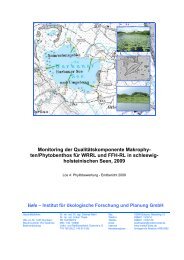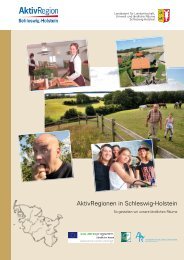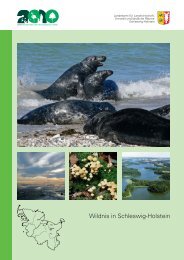Somatochlora metallica - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Somatochlora metallica - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Somatochlora metallica - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort 3<br />
Einleitung 4<br />
Danksagung 5<br />
Material <strong>und</strong> Methode 6<br />
Charakterisierung der Naturräume Schleswig-Holsteins 9<br />
Verbreitung der Arten 11<br />
Gebänderte Prachtlibelle - Calopteryx splendens (HARRIS 1782) 12<br />
Blauflügel-Prachtlibelle - Calopteryx virgo (LINNAEUS 1758) 14<br />
Gemeine Winterlibelle - Sympecma fusca (VAN DER LINDEN 1820) 16<br />
Sibirische Winterlibelle - Sympecma paedisca (BRAUER 1882) 18<br />
Südliche Binsenjungfer - Lestes barbarus (FABRICIUS 1798) 20<br />
Glänzende Binsenjungfer - Lestes dryas (KIRBY 1890) 22<br />
Gemeine Binsenjungfer - Lestes sponsa (HANSEMANN 1823) 24<br />
Kleine Binsenjungfer - Lestes virens (CHARPENTIER 1825) 26<br />
Weidenjungfer - Lestes viridis (VAN DER LINDEN 1825) 28<br />
Federlibelle - Platycnemis pennipes (PALLAS 1771) 30<br />
Frühe Adonislibelle - Pyrrhosoma nymphula (SULZER 1776) 32<br />
Gemeine Pechlibelle - Ischnura elegans (VAN DER LINDEN 1820) 34<br />
Kleine Pechlibelle - Ischnura pumilio (CHARPENTIER 1825) 36<br />
Hauben-Azurjungfer - Coenagrion armatum (CHARPENTIER 1825) 38<br />
Speer-Azurjungfer - Coenagrion hastulatum (CHARPENTIER 1825) 40<br />
Mond-Azurjungfer - Coenagrion lunulatum (CHARPENTIER 1840) 42<br />
Helm-Azurjungfer - Coenagrion mercuriale (CHARPENTIER 1840) 44<br />
Hufeisen-Azurjungfer - Coenagrion puella (LINNAEUS 1758) 46<br />
Fledermaus-Azurjungfer - Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN 1825) 48<br />
Becher-Azurjungfer - Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER 1840) 50<br />
Großes Granatauge - Erythromma najas (HANSEMANN 1823) 52<br />
Kleines Granatauge - Erythromma viridulum (CHARPENTIER 1840) 54<br />
Späte Adonislibelle - Ceriagrion tenellum (DE VILLERS 1789) 56<br />
Zwerglibelle - Nehalennia speciosa (CHARPENTIER 1840) 58<br />
Asiatische Keiljungfer - Gomphus flavipes (CHARPENTIER 1825) 60<br />
Westliche Keiljungfer - Gomphus pulchellus (SELYS 1840) 62<br />
Gemeine Flußjungfer - Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS 1758) 64<br />
Grüne Keiljungfer - Ophiogomphus cecilia (FOURCROY 1785) 66<br />
Kleine Mosaikjungfer - Brachytron pratense (MULLER 1764) 68<br />
Südliche Mosaikjungfer - Aeshna affinis (VAN DER LINDEN 1820) 70<br />
Blaugrüne Mosaikjungfer - Aeshna cyanea (MULLER 1764) 72<br />
Braune Mosaikjungfer - Aeshna grandis (LINNAEUS 1758) 74<br />
Keilflecklibelle - Aeshna isosceles (MULLER 1767) 76<br />
Torf-Mosaikjungfer - Aeshna juncea (LINNAEUS 1758) 78<br />
Herbst-Mosaikjungfer - Aeshna mixta (LATREILLE 1805) 80<br />
Hochmoor-Mosaikjungfer - Aeshna subarctica (WALKER 1908) 82<br />
Grüne Mosaikjungfer - Aeshna viridis (EVERSMANN 1836) 84<br />
Schabrackenlibelle - Hemianax ephippiger (BURMEISTER 1839) 86<br />
Große Königslibelle - Anax Imperator (LEACH 1815) 88<br />
Kleine Königslibelle - Anax parthenope (SELYS 1839) 90<br />
Zweigestreifte Quelljungfer - Cordulegaster boltonii (DONOVAN 1807) 92<br />
Gemeine Smaragdlibelle - Cordulia aenea (LINNAEUS 1758) 94<br />
Zweifleck - Epitheca bimaculata (CHARPENTIER 1825) 96<br />
Arktische Smaragdlibelle - <strong>Somatochlora</strong> arctica (ZETTERSTEDT 1840) 98<br />
Gefleckte Smaragdlibelle - <strong>Somatochlora</strong> flavomaculata (VAN DER LINDEN 1825) .... 100
Glänzende Smaragdlibelle - <strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong> (VAN DER LINDEN 1825) 102<br />
Plattbauch - Libellula depressa (LINNAEUS 1758) 104<br />
Spitzenfleck - Libellula fulva (MULLER 1764) 106<br />
Vierfleck - Libellula quadrimaculata (LINNAEUS 1758) 108<br />
Südlicher Blaupfeil - Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE 1837) 110<br />
Großer Blaupfeil - Orthetrum cancellatum (LINNAEUS 1758) 112<br />
Kleiner Blaupfeil - Orthetrum coerulescens (FABRICIUS 1798) 114<br />
Schwarze Heidelibelle - Sympetrum danae (SULZER 1776) 116<br />
Gefleckte Heidelibelle - Sympetrum flaveolum (LINNAEUS 1758) 118<br />
Frühe Heidelibelle - Sympetrum fonscolombei (SELYS 1840) 120<br />
Südliche Heidelibelle - Sympetrum meridionale (SELYS 1841) 122<br />
Gebänderte Heidelibelle - Sympetrum pedemontanum (ALLIONI 1766) 124<br />
Blutrote Heidelibelle - Sympetrum sanguineum (MÜLLER 1764) 126<br />
Große Heidelibelle - Sympetrum striolatum (CHARPENTIER 1840) 128<br />
Gemeine Heidelibelle - Sympetrum vulgatum (LINNAEUS 1758) 130<br />
Östliche Moosjungfer - Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER 1839) 132<br />
Zierliche Moosjungfer - Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER 1840) 134<br />
Kleine Moosjungfer - Leucorrhinia dubia (VAN DER LINDEN 1825) 136<br />
Große Moosjungfer - Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER 1825) 138<br />
Nordische Moosjungfer - Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a (LINNAEUS 1758) 140<br />
Naturräumliche Verteilung der Arten 142<br />
Bilanz <strong>und</strong> Diskussion 144<br />
Ausblick 157<br />
Empfehlungen zur Erfassungsmethode <strong>und</strong> Meldebogen 158<br />
Zusammenfassung 160<br />
Summary<br />
Sammenfatning 162<br />
Literatur 163<br />
Glossar 173<br />
Anschriften der Verfasser 177<br />
161
Vorwort<br />
Mit dem Atlas der Libellen Schleswig-<br />
Holsteins legt das <strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong> Natur<br />
<strong>und</strong> <strong>Umwelt</strong> Schleswig-Holstein (LANU)<br />
nach den Verbreitungsatlanten <strong>für</strong> die<br />
Mollusken, Säugetiere <strong>und</strong> Heuschrecken<br />
ein weiteres faunistisches Übersichtswerk<br />
vor. Das LANU erfüllt damit eine nach dem<br />
schleswig-holsteinischen Naturschutz-<br />
gesetz bestehende Verpflichtung, die Ent-<br />
wicklung der Tier- <strong>und</strong> Pflanzenwelt in<br />
unserer Landschaft <strong>und</strong> ihre Veränderung<br />
zu dokumentieren.<br />
Libellen sind wegen ihres Indikatorwertes<br />
<strong>und</strong> der relativ guten Erfaßbarkeit <strong>für</strong> ein<br />
sogenanntes „Artenmonitoring" gut geeig-<br />
net. Mit der Zusammenfassung der verfüg-<br />
baren Daten <strong>für</strong> das Land Schleswig-<br />
Holstein wird der Ist-Zustand dokumentiert<br />
<strong>und</strong> damit die Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> zukünftige<br />
Vergleiche geschaffen. Ergebnisse zukünf-<br />
tiger Erfassungen werden präziser bewer-<br />
tet <strong>und</strong> eingeordnet werden können. Der<br />
Atlas hat somit auch eine planungsbezo-<br />
gene Bedeutung. Mit Blick auf die<br />
„Geschichte" der Libellen wird versucht,<br />
die Veränderungen in den vergangenen<br />
h<strong>und</strong>ert Jahren bis zum heutigen Zustand<br />
nachzuvollziehen.<br />
Dieser Atlas konnte nur mit einer umfas-<br />
senden Unterstützung <strong>und</strong> Mitarbeit bei<br />
der Datenbeschaffung durch Planungs-<br />
büros <strong>und</strong> freischaffende Biologen erstellt<br />
werden. Allen, die Daten zur Verfügung<br />
gestellt haben, sei an dieser Stelle herzlich<br />
gedankt.<br />
Ich hoffe, daß der Atlas der Libellen<br />
Schleswig-Holsteins Anregungen gibt, sich<br />
mit dieser <strong>und</strong> anderen Organismengrup-<br />
pen zu beschäftigen. Der unmittelbare<br />
Umgang mit <strong>und</strong> das Erleben von Natur<br />
mit ihren vielfältigen Funktionen <strong>und</strong> For-<br />
men, ihrer Ästhetik im großen wie im klei-<br />
nen ist eine wesentliche Gr<strong>und</strong>vorausset-<br />
zung <strong>für</strong> ein besseres Naturverständnis. Ich<br />
würde mich freuen, wenn daraus auch ein<br />
zusätzliches Engagement <strong>für</strong> ihren Schutz<br />
erwachsen würde.<br />
Direktor Wolfgang Vogel<br />
<strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong> Natur <strong>und</strong> <strong>Umwelt</strong> des<br />
Landes Schleswig-Holstein<br />
3
Einleitung<br />
4<br />
Die Beschäftigung mit der Libellenfauna<br />
von Schleswig-Holstein reicht schon sehr<br />
weit zurück. BEUTHIN (1875) <strong>und</strong> TIMM<br />
(1906) veröffentlichten Verzeichnisse über<br />
die Libellen der Umgebung von Hamburg,<br />
ROSENBOHM 11928) die erste zusammen-<br />
fassende Arbeit <strong>für</strong> ganz Schleswig-<br />
Holstein. Aus den 30er Jahren liegen vor<br />
allem Arbeiten von LUNAU vor. Von<br />
ROSENBOHM stammen aus den frühen<br />
50er Jahre Bemerkungen <strong>und</strong> Ergänzun-<br />
gen zur Libellenfauna. Anfang der 60er<br />
Jahre trieb insbesondere SCHMIDT bis<br />
Ende der 80er Jahre die Libellenfaunistik in<br />
Schleswig-Holstein voran. Weitere wich-<br />
tige Arbeiten aus diesem Zeitraum gibt es<br />
von GLITZ <strong>für</strong> den Raum Hamburg <strong>und</strong><br />
Nordwestdeutschland sowie von FISCHER,<br />
der 1984 (a) ein aktuelles Verzeichnis der<br />
Libellen Schleswig-Holsteins vorlegte. In<br />
den 80er <strong>und</strong> 90er Jahren erlebte die<br />
Odonatologie in Schleswig-Holstein wieder<br />
eine „Blütezeit". Neben vielen Beobach-<br />
tungen von Privatpersonen <strong>und</strong> aus<br />
Diplomarbeiten liegen insbesondere die<br />
Untersuchungen von Planungsbüros im<br />
Rahmen von gutachterlichen Auftragsar-<br />
beiten vor. Letztere liefern vor allem mehr<br />
flächenbezogene Daten auch aus früher<br />
wenig untersuchten Gebieten des Landes.<br />
Leider werden diese Datensammlungen<br />
häufig nicht veröffentlicht <strong>und</strong> auch nicht<br />
zentral erfaßt. Deshalb war es nahezu<br />
unmöglich, alle Datenerhebungen im vor-<br />
liegenden Atlas zu berücksichtigen.<br />
Für Schleswig-Holstein liegt bislang neben<br />
der ersten Roten Liste von SCHMIDT (in<br />
LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ UND<br />
LANDSCHAFTSPFLEGE 1982), dem Ver-<br />
zeichnis von FISCHER (1984 a) die aktuelle<br />
Rote Liste der Libellen vor (BROCK et al.<br />
1997). Darin sind 65 der 80 in Deutschland<br />
nachgewiesenen Arten aufgeführt.<br />
Libellen können sehr schnell auf verän-<br />
derte Lebensbedingungen reagieren.<br />
Während einige Arten <strong>für</strong> Schleswig-Hol-<br />
stein zur Zeit als verschollen gelten, treten<br />
andere neu auf. Mit dem Verbreitungsatlas<br />
sollen die aktuelle Verbreitung <strong>und</strong> die Ver-<br />
änderungen der Libellen in Schleswig-Hol-<br />
stein dokumentiert werden. Gleichzeitig<br />
kann er allen interessierten Personen bei<br />
der Beurteilung eigener Beobachtungen<br />
helfen.
Danksagung<br />
Diesem Atlas liegt eine umfangreiche<br />
Datensammlung zugr<strong>und</strong>e, die ohne die<br />
Mithilfe von zahlreichen Personen, Büros,<br />
Vereinen, Behörden <strong>und</strong> Institutionen nicht<br />
zustande gekommen wäre. Viele haben -<br />
von Einzelf<strong>und</strong>en bis hin zu nahezu voll-<br />
ständigen Aufstellungen <strong>für</strong> größere<br />
Gebiete - Angaben zur Verbreitung der<br />
Libellen in Schleswig-Holstein geliefert.<br />
Allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.<br />
Bedanken möchten wir uns auch bei<br />
denen, die mit uns diskutiert, uns auf Lite-<br />
raturstellen hingewiesen <strong>und</strong> unsere Texte<br />
korrigiert haben. Wir hoffen sehr, daß in<br />
der nachfolgenden, alphabetisch, sortierten<br />
Liste niemand vergessen worden ist.<br />
M. Adomßent (Wendisch Evern),<br />
M. Anselm (Hamburg), H.-J. Augst (Kiel),<br />
T. Behrends (Kiel), R. Berndt (Kiel),<br />
A. Bruens (Kiel), H. Bruns (Husum), K. Buck<br />
(Steinburg), Büro Brien, Wessels, Werning<br />
(Lübeck), Büro Eggers - Biologische Gut-<br />
achten (Hamburg), Büro Eggers & Grosser<br />
(Hamburg), Büro Greuner-Pönicke, BBS<br />
(Kiel), Büro Hess & Jacob (Norderstedt),<br />
Büro Nebelung & Nebelung (Niebüll), Büro<br />
Seebauer, Wefers & Partner (Berlin), Büro<br />
Trüper, Gondesen & Partner (Lübeck),<br />
B.U.N.D. Ortsgruppe Glinde, B.U.N.D.<br />
Kreisgruppe Nordfriesland, H. Carius,<br />
<strong>Umwelt</strong>amt der Hansestadt Lübeck<br />
(Lübeck), U. Dierking (Kirchbarkau),<br />
0. Ekelöf (Friedrichstadt), Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Freilandökologie <strong>und</strong> Naturschutz, GFN<br />
(Kiel), D. Glitt (Bonn), K. <strong>und</strong> U. Graeber<br />
(Bad Oldesloe), A. Haack, Büro <strong>für</strong> ökolo-<br />
gisch-faunistische Planung, böp (Ueter-<br />
sen), B. Hälterlein (Winnert), W. Hanoldt<br />
(Hamburg), D. Narbst (Bordesholm),<br />
G. Hess (Reinbek), A. <strong>und</strong> U. Holm<br />
(Muxall), M. <strong>und</strong> J. Horstkotte (Hamburg),<br />
B.-R. Hündorf (Friedrichstadt), G. Ihssen<br />
(Hamburg), Institut <strong>für</strong> Naturschutz- <strong>und</strong><br />
<strong>Umwelt</strong>forschung (INUF) des Verein<br />
Jordsand (Ahrensburg), U. Irmler, FOAG<br />
(Kiel), G. Jansen (Barmstedt), T. Jansen<br />
(Hamburg), K. Jödicke (Kiel), R. Jödicke<br />
(Lindern), P. Junge, <strong>Umwelt</strong>amt der Stadt<br />
Geesthacht (Geesthacht), J. Kählert (Burg),<br />
E. <strong>und</strong> W. Kappes (Hamburg), C. Kassebeer<br />
(Kiel), J. Kieckbusch (Kiel), Kieler Institut<br />
<strong>für</strong> Landschaftsplanung, KIFL (Kiel), D.<br />
König (Rendsburg), G. Kulik (Hamburg),<br />
M. Laczny (Hamburg), L. Lange (Wewels-<br />
fleth), L.E.G.U.A.N. (Hamburg), J. Lempert<br />
(Hamburg), J. Lietz (Bordesholm), K. Lutz<br />
(Hamburg), A. Martens (Braunschweig),<br />
J. Martens, Stiftung Naturschutz, (Ham-<br />
burg), G. Nehls (Husum), H. Niehus,<br />
<strong>Umwelt</strong>amt der Hansestadt Lübeck<br />
(Lübeck), K. Peschel (Hamburg), G. Peters<br />
(Berlin), K. Rau (Hamburg), H. Recher<br />
(Kiel), H. Reimers (Pinneberg),<br />
H. G. Riefenstahl (Hamburg), K. Romahn<br />
(Kiel), J. Ruddek (Bremen), S. Samu (Ham-<br />
burg), M. Schorr (Zerf), C. Schröter (Ham-<br />
burg), M. Schumann (Preetz), J. Schwahn<br />
(Rodenbek), H. Stobbe (Hamburg),<br />
R. Stilbinger (Bälau), B. Struwe-Juhl (Fal-<br />
kendorf), J. Stuhr (Kiel), K. H. Teschke<br />
(Hamburg), C. Triebstein (Itzehoe) ,<br />
J. J. Vlug (Alkmaar), B. Vossen (Berlin),<br />
I. Wesenberg (Bebensee), S. Wischhof<br />
(Hamburg), S. Wriedt (Kiel), F. Ziesemer<br />
(Bauersdorf), M. Zörner (Hamburg).<br />
Fre<strong>und</strong>licherweise erlaubte der Verlag<br />
Harley Books, Colchester, England, den<br />
Abdruck der europäischen Verbreitungs-<br />
karten aus dem Buch The Dragonflies of<br />
Europe von R. R. Askew.<br />
Besonderer Dank gilt C. Viße (Kiel) <strong>und</strong><br />
U. Dierking (Kirchbarkau) <strong>für</strong> die Korrektu-<br />
ren des Manuskriptes.<br />
Für die Hilfe bei der dänischen Zusammen-<br />
fassung danken wir Herrn K. Piper (Ham-<br />
burg) <strong>und</strong> Herrn E. Rasmussen (Odense).<br />
Die englische Zusammenfassung wurde<br />
von Frau M. Tanimoto (Nakamura) überprüft.<br />
5
Material <strong>und</strong> Methode<br />
6<br />
Die Datengr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> diesen Verbrei-<br />
tungsatlas wurde geschaffen, indem Fach-<br />
leute, Planungsbüros, <strong>Umwelt</strong>verbände<br />
<strong>und</strong> staatliche Stellen befragt, Sammlun-<br />
gen in Museen <strong>und</strong> bei Privatpersonen<br />
durchgesehen sowie Literatur über<br />
Schleswig-Holstein geprüft wurden.<br />
Zusätzlich wurden limnologisch <strong>und</strong> libel-<br />
lenk<strong>und</strong>lich orientierte Diplom- <strong>und</strong> Dok-<br />
torarbeiten ausgewertet. Weitere Beobach-<br />
tungen sind Betreuungsberichten<br />
schleswig-holsteinischer Naturschutzge-<br />
biete entnommen worden.<br />
Leider sind von einigen Personen, die über<br />
umfangreiches Material verfügen, trotz<br />
mehrfacher Bitten bis zur Drucklegung<br />
keine Daten zur Verfügung gestellt worden.<br />
Die Daten wurden gesichtet, auf offensicht-<br />
liche Fehler geprüft <strong>und</strong> per EDV erfaßt.<br />
Hierzu wurde das Programm SoftCol, das<br />
Gerhard Strauß, Biberach-Riß, program-<br />
mierte, verwendet.<br />
Nur die Fälle, bei denen offensichtlich Fehl-<br />
bestimmungen vorlagen, wurden nicht<br />
berücksichtigt. So gab es Angaben zu Art-<br />
beobachtungen, die beispielsweise nicht<br />
mit der tatsächlichen Verbreitung<br />
(Crocothemis erythraea im Oberlauf der<br />
Alster) oder den ökologischen Ansprüchen<br />
(Cordulegaster boltonii in Stillgewässern)<br />
der Arten übereinstimmten. Andere Mel-<br />
dungen konnten dagegen durch Uberprü-<br />
fung der entsprechenden Tiere (Samm-<br />
lungsstücke, Fotos) beziehungsweise<br />
durch Befragung der Sammler bestätigt<br />
werden. Gegebenenfalls wurden unsichere<br />
<strong>und</strong> nicht zu überprüfende Angaben nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Ausnahmsweise wurden auch solche Hin-<br />
weise aufgenommen, die räumlich nicht<br />
eindeutig zuzuordnen waren. Gerade in der<br />
älteren Literatur gab es häufig Textstellen<br />
wie „in der Nähe von ..." oder „in der<br />
Umgebung von ...".<br />
Die vorhandenen Daten erwiesen sich -<br />
abhängig vom Jahr der Beobachtung,<br />
Sammler <strong>und</strong> Ziel der Erhebung - als sehr<br />
heterogen. Daraus resultierten Schwierig-<br />
keiten, Beobachtungsdaten unterschiedlicher<br />
Wertigkeit grafisch komprimiert zu<br />
dokumentieren. Es ist praktisch unmöglich,<br />
ohne Informationsverlust oder verfälschen-<br />
de Darstellung alle Daten adäquat darzu-<br />
stellen.<br />
Meistens werden keine Angaben zur<br />
Bodenständigkeit gemacht, die ohnehin<br />
schwierig einzuschätzen ist (vergleiche<br />
JURZITZA 1989), <strong>und</strong> vielfach fehlen auch<br />
Hinweise zur Häufigkeit oder zum Verhal-<br />
ten, beispielsweise Eiablage, Paarungsrad,<br />
oder diese sind sehr ungenau. Ferner war<br />
die Beobachtungsintensität je nach Erfas-<br />
sungziel wie systematische Erfassung, Gut-<br />
achten, Zufallsbeobachtungen sehr unter -<br />
schiedlich.<br />
Als gangbaren Kompromiß zwischen not-<br />
wendiger Zusammenfassung der Daten<br />
<strong>und</strong> einer räumlichen Auflösung mit befrie-<br />
digendem Informationsgehalt werden die<br />
Nachweise der einzelnen Arten in Raster-<br />
karten (UTM-Gitter, 10 x 10 km 2) dargestellt<br />
<strong>und</strong> die Verbreitung, der Status sowie<br />
Häufigkeitsangaben im Text kommentiert.<br />
Zur Verdeutlichung von Tendenzen in der<br />
Zusammensetzung <strong>und</strong> Verbreitungsent-<br />
wicklung der schleswig-holsteinischen<br />
Libellenfauna werden die Beobachtungen<br />
in Zeitraumkarten dargestellt. Die Beob-<br />
achtungszeiträume wurden dabei so<br />
gewählt, daß wichtige Aktivitätsphasen in<br />
der Erfassung über die Jahrzehnte mög-<br />
lichst in jeweils einer Periode zusammen-<br />
gefaßt wurden. Als aktueller Erfassungs-<br />
zeitraum wurden dabei die letzten zehn<br />
Jahre (1985 bis 1995) gewählt. In den Kar-<br />
ten sind diese Angaben mit unterschiedli-<br />
chen Symbolen belegt.<br />
Ein weiteres Problem ist die Verteilung der<br />
Beobachtungen. Während die Meldungen<br />
um 1900 häufig nur den Wohnsitz oder die<br />
nähere Umgebung der Beobachter betra-<br />
fen, kamen mit der zunehmenden Mobilität<br />
der Libellenk<strong>und</strong>ler weitere Beobachtungs-<br />
gebiete hinzu. Trotzdem geben die Anga-<br />
ben auch während dieser Perioden ein ver-<br />
fälschtes Bild der Verbreitung vieler Arten<br />
wieder, da häufig nur Gebiete mit beson-<br />
deren Arten oder artenreichere Gewässer<br />
aufgesucht wurden. Erst in jüngerer Zeit<br />
stehen durch Kartierungen im Rahmen von<br />
gesetzlich vorgeschriebenen <strong>Umwelt</strong>ver-<br />
träglichkeitsuntersuchungen oder Biotopkartierungen<br />
zunehmend flächendeckende<br />
Datensammlungen auch über artenarme<br />
Landschaftsteile zur Verfügung.
Abbildung 1:<br />
Flächendeckung<br />
der Libellennach-<br />
weise in Schleswig-<br />
Holstein<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2 ^<br />
ME<br />
5 6 7 8<br />
0 vor 1925<br />
Flächendeckung der Libellennachweise<br />
Die Ubersicht über alle F<strong>und</strong>orte (Abbil-<br />
dung 1) suggeriert eine nahezu flächen-<br />
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
deckende Nachweisdichte. Dieses bedeutet<br />
aber keinesfalls auch eine identische Erfas-<br />
sungsdichte, da auch ein Einzelf<strong>und</strong> einen<br />
Nachweispunkt verursacht.<br />
Die Karte Flächendeckung der Libellen-<br />
nachweise in Schleswig-Holstein zeigt<br />
deutlich, wo offensichtlich noch Erfas-<br />
sungsdefizite bestehen. Dies ist insbeson-<br />
dere in den Marschen <strong>und</strong> Küstenberei-<br />
chen sowie in den nördlichen Landesteilen<br />
gegeben. Hier sollte zukünftig auch auf die<br />
anderenorts häufigen Arten geachtet werden.<br />
Aus den Verbreitungskarten des Hamburger<br />
Libellenatlas (GLITZ et al. 1989) wur-<br />
den F<strong>und</strong>e, die in Schleswig-Holstein liegen<br />
<strong>und</strong> zu denen keine originalen<br />
Meldungen zur Verfügung standen, direkt<br />
in den vorliegenden Atlas übertragen.<br />
Dabei kann es infolge der unterschiedlich<br />
zugr<strong>und</strong>e gelegten Rasterkarten (GAUSS-<br />
KRUGER- <strong>und</strong> UTM-Gitter) zu geringen<br />
Abweichungen kommen.<br />
O Anfa<br />
ng925 1 O Anfang 1 900 G Anfa 175 9<br />
bis Ende 1949 bisnf Ende 1974 bis Ende 1984 • ab 1985<br />
Unstimmigkeiten gab es beim Vergleich<br />
der Arten der Roten Liste Lübeck<br />
(UMWELTAMT DER STADT LÜBECK 1989)<br />
mit den von der Unteren Naturschutz-<br />
behörde Lübeck fre<strong>und</strong>licherweise zur<br />
Verfügung gestellten Originaldaten. Sie<br />
beruhen auf einer fehlerhaften EDV-Daten-<br />
ausgabe.<br />
Wo Angaben zur Bodenständigkeit fehlten<br />
oder nicht überprüfbar waren, wurden die<br />
Nachweise in der Regel als bodenständig<br />
interpretiert.<br />
Aus der Literatur übernommene F<strong>und</strong>-<br />
Daten werden in der Regel nicht ausführ-<br />
lich zitiert; im Literaturverzeichnis sind<br />
aber alle Quellen vollständig aufgeführt.<br />
Die Systematik im vorliegenden Atlas folgt<br />
SCHORR (19901 <strong>und</strong> JODICKE (1992). All-<br />
gemeine Hinweise auf die großräumige<br />
Verbreitung der Arten werden in kurzer<br />
Form gegeben, da sie in jedem umfangrei-<br />
cheren Werk über Libellen ausführlich dargestellt<br />
sind.<br />
7
8<br />
In die Flugzeitendiagramme fanden nur<br />
solche Datensätze Eingang, bei denen auch<br />
das genaue Datum der Beobachtung adul-<br />
ter Tiere angegeben war. Dieses ist aber<br />
insbesondere bei den aus der Literatur<br />
übernommenen Nachweisen praktisch nie<br />
der Fall, Die Grafiken wurden bereinigt,<br />
wenn Zweifel an Zeitangaben bestanden.<br />
Ein Balken in den Grafiken beschreibt<br />
jeweils einen Zeitraum von fünf Tagen.<br />
Bei den Flugzeitendiagrammen ist zu<br />
beachten, daß es in Jahren mit extremen<br />
Witterungsverläufen zu relativ frühen oder<br />
späten Nachweisen kommen kann. Die<br />
dargestellten Flugzeiten einiger Arten wei-<br />
sen deshalb teilweise eine deutliche zeitli-<br />
che Streckung auf. Für die Interpretation<br />
der Grafiken sind deswegen diejenigen<br />
Zeitabschnitte von stärkerem Interesse, in<br />
denen die Dichte ausgewerteter Meldun-<br />
gen höher ist.<br />
Ebenso wie bei den Verbreitungskarten<br />
schwankt der Datenumfang auch bei den<br />
Angaben zur Phänologie erheblich. Hier<br />
wie dort wurden jedoch stets Einzelbeob-<br />
achtungen berücksichtigt.
Charakterisierung der Naturräume<br />
Schleswig-Holsteins<br />
Der Abschnitt Landschaftliche Gliederung<br />
ist mit geringfügigen Ergänzungen dem<br />
von BORKENHAGEN (19931 veröffentlich-<br />
ten Säugetieratlas mit fre<strong>und</strong>licher Geneh-<br />
migung des Autors übernommen worden.<br />
Landschaftliche Gliederung<br />
Schleswig-Holstein verdankt seine heutige<br />
Oberflächengestalt im wesentlichen den<br />
beiden letzten Eiszeiten. Sie schufen die<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die drei Landschaftszonen:<br />
Östliches Hügelland, Geest <strong>und</strong> Marsch.<br />
Auf das Östliche Hügelland entfallen<br />
43 Prozent (668.231 ha) der Landesfläche.<br />
Es ist ein Teil der Jungmoränenlandschaft,<br />
die sich von Dänemark bis zum Baltikum<br />
erstreckt <strong>und</strong> die die Randlagen des Eises<br />
während der letzten Kaltzeit (Weichseleis-<br />
zeit) markiert. Die Ostseeküste ist durch<br />
ehemalige Eiszungen in Förden <strong>und</strong> Buch-<br />
ten gegliedert. Das Hinterland zeigt ein leb-<br />
haftes Relief, das im Landesteil Schleswig<br />
in den Hüttener Bergen (106 m) <strong>und</strong> in Ost-<br />
holstein mit dem Bungsberg (168 m) seine<br />
höchsten Erhebungen hat. Im östlichen<br />
<strong>und</strong> südöstlichen Landesteil sind zahlrei-<br />
che Seen eingestreut. Ausgangsmaterial<br />
<strong>für</strong> die Bodenbildung ist der Geschiebe-<br />
mergel, aus dem sich Parabraunerden ent-<br />
wickelten. Ursprünglich waren diese<br />
Gebiete mit Buchenmischwäldern bestanden.<br />
Bedeutende Libellenhabitate des Ostlichen<br />
Hügellandes sind Seen, zahlreiche zumeist<br />
kleinere Moore, eine Reihe naturnaher<br />
Bäche sowie Kleingewässer.<br />
Die Geest geht auf zwei eiszeitliche Ele-<br />
mente zurück: die Vorgeest (16 Prozent =<br />
252.117 ha) ist das Sandergebiet im Vorfeld<br />
der Jungmoränen. Aus ihr erheben<br />
sich im Westen inselartig die Hügel der<br />
Hohen Geest 128 Prozent = 432. 824 hat.<br />
Sie stellen die Endmoränen der vorletzten<br />
Vereisung (Saaleeiszeit) dar. Das subarkti-<br />
sche Klima der Weichseleiszeit hat sie<br />
überformt: Bodenfließen führte zu einem<br />
ausgeglichenen Relief. Die feinen, nähr-<br />
stoffhaltigen <strong>und</strong> quellfähigen Bestandteile<br />
wurden ausgewaschen oder ausgeblasen.<br />
Auf den leichten, zur Podsolierung neigen-<br />
den Sandböden der Geest stockte<br />
ursprünglich ein Eichen-Buchen-Misch-<br />
wald, der schon früh durch Obernutzung<br />
zu Heideflächen degenerierte. Heute finden<br />
sich hier größere Nadelholzaufforstungen<br />
(Fichte, Kiefer). Charakteristisch <strong>für</strong> den<br />
Mittelrücken sind die eingestreuten, viel-<br />
fach mehrere Quadratkilometer großen<br />
Hoch- <strong>und</strong> Niedermoore. Eingebettet in<br />
diese Landschaft sind die ausgedehnten<br />
Niederungsgebiete von Eider/Treene <strong>und</strong><br />
anderen Flüssen.<br />
Bemerkenswerte Libellengewässer der<br />
Geest sind Torfstiche, Heideweiher <strong>und</strong><br />
naturnahe Fließgewässer einschließlich<br />
ihrer Altarme, aber auch Grabensysteme in<br />
den großen Flußniederungen.<br />
Die Marsch ist die jüngste <strong>und</strong> mit 13 Pro-<br />
zent Anteil (202.723 ha) die kleinste der<br />
drei Landschaftszonen. Mit Abtauen der<br />
eiszeitlichen Gletscher stieg der Meeres-<br />
spiegel wieder an <strong>und</strong> erreichte schließlich<br />
den Geestrand. Durch Sedimentablage-<br />
rung im Rhythmus der Gezeiten entwickelt<br />
sich ein breiter, von Mooren durchsetzter<br />
Marschengürtel. Sturmfluten im 14. <strong>und</strong><br />
17. Jahrh<strong>und</strong>ert zerschlugen diese Anlan-<br />
dungen wieder <strong>und</strong> ließen das Wattenmeer<br />
mit seinen Inseln entstehen. Landgewin-<br />
nungs- <strong>und</strong> Eindeichungsmaßnahmen bis<br />
in unsere Tage gaben dem Küstenraum<br />
seine derzeitige Gestalt.<br />
Zu den wichtigsten Libellenhabitaten der<br />
Marsch gehören heute die alten, sehr aus-<br />
gedehnten Grabensysteme, welche in<br />
Grünlandgebieten mit relativ hohen Was-<br />
serständen große Krebsscherenvorkom-<br />
men aufweisen können (Hattstedter<br />
Marsch, Nordfriesland). Auf den Geestin-<br />
seln <strong>und</strong> im Westen der Halbinsel Eider-<br />
stedt sowie auf Amrum sind insbesondere<br />
die zum Teil vermoorten, wasserführenden<br />
Dünentäler hervorzuheben. Bedeutsam<br />
sind auch im Zuge von Eindeichungen<br />
geschaffene, aussüßende, größere Flach-<br />
gewässer in jüngeren Kögen wie dem<br />
Hauke-Haien-Koog (KELM 1993) oder dem<br />
Speicherkoog Dithmarschen.<br />
9
10<br />
Klima<br />
Die vom Atlantik bei vorherrschenden<br />
West- <strong>und</strong> Südwestwinden herangeführten<br />
maritimen Luftmassen bestimmen das<br />
überwiegend subozeanische Klima<br />
Schleswig-Holsteins. Es zeichnet sich<br />
durch milde Winter, mäßig warme <strong>und</strong> nie-<br />
derschlagsreiche Sommer sowie relativ<br />
hohe Windgeschwindigkeiten aus. Inner-<br />
halb des Landes sind klimatische Unter-<br />
schiede von Nordwesten nach Südosten zu<br />
beobachten. Besonders ausgeprägt ist das<br />
atlantisch-feuchte Klima im Nordwesten<br />
des Landes, während der äußerste Süd-<br />
osten schon ein annähernd subkontinenta-<br />
les Klima besitzt.<br />
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt<br />
8,1°C bei nur geringen Abweichungen in<br />
den einzelnen Landesteilen. Die Januar-<br />
Durchschnittstemperaturen schwanken<br />
zwischen 0 <strong>und</strong> 1°C, die Julimittel zwi-<br />
schen 16 <strong>und</strong> 17°C (DEUTSCHER WETTER-<br />
DIENST 1967). Neben wenigen Wärmein-<br />
seln auf der Geest weist der Südosten des<br />
Landes die höchsten Sommertemperatu-<br />
ren auf.<br />
Die Niederschlagsverteilung zeigt deutliche<br />
Beziehungen zur Geomorphologie. Die<br />
Niederschlagsmenge ist auf den Nordsee-<br />
inseln <strong>und</strong> in der unmittelbaren Nordsee-<br />
küstenregion relativ niedrig (550 -750 mm),<br />
um dann im Bereich der Hohen Geest <strong>und</strong><br />
nochmals im Norden des Östlichen Hügel-<br />
landes (Region Hüttener Berge bis Flens-<br />
burg) stark anzusteigen 1750 mm -<br />
>850 mm). Im „Windschatten" dieser<br />
„Höhenzüge" sinkt die Regenmenge konti-<br />
nuierlich bis auf 600 mm ab. Am nieder-<br />
schlagsärmsten ist die Ostseeinsel<br />
Fehmarn mit zum Teil unter 550 mm Nie-<br />
derschlag.<br />
Im nordfriesischen Küstenraum liegt die<br />
höchste durchschnittliche jährliche Wind-<br />
geschwindigkeit bei 6,5 m/sec. Nach Süd-<br />
osten, im Kreis Lauenburg, sinkt sie auf<br />
etwa 3 bis 2 m/sec.<br />
Im einzelnen weicht der jährliche Witte-<br />
rungsverlauf häufig in erheblichem Maße<br />
von diesem skizzierten langjährigen Durch-<br />
schnittsklima ab. So zeigen die Wetterauf-<br />
zeichnungen seit 1917 mehr oder weniger<br />
regelmäßige deutliche Klimaschwankun-<br />
gen, in denen sich ausgesprochene Kälte-<br />
<strong>und</strong> Wärmephasen abwechseln.<br />
Neuere Untersuchungen belegen, daß in<br />
letzter Zeit deutliche Abweichungen<br />
wesentlicher Klimaelemente von den<br />
langjährigen Mittelwerten festzustellen<br />
sind. KIRSCHNING (1991) ermittelte <strong>für</strong> die<br />
Periode von 1968 bis 1988 eine signifikante<br />
landesweite mittlere Abnahme der jährli-<br />
chen Sonnenscheindauer um 12 Prozent.<br />
Besonders betroffen sind die Frühjahrs-<br />
<strong>und</strong> Sommermonate, wobei im Sommer<br />
der Juni mit 26 Prozent die stärkste<br />
Abnahme zeigt, dicht gefolgt von den<br />
Monaten Juli <strong>und</strong> August mit etwas unter<br />
20 Prozent. Im gleichen Zeitraum steigen<br />
die mittleren Jahresniederschläge zwi-<br />
schen den Dekaden 1968-1977 <strong>und</strong> 1978-<br />
1988 um 113 mm (16 Prozent) an. Insbe-<br />
sondere die Monate Juni <strong>und</strong> August<br />
wurden nasser (KIRSCHNING 1991).<br />
Zugleich ist in den 80er Jahren eine Häu-<br />
fung extremer Witterungsereignisse fest-<br />
stellbar, die durch eine Klimaänderung<br />
ausgelöst sein können. KIRSCHNING<br />
11991) vermutet den Hauptfaktor <strong>für</strong> die<br />
Veränderungen in der Zunahme der<br />
Geschwindigkeit der vom Nordatlantik<br />
wehenden Westwinde in Bodennähe, die<br />
eine Zunahme des Wasserdampfgehalts<br />
der nach Norddeutschland herangeführten<br />
Luft bewirkt. Von einem stabilen Trend<br />
könne jedoch noch nicht gesprochen wer-<br />
den. Die Wärmephase von 1988 bis 1995<br />
hat allerdings zumindest zu einer Unterbre-<br />
chung des Trends geführt.<br />
Ausführlichere Darstellungen zu Landes-<br />
natur <strong>und</strong> Klima geben EMEIS (19501,<br />
DEGN & MUUSZ (1966), SCHLENGER et al.<br />
(19691, HEYDEMANN & MÜLLER KARCH<br />
(1980) <strong>und</strong> SCHMIDTKE (1992).
Verbreitung der Arten<br />
In Schleswig-Holstein nachgewiesene Libellenarten<br />
Unterordnung: Kleinlibellen - Zygoptera<br />
Familie: Prachtlibellen - Calopterygidae<br />
Gattung: Calopteryx<br />
Gebänderte Prachtlibelle Calopteryx splendens<br />
Blauflügel-Prachtlibelle Calopteryx virgo<br />
Familie: Teichjungfern - Lestidae<br />
Gattung: Sympecma<br />
Gemeine Winterlibelle Sympecma fusca<br />
Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca<br />
Gattung: Lestes<br />
Südliche Binsenjungfer Lestes barbarus<br />
Glänzende Binsenjungfer Lestes dryas<br />
Gemeine Binsenjungfer Lestes sponsa<br />
Kleine Binsenjungfer Lestes virens<br />
Große Binsenjungfer Lestes viridis<br />
Familie: Federlibellen - Platycnemidae<br />
Gattung: Platycnemis<br />
Federlibelle Platycnemis pennipes<br />
Familie: Schlanklibellen - Coenagrionidae<br />
Gattung: Pyrrhosoma<br />
Frühe Adonislibelle Pyrrhosoma nymphula<br />
Gattung: Ischnura<br />
Gemeine Pechlibelle Ischnura elegans<br />
Kleine Pechlibelle Ischnura pumilio<br />
Gattung: Coenagrion<br />
Hauben-Azurjungfer Coenagrion armatum<br />
Speer-Azurjungfer Coenagrion hastulatum<br />
Mond-Azurjungfer Coenagrion lunulatum<br />
Helm-Azurjungfer Coenagrion mercuriale<br />
Hufeisen-Azurjungfer Coenagrion puella<br />
Fledermaus-Azurjungfer Coenagrion pulchellum<br />
Gattung: Enallagma<br />
Becher-Azurjungfer Enallagma cyathigerum<br />
Gattung: Erythromma<br />
Großes Granatauge Erythromma najas<br />
Kleines Granatauge Erythromma viridulum<br />
Gattung: Ceriagrion<br />
Späte Adonislibelle Ceriagrion tenellum<br />
Gattung: Nehalennia<br />
Zwerglibelle Nehalennia speciosa<br />
Unterordnung: Großlibellen - Anisoptera<br />
Familie: Flußjungfern - Gomphidae<br />
Gattung: Gomphus<br />
Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes<br />
Westliche Keiljungfer Gomphus pulchellus<br />
Gemeine Flußjungfer Gomphus vulgatissimus<br />
Gattung: Ophiogomphus<br />
Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia<br />
Familie: Edellibellen - Aeshnidae<br />
Gattung: Brachytron<br />
Kleine Mosaikjungfer Brachytron pratense<br />
Gattung: Aeshna<br />
Südliche Mosaikjungfer Aeshna affinis<br />
Blaugrüne Mosaikjungfer Aeshna cyanea<br />
Braune Mosaikjungfer Aeshna grandis<br />
Keilflecklibelle Aeshna isosceles<br />
Torf-Mosaikjungfer Aeshna juncea<br />
Herbst-Mosaikjungfer Aeshna mixta<br />
Hochmoor-Mosaikjungfer Aeshna subarctica<br />
Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis<br />
Gattung: Hemianax<br />
Schabrackenlibelle Hemianax ephippiger<br />
Gattung: Anax<br />
Große Königslibelle Anax imperator<br />
Kleine Königslibelle Anax parthenope<br />
Familie: Quelljungfern - Cordulegastridae<br />
Gattung: Cordulegaster<br />
Zweigestreifte Quelljungfer Cordulegaster boltonii<br />
Familie: Falkenlibellen - Corduliidae<br />
Gattung: Cordulia<br />
Gemeine Smaragdlibelle Cordulia aenea<br />
Gattung: Epitheca<br />
Zweifleck Epitheca bimaculata<br />
Gattung: <strong>Somatochlora</strong><br />
Arktische Smaragdlibelle <strong>Somatochlora</strong> arctica<br />
Gefleckte Smaragdlibelle <strong>Somatochlora</strong> flavomaculata<br />
Glänzende Smaragdlibelle <strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong><br />
Familie: Segellibellen - Libellulidae<br />
Gattung: Libellula<br />
Plattbauch Libellula depressa<br />
Spitzenfleck Libellula fulva<br />
Vierfleck Libellula quadrimaculata<br />
Gattung: Orthetrum<br />
Südlicher Blaupfeil Orthetrum brunneum<br />
Großer Blaupfeil Orthetrum cancellatum<br />
Kleiner Blaupfeil Orthetrum coerulescens<br />
Gattung: Sympetrum<br />
Schwarze Heidelibelle Sympetrum danae<br />
Gefleckte Heidelibelle Sympetrum flaveolum<br />
Frühe Heidelibelle Sympetrum fonscolombei<br />
Südliche Heidelibelle Sympetrum meridionale<br />
Gebänderte Heidelibelle Sympetrum pedemontanum<br />
Blutrote Heidelibelle Sympetrum sanguineum<br />
Große Heidelibelle Sympetrum striolatum<br />
Gemeine Heidelibelle Sympetrum vulgatum<br />
Gattung: Leucorrhinia<br />
östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons<br />
Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis<br />
Kleine Moosjungfer Leucorrhinia dubia<br />
Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis<br />
Nordische Moosjungfer Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5 Q '3<br />
4Q<br />
3 o<br />
2<br />
1<br />
9 11I O RD-<br />
8 4 0<br />
7 SEF.<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2 ^<br />
Calopteryx splendens<br />
ME 1 NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
12<br />
Jm Ne A, Daz
Gebänderte Prachtlibelle -<br />
Calopteryx splendens (HARRIS 1782)<br />
Verbreitung<br />
Nach ST. QUENTIN (1960) ist die Art im<br />
gesamten Mittelmeerraum verbreitet <strong>und</strong><br />
kommt im Osten bis lrkutsk in Sibirien, im<br />
Norden bis Mittelfinnland vor. DEVAI<br />
(19761 stellt sie zum pontomediterranen<br />
Faunenkreis. Für Deutschland läßt sich<br />
eine flächendeckende Verbreitung von<br />
Calopteryx splendens feststellen.<br />
Habitatansprüche<br />
Die Art kommt bevorzugt an Wiesenbächen<br />
sowie langsam bis mäßig schnell<br />
fließenden Flüssen mit meist reichlich ent-<br />
wickelter Ufervegetation vor. Aber auch<br />
nahezu stehende Gewässer wie Altwasser<br />
<strong>und</strong> Uferbereiche großer Seen können in<br />
geringen Populationsdichten besiedelt<br />
werden. Die bevorzugten Habitate sind<br />
größere besonnte Bereiche mit eingestreu-<br />
ten offenen Wasserflächen. Als ökologi-<br />
sche Faktoren der Besiedlung gelten<br />
Gewässerbreite, exponierte Sitzwarten,<br />
Schwimmblattzone <strong>und</strong> Sauerstoffnutz-<br />
wert.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die Vorkommen von Calopteryx splendens<br />
konzentrieren sich auf die Fließgewässer<br />
der Geest <strong>und</strong> des östlichen Hügellandes.<br />
Aus den nördlichen Bereichen der Geest<br />
<strong>und</strong> des Hügellands liegen allerdings nur<br />
wenige F<strong>und</strong>e vor. In den Marschen wird<br />
die Art nur selten bodenständig <strong>und</strong> dann<br />
meist in sehr kleinen Populationen nachge-<br />
wiesen, so in der Dithmarscher <strong>und</strong> Eider-<br />
stedter Marsch. Ansonsten können wan-<br />
dernde Tiere beobachtet werden. Für den<br />
aktuellen Zeitraum ist eine Zunahme der<br />
Meldungen feststellbar, die sich überwie-<br />
gend mit erhöhten Erfassungsaktivitäten,<br />
darunter sehr viele Fließgewässerkartie-<br />
rungen, erklären läßt. Ob damit auch<br />
gleichzeitig eine Bestandszunahme der Art<br />
einhergeht, muß in der Zukunft aufmerk-<br />
sam beobachtet werden. Sicher ist, daß die<br />
Populationen im östlichen Hügelland in der<br />
Regel hohe Ab<strong>und</strong>anzen aufweisen wie an<br />
der Trave.<br />
13
14<br />
MG<br />
0<br />
Calopteryx virgo<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 950 61a<br />
Anf En 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis ngde 1984<br />
Jee Feb A, Mal Jun Jul Aug Sep Okf Nov Dez
Blauflügel-Prachtlibelle -<br />
Calopteryx virgo (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
Die Art wird nach ST. QUENTIN (1960) zum<br />
eurosibirischen Faunenkreis gezählt. Sie<br />
kommt in ganz Europa <strong>und</strong> dem nördli-<br />
chen Asien bis Japan vor, fehlt jedoch im<br />
südlichen Mittelmeerraum. Calopteryx<br />
virgo ist in Deutschland noch fast überall<br />
verbreitet, mit Schwerpunkt in den Mittel-<br />
gebirgen.<br />
Habitatansprüche<br />
Calopteryx virgo ist eine typische Art kraut-<br />
reicher, kühler Fließgewässer, an denen<br />
sich schattige, gehölzgesäumte Abschnitte<br />
mit sonnigen <strong>und</strong> krautbestandenen<br />
abwechseln. Sie kommt in der Regel an<br />
den gleichen Fließgewässern vor wie<br />
Calopteryx splendens, besiedelt aber mehr<br />
die oberen Bereiche. Das Vorkommen der<br />
Art wird in erster Linie durch die Strö-<br />
mungsgeschwindigkeit, Wassertemperatur<br />
<strong>und</strong> eine hohe Sauerstoffsättigung<br />
bestimmt.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Im Gegensatz zur vorhergehenden Art ist<br />
Calopteryx virgo aufgr<strong>und</strong> der Habitatan-<br />
sprüche in Schleswig-Holstein schon<br />
immer selten gewesen. Ein Vergleich der<br />
F<strong>und</strong>e vor 1985 mit den aktuellen zeigt<br />
allerdings insgesamt eine Abnahme. Die<br />
Art meidet die Marschen <strong>und</strong> Inseln, bei<br />
Nachweisen von dort dürfte es sich um<br />
wandernde Tiere handeln. Die rezenten<br />
Vorkommen beschränken sich im wesentli-<br />
chen auf die mittlere bis südliche Geest<br />
<strong>und</strong> das südöstliche Hügelland.<br />
15
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
0 Anfang 0 vor 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
16<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Sympecma fusca<br />
PF<br />
PE
Gemeine Winterlibelle -<br />
Sympecma fusca (VAN DER LINDEN 1820)<br />
Verbreitung<br />
Sympecma fusca ist nach DEVAI (19761 ein<br />
holomediterranes Faunenelement mit<br />
Schwerpunkt im östlichen Mittelmeer-<br />
gebiet (ST. QUENTIN 1960) <strong>und</strong> von der<br />
mittleren Wolga über das östliche Mittel-<br />
meer nach Süden bis Nordafrika anzutref-<br />
fen. In den Niederlanden <strong>und</strong> Schleswig-<br />
Holstein befindet sich die nordwestliche<br />
Verbreitungsgrenze der Art.<br />
Habitatansprüche<br />
Diese nach LOHMANN (19801 euryöke Art<br />
bevorzugt bei uns vegetationsreiche Nie-<br />
dermoore <strong>und</strong> Röhrichte von Seen in<br />
Waldnähe, an denen sich schnell erwär-<br />
mende Flachwasserbereiche finden. Das<br />
Vorkommen ist zudem möglicherweise von<br />
der Dichte submerser Vegetation abhän-<br />
gig. Vielfach scheint sie als Erstbesiedler<br />
aufzutreten, da sie auch an Kleingewäs-<br />
sern, Fischteichen <strong>und</strong> Baggerseen gefun-<br />
den wird. In geringem Maße besiedelt die<br />
Art auch astatische Gewässer beziehungs-<br />
weise Gewässerzonen (SCHMIDT, B. 1991).<br />
Überwinternde Tiere werden oftmals weit<br />
entfernt von ihren Brutgewässern angetroffen.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Sympecma fusca ist in Schleswig-Holstein<br />
schon immer selten gewesen, weil sie hier<br />
ihre nordwestliche Verbreitungsgrenze<br />
erreicht. Nach 1985 wurde sie jedoch von<br />
sehr viel mehr F<strong>und</strong>orten nachgewiesen,<br />
als dieses früher der Fall war. Allein aus<br />
den letzten vier Jahren stammen fast 30<br />
Prozent aller Meldungen, was vermutlich<br />
auf erhöhte Erfassungsaktivitäten zurück-<br />
zuführen ist. Möglicherweise wurde die Art<br />
in der Vergangenheit oft übersehen. Wei-<br />
terhin ist auffällig, daß die Art derzeit in<br />
höheren Ab<strong>und</strong>anzen nachgewiesen wird<br />
als früher. Ihre heutigen Vorkommen kon-<br />
zentrieren sich in der mittleren Geest <strong>und</strong><br />
dem südöstlichen Hügelland. Sympecma<br />
fusca fehlt in der Marsch <strong>und</strong> auf den<br />
Inseln.<br />
17
5 6 7 8<br />
Sympecma paedisca<br />
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0<br />
2 3 4 5<br />
O Anfang O vor1925 1925 4) Anfang 1950 C Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
18
Sibirische Winterlibelle -<br />
Sympecma paedisca (BRAUER 1882)<br />
Verbreitung<br />
Sympecma paedisca ist nach ST. QUENTIN<br />
(19601 ein eurosibirisches Faunenelement.<br />
Die Art zeigt im Westen ein disjunktes Vor-<br />
kommen bis in die Niederlande <strong>und</strong> ist im<br />
Osten bis nach Japan verbreitet. Im Süden<br />
erstreckt sich ihr Vorkommen über die<br />
Schweiz, Österreich, Italien <strong>und</strong> Frankreich.<br />
In Deutschland wird hauptsächlich der<br />
Süden besiedelt <strong>und</strong> hier vornehmlich<br />
das Alpenvorland.<br />
Habitatansprüche<br />
Die Habitatansprüche dieser Art sind bis-<br />
her wenig geklärt. In Mitteleuropa schei-<br />
nen hauptsächlich gr<strong>und</strong>wasserbeeinflußte<br />
Niedermoorgebiete mit Riedern besiedelt<br />
zu werden (SCHMIDT, B. 1991). Bevorzugte<br />
Larvalhabitate sind zum Teil austrocknende<br />
Schlenken. SCHORR 11990) gibt Kopfbin-<br />
senmoore <strong>und</strong> sphagnumreiche Fadenseg-<br />
genmoore als bevorzugte Brutgewässer<br />
von Sympecma paedisca an.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Sympecma paedisca konnte bisher nur ein-<br />
mal in Schleswig-Holstein am Segrahner<br />
See (19711 nachgewiesen werden. Die Art<br />
kann nicht zur einheimischen Libellenfauna<br />
gezählt werden. Nach ZESSIN &<br />
KÖNIGSTEDT (1993) fehlt Sympecma<br />
paedisca im Westen Mecklenburg-Vorpom-<br />
merns, <strong>und</strong> auch aus Niedersachsen liegt<br />
nur ein älterer Nachweis vor. In den Nie-<br />
derlanden war die Art in den 50er Jahren<br />
lokal häufig, nahm dann aber kontinuier-<br />
lich ab. Aktuell liegt auch dort nur noch ein<br />
Nachweis vor (WASSCHER et al. 1995). Es<br />
ist aber nicht auszuschließen, daß<br />
Sympecma paedisca in Jahren mit konti-<br />
nentalem Klima auch in Schleswig-<br />
Holstein wieder auftritt.<br />
19
20<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
•<br />
e Cl<br />
Lestes barbarus<br />
O ST SEE<br />
ME I NE<br />
P E<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
vor 1925 O Anfang 1 925 O Anfang 1950 Cnf Aan 1975•ab 1985<br />
o bis Ende 1949 bis Ende 1974bisgEnde<br />
1984 •<br />
Apr<br />
0
Südliche Binsenjungfer -<br />
Lestes barbarus (FABRICIUS 1798)<br />
Verbreitung<br />
Diese Art, von GEIJSKES & VAN TOL<br />
(1983) als holomediterranes Faunenele-<br />
ment eingestuft, ist ostwärts bis nach Ruß-<br />
land <strong>und</strong> südostwärts bis Indien verbreitet.<br />
Im Norden sind Einzelf<strong>und</strong>e noch aus<br />
Dänemark <strong>und</strong> Südschweden bekannt.<br />
Nach Süden reicht ihre Verbreitung bis<br />
Nordafrika. Die Art weist eine Ausbrei-<br />
tungstendenz nach Norden auf. In Deutsch-<br />
land ist sie zumeist nur in kleinen Vorkom-<br />
men nachgewiesen.<br />
Habitatansprüche<br />
Lestes barbarus besiedelt vorwiegend tem-<br />
poräre Gewässer, kommt aber auch an fla-<br />
chen Weihern <strong>und</strong> Teichen vor. Bevorzugt<br />
werden Gewässer der Offenlandschaft<br />
(Wiesen). Diese wanderfreudige Art wird<br />
häufig als Erstbesiedler an neu entstande-<br />
nen, flachen Kleingewässern gef<strong>und</strong>en. An<br />
den Wasserchemismus werden nur<br />
geringe Ansprüche gestellt. Die Larven<br />
benötigen <strong>für</strong> ihre kurze Entwicklung<br />
höhere Wassertemperaturen.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die ersten Nachweise der Art stammen aus<br />
den 30er Jahren. Allerdings läßt sich erst<br />
in den 60er <strong>und</strong> 70er Jahren eine regel-<br />
mäßige Besiedlung des östlichen Hügel-<br />
lands feststellen, <strong>und</strong> mittlerweile kommt<br />
Lestes barbarus auch vereinzelt in der<br />
Geest vor. Aufgr<strong>und</strong> der besiedelten Habi-<br />
tate ist es fraglich, ob die Art sich tatsäch-<br />
lich auch über Jahre an allen Gewässern<br />
halten kann, an denen sie nachgewiesen<br />
wurde. Obwohl Lestes barbarus eine nach<br />
Schleswig-Holstein eingewanderte medi-<br />
terrane Art ist, muß man sie heute zur hei-<br />
mischen Libellenfauna zählen. Sie ist<br />
sicherlich noch sehr selten, <strong>und</strong> die boden-<br />
ständigen Vorkommen gelten derzeit als<br />
gefährdet. Dabei ist nicht auszuschließen,<br />
daß die aktuellen Bestände überwiegend<br />
durch Zuwanderer gestützt werden. Aus<br />
den letzten zwei Jahren stammen allein<br />
37 Prozent aller Beobachtungen, wobei die<br />
Mehrzahl keine autochthonen Vorkommen<br />
sind. Neben den vermehrten Erfassungsaktivitäten<br />
haben die letzten klimatisch gün-<br />
stigen Jahre möglicherweise zu Zuwande-<br />
rungen geführt. Es bleibt abzuwarten, ob<br />
<strong>für</strong> die Art in Schleswig-Holstein auf Dauer<br />
eine ähnliche Bestandserweiterung zu<br />
beobachten sein wird, wie dieses derzeit<br />
im mittleren Niedersachsen der Fall ist.<br />
CLAUSNITZER (1996) erachtet sie dort des-<br />
halb als „nicht mehr erwähnenswert". Die<br />
Nachweise von den Inseln, zum Beispiel<br />
von Helgoland, belegen eher die dispersale<br />
Neigung der Art; sie dürfte hier nicht<br />
bodenständig sein. LEMPERT (1996 a)<br />
konnte Lestes barbarus auf Mellum als<br />
einen der häufigsten Durchwanderer beob-<br />
achten, ohne daß die Art dort bodenstän-<br />
dig ist.<br />
21
22<br />
MG<br />
MF<br />
Lestes dryas<br />
Jm<br />
ST SEE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Aang nf 1925 O Anfang 1950 G Aan nf Eng 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis de 1984<br />
•<br />
o<br />
Aug<br />
PF<br />
c<br />
PE
Glänzende Binsenjungfer -<br />
Lestes dryas KIRBY 1890<br />
Verbreitung<br />
Die Verbreitung dieser Art ist holarktisch<br />
<strong>und</strong> circumboreal. DEVAI (1976) stellt sie zu<br />
den sibirischen Faunenelementen. In<br />
Europa kommt sie von Spanien bis zum<br />
Polarkreis vor, mit Ausnahme von Teilen<br />
der Britischen Inseln <strong>und</strong> großen Teilen<br />
des westlichen Mittel- <strong>und</strong> Nordskandina-<br />
viens. In Deutschland wird Lestes dryas<br />
mittlerweile aus fast allen Landesteilen<br />
gemeldet.<br />
Habitatansprüche<br />
Nach SCHMIDT (1975 b) besiedelt Lestes<br />
dryas kleine, flache <strong>und</strong> dicht mit Ried-<br />
pflanzen wie Binsen, Igel- <strong>und</strong> Rohrkolben<br />
oder Sumpfschachtelhalm bewachsene<br />
Teiche. Die Art bevorzugt sommertrockene<br />
Sümpfe <strong>und</strong> Gewässer in Waldnähe. Man<br />
findet sie aber durchaus auch in Verlan-<br />
dungsbereichen mittleren <strong>und</strong> hohen<br />
Nährstoffgehalts größerer Gewässer,<br />
sowie in Nieder- <strong>und</strong> Übergangsmooren.<br />
Ähnlich Lestes barbarus ist Lestes dryas in<br />
der Lage, neu entstandene Gewässer<br />
schnell zu besiedeln.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Lestes dryas wurde in Schleswig-Holstein<br />
erstmalig 1912 nachgewiesen. Ab 1985 ist<br />
allgemein eine Zunahme der Art zu ver-<br />
zeichnen (SCHORR 1990). Allerdings<br />
erweist sich eine Interpretation der<br />
Bestandsentwicklung als schwierig, da<br />
Lestes dryas über Jahre betrachtet nur<br />
unstetig an ihren Brutgewässern vor-<br />
kommt. In Schleswig-Holstein schnellten<br />
die aktuellen Nachweise extrem hoch,<br />
78 Prozent aller Beobachtungen stammen<br />
aus den letzten zehn <strong>und</strong> über die Hälfte<br />
aus den letzten fünf Jahren. Auf dem Fest-<br />
land belegt die Art mittlerweile über 20<br />
Prozent aller Raster, dabei ist ein Schwer-<br />
punkt im Hügelland festzustellen. Von dort<br />
aus scheint sie aus Richtung Westen <strong>und</strong><br />
Nordwesten zu dispergieren. Von den<br />
Inseln liegt aktuell nur von Föhr ein F<strong>und</strong><br />
vor.<br />
23
24<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Lestes sponsa<br />
ME I NE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1 925 O Anfa ng1950<br />
G Anfan 1 975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende<br />
1974 bis Engde<br />
1984<br />
20<br />
Apr<br />
kn Jul Aug Se Okt N. Osx
Gemeine Binsenjungfer -<br />
Lestes sponsa (HANSEMANN 1823)<br />
Verbreitung<br />
Lestes sponsa gehört nach DEVAI (19761<br />
zum sibirischen Faunenkreis. Diese nach<br />
ST. QUENTIN (1960) ho!arktisch verbreitete<br />
Art ist in ganz Europa mit Ausnahme Itali-<br />
ens <strong>und</strong> Bereichen nördlich des Polarkrei-<br />
ses bis weit nach Asien hinein anzutreffen.<br />
In Deutschland kommt Lestes sponsa<br />
nahezu überall vor <strong>und</strong> ist wahrscheinlich<br />
die häufigste Lestide.<br />
Habitatansprüche<br />
Lestes sponsa besiedelt fast alle Gewäs-<br />
sertypen, findet sich aber nur ausnahms-<br />
weise an Fließ- <strong>und</strong> Pioniergewässern.<br />
Bevorzugt werden stehende Gewässer mit<br />
ausgebildeter Riedzone am Ufer, im Nor-<br />
den des Verbreitungsgebiets sonnenexpo-<br />
nierte Weiher mit ausgedehnten Verlan-<br />
dungszonen. Sie kann sogar brackige<br />
Gewässer mit 2 % Salzgehalt (MIELEWCZYK<br />
1970) besiedeln, <strong>und</strong> man findet sie auch<br />
in astatischen Gewässern in großer Zahl.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Lestes sponsa ist über ganz Schleswig-<br />
Holstein verbreitet. Eine Konzentration der<br />
Populationen läßt sich im Hügelland <strong>und</strong><br />
der Geest feststellen. Nach Norden nimmt<br />
die Zahl der Nachweise stark ab, was<br />
sicherlich auch auf Erfassungslücken<br />
zurückzuführen ist. Lestes sponsa zählt zu<br />
den häufigsten Libellen in Schleswig-<br />
Holstein.<br />
25
26<br />
MG<br />
0 MF<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Lestes virens<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 O Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
7<br />
ST SEE<br />
Jm FCC Ati Apr Mal Jur .kii Auy Pep Okt Mov DA,<br />
PF<br />
c<br />
PE
Kleine Binsenjungfer -<br />
Lestes virens (CHARPENTIER 1825)<br />
Verbreitung<br />
Lestes virens gehört nach ST. QUENTIN<br />
119601 zum holomediterranen Faunenkreis.<br />
Die Art ist von Marokko über Spanien bis<br />
Syrien, Armenien <strong>und</strong> Turkestan verbreitet.<br />
Nordwärts kommt sie bis Dänemark vor,<br />
fehlt aber auf den Britischen Inseln. In<br />
Deutschland kommt Lestes virens zwar in<br />
allen naturräumlichen Haupteinheiten vor,<br />
größere Siedlungsdichten werden aber nur<br />
aus dem Osten <strong>und</strong> Nordosten gemeldet<br />
(SCHORR 19901.<br />
Habitatansprüche<br />
Lestes virens bevorzugt mesotrophe bis<br />
eutrophe, meist saure Gewässer mit rei-<br />
cher Verlandungszone. Im Norden ist sie<br />
hauptsächlich an Moorweihern, Torfstichen<br />
mit Schwingrasen <strong>und</strong> versumpften Tüm-<br />
peln anzutreffen. Beobachtet wird sie häu-<br />
fig an flachen beziehungsweise ephemeren<br />
Gewässern. Diese Art ist an besondere kli-<br />
matische Bedingungen an den Gewässern<br />
geb<strong>und</strong>en. Neben niedrigen Wassertempe-<br />
raturen <strong>für</strong> die Larvalentwicklung werden<br />
höhere Sommertemperaturen im Flugbe-<br />
reich der Imagines benötigt. Weiterhin<br />
muß ein lückiger Riedsaum an den Gewäs-<br />
sern vorhanden sein.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Lestes virens wird aus Schleswig-Holstein<br />
schon seit Anfang des Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
gemeldet. Es läßt sich eine leichte Konzen-<br />
tration der F<strong>und</strong>e im südöstlichen Hügel-<br />
land <strong>und</strong> der südlichen Geest feststellen.<br />
Die übrigen, zumeist älteren F<strong>und</strong>e liegen<br />
dispers verteilt bis in die nördlichen Lan-<br />
desteile hinein. Viele alte F<strong>und</strong>orte konnten<br />
aktuell nicht mehr bestätigt werden, ande-<br />
rerseits sind neue Vorkommen, hauptsäch-<br />
lich im südöstlichen Hügelland <strong>und</strong> der<br />
südlichen Geest, hinzugekommen. Die<br />
Anzahl der Meldungen aus den letzten<br />
zehn Jahren ist insgesamt rückläufig, auch<br />
wenn in den letzten vier Jahren wieder ein<br />
Anstieg zu verzeichnen ist. Die Zahl der<br />
F<strong>und</strong>orte im Gesamtzeitraum ist jedoch in<br />
etwa gleich geblieben. Die weitere Entwick-<br />
lung der Art in Schleswig-Holstein sollte<br />
aufmerksam verfolgt werden. Die Selten-<br />
heit der bevorzugten Biotope <strong>und</strong> die spe-<br />
zialisierten Ansprüche an das Klima sind<br />
möglicherweise die Hauptursachen <strong>für</strong> die<br />
wenigen Nachweise von Lestes virens.<br />
27
28<br />
0<br />
Lestes viridis<br />
O S T SEE<br />
ME 1 NE PE_<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Weidenjungfer -<br />
Lestes viridis (VAN DER LINDEN 1825)<br />
Verbreitung<br />
Dieses nach DEVAI (19761 atlantomediter-<br />
rane Faunenelement ist im gesamten west-<br />
lichen Mittelmeerraum verbreitet. In<br />
Europa kommt sie nordwärts bis Däne-<br />
mark <strong>und</strong> Polen, ostwärts bis zum Kauka-<br />
sus vor. In Deutschland ist sie fast flächen-<br />
deckend verbreitet, aber selten in höheren<br />
Ab<strong>und</strong>anzen. Nach Norden hin nimmt die<br />
Siedlungsdichte ab.<br />
Habitatansprüche<br />
Lestes viridis kommt an stehenden <strong>und</strong><br />
langsam fließenden Gewässern aller Art<br />
vor, in Hochmooren im engeren Sinne fehlt<br />
sie jedoch. Häufig ist sie an künstlichen<br />
Gewässern wie Fischteichen, Baggerseen<br />
oder Gräben zu finden. Im Gegensatz zu<br />
den meisten anderen Lestiden wird eine<br />
Austrocknung der Larvengewässer nur in<br />
geringem Maße toleriert. Lestes viridis<br />
sticht ihre Eier in die Zweige von Gehölzen,<br />
deshalb müssen die Ufer der Brutgewässer<br />
mit besonnten (Weich-(Gehölzen bestan-<br />
den sein.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Lestes viridis besiedelt in Schleswig-<br />
Holstein bevorzugt das östliche Hügelland<br />
<strong>und</strong> die mittlere, beziehungsweise südliche<br />
Geest. Wie die meisten anderen<br />
Lestes-Arten meidet sie offensichtlich die<br />
Marschen. Aus den nördlichen Landestei-<br />
len liegen nur wenige Nachweise vor.<br />
Während SCHORR (1990) noch vermutete,<br />
daß die nördliche Verbreitungsgrenze mit-<br />
ten durch Schleswig-Holstein verläuft,<br />
stammt der mittlerweile nördlichste aktu-<br />
elle F<strong>und</strong>nachweis von der dänischen<br />
Grenze. Auch die Aussage von SCHMIDT<br />
(1965 <strong>und</strong> 1975 b), wonach Lestes viridis<br />
nur im Südosten des Landes <strong>und</strong> auch nur<br />
in klimatisch günstigen Jahren bodenstän-<br />
dig vorkommt, ist nicht mehr gültig. Die<br />
Art wurde gerade in den letzten zehn Jah-<br />
ren regelmäßig von vielen F<strong>und</strong>orten wie-<br />
dergemeldet. Darüber hinaus ist mit fast<br />
75 Prozent aller F<strong>und</strong>meldungen im aktuel-<br />
len Zeitraum eine Zunahme von Lestes<br />
viridis zu verzeichnen.<br />
29
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O Anfang O vor1925 1925 0 Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
30<br />
0 Platycnemis pennipes<br />
An All Aug Sep<br />
PF<br />
Dez
Federlibelle -<br />
Platycnemis pennipes (PALLAS 1771)<br />
Verbreitung<br />
Nach ST. QUENTIN (1960) ist Platycnemis<br />
pennipes ein eurosibirisches Faunenele-<br />
ment <strong>und</strong> in Europa von Nordspanien ost-<br />
wärts bis Westsibirien <strong>und</strong> Turkestan ver-<br />
breitet. Im Norden ist sie bis Südnorwegen<br />
<strong>und</strong> Mittelfinnland, im Süden bis Italien<br />
anzutreffen. In Deutschland hat die Art<br />
nach SCHORR 11990) einen Verbreitungs-<br />
schwerpunkt im Norddeutschen Tiefland.<br />
Habitatansprüche<br />
Platycnemis pennipes bevorzugt krautreiche,<br />
saubere <strong>und</strong> langsam fließende Wie-<br />
senbäche mit natürlichen Uferstrukturen,<br />
kleine Flüsse, Altwasser oder Waldseen mit<br />
Schwimmblattzone <strong>und</strong> krautreichen<br />
Ufern. Die Art wird von einigen Autoren als<br />
ubiquitär eingestuft. Jüngere Untersuchun-<br />
gen zeigen unter anderem eine Bindung an<br />
neutrale bis leicht basische Gewässer.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die Vorkommen von Platycnemis pennipes<br />
konzentrieren sich auf die Fließgewässer-<br />
systeme der südlichen Geest <strong>und</strong> des östli-<br />
chen Hügellandes. Uberraschend ist der<br />
Nachweis bei Friedrichstadt, denn er liegt<br />
weit entfernt <strong>und</strong> isoliert zu den rezenten<br />
Populationen in Geest <strong>und</strong> Hügelland.<br />
Nach MARTENS 11996) gehört Platycnemis<br />
pennipes zu den mobilen Arten <strong>und</strong> kann<br />
sich entlang der Flußniederungen relativ<br />
schnell ausbreiten. BROCKHAUS 11996)<br />
stellt dazu fest, daß die Art jedoch „nicht<br />
wanderfreudig" ist. Es ist deshalb zu vermuten,<br />
daß Platycnemis pennipes sich allmählich<br />
aus den Vorkommen in der Geest<br />
entlang der Treene bis in den Mündungs-<br />
bereich ausgebreitet hat. Diese Population<br />
ist derzeit das einzige küstennahe Vorkom-<br />
men der Art in Deutschland.<br />
31
32<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5 c ,<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
4°<br />
Q<br />
9 ORD-1<br />
8 4 a<br />
7 SEE<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Pyrrhosoma nymphula<br />
ME 1 NE<br />
0 6<br />
OST SEE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 C Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jm Aw .uq<br />
PE
Frühe Adonislibelle -<br />
Pyrrhosoma nymphula (SULZER 1776)<br />
Verbreitung<br />
Nach GEIJSKES & VAN TOL (1983) ist die<br />
Art ein adriatomediterranes Faunenele-<br />
ment. Die Verbreitung von Pyrrhosoma<br />
nymphula erstreckt sich über ganz Europa<br />
<strong>und</strong> reicht im Osten bis zum Kaukasus, im<br />
Norden bis zum Polarkreis. In Deutschland<br />
ist sie weit verbreitet <strong>und</strong> häufig.<br />
Habitatansprüche<br />
Pyrrhosoma nymphula besiedelt bei uns<br />
Gewässer aller Art. Sie findet sich sowohl<br />
in langsam fließenden als auch in allen<br />
Typen stehender Gewässer. Von vielen<br />
Autoren werden eher eutrophe Bedingun-<br />
gen beschrieben, es gibt aber auch Hin-<br />
weise auf große Vorkommen in produk-<br />
tionsarmen Klarwasserseen. Abschnitte<br />
mit höherer Vegetation am Gewässer<br />
(Hochstauden, Sträucher, Bäume) scheinen<br />
gegenüber niedrigwüchsigen Bereichen<br />
bevorzugt zu werden.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Von TIMM bereits 1906 in der Umgebung<br />
von Hamburg als ziemlich häufig einge-<br />
stuft, ist diese An heute insbesondere im<br />
süd(öst-Ilichen Landesteil weit verbreitet<br />
<strong>und</strong> häufig. Nördlich des Nord-Ostsee-<br />
Kanals nimmt die Zahl der Nachweise<br />
deutlich ab, stellenweise konnten hier auch<br />
ältere Angaben später nicht mehr bestätigt<br />
werden. Der Bereich der Marschen wird<br />
von Pyrrhosoma nymphula offensichtlich<br />
weitgehend gemieden, <strong>und</strong> auch von den<br />
nordfriesischen Inseln liegen keine Mel-<br />
dungen vor.<br />
33
^ I I I I l I<br />
A, Mal An LI Aup SAp 0.r Mov<br />
34<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Ischnura elegans<br />
ME 1 NE PE_<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
© Anfang 1 925 Onf Aan g1<br />
950 o Anfa ng 1 975 •<br />
ab 1985<br />
o '1' 1925 bis Ende 1949 bis Ende<br />
1974 bis Ende<br />
1984
Gemeine Pechlibelle -<br />
Ischnura elegans (VAN DER LINDEN 1820)<br />
Verbreitung<br />
Die Art wird von GEIJSKES & VAN TOL<br />
(19831 als adriatomediterranes Faunenele-<br />
ment bezeichnet. Das Areal von Ischnura<br />
elegans reicht von Nordwestspanien quer<br />
durch Eurasien bis zum Baikalsee. Sie fehlt<br />
in Nordskandinavien. In Deutschland ist<br />
die Art weit verbreitet <strong>und</strong> häufig.<br />
Habitatanspruche<br />
Ischnura elegans kommt in langsam<br />
fließenden <strong>und</strong> stehenden Gewässern aller<br />
Art vor, sogar Brackgewässer sowie orga-<br />
nisch stark belastete Gewässer werden als<br />
Larvallebensraum genutzt. Auch in ephe-<br />
meren Gewässern entwickelt sie sich in<br />
großer Zahl. Dagegen wird sehr saures<br />
Wasser mit pH-Werten unter 4,5 gemieden<br />
(KIKILLUS & WEITZEL 1981). Ischnura<br />
elegans besiedelt auch vom Menschen<br />
geschaffene Gewässer in den Städten.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Ischnura elegans ist eine im gesamten süd-<br />
lichen Schleswig-Holstein weit verbreitete<br />
<strong>und</strong> häufige Kleinlibelle, während nach<br />
Norden die Nachweise zurückgehen. Hier<br />
ist der Anteil älterer Meldungen (vor 1985)<br />
relativ hoch. Die Marschbereiche werden<br />
nicht so deutlich gemieden wie etwa von<br />
Pyrrhosoma nymphula, <strong>und</strong> auch von eini-<br />
gen Inseln liegen zum Teil jüngere Anga-<br />
ben vor.<br />
35
36<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
c v3<br />
Ischnura pumilio<br />
OST S E E<br />
1 ME NE ! P0<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
vor 1925<br />
o<br />
O Anfan g 1925<br />
bis Ende 1949<br />
15 Anfang 1950<br />
bis Ende 1974<br />
G Anfan g 1975<br />
bis Ende 1984<br />
• ab 1985<br />
i-<br />
Jm
Kleine Pechlibelle -<br />
Ischnura pumilio (CHARPENTIER 1825)<br />
Verbreitung<br />
Ischnura pumilio zählt nach DEVAI (1976)<br />
zum pontomediterranen Faunenkreis. Die<br />
Art kommt von Nordchina nach Westen bis<br />
England <strong>und</strong> Spanien vor. Sie ist in ganz<br />
Deutschland verbreitet, in den westlichen<br />
Landesteilen zum Teil jedoch nur in Insel-<br />
populationen. Offensichtlich hat sich<br />
Ischnura pumilio erst in den letzten ein-<br />
h<strong>und</strong>ert Jahren Richtung Nordwesten aus-<br />
gebreitet.<br />
Habitatansprüche<br />
Ischnura pumilio läßt sich oftmals als Erst-<br />
besiedler bevorzugt an kleineren, zumeist<br />
flachen bis ephemeren, mehr oder weniger<br />
vegetationsarmen <strong>und</strong> unbeschatteten<br />
Gewässern nieder. Mit dichter werdendem<br />
Bewuchs verschwindet sie aber sehr oft<br />
wieder. Weitere Nachweise liegen aus<br />
Mooren (RUDOLPH 1979) <strong>und</strong> langsam<br />
fließenden Gräben vor (BEYER 1985, zitiert<br />
in SCHORR 1990). In letzteren werden<br />
durch Unterhaltungsmaßnahmen <strong>für</strong> die<br />
Art geeignete Bedingungen geschaffen.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die frühesten ausgewerteten Angaben zum<br />
Vorkommen von Ischnura pumilio aus dem<br />
Jahre 1911 stammen von der Insel Helgo-<br />
land. ROSENBOHM bezeichnete sie 1928<br />
als in Schleswig-Holstein nicht häufig.<br />
Ältere <strong>und</strong> jüngere F<strong>und</strong>punkte decken<br />
sich vielfach, allerdings liegen aktuelle<br />
Nachweise aus den Marsch- <strong>und</strong> Küstenbe-<br />
reichen kaum mehr vor. Die Meldungen<br />
von den Inseln Amrum <strong>und</strong> Sylt stammen<br />
alle aus dem Zeitraum vor 1985 bezie-<br />
hungsweise sogar vor 1975, <strong>und</strong> auch von<br />
Helgoland fehlen neuere Daten. Nur von<br />
Föhr gibt es aktuelle Nachweise. Die<br />
rezente Verbreitung von Ischnura pumilio<br />
ist auf die mittleren <strong>und</strong> südlichen Landes-<br />
teile beschränkt, wobei die Art aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer spezielleren Ansprüche deutlich weni-<br />
ger häufig ist als Ischnura elegans.<br />
37
38<br />
MG<br />
MF<br />
Coenagrion armatum<br />
ST SEE<br />
oP<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jan fst, Nz , Jul Aug Sep Ok^ Nov Daz<br />
PF<br />
C<br />
PF
Hauben-Azurjungfer -<br />
Coenagrion armatum (CHARPENTIER 1825)<br />
Verbreitung<br />
Coenagrion armatum ist nach<br />
ST. QUENTIN (19601 ein eurosibirisches<br />
Faunenelement. Das Areal der Art erstreckt<br />
sich von den Niederlanden <strong>und</strong> Belgien im .<br />
Westen bis nach Kamtschatka im Osten<br />
zwischen dem 50. <strong>und</strong> 65. Breitengrad. In<br />
Europa wird sie rezent regelmäßig nur<br />
noch in Skandinavien, Rußland <strong>und</strong> Polen,<br />
unregelmäßig auch in Deutschland <strong>und</strong><br />
Rumänien nachgewiesen. Die Vorkommen<br />
in Schleswig-Holstein liegen nach<br />
SCHMIDT (1978 a) am Südrand des Areals.<br />
Habitatansprüche<br />
In Finnland bevorzugt Coenagrion<br />
armatum wasserstauende Lehmböden mit<br />
kleinen, vegetationsreichen Tümpeln<br />
(VALLE 1938). Nach SCHMIDT (1978 a) wer-<br />
den in Schleswig-Holstein mesotrophe, mit<br />
Seggen <strong>und</strong> Wollgras bewachsene Zwi-<br />
schen- <strong>und</strong> Heidemoorweiher besiedelt.<br />
Diese können lichtes Schilf, Schachtel-<br />
halmbestände Equisetum limosum, lockere<br />
Riedgrasrasen beispielsweise aus Carex<br />
rostrata oder Eriophorum angustifolium<br />
<strong>und</strong> eingestreute Schwimmblattbestände<br />
zum Beispiel Potamogeton oblongus oder<br />
flutende Wasserpflanzen wie Utricularia<br />
spec. <strong>und</strong> flutende Sphagnen aufweisen.<br />
KELM (1983) beschreibt einen von diesem<br />
Lebensraumtyp abweichenden F<strong>und</strong>ort in<br />
der mit lockerem Schilf- <strong>und</strong> Strand-<br />
simsen-Röhricht bestandenen Flachwas-<br />
serzone eines brackigen Marschgewässers<br />
im Hauke-Haien-Koog, Nordfriesland.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die frühesten Nachweise von Coenagrion<br />
armatum aus den Jahren 1928 bis 1932 lie-<br />
gen vom ehemaligen Silk-Teich am<br />
Dummersdorfer Ufer bei Lübeck vor, mit<br />
maximal bis zu neun Tieren im Jahr 1929<br />
(LUNAU 1932 a). Weitere Einzelf<strong>und</strong>e im<br />
südöstlichen Schleswig-Holstein aus den<br />
Jahren 1941 bis 1967 stammen von mehre-<br />
ren F<strong>und</strong>orten bei Ahrensburg, so bei-<br />
spielsweise vom Hopfenbachmoor, wo die<br />
Art in mehreren Jahren beobachtet wurde.<br />
Der einzige aktuelle F<strong>und</strong> (19881 im südöst-<br />
lichen Hügelland betrifft ein Männchen in<br />
einer Kiesgrube südlich Gudow, die<br />
benachbart zu Moorkomplexen liegt. Dort<br />
wurde die Art trotz Nachsuche in den Fol-<br />
gejahren aber nicht mehr bestätigt<br />
(ADOMSSENT 1994). Relativ häufig trat<br />
Coenagrion armatum dagegen in den Krei-<br />
sen Nordfriesland <strong>und</strong> Schleswig-Flens-<br />
burg auf. SCHMIDT (1975 b) stuft sie im<br />
Landesteil Schleswig als bodenständig ein.<br />
Seit 1982 liegen aber auch aus diesem<br />
Bereich keine neuen F<strong>und</strong>e vor. SCHORR<br />
(1990) vermutet neben anthropogenen Ein-<br />
griffen in geeignete Habitate (Moorgewäs-<br />
ser) als Hauptursache des Rückgangs der<br />
Art auch ein „vorübergehendes Ausster-<br />
ben von Populationen an der südlichen<br />
Artverbreitungsgrenze durch Austrock-<br />
nung der Gewässer in warmen Jahren" als<br />
weitere Rückgangsursache.<br />
39
40<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
5 03<br />
C5<br />
Coenagrion hastulatum<br />
OST SEE<br />
1 ME NE -<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor1925 O Anfa ng925 1 G Anfagn 1 950 Anfang 1 975 ab 1980<br />
bis Ende<br />
1949 bis Ende<br />
1974 Gnf bis Ende 1984 •<br />
AP Fob Mr: A, Mal Jun JN Aug Sep Okt N, De:
Speer-Azurjungfer -<br />
Coenagrion hastulatum (CHARPENTIER 1825)<br />
Verbreitung<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Nach ST. QUENTIN (1960) ist Coenagrion Der früheste vorliegende Nachweis von<br />
hastulatum ein eurosibirisches Faunen- Coenagrion hastulatum stammt aus dem<br />
element. Das Areal reicht von Mittel- <strong>und</strong> Jahre 1889 von der Insel Helgoland<br />
Nordeuropa ostwärts bis in das nördliche (KEILHACK 1911). Bis Ende 1949 wurde die<br />
Asien. In Europa kommt die Art von Bel- Art vorwiegend im Lübecker Raum an<br />
gien <strong>und</strong> den Niederlanden im Westen nährstoffarmen Mooren <strong>und</strong> Seen festge-<br />
über Deutschland ostwärts bis Polen <strong>und</strong> stellt. SCHMIDT (1975 b) bezeichnet sie als<br />
Rußland vor. Im Norden tritt sie in ganz „Charakterart nährstoffärmerer Flach-<br />
Skandinavien, im Süden bis in die Alpen- moore" <strong>und</strong> gibt als längerfristig besie-<br />
regionen auf. Inselartige Vorkommen gibt delte Gebiete zum Beispiel den Oldenbur-<br />
es im französischen Zentralmassiv, dem ger See, das Salemer Moor, das Deepen-<br />
Jura-Gebirge, den Vogesen <strong>und</strong> den moor <strong>und</strong> das Ratekauer Moor an. Die<br />
Pyrenäen. Angabe von FISCHER (1984 a), wonach die<br />
Art in Schleswig-Holstein überwiegend auf<br />
Habitatansprüche der Geest vorkommt, wird von den aktuellen<br />
Daten seit 1985 bestätigt. Dagegen<br />
Im Norden des Areals in der Habitatwahl scheinen viele F<strong>und</strong>orte im östlichen<br />
wenig wählerisch, bevorzugt Coenagrion Hügelland, insbesondere im Norden, in<br />
hastulatum in Mitteleuropa Moor- <strong>und</strong> neuerer Zeit nicht mehr besiedelt zu sein.<br />
Moorrandbereiche. Dort werden kleinflä- Als Ursachen kommen unter anderem<br />
chige Torfstiche oder durch schmale Torf- zunehmende Trockenlegungen von Moo-<br />
wände stark zergliederte größere Torfstich- ren <strong>und</strong> die steigende Eutrophierung nähr-<br />
komplexe als Habitat benötigt (SCHORR stoffarmer Gewässer in Betracht. Bis auf je<br />
19901. Die Art kann aber auch Teiche <strong>und</strong> ein Vorkommen von Helgoland (1889) <strong>und</strong><br />
Tümpel mit lehmigem Untergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Amrum (19721 liegen von der Nordsee-<br />
Ton-, Sand- <strong>und</strong> Kiesgruben besiedeln käste <strong>und</strong> der Marsch keine Meldungen<br />
(BENKEN 1980). Wesentliches Element vor.<br />
aller besiedelten Gewässer ist ein lockerer<br />
Riedsaum. Ein kurzfristiges Austrocknen<br />
der Larvalgewässer wird weitgehend tole-<br />
riert.<br />
41
42<br />
MG<br />
0 MF<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Coenagrion lunulatum<br />
ST SEE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Aang nf 1925<br />
bis Ende 1949<br />
OAnfang 1950<br />
Anf bis Ende1974<br />
o Aa nf ng1975 1984 • ab 1985<br />
bis Ende<br />
PF
Mond-Azurjungfer -<br />
Coenagrion lunulatum (CHARPENTIER 1840)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Coenagrion lunulatum ist nach Die früheste Beobachtung dieser Art<br />
ST. QUENTIN (1960) ein eurosibirisches gelang im Jahre 1911 auf Helgoland<br />
Faunenelement, das nach Osten bis Ostsi- (KEILHACK 1911). Bis zum Jahre 1950 wur-<br />
birien, nach Westen bis in die Niederlande den Vorkommen von Coenagrion<br />
<strong>und</strong> Belgien, nach Norden bis Nordfinn- lunulatum nahezu ausschließlich aus dem<br />
land <strong>und</strong> nach Süden bis Kleinasien vor- Lübecker Raum <strong>und</strong> dem Kreis Herzogtum<br />
kommt. In Deutschland ist nur der Norden Lauenburg bekannt. Das Fehlen älterer<br />
regelmäßig besiedelt, spärliche Vorkom- Nachweise in den nördlichen Landesteilen<br />
men liegen im Mittelgebirgsraum <strong>und</strong> erklärt SCHMIDT (1975 b) durch die kurze<br />
Alpenvorland (nach SCHORR 1990). Flugzeit <strong>und</strong> die schwierige Zugänglichkeit<br />
der Flughabitate (zum Beispiel Außenrand<br />
Habitatansprüche der Röhrichtzone). Die aktuelle Verbreitung<br />
konzentriert sich auf die Geest <strong>und</strong> das Ost-<br />
im atlantisch geprägten Klimabereich liche Hügelland. Im nördlichen <strong>und</strong> westli-<br />
scheint diese kontinentale Art sonnen- chen Landesteil sind die Vorkommen ins-<br />
exponierte Gewässer mit schneller Erwär- gesamt spärlicher als im Südosten. Von<br />
mung zu bevorzugen, vor allem dystrophe der Westküste liegen Beobachtungen vom<br />
Moorgewässer (Torfstiche), aber auch Hauke-Haien-Koog 11982) <strong>und</strong> Amrum<br />
Flachwasserbiotope wie Ton-, Sand- <strong>und</strong> (1982) vor. Das Verbreitungsbild ist dem<br />
Kiesgruben, (lehmige) Wiesentümpel, von Coenagrion hastulatum ähnlich. Mög-<br />
Krebsscherengewässer. Als wesentliche licherweise sind auch bei Coenagrion<br />
Strukturmerkmale nennt SCHMIDT (1985 a) lunulatum Habitatveränderungen durch<br />
lockere, niedrigwüchsige Riedzonen mit zunehmende Nährstoffanreicherungen <strong>und</strong><br />
vorgelagerten Beständen schwimmender Trockenlegungen der Larvalgewässer <strong>für</strong><br />
Pflanzen beziehungsweise abgestorbener den Rückgang im östlichen Landesteil ver-<br />
vorjähriger Pflanzenteile. antwortlich.<br />
43
44<br />
Coenagrion mercuriale<br />
63 ST S EE<br />
ME 1 NE \ • PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925 O Anfan g 1925 O Anfang 1950 C Anfan g 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jan<br />
Aug Sap Okl Nev 13.<br />
PF
Helm-Azurjungfer -<br />
Coenagrion mercuriale (CHARPENTIER 1840)<br />
Verbreitung<br />
Coenagrion mercuriale ist nach<br />
ST. QUENTIN (1960) ein westmediterranes<br />
Faunenelement. Das Areal der Art reicht<br />
von Nordafrika, Spanien <strong>und</strong> Italien im<br />
Süden bis Südengland im Norden, in Mit-<br />
teleuropa nordwärts bis zur Elbe, Thürin-<br />
gen <strong>und</strong> Bayern. In Deutschland liegen nur<br />
wenige F<strong>und</strong>e vor.<br />
Habitatansprüche<br />
In Mitteleuropa werden vorwiegend<br />
schmale, flache, langsam fließende sowie<br />
krautreiche Bäche <strong>und</strong> Gräben mit üppiger<br />
Ufervegetation besiedelt. Die Habitate sind<br />
oft durch Kalkreichtum <strong>und</strong> das Vorkom-<br />
men von Berle Berula erecta <strong>und</strong> Wasser-<br />
minze Mentha aquatica gekennzeichnet<br />
(SCHORR 1990). Alle F<strong>und</strong>orte sind quell-<br />
wasserbeeinflußt <strong>und</strong> frieren daher im<br />
Winter nicht zu. SCHORR vermutet hierin<br />
den wesentlichen Faktor, der das Vorkom-<br />
men der Art in Mitteleuropa bestimmt.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die wenigen Nachweise von Coenagrion<br />
mercuriale betreffen ausnahmslos den<br />
südöstlichen Landesteil <strong>und</strong> den Hambur-<br />
ger Raum. ROSENBOHM (1931) führt<br />
neben den Hamburger F<strong>und</strong>orten Eppen -<br />
dorfer Moor <strong>und</strong> Bramfeld auch den<br />
Sachsenwald auf. LUNAU (1932 a) erwähnt<br />
den F<strong>und</strong> eines männlichen Tieres vom<br />
Dummersdorfer Ufer bei Lübeck. Ein weite-<br />
res Männchen wurde 1970 an einem<br />
Brachlandtümpel im Stellmoorer Tunneltal<br />
nahe der Hamburger Landesgrenze zum<br />
Kreis Stormarn (GLITZ et al. 1989) gefan-<br />
gen. Von 1933 (23 Exemplare belegt) bis<br />
mindestens 1972 (zuletzt neun Exemplare)<br />
bestand eine individuenreiche Population<br />
am Lottseebach im Hellbachtal<br />
(SCHMIDT 1975 b), das einzige ehemals<br />
bodenständige Vorkommen in Schleswig-<br />
Holstein. Diesem dürfte auch der F<strong>und</strong><br />
eines Tieres im Jahr 1952 am Gr<strong>und</strong>losen<br />
Kolk bei Mölln (SAAGER 1977) zuzuordnen<br />
sein.<br />
45
46<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Coenagrion puella<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 b Anfang 1925 O Anfan g 1950 G • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 =WI<br />
35 -<br />
30<br />
25<br />
20<br />
Jm Feb 11,7 A, Mol .n JW Aug Sep Okt Nov Dex
Hufeisen-Azurjungfer -<br />
Coenagrion puella (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
Die Art ist nach GEIJSKES & VAN TOL<br />
(19831 ein mediterranes Faunenelement<br />
<strong>und</strong> in ganz Europa bis in den sibirischen<br />
Raum hinein verbreitet. Schottland <strong>und</strong><br />
das nördliche Skandinavien sind bis auf<br />
Einzelvorkommen nicht besiedelt. In Gebir-<br />
gen erreicht sie Höhen bis zu 1800 m. In<br />
Deutschland dürfte Coenagrion puella zu<br />
den häufigsten Libellenarten zählen. Sie<br />
kommt in allen naturräumlichen Hauptein-<br />
heiten in hoher Stetigkeit vor (SCHORR<br />
1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Coenagrion puella tritt an Gewässern aller<br />
Art auf. Sie ist Charakterart eutropher bis<br />
oligotropher Kleingewässer, aber nur spär-<br />
lich an den meisten Fließgewässern zu fin-<br />
den (LOHMANN 1980). Bevorzugt wird der<br />
dicht bewachsene Uferbereich stehender<br />
Gewässer. Wichtig <strong>für</strong> die Eiablage sind<br />
Wasserpflanzen wie Laichkraut, Froschbiß,<br />
Seerosen, Wasserschlauch oder Tausendblatt.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
ROSENBOHM (19311 bezeichnete die Art<br />
als die verbreitetste <strong>und</strong> häufigste Azur-<br />
jungfer in Schleswig-Holstein. Diese Fest-<br />
stellung wird insgesamt durch die aktuel-<br />
len Vorkommen bestätigt, auch wenn es<br />
besonders in den nördlichen Landesteilen<br />
erhebliche Verbreitungslücken im Bereich<br />
von Marsch <strong>und</strong> Geest zu geben scheint.<br />
Dieses könnte aber auch auf mangelnde<br />
Beachtung der Art bei Erfassungsarbeiten<br />
zurückzuführen sein.<br />
47
48<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Ga°<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Coenagrion pulchellum<br />
1<br />
ME NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfagn 1950 G<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 b1/42C2)79584 • ab 1985<br />
so<br />
ao<br />
.M Jul Aug Se. 0. Wv Dez
Fledermaus-Azurjungfer -<br />
Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN 1825)<br />
Verbreitung<br />
Nach ST. QUENTIN (1960) ist Coenagrion<br />
pulchellum zu den Arten des östlichen Mit-<br />
telmeeres zu rechnen, die zur eurosibiri-<br />
schen Gruppe überleiten. Auch DEVAI<br />
(1976) zählt sie zum pontomediterranen<br />
Faunenkreis. Die Art ist in ganz Europa <strong>und</strong><br />
Teilen Asiens bis zum Altai, nach Norden<br />
bis Mittelfinnland verbreitet. SCHORR<br />
(19901 stellt zwar in Deutschland wie über-<br />
all in Europa ein fast flächendeckendes<br />
Vorkommen fest, weist aber auch auf zum<br />
Teil größere Verbreitungslücken hin.<br />
Habitatansprüche<br />
Diese euryöke Coenagrionide besiedelt<br />
vorzugsweise eutrophe, stehende Gewäs-<br />
ser wie Seen mit Schilfsäumen <strong>und</strong> See-<br />
rosenzonen, Weiher <strong>und</strong> Teiche, Tongru-<br />
ben, nährstoffreiche Flachmoore,<br />
vegetationsreiche Gräben in der Marsch<br />
<strong>und</strong> Wiesenbäche. Coenagrion pulchellum<br />
wird mitunter in Brackwassern mit bis zu<br />
7 %a Salzgehalt festgestellt. Die Art ent-<br />
wickelt sich auch in ephemeren Gewäs-<br />
sern (SCHMIDT, B. 1991).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Das Verbreitungsbild von Coenagrion<br />
pulchellum gleicht dem von C. puella. Das<br />
Vorkommen ist in den südlichen <strong>und</strong> zum<br />
Teil mittleren Landesteilen insgesamt sehr<br />
viel geschlossener als im Norden. Verbrei-<br />
tungslücken finden sich innerhalb der<br />
Marsch <strong>und</strong> Geest <strong>und</strong> besonders in den<br />
Kreisen Nordfriesland <strong>und</strong> Schleswig-<br />
Flensburg. Sofern da<strong>für</strong> aber nicht Erfas-<br />
sungsmängel verantwortlich sind, kann<br />
nicht - wie noch vor wenigen Jahren<br />
(SCHORR 1990) - von einer geschlossenen<br />
Verbreitung in Schleswig-Holstein gespro-<br />
chen werden.<br />
49
50<br />
0<br />
e<br />
Enallagma cyathigerum<br />
• o<br />
OSTSEE<br />
••<br />
ME 1 NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfa ng1925<br />
O A an 1 950 G Anfan g 1 975 • ab 1985<br />
bis Ende<br />
1 949 bisnf Engde 1974 bis Ende 1984<br />
zo<br />
1s
Becher-Azurjungfer -<br />
Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER 1840)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Enallagma cyathigerum ist nach DEVAI<br />
11976) <strong>und</strong> ST. QUENTIN (1960) ein sibiri-<br />
sches Faunenelement <strong>und</strong> circumpolar<br />
beziehungsweise holarktisch verbreitet. In<br />
Europa kommt sie vom Mittelmeer bis<br />
nördlich des Polarkreises vor. Im Bereich<br />
der südlichen Verbreitungrenze ist die Art<br />
nur in höheren Lagen anzutreffen, in den<br />
Alpen bis zu 2000 m über NN (KNAPP et al.<br />
1983). In Deutschland kommt Enallagma<br />
cyathigerum flächendeckend vor.<br />
Habitatansprüche<br />
Diese euryöke Art kommt an allen Gewäs-<br />
sertypen vor. Sie sollten aber eine größere<br />
offene Wasserfläche, gute Besonnung<br />
sowie flutende Vegetation <strong>und</strong> lichten<br />
Schwimmpflanzenbewuchs aufweisen.<br />
Auch langsam fließende Gewässer werden<br />
besiedelt, diese dürfen aber nicht zu<br />
schmal sein (DONATH 1980). Eine Entwick-<br />
lung erfolgt ebenfalls in ephemeren<br />
Gewässern (SCHMIDT, B. 1991).<br />
Enallagma cyathigerum ist in den südli-<br />
chen Landesteilen Schleswig-Holsteins<br />
nahezu flächendeckend verbreitet <strong>und</strong> aus<br />
den meisten Gebieten mit F<strong>und</strong>en aus dem<br />
Zeitraum seit 1985 belegt. Im Norden <strong>und</strong><br />
Westen (Küsten, Marsch <strong>und</strong> Geest) ist das<br />
Vorkommen lückenhaft. Insgesamt ergibt<br />
sich ein Verbreitungsmuster, das dem von<br />
Coenagrion puella <strong>und</strong> C. pulchellum sehr<br />
ähnlich ist.<br />
51
52<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Erythromma najas<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfa ng 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1 974 bis Ende<br />
1984<br />
20<br />
15—<br />
10—<br />
,m ieb Mrr Apr M01 An LI A1p Sep Okl N0v Der
Großes Granatauge -<br />
Erythromma najas (HANSEMANN 1823)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Erythromma najas ist nach ST. QUENTIN Erythromma najas kommt vor allem im<br />
(1960) <strong>und</strong> DEVAI (1976) ein eurosibirisches östlichen Hügelland <strong>und</strong> im Süden der<br />
Faunenelement. GEIJSKES & VAN TOL Geest in hoher Stetigkeit vor. Für dén<br />
(1983) geben sie als holomediterran an. Lübecker Raum führt SCHMIDT (1975 b)<br />
Das Verbreitungsbild der Art spricht jedoch zahlreiche F<strong>und</strong>orte an, die über einen lan-<br />
eher <strong>für</strong> erstere Annahme. Im Osten gen Zeitraum besiedelt waren, wie Lottsee<br />
erreicht Erythromma najas die Ostküste (1930 bis 1972) oder Krebssee (1930 bis<br />
Sibiriens, nördlich den Polarkreis <strong>und</strong> süd- 1969). Zahlreiche neue F<strong>und</strong>orte in südli-<br />
lich Nordafrika. In Europa sind Nordskandi- chen <strong>und</strong> östlichen Landesteilen wurden<br />
navien, Schottland <strong>und</strong> der mediterrane innerhalb der letzten fünf Jahre durch<br />
Raum in weiten Teilen nicht oder nur punk- zunehmende Kartierungsaktivitäten<br />
tuell besiedelt. In Deutschland liegen Ver- erbracht. Nach Westen <strong>und</strong> Norden wer-<br />
breitungsschwerpunkte in den Flußauen den die Vorkommen zunehmend spärli-<br />
<strong>und</strong> im Bereich größerer Seen (SCHORR cher. Nördlich einer Linie Husum - Eckern-<br />
1990). förde liegen nur drei aktuelle Nachweise<br />
aus dem Zeitraum seit 1985 vor. Das ein-<br />
Habitatansprüche zige Vorkommen an der Westküste<br />
(Amrum) stammt aus dem Jahre 1972. Bei-<br />
Bevorzugt werden größere Gewässer oder spiele <strong>für</strong> die Salinitätstoleranz der Art sind<br />
langsam fließende Flußabschnitte sowie Vorkommen an der Ostseeküste wie am<br />
Gräben mit breit ausgebildeten Schwimm- Grünen Brink auf Fehmarn.<br />
blattzonen <strong>und</strong> offenen Wasserflächen. Die<br />
Art kommt auch in Brackwasserbereichen<br />
der Ostsee bis zu einem Salinitätsgehalt<br />
von 6,6 %o vor. Für die erfolgreiche Repro-<br />
duktion der Art ist neben einer Schwimm-<br />
blattzone auch ein Riedsaum <strong>für</strong> das<br />
Schlüpfen der Larven von Bedeutung<br />
(SCHORR 1990).<br />
53
54<br />
Erythromma viridulum<br />
2<br />
0 ST SEE<br />
1 ME NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 M Anfa ng1925<br />
bis Ende<br />
1949<br />
41 Aa nf ng 1950 bis Ende<br />
1974<br />
G Ana f ng 1975<br />
bis End e 1984<br />
• ab 1985
Kleines Granatauge -<br />
Erythromma viridulum (CHARPENTIER 1840)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Nach DEVAI (1976) gehört die Art zu den<br />
pontomediterranen Faunenelementen. Das<br />
Areal von Erythromma viridulum reicht<br />
von Armenien über Polen, Holland, Frank-<br />
reich bis nach Spanien <strong>und</strong> Nordafrika. Der<br />
Verbreitungsschwerpunkt liegt im mediter-<br />
ranen Raum. Die Vorkommen in Mitteleu-<br />
ropa sind spärlich bis lokal begrenzt. In<br />
Deutschland liegen Nachweise aus vielen<br />
Regionen vor, wobei es sich meist um<br />
kleine lokale Vorkommen handelt.<br />
Habitatansprüche<br />
Erythromma viridulum bevorzugt Gewäs-<br />
ser mit gut ausgebildeten Schwimm- <strong>und</strong><br />
Tauchpflanzenzonen. Dieses können See-<br />
ufer, nährstoffreiche Teiche, Altwasser,<br />
Baggerseen <strong>und</strong> Gräben sein, die eine<br />
möglichst reichhaltige submerse Vegeta-<br />
tion zum Beispiel aus Ceratophyllum<br />
demersum oder Myriophyllum spec. auf-<br />
weisen sollten, die die Art als Eiablage-<br />
substrat benötigt. Aber auch in Beständen<br />
von Wasserpest Elodea canadensis <strong>und</strong><br />
anderen sowie in Algenwatten kann sie<br />
gef<strong>und</strong>en werden (MARTENS 1985,<br />
JODICKE & SENNERT 19861.<br />
Erstmals wurde Erythromma viridulum in<br />
Schleswig-Holstein im Jahr 1969 im Kie-<br />
bitzmoor bei Ahrensburg/Kreis Stormarn<br />
beobachtet. Erst 1984 gelang ein zweiter<br />
Nachweis bei Appen/Kreis Pinneberg. Seit<br />
1991 häufen sich Nachweise aus dem Kreis<br />
Herzogtum Lauenburg, dem Lübecker<br />
Raum sowie von der Geest bei Kaltenkir-<br />
chen, Quickborn <strong>und</strong> Neumünster. Die Art<br />
scheint aufgr<strong>und</strong> ihrer gegenwärtigen Ten-<br />
denz zur Arealausweitung Schleswig-<br />
Holstein zunehmend in Richtung Norden<br />
<strong>und</strong> Westen zu besiedeln. So ist sie 1995<br />
bereits an der Nordseeküste beim Spei-<br />
cherkoog Meldorf nachgewiesen worden.<br />
JACOB (1969) postuliert <strong>für</strong> das Vorkom-<br />
men <strong>und</strong> die Ausbreitung von Erythromma<br />
viridulum ein „günstiges Großklima", wie<br />
es insbesondere <strong>für</strong> die Stromtäler fest-<br />
stellbar ist. SCHORR (19901 wirft die Frage<br />
auf, ob die Art sich möglicherweise je nach<br />
Klima innerhalb einer Fluktuationszone<br />
bewegt. Beide Einschätzungen könnten<br />
auch Dispersion <strong>und</strong> Dispersal der Art in<br />
Schleswig-Holstein über das wärmebegün-<br />
stigte (südöstliche) Hügelland <strong>und</strong> Elbetal<br />
erklären. Weiterhin dürften zudem die war-<br />
men Sommer Anfang der 90er Jahre die<br />
Zunahme dieser thermophilen Art gefördert<br />
haben.<br />
55
56<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Ceriagrion tenellum<br />
O ST S EE<br />
ME I NE r^ P<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925 O Anfan g 1925<br />
bis Ende 1949<br />
O Anfan g 1950<br />
bis Ende 1974<br />
G Anfan g 1975<br />
bis Ende 1984<br />
• ab 1985<br />
f•
Späte Adonislibelle -<br />
Ceriagrion tenellum (DE VILLERS 1789)<br />
Verbreitung<br />
Ceriagrion tenellum ist nach ST. QUENTIN<br />
(1960) ein westmediterranes Faunenele-<br />
ment. Das Areal der Art in Europa umfaßt<br />
Südengland, Frankreich, die Benelux-Län-<br />
der sowie die Nordschweiz. In Deutschland<br />
liegen Schwerpunkte im Bodenseeraum, in<br />
der Schwäbischen Alb <strong>und</strong> am Nieder-<br />
rhein. Seltener ist sie im Norddeutschen<br />
Tiefland, hier kommt sie vor allem in<br />
Hochmooren Niedersachsens vor. Die Art<br />
kann bis nach Schleswig-Holstein vordrin-<br />
gen.<br />
Habitatansprüche<br />
In Mitteleuropa liegen die bevorzugten<br />
Habitate im Bereich der Flach-, Heide- <strong>und</strong><br />
Hochmoorgewässer, aber auch an fließen-<br />
den Gewässern (vergleiche JURZITZA 1964).<br />
Im Nordosten ist Ceriagrion tenellum<br />
tyrphophil (CLAUSNITZER 1981, PEUS<br />
1932). In Süddeutschland <strong>und</strong> der Schweiz<br />
ist sie Leitart der Schlenken der Kalkquell-<br />
moore <strong>und</strong> -sümpfe des Bodenseeraumes,<br />
vor allem in Mehlprimel-Kopfbinsenrieden<br />
(nach BUCHWALD 1983 a, FRANKE 1981,<br />
HUBER 1983). In Norddeutschland werden<br />
mineralbodenbeeinflußte Hochmoore<br />
besiedelt. Im Naturschutzgebiet Fischbeker<br />
Heide im Südwesten Hamburgs kam die<br />
Art in einem Hangquellmoor vor. Die Vege-<br />
tation war hier durch Gagelstrauch, Ähren-<br />
lilie <strong>und</strong> Lungenenzian dominiert. Das<br />
Gewässer bestand aus einem kleinen<br />
Moorweiher mit Torfmoos-Schwingrasen.<br />
Die adulten Tiere hielten sich bevorzugt im<br />
Wollgrasstreifen Eriophorum<br />
angustifolium, nicht jedoch in den Gagel-<br />
strauchbeständen auf.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Ceriagrion tenellum wurde in Schleswig-<br />
Holstein erstmals 1928 in einem Moor süd-<br />
lich Mölln festgestellt (ROSENBOHM 1928).<br />
Das einzige bodenständige Vorkommen<br />
dieser mediterranen Art bestand von 1938<br />
bis 1946 an dem dystrophen, hochmoor-<br />
ähnlichen Gr<strong>und</strong>losen Kolk bei Mölln<br />
(LUNAU 1939, SCHMIDT, 1975 b(. In späte-<br />
ren Jahren wurde die Art dort trotz intensi-<br />
ver Kontrollen nicht wieder nachgewiesen.<br />
SCHMIDT (1975 b) weist auf die klimatisch<br />
günstige Situation in diesem Gebiet<br />
während der Besiedlungsdauer hin. Auf<br />
Ceriagrion tenellum sollte besonders<br />
geachtet werden, da sie erneut nach Nor-<br />
den vorzudringen scheint. CLAUSNITZER<br />
(1996) berichtet, daß die Art in der nieder-<br />
sächsischen Südheide mittlerweile sogar<br />
an Gewässern in Städten zu beobachten<br />
ist.<br />
57
58<br />
0<br />
ME<br />
Nehalennia speciosa<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 o Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jm<br />
0 ST SE E<br />
Feb A, Aug De,
Zwerglibelle -<br />
Nehalennia speciosa (CHARPENTIER 1840)<br />
Verbreitung<br />
Nehalennia speciosa gehört als kleinste<br />
europäische Libelle zum eurosibirischen<br />
Faunenkreis (ST. QUENTIN 1960). Ihre<br />
westliche Verbreitungsgrenze erreicht die<br />
Art in den Niederlanden <strong>und</strong> Belgien, im<br />
Osten kommt sie bis Japan vor. In<br />
Deutschland scheint ihr Verbreitungs-<br />
schwerpunkt im Bereich des voralpinen<br />
Hügel- <strong>und</strong> Moorlandes zu liegen.<br />
Habitatansprüche<br />
Nehalennia speciosa besiedelt insbeson-<br />
dere Verlandungszonen von Torfgewässern<br />
<strong>und</strong> Seggensümpfe mit lockerem, rasigem<br />
Wuchs bei konstant niedrigem Wasser-<br />
stand <strong>und</strong> eher nährstoffarmen Bedingun-<br />
gen. Entscheidend ist nach DE MARMELS<br />
& SCHIESS (1977), daß die Vegetation<br />
30 bis 40 cm hoch ist <strong>und</strong> 70 Prozent der<br />
Gr<strong>und</strong>fläche deckt, wobei die Halme<br />
gleichmäßig dicht stehen, aber keine Hor-<br />
ste bilden.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die frühesten Meldungen von Nehalennia<br />
speciosa stammen aus dem Kreis Storman<br />
<strong>und</strong> datieren aus dem Jahre 1928. In der<br />
Umgebung von Ahrensburg - so im Hop-<br />
fenbachmoor <strong>und</strong> im Naturschutzgebiet<br />
Stellmoorer Tunneltal - ist sie auch später<br />
noch gef<strong>und</strong>en worden, während aus dem<br />
Deepenmoor bei Lübeck nur ein Einzel-<br />
f<strong>und</strong> aus 1942 vorliegt. Das letzte bekannt-<br />
gewordene Vorkommen in der Region<br />
wurde Anfang der 80er Jahre innerhalb<br />
der Hamburger Landesgrenze im Natur-<br />
schutzgebiet Duvenstedter Brook belegt<br />
(GLITZ mündlich).<br />
59
60<br />
0<br />
Gomphus flavipes<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jon<br />
ST S EE<br />
ME I NE E
Asiatische Keiljungfer -<br />
Gomphus flavipes (CHARPENTIER 1825)<br />
Verbreitung<br />
Dieses nach DEVAI (1976) eurosibirische<br />
Faunenelement ist nach Osten von der<br />
Oder bis zum Amur in Sibirien weit ver-<br />
breitet. Nach Norden reicht das Areal bis<br />
zum 60. Breitengrad, im Süden werden der<br />
Irak <strong>und</strong> die Türkei erreicht. In Europa ist<br />
Gomphus flavipes westlich von Oder <strong>und</strong><br />
Spree nur noch in Inselpopulationen in<br />
Frankreich <strong>und</strong> Italien anzutreffen. In den<br />
westlichen B<strong>und</strong>esländern war die Art seit<br />
mehr als 50 Jahren verschollen.<br />
BRUMMER & MARTENS (19941 fanden<br />
Gomphus flavipes jedoch 1992, 1993 <strong>und</strong><br />
1994 an der Mittleren Elbe in einem boden-<br />
ständigen Vorkommen wieder. Aktuell<br />
konnten MÜLLER & STEGLICH (19971 auch<br />
Reproduktionsnachweise unter anderem<br />
<strong>für</strong> die Elbe bei Lauenburg <strong>und</strong> die Weser<br />
bei Bremen erbringen. Den derzeit west-<br />
lichsten F<strong>und</strong> melden HABRAKEN &<br />
CROMBAGHS (1997) aus Nijmegen in den<br />
Niederlanden.<br />
Habitatansprüche<br />
Gomphus flavipes ist an warmkontinenta-<br />
les Klima geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> besiedelt bevor-<br />
zugt das Potamal der Fließgewässer<br />
(LOHMANN 1980). Die Larven scheinen<br />
langsam fließende Abschnitte <strong>und</strong> Buchten<br />
mit feinsandigem bis leicht schlammigem<br />
Untergr<strong>und</strong> zu bevorzugen. BRUMMER &<br />
MARTENS geben <strong>für</strong> die Elbe als wichtig-<br />
ste F<strong>und</strong>habitate der Larven die Gleithangzonen<br />
an.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Bis vor kurzem galt Gomphus flavipes in<br />
Schleswig-Holstein als bereits seit Anfang<br />
dieses Jahrh<strong>und</strong>erts verschollen. TIMM<br />
(1906) fand die Art erstmalig 1901 bei Lau-<br />
enburg <strong>und</strong> bei Geesthacht. Der zweite <strong>und</strong><br />
bis 1996 letzte Nachweis stammt von 1912<br />
bei Geesthacht (Sammler unbekannt;<br />
Belegexemplare im Zoologischen Institut<br />
der Universität Hamburg). Westlich dieser<br />
F<strong>und</strong>orte gab es nur 1929 einen Nachweis<br />
bei Neugraben (Hamburg) <strong>und</strong> sieben wei-<br />
tere in den Niederlanden (GEIJSKES &<br />
VAN TOL 1983). Auffällig ist bei diesen<br />
F<strong>und</strong>en, daß sie fast zeitgleich mit denen<br />
bei Geesthacht <strong>und</strong> Lauenburg auftraten:<br />
ein Nachweis 1878, fünf 1900 <strong>und</strong> der<br />
letzte von 1902. Alle diese F<strong>und</strong>e liegen<br />
außerhalb der West-Verbreitungsgrenze<br />
der Art. Es ist zu vermuten, daß sich<br />
Gomphus flavipes, begünstigt durch ver-<br />
schiedene Faktoren <strong>und</strong> Ereignisse (intakte<br />
Bruthabitate in den Strömen, Klima <strong>und</strong><br />
weitere) am Anfang dieses Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
dispers, aber unstetig nach Westen ausge-<br />
breitet hat, ohne jedoch wirklich boden-<br />
ständig zu werden. Nach dem Wegfall die-<br />
ser Begünstigungen ist die Art innerhalb<br />
weniger Jahre von diesen Orten wieder<br />
verschw<strong>und</strong>en. Anthropogene Einflüsse<br />
dürften da<strong>für</strong> jedenfalls nicht verantwort-<br />
lich gewesen sein. Die aktuellen Nach-<br />
weise von Exuvien <strong>und</strong> frisch geschlüpften<br />
Imagines, die fast zeitgleich in Niedersach-<br />
sen, Schleswig-Holstein <strong>und</strong> den Nieder-<br />
landen erfolgten, bestätigen diese Hypo-<br />
these. Die Beobachtungen in Schleswig-<br />
Holstein aus dem Jahr 1997 konnten aus<br />
technischen Gründen nicht mehr in der<br />
Verbreitungskarte berücksichtigt werden.<br />
Nach SUHLING & MULLER (1996) hat die<br />
An einen drei- bis vierjährigen Lebens-<br />
zyklus. Deshalb muß ein Einflug aus den<br />
östlichen Population während der letzten<br />
Wärmephase 1994 <strong>und</strong> 1995 erfolgt sein.<br />
Gomphus flavipes gehört dennoch nicht<br />
zur einheimischen Libellenfauna. Die Vor-<br />
kommen der Art an der Mittleren Elbe <strong>und</strong><br />
der Havel bilden seit jeher die nordwestli-<br />
che Verbreitungsgrenze, die MÜLLER<br />
(1995) hier als „pulsierende Arealgrenze"<br />
bezeichnet. Migrationen nach Westen über<br />
diese Grenze hinaus erfolgen offensichtlich<br />
nur unter günstigen Bedingungen <strong>und</strong> in<br />
großen Zeitabständen. Solche Populatio-<br />
nen können sich in der Regel aber nur<br />
kurzzeitig halten.<br />
61
62<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5s 3<br />
4Q<br />
3<br />
CZ<br />
2<br />
1<br />
0<br />
na<br />
9 ORD-<br />
8<br />
40<br />
7 SF.F.<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2 ^<br />
Gomphus pulchellus<br />
O STSEE<br />
I ME NE<br />
PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
vor 1925<br />
o<br />
OAnfang 1925<br />
bis Ende 1949<br />
O Anfang 1950<br />
bis Ende 1974<br />
C Anfan g 1975<br />
bis Ende 1984<br />
• ab 1985<br />
Jan iao Ike epr Mnl .kw JU<br />
Okl Nov
Westliche Keiljungfer -<br />
Gomphus pulchellus SELYS 1840<br />
Verbreitung<br />
Gomphus pulchellus ist nach GEIJSKES &<br />
VAN TOL (1983) ein atlantomediterranes<br />
Faunenelement <strong>und</strong> ist im Westen von Por-<br />
tugal über Spanien bis Frankreich verbrei-<br />
tet. In der Schweiz, Deutschland <strong>und</strong> den<br />
Benelux-Staaten ist die Art nur mit inselar-<br />
tigen Vorkommen anzutreffen. Nach<br />
RUDOLPH (1980) ist Gomphus pulchellus<br />
sowohl in östliche als auch nördliche Rich-<br />
tung in Ausbreitung begriffen.<br />
Habitatansprüche<br />
Gomphus pulchellus ist hauptsächlich an<br />
stehenden Gewässern anzutreffen. Sie<br />
bevorzugt größere Gewässer mit vegetati-<br />
onsarmen bis -freien Ufern aus Ton, Lehm,<br />
Sand oder Kies, wird aber auch in ruhigen<br />
Abschnitten von Fließgewässern <strong>und</strong> an<br />
Altarmen nachgewiesen. Die Art benötigt<br />
offensichtlich eine gewisse Mindestgröße<br />
der freien Wasserfläche sowie vegetations-<br />
freie Teilbereiche der Ufer <strong>und</strong> tritt häufig<br />
als Erstbesiedler von Kies- <strong>und</strong> Tongruben<br />
in Erscheinung.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
In Schleswig-Holstein konnte Gomphus<br />
pulchellus bisher erst einmal (19921 mit<br />
zwei Männchen in einer Kreideabbaugrube<br />
im Kreis Steinburg nachgewiesen werden.<br />
Ob die Art dort auch tatsächlich reprodu-<br />
ziert hat, ist zunächst zweifelhaft, da keine<br />
Weibchen beobachtet wurden. Nur über<br />
Larvenf<strong>und</strong>e beziehungsweise den Nach-<br />
weis geschlüpfter Tiere am Gewässer (vier<br />
bis fünfjährige Larvalentwicklung) könnte<br />
innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Fort-<br />
pflanzungsnachweis erbracht werden.<br />
RUDOLPH dokumentiert 1980 noch eine<br />
großflächige Arealausweitung <strong>für</strong> das<br />
westliche <strong>und</strong> nordwestliche Deutschland,<br />
unterstützt durch Baggerseen <strong>und</strong> Kiesgru-<br />
ben. Er setzt die Vagilität von Gomphus<br />
pulchellus mit der von Sympetrum<br />
pedemontanum gleich. Möglicherweise<br />
spielen bei dem großräumigen Dispersal<br />
beider Arten die Systeme der großen<br />
Flüsse <strong>und</strong> Kanäle eine entscheidende<br />
Rolle. Ein Einflug in den Elberaum hätte<br />
dann aus den östlich von Hannover liegen-<br />
den Populationen über Aller <strong>und</strong> Elbe-<br />
Seitenkanal erfolgen können.<br />
63
64<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
5 6 7 8<br />
O vor 1925<br />
Gomphus vulgatissimus<br />
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O Anfang 1 925 O Anfang<br />
1 950 Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende<br />
1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Gemeine Flußjungfer -<br />
Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Dieses nach ST. QUENTIN (19601 eurosibi- Gomphus vulgatissimus besiedelt in<br />
rische Faunenelement ist von Nordwest- Schleswig-Holstein fast ausschließlich das<br />
spanien bis zum Ural <strong>und</strong> nach Norden bis östliche Hügelland. Aus der Geest liegen<br />
Südengland sowie Südfinnland verbreitet. nur fünf Nachweise vor, von denen drei<br />
In Deutschland ist die Verbreitung von ältere aus der südlichen Geest (Hamburger<br />
Gomphus vulgatissimus flächendeckend. Geestring) stammen <strong>und</strong> zwei aktuelle in<br />
Daß die Art früher jedoch überall häufig der Schleswiger Vorgeest an der Treene<br />
war (vgl. SCHORR 1990), muß bezweifelt <strong>und</strong> der Bredstedt-Husumer Geest erbracht<br />
werden. Allenfalls kann angenommen wer- werden konnten. Die Anzahl der Nach-<br />
den, daß sie lokal häufig vorkommen weise hat in den letzten zehn Jahren um<br />
konnte. fast 50 Prozent zugenommen. Allerdings<br />
ist auch feststellbar, daß viele ehemalige<br />
Habitatansprüche Vorkommen an Fließgewässern mittler-<br />
weile erloschen sind. Andererseits konnten<br />
Gomphus vulgatissimus besiedelt bevor- durch verstärkte Erfassungsaktivitäten<br />
zugt langsam bis schnell fließende Bäche, viele bisher unbekannte oder vielleicht<br />
Flüsse <strong>und</strong> Kanäle, ist aber auch häufig an sogar neu entstandene Populationen in<br />
Brandungsufern von Seen zu finden. Es den letzten fünf Jahren festgestellt werden.<br />
werden auch Seeufer angenommen, deren Auffällig ist, daß Neuansiedlungen insbe-<br />
Pioniercharakter durch Wellenschlag von sondere an Brandungsufern größerer Seen<br />
häufigem Bootsverkehr hervorgerufen beobachtet werden. Schon SCHORR<br />
wird (SCHMIDT 1984). Das Vorkommen ist bemerkt 1990 <strong>für</strong> die B<strong>und</strong>esrepublik eine<br />
offensichtlich an eine sommerliche Min- auffallende Zunahme der Nachweise von<br />
desttemperatur des Gewässers geb<strong>und</strong>en. Gomphus vulgatissimus. Die Bestandsent-<br />
Die Larven benötigen offene, vegetations- wicklung der Art in Schleswig-Holstein ist<br />
arme Wasserstellen mit feinkörnigem in Zukunft aufmerksam zu verfolgen.<br />
Untergr<strong>und</strong> (NIEHUIS 1984).<br />
65
66<br />
0<br />
O RD-<br />
SEE<br />
0<br />
Ophiogomphus cecilia<br />
O ST SEE<br />
ME 1 NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Grüne Keiljungfer -<br />
Ophiogomphus cecilia (FOURCROY 1785)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Dieses nach ST. QUENTIN (1960) eurosibi-<br />
rische Faunenelement hat seinen Verbrei-<br />
tungsschwerpunkt in Zentralasien, in<br />
Europa kommt die Art in meist unbestän-<br />
digen Inselpopulationen westwärts bis<br />
Frankreich vor. Im Norden tritt sie lediglich<br />
in Mittelfinnland mit bodenständigen<br />
Populationen auf. In Deutschland konzen<br />
triert sich das Vorkommen von<br />
Ophiogomphus cecilia auf die östlichen<br />
Landesteile. Nachweise zur Bodenständig-<br />
keit liegen auch aus der Lüneburger Heide<br />
<strong>und</strong> der Nordheide vor.<br />
Habitatansprüche<br />
Ophiogomphus cecilia tritt im Hyporhithral<br />
bis Epipotamal von Fließgewässern mit<br />
kiesig-sandigem Untergr<strong>und</strong> auf. Die Art<br />
bevorzugt dabei waldige Gewässerberei-<br />
che mit Lichtungen oder Fließgewässer an<br />
Waldrändern. Die Larven halten sich<br />
wegen ihres hohen Sauerstoffbedarfs in<br />
Bereichen mit stärkerer Strömung auf.<br />
Aus Schleswig-Holstein sind keine aktuellen<br />
Vorkommen von Ophiogomphus cecilia<br />
bekannt. Erstmalig wurde die Art 1872 von<br />
BEUTHIN an der Bille bei Friedrichsruh<br />
nachgewiesen. Einem weiteren Nachweis<br />
aus dem Jahr 1912 bei Geesthacht folgte<br />
erst 1976 der bisher letzte F<strong>und</strong> eines<br />
Männchens vom Hellbach (Mölln). Ein vier-<br />
ter Nachweispunkt wurde dem Hamburger<br />
Atlas (GLITZ et al. 1989) entnommen. Alle<br />
vier F<strong>und</strong>orte liegen dicht beieinander im<br />
Südost-Zipfel von Schleswig-Holstein,<br />
wobei nur die beiden älteren Vorkommen<br />
in der Lauenburger Geest möglicherweise<br />
autochthon gewesen sind. Sie lagen nicht<br />
weit entfernt von den Populationen in der<br />
Luheheide (Winsen) <strong>und</strong> der Nordheide<br />
(Buchholz). Nach ZESSIN & KÖNIGSTEDT<br />
(1993) fehlt Ophiogomphus cecilia in Mecklenburg.<br />
Ein Einflug dieser in Schleswig-<br />
Holstein verschollenen Art könnte am ehe-<br />
sten aus den nicht weit entfernten<br />
niedersächsischen Vorkommen erfolgen,<br />
zumal diese am Nordwestrand des Verbreitungsareals<br />
liegen. In den nächsten Jahren<br />
sollte verstärkt auf Ophiogomphus cecilia<br />
geachtet werden.<br />
67
6 8<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925<br />
Brachytron pratense<br />
O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
so<br />
S-<br />
A,
Kleine Mosaikjungfer -<br />
Brachytron pratense (MÜLLER 1764)<br />
Verbreitung<br />
Nach ST. QUENTIN (19601 ist Brachytron<br />
pratense ein pontomediterranes Faunen-<br />
element. Ihre Verbreitung reicht im Westen<br />
bis Irland <strong>und</strong> Frankreich, im Norden bis<br />
Mittelfinnland <strong>und</strong> im Osten bis in den<br />
Bereich des Kaukasus. In Deutschland ist<br />
die Art nach SCHORR (19901 zwar weit ver-<br />
breitet, aber in vielen Regionen nur spär-<br />
lich nachgewiesen. Mittelgebirge werden<br />
anscheinend gemieden.<br />
Habitatansprüche<br />
Diese Frühjahrsart besiedelt bevorzugt ste-<br />
hende <strong>und</strong> langsam fließende Gewässer<br />
mit gut ausgebildeten Röhrichtgürteln,<br />
insbesondere Altwasser <strong>und</strong> Weiher mit<br />
dichter Vegetation <strong>und</strong> angrenzenden<br />
Erlenbruch- <strong>und</strong> Auwäldern. Reine Schilf-<br />
röhrichte werden nach PETERS (1987)<br />
jedoch gemieden. Die Entwicklung kann<br />
auch in ephemeren Gewässern erfolgen<br />
(SCHMIDT, B. 1991). Viele Beobachtungen<br />
in Schleswig-Holstein stammen von Grä-<br />
ben. An der Ostsee tritt sie auch in Brack-<br />
wasserröhrichten in Bereichen mit bis zu<br />
4,6 %o Salzgehalt auf (MIELEWCZYK 1970).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Brachytron pratense ist in Schleswig-<br />
Holstein zwar weit verbreitet, die F<strong>und</strong>-<br />
dichte nimmt aber im Bereich der Küsten-<br />
marschen, der nördlichen Geest <strong>und</strong> im<br />
nördlichen Hügelland stark ab. In vielen<br />
früher besiedelten Bereichen (SCHMIDT<br />
1977 c) ist sie aktuell nicht mehr nachge-<br />
wiesen worden. Brachytron pratense wird<br />
wie viele Frühjahrsarten bei wenig intensi-<br />
ven Untersuchungen leicht übersehen.<br />
69
70<br />
Aeshna affinis<br />
OST SE V,<br />
ME I NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1 925 O Anfan gO Anfang<br />
bis Ende<br />
G Anfan 1 • ab 1985<br />
1925<br />
1950<br />
1949 bis Ende 1974 bis Engd 975<br />
e 1984<br />
aa
Südliche Mosaikjungfer -<br />
Aeshna affinis VAN DER LINDEN 1820<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Nach DEVAI (1976) ist Aeshna affinis ein Der erste veröffentlichte Nachweis von<br />
holomediterranes Faunenelement. Aeshna affinis stammt aus dem Jahre 1994<br />
ST. QUENTIN (19601 zählt die Art dagegen von einem versumpften Kleingewässer im<br />
zum eurosibirischen Faunenkreis, aller- Kreis Segeberg, an dem am 23. August des<br />
dings mit mediterranem Verbreitungsbild. Jahres ein einzelnes Männchen gef<strong>und</strong>en<br />
Ihr Areal reicht bis nach Mitteldeutschland. wurde (ADOMSSENT 1995 a(. Weitere<br />
Nach SCHORR (19901 tritt Aeshna affinis in Nachweise von Einzeltieren gelangen im<br />
Deutschland mehr oder weniger regelmä- Jahre 1995 im Raum Kiel (zwei F<strong>und</strong>e) <strong>und</strong><br />
ßig nur im Südwesten auf. Im Jahr 1994 im Bereich des Naturparks Schaalsee<br />
wurde sie erstmalig auch in Niedersachsen sowohl auf holsteinischer als auch auf<br />
(MARTENS & GASSE 1996) <strong>und</strong> Schleswig- mecklenburgischer Seite. Bisher wurde<br />
Holstein (ADOMSSENT 1995 a) beobach- weder in Schleswig-Holstein noch in Nie-<br />
tet. dersachsen ein Reproduktionsverhalten<br />
wie Eiablage beobachtet. Ob die Einwan-<br />
Habitatansprüche derung dieser Art durch die sehr warmen<br />
Sommer 1994 <strong>und</strong> 1995 begünstigt wurde<br />
Aeshna affinis wurde nach LOHMANN oder ob sie wegen der leichten Verwech-<br />
(19801 hauptsächlich an stark bewachse- selbarkeit mit Aeshna mixta bisher überse-<br />
nen Flachmoorgräben, in Flachmooren hen wurde, läßt sich zur Zeit noch nicht<br />
<strong>und</strong> versumpften Stellen an Seichtwasser- eindeutig klären.<br />
Weihern sowie an Baggerseen <strong>und</strong> im<br />
Hochmoor beobachtet. Weitere Angaben<br />
verschiedener Autoren weisen darauf hin,<br />
daß die Art vegetationsreiche, vielfach aus-<br />
trocknende Flachgewässer bevorzugt,<br />
offene Wasserflächen dagegen eher mei-<br />
det. MARTENS & GASSE 11996) bezeich-<br />
nen sie als Bewohnerin sommertrockener<br />
Gewässer.<br />
71
72<br />
MG<br />
0 MF<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Aeshna cyanea<br />
6<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1 925 OAnfang 1950<br />
bis Ende 1949 bisAnf Ende 1974<br />
G Anfang 1975 bis Ende 1984<br />
• ab 1985<br />
Jan fab Jun JU Auq Sap Okt ebv De,<br />
PF<br />
c
Blaugrüne Mosaikjungfer -<br />
Aeshna cyanea (MÜLLER 1764)<br />
Verbreitung<br />
Aeshna cyanea ist nach DEVAI (1976) ein<br />
holomediterranes Faunenelement. Das<br />
Areal der Art erstreckt sich über ganz<br />
Europa vom Mittelmeer bis ins südliche<br />
Skandinavien <strong>und</strong> nach Osten bis zum<br />
Kaukasus. In Deutschland ist Aeshna<br />
cyanea überall häufig anzutreffen.<br />
Habitatansprüche<br />
WILDERMUTH (19801 beschreibt Aeshna<br />
cyanea als sehr anpassungsfähige Art mit<br />
großer „ökologischer Plastizität". Sie<br />
besiedelt fast alle Gewässerbiotope, wobei<br />
sie die kleineren zu bevorzugen scheint<br />
(ROBERT 1959), ist aber auch an langsam<br />
fließenden Gewässern <strong>und</strong> Altarmen anzu-<br />
treffen. PETERS (1987) berichtet sogar von<br />
extremen Larvenf<strong>und</strong>orten wie vegeta-<br />
tionslosen Brunnenringen <strong>und</strong> Regenwas-<br />
sertonnen.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Aeshna cyanea ist in Schleswig-Holstein<br />
weit verbreitet <strong>und</strong> häufig. Die F<strong>und</strong>dichte<br />
nimmt aber im Bereich der Küstenmar-<br />
schen ab. Dies liegt vermutlich hauptsäch-<br />
lich an der geringeren Beobachtungsinten-<br />
sität in diesem Bereich. Die Art kommt in<br />
Schleswig-Holstein in allen Natur- <strong>und</strong><br />
Landschaftsräumen vor. Selbst in Städten<br />
ist sie an vielen Gewässern wie Parktei-<br />
chen <strong>und</strong> Kanälen häufig zu beobachten.<br />
73
74<br />
0 Aeshna grandis<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
5 6 7 8<br />
0 vor 1925<br />
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O Anfang925 1 O Aan nf Eng1950<br />
C Anfang n 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis de<br />
1974 bis Ende 1984<br />
Job feb 4p Mal Joe JO<br />
PF
Braune Mosaikjungfer -<br />
Aeshna grandis (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
DEVAI (1976) stellt die Art zum westsibiri-<br />
schen Faunenkreis. Aeshna grandis ist in<br />
Europa weit verbreitet <strong>und</strong> tritt noch bis<br />
etwa 110° östlicher Länge in Sibirien auf<br />
(GEIJSKES & VAN TOL 1983). Sie kommt<br />
nach Westen bis Irland <strong>und</strong> Frankreich<br />
sowie in Skandinavien bis nördlich des<br />
Polarkreises vor. In Deutschland ist die Art<br />
weit verbreitet, wobei sie allerdings nicht<br />
überall häufig <strong>und</strong> regelmäßig auftritt.<br />
Habitatansprüche<br />
Auch Aeshna grandis scheint eine mehr<br />
oder minder große Anpassungsfähigkeit<br />
an verschiedene Gewässertypen zu haben.<br />
In Mitteleuropa besiedelt die Art eutrophe<br />
bis oligotrophe stehende <strong>und</strong> langsam<br />
fließende Gewässer, die teilweise stärker<br />
verkrautet sind <strong>und</strong> häufig in Waldnähe lie-<br />
gen beziehungsweise Gehölzsäume aufweisen.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Aeshna grandis ist in Schleswig-Holstein<br />
ähnlich wie Aeshna cyanea weit verbreitet<br />
<strong>und</strong> häufig. Verbreitungslücken sind wohl<br />
in erster Linie auf geringere Beobachtungs-<br />
intensität zurückzuführen. Auch diese Art<br />
ist in allen Naturräumen <strong>und</strong> dort jeweils<br />
an vielen Gewässertypen anzutreffen.<br />
75
76<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Aeshna isosceles<br />
ME 1 NE PE<br />
O<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
1925 o "1.1925'2 bis Ende<br />
1949<br />
O Anf an Eng1<br />
bis d<br />
6 an 15•ab 1985<br />
950<br />
e 1974<br />
Anf Eng<br />
bis d 97<br />
e 1984 •<br />
s-<br />
3_<br />
Jan f,b MIS Apr Mal hn Jul Aay
Keilflecklibelle -<br />
Aeshna isosceles (MÜLLER 1767)<br />
Verbreitung<br />
Aeshna isosceles ist nach DEVAI 11976) ein<br />
atlantomediterranes Faunenelement. Die<br />
Art ist nordwärts bis Dänemark, teilweise<br />
bis nach Südschweden verbreitet.<br />
Schleswig-Holstein liegt somit im nördli-<br />
chen Randbereich des Areals. Die Verbrei-<br />
tung in Deutschland ist sehr lückenhaft<br />
<strong>und</strong> schwer zu interpretieren, wohl auch<br />
deswegen, weil Aeshna isosceles nur unre-<br />
gelmäßig <strong>und</strong> meist einzeln auftritt. Nach<br />
SCHORR 11990) kommt die Art insbeson-<br />
dere an Gewässern der Ebene vor.<br />
Habitatansprüche<br />
Generell scheint Aeshna isosceles dicht<br />
bewachsene Gewässer mit schlammigem<br />
Untergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> ausgedehntem Röhricht-<br />
gürtel zu bevorzugen (SCHORR 1990).<br />
Mehrere Autoren (SCHMIDT 1965, ZIEBELL<br />
& BENKEN 1982, BREUER & RITZAU 1983)<br />
geben Flachmoorweiher <strong>und</strong> Gräben mit<br />
dichtem Krebsscheren-Bestand als Habitat<br />
an. In erster Linie scheint der sehr dichte<br />
Bewuchs <strong>für</strong> das Ökoschema der Art ent-<br />
scheidend zu sein. Im Süden reproduziert<br />
Aeshna isosceles überwiegend an eutro-<br />
phen bis mesotrophen Teichen <strong>und</strong> Seen<br />
mit dichten Schwimmpflanzendecken<br />
(SCHORR 1990). Nach B. SCHMIDT (1991)<br />
entwickelt sich die Art auch in ephemeren<br />
Gewässern.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die Verbreitung von Aeshna isosceles ist in<br />
erster Linie auf das östliche Hügelland<br />
beschränkt. Nur wenige F<strong>und</strong>e liegen im<br />
Bereich der Geest. Die ersten F<strong>und</strong>e dieser<br />
Art stammen von 1926 aus dem Raum<br />
Mölln (Sammlungsexemplare im Museum<br />
<strong>für</strong> Naturk<strong>und</strong>e der Humboldt-Universität<br />
Berlin), aber erst in den 30er Jahren konnte<br />
sie dann erneut nachgewiesen werden. Die<br />
höchste F<strong>und</strong>dichte erreicht Aeshna<br />
isosceles im Raum Kiel <strong>und</strong> im Südosten<br />
des Hügellandes im Bereich Lübeck/Mölln,<br />
wo sie wohl zumindest in klimatisch gün-<br />
stigen Jahren auch reproduziert. Bei der<br />
nördlichsten Beobachtung im Bereich der<br />
Geltinger Birk scheint es sich nach<br />
SCHMIDT (1977 cl um „ein nur als Wande-<br />
rer anzusprechendes Tier" zu handeln.<br />
Obwohl diese Art regelmäßig über alle<br />
Jahrzehnte beobachtet wurde, sind<br />
größere Bestände nur aus dem Raum Kiel,<br />
Lübeck <strong>und</strong> Gudow bekannt geworden. Bei<br />
den aktuellen Nachweisen handelt es sich<br />
hauptsächlich um Einzeltiere.<br />
77
78<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Aeshna juncea<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O Anfang 1925 Onf Anfan g 1950 E Anfan 1 975 • ab 1985<br />
o "1.1925 bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Engd e 1984<br />
Jon Fe, Mrznpr Mol .4n i,l n^^^ Sep
Torf-Mosaikjungfer -<br />
Aeshna juncea (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
Aeshna juncea gehört nach DEVAI (1976)<br />
zum eurosibirisches Faunenkreis. Die Art<br />
ist circumboreal verbreitet (PETERS 1987)<br />
<strong>und</strong> tritt noch nördlich des Polarkreises<br />
auf. Im Gebirge ist sie bis über 2000 m<br />
Höhe nachgewiesen worden. Im Norden<br />
Deutschlands ist Aeshna juncea zwar nicht<br />
häufig, aber doch allgemein verbreitet. Im<br />
Süden beschränken sich die Vorkommen<br />
der Art weitgehend auf Mittelgebirge <strong>und</strong><br />
die Alpen.<br />
Habitatansprüche<br />
Aeshna juncea ist nach CLAUSNITZER<br />
(1972) an jedem Moorweiher <strong>und</strong> Torfstich<br />
anzutreffen. In Norddeutschland kommt<br />
die Art hauptsächlich in nährstoffarmen<br />
Sphagnum-Mooren, mesotrophen, moori-<br />
gen Weihern <strong>und</strong> Sümpfen, nährstoffrei-<br />
cheren Flachmooren bis hin zu eutrophen<br />
Teichen, Torfstichen <strong>und</strong> Gräben vor<br />
(SCHMIDT 1977 c, GLITZ et al. 1989).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Aeshna juncea ist zwar über ganz<br />
Schleswig-Holstein verbreitet, ihr Verbreitungsmuster<br />
ist aber nicht flächendeckend<br />
wie bei Aeshna cyanea oder A. grandis,<br />
sondern eher mosaikartig wie die Vertei-<br />
lung der Moore. Die Häufigkeit der Nach-<br />
weise hat gegenüber den früheren Jahr<br />
zehnten insbesondere im nördlichen Teil<br />
des Landes abgenommen. Die Ursache<br />
liegt höchstwahrscheinlich in der anhalten-<br />
den Zerstörung der Habitate. Die Einschät-<br />
zung von SCHMIDT (1966), daß sich das<br />
Vorkommen der Art überwiegend auf die<br />
Geest konzentriert, werden aktuell nicht<br />
mehr eindeutig bestätigt. So ist auch eine -<br />
wenn auch lückenhafte - Besiedlung des<br />
Hügellands feststellbar.<br />
79
80<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Aeshna mixta<br />
ME NE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
PE<br />
o vor 1925 O Aang nf 1925<br />
bis Ende 1949<br />
O Anf an Eng 1950<br />
bis de 1974<br />
G Aan nf Eng 1975<br />
bis de 1984<br />
• ab 1985<br />
AP. uai .w,n .x,i nuq Pep okr no. oex
Herbst-Mosaikjungfer -<br />
Aeshna mixta LATREILLE 1805<br />
Verbreitung<br />
Nach ST. QUENTIN 11960) ist Aeshna mixta<br />
ein eurosibirisches Faunenelement. Ihr<br />
Areal reicht vom Mittelmeergebiet bis zum<br />
Amur <strong>und</strong> in die Mongolei, allerdings<br />
scheint die Art Gebirge zu meiden. Aeshna<br />
mixta ist über ganz Deutschland verbreitet,<br />
wobei eine Zunahme der F<strong>und</strong>häufigkeit<br />
nach Norden festzustellen ist (SCHORR<br />
1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Aeshna mixta kommt an verlandenden,<br />
nährstoffreichen stehenden <strong>und</strong> langsam<br />
fließenden Gewässern vor. Ausgeprägte<br />
Röhrichtgürtel scheinen besonders attrak-<br />
tiv zu sein, da die Weibchen bevorzugt ihre<br />
Eier dort ablegen. Die Art entwickelt sich<br />
auch in ephemeren Gewässern (SCHMIDT,<br />
B. 19911.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Aeshna mixta ist neben A. cyanea die häuigste<br />
<strong>und</strong> am weitesten verbreitete<br />
Aeshnide in Schleswig-Holstein. Im Nord-<br />
westen des Landes nimmt die Anzahl der<br />
Nachweise aber wohl auch infolge einer<br />
eringeren Untersuchungsdichte ab. Die<br />
<strong>und</strong>dichte ist wie bei Aeshna cyanea in<br />
d er Geest <strong>und</strong> im Hügelland am höchsten.<br />
81
82<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Aeshna subarctica<br />
ME I NE n<br />
PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1 925 O Anfang 1950 G Aan nf Eng 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1 974 bis de 1984
Hochmoor-Mosaikjungfer -<br />
Aeshna subarctica WALKER 1908<br />
Verbreitung<br />
Aeshna subarctica ist nach GEIJSKES &<br />
VAN TOL (1983) cirkumpolar <strong>und</strong> holark-<br />
tisch verbreitet. Der Schwerpunkt liegt im<br />
nordöstlichen Europa. Die geschlossene<br />
südliche Verbreitungsgrenze liegt bei etwa<br />
50° nördlicher Breite. In Deutschland ist sie<br />
im wesentlichen auf die Moore des Nor-<br />
dens <strong>und</strong> des süddeutschen Raumes<br />
beschränkt.<br />
Habitatansprüche<br />
Aeshna subarctica ist in ihrem Vorkommen<br />
an Moore mit flutenden Sphagnen gebun-<br />
den, wobei sie bei uns - im Gegensatz zu<br />
A. juncea - großflächige Torfmoore mit<br />
Wasserflächen von mindestens einem<br />
Hektar Größe <strong>und</strong> breiten Schwingrasen-<br />
gürteln bevorzugt (GLITZ et al. 1989). Die<br />
pH-Werte liegen hier meist zwischen<br />
4 <strong>und</strong> 4,2.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Aeshna subarctica ist in der Vergangenheit<br />
in Geest <strong>und</strong> Hügelland offensichtlich weit<br />
verbreitet gewesen. Eine Vielzahl der ins-<br />
besondere von SCHMIDT (1977c) überwie-<br />
gend in den nördlichen Landesteilen doku-<br />
mentierten F<strong>und</strong>e aus den 70er Jahren<br />
konnten aber in der Folgezeit nicht mehr<br />
bestätigt werden. Gegenüber Aeshna<br />
juncea scheint diese Art von der anhalten-<br />
den Zerstörung der Moore weitaus stärker<br />
betroffen zu sein. Aus dem Zeitraum von<br />
1985 bis 1995 liegen immerhin noch 25<br />
Meldungen vor, davon allerdings ab 1992 -<br />
also bei deutlich erhöhter Erfassungsintensität<br />
- nur noch sechs.<br />
83
84<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Aeshna viridis<br />
ME NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfan g 1925 O Anfan g 1950 C Anfan g 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jm feb npr Mol An Aii Aug Sep 0. Nev Oe:
Grüne Mosaikjungfer -<br />
Aeshna viridis EVERSMANN 1836<br />
Verbreitung<br />
Aeshna viridis ist über Nordosteuropa <strong>und</strong><br />
Sibirien verbreitet <strong>und</strong> erreicht ihre West-<br />
grenze in den Niederlanden. Nach Norden<br />
ist sie bis Mittelschweden verbreitet, im<br />
Süden bis nach Ungarn (GEIJSKES & VAN<br />
TOL 1983). Nach DEVAI (1976) ist sie ein<br />
westsibirisches Faunenelement. In<br />
Deutschland hat die Art ihren Verbrei-<br />
tungsschwerpunkt im nordwestdeutschen<br />
Flachland.<br />
Habitatansprüche<br />
Aeshna viridis wird von SCHMIDT (1975 a)<br />
als Charakterart der Gewässer mit dichten<br />
Beständen von Krebsschere Stratiodes<br />
aloides bezeichnet. Da die Blätter dieser<br />
Pflanze praktisch das einzige Eiablage-<br />
substrat darstellen, ist diese Art eng an<br />
deren Vorkommen in Teichen, Tümpeln,<br />
Kolken, Torfstichen, Buchten von Seen,<br />
Altarmen oder Gräben (in den Flußtälern)<br />
geb<strong>und</strong>en (SCHORR 1990). Im Elbtal lebt<br />
sie nach GLITZ et al. (19891 an Bracks <strong>und</strong><br />
breiten Marschgräben.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die ersten Nachweise von Aeshna viridis in<br />
Schleswig-Holstein datieren aus der Zeit<br />
um die Jahrh<strong>und</strong>ertwende. Damals wurde<br />
die Art in den Elbmarschen bei Hamburg-<br />
Bergedorf „zu Tausenden" registriert. Bis<br />
Ende 1949 liegen nur knapp 30 Meldungén<br />
vor, von 1950 bis 1974 wurde Aeshna<br />
viridis über 60mal festgestellt. Bis 1984<br />
wurde sie an 17 Gewässern beobachtet,<br />
dann bis 1995 wieder an über 40. Etwa die<br />
Hälfte der Meldungen erfolgte ab 1992. Die<br />
Mehrzahl der rezenten Nachweise stammt<br />
aus Geest <strong>und</strong> Hügelland, hier unter ande-<br />
rem aus dem Bereich der Flüsse Stör,<br />
Treene <strong>und</strong> Trave sowie aus einer Reihe<br />
von Mooren. Dabei weist das Verbreitungs-<br />
bild insgesamt große Lücken auf, <strong>und</strong> von<br />
vielen alten F<strong>und</strong>orten konnten keine<br />
neuen Nachweise mehr erbracht werden.<br />
Die individuenreichsten rezenten Vorkom-<br />
men liegen im südlichen Nordfriesland.<br />
85
86<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1d<br />
9 l^ OR^-<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
SEE<br />
Hemianax ephippiger<br />
OST SEE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O Anfang925 1<br />
o "1.1925<br />
bis Ende 1949<br />
O Anfang 1950<br />
bis Ende 1974<br />
G A ang975 1<br />
bisnf Ende 1984<br />
• ab 1985
Schabrackenlibelle -<br />
Hemianax ephippiger (BURMEISTER 1839)<br />
Verbreitung<br />
Hemianax ephippiger ist über ganz Afrika<br />
<strong>und</strong> den Vorderen Orient bis nach Indien<br />
verbreitet <strong>und</strong> regelmäßig auch im medi-<br />
terranen Teil Europas anzutreffen. Die Art<br />
muß dem saharosindhischen Faunenkreis<br />
zugerechnet werden (LATTIN 1967). Diese<br />
Wanderlibelle, die an wenigen F<strong>und</strong>orten<br />
in Frankreich <strong>und</strong> Italien als bodenständig<br />
beobachtet wurde, ist die bisher einzige<br />
Libellenart, die auf Island nachgewiesen<br />
wurde. In Deutschland wurde sie als Wan-<br />
derer erstmals im Jahre 1927 beobachtet.<br />
Seitdem gab es vereinzelt immer wieder<br />
Einflüge. Im Jahr 1995 erfolgten die bisher<br />
meisten F<strong>und</strong>e, wobei Hemianax<br />
ephippiger in Brandenburg auch bei der<br />
Eiablage beobachtet werden konnte.<br />
Habitatansprüche<br />
Die Art scheint größere stehende Gewäs-<br />
ser mit hoher Wassertemperatur <strong>und</strong> mit<br />
nur spärlicher Vegetation zu bevorzugen<br />
(LOHMANN 1980). Hemianax ephippiger<br />
tritt auch häufig als Erstbesiedler an tem-<br />
porären Kleingewässern mit stellenweise<br />
vorhandenem Röhricht auf.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
In Schleswig-Holstein wurde Hemianax<br />
ephippiger bisher nur einmal mit einem<br />
Einzeltier am Selenter See nachgewiesen<br />
(21. April 1957, HEYMER 1962). Da die Art<br />
in Brandenburg 1995 bei der Eiablage<br />
beobachtet werden konnte (PETERS,<br />
mündliche Mitteilung), ist in Jahren mit<br />
günstiger Witterung auch mit einer erneu-<br />
ten Zuwanderung nach Schleswig-Holstein<br />
zu rechnen. Ob es allerdings zur Ausbil-<br />
dung von bodenständigen Populationen<br />
kommt ist eher unwahrscheinlich, da nach<br />
PETERS (19871 vermutlich sowohl die naß-<br />
kalten atlantischen Winter im Westen als<br />
auch die kontinentalen Winter im Osten<br />
eine Larvalentwicklung kaum ermöglichen.<br />
87
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
nf 0 vor 1925 O Anfang 1 925 O Aan 950 g 1 G Afan n g 1975 • ab 1985<br />
bis Ende<br />
1949 bisEnde<br />
1974 bisEnde<br />
1984<br />
88<br />
0 Anax imperator<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
npr xr Aug
Große Königslibelle -<br />
Anax imperator LEACH 1815<br />
Verbreitung<br />
Nach DEVAI (19761 ist Anax imperator ein<br />
holomediterranes Faunenelement. Die Art<br />
ist über Teile Afrikas, Asiens <strong>und</strong> in Europa<br />
nach Norden bis Südengland <strong>und</strong> Nord-<br />
deutschland verbreitet. In ganz Deutsch-<br />
land ist Anax imperator mehr oder weniger<br />
regelmäßig anzutreffen. Insbesondere in<br />
Norddeutschland dürfte aber in vielen<br />
Bereichen eine Reproduktion fraglich sein<br />
(SCHORR 1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Die Art ist recht anpassungsfähig, da sie<br />
häufig auch als Erstbesiedler in ephemeren<br />
Gewässern auftritt. Sie kommt an kleinen<br />
Tümpeln, Wassergräben <strong>und</strong> Weihern vor,<br />
scheint aber größere Gewässer zu bevor-<br />
zugen. Besiedelt werden in Schleswig-<br />
, Holstein auch Moorteiche, aufgelassene<br />
Fischteiche, Bodenentnahmegewässer <strong>und</strong><br />
flache Teiche in der Marsch, sofern sie<br />
windgeschützt liegen (GLITZ et al. 1989).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Anax imperator wird hauptsächlich im<br />
Süden des Landes beobachtet. Trotz des<br />
guten Flugvermögens scheint die Art nur<br />
selten in den Norden Schleswig-Holsteins<br />
vorzudringen. Dagegen sind in den südli-<br />
chen Landesteilen die Bedingungen <strong>für</strong><br />
eine Reproduktion in wärmeexponierten,<br />
geschützten Pionierhabitaten <strong>und</strong> Weihern<br />
günstig. SCHMIDT (1977 cl vermutet, daß<br />
das Fehlen älterer F<strong>und</strong>e (vor 1960 nur ein<br />
F<strong>und</strong> bei Lübeck) an dem ausdauernden<br />
Flugverhalten über unzugänglichen<br />
Schwimmblattzonen liegt, was ein Bestim-<br />
men oder gar Fangen der Tiere erschwert.<br />
89
90<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Anax parthenope<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
0 vor 1925 O Anfan g 1 925<br />
bis Ende<br />
1949<br />
O Anf a End ng1 950<br />
bis e 1974<br />
G Anfan 19<br />
bis Erde 175 984<br />
• ab 1985<br />
im F.e ep.
Kleine Königslibelle -<br />
Anax parthenope SELYS 1839<br />
Verbreitung<br />
Anax parthenope wird von DEVAI 11976)<br />
als pontomediterranes Faunenelement auf-<br />
geführt. Die Art ist von Frankreich bis nach<br />
Japan verbreitet. Das Alpenvorland <strong>und</strong><br />
die Rheintiefebene bilden im westlichen<br />
Europa den nördlichen Rand des Areals.<br />
Weiter im Norden wird die Art nur punktu-<br />
ell <strong>und</strong> in wenigen bodenständigen Vor-<br />
kommen nachgewiesen. Während Anax<br />
parthenope in Ostdeutschland in den 30er<br />
Jahren an allen größeren Gewässern<br />
gef<strong>und</strong>en werden konnte (MUNCHBERG<br />
1936), liegen aktuell nur von wenigen, kli-<br />
matisch begünstigten Gebieten Nachweise<br />
vor (ZESSIN & KÖNIGSTEDT 1993).<br />
SCHORR 11990) führt eine allmähliche Aus-<br />
breitung der Art nach Westen an.<br />
Habitatansprüche<br />
Nach LOHMANN (19801 ist Anax parthenope<br />
eine Charakterart mesotropher bis eutro-<br />
pher Seen mit großer freier Wasserfläche<br />
<strong>und</strong> stellenweise vorhandener Schwimm-<br />
blattzone. JACOB (19691 gibt als F<strong>und</strong>orte<br />
auch Tümpel <strong>und</strong> künstlich angelegte Stau-<br />
seen an.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Anax parthenope ist nach SCHMIDT<br />
(1977c) ein seltener Einwanderer, der bis-<br />
her nur im Bereich der östlichen Seenplat-<br />
ten bei Plön <strong>und</strong> Mölln (zweimal) <strong>und</strong> auf<br />
Sylt (einmal) nachgewiesen wurde. Auch<br />
aus Mecklenburg-Vorpommern sind aus<br />
den letzten drei Jahrzehnten nur wenige<br />
Nachweise bekannt (ZESSIN & KONIG-<br />
STEDT 1993). Zweifelsohne ist das Vor-<br />
kommen der Art an klimatisch besonders<br />
günstige Bedingungen geb<strong>und</strong>en. Dement-<br />
sprechend kann ein unregelmäßiges Auf-<br />
treten der Art in Schleswig-Holstein erwar-<br />
tet werden.<br />
91
92<br />
0 Cordulegaster boltonii<br />
.kln FED MIM >yr Mal An Jul •yy<br />
OST SEE<br />
1 ME NE 1 PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 M Anfan g 1925 O Anfan 1 950 C Anfan 1 975 • ab 1985<br />
bis Ende<br />
1949 bis Engde<br />
1974 bis Engde<br />
1984
Zweigestreifte Quelljungfer -<br />
Cordulegaster boltonii (DONOVAN 1807)<br />
Verbreitung<br />
Nach DEVAI (1976) ist Cordulegaster<br />
boltonii ein westmediterranes Faunenele-<br />
ment. Die Art kommt in Europa von Spa-<br />
nien bis Mittelfinnland vor. Im gesamten<br />
nordwestlichen Randbereich ihres Verbrei-<br />
tungsgebietes weist das Vorkommen von<br />
Cordulegaster boltonii ein sehr uneinheitli-<br />
ches Bild auf. In Westdeutschland ist die<br />
Art relativ weit verbreitet, in den östlichen<br />
Landesteilen kommt sie nur in Inselpopula-<br />
tionen vor (ASKEW 1988).<br />
Habitatansprüche<br />
SCHIEMENZ (19571 gibt <strong>für</strong> diese Art<br />
Gebirgsbäche sowie Quellsümpfe <strong>und</strong><br />
deren Abflüsse als bevorzugte Habitate an.<br />
Besiedelt werden vor allem strömungs-<br />
arme Flachwasserstellen von Bächen mit<br />
Feingr<strong>und</strong>, die in lichten Wäldern oder an<br />
Waldrändern liegen. Die Larven, von<br />
GEIJSKES (1935) als „eurytherme Kaltwas-<br />
sertiere" eingestuft, benötigen aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer langen Entwicklungsdauer konstante<br />
ökologische Bedingungen.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Cordulegaster boltonii wurde <strong>für</strong> Schleswig-<br />
Holstein bereits Anfang des Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
bei Friedrichsruh von TIMM (19061 nachge-<br />
wiesen, wobei der Autor die Art schon<br />
damals als sehr selten bezeichnete. Erst<br />
1969 folgte der zweite Nachweis eines<br />
wahrscheinlich wandernden Männchens<br />
an der Wandse. Nach über 70 Jahren<br />
konnte 1977 <strong>und</strong> 1978 eine damals offen-<br />
sichtlich bodenständige Population an der<br />
Bille bei Witzhave festgestellt werden.<br />
Rezent ist derzeit nur ein autochthones<br />
Vorkommen aus der Nähe von Itzehoe<br />
bekannt (1994 <strong>und</strong> 1995). Alle bisherigen<br />
F<strong>und</strong>orte liegen in der Geest, wobei der<br />
aktuelle F<strong>und</strong> zugleich auch der nördlichste<br />
ist. Das Verbreitungsareal dieser westmedi-<br />
terranen Art weist nach ASKEW (1988) im<br />
südlichen Raum um Nordsee <strong>und</strong> Ostsee<br />
erhebliche Lücken auf, so daß das derzei-<br />
tige Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
schon außerhalb des geschlossenen Ver-<br />
breitungsareals liegt. Verantwortlich <strong>für</strong><br />
dieses Verbreitungsbild dürfte aber in<br />
erster Linie die Seltenheit der von<br />
Cordulegaster boltonii präferierten Brutha-<br />
bitate sein.<br />
93
94<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
M<br />
Cordulia aenea<br />
to<br />
O ST S BB<br />
NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 C Anfang 1 975 ti ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jen Feb ltz A, Jun Jui Aug Sep Okt Nee De-[
Gemeine Smaragdlibelle -<br />
Cordulia aenea (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
Cordulia aenea ist nach DEVAI (1976) ein<br />
westsibirisches Faunenelement, dessen<br />
Areal sich nach Osten bis etwa zum Baikal-<br />
see erstreckt (GEIJSKES & VAN TOL 1983).<br />
Nach Westen tritt die Art bis Frankreich<br />
auf, fehlt aber im Mittelmeerbereich.<br />
Cordulia aenea ist in Deutschland allge-<br />
mein verbreitet, wobei jedoch auffällt, daß<br />
größere Landschaftsräume offensichtlich<br />
unbesiedelt sind (SCHORR 1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Cordulia aenea ist eine euryöke Libelle, die<br />
fast überall angetroffen werden kann, aber<br />
verstärkt an Tümpeln, Teichen <strong>und</strong> Wald-<br />
seen sowie an moorigen Gewässern nach-<br />
zuweisen ist. Das Vorhandensein von<br />
Schwimmblattvegetation scheint sich<br />
dabei günstig auszuwirken.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Das Verbreitungsbild der Art überrascht<br />
etwas. Während alle Bearbeiter sie als<br />
ubiquitär, wenn auch nirgends häufig ein-<br />
schätzten, weist die Auswertung aller Mel-<br />
dungen eine nur vergleichsweise geringe<br />
Punktdichte im Norden <strong>und</strong> Westen in der<br />
kartographischen Darstellung aus. Die<br />
frühesten Angaben zum Vorkommen von<br />
Cordulia aenea stammen 1889 von Helgo-<br />
land. Bis 1984 gibt es nur knapp 60 weitere<br />
Angaben. Aus der Untersuchungsdekade<br />
ab 1985 liegen über 110 Meldungen aus<br />
über 45 Quadranten insbesondere aus den<br />
südöstlich des Nord-Ostsee-Kanals gelege-<br />
nen Landesteilen vor. Die zahlenmäßige<br />
Verdoppelung der Nachweise, dürfte mit<br />
der zum Teil flächendeckenden Kartierung<br />
zusammenhängen. Die alten F<strong>und</strong>orte sind<br />
dagegen vielfach nicht mehr bestätigt worden.<br />
95
96<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Epitheca bimaculata<br />
OST S EE<br />
ME 1 NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 M Anfang 1925<br />
b is<br />
C Anfan g 1 Gnf Anfang 175 9 ab 1985<br />
nf<br />
Ende 1949<br />
950<br />
bisnEnde 1974 bis Ende 1984 •<br />
lm f eb epr An<br />
^+9
Zweifleck -<br />
Epitheca bimaculata (CHARPENTIER 1825)<br />
Verbreitung<br />
Epitheca bimaculata wird von<br />
ST. QUENTIN (1960) als eurosibirisches<br />
Faunenelement beschrieben, dessen Ver-<br />
breitung sich nach Osten bis Ostsibirien<br />
<strong>und</strong> Japan, nach Westen bis in die Nieder-<br />
lande erstreckt. DEVAI (1976) bezeichnet<br />
die Art als westsibirisches Faunenelerent<br />
mit europäischen Ausbreitungstendenzen.<br />
In Deutschland kommt Epitheca<br />
bimaculata nur punktuell vor (SCHORR<br />
1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Epitheca bimaculata findet sich an Seen<br />
unterschiedlichen Trophiegrades, selten<br />
auch an größeren <strong>und</strong> langsam fließenden<br />
Gewässern, scheint aber eher nährstoffär-<br />
mere Verhältnisse zu bevorzugen. Als<br />
wichtige Habitatelemente werden von eini-<br />
gen Autoren Röhrichtgürtel angegeben,<br />
außerdem zeigt sich eine gewisse Nach-<br />
weishäufung bei Gewässern in Waldlage.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Von Epitheca bimaculata liegen in<br />
Schleswig-Holstein seit etwa 15 Jahren<br />
keine Meldungen mehr vor. Die Art ist<br />
früher insbesondere östlich des Elbe-<br />
Lübeck-Kanals in den mecklenburgnahen<br />
Teilen des Kreises Herzogtum Lauenburg<br />
sowie in der Umgebung von Lübeck ver-<br />
mutlich sogar bodenständig gef<strong>und</strong>en wor-<br />
den (FISCHER 1984 a(, nirgends allerdings<br />
in hohen Ab<strong>und</strong>anzen. Der letzte <strong>und</strong><br />
zugleich nördlichste Nachweis gelang 1982<br />
am Kleinen Schierenseebach westlich der<br />
Landeshauptstadt Kiel. Nach FISCHER<br />
(1984 a) dringt Epitheca bimaculata in<br />
manchen Jahren als Wanderer aus der<br />
brandenburgisch-mecklenburgischen<br />
Seenplatte vor.<br />
97
98<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4 Q<br />
3<br />
2<br />
1<br />
®°<br />
Q 3<br />
'Z3o<br />
91$OR -D-<br />
84 0<br />
7 SEE<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2 ^<br />
<strong>Somatochlora</strong> arctica<br />
0 STSEE<br />
ME I NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 C Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Arktische Smaragdlibelle -<br />
<strong>Somatochlora</strong> arctica (ZETTERSTEDT 1840)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
<strong>Somatochlora</strong> arctica ist nach<br />
ST. QUENTIN (1960) ein eurosibirisches<br />
Faunenelement, das im Westen des Areals<br />
nur in Skandinavien eine geschlossene<br />
Verbreitung zeigt, während in Mitteleuropa<br />
die F<strong>und</strong>ortdichte deutlich geringer wird.<br />
Ein weiterer Verbreitungsschwerpunkt liegt<br />
im Bereich der Alpen. Das Vorkommen der<br />
Art in Deutschland ist punktuell <strong>und</strong> von<br />
den ökologischen Ansprüchen bestimmt.<br />
Allgemein ist <strong>Somatochlora</strong> arctica als<br />
sehr selten einzustufen.<br />
Habitatansprüche<br />
<strong>Somatochlora</strong> arctica besiedelt als<br />
Hochmoorlibelle insbesondere von Wald<br />
umgebene kleinflächige Moorbereiche, die<br />
in Norddeutschland zumindest zeitweise<br />
fließendes Wasser aufweisen können. Die<br />
bevorzugten Habitate sind durch eine fast<br />
geschlossene Sphagnumdecke sowie nur<br />
äußerst kleine Flächen mit freiem Wasser -<br />
beispielsweise in Schlenken - charakteri-<br />
siert (CLAUSNITZER 1980). Häufig findet<br />
sich dort auch die Moorlilie.<br />
Ahnlich wie <strong>für</strong> Epitheca bimaculata liegen<br />
auch <strong>für</strong> <strong>Somatochlora</strong> arctica nur wenige<br />
ältere Meldungen zumeist aus dem Kreis<br />
Herzogtum Lauenburg östlich des Elbe-<br />
Lübeck-Kanals sowie aus der Umgebung<br />
von Lübeck vor. Die ältesten Angaben zum<br />
Vorkommen der Art stammen von Helgo-<br />
land (1911) beziehungsweise aus der Nähe<br />
von Oldenhütten am mittleren Abschnitt<br />
des Nord-Ostsee-Kanals. <strong>Somatochlora</strong><br />
arctica ist seit 1972 nicht mehr in<br />
Schleswig-Holstein nachgewiesen.<br />
99
100<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
<strong>Somatochlora</strong> flavomaculata<br />
O ST SEE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Ail Aug
Gefleckte Smaragdlibelle -<br />
<strong>Somatochlora</strong> flavomaculata (VAN DER LINDEN 1825)<br />
Verbreitung<br />
<strong>Somatochlora</strong> flavomaculata ist als euro-<br />
sibirisches Faunenelement (ST. QUENTIN<br />
1960) im Osten bis Sibirien, im Westen bis<br />
Frankreich verbreitet. Dabei nimmt die<br />
F<strong>und</strong>ortdichte nach Westen ab, wobei hier<br />
insbesondere niedrig gelegene Regionen<br />
besiedelt werden. Das Verbreitungsbild der<br />
Art in Deutschland zeigt, daß hauptsäch-<br />
lich die Ebenen besiedelt werden. Atlan-<br />
tisch geprägte Bereiche werden gemieden<br />
(SCHORR 1990).<br />
Habitatansprüche<br />
<strong>Somatochlora</strong> flavomaculata findet nach<br />
BUCHWALD et al.119861 geeigneten<br />
Lebensraum in Niedermooren mit Seggen-<br />
bewuchs, <strong>und</strong> auch GLITZ (1970 b)<br />
beschreibt als Habitate Seggen- <strong>und</strong><br />
Juncussümpfe eutropher bis mesotropher<br />
Moore <strong>und</strong> Weiher sowie Verlandungssta-<br />
dien größerer Gewässer, die an geschützte<br />
Waldränder angrenzen. Dagegen meidet<br />
die Art größere offene Wasserflächen. Es<br />
werden aber auch langsam fließende<br />
Gewässer besiedelt. Typische F<strong>und</strong>orte<br />
sind astatische Gewässer beziehungsweise<br />
Verlandungszonen. Die Larven besitzen<br />
eine ausgeprägte Resistenz gegenüber län-<br />
gerer Austrocknung ihrer Habitate.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die ersten Meldungen über F<strong>und</strong>e von<br />
<strong>Somatochlora</strong> flavomaculata datieren<br />
bereits aus dem Jahre 1911 von der Insel<br />
Helgoland. Insgesamt ist die Anzahl besetz-<br />
ter Quadranten in den letzten 20 Jahren<br />
deutlich zurückgegangen, obwohl im<br />
Zusammenhang mit einigen flächen-<br />
deckenden Kartierungen der vergangenen<br />
Jahre zahlreiche Einzelmeldungen vorlie-<br />
gen. Der aktuelle Verbreitungsschwerpunkt<br />
von <strong>Somatochlora</strong> flavomaculata liegt in<br />
den südlichen Teilen des Östlichen Hügel-<br />
landes. Die Nachweise aus der südöstli-<br />
chen Geest stammen im wesentlichen aus<br />
den Mooren im Hamburger Umland (Witt-<br />
moor, Nienwohlder Moor).<br />
101
102<br />
0 MG<br />
MF <strong>Somatochlora</strong><br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
<strong>metallica</strong><br />
ST S EE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
•<br />
PF<br />
c<br />
PE
Glänzende Smaragdlibelle -<br />
<strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong> (VAN DER LINDEN 1825)<br />
Verbreitung<br />
<strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong> wird von DEVAI<br />
(1976) als westsibirisches Faunenelement<br />
eingestuft. Die Verbreitung der Art<br />
erstreckt sich von Sibirien bis Frankreich<br />
<strong>und</strong> von Mittelitalien bis jenseits des Polar<br />
kreises. In Deutschland ist <strong>Somatochlora</strong><br />
<strong>metallica</strong> allgemein weit verbreitet.<br />
Habitatanspruche<br />
<strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong> kommt sowohl an<br />
langsam fließenden als auch an stehenden<br />
Gewässern vor. Dabei werden offensicht-<br />
lich größere Gewässer mit zumindest<br />
abschnittsweise ausgebildetem Gehölz-<br />
saum <strong>und</strong> schlammigem Gr<strong>und</strong> bevorzugt.<br />
Viele Beobachtungen stammen von künst-<br />
lich angelegten Gewässern wie Fischtei-<br />
chen <strong>und</strong> Gräben.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Auch zu <strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong> stammen<br />
die ältesten Meldungen von Helgoland. Die<br />
Art ist in Schleswig-Holstein insbesondere<br />
in den südlichen Teilen von Geest <strong>und</strong><br />
Hügelland weit verbreitet, wenn sie auch<br />
kaum in hohen Ab<strong>und</strong>anzen auftritt. Dage-<br />
gen wird die Marsch offensichtlich weitge-<br />
hend gemieden.<br />
103
104<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
ME<br />
Libellula depressa<br />
O<br />
•<br />
••<br />
e•<br />
••<br />
••<br />
• •<br />
•<br />
• • •<br />
•<br />
•• • •<br />
•<br />
•<br />
ST SEE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
0 vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
8<br />
Jul<br />
PE
Plattbauch -<br />
Libellula depressa (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
Libellula depressa ist nach ST. QUENTIN<br />
(1960) ein eurosibirisches Faunenelement,<br />
DEVAI (1976) zählt sie dagegen zum ponto-<br />
mediterranen Faunenkreis. Mit Ausnahme<br />
von Irland, Schottland sowie Mittel- <strong>und</strong><br />
Nordskandinavien wird ganz Europa besie-<br />
delt. Im Mittelmeerraum ist die Art weit<br />
verbreitet. Im Osten reicht das Areal bis<br />
Westasien (Altai). In Deutschland besiedelt<br />
Libellula depressa überwiegend die westli-<br />
chen flachen Teile <strong>und</strong> scheint die Hochla-<br />
gen zu meiden (SCHORR 1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Libellula depressa besiedelt als Pionierart<br />
insbesondere vegetationsarme Gewässer<br />
beziehungsweise Gewässerabschnitte. Der<br />
Deckungsgrad der Vegetation beträgt in<br />
der Regel unter 50 Prozent (GLITZ 1970 al.<br />
Vielfach handelt es sich dabei um flache<br />
Gewässer. Typische Habitate sind Abgra-<br />
bungsgewässer, Tümpel, Teiche, Torfstiche<br />
sowie langsam fließende Gräben <strong>und</strong><br />
Bäche. An größeren Gewässern ist die Art<br />
selten (GLITZ et al. 1989).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die Art ist über alle Naturräume verbreitet.<br />
Im Landesteil Holstein ist sie allgemein<br />
häufig, im Landesteil Schleswig offenbar<br />
seltener. SCHMIDT (1966) betont die jahr-<br />
weise schwankende Ab<strong>und</strong>anz der Art <strong>für</strong><br />
diese Region, wobei sie nur in Jahren mit<br />
sonnigem Frühsommer häufig ist. Weiter-<br />
hin hält er auch Zuwanderungen <strong>für</strong> wahr-<br />
scheinlich. Auf Schwankungen ist in der<br />
Zukunft zu achten.<br />
105
106<br />
0 Libellula fulva<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
0 vor1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 o Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
PF
Spitzenfleck -<br />
Libellula fulva (MÜLLER 1764)<br />
Verbreitung<br />
Libellula fulva ist nach ST. QUENTIN (19601<br />
ein eurosibirisches Faunenelement. Das<br />
Areal der Art reicht von Spanien bis zum<br />
Iran. In Nordeuropa wurde sie bisher nur<br />
von wenigen Orten wie in Finnland nach-<br />
gewiesen. Das Vorkommen von Libellula<br />
fulva ist in Deutschland auf wenige<br />
Gebiete beschränkt.<br />
Habitatansprüche<br />
Libellula fulva besiedelt sonnige, kalkrei-<br />
che, stehende <strong>und</strong> langsam fließende<br />
Gewässer mit ausgeprägter Röhricht-<br />
beziehungsweise Großseggen-Vegetation<br />
im Uferbereich (SCHMIDT 1975 b,<br />
THOMES 19871. Die meisten F<strong>und</strong>ortan-<br />
gaben betreffen Tieflandflüsse, Altarme,<br />
Kleinseen <strong>und</strong> Weiher, es werden aber<br />
auch künstliche Gewässer wie Kanäle <strong>und</strong><br />
Gräben besiedelt (ZIEBELL & BENKEN<br />
1982, BUCHWALD et al. 19861.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Das Vorkommen von Libellula fulva ist -<br />
mit Ausnahme zweier F<strong>und</strong>e an der unte-<br />
ren Treene <strong>und</strong> der Eider - ganz auf das<br />
östliche <strong>und</strong> südliche Holstein beschränkt.<br />
Die ersten Nachweise stammen aus dem<br />
Jahre 1908. Bis etwa 1970 erfolgten relativ<br />
kontinuierlich weitere Beobachtungen in<br />
geringer Zahl. Ab 1970 ist ein deutlicher<br />
Anstieg zu verzeichnen, der vermutlich auf<br />
eine verstärkte, teilweise flächendeckende<br />
Beobachtungsintensität zurückzuführen ist.<br />
Eine Zunahme der Art darf hieraus jedoch<br />
nicht abgeleitet werden.<br />
107
108<br />
Libellula quadrimaculata<br />
•<br />
55<br />
•<br />
•<br />
• •<br />
O<br />
en Mal Jtn JuW<br />
ST S E E<br />
NE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
PE<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Vierfleck -<br />
Libellula quadrimaculata (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
Libellula quadrimaculata ist nach DEVAI<br />
(1976) ein sibirisches Faunenelement mit<br />
holarktischer beziehungsweise circumbo-<br />
realer'Verbreitung (GEIJSKES & VAN TOL<br />
1983). Sie besiedelt Nordamerika, fast ganz<br />
Europa <strong>und</strong> Zentralasien nach Osten bis<br />
Japan. Die Art ist in Deutschland allgemein<br />
verbreitet.<br />
Habitatansprüche<br />
Als euryöke Art kommt Libellula<br />
quadrimaculata in stehenden Gewässern<br />
unterschiedlicher Größe <strong>und</strong> Nährstoffge<br />
halt vor (WIEBUSCH & HEINBOCKEL 1983).<br />
Dabei werden Salzgehalte bis zu 7 %o<br />
(MIELEWCZYK 1970) <strong>und</strong> auch ein Aus-<br />
trocknen des Gewässers toleriert<br />
(SCHMIDT, B. 1991). An oligotrophen bis<br />
mesotrophen, vielfach moorigen Gewäs-<br />
sern mit breiter, reichgegliederter Verlan-<br />
dungszone werden hohe Individuenzahlen<br />
erreicht. Gerne werden auch Gartenteiche<br />
angenommen (GLITZ et al. 1989).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Die Art ist über alle Naturräume verbreitet<br />
<strong>und</strong> zumeist auch häufig. Lediglich im<br />
Bereich der Nordseemarschen <strong>und</strong> der<br />
Ostseeküste sind die F<strong>und</strong>e relativ spärlich.<br />
Die nach Norden abnehmende Dichte ist<br />
sicherlich auch auf Nachweislücken zurückzuführen.<br />
109
110<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
ORD-<br />
4 0<br />
SEE<br />
Orthetrum brunneum<br />
ST S EE<br />
1 ME NE ' PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Aug
Südlicher Blaupfeil -<br />
Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE 1837)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Nach DEVAI (19761 ist Orthetrum<br />
brunneum ein holomediterranes Faunen-<br />
element. Das Areal der Art reicht von der<br />
Iberischen Halbinsel im Westen über Nord-<br />
afrika, den Vorderen Orient <strong>und</strong> Teilen<br />
Asiens nach Osten bis Kaschmir <strong>und</strong> zur<br />
Wüste Gobi (STARK 1976). In Europa liegt<br />
der Verbreitungsschwerpunkt im Mittel-<br />
meergebiet. Die Art kommt in Süddeutsch-<br />
land mehr oder minder flächendeckend bis<br />
etwa zur Mainlinie vor (SCHORR 1990).<br />
Nördlich davon wurden meist nur sehr ver-<br />
streute Vorkommen bekannt.<br />
Habitatansprüche<br />
Nach BUCHWALD et al. 11986) <strong>und</strong><br />
PLACHTER (1985) ist Orthetrum brunneum<br />
eine Pionierart flacher, zum Teil auch ephe-<br />
merer, vegetationsarmer <strong>und</strong> sommerwar-<br />
mer Kleingewässer. Die Vegetationsbe-<br />
deckung der Habitate der Art beträgt im<br />
Optimalfall 10 bis 30 Prozent. Vielfach sind<br />
langsame Wasserbewegungen oder Quell-<br />
einflüsse vorhanden. Typische Habitate<br />
sind neben langsam fließenden Bächen<br />
<strong>und</strong> geräumten Gräben (DONATH 1980)<br />
vor allem Abgrabungsgewässer, ferner<br />
Schlenken in Kalkquell- <strong>und</strong> Hochmooren.<br />
Es sind bisher zwei F<strong>und</strong>orte im südlichen<br />
beziehungsweise südöstlichen Holstein<br />
bekannt geworden, die sich gut in das skiz-<br />
zierte Habitatschema der Art einfügen.<br />
1994 wurde ein einzelnes Tier in der Krei-<br />
degrube Saturn bei Itzehoe nachgewiesen<br />
(BUCK 1990 a(. Im Jahr 1995 wurden meh-<br />
rere Exemplare in der Nähe des Schaal-<br />
sees an einem 1,5 m breiten, flachen <strong>und</strong><br />
langsam fließenden Graben beobachtet,<br />
der frisch geräumt war. Vermutlich hängt<br />
der Einflug mit der Folge relativ heißer<br />
Sommer in den letzten Jahren zusammen.<br />
111
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Orthetrum cancellatum<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O Anfang O vor 1925<br />
O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
112<br />
20<br />
.an leo Mrz epr Mal h,r ♦ug Sep. 0k1 Mov Dez
Großer Blaupfeil -<br />
Orthetrum cancellatum (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
Orthetrum cancellatum ist nach<br />
ST. QUENTIN (1960) <strong>und</strong> DEVAI (1976) dem<br />
holomediterranen Faunenkreis zuzurech-<br />
nen. In Nordeuropa fehlt die Art, im Osten<br />
reicht das Areal bis zum oberen Jenessij-<br />
Gebiet (BELYSCHEV 1958). In Deutschland<br />
ist Orthetrum cancellatum allgemein weit<br />
verbreitet <strong>und</strong> häufig, meidet aber Hochla-<br />
gen über 750 m.<br />
Habitatansprüche<br />
Als Pionierart besiedelt Orthetrum<br />
cancellatum bevorzugt sonnige, vegetati-<br />
onsarme Uferzonen von größeren stehen-<br />
den Gewässern. Sie verhält sich in Bezug<br />
auf den Wasserchemismus weitgehend<br />
indifferent: es werden sowohl brackige als<br />
auch saure, moorige Gewässer besiedelt.<br />
Außer in Seen <strong>und</strong> Weihern lebt Orthetrum<br />
cancellatum in einer Vielzahl künstlicher<br />
Gewässertypen wie Abgrabungsgewäs-<br />
sern, Fischteichen, Regenrückhaltebecken<br />
sowie auch in frischen <strong>und</strong> wasserspei-<br />
chernden Spülfeldern (GLITZ et al. 1989).<br />
Die freie Wasserfläche beträgt nach GLITZ<br />
(1970 b) mindestens 2000 m'.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Orthetrum cancellatum ist über alle<br />
Naturräume verbreitet. Im südlichen <strong>und</strong><br />
östlichen Schleswig-Holstein ist die Art all-<br />
gemein häufig, während im nordwestli-<br />
chen Teil des Landes sowie von den Inseln,<br />
Küsten <strong>und</strong> Marschen nur wenige Beob-<br />
achtungen gemeldet wurden.<br />
113
114<br />
0 Orthetrum coerulescens<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9 O RD- C<br />
8 a<br />
7 SEE<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Jm<br />
Ap<br />
ST SEE<br />
ME 1 NE 1 PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
De,
Kleiner Blaupfeil -<br />
Orthetrum coerulescens (FABRICIUS 1798)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
GEIJSKES & VAN TOL 11983) stellen<br />
Orthetrum coerulescens zum adriatomediterranen<br />
Faunenkreis. Die Art ist im<br />
gesamten Mittelmeerraum verbreitet, mit<br />
inselartigen Vorkommen nordwärts bis<br />
Südirland, Südengland <strong>und</strong> Südskandina-<br />
vien IGLITZ et al. 1989). Im Osten reicht<br />
das Areal bis Westrußland. In Deutschland<br />
kommt Orthetrum coerulescens nur verein-<br />
zelt vor (SCHORR 1990) <strong>und</strong> ist nach<br />
KIKILLUS & WEITZEL (1981) offenbar<br />
streng an die Tiefebenen <strong>und</strong> klimatisch<br />
begünstigte Standorte der Mittelgebirge<br />
geb<strong>und</strong>en.<br />
Habitatansprüche<br />
Die Art besiedelt kleine, quellige, teilweise<br />
nur wenige Zentimeter tiefe Gewässer in<br />
sonniger Lage mit lockerem, <strong>für</strong> die Larven<br />
zum Graben geeignetem Substrat<br />
(SCHORR 1990). Als Habitate werden kalk-<br />
reiche Wiesenbäche <strong>und</strong> Gräben, Schlenken<br />
<strong>und</strong> Torfstiche in Hoch- <strong>und</strong> Heidemooren<br />
sowie - insbesondere <strong>für</strong> Süddeutschland -<br />
Schlenken <strong>und</strong> Quellabflüsse von Kalkflachmooren<br />
genannt.<br />
Orthetrum coerulescens wurde bis in die<br />
70er Jahre an zwei Bächen im südöstlichen<br />
Holstein beobachtet. Die meisten Nach-<br />
weise stammen vom Lottseebach. An der<br />
Bille beziehungsweise nahe eines Neben-<br />
baches der Bille wurde die Art einmal registriert.<br />
Seit 1977 wurde Orthetrum<br />
coerulescens nicht mehr in Schleswig-<br />
Holstein nachgewiesen.<br />
115
116<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9 55 O RD-<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
SEE<br />
Sympetrum danae<br />
ME 1 NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
.bn fob Akx Apr Mai An 1A Aug Sep Okt Nov Uai
Schwarze Heidelibelle -<br />
Sympetrum danae (SULZER 1776)<br />
Verbreitung<br />
Die Art ist nach DEVAI (1976) ein sibiri-<br />
sches Faunenelement <strong>und</strong> nach GEIJSKES<br />
& VAN TOL (1983) holarktisch verbreitet. In<br />
Europa verläuft die Südgrenze des Areals<br />
in den Pyrenäen <strong>und</strong> in Norditalien. Bis auf<br />
Island <strong>und</strong> Nordskandinavien wird der<br />
größte Teil Nordeuropas besiedelt. Im<br />
Osten reicht die Verbreitung bis Japan. In<br />
Deutschland erreicht die Art ihre höchsten<br />
Bestandsdichten im Norden. Nach Süden<br />
hin ist eine starke Abnahme zu beobachten.<br />
Habitatansprüche<br />
Sympetrum danae kommt nach<br />
LOHMANN (1980) in Verlandungszonen<br />
von Gewässern aller Art vor <strong>und</strong> besitzt<br />
dabei ein ausgeprägtes Optimum in sau-<br />
ren, nährstoffarmen Moor- <strong>und</strong> Heidege-<br />
wässern. Vermutlich kommt dem Vorhan-<br />
densein senkrechter Riedvegetation eine<br />
hohe Bedeutung zu (SCHEFFLER 1970). Es<br />
werden vielfach sehr flache sowie'ephe-<br />
mere Gewässerzonen besiedelt (ROBERT<br />
1959, SCHMIDT, B. 1991). Als weitere Habi-<br />
tate werden unter anderem vegetationsrei-<br />
che Gräben (GLITZ et al. 1989) <strong>und</strong><br />
brackige Strandseen der Ostseeküste<br />
genannt (MIELEWCZYK 1970).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Sympetrum danae ist über alle Naturräume<br />
verbreitet <strong>und</strong> - insbesondere in Mooren -<br />
zumeist häufig. Lediglich in den Marschge-<br />
bieten tritt sie nur spärlich auf. In den letz-<br />
ten Jahren gibt es Hinweise <strong>für</strong> einen<br />
gebietsweisen Rückgang der Art, der aber<br />
mit dem vorliegenden Datenmaterial nicht<br />
eindeutig zu belegen ist. Auf die Bestands-<br />
entwicklung ist in Zukunft zu achten.<br />
117
118<br />
MG<br />
0 MF<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Sympetrum flaveolum<br />
%T SEE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
PF<br />
c<br />
PE
Gefleckte Heidelibelle -<br />
Sympetrum flaveolum (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
DEVAI (1976) zählt Sympetrum flaveolum<br />
zum sibirischen Faunenkreis. Die Art besie-<br />
delt fast ganz Europa. Im Osten reicht die<br />
Verbreitung bis Kamtschatka <strong>und</strong> Japan<br />
(STARK 1976). Sie ist in ganz Deutschland<br />
verbreitet, wobei sich regionale Schwer-<br />
punkte feststellen lassen.<br />
Habitatansprüche<br />
Die Art ist typisch <strong>für</strong> mesotrophe bis<br />
eutrophe Verlandungsbereiche mit stark<br />
wechselndem Wasserstand <strong>und</strong> wenig-<br />
stens teilweiser sommerlicher Austrock-<br />
nung (BUCHWALD et al. 1986). Für die<br />
Eiablage sind dichte Moospolster beson-<br />
ders günstig (BUCHWALD 1983 b). Habi-<br />
tate sind Verlandungsbereiche von Wei-<br />
hern <strong>und</strong> Seen, Sümpfe, Nieder- <strong>und</strong><br />
Übergangsmoore <strong>und</strong> Marschgräben<br />
(GLITZ et al. 1989) <strong>und</strong> Brackwasserzonen<br />
(MIELEWCZYK 1970).<br />
Sympetrum flaveolum ist über alle<br />
Naturräume verbreitet. Im Nordwesten des<br />
Landes, insbesondere in der Marsch,<br />
wurde die Art seltener registriert als im<br />
Osten <strong>und</strong> Süden. SCHMIDT (1966) <strong>und</strong><br />
BUCK 11994) weisen auf die jahrweise stark<br />
schwankende Ab<strong>und</strong>anz der Art hin. Nach<br />
SCHMIDT 119661 ist sie im Landesteil<br />
Schleswig (Nordwesten) nach einer Folge<br />
von Jahren mit verregnetem Sommer sel-<br />
ten oder fehlt völlig; weiterhin nimmt er <strong>für</strong><br />
diese Region eine starke Zuwanderung der<br />
Art aus dem Süden an. Die Häufung von<br />
Registrierungen in den Jahren 1992 bis<br />
1995 ist sicher teilweise eine Folge ver-<br />
stärkter Beobachtungsintensität, dürfte<br />
aber auch mit den relativ trockenen <strong>und</strong><br />
warmen Sommern zusammenhängen.<br />
119
120<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9 ly O RD-<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
4 0<br />
SEE<br />
Sympetrum fonscolombei<br />
O ST S EE<br />
I ME NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 C Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Aug
Frühe Heidelibelle -<br />
Sympetrum fonscolombei (SELYS 1840)<br />
Verbreitung<br />
ST. QUENTIN (1960) <strong>und</strong> DEVAI (19761<br />
bezeichnen Sympetrum fonscolombei als<br />
holomediterranes Faunenelement, dessen<br />
Areal nach Norden bis Schottland, nach<br />
Westen bis Spanien <strong>und</strong> nach Osten bis<br />
Zentralasien reicht (STARK 19761. Als sehr<br />
vagile Art stößt sie immer wieder nach<br />
Norden vor. In Deutschland kommt<br />
Sympetrum fonscolombei bodenständig<br />
nur in wenigen punktuell verbreiteten<br />
Populationen im Süden vor.<br />
Habitatansprüche<br />
In Mitteleuropa werden bevorzugt flache<br />
beziehungsweise ephemere, sonnige Pio-<br />
niergewässer mit spärlicher Vegetationsbe-<br />
deckung besiedelt (BUCHWALD 1985,<br />
LEMPERT 19871. In Süddeutschland wer-<br />
den vor allem Kiesabbaugewässer in ther-<br />
misch begünstigter Lage im Oberrheintal,<br />
Bodenseegebiet <strong>und</strong> Alpenvorland ange-<br />
nommen (BELLMANN 19871.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Bis 1995 lagen lediglich Nachweise von<br />
zwei F<strong>und</strong>orten aus dem östlichen Hügel-<br />
land jeweils nahe der Ostseeküste vor. Bei<br />
Grömitz wurde Sympetrum fonscolombei<br />
zweimal in der ersten Hälfte dieses Jahr-<br />
h<strong>und</strong>erts beobachtet. Ein aktueller F<strong>und</strong><br />
(19931 stammt von einem größeren Teich<br />
mit flachem Ufer <strong>und</strong> spärlichem Uferröh-<br />
richt im Naturschutzgebiet Barsbeker See<br />
nordöstlich von Kiel. Im Mai/Juni 1996<br />
konnte in ganz Deutschland sowie den Nie-<br />
derlanden <strong>und</strong> England ein starker Einflug<br />
von Sympetrum fonscolombei beobachtet<br />
werden (LEMPERT mündlich). Während<br />
dieser Zeit trat die Art auch in Nord-<br />
deutschland auf, zunächst in beachtlicher<br />
Zahl im Innenstadtbereich Hamburgs,<br />
wenige Tage später, am B. Juni 1996, auch<br />
in Schleswig-Holstein im Kreis Pinneberg.<br />
Weiter nach Norden beziehungsweise<br />
Nordwesten konnte Sympetrum<br />
fonscolombei trotz gezielter Nachsuche<br />
nicht nachgewiesen werden. Die Art hat in<br />
Hamburg nachweislich reproduziert, <strong>und</strong><br />
bereits Anfang September 1996 schlüpften<br />
hier auch die ersten Tiere (LEMPERT<br />
mündlich). Auch im Kreis Stormarn wur-<br />
den noch im selben Monat ebenfalls frisch-<br />
geschlüpfte Sympetrum fonscolombei<br />
gef<strong>und</strong>en (LANGE mündlich). Die Art<br />
könnte also in Schleswig-Holstein durch-<br />
aus auf Dauer bodenständig werden.<br />
121
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4Q<br />
3^a<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9 ORD-<br />
8 4 0<br />
7 S EE<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2 ^<br />
Sympetrum meridionale<br />
ST SEE<br />
ME 1 NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
1 I I 1 1 1 1 I<br />
kn fob Mr: Aw wi am AA . . Mor oa<br />
122
Südliche Heidelibelle -<br />
Sympetrum meridionale (SELYS 1841)<br />
Verbreitung<br />
DEVAI (1976) bezeichnet Sympetrum<br />
meridionale als holomediterranes Faunen-<br />
element. Nach STARK (19761 kommt die<br />
Art im Westen bis Spanien <strong>und</strong> im Osten<br />
bis zum Amur vor. Nördlich der Alpen tritt<br />
die wanderfreudige Art nur sporadisch auf.<br />
Für Deutschland liegen nur Streuf<strong>und</strong>e vor,<br />
wobei Sympetrum meridionale im Süden<br />
zumindest zeitweise häufig auftreten kann<br />
(SCHORR 1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Als Lebensraum werden insbesondere<br />
ephemere, sommerwarme Klein- <strong>und</strong><br />
Kleinstgewässer in Verlandungszonen ste-<br />
hender Gewässer angegebén<br />
(MÜNCHBERG 1982, BUCHWALD et al.<br />
1984). Der Wasserchemismus der F<strong>und</strong>orte<br />
variiert in hohem Maße, es werden sowohl<br />
oligotrophe Hoch- <strong>und</strong> Heidemoore<br />
(LOHMANN 1980) als auch eutrophe Rohr-<br />
kolben-Flachgewässer genannt (DREYER<br />
1986).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Ein einzelnes Männchen dieser Art wurde<br />
nur einmal, ohne genauere Angaben, ver-<br />
mutlich um die Jahrh<strong>und</strong>ertwende bei<br />
Hamburg von FELDTMANN gefangen<br />
(nach ROSENBOHM 1931). Obwohl keine<br />
genauen F<strong>und</strong>angaben zum einzigen Nach-<br />
weis dieser Art in Schleswig-Holstein vor-<br />
liegen, wurde Sympetrum meridionale bis-<br />
her in allen regionalen Odonatenlisten<br />
aufgeführt. Da derart erfahrene Odonatolo-<br />
gen wie ROSENBOHM (1931) <strong>und</strong><br />
SCHMIDT (in: LANDESAMT FUR NATUR-<br />
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 1982)<br />
offenbar nicht an der Richtigkeit des Nach-<br />
weises durch FELDTMANN zweifelten,<br />
wurde die Art auch hier aufgenommen.<br />
123
124<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
SEE<br />
4 0<br />
Sympetrum pedemontanum<br />
NF<br />
O ST SEE<br />
I ME NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 C Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jm<br />
A,<br />
s.p
Gebänderte Heidelibelle -<br />
Sympetrum pedemontanum (ALLIONI 1766)<br />
Verbreitung<br />
Sympetrum pedemontanum wird von<br />
GEIJSKES & VAN TOL (19831 als sibiri-<br />
sches Faunenelement bezeichnet. Im<br />
Westen erreicht die Art Spanien <strong>und</strong><br />
kommt ostwärts durchgehend bis Japan<br />
vor. An der Arealgrenze in Norddeutsch-<br />
land zeigt sie eine Ausbreitungstendenz<br />
(BUCK 1990 b).<br />
Habitatansprüche<br />
Nach BUCHWALD et al. 11984) lebt die Art<br />
hauptsächlich in „spärlich bis dicht<br />
bewachsenen Uferzonen von Seen, Tüm-<br />
peln, träge fließenden Altwassern, Kiesgru-<br />
bengewässern, Seggensümpfen". Sie<br />
kommt in der Regel in „ausgeprägt som-<br />
merwarmen Gewässerbereichen" vor.<br />
Häufig ist eine Besiedlung instabiler Habi-<br />
tate mit Pioniercharakter zu beobachten,<br />
wobei insbesondere regelmäßig geräumte<br />
Gräben bedeutende Fortpflanzungsgewäs-<br />
ser sind (DONATH 1980, STÖCKEL 1983).<br />
BEYER (19881 weist auf die Bevorzugung<br />
von Flachwasserzonen bis 30 cm Tiefe hin.<br />
Bemerkenswert ist außerdem die Fähigkeit<br />
zur Besiedlung ephemerer Gewässer<br />
(TAMM 1982).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Sympetrum pedemontanum wurde 1982<br />
im äußersten Südosten bei Lauenburg an<br />
der Elbe zum ersten Mal in Schleswig-<br />
Holstein nachgewiesen. Im Jahr 1985<br />
wurde die Art im äußersten Nordosten des<br />
Landes im Naturschutzgebiet Oehe-<br />
Schleimünde entdeckt; dieses ist allerdings<br />
bislang der einzige Nachweis nördlich des<br />
Nord-Ostsee-Kanals. Fast alle übrigen<br />
F<strong>und</strong>orte betreffen das südliche <strong>und</strong><br />
südöstliche Holstein. Das größte bekannte<br />
<strong>und</strong> nachweislich reproduktive Vorkom-<br />
men befindet sich in der Kreidegrube<br />
Saturn bei Itzehoe (BUCK 1990 b). Ange-<br />
sichts der südöstlichen Verbreitung mag<br />
die Elbe mit ihren Nebenflüssen als Leitli-<br />
nie eine besondere Bedeutung bei der Ein-<br />
wanderung dieser Art haben (FISCHER<br />
1984131.<br />
125
126<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Sympetrum sanguineum<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
0 vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 C Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
•.<br />
4pr<br />
O<br />
ST SEE<br />
ME 1 NE PE
Blutrote Heidelibelle -<br />
Sympetrum sanguineum (MÜLLER 1764)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Sympetrum sanguineum ist nach ST.<br />
QUENTIN (1960) <strong>und</strong> DEVAI (19761 ein<br />
holomediterranes Faunenelement. Die Art<br />
ist in ganz Süd- <strong>und</strong> Mitteleuropa bis<br />
Südirland, Mittelengland <strong>und</strong> Südskandi-<br />
navien verbreitet. Nach Osten kommt sie<br />
bis in die Mongolei <strong>und</strong> an den Amur vor<br />
(STARK 1976, GEIJSKES & VAN TOL 1983).<br />
In Deutschland kommt Sympetrum<br />
sanguineum mittlerweile überall mehr<br />
oder minder häufig Vor.<br />
Habitatansprüche<br />
Sympetrum sanguineum besiedelt bevorzugt<br />
die Verlandungszonen sonniger, nähr-<br />
stoffreicher stehender <strong>und</strong> langsam<br />
fließender Gewässer (BUCHWALD et al.<br />
1986). Einige Autoren heben die Bedeu-<br />
tung von nicht zu dichten Röhrichtstruktu-<br />
ren an Gräben <strong>und</strong> Bächen hervor<br />
(BREUER & RITZAU 1983, BUCHWALD<br />
1983 b). Die Art entwickelt sich häufig auch<br />
in ephemeren Gewässern (BUCHWALD<br />
1983 b, SCHMIDT, B. 1991). Moore werden<br />
ebenfalls besiedelt, ausgesprochen oligo-<br />
trophe Gewässer scheinen dagegen<br />
gemieden zu werden (WIEBUSCH &<br />
HEINBOCKEL 1983).<br />
Sympetrum sanguineum wurde vor 1960<br />
in Schleswig-Holstein nur siebenmal nach-<br />
gewiesen. Nach den vorliegenden Daten<br />
stieg in den 60er Jahren die Zahl der<br />
Registrierungen deutlich an. Dennoch<br />
nennt SCHMIDT (19661 <strong>für</strong> diesen Zeitraum<br />
nur einen F<strong>und</strong>ort im Landesteil Schleswig<br />
nahe Kiel, während er sie <strong>für</strong> Holstein als<br />
„nicht häufig" bezeichnet. Die Zahl der<br />
Nachweise in den 70er Jahren liegt nur<br />
geringfügig über denen des vorangehen-<br />
den Jahrzehnts. Erst in den 80er Jahren<br />
steigt die Zahl der F<strong>und</strong>e stark an, <strong>und</strong> ab<br />
1989 wird die Art sehr häufig beobachtet.<br />
Somit ist eine stetige Zunahme in der<br />
zweiten Hälfte dieses Jahrh<strong>und</strong>erts zu ver-<br />
zeichnen. Aktuell ist Sympetrum<br />
sanguineum über alle Naturräume verbrei-<br />
tet <strong>und</strong> nahezu genauso häufig wie<br />
S. vulgatum. Es ist jedoch ein ausgepräg-<br />
tes Südost-Nordwest-Gefälle festzustellen:<br />
während die Art in Holstein allgemein häu-<br />
fig ist, sind sowohl die Zahl der Nachweise<br />
als auch die Individuenzahlen nördlich des<br />
Nord-Ostsee-Kanals relativ gering. Beson-<br />
ders spärlich ist sie in der Nordseemarsch<br />
<strong>und</strong> auf den nordfriesischen Inseln mit<br />
Ausnahme von Föhr <strong>und</strong> Sylt vertreten.<br />
127
128<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9 IPI O RD-<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Sympetrum striolatum<br />
•.<br />
O ST SEE<br />
Cr" 0 01<br />
I ME NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jm V.b I,YZ Ay 11 n1 .Mr w^ RUo Sp
Große Heidelibelle -<br />
Sympetrum striolatum (CHARPENTIER 1840)<br />
Verbreitung<br />
Sympetrum striolatum ist nach DEVAI<br />
(1976) ein holomediterranes Faunenele-<br />
ment. Die Art besitzt ein großes Verbrei-<br />
tungsgebiet, das den ganzen Mittelmeer-<br />
raum <strong>und</strong> Europa nordwärts bis zu den<br />
Britischen Inseln <strong>und</strong> Südskandinavien<br />
einschließt. Im Osten erreicht Sympetrum<br />
striolatum China <strong>und</strong> Japan (GEIJSKES &<br />
VAN TOL 1983). In Deutschland kommt die<br />
Art im Norden <strong>und</strong> den Mittelgebirgslagen<br />
sehr viel spärlicher als im Westen <strong>und</strong><br />
Süden vor.<br />
Habitatansprüche<br />
In Mitteleuropa besiedelt Sympetrum<br />
striolatum als Pionierart insbesondere son-<br />
nenexponierte Sek<strong>und</strong>ärbiotope wie Kies-<br />
gruben, Gräben <strong>und</strong> Kanäle, denen zumin-<br />
dest teilweise im Uferbereich höhere<br />
Vegetation fehlt (JACOB 1969). Als optimal<br />
wird ein Deckungsgrad der Vegetation von<br />
25 Prozent genannt (BUCHWALD 1985). In<br />
derartigen instabilen Pionierhabitaten<br />
gelangt die Art zu optimaler Entfaltung<br />
(KIKULLUS & WEITZEL 1981, BUCK 1990<br />
b). Nach B. SCHMIDT (1991) entwickelt sich<br />
Sympetrum striolatum auch in ephemeren<br />
Gewässern.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Sympetrum striolatum wurde in Schleswig-<br />
Holstein bisher relativ selten beobachtet,<br />
überwiegend im Süden <strong>und</strong> Osten<br />
SCHMIDT (1974) weist darauf hin, daß die<br />
Häufigkeit der südlichen Art von Jahr zu<br />
Jahr in Abhängigkeit von der Witterung<br />
schwankt; außerdem hält er eine ständige<br />
Einwanderung <strong>für</strong> möglich. Die starke<br />
Zunahme der Nachweise seit 1988 dürfte<br />
teilweise mit verstärkter Beobachtungstä-<br />
tigkeit zusammenhängen. Auffallend ist<br />
jedoch auch die besonders hohe Zahl von<br />
Nachweisen in den Jahren 1992, 1994 <strong>und</strong><br />
1995 mit jeweils heißen Sommern. In den<br />
Jahren 1994 <strong>und</strong> 1995 wurde im Kreis<br />
Steinburg mehrfach die erfolgreiche Fort-<br />
pflanzung der Art nachgewiesen, insbeson-<br />
dere in der Kiesgrube Saturn bei Itzehoe<br />
sowie in dem benachbarten Dammteich<br />
(BUCK 1990 a, 1994).<br />
129
130<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Sympetrum vulgatum<br />
• •<br />
6 0 ST SEE<br />
ME I NE<br />
PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Gemeine Heidelibelle -<br />
Sympetrum vulgatum (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Sympetrum vulgatum wird von<br />
ST. QUENTIN 11960) als eurosibirisches<br />
Faunenelement eingestuft. In Europa fehlt<br />
die Art im Mittelmeerraum <strong>und</strong> in großen<br />
Teilen Nordeuropas. Im Osten ist sie bis<br />
Südsibirien, China <strong>und</strong> Japan zu finden<br />
(GEIJSKES & VAN TOL 1983). Die Art<br />
kommt in ganz Deutschland verbreitet vor.<br />
Habitatansprüche<br />
Die Art besiedelt nach LOHMANN 11980)<br />
Gewässer aller Art wie Gräben, Weiher,<br />
Tümpel, Kleinstgewässer, große <strong>und</strong> kleine<br />
Seen, langsam fließende Wiesenbäche.<br />
Einige Autoren betonen die Bedeutung<br />
einer gut ausgebildeten Verlandungsvege-<br />
tation (MAYER 1961, JACOB 1969). Viel-<br />
fach erfolgt eine Entwicklung auch in ephe-<br />
meren Gewässern (SCHMIDT, B. 1991).<br />
GLITZ et al. (1989) bezeichnen die Art als<br />
Kulturfolger, die häufig an Gartenteichen<br />
vorkommt. Es werden mitunter auch hohe<br />
Salzkonzentrationen toleriert<br />
(MIELEWCZYK 1970).<br />
Sympetrum vulgatum ist in Schleswig-<br />
Holstein die häufigste Heidelibelle <strong>und</strong><br />
über alle Naturräume verbreitet. Im Süden<br />
<strong>und</strong> Osten des Landes ist die Art allgemein<br />
häufig, dagegen nimmt die F<strong>und</strong>häufigkeit<br />
nach Norden hin ab.<br />
131
132<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Leucorrhinia albifrons<br />
ME<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0<br />
O ST S EE<br />
2 3 4 5<br />
O vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jm Fee la, Apr<br />
PE
Östliche Moosjungfer -<br />
Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER 1839)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Dieses nach ST. QUENTIN (19601 eurosibi-<br />
rische Faunenelement ist nach Westen bis<br />
zu den Niederlanden <strong>und</strong> Südwestfrank-<br />
reich zu finden, wo sie allerdings nur in<br />
Inselpopulationen auftritt. Nach Süden<br />
kommt Leucorrhinia albifrons vereinzelt<br />
bis in die Schweiz <strong>und</strong> Österreich vor, nach<br />
Osten bis zum Ural. Im Norden sind der<br />
Südosten Schwedens <strong>und</strong> der Süden Finn-<br />
lands besiedelt. In Deutschland ist die Art<br />
nur punktuell verbreitet, wobei in den letz-<br />
ten Jahrzehnten sehr viele Vorkommen<br />
erloschen sind. Nur in Brandenburg<br />
scheint Leucorrhinia albifrons noch etwas<br />
häufiger zu sein. Schleswig-Holstein liegt<br />
am Nordwestrand des Areals.<br />
Habitatansprüche<br />
Die Art besiedelt dystrophe Waldseen mit<br />
Teich- <strong>und</strong> Seerosen vor der Schwingra-<br />
senzone (SCHMIDT 1975 b, LOHMANN<br />
1980). Nach SCHEFFLER (1973) ist<br />
Leucorrhinia albifrons eine Charakterart<br />
von Restseen mit weiherartigem Charakter,<br />
die inmitten eines oligotrophen, locker<br />
bewaldeten Waldhochmoores liegen.<br />
Die wenigen früheren Vorkommen von<br />
Leucorrhinia albifrons lagen nahezu alle im<br />
südöstlichen Hügelland sowie im west-<br />
mecklenburgischen Seen- <strong>und</strong> Hügelland.<br />
Die ersten F<strong>und</strong>e aus der Umgebung von<br />
Lübeck datieren aus dem Jahre 1934, der<br />
letzte F<strong>und</strong> stammt von 1970 aus dem<br />
Kreis Rendsburg.<br />
133
134<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Leucorrhinia caudalis<br />
O ST SEE<br />
ME I NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Jm
Zierliche Moosjungfer -<br />
Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER 1840)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Leucorrhinia caudalis ist nach DEVAI (1976)<br />
ein westsibirisches Faunenelement. Der<br />
Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt in<br />
Osteuropa <strong>und</strong> Südfinnland. Nach Westen<br />
ist sie bis Frankreich <strong>und</strong> den Niederlan-<br />
den, allerdings nur sporadisch, anzutref-<br />
fen. Schleswig-Holstein liegt am Nord-<br />
westrand des Areals. In Deutschland wies<br />
Leucorrhinia caudalis stets nur eine punktuelle<br />
Verbreitung auf. Aktuelle F<strong>und</strong>e exi-<br />
stieren derzeit nur noch aus Niedersach-<br />
sen, dem Voralpenraum <strong>und</strong> dem<br />
südlichen Oberrhein. SCHORR (19901 ver-<br />
mutet bezüglich der Dispersion der Art<br />
eine Bevorzugung der großen Flüsse<br />
Rhein, Donau <strong>und</strong> Elbe.<br />
Habitatansprüche<br />
Leucorrhinia caudalis bewohnt Torfmoor-<br />
gewässer <strong>und</strong> Waldseen mit Schwimm-<br />
blattzone (GLITZ et al. 1989). In Mitteleu-<br />
ropa kann sie als Charakterart der Teich-<br />
<strong>und</strong> Seerosenzone der Altwasser großer<br />
Flüsse <strong>und</strong> deren Auen bezeichnet werden.<br />
Ebenso besiedelt sie die Schwimmblatt-<br />
zone größerer, mäßig saurer Seen<br />
(SCHORR 1990).<br />
Ähnlich wie bei Leucorrhinia albifrons<br />
lagen die wenigen früheren Vorkommen<br />
von L. caudalis mit einer Ausnahme im<br />
südöstlichen Hügelland. Die ersten F<strong>und</strong>e<br />
vom Festland datieren aus dem Jahre<br />
1941, der letzte F<strong>und</strong> stammt von 1942, alle<br />
aus der Umgebung von Lübeck. Der Erst-<br />
nachweis aus 1889 von der Insel Helgoland<br />
zeigt, daß diese Art auch weite Strecken<br />
bewältigen kann.<br />
135
136<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Leucorrhinia dubia<br />
O ST S EE<br />
ME 1 NE PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984<br />
Feb Jun Sp
Kleine Moosjungfer -<br />
Leucorrhinia dubia (VAN DER LINDEN 1825)<br />
Verbreitung<br />
Leucorrhinia dubia ist ein eurosibirisches<br />
Faunenelement (ST. QUENTIN 1960). Die<br />
Art ist von Großbritannien bis Japan ver-<br />
breitet. In Europa tritt sie auch nördlich des<br />
Polarkreises auf, <strong>und</strong> nach Süden ist sie<br />
noch in den Alpen zu finden. In den Mittel-<br />
gebirgen besiedelt sie meist nur Moorbe-<br />
reiche. In Deutschland ist die Verbreitung<br />
nördlich der Mittelgebirge zwar nur spär-<br />
lich, erreicht aber lokal beziehungsweise<br />
regional in einigen Hochmoor-, Torfstich-<br />
oder Heidemoorgebieten hohe Ab<strong>und</strong>an-<br />
zen (SCHORR 1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Leucorrhinia dubia ist nach STEINER<br />
(1948) als tyrphobiont einzustufen. Sie<br />
fliegt zahlreich in Hochmooren, Uber-<br />
gangsmooren <strong>und</strong> an kleinen Moorwei-<br />
hern <strong>und</strong> ist als Charakterart der Torfmoos-<br />
gewässer <strong>und</strong> Hochmoore mit einem<br />
pH-Wert von 4 bis 4,2 anzusehen.<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
In Schleswig-Holstein ist Leucorrhinia<br />
dubia nur etwas seltener als L. rubic<strong>und</strong>a,<br />
mit der sie häufig vergesellschaftet auftritt.<br />
Das Verbreitungsbild ist insbesondere<br />
durch die Verteilung der Moorhabitate<br />
geprägt. Nach Norden hin nehmen die<br />
Nachweise ab.<br />
137
138<br />
MG<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Leucorrhinia pectoralis<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
o vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Große Moosjungfer -<br />
Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER 1825)<br />
Verbreitung Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Leucorrhinia pectoralis ist nach DEVAI<br />
(1976) ein westsibirisches Faunenelement,<br />
welches von Südschweden bis zu den<br />
Alpen <strong>und</strong> im Westen bis nach Frankreich<br />
verbreitet ist. In Deutschland ist die Art vor<br />
allem im Norddeutschen Tiefland zu fin-<br />
den, während in den Mittelgebirgen <strong>und</strong><br />
im Süden die F<strong>und</strong>ortdichte nur spärlich ist<br />
(SCHORB 1990).<br />
Habitatansprüche<br />
Nach LOHMANN 11980) bewohnt diese Art<br />
mesotrophe bis eutrophe saure Gewässer<br />
der Ebene. In Norddeutschland werden<br />
bevorzugt von Wald umgebene, kleine<br />
Ubergangsmoore, aber auch Torfmoos-<br />
moore mit Hochmoorcharakter <strong>und</strong> offene<br />
Niedermoore mit Weidengebüsch besiedelt.<br />
Wie Leucorrhinia dubia <strong>und</strong> L. rubic<strong>und</strong>a<br />
besiedelt L. pectoralis Schleswig-Holstéin<br />
nur punktuell. Nach SCHMIDT 11988) ist<br />
diese thermisch anspruchsvollste Art aus<br />
der rubic<strong>und</strong>a-Gruppe im Landesteil<br />
Schleswig als Vermehrungsgast einzustu-<br />
fen, da sie stets in geringer Ab<strong>und</strong>anz, oft<br />
nur als Einzeltier nachgewiesen wurde.<br />
Somit sind wahrscheinlich ausschließlich<br />
die F<strong>und</strong>e im Großraum Hamburg <strong>und</strong> im<br />
südöstlichen Hügel- <strong>und</strong> Seenland als<br />
bodenständig anzusehen. Aus diesen<br />
Bereichen stammen auch die meisten aktu-<br />
ellen Meldungen. Allerdings wird die Art<br />
selbst hier immer nur in relativ geringen<br />
Ab<strong>und</strong>anzen nachgewiesen.<br />
139
140<br />
0 Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7<br />
0 vor 1925 O Anfang 1925 O Anfang 1950<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974<br />
NF<br />
O ST SEE<br />
8 9 0 1 2 3 4 5<br />
G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1984<br />
An Ad Aug Sep Ok1 Nu,<br />
PF
Nordische Moosjungfer -<br />
Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a (LINNAEUS 1758)<br />
Verbreitung<br />
GEIJSKES & VAN TOL (1983) stufen<br />
Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a als sibirisches Fau-<br />
nenelement ein. Die Art ist von Frankreich<br />
nach Osten bis etwa 90° östlicher Länge<br />
verbreitet. Im Norden ist sie in ganz Skan-<br />
dinavien zu finden, im Süden bis Oster-<br />
reich, hier aber nur noch punktuell. Nach<br />
SCHORR 11990) liegt im Norden von<br />
Deutschland der Verbreitungsschwerpunkt<br />
dieser Art. In den Mittelgebirgen <strong>und</strong> im<br />
Süden existieren nur eher spärliche Vorkommen.<br />
Habitatansprüche<br />
Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a tritt häufig zusam-<br />
men mit L. dubia auf. Die Art ist ebenfalls<br />
eine typische Moorlibelle, welche in oli-<br />
gotrophen bis mesotrophen Mooren mit<br />
pH-Werten zwischen 4 <strong>und</strong> 5,5 zu finden<br />
ist. Bevorzugt werden torfmoosreiche<br />
Hoch- <strong>und</strong> Übergangsmoore. In moorigen<br />
Weihern mit mittleren Nährstoffgehalt<br />
nimmt die Bestandsdichte allerdings deut-<br />
lich ab (GLITZ et al. 1989).<br />
Vorkommen in Schleswig-Holstein<br />
Das mosaikartige Verbreitungsbild von<br />
Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a ist wie bei L. dubia<br />
geprägt durch die Verteilung der Moore im<br />
Lande. Allerdings nehmen die Nachweise<br />
nach Norden hin ab.<br />
141
Naturräumliche Verteilung<br />
der Arten<br />
Abbildung 2:<br />
Arten pro 0 MG<br />
MF<br />
UTM-Quadrant<br />
9<br />
142<br />
Im Bereich von Inseln, Küste <strong>und</strong> Marsch<br />
wurden insgesamt 47 Arten nachgewiesen,<br />
im Bereich der Geest 56 <strong>und</strong> im Hügelland<br />
61. Bemerkenswert ist allerdings, daß<br />
16 von 47 Arten die Küsten von Nord- <strong>und</strong><br />
Ostsee nur sehr lokal besiedeln (weniger<br />
als fünf besetzte Quadranten), während<br />
dieses bei nur einer Art auf der Geest<br />
beziehungsweise keiner im Hügelland der<br />
Fall ist. In den Küstenregionen finden also<br />
offensichtlich nur 31 Arten weiträumig<br />
geeignete Bedingungen vor.<br />
Für die Inseln wurden Meldungen von ins-<br />
gesamt 42 Arten berücksichtigt. Aus dem<br />
Bereich der nordfriesischen Inseln <strong>und</strong> Hel-<br />
goland stammen 41 Artnachweise, von<br />
Fehmarn 21.<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
4<br />
Arten pro UTM-Quadrant<br />
Im Zeitraum von 1985 bis 1995 wurden im<br />
Bereich von Inseln, Küste <strong>und</strong> Marsch ins-<br />
gesamt 36 Arten nachgewiesen - inklusive<br />
von 16 nur lokal verbreiteten - , auf der<br />
Geest <strong>und</strong> im Hügelland jeweils 48, von<br />
denen vier auf der Geest nur lokal verbrei-<br />
tet sind. Für die Inseln sind 16 Arten<br />
belegt, davon 14 von der Nord- <strong>und</strong> neun<br />
von der Ostseeküste.<br />
Interessant <strong>und</strong> aufschlußreich ist auch die<br />
Verteilung der Arten auf die einzelnen Qua-<br />
dranten des UTM-Gitternetzes. Abbildung 2,<br />
in der Angaben aus allen Erfassungsperi-<br />
oden berücksichtigt sind, zeigt hier erhebli-<br />
che Unterschiede. So sind aus insgesamt<br />
27 Quadranten, die sich auf zwei im Lan-<br />
desinneren <strong>und</strong> 25 im Küstenbereich sowie<br />
an der dänischen Grenze verteilen, keine<br />
$ .e<br />
e<br />
4', 4<br />
ME II NE 1 PE<br />
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5<br />
O vor 1925 0 Anfang 1925 O Anfang 1950 G Anfang 1975 • ab 1985<br />
bis Ende 1949 bis Ende 1974 bis Ende 1984
Larve der Großen<br />
Pechlibelle<br />
(Ischnura elegans),<br />
eine der häufigsten<br />
Kleinlibellenarten in<br />
Schleswig-Holstein.<br />
Sie ist in fast allen<br />
Gewässertypen<br />
anzutreffen.<br />
Nachweise gemeldet worden. Dagegen<br />
wurden an anderen Stellen (so bei Gudow,<br />
Kreis Herzogtum Lauenburg) bis zu<br />
53 Arten gef<strong>und</strong>en.<br />
Artenzahlen von insgesamt 30 oder mehr<br />
pro Quadrant wurden - mit Ausnahmen<br />
südwestlich von Albersdorf (Kreis Dithmar-<br />
schen) beziehungsweise nördlich von Kiel<br />
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) - überwie-<br />
gend südöstlich des Nord-Ostsee-Kanals<br />
mit Schwerpunkt im Bereich Hamburg <strong>und</strong><br />
östlich des Elbe-Lübeck-Kanals festgestellt.<br />
Hier spiegelt sich einerseits eine Zunahme<br />
nach Süden, insbesondere Südosten<br />
wider, die auch von SCHMIDT (1977 cl<br />
beschrieben wurde. Er macht hier<strong>für</strong> im<br />
wesentlichen einen klimatischen Gradien-<br />
ten, im Küstenraum auch Wind <strong>und</strong> einsei-<br />
tige Biotopausstattungen verantwortlich.<br />
SCHMIDT (1977 cl interpretiert die Häu-<br />
fung bei Hamburg unter anderem mit<br />
einem Maximum der mediterranen Arten,<br />
während im Bereich Lübeck/Lauenburg ein<br />
Maximum der östlichen Arten zu finden ist.<br />
Andererseits ist die Abnahme der Arten<br />
nach Norden sicher Ausdruck einer unter-<br />
schiedlichen Erfassungs- <strong>und</strong> Meldeaktivität.<br />
Einen Hinweis auf die angesprochene<br />
Erfassungssituation mag die insgesamt<br />
hohe Zahl von immerhin 36 Artmeldungen<br />
von der Insel Helgoland geben.<br />
Im Bereich der nordfriesischen Inseln<br />
ergibt der Vergleich von Amrum (27 Arten)<br />
<strong>und</strong> Föhr (18 Arten) mit Sylt (maximal elf<br />
Arten) nicht erklärbare Unterschiede.<br />
Ein Erfassungsschwerpunkt liegt in Teilen<br />
des Kreises Steinburg, wo aus einem Qua-<br />
dranten immerhin 40 Artmeldungen vorlie-<br />
gen. Dieses ist im übrigen Land in lediglich<br />
neun weiteren Quadranten aus der Umge-<br />
bung von Hamburg <strong>und</strong> im Kreis Herzogtum<br />
Lauenburg der Fall.<br />
143
Bilanz <strong>und</strong> Diskussion<br />
144<br />
Um einen Uberblick über die Verbreitung<br />
der Libellen in Schleswig-Holstein sowohl<br />
im Zeitraum 1985 bis 1995 als auch im<br />
Gesamtzeitraum von vor 1925 bis 1995 zu<br />
erhalten, wurden die Rasterfrequenzen<br />
(vergleiche BEZZEL & UTSCHIK 1979) aller<br />
Arten zusammengestellt. Aufgelistet sind<br />
die jeweiligen Prozentanteile der UTM-<br />
Quadranten mit Nachweisen in den einzel-<br />
nen Naturräumen sowie <strong>für</strong> ganz<br />
Schleswig-Holstein. Die Arten sind in<br />
absteigender Reihenfolge gemäß der Fre-<br />
quenzen im aktuellen Zeitraum von 1985<br />
bis 1995 angeordnet.<br />
Tabelle 1: Rasterfrequenzen der Libellenarten in den Naturräumen <strong>und</strong> der gesamten<br />
Landesfläche (Angaben in Prozent)<br />
Tabellenerklärung: KM = Küste, Inseln <strong>und</strong> Marsch; GE = Geest; OH = Östliches Hügel-<br />
land; SH = Gesamtfläche Schleswig-Holstein<br />
Naturraum KM 1 GE 1 ÖH 1 SH KM 1 GE 1 ÖH 1 SH<br />
Zeitraum Aktuell 1985-1995 Gesamt
Mit Krebsschere<br />
bestandener Gra-<br />
ben in einer Fluß-<br />
marsch. Die Krebs-<br />
schere ist<br />
Haupteiablage-<br />
pflanze der Grünen<br />
Mosaikjungfer<br />
(Aeshna viridis), die<br />
hier in Schleswig-<br />
Holstein eines ihrer<br />
bedeutendsten Vor<br />
kommen in<br />
Deutschland hat.<br />
Naturraum KM 1 GE 1 ÖH 1 SH KM 1 GE 1 ÖH 1 SH<br />
Zeitraum Aktuell 1985-1995 Gesamt
146<br />
An der Spitze der Tabelle stehen die Arten<br />
mit einem breitem Habitatspektrum wie<br />
Ischnura elegans. Die stenöken Arten rangieren<br />
durchweg in der unteren Tabellen-<br />
hälfte.<br />
Im Zeitraum 1985 bis 1995 wird nur von<br />
den beiden Arten Ischnura elegans <strong>und</strong><br />
Lestes sponsa eine Rasterfrequenz von<br />
mehr als 50 Prozent erreicht, im Gesamt-<br />
zeitraum dagegen von 14 Arten.<br />
Im Bereich einer mittleren Rasterfrequenz<br />
von 10 bis 50 Prozent ist das Verhältnis in<br />
den betrachteten Zeiträumen mit 31:31<br />
ausgeglichen, wenn auch beiden Summen<br />
zum Teil verschiedene Arten zugr<strong>und</strong>e lie-<br />
gen.<br />
Bei Arten wie Aeshna subarctica oder<br />
A. viridis, aber auch anderen, zeigen sich<br />
deutliche Rückgänge in der Gesamtverbrei-<br />
tung.<br />
Im unteren Bereich (Rasterfrequenz 0 bis<br />
10 Prozent) finden sich im Zeitraum von<br />
1985 bis 1995 insgesamt 32, im Gesamt-<br />
zeitraum dagegen nur 20 Arten. Auch dies<br />
ist als deutlicher Hinweis zu werten, daß<br />
bei vielen Arten alte F<strong>und</strong>orte aktuell nicht<br />
mehr besiedelt sind, so bei Arten wie<br />
Leucorrhinia pectoralis, Aeshna isosceles,<br />
Coenagrion lunulatum, Lestes virens oder<br />
Coenagrion armatum. Die Ursachen liegen<br />
sowohl in einer Verschlechterung der Habi-<br />
tatqualitäten als auch in der Dispersionsdy-<br />
namik einzelner Arten.<br />
Ein Verbreitungsmaximum im Bereich von<br />
Inseln, Küste <strong>und</strong> Marsch weist die Tabelle<br />
1 nur <strong>für</strong> Sympetrum fonscolombei aus.<br />
Allerdings basiert dieses Ergebnis auf<br />
wenigen F<strong>und</strong>en, so daß es nicht repräsen-<br />
tativ ist.<br />
Einen Verbreitungsschwerpunkt in der<br />
Geest bei beiden Zeitskalen lassen sieben<br />
Arten erkennen: Libellula quadrimaculata,<br />
L. depressa, Aeshna juncea, Lestes viridis,<br />
Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a, Anax imperator<br />
<strong>und</strong> Leucorrhinia dubia. Bei Arten wie<br />
A. juncea sowie L. rubic<strong>und</strong>a <strong>und</strong> L. dubia<br />
ist dies durch ihre Bindung an Moore zu<br />
erklären.<br />
Die meisten Arten weisen die größte<br />
Rasterfrequenz im Ostlichen Hügelland<br />
auf. Eine deutlich ausgeprägte Präferenz<br />
des Hügellandes gegenüber der Geest zeigen<br />
nur Platycnemis pennipes oder<br />
Libellula fulva. Die kontinental beeinflußte,<br />
klimatisch bevorzugte Lage des Südostens<br />
Schleswig-Holsteins scheint diesen Arten<br />
günstigere Voraussetzungen <strong>für</strong> eine<br />
Besiedlung zu bieten.<br />
Von den <strong>für</strong> die B<strong>und</strong>esrepublik Deutsch-<br />
land aufgeführten 80 Libellenarten<br />
(SCHORR 1990) konnten in Schleswig-<br />
Holstein bisher 65 nachgewiesen werden.<br />
Damit weist das nördlichste B<strong>und</strong>esland<br />
eine sehr hohe Artenzahl auf, die nur in<br />
Niedersachsen <strong>und</strong> Bayern übertroffen<br />
wird (Abbildung 3). Diese Zahlen spiegeln<br />
ohne Zweifel auch die odonatologischen<br />
Aktivitäten in den einzelnen B<strong>und</strong>eslän-<br />
dern wider.<br />
Ausschlaggebend <strong>für</strong> den relativen Arten-<br />
reichtum in Schleswig-Holstein ist insbe-<br />
sondere die Vielfalt der Naturräume mit<br />
Marschen, Geest <strong>und</strong> dem gewässerrei-<br />
chen Hügelland.<br />
80<br />
80 _<br />
65<br />
60 _<br />
40 _<br />
20 _<br />
0<br />
56<br />
67 60 64<br />
53<br />
73<br />
69<br />
65<br />
1 il<br />
SH HH Nds MV BB TH BW 130 D DK NL<br />
Abbildung 3: Anzahl nachgewiesener Libellenarten in einigen B<strong>und</strong>esländern, in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, Dänemark <strong>und</strong> den Niederlanden<br />
Abbildungserklärung: SH = Schleswig-Holstein (BROCK et al. 1996), HH = Hamburg<br />
(GLITZ et al. 1989), Nds = Niedersachsen (ALTMULLER 1985), MV = Mecklenburg-Vorpommern<br />
(ZESSIN & KONIGSTEDT 1993), BB = Brandenburg (BEUTLER 1992), TH = Thürin-<br />
gen (ZIMMERMANN & MEY 1993), BW = Baden-Württemberg (BUCHWALD et al. 1994),<br />
BY= Bayern (KUHN 1993), D = Deutschland (BLAB et al. 1984), DK Dänemark (HOLMEN<br />
& PEDERSEN 1996), NL = Niederlande (WASSCHER 1990)
Der Westensee,<br />
einer der vielen<br />
naturnahen Seen<br />
im Östlichen Hügel-<br />
land. Lebensraum<br />
zum Beispiel <strong>für</strong><br />
Spitzenfleck<br />
(Libellula fulva),<br />
Kleine Mosaikjung-<br />
fer (Brachytron<br />
pratense) <strong>und</strong><br />
Großes Granatauge<br />
(Erythromma<br />
najas).<br />
Ein weiterer wesentlicher Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong> die<br />
Artenvielfalt ist die biogeographische Lage<br />
Schleswig-Holsteins, denn hier treffen die<br />
Areale von Arten des mediterranen <strong>und</strong><br />
des sibirischen Faunenkreises aufeinander.<br />
Außerdem hat der Verlauf vieler Verbrei-<br />
tungsgrenzen durch den oder am Bezugs-<br />
raum zur Folge, daß überproportional viele<br />
Arten vorkommen können.<br />
Faunenkreise<br />
Nach ST. QUENTIN (1960) läßt sich die<br />
europäische Odonatenfauna der mediterra-<br />
nen <strong>und</strong> der sibirischen Provinz der Palä-<br />
arktis zuordnen (Tabelle 2). Der mediter-<br />
rane Faunenkreis überdauerte die<br />
Glazialperiode im klimatisch begünstigten<br />
Mittelmeerraum. Die sibirischen Faunen-<br />
elemente konnten in den eisfreien Regio-<br />
nen ihres Areals verbleiben <strong>und</strong> drangen in<br />
der postglazialen Phase in artenreichen<br />
Invasionen in die eisfrei gewordenen Sied-<br />
lungsräume bis weit nach Westen an die<br />
Nordsee <strong>und</strong> den Atlantik vor (LATTIN<br />
1967). ST. QUENTIN bezeichnet daher<br />
diese zunächst vorwiegend durch sibiri-<br />
sche Libellen neu besiedelten mittel- <strong>und</strong><br />
nordeuropäischen Mischwaldgebiete der<br />
Expansionsphase als Invasionsräume <strong>und</strong><br />
ordnet ihre Fauna entsprechend der<br />
Invasionsfauna zu.<br />
Sowohl der mediterrane als auch der sibiri-<br />
sche Faunenkreis entstammen nach<br />
LATTIN entsprechend benannten Ausbrei-<br />
tungszentren. Während das mediterrane<br />
Ausbreitungszentrum als Erhaltungszentrum<br />
der Arten zu verstehen ist, entspricht<br />
das sibirische eher einem Expansions- <strong>und</strong><br />
auch Entstehungszentrum.<br />
Obwohl die Entfernung vom sibirischen<br />
Ausbreitungszentrum in die postglazial<br />
eisfreien mittel- <strong>und</strong> nordeuropäischen<br />
Räume ungleich viel weiter war als vom<br />
mediterranen Zentrum, erfolgte eine<br />
Besiedlung zunächst fast ausschließlich<br />
durch sibirische Faunenelemente. Die<br />
Ursache hier<strong>für</strong> liegt in den sehr verschie-<br />
denartigen Ausbreitungsbedingungen. Die<br />
mediterranen Formen mußten nämlich,<br />
um nach Mitteleuropa zu gelangen, gegen<br />
ein sehr ausgeprägtes Klimagefälle vor-<br />
dringen. Dieses wurde in seiner hemmen-<br />
den Wirkung noch durch die ostwestlich<br />
verlaufenden Hochgebirgsriegel intensi-<br />
viert. Dagegen bestanden <strong>für</strong> die im<br />
wesentlichen in nordwestlicher Richtung<br />
vordringenden sibirischen Formen keine<br />
vergleichbar hemmenden Faktoren<br />
(LATTIN 1967).<br />
ST. QUENTIN (1960) sieht Unterschiede<br />
zwischen beiden Gruppen unter anderem<br />
darin, daß sich die mediterrane Gruppe in<br />
viele Gattungen mit wenigen Arten, die<br />
sibirische Gruppe in wenige Gattungen mit<br />
vielen Arten aufteilt.<br />
Dieses trifft jedoch <strong>für</strong> die Odonatenfauna<br />
des Invasionsraumes nur bedingt zu, wie<br />
sich insbesondere <strong>für</strong> Schleswig-Holstein<br />
nachweisen läßt. Das Gattungen-Arten-<br />
Verhältnis beträgt <strong>für</strong> die mediterranen<br />
Faunenelemente 1:1,9, was damit dem Ver-<br />
hältnis von 1:2 des Faunenkreises im Aus-<br />
breitungszentrum entspricht (ST. QUENTIN<br />
1960). Das Gattungen-Arten-Verhältnis <strong>für</strong><br />
147
Paarungsrad der<br />
Fledermaus-<br />
Azurjungfer<br />
(Coenagrion<br />
pulchellum).<br />
148<br />
Tabelle 2: Zuordnung der in Schleswig-Holstein nachgewiesenen Libellenarten zu den<br />
Faunenkreisen nach ST QUENTIN (1960), DEVAI (1976) <strong>und</strong> GEIJSKES & VAN TOL (1983).<br />
pontomediterran adriatomediterran atlantomediterran holomediterran<br />
Calopteryx splendens<br />
Ischnura pumilio<br />
Coenagrion puella<br />
Coenagrion pulchellum<br />
Erythromma viridulum<br />
Brachytron pratense<br />
Anax parthenope<br />
Insgesamt 7 Arten:<br />
Calopterygiden 1<br />
Coenagrioniden 4<br />
Aeshniden 2<br />
Mediterraner Faunenkreis<br />
Pyrrhosoma nymphula<br />
Ischnura elegans<br />
Lestes viridis<br />
Coenagrion mercuriale Lestes barbarus<br />
Orthetrum coerulescens Ceriagrion tenellum<br />
Insgesamt 3 Arten:<br />
Coenagrioniden 2<br />
Libelluiden 1<br />
Gomphus pulchellus<br />
Cordulegaster boltonii Aeshna cyanea<br />
Aeshna isosceles<br />
Insgesamt 6 Arten:<br />
Lestiden 1<br />
Aeshniden 1<br />
Coenagrioniden 2<br />
Gomphiden 1<br />
Insgesamt 28 Arten:<br />
Calopterygiden 1<br />
Lestiden 4<br />
Coenagrioniden 8<br />
Gomphiden 1<br />
Cordulegasteriden 1<br />
Aeshniden 6<br />
Libelluliden 7<br />
Cordulegasteriden 1<br />
Sympecma fusca<br />
Lestes virens<br />
Aeshna affinis<br />
Anax imperator<br />
Orthetrum brunneum<br />
Orthetrum cancellatum<br />
Sympetrum fonscolombei<br />
Sympetrum meridionale<br />
Sympetrum sanguineum<br />
Sympetrum striolatum<br />
Insgesamt 12 Arten:<br />
Lestiden 3<br />
Aeshniden 3<br />
Libelluiden 6
Sibirischer Faunenkreis<br />
eurosibirisch (holo- ► sibirisch<br />
Calopteryx virgo Aeshna viridis Lestes dryas<br />
Sympecma paedisca Cordulia aenea .<br />
Lestes sponsa<br />
Platycnemis pennipes Epitheca bimaculata Enallagma cyathigerum<br />
Coenagrion armatum <strong>Somatochlora</strong> arctica Aeshna subarctica<br />
Coenagrion hastulatum <strong>Somatochlora</strong> flavomaculata Libellula quadrimaculata<br />
Coenagrion lunulatum <strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong> Sympetrum danae<br />
Erythromma najas Libellula depressa Sympetrum flaveolum<br />
Nehalennia speciosa Libellula fulva Sympetrum pedemontanum<br />
Gomphus flavipes Sympetrum vulgatum Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a<br />
Gomphus vulgatissimus Leucorrhinia albifrons<br />
Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia caudalis<br />
Aeshna grandis Leucorrhinia dubia<br />
Aeshna juncea Leucorrhinia pectoralis<br />
Aeshna mixta<br />
Insgesamt 27 Arten: Insgesamt 9 Arten:<br />
Calopterygiden 1 Lestiden 2<br />
Lestiden 1 Coenagrioniden 1<br />
Platycnemididen 1 Aeshniden 1<br />
Coenagrioniden 5 Libelluliden 5<br />
Gomphiden 3<br />
Aeshniden 4<br />
Corduliiden 5<br />
Libelluiden 7<br />
Insgesamt 36 Arten:<br />
Calopterygiden 1<br />
Lestiden 3<br />
Platycnemididen 1<br />
Coenagrioniden 6<br />
Gomphiden 3<br />
Aeshniden 5<br />
Corduliiden 5<br />
Libelluliden 12<br />
Saharosindhischer Faunenkreis<br />
saharosindhisch<br />
Hemianax ephippiger<br />
Insgesamt 1 Art:<br />
Aeshniden 1<br />
die sibirischen Faunenelemente liegt mit<br />
1:2,1 in der gleichen Größenordnung,<br />
während es im Ausbreitungszentrum 1:3<br />
beträgt (Tabelle 2).<br />
Die Gründe hier<strong>für</strong> liegen unter anderem<br />
darin, daß die Invasionsfauna in Schles-<br />
wig-Holstein an ihre nordwestliche Expan-<br />
sionsgrenze stößt, <strong>und</strong> daß es während<br />
der Expansionsphase aus östlicher Rich-<br />
tung mit zunehmender Entfernung zu<br />
einem Artengefälle kam. So ist beispiels-<br />
weise das Gattungen-Arten-Verhältnis der<br />
Libellen sibirischen Ursprungs weiter öst-<br />
lich in Mecklenburg-Vorpommern mit 1:2,3<br />
größer, in Brandenburg beträgt es sogar<br />
1:2,5.<br />
Derzeit überwiegt das Verhältnis der medi-<br />
terranen Elemente der Odonatenfauna<br />
Schleswig-Holsteins mit fast 54 Prozent zu<br />
den sibirischen mit 46 Prozent. In der<br />
149
Die Gemeine<br />
Smaragdlibelle<br />
(Cordulia aenea) ist<br />
eine mäßig häufig<br />
nachgewiesene<br />
Falkenlibelle.<br />
150<br />
Roten Liste von 1982 lag dieses Verhältnis<br />
noch bei 40 zu 60 Prozent. Die Verbreitung<br />
einiger Arten des sibirischen Faunenkrei-<br />
ses scheint zumindest in Schleswig-<br />
Holstein eine Regression zu erfahren,<br />
während gleichzeitig mediterrane Faunen-<br />
elemente hierher expandieren. Im Zeit-<br />
raum von 1917 bis 1995 sind drei sibirische<br />
<strong>und</strong> zehn mediterrane Arten zugewandert<br />
(Abbildung 6). Gleichzeitig sind sieben<br />
Arten des sibirischen <strong>und</strong> drei des mediter-<br />
ranen Faunenkreises in Schleswig-Holstein<br />
ausgestorben oder verschollen (Abbildung<br />
7). Die Netto-Bilanz weist somit auf vier<br />
verschollene sibirische Faunenelemente<br />
eine Zuwanderung von sieben mediterra-<br />
nen aus.<br />
Zu- <strong>und</strong> Abwanderungen<br />
Die Suche nach den Gründen <strong>für</strong> diese Ver-<br />
änderung in der Libellenfauna Schleswig-<br />
Holsteins erfordert zunächst einen Ver-<br />
gleich der ökologischen Potenzen der<br />
zugewanderten <strong>und</strong> der verschollenen<br />
Arten. Es müssen also die Faktoren<br />
gesucht werden, die die Zuwanderer för-<br />
dern, während sie die Regressionsarten<br />
hemmen.<br />
Von Bedeutung sind die Vagilität, die Tem-<br />
peratur- <strong>und</strong> die Lebensraumtoleranz<br />
sowie die Herkunft der Arten. Besondere<br />
Beachtung scheinen die unterschiedlichen<br />
Klimatoleranzen zu verdienen.<br />
Zunächst fallen Gemeinsamkeiten inner-<br />
halb der Gruppen auf, durch die sie sich<br />
gegeneinander abgrenzen (Tabelle 3). Die<br />
Zuwanderer zeichnen sich insbesondere<br />
durch Vagilität <strong>und</strong> eine hohe Temperatur-<br />
toleranz aus. Diese Arten bevorzugen als<br />
Imagines relativ warme Lufttemperaturen<br />
<strong>und</strong> die Larven brauchen mit Ausnahme<br />
von Anax imperator <strong>und</strong> Erythromma<br />
viridulum relativ warmes Wasser. Mit Aus-<br />
nahme von Sympetrum pedemontanum<br />
<strong>und</strong> Hemianax ephippiger liegen wesentliche<br />
Teile der Areale dieser Arten in den<br />
winterfeuchten Subtropen; alle gehören<br />
dem mediterranen Faunenkreis an. Aber<br />
auch die Areale von S. pedemontanum<br />
(sibirisches Faunenelement) <strong>und</strong><br />
H. ephippiger (saharosindhisches Element)<br />
liegen in wärmebegünstigten Okozonen,<br />
also in trockenen Mittelbreiten beziehungs-<br />
weise subtropischen Trockengebieten.<br />
Die Gruppe der seit Jahren in Schleswig-<br />
Holstein ausgestorbenen oder verscholle-<br />
nen Arten zeichnet sich durch sehr viel<br />
mehr Gemeinsamkeiten aus, wobei die ins-<br />
gesamt engen Toleranzbereiche auffällig<br />
sind. So sind alle Arten stenotherm in<br />
einem relativ niedrigeren Luft- <strong>und</strong> Was-<br />
sertemperaturbereich als dem der Gruppe<br />
der zugewanderten Arten. Allenfalls<br />
Imagines von Sympecma paedisca können<br />
als eurytherm bezeichnet werden<br />
(SCHIEMENZ 1957, ROBERT 1959,<br />
GEIJSKES & VAN TOL 1983, SCHORR 1990).<br />
Weiterhin stellen sie sehr spezielle<br />
Ansprüche an ihren Lebensraum <strong>und</strong> wei-<br />
sen letztlich in Anpassung an bestimmte<br />
Quantitäten eine sehr geringe Schwan-<br />
kungsbreite auf. Die Arten dieser Gruppe<br />
sind nur wenig vagil oder neigen über-<br />
haupt nicht zu Wanderungen. Bemerkens-<br />
wert ist, daß sich ihre Areale (abgesehen<br />
von S. paedisca) in den gleichen ökozona-<br />
len Breiten befinden.
Tabelle 3: Vergleich ökologischer Toleranzfaktoren <strong>und</strong> ökozonaler Areale der in<br />
Schleswig-Holstein seit 1917 zugewanderten <strong>und</strong> verschollenen Odonaten<br />
Tabellenerklärung: gemeinsame Faktoren innerhalb einer Gruppe<br />
Vagilität: Temperaturtoleranz:<br />
- = keine Neigung zu Wanderungen<br />
± = wenig vagil<br />
+ = sehr vagil<br />
Ökozonen (nach MÜLLER 1981)<br />
1 = Polare/Subpolare Zone<br />
2 = Boreale Zone<br />
3= Feuchte Mittelbreiten<br />
(+) = Optimum im höheren Temperaturbereich<br />
1-1 = Optimum im niedrigeren Temperaturbereich<br />
keine Angabe = kein bevorzugtes Optimum<br />
4 = Trockene Mittelbreiten<br />
oder dieses nicht bekannt<br />
5 = Winterfeuchte Subtropen<br />
6 = Subtropische Trockengebiete<br />
Zugewanderte Arten mit gemeinsamen Vitalitätsfaktoren<br />
Art Vagilität Temperaturtoleranz Lebensraum- Verbreitungszentren der<br />
toleranz Arten in den Okozentren<br />
lmago lmago Larve !maga<br />
<strong>und</strong> Larve<br />
Aeshna affinis -t- stenotherm 1+) stenotherm 1+1 eurytop 5<br />
'mag°<br />
Anax irnperator + eurytherm (+I eurytherm eurytop 5 <strong>und</strong> 3<br />
Anax parthenope + stenotherm 1+1 stenotherm 1+1 stenotop 5, seltener südlich 3<br />
Erythromma viridulum + eurytherm 1+1 eurytherm (+1 stenotop westlich 5 <strong>und</strong> 3<br />
Gomphus pulchellus + stenotherm (+1 stenotherm (+) stenotop südwestlich 5 bis südwestlich 3<br />
Lestes barbarus + stenotherm 1+1 stenotherm (+1 stenotop 5 bis südlich 3<br />
Orthetrum brunneum + stenotherm (+) stenotherm (+1 stenotop 5 bis südlich 3 (vereinzelt im Ni<br />
Sympetrum fonscolombei s stenotherm (+) stenotherm 1+1 eurytop 5 <strong>und</strong> südlich 3<br />
Sympetrum pedemontanum + stenotherm (+) stenotherm (+) eurytop 4<br />
liemianax ephippiger + stenotherm 1« stenotherm 1+1 eurytop 6<br />
Verschollene Arten mit gemeinsamen Vitalitätsfaktoren<br />
Epitheca bimaculata stenotherm 1-1 stenotherm (-1 stenotop nordöstlich 3 <strong>und</strong> 2<br />
Leucorrhinia albifrons stenotherm (-) stenotherm (-1 SterlOtOp nordöstlich 3 <strong>und</strong> südlich 2<br />
Leucorrhinia caudalis stenotherm (-1 stenotherm 1-1 stenotop nordöstlich 3 <strong>und</strong> südlich 2<br />
Nehalennia speciosa stenotherm (-) stenotherm (-1 stenotop nordöstlich 3 <strong>und</strong> südlich 2<br />
Ophiogomphus cecilia stenotherm 1-1 stenotherm 1-1 stenotop nordöstlich 3 <strong>und</strong> südlich 2<br />
<strong>Somatochlora</strong> arctica stenotherm stenotherm (-1 stenotop nördlich 3, 2 <strong>und</strong> südlich 1<br />
Sympecma paedisca eurytherm I-) stenotherm 1-1 stenotop<br />
Nicht einstufbare Arten<br />
Cordulegaster boltonü eurytherm stenotherm stenotop 5 bis südlich 2<br />
Ceriagrion tenellum stenotherm 1+1 stenotherm stenotop 5 <strong>und</strong> südwestlich 3<br />
Coenagrion mercuriale stenotherm 1+1 stenotherm (+) stenotop 5 <strong>und</strong> südwestlich 3<br />
Orthetrum coerulescens stenotherm (+) stenotherm (+1 StenOtO b 5 <strong>und</strong> südlich 3 (vereinzelt im N1<br />
Zudem kommen Epitheca bimaculata,<br />
Leucorrhinia albifrons, L. caudalis,<br />
Nehalennia speciosa <strong>und</strong> Ophiogomphus<br />
cecilia sympatrisch vor. Alle Arten der<br />
Gruppe gehören zum sibirischen Faunenkreis.<br />
Vier Arten, ausschließlich mediterrane Fau-<br />
nenelemente, lassen sich dem Schema nur<br />
schwer zuordnen. Von diesen sind<br />
Ceriagrion tenellum, Coenagrion<br />
mercuriale <strong>und</strong> Orthetrum coerulescens<br />
Anfang des Jahrh<strong>und</strong>erts nach Schleswig-<br />
Holstein zugewandert. Sie konnten hier <strong>für</strong><br />
kurze Zeit kleine Populationen aufbauen<br />
<strong>und</strong> sind spätestens seit Mitte der 70er<br />
Jahre wieder verschw<strong>und</strong>en. Sie müssen<br />
in Schleswig-Holstein als ehemals indigen<br />
eingestuft werden <strong>und</strong> sind heute der<br />
Gruppe der verschollenen Arten zuzuord-<br />
nen. Alle drei Arten weisen gleiche Fakto-<br />
renmerkmale wie die Gruppe der zugewan-<br />
derten Arten auf, unterscheiden sich<br />
jedoch abgesehen von 0. coerulescens<br />
durch eine sehr viel geringere Vagilität.<br />
Diejenigen Faktoren, die zur Zuwanderung<br />
führten, sind wahrscheinlich sehr ähnliche<br />
oder sogar die gleichen, die auch das<br />
Dispersal der anderen Arten bestimmt<br />
haben. Vermutlich haben aber andere<br />
Gründe zum Verschwinden dieser drei<br />
Arten geführt, als bei den verschollenen<br />
Arten mit gemeinsamen Vitalitätsfaktor<br />
(CLAUSNITZER 19961.<br />
151
Die Federlibelle<br />
(Platycnemis<br />
pennipes) trägt<br />
ihren Namen auf-<br />
gr<strong>und</strong> der federar-<br />
tig verbreiterten<br />
Unterschenkel.<br />
152<br />
Die vierte Art Cordulegaster boltonii<br />
kommt in einem über mehrere Okozonen<br />
ausgedehnten Areal vor, das jedoch zum<br />
einen Verbreitungslücken insbesondere in<br />
Mitteleuropa, zum anderen aber mehrere<br />
Verbreitungsschwerpunkte aufweist. Die<br />
Art, erst in den späten 40er Jahren nach<br />
Schleswig-Holstein zugewandert, zeigt ein<br />
anderes <strong>und</strong> weniger ausgeprägtes Disper-<br />
salverhalten als die zugewanderten Arten<br />
mit gemeinsamen Vitalitätsfaktor. Neben<br />
der geringeren Vagilität dürften da<strong>für</strong> noch<br />
andere, in der Vergleichstabelle nicht auf-<br />
geführte, da unbekannte Faktoren verant-<br />
wortlich sein.<br />
Der Vergleich der zugewanderten mit den<br />
verschollenen Arten ergibt zusammenfas-<br />
send drei wesentliche Unterschiede:<br />
• die zugewanderten Arten zeichnen<br />
sich gegenüber den verschollenen<br />
durch eine hohe Vagilität aus,<br />
n o co co m N ^n<br />
N N N N 7 M<br />
m m m m rn m rn<br />
• die Verbreitungszentren der zugewan -<br />
derten Arten liegen überwiegend in<br />
wärmebegünstigten Ökozonen, die<br />
der verschollenen Arten in den kühle-<br />
ren nördlichen Zonen, <strong>und</strong><br />
• die zugewanderten Arten benötigen<br />
(auch <strong>für</strong> eine erfolgreiche Reproduk-<br />
tion) einen warmen Temperaturbe-<br />
reich, dagegen sind die verschollenen<br />
Arten relativ kältetolerant.<br />
Somit sind sowohl Vagilität - abgesehen<br />
von möglichen Appetenzen - <strong>und</strong> folglich<br />
auch Dispersion dieser Arten von ihrer<br />
jeweiligen Temperaturtoleranz abhängig.<br />
Daraus kann der Schluß gezogen werden,<br />
daß insbesondere Klimafaktoren die Zu-<br />
<strong>und</strong> Abwanderung von Libellen in<br />
Schleswig-Holstein bestimmen<br />
(HOFFMANN 1997).<br />
$ _ Wärme<br />
a n o m co m ^n UFA m o m N<br />
rn m rn m m m m N ôi ái rn m§ m m rn<br />
Jahr<br />
Häufigste Windrichtung —4— Malere Jahrestemperatur - Wärmephase Kältephase<br />
West<br />
Südwest<br />
S üdost<br />
Ost<br />
-/Kältephasen<br />
Abbildung 4: Mittlere Jahrestemperaturen <strong>und</strong> die am häufigsten beobachteten Windrichtungen<br />
im Zeitraum 1917 (Beginn der Wetteraufzeichnungen) bis 1995. Alle Daten stammen<br />
von der Wetterstation Neumünster (DEUTSCHER WETTERDIENST 1917-1995). Neumünster<br />
wurde ausgewählt, weil diese Station in Schleswig-Holstein relativ zentral liegt.
Klimaeinflüsse<br />
Die Lufttemperatur <strong>und</strong> die Verteilung der<br />
Windrichtung jeweils im Jahresmittel zeigt,<br />
daß sich in Schleswig-Holstein, überwie-<br />
gend bedingt durch großräumige Wetterla-<br />
gen, ständig Phasen höherer Temperaturen<br />
mit solchen niedriger Temperaturen („Wär-<br />
mephasen” <strong>und</strong> „Kältephasen") ablösen.<br />
Die Temperaturen der Wärmephasen<br />
betragen mindestens 8,4°C, die der Kälte-<br />
phasen höchstens 7,7°C. Die durchschnittli-<br />
che Temperatur aller Wärmephasen liegt<br />
bei 8,8°C, die der Kältephasen bei 7,6°C<br />
(Abbildung 5). Die Dauer der einzelnen<br />
Phasen ist recht unterschiedlich, im Durch-<br />
schnitt sind die Wärmephasen jedoch fast<br />
doppelt so lang wie die Kältephasen. Die<br />
Temperaturdifferenz der beiden Phasen<br />
beträgt im Durchschnitt über den gesam-<br />
ten Zeitraum 1,2 °C (Abbildung 5). Auffällig<br />
ist, daß die häufigste Windrichtung in den<br />
Jahren der Wärmephasen Südwest ist (78<br />
Prozent), während in den Kältephasen die<br />
Windrichtung stark variiert.<br />
Temperatur <strong>und</strong> Wind haben auch in<br />
Schleswig-Holstein einen wesentlichen<br />
Einfluß auf das Dispersalverhalten von<br />
Libellenarten. Bei anderen Klimafaktoren<br />
wie Niederschlag, Sonnenscheindauer, die<br />
daraufhin untersucht wurden, ergab sich<br />
keine so deutliche Affinität (HOFFMANN<br />
1997).<br />
Es fällt auf, daß die Erstnachweise mediter-<br />
raner Faunenelemente <strong>und</strong> thermophiler<br />
Arten ausschließlich während der Wärme-<br />
phasen erfolgten, wobei die mittlere<br />
Jahrestemperatur der Nachweisjahre<br />
mindestens 8,3°C betrug (1966 mit Erst-<br />
9<br />
8t<br />
s<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
I—<br />
6,6 Jahre<br />
3,7 Jahre<br />
nachweis von Anax parthenope; Abbildung<br />
6). Im Zeitraum von 1917 bis 1995 wurden<br />
insgesamt elf Arten des mediterranen Fau-<br />
nenkreises erstmals in Schleswig-Holstein<br />
nachgewiesen, dagegen nur vier des sibiri-<br />
schen. Das Verhältnis mediterraner zu sibi-<br />
rischen Faunenelementen betrug in den<br />
ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhun-<br />
derts 1:1,9. Bei den zwischen 1982 bis 1995<br />
nachgewiesenen Arten beträgt es mittler-<br />
weile 1:1,2 <strong>und</strong> hat sich somit stark zugun-<br />
sten des mediterranen Faunenkreises ver-<br />
schoben.<br />
Der Ausfall der in Schleswig-Holstein mitt-<br />
lerweile als ausgestorben oder verschollen<br />
eingestuften Arten (BROCK et al. 1996)<br />
liegt nicht eindeutig an Temperatureinflüs-<br />
sen (Abbildung 7).<br />
Die jeweils letzten Nachweise dieser Arten<br />
erfolgten sowohl im Laufe von Wärme- als<br />
auch von Kältephasen. Von den in Schles-<br />
wig-Holstein zwischen 1917 <strong>und</strong> 1995 ver-<br />
schw<strong>und</strong>enen Libellen gehören sieben<br />
Arten dem sibirischen <strong>und</strong> drei dem medi-<br />
terranen Faunenkreis an.<br />
Allen diesen Arten ist jedoch gemeinsam,<br />
daß sie ausgesprochen stenök <strong>und</strong> steno-<br />
top sind (Tabelle 3). Das läßt vermuten,<br />
daß nicht ausschließlich <strong>und</strong> vielleicht<br />
nicht einmal überwiegend Klimafaktoren<br />
<strong>für</strong> das Verschwinden dieser Arten verant-<br />
wortlich sind. So gelten auch die Lebens-<br />
räume dieser Libellen als stark gefährdet<br />
(Moore, Seggensümpfe, Fließgewässer),<br />
<strong>und</strong> schon geringe anthropogene Beein-<br />
trächtigungen können aufgr<strong>und</strong> der<br />
Stenökie der Arten die meist wenigen <strong>und</strong><br />
kleinen Populationen auslöschen.<br />
8,8°C<br />
7,6°C<br />
Wärme-Kälte- Wärme- Kälteperiode<br />
periode<br />
periode periode<br />
Abbildung 5, Durchschnittliche Dauer <strong>und</strong> durchschnittliche mittlere Temperatur der<br />
einzelnen Wärme- <strong>und</strong> Kältephasen im mittleren Schleswig-Holstein (Station Neumünster)<br />
von 1917 bis 1995.<br />
153
Andererseits belegt gerade das allmähliche<br />
Abwandern von Coenagrion armatum,<br />
einem sibirischen Faunenelement, daß<br />
zumindest bei dieser Art offenbar doch<br />
überwiegend Klimafaktoren <strong>für</strong> das Ver-<br />
schwinden verantwortlich gemacht werden<br />
können. Zwar geben WENDLER & NUSS<br />
(1991) noch Biotopzerstörungen als Gr<strong>und</strong><br />
der Gefährdung an, aber schon SCHORR<br />
(1990) relativierte diese Meinung. Er führte<br />
den Rückgang von C. armatum auf immer<br />
häufigere Austrocknungen der Larvenge-<br />
1988-1995<br />
1985-1987<br />
1982-1984<br />
1978-1981<br />
1972-1977<br />
1970-1971<br />
1966-1969<br />
iá 1962-1965<br />
1957-1961<br />
F 1954-1956<br />
1943-1953<br />
1940-1942<br />
1927-1939<br />
1921-1926<br />
1917-1920<br />
wässer zurück; allerdings macht er da<strong>für</strong><br />
auch anthropogene Einflüsse verantwort-<br />
lich.<br />
HOLMEN & PEDERSEN (1996) geben <strong>für</strong><br />
Dänemark eine stark rückläufige Entwick-<br />
lung <strong>für</strong> C. armatum an. Hier liegen insbesondere<br />
aus den südlichen Landesteilen<br />
seit den 80er Jahren keine Meldungen<br />
mehr vor, obwohl sich die Lebensräume<br />
der Art in Dänemark (überwiegend Dünen-<br />
moore) kaum verändert haben.<br />
A. affinis, 0. brunneum, G. pulchellu<br />
S. pedemontanum<br />
S. paedisca<br />
A. parthenope, E. ar-idulu<br />
H. ephippiger<br />
C. bo tonu, • rmperator<br />
L. barbarus, C. tenellum, S. tonscolombei, 0. coerulescens, . speaosa, (C, mercuriale, I. pumilio)<br />
s s<br />
154<br />
Temperatur (°C)<br />
Wärmephasen Kältephasen<br />
bimacu ata<br />
Abbildung 6: Zuordnung der nach Schleswig-Holstein eingewanderten wärmeliebenden<br />
Libellenarten des mediterranen Faunenkreises (fett) zu den Temperaturphasen. Die in<br />
Klammern stehenden Arten C. mercuriale <strong>und</strong> 1. pumilio wurden <strong>für</strong> die angegebene Tem-<br />
peraturphase das zweite Mal nachgewiesen, die Erstnachweise lagen jeweils vor Beginn<br />
der Temperaturaufzeichnungen. H. ephippiger (saharosindhisch) <strong>und</strong> S. pedemontanum<br />
(sibirisch) gehören zwar nicht zum mediterranen Faunenkreis, sind aber ebenfalls thermo-<br />
phile Arten. E. bimaculata, N. speciosa <strong>und</strong> S. paedisca sind sibirische Faunenelemente.<br />
1988-1995<br />
1985-1987<br />
1982-1984<br />
1978-1981<br />
1972-1977<br />
1970-1971<br />
1966-1969<br />
1962-1965<br />
1957-1961<br />
E<br />
F 1954-1956<br />
1943-1953<br />
1940-1942<br />
1927-1939<br />
1921-1926<br />
1917-1920<br />
Wärmephasen<br />
4 5 10<br />
Temperatur (°C)<br />
Kältephasen<br />
Abbildung 7: Zuordnung der Letztnachweise der in Schleswig-Holstein ausgestorbenen<br />
oder verschollenen Libellenarten zu den Temperaturperioden. Fett gedruckt sind hier die<br />
Arten des sibirischen Faunenkreises. C. mercuriale, C. tenellum <strong>und</strong> 0. coerulescens<br />
gehören dem mediterranen Faunenkreis an. C. armatum scheint die Arealgrenze nach<br />
Norden zu verschieben <strong>und</strong> existiert aktuell nur noch als Einzelnachweis.
Weiher im<br />
Kaltenhofer Moor,<br />
Lebensraum vieler<br />
Moorarten wie zum<br />
Beispiel der<br />
Moosjungfern.<br />
Die Bille oberhalb<br />
Witzhave. Lebens-<br />
raum der Blau-<br />
flügel-Prachtlibelle<br />
(Calopteryx virgo),<br />
der Gebänderten<br />
Prachtlibelle<br />
(C. splendens) <strong>und</strong><br />
der Zweigestreiften<br />
Quelljungfer<br />
(Cordulegaster<br />
boltonii).<br />
Aufgr<strong>und</strong> einer Arbeit von VALLE (1931)<br />
über die Odonatenfauna des nördlichen<br />
Finnlands stellte schon BARTENEF (1932 a<br />
<strong>und</strong> b) eine Nordverschiebung des Areals<br />
unter anderem von C. armatum fest, mit<br />
möglichen Arealverlusten im Süden.<br />
Alle diese Beobachtungen lassen <strong>für</strong> diese<br />
Art in erster Linie einen starken tempera-<br />
turbedingten Einfluß vermuten <strong>und</strong> ein<br />
völliges Verschwinden aus Schleswig-<br />
Holstein annehmen. Auch eine Optimie-<br />
rung der Lebensräume würde diese Ent-<br />
wicklung kaum verhindern können. Aus-<br />
geprägte Kältephasen könnten wohl eher<br />
diese Arealverschiebung verlangsamen.<br />
Anthropogene Einflüsse<br />
In den Kulturlandschaften Mitteleuropas ist<br />
das Vorkommen <strong>und</strong> überleben vieler<br />
Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten vom Grad anthro-<br />
pogener Einflüsse auf Lebensräume<br />
abhängig. Menschliches Wirken in der<br />
Landschaft kann zu extremen Veränderun-<br />
gen der jeweiligen Zönosen führen. Dort,<br />
wo massive Eingriffe in sensible Land-<br />
schaftsteile erfolgen, sind speziell auch<br />
angepaßte Libellenarten in ihrem Bestand<br />
bedroht. Gleichzeitig werden mitunter Ubi-<br />
quisten gefördert. Andererseits können<br />
gezielte Biotoppflegemaßnahmen stenöke<br />
<strong>und</strong> meist sehr sensible Arten in ihrem<br />
Bestand stützen.<br />
Auch wenn klimatische Faktoren Verände-<br />
rungen in der Libellenfauna Schleswig-<br />
Holsteins bewirken, muß <strong>für</strong> das Ver<br />
schwinden anderer Arten ein überwiegend<br />
anthropogener Einfluß verantwortlich<br />
gemacht werden. Nur wenige natürliche<br />
Biotoptypen gelten in Deutschland als der-<br />
zeit nicht gefährdet (RIECKEN et al. 1994).<br />
Insbesondere Gewässer unterliegen in der<br />
Regel mehr oder minder starken Beein-<br />
trächtigungen.<br />
Die in Schleswig-Holstein vorkommenden<br />
Libellen lassen sich grob drei verschiede-<br />
nen Biotoptypen zuordnen (nach JEDICKE<br />
& JEDICKE 1992):<br />
1. Fließgewässer (Quellen, Bäche, Flüsse,<br />
Kanäle, fließende Gräben),<br />
2. Stillgewässer (Seen, Weiher, Teiche, Alt-<br />
wasser, Tümpel, stehende Gräben),<br />
3. Moore (Hochmoore, Ubergangsmoore,<br />
Niedermoore, Torfstiche).<br />
155
Die Blauflügel-<br />
Prachtlibelle<br />
(Calopteryx virgo)<br />
ist ein typischer<br />
Bewohner natur-<br />
naher,sauerstoff- reicher Bäche.<br />
156<br />
Alle diese Biotoptypen <strong>und</strong> damit auch ihre<br />
Odonatenzönosen unterliegen unterschied-<br />
lichen Gefährdungen <strong>und</strong> anthropogenen<br />
Einflüssen.<br />
Die wesentlichen Gefährdungsursachen <strong>für</strong><br />
diese Lebensräume <strong>und</strong> die in ihnen vor-<br />
kommenden Libellen (nur aktuell gefähr-<br />
dete Arten; BROCK et al. 1997) sind nach-<br />
folgend aufgeführt.<br />
Fließgewässer<br />
Ausbau <strong>und</strong> Unterhaltung (zum Beispiel<br />
Mand der Gewässerränder, Räumung);<br />
Schadstoffeinleitung; Anlage von Fischtei-<br />
chen (Aufstau); Anlegen von Monokulturen<br />
an den Uferrändern; intensive landwirt-<br />
schaftliche Nutzung bis an die Uferränder.<br />
Betroffene Arten: Calopteryx virgo,<br />
Cordulegaster boltonii, Gomphus<br />
vulgatissimus, Libellula fulva, Platycnemis<br />
pennipes.<br />
Stillgewässer<br />
Verfüllung von Tümpeln <strong>und</strong> kleinen<br />
Gewässern; Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung;<br />
Umwandlung (zum Beispiel in Fischteiche);<br />
Zerstörung der Weiher <strong>und</strong> Altwasser; Ent-<br />
krautung zur Nutzung als Angelgewässer;<br />
intensive landwirtschaftliche Nutzung bis<br />
an die Uferränder; Hypertrophierung.<br />
Betroffene Arten: Aeshna isosceles,<br />
A. viridis, Anax imperator, Brachytron<br />
pratense, Cordulia aenea, Ischnura<br />
pumilio, Lestes barbarus, L. virens,<br />
<strong>Somatochlora</strong> flavomaculata, Sympecma<br />
fusca, Sympetrum striolatum.<br />
Moore<br />
Torfabbau; Entwässerung <strong>und</strong> Trdckenle-<br />
gung; Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungen; landwirt-<br />
schaftliche Nutzung; Eutrophierung; in Nie-<br />
dermooren auch Anlage von Fischteichen.<br />
Betroffene Arten: Aeshna juncea,<br />
A. subarctica, Coenagrion armatum,<br />
C. hastulatum, C. lunulatum, Leucorrhinia<br />
dubia, L. pectoralis, L. rubic<strong>und</strong>a.
Ausblick<br />
In Schleswig-Holstein wurden bisher<br />
65 Arten nachgewiesen . Von diesen kann<br />
etwa die Hälfte (34 Arten) als „Stamm-<br />
fauna" eingestuft werden. Das heißt, diese<br />
Arten bilden ohne Berücksichtigung von<br />
möglichen Bestandsschwankungen einen<br />
relativ stabilen Anteil der Odonatenfauna,<br />
während die übrigen 31 Arten eher labil<br />
einzuschätzen sind. Hierzu müssen derzeit<br />
auch Adventivarten wie Lestes dryes oder<br />
Anax imperator gezählt werden, also<br />
Arten, die als Zuwanderer mittlerweile<br />
findigen sind.<br />
Die Asiatische Keiljungfer (Gomphus<br />
flavipes) ist eine Dispersalart, die 1997<br />
nach 85 Jahren erstmals wieder in<br />
Schleswig-Holstein an der Elbe nachgewiesen<br />
werden konnte.<br />
Diese „Labil-Fauna" macht über 45 Prozent<br />
des Gesamtbestandes der Arten aus. Sie<br />
dürfte auch in Zukunft eine ständige Ande-<br />
rung erfahren. Sollte der derzeitige Trend<br />
anhalten, so wird in den kommenden<br />
Kälte- <strong>und</strong> Wärmephasen ein weiterer<br />
Artenaustausch stattfinden. So ist aktuell<br />
(19971 Gomphus flavipes nach 85 Jahren in<br />
Schleswig-Holstein wieder nachgewiesen<br />
worden (MULLER & STEGLICH 1997). Eine<br />
Dispersion der Art wurde auch in anderen<br />
B<strong>und</strong>esländern festgestellt. Es ist zu ver-<br />
muten, daß schon in den nächsten zehn<br />
Jahren eine sibirische Art wie Coenagrion<br />
armatum als ausgestorben eingestuft wer-<br />
den muß, gleichzeitig aber auch mediter-<br />
rane Libellen wie Cercion lindeni nach<br />
Schleswig-Holstein zuwandern werden<br />
(SCHORR 1990 <strong>und</strong> OTT 1996 a, b). Verschollene<br />
Arten wie Ophiogomphus cecilia<br />
<strong>und</strong> Ceriagrion tenellum könnten bei Optimierung<br />
ihrer Lebensräume Schleswig-<br />
Holstein erneut besiedeln. Die Zuwande-<br />
rung mediterraner Faunenelemente ist<br />
unter der derzeitigen Klimaentwicklung<br />
wahrscheinlich. Ursache <strong>für</strong> die Abwande-<br />
rung insbesondere sibirischer Arten ist<br />
neben den klimatischen Bedingungen sehr<br />
viel stärker der negative anthropogene Ein-<br />
fluß. Sicherlich ist in Schleswig-Holstein<br />
noch nicht die maximale Artenzahl<br />
erreicht. Dennoch ist zu erwarten, daß auf<br />
die zukünftig maximal fünf bis sieben<br />
Zuwanderungen mindestens das Doppelte<br />
an Abwanderungen <strong>und</strong> Bestandsauflösungen<br />
kommt.<br />
Um die weitere Entwicklung der Odonaten-<br />
fauna in Schleswig-Holstein abschätzen zu<br />
können, ist es unabdingbar, zukünftig<br />
neben Artenlisten auch Angaben zum<br />
Bestand zu machen. Das betrifft sämtliche<br />
Arten, denn erst die Ab<strong>und</strong>anzen lassen<br />
auch biotopspezifische Aussagen zu <strong>und</strong><br />
ermöglichen damit gegebenenfalls popula -<br />
tionsstützende Maßnahmen.<br />
157
Empfehlungen zur Erfassungsmethode<br />
Um in Zukunft <strong>für</strong> Schleswig-Holstein eine • Nachweise über die tatsächliche Enteinheitliche<br />
<strong>und</strong> realistische Ubersicht über wicklung von Arten an einem Gewässer<br />
den Artenbestand, Reproduktionsbestände lassen sich nur über Exuvienf<strong>und</strong>e bezie<strong>und</strong><br />
autochthone Populationen der Libellen hungsweise frischgeschlüpfte Imagines<br />
zu erhalten, ist es notwendig, nach einer erbringen. Bei einer Erfassung der Libelkonsequenten<br />
<strong>und</strong> einheitlich anwendba- lenfauna ist der Schwerpunkt auf eine<br />
ren Erfassungsmethode vorzugehen.<br />
zumindest halbquantitative Exuviensuche<br />
zu verlegen, die durch eine Erfas-<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gibt es zwei Möglichkeiten<br />
158<br />
um festzustellen, welche Gewässer von<br />
Libellen zur Fortpflanzung genutzt werden:<br />
entweder werden Gewässer nach Exuvien<br />
abgesucht oder es werden Imagines bei<br />
Paarung <strong>und</strong> Eiablage beobachtet. Die<br />
erste Methode ist sehr viel zuverlässiger,<br />
zumal der Nachweis erbracht wird, daß<br />
sich eine Art auch erfolgreich entwickelt<br />
hat. Noch günstiger ist eine Kombination<br />
beider Methoden. Aus der Beobachtung<br />
von Imagines - beispielsweise von kurzzei-<br />
tigen Gastarten am Gewässer - können<br />
sich darüber hinaus zusätzliche Aspekte<br />
<strong>und</strong> auch Anregungen <strong>für</strong> weitere Untersu-<br />
chungen ergeben.<br />
sung der Imagines ergänzt wird. Nahezu<br />
alle Exuvien sind beispielsweise nach<br />
dem „Handbuch <strong>für</strong> Exuviensammler"<br />
von HEIDEMANN & SEIDENBUSCH<br />
(19931 bestimmbar. Auf den Fang von<br />
Larven kann verzichtet werden, wenn es<br />
sich nur um den Nachweis einer erfolg-<br />
reichen Reproduktion handelt. Außer-<br />
dem sind die Larven einiger Arten in den<br />
frühen Stadien nicht oder nur schwer<br />
bestimmbar.<br />
• Die Erhebungen richten sich nach den<br />
Flugperioden der einzelnen Arten. Die-<br />
ses bedeutet, daß je nach Art <strong>und</strong> Größe<br />
des Gewässers sowie dem zu erwarten-<br />
den Artenspektrum acht bis zehn Bege-<br />
Sicherlich ist eine Erfassung von Libellen hungen pro Jahr notwendig sein können.<br />
an einem Gewässer in erster Linie von der<br />
jeweils vorliegenden Frage- <strong>und</strong> Aufgaben-<br />
stellung abhängig. Allerdings sollten<br />
bestimmte Anforderungen in jedem Fall<br />
eingehalten werden.<br />
• Die Erfassung der Imagines sollte neben<br />
der Anzahl auch Details zum Biotop be-<br />
ziehungsweise Habitat <strong>und</strong> zum Verhal-<br />
ten einschließen (beispielsweise mit<br />
Angabe eventuellen Reproduktionsver-<br />
haltens). Dazu sind längere Beobach-<br />
tungsphasen notwendig. Wichtig ist es,<br />
die Anzahl der beobachteten Tiere anzu-<br />
geben; dieses kann in der Regel in<br />
Ab<strong>und</strong>anzklassen geschehen. Bei<br />
umfangreichen Untersuchungen mit spe-<br />
zifischer Fragestellung ist die „highest<br />
steady density" zu bestimmen. Bei die-<br />
ser „höchsten stetigen Dichte" wird<br />
anhand mehrfacher Stichproben die<br />
Anzahl der auf bestimmten Uferlängen<br />
oder an Kleingewässern anwesenden<br />
Männchen festgestellt. Wenn sich dabei<br />
ergibt, daß die maximal festgestellte<br />
Anzahl der Männchen mit der Gewässer-<br />
fläche korreliert, kann angenommen werden,<br />
daß die Art das entsprechende<br />
Habitat regelmäßig <strong>und</strong> erfolgreich zur<br />
Fortpflanzung nutzt (MOORE 1991).<br />
• Die Erfassungen sollten wenn möglich<br />
unter gleichen oder doch ähnlichen<br />
Bedingungen erfolgen. Als Standardbe-<br />
dingungen gelten Windstille, Sonnen-<br />
schein <strong>und</strong> eine Aufnahme am späten<br />
Vormittag. Eine ausschließliche Erfas-<br />
sung der Exuvien ist relativ wetterunab-<br />
hängig <strong>und</strong> stellt damit auch einen Vor-<br />
teil gegenüber der Imagineserfassung<br />
dar.<br />
• Es sollte immer eine definierte Fläche<br />
beziehungsweise Uferlänge begangen<br />
<strong>und</strong> abgesucht werden. Die Probeflä-<br />
chengröße richtet sich nach der Größe<br />
der Gewässer. Kleinere Gewässer mit<br />
weniger als 500 m Uferlinie sollten kom-<br />
plett erfaßt werden. Bei größeren ste-<br />
henden Gewässern sollten in Abhängig-<br />
keit von den vorhandenen Strukturen<br />
mindestens zwei Probeflächen gewählt<br />
werden, wobei die zu untersuchende<br />
Uferlinie mindestens 250 m betragen<br />
sollte. Für Fließgewässer müssen die zu<br />
begehenden Uferabschnitte in Abhän-<br />
gigkeit von den örtlichen Gegebenheiten<br />
etwa 1000 m lang sein. Die Anzahl der<br />
Probeflächen an diesen Gewässern ist<br />
von der Gesamtlänge <strong>und</strong> dem Fließge-<br />
wässertyp abhängig.
Weiterhin sollten neben pflanzensoziologi-<br />
schen Daten folgende wesentlichen Merk-<br />
male zur Charakterisierung der Gewässer<br />
angegeben werden (nach WILDERMUTH<br />
1994):<br />
• Wasserfläche (Größe, Form),<br />
• Uferstruktur,<br />
• Wassertiefen <strong>und</strong> Wasserstands<br />
schwankungen,<br />
• Wasserbewegungen,<br />
• Farbe <strong>und</strong> Transparenz des Wassers,<br />
• Wärmehaushalt des Gewässers,<br />
• Farbe <strong>und</strong> strukturelle Beschaffenheit<br />
des Gewässergr<strong>und</strong>es <strong>und</strong><br />
• hydrochemische Eigenschaften.<br />
Die hier aufgeführte Methode zur Erfas-<br />
sung von Libellen ist als Mindestanforde-<br />
rung <strong>für</strong> wissenschaftliche Untersuchun-<br />
gen auch im Rahmen von Auftragsarbeiten<br />
zu verstehen. Sie sollte jedoch Hobby-<br />
odonatologen <strong>und</strong> Naturbeobachter nicht<br />
davon abhalten, ihre Libellenbeobachtun-<br />
gen auch weiterhin <strong>für</strong> den Natur- <strong>und</strong><br />
Artenschutz zur Verfügung zu stellen. Bis<br />
auf wenige Ausnahmen sind auch Beob-<br />
achtungen von Wert, die nur Ort, Zeit, Art<br />
<strong>und</strong> Anzahl der Imagines angeben.<br />
Im Anhang finden Sie einen Mustermelde-<br />
bogen, der die geforderten Anregungen<br />
berücksichtigt. Die ausgefüllten Bögen<br />
senden Sie bitte an das<br />
<strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong> Natur <strong>und</strong> <strong>Umwelt</strong><br />
des Landes Schleswig-Holstein<br />
Abteilung Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Hamburger Chaussee 25<br />
24220 Flintbek<br />
159
Zusammenfassung<br />
160<br />
Das Vorkommen der Libellen Schleswig-<br />
Holsteins in Vergangenheit <strong>und</strong> Gegenwart<br />
wird anhand von Rasterkarten dargestellt.<br />
Für jede Art gibt es eine Verbreitungskarte<br />
auf Gr<strong>und</strong>lage des UTM-Gitters (10x10 km 2 ).<br />
Jedem F<strong>und</strong>ort ist einem entsprechenden -<br />
Planquadrat zugeordnet. Die Beobachtun-<br />
gen betreffen den Zeitraum von 1875 bis<br />
1995 <strong>und</strong> wurden auf fünf Zeitabschnitte<br />
verteilt. Neben eigenen Erhebungen ent-<br />
stammen viele Daten dem umfangreichen<br />
Schrifttum.<br />
Für die Darstellung der aktuellen Verbrei-<br />
tung wurden die F<strong>und</strong>e der letzten zehn<br />
Jahre (1985 bis 1995) ausgewertet.<br />
Die Anzahl der in Schleswig-Holstein nach-<br />
gewiesenen Arten hat von 61 (LANDESAMT<br />
FUR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTS-<br />
PFLEGE 1982) auf nunmehr 65 zugenom-<br />
men.<br />
Seit 1982 wurden die Arten Südliche<br />
Mosaikjungfer Aeshna affinis, Westliche<br />
Keiljungfer Gomphus pulchellus, Südlicher<br />
Blaupfeil Orthetrum brunneum sowie<br />
Gebänderte Heidelibelle Sympetrum<br />
pedemontanum erstmals in Schleswig-<br />
Holstein nachgewiesen. Diese Arten haben<br />
ihre Verbreitungsschwerpunkte in Süd-<br />
oder Osteuropa. Ein Trend zur Arealaus-<br />
weitung nach Norden <strong>und</strong> Westen zeigt<br />
sich auch bei weiteren Arten wie Kleines<br />
Granatauge Erythromma viridulum oder<br />
Südliche Binsenjungfer Lestes barbarus.<br />
Zoogeographisch lassen sich die Libellen<br />
Schleswig-Holsteins den mediterranen,<br />
sibirischen <strong>und</strong> saharosindhischen Fau-<br />
nenkreisen zuordnen. Generell zeichnet<br />
sich ein Trend in der Zuwanderung medi-<br />
terraner (sieben Arten) <strong>und</strong> im Rückzug<br />
sibirischer (vier Arten) Faunenelemente ab.<br />
Als Ursachen werden in der Hauptsache<br />
klimatische Faktoren wie die Zunahme<br />
warmer Sommer aber auch anthropogene<br />
Habitatveränderungen diskutiert.<br />
Die Naturräume Schleswig-Holsteins wei-<br />
sen unterschiedliche Artenzahlen auf:<br />
47 Arten kommen im Bereich von Inseln,<br />
Küste <strong>und</strong> Marsch vor, 56 auf der Geest<br />
<strong>und</strong> 61 im Östlichen Hügelland.<br />
Die Mehrzahl der Arten hat ihre höchste<br />
Rasterfrequenz im Östlichen Hügelland,<br />
<strong>und</strong> hier insbesondere im klimatisch konti-<br />
nental beeinflußten Kreis Herzogtum Lau-<br />
enburg sowie im Lübecker Raum. Die mei-<br />
sten Arten haben in der Marsch <strong>und</strong> an<br />
den Küsten erhebliche Verbreitungslücken<br />
oder fehlen völlig.<br />
Für viele Arten wurden im Zeitraum ab<br />
1985 die höchste Anzahl an Nachweisen<br />
erbracht. Dies ist vor allem auf verstärkte,<br />
flächenhafte Kartierungsaktivitäten zurück-<br />
zuführen.<br />
Langfristige Populationsentwicklungen las-<br />
sen sich nur <strong>für</strong> wenige, meist seltene <strong>und</strong><br />
stenöke Arten angeben. Diese weisen<br />
durchweg einen kontinuierlichen Bestands-<br />
rückgang auf, der hauptsächlich auf nega-<br />
tive Veränderungen oder Zerstörung ihrer<br />
Lebensräume in Schleswig-Holstein<br />
zurückzuführen ist.<br />
Die Entwicklung der Libellenfauna<br />
Schleswig-Holsteins sollte zukünftig<br />
sowohl hinsichtlich qualitativer (Arealver-<br />
änderungen <strong>und</strong> Dispersionen) als auch<br />
quantitativer (Bestandsveränderungen)<br />
Aspekte aufmerksam verfolgt werden. Zu<br />
diesem Zweck werden Empfehlungen zur<br />
Erfassungsmethodik gegeben.
Summary<br />
The distribution of the dragonflies of<br />
Schleswig-Holstein in previous time and at<br />
present are discussed and shown an maps.<br />
For each species a distribution map is<br />
given based on the UTM-squares<br />
110 x 10 km 2). The maps show records in<br />
five periods, which cover the time from<br />
1875 to 1995. The period of the last ten<br />
years (1985 to 1995) was used to discuss<br />
the present status of each species. The<br />
records were compiled from litersture and<br />
own researches.<br />
The number of species increased from 61<br />
in 1982 (LANDESAMT FUR NATURSCHUTZ<br />
UND LANDSCHAFTSPFLEGE 1982) up to<br />
65. Since 1982 Aeshna affinis, Gomphus<br />
pulchellus, Orthetrum brunneum as well as<br />
Sympetrum pedemontanum occurred for<br />
the first time in Schleswig-Holstein. These<br />
species have their main distribution in<br />
South - or Eastern Europe. A trend for the '<br />
dispersal to the north and west can also be<br />
recognized for Erythromma viridulum or<br />
Lestes barbarus.<br />
The dragonflies of Schleswig-Holstein<br />
were derived from three zoogeographical<br />
origins (Mediterranean, Siberian and Saha-<br />
rosindhian regions). There is a general<br />
trend of immigration of Mediterranean<br />
faunistical elements (7 species) and of<br />
disappearance of Siberian elements<br />
(4 species). Climatic factors (the increased<br />
temperatures in the summers) and anthro-<br />
pogenic changes of habitates are discus-<br />
sed as main reasons for this development.<br />
The three main natural landscapes inhabit<br />
different numbers of species: 47 species<br />
were fo<strong>und</strong> in the region with islands,<br />
coasts and marshes ('Inseln, Küste <strong>und</strong><br />
Marsch'), 56 species were fo<strong>und</strong> in the<br />
sandy heath-fand ('Geest') and 61 in the<br />
eastern hilly region ('Östliches Hügelland').<br />
The majority of the species has its highest<br />
density in the eastern parts of the country<br />
and especially in the climatically continen-<br />
tal influenced district of Kreis Herzogtum<br />
Lauenburg and in the area of Lübeck.<br />
While the south of the sandy heath-land is<br />
colonized by more dragonflies species<br />
than the north, most of the species show<br />
considerable distribution gaps or are com-<br />
pletely missed in the region with islands,<br />
coasts and marshes.<br />
Most of the records were recognized in the<br />
years 1985 to 1995, because of the more<br />
intense field work of biologists.<br />
Long-term predictions of population deve-<br />
lopments can be made for only few, mostly<br />
rare and ecologically specialized species.<br />
These display a continuous population-<br />
decrease, which is to be led back mainly to<br />
negative changes or loss of habitates in<br />
Schleswig-Holstein.<br />
In future it is necessary to pay attention on<br />
qualitative (changes in distribution and<br />
dispersal) and on quantitative (changes of<br />
ab<strong>und</strong>ances) aspects of the development<br />
of the dragonfly fauna. For this purpose<br />
methodical recommendations are given<br />
concerning field work.<br />
161
Sammenfatning<br />
162<br />
Forekomsten af Slesvigs og Holstens<br />
guldsmede i for- og nutiden dokumenteres •<br />
i 10x10 km 2 raster-kort. Observationer fra<br />
1875 til 1995 er inddelt i fern tidsrammer.<br />
For aktuel udbredelse f<strong>und</strong>ene i de sidste ti<br />
ár (1985-1995) havde nyttet. Datoerne er<br />
gr<strong>und</strong>lag for en ny'Rod Liste' (se BROCK<br />
et al. 1996).<br />
Fra 1982 (LANDESAMT FUR NATUR-<br />
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE<br />
1982: gamle 'Riad Liste') til 1995 fire arter<br />
er pány pávist i Slesvig og Holsten. Arterne<br />
er Aeshna affinis, Gomphus pulchellus,<br />
Orthetrum brunneum og Sympetrum<br />
pedemontanum. De stammer fra Syd- og<br />
Osteuropa. Ogsá Erythromma viridulum<br />
og Lestes barbarus udbreder sig til nord-<br />
og vestlig retning.<br />
Indvandring observeres af mediterrane<br />
[over alt syv spp.] og forsvindelsen af sibi-<br />
riske arter [over alt fire spp.] (se afbildnin-<br />
ger 6 og 7).<br />
Enkelte landskaber adskiller sig: i landskab<br />
'0er, kyst og marsk' (Inseln, Küste <strong>und</strong><br />
Marsch) findes 47 arter, i hedeland (Geest)<br />
56 og i det ostlige bakkeland (Östliches<br />
Hügelland) 61.
Literatur<br />
Die Literaturliste umfaßt auch Titel, auf die im Text nicht eingegangen wird. In der Regel<br />
betreffen sie einzelne F<strong>und</strong>meldungen, die bei der Beschreibung der Arten nicht zitiert<br />
wurden.<br />
ADOMSSENT, M., 1994: Zur Libellenfauna einiger Seen <strong>und</strong> Teiche im südöstlichen<br />
Schleswig-Holstein. - Bombus 3111/12): 43-47.<br />
ADOMSSENT, M., 1995 a: Bemerkenswerte F<strong>und</strong>e mediterraner Libellen in unserem Faunengebiet<br />
während des heißen Sommers 1994. - Bombus 3(13-16): 51-52.<br />
ADOMSSENT, M., 1995 b: Naturräumliche Gliederung der lauenburgischen Libellenfauna<br />
(Schleswig-Holstein). - Libellula 1413/41: 125-156.<br />
ADOMSSENT, M., 1995 c: Erstnachweis der Südlichen Mosaikjungfer Aeshna affinis VAN<br />
DER LINDEN 1823 <strong>für</strong> Schleswig-Holstein (Odonata). Faunistische Notizen 553. - Ent.<br />
Nachr. Ber. 39(3): 146-147.<br />
ALTMÜLLER, R., 1985: Libellen - Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Libellen.<br />
- Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Fachbehörde <strong>für</strong> Naturschutz, Hannover.<br />
ALTMÜLLER, R., J. BÄTER & G. GREIN, 1981: Zur Verbreitung von Libellen, Heuschrecken<br />
<strong>und</strong> Tagfaltern in Niedersachsen (Stand 1980). - Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege in<br />
Niedersachsen, Beiheft 1.<br />
ASKEW, R.R., 1988: The Dragonflies of Europe. - Harley Books, Colchester, England.<br />
BARTENEF, A., 1932 a: Über die Verschiedenheit der Verbreitungsgrenzen der Odonatenarten<br />
in der Paläarktik nach Norden. - Zool. Anzeiger 9819/101: 267-272.<br />
BARTENEF, A., 1932 b: Versuch einer biologischen Gruppierung der Odonaten des<br />
europäischen Teiles der Sowjetunion. - Russ. Zool. Jour. 10: 57-131.<br />
BEIER, M., 1928: Zur Kenntnis der Fauna von Helgoland.- Zeitschrift <strong>für</strong> wissenschaftliche<br />
Insektenbiologie, 23: 47-51.<br />
BEHR, H., 1984: Zur Insektenfauna der Hochmoorgewässer, unter besonderer Berücksich-<br />
tigung der Libellen (Odonata), Käfer (Coleoptera) <strong>und</strong> Wanzen (Heteroptera) in Glas- <strong>und</strong><br />
Ohemoor - Hausarbeit. - Universität Hamburg.<br />
BELLMANN, H., 1987: Libellen: beobachten, bestimmen. - Verlag J. Neumann-Neudamm,<br />
Melsungen.<br />
BELYSHEV, B. F., 1958: Die Verbreitung der Odonaten in Sibirien. - Dtsch. Ent. Zschr., N.F.<br />
5(1/2): 79-85.<br />
BENKEN, T., 1980: Die Libellenfauna des Hahlener Moores (Gemeinde Menslage). - Inf.<br />
Natursch. Landschaftspfl., Wardenburg 2: 163-178<br />
BERNDT, R. K. & H. THIESSEN, 1990: Hemmelsdorfer See - Seeufer schleswigholsteinischer<br />
Seen - Zustand, Nutzung, Gefährdung, Schutz. - <strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong> Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Landschaftspflege Schleswig-Holstein.<br />
BEUTHIN, H., 1875: Verzeichnis der Pseudoneuropteren <strong>und</strong> Neuropteren der Umgegend<br />
von Hamburg. - Verh. Vereins naturwiss. Unterhaltung zu Hamburg 1871-1874: 122-126.<br />
BEUTLER, H., 1992: Rote Liste - Libellen (Odonata). - In: Ministerium <strong>für</strong> <strong>Umwelt</strong>, Natur-<br />
schutz <strong>und</strong> Raumordnung (Hrsg.): Rote Liste - Gefährdete Tiere im Land Brandenburg:<br />
223-225.<br />
BEYER, S., 1988: Gebänderte Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum) <strong>und</strong> Südlicher<br />
Blaupfeil (Orthetrum brunneum) an Wiesengräben im Coburger Land. - Schr. R. Bay.<br />
<strong>Landesamt</strong> f. <strong>Umwelt</strong>schutz 79: 125-129.<br />
BEZZEL, E. & H. UTSCHIK, 1979: Die Rasterkartierung von Sommervogelbeständen -<br />
Bedeutung <strong>und</strong> Grenzen. - J. Im. 120: 431-440.<br />
BFN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.), 1995: Klimaänderungen <strong>und</strong> Naturschutz.<br />
- Angewandte Landschaftsökologie 4.<br />
BLAB, J. & E. NOWAK (Hrsg.), 1989: Zehn Jahre Rote Liste gefährdeter Tierarten in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland - Situation, Erhaltungszustand, neuere Entwicklungen. -<br />
Kilda-Verlag, Greven.<br />
BLAB, J., E. NOWAK, W. TRAUTMANN & H. SUKOPP (Hrsg.), 1984: Rote Liste der gefährdeten<br />
Tiere <strong>und</strong> Pflanzen in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. - Kilda-Verlag, Greven.<br />
BLANCKE, C., K. LUTZ, H. STÖKL, & M. SCHLORF, 1981: Dosenmoor 1981. - Naturkdl.<br />
Beitr. DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) 8: 25-32.<br />
BÖGER, K., 1975: Red area book: Himmelmoor. - DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung)<br />
Naturk<strong>und</strong>liches Jahrbuch 12(1975/761: 124-133.<br />
163
164<br />
BÖTTGER, K., 1986: Aspekte der Gehölzbeschattung <strong>und</strong> Zielvorstellungen der Renaturierungsmaßnahmen<br />
am Unteren Schierenseebach (Schleswig-Holstein), unter besonderer<br />
Herausstellung der Odonata. - Natur <strong>und</strong> Landschaft 61111: 10-13.<br />
BOTTGER, K. & B. STATZNER, 1983: Die ökologischen Folgen der Ausbaggerung eines<br />
norddeutschen Tieflandbaches, dargestellt am Beispiel des Unteren Schierenseebaches<br />
(Naturpark Westensee, Schleswig-Holstein).- Schr. Naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein 53:<br />
59-81.<br />
BORKENHAGEN, P., 1993: Atlas der Säugetiere Schleswig-Holsteins. - <strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong><br />
Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege Schleswig-Holstein (Hrsg.), Kiel.<br />
BOTHE, G., 1989: Oberalsterniederung 1985/86 - Insektenf<strong>und</strong>e. - Naturkdl. Beitr. DJN<br />
(Deutscher Jugenb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) 18: 14-21.<br />
BOYE, P., 1984: Red area: Appener Moor. - Naturkdl. Beitr. DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong><br />
<strong>für</strong> Naturbeobachtung) 13: 1-134 (<strong>und</strong> Anhang).<br />
BOVE, P., A. TESCH & M. FRITZ, 1980: DJN-Sommerlager 1979 in Stapelholm. - Naturkdl.<br />
Beitr. DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) 5: 6-38.<br />
BREUER, M. & C. RITZAU, 1983: Bestandsaufnahmen zur Odonatenfauna des Bremer<br />
Blocklandes <strong>und</strong> Hollerlandes. Abh. Naturw. Ver. Bremen 40: 1--14.<br />
BRINKMANN, R., 1985: Ökologische Studien am Benthon des Unteren Schierenseebaches<br />
(Naturpark Westensee, Schleswig-Holstein) - Diplomarbeit. - Christian-Albrechts-Univer-<br />
sität Kiel.<br />
BROCK, V., J. HOFFMANN, 0. KÜHNAST, W. PIPER & K. VOSS, 1997: Die Libellen Schleswig-Holsteins<br />
- Rote Liste. - <strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong> Natur <strong>und</strong> <strong>Umwelt</strong> des Landes Schleswig-<br />
Holstein (Hrsg.), Flintbek.<br />
BROCKHAUS, T., 1994: Rote Liste der Libellen - Black Box <strong>für</strong> den praktischen Naturschutz.<br />
- Verh. Westd. Entom. Tag, 1993: 43-50.<br />
BROCKHAUS, T., 1996: Populationsdynamik der Federlibelle Platycnemis pennipes (Pallas,<br />
1771) an ihrer regionalen Verbreitungsgrenze im Erzgebirge (Zygoptera: Platycnemididae).<br />
- Vortrag auf der 15. Jahrestg. der Gd0 in Berlin, März 1996.<br />
BRÜMMER, I. & A. MARTENS, 1994: Die Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes in der<br />
mittleren Elbe bei Wittenberge (Odonata: Gomphidae). - Braunschw. naturkdl. Schr. 4:<br />
497-502.<br />
BRUENS, A., 1990: Die Odonaten (lnsecta) des Schilfgürtels vom Belauer See (Schleswig-<br />
Holstein) - Ein Beitrag zur Ökosystemforschung im Bereich der Bornhöveder Seenkette -<br />
Diplomarbeit. - Christian-Albrechts-Univerität Kiel.<br />
BUCHHOLZ, H., 1977: Die ungenehmigte Ausbaggerung eines Teiches in einem Flachmoorbruch<br />
im Landschaftsschutzgebiet. - Vogelk<strong>und</strong>liches Tagebuch Schleswig-Holstein<br />
5: 86-93.<br />
BUCHWALD, R., 1983 a: Kalkquellmoore <strong>und</strong> Kalkquellsümpfe als Lebensraum gefährdeter<br />
Libellenarten im westlichen Bodenseeraum. Telma 13: 91-98<br />
BUCHWALD, R., 1983 b. Ökologische Untersuchungen an Libellen im westlichen Bodenseegebiet.<br />
- In: Der Mindelsee bei Radolfzell. Monographie eines Naturschutzgebietes auf<br />
dem Bodanrück. Natur- <strong>und</strong> Landschaftsschutzgebiete Bad.-Wiirtt. 11: 539-637.<br />
BUCHWALD, R., 1985: Libellenfauna einer schützenswerten Kiesgrube am Hochrhein<br />
(Bad.-Württ.(. - Libellula 4(3/4): 181-194.<br />
BUCHWALD, R., B. GERKEN, K. SIEDLE & K. STERNBERG, 1984: Übersicht über die Libellenvorkommen<br />
in Baden-Württemberg mit kurzer Charakteristik des Fortpflanzungsgebie-<br />
tes <strong>und</strong> Angaben zur Verbreitung. - Libellula 3(3/4): 101-110.<br />
BUCHWALD, R., J. KUHN, A. SCHANOWSKI, K. SIEDLE & K. STERNBERG, 1986: 3. Sammelbericht<br />
über Libellenvorkommen in Baden-Württemberg. - Schutzgemeinschaft Libel-<br />
len in Baden-Württemberg (Hrsg.), Freiburg, Tübingen.<br />
BUCHWALD, R., B. HÖPPNER & A. SCHANOWSKI, 1994: 10. Sammelbericht über Libellenvorkommen<br />
in Baden-Württemberg, Rheinmünster: 1-36.<br />
BUCK, K., 1990 a: Libellen im Kreis Steinburg. - Libellula 9(1/2): 67-70.<br />
BUCK, K., 1990 b: Nachweis von Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) <strong>und</strong><br />
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) in einer Kreidegrube bei Itzehoe (Anisoptera:<br />
Libellulidae). - Libellula 9(3/4): 75-92.<br />
BUCK, K., 1991: Moorlibellen im Kreis Steinburg (Holstein). - Libellula 10(1/2): 73-76.<br />
BUCK, K., 1994: Libellen im Kreis Steinburg - Bestandserfassung der F<strong>und</strong>e aus den Jahren<br />
1989 bis 1992. - Libellula 13(3/41: 81-171.<br />
BUCK, K., 1995: Libellen im Kreis Steinburg - Bestandserfassung der F<strong>und</strong>e aus den<br />
Jahren 1989 bis 1992. Errata zu BUCK 1994. - Libellula 14(1/2): 123-124.<br />
CASPERS, H., 1942: Die Landfauna der Insel Helgoland. - Zoogeographica 4(21: 127-186.
CLAUSNITZER, H.-J., 1972: Die Odonaten im Naturpark Südheide (Umgebung Celle).<br />
- Ent Zschr. 82)20): 236-240.<br />
CLAUSNITZER, H.-J., 1980: Hilfsprogramm <strong>für</strong> gefährdete Libellen. - Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />
55(1): 12-15.<br />
CLAUSNITZER, H.-J., 1981: Die Libellen im Naturschutzgebiet „Breites Moor" bei Celle. -<br />
Beitr. Naturk. Niedersachsen 34 (1981): 91-101.<br />
CLAUSNITZER, H.-J., 1996: Veränderungen der Libellenfauna in der Südheide von 1975<br />
bis 1995. - Vortrag auf der 15. Jahrestg. der GdO in Berlin, März 1996.<br />
COLLAR, N., 1994: New Criteria for the Assessment of Threatened Status of Species. (Vor-<br />
tragsmanuskript, Tagung „Rote Listen in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland", Gut S<strong>und</strong>er,<br />
Meißendorf, 20.3.94)<br />
DALLA TORRE, K. W., 1889: Die Fauna von Helgoland. - Zool. Jahrb., Abtlg. Systematik,<br />
Geographie u. Ökologie der Tiere 4: 78-81.<br />
DE MARMELS, J. & H. SCHIESS, 1977: Zum Vorkommen der Zwerglibelle Nehalennia speciosa<br />
(Charp., 1840) in der Schweiz. - Vierteljahresschr. Naturforsch. Ges. Zürich 122: 339-348.<br />
DEGN, C. & U. MUUSS, 1966: Topographischer Atlas Schleswig-Holstein. - Verlag K.<br />
Wachholtz, Neumünster.<br />
DEUTSCHER WETTERDIENST, 1917-1995: Deutsche Meteorologische Jahrbücher 1917-<br />
1995. - Selbstverlag, Kissingen, Offenbach, Hamburg.<br />
DEUTSCHER WETTERDIENST, 1967: Klima-Atlas von Schleswig-Holstein, Hamburg <strong>und</strong><br />
Bremen. - Selbstverlag, Offenbach.<br />
DEVAI, G., 1976: Chorologische Untersuchungen der Libellenfauna Ungarns. - Acta Biol.<br />
Debrecina 13 (Suppl. 1): 119-157.<br />
DIEHL, D. & M. DIEHL, 1977: Zur biologischen Charakterisierung der verschiedenartigen<br />
Gewässer in der Schellbruch-Niederung. - Ber. Ver. Natur Heimat Naturh. Mus. Lübeck<br />
1977(15): 7-25.<br />
DIERSCHKE, V., 1986: Erneuter F<strong>und</strong> von Sympetrum pedemontanum (Allioni) in<br />
Schleswig-Holstein. - Drosera '86111: 13-14.<br />
DONATH, H., 1980: Meliorationsgräben als Lebensraum <strong>für</strong> Libellen. - Ent. Nachr. Dresden<br />
2416): 81-90.<br />
DREYER, H., 1986: Die Libellen. - Gerstenberg-Verlag, Hildesheim.<br />
EMEIS, W., 1941: Die Hautflügler (Hymenoptera) - Die Libellen - Gradflügler (Orthoptera) -<br />
Köcherfliegen (Trichoptera) - Zikaden. In: MOLLER, H.: Das Satrupholmer Moor. - Veröf-<br />
fentlichungen des Instituts <strong>für</strong> Volks- <strong>und</strong> Landesforschung an der Landesuniversität Kiel -<br />
Schriften zur Schleswig-Holsteinischen Landesforschung 2: 154.<br />
EMEIS, W.; 1950: Einführung in das Pflanzen- <strong>und</strong> Tierleben Schleswig-Holsteins. - H. Möller<br />
Söhne, Rendsburg.<br />
ERFURT, H. J. & V. DIERSCHKE, 1992: Oehe-Schleimlinde. - Seevögel (Zeitschrift des Verein<br />
Jordsand zum Schutze der Seevögel <strong>und</strong> der Natur e. V.) 13(Sonderheft 11: 1-104.<br />
FISCHER, C., 1970: Zur Libellenfauna des Landesteils Schleswig. - Die Heimat 7715): 146-149.<br />
FISCHER, C., 1972: Beitrag zur Odonatenfauna des Landesteils Schleswig. - Die Heimat<br />
79(4): 111-114.<br />
FISCHER, C., 1984 a: Libellen Schleswig-Holsteins. - Mitteilungen aus dem Zoologischen<br />
Museum der Universität Kiel 2 (Suppl.).<br />
FISCHER, C., 1984 b: Sympetrum pedemontanum (Allioni) <strong>und</strong> Tjederina gracilis (Schneider)<br />
in Schleswig-Holstein (lnsecta: Odonata, Neuroptera). Drosera '84111: 51-52.<br />
FRANKE, U., 1981: Libellen im Naturschutzgebiet Etzwiler Ried (Kanton Thurgau,<br />
Schweiz). Mitt. thurg. naturf. Ges., Frauenfeld 44: 105-120<br />
FRIEDRICH, H., 1938: Eine überwinternde Libelle in Schleswig-Holstein. - Die Heimat 48141: 124.<br />
GEIJSKES, D. C., 1935: Faunistisch-ökologische Untersuchungen am Röserenbach bei<br />
Liestal im Baseler Tafeljura. - Tijdschrift v. Ent. 28: 249-382.<br />
GEIJSKES, D. C. & J. VAN TOL, 1983: De Libellen van Nederland (Odonata). - Koninklijke '<br />
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Hoogwond<br />
GLEISS, H. G. W., 1965: Entomologische, cecidologische <strong>und</strong> phytopathologische Sam-<br />
melergebnisse aus Nord- <strong>und</strong> Mitteldeutschland, 1946-1964 (Teil I). - Schr. Arb.kr. naturw.<br />
Heimatforsch. Wedel 1(1): 5.<br />
GLITZ, D., 1970 a: Beitrag zur Libellenfauna des Truppenübungsplatzes Höltigbaum. - DJN<br />
(Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung), Jahrbuch 1: 43-77.<br />
GLITZ, D., 1970 b: Die Libellenfauna der Stadtrandbezirke Hamburgs.- DJN (Deutscher<br />
Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung), Jahrbuch 1: 85-144.<br />
165
166<br />
GLITZ, D., 1970 c: Vorläufige Odonatenliste mit Verbreitungsdiagrammen aus Hamburg<br />
<strong>für</strong> den Zeitabschnitt von 1872 bis 1970.- DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobach-<br />
tung), Jahrbuch 2: 123-158.<br />
GLITZ, D., 1976: Zur Odonatenfauna Nordwestdeutschlands - Anisoptera. - Bombus 2(581:<br />
229-231.<br />
GLITZ, D., 1977: Zur Odonatenfauna Nordwestdeutschlands - Zygoptera. - Bombus<br />
2(59/60): 233-235.<br />
GLITZ, D., H. -J. HOHMANN & W. PIPER, 1989: Artenschutzprogramm Libellen in Hamburg.<br />
- Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege in Hamburg 26: 1-92.<br />
GROSSE, A., 1957: Entomologische Beobachtungen aus Dithmarschen 1955 <strong>und</strong> 1956. -<br />
Mitt. Faun. Arb. Gem. Schleswig-Holstein, Hamb. <strong>und</strong> Lüb. N.F. 9.Jg.(3): 46-47.<br />
GULSKI, M., 1985: Landschaftsökologische Untersuchungen im Hellbachtal (Kreis Herzogtum<br />
Lauenburg). - Mitt. ArGe Geobot. in Schleswig-Holstein u. Hamburg 35: 6-9 u. 80-82.<br />
HABRAKEN, J.M.P.M. & B.H.J.M. CROMBAGHS, 1997: Een vondst van de Rivierrombout<br />
Gomphus flavipes (Charpentier) langs de Waal. - Brachytron 1: 3-5.<br />
HARDERSEN, S., 1991: Die Vegetation des Schwabstedter Westerkooges <strong>und</strong> zoologische<br />
Begleituntersuchungen an ausgewählten Tiergruppen. - Diplomarbeit am Botanisches<br />
Institut im Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften der Christian Albrecht Univer-<br />
sität, Kiel.<br />
HEIDEMANN, H. & R. SEIDENBUSCH, 1993: Die Libellenlarven Deutschlands <strong>und</strong> Frankreichs<br />
- Handbuch <strong>für</strong> Exuviensammler. - Verlag Erna Bauer, Keltern.<br />
HENNES, M., 1985: Zum Vorkommen von Libellen (Odonatal <strong>und</strong> Tagfaltern (Lepidoptera)<br />
im Naturschutzgebiet Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal / Kreis Stormarn. - Seevögel<br />
(Zeitschrift des Vereins Jordsand zum Schutze der Seevögel <strong>und</strong> der Natur e. V.) 6 (Son -<br />
derband): 15-27.<br />
HEYDEMANN, B. & J. MÜLLER-KARCH, 1980: Biologischer Atlas Schleswig-Holstein. -<br />
K. Wachholtz, Neumünster.<br />
HEYMER, A., 1958: Odonaten-F<strong>und</strong>e 1958 aus der Umgebung von Hamburg. - Mitt. d.<br />
Faun. Arb.Gem. Schleswig-Holstein, Hamburg u. Lübeck 11(31: 42.<br />
HEYMER, A., 1962: Hemianax ephippiger (Burmeister) am Selenter See (Schleswig-<br />
Holstein). - Beiträge zur Entomologie 12(5/6): 527-528.<br />
HOERSCHELMANN, U., 1992: Okologische Produktionsbiologie benthischer Makroinvertebrata<br />
des Belauer Sees (Schleswig-Holstein) unter besonderer Berücksichtigung der<br />
Hydrachnidia (Acari). - Faun. -Okol. Mitt. 14 (Suppl.).<br />
HOFFMANN, J., 1997: Odonatenfauna <strong>und</strong> Klima in Schleswig-Holstein - Veränderungen<br />
von 1917 bis heute. - Vortrag auf der 16. Jahrestg. der GdO in Nürnberg, März 1997.<br />
HOFFMANN, J., (in Vorb.): Einfluß des Klimas auf Veränderungen in der Odonatenfauna<br />
Schleswig-Holsteins.<br />
HOLMEN, M. & H. PEDERSEN, 1996: Odonata i Danmark, forel0big status 1995. - Nordisk<br />
Odonat. Forum 2(1): 4-7.<br />
HUBER, C., 1983: Kalkquellsümpfe <strong>und</strong> Wiesenbäche/Wiesengräben als Biotop von<br />
Orthetrum coerulescens - Untersuchungen im westlichen Bodenseegebiet. Diplomarbeit<br />
Universität Freiburg. 110 S.<br />
JACOB, U., 1969: Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung<br />
heimischer Libellen. - Faun. Abh, Staatl. Mus. Tierk. Dresden 2 (24): 197-239.<br />
JAECKEL, S. G. A., 1962: Die Tierwelt der Schlei. - Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein<br />
33: 11-32.<br />
JEDICKE, L. & E. JEDICKE, 1992: Farbatlas Landschaften <strong>und</strong> Biotope Deutschlands. - Verlag<br />
Eugen Ulmer, Stuttgart.<br />
JÖDICKE, R., 1992: Die Libellen Deutschlands - Eine Systematische Liste mit Hinweisen<br />
auf aktuelle nomenklatorische Probleme. - Libellula 11(3/4): 89-112.<br />
JÖDICKE, R. & G. SENNERT, 1986: Die Libelle Erythromma viridulum im Rheinland vom<br />
Aussterben bedroht oder übersehen ? Rheinische Heimatpflege N.F. 23: 179-184.<br />
JURTZITZA, G., 1964: Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe IV. Mitt.:<br />
Ceriagrion tenellum (de Villers) in Karlsruhe. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 23111: 71-72.<br />
JURZITZA, G., 1989: Anmerkungen zu den üblichen Kriterien <strong>für</strong> eine Bodenständigkeit<br />
von Libellen. - Libellula 8)3/4): 177-179.<br />
KALUSCHE, J., 1985: Das Blixmoor (Kreis Schleswig-Flensburg) - Vegetationsk<strong>und</strong>liche<br />
<strong>und</strong> faunistische Erhebung zum Nachweis der Naturschutzwürdigkeit - Diplomarbeit. -<br />
Universität Kiel.<br />
KEILHACK, L., 1911: Libellen auf Helgoland.- Aus der Natur 6 (24): 737-740; Leipzig.
KELM, H. -J., 1983: Neue F<strong>und</strong>e von Coenagrion armatum Charpentier 1840 in Schleswig-<br />
Holstein. - Drosera 83(11: 13-14.<br />
KIKILLUS, R. & M. WEITZEL,1981: Gr<strong>und</strong>lagenstudien zur Ökologie <strong>und</strong> Faunistik der<br />
Libellen des Rheinlandes. - Pollichia Buch Nr. 2.<br />
KIRSCHNING, I., 1991: Sonnenscheindauer <strong>und</strong> Niederschläge in Schleswig-Holstein von<br />
1968 bis 1990. - In: Flensburger Regionale Studien 4: Ändert sich das Sommerkiima in<br />
Schleswig-Holstein?: 7-88.<br />
KNAPP, E., A. KREBS & H. WILDERMUTH, 1983: Libellen. Neujahrsbl. naturforsch. Ges.<br />
Schaffhausen 35: 1-90.<br />
KNIEF, W., R.K. BERNDT, T. GALL, B. HÄLTERLEIN, B. KOOP & B. STRUWE-JUHL, 1995:<br />
Die Brutvögel Schleswig-Holsteins - Rote Liste. - <strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong> Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Schleswig-Holstein (Hrsg.), Kiel.<br />
KÖNIG, D., 1955: Bemerkungen über Pararge aegeria v. egerides Stgr. (Lep., Rhop.) <strong>und</strong><br />
Calopteryx virgo L. (Odon., Zygopt.). - Mitt. Faun. ArbGem. Schl.-Holst., Hamb. <strong>und</strong> Lüb.,<br />
N. F., 8: 31-32.<br />
KÖNIG, D., 1964: Ein zoologischer Blick in die ostholsteinische Landschaft.- Faun. Mitt.<br />
Nordd. 2: 129-132.<br />
KORN, M., 1988: Erstnachweis der Südlichen Binsenjungfer (Lestes barbarus) auf Helgo-<br />
land. - Seevögel (Zeitschrift des Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel <strong>und</strong> der<br />
Natur e. V.) 9(2): 25.<br />
KRENTZ, T., 1988: Ökologisch-faunistische Untersuchungen an Libellen (Odonata) der<br />
Lanzer Kiesseen (Kreis Lauenburg) - Hausarbeit zur 1. Staatsexamenprüfung <strong>für</strong> das Lehramt<br />
an Gymnasien. - Universität Hamburg.<br />
KREUZER, R., 1940: Limnologisch-ökologisch Untersuchungen an holsteinischen Kleinge-<br />
wässern. - Arch. Hydrobiol. 10(Suppl.(: 359-572.<br />
KRISMANN, A., 1992: Bestand an Stillgewässern auf der Insel Föhr im Vergleich mit anderen<br />
Regionen Deutschlands. - Drosera '92(10): 85-87.<br />
KUHN, K., 1993: Libellen (Odonata). - In: Rote Liste gefährdeter Tiere in Bayern (Wirbel-<br />
tiere, Insekten, Weichtiere). - Bayrisches Staatsministerium <strong>für</strong> Landesentwicklung <strong>und</strong><br />
<strong>Umwelt</strong>fragen, München: 34-36.<br />
KUNDY, M., 1984: Ökologische Untersuchungen über das Zoobenthos der Oberen Alster -<br />
Diplomarbeit. - Institut <strong>für</strong> Hydrobiologie <strong>und</strong> Fischereiwissenschaft, Universität Hamburg.<br />
LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE SCHLESWIG-HOLSTEIN,<br />
1982: Rote Listen der Pflanzen <strong>und</strong> Tiere Schleswig-Holsteins. Libellen - Odonata (Bearbei-<br />
ter: SCHMIDT). - Schriftenreihe des <strong>Landesamt</strong>es <strong>für</strong> Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Schleswig-Holstein 5.<br />
LATTIN, G. de, 1967: Gr<strong>und</strong>riß der Zoogeographie. - Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.<br />
LE R01, 0., 1913: Zur Odonatenfauna Deutschlands. - Arch. Naturgesch. (A) 79121: 102-120.<br />
LEMPERT, J. 1987: Das Vorkommen von Sympetrum fonscolombei in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. - Libellula 611/21: 59-69.<br />
LEMPERT, J., 1996 a: Libellenwanderungen auf der Nordseeinsel Mellum. - Vortrag auf<br />
der 15. Jahrestg. der GdO in Berlin, März 1996.<br />
LEMPERT, J., 1996 b: Zur Libellenfauna der ostfriesischen Insel Wangerooge. - Seevögel<br />
(Zeitschrift des Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel <strong>und</strong> der Natur e. V.) 17(4): 82-87.<br />
LEMPERT, J., (in Vorb.): Migration einiger Libellenarten.<br />
LENZ, N., 1991: The importance of abiotic and biotic factors for the structure of odonate<br />
communities of ponds (Insecta: Odonata).- Faun.-ökol. Mitt., 6(5/6): 175-189.<br />
LOHMANN, H., 1964: Naturk<strong>und</strong>licher Bericht über das Fehmarn-Sommerlager 1964. -<br />
DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) Naturk<strong>und</strong>liches Jahrbuch<br />
4(1964/65): 111-115.<br />
LOHMANN, H., 1980: Faunenliste der Libellen (Odonata) der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland<br />
<strong>und</strong> Westberlins. - Societas Internationalis Odonatologica - Rapid Communications<br />
1.<br />
LOHMANN, H., 1981: Postglaziale Disjunktion bei europäischen Libellen. - Libellula 1(1): 2-4<br />
LUNAU, C., 1929: Aeshna subarctica Walker in Ostholstein (Odon.). - Dtsch. Ent. Zschr.<br />
1929: 128.<br />
LUNAU, C., 1930: Ins Nienwohlder Moor.- Die Heimat 40(2): 40-41.<br />
LUNAU, C., 1932 a: Die Libellen des Dummersdorfer Ufers. - In: Denkmalrat (Hrsg.), 1932:<br />
Das linke Untertraveufer (Dummersdorfer Ufer) - Eine naturwissenschaftliche Bestands-<br />
aufnahme. - Kommissionsverlag Rathgens, Lübeck: 277-288.<br />
LUNAU, C., 1932 b: Eiablage von Lestes virens (Charp.) (Odon. Lib.). - Mitt. dt. ent. Ges.<br />
3(3): 44-45.<br />
167
168<br />
LUNAU, C., 1932 c: Epitheca bimaculata (Charp.) <strong>und</strong> <strong>Somatochlora</strong> arctica (Zett.), zwei<br />
<strong>für</strong> Schleswig-Holstein neue Libellenarten.- Mitt. Faun. ArbGem. Schleswig-Holstein,<br />
Hamb. <strong>und</strong> Lüb. 8/9: 35-36.<br />
LUNAU, C., 1934: Libellenstudien I. 1. Eiablage von Agrion mercuriale (Charp.). 2. Drei<br />
Paarungen zwischen verschiedenen Libellenarten. - Mitt. dt. ent. Ges. 517/81: 59.<br />
LUNAU, C., 1935: Zwei <strong>für</strong> Nordelbingen neue Libellenarten (Sympecma paedisca Brau.<br />
<strong>und</strong> Leucorrhinia albifrons Burm.). - Die Heimat 43(8/91: 213-214.<br />
LUNAU, C., 1939: Ceriagrion tenellum de Vill., eine in Schleswig-Holstein heimische Libellenart.<br />
- Schr. naturw. Verein. Schlesw. -Holst 23(1): 140.<br />
LUNAU, C., 1947: Interne Mitglieder-Nachrichten: e) Libellen.- R<strong>und</strong>schr. 21.9.47 der Faun.<br />
ArbGem. Schleswig-Hoistein, Hamb.<strong>und</strong> Lüb. 2: 10.<br />
LUNAU, C., 1950: Zur Heuschreckenfauna Schleswig-Holsteins. - Schr. Naturwiss. Verein<br />
Schleswig-Holstein 24(21:51-56.<br />
LUNAU, C., 1952: Stare auf Libellenfang. - Die Vogelwelt 73121: 59.<br />
LUNAU, C., 1954: Anax imperator Leach (Odon.) bei Lübeck gefangen. - Mitt. faun. Arb-<br />
Gem. Schl. -Holst. (N. F.) 7131: 46.<br />
LÜTT, S., 1985: Die Vegetation der kalkreichen Niedermoorwiese am Dobersdorfer See,<br />
Kreis Plön. - Kieler Notizen z. Pflanzenk<strong>und</strong>e in Schleswig-Holstein u. Hamburg 17(4): 149.<br />
LUTZ, K. & R. VOLKER, 1981: Himmelmoor 1981. - Naturk<strong>und</strong>liche Beiträge des DJN<br />
(Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) 8: 4-7.<br />
MARTENS, A., 1985: Vorkommen des Kleinen Granatauges Erythromma viridulum in der<br />
Umgebung von Braunschweig. Braunschw. Naturk. Schr. 2 (21: 289-298.<br />
MARTENS; A., 1996: Die Federlibellen Europas: Platycnemidae. - Neue Brehm-Bücherei<br />
626: 1-149, Westarp-Wiss., Magdeburg; Spektrum Akad. Verl., Heidelberg.<br />
MARTENS; A. & M. GASSE, 1996: Die Südliche Mosaikjungfer Aeshna affinis in Niedersachsen<br />
<strong>und</strong> Sachsen-Anhalt (Odonata: Aeshnidae). - Braunschw. Naturkdl. Schr. 4141:<br />
795-802.<br />
MARTIN, C., 1990: Beitrag zur Vegetation <strong>und</strong> Fauna des Tetenhusener Moores<br />
(Schleswig-Holstein) - Diplomarbeit. - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel.<br />
MAUSS, V., 1984: Norderstedter Ohmoor 1982/83. - Naturkdl. Beitr. DJN (Deutscher<br />
Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) 12:<br />
20-36.<br />
MAUSS, V., 1985: Ohmoor 1984.- Naturkdl. Beitr. DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung)<br />
14: 51-58.<br />
MAUSS, V., 1986: Regenwasserrückhaltebecken. - Naturkdl. Beitr. DJN (Deutscher<br />
Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) 17: 33-60.<br />
MAYER, G., 1961: Studien an der Heidelibelle Sympetrum vulgatum (L.). - Naturkdl. Jahrb.<br />
Stadt Linz 1961: 201 -217.<br />
MEINEKE, T., 1976: Beobachtungen von Insektenwanderungen auf der Insel Sylt in der<br />
Zeit vom 30.VI1. - 9. VIII. 1975. - Atalanta 7141: 216-218.<br />
MIELEWCZYK, S., 1970: Odonata <strong>und</strong> Heteroptera aus dem Naturschutzgebiet Ptasi Raj<br />
bei Gdansk mit besonderer Berücksichtigung des Brackwassersees. - Fragmenta Fauni-<br />
stica 15(19): 343-363.<br />
MOORE, N. W., 1991: The development of dragonfly communities and the consequences<br />
of territorial behaviour: a 27 year study an small ponds at Woodwalton Fen, Cambridge-<br />
shire, United Kingdom. - Odonatologica 20(2): 203-231.<br />
MOSSAKOWSKI, D., 1964: Neuer F<strong>und</strong> von <strong>Somatochlora</strong> arctica Zett. (Odon.). - Faun.<br />
Mitt. Nordd. 2: 203 <strong>und</strong> 2 (Register): xi.<br />
MÜLLER, J. & R. STEGLICH, 1997: Zwischenergebnis 1997 zum aktuellen Vorkommen von<br />
Gomphus flavipes in der Elbe von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-<br />
sachsen, Schleswig-Holstein <strong>und</strong> der Weser bei Bremen. - Hagenia 14: 21-22.<br />
MÜLLER, 0., 1995: Ökologische Untersuchungen an Gomphiden (Odonata: Gomphidae)<br />
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Larvenstadien. - Cuvillier Verlag, Göttingen.<br />
MÜLLER, P., 1981: Arealsysteme <strong>und</strong> Biogeographie. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.<br />
MÜLLER-LIEBENAU, I., 1956: Die Besiedlung der Potamogeton-Zone ostholsteinischer<br />
Seen. - Arch. Hydrobiol. 52: 470-606.<br />
MÜNCHBERG, P., 1936: Zur Verbreitung der beiden Anax-Arten in Ostdeutschland. -<br />
Abhandl. Naturwiss. Abt. Grenzm. Gesellsch. Erforsch. u. Pflege d. Heimat 11:90-95.<br />
MÜNCHBERG, P., 1982: Zur Parasitierung der Flügel von Sympetrum meridionale <strong>und</strong><br />
fonscolombei durch die Larven von Arrenurus papillator zugleich zur Spezifität <strong>und</strong> den<br />
Voraussetzungen dieses Parasitismus. - Arch. Hydrobiol. 95(1/4): 299-316.
NIEHUIS, M., 1984: Verbreitung <strong>und</strong> Vorkommen der Libellen (lnsecta: Odonata) im Regie-<br />
rungsbezirk Rheinhessen-Pfalz <strong>und</strong> im Nahetal. - Naturschutz u. Ornithologie in Rheinl.-<br />
Pfalz 3111: 1-203<br />
NIETZKE, G., 1937: Die Kossau: Hydrobiologisch-faunistische Untersuchungen an<br />
schleswig-holsteinischen Fließgewässern. - Arch. Hydrobiol. 32: 1-74.<br />
OHNESORGE, D., 1982: Biologie <strong>und</strong> Verhalten der Libellen an norddeutschen Stillgewäs-<br />
sern - Hausarbeit zur wissenschaftlichen Prüfung <strong>für</strong> das Lehramt an Gymnasien. - Universität<br />
Hamburg.<br />
OHNESORGE, D., 1988: Die Libellenfauna (Odonatal der Kiesgrube Barkholz (Kreis Stor-<br />
mann, Schleswig-Holstein). - Seevögel (Zeitschrift des Verein Jordsand zum Schutze der<br />
Seevögel <strong>und</strong> der Natur e. V.) 912): 17-25.<br />
OTT, J., 1995: Crocothemis erythraea - an indicator for climatic change? - Vortrag auf dem<br />
XIII. Int. Symp. Odonatology Essen, Aug. 1995.<br />
OTT, J., 1996 a: Aktuelle Bestandsveränderungen in der Odonatenfauna Deutschlands <strong>und</strong><br />
Europas als Auswirkungen einer Klimaveränderung? - Vortrag auf der 15. Jahrestg. der<br />
GdO in Berlin, März 1996.<br />
OTT, J., 1996 b: Zeigt die Ausbreitung der Feuerlibelle in Deutschland eine Klimaverände-<br />
rung an? - Naturschutz u. Landschaftsplanung 28121: 53-61.<br />
PAPE, R., 1975: Red area book: Alsterniederung. - DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Natur-<br />
beobachtung) Naturk<strong>und</strong>liches Jahrbuch 1211975/761: 113-122.<br />
PETERS, G., 1987: Die Edellibellen Europas. - Neue Brehm Bücherei 585, Ziemsen-Verlag.<br />
Wittenberg, Lutherstadt.<br />
PEUS, F., 1932: Die Tierwelt der Moore unter besonderer Berücksichtigung der europäischen<br />
Hochmoore. Berlin.<br />
PIX, A., 1994: Sympetrum fonscolombei SELYS 1848 mit zwei Generationen eines Jahres<br />
neben Orthetrum brunneum FONSCOLOMBE 1837 (Insecta: Odonata: Libellulidae) in<br />
Abbaugruben Südniedersachsens <strong>und</strong> Nordhessens. - Göttinger Naturk<strong>und</strong>liche Schrif-<br />
ten: 89-96.<br />
PLACHTER, H., 1985: Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Sandstandorten des<br />
unteren Brombachtales (Bayern) <strong>und</strong> ihre Bewertung aus Sicht des Naturschutzes. - Ber.<br />
ANL 9: 45-92.<br />
POPPERL, R., 1992: Die Besiedlung <strong>und</strong> Vergesellschaftung der Makroinvertebraten in<br />
einem Seeabfluß des Norddeutschen Tieflandes, der Alten Schwentine zwischen Belauer<br />
<strong>und</strong> Stolper See (Schleswig-Holstein). - Drosera 92(21: 189-206.<br />
RIECKEN, U., U. RIES & A. SYMANK, 1994: Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. - Schriftenreihe f. Landschaftspflege u. Naturschutz 41,<br />
Kilda-Verlag, Greven.<br />
ROBERT, P.-A., 1959: Die Libellen (Odonata). - Verlag Kümmerly & Frey, Bern.<br />
ROSENBOHM, A., 1928: Die Libellenfauna von Schleswig-Holstein <strong>und</strong> Hamburg, auf<br />
Gr<strong>und</strong> der Literaturangaben zusammengestellt. - Schriften d. Naturwiss. Ver. f. Schleswig-<br />
Holstein 1812): 463-470.<br />
ROSENBOHM, A., 1931: Die Libellenfauna der Umgebung von Hamburg. - Verh. Ver.<br />
naturw. Heimatforsch. Hamburg 23: 114-127.<br />
ROSENBOHM, A., 1951 a: Bemerkungen zur Libellenfauna Schleswig-Holsteins <strong>und</strong> des<br />
Niederelbegebietes. - Mitt. Faun. Arbeitsgem. Schleswig-Holstein, Hbg. u. Lüb. (N.F.) 412):<br />
27-29.<br />
ROSENBOHM, A., 1951 b: Die Libellenfauna des Hopfenbacher Moores bei Ahrensburg. -<br />
Mitt. Faun. Arbeitsgem. Schleswig-Holstein, Hbg. u. Lüb. (N.F.) 4131: 53-54.<br />
ROSENBOHM, A., 1953: Bericht über den ornithologischen <strong>und</strong> entomologischen Ausflug<br />
der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft am 31. Mai 1953 nach dem Oldenburger <strong>und</strong><br />
Bannauer Moor (b. Lehmrade in Lauenburg). - Mitt. Faun. Arbeitsgem. Schleswig-<br />
Holstein, Hbg. u. Lüb. (N.F.) 6: 58.<br />
RUDOLPH, R., 1979: Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Libellenzönosen von<br />
sechs Kleingewässern im Münsterland. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster Westf. 41111:<br />
3-28.<br />
RUDOLPH, R., 1980: Die Ausbreitung der Libelle Gomphus pulchellus Selys 1840 in Westeuropa.<br />
- Drosera '80121: 63-66.<br />
RUDOLPH, R., 1984: Ergänzungen zur Libellenfauna deutscher Nordseeinseln. - Libellula<br />
313/4): 91-92.<br />
RÜHM, W. & W. PIPER, 1989: Simuliidenlarven <strong>und</strong> -puppen als Beute räuberisch leben-<br />
der Tierarten in Alster, Bille <strong>und</strong> Seeve (Diptera, Simuliidae). - Entomol. Mitt. Zool. Mus.<br />
Hamburg 91136/137): 283-293.<br />
169
170<br />
SAAGER, H., 1977: Die Libellen der Umgebung Lübecks. - Ber. Ver. H. Nat. His. Mus.<br />
Lübeck: 64-67.<br />
SCHEFFLER, W., 1970: Die Odonatenfauna der Waldmoore des Stechlinseegebietes. - Lim-<br />
nologica 7(2): 339 369.<br />
SCHEFFLER, W., 1973: Zur odonatologischen Charakterisierung der Moortypen im Stechlinsen-Gebiet.<br />
- Ent. Ber., Berlin 1973: 1-4.<br />
SCHIEMENZ, H., 1957: Die Libellen unserer Heimat. - Urania-Verlag, Jena.<br />
SCHLENGER, H., K. H. PAFFEN & R. STEWIG (Hrsg.), 1969: Schleswig-Holstein - Ein geo-<br />
graphisch-landesk<strong>und</strong>licher Exkursionsführer. - Schriften des Geographischen Instituts<br />
der Universität Kiel 30.<br />
SCHMIEDEL, J., 1985: Wedeler Kiesgruben. - Naturkdl. Beitr. DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong><br />
<strong>für</strong> Naturbeobachtung) 14: 37-50.<br />
SCHMIEDS, U. J., 1976: Ökologische Studien an Fischen im Schierenseebach - einem<br />
norddeutschen Seeausfluß (Naturpark Westensee, Schleswig-Holstein), Teil I Die Nahrung<br />
des Flußbarsches (Perca fluviatilis L.) - Faun.-ökol. Mitt. 5: 199-205.<br />
SCHMIDT, B., 1991: Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur Libellenfauna (Odonatal<br />
der Streuwiesen im NSG Wolmatinger Ried bei Konstanz. - Naturschutzforum 3/4: 39-80.<br />
SCHMIDT, E., 1961: Zur Lebensweise von Aeshna subarctica Walker (Odonata). - Zool.<br />
Anzeiger 167: 80-82.<br />
SCHMIDT, E., 1964 a: Libelleneinwanderungen ins mittlere Schleswig-Holstein 1963. -<br />
Faun. Mitt. Nordd. 2(5/61: 164.<br />
SCHMIDT, E., 1964 b: Markierungsergebnisse bei der Hochmoorlibelle Aeshna subarctica<br />
Walker 1Odonata). - Faun. Mitt. Nordd. 217/81: 184-186.<br />
SCHMIDT, E., 1964 c: Anax parthenope (Selys) am Großen Plöner See in Schleswig-<br />
Holstein (Odonata). - Faun. Mitt. Nordd. 2(7/8): 202-203.<br />
SCHMIDT, E., 1964 d: Zur Verbreitung <strong>und</strong> Biotopbindung von Aeschna subarctica<br />
WALKER in Schleswig-Holstein (Odonata). - Faun. Mittlg. Nordd. 2(7/8): 197-200.<br />
SCHMIDT, E., 1964 e: Biologisch-ökologische Untersuchungen an Hochmoorlibellen<br />
(Odonata). - Zeitschrift <strong>für</strong> wissenschaftliche Zoologie 16913/41: 313-386.<br />
SCHMIDT, E., 1965: Die Libellenfauna (Odonata) einiger Flachmoore der Umgebung von<br />
Kiel. - Faun. Mitt. Nordd. 2 17/81: 237-249.<br />
SCHMIDT, E., 1966: Die Odonatenfauna des Landesteils Schleswig. - Faun.-ökol. Mittlg.<br />
311/21: 51-66.<br />
SCHMIDT, E., 1971: Ökologische Analyse der Odonatenfauna eines ostholsteinischen Wiesenbaches.<br />
- Faun.-ökol. Mitt. 4: 48-65.<br />
SCHMIDT, E., 1974: Faunistisch-ökologische Analyse der Odonatenfauna der Nordfriesischen<br />
Inseln Amrum, Sylt <strong>und</strong> Föhr. - Faun.-ökol. Mitt. 4: 401-418.<br />
SCHMIDT, E., 1975 a: Aeshna viridis Eversmann in Schleswig-Holstein, B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland (Anisoptera: Aeshnidae). - Odonatologica 4(2): 81-88.<br />
SCHMIDT, E., 1975 b: Die Libellenfauna des Lübecker Raumes. - Ber. Ver. Natur Heimat<br />
Naturh. Mus. Lübeck 13/14: 25-43.<br />
SCHMIDT, E., 1975 c: Zur Libellenfauna zweier Heideweiher bei Flensburg. - Die Heimat<br />
82(7/8): 207-209.<br />
SCHMIDT, E., 1977 a: Ausgestorbene <strong>und</strong> bedrohte Libellenarten in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. - Odonatologica 6(2): 97-103.<br />
SCHMIDT, E., 1977 b: Zur Libellenfauna des Lebrader Moores bei Plön (Holstein). - Faun.-<br />
ökol. Mitt. 5: 119-124.<br />
SCHMIDT, E., 1977 c: Analyse der Libellenverbreitung in Schleswig-Holstein (Norddeutschland,<br />
BRD) am Beispiel der Aeshniden (Odonata).- Verh. des Sechsten Int. Symp.<br />
über Entomofaunistik in Mitteleuropa 1975, Junk, The Hague: 27-42.<br />
SCHMIDT, E., 1977 d: Die Libellen der Mühlenau bei Warder, Kreis Rendsburg-Eckernförde.-<br />
Die Heimat 84(7/8): 219-223.<br />
SCHMIDT, E., 1978 a: Die Verbreitung der Kleinlibelle Coenagrion armatum Charpentier,<br />
1840, in Nordwestdeutschland (Odonata: Coenagrionidae(. - Drosera '78(2): 39-42.<br />
SCHMIDT, E., 1978 b: Okologische Analyse der Odonatenfauna von Schleswig-Holstein. -<br />
Verh. Ges. Okol.: 427.<br />
SCHMIDT, E., 1979: Libellen im Fockbeker Moor.- Rendsburger Jahrbuch, 29: 61-67.<br />
SCHMIDT, E., 1980 a: Das Artenspektrum der Libellen der Insel Helgoland unter dem<br />
Aspekt der F<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Einwanderungswahrscheinlichkeit (Odonata). - Entomologia Gene-<br />
ralfis 6(2/41: 247-250.<br />
SCHMIDT, E., 1980 b: Zur Libellenfauna holsteinischer Seen <strong>und</strong> Teiche (354.). - Bombus<br />
2(67): 266-267.
SCHMIDT, E., 1981: Faunistische Notizen aus nordwestdeutschen Mooren. - Libellula 1(1):<br />
37-38.<br />
SCHMIDT, E., 1984: Gomphus vulgatissimus L. an einem belasteten Havelsee, dem Tege-<br />
ler See (Insel Scharfenberg) in Berlin (West). - Libellula 313/41: 52.<br />
SCHMIDT, E., 1985 a: Suchstrategien <strong>für</strong> unauffällige Odonatenarten. I.: Coenagrion<br />
lunulatum. - Libellula 4(1/2): 32-48.<br />
SCHMIDT, E., 1985 b: Zum Kannibalismus bei mitteleuropäischen Zygopteren. - Libellula<br />
4(1/2): 21-31.<br />
SCHMIDT, E., 1986: Fotonotizen zur Biologie heimischer Odonaten IV. Das Eingraben der<br />
Larve vom Blaupfeil (Orthetrum cancellatum). - Libellula 5(1/2): 43-44.<br />
SCHMIDT, E., 1987: Makabre Verstümmelungen bei eierlegenden Kleinlibellen (Odonata -<br />
Coenagrionidae). - Libellula 611/21: 47-49.<br />
SCHMIDT, E., 1988: Zum Status der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) im Lan-<br />
desteil Schleswig. - Faun.-Ökol. Mitt 611/2): 37-42.<br />
SCHMIDT, E., 1989: Zur Odonatenfauna des Hechtmoores in Angeln/Schleswig. - Drosera<br />
8911/2): 31-42.<br />
SCHMIDT, E., 1995: Zur Odonatenfauna des NSG Heidefläche bei Kellinghusen (Störka-<br />
thener Heide), Kreis Steinburg (Holstein). - In: GdO (Hrsg.), 1995: GdO-Tagung 1995 -<br />
Kurzfassungen der Vorträge <strong>und</strong> Poster.<br />
SCHMIDT-MOSER, R., 1986: Die Vogelwelt des Hauke-Haien-Koog. - Seevögel (Zeitschrift<br />
des Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel <strong>und</strong> der Natur e. V.) 7 (Sonderheft): 1-49.<br />
SCHMIDTKE, K.-D., 1992: Die Entstehung Schleswig-Holsteins. - K. Wachholtz, Neumünster.<br />
SCHNITTLER, M., G. LUDWIG, P. PRETSCHER & P. BOYE, 1994: Konzeption der Roten<br />
Listen der in Deutschland gefährdeten Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten - unter Berücksichtigung<br />
der neuen internationalen Kategorien. - Natur <strong>und</strong> Landschaft 691101: 451-459.<br />
SCHORR, M., 1983: Rote Listen - ein Instrument des Libellenschutzes? Eine kritische Wertung<br />
von Roten Listen. - Libellula 2 11/2): 91-103.<br />
SCHORR, M., 1990: Gr<strong>und</strong>lagen zu einem Artenhilfsprogramm Libellen der B<strong>und</strong>esrepu-<br />
blik Deutschland. - Ursus Scientific Publishers, Bilthoven, Niederlande.<br />
SCHROETER, W., 1983: Zu: Bachstelze (Motacilla alba) attackiert Großlibelle (Anisoptera).<br />
- Die Vogelwelt 104161: 225.<br />
SCHUBRING, A., U. STRÖH-NEBEN & F. PÜTZ, 1994: Das Naturschutzgebiet Dosenmoor. -<br />
Amt <strong>für</strong> Natur, <strong>Umwelt</strong> <strong>und</strong> Abfallwirtschaft der Stadt Neumünster - Untere Naturschutz-<br />
behörde, Neumünster.<br />
SERVET, K., 1961: Kopula zwischen Leucorrhinia dubia (W) <strong>und</strong> L. rubic<strong>und</strong>a (M). - Ent.<br />
Zeitschr. (Stuttgart) 71: 172.<br />
SOEFFING, K., 1990 a: Die Aktivitätshöhe von Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a (L., 1758) <strong>und</strong><br />
Libellula quadrimaculata L., 1758, als Mechanismus der Artentrennung am Gewässer<br />
(Anisoptera: Libellulidae). - Libellula 913/41: 105-112.<br />
SOEFFING, K., 1990 b: Verhaltensökologie der Libelle Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a (L.)<br />
(Odonata: Libellulidae) unter besonderer Berücksichtigung nahrungsökologischer<br />
Aspekte - Dissertation. - Universität Hamburg.<br />
SOEFFING, K., 1991: Die Bedeutung der Torfmoose <strong>für</strong> die Ontogenie von Leucorrhinia<br />
rubic<strong>und</strong>a (LINNAEUS, 1758) (Odonata: Libellulidae). - Seevögel (Zeitschrift des Verein<br />
Jordsand zum Schutze der Seevögel <strong>und</strong> der Natur e. V.) 12(Sonderheft 1): 109-110.<br />
STARK, W., 1976: Die Libellen der Steiermark <strong>und</strong> des Neusiedler Sees in monographi-<br />
scher Sicht. - Inaug. Diss Uni. Graz.<br />
STECHMANN, D.-H., 1976: Zur Phänologie <strong>und</strong> zum Wirtsspektrum einiger Zygopteren<br />
(Odonata) <strong>und</strong> Nematoceren (Diptera) ektoparasitisch auftretenden Arrenurus-Arten<br />
(Hydrachnellae, Acari).- Z. ang. Ent. 82(1976/77): 349-355.<br />
STEINER, H., 1948: Die Bindung der Hochmoorlibelle Leucorrhinia dubia Vand. an ihren<br />
Biotop. - Zool. Jahrb. (Systematik) 78111: 65-96.<br />
STERNBERG, K., 1993: Bedeutung der Temperatur <strong>für</strong> die (Hoch-)Moorbindung der Moor-<br />
libellen (Odonata: Anisoptera). - Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent. 8: 521-527.<br />
STOBBE, H., 1970: Der Odonatenbestand des Kiebitzmoores im Jahre 1969. Informatio-<br />
nen zur ökologischen Entomologie. - Naturkdl. Beitr. DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong><br />
Naturbeobachtung) 1: 78-86.<br />
STÖCKEL, G., 1983: Zur derzeitigen Verbreitung von Sympetrum pedemontanum<br />
ALLIONI (Odonata) in der DDR. - Ent. Nachr. Ber. 27(6): 261-266.<br />
ST. QUENTIN, D., 1960: Die Odonatenfauna Europas, ihre Zusammensetzung <strong>und</strong> Her-<br />
kunft. - Zool. Jahrb., Systematik 87130): 301-316.<br />
171
172<br />
SUHLING, F. & 0. MÜLLER, 1996: Die Flußjungfern Europas. Die Libellen Europas 2. -<br />
Neue Brehm-Bücherei 628: 1-237, Westarp-Wiss., Magdeburg; Spektrum Akad. Verl., Hei-<br />
delberg.<br />
TAMM, J., 1982: Beobachtungen zur Okologie <strong>und</strong> Ethologie von Sympetrum<br />
pedemontanum ALLIONI (Insecta, Odonata) anläßlich seiner Wiederentdeckung in<br />
Hessen. - Hess. Faun. Briefe 2: 20-29.<br />
TECH, H. J., 1977: Das Naturschutzgebiet Geltinger Birk - Lebensraum <strong>für</strong> Entenvögel?. -<br />
Die Heimat 84: 226-231.<br />
THOMES, A., 1985: Ökologische Beobachtungen an den Libellen (Odonata, Insecta) des<br />
Unteren Schierenseebaches (Naturpark Westensee, Schleswig-Holstein) - Diplomarbeit<br />
aus dem Zoologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität Kiel.<br />
THOMES, A., 1987: Auswirkungen anthropogener Veränderungen eines norddeutschen<br />
Tieflandbaches auf die Libellenfauna. - Limnologica 18(2): 253-268.<br />
TIMM, W., 1901: Zur Lebensweise des Agrion najas oder der Wasser-Schlankjungfer. - Die<br />
Heimat 11: 116-118.<br />
TIMM, W., 1902: Dämmerungsflieger unter den einheimischen Libellen. - Insekten-Börse,<br />
19(23): 188-189.<br />
TIMM, W., 1906: Verzeichnis der in der Umgegend von Hamburg vorkommenden<br />
Odonaten. - Insekten-Börse, 23: 134-135, 140, 147-148, 151, 155.<br />
ULMER, G., 1904: Zur Fauna des Eppendorfer Moores bei Hamburg. - Verh. naturw. Ver.<br />
Hamb. 11(3): 1-25.<br />
UMWELTAMT DER STADT LÜBECK, 1989: Regionale Rote Liste Lübeck. Tagfalter, Libellen,<br />
Heuschrecken. - <strong>Umwelt</strong>amt der Stadt Lübeck, Untere Landschaftspflegebehörde: 24-33.<br />
VALLE, K.J., 1938: Zur Okologie der finnischen Odonaten. - Ann. Univ. Turkuensis A 61141:<br />
1-76.<br />
VÖLKER, H., 1970: Vorkommen von Cordulegaster annulatus (Odonatal im Kreis Burgdorf/Hannover,<br />
zugleich ein Beitrag zur Biologie, Ethologie <strong>und</strong> Ökologie dieser Großli-<br />
belle. - Ber. Naturhist. Ges. 114: 91-98.<br />
VÖLKER, R., V. MAUSS, C. SCHLORF, M. SCHLORF & K. LUTZ, 1984: Kollauniederung<br />
Nord 1982. - Naturkdl. Beitr. DJN (Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbeobachtung) 12: 37-52.<br />
WASSCHER, M., 1990: Lijst van bedreigde en uitgestorven libellesoorten in Nederland<br />
(Odonato). - Ent. Ber., Amsterdam 50: 81-83.<br />
WASSCHER, M., R. KETELAAR, M. VAN DER WEIDE, A. STROO, V. KALKMAN,<br />
N. DINGEMANSE, H. INBERG & I. TIELEMAN, 1995: Verspreidingsgegevens van de<br />
Nederlandse libellen. - Bijlage bij Nieuwsbrief EIS-Nederland 23.<br />
WEISS, V., 1947: Bemerkenswerte Libellenf<strong>und</strong>e in Nordwestdeutschland. - Bombus -<br />
Faun. Mitt. Nordwestdeutschland 35: 153-154.<br />
WENDLER, A. & J.-H. NUSS, 1991: Libellen. - DJN - Deutscher Jugendb<strong>und</strong> <strong>für</strong> Naturbe-<br />
obachtung (Hrsg.), Hamburg.<br />
WIEBUSCH, H. & T. HEINBOCKEL, 1983: Die Libellen der Stader Geest - Verbreitung,<br />
Gefährdung, Schutz. - Eigenverlag.<br />
WILDERMUTH, H., 1980: Die Libellen der Drumlinlandschaft im Zürcher Oberland. - Vier-<br />
teljahrsschr. Naturf. Ges Zürich 125131: 201-237.<br />
WILDERMUTH, H., 1994: Habitatselektion bei Libellen. - Adv. Odonatol. 6: 223-257<br />
WINKLER, W., 1948: Wanderzug von Libellen bei Kiel. - Mitt. Faun. Arbeitsgem. Schles-<br />
wig-Holstein, Hbg. u. Lüb. (N.F.) 117 ► : 67.<br />
WRIEDT, S. & M. SCHÖN, 1980: Zur Kenntnis der Libellenfauna eines Weihers bei Preetz. -<br />
Die Heimat 87(11/12): 433.<br />
WRIEDT, S. & M. SCHÖN, 1983: Die Libellenfauna des Kolksees. - Die Heimat 90: 356-358.<br />
ZACHAU, A., 1961: Fauvistische Notizen II. - Faun. Mitt. Nordd. 2(1): 14-21.<br />
ZESSIN, W.K.G. & D.G.W. KÖNIGSTEDT, 1993: Rote Liste der gefährdeten Libellen Mecklenburg-Vorpommerns.<br />
- Der <strong>Umwelt</strong>minister des Landes Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Schwerin.<br />
ZIEBELL, S. & T. BENKEN, 1982: Zur Libellenfauna in West-Niedersachsen (Odonata). -<br />
Drosera '82(2): 135-150.<br />
ZIMMERMANN, K., 1935: Zur Fauna von Sylt. - Naturw. Ver. Schleswig-Holstein 21: 274-286.<br />
ZIMMERMANN, W. & D. MEY, 1993: Rote Liste der Libellen (Odonata) Thüringens. - In:<br />
Rote Listen Thüringens. - Naturschutzreport 5: 59-62.
Glossar<br />
Ab<strong>und</strong>anz - Häufigkeit von Individuen, seltener von Arten, auf ein Flächen- oder Raumeinheit<br />
adriatomediterran - geographische Zuordnung zu einemAusbreitungszentrum (vergleiche Abbildung 8)<br />
Adventivart - eine Art, die ursprünglich im Gebiet nicht heimisch war oder ist <strong>und</strong> sich vorübergehend<br />
oder ständig eingebürgert hat<br />
Anisoptera - Großlibelle<br />
anthropogen - vom Menschen geschaffen, beeinflußt oder verändert<br />
Appetenz Neigung; hier: die Neigung zu Ortsveränderungen zwecks Partner- <strong>und</strong>/oder Gewässersuche<br />
zur Fortpflanzung<br />
Areal - das Siedlungsgebiet einer taxonomischen Einheit (zum Beispiel einer Art)<br />
astatisch - bezüglich lebender als auch lebloser Einflüsse stetig veränderlich<br />
atlantomediterran geographische Zuordnung zu einem Ausbreitungszentrum (vergleiche Abbildung 8)<br />
Abbildung 8: Ausbreitungszentren europäischer Libellenarten.<br />
Abbildungserklärung: A = mediterranes Erhaltungszentrum, Al = atlantomediterranes<br />
Sek<strong>und</strong>ärzentrum, A2 = adriatomediterranes Sek<strong>und</strong>ärzentrum, A3 = pontomediterranes<br />
Sek<strong>und</strong>ärzentrum; 8 = saharosindhisches Ausbreitungszentrum; C = sibirisches Entste-<br />
hungs- <strong>und</strong> Expansionszentrum mit eurosibirischem Sek<strong>und</strong>ärzentrum (vergleiche auch<br />
LATTIN 1967)<br />
autochton bodenständig; im selben Gebiet entstanden oder heimisch<br />
Biotop - ein durch charakterstische Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten gekennzeichneter Lebensraum<br />
circumboreal - Bezeichnung <strong>für</strong> ein Vorkommen, rings um den Nordpol in der Nadelwaldzone Eurasiens<br />
<strong>und</strong> Nordamerikas<br />
circumpolar - annähernd zusammenhängend auf den Nordkontinenten verbreitet<br />
disjunkt - diskontinuierlich, unterbrochen<br />
dispergieren - sich verteilen, wandern<br />
dispers - zerstreut verbreitet<br />
Dispersal - Vorgang mit dem sich Organismen von ihrem Ursprungsort entfernen; Ausbreitung,<br />
Wanderung<br />
Dispersion - Verteilungsmuster von Individuen einer Population; biographische Verteilung von Individuen<br />
<strong>und</strong> Populationen einer Art in ihrem Areal<br />
dystroph - nährstoffarm; Humusgewässer mit sehr geringem Kalk- aber hohem Humusgehalt<br />
ephemer - kurzlebig, vorübergehend<br />
Epipotamal - obere Zone (Barbenregion) eines Tieflandflusses<br />
eurosibirisch - geographische Zuordnung zu einem Ausbreitungszentrum (vergleiche Abbildung 8)<br />
euryök - verbreitet vorkommend; nicht an bestimmte <strong>Umwelt</strong>verhältnisse geb<strong>und</strong>en<br />
eurytherm - keine besonderen Ansprüche an die Temperatur stellend<br />
eurytop - in vielen Lebensräumen vorkommend<br />
eutroph - nährstoffreich<br />
173
Faunenkreis - Gruppe von Arten, deren oft unterschiedlich umgrenzte Areale sich in einem Kerngebiet<br />
(Ausbreitungszentrum) überschneiden<br />
Fluktuation - das Wandern, aber auch Abwandern von Tieren in andere Gebiete<br />
highest steady density- „höchste stabile Dichte"; Verfahren zur Ermittlung der wahrscheinlichen Siedlungs<br />
dichte einer Population nach MOORE (1991)<br />
Holarktis - das die nördliche Polarzone umfassende tier- <strong>und</strong> pflanzengeographische Gebiet; die<br />
Holarktis ist in drei Unterregionen aufgeteilt<br />
holomediterran - das gesamte mediterrane Ausbreitungszentrum betreffend (vergleiche Abbildung 8)<br />
Hyporhithral - untere Zone (Aschenregion) eines Baches<br />
indigen - einheimisch <strong>und</strong> im betreffenden Gebiet bodenständig<br />
mesotroph - einen mittleren Nährstoffgehalt betreffend; bei Gewässern mineralsalzarm<br />
Migration - Wanderung, die unter anderem einen Genfluß verursachen kann<br />
Odonata - Libellen<br />
oligotroph - nährstoffarm -<br />
Paläarktis -Tiergeografisches Gebiet, das das außertropische Eurasien, Nordafrika <strong>und</strong> den größten<br />
Teil Arabiens umfaßt<br />
pontomediterran - geographische Zuordnung zu einem Ausbreitungszentrum (vergleiche Abbildung 8)<br />
Population - Gesamtheit der an einem Ort vorkommenden Individuen einer Art<br />
Regression - Rückzug einer Art; meist bezieht sich der Begriff auf Arealeinengungen aufgr<strong>und</strong> klima-<br />
tischer Veränderungen<br />
rezent - in der jetzigen Zeit vorkommend<br />
saharosindhisch - geographische Zuordnung zu einem Ausbreitungszentrum (vergleiche Abbildung 8)<br />
sibirisch - geographische Zuordnung zu einem Ausbreitungszentrum (vergleiche Abbildung 8)<br />
stenök - an ganz bestimmte <strong>Umwelt</strong>verhältnisse geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> an ökologische Ansprüche<br />
spezialisiert<br />
stenotop - nur in einem oder wenigen Lebensräumen vorkommend<br />
submers - untergetaucht (Wasserpflanzen)<br />
sympatrisch - im gleichen Gebiet lebend<br />
temporäre Gewässer - zeitweilig trockenfallende Gewässer<br />
thermophil - wärmeliebend<br />
Trophiegrad - der Grad der Intensität der Nährstoffproduktion<br />
tyrphobiont - Arten, deren Vorkommen auf Hochmoore beschränkt sind<br />
tyrphophil - Hochmoore bevorzugend<br />
ubiquitär - fast überall vorkommend<br />
UTM-Gitter - Universale Transversale Mercatorprojektion; geographisches Verfahren der Rasterauf-<br />
teilung<br />
Vagilität, vagil - Neigung zum Umherstreifen oder Wandern; Neigung zur Ausbreitung<br />
Zygoptera - Kleinlibellen<br />
174<br />
in Anlehnung an: HENTSCHEL, E. & G. WAGNER, 1984: Zoologisches Wörterbuch<br />
(Gustav Fischer Verl., Jena) <strong>und</strong> Sedlag, U. & E. Weinert, 1987: Wörterbuch der Biologie-<br />
Biographie, Artbildung, Evolution (Gustav Fischer Verlag, Jena)
Melderin:<br />
Name:<br />
Straße:<br />
Ort:<br />
Erfassungsbogen Libellen<br />
<strong>für</strong> Schleswig-Holstein<br />
Tel.: Datum:<br />
Datum der Beobachtungen'<br />
F<strong>und</strong>ort:<br />
Koordinaten' :<br />
F<strong>und</strong>ortbeschreibung: Landschaftsteil: Inseln, Marsch <strong>und</strong> Küste Geest Hügelland<br />
Gewässertyp:<br />
Quelle See Fischteich<br />
Jahr<br />
Bach Weiher Rückhaltebecken<br />
Fluß Tümpel Ziergewässer / Gartenteich<br />
Altarm Teich Graben<br />
Mündung in See Moorgewässer Kanal<br />
Torfstich Brackwasser<br />
Abbaugewässer<br />
Charakteristika, Vegetation (Gewässer / Ufer):<br />
fließend kalkarm naturnah Röhricht<br />
sommerwarm<br />
sommerkalt<br />
kalkreich<br />
oligotroph<br />
naturfern<br />
Ufer flach<br />
Schwimmblattvegetation<br />
Unterwasservegetation<br />
stehend mesotroph Ufer steil Schwingrasen / Torfmoose<br />
temporär eutroph künstlich eingefaßt Naßwiese<br />
verlandend dystroph vegetationsfrei<br />
vegetationsarm<br />
vegetationsreich<br />
Hochstaudenflur<br />
Zygoptera<br />
Art<br />
Calopteryx splendens<br />
Calopteryx virgo<br />
Lestes barbarus<br />
Lestes dryas<br />
Lestes sponsa<br />
Lestes virens<br />
Lestes viridis<br />
Sympecma fusca<br />
Platycnemis pennipes<br />
Coenagrion armatum<br />
Coenagrion hastulatum<br />
Coenagrion lunulatum<br />
Coenagrion puella<br />
Coenagrion pulchellum<br />
Häufigkeit3<br />
1 2-5 6-20 21-50 > 50 b<br />
Status°<br />
vb nb kA<br />
Bemerkungen<br />
nur falls vorhanden<br />
2 pro Ort <strong>und</strong> Jahr können mehrere Beobachtungstage eingetragen werden; dann immer höchste Häufigkeit <strong>und</strong><br />
Status<br />
3 in Klassen nach Individuenzahlen<br />
° b = bodenständig (Larve, Exuvie, Schlupf), vb = vermutlich bodenständig (Balz, Kopula, Paarungskette, Eiablage<br />
etc.). nb = nicht bodenständig. kA = keine Angabe<br />
175
Art<br />
Enallagma cyathigerum<br />
Erythromma najas<br />
Erythromma viridulum<br />
Ischnura elegans<br />
Ischnura pumilio<br />
Pyrrhosoma nymphula<br />
Anisoptera<br />
Aeshna cyanea<br />
Aeshna grandis<br />
Aeshna isosceles<br />
Aeshna juncea<br />
Aeshna mixta<br />
Aeshna subarctica<br />
Aeshna viridis<br />
Anax imperator<br />
Brachytron pratense<br />
Gomphus vulgatissimus<br />
Cordulegaster boltonii<br />
Cordulia aenea<br />
<strong>Somatochlora</strong><br />
flavomaculata<br />
<strong>Somatochlora</strong> <strong>metallica</strong><br />
Leucorrhinia dubia<br />
Leucorrhinia pectoralis<br />
Leucorrhinia rubic<strong>und</strong>a<br />
Libellula depressa<br />
Libellula fulva<br />
Libellula quadrimaculata<br />
Orthetrum cancellatum<br />
Sympetrum danae<br />
Sympetrum flaveolum<br />
Sympetrum<br />
pedemontanum<br />
Sympetrum sanguineum<br />
Sympetrum striolatum<br />
Sympetrum vulgatum<br />
Raum <strong>für</strong> Anmerkungen:<br />
Häufigkeit'<br />
1 2-5 6-20 21-50 > 50 b<br />
Status'<br />
vb rtb kA<br />
Meldebogen bitte selbst vervielfältigen <strong>und</strong> die ausgefüllten Bögen senden an:<br />
<strong>Landesamt</strong> <strong>für</strong> Natur <strong>und</strong> <strong>Umwelt</strong> des Landes Schleswig-Holstein<br />
Abteilung Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek<br />
Bemerkungen<br />
in Klassen nach Individuenzahlen<br />
' b = bodenständig (Larve, Exuvie, Schlupf), vb = vermutlich bodenständig (Balz, Kopula, Paarungskette, Eiablage<br />
etc.(. nb = nicht bodenständia. kA = keine Anaabe<br />
176
Anschriften der Verfasser<br />
► Dr. Vilmut Brock<br />
Heidekamp 7<br />
21256 Handeloh<br />
► Joachim Hoffmann<br />
Eidelstedter Weg 15<br />
20255 Hamburg<br />
► Olaf Kuhnast<br />
Lauenburger Straße 76<br />
21502 Geesthacht<br />
► Werner Piper<br />
Unnastraße 6<br />
20253 Hamburg<br />
► Klaus Voß<br />
Rendsburger Landstraße 382a<br />
24111 Kiel