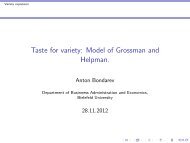4 Das Job Definition Format
4 Das Job Definition Format
4 Das Job Definition Format
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
– eine XML-basierte Skriptsprache<br />
für die Druckindustrie –<br />
Eine Fallstudie<br />
Diplom-Hausarbeit<br />
an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie in Leer e.V.<br />
von<br />
Peter Hilbrands<br />
26826 Weener, Beerumer Weg 5<br />
Betreuung:<br />
Prof. Dr. Ing. Thorsten Spitta (i.R.)<br />
2010
VWA Leer e.V. Verzeichnisse<br />
I<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................................III<br />
1 Einleitung ......................................................................................................................1<br />
2 <strong>Das</strong> Umfeld (Druckerei) ...............................................................................................2<br />
2.1 Aufgaben/Funktionen ...................................................................................................2<br />
2.2 Betriebliche Prozesse ....................................................................................................2<br />
2.3 Daten und Informationen ..............................................................................................4<br />
2.3.1 Objekt-/Datentypen .......................................................................................................4<br />
2.3.2 Grundobjektdaten .........................................................................................................5<br />
2.3.3 Vorgangsobjektdaten .....................................................................................................6<br />
2.4 Anwendungssysteme ....................................................................................................6<br />
2.4.1 Datenaustausch .............................................................................................................6<br />
2.4.2 Auftragsbearbeitung .....................................................................................................7<br />
2.4.3 Druckvorstufe (Satzherstellung und Bogenmontage) ...................................................7<br />
2.4.4 Druck ............................................................................................................................7<br />
2.4.5 Weiterverarbeitung ........................................................................................................7<br />
3 Betriebswirtschaftlicher Bezug .....................................................................................8<br />
3.1 Transaktionskosten .......................................................................................................8<br />
3.2 Prozesskostenanalyse ....................................................................................................8<br />
3.3 Prozessintegration .........................................................................................................9<br />
3.3.1 Nutzen-Überblick .........................................................................................................9<br />
3.3.2 Erforderliche Investitionen .........................................................................................10<br />
3.3.3 Personelle Investitionen ..............................................................................................11<br />
4 <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong> ..........................................................................................12<br />
4.1 Grundidee ...................................................................................................................12<br />
4.2 Erstellung einer <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> ...................................................................................12<br />
4.3 Funktionsweise des JDF .............................................................................................14<br />
4.3.1 XML als Basis.............................................................................................................14<br />
4.3.2 <strong>Format</strong> und Sprache ...................................................................................................17<br />
4.3.3 Skriptsprache ..............................................................................................................17<br />
4.4 <strong>Das</strong> CIP4-Konsortium ................................................................................................19<br />
4.4.1 Aufgaben .....................................................................................................................19<br />
4.4.2 Spezifikationen ...........................................................................................................19<br />
4.5 Aufbau des JDF ..........................................................................................................22<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Verzeichnisse<br />
II<br />
4.5.1 Nodes ..........................................................................................................................22<br />
4.5.2 Ressourcen ..................................................................................................................23<br />
4.5.3 Machines, Devices, Agents und Controller ................................................................23<br />
4.5.4 <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> Messaging <strong>Format</strong> .........................................................................................24<br />
4.6 Netzwerk und Schnittstelle .........................................................................................25<br />
4.7 Die Verbindung zu den Druckdaten ............................................................................27<br />
4.8 Management Information System ...............................................................................28<br />
5 Voraussetzungen für die Prozessintegration ...............................................................29<br />
5.1 Betrieb insgesamt ........................................................................................................29<br />
5.2 Auftagsmanagement ...................................................................................................29<br />
5.3 Prepress .......................................................................................................................29<br />
5.4 Press ............................................................................................................................30<br />
5.5 Postpress .....................................................................................................................30<br />
6 Fazit ............................................................................................................................32<br />
Literaturverzeichnis ..................................................................................................................34<br />
Anhang ................................................................................................................................35<br />
Erklärung ................................................................................................................................44<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Verzeichnisse<br />
III<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
AMS Anfrage- und Auftragsmanagementsystem<br />
ASCII American Standard Code for Information Interchance<br />
B2B Business to Business<br />
B2C Business to Consumer<br />
CIP4 International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress<br />
CMYK Cyan Magenta Yellow Black<br />
CRM Customer Relationship Management<br />
CTP Computer to Plate<br />
DTD Dokument Typ <strong>Definition</strong><br />
FTP File Transfer Protocol<br />
HTML Hypertext Markup Language<br />
HTTP Hypertext Transfer Protocol<br />
ICC International Color Consortium<br />
ICMP Internet Control Message Protocol<br />
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers<br />
IMAP Internet Message Access Protocol<br />
ISO International Organization for Standardization<br />
JDF <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
JMF <strong>Job</strong> Messaging <strong>Format</strong><br />
LAN Local Area Network<br />
MIS Management Information System<br />
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions<br />
OSI Open Systems Interconnection<br />
PDF Portable Document <strong>Format</strong><br />
POP3 Post Office Protocol<br />
RIP Raster Image Prozessor<br />
RGB Red Green Blue<br />
ROI Return on Investment<br />
SMTP Simple Mail Transfer Protocol<br />
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol<br />
UDP User Datagram Protocol<br />
UML Unified Modeling Language<br />
W3C Wide Web Consortium<br />
XML Extensible Markup Language<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Einleitung<br />
1<br />
1 Einleitung<br />
Für die Auftragsabwicklung in einer Druckerei werden verschiedene Anwendungssysteme aus<br />
den unterschiedlichsten Funktionsbereichen des Unternehmens eingesetzt.<br />
Betrachtet man den einzelnen Auftrag und die dazugehörigen betrieblichen Prozesse, wird deutlich,<br />
dass eine Verbindung bzw. Vernetzung der Bereiche sinnvoll ist. Ziel muss es also zum<br />
einen sein, eine „Schnittstelle“ zwischen den einzelnen und sehr unterschiedlichen Anwendungssystemen<br />
einer Druckerei zu finden, um einen Datenaustausch zu ermöglichen und somit<br />
betriebliche Prozesse zu verbinden – unabhängig von Plattformen, den einzelnen Programmen<br />
oder den Software-/Hardware-Herstellern.<br />
Ein weiteres Ziel ist das Speichern aller auftragsrelevanten Daten in einer gemeinsamen Datei,<br />
die – ähnlich wie eine Auftragstasche – sämtliche Auftragsinformationen enthält. Jede Abteilung<br />
erhält genau die Daten, die von Bedeutung für die Erstellung sind.<br />
<strong>Das</strong> auf XML basierte <strong>Job</strong>-<strong>Definition</strong>-<strong>Format</strong> setzt genau hier an.<br />
Diese Diplomarbeit soll Einblicke in die Funktionsweise und die Möglichkeiten des JDF geben.<br />
Außerdem sollen Antworten gefunden werden auf die technischen wie auch betriebswirtschaftlichen<br />
Fragen. Dieses geschieht am Beispiel einer mittelständischen Druckerei, der Johannesburg-<br />
Druck in Surwold.<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> Umfeld<br />
2<br />
2 <strong>Das</strong> Umfeld (Druckerei)<br />
Um einen Überblick über den Arbeitsablauf bzw. Workflow einer Druckerei im Allgemeinen<br />
und konkret der Johannesburg-Druck zu erhalten, erfolgt zunächst eine kurze Beschreibung der<br />
Strukturen und der Abläufe des Unternehmens:<br />
Die mittelständische Druckerei (ca. 10 Mitarbeiter) der Johannesburg GmbH 1 in Surwold erstellt<br />
Akzidenzen im Digital- und im Offsetdruck bis zum <strong>Format</strong> 70 x 50 cm. Dabei kann es sich<br />
um Visitenkarten, Briefbögen, Plakate, aber auch um Broschüren, Bücher usw. handeln. Zu den<br />
Kunden gehören neben Privatpersonen auch kleinere Unternehmen und Werbeagenturen aus<br />
der Region.<br />
2.1 Aufgaben/Funktionen<br />
Die anstehenden Aufgaben/Funktionen bilden die Grundlage für folgende Abteilungen:<br />
● Die Auftragsbearbeitung/das Auftragsmanagement<br />
Kundenberatung, Vorkalkulation, Angebots- und Auftragsbearbeitung, Nachkalkulation usw.<br />
● Die Druckvorstufe (Pre-Press)<br />
Satzherstellung, Prüfung (der sog. „Preflight“), eventuelle Bearbeitung und Interpretation<br />
von gelieferten Druckdaten,<br />
digitale Bogenmontage (Zusammenstellung der einzelnen Seiten zu einer Druckform),<br />
CTP-Plattenkopie (per Laserlicht wird die digitale Druckform auf die Druckplatte belichtet)<br />
● Der Druck (Press)<br />
Dabei kommen zwei Technologien zum Einsatz: Kleinere Druckauflagen werden direkt<br />
(ohne Druckplatte) mit einer Digitaldruckmaschine (Farb-Laserdrucker mit Trockentoner)<br />
gedruckt; höhere Auflagen produziert man an einer der drei Offsetdruckmaschinen.<br />
● Die Weiterverarbeitung (Post-Press)<br />
Die Druckprodukte werden hier rundum beschnitten, gegebenenfalls gefalzt, zusammengetragen,<br />
rückengeklammert und verpackt.<br />
<strong>Das</strong> Materiallager (Papier) ist traditionell dem Post-Press-Bereich zugeordnet.<br />
● Die Auslieferung erfolgt über Zivildienstleistende und soll hier nicht weiter beachtet werden.<br />
● Weitere (Management-)Aufgaben wie Controlling, Analyse, Jahresabschluss usw. betreffen<br />
die Geschäftsleitung – diese befindet sich aber nicht in den Räumlichkeiten der Druckerei.<br />
(Weitere technische Angaben siehe Anhang 2a)<br />
2.2 Betriebliche Prozesse<br />
Um den betrieblichen Prozess am Beispiel eines Auftrag-Workflows zu verdeutlichen, wird ein<br />
Aktivitätsdiagramm in der Sprache UML verwendet (vgl. [HAN 09, S. 336]).<br />
1 Webseite: http://www.johannesburg.de<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> Umfeld<br />
3<br />
Kunde<br />
[Auftragsdaten]<br />
[Content-Daten]*<br />
Digitaldruck***<br />
Unternehmen (Druckerei)<br />
[Auftrag erteilt]<br />
Auftragsbearbeitung/AMS<br />
Druckvorstufe/Prüfung<br />
[Content-Daten nicht druckbar] **<br />
Digitale Bogenmontage<br />
Weiterverarbeitung<br />
CTP-Druckplattenkopie<br />
Offsetdruck***<br />
Abb. 2.1: UML-Darstellung: Auftragsworkflow als Musterprozess (vereinfacht)<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands<br />
[else]<br />
[Auftrag ausgeliefert]<br />
* Möglich ist auch das Senden der Content-Daten vom Kunden an die Auftragsbearbeitung.<br />
Diese gibt die Daten mit der Auftragstasche an die Druckvorstufe weiter.<br />
** Während die gelieferten Druckdaten noch geprüft werden müssen, kann die Auftragstasche bereits<br />
in die „digitale Bogenmontage“ gegeben werden.<br />
*** Die Materialbeschaffung für den Druck erfolgt entweder auftragsbezogen direkt vom Lieferanten<br />
oder aus dem Papierlager der Weiterverarbeitung (in der Abb. nicht dargestellt).
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> Umfeld<br />
4<br />
Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass der Kunde die eigentlichen Druckdaten selbst<br />
erstellt hat und als PDF-Datei an die Druckerei sendet. Sie werden auch als Content-Daten<br />
bezeichnet. Die Auftrags-Daten beschreiben den Auftrag, enthalten also Angaben wie Auflage,<br />
<strong>Format</strong>, Liefertermin usw (vgl. [KUE 04, S. 5]).<br />
Abbildung 2.1 zeigt neben dem Leistungsfluss (der Content) die Auftragsdaten als Lenkungsfluss<br />
(vgl. [SPI 06, S. 14]).<br />
2.3 Daten und Informationen<br />
Im Gegensatz zu den reinen Daten, die als Einzelwerte in alphabetischer oder numerischer Form<br />
vorliegen können, enthalten Informationen einen Neuigkeitswert für den Empfänger. Die Daten<br />
liefern somit das Medium für die eigentliche aktionsauslösende Botschaft (vgl. [THO 06, S. 51 f.]).<br />
Im Folgenden sollen die auftragsrelevanten Daten genauer betrachtet werden.<br />
2.3.1 Objekt-/Datentypen<br />
Während die eigentlichen Druck- bzw. Content-Daten (also üblicherweise die PDF-Datei vom<br />
Kunden) von der Auftragsannahme bis zur Druckplattenbelichtung unverändert und damit im<br />
originären Zustand bleiben – es sei denn, beim Preflight werden Probleme erkannt und eine<br />
Bearbeitung ist erforderlich – kommt es bei den Auftragsdaten und somit beim Lenkungsfluss<br />
immer wieder zu Konvertierungen und Neueingaben und somit zu Redundanzen.<br />
Wie auch in Abb. 2.1 gezeigt, erfolgt zunächst die Übermittlung der relevanten Daten (alle<br />
Informationen, die den Vorgang „Auftrag“ beschreiben) vom Kunden zur Auftragsbearbeitung<br />
bidirektional per Telefon oder unidirektional und asynchron per E-Mail.<br />
Ist der Auftrag erfolgt, werden die entsprechenden Daten zwar in einer AMS-Software (siehe<br />
auch Kap. 2.4.1) erfasst, die Weitergabe der Auftragsinformationen an die folgenden Abteilungen<br />
erfolgt aber über eine traditionelle Auftragstasche aus Papier mit entsprechenden Angaben für<br />
jede Abteilung (Auftragspapiere siehe auch Anhang 2b).<br />
Der bereits in der Vorkalkulation digital erstellte Standbogen bzw. das Ausschießschema 2 wird<br />
als Laserdruckerausdruck in die „Digitale Bogenmontage“ gegeben, wo die Werte erneut in die<br />
entsprechende Eingabemaske eingegeben werden müssen.<br />
Farbeinstellungen an der Druckmaschine erfolgen durch den Mitarbeiter mit Hilfe von visueller<br />
oder metrischer Messung des Druckbogens.<br />
Zu guter Letzt werden Programme für die Schnittfolge des Druckbogens oder gegebenenfalls<br />
für die Falzmaschine vom Mitarbeiter der „Buchbinderei“ in die entsprechende Maschine eingegeben<br />
– als Vorgabe gilt auch hier ein Ausdruck von der Auftragsbearbeitung.<br />
Die Datentypen in der Printmedienindustrie lassen sich in sieben Bereiche gliedern (vgl. [KUE<br />
04, S. 5]):<br />
2 Der Standbogen legt den genauen Stand und die Abstände der zu druckenden Teile fest; das Ausschießschema<br />
beschreibt die Zusammenstellung der einzelnen Seiten zu einer Druckform (vgl. [KIP 00, S. 556]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> Umfeld<br />
5<br />
● Content-Daten:<br />
die eigentlichen Druckinhalte – Verwendung findet i. d. R. das PDF-<strong>Format</strong> der Fa. Adobe<br />
● Stammdaten (auch Grunddaten):<br />
das datenmäßige Abbild der betrieblichen Ressourcen und der Objekte (vgl. [SPI 06, S. 61]).<br />
● Auftragsdaten:<br />
Beschreibung des Druckauftrages (Vorgangsdaten) wie Auftrags-Nr., Auflagenhöhe usw.<br />
● Produktionsdaten:<br />
Sie definieren den Produktionsprozess zwischen den Anwendungen und den Maschinen<br />
(Beispiel: ICC-Farbprofil) 3 .<br />
● Steuerungsdaten:<br />
Aus den Produktionsdaten werden über Software Steuerungsdaten für die Maschinen.<br />
● Betriebs- und Maschinendaten:<br />
Sie werden direkt aus der Maschine/dem Workflow zur betriebswirtschaftlichen Nutzung<br />
ausgelesen; Betriebsdaten geben Auskunft über Ressourcennutzung und Materialverbrauch.<br />
● Qualitätsdaten:<br />
Messwerte zur Aufrechterhaltung von angestrebten Qualitätsstandards<br />
Die abgeleiteten Daten wie Bestandsdaten (Lagerbestände, Konten), dispositive Daten (z. B.<br />
Plandaten für die Produktion), aber auch informative Daten (aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung<br />
usw.) werden in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.<br />
Am Beispiel dieser Diplomarbeit soll deutlich gemacht werden, welche Grund- und Vorgangsobjektdaten<br />
als Lenkungsfluss für den einzelnen Auftrag benötigt werden.<br />
2.3.2 Grundobjektdaten<br />
Zu jedem Unternehmen gehören Grundobjekttypen wie Gebäude, der Mitarbeiter, der<br />
Lieferant usw. Beleuchtet werden soll aber nur der Kunde in der Rolle des unmittelbaren<br />
Auftraggebers. Hier kann für das Unternehmen der Einsatz eines Kundenmanagementsystems<br />
(engl. Customer Relationship Managementsystem, kurz CRM) sinnvoll sein.<br />
Es unterstützt kundenbezogene Geschäftsmodelle auf allen Ebenen und in allen Phasen.<br />
Dabei wird ein Kundenprofil erstellt, welches alle Eigenschaften erhält, die typisch<br />
für den Kunden und relevant für die Geschäftsbeziehung sind (vgl. [HAN 09, S. 870 ff.]).<br />
Wir beachten nur die Informationen über den Auftraggeber, die für die Lenkung des Druckauftrages<br />
wichtig sind. Diese finden sich auch auf der Auftragstasche wieder.<br />
● Kunden-Nr.: Primärschlüssel, eindeutige Zuordnung des Auftraggebers<br />
● Firma: Name des Kunden/der Firma<br />
● Anschrift: Rechnungsanschrift<br />
● Lieferanschrift: Wohin sollen die Drucksachen geliefert werden?<br />
● Kontaktperson: Ansprechpartner bei etwaigen Rückfragen<br />
● Position: Welche „Rolle“ hat die Kontaktperson im Unternehmen?<br />
3 Ein ICC-Profil beschreibt die Farbcharakteristik/den Farbraum eines Ausgabeprozesses (vgl. [BOE 08, S. 225]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> Umfeld<br />
6<br />
● Telefon: Kontakt zum Ansprechpartner<br />
● Telefax: Kontakt zum Ansprechpartner<br />
● E-Mail: Versenden von Korrekturabzügen<br />
2.3.3 Vorgangsobjektdaten<br />
Für das Beispiel dieser Diplomarbeit fallen u. a. folgende Auftragsdaten an:<br />
● Auftrags-Nr.: AU10-0049<br />
● Liefertermin: 02.08.10<br />
● <strong>Format</strong>: DIN A4 (Beschnittenes Endformat)<br />
● Umfang 4 Seiten Umschlag/48 Seiten Inhalt<br />
● Auflage: 10<br />
● Satzherstellung: PDF-Datei vom Kunden geliefert, auf Drucktauglichkeit prüfen<br />
● Druck: Inhalt 4/0-farbig Europa-Skala 4<br />
● Weiterverarbeitung: Umschlag links gerillt, Klebebindung links, an drei Seiten<br />
glatt beschnitten, CD-Tasche eingeklebt<br />
● Material: Umschlag: Karton 300 g/qm satiniert<br />
Inhalt: Bilderdruck 115 g/qm mattgestrichen<br />
2.4 Anwendungssysteme<br />
Neben den Daten spielen natürlich auch die Hard- und Software, aber auch die Netzwerk- und<br />
die Kommunikationstechnik eine entscheidende Rolle in der IT-Infrastruktur (Anwendungssystem)<br />
eines Unternehmens.<br />
2.4.1 Datenaustausch<br />
Betrachtet man die Kommunikationsstruktur der Druckerei, fällt auf, dass zwar innerhalb einer<br />
Abteilung ein direkter Datenaustausch stattfindet, eine Verbindung zwischen den einzelnen<br />
Abteilungen besteht aber nur per E-Mail, obwohl z. B. zwischen der Auftragsbearbeitung und<br />
der Druckvorstufe ein LAN, also ein kabelgebundendes Netzwerk, vorhanden ist (siehe auch<br />
Anhang 2a). Die Auftragstasche stellt ein Bindeglied dar.<br />
Für die Kommunikation – d. h. den E-Mail-Verkehr, die Kalender- und Adressbuchsynchronisierung<br />
– wird die Open-Source-Software „Horde“ 5 verwendet. Dieses Paket verwendet offene<br />
Standardformate und steht allen beteiligten Abteilungen zur Verfügung.<br />
4 Farbseparation bzw. Zusammensetzung aus den Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz<br />
5 Webseite: http://www.horde.org<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> Umfeld<br />
7<br />
2.4.2 Auftragsbearbeitung<br />
Der erste Kontakt mit dem Kunden wird per Telefon oder E-Mail hergestellt.<br />
Die Vorkalkulation bzw. die komplette Auftragsbearbeitung erfolgt in der branchenspezifischen<br />
AMS-Software „Lector Druck“ der Fa. Lector Computersysteme GmbH 6 . Dabei werden proprietäre<br />
– also herstellerspezifische – Dateiformate eingesetzt.<br />
2.4.3 Druckvorstufe (Satzherstellung und Bogenmontage)<br />
In der Satzherstellung (auch Mediengestaltung genannt) wird das Creativ-Suite-Paket der Fa.<br />
Adobe 7 eingesetzt. Alle enthaltenen Applikationen verwenden jeweils ein geschlossenes und proprietäres<br />
Dateiformat (Allerdings ist ein Export in diverse Standard-Grafik-Dateiformate, aber<br />
auch in ein Austauschformat – z. B. PDF – möglich).<br />
Ist die Datei druckfertig, wird in das PDF-Dateiformat exportiert. Ziel dabei ist, eine Datei zu<br />
schaffen, die unabhängig vom ursprünglichen Anwendungsprogramm, vom Betriebssystem oder<br />
von der Hardware-Plattform originalgetreu weitergegeben werden kann (vgl. [WIKI 10, „PDF“,<br />
28.06.10]).<br />
In der Bogenmontage wird die Ausschießsoftware „Prinect Signastation“ der Fa. Heidelberg 8<br />
eingesetzt. Nachdem der Mitarbeiter die Auftragsdaten eingegeben hat, werden diese in einem<br />
herstellerspezifischen Dateiformat gespeichert und an die „Meta Dimension“ (ebenfalls Fa.<br />
Heidelberg), dem Rechner für die Plattenbelichtung, weitergereicht.<br />
2.4.4 Druck<br />
Kontakt nur per E-Mail, Verbindung zum Kunden nur über Telefon. Auftragsdaten werden durch<br />
die Auftragstasche weitergegeben – eventuelle Änderungen im Prozess werden hier handschriftlich<br />
vermerkt.<br />
2.4.5 Weiterverarbeitung<br />
Kontakt nur per E-Mail, Verbindung zum Kunden nur über Telefon. Auftragsdaten werden durch<br />
die Auftragstasche weitergegeben – eventuelle Änderungen im Prozess werden hier handschriftlich<br />
vermerkt.<br />
6 Webseite: http://www.lector.de<br />
7 Webseite: http://www.adobe.de<br />
8 Webseite: http://www.heidelberg.com<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Betriebswirtschaftlicher Bezug<br />
8<br />
3 Betriebswirtschaftlicher Bezug<br />
Zur Verbesserung des Betriebserfolges muss es auf der Erlösseite zu einer Steigerung der Erträge/<br />
Leistungen und/oder auf der Kostenseite zu einer Reduzierung der Kosten kommen.<br />
Die gezielte Beeinflussung der Kosten (Kostenmanagement) spielt durch veränderte Kostenstrukturen<br />
(z. B. zunehmende Automatisierung und damit Rückgang der Lohneinzelkosten) und<br />
durch den zunehmenden Kostendruck im internationalen Wettbewerb eine immer wichtigere<br />
Rolle. <strong>Das</strong> Management sollte in der Lage sein, auf Basis von entsprechenden Informationen<br />
durch Maßnahmen die Kosten von Produkten, Prozessen und Ressourcen zu beeinflussen (siehe<br />
auch [KLE 06, ab S. 159]).<br />
Dieses Kapitel stellt dar, wie die Geschäftsprozesse die Kosten 9 beinflussen.<br />
3.1 Transaktionskosten<br />
Jeder konkrete Druckauftrag lässt sich auch als Transaktion bezeichnen. Es gibt immer ein<br />
auslösendes (z. B. die Bestellung) und ein abschließendes Ereignis (z. B. die Auslieferung der<br />
Drucksache). Dabei entstehen durch die innerbetrieblichen Prozesse Transaktionskosten. Diese<br />
erhöhen sich noch, wenn vom normalen Bearbeitungsverlauf durch Rückfragen, doppelte Eingaben<br />
usw. abgewichen werden muss und dadurch für die Operationen mehr Zeit verbraucht<br />
wird als für einen Routineprozess nötig (vgl. [SPI 06, S. 22]).<br />
Ebenso kann es zwischen den beteiligten Personen/Abteilungen zu Kommunikationsbedarf,<br />
Verständigungsproblemen, Missverständnissen oder gar zu Konflikten kommen (vgl. [WIKI 10,<br />
„Transaktionskosten“, 01.07.10]).<br />
<strong>Das</strong> betriebswirtschaftliche Ziel muss also sein, diese Kosten möglichst zu senken bzw. gering<br />
zu halten.<br />
3.2 Prozesskostenanalyse<br />
Die Ist-Situation wird mit Hilfe einer Prozesskostenanalyse aufgenommen. Diese Vollkostenrechnung<br />
(Gemeinkosten 10 werden verursachungsgerecht den Kostenträgern zugerechnet) erfasst<br />
alle Prozesse von der Angebotsphase bis zur Auslieferung der Drucksachen. Dabei werden die<br />
Prozessketten bezüglich des organisatorischen und technischen Ablaufes untersucht .<br />
Am Ende einer Analye sind die Kosten eines einzelnen Auftrags in Abhängigkeit mit seiner<br />
Komplexität bekannt. Die Auftragskosten werden dann mit Hilfe einer Zusschlagskalkulation<br />
ermittelt (vgl. [KUE 04, ab S. 77]).<br />
9 Bewerteter, durch Leistungserstellung bedingter Güter- und Dienstleistungsverzehr (wertmäßiger Kostenbegriff)<br />
(vgl. [BET 08, S. 23])<br />
10 Gemeinkosten fallen für mehrere Produkte gemeinsam an, d. h. die direkte Zurechenbarkeit der Kosten auf das<br />
einzelne Produkt ist nicht möglich (vgl. [KLE 06, S. 119]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Betriebswirtschaftlicher Bezug<br />
9<br />
3.3 Prozessintegration<br />
In der Druckerei der Johannesburg GmbH hat sich die IT-Infrastruktur in den einzelnen Bereichen<br />
und Abteilungen unabhängig voneinander entwickelt. Erst durch den Aufbau eines physikalischen<br />
Kabel-Netzwerkes (LAN) war eine Verbindung der einzelnen Anwendungssysteme<br />
technisch möglich.<br />
Es kommt aber nicht nur zwischen den einzelnen Abteilungen der Druckerei zu „Informationsbrüchen“,<br />
sondern auch innerhalb der Bereiche funktioniert die Kommunikation durch die<br />
verschiedenen Softwareapplikationen nicht reibungslos. Diese Prozessineffizienzen spiegeln<br />
sich in den Prozesskosten wider.<br />
Nachdem der Ist-Zustand des Geschäftsprozesses „Auftrag“ beleuchtet worden ist, erfolgt jetzt<br />
ein Blick auf die Verbesserung („Optimierung“) dieses Prozesses. Durch die Prozessintegration<br />
(generierte Auftragsdaten werden für die am Geschäftsprozess beteiligten und vernetzten Abteilungen<br />
verfügbar gemacht) lassen sich die Transaktions- bzw. die Prozesskosten senken (vgl.<br />
[KUE 04, S. 3]). Außerdem führt die Integration aller Prozesse zu einer höheren Effizienz der<br />
Produktionsabläufe, zu mehr Transparenz und einem beschleunigten Auftragsfluss (vgl. [HEI<br />
10, 15.07.10]).<br />
3.3.1 Nutzen-Überblick<br />
Folgende Beispiele sollen den konkreten Nutzen einer Prozessintegration verdeutlichen:<br />
Nutzen durch die Einbindung des Kunden<br />
● Hoher Miteinbezug (z. B. Kunde erfasst bereits auftragsrelevante Daten)<br />
● Transparenz: Kunde erhält Übersicht über benötigte Informationen (z. B. Auftragsverfolgung<br />
über das Internet)<br />
Nutzen der Auftragsbearbeitung:<br />
● Reduzierung der Prozesskosten durch Integration der Bestellprozesse<br />
(Daten aus dem Bestellwesen werden für der Auftragsbearbeitung übernommen, z. B. Angaben<br />
zum Papier, zur Farbe usw..)<br />
● Vermeidung von Ineffizienzen durch doppelte Erfassung von Daten<br />
(Anfrage-, Angebots- bzw. Auftragsdaten usw. werden nur einmal erfasst.)<br />
● Verringerung der Fehlerkosten durch einheitliche Bezeichnungen und aktuelle Auftragsinformationen<br />
(Es findet bereits eine Integritätsprüfung bei der Eingabe der Daten in die Eingabemaske<br />
statt.)<br />
● Verringerung der Auftragsdurchlaufzeiten (Zeitersparnis)<br />
Nutzen für die Druckvorstufe (PrePress)<br />
● Mehr Produktivität vom ersten Schritt bis zum fertigen Druck<br />
● Höhere Verlässlichkeit gegenüber dem Kunden<br />
● Farbtreue Proofs11 (Farbinformationen werden z. T. bereits vom Kunden angelegt und können<br />
in den entsprechenden Bereichen verwendet werden.)<br />
11 Funktion des Proofs (je nach Stellung im Gesamtprozess): Qualitätskontrolle, Qualitätsüberwachung, Verein<br />
barungsdokument zw. Kunde u. Druckerei, Richtnorm für Auflagendruck, Dokumentation (vgl. [KIP 00, S. 508])<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Betriebswirtschaftlicher Bezug<br />
10<br />
Nutzen bei der Maschineneinstellung<br />
● Verringerung der Rüstzeiten (z. B. Steuerung der Druckmaschine: Die Farbzonen müssen<br />
nicht vom Drucker manuell eingestellt werden.)<br />
● Verringerung der Makulatur 12<br />
● Verlagerung der Arbeiten auf wenige Facharbeiter (z. B. an der Prinect Signastation: Kein<br />
erneutes Bearbeiten nötig, da die Ausschießform bereits in der Abteilung „Auftragsbearbeitung“<br />
erstellt worden ist.)<br />
Nutzen für die Produktionsplanung/-steuerung<br />
● Vermeidung von Doppeleingaben<br />
● Vermeidung von Rückfragen zum Produktionsstatus<br />
● Erhöhung der Produktionssicherheit<br />
● Erhöhung der Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens durch bessere Auswertung<br />
Nutzen für die Betriebsdatenerfassung/Nachkalkulation<br />
● Erfassen der tatsächlichen Aufwendungen<br />
● Vermeidung von Doppeleingaben<br />
● Zeitnahes Bereitstellen von Status- und Managementinformationen (nach [KUE 04, ab S. 56])<br />
3.3.2 Erforderliche Investitionen<br />
Neben dem Nutzen spielen für die Unternehmen zwei Kennzahlen eine wichtige Rolle in der Investitionsrechnung:<br />
zum einen die Amortisationsdauer (Dauer, bis die Anschaffungsauszahlung<br />
durch die mit der Investition erzielbaren Einnahmeüberschüsse gedeckt wird (vgl. [BET 08, S.<br />
59]); und zum anderen der Return on Investment (Der ROI ist das Produkt aus Umsatzrentabilität<br />
und Kapitalumschlag (vgl. [KUE 04, S. 66]). Beide Kennzahlen sagen etwas über den Erfolg<br />
einer Investition aus.<br />
Für die Druckerei der Johannesburg GmbH bedeutet eine Vernetzung zusätzliche Investitionen<br />
im Bereich der Software (Die entsprechende Hardware ist vorhanden und ausreichend.):<br />
● Erweiterung der AMS-Software der Fa. Lector um das JDF-Modul (Zwei Lizenzen)<br />
● Erweiterung der Prinect-Software der Fa. Heidelberg in der Druckvorstufe<br />
Außerdem sind folgende Sachinvestitionen erforderlich:<br />
● Verlegung/Erweiterung des Netzwerkes im Drucksaal und in der Weiterverarbeitung<br />
● Nachrüsten der Netzwerkfähigkeit von Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen<br />
(Dieses ist bei den zurzeit vorhandenen Offset-Druckmaschinen aufgrund des Alters nicht<br />
möglich – erst eine Ersatzinvestition würde die Möglichkeit schaffen, ist aber mittelfristig<br />
nicht geplant.)<br />
<strong>Das</strong> Erweitern des Netzwerkes kann durch die EDV-Abteilung der Johannesburg GmbH vorgenommen<br />
werden, die Einbindung der einzelnen Anwendungssysteme muss aber durch Fremdfirmen<br />
erfolgen.<br />
12 Fehldrucke, die beim Einrichten, Anlauf oder Wiederanlauf einer Druckmaschine entstehen (vgl. [KIP 00, S.<br />
949]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Betriebswirtschaftlicher Bezug<br />
11<br />
Auf konkrete Angaben von GE (Geldeinheiten) wie auch auf weiterführende Investitionsrechnungen<br />
soll hier nicht näher eingegangen werden.<br />
Für den Entscheidungsprozess bei einer Investition stellen sich die folgende Fragen (vgl. [BET<br />
08, S. 27]):<br />
● Zielsetzung des Investors – Was will das Unternehmen erreichen?<br />
● Handlungsmöglichkeiten – Welche Investitionen können durchgeführt werden?<br />
● Konsequenzen – Welche Folgen sind zu erwarten, wenn die Investition realisiert wird?<br />
● Bewertung der Investition – Wie sind die Konsequenzen der Alternativen zu beurteilen?<br />
3.3.3 Personelle Investitionen<br />
Personalinvestitionen, d. h. langfristig wirksame Ausgaben für Beschaffung und Ausbildung<br />
(auch Weiterbildungsmaßnahmen wie Schulungen usw.) der betrieblichen Personalausstattung,<br />
sind rechnerisch schwierig zu behandeln, da der Nutzen häufig nicht quantifiziert werden kann<br />
(vgl. [BET 08, S. 44]).<br />
Schulungen über Prozessintegration werden von den Firmen der verwendeten Anwendungssysteme<br />
(Lector Computersysteme GmbH und Heidelberg) durchgeführt. Von einer Weiterbildung<br />
wären zwei Mitarbeiter in der Auftragsbearbeitung und vier Mitarbeiter in der Produktion<br />
(Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung) betroffen.<br />
Es geht aber nicht einfach nur darum, vorhandene Abläufe und Strukturen miteinander zu vernetzen,<br />
sondern vorhandene Organisationsstrukturen mit allen Prozessen kritisch zu hinterfragen<br />
und gegebenenfalls zu verbessern. Nicht sinnvoll wäre die Vernetzung einer unstrukturierten<br />
Ablauforganisation. Es kann durchaus sinnvoll sein, vorhandene – traditionelle – Abläufe oder<br />
Strukturen zu ändern.<br />
Da die Auftragsbearbeitung oder besser das Auftragsmanagement/AMS viel direkter auf die<br />
Produktion wirkt als ohne Vernetzung, müssen die Verantwortungsbereiche neu geregelt werden.<br />
Um die Daten konsistent zu halten, muss klar geregelt sein, wer unter welchen Bedingungen<br />
wann welche Daten ändern darf.<br />
Nach der Analye der Ist-Situation erfolgt die Bedarfsanalye und evtl. die Prozesskostenanalyse.<br />
Im Anschluss wird ein sog. Pflichtenheft erstellt. Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass<br />
die Gesamtvernetzung der Druckerei ca. neun bis zwölf Monate dauert.<br />
Ziel muss es sein, Abläufe und Strukturen zu verbessern, Prozesse zu integrieren und unnötige<br />
Schnittstellen zwecks Kostenreduzierung abzubauen (vgl. [KUE 04, S. 56]). Für eine Investitionsrechnung<br />
sind neben den rein monitären Kenngrößen weitere Faktoren wie die Kapitalbindung<br />
und Interdependenzen (wechselseitige Beeinflussungen) zu berücksichtigen (siehe auch<br />
Kap. 5).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
12<br />
4 <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
Wie lassen sich die verschiedenen Anwendungssysteme einer Druckerei miteinander verknüpfen<br />
bzw. integrieren? Als Bindeglied kann das <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong> (JDF) dienen.<br />
Es enthält die Auftragsdefinition, Prozessanweisungen, kann Produktionsmittel steuern und<br />
kontrollieren und dient der Leistungserfassung. Dieses Kapitel soll das JDF genauer beleuchten<br />
und die Funktionsweise deutlich machen.<br />
4.1 Grundidee<br />
Im Jahr 2000 wurde es von den Firmen Adobe, AGFA, Heidelberg und MAN-Roland präsentiert<br />
(vgl. [LEC 10, 20.07.10]). Sie verfolgten damit die Idee eines einheitlichen, herstellerunabhängigen<br />
und umfassenden Dateiformates für die Druckindustrie (vgl. [KUE 04, S. 23]).<br />
JDF ist ein offenes und standardisiertes Austauschformat; mit ihm lassen sich Auftragsdaten anlegen<br />
und beschreiben, d. h. die Datei enthält alle auftragsrelevanten Grund- und Vorgangsdaten<br />
wie auch alle für den Auftrag erforderlichen Prozessschritte.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Format</strong> gewährleistet eine<br />
● Vernetzung von Anwendungssystemen/Maschinen unterschiedlicher Hersteller<br />
● Verbindung von Administration/Auftragsbearbeitung und Produktion<br />
● Begleitung des Auftrags durch die ganze Prozesskette (elektronische Auftragstasche)<br />
● externe Kommunikation mit Kunden und Lieferanten (vgl. [HOH 07, Folie 14])<br />
4.2 Erstellung einer <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong><br />
Zunächst stellt sich die Frage, von wem und mit welcher Anwendung die JDF-Datei erstellt<br />
werden sollte. Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten:<br />
1. Der Druckauftrag wird von Mitarbeitern in der Auftragsbearbeitung/im Auftragsmanagement<br />
mit Hilfe der AMS-Software (z. B. Lector Druck) erfasst und mit allen relevanten Daten (Grund-<br />
und Vorgangsobjektdaten – siehe Kapitel 2.3.2 und 2.3.3) eingegeben. Hierbei kann eventuell auf<br />
bereits vorhandene Angebotsdaten zugegriffen werden. Technische und auftragsbezogene Fragen<br />
(z. B. verwendete Druckfarben, Papiersorten, verwendete Maschinen usw.) muss der Mitarbeiter/<br />
Disponent klären – ein hohes Maß an Produktionswissen wird deshalb vorausgesetzt (vgl. [KUE<br />
04, S. 80]). Gespeichert wird die JDF-Datei auf dem AMS-Server (siehe auch Anhang 2b).<br />
2. Der Kunde erstellt neben den eigentlichen Content-Daten auch die auftragsbezogenen Vorgangsdaten<br />
und die Stammdaten, d. h. seine eigenen Kundendaten. Dieses erfolgt z. B. in<br />
dem Acrobat-Programm der Fa. Adobe (siehe Anhang 4a).<br />
Neben der eigentlichen Auftragsbeschreibung helfen sog. „Manager“ bei der Dateneingabe:<br />
● Kontakt-Manager: Eingabe aller relevanten Kundendaten wie Adresse, Telefon-Nr. usw.<br />
● Medien-Manager: Eingabe der Medien (z. B. Umschlagkarton und Papier für den Inhalt)<br />
● Auftrags-Manager: Was soll mit der JDF- und der Contentdatei nach Fertigstellung geschehen?<br />
(z. B. das Kopieren aller Dateien in einen Versand-Ordner)<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
13<br />
Unternehmen (Druckerei)<br />
[Auftrag erteilt]<br />
***<br />
Auftragsbearbeitung/AMS mit JDF-Schnittstelle<br />
[Auftragsdaten]*<br />
[Content-Daten]<br />
* Bei den Auftragsdaten kann<br />
es sich bereits um JDF-Daten<br />
handeln, dieses ist aber nicht<br />
unbedingt erforderlich.<br />
** Die Verbindung zwischen AMS-<br />
Server und der entsprechenden<br />
Abteilung erfolgt unidirektional<br />
und asynchron. In Richtung<br />
AMS wird die Verbindung mit<br />
Hilfe vom JMF aufgebaut<br />
(siehe auch Kapitel 4.5.4).<br />
**<br />
Druckvorstufe/<br />
Prüfung<br />
[Content-Daten nicht OK]<br />
[else]<br />
* Möglich ist auch das Senden der Contentdaten vom Kunden an die Auftragsbearbeitung.<br />
Diese gibt die Daten mit der Auftragstasche an die Druckvorstufe weiter.<br />
Digitale Bogenmontage<br />
** Während die gelieferten Druckdaten noch geprüft werden müssen, kann die Auftragstasche bereits<br />
in die „digitale Bogenmontage“ gegeben werden<br />
Kunde<br />
*** Die Materialbeschaffung für den Druck erfolgt entweder auftragsbezogen direkt vom Lieferanten<br />
oder aus dem Papierlager der Weiterverarbeitung (in der Abb. nicht dargestellt).<br />
Abb. 4.1: UML-Darstellung: Auftragsworkflow mit dem JDF/JMF als Bindeglied (vereinfacht)<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands<br />
CTP-Druckplattenkopie<br />
*** Die Verbindung vom Kunden zum<br />
AMS-Server findet per Webinterface<br />
über das Internet statt.<br />
Offsetdruck***<br />
Digitaldruck***<br />
Weiterverarbeitung<br />
[Auftrag<br />
ausgeliefert]
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
14<br />
Da auch hier bereits Produktionswissen vorausgesetzt wird, empfiehlt sich die Eingabe nur<br />
für Kunden mit Fachwissen. Nachdem die JDF-Datei zur Druckerei übermittelt worden ist,<br />
erfolgt die Kontrolle seitens der Druckerei und fehlende Daten werden ergänzt.<br />
3. Im Auftragsmanagement wird eine JDF-Datei erstellt, diese wird dann in den jeweiligen Arbeitsbereichen<br />
mit Auftragsdaten angereichert und ergänzt. Dieses Prinzip macht allerdings<br />
eine klare Aufgabenverteilung erforderlich (vgl. [KUE 04, S. 81]).<br />
(Siehe auch Beispiel-JDF auf CD-ROM, Anhang 6)<br />
4.3 Funktionsweise des JDF<br />
Um zu verstehen, wie es überhaupt möglich ist, die verschiedensten Anwendungssysteme durch<br />
ein standardisiertes Datenaustauschformat miteinander zu verbinden, muss man sich die Funktionsweise<br />
des JDF ansehen.<br />
4.3.1 XML als Basis<br />
Bei XML (Extensible Markup Language 13 ) handelt es sich um eine Auszeichnungssprache, die<br />
aus reinem textorientiertem Code (z. B. ASCII 14 oder Unicode 15 ) besteht. <strong>Das</strong> hat den großen Vorteil,<br />
dass eine Textdatei im Gegensatz zu einer Binärdatei ohne Verwendung spezieller Software<br />
erstellt, gelesen und bearbeitet werden kann – ein einfacher Texteditor 16 ist schon ausreichend.<br />
Daraus ergibt sich bereits ein zweiter, sehr wichtiger Vorteil: eine XML-Datei ist unabhängig<br />
von einzelnen Programmen, vom Betriebssystem bzw. von der Plattform.<br />
Bei einem Datenaustausch zwischen den Anwendungssystemen müssen diese nicht erst konvertiert<br />
werden, sondern können als Textdatei einfach exportiert bzw. importiert werden.<br />
Zunächst fällt bei einem XML-Dokument die Trennung von Inhalten und der Beschreibung<br />
auf. <strong>Das</strong> geschieht mit sog. „Tags“ (Etikett, Auszeichnung). Innerhalb von spitzen Klammern<br />
wird das Start-Tag gesetzt, es folgt der Elementinhalt und dann das End-Tag. <strong>Das</strong> End-Tag wird<br />
durch einen Schrägstrich („Slash“) gekennzeichnet. So lassen sich Inhalte sauber strukturieren.<br />
Eine Verschachtelung von Tags ist möglich.<br />
Anders als bei HTML (Hyper Text Markup Language 17 ) lassen sich die Tags und damit die Datenstrukturen<br />
selbst definieren. Genau diese Möglichkeit erlaubt die automatische Kommunikation<br />
zwischen den Systemen (vgl. [SPI 06, S. 143]).<br />
10<br />
Abb. 4.2: Element mit Start-Tag, Elementinhalt und End-Tag<br />
13 übersetzt: „Erweiterbare Auszeichnungssprache“<br />
14 American Standard Code for Information Interchange – 7- bzw. 8-Bit-Zeichencodierung<br />
15 internationaler Standard, der alle Zeichen und Sonderzeichen in einem Code vereint – bis 32 Bit (vgl. [BOE 08, S. 8])<br />
16 Spezielle XML-Editoren haben weitere Funktionen wie Schemaprüfung usw. (vgl. [BOE 08, S. 389]).<br />
17 Auszeichnungssprache zur Erstellung hypertextbasierter (Web)-Seiten (vgl. [BOE 08, S. 37])<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
15<br />
Damit eine XML-Datei auch vom Parser 18 interpretiert werden kann, müssen ein paar Regeln<br />
eingehalten werden – das Dokument muss wohlgeformt sein. Als Beispiele seien hier genannt:<br />
● Jedes Dokument enthält nur ein „Wurzelelement“.<br />
● Jedes Element besitzt ein Start- und ein End-Tag.<br />
● Ein Element darf nicht mehrere Attribute gleichen Namens enthalten.<br />
● Die Start- und End-Tags sind ebenentreu-paarig verschachtelt. <strong>Das</strong> bedeutet, dass alle Elemente<br />
geschlossen werden müssen, bevor die End-Kennung des entsprechenden Elternelements<br />
oder die Beginn-Kennung einen Geschwisterelements erscheint (vgl. [WIKI 10,<br />
„XML“, 14.07.10]).<br />
Da beim Import bzw. Export der Datei die Semantik – also die Bedeutung der Daten – mit übertragen<br />
wird, ist die Datei besser lesbar für den Empfänger und es entfällt die Notwendigkeit,<br />
nicht verwendete Elemente näher zu kennzeichnen (vgl. [SPI 09, S. 40]).<br />
Damit aber beim Empfänger die Daten richtig interpretiert – also verstanden – werden können,<br />
müssen Sender und Empfänger das gleiche Schema 19 verwenden. Von Wichtigkeit sind dabei<br />
die drei Ebenen/Schichten (vgl. [SPI 06, S. 140]):<br />
1. Externes Schema: wird vom Benutzer gesehen, z. B. Unternehmensdaten wie Kundendaten,<br />
Rechnungen usw.<br />
2. Konzeptuelles Schema: die Daten in Form von Modellen, z. B. Entity-Relationship, Relationen,<br />
XML-Schemata usw.<br />
3. Internes Schema: die Speichertechnik, z. B. Datenbanken wie MySQL, Oracle usw.<br />
Sender<br />
Schema A<br />
Daten A<br />
Sender<br />
XML-Daten<br />
erzeugen<br />
[Daten]<br />
* Ein fehlendes oder falsches Schema führt zu einer Fehlinterpretation<br />
bzw. zur Unlesbarkeit der gesendeten Daten<br />
[Schema und Daten]<br />
Empfänger<br />
Schema B*<br />
Daten A<br />
Empfänger<br />
XML-Daten<br />
lesen<br />
Abb. 4.3 UML-Darstellung: Datenübertragung mit zwei Akteuren (nach [SPI 06, S. 143])<br />
18 Programme oder Programmteile, die XML-Daten auslesen, interpretieren und ggf. auf Gültigkeit prüfen. Prüft<br />
der Parser die Gültigkeit, so ist er ein validierender Parser (vgl. [WIKI 10, „XML“, 14.07.10]).<br />
19 Schichtenmodell von Beschreibungsebenen für Daten, bei dem jede Ebene von der darunter liegenden „ab -<br />
strahiert“ – üblich sind drei Ebenen (vgl. [SPI 06, S. 140]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands<br />
?
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
16<br />
<br />
<br />
<br />
Hilbrands<br />
Peter<br />
Beerumer Weg<br />
5<br />
26826<br />
Weener<br />
<br />
Abb. 4.4: Beispiel für ein XML-Dokument (vereinfacht)<br />
Für den Datenaustausch spielt neben der Wohlgeformtheit die Gültigkeit (Validität) eine große<br />
Rolle – sie wird durch Parser anhand der zugeordneten Beschreibung (DTD – Dokument Typ<br />
<strong>Definition</strong> 20 , auch Doctype) geprüft. Diese <strong>Definition</strong> lässt sich bei der Datenübertragung mitsenden<br />
oder wird auf einem Server hinterlegt, das XML-Dokument verweist dann auf die DTD<br />
bzw. Doctype (siehe auch Abb. 4.4).<br />
Es gibt Unterschiede zwischen der Dokument Type <strong>Definition</strong> und dem XML-Schema, welches<br />
von der W3C (Wide Web Consortium 21 ) – einem Gremium zur Standardisierung der das World<br />
Wide Web betreffenden Techniken – ausgearbeitet wurde:<br />
● <strong>Das</strong> XML-Schema ermöglicht eine sehr genaue <strong>Definition</strong> der Elemente, d. h. es werden<br />
elementare Datentypen wie Integer, Float, String usw. definiert. Diese lassen sich durch<br />
Nebenbedingungen noch weiter eingrenzen (z. B. nur positive Zahlen usw.).<br />
● <strong>Das</strong> XML-Schema selbst ist ein XML-Dokument. Ein Programm kann mit der gleichen Logik<br />
wie bei XML-Dokumenten die Elemente und Attribute verarbeiten.<br />
● Beim XML-Schema lässt sich für jedes Element und Attribut ein gültiger Wertebereich festlegen,<br />
dieses ist bei einer DTD nicht definierbar (z. B. ob ein eingegebenes Auftragsdatum<br />
überhaupt ein gültiges Datum ist).<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt im Hinblick auf das <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong> ist der sog. XML-<br />
Namensraum. Da sich XML-Dokumente aus Elementen von unterschiedlichen Dokument Typ<br />
<strong>Definition</strong>en zusammensetzen können, kann es zu Namenskonflikten kommen. So könnte der<br />
gleiche Name für unterschiedliche Elemente verwendet werden.<br />
Der XML-Namensraum ordnet die Element- und Attributnamen den entsprechenden <strong>Definition</strong>en<br />
zu (vgl. [HAN 05, S. 478]).<br />
<br />
Abb. 4.5: Beispiel einer Namensraumdeklaration („Namespaces“)<br />
* Wurzelelement, hier<br />
als Beispiel „Kunde“<br />
20 <strong>Definition</strong> der erlaubten Elemente und Attribute und ihrer Zusammensetzung für eine Klasse von Dokumenten<br />
(vgl. [VON 09, S. 564])<br />
21 Webseite: http://www.w3.org<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
17<br />
4.3.2 <strong>Format</strong> und Sprache<br />
Bei XML handelt es sich zweifelsfrei um eine Sprache. Formale Sprachen sind durch Logik und<br />
Mengenlehre beschreibbar. Sie bestehen aus einer aufzählbaren Menge von Basisausdrücken,<br />
es gibt klare Regeln der Komposition und wohlgeformte Ausdrücke (vgl. [WIKI 10, „Sprache“,<br />
15.07.10]). Die formale Grammatik legt die Syntax fest und definiert somit den Aufbau des<br />
Textes (vgl. [HAN 05, S. 334]).<br />
Die in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Auszeichnungen oder Tags werden auch Meta-Tags genannt.<br />
Sie beschreiben die eigentlichen Daten (Elementinhalte). Metadaten geben „Informationen“ über<br />
Daten. XML wird deshalb auch als Metasprache – „eine Sprache über eine Sprache“ – bezeichnet.<br />
Sie beschreibt die inhaltliche Struktur der Daten und dient als Basis für weitere spezielle<br />
Beschreibungssprachen wie etwa das JDF.<br />
Die Begrenztheit der Ausdrücke bei einer Sprache ist bei XML beispielsweise durch das XML-<br />
Schema oder die „Dokument Typ <strong>Definition</strong>“ gegeben.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong> als Sprache geht etwas darüber hinaus, da das JDF durch die Beschreibung<br />
eines Druckauftrages auf Programmeinstellungen und in gewisser Weise auch auf<br />
die Einstellung und Steuerung von Maschinen zugreift. Prozesse können gestartet, ausgeführt,<br />
geändert und wieder beendet werden.<br />
Beispiel: Benötigte Voreinstelldaten (z. B. Farbzoneneinstellungen) für die Offsetdruckmaschine<br />
sind bereits in der Druckvorstufe erstellt worden und werden an den Leitstand übertragen; ein<br />
Einstellen der Farbzonen durch den Mitarbeiter ist nicht mehr erforderlich – Rüstzeiten werden<br />
so verringert. Außerdem lassen sich die Auftragsdaten speichern und für spätere Wiederholungsaufträge<br />
erneut verwenden.<br />
4.3.3 Skriptsprache<br />
Als Skript gilt historisch gesehen die „Mitschrift“ von Kommandos, um Befehle wiederholt<br />
ausführen zu können. Diese werden in einer Datei gespeichert und lassen sich immer wieder<br />
verwenden.<br />
Darüber hinaus erlaubt eine Skriptsprache neben dem bloßen Abspeichern auch die Formulierung<br />
von Ablaufsteuerungsprogrammen. <strong>Das</strong> Ausführen von Kommandos lässt sich so an Bedingungen<br />
knüpfen: Erst bei einem bestimmten Ereignis/einer bestimmten Eigenschaft einer Datei soll<br />
ein vorher definiertes Kommando ausgeführt werden (vgl. [HAN 05, S. 345]).<br />
Beispiel JavaScript 22 : <strong>Das</strong> Script wird in eine HTML-Seite eingebunden. Es erweitert die statische<br />
HTML-Seite z. B. um Möglichkeiten der dynamischen Nutzerinteraktion. Die Ausführung<br />
erfolgt dann im Internetbrowser (dieser fungiert als Interpreter 23 ) (vgl. [PAA 08, S. 58]).<br />
<strong>Das</strong> Skript fungiert als „Vermittler“ und ermöglicht die Interaktion zwischen den verschiedenen<br />
Komponenten.<br />
22 Javascript ist eine Skriptsprache für Webseiten (vgl. [BOE 08, S. 37]).<br />
23 ein Programm, das Quellcode einliest, analysiert und dann ausführt<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
18<br />
Drei wichtige Eigenschaften zeichnen Skriptsprachen i. d. R. aus (nach [HAN 05, S. 346]):<br />
● Der Befehlsumfang lässt sich durch den Anwender verhältnismäßig leicht erweitern.<br />
● Die Befehle/Kommandos sind meist in einer anderen Programmiersprache implementiert.<br />
● <strong>Das</strong> Skript wird durch einen Interpreter ausgeführt und verlangt keine Deklaration der verwendeten<br />
Variablen.<br />
Auch Makrosprachen erlauben die Automatisierung und Steuerung von wiederkehrenden Abläufen,<br />
allerdings i. d. R. nur innerhalb von Anwendungen, sie lassen sich außerdem nicht zur<br />
Entwicklung von Applikationen verwenden (vgl. [HAN 05, S. 346]).<br />
Eine genaue Zuordnung des JDF ist sehr schwierig, da eine JDF-Datei mit Auftrags- und Prozessbeschreibung<br />
unter anderem Voreinstelldaten enthalten kann und somit wie ein Skript bzw. eine<br />
Skriptsprache auf die Steuerung einer Applikation oder einer Maschine Einfluss nehmen kann.<br />
Die zum JDF-Workflow zugehörigen Komponenten „Agents, Controller, Device und Machines“<br />
führen zwar Interaktionen aus, beziehen ihre benötigten Steuer-Informationen aus der Master-<br />
JDF-Datei (siehe auch Kap. 4.5.3). In der Datei selbst sind aber weder Anweisungen noch<br />
Befehle oder Kommandos 24 enthalten; die JDF-Datei beschreibt lediglich einen Prozess- und<br />
Ressourcenstatus. Die Steuerung der Prozesse bzw. der Maschinen übernehmen die einzelnen<br />
Anwendungen, sie nutzen die Informationen aus der JDF-Datei, um dann Kommandos auszuführen.<br />
Außerdem muss die Textdatei nicht durch einen Interpreter ausgeführt werden.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine JDF-Datei durch die enthaltenen Daten Einfluss<br />
nimmt auf die Programmeinstellung und auf die Einstellung/Steuerung von Maschinen. Die<br />
Auftrags-/Prozessbeschreibungen im JDF stellen die Basis dar für Befehle und Kommandos,<br />
die in den einzelnen Anwendungssystemen ausgeführt werden. Schnittstellen übersetzen dafür<br />
in programm-/maschineninterne Sprachen.<br />
Im Gegensatz zu einem Skript/einer Skriptsprache enthält die JDF-Datei keine Anweisungen<br />
oder Kommandos, bietet aber die Datenbasis und die Schnittstellen nach außen, um die Ausführung<br />
der Befehle zu ermöglichen.<br />
Deshalb ist das <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong> dem Begriff der „Auszeichnungssprache“ näher. Diese<br />
stellt Regeln zur Auszeichnung von Textelementen bereit. Damit lassen sich auf deklarative Weise<br />
bestimmten Textelementen Eigenschaften zuweisen, wodurch deren Bedeutung ausgedrückt<br />
werden kann (vgl. [HAN 05, S. 469]).<br />
24 Ein Kommando besteht aus einem Schlüsselwort zur Kennzeichnung der aufgerufenen Operation und aus<br />
optinalen Parameterangaben, die besagen, worauf sich die jeweilige Operation bezieht. Manche Kommandos<br />
besitzen keine Parameter (vgl. [HAN 05, S. 324]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
19<br />
4.4 <strong>Das</strong> CIP4-Konsortium<br />
Nachdem in Kapitel 4.2 die Syntax des JDF erläutert worden ist, richtet sich jetzt der Fokus auf<br />
die Spezifizierung und Standardisierung des <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong>s.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Format</strong> wurde von den Initiatoren (siehe auch Kapitel 4.1) an das CIP4-Konsortium übergeben.<br />
Dieser International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press<br />
and Postpress 25 gehören heute über 250 Anbieter, Systemintegratoren, Berater, Anwender und<br />
Vereinigungen an. Sämtliche „wichtigen“ Hersteller aus allen Bereichen der grafischen Branche<br />
sind heute CIP4-Mitglied.<br />
4.4.1 Aufgaben<br />
Ziel dieser herstellerunabhängigen Vereinigung ist die Förderung einer datentechnischen Integration<br />
aller Arbeitsschritte in der Druckproduktion. Dies geschieht vor allem durch die Spezifizierung<br />
von Standards (vgl. [CIP 10, 20.07.10]).<br />
Dabei spielen die Pflege, die Weiterentwicklung und auch die Verbreitung des JDF eine große<br />
Rolle.<br />
Durch Bildung von Arbeitsgruppen werden die Spezifikationen vom JDF ständig weiterentwickelt.<br />
Außerdem versuchen die beteiligten Hersteller, ihre Produkte weiter dem gemeinsamen<br />
Standard anzupassen. Am Prozess beteiligte Produkte können sich von dem CIP-Konsortium<br />
zertifizieren lassen.<br />
Neben den Spezifikationen und Dokumentationen werden auch Beispielcode, Frameworks („Programmiergerüste“)/Bibliotheken<br />
und Tools für Programmierer zur Verfügung gestellt. Diese<br />
Bibliotheken sollen den Softwareentwicklern der Software-/Hardwarehersteller die Arbeit erleichtern.<br />
Weitere Standards der CIP4 sind PrintTalk, ein Standard zur Beschreibung von Druckaufträgen,<br />
und Print Production <strong>Format</strong>, ein Vorläufer des JDF – beide nicht Bestandteil dieser Diplom-<br />
Hausarbeit.<br />
4.4.2 Spezifikationen<br />
Als Referenz wird die XML-Spezifikation des World Wide Web Consortiums (W3C) 26 verwendet.<br />
Darauf aufbauend wurde vom CIP4-Konsortium die Spezifikation erstellt, die mittlerweile<br />
in der Version 1.4a (Dezember 2009) vorliegt und über 1100 Seiten umfasst. Sie steht<br />
als HTML-Seite oder zum Download als PDF-Datei auf der Internetseite zur Verfügung 27 .<br />
Sie enthält viele Tabellen, Abbildungen und Beispielcodezeilen. Festgelegt werden u. a. die<br />
Notation, viele Parameter für Seitenformate, Farbe, Medien usw., aber auch die Prozesse, die<br />
Statusmeldungen usw..<br />
25 Webseite: http://www.cip4.org<br />
26 URL: http://www.w3.org/TR/REC-xml<br />
27 URL: http://www.cip4.org/documents/jdf_specifications/JDF1.4.pdf<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
20<br />
Um einen Eindruck von der JDF-Spezifikation zu erhalten, werden im Folgenden einige Beispiele<br />
der Beschreibungen/Festlegungen genannt:<br />
● der grundsätzliche Aufbau/die Struktur einer JDF-Datei (siehe auch Abb. 4.4) mit Feldnamen/<br />
Tags und Elementinhalten<br />
● zu verwendende Datentypen (Boolean, Double, Integer usw.)<br />
Für das Element „JDF-ID“ ist beispielsweise der Datentyp String vorgesehen.<br />
● Beschreibung weiterer Komponenten, die Einfluss auf eine JDF-Datei nehmen können:<br />
Machines, Devices, Agents und Controllers (siehe auch Kap. 4.5.3)<br />
● Beschreibung einzelner Workflows<br />
● Schnittstellenbeschreibungen<br />
● Nodes (Knoten) und Nodesstrukturen – Beschreibung eines Produktes/Teilproduktes oder<br />
eines Prozesses (siehe Kap. 4.5.1)<br />
● Ressourcen (Parametersets oder benötigtes Material) (siehe Kap.4.5.2)<br />
● Funktion des JMF-Messaging (siehe Kap. 4.5.4)<br />
● Genormte Maßeinheiten. Als Beispiele seien hier Screensolution = ppi und Papiergewicht<br />
= g/m² genannt<br />
● Parametrisierung (z. B. Lage der Druckseite, Winkel, Rotation)<br />
● Farbräume (RGB oder CMYK)<br />
● Umgang mit Farbseparationen 28 (Datentyp Boolean: „False“ entspricht unsepariert)<br />
● Mögliche Statusmeldungen (z. B. „InProgress = The Node ist currently execute“)<br />
● Weitere Parameter für Seiten, Platzierungen, Bundangaben usw.<br />
● Medienformatnormen wie u. a. die DIN-Reihe (Bezeichnung und Maße usw.)<br />
● Definierte Medientypen wie Coated (gestrichenes Papier) oder Uncoated (ungestrichenes)<br />
● Bindearten<br />
● Falzparameter<br />
(vollständige JDF Spezifikation siehe PDF-Datei auf der CD-ROM, Anhang 6)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Abb. 4.6: Beispielcode „Farbnamen“: Die Farbangabe im Hexadezimalcode wird neu definiert<br />
in die Bezeichnung „Grün“(vgl. [CIP 10 JDF Specification S. 453]).<br />
28 Zerlegung eines Farbbildes (Composit) in die Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK)<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
21<br />
7.2.26.2 Element: PrintConditionColor<br />
New in JDF 1.2<br />
JDF Specification Release 1.4a<br />
The PrintConditionColor Element describes the specific properties of a colorant (named in Color/@Name) when<br />
applied in a given printing condition, (i.e., media surface, media opacity, media color, screening/RIP, (e.g., halftone)<br />
technology). It is used to overwrite the generic values of Color, which are supplied as the default. See the descriptions<br />
in Color for details of the individual Attributes and Elements.<br />
Table 7-99: PrintConditionColor Element (Sheet 1 of 2)<br />
Name Data Type Description<br />
CMYK ? CMYKColor CMYK of the PrintConditionColor.<br />
Default value is from: parent Color/@CMYK<br />
ColorBook ? string ColorBook of the PrintConditionColor.<br />
Default value is from: parent Color/@ColorBook<br />
ColorBookEntry ? string ColorBookEntry of the PrintConditionColor.<br />
Default value is from: parent Color/@ColorBookEntry<br />
ColorBookPrefix ? string ColorBookPrefix of the PrintConditionColor.<br />
Default value is from: parent Color/@ColorBookPrefix<br />
ColorBookSuffix ? string ColorBookSuffix of the PrintConditionColor.<br />
Default value is from: parent Color/@ColorBookSuffix<br />
Density ? double Density of the PrintConditionColor.<br />
Default value is from: parent Color/@Density<br />
Lab ? LabColor Lab of the PrintConditionColor.<br />
MappingSelection ?<br />
New in JDF 1.2<br />
Default value is from: parent Color/@Lab<br />
enumeration This value specified the mapping method to be used for this Color.<br />
Default value is from: parent Color/@MappingSelection.<br />
MediaSide = "Both" enumeration<br />
Values are:<br />
UsePDLValues – Use color values specified in the PDL for this color.<br />
See [ColorPS].<br />
UseLocalPrinterValues – Use the Printer's best local mapping for<br />
this Color.<br />
UseProcessColorValues – Use the values defined in this Color.<br />
Media front and back surfaces can be different, affecting color results. If<br />
the Media/@FrontCoatings, Media/@BackCoatings or Media/<br />
@Gloss Attributes indicate differences in surface then MediaSide can<br />
be used to specify the side of the media to which the<br />
PrintConditionColor Attributes pertain.<br />
Values are:<br />
Front<br />
Back<br />
Both<br />
NeutralDensity ? double NeutralDensity of the PrintConditionColor.<br />
Default value is from: parent Color/@NeutralDensity<br />
Abb. 4.7: Beispielseite „Farbe“ mit Elementnamen, dem dazugehörigen Datentyp und der<br />
Beschreibung [CIP 10, „JDF Specification“, S. 449]<br />
Process Resources 449<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
22<br />
4.5 Aufbau des JDF<br />
Die zum Druckauftrag zugeordnete JDF-Datei (z. B. diese Diplomarbeit) wird nach der Erstellung<br />
(siehe Kap. 4.2) entweder dezentral gespeichert, d. h. sie wird von einer Abteilung an<br />
die folgende weitergegeben, oder sie wird zentral auf einem AMS-Server gespeichert, wo alle<br />
Teilnehmer des Workflows zugreifen bzw. ändern dürfen (vgl. [KUE 04, S. 40]). Was genau eine<br />
JDF-Datei abbildet, soll dieses Kapitel aufzeigen.<br />
(Die Auftragsdefinition dieser Diplomarbeit als JDF-Datei befindet sich im Anhang 4b.)<br />
4.5.1 Nodes<br />
Grundsätzlich enthält jede Auftragsdefinition die Beschreibung der beteiligten Produkte/Teilprodukte<br />
und die erforderlichen Prozesse. Diese Produkte und Prozesse werden als JDF-Knoten<br />
(Node) bezeichnet. Durch den hierarchischen Aufbau entsteht eine Baumstruktur, die neben<br />
seriellen und parallelen auch überlappende und iterative (sich wiederholende) Prozesse abbilden<br />
kann. Beispielsweise kann der Umschlag parallel zum Inhalt auf anderen Maschinen gefertigt<br />
werden.<br />
Bereits im Auftragsmanagement wird die eigentliche Prozessstruktur festgelegt. Sie beinhaltet<br />
alle Prozesse, beteiligte Maschinen und die Produktionsabfolge. Hinterlegt wird diese Beschreibung<br />
in dem JDF-Element NodeInfo.<br />
Der modulare Aufbau des JDF ermöglicht zu jeder Zeit eine Änderung der Prozessbeschreibung<br />
(vgl. [KUE 04, ab S. ff.].<br />
Umschlag<br />
Postpress<br />
Schneiden<br />
Rippen<br />
Broschüre Produkt<br />
Fertigschneiden Prozess<br />
Klebebinden<br />
Prepress<br />
Ausschießen<br />
Inhalt<br />
Abb. 4.8: Produkte und Prozesse als Knoten (Node) [nach HOH 07, Folie 18]<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands<br />
Press<br />
Drucken<br />
Postpress<br />
Schneiden
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
23<br />
4.5.2 Ressourcen<br />
Ein weiteres Strukturelement sind die Ressourcen. Sie beschreiben sämtliche für den Produktionsprozess<br />
benötigten Prozessmittel und Verbrauchsmaterialien wie Farbe, Papier und Druckplatten<br />
usw.. Aber nicht nur die klassischen Werkstoffe wie Rohstoffe und Zulieferteile sind<br />
Ressourcen, sondern auch Zwischenstufen.<br />
Jeder Prozess konsumiert und erzeugt Ressourcen. So ist der Output eines Knotens (z. B. das<br />
bedruckte Papier aus der Druckmaschine) als Ressource für den Input eines anderen Knotens<br />
(Falzmaschine) anzusehen.<br />
Ebenso zählen digitales Material (Daten) wie Maschinenparameter, Voreinstelldateien, ICC-<br />
Farbprofile und auch PDF-Seiten usw. zu den Ressourcen. Prozessanweisungen wie z. B. ein<br />
Ausschießschema (siehe auch Anhang 2b) zählen ebenfalls dazu.<br />
Die Verbindung zu den Prozessen wird durch Verknüpfungen (sog. ResourceLinks) hergestellt.<br />
4.5.3 Machines, Devices, Agents und Controller<br />
Ein wichtiges Grundprinzip des JDF ist das Erstellen einer zentralen Datei mit allen Produkten,<br />
Prozessen und benötigten Ressourcen, die durch beteiligte Systeme angepasst, ergänzt und geändert<br />
werden darf. Für einen Datenaustausch sorgen folgende Komponenten:<br />
● Agents können ein JDF schreiben, es erweitern oder modifizieren.<br />
● Controller empfangen JDF, wählen Geräte aus und leiten JDF an die vorgesehene Stelle.<br />
● Devices (Geräte) bilden Schnittstellen zwischen den Anwendungssystemen und den Maschinen.<br />
Sie interpretieren das JDF und führen die Anweisungen selbst aus oder steuern die<br />
jeweilige Maschine an.<br />
● Machines sind nicht JDF-fähige Hard- oder Software, die von JDF-Geräten (Devices) mit<br />
maschinen eigenen Anweisungen gesteuert werden.<br />
Controller und Geräte können über das JMF (<strong>Job</strong> Messaging <strong>Format</strong>) kommunizieren. Zum<br />
Beispiel fragt der Controller bei der Einrichtung eines neues Gerätes ab, welche Prozesse das<br />
Gerät ausführen kann (vgl. [PAA 08, S. 294]).<br />
JDF JMF<br />
Controller/Agent<br />
JDF<br />
JDF JMF<br />
Device/Agent Device<br />
Controller/Agent<br />
JDF JDF JMF<br />
JDF DeviceJMF<br />
Abb. 4.9: Interaktionen von Agenten, Controllern und Devices (nach [PAA08, S. 294])<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands<br />
JDF<br />
Device
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
24<br />
4.5.4 <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> Messaging <strong>Format</strong><br />
<strong>Das</strong> JMF (<strong>Job</strong> Messaging <strong>Format</strong>) ist als Teil des JDF für die Übertragung und den Austausch<br />
der Daten zuständig. Es basiert ebenfalls auf XML und ist CIP4-spezifiziert. Mittels JDF meldet<br />
beispielsweise ein Gerät seine Bereitschaft oder Beschäftigung an den Controller.<br />
Die Meldungen können während der Prozesse nahezu in Echtzeit übertragen werden und lassen<br />
sich in sechs verschiedene Kategorien einteilen (nach [HOH 07, Folie 34]):<br />
● Befehle („Commands“) – Befehle, der eine Statusänderung bewirken<br />
● Signale („Signals“) – automatische Meldungen an Abonnenten<br />
● Anfragen („Queries“) – Abfragen ohne Statusänderung<br />
● Bestätigungen („Acknowledgements“) – verzögerte Antworten auf ein Command<br />
● Antworten („Responses“) – sofortige Antworten auf eine Query oder ein Command<br />
● Befehlsanfragen („Registrations“) – Abonnierung von Prozessmeldungen<br />
Beispiele für die Nutzung wären Statusmeldungen, Materialverbrauchabfragen, Änderung der<br />
Auftragsparameter und Abfrage von Geräteeigenschaften usw..<br />
Als Übertragungsweg wird entweder das HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 29 verwendet – die<br />
Übertragung erfolgt dann bidirektional – oder es wird unidirektional per MIME-Paket (Multipurpose<br />
Internet Mail Extensions) 30 in einen Hotfolder 31 übertragen (vgl. [KUE 04, S. 32 ff.]).<br />
JMF wird deshalb auch als das „SMS der Druckindustrie“ bezeichnet.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Abb. 4.10: JMF-Datei: Antwort (Response) auf eine Anfrage über den Printerstatus (nach [CIP 10,<br />
JDF Specification, S. 185]).<br />
29 HTTP regelt die Verständigung zwischen Web-Client und Web-Server (vgl. [PAA 08, S. 125]).<br />
30 MIME ist ein Standard für die Struktur und den Aufbau von E-Mails und anderen Internetnachrichten (vgl. [WIKI 10,<br />
„MIME“, 17.07.10]).<br />
31 überwachte Ordner zur unidirektionalen Kommunikation (vgl. [PAA 08, S. 291]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
25<br />
7 Anwendungsschicht<br />
6 Darstellungsschicht<br />
5 Sitzungssschicht<br />
ISO/OSI-Modell TCP/IP-Familie Realisierung<br />
Abb. 4.11: <strong>Das</strong> ISO/OSI- und das TCP/IP-Schichtenmodell (nach [HAN 05, S. 613]).<br />
4.6 Netzwerk und Schnittstelle<br />
Anwendungsschicht<br />
HTTP, FTP, SMTP,<br />
POP, IMAP, LDAP,<br />
Telnet, SSH usw.<br />
4 Transportschicht Transportschicht TCP, UDP<br />
3 Vermittlungsschicht Internet-Schicht IP, ICMP<br />
2 Datensicherungsschicht ARP, IEEE 802 usw.<br />
Verbindungsschicht<br />
1 Bitübertragungsschicht<br />
Kupfer-, Koaxial-,<br />
Glasfaserkabel, Funk<br />
Für eine zuverlässige Datenübertragung von JDF-Daten ist die Normung auf mehreren informationstechnischen<br />
Ebenen notwendig. Nur dann lassen sich universelle Schnittstellen mit einer<br />
genormten Grundlage definieren (vgl. [KUE 04, S. 27]). Deutlich wird dieses durch das ISO/<br />
OSI 32 -Schichtenmodell mit sieben Schichten bzw. durch das TCP/IP-Modell mit vier Schichten<br />
(siehe Abb. 4.11).<br />
Im Gegensatz zum ISO/OSI-Referenzmodell wird beim TCP/IP-Modell die Bitübertragungs-<br />
und die Sicherungsschicht nicht genau definiert. Daraus ergibt sich eine Unabhängigkeit von<br />
technologischen Entwicklungen (vgl. [HAN 05, S. 614]). Außerdem werden die anwendungsorientierten<br />
Schichten zu einer Schicht zusammengefasst. Insgesamt betrachtet sind die Schichten<br />
des TCP/IP-Modells nicht so festgelegt wie beim OSI-Modell, was die Dienste und Funktionen<br />
betrifft.<br />
Die Modelle verdeutlichen die Kommunikation zwischen den Datenstationen. Um eine Verbindung<br />
von Sender und Empfänger zu ermöglichen, sind zwischen ihnen exakte Vereinbarungen<br />
(sog. Protokolle) erforderlich. Diese „Regeln“ legen u. a. den Beginn und die <strong>Format</strong>ierung der<br />
Botschaft, die Datenflusskontrolle, Vereinbarungen der Verbindungscharakteristiken und Fehlerkorrekturverfahren<br />
fest (vgl. [WIKI 10, „Protokoll“, 17.07.10]).<br />
Beim ISO/OSI-Referenzmodell findet ein realer Datentransport nur auf der untersten Ebene<br />
statt, den höheren Schichten ist die Art des Transportes egal – sie erhalten über die physikalische<br />
32 Die „Open Systems Interconnection“ ist eine Arbeitsgruppe der ISO (International Organization for Standardization)<br />
und erarbeitet Standards und Protokolle für die Datenübertragung (vgl. [KUE 04, S. 27]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
26<br />
Übertragung der Daten keine Informationen. Dieses Prinzip wird auch „Information hiding“<br />
genannt (vgl. [SPI 09, S. 30]).<br />
Durch die Trennung der Schichten spielt beispielsweise der Wechsel von Kupfer- auf Glasfaserkabel<br />
im Netzwerk der Druckerei keine Rolle, da die einzelnen Schichten keinen Einfluss auf<br />
darüber- oder darunterliegende Schichten haben (vgl. [KUE 04, S. 27]).<br />
Die Übertragung im Netzwerk erfolgt auf der Basis eines kabelgebundenen Datennetzes, dem<br />
Ethernet. Es umfasst Festlegungen für Kabeltypen und Stecker sowie für Übertragungsformen<br />
(Signale auf der Bitübertragungsschicht, Paketformate). Dabei werden Datenpakete in heutiger<br />
Zeit i. d. R. über Kupfer- oder Glasfaserkabel versendet.<br />
Im OSI-Modell ist mit Ethernet sowohl die physikalische Schicht (OSI Layer 1) als auch die<br />
Data-Link-Schicht (OSI Layer 2) festgelegt (vgl. [WIKI 10, „Ethernet“, 17.07.10]).<br />
Als Protokoll wird das Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) verwendet.<br />
Es ist der wichtigste Standard im Bereich der Netzwerkprotokolle und gewährleistet, dass die<br />
Datenpakete durch Routing ihr Ziel ereichen können. Dabei stellt das TCP sicher, dass die Datenübertragung<br />
korrekt und vollständig erfolgt. Die Identifizierung der am Netzwerk teilnehmenden<br />
Rechner geschieht über IP-Adressen.<br />
IP liegt auf Schicht 3 des OSI-Modells, TCP befindet sich auf Schicht 4, darüber befindet sich<br />
die Anwendungsschicht mit Protokollen wie FTP (File Transfer Protocol), HTTP und SMTP<br />
(Simple Mail Transfer Protocol) (vgl. [PAA 08, S. 122]).<br />
<strong>Das</strong> TCP-Protokoll arbeitet verbindungsorientiert (connection-oriented), d. h. es findet eine<br />
„Unterhaltung“ zwischen Sender und Empfänger statt. Mit Hilfe eines Handshake-Protokolls<br />
kommunizieren Server und Clients miteinander – dazu sendet der Server eine generierte Prüfziffer<br />
an den Client. So lässt sich überprüfen, ob die Datenpakete komplett und fehlerfrei übertragen<br />
wurden. Beim verbindungslosen (connectionless) IP-Protokoll hingegen findet zwischen<br />
Sender und Empfänger keine Kommunikation „außerhalb“ der Datenpakete statt – sie werden<br />
ohne Empfangsbestätigung versendet (vgl. [SPI 10, S. 61]).<br />
Erst die genormten Standardprotokolle und Hardwarestandards bilden die Basis für Standardschnittstellen<br />
für die sichere Kommunikation untereinander und ein einfaches Einbinden/Anschließen<br />
von Komponenten wie Applikationen, Hardware usw.. JDF-Entwickler können sich<br />
auf der Webseite des CIP4-Konsortiums viele Frameworks und Tools herunterladen, um Schnittstellen<br />
zu programmieren.<br />
Über Internet ist die Verbindung zum Kunden („B2C“) 33 und zum Lieferanten („B2B“) 34 möglich.<br />
JDF stellt somit die Basis für „eBusiness“ – die elektronische Geschäftsabwicklung – zur<br />
Verfügung.<br />
● Kunden senden die Auftragsbeschreibungsdaten mit den Content-Daten an das Auftragsmanagement.<br />
Außerdem kann der Kunde über ein Webinterface jederzeit den Status seines<br />
Druckauftrages abrufen. Erforderlich ist dafür ein Zugang (passwortgeschützt) auf den Server<br />
der Druckerei.<br />
33 Business to Consumer: Transaktionen zwischen Unternehmen und Endkunden<br />
34 Business to Business: Transaktionen zwischen Unternehmen und Unternehmen (vgl. [THO 06, S. 75])<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
27<br />
● Bei Bestellungen ließen sich die auftragsrelevanten Lieferantendaten (Grund- und Vorgangsdaten<br />
wie z. B. Adresse, aber auch Daten über Prozessmittel wie Papier, Farbe usw.) als<br />
Ressource mit in den JDF-Workflow integrieren – desgleichen Daten über Prozesse bei<br />
Partnerbetrieben (z. B. eine Buchbinderei, die die Weiterverarbeitung übernimmt).<br />
Nur die Integration von Kunde und Lieferant ermöglicht eine bemerkenswerte Kosteneinsparung<br />
durch Automatisierung. Die Nutzung des Internets zur bloßen Datenübertragung bringt keine<br />
wesentlichen Vorteile (vgl. [THO 06, S. 87]).<br />
Leider enthält das Internet im Bereich der Datensicherheit große „Lücken“ und lässt Manipulationen<br />
zu. Um die Sicherheit zu erhöhen, müssen neben verbindungsorientierten Protokollen<br />
Verschlüsselungstechniken eingesetzt werden – damit lassen sich z. B. protokollbedingte Sicherheitslöcher<br />
„stopfen“ (vgl. [SPI 10, S. 62]).<br />
4.7 Die Verbindung zu den Druckdaten<br />
Die Content-Daten liegen üblicherweise im „Portable Document <strong>Format</strong>“ (PDF) der Fa. Adobe<br />
vor. Es wurde als eigenständiges Dateiformat zum Austausch von Daten entwickelt und ist heute<br />
der „De-facto-Standard“ für die Publikation elektronischer Dokumente (vgl. [BOE 08, S. 360]).<br />
Die ISO (International Organization for Standardization) verabschiedete einen Standard mit der<br />
Bezeichnung „PDF/X“, um den Datenaustausch speziell in der Druckindustrie zu erleichtern.<br />
Die Untergruppe des PDF gibt ein paar „Spielregeln“ in Form von Kann-, Muss- oder Sollbestimmungen<br />
vor. Erreicht werden soll damit eine höhere Produktionssicherheit (z. B. keine<br />
Fehlbelichtungen durch korrupte Daten usw.) (vgl. [SCH 06, S. 223]).<br />
Da der gesamte Workflow der Johannesburg GmbH auf PDF eingerichtet ist, wird aus Gründen<br />
der Vereinfachung grundsätzlich von PDF-Dateien ausgegangen. Ein Verknüpfen der JDF-Datei<br />
mit einer offenen Satzdatei, z. B. einer „InDesign“-Datei, ist aber ebenso möglich.<br />
Nach Erstellung der Content-Daten und der dazugehörigen Auftragsbeschreibung (siehe auch<br />
Kap. 4.2) wird im Programm „Adobe Acrobat“ an die entsprechenden Produktnodes die PDF-Datei<br />
angehängt. Sie ist mit der Beschreibung nur verknüpft, also nicht darin eingebettet. Es besteht<br />
die Möglichkeit, nur bestimmte Seitenbereiche der Content-Datei auszuwählen. Außerdem kann<br />
ein Produktknoten auch aus mehreren Content-Dateien bestehen. So kann sich beispielsweise<br />
der Knoten „Inhalt“ dieser Diplomarbeit aus mehreren PDF-Dateien zusammensetzen.<br />
Nach Fertigstellung lassen sich die JDF- und die PDF-Datei in einen Versandordner exportieren<br />
oder es wird ein MIME-Paket gemäß dem MIME-Standard erstellt.<br />
Zur besseren Übersicht besteht die Möglichkeit, die Auftragsbeschreibung zusätzlich als HTML-<br />
Datei zu exportieren – der Auftragsbearbeiter kann sich diese zur Kontrolle in einem Webbrowser<br />
ansehen (siehe auch Auftragsbeschreibung auf CD-ROM, Anhang 6).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. <strong>Das</strong> <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong><br />
28<br />
4.8 Management Information System<br />
Bislang wurde der Druckauftrag mit seinen relevanten Objekttypen wie Stamm-/Grund- und Vorgangsdaten<br />
betrachtet. Aber ein modernes MIS (Managment Information System) kann mehr: Es<br />
stellt der Unternehmensleitung Informationen zur Verfügung, mit deren Hilfe das Unternehmen<br />
gelenkt bzw. das Controlling 35 (Produktions- und Vertriebssektor) betrieben werden kann (vgl.<br />
[WIKI 10, „MIS“, 18.07.10]). Betriebsdatenerfassung und Nachkalkulation liefern die Zahlenbasis<br />
für das Controlling des Unternehmens.<br />
In einem vernetzten Unternehmen stellt die Bereitstellung von Ist-Daten (z. B. Maschinendaten<br />
usw.) kein Hindernis dar. Daraus lassen sich vom Anwendungssytem abgeleitete Daten verdichten.<br />
Dabei wird zwischen dispositiven (z. B. Bedarf für Material und Produktionsplanung) und aggregierten<br />
Daten (z. B. Gewinn- und Verlustrechnung oder Soll-/Ist-Vergleich der Kostenstellen)<br />
unterschieden (vgl. [SPI 06, S. 83]). Aus diesem Grund ist eine Vernetzung des Auftragsmanagementsystems<br />
mit dem System der Finanzbuchhaltung sinnvoll.<br />
Vom Controlling erstellte detaillierte Statistiken und aussagekräftige Kennzahlen dienen der<br />
Geschäftsleitung zur Entscheidungsfindung. Hier einige Beispiele (nach [KUE 04, S. ff.]):<br />
● Ergebnisübersicht – auftragsbezogene Ergebnisse. U. a. werden Deckungsbeitrag, Umsatzrentabilität<br />
eines Auftrags ausgewertet.<br />
● Kundenanalyse – Auswertung der Umsatzdaten, Verhältnis von Angeboten zu Aufträgen usw.<br />
● Produktgruppenanalye – Auswertung der Umsätze, Deckungsbeiträge und Kosten von Produktgruppen<br />
● Kostenstellenstatistik – Gegenüberstellung von Hilfs- und Fertigungszeiten, Ermittlung des<br />
Beschäftigungsgrades usw.<br />
● Erfassung der Fehl- und Wiederholungsarbeiten – Unterscheidung der Prozessschwankungen<br />
und der Prozessstörungen mit Fehleranalyse<br />
● Mehrarbeitstatisik – Erfassung aller Leistungen, die aufgrund von fehlerhaft angelieferten<br />
Dateien, Korrekturwünschen usw. verursacht wurden. Ob diese Kosten in Rechnung gestellt<br />
werden, entscheidet die Geschäftsleitung.<br />
35 Controlling ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Geschäftsführung<br />
(vgl. [WIKI 10, „Controlling“, 18.07.10]).<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Voraussetzungen für die Prozessintegration<br />
29<br />
5 Voraussetzungen für die Prozessintegration<br />
Die Prozessintegration kann Abläufe und Strukturen in einem Betrieb eventuell ganz gravierend<br />
ändern. Außerdem bedeuten Investitionen i. d. R. eine hohe Kapitalbindung und können unter<br />
Umständen Interdependenzen zu anderen Unternehmensbereichen (Finanzen, Personal usw.)<br />
zur Folge haben (vgl. [BET 08, S. 20]). Deshalb sollten zur Entscheidungsfindung die Voraussetzungen<br />
sehr genau reflektiert werden.<br />
5.1 Betrieb insgesamt<br />
Für alle an der Integration beteiligten Bereiche muss eine ausreichende Infrastruktur vorhanden<br />
sein. <strong>Das</strong> heißt, es muss ein Kabelnetzwerk (i. d. R. Ethernet) mit entsprechend ausgestatteten<br />
Clients und Servern vorhanden sein. Neben weiterer Netzwerkhardware wie Switches usw. ist<br />
natürlich auch an ein ausreichendes Backup-System zu denken. Inwieweit die Infrastruktur redundant<br />
vorhanden sein sollte (Sicherheitsaspekt), ist Teil der Investitionsentscheidung.<br />
Organisatorisch werden Verantwortlichkeiten und Funktionen aus der Produktion in die Arbeitsvorbereitung<br />
bzw. in das Auftragsmanagment verlegt (vgl. [HOH 07, Folie 22]). Bereitschaft<br />
für personelle und strukturelle Veränderungen ist somit eine wichtige Voraussetzung im Betrieb/<br />
Unternehmen.<br />
● Eine Netzwerkinfrastruktur der Johannesburg-Druck (siehe auch Kap. 2.4.1) – d. h. Switches,<br />
Kabel, Server usw. – ist in weiten Teilen vorhanden.<br />
5.2 Auftagsmanagement<br />
<strong>Das</strong> Auftragsmanagementsystem muss Schnittstellen (z. B. mit JDF) zu den anderen Unternehmensteilen<br />
bereitstellen oder sich erweitern lassen. Um als JDF-Server eingesetzt werden zu<br />
können, ist die Abbildung der kompletten Prozessstruktur erforderlich (vgl. [KUE 04, S. 50]).<br />
Von den Mitarbeitern in der Auftragsbearbeitung wird ein hohes technisches Verständnis und<br />
Fachwissen aus allen Produktionsbereichen verlangt, da alle Prozessschritte vorab geplant und<br />
kalkuliert werden müssen.<br />
● <strong>Das</strong> in der Johannesburg-Druck eingesetzte Anwendungssystem „Lector Druck“ lässt sich<br />
durch verschiedene käufliche Ausbaustufen um die JDF-Schnittstelle ergänzen. „Lector Druck<br />
orientiert sich bezüglich der vernetzten Druckerei ausschließlich an den Richtlinien 36 von CIP4<br />
und JDF“ [LEC 10, 22.07.10].<br />
5.3 Prepress<br />
Der kreative Teil der Druckvorstufe – die eigentliche Mediengestaltung bzw. Satzherstellung<br />
– lässt sich nur bedingt einbinden. Beispielsweise lassen sich in dem Layoutprogramm „In-<br />
36 Die Fa. „Lector Computersysteme“ ist Mitglied bei der CIP4.<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Voraussetzungen für die Prozessintegration<br />
30<br />
Design“ der Fa. Adobe zwar XML-Dateien im- und exportieren, diese Funktion bezieht sich<br />
aber ausschließlich auf Content-Daten. Zurzeit bietet nur die Anwendung „Adobe Acrobat Pro“<br />
JDF-Unterstützung.<br />
Die Hersteller von Anwendungssoftware für die digitale Bogenmontage und für die CTP-Plattenkopie<br />
bieten Schnittstellen-Module als Erweiterung an.<br />
● <strong>Das</strong> in der Johannesburg eingesetzte Heidelberg-System „Prinect“ 37 hat den JDF-Workflow<br />
bereits integriert, weitere Module, z. B. zur Anbindung der Kunden, lassen sich erwerben. (vgl.<br />
[HEI 10, 22.07.10]).<br />
5.4 Press<br />
Neben der Vernetzung des Drucksaals spielt die Netzwerkfähigkeit der Offset-Druckmaschinen<br />
eine erhebliche bzw. entscheidende Rolle für die Prozessintegration. Moderne Leitstände der<br />
Druckmaschinen lassen sich integrieren und können JDF-Daten empfangen bzw. senden.<br />
Bei älteren Maschinen ist eine Einbindung nur über das Vorschalten externer Data-Terminals<br />
möglich, außerdem muss gegebenfalls externe Sensorik angebracht werden. Ob so eine Lösung<br />
betriebswirtschaftlich zufriedenstellt, muss im Einzelfall geklärt werden (vgl. [KUE 04, S. 74]).<br />
● Bei den Offset-Druckmaschinen der Johannesburg-Druck ist eine Prozessintegration nicht<br />
mehr sinnvoll, da eine Investition nicht wirtschaftlich wäre. Bei mittel- bzw. langfristigen Ersatzinvestitionen<br />
wäre eine Maschinenintegration als Handlungsalternative zu berücksichtigen.<br />
Im Digitalbereich ist es erforderlich, dass der RIP (Raster Image Prozessor 38 ) JDF-Daten „verstehen“<br />
kann, um darin enthaltene Anweisungen an das Ausgabegerät weiterreichen zu können.<br />
● In der Digitaldruckerei der Johannesburg werden ein RIP der Fa. Fiery und ein Laserdrucker<br />
der Fa. Xerox verwendet 39 . Beide Geräte verwenden die Spezifikationen der CIP4.<br />
5.5 Postpress<br />
Ähnlich wie im Bereich „Press“ ist ein moderner Maschinenpark Voraussetzung für die Integration.<br />
Beispiel Fa. Heidelberg: „Mit dem Prinect Postpress Manager von Heidelberg können<br />
folgende Prozesse integriert und im System abgebildet werden: Falzen, Sammelheften, Klebebinden,<br />
Schneiden, Faltschachtelkleben und Stanzen.<br />
Handarbeitsplätze lassen sich über das Data Terminal erfassen. Nicht automatisierte Weiterverarbeitungsmaschinen<br />
lassen sich ebenso wie Fremdmaschinen über ein Data Terminal in ein effizientes<br />
Weiterverarbeitungsmanagement einbinden. Der Prinect Postpress Manager gibt hierzu<br />
seine vollständigen Auftragsdaten als Auftragslisten an einen separat eingerichteten Computer<br />
weiter“ [HEI 10, 22.07.10].<br />
37 Die Fa. Heidelberg ist CIP4-Mitglied.<br />
38 Im RIP werden ankommende Druckdaten interpretiert, gerendert und anschließend gerastert zum Ausgabegerät<br />
geschickt (vgl. [BOE 08, S. 337]).<br />
39 Die Fa. Fiery und die Fa. Xerox sind CIP-4-Mitglied.<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Voraussetzungen für die Prozessintegration<br />
31<br />
Alle Hersteller der Weiterverarbeitungsmaschinen in der Johannesburg-Druck sind CIP4-Mitglied.<br />
So lassen sich beispielsweise die Schneidemaschinen der Fa. Polar-Mohr 40 , die Falzmaschinen<br />
der Fa. Stahl (jetzt Fa. Heidelberg) und die Sammelhefter der Fa. Müller-Martini 41 in<br />
ihren aktuellen Ausführungen in einen JDF-Workflow integrieren, für die Einbindung sind aber<br />
jeweils zusätzliche Terminals erforderlich.<br />
● Der Maschinenpark in der Weiterverarbeitung der Johannesburg-Druck ist für eine Prozessintegration<br />
ungeeignet. Wie auch im Druckbereich wäre eine Maschineneinbindung in einen JDF-<br />
Workflow erst bei einer mittel- bzw. langfristigen Ersatzinvestition in die Investitionsrechnung<br />
mit einzubeziehen.<br />
40 Webseite: http://www.polar-mohr.de<br />
41 Webseite: http://www.mullermartini.com/de<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Fazit<br />
32<br />
6 Fazit<br />
Für die Druckindustrie ist mit dem <strong>Job</strong> <strong>Definition</strong> <strong>Format</strong> und der Arbeit der internationalen<br />
Kooperation CIP4 eine wichtige Basis für einen Datenaustausch zwischen den Anwendungssystemen<br />
geschaffen. Da alle namhaften Hersteller um eine Standardisierung, Erweiterung und<br />
Verbreitung des JDF bemüht sind, steht dieses <strong>Format</strong> auf einem „breiten Fundament“. Außerdem<br />
wird der JDF-Standard durch Arbeitsgruppen des Konsortiums ständig weiterentwickelt<br />
und ausgebaut.<br />
Für einzelne Betriebe geht es nicht einfach darum, vorhandene Strukturen und Abläufe zu automatisieren<br />
und integrieren. <strong>Das</strong> würde bedeuten, dass Ineffizienzen in die Routineprozesse mit<br />
übernommen werden würden.<br />
Daraus ergibt sich für die Betriebe folgende Sichtweise: „Einerseits erscheint die Integration<br />
zu kompliziert und man schreckt davor zurück. Andererseits wird erkannt, dass die Informationsverarbeitung<br />
in einem integrierten System ganz anders verläuft und folglich einige organisatorische<br />
Konsequenzen gezogen werden müssten. Davor schreckt man aber auch zurück,<br />
weil die Mitarbeiter zu neuen Abläufen oft nur mit Überredungskunst zu bewegen sind. Die<br />
Konsequenzen sind fatal, weil dringend benötigte Rationalisierungsvorteile so nicht erreicht<br />
werden“ [THO 06, S. 69].<br />
Eine Veränderung der Abläufe ist aber bei einem JDF-Workflow zwangsläufig erforderlich:<br />
● Produktionsplanungen und damit Prozessplanungen sind Aufgaben im Auftragsmanagement<br />
● Bestimmte Arbeitsschritte (z. B. die Farbzonensteuerung) werden von der Produktion in das<br />
Auftragsmanagement verlagert.<br />
● Abläufe sind vorgegeben. Geplante Prozesse lassen sich nicht spontan und kurzfristig ändern.<br />
Jede Änderung muss erfasst werden und in den Workflow einfließen.<br />
● Alle am Prozess beteiligten Firmen, Produkte, Ressourcen wie Maschinen, Materialien usw.<br />
müssen klar definiert, im System erfasst und klassifiziert werden.<br />
● Verwendete Parameter sind genau und vollständig definiert. (Beispiel Farbe als Ressource:<br />
Ein „Blau“ als Farbdefinition ist nicht ausreichend; benötigt werden die genauen Farbbezeichnungen<br />
der Farbenhersteller wie z. B. „HSK 41 N“.)<br />
Die Geschäftsführung sollte diese Punkte in die Planung einbeziehen. Außerdem ist bei Re-/<br />
bzw. Erweiterungsinvestitionen darauf zu achten, dass Applikationen und Maschinen einen JDF-<br />
Workflow unterstützen (vgl. [KUE 04, S. 87]).<br />
Inwieweit die einzelnen Prozesse in den JDF-Workflow integriert werden sollen, ist von der Geschäftsführung<br />
zu entscheiden. So besteht die Möglichkeit, zunächst das Auftragsmanagement<br />
und die Druckvorstufe zu vernetzen, später dann – nach Anschaffung neuer Maschinen für Press<br />
und Postpress – weitere Abteilungen mit einzubinden.<br />
Durch den einfachen und klaren Aufbau des <strong>Job</strong> Definiton <strong>Format</strong> – textbasiert und klare Syntax<br />
– lassen sich neue Anwendungssysteme, aber auch weitere Ressourcen modular in den Workflow<br />
einbinden.<br />
Inwieweit neben dem Lieferanten auch der Kunde in den Druckerei-Workflow eingebunden<br />
werden soll, ist ebenfalls von der Geschäftsleitung zu klären.<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Fazit<br />
33<br />
Für die Druckerei der Johannesburg GmbH ist eine vollständige Prozessintegration des gesamten<br />
Workflows zurzeit nicht durchführbar.<br />
<strong>Das</strong> AMS-Anwendungssystem lässt sich um eine JDF-Schnittstelle erweitern und die Software<br />
in der Druckvorstufe hat bereits die JDF-Schnittstelle integriert. Außerdem ist der vorhandene<br />
Digitaldrucker mit dem vorgeschalteten Raster Image Prozessor ebenfalls CIP4-zertifiziert.<br />
Aber spätestens nach Erstellung der Druckplatte kommt es zu einem „Medienbruch“. Im Drucksaal<br />
und in der Weiterverarbeitung müssten erst große Investitionen getätigt werden, um die Maschinen<br />
an den digitalen Workflow anzubinden. Deutlich wird dieser Bruch an der zweigeteilten<br />
Auftragstasche – der obere Teil wird mit dem AMS-Anwendungssystem „Lector Druck“ erstellt,<br />
der untere Teil von den Mitarbeitern der einzelnen Produktionsabteilungen handschriftlich ausgefüllt<br />
(siehe auch Anhang 2b „Auftragstasche“).<br />
„Interessant“ im Hinblick auf eine Gesamt-Inte gration sind mittel- oder langfristige Ersatzinvestitionen.<br />
Dann könnte die Netzwerkfähigkeit der Produktionsmaschinen eine Handlungsalternative<br />
für die Geschäftsleitung darstellen.<br />
Kurzfristig lässt sich ein eingeschränkter JDF-Workflow umsetzen. Dabei spielt die Einbindung<br />
des Kunden in den Prozess noch keine Rolle.<br />
Viele technische Entwicklungen – auch wenn sie betriebswirtschaftlich sehr interessant sind<br />
– benötigen einen gewissen Zeitraum, bis sie in kleinen oder mittelständischen Druckereien<br />
„wahrgenommen“ bzw. umgesetzt werden.<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Literaturverzeichnis<br />
34<br />
Literaturverzeichnis<br />
[BET 08] BETGE, P.: VWA-Script Nr. XIII/34 Investition und Finanzierung, Leer 2009<br />
[BOE 08] BöHRINGER, J., BÜHLER, P., SCHLAICH, P.: Mediengestaltung,<br />
Berlin, Heidelberg 2008<br />
[HAN 05] HANSEN, H. R., NEUMANN, G.: Wirtschaftsinformatik 2, Stuttgart 2005<br />
[HAN 09] HANSEN, H. R., NEUMANN, G.: Wirtschaftsinformatik 1, Stuttgart 2009<br />
[KIP 00] KIPPHAN, H.: Handbuch der Printmedien, Berlin, Heidelberg 2000<br />
[KLE 06] KLEINE-DOEPKE, R., STANDORP, D., WIRTH, W.: Management-Basiswissen,<br />
München 2006<br />
[KUE 04] KÜHN, W., GRELL, M.: JDF – Prozessintegration, Technologie, Produktdarstellung,<br />
Berlin, Heidelberg 2004<br />
[PAA 08] PAASCH, U., MORITZ, C., OTTERSBACH, J. u. a.: Informationen verbreiten,<br />
Itzehoe 2008<br />
[SCH 06] SCHNEEBERGER, H. P.: PDF in der Druckvorstufe, Bonn 2008<br />
[SPI 06] SPITTA, T.: Informationswirtschaft – Eine Einführung, Heidelberg 2006<br />
[SPI 09] SPITTA, T.: VWA-Script Nr. XIII/38 Betriebliche Anwendungssysteme, Leer 2009<br />
[SPI 10] SPITTA, T.: VWA-Script Nr. XIII/53 Informations-Ressourcen-Management, Leer 2010<br />
[THO 06] THOME, R.: Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, München 2006<br />
Internetquellen<br />
[CIP 10] CIP4, http://www.cip4.org<br />
[HEI 10] HEIDELBERG, http://www.heidelberg.com<br />
[HOH 07] HOHMANN, O.: JDF-Grundlagen, Power-Point-Präsentation, 2007<br />
[LEC 10] LECTOR COMPUTERSYSTEME GMBH, http://www.lector.de<br />
[WIKI 10] WIKIPEDIA, http://wikipedia.de, 2010<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Anhang 2a<br />
35<br />
Technische Angaben (Überblick) zur Druckerei „Johannesburg Druck“<br />
Netzwerk: Switch mit Gigabit-Eternet mit Twisted-Pair Kabel (Cat7)<br />
Server: Fujitsu-Siemens-Server mit Xeon-Quadcore-Prozessor<br />
Betriebssysteme: Linux Suse 10 und Windows 2003 Server<br />
Datensicherung über Streamer-Laufwerk<br />
Vier Festplatten à ca. 1 Terrabyte (RAID 1 – „Mirroring“)<br />
Clients: Betriebssysteme: Windows XP Pro und Apple Mac OS 10<br />
Auftragsbearbeitung: Software: MIS-Software „Lector Druck“ der Fa. Lector Computersysteme<br />
GmbH (ohne JDF-Modul)<br />
Druckvorstufe/Satz: Software: „Creativ-Suite“ (Version 2 bis 4) der Fa. Adobe<br />
incl. Adobe Acrobat Pro 9.0 (PDF- und JDF-Erstellung)<br />
Preflight-Sofware „Pitstop Pro 7.0“ von der Fa. Enfocus<br />
Hardware: Apple-Computer „Macintosh“ G4, G5 und iMacs (Intel)<br />
Digitale Bogenmontage: Software: „Prinect Signastation 6.5“ der Fa. Heidelberg<br />
CTP-Plattenbelichtung: Software: „Prinect Meta Dimension 6.5“ der Fa. Heidelberg<br />
(incl. PDF-Engine)<br />
Belichter: „Supra-Setter A74“ Thermolaserbelichter<br />
der Fa. Heidelberg<br />
Digitaldruck: Laserdrucker „DocuColor 250“ der Fa. Xerox (<strong>Format</strong> max. 48 x 33 cm)<br />
mit RIP-Prozessor der Fa. Fiery<br />
Offsetdruck: Druckmaschinen „GTO“ der Fa. Heidelberg (<strong>Format</strong> 52 x 36 cm)<br />
Druckmaschine „SORM“ der Fa. Heidelberg (<strong>Format</strong> 74 x 52 cm)<br />
Weiterverarbeitung: Schneidemaschine der Fa. Polar-Mohr (max. Breite 92 cm)<br />
Falzmaschine „KC66“ der Fa. Stahl mit fünf Taschen- und einem<br />
Schwertfalz<br />
Sammelhefter der Fa. Müller-Martini mit fünf Stationen<br />
Die Klebebindung ist nur in der angeschlossenen Handbuchbinderei<br />
möglich, daher sind nur Kleinstauflagen rentabel. Größere Auflagen<br />
müssen fremdgefertigt werden.<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Anhang 2b<br />
36<br />
Screenshot vom Auftragsmanagementprogramm „Lector Druck“: Standbogen [LEC 10, 28.06.10]<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Anhang 2b<br />
37<br />
Auftragstasche: Teil oben von AMS-Software erstellt;<br />
Teil unten auf Papiertasche vorgedruckt, wird traditionell „von Hand“ ausgefüllt<br />
Auftragstasche Auftragsnummer : AU10-0049<br />
Auftragsdatum : 05.06.201 Termin :<br />
02.08.2010<br />
Sachbearbeiter : Heiner Kassens<br />
Vorgangsnummer:<br />
Arbeitsnummer :<br />
VG10-0427<br />
Peter Hilbrands<br />
Telefon :<br />
04965/891-0<br />
Beerumer Weg 5<br />
Telefax :<br />
26826 Weener<br />
E-Mail : halme-e-mail@ewetel.net<br />
zuständig :<br />
Best.-Nr. :<br />
Herr Peter Hilbrands<br />
Abteilung : Ausbilder<br />
Kunden-Nr. : 00095<br />
X<br />
Auftragstasche<br />
Neudruck Nachdruck mit Änderung unveränderter Nachdruck<br />
Korrektur am :<br />
Druckfreigabe am :<br />
Korrektur zurück am :<br />
erteilt durch :<br />
Auflage : 10 Exemplare<br />
Produkt : Diplomarbeit<br />
<strong>Format</strong> : DIN A4<br />
Umfang : Umschlag, 2 Blatt<br />
Inhalt, 1 Blatt, 48 Seiten<br />
Druck : Inhalt, 4/0-farbig Euroskala Toner<br />
Material : Umschlag, 300 g/m² Aktendeckel satiniert<br />
Inhalt, 115 g/m² Bilderdruck matt, weiss<br />
Verarbeitung : Umschlag, glatt beschneiden<br />
Inhalt, glatt beschneiden<br />
Endverarbeitung : Buchblock mit Hotmelt in Gaze klebebinden, dreiseitig beschneiden<br />
Versand : Selbstabholer<br />
Vorlagen : PDF-Daten (separiert) werden vom Kunden gestellt, auf Drucktauglichkeit prüfen<br />
Mediengestaltung<br />
Pfad: projekte johannesburg /<br />
Setzer: A-Korrekturzeit:<br />
Satzzeit: Schrift:<br />
Bogenmontage: geprüft:<br />
Bemerkungen:<br />
Plattenbelichtung<br />
GTO SORMZ Anzahl Platten:<br />
Plattenbelichtung: geprüft:<br />
Drucker<br />
Drucker: Druckzeit:<br />
Druckzahl: geprüft:<br />
Bemerkungen:<br />
Buchbinderei<br />
Buchbinder:<br />
Maschine: Zeit:<br />
Maschine: Zeit:<br />
Maschine: Zeit:<br />
Liefermenge:<br />
Bemerkungen:<br />
Verpackungsmaterial:<br />
Versandart: Kosten:<br />
geprüft:<br />
Sonstige Bemerkungen<br />
Bitte Druckfreigabebogen und zwei Druckmuster mit in die Tasche legen !!!<br />
auftragstasche_2006.indd 1 31.01.2008 15:59:48 Uhr<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Anhang 2b<br />
38<br />
Zugehörige Begleitpapiere: Druckbogen als Vorlage für den Standbogen<br />
(befindet sich in der Auftragstasche)<br />
Druckbogen<br />
Kalkulation-Nr.<br />
Vorgang-Nr.<br />
Auftrag-Nr.<br />
Produkt<br />
Produktteil<br />
KA10-05374 / Diplomarbeiten<br />
VG10-0427 / Diplomarbeit<br />
AU10-0049<br />
139 / Diplomarbeit<br />
142 / Inhalt<br />
ObjektID 151 / Inhalt<br />
<strong>Job</strong>ID<br />
161 / Drucken Digital ( Bogen )<br />
Druckart<br />
Schöndruck<br />
Montage Fuß an Kopf<br />
Druckmaschine 4180 - Xerox DC 250<br />
440,0<br />
2 1 0 ,0<br />
2 1 0 ,0<br />
9, 0<br />
Untere Greiferk ante: 6,0<br />
Druckbogenformat<br />
Rohbogenformat<br />
315,0<br />
2 9 7 ,0<br />
Datum 20.07.201013:10:19<br />
Kunde<br />
Peter Hilbrands<br />
31,5 x 44 cm, BB<br />
44 x 63 cm, SB<br />
Beerumer Weg 5<br />
26826 Weener<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands<br />
297, 0<br />
9, 0<br />
210, 0<br />
210, 0<br />
7, 0<br />
7, 0<br />
6, 0
VWA Leer e.V. Anhang 2b<br />
39<br />
Weitere Begleitpapiere: Schneideanweisung für die Weiterverarbeitung (Postpress)<br />
(aus angelieferten Rohbogen werden Druckbogen geschnitten)<br />
Papierzettel Auftrag<br />
Titel: Diplomarbeit<br />
Datum:<br />
20 Juli 2010 13:07 Uhr<br />
Kurzbeschreibung:<br />
Vorgangs-Nummer: VG10-0427<br />
Sachbearbeiter: Heiner Kassens<br />
Kunde:<br />
Telefon:<br />
04965/891-0<br />
Peter Hilbrands<br />
Telefax:<br />
EMail:<br />
Beerumer Weg 5<br />
zuständig:<br />
Herr Hilbrands<br />
26826 Weener Termin:<br />
02.08.2010<br />
Produkt-Nr. / Teil-Nr.<br />
139 / 151 Inhalt ( Diplomarbeit )<br />
115 g/m² Bilderdruck matt, weiss<br />
Papierzettel Auftrag<br />
AU10-0049 / 2<br />
Titel: Diplomarbeit<br />
Datum:<br />
20 Juli 2010 13:07 Uhr<br />
Kurzbeschreibung:<br />
Vorgangs-Nummer: VG10-0427<br />
Sachbearbeiter: Heiner Kassens<br />
Kunde:<br />
Telefon:<br />
04965/891-0<br />
Peter Hilbrands<br />
Telefax:<br />
EMail:<br />
Beerumer Weg 5<br />
zuständig:<br />
Herr Hilbrands<br />
26826 Weener Termin:<br />
02.08.2010<br />
Produkt-Nr. / Teil-Nr.<br />
139 / 150 Umschlag ( Diplomarbeit )<br />
300 g/m² Aktendeckel satiniert<br />
NUMMER<br />
Aktendeckel satiniert<br />
64,8 x 45,8 cm, schmalbahn, weiß<br />
MENGE (NETTO) MENGE (Brutto) Einheit<br />
17771-250<br />
5 5<br />
Bogen<br />
Bestellt am:<br />
Vorschneiden:<br />
Druckmaschine:<br />
bei:<br />
Deutsche Papier<br />
AU10-0049/ 2<br />
Bilderdruck matt<br />
115g/m², 44 x 63 cm, schmalbahn, weiss<br />
NUMMER MENGE (NETTO) MENGE (Brutto) Einheit<br />
BP-00210-107<br />
3 5<br />
Bogen<br />
Bestellt am:<br />
bei:<br />
Deutsche Papier<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands<br />
Lager<br />
Vorschneiden: Polar 92<br />
1 Schnitt, 5 Rohbogen, im <strong>Format</strong> 44 x 63 cm, SB, zu 2 Nutzen, schneiden auf<br />
31,5 x 44 cm, BB = 10 Druckbogen<br />
Druckmaschine: Xerox DC 250 Schöndruck<br />
Lager<br />
Polar 92<br />
4 Schnitte, 5 Rohbogen, im <strong>Format</strong> 45,8 x 64,8 cm, SB, zu 4 Nutzen, schneiden<br />
auf 21 x 29,7 cm, SB = 20 Bogen<br />
Auflage<br />
10<br />
Auflage<br />
10
VWA Leer e.V. Anhang 4a<br />
40<br />
Screenshots von dem Adobe-Acrobat-Pro-Programm: JDF-Erstellung/<strong>Definition</strong><br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Anhang 4b<br />
41<br />
Die Auftragsdefinition „Diplomarbeit“ als JDF-Datei (erstellt mit Adobe Acrobat Pro 9.0)<br />
<br />
<br />
Diplom-Hausarbeit von Peter Hilbrands Betreuung: Prof. Dr. Ing.<br />
Thorsten Spitta (i.R.)2010<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Anzahl Exemplare gesetzt auf 5<br />
<br />
Anzahl Exemplare gesetzt auf 10 von 5<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
VWA Leer e.V. Anhang 4b<br />
42<br />
Die Auftragsdefinition (Fortsetzung)<br />
Preferred=“None“/><br />
<br />
<br />
<br />
- Vordereinband hinzugefügt<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
- Rückeinband hinzugefügt<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
- Abschnitt Inhalt hinzugefügt <br />
<br />
ArtDeliveryIntent hinzugefügt <br />
<br />
<br />
<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Anhang 6<br />
43<br />
CD-ROM<br />
● Hilbrands_VWA-Diplomarbeit-2010.pdf – Diplomarbeit als druckbare PDF-Datei<br />
● JDFProdDef.jdf – die JDF-Auftragsbeschreibung<br />
● JDFProdDEF.html – die Auftragsbeschreibung als HTML-Datei<br />
● JDF1.4a.pdf – die JDF-Spezifikationen (Release 1.4a) vom CIP4-Consortium [CIP 10]<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands
VWA Leer e.V. Erklärung<br />
44<br />
Erklärung<br />
„Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte<br />
Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd<br />
wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen worden sind, durch Zitate als solche kenntlich<br />
gemacht habe.“<br />
Ort, Datum Unterschrift<br />
Stand: 29.08.10 12:18 Uhr Peter Hilbrands