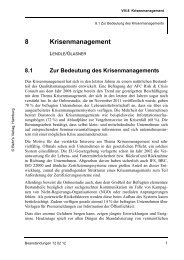Ausgabe 12/2012 - HACCP
Ausgabe 12/2012 - HACCP
Ausgabe 12/2012 - HACCP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURGAUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong><strong>12</strong>Das Wichtigste über Lebensmittelsicherheit,Hygiene und Qualitätsmanagement.20<strong>12</strong>INHALTTOP! THEMAAntibiotika in der Lebensmittelkette 03HYGIENE IN DERÖFFENTLICHKEITRECHTHYGIENEINTERNATIONALProduktrückrufe und Warnungen (Auswahl) 04Vor-Ort-Kontrollen in Geflügelbetrieben 05Daten zur Lebensmittelüberwachung 2011 05Mit Ciguatoxin belastete Fische zurückgerufen 05Mumifizierte Fledermaus in Flakes-Karton entdeckt 06RKI: Rotavirus bringt Tausende Kinder in die Klinik 06Hepatitis A-Welle in Niedersachsen 06Vibrionen: Erreger in Seafood auf dem Vormarsch? 06Linsen: Glyphosat in Hülsenfrüchten 07Herbstzeit – Kürbiszeit 07Wenn der Apfel fault: Pilzgift Patulin vermeiden 07Kontrolle des Internethandels von Lebensmitteln 08Auswahl aus dem Schnellwarnsystem der EU 08Veröffentlichung von Hygienemängeln in Gaststätten? 09Änderungen KontaminantenVO (EG) Nr. 1881/2006 09Bundesrat über die Arzneimittelrechtsnovelle 10Tiergesundheitsgesetz verabschiedet 10„Kasseler Stielkottelet – zum Rohverzehr geeignet“? 11„Pestizidrückstand“ nach VO (EG) Nr. 396/2005 11EFSA: BSE-Tests für gesunde Rinder entfallen <strong>12</strong>EU gegen Freibrief für Hormon Ractopamin <strong>12</strong>Österreich: TBC-Verdachtsfall − 39 Rinder getötet <strong>12</strong>Trichinellose in Russland und Argentinien <strong>12</strong>Fukushima-Fische strahlen noch immer 13USA: West-Nil-Fieber − über 200 Tote 13USA: Tod durch Energy-Drinks 13FOCUSLebensmittelhygiene aktuell: DVG-Tagung 20<strong>12</strong> in Garmisch-Partenkirchen 14HYGIENEINTERNATIONALAus dem weltweiten Food Safety Network (FSN) 19WISSENSCHAFTFÜR DIE PRAXISChronisch-entzündliche Darmkrankheiten 19Acrylamid in Lebensmitteln nahezu unverändert 20Säuglingsnahrung: Hygienische Zubereitung 20Aus der Wissenschaft für die Praxis 21SCHWERPUNKT-THEMABerufs- und Schutzkleidung 22LIEFERANTEN 23VERANSTALTUNGEN UND TERMINE 23REDAKTION | PROF. DR. WALTHER HEESCHEN, KIEL & DIPL.-ING. AGR. JAN PETER HEESCHEN M. SC., KIEL
TOP! THEMASEITE | 03Antibiotika in der LebensmittelketteNach der Entdeckung des Penicillins durch den britischen Forscher AlexanderFlemming im Jahr 1928 erfolgte der erste Einsatz zur Behandlungvon Menschen Mitte der 1940er-Jahre, und die Problematik einer möglichenResistenzentwicklung wurde bereits in der Nobelpreisrede desEntdeckers thematisiert. Der Einsatz von Antibiotika zur Leistungssteigerungseit den späten 1960er-Jahren basierte auf Beobachtungen, dassdie Mast- und Legeleistung von Hühnern bei Haltung auf Tiefstreu (mitnatürlich vorkommenden und Antibiotika produzierenden Pilzen) deutlicherhöht war. Der britische Swann-Report aus dem Jahr 1969 sprach sichaufgrund der Resistenzproblematik gegen den Einsatz antibiotischerWachstumsförderer in der Tierhaltung aus, und ein Verbot erfolgte inSchweden bereits 1986 und in der EU im Jahr 2006.Seit diesen sehr frühen Erkenntnissen und in Verbindung mit der Zunahmedes Resistenz-Phänomens gegenüber Antibiotika haben die Diskussionenzum Antibiotikaeinsatz in Human- und Veterinärmedizin sowie in derLandwirtschaft ständig zugenommen und in jüngster Zeit in Verbindungmit dem Auftreten Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)und von Enterobakterien mit einem breiten Spektrum an ß-Laktamasen(ESBL) in Wissenschaft und Öffentlichkeit hohe Aufmerksamkeit erreicht.Die Verantwortung für diese Entwicklung wird zwischen den Beteiligten(Humanmedizin, Veterinärmedizin und Landwirtschaft) in einer teilweiseemotionalisierten Diskussion hin und her geschoben. Erhebungen ausdem Jahr 2011 zum Einsatz von Antibiotika als Tierarzneimittel in einerMenge von über 1.700 t haben den teilweise einseitigen Schuldzuweisungenneue Nahrung gegeben.Vom 08. bis 10. Oktober 20<strong>12</strong> fand in Karlsruhe eine internationale Konferenzzum Antibiotikaeinsatz in der Lebensmittelkette („Antibiotics in theFood Chain“) statt, in dessen Verlauf umfassend zur Problematik diskutiertwurde. Nachstehend werden in Kurzfassung einige wichtige Aussagenbzw. Erkenntnisse wiedergegeben:Die Verbreitung von MRSA und ESBL kann über Staubemissionen ausStallungen mit hohem Tierbesatz bis in einen Umkreis von 600 m umden Betrieb erfolgen.Die wichtigsten Maßnahmen zur Begrenzung des Antibiotikaeinsatzesim Tierbestand sind– Vorbeugemaßnahmen gegen die Einschleppung von Krankheitserregern(„Biosecurity“),– Überlegter und vorsichtiger Einsatz („Prudent Use“),– Verbesserung von Tiergesundheit und Hygiene,– Impfungen sowie gutes betriebliches Management.Besonders strikte Regelungen zum Antibiotikaeinsatz bestehen in Dänemarkwie– Kein Dispensierrecht für Tierärzte,– Verzicht auf „kritische“ (weil in der Humanmedizin unverzichtbare) Antibiotikawie Cephalosporine und Fluorchinolone und– Einführung eines Ampelsystems.Die Beanstandungsquote im EU-Schnellwarnsystem aufgrund von Antibiotikarückständenist mit 0,1 bis 0,2 % vergleichsweise gering.Für Honig sind keine zugelassenen Antibiotika verfügbar, und Wartezeitenfür Bienen bzw. Honig wären auch praktisch nicht einhaltbar. SpeziellesProblem: Einsatz von Streptomycin im Pflanzenschutz!Das Vorkommen von Antibiotika (Tetrazykline) ist auch in Cerealien undin Gemüse über einen Transfer über den Boden nachgewiesen, allerdingsin sehr geringen Konzentrationen.Der therapeutische Einsatz von Antibiotika zur Behandlung erkrankterTiere ist unumstritten. Eine rein mengenmäßige Betrachtung ist nichtAntibiotikaeinsatz zur Leistungssteigerungseit Jahrzehnten in der Kritik und seit 2006in der EU verbotenZunahme des Resistenzphänomens mitAusbildung von MRSA (Methicillin-resistenteStaphylococcus aureus) und ESBL(Enterobacteriaceen mit erweitertemß-Laktamase-Spektrum)Risiken durch MRSA für Personen mitTierkontaktVorbeugemaßnahmen umfassen „Biosecurity“und „Prudent Use“ sowie einenhohen Stand des Hygiene- und BetriebsmanagementsDeutliche Erfolge beim Antibiotikaeinsatzdurch strikte Regelungen in DänemarkDas Vorkommen (Transfer aus dem Bodennach Gülleeinsatz) von Antibiotika inCerealien und Gemüsebedarf weitererErforschungFOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
SEITE | 04TOP! THEMADer therapeutische Antibiotikaeinsatz istunverzichtbar und sollte nicht allein mengenmäßigbeurteilt werdenEinbeziehung des Landwirtes zur Sicherungeines hohen hygienischen Standardsim Hygiene- und HaltungsmanagementVermeidung des Teufelskreises „Antibiotikagabe– Resistenzentwicklung – erhöhteAntibiotikagabe – erneute Resistenz-entwicklung– neue Antibiotika“ – undso weiterzielführend, da ein Ausweichen auf Wirkstoffe wie Cephalosporine undFluorchinolone zwar die eingesetzten Mengen reduzieren würde, dieResistenzproblematik jedoch erhöhen könnte.Im Fazit lässt sich feststellen, dass der besonders in der Kritik stehendeEinsatz von Antibiotika im Sinne einer „Herdenbehandlung“ (Geflügel,Schweine) nur dann zu vermindern ist, wenn ein hoher Stand der Tiergesundheitund die Berücksichtigung hoher Standards für den Schutz unddas Wohlergehen der Tiere angemessene Berücksichtigung finden. DerLandwirt muss daher in die Verantwortung einbezogen werden, da in Betriebenmit einem guten Hygiene- und Haltungsmanagement weitgehendauf den Einsatz von Antibiotika verzichtet werden kann.Ein „verantwortungsvoller“ Einsatz von Antibiotika in der Tie rbehandlungbedeutetKeine Vorbeuge (Prophylaxe),Resistenzprüfung der beteiligten Erreger undAusreichend lange und hohe Gabe der Wirkstoffe beiEinhaltung der vorgeschriebenen Wartezeiten.Eine Reduktion des Antibiotikaeinsatzes durch niedrige Dosierungen undweniger Behandlungstage führt nicht zu weniger, sondern eher zu einerErhöhung der Antibiotikaresistenzen!HYGIENE IN DER ÖFFENTLICHKEITQUELLE: www.lebensmittelwarnung.deProduktrückrufe und Warnungen (Auswahl)Die Bundesländer oder das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit(BVL) publizieren öffentliche Warnungen und Informationen(§ 40 des LFGB). In der Regel handelt es sich um Hinweise derzuständigen Behörden auf eine Information der Öffentlichkeit oder eineRücknahme- oder Rückrufaktion durch den Lebensmittelunternehmer.Erfasst werden einschlägige Informationen über Lebensmittel und mitLebensmitteln verwechselbare Produkte, die in den angegebenen Bundesländernauf dem Markt sind oder über das Internet verkauft werdenund möglicherweise bereits an Endverbraucher abgegeben wurden.Datum Produkt Grund der Warnung13.11.20<strong>12</strong> 2cm 16 Geleebonbons (abama Müting GmbH & Co. KG,Süsterfeldstr. 27, 52072 Aachen)Verwechselbarkeit mit Lebensmitteln,Verschluckbarkeit13.11.20<strong>12</strong> Red Snapper (Deutsche See GmbH, Bremerhaven) Ciguatera-Vergiftung<strong>12</strong>.11.20<strong>12</strong> Keiems Bloempje / Keiemse Witte / Keiemnaer / Keiemnaer 20+ / Listerien (Listeria monocytogene)Keiemtaler (Het Dischhof, Dodepaardenstraat 58, 8600 Keiem)09.11.20<strong>12</strong> Keiems Bloempje met kruiden, Keiems Bloempje natuur (Het Dischhof, ListerienDodepaardenstraat 58, 8600 Keiem, Belgien)02.11.20<strong>12</strong> Bio-Eier Güteklasse A (Betrieb: Erzeugercode 0-DE-0358591) Überschreitung des Höchstwertes vonnicht-dioxinähnlichen PCB31.10.20<strong>12</strong> Gemüseallerlei mit Mini-Pasta und zartem Bio-Rind (Baby BIO MENÜ)(Hersteller: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7,D-85276 Pfaffenhofen (Ilm))Verklumpungen (Erstickungsgefahr)AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG
HYGIENE IN DER ÖFFENTLICHKEITSEITE | 05Vor-Ort-Kontrollen in GeflügelbetriebenHervorragende Ergebnisse haben die ersten „QS“-Spotaudits in DeutschlandsGeflügelställen gebracht. Bei den bislang durchgeführten <strong>12</strong>.024Einzelbewertungen an 669 Standorten hatten die unabhängigen Kontrolleurein rund 9.834 Einzelbewertungen die Bestnote A vergeben.Lediglich in neun Fällen (0,07 %) wurden Anforderungen nicht erfüllt, diejedoch keine K.O.-Kriterien waren. Einen essentiellen Bestandteil desKontrollsystems stellen die Sanktionsmöglichkeiten dar: Bei Abweichungenwerden zunächst Korrekturmaßnahmen vereinbart, die es innerhalbeiner bestimmten Frist umzusetzen gilt. Das Nichteinhalten von K.O.-Kriterien führt zum Verlust der Lieferberechtigung und hat ein Sanktionsverfahrenzur Folge.KOMMENTAR:Leo Graf von Drechsel (Präsident des GeflügelwirtschaftsverbandesZDG): „Wennbei rund 82 % der unangekündigten Kontrollendie Bestnote vergeben wird, danndarf wohl von einer überdurchschnittlichenLeistung gesprochen werden.“QUELLE: Top Agrar vom 17.11.20<strong>12</strong>:www.topagrar.comDaten zur Lebensmittelüberwachung 2011Die amtliche Lebensmittelüberwachung der Länder hat in 2011 insgesamt933.751 Kontrollbesuche in 548.233 Betrieben durchgeführt. Bei knapp27 % (rund 146.000 Betrieben) stellten die Kontrolleure Verstöße festund leiteten entsprechende Maßnahmen ein. Die weitaus größte Zahl derBeanstandungen betrafen mit 53 % – wie auch schon in den Vorjahren –die allgemeine Betriebshygiene, gefolgt von Mängeln im Hygienemanagement(24 %) der Betriebe sowie der Kennzeichnung und Aufmachung(18 %) der Lebensmittel. Die Lebensmittelüberwachungsbehördenhaben 402.082 Proben untersucht und 13 % (52.442 Proben) beanstandet.Die höchste Beanstandungsquote wiesen mit 22 % „Lebensmittelfür besondere Ernährungsformen“ auf, gefolgt von den drei Produktgruppen„alkoholische Getränke (außer Wein)“, „Zuckerwaren“ sowie„Fleisch, Wild, Geflügel und Erzeugnisse daraus“ (17 bis 19 %). Vergleichsweisewenig beanstandet wurden die Produktgruppen „Schokolade,Kakao und kakaohaltige Erzeugnisse, Kaffee, Tee“, „Zusatzstoffe“,„Nüsse, Nusserzeugnisse, Knabberwaren“ sowie „Obst und Gemüse“(unter 10 %). Die Hälfte der beanstandeten Proben verstieß gegen Vorschriftender „Kennzeichnung und Aufmachung“. Achtzehn Prozent derProben wiesen mikrobiologische Verunreinigungen und 11 % Mängel inder Zusammensetzung auf.HINTERGRUND:Die Gesamtzahl der registrierten Betriebe,die der Lebensmittelüberwachung unterliegen,liegt bei 1,24 Mio. – es wurden44 % aller Betriebe in Deutschland kontrolliert,die Lebensmittel herstellen, bearbeitenoder verkaufen.QUELLEN: aid PresseInfo Nr. 46 vom 14.11.20<strong>12</strong>:www.aid.de Pressemitteilung des Bundesamtes fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit(BVL) vom 08.11.20<strong>12</strong>:www.bvl.bund.de Foodwatch-Pressemitteilung vom08.11.20<strong>12</strong>: www.foodwatch.de Stiftung Warentest vom 08.11.20<strong>12</strong>:www.test.deMit Ciguatoxin belastete Fische zurückgerufenSechs Menschen in Hamburg und Niedersachsen sind nach dem Verzehrvon Red Snapper erkrankt. Das Unternehmen „Deutsche See Fischmanufaktur“rief den mit einem Ciguatoxin belasteten Fisch aus dem Handelzurück. Laut Karla Götz (Sprecherin des Bremer Gesundheitsressorts) hatsich das Unternehmen ordnungsgemäß verhalten. Betroffen vom Ciguatoxin,das u. a. Durchfall und Erbrechen auslöst, sind zwei Familien in Hamburgund eine in Celle. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Fische warennach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Bremerhaven nur als unverpackteFrischware verkauft worden. Sie stammen aus dem IndischenOzean vor Sri Lanka, wo das Bio-Toxin normalerweise nicht vorkommt.Bekannt sind Bio-Toxin-Belastungen von Red Snapper vor allem aus derKaribik, dem Pazifik und Teilen des Indischen Ozeans.HINTERGRUND:Ciguatoxin wird von Kleinstlebewesengebildet, die auf Großalgen leben − wennFische diese Algen fressen, gelangt dasGift in die Nahrungskette.QUELLEN: Die Welt vom 13.11.20<strong>12</strong>: www.welt.de Lebensmittel Praxis vom 13.11.20<strong>12</strong>:www.lebensmittelpraxis.deFOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
HYGIENE IN DER ÖFFENTLICHKEITSEITE | 07Linsen: Glyphosat in HülsenfrüchtenNach Angaben des Verbrauchermagazins „Öko-Test“ enthalten vieleHülsenfrüchte das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat − in acht von13 konventionellen Marken war Glyphosat nachweisbar. Darüber hinauswiesen die Labore in manchen Produkten ein verbotenes Spritzmittelund Mineralöl nach. Laut „Öko-Test“ darf Glyphosat noch kurz vor derErnte zum Einsatz kommen, damit die Linsen absterben und gleichmäßigtrocknen. Alle neun untersuchten Bio-Produkte waren Glyphosat-frei. Inzwei Produkten wurde ein in der EU nicht zugelassenes Unkrautvernichtungsmittelentdeckt. In den Linsen eines französischen Herstellers wurdezudem Mineralöl nachgewiesen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus derPappverpackung stammt. Diese Öle können sich im Körper anreichern undvermutlich Schäden an Leber, Lymphknoten und Herzklappen verursachen.HINTERGRUND:Linsen enthalten viele Ballaststoffe undbewirken, dass die Nahrung länger undbesser gekaut wird – sie füllen den Magen,sättigen, lassen den Blutzuckerlangsamer ansteigen und sorgen für einegeregelte Verdauung.QUELLEN: Top Agrar vom 01.11.20<strong>12</strong>:www.topagrar.com Öko-Test-Magazin von November20<strong>12</strong>: www.oekotest.de Netdoktor vom 26.10.20<strong>12</strong>:www.netdoktor.deHerbstzeit – KürbiszeitAnlässlich eines Beschwerdefalls mit einem bitteren Speisekürbis wurdenverschiedene essbare und dekorative Vertreter dieses beliebten Gemüsesunter die Lupe genommen. Bittere Kürbisse kommen bei Speisekürbissennur als seltene Einzelfälle vor. Zierkürbisse hingegen enthalten häufigerdie giftigen Cucurbitacine, die die Früchte ungenießbar machen. Außerim Beschwerdefall wurden in keinem weiteren Speisekürbis (insgesamt<strong>12</strong> Proben) Cucurbitacine nachgewiesen. Als Beschwerdeprobe wurdeein zubereitetes Kürbisgemüse vorgelegt, das durch einen extrem starkenBittergeschmack auffiel. Die Beschwerdeführerin erkrankte nach Verzehran den klassischen Symptomen Erbrechen und Durchfall. In dieser Probewurden in der Summe nur rund 1,3 mg Cucurbitacine pro kg Kürbisgerichtbestimmt, daher ist davon auszugehen, dass noch weitere Cucurbitacin-Vertreter neben den vier untersuchten Typen B, D, E und I enthalten waren.Bei den insgesamt 26 untersuchten Zierkürbissen wurde das CVUAbei neun Proben fündig, wobei die Summengehalte von Spuren kleiner10 µg/kg bis 218 mg/kg reichten.Wenn der Apfel fault: Pilzgift Patulin vermeidenPatulin ist ein Pilzgift, das beim Wachstum vieler Schimmelpilze auf Lebens-und Futtermitteln gebildet und vom Pilzgeflecht ausgeschiedenwird. Gerade in angefaultem Kernobst ist es anzutreffen. In Äpfeln oderBirnen kann Patulin bis zu 1 g pro kg Faulstelle gefunden werden. BeiÄpfeln wandert Patulin praktisch nicht in das gesunde Gewebe, sodassbei großzügigem Entfernen der angefaulten braunen Stellen das Obstverarbeitet bzw. verzehrt werden kann. Bei anderen Obstarten kann auchder gesunde Teil Patulin-haltig sein. Patulin kann zu Blutungen in derNiere, Milz oder Leber führen. Als Zellgift kann es in höheren Dosen Übelkeitoder Magenschleimhautentzündungen auslösen oder es führt zurSchädigung der Leber. Im Tierversuch wirkt es bei Ratten unter die Hautgespritzt krebserregend. Bei Aufnahme über die Nahrung konnte keinekarzinogene Wirkung festgestellt werden. Bei der Verarbeitung zu Säften,Püree und Mus sollten keine Früchte mit Faulstellen verwendet werden.Das Pasteurisieren der Fruchtsäfte ist meist wirkungslos, da Patulin beikurzer Hitzeeinwirkung relativ beständig ist. Soll das Patulin entfernt werden,wird der Saft entweder vergoren oder geschwefelt.HINTERGRUND:Cucurbitacine sind Bitterstoffe, die hauptsächlichin der Familie der Kürbisgewächseund Braunwurzgewächse (z. B. Bacopamonnieri) vorkommen − eine besondereVergiftungsgefahr kann von Zier- und Wildkürbissenausgehen.QUELLE: Informationsdienst des Chemischen undVeterinäruntersuchungsamtes (CVUA)Stuttgart vom 30.10.20<strong>12</strong>:www.ua-bw.deHINTERGRUND:Patulin-Höchstwerte sind nach der EU-Kontaminantenverordnung für Fruchtsäfteund Fruchtsaftkonzentrate, für feste Apfelerzeugnisseund für Spirituosen undandere alkoholische Getränke mit je 50 µg/kg festgesetzt − für Apfelerzeugnisse fürSäuglinge und Kleinkinder gilt ein Höchstwertvon 10 µg/kg.QUELLEN: VerbraucherFenster Hessen vom29.10.20<strong>12</strong>:www.verbraucherfenster.hessen.de aid PresseInfo Nr. 41 vom 10.10.20<strong>12</strong>:www.aid.deFOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
SEITE | 08HYGIENE IN DER ÖFFENTLICHKEITHINTERGRUND:Zum Schutz der Verbraucher hat dasBundesamt für Verbraucherschutz undLebensmittelsicherheit (BVL) einen Flyermit Hinweisen zum sicheren Einkauf vonLebensmitteln im Internet herausgegeben.Kontrolle des Internethandels von LebensmittelnDas Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)hat mit den Ländern das Pilotprojekt zum Thema „Kontrolle des Internethandelsvon Lebensmitteln“ durchgeführt und im Nachgang hierzugemeinsam mit den Ländern FAQ zu Fragen der Registrierung und derPflichten von Lebensmittelunternehmern abgestimmt, die auf der Homepagedes BVL zur Verfügung stehen. Es enthält neben grundlegendenDefinitionen („Lebensmittel“, „Lebensmittelunternehmen“) Informationenüber Art und Umfang der Registrierungspflicht, zu beachtendelebensmittelrechtliche Regelungen sowie hilfreiche weiterführende Linkszu Einzeldokumenten, Institutionen oder Suchmaschinen.QUELLEN: BLL-Rundschreiben (nur für Mitglieder verfügbar) Nr. 511des Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkundee. V. (BLL) vom 23.10.20<strong>12</strong>: www.bll.de www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/04_Antragsteller-Unternehmen/<strong>12</strong>_UeberwachungInternethandel/lm_ueberwachung_internethandel_node.htmlQUELLEN: www.bvl.bund.de http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htmAuswahl aus dem Schnellwarnsystem der EUDie nachstehende Auswahl aus dem Schnellwarnsystem (Zeitraum:20.10. bis 20.11.20<strong>12</strong>) enthält interessante Hinweise zu lebensmittelhygienischenProblemen bzw. Beanstandungen. Die vollständigen Listen sindauf den Websites des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit(BVL) bzw. der Europäischen Kommission einzusehen.Die nach wie vor häufigen Mitteilungen über Mykotoxine in Pistazien undNüssen (insbesondere aus der Türkei und dem Iran) sowie über nicht zugelasseneFarbstoffe in verschiedensten Lebensmitteln werden nur nochin Einzelfällen aufgenommen.Datum der Meldung Beschreibung der Warnung Ursprungsland15.11.20<strong>12</strong> Fehlende Genusstauglichkeitsbescheinigung für Paranüsse Brasilien14.11.20<strong>12</strong> Listeria monocytogenes in Rettichsprossen Niederlande14.11.20<strong>12</strong> Migration von Formaldehyd aus Küchenutensilien (Lochkellen, Rührkellen)China via die Schweiz14.11.20<strong>12</strong> Listeria welshimeri und Salmonellen der Gruppe B inNiederlandeAlfalfasprossen13.11.20<strong>12</strong> Nicht gekennzeichnete Nüsse in Karamell-Riegeln Deutschland<strong>12</strong>.11.20<strong>12</strong> Nitrofuran (Metabolit) - Furazolidon (AOZ) in gefrorenen Black Tiger- IndienGarnelen (Penaeus monodon)09.11.20<strong>12</strong> Quecksilber in gekühltem Seehecht Südafrika09.11.20<strong>12</strong> Nicht zugelassenes neuartiges Lebensmittel sowie mangelhafte ChinaKennzeichnung bei Tee08.11.20<strong>12</strong> Nicht zugelassenes neuartiges Lebensmittel in Tee China08./09./14.11.20<strong>12</strong> Listeria monocytogenes in Käse Belgien07.11.20<strong>12</strong> Aflatoxine in Feigen Türkei07.11.20<strong>12</strong> Radioaktivität in frischen Pfifferlingen Ukraine07.11.20<strong>12</strong> Fehlende Kennzeichnung bei gekühlten Schafskarkassen Belgien07.11.20<strong>12</strong> Erstickungsgefahr durch Verzehr von Kaugummi China via Deutschland06.11.20<strong>12</strong> Nicht-dioxinähnliche PCB bei Bio-Eiern Deutschland05./08.11.20<strong>12</strong> Erstickungsgefahr bei dem Verzehr von Bio-Babybrei Deutschland31.10.20<strong>12</strong> 1,3-Dimethylamylamin (DMAA) in Nahrungsergänzungsmitteln Vereinigte Staaten via dieNiederlande26.10.20<strong>12</strong> Aflatoxine in frischen Feigen Türkei26.10.20<strong>12</strong> Histamin in Sardinen (Sardina pilchardus) Marokko26.10.20<strong>12</strong> Überhöhter Aluminiumgehalt in Vermicelli Südkorea via die NiederlandeAUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG
HYGIENE IN DER ÖFFENTLICHKEITSEITE | 09Datum der Meldung Beschreibung der Warnung Ursprungsland25.10.20<strong>12</strong> Salmonella Thompson in geräuchertem Lachs Griechenland, mit Rohmaterialaus Norwegen, via die Niederlande25./26.10. und09.11.20<strong>12</strong>Lebensmittelbedingter Krankheitsausbruch vermutlich verursachtdurch gefrorene Erdbeeren23.10. und 13.11.20<strong>12</strong> Bombage bei Wurst portioniert in Schalen Deutschland22.10.20<strong>12</strong> Ochratoxin A in gemahlenen Muskatnüssen Deutschland (Rohmaterial ausden Niederlanden)19.10.20<strong>12</strong> Salmonella Bredeney und Salmonella Lexington in Moringa-Pulver Indien19./24./26./31.10.und 09.11.20<strong>12</strong>Aflatoxine in getrockneten FeigenTürkeiChinaRECHTVeröffentlichung von Hygienemängeln in Gaststätten?Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe hat dem Eilantrageines Pforzheimer Gaststättenbetreibers mit Beschluss vom 07.11.20<strong>12</strong>stattgegeben, der sich gegen eine Internetveröffentlichung über bei einerKontrolle festgestellte Betriebshygiene-/Reinigungsmängel durch dieStadt Pforzheim wandte. Zur Begründung führte das VG Karlsruhe aus:„Es bestünden aber – so das Verwaltungsgericht − erhebliche Zweifel, ob§ 40 Abs. 1a LFGB die Behörde auch dazu ermächtige und verpflichte, dieÖffentlichkeit über Mängel bei der Hygiene eines Gaststättenbetreiberszu informieren. Der Wortlaut des Gesetzes spreche dafür, dass die Behördenur zur Herausgabe einer sogenannten Produktwarnung ermächtigtwerde, also zur Information über ein konkretes Lebensmittel, das unterVerstoß gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften hergestellt, behandeltoder in den Verkehr gelangt sei. Dass die Vorschrift über ihren Wortlauthinaus die Pflicht der Behörden begründe, die Öffentlichkeit generellüber hygienische Mängel in Betrieben zu informieren, die Lebensmittelverarbeiteten und/oder in Verkehr brächten, lasse sich auch der amtlichenBegründung des Gesetzes nicht entnehmen. Angesichts der erheblichenZweifel an der Rechtmäßigkeit der geplanten Veröffentlichung überwiegedas Interesse des Gaststättenbetreibers, hiervon vorläufig verschont zubleiben.“HINTERGRUND:§ 40 Abs. 1a LFGB verpflichtet die zuständigenBehörden, die Öffentlichkeit unterNennung des betroffenen Unternehmersüber bestimmte Verstöße im Bereich desLebensmittelrechts zu informieren − derBeschluss (2 K 2430/<strong>12</strong>) vom 07.11.20<strong>12</strong>ist nicht rechtskräftig.QUELLEN: BLL-Rundschreiben (nur für Mitgliederverfügbar) Nr. 556 des Bundes für Lebensmittelrechtund Lebensmittelkundee. V. (BLL) vom 15.11.20<strong>12</strong>: www.bll.de Pressemitteilung des VG Karlsruhevom 13.11.20<strong>12</strong>: http://vgkarlsruhe.de/servlet/PB/menu/<strong>12</strong>80205/index.html?ROOT=11974<strong>12</strong>Änderungen KontaminantenVO (EG) Nr. 1881/2006Im Rahmen der diesjährigen Sitzung der Codex Alimentarius-Kommission(CAC) vom 02. bis 07.07.20<strong>12</strong> in Rom wurde u. a. der Vorschlag des CodexKomitees für Kontaminanten (CCCF) angenommen, für Aflatoxine ingetrockneten Feigen einen Höchstgehalt von 10 µg/kg festzulegen. DerCodex-Höchstgehalt gilt für die Summe der Aflatoxine (B1, B2, G1, G2)in verzehrsfertigen („ready-to-eat“) getrockneten Feigen. Nach Angabenvon FoodDrinkEurope hat der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelketteund Tiergesundheit (SCoFCAH; STALuT) beschlossen, den Codex-Höchstgehalt zu übernehmen. Neben einem Höchstgehalt für die Summean Aflatoxinen (B1, B2, G1, G2) wird im Rahmen der europäischen Kontaminantenverordnung(EG) Nr. 1881/2006 auch ein Höchstgehalt für AflatoxinB1 allein von 6 µg/kg festgelegt. Eine Unterscheidung zwischen verzehrsfertigengetrockneten Feigen und Feigen, die zuvor einer Sortierung oderphysikalischen Behandlung unterzogen werden, ist nicht vorgesehen.HINTERGRUND:Die Verordnung (EU) Nr. 1058/20<strong>12</strong> überHöchstgehalte für Aflatoxine in getrocknetenFeigen“ wurde am 13.11.20<strong>12</strong> imAmtsblatt der EU veröffentlicht (ABl. L 313,S. 14) und tritt am 03.<strong>12</strong>.20<strong>12</strong> in Kraft.QUELLE: BLL-Rundschreiben (nur für Mitgliederverfügbar) Nr. 544 und 551 des Bundesfür Lebensmittelrecht und Lebensmittelkundee. V. (BLL) vom 09. und14.11.20<strong>12</strong>: www.bll.deFOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
SEITE | 10RECHTKOMMENTAR:Deutscher Bauernverband (DBV): „Werdas richtige Ziel einer Reduzierung desAntibiotikaeinsatzes allein mit noch mehrBürokratie erreichen will, der liegt falsch.“QUELLEN: Vetline.de vom 07.11.20<strong>12</strong>: www.vetline.de Top Agrar vom 02. und 05.11.20<strong>12</strong>:www.topagrar.com Animal Health Online vom 05.11.20<strong>12</strong>:www.animal-health-online.de/gross/ Pressemitteilung des Deutschen Bauernverbandes(DBV) vom 02.11.20<strong>12</strong>:www.bauernverband.deBundesrat über die ArzneimittelrechtsnovelleDie Vorstellungen der Bundesregierung zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzesin der Tierhaltung gehen den Ländern nicht weit genug. Inseiner in der 44. Kalenderwoche beschlossenen Stellungnahme zumvorliegenden Entwurf für eine Novelle des Arzneimittelgesetzes verlangtder Bundesrat u. a., die vorgesehene Antibiotika-Datenbank bundeseinheitlichzu regeln. Zudem verlangen die Länder detailliertere Vorgaben fürdie geforderten Angaben der Betriebsleiter zum Antibiotikaeinsatz in ihrenBeständen. Dazu zählt eine Differenzierung nach Nutzungsarten sowieAngaben zur verabreichten Menge des jeweiligen Arzneimittels pro Tierund Tag. Als letztes Mittel will der Bundesrat den zuständigen Behördenermöglichen, einem Betriebsleiter die Haltung von Tieren zu untersagen,wenn Maßnahmen zur Minderung des Antibiotikaeinsatzes wiederholtkeine Wirkung zeigen. Nicht mehrheitsfähig waren im Bundesrat Forderungenzur Festlegung konkreter Reduktionsziele.HINTERGRUND:Im Rahmen der Prävention soll das Friedrich-Loeffler-Institut(FLI) zukünftig dieweltweite Tierseuchensituation beobachtenund frühzeitig auf eventuelle Gefahrenaufmerksam machen (z. B. drohendeEinschleppung von Tierseuchenerregerndurch lebende Tiere oder Erzeugnisse)− zudem soll am FLI eine „Ständige ImpfkommissionVeterinärmedizin“ etabliertwerden, die mit unter Berücksichtigungder Tierseuchensituation in DeutschlandImpfempfehlungen erarbeiten soll.QUELLEN: Pressemitteilung Nr. 322 des Bundesministeriumsfür Ernährung, Landwirtschaftund Verbraucherschutz (BMELV) vom31.10.20<strong>12</strong>: www.bmelv.de Pressemitteilung des Deutschen Bauernverbandes(DBV) vom 31.10.20<strong>12</strong>:www.bauernverband.deTiergesundheitsgesetz verabschiedetDas Bundeskabinett hat am 31.10.20<strong>12</strong> das Gesetz zur Vorbeugung vorund Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz) verabschiedet− es wird das Tierseuchengesetz ablösen. Das neue Tiergesundheitsgesetzenthält eine Reihe von neuen Regelungen zum vorbeugendenSchutz vor Tierseuchen, deren Bekämpfung sowie zur Verbesserungder Überwachung. Beispielsweise wird der Personenkreis erweitert, dereine anzeigepflichtige Tierseuche anzeigen muss. Dieses sind nebenden Amtsveterinären künftig beispielsweise auch Tiergesundheitsaufseher,Veterinäringenieure, amtliche Fachassistenten und Bienensachverständige.Zudem wird ein rechtlicher Rahmen geschaffen, neben derBekämpfung von Tierseuchen auch vorbeugend tätig zu werden, um dieTiergesundheit zu erhalten und zu fördern (z. B. eigenbetriebliche Kontrollen,verpflichtende hygienische Maßnahmen). Eine weitere neue Rechtsgrundlageermöglicht künftig ein Monitoring über den Gesundheitsstatusvon Tieren: Durch die Untersuchung repräsentativer Proben können damitGefahren für die Tiergesundheit frühzeitiger erkannt werden. Zudemkönnen die zuständigen Behörden künftig Schutzgebiete einrichten, d. h.,Gebiete, die überwiegend frei sind von bestimmten Tierseuchen und indie Tiere nur mit nachgewiesenem entsprechenden Gesundheitsstatusverbracht werden können.AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG
RECHTSEITE | 11„Kasseler Stielkottelet – zum Rohverzehr geeignet“?Ausgangspunkt des Verfahrens waren im Rahmen einer Hygieneuntersuchungvom Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Görlitzfestgestellte Salmonellen im „Kasseler Stielkottelet“ der Klägerin – einfleischverarbeitender Betrieb. Beanstandet wurde der fehlende Hinweisdarauf, dass das Lebensmittel vor dem Verzehr ausreichend durcherhitztwerden soll. Daraufhin begehrte die Klägerin die Feststellung, dassdas von ihr hergestellte und in den Verkehr gebrachte Erzeugnis mit derBezeichnung „Kasseler Stielkottelet“ in objektiver Hinsicht nicht gegeneuroparechtliche bzw. nationale Vorschriften des Lebensmittelrechtsverstoße. Es handele sich nicht um ein unsicheres Lebensmittel, da esgem. Art. 14 Abs. 3 a) Basis-V auf die normalen Bedingungen der Verwendungankomme. „Kasseler Stielkottelet“ werde jedoch üblicherweisedurchgegart verzehrt, weshalb ein Durchgarhinweis entbehrlich sei. DieKlage war erfolglos. Das Verwaltungsgericht Berlin entschied, dass derfehlende Hinweis auf das notwendige Durcherhitzen ein Verstoß gegenArt. 14 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 178/2002 (Basis-VO) begründet. Das vonder Klägerin in den Verkehr gebrachte Kasseler gelte als nicht sicher, daes im Sinne von Art. 14 Abs. 2a) Basis-V gesundheitsschädlich sei: Eswar jedenfalls zum Teil in einem Maße mit Salmonellen behaftet, dasden Rohverzehr zu einem Risiko mache. Entgegen der Klägerauffassungsei eine abweichende Beurteilung auch nicht in Anwendung von Art. 14Abs. 3 der VO (EG) Nr. 178/2002 geboten. Zur Begründung führte esInternet-Kochrezepte an. Darüber hinaus bliebe das streitgegenständlicheProdukt auch bei einer unterstellten normalen Verwendung ausschließlichdurchgegarten Kasselers unsicher, da nicht zweifelsfrei erkennbar sei, obes sich um ein bereits durcherhitztes oder noch rohes Erzeugnis handele(Ergebnis einer Inaugenscheinnahme der von der Klägerin vorgelegtenMuster durch das Gericht).HINTERGRUND:Kasseler-Produkte werden zwar üblicherweisenicht nur roh, sondern auch bereitsim durchgegarten Zustand in den Verkehrgebracht − ein Rohverzehr kann abernach vernünftigem Ermessen nicht ausgeschlossenwerden (Urteil des VerwaltungsgerichtsBerlin vom 13.06.20<strong>12</strong> (Az.VG 14 K 63.10)).QUELLEN: BLL-Recht Aktuell (nur für Mitgliederverfügbar) Nr. 3 des Bundes für Lebensmittelrechtund Lebensmittelkunde e. V.(BLL) vom 29.10.20<strong>12</strong>: www.bll.de www.kochbar.de/rezept/356811/Kasseler-Carpaccio-mit-Sauerkrautpestoan-Sauerkrautsalat.html„Pestizidrückstand“ nach VO (EG) Nr. 396/2005Immer wieder treten Probleme mit der Beurteilung von Substanzen auf,die von der Lebensmittelüberwachung als „Pestizidrückstand“ eingestuftwerden, deren Herkunft in dem entsprechenden Produkt aber entwederungeklärt ist oder deren Vorhandensein nicht auf die Anwendung vonPflanzenschutzmitteln zurückgeht. Beispiele sind Nikotin, Biphenyl, DEETund QAV (insbesondere DDAC und BAC). Da unklare Ursachen oder andereUrsachen als die Anwendung als Pflanzenschutzmittel bei der Festsetzungvon Rückstandshöchstgehalten in Lebensmitteln gemäß Verordnung(EG) Nr. 396/2005 üblicherweise nicht berücksichtigt werden, führtdie Einstufung als „Pestizidrückstand“ in diesen Fällen in der Regel dazu,dass die Lebensmittel als „nicht verkehrsfähig“ beurteilt werden. In 20<strong>12</strong>konnte ein Positionspapier von FoodDrinkEurope mit dem Titel „Regulation(EC) No 396/2005 and Substances not Used as Pesticides” fertiggestelltwerden, an dem der BLL aktiv mitgearbeitet hat. Dieses Dokumentwurde der EU-Kommission in Zusammenhang mit den Diskussionen zuQAV in Lebensmitteln im Sommer 20<strong>12</strong> übergeben.HINTERGRUND:Der Bund für Lebensmittelrecht undLebensmittelkunde e. V. (BLL) hat einerechtliche Stellungnahme zur Frage derAnwendbarkeit der Verordnung (EG) Nr.396/2005 auf unerwünschte Stoffe, derenUrsache ungeklärt ist bzw. die nicht ausder Verwendung von Pflanzenschutzmittelnresultieren, erarbeitet − die Ausdehnungder unklar formulierten Definition von„Pestizidrückstand“ auf Biozid- und Tierarzneimittelrückständewird abgelehnt.QUELLE: BLL-Rundschreiben (nur für Mitgliederverfügbar) Nr. 5<strong>12</strong> des Bundes für Lebensmittelrechtund Lebensmittelkundee. V. (BLL) vom 24.10.20<strong>12</strong>: www.bll.deFOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
SEITE | <strong>12</strong>HYGIENE INTERNATIONALQUELLEN: Animal Health Online vom 02.11.20<strong>12</strong>:www.animal-health-online.de/gross/ EFSA Journal (20<strong>12</strong>; 10(10): 2913(90 pp.), doi: 10.2903/j.efsa.20<strong>12</strong>.2913)EFSA: BSE-Tests für gesunde Rinder entfallenFür die EU-Mitgliedsstaaten Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich,Großbritannien, Irland, die Niederlande und Spanien könnten bald die BSE-Tests bei gesunden Schlachtrindern wegfallen. Aus einem aktuellen Gutachtender Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Parmaist zu entnehmen, dass sich das BSE-Risiko beim Wegfall dieser Testsnicht erhöhen würde. Nicht betroffen hiervon wären die Untersuchungenvon verhaltensauffälligen oder verendeten Tieren über 48 Monate.HINTERGRUND:Ractopamin gehört zur Kategorie derBeta-Agonisten, deren Verwendung mitAusnahme einiger therapeutischer Einsatzgebietein der EU bei der Lebensmittelerzeugungdienenden Tieren durch dieRichtlinie 96/22/EG verboten ist − nachCodex Alimentarius sind Ractopamin-Rückstände von bis zu 10 µg/kg RindoderSchweinefleisch, 40 µg/kg Leberund 90 µg/kg Nieren unbedenklich.EU gegen Freibrief für Hormon RactopaminDie EU-Mitgliedstaaten kritisieren geschlossen die Entscheidung derVereinten Nationen (UN), Rückstandshöchstwerte für das WachstumshormonRactopamin in Fleisch einzuführen. In einer Stellungnahme, diebeim jüngsten Agrarrat am 22.10.20<strong>12</strong> einstimmig angenommen wurde,bedauern die Mitgliedstaaten den von der UN angewendeten Mehrheitsbeschluss,da doch sonst auf einen Konsens hingearbeitet werde. DerRat bekräftigt das prinzipielle EU-Verbot von Wachstumsförderern in derTierhaltung, auch für Importe, und erinnert an bestehende wissenschaftlicheZweifel zur Sicherheit von Ractopamin. Er wies die EU-Kommissionan, auch künftig darauf zu achten, dass Drittstaaten, die das Anabolikumeinsetzen, für Exporte in die EU über eine strikt getrennte, RactopaminfreieProduktionslinie verfügen.QUELLE: Top Agrar vom 29.10.20<strong>12</strong>:www.topagrar.comHINTERGRUND:Es werden alle Rinderbestände, die mitdem betroffenen Verdachtsbestand überTierzukäufe oder gemeinsame AlpungKontakt hatten, auf TBC getestet.QUELLE: Animal Health Online vom 14.11.20<strong>12</strong>:www.animal-health-online.de/gross/KOMMENTAR:CRM Centrum für Reisemedizin: „Nebender Beachtung der Nahrungsmittelhygienesollten nur durchgegarte Fleischprodukteverzehrt werden.“Österreich: TBC-Verdachtsfall − 39 Rinder getötetDie Fleischuntersuchung bei einer Schlachtung in Salzburg (Österreich)hat bei einem 13-jährigen Rind einen Tuberkulose-Verdacht ergeben. DerBetrieb im Zillertal wurde noch am selben Tag für den Tierverkehr undMilchlieferungen gesperrt und alle Tiere auf TBC getestet. Nach Angabenvon Josef Kössler (Landesveterinärdirektor) reagierten 39 Rinder bei diesemTest positiv, weshalb die betroffenen Tiere diagnostisch getötet undGewebeproben zur weiteren Abklärung an das Referenzlabor geschicktwurden. Der Bestand bleibt vorläufig gesperrt − Milch darf nur nachkontrollierter Erhitzung verwendet werden. Einen Rückschluss über dieEinschleppung der Krankheit in den Bestand wird die sog. Fingerprint-Methode liefern, mit der bei den vom Probematerial angezüchtetenKrankheitserregern die Herkunft festgestellt werden kann.Trichinellose in Russland und ArgentinienDas CRM Centrum für Reisemedizin warnt vor Infektionen mit Trichinenin Russland und Argentinien. In der Region Krasnoyarsk in Sibirien sindAnfang Oktober 20<strong>12</strong> 19 Personen an Trichinellose erkrankt – eine Personist gestorben. Alle hatten Fleisch von einem bestimmten Marktstand verzehrt− Trichinen wurden darin nachgewiesen. In Argentinien sind 59 Personenin Tandil (Provinz Buenos Aires) betroffen. Alle Erkrankten hattenzuvor Würstchen an einem Straßenstand gegessen.QUELLE: Ärztezeitung vom 02.11.20<strong>12</strong>:www.aerztezeitung.deAUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG
SEITE | 14FOCUS LEBENSMITTELSICHERHEITFakten, Hintergründe und Folgen aktueller EreignisseDVG-Tagung „Lebensmittelhygiene“ 20<strong>12</strong>:Schwerpunkte und Verfügbarkeit der Kurzfassungenim TagungsbandEU-Lebensmittelhygienerecht: Nach denÜberlegungen der Kommission sind nurgeringe Änderungen bzw. Ergänzungen zuerwartenIn der Diskussion: Dekontamination vonSchlachttierkörpern und Zulassung vonSprossenbetriebenNach wie vor in kontroverser Diskussion:öffentliche Warnungen und Meldepflichtprivater LaboratorienLebensmittelhygiene aktuell:DVG-Tagung 20<strong>12</strong> in Garmisch-PartenkirchenDie 53. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes „Lebensmittelhygiene“ derDeutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) fand vom 25. bis28. September 20<strong>12</strong> als „Dreiländertagung“ (Deutschland, Österreichund Schweiz) in Garmisch-Partenkirchen statt. Insgesamt wurden 200Beiträge (Vorträge und Poster) von den mehr als 600 Teilnehmern ausSicht der Praxis, Lebensmittelüberwachung und Wissenschaft diskutiert.Schwerpunkte des Programms warenLebensmittelrecht (Stand der Revision des EU-Lebensmittelhygienerechts,Lebensmittelsicherheit und Verbraucherinformation, öffentlicheWarnungen, § 44 LFGB etc.);Lebensmittelhygiene mit einem Schwerpunkt Tierhaltung – Tiergesundheit− Lebensmittelsicherheit;Milchhygiene von der Rohmilch bis zu Milchprodukten;Fleischhygiene einschließlich eines Workshops über „Lebensmittelketten-orientierteSchlachttier- und Fleischuntersuchung“ sowiePoster-Präsentationen mit einem beeindruckenden Umfang an methodischenund technischen Details.Die Kurzfassungen der Beiträge finden sich in einer Sonderausgabeder Zeitschrift „Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle“(ISSN 0945-3296). Bei der Beschaffung der Kurzfassungen bzw. derKontaktadressen ist die Redaktion gern behilflich. Über ausgewählte Themenund Diskussionsergebnisse wird nachstehend berichtet.1. LebensmittelrechtDas „neue“ EU-Lebensmittelhygienerecht („Hygienepaket“) hatsich seit dem Inkrafttreten in den Jahren 2004 bis 2006 grundsätzlichbewährt. Wesentliche Änderungen sind in der nahen Zukunft nicht zuerwarten. Überlegungen der EU-Kommission betreffen unter anderemfolgende Aspekte:Erweiterung der Tätigkeitsfelder des Schlachthofpersonals mit einerÜberwachungsfunktion („Supervisor“) der amtlichen Tierärzte;Herausnahme bestimmter Betriebe der Lebensmittelwirtschaft aus der(„Hürdentechnologie!“) Verordnung (EG) Nr. 852/2004, beispielsweiseZulieferbetriebe von Enzymen, Zusatzstoffen und Kollagen;Erneutes Aufgreifen der Diskussion zur Dekontamination vonSchlachttierkörpern, die bisher sehr kritisch gesehen wurde (Einsatzvon Milchsäure?);Eine Erweiterung der Rechtsgrundlage soll zur Zulassung von Sprossenbetriebenund Neuregelungen bei der Einfuhr zusammengesetzterLebensmittel (Beispiel: Pizza) führen.Der neue in das LFGB eingefügte § 40 Absatz 1a sieht vor, alle Überschreitungenvon Höchstmengen zu veröffentlichen, selbst wenn keinerleigesundheitliche Risiken davon ausgehen. Zusätzlich sollen noch allegravierenden sonstigen Verstöße bekannt gemacht werden, sofern eineBagatellgrenze bei einem zu erwartenden Bußgeld von 350 Euro gesetztwurde. Dieser Übergang zu einer „aktiven“ Lebensmittelwarnung wirdaußerordentlich kritisch gesehen und bezweifelt, ob durch diese Formder Verbraucherinformation wirklich eine erhöhte Lebensmittelsicherheiterreicht werden kann (A. Preuß, Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutzund Lebensmittelsicherheit).Wie bereits im Vorjahr wurde erneut die Frage der Meldepflicht vonLaboratorien (LFGB § 44 a) behandelt. Sie gilt für alle Lebensmittel,die einem Verkehrsverbot nach Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG)Nr. 178/2002 (Basisverordnung) unterliegen. Nach wie vor besteht in diesemBereich erhebliche Unsicherheit, und die Erfahrungen haben gezeigt,dass die Zahl der Meldungen offensichtlich vergleichsweise gering ist.AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG
FOCUS LEBENSMITTELSICHERHEITFakten, Hintergründe und Folgen aktueller EreignisseSEITE | 15Die Beschreibung des Berufsfeldes für Tierärzte fokussiert die tierärztlicheAusbildung auf Lebensmittel tierischer Herkunft. Damit erfolgte(bisher) die Abgrenzung der Tätigkeiten der verschiedenen Berufsgruppenim gesundheitlichen Verbraucherschutz (Lebensmittelchemiker,Ärzte und Tierärzte). Die rasanten Veränderungen in der Produktion,Distribution, Vermarktung von Lebensmitteln und das Auftreten neuerGefahren erfordern die Neuausrichtung des Lebensmittelrechts aufhorizontale und lebensmittelübergreifende Normen. So werden beispielsweisezunehmend Zoonose-Erreger auch auf pflanzlichen Lebensmittelnnachgewiesen, und Gleiches gilt für Tierarzneimittel. Auch dasTransfergeschehen („Carry over“) unerwünschter Stoffe (Dioxine, PCB)sprechen dafür, die lebensmittelbedingten Gesundheitsgefahren breiterals bisher einzuordnen und den für die gesamte Lebensmittelketteerforderlichen Sachverstand zu berücksichtigen.2. LebensmittelhygieneUnter den Beiträgen zur Methodik (Nachweisverfahren) ist im Zusammenhangmit der Probenvorbereitung die erstmalige Anwendung,Adaptierung und Bewertung des Probenvorbereitungssystems „Matrix-Lysis“ für die direkte Quantifizierung pathogener Keime aus ProbenLebensmittel liefernder Tiere und die Validierung einer schnellen automatisiertenimmunomagnetischen Separationsmethode zum Nachweisvon Salmonellen in Lebensmittel- und Umweltproben zu nennen.PCR-Verfahren gewinnen zunehmende Bedeutung, insbesondere alsschnelle Screening- oder Suchverfahren. Dieses gilt auch für den Nachweisdes EHEC O104:H4 aus Lebensmitteln pflanzlichen und tierischenUrsprungs. Eine Multiplex-PCR ist zum Nachweis wichtiger Escherichiacoli-Serotypen (O26, O103, O111, O145 und O157) geeignet. ZumNachweis pathogener Vibrio parahaemolyticus wurde ein immunchromatografischerSchnelltest entwickelt und für diesen Erreger in Lebensmittelnmarinen Ursprungs etabliert.Die Einsatzfähigkeit der matrixunterstützten Laser-Desorptions/Ionisations-Flugzeit-Massenspektrometrie(MALDI-TOF-MS) wurde für diebakteriologische Routineanalytik untersucht. Die mit dieser Methodikerhaltenen Muster werden mit denen einer kontinuierlich weiter zu ergänzendenDatenbank verglichen und eignen sich grundsätzlich für diesehr schnelle Identifizierung von Bakterien auf der Ebene der Gattungund auch der Art.Insgesamt wurde deutlich, dass in der Lebensmittelanalytik die klassischenkulturellen Verfahren, ergänzt durch eine biochemische Bestätigungder Isolate, nach wie vor unverzichtbar sind. MolekularbiologischeVerfahren wie die Echtzeit-PCR finden zunehmend ihren Einzug in diemikrobiologische Lebensmitteldiagnostik. Aber auch die neuen analytischenVerfahren wie die MALDI-TOF-Massenspektrometrie befindensich eindeutig auf dem Vormarsch. Allerdings sind die molekularbiologischenund massenspektrometrischen Methoden derzeit noch größerenbzw. spezialisierten Laboratorien vorbehalten.Das Vorkommen Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)und von Escherichia coli mit einem breiten Beta-Laktamase-Spektrum(ESBL) in Schweine- und Geflügelbeständen war im Zusammenhangmit der Resistenzproblematik und dem vielfach kritisierten Einsatz vonAntibiotika ein wichtiges Thema. Die bisherigen Ergebnisse zeigen,dass MRSA in einem hohen Prozentsatz in Schweine- und Geflügelmastbetriebengefunden werden, und auch ESBL konnten in vielenSchweinemastbetrieben und in der überwiegenden Zahl der Hähnchenmastbeständenachgewiesen werden. Das Hauptreservoir fürMRSA ist Staub, und zugekaufte Tiere sind die Haupteintragsquellefür MRSA und ESBL. Der Austrag aus den Beständen erfolgt bei bei-Neuausrichtung des Lebensmittelrechts:Horizontale und lebensmittelübergreifendeNormen gefordertMolekularbiologische (PCR) und massenspektrometrische(MALDI-TOF) Verfahrenfinden zunehmend Eingang in die mikrobiologischeLebensmittelanalytikKulturelle Verfahren mit biochemischerBestätigung der Isolate sind nach wie vorin der mikrobiologischen Diagnostik unverzichtbarMRSA und ESBL sind in Schweine- undGeflügelbeständen weit verbreitet undeine potenzielle Infektionsquelle für denexponierten MenschenFOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
SEITE | 18FOCUS LEBENSMITTELSICHERHEITFakten, Hintergründe und Folgen aktueller EreignisseBiogasanlagen: Entwicklung und Anreicherungvon pathogenen Clostridien (Clostridiumbotulinum) „nicht zwingend“Diskussion risikobasierter Fleischuntersuchungsverfahrenund Rückmeldung vonSchlachthofbefunden an den MastbetriebFazit der DVG-Lebensmittelhygienetagung20<strong>12</strong>: ausgewogenes Programm mit aktuellenThemen für Wirtschaft, Überwachung,Wissenschaft und VerbraucherSchnellnachweis von Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis(MAP) in Milch und Säuglingsanfangsnahrung (Optimierung und Validierungvon DNA-Extraktionsverfahren und Entwicklung einer sensitivenEchtzeit-PCR);Zusammenhang zwischen MAP und Morbus Crohn? (Nachweis vonMAP aus humanen Darmbiopsieproben).Fleischhygiene:Verderbnispotenzial psychrophiler Hefen auf vakuumverpacktem Rindfleisch;Bewertung der mikrobiologischen Sicherheit verschiedener Rindfleischreifungssysteme;Entwicklung (Anreicherung) von Clostridien in Biogasanlagen (nichtzwingend pathogene Clostridien und insbesondere Clostridium botulinum);Neue Ansätze zum Nachweis von Yersinia enterocolitica;Flächendeckende Untersuchung (2011) von Rot- und Schwarzwild sowieFüchsen auf Tuberkulose, Brucellose, Paratuberkulose, AujeszkyscheKrankheit und Klassische Schweinepest in Österreich;Haaruntersuchungen zur Rückstandskontrolle bei Lebensmittel lieferndenTieren (Nachweis von Beta-Agonisten beim Rind);Messung der radioaktiven Kontamination von lebenden Schlachttierenunter Feldbedingungen.5. WorkshopsErgänzend zu den vorgenannten Sitzungen fand ein Workshop zur „Lebensmittelketten-orientiertenSchlachttier- und Fleischuntersuchung“statt mit Themen wieStandortübergreifende Standardisierung der am Schlachthof erhobenenamtlichen Organbefundung;Einführung eines risikobasierten Fleischuntersuchungsverfahrensan einem mittelständischen Schlachthof in NRW;Validierung von Schlachtbefundrückmeldesystemen in der SchweineproduktionundErfahrungen aus der Praxis zur Rückmeldung der Schlachthofbefunde anden Mastbetrieb.Ein weiterer Workshop betraf sensorische Untersuchungen mit praktischenÜbungen unter besonderer Berücksichtigung des DLG-5-Punkte-Schema.6. PosterpräsentationenIn einer mit <strong>12</strong>0 Postern hervorragend bestückten Präsentation wurdenin erster Linie Fragen der Analytik sowie Spezialthemen aus den Gebietendes Lebensmittelrechts, der Lebensmittelhygiene, der Milch- undFleischhygiene sowie dem Schwerpunkt „Tierhaltung – Tiergesundheit –Lebensmittelsicherheit“ vorgestellt.7. SchlussbemerkungDie 53. „Garmische Lebensmittelhygienetagung“ war inhaltlich-thematisch,organisatorisch und aus der Sicht der Beteiligung erneut einHöhepunkt zur Diskussion von Fragen der Lebensmittelsicherheit und-hygiene. Auswahl und Aktualität der Themen mit Schwerpunktbildungenentsprachen vollinhaltlich den Erwartungen. Dem Leiter des DVG-Arbeitsgebietes „Lebensmittelhygiene“, Herrn Prof. Dr. Bülte (UniversitätGießen), und seinem Team gebühren besonderer Dank für eine aus derSicht des Berichterstatters sehr erfolgreichen Veranstaltung!AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG
HYGIENE INTERNATIONALSEITE | 19Aus dem weltweiten Food Safety Network (FSN)Das FSN berichtet unter der Bezeichnung „Bites“ nahezu täglich überaktuelle lebensmittelhygienische Fragen und Ereignisse weltweit. Nachstehendsind interessante Informationen der letzten Wochen zusammengestellt(mit Angabe des Erscheinungsdatums der Beiträge). Nichtaufgenommen wurden die zahlreichen Einträge über „lokale“ lebensmittelassoziierteErkrankungen aus der ganzen Welt. Die Beiträge könnenüber eine Suchfunktion mit Eingabe eines Stichworts (in englischer Sprache)unter www.bites.ksu.edu nachgelesen werden. Die Redaktion ist beider Suche gern behilflich.Datum Land Ereignis28.10.20<strong>12</strong> Kanada Verbraucher wissen zu wenig über mikrobiologische Aspekte der Lebensmittelsicherheitvon „mechanisch weichgemachtem“ Fleisch25.10.20<strong>12</strong> Irland Salmonellen-Bekämpfung bei Enten erfolgreich; Reptilien bleiben eine Infektionsquelle22.10.20<strong>12</strong> USA Die Nähe zu landwirtschaftlichen Nutztieren erhöht das MRSA-Risiko für den Menschen22.10.20<strong>12</strong> Skandinavien Lebensmittelsicherheit: Hinweise auf eine zunehmende Bedeutung pflanzlicher Produkte21.10.20<strong>12</strong> Kanada Gesundheitsbehörden untersuchen Probleme im Zusammenhang mit „mechanisch weichgemachtem“Fleisch19.10.20<strong>12</strong> Niederlande Mehr als 1.000 Erkrankungen und drei Todesfälle durch geräucherten Lachs16.10.20<strong>12</strong> Italien 20 Erkrankungen mit vier Todesfällen durch Listerien in Ricotta-Käse16.10.20<strong>12</strong> Niederlande Mehr als 500 Erkrankungen durch geräucherten Lachs − ein Todesfall15.10.20<strong>12</strong> Frankreich 18 Erkrankungen nach Verzehr von Bio-Buchweizenmehl/-brot in Zusammenhang mit einerKontamination durch eine toxische Stechapfelpflanze (Datura)13.10.20<strong>12</strong> Großbritannien Kryptosporidiose-Ausbruch über Swimmingpool10.10.20<strong>12</strong> USA (Kalifornien) Neue Hinweise zur Kontamination von Blattgemüse05.10.20<strong>12</strong> USA Salmonellen-Infektionen durch Erdnussbutter03.10.20<strong>12</strong> USA (FSIS) Neue Regelungen für das „mechanische Weichmachen“ von RindfleischWISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXISChronisch-entzündliche DarmkrankheitenVon chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind über 2,5 Mio.Menschen weltweit betroffen. Eine aktuelle Studie gibt neue Einblickein die Pathogenese dieser Krankheiten. In die Studie gingen die genetischenDaten von mehr als 41.000 Morbus Crohn- und Colitis Ulcerosa-Patienten sowie gesunden Kontrollpersonen ein. Entdeckt wurden indiesen Daten genetische Variationen in 163 Regionen des Genoms, diemit einem erhöhten Risiko für chronisch-entzündliche Darmerkrankungenin Verbindung stehen − 71 davon waren bislang unbekannt. Die Regionenstimmen vielfach mit solchen überein, die mit anderen Autoimmunerkrankungenin Verbindung gebracht werden. Dieses stärkt die These, dass essich bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen um Autoimmunreaktionenhandelt. Der Studie zufolge sollte sich die Forschung noch mehrauf Bakterien und Viren fokussieren, die diese Reaktionen auslösen.KOMMENTAR:Die (ursächliche) Beteiligung von Mycobacteriumavium ssp. paratuberculosis(MAP) an der Entstehung von MorbusCrohn wird nach wie vor kontrovers diskutiert.QUELLEN: Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) vom06.11.20<strong>12</strong>:www.deutsche-apotheker-zeitung.de Nature (20<strong>12</strong>; 491: 119-<strong>12</strong>4)FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
SEITE | 20WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXISHINTERGRUND:Acrylamid entsteht bei der Verarbeitungbzw. Zubereitung stärkehaltiger Lebensmittelerzeugnisse(z. B. Kartoffelchips,Pommes frites, Brot, Kekse, Kaffee) unterhohen Temperaturen (z. B. Braten, Backen,Rösten) – nach einer Stellungnahme derEFSA aus 2005 bestehen möglichweiseaufgrund der nachgewiesenen Kanzerogenitätund Genotoxizität der Substanzpotenzielle Gesundheitsbedenken.QUELLE: Pressemitteilung der Europäischen Behördefür Lebensmittelsicherheit (EFSA)vom 23.10.20<strong>12</strong>: www.efsa.europa.euKOMMENTAR:Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR):„In der Risikobewertung sind insbesondereVerunreinigungen von Säuglingsanfangsnahrungund Spezialnahrungen fürFrühgeborene mit Cronobacter spp. zu berücksichtigen− diese Infektionen könnenschwerwiegende gesundheitliche Folgenwie Hirnhautentzündung verursachen.“QUELLEN: aid PresseInfo Nr. 46 vom 14.11.20<strong>12</strong>:www.aid.de Stellungnahme Nr. 40 des Bundesinstitutsfür Risikobewertung (BfR) vom06.11.20<strong>12</strong>: www.bfr.bund.deAcrylamid in Lebensmitteln nahezu unverändertDie Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat ihrenjährlichen, aktualisierten Bericht zum Acrylamid-Gehalt in Lebensmittelnin 25 europäischen Ländern veröffentlicht. Der Bericht erstreckt sich aufden Überwachungszeitraum 2007 bis 2010 und ergibt für die Mehrzahlder untersuchten Lebensmittelkategorien keine wesentlichen Änderungengegenüber dem letzten Bericht. Die Zahl der Ergebnisse, die derEFSA übermittelt werden, ist seit 2008 rückläufig, was die Aussagekraftder Trendanalyse einschränkt. Die EU-Mitgliedstaaten sind aufgefordert,den Acrylamid-Gehalt jährlich zu überwachen − die Überwachungsdatenwerden von der EFSA bewertet und in einem Jahresbericht zusammengestellt.Der vorliegende Bericht ist der vierte Jahresbericht der EFSAzur Acrylamid-Überwachung in Lebensmitteln seit 2009. Dieser wurdevom Referat Diätetische und chemische Überwachung der EFSA anhandvon rund 13.000 Datenpunkten zum Acrylamid-Gehalt in Lebensmittelnerstellt.Säuglingsnahrung: Hygienische ZubereitungDie hygienischen Anforderungen an Säuglingsnahrung sind sehr hoch,entsprechend selten treten Infektionen mit krankmachenden Keimen auf.Dennoch kann es in Ausnahmefällen zu Verunreinigungen der Nahrungkommen, weil viele Keimarten den Herstellungsprozess für pulverförmigeNahrung überleben und sich in der zubereiteten Nahrung vermehren können.Zudem können Keime über Löffel, Sauger oder Trinkfläschchen beider Zubereitung in die Nahrung gelangen. Vor diesem Hintergrund empfiehltdas BfR, pulverförmige Säuglingsnahrung erst kurz vor dem Verzehrzuzubereiten. Es sollte möglichst abgekochtes Wasser zur Zubereitungder Nahrung für Säuglinge in den ersten Lebensmonaten verwendet werden.Zum Anschütteln des Pulvers sind Wassertemperaturen bis zu 50 °Cfür reif geborene, gesunde Säuglinge ausreichend. Lange Standzeiten derzubereiteten Nahrung bei Temperaturen über 5° C von mehr als 2 h biszum Verzehr oder beim Abkühlen und Wiederaufwärmen von zubereiteterNahrung sollten unbedingt vermieden werden. Die Reste von zubereiteterNahrung sollten entsorgt werden. Ein Eintrag von Keimen bei der Zubereitungder Nahrung kann verhindert werden, indem die verwendetenKüchenutensilien in der Spülmaschine bei 65 °C oder mit heißem Wasserund Spülmittel gründlich gereinigt werden. In Kliniken sollten möglichstMilchküchen eingerichtet werden, in denen umfassende hygienischeAnforderungen berücksichtigt werden können. Dieses gilt in besonderemMaße für die Nahrungszubereitung für Frühgeborene und immungeschwächteSäuglinge.NEWSFLASHBrandaktuell die wichtigsten Ereignisse aus dem Bereich der Lebensmittelsicherheit –mit dem Newsflash sind Sie sofort informiert und erfahren, was Sie beachten müssen!Nutzen Sie diesen exklusiven Service und schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort„Newsflash“ an qm@behrs.de. Dieser E-Mail-Dienst ist für Sie als Abonnent kostenlos!AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG
WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXISSEITE | 21Aus der Wissenschaft für die PraxisDie nachstehenden Informationen wurden aus der internationalen Literaturim Hinblick auf die Bedeutung für die Praxis der Lebensmittelwirtschaftausgewählt.Untersuchungen eines großen Ausbruchs einer Salmonella Typhimurium-Infektion in Schulen in Verbindung mit importiertem Rindfleisch in Frankreich(Oktober 2010)Eurosurveillance, Volume 17, Issue 40,04 October 20<strong>12</strong>: www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20289Reiseassoziierte Magen-Darm-Infektionen in Norwegen: Sind sie alle importiert?Eurosurveillance, Volume 17, Issue 41, 11October 20<strong>12</strong>: www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20294Bedeutung der Kreuzkontamination mit Salmonellen beim Schneiden vonSchweinefleischRisk Analysis: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.20<strong>12</strong>.01908.x/abstractVerbreitung des Hepatitis E-Virus in der Schweinepopulation in Frankreichund die mögliche zoonotische ÜbertragungVerbreitung des Hepatitis E-Virus in der Schweinepopulation in Frankreichund die mögliche zoonotische ÜbertragungBulletin épidémiologique, santéanimale et alimentation no 52Journal of Food Science, Volume 77,Issue 10, pages M550-M559, October20<strong>12</strong>: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-3841.20<strong>12</strong>.02893.x/abstractVerbreitung des Hepatitis E-Virus in der Schweinepopulation in Frankreichund die mögliche zoonotische ÜbertragungAnheftung kälteadaptierter Escherichia coli O157:H7 an Oberflächen vonrostfreiem Stahl und GlasAgroterrorismus bei Nutztieren und die Einbringung hoch-infektiöserKrankheitserregerDie Übertragung von Zoonosen durch kleine HeimtiereÜbertragung von Escherichia coli O157:H7 von Oberflächen auf frischgeschnittenesBlattgemüseWirksamkeit von Milchsäure zur Reduktion von Krankheitserregern aufRindfleischFood Control, Volume 30, Issue 2,April 2013, Pages 575-579: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09567135<strong>12</strong>004938Foodborne Pathogens and Disease,October 20<strong>12</strong>, 9(10): 869-877:http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/fpd.20<strong>12</strong>.1146Emerging Infectious Diseases:http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/<strong>12</strong>/<strong>12</strong>-0664_article.htmJournal of Food Protection, Volume 75,Number 11, November 20<strong>12</strong>, pp. 1920-1929(10): www.ingentaconnect.com/content/iafp/jfp/20<strong>12</strong>/00000075/00000011/art00002Journal of Food Protection, Volume 75,Number 11, November 20<strong>12</strong>, pp. 1968-1973(6): www.ingentaconnect.com/content/iafp/jfp/20<strong>12</strong>/00000075/00000011/art00007FOOD & HYGIENE | © BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>
SEITE | 22SCHWERPUNKTTHEMABerufs- und SchutzkleidungBei der Handhabung unverpackter, leicht verderblicher undsomit aus mikrobiologischer Sicht besonders empfindlicherProdukte sind höchste Anforderungen an die persönlicheHygiene der Mitarbeiter zu stellen; denn eine unzureichendepersönliche Hygiene – diese betrifft nicht nur die Körperpflege,Beachtung des Schmuckverbots und Händehygiene, sonderninsbesondere auch die hygienische Beschaffenheit der ArbeitsundSchutzkleidung – kann zu einer Kontamination und damit zueiner Beeinträchtigung der Sicherheit der Produkte führen.Rechtliche RahmenbedingungenIm Anhang II zur Lebensmittelhygieneverordnung (EG) Nr.852/2004 wird in Kapitel VIII über „Persönliche Hygiene“ausgeführt, dass „Personen, die in einem Bereich arbeiten, indem mit Lebensmitteln umgegangen wird, …. geeignete undsaubere Arbeitskleidung und erforderlichenfalls Schutzkleidungtragen müssen“. Weitere Vorschriften finden sich in der AllgemeinenVerwaltungsvorschrift Lebensmittelhygiene (AVVLmH Anlage 1.1, Nr. 5.1).Aus den Rechtsvorschriften ergibt sich, dass in Lebensmittelbetriebenarbeitende Personen Schutzkleidung dann anzulegenhaben, sofern das Produkt und die Tätigkeit dieses erfordern.Eine saubere Arbeitskleidung wird auch dann benötigt,wenn in einem Lager- oder Kühlhausbereich mit verpacktenWaren gearbeitet wird. Beim Umgang mit offenen, verderbnisgefährdetenoder verzehrsfertigen Lebensmitteln ist einesaubere Schutzkleidung unabdingbar.Vom Produkt und der Tätigkeit hängt es ab, welche Teile zueiner ausreichenden Schutzkleidung gehören. Das Tragen einessauberen, hellen Arbeitskittels stellt den einfachsten Fall dar. Beibesonders empfindlichen Lebensmitteln wie Hackfleisch undFleischzubereitungen oder bei verzehrsfertigen Erzeugnissensind darüber hinaus eine helle Hose, Kopfbedeckung, gegebenenfallsMund-/Nasenmaske sowie Einmalhandschuhe angezeigt.Auch sauberes Schuhwerk gehört zur Schutzkleidung.DIN-Norm und LeitlinienHinweise zur Beschaffenheit von Arbeits- bzw. Schutzkleidungfinden sich nicht nur in Rechtsvorschriften, sondernauch in einer DIN-Norm sowie in den GHP-Leitlinien der Lebensmittelwirtschaftund in Handelsstandards wie dem IFS 6:Norm DIN 10524 „Lebensmittelhygiene − Arbeitskleidung inLebensmittelbetrieben und dieLeitlinien bezüglich Bäckerhandwerk (Abschnitte 3 und 4.3),Bundesverband Fisch (4.19), Direktvermarkter (Teil B), ortsveränderlicheBetriebsstätten (1.8.2) und soziale Einrichtungen(D.6, S.6 und H.4).Wiederaufbereitung von TextilienBei der Wiederaufbereitung der Textilien muss gemäß DIN10524, die in engem Zusammenhang mit der Lebensmittelhygieneverordnung(LMHV) zu sehen ist, eine hygienegerechteReinigung sichergestellt werden. Eine Wiederaufbereitungder Textilien im Privathaushalt ist nach dieser Norm nichtmit einem Qualitätsmanagementsystem für hygienisch anspruchsvolleBereiche vereinbar und garantiert nicht die sichereWiederherstellung eines sachgerechten Hygienestatus derTextilien. In diesem Zusammenhang und mit der Einführungdes <strong>HACCP</strong>-Konzeptes wird von den textilen Dienstleisternhäufig der Nachweis gefordert, dass die hygienische Unbedenklichkeitder aufbereiteten Textilien gewährleistet ist. ImInternational Food Standard (IFS), der auf der Global FoodSafety Initiative (GFSI) basiert, sind weitere Forderungen hinsichtlichder Textilhygiene integriert worden:1. Die regelmäßige und gründliche Reinigung muss auf derGrundlage einer prozess- und produktorientierten Risikoanalyseerfolgen.2. Vorgaben zur Reinigung und Verfahren zur Reinheitskontrolleder Schutzkleidung wurden eingeführt.Dieses bedeutet in der Praxis, dass die Aufbereitung vonprofessionellen Wäschereien bzw. textilen Dienstleistungsunternehmendurchgeführt werden sollte, wobei die Textilienmit validierten Waschverfahren desinfizierend aufbereitet undkeimarm bzw. – sofern erforderlich – steril dem Kunden übergebenwerden. Nach DIN 10524 werden MikrobiologischeGrenzwerte für Textilien vorgegeben. Diese dürfen in Koloniebildenden Einheiten (KbE) pro dm² Textiloberfläche 50 nichtüberschreiten (in neun von zehn Proben). Human-pathogeneKeime dürfen nicht nachweisbar sein.Ausgewählte Hinweise für die PraxisArbeitskleidung darf nur in den Produktionsräumen getragenwerden und ist beim Betreten und Verlassen an- bzw. auszuziehen.Je nach Hygieneanforderung des Betriebes oder desProduktionsbereiches können die Anforderungen unterschiedlichsein. Sofern nicht betrieblich verwendete ArbeitskleidungVerwendung findet, sollte für Besucher Einwegschutzkleidungverfügbar gehalten werden, die mindestens einen Besucherkittel,Kopfbedeckung und ggf. Überschuhe umfasst.Nach DIN 10524 werden für die Arbeitskleidung in LebensmittelbetriebenHygieneanforderungen festgeschrieben, die sichnach der Risikoeinstufung der unterschiedlichen Tätigkeiteninnerhalb des Betriebes richten und drei unterschiedlicheRisikoklassen umfassen. Die Einstufung in die Risikoklassenwird vom Lebensmittelbetrieb festgelegt. Dabei sind die Artder Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen, dieRäumlichkeiten, die Art des Lebensmittels (mikrobiologischeEmpfindlichkeit) sowie die Tätigkeiten zu berücksichtigen.Weitere Hinweise:Das Tragen von Einmalhandschuhen ist nicht normiert, kannjedoch bei ordnungsgemäßer Verwendung angezeigt sein.Auch bei Backwaren und Brötchen ist es „unhygienisch“,wenn diese Erzeugnisse mit einer möglicherweise verschmutztenHand berührt werden. Im Verkaufsbereich vonBäckereien finden daher Einmalhandschuhe weite Verwendung.Haare müssen bei der Zubereitung von Lebensmitteln in Küchenoder bei der Produktion verzehrsfertiger bzw. verderbnisgefährdeterProdukte vollständig bedeckt sein.Voraussetzung für eine wirkungsvolle Desinfektion derHände ist die vorherige gründliche Reinigung (Waschen mitWasser und Seife). Zum Trocknen der Hände sind einmal zubenutzende Handtücher in der Regel das Mittel der Wahl.Bei Verletzungen an den Händen mit der Möglichkeit einerKontamination (beispielsweise durch Eitererreger) sollte keineBeschäftigung in der Lebensmittelproduktion erfolgen.Gegebenenfalls ist die Abdeckung mit einem wasserdichtenPflaster bei gleichzeitigem Tragen von Einmalhandschuhenmöglich bzw. zu verantworten.Das Schmuckverbot am Arbeitsplatz bezieht sich auch dannauf das Tragen von Piercings, wenn Aspekte des Arbeitsschutzesdieses erfordern.AUSGABE <strong>12</strong> | 20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENE | © BEHR´S VERLAG, HAMBURG
B. Behr’s Verlag GmbH & Co. KG, 22085 HamburgPostvertriebsstück/DPAG, „Entgelt bezahlt“, ZKZ 50556+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++WER & WAS...Firmen • Fakten • FührungskräfteSuchen Sie Ihre Hersteller, Zuliefereroder Dienstleister jetzt online!Das Symposium für die Praxismit den Schwerpunkten:Anmeldeschluss:22.10.20<strong>12</strong>FOOD & HYGIENEIhre Ansprechpartnerin:Carolin Schnekenburgercarolin.schnekenburger@behrs.deIMPRESSUM:Herausgeber:© B. Behr’s Verlag GmbH & Co. KGAverhoffstraße 10 | 22085 HamburgTel.: 040/227 00 80 | info@behrs.dewww.behrs.deAnzeigen:Markus Wenzel, Tel.: 040/22 70 08-15Erscheinungsweise:<strong>12</strong>-mal jährlich, ISSN 1613-2696,Bezugspreis pro Jahr inkl. Food Hygiene &Qualität Praxis: EUR 149,50 zzgl. MwSt.Redaktionsschluss:25.11.20<strong>12</strong>Redaktion:Univ.-Prof. Dr. Walther Heeschen,24105 Kiel (Leitung),Dipl.-Ing. Agr. Jan Peter Heeschen M. Sc.,Dr. Arno Langbehn,Dipl.-Ökotroph. Barbara Lipsky,Dipl.-Ökotroph. Carolin SchnekenburgerGestaltung:GO: Grafik und Konzept GmbHwww.go-grafik.deDie neue Firmensuchmaschinewww.werundwas.debringt die Praxis auf den Punkt.B. Behr’s Verlag GmbH & Co. KG • Averhoffstraße 10 • D-22085 Hamburg