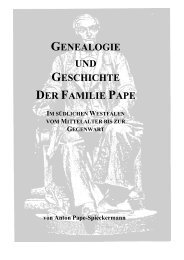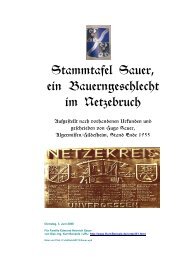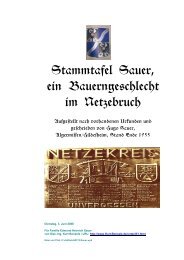Pasel - kurt-bonsels.de
Pasel - kurt-bonsels.de
Pasel - kurt-bonsels.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.pdfmailer.<strong>de</strong><br />
PDFMAILER.DE<br />
Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail<br />
versen<strong>de</strong>n >Test it free www.pdfmailer.<strong>de</strong><br />
Scudo, in <strong>de</strong>n südlichen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n Dukaton o<strong>de</strong>r Patagon, in Spanien und seinen<br />
Kolonien war dies das Acht-Reales-Stück o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Peso.<br />
In Deutschland versuchte man durch die Reichsmünzordnungen <strong>de</strong>s 16. Jh.s zu<br />
einem einheitlichen Gewicht und Feingehalt <strong>de</strong>r in verschie<strong>de</strong>nen Münzfüßen<br />
ausgebrachten Taler zu kommen: Die Esslinger Reichsmünzordnung von 1524<br />
ignorierte <strong>de</strong>n sächsischen Münzfuß und führte einen kaum geprägten Guldiner ein,<br />
an <strong>de</strong>n sich auch die Habsburger nicht hielten, nach<strong>de</strong>m ihnen Kaiser Karl V. 1524<br />
das Privileg erteilte, ihn ein Quentchen (1/63 Mark) leichter zu prägen (Privileg <strong>de</strong>s<br />
Quentchen). Trotz<strong>de</strong>m nahm die Prägung <strong>de</strong>r Taler mit <strong>de</strong>n Jahren zu. Auch die<br />
Augsburger Reichsmünzordnung von 1551 konnte <strong>de</strong>n Dualismus zwischen Taler<br />
und Guldiner nicht lösen und setzte einen Guldiner zu 72 Kreuzern fest, gemäß <strong>de</strong>m<br />
inzwischen gestiegenen Kurswert <strong>de</strong>s Gul<strong>de</strong>ns. Als danach immer noch viele<br />
Münzstän<strong>de</strong> am Taler festhielten, wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Augsburger Reichsmünzordnung<br />
von 1559 die Bindung <strong>de</strong>s Silbergel<strong>de</strong>s an das Gold aufgegeben. Diese Ordnung<br />
begünstigte <strong>de</strong>n in Süd<strong>de</strong>utschland inzwischen heimisch gewor<strong>de</strong>nen Silbergul<strong>de</strong>n<br />
o<strong>de</strong>r Reichsguldiner zu 60 Kreuzern. Den Durchbruch zum Reichstaler brachte erst<br />
<strong>de</strong>r Reichsabschied von 1566. Aus <strong>de</strong>r Kölner Mark zu 233,856 g sollten nun 9<br />
Reichstaler ausgebracht wer<strong>de</strong>n, im Raugewicht von 29,23 g (889/1000 fein), im<br />
Silbergewicht von je 25,98 g. Diese Regelung bestand theoretisch (ungeachtet <strong>de</strong>r<br />
tatsächlichen Prägungen) bis zur Auflösung <strong>de</strong>s Römisch-Deutschen Reichs (1806).<br />
Verantwortlich für die Unterhöhlung <strong>de</strong>r Talerprägung waren nicht zuletzt die<br />
Habsburger Kaiser selbst, die vor allem unter Erzherzog Ferdinand II. und unter<br />
Karl VI. min<strong>de</strong>rwertige Talermünzen ausgaben.<br />
Neben <strong>de</strong>n tatsächlich ausgeprägten Talern (Speciestaler) bürgerte sich <strong>de</strong>r<br />
Rechnungstaler ein, <strong>de</strong>r nach 1600 in Nord- und Mittel<strong>de</strong>utschland zu 24 Guten<br />
Groschen, in Süd<strong>de</strong>utschland zu 90 Kreuzern gerechnet wur<strong>de</strong>. Dieses<br />
Rechnungssystem blieb auch bestehen, als <strong>de</strong>r Speciestaler nach <strong>de</strong>m Leipziger<br />
Fuß auf 32 Gute Groschen bzw. 90 Kreuzer gesetzt wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r Kipper- und<br />
Wipperzeit wur<strong>de</strong>n in Sachsen, Thüringen und Bayern unterwertige Kippertaler<br />
geprägt. Nach <strong>de</strong>r Kipper- und Wipperzeit blühte die Prägung <strong>de</strong>s<br />
Reichsspeciestalers noch einmal auf. Nach <strong>de</strong>r Einführung <strong>de</strong>s Graumannschen<br />
Münzfußes 1750 und <strong>de</strong>s Konventionsfußes 1753 haben nur noch Kur-Hannover und<br />
Braunschweig-Wolfenbüttel Reichsspeciestaler geprägt (vorwiegend als<br />
Ausbeutetaler). Im 17./18. Jh. prägten viele Münzstän<strong>de</strong> in Mittel- und<br />
Nord<strong>de</strong>utschland nach <strong>de</strong>m Münzfuß <strong>de</strong>s leichteren Albertustaler (Patagon), <strong>de</strong>r an<br />
<strong>de</strong>r Ostsee zur Han<strong>de</strong>lsmünze wur<strong>de</strong>. Auch Konventionstaler wur<strong>de</strong>n geprägt, die zu<br />
Beginn <strong>de</strong>s 19. Jh.s in Süd<strong>de</strong>utschland vom Kronentaler verdrängt wur<strong>de</strong>n, die<br />
ebenfalls aus <strong>de</strong>n Südlichen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n stammten. Eine Beson<strong>de</strong>rheit stellte <strong>de</strong>r<br />
Bergische Kassentaler dar. Danach spielte <strong>de</strong>r Vereinstaler eine wichtige Rolle, <strong>de</strong>r<br />
praktisch von allen <strong>de</strong>utschen Staaten geprägt wur<strong>de</strong>. Nach <strong>de</strong>r sukzessiven<br />
Umstellung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Kaiserreichs<br />
auf die Markwährung wur<strong>de</strong>n im Jahr 1908<br />
die letzten im Umlauf verbliebenen<br />
Vereinstaler, die noch im Wert von 3 Mark<br />
zirkulierten, ungültig. Die nachfolgen<strong>de</strong>n<br />
3-Mark-Stücke wer<strong>de</strong>n zu Unrecht als<br />
Taler bezeichnet. Es gab auch<br />
repräsentative Mehrfachtaler (vor allem im<br />
Großherzogs Ludwig III.,1848-1877, Vereinstaler 1868 silberreichen Sachsen und<br />
Nie<strong>de</strong>rsachsen), die neben <strong>de</strong>n einfachen<br />
Taler-Stücken heute gesuchte und<br />
- 34 -