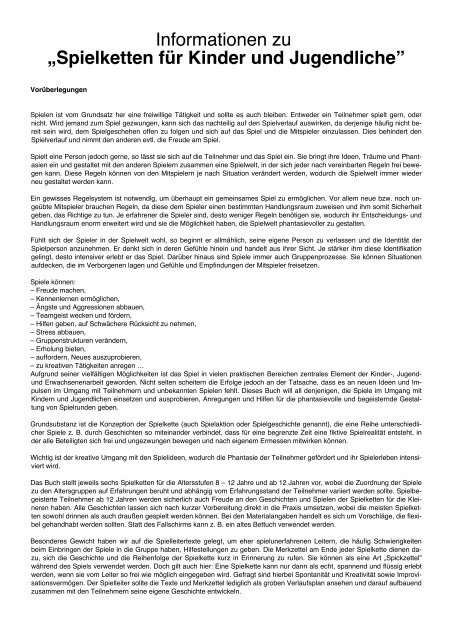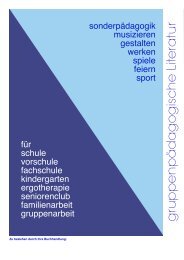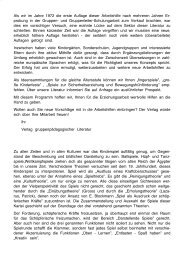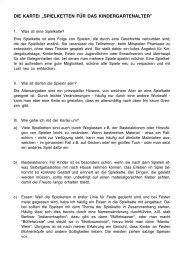Informationen zu „Spielketten für Kinder und Jugendliche”
Informationen zu „Spielketten für Kinder und Jugendliche”
Informationen zu „Spielketten für Kinder und Jugendliche”
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Informationen</strong> <strong>zu</strong><br />
<strong>„Spielketten</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche”</strong><br />
Vorüberlegungen<br />
Spielen ist vom Gr<strong>und</strong>satz her eine freiwillige Tätigkeit <strong>und</strong> sollte es auch bleiben. Entweder ein Teilnehmer spielt gern, oder<br />
nicht. Wird jemand <strong>zu</strong>m Spiel gezwungen, kann sich das nachteilig auf den Spielverlauf auswirken, da derjenige häufig nicht bereit<br />
sein wird, dem Spielgeschehen offen <strong>zu</strong> folgen <strong>und</strong> sich auf das Spiel <strong>und</strong> die Mitspieler ein<strong>zu</strong>lassen. Dies behindert den<br />
Spielverlauf <strong>und</strong> nimmt den anderen evtl. die Freude am Spiel.<br />
Spielt eine Person jedoch gerne, so lässt sie sich auf die Teilnehmer <strong>und</strong> das Spiel ein. Sie bringt ihre Ideen, Träume <strong>und</strong> Phantasien<br />
ein <strong>und</strong> gestaltet mit den anderen Spielern <strong>zu</strong>sammen eine Spielwelt, in der sich jeder nach vereinbarten Regeln frei bewegen<br />
kann. Diese Regeln können von den Mitspielern je nach Situation verändert werden, wodurch die Spielwelt immer wieder<br />
neu gestaltet werden kann.<br />
Ein gewisses Regelsystem ist notwendig, um überhaupt ein gemeinsames Spiel <strong>zu</strong> ermöglichen. Vor allem neue bzw. noch ungeübte<br />
Mitspieler brauchen Regeln, da diese dem Spieler einen bestimmten Handlungsraum <strong>zu</strong>weisen <strong>und</strong> ihm somit Sicherheit<br />
geben, das Richtige <strong>zu</strong> tun. Je erfahrener die Spieler sind, desto weniger Regeln benötigen sie, wodurch ihr Entscheidungs- <strong>und</strong><br />
Handlungsraum enorm erweitert wird <strong>und</strong> sie die Möglichkeit haben, die Spielwelt phantasievoller <strong>zu</strong> gestalten.<br />
Fühlt sich der Spieler in der Spielwelt wohl, so beginnt er allmählich, seine eigene Person <strong>zu</strong> verlassen <strong>und</strong> die Identität der<br />
Spielperson an<strong>zu</strong>nehmen. Er denkt sich in deren Gefühle hinein <strong>und</strong> handelt aus ihrer Sicht. Je stärker ihm diese Identifikation<br />
gelingt, desto intensiver erlebt er das Spiel. Darüber hinaus sind Spiele immer auch Gruppenprozesse. Sie können Situationen<br />
aufdecken, die im Verborgenen lagen <strong>und</strong> Gefühle <strong>und</strong> Empfindungen der Mitspieler freisetzen.<br />
Spiele können:<br />
– Freude machen,<br />
– Kennenlernen ermöglichen,<br />
– Ängste <strong>und</strong> Aggressionen abbauen,<br />
– Teamgeist wecken <strong>und</strong> fördern,<br />
– Hilfen geben, auf Schwächere Rücksicht <strong>zu</strong> nehmen,<br />
– Stress abbauen,<br />
– Gruppenstrukturen verändern,<br />
– Erholung bieten,<br />
– auffordern, Neues aus<strong>zu</strong>probieren,<br />
– <strong>zu</strong> kreativen Tätigkeiten anregen …<br />
Aufgr<strong>und</strong> seiner vielfältigen Möglichkeiten ist das Spiel in vielen praktischen Bereichen zentrales Element der <strong>Kinder</strong>-, Jugend<strong>und</strong><br />
Erwachsenenarbeit geworden. Nicht selten scheitern die Erfolge jedoch an der Tatsache, dass es an neuen Ideen <strong>und</strong> Impulsen<br />
im Umgang mit Teilnehmern <strong>und</strong> unbekannten Spielen fehlt. Dieses Buch will all denjenigen, die Spiele im Umgang mit<br />
<strong>Kinder</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen einsetzen <strong>und</strong> ausprobieren, Anregungen <strong>und</strong> Hilfen <strong>für</strong> die phantasievolle <strong>und</strong> begeisternde Gestaltung<br />
von Spielr<strong>und</strong>en geben.<br />
Gr<strong>und</strong>substanz ist die Konzeption der Spielkette (auch Spielaktion oder Spielgeschichte genannt), die eine Reihe unterschiedlicher<br />
Spiele z. B. durch Geschichten so miteinander verbindet, dass <strong>für</strong> eine begrenzte Zeit eine fiktive Spielrealität entsteht, in<br />
der alle Beteiligten sich frei <strong>und</strong> ungezwungen bewegen <strong>und</strong> nach eigenem Ermessen mitwirken können.<br />
Wichtig ist der kreative Umgang mit den Spielideen, wodurch die Phantasie der Teilnehmer gefördert <strong>und</strong> ihr Spielerleben intensiviert<br />
wird.<br />
Das Buch stellt jeweils sechs Spielketten <strong>für</strong> die Altersstufen 8 – 12 Jahre <strong>und</strong> ab 12 Jahren vor, wobei die Zuordnung der Spiele<br />
<strong>zu</strong> den Altersgruppen auf Erfahrungen beruht <strong>und</strong> abhängig vom Erfahrungsstand der Teilnehmer variiert werden sollte. Spielbegeisterte<br />
Teilnehmer ab 12 Jahren werden sicherlich auch Freude an den Geschichten <strong>und</strong> Spielen der Spielketten <strong>für</strong> die Kleineren<br />
haben. Alle Geschichten lassen sich nach kurzer Vorbereitung direkt in die Praxis umsetzen, wobei die meisten Spielketten<br />
sowohl drinnen als auch draußen gespielt werden können. Bei den Materialangaben handelt es sich um Vorschläge, die flexibel<br />
gehandhabt werden sollten. Statt des Fallschirms kann z. B. ein altes Bettuch verwendet werden.<br />
Besonderes Gewicht haben wir auf die Spielleitertexte gelegt, um eher spielunerfahrenen Leitern, die häufig Schwierigkeiten<br />
beim Einbringen der Spiele in die Gruppe haben, Hilfestellungen <strong>zu</strong> geben. Die Merkzettel am Ende jeder Spielkette dienen da<strong>zu</strong>,<br />
sich die Geschichte <strong>und</strong> die Reihenfolge der Spielkette kurz in Erinnerung <strong>zu</strong> rufen. Sie können als eine Art „Spickzettel”<br />
während des Spiels verwendet werden. Doch gilt auch hier: Eine Spielkette kann nur dann als echt, spannend <strong>und</strong> flüssig erlebt<br />
werden, wenn sie vom Leiter so frei wie möglich eingegeben wird. Gefragt sind hierbei Spontanität <strong>und</strong> Kreativität sowie Improvisationsvermögen.<br />
Der Spielleiter sollte die Texte <strong>und</strong> Merkzettel lediglich als groben Verlaufsplan ansehen <strong>und</strong> darauf aufbauend<br />
<strong>zu</strong>sammen mit den Teilnehmern seine eigene Geschichte entwickeln.
Selbstverständlich können Spiele, die aus räumlichen oder sonstigen Gründen in der aktuellen Situation nicht durchführbar sind,<br />
gegen andere ausgetauscht werden, sofern diese in die Geschichte eingeb<strong>und</strong>en präsentiert werden. Je häufiger ein Spielleiter<br />
den Mut aufbringt <strong>und</strong> es wagt, sich mit seiner Gruppe auf eine Spielkette ein<strong>zu</strong>lassen, desto eher wird er frei <strong>und</strong> ohne Merkzettel<br />
agieren können <strong>und</strong> eigene Spielketten erfinden. Für diesen Schritt <strong>und</strong> <strong>für</strong> bereits spielerfahrene Leiter haben wir im ersten<br />
Teil des Buches die notwendige Theorie <strong>zu</strong>r Planung, Organisation <strong>und</strong> Durchführung von Spielketten ausführlich dargestellt.<br />
Dies bietet die Möglichkeit, selbst Spielketten <strong>zu</strong> speziellen Lernzielen <strong>zu</strong> erstellen, die auf die Gruppe, ihre Vorerfahrungen <strong>und</strong><br />
die aktuelle Gruppensituation abgestimmt sind.<br />
Im Anhang haben wir zahlreiche Literatur- <strong>und</strong> Musikvorschläge <strong>zu</strong>sammengestellt, die sowohl <strong>zu</strong>r Vertiefung als auch <strong>zu</strong>r kreativen<br />
Weiterentwicklung der Spielideen anregen sollen.<br />
An dieser Stelle noch ein Wort <strong>zu</strong> der im Buch verwendeten Anrede:<br />
Wir verwenden durchgehend die maskuline Form der Anrede, da wir der Meinung sind, dass die Schreibweise „der/die Spielleiter<br />
(in)” bzw. „der/die Teilnehmer (innen)” den Lesefluss, vor allem beim direkten Einsatz, unnötig unterbricht.<br />
Bleibt uns nur noch, allen Spielleitern einen kreativen <strong>und</strong> phantasievollen Umgang mit diesem Buch sowie viel Spaß <strong>und</strong> Erfolg<br />
beim Spielen <strong>und</strong> Erproben eigener Spielketten <strong>zu</strong> wünschen.<br />
I. Theorie <strong>zu</strong>r Spielkette<br />
1. Was ist eine Spielkette?<br />
Die Autoren<br />
Eine Spielkette ist eine Abfolge unterschiedlicher, aufeinander aufbauender Spiele, die durch eine Geschichte, Musik, Material<br />
oder Spielelemente (Bewegungsart, Gruppenformation u.ä.) in einer vorher festgelegten Reihenfolge miteinander verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
auf ein gemeinsames Ziel gerichtet sind.<br />
Spielketten bieten eine Form der Verknüpfung von mehreren Spielen auf eine Art, die <strong>für</strong> viele Mitspieler <strong>zu</strong>nächst oft unbekannt<br />
ist. Sie geben die Gelegenheit, sich in eine Phantasiewelt hinein<strong>zu</strong>versetzen <strong>und</strong> durch das eigene Erleben dieser Phantasiewelt<br />
eine neue Beziehung <strong>zu</strong>m Spielen <strong>zu</strong> bekommen.<br />
Spiele einer Spielkette wirken nicht „von oben” aufgesetzt oder vorgeschrieben. Sie bilden durch ihre Einbindung in eine Sinnkette<br />
einen Baustein eines größeren Gebildes, das <strong>zu</strong> entdecken <strong>und</strong> mit<strong>zu</strong>erleben immer wieder Spaß macht.<br />
Spielketten bestehen überwiegend aus „kooperativen Spielen” (bekannt auch als „New Games” oder „Spiele ohne Sieger”), da<br />
das miteinander Erleben, ohne Ängste <strong>und</strong> Konkurrenzdruck im Vordergr<strong>und</strong> steht.<br />
2. Welchen Zweck/welches Ziel hat eine Spielkette?<br />
Durch die, <strong>für</strong> viele Spieler neue Art der Verknüpfung, können Spielketten helfen, Spiele in Gruppen wieder interessant <strong>und</strong> attraktiv<br />
<strong>zu</strong> machen <strong>und</strong> geben somit vielen Spielteilnehmern die Chance, die im Spiel liegenden Möglichkeiten wie: Ängste <strong>und</strong><br />
Aggressionen abbauen, Erholung finden, usw., <strong>zu</strong> nutzen.<br />
Ziele von Spielketten können sein:<br />
– Kennenlernen,<br />
– Bewegung,<br />
– Vertrauen,<br />
– Kooperation/Teamarbeit,<br />
– Körpertraining, etc.<br />
wobei das Besondere an der Spielkette ist, dass sich eine Abfolge von Spielen (mit bestimmten Feinzielen) <strong>zu</strong> einem Grobziel<br />
verbindet. Der pädagogische Wert der Spielkette liegt in der „spielerischen” Verknüpfung der Feinziele <strong>und</strong> der Möglichkeit, sich<br />
einem komplexen Thema, wie z. B. Umweltbewusstsein „spielend” <strong>zu</strong> nähern.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist unbedingt darauf <strong>zu</strong> achten, dass die einzelnen Spiele in einem Sinn<strong>zu</strong>sammenhang stehen, durch die o.g.<br />
Mittel aufeinander aufbauen <strong>und</strong> somit eine Einheit bilden, damit eine <strong>für</strong> die Spieler nachvollziehbare Spielwelt entstehen kann.<br />
Brüche oder Unstimmigkeiten im Spielfluss können Ängste <strong>und</strong> Unsicherheit erzeugen <strong>und</strong> so den Spielfluss hemmen.<br />
Ob die Ziele erreicht werden können, ist <strong>zu</strong>m einem vom Spielleiter, <strong>zu</strong>m andern aber auch stark von Faktoren wie:<br />
– Gruppen<strong>zu</strong>sammenset<strong>zu</strong>ng,<br />
– Stimmung der einzelnen Spieler,<br />
– äußere Einflüsse (Wetter), etc.<br />
abhängig. (vgl. BAER, 1985)<br />
Dies sollte der Spielleiter berücksichtigen <strong>und</strong> sich nicht nach den ersten Versuchen entmutigen lassen, sondern sich bemühen,<br />
störende Faktoren frühzeitig <strong>zu</strong> erkennen <strong>und</strong> möglichst aus<strong>zu</strong>schließen.
II. Organisation von Spielketten<br />
1. Planung von Spielketten<br />
Für den reibungslosen Ablauf ist es wichtig, die Spielkette gründlich vor<strong>zu</strong>bereiten. Es besteht sonst leicht die Gefahr, dass das<br />
geplante Ziel nicht erreicht wird, die Spielwelt zerbricht, die Mitspieler enttäuscht sind oder dem Spielleiter der Überblick verlorengeht.<br />
(vgl. KÖNIG / VOLMER 1982, 96 ff)<br />
Die Vorbereitung sollte folgende Schritte umfassen:<br />
1.1 Analyse der Zielgruppe<br />
Wie jedes Spiel, so lebt auch die Spielkette von der Motivation der Spieler. Daher ist es wichtig, sich <strong>zu</strong> Beginn der Spielplanung<br />
darüber klar<strong>zu</strong>werden, welcher Teilnehmerkreis angesprochen werden soll. Folgende Punkte sollen der Analyse der Zielgruppe<br />
dienen:<br />
– An wen richtet sich die Veranstaltung?<br />
o Gemeinsame Vorerfahrungen, Anknüpfungspunkte der Teilnehmer<br />
o Gruppenprobleme (Behinderungen, Konflikte, etc.)<br />
1.2 Festlegung des Ziels<br />
Nachdem die Zielgruppe analysiert ist, sollte der Spielleiter sich darüber klarwerden, welches Ziel er unter Berücksichtigung des<br />
Teilnehmerkreises mit der Spielkette erreichen will. Die <strong>zu</strong>gr<strong>und</strong>eliegende Fragestellung lautet:<br />
– Was genau soll mit der Spielkette erreicht werden?, d.h. welches Grobziel will ich erreichen, bzw. welches Thema soll erarbeitet<br />
werden?<br />
Hierbei ist gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>zu</strong> beachten, dass zwischen dem Grobziel der Spielkette (vgl. S. 4) <strong>und</strong> den Feinzielen der einzelnen<br />
Spiele unterschieden werden muss.<br />
Um das Grobziel erreichen <strong>zu</strong> können, müssen die einzelnen Spiele so aufeinander aufbauen, dass sich deren Feinziele <strong>zu</strong>m<br />
Grobziel hin ergänzen.<br />
1.3 Situation<br />
Nachdem Teilnehmerkreis <strong>und</strong> Ziel abgeklärt sind, gilt es, die situativen Gegebenheiten, die <strong>zu</strong>r Verfügung stehen, <strong>zu</strong> überprüfen,<br />
da die Gestaltung der Spielkette stark von räumlichen <strong>und</strong> zeitlichen Bedingungen abhängig ist. Zu überlegen ist hierbei:<br />
– Wo findet die Spielkette statt? (draußen, drinnen)<br />
– Wieviel Platz steht <strong>zu</strong>r Verfügung? Können größere Spielgeräte (Fallschirm etc.) eingesetzt werden?<br />
– Welches Material ist vorhanden?<br />
– Zu welcher Tageszeit findet sie statt (tagsüber, abends)? Wie leistungsfähig werden die Spieler voraussichtlich sein?<br />
– Wieviel Zeit steht <strong>zu</strong>r Verfügung?<br />
1.4 Auswahl geeigneter Spiele<br />
Unter Berücksichtigung von Teilnehmerkreis, Ziel <strong>und</strong> Situation, überlegt sich der Spielleiter dann, welche Spiele eingesetzt werden<br />
können. Für die Auswahl bieten sich folgende Kriterien an:<br />
– Bekanntheitsgrad der Spiele,<br />
– Teilnahmemöglichkeit <strong>für</strong> alle Spieler,<br />
– Vermeidung von „Ätsch-Spielen” (Einer steht außerhalb der Gruppe <strong>und</strong> alle lachen über ihn, worauf häufig Angst <strong>und</strong> Resignation<br />
folgen),<br />
– vorhandenes Material.<br />
Da Spielen nicht <strong>für</strong> alle Teilnehmer eine alltägliche Beschäftigung ist, können Hemmungen <strong>und</strong> Ängste bei den Spielern bestehen,<br />
auf die der Spielleiter vorbereitet sein sollte. Angst <strong>und</strong> Unsicherheit entstehen u.a. durch:<br />
– unbekannte Spiele mit neuen Regeln,<br />
– neues Spielmaterial,<br />
– unklare Autorität des Spielleiters,<br />
– fremde Mitspieler,<br />
– neue Umgangsformen,<br />
– fremde Sprache (ungewohnte Ausdrücke etc.),<br />
– neue Umgebung,<br />
– besondere Herausstellung eines Spielers (Vorführcharakter),<br />
– Leistungskontrolle.
Um dies <strong>zu</strong> vermeiden, sollte der Spielleiter folgendes beachten (siehe auch 3.Durchführung):<br />
– bekannte Spiele mit einfachen Regeln verwenden,<br />
– Spiele mit eindeutigen Ergebnissen einsetzen,<br />
– anfangs nicht in Kleingruppen spielen,<br />
– Musik im Hintergr<strong>und</strong> <strong>zu</strong>m Hemmungsabbau einsetzen,<br />
– neues Spielmaterial erklären,<br />
– vertraute Menschen <strong>und</strong> eine vertraute Umgebung geben Sicherheit.<br />
1.5 Reihenfolge der Spiele<br />
Bei dem Aufbau einer Spielkette ist <strong>zu</strong> beachten, dass mit einfachen, relativ ruhigen Spielen begonnen wird, die den einzelnen<br />
nicht überfordern <strong>und</strong> ihm die benötigte Sicherheit in der Gruppe geben (Simultanspiele). Daran anschließen können Paar- <strong>und</strong><br />
Kleingruppenspiele, die neue Spielelemente enthalten, vermehrt Aktivität bringen <strong>und</strong> den Spielern die Möglichkeit geben, Hemmungen<br />
ab<strong>zu</strong>bauen <strong>und</strong> sich <strong>zu</strong> entfalten. Dieser Phase folgen Kooperationsspiele in der Großgruppe, die mit ruhigen Elementen<br />
ausklingen. Beendet wird die Spielkette durch ein eindeutiges Spiel (z.B. Verabschiedung nach einer Reise), da vor allem<br />
jüngere Spieler eine Rückführung in die Realität brauchen. Gerade bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie in der Spielwelt bleiben<br />
<strong>und</strong> sich in der Realität nur schwer wieder <strong>zu</strong>rechtfinden. Bleiben sie in der Rolle der Person, deren Identität sie angenommen<br />
haben, zeigen sie ggf. Störungen in ihrem Sozialverhalten, da sie nicht mehr zwischen eigener <strong>und</strong> angenommener Identität differenzieren<br />
können.<br />
Durch diese Reihenfolge entsteht ein Spannungsbogen, wobei die Spannung allmählich gesteigert wird. Die Spieler werden so<br />
mit der Spielwelt vertraut gemacht, können Hemmungen <strong>und</strong> Ängste spielerisch abbauen <strong>und</strong> erhalten <strong>zu</strong>nehmend Sicherheit<br />
beim Spiel. Dies schafft die Möglichkeit, dass die Spieler lernen, neuen Spielformen aufgeschlossener gegenüber<strong>zu</strong>stehen. Sie<br />
werden motiviert, sich in das Spiel ein<strong>zu</strong>bringen <strong>und</strong> die Spielkette aktiv mit<strong>zu</strong>gestalten.<br />
Beginn<br />
Paarspiele<br />
Je nach Dauer einer Spielkette kann es einen oder mehrere Höhepunkte geben. (D.h. ein oder mehrere Spiele, die besonders<br />
viel Action bringen). Nach einem Höhepunkt fällt der Spannungsbogen langsam ab, um dann entweder wieder an<strong>zu</strong>steigen (Hinführung<br />
<strong>zu</strong>m nächsten Höhepunkt), oder das Spielkettenende vor<strong>zu</strong>bereiten. Das Abschlussspiel sollte vom Spielleiter als solches<br />
deutlichgemacht werden.<br />
Je nach Alter der Gruppe <strong>und</strong> Ziel der Spielkette, kann im Anschluss daran eine Auswertung erfolgen (ggf. auch als Auswertungsspiel),<br />
die dem Spielleiter zeigt, ob das Ziel erreicht wurde <strong>und</strong> wie die Teilnehmer die Spielkette erlebt haben.<br />
1.6 Verknüpfung der Spiele<br />
Spiele einer Spielkette können durch:<br />
– eine Geschichte,<br />
– Musik,<br />
– Material,<br />
– Spielelemente, z.B.<br />
o Sitzordnung<br />
o Kleingruppen<br />
o Lichtverhältnisse<br />
miteinander verknüpft werden.<br />
Kennenlernen<br />
(Großgruppe,<br />
anonym, simultan)<br />
Spannungsbogen<br />
Höhepunkt<br />
Action<br />
Kleingruppen<br />
Großgruppe<br />
(Kooperation)<br />
Ende / Entspannung<br />
Der Spielleiter hat die Möglichkeit, Verknüpfungsarten innerhalb einer Spielkette <strong>zu</strong> wechseln, sowie mehrere gleichzeitig (z.B.<br />
Musik <strong>und</strong> Material) an<strong>zu</strong>wenden, um so die Spielkette <strong>zu</strong> beleben <strong>und</strong> interessanter <strong>zu</strong> gestalten. Abwechslung erhöht die<br />
Spannung <strong>und</strong> fördert die Bereitschaft <strong>zu</strong>m Mitspielen.<br />
Je jünger die Teilnehmer der Spielkette sind, desto wichtiger ist es, die Spiele durch eine Rahmenhandlung/Geschichte <strong>zu</strong> verbinden,<br />
da dieses allen <strong>Kinder</strong>n ein intensiveres „Mit-Erleben” ermöglicht.<br />
Bei älteren <strong>Kinder</strong>n, insbesondere bei jugendlichen Teilnehmern, kann die Verknüpfung durch Geschichten, speziell bei spielunerfahrenen<br />
Gruppen, Unlust oder Geringschätzigkeit hervorrufen, die bis <strong>zu</strong>r Blockierung der gesamten Spielkette führen kann.<br />
Bei diesen Zielgruppen hat es sich als sinnvoll erwiesen, abhängig vom Erfahrungshintergr<strong>und</strong> der Gruppe, stärker auf die Verknüpfung<br />
durch Musik, Material oder Spielelemente <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>greifen.
2. Vorbereitung<br />
Im Gegensatz <strong>zu</strong>m „einfachen” Spiel braucht die selbst erstellte Spielkette eine gewisse Vorbereitung, um einen reibungslosen<br />
Ablauf <strong>und</strong> die Zielerreichung <strong>zu</strong> gewährleisten. Je versierter der Spielleiter ist, desto kürzer wird die Vorbereitungszeit sein.<br />
2.1 Hilfskräfte<br />
Vor allem bei größeren Spielgruppen oder längeren Veranstaltungen (Spielfesten) erscheint es ratsam, dem Spielleiter <strong>zu</strong>r Entlastung<br />
noch Hilfskräfte <strong>zu</strong>r Verfügung <strong>zu</strong> stellen. Diese sollten über den gesamten Spielverlauf informiert sein <strong>und</strong> können z.B.:<br />
– sich um Außenseiter kümmern,<br />
– Teilnehmer verabschieden oder einführen,<br />
– bei Notfällen oder Störungen eingreifen,<br />
– sich um Material kümmern,<br />
– eine Kleingruppe übernehmen,<br />
– die Rolle des Spielleiters vorübergehend übernehmen,<br />
– das nächste Spiel vorbereiten,<br />
– dem Spielleiter später Rückmeldung geben.<br />
Wichtig ist hierbei insbesondere die exakte Absprache untereinander. Es muss vorher genau geklärt werden, wer welchen Part<br />
hat (welche Aufgaben übernimmt), damit es nicht <strong>zu</strong> Differenzen während des Spiels kommt, was sich negativ auf die Teilnehmer<br />
auswirken könnte.<br />
Wechsel der Spielleitung im Verlauf der Spielkette kann <strong>zu</strong>r Belebung beitragen <strong>und</strong> die Mitspieler <strong>zu</strong>sätzlich motivieren. Wichtig<br />
ist jedoch, dass er <strong>für</strong> die Spieler deutlich nachvollziehbar <strong>und</strong> einsichtig ist. D.h. der Wechsel findet mit Beginn eines neuen<br />
Spiels <strong>und</strong> nicht während einer laufenden Spielphase statt, da <strong>für</strong> die Spieler dann nicht <strong>zu</strong> erkennen ist, wer im Moment die<br />
„Spielautorität” besitzt.<br />
2.2 Gedankliches/praktisches Durchspielen der Spielkette<br />
Es ist unbedingt <strong>zu</strong> empfehlen (vor allem bei unerfahrenen Spielleitern), die Spielkette nach Festlegung des Ziels, Auswahl <strong>und</strong><br />
Verknüpfung der Spiele, gedanklich (besser noch: praktisch z.B. mit Bekannten) durch<strong>zu</strong>spielen, um fest<strong>zu</strong>stellen, ob:<br />
– das Ziel erreicht werden kann,<br />
– die Kette in sich stimmig ist,<br />
– die Übergänge fließend sind,<br />
– die Spiele <strong>zu</strong>r Geschichte passen,<br />
– die Musik passend ist,<br />
– die Reihenfolge der Spiele praktikabel ist,<br />
– ein Spannungsbogen enthalten ist,<br />
– das Material ausreicht, zweckdienlich ist,<br />
– bei mehreren Spielleitern die Zusammenarbeit geregelt ist,<br />
– mögliche Störungen berücksichtigt sind.<br />
2.3 Beschaffung/Herstellung benötigter Materialien<br />
Rechtzeitig vor Spielbeginn werden alle vorgesehenen Materialien in ausreichender Menge beschafft bzw. selbst hergestellt.<br />
Dies kann auch Bestandteil vorheriger Treffen oder Gruppenst<strong>und</strong>en sein <strong>und</strong> fördert eine noch intensivere Auseinanderset<strong>zu</strong>ng<br />
bzw. ein intensiveres Erleben der Spielkette.<br />
Technische Geräte werden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft <strong>und</strong> nach Möglichkeit sollte ein Ersatzgerät vorhanden sein.<br />
Der Spielleiter macht sich (<strong>und</strong> evtl. Hilfskräfte) vor dem Einsatz der Materialien in der Spielkette mit ihrem Gebrauch vertraut<br />
(z.B. Schwungtuch), um Pannen während des Spielverlaufs <strong>zu</strong> vermeiden.<br />
Benötigte Materialien sind z.B.:<br />
– Musikcassetten/Recorder,<br />
– Bälle,<br />
– Fallschirm, Schwungtuch,<br />
– Papier, Tücher,<br />
– Schminke,<br />
– Verkleidungsmaterial,<br />
– Preise, Geschenke.<br />
2.4 Notwendige Absprachen (vorbeugende Maßnahmen)<br />
Werden Spielketten in einer Institution (z.B. <strong>Kinder</strong>tagesstätte) eingesetzt, so kann es <strong>für</strong> die Gewährleistung einer reibungslosen<br />
Durchführung der Spielkette mitunter notwendig sein, Absprachen mit Kollegen <strong>zu</strong> treffen, um <strong>für</strong> die Dauer der Spielkette nicht<br />
mit anderen Aufgaben oder Störungen konfrontiert <strong>zu</strong> werden. Eine Unterbrechung der Spielkette sollte möglichst vermieden<br />
werden, da die Spieler mit Hemmungen <strong>und</strong> Ängsten reagieren könnten. Es sollte beachtet werden, dass:<br />
– möglichst keine Zuschauer anwesend sind,<br />
– die Gruppe relativ ungestört ist (Telefon, andere Gruppen im Haus),<br />
– der Spielleiter die ganze Zeit anwesend ist <strong>und</strong> aktiv am Spiel teilnehmen kann.
2.5 Vorbereitung des Raumes<br />
Eine reibungslose Durchführung der Spielkette setzt eine entsprechende Vorbereitung des Raumes voraus. Hier<strong>zu</strong> zählt u.a.<br />
– <strong>für</strong> ausreichende Beleuchtung, Belüftung, Hei<strong>zu</strong>ng sorgen,<br />
– die Stromversorgung muss sichergestellt sein,<br />
– die benötigten Materialien müssen bereitliegen,<br />
– Fußbodenbelag überprüfen (nicht <strong>zu</strong> rauh, rutschig ...),<br />
– Gegenstände, die umfallen oder verletzen können, entfernen.<br />
3. Durchführung<br />
3.1 Hinweise <strong>zu</strong>m Arbeiten mit Gruppen<br />
Das Spielen mit <strong>Kinder</strong>n, Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen in unstrukturierten Gruppenformationen (z.B. bei Großgruppen auf<br />
Spielfesten) unterscheidet sich vom Spielen in strukturierten Gruppen (z.B. bei länger bestehenden Jugendgruppen) erheblich.<br />
In strukturierten Kleingruppen mit regelmäßigen Treffen kennen die Teilnehmer die Stärken <strong>und</strong> Schwächen der Gruppenmitglieder<br />
<strong>und</strong> des Leiters. Viele Situationen sind bereits gemeinsam erlebt/durchlebt worden, so dass auch der Leiter seine Gruppe<br />
einschätzen kann. Er kennt einen Großteil ihrer Probleme <strong>und</strong> kann aus seiner Erfahrung heraus so agieren, dass diese oft gar<br />
nicht erst entstehen.<br />
In unstrukturierten Großgruppen, <strong>zu</strong> denen Spielgruppen oft zählen, ist dies nur selten möglich. Häufig verlassen Mitglieder die<br />
Gruppe oder kommen neu hin<strong>zu</strong>. Weiterhin entstehen Spielgruppen oft nur <strong>für</strong> kurze Zeit (Fest, Aktionen ...), so dass sich Teilnehmer<br />
<strong>und</strong> Leiter nur wenig oder überhaupt nicht kennen.<br />
Auf jeden Fall ist es hilfreich, wenn sich der Spielleiter vorher folgende Punkte (vgl. BAER, C) bewusstmacht:<br />
a.<br />
In einer Großgruppe neigen mehr Spieler da<strong>zu</strong>, nicht mit<strong>zu</strong>spielen, als in einer Kleingruppe.<br />
Der Spielleiter darf nicht resignieren, wenn Teilnehmer bei einzelnen Spielen nicht mitmachen möchten. Im Gegenteil: Er sollte<br />
diese Möglichkeit von vornherein deutlich machen <strong>und</strong> durch den Einsatz von Helfern oder starkes persönliches Engagement<br />
versuchen, alle Teilnehmer an das Spiel <strong>zu</strong> fesseln, so dass der Wunsch nach einem Aussetzen möglichst nicht entsteht.<br />
Setzen Teilnehmer trotzdem aus, sollte der Spielleiter dieses nicht als Kritik an seiner Person werten <strong>und</strong> sich dadurch verunsichern<br />
lassen, sondern jedem Teilnehmer das Recht auf Eigenständigkeit <strong>zu</strong>gestehen.<br />
b.<br />
Es kann vorkommen, dass Teilnehmer später kommen bzw. früher gehen müssen.<br />
Bei einer Spielkette sollte dieses die Ausnahme bleiben <strong>und</strong> nach Möglichkeit vermieden werden, da eine Gruppenveränderung<br />
immer die Gefahr beinhaltet, den Spielfluss <strong>zu</strong> unterbrechen.<br />
Ist es trotzdem erforderlich, sollte die Unterbrechung „spielerisch” integriert werden. Das Hin<strong>zu</strong>kommen oder Weggehen eines<br />
Teilnehmers wird vom Spielleiter mit in den Spielleitertext hineingenommen. Wenn z.B. bei der Tanzspielkette ein Teilnehmer<br />
früher gehen muss, so kann der Spielleiter sagen:<br />
„Jörg steigt hier am Bahnhof aus, da er noch dringend weg muss. Kommt, wir reichen Jörg alle schnell die Hand <strong>und</strong> sagen auf<br />
Wiedersehen ... Nun aber schnell in den Zug <strong>und</strong> los geht die Fahrt. Kommt, wir winken Jörg alle nochmal.”<br />
Auf diese Weise ist der Teilnehmer im Spiel, <strong>für</strong> alle gut nachvollzielbar, aus der Gruppe gelöst worden.<br />
c.<br />
Die Teilnehmer brauchen eine Orientierung, wie lange eine Spielkette dauern soll.<br />
Viele Spiel- <strong>und</strong> Gruppenprozesse leben davon, dass sich die Teilnehmer intensiv in das Spielgeschehen einbringen können. Vor<br />
allem bei älteren Teilnehmern ist es wichtig, sie über die voraussichtliche Dauer einer Spielkette <strong>zu</strong> informieren, damit sie <strong>für</strong> sich<br />
selbst entscheiden können, wie stark sie sich in Gruppenprozesse einlassen wollen.<br />
3.2 Hinweise <strong>für</strong> Spielleiter<br />
Vorweg:<br />
Es gibt weder den idealen Spielleiter noch einen allgemeingültigen Plan, nach dem Spielketten optimal durchgeführt werden können.<br />
Jeder Spielleiter muss seinen eigenen Stil entwickeln <strong>und</strong> ein Gespür da<strong>für</strong> bekommen, wie die Gruppenmitglieder auf sein Verhalten<br />
<strong>und</strong> seine Anleitungen reagieren.<br />
Aufgr<strong>und</strong> unserer Erfahrungen haben wir einige Hinweise, die die Durchführung der Spielketten erleichtern, aufgestellt.<br />
Der Spielleiter sollte:<br />
a. der gesamten Gruppe akustisch gut verständlich sein, wobei er, wenn nötig, (z.B. bei Spielfesten) ein Mikrofon benutzt.<br />
b. klar, deutlich, <strong>und</strong> laut genug sprechen.<br />
c. kurze <strong>und</strong> präzise Sätze verwenden.<br />
d. nicht verstandene Spielanweisungen (z.B. daran <strong>zu</strong> erkennen, dass die Teilnehmer verwirrt umherschauen oder nicht reagieren...)<br />
nochmals mit anderen Worten wiederholen.<br />
e. Spieleinheiten nach Möglichkeit vormachen (eventuell einen Helfer einsetzen), um die Teilnehmer so durch sein eigenes<br />
Vorbild <strong>zu</strong> motivieren <strong>und</strong> Ängste <strong>zu</strong> nehmen (je stärker der Spielleiter hierbei engagiert ist, desto leichter kann er die Gruppe<br />
mitreißen).<br />
f. nicht <strong>zu</strong> weit von der Gruppe stehen, aber auch den Teilnehmern nicht „auf die Pelle” rücken. Zu große Nähe bzw. Distanz<br />
erzeugen unangenehme / negative Gefühle. Einen generellen Anhalt <strong>für</strong> die optimale Entfernung gibt es nicht. Der Spielleiter<br />
muss den richtigen Mittelweg aus dem Verhalten der Teilnehmer schließen.
g. nicht verstandene oder akzeptierte Spielregeln vereinfachen oder verkürzen (weglassen bzw. Vorschläge der Gruppe auffangen<br />
<strong>und</strong> realisieren). Ein starres „Abspulen” des Programms erzeugt Unmut, wenn Teilnehmer sich mit eigenen Ideen einbringen<br />
wollen. Daher:<br />
– Ersatzvorschläge <strong>und</strong> -spielmaterial bereithalten,<br />
– flexibel auf den Spielfluss reagieren (Störungen haben Vorrang),<br />
– Probleme, Ideen, Wünsche <strong>und</strong> Vorschläge berücksichtigen,<br />
– Teilnehmer in den Spielfluss einbinden.<br />
h. eigene Ängste, Schwächen <strong>und</strong> Unsicherheiten eingestehen <strong>und</strong> niemals jemanden aus der Gruppe <strong>zu</strong>m Spiel zwingen. Die<br />
Teilnahme muss freiwillig bleiben, um den Spaß am Spiel <strong>zu</strong> erhalten.<br />
i. ein Spiel im richtigen Moment abbrechen oder bei Bedarf erneut spielen. Es macht keinen Sinn, ein Spiel, das nicht ankommt,<br />
bis <strong>zu</strong>m Ende durch<strong>zu</strong>spielen. Ebenso ist es sinnvoll, ein Spiel, das den Teilnehmern gut gefällt erneut <strong>zu</strong> spielen,<br />
wenn sie es wünschen. Hier hat die Gruppe bzw. die Spielatmosphäre auf jeden Fall Vorrang.<br />
j. beim Einsatz des Materials nicht starr an der Vorgabe kleben, sondern flexibel <strong>und</strong> phantasievoll sein. Improvisation ist wichtig,<br />
da nicht immer das entsprechende Material <strong>zu</strong>r Verfügung steht.<br />
Wir hoffen, dass diese Hinweise dem Spielleiter bei seinen ersten Versuchen mit Spielketten hilfreich sind. Auf jeden Fall aber<br />
gilt:<br />
„Übung macht den Meister”.<br />
4. Auswertung<br />
Die Auswertung einer Spielkette kann, je nach Altersgruppe auf der<br />
– inhaltlichen (<strong>und</strong>/oder)<br />
– methodischen Ebene erfolgen.<br />
4.1 Inhaltliche Auswertung<br />
Die inhaltliche Auswertung erfolgt häufig, wenn Spielketten bei älteren Teilnehmern <strong>zu</strong> speziellen Lernzielen wie Teamarbeit oder<br />
Vertrauen eingesetzt werden.<br />
Sie findet <strong>zu</strong>sammen mit den Teilnehmern als Abschlussspiel (z.B. Spielkette „Vertrauen / Körperkontakt” , Spiel „Gruppenzentrum”)<br />
oder direkt im Anschluss an die Spielkette statt. In ihrem Verlauf wird deutlich, wie jeder einzelne Teilnehmer die Spielkette<br />
erlebt hat <strong>und</strong> welche Prozesse in ihm in Gang gesetzt worden sind. Ebenso können Gruppenprozesse aufgedeckt <strong>und</strong> damit<br />
eine Ausgangsbasis <strong>für</strong> weitere Diskussionen oder Aktionen geschaffen werden.<br />
Mögliche Fragen der inhaltlichen Auswertung sind:<br />
– Wie fühlt ihr euch jetzt?<br />
– Wie habt ihr die Spiele erlebt?<br />
– Hat sich <strong>für</strong> euch etwas verändert?<br />
4.2 Methodische Auswertung<br />
Nach Durchführung der Spielkette sollte sich der Spielleiter (ggf. mit den Helfern) die Zeit nehmen, über den Verlauf der Spielkette<br />
<strong>und</strong> der eventuell erfolgten inhaltlichen Auswertung <strong>zu</strong> reflektieren.<br />
In der Reflektionsphase ergeben sich oft wertvolle Hinweise <strong>für</strong> die Planung, Organisation <strong>und</strong> Durchführung <strong>zu</strong>künftiger Spielketten.<br />
Positive <strong>und</strong> negative Punkte sollten angesprochen werden, wobei jedoch darauf <strong>zu</strong> achten ist, dass die Auswertung keine<br />
persönliche Kritik (z.B. aufgr<strong>und</strong> von Meinungsverschiedenheiten) enthalten darf, sondern auf sachlicher Ebene erfolgt.<br />
Wenn der Spielleiter ohne Hilfskräfte gearbeitet hat, <strong>und</strong> auch nicht die Möglichkeit eines Auswertungsspiels bestand, so sollte er<br />
doch auf jeden Fall versuchen, den Spielverlauf gedanklich <strong>zu</strong> rekonstruieren, um <strong>für</strong> sich selber gute <strong>und</strong> negative Punkte aus<strong>zu</strong>machen.<br />
Mögliche Fragen <strong>für</strong> die Auswertungsr<strong>und</strong>e sind:<br />
– Wie war die Spielkette aufgebaut?<br />
– Was war gut? Was war nicht so gut?<br />
– Woran kann es gelegen haben?<br />
– Wie war der Spannungsbogen?<br />
– Waren die Spiele <strong>für</strong> den Personenkreis angemessen?<br />
– Waren die Spielerklärungen verständlich?<br />
– War das Material ausreichend <strong>und</strong> brauchbar?<br />
– Ist das Ziel erreicht worden?<br />
– Wie war/wirkte das Verhalten des Spielleiters, der Helfer?<br />
– Wie funktionierte die Zusammenarbeit von Spielleiter <strong>und</strong> Helfern?<br />
– Was könnte beim nächsten Mal verbessert werden?
III. Handhabung der Spielkettenbeschreibung<br />
Nachfolgend werden 12 in der Praxis mehrfach erprobte <strong>und</strong> bewährte Spielketten <strong>für</strong> zwei unterschiedliche Altersstufen vorgestellt.<br />
Zu jeder Spielkette gibt es eine Beschreibung, die<br />
– das Grobziel der Spielkette,<br />
– das Alter der möglichen Zielgruppe,<br />
– die Mindestteilnehmerzahl,<br />
– die Gesamtdauer der Spielkette,<br />
– den Gesamtmaterialbedarf,<br />
– bewährte Musiktitel <strong>und</strong><br />
– allgemeine Hinweise <strong>zu</strong>r Spielkette<br />
enthält.<br />
Zur besseren Orientierung erhielt jedes einzelne Spiel der Spielkette einen eigenen Namen <strong>und</strong> folgende Angaben:<br />
– Feinziel des Spiels,<br />
– Dauer des Spiels,<br />
– benötigtes Material,<br />
– Gruppierung <strong>und</strong><br />
– Hinweise <strong>zu</strong>m Spielverlauf.<br />
Dies ermöglicht es, die Spiele auch einzeln ein<strong>zu</strong>setzen, bzw. sie untereinander <strong>zu</strong> variieren.<br />
Die Spielanweisung <strong>zu</strong> Beginn jedes Spiels enthält die wichtigsten Angaben <strong>zu</strong>r Spielbeschreibung. Im Spielleitertext (kursiv gedruckt)<br />
wird das Spiel dann nochmals, eingeb<strong>und</strong>en in die Rahmengeschichte, ausführlich beschrieben, so dass die Spielleiter<br />
die Möglichkeit haben, die Spielanweisung in die Geschichte <strong>zu</strong> integrieren.<br />
Spielbeschreibungen <strong>und</strong> Spielleitertexte dienen selbstverständlich nur als Anhalt <strong>und</strong> sollten je nach Situation individuell verändert<br />
werden.<br />
Der Merkzettel am Ende jeder Spielkette enthält die einzelnen Spiele, die wesentlichen Elemente der Rahmenhandlung <strong>und</strong> kurz<br />
<strong>zu</strong>sammengefasst die entsprechenden Spielanweisungen. Er kann als „Spickzettel” während des Spiels dienen.<br />
Für alle Spiele gilt:<br />
– die Gruppierungen flexibel entsprechend der Teilnehmerzahl handhaben<br />
– die Musik auf die Gruppe abgestimmt auswählen, bei den angegebenen Titeln handelt es sich lediglich um Vorschläge. Musik<br />
ist kein absolutes Muss, dient aber dem Abbau von Hemmungen <strong>und</strong> lockert die Spielatmosphäre<br />
– die aufgeführten Zeitangaben beruhen auf Erfahrungswerten <strong>und</strong> müssen, je nach Gruppe <strong>und</strong> Spielsituation, verlängert bzw.<br />
verkürzt werden<br />
– der Spielleiter achtet in allen Spielen, bei denen die Spieler die Augen geschlossen haben darauf, dass keine Verlet<strong>zu</strong>ngen<br />
geschehen. Dies gibt er auch <strong>zu</strong> Beginn des Spiels bekannt, damit bei den Teilnehmern keine Ängste <strong>und</strong> Unsicherheiten<br />
entstehen. Kann der Spielleiter aufgr<strong>und</strong> der Teilnehmeranzahl nicht alle Spieler beobachten, sollte er einen Helfer einsetzen<br />
oder das Spiel abändern!<br />
IV. Praktische Beispiele<br />
1. Spielketten <strong>für</strong> 8 – 12 Jahre<br />
Die Altersgruppe der 8 – 12jährigen ist häufig nur schwer <strong>für</strong> ein gemeinsames Spiel <strong>zu</strong> begeistern. Die älteren Gruppenmitglieder<br />
sind oft der Meinung, dass sie sich <strong>zu</strong> „Kleinkinderspielen” hergeben müssen, <strong>und</strong> dass sie sowieso „<strong>zu</strong> alt” <strong>zu</strong>m Spielen<br />
sind. Gleichzeitig brauchen <strong>und</strong> suchen sie aber selbst einen Ausgleich <strong>zu</strong>m Schulalltag <strong>und</strong> dem damit leider oft verb<strong>und</strong>enen<br />
„Lernstress”, hervorgerufen durch Leistungsdruck <strong>und</strong> Konkurrenzdenken.<br />
Bei der Spielkette haben ältere <strong>Kinder</strong> nicht das Gefühl „wieder so ein doofes <strong>Kinder</strong>spiel” mit den Kleineren machen <strong>zu</strong> müssen,<br />
sondern es entsteht durch die Geschichte ein „Wir-Gefühl” der Gruppe, da alle einen gemeinsamen Handlungsrahmen haben.<br />
Die älteren <strong>Kinder</strong> können die Spielkette aktiv mitgestalten (Vorgaben machen, Regeln verändern, Geschichte <strong>zu</strong>sätzlich ausschmücken),<br />
jedoch sollte der Spielleiter darauf achten, dass die Kleineren „mithalten” können. Auf keinen Fall darf er sich die Spielleitung<br />
aus der Hand nehmen lassen.<br />
Die von uns vorgestellten Spielketten sind weitgehend konkurrenzfrei, so dass sie die Spieler nicht unter Leistungsdruck stellen <strong>und</strong><br />
niemand am Ende eines Spiels „als der Dumme” dasteht. Konkurrenzfrei heißt jedoch nicht, dass die Spielketten keine Wettkampfelemente<br />
enthalten. Gerade <strong>für</strong> 8 – 12jährige verlieren Spiele ohne jegliche Konkurrenz schnell an Reiz, da sie ihre Kräfte messen<br />
wollen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> enthalten die Spielketten <strong>für</strong> diese Altersgruppe vermehrt Wettkampfspiele (z.B. bei der „Olympiade der<br />
Schneckmecks”), die allerdings so angelegt sind, dass es sich immer um Gruppen- oder Paarwettkämpfe handelt, damit Sieg <strong>und</strong><br />
Niederlage gemeinsam bewältigt werden können. Auf diese Art werden Außenseiterpositionen (der ewige Verlierer/Sieger) <strong>und</strong> Misserfolgsängste<br />
(„Ich schaffe das nie”) vermieden <strong>und</strong> gleichzeitig kooperatives Handeln als wichtig <strong>und</strong> spannend erlebt. Bei Wett-
kampfspielen sollten alle Leistungen gleichermaßen honoriert (z.B. <strong>für</strong> alle bei der Siegerehrung Süßigkeiten verteilen) werden.<br />
Besonders bei der hier angesprochenen Altersgruppe ist es wichtig, den Sprachgebrauch auf die Gruppe ab<strong>zu</strong>stimmen, denn eine<br />
<strong>zu</strong> einfache Sprache kann gerade bei älteren Spielern <strong>zu</strong> Blockierungen gegenüber dem speziellen, aber auch gegenüber <strong>zu</strong>künftigen<br />
Spielen führen.<br />
Also – nicht am Spielleitertext kleben – sondern auf die Gruppe <strong>und</strong> die Situation abstimmen.<br />
2. Spielketten ab 12 Jahren<br />
Wie schon weiter oben angedeutet, ist es besonders bei spielunerfahrenen, älteren <strong>Kinder</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen häufig ratsam, die<br />
Verknüpfung der Spiele durch Musik, Material oder andere Spielelemente <strong>zu</strong> wählen <strong>und</strong> auf Rahmengeschichten <strong>zu</strong> verzichten,<br />
da dieses häufig als „<strong>Kinder</strong>kram” abgetan wird. In diesem Fall ist es dann sehr schwer, die Gruppe erneut <strong>für</strong> eingebrachte<br />
Spielideen <strong>zu</strong> motivieren. Je spielerfahrener <strong>und</strong> -begeisterter eine Gruppe jedoch ist, desto eher –<strong>und</strong> dann auch intensiver–<br />
lässt sie sich auf eine Rahmengeschichte ein, wodurch eine Spielkette noch fesselnder werden kann.<br />
Bis diese Stufe erreicht ist, muss der Spielleiter die Art der Verknüpfung sorgfältig überlegen <strong>und</strong> gut vorbereiten. Vor allem über<br />
Musik lässt sich bei Jugendlichen gut ein Spielkettenrahmen herstellen, sofern sie aktuell genug ist oder nach bestimmten Kriterien<br />
ausgewählt wird. So sind aktuelle Pophits immer gefragt <strong>und</strong> auch ältere Titel werden meistens akzeptiert, wenn sie bekannte<br />
Oldies sind oder Titelmusiken berühmter Filme waren. Volkstümliche Schlager finden dagegen nur selten Akzeptanz.<br />
Da uns die Problematik dieser Altersgruppe aus langjähriger Erfahrung gut bekannt ist, geben wir fünf Beispiele <strong>für</strong> die Verknüpfung<br />
einer Spielkette ohne Rahmengeschichte (was jedoch schnell verändert werden kann) <strong>und</strong> ein Beispiel <strong>für</strong> eine Kette, verknüpft<br />
durch Rahmengeschichte <strong>und</strong> Musik, die wiederholt bei Gruppen mit spielerischer Erfahrung erfolgreich eingesetzt wurde.<br />
Spielketten können besonders bei Jugendlichen<br />
– als „Arbeitsmittel” <strong>zu</strong> einem bestimmten Thema,<br />
– als Methode <strong>zu</strong>r Bewusstmachung,<br />
– <strong>zu</strong>r Erreichung gruppenpädagogischer Ziele,<br />
– <strong>zu</strong>r Einleitung weiterer Aktivitäten, usw.<br />
eingesetzt werden.<br />
Dies ist möglich, da Jugendliche gut in der Lage sind, über gemachte Erfahrungen <strong>zu</strong> reflektieren, Themen wie Teamarbeit häufig<br />
an aktuelle Probleme der Jugendlichen anknüpfen <strong>und</strong> sie relativ sensibel <strong>für</strong> diese Themen sind. Die Auswertungsvorschläge<br />
am Ende einiger Spielketten geben Hinweise <strong>für</strong> eine gezielte <strong>und</strong> gemeinsame Auswertung.