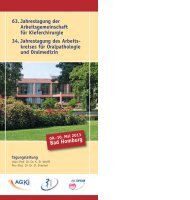Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift - Arbeitsgemeinschaft für ...
Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift - Arbeitsgemeinschaft für ...
Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift - Arbeitsgemeinschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
JAHRESTAGUNG DER AGKI / DES AKOPOM 2013D11folgt anhand des typischen röntgenologischen Bildes. Susukssind deutlich kürzer und bilden keine netzartige Struktur. Anamnestischstreiten die Träger der Susuks den Ursprung derröntgendichten Strukturen aufgrund von religiösen Hintergründenab. Bei der klinischen Untersuchung lassen sichGoldfäden oder Susuks nicht nachweisen. Aufgrund der röntgendichtenStruktur reduzieren sie die Qualität der Röntgenbilderund können bei Unwissenheit fehlinterpretiert werden.Susuks und Goldfäden sind im europäischen Kulturkreis eineRarität und treten in der Regel als Zufallsbefund auf, solltenaber dem Behandler bekannt sein, um eine Fehldiagnose zuvermeiden.Untersuchung über die Lokalisation von malignenHauttumoren im Kopf-Hals-BereichO. Thiele, B. Sundermann, K. Freier, J. HoffmannKlinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,Universitätsklinikum Heidelberg; oliver.thiele@med.uniheidelberg.deEinleitung: Maligne Hauttumoren zeigen eine deutlich zunehmendeInzidenz und werden als häufigste bösartige Erkrankungdes Menschen angesehen. Am häufigsten treten dieseMalignome im Kopf-Hals-Bereich auf. Das Basalzellkarzinom(BCC), das Plattenepithelkarzinom der Haut (SCCS) und dasmaligne Melanom (MM) sind die häufigsten Vertreter dieserGruppe von Tumoren.Patienten und Methodik: In diese Untersuchung wurden alle Patienteneingeschlossen, die im Zeitraum von 1994–2009 mit einerder oben genannten Erkrankungen in unserer Abteilungvorgestellt und behandelt wurden. Untersucht wurde die Lokalisationder Erkrankungen, um ein „mapping“ dieser Malignomeim Kopf-Hals-Bereich zu erstellen.Ergebnisse: Insgesamt wurden 325 Patienten eingeschlossen.Im Einzelnen zeigten sich 116BCC, 165SCCS und 44MM. Anhandder ästhetischen Untereinheiten des Gesichtes und Kopf-Hals-Bereiches wurde ein mapping der einzelnen Subtypen(BCC, SCCS, MM) und der Gesamtanzahl der Malignome erstellt.Schlussfolgerung: Diese Analyse der anatomischen Lokalisationender oben genannten Malignome erleichtert die Strukturierungder Planung der Resektion und plastischen Rekonstruktionvon Hauttumoren. Auch in der Planung der Festlegung vonSchwerpunkten in der chirurgischen Ausbildung können dieseErgebnisse Verwendung finden. Ebenso können sie bei Vorsorgeuntersuchungendieser in Zukunft häufigsten Tumorlokalisationdes Menschen die wichtigsten Zielstrukturen aufzeigen.Sensibilitätsausfall des N. alveolaris inferior durchein primär intraossäres Lymphom des Unterkiefers –ein FallberichtJ. IhbeCharitéCentrum <strong>für</strong> Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Berlin;jakob.ihbe@charite.deHintergrund: Die Differenzialdiagnose eines isolierten Sensibilitätsausfallsim Versorgungsgebiet des N. alveolaris inferior istvielfältig. Sie reicht von dentogener Kompression hin zur Osteomyelitisbis zu sich im Canalis alveolaris ausbreitendenraumfordernden Prozessen.Fallbericht: Ein 29-jähriger Patient stellte sich mit einem progredientenTaubheitsgefühl der linken Unterlippe zur operativenEntfernung des verlagerten Zahnes 38 vor. Nach initialerpostoperativer Beschwerdebesserung erfolgte die mehrfacheWiedervorstellung beim Hauszahnarzt aufgrund erneutenTaubheitsgefühls. Zwei Jahre nach der operativen Entfernungvon Zahn 38 erfolgte die erneute ambulante Vorstellung in derMKG-Chirurgie. Klinisch imponierte jetzt ein aufgetriebener,druckdolenter Alveolarkamm der regio 36 bis 38 sowie eineausgeprägte Hypästhesie der linken Unterlippe. Die PSA erbrachteeine unspezifische Transparenzerhöhung der regio 38bis 36, bis an den Canalis mandibularis reichend. Unter antibiotischerTherapie führten wir eine Kastenresektion des Unterkiefersdurch. Intraoperativ zeigten sich nekrotische Kieferanteilemit Entleerung von Pus sowie ein nach Debridementlangstreckig freiliegender N. alveolaris inferior. Histopathologischimponierten dichte Ansammlungen hochgradig pleomorpherZellen mit großen Kernen und Mitosen. Es konnte dieDiagnose eines hochmalignen Non-Hodgkin-Lymphoms derB-Zellreihe gestellt werden. Nach Kryokonservierung von Spermienwurde eine Immun-Chemotherapie durchgeführt. DerPatient befindet sich aktuell in kompletter Remission.Diskussion und Schlussfolgerung: Die Ursache einer Hypästhesieliegt meist in einer Beeinträchtigung des N. alveolaris inferiorinnerhalb des knöchern umschlossenen Mandibularkanals.Zunächst kommen hierbei irritativ-toxische Schädigungen imRahmen einer dentogenen Infektion bzw. nicht lege artisdurchgeführter endodontischer Maßnahmen der Unterkieferseitenzähnein Betracht. Traumatische Ursachen beinhaltendie Unterkieferfraktur sowie iatrogene Verletzungen in Nähedes Foramen mentale während einer Implantation oder einerWurzelspitzenresektion. Auch Umstellungsosteotomien sowiekieferorthopädische Therapie können eine Hypästhesie verursachen.Kompression des N. alveolaris inferior mit konsekutivemSensibilitätsausfall kann weiterhin durch Zysten odermaligne Prozesse bedingt sein. Die häufigste traumatische Ursacheeiner Hypästhesie ist die operative Entfernung retinierterund verlagerter Weisheitszähne in Nähe des Mandibularkanals.Mit der Diagnose eines primär im Unterkiefer symptomatischwerdenden Lymphoms zeigte sich in diesem Fall eineseltene durch Kompression bedingte Ursache einer Hypästhesiedes N. alveolaris inferior.Ein Weisheitszahn auf AbwegenK. Kansy, J. Hoffmann, K. FreierKlinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,Universitätsklinikum Heidelberg; katinka.kansy@med.uniheidelberg.deEinleitung: Etwa 20–30% aller unteren Weisheitszähne sind retiniert.Eine Verlagerung solcher Zähne in den aufsteigendenUnterkieferast ist deutlich seltener und nur wenige Fälle sind inder Literatur beschrieben. Im Folgenden möchten wir den Falleiner jungen Patientin darstellen, die sich in unserer Ambulanzvorstellte.Fallbeschreibung: Eine 27-jährige Patientin wurde seitens ihresHauszahnarztes zugewiesen. Im Alter von 22 Jahren war bei der© <strong>Deutsche</strong>r Ärzte-Verlag | DZZ | <strong>Deutsche</strong> <strong>Zahnärztliche</strong> <strong>Zeitschrift</strong> | 2013; 68 (5) ■