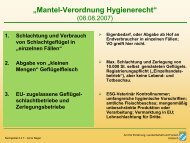Die Land- und Forstwirtschaft in Stadt und Landkreis Ansbach
Die Land- und Forstwirtschaft in Stadt und Landkreis Ansbach
Die Land- und Forstwirtschaft in Stadt und Landkreis Ansbach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
mit <strong>Land</strong>wirtschaftsschule<br />
Rothenburg<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
AELF <strong>Ansbach</strong><br />
Heilsbronn<br />
<strong>Die</strong> <strong>Land</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong>
Impressum<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Rügländer Straße 1<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Tel. 0981-8908-0<br />
Fax 0981-8908-199<br />
E-Mail poststelle@aelf-an.bayern.de<br />
Internet: www.aelf-an.bayern.de<br />
Schriftleitung:<br />
Berenz, Stefan<br />
Mun<strong>in</strong>ger, Maximilian<br />
Textbeiträge:<br />
Berenz, Stefan<br />
Habermayer, Gertrud<br />
Huber, Josef<br />
Hummel, Christian<br />
Jokic, Petra<br />
Kalchreuter, Siegfried<br />
Kolb, Herbert<br />
Küßwetter, Alexander<br />
Luger, Friedrich<br />
Meißler, Ludwig<br />
Messerschmidt, Elke<br />
Mun<strong>in</strong>ger, Maximilian<br />
Nagel, Anna<br />
Nagel, Bernd<br />
Pumpenmeier, Kurt<br />
Rieder, Kurt<br />
Rohr, Ines<br />
Spranger, Claus Rudolf<br />
Stemmer, Jürgen<br />
Täufer, Sylvia<br />
Wolfrum, Werner<br />
Zimmerer, Thomas<br />
Grafiken:<br />
Berenz, Stefan<br />
Huber, Gerald<br />
Mun<strong>in</strong>ger, Maximilian<br />
Layout:<br />
Berenz, Stefan<br />
1. Auflage: 200 Stück<br />
Druck Auernheimer, Robert im Eigenverlag<br />
des AELF <strong>Ansbach</strong><br />
Stand: Februar 2010<br />
2<br />
Datengr<strong>und</strong>lage<br />
AELF AN: Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten<br />
<strong>Ansbach</strong> Eigene Datenerhebungen.<br />
ALuE AN: Amt für <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Ernährung <strong>Ansbach</strong><br />
(2000): <strong>Die</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft im <strong>Die</strong>nstgebiet des Amtes für <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Ernährung <strong>Ansbach</strong>.<br />
ALF AN: Amt für <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong> (2005):<br />
<strong>Die</strong> <strong>Land</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong> <strong>und</strong> deren Entwicklung im <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong>.<br />
Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Forsten: INVEKOS-Daten.<br />
BMELV: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong><br />
Verbraucherschutz: http://www.bmelv-statistik.de/<br />
BMELV: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong><br />
Verbraucherschutz (2007): Agrar-politischer Bericht der B<strong>und</strong>esregierung<br />
2007.<br />
http://www.bmelv.de/cln_045/nn_751986/DE/13-Service/Pub<br />
likationen/Agrarbericht/__Agrarbericht__node.html__nnn=true<br />
C.A.R.M.E.N. e.V.: Centrale Agrar-Rohstoff- Market<strong>in</strong>g- <strong>und</strong><br />
Entwicklungs-Netzwerk e.V.: Demonstrationsprojekte der energetischen<br />
Biomassenutzung <strong>in</strong> Bayern. http://www.carmen-ev.de<br />
Cluster-Initiative Forst <strong>und</strong> Holz <strong>in</strong> Bayern: Cluster-Studie<br />
Forst <strong>und</strong> Holz <strong>in</strong> Bayern 2008. www.cluster-forstholzbayern.de<br />
Energiekonzept <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008: EBA-GmbH<br />
Triesdorf, Ing.-Büro Jungbauer <strong>und</strong> Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
Handwerkskammer für Mittelfranken: Statistik zu Holzverarbeitenden<br />
Betrieben <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong>. www.hwk-mittelfranken.de<br />
LfL/IEM: Bayerische <strong>Land</strong>esanstalt für <strong>Land</strong>wirtschaft, Institut<br />
für Ernährung <strong>und</strong> Markt: Milchquotenwanderung <strong>in</strong> Bayern (seit<br />
Bestehen der Milchbörse).<br />
LfL/ILB: Bayerische <strong>Land</strong>esanstalt für <strong>Land</strong>wirtschaft, Institut<br />
für Ländliche Strukturentwicklung, Betriebswirtschaft <strong>und</strong> Agrar<strong>in</strong>formatik:<br />
Deckungsbeiträge <strong>und</strong> Kalkulationsdaten.<br />
http://www.lfl.bayern.de/ilb/db/<br />
LfL/ILT: Bayerische <strong>Land</strong>esanstalt für <strong>Land</strong>wirtschaft, Institut<br />
für <strong>Land</strong>technik <strong>und</strong> Tierhaltung (2009): Jahresbericht 2008.<br />
LfStaD: Bayerisches <strong>Land</strong>esamt für Statistik <strong>und</strong> Datenverarbeitung:<br />
https://www.statistikdaten.bayern.de<br />
LWA AN: <strong>Land</strong>wirtschaftsamt <strong>Ansbach</strong> (2001): <strong>Die</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
im <strong>Die</strong>nstgebiet des <strong>Land</strong>wirtschaftsamtes <strong>Ansbach</strong>.<br />
LWF: <strong>Land</strong>esanstalt für Wald <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong>:: Erfolgreich<br />
mit der Natur. Ergebnisse der zweiten B<strong>und</strong>eswald<strong>in</strong>ventur <strong>in</strong><br />
Bayern. 2004. www.lwf.bayern.de<br />
Reg Mfr.: Regierung von Mittelfranken: Mittelfranken <strong>in</strong> Zahlen:<br />
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt3/zahl<br />
en/abt35009.htm<br />
StatBA: Statistisches B<strong>und</strong>esamt Deutschland:<br />
http://www.destatis.de<br />
StMLF: Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong><br />
Forsten (2008):Bayerischer Agrarbericht 2008.<br />
StMELF: Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Forsten (2009): http://www.stmelf.bayern.de<br />
Taeger, S. (2007): Abschätzung e<strong>in</strong>es Waldenergiepotenzials für<br />
den <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong>. Amt für <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten<br />
<strong>Ansbach</strong>, Bereich Forsten.<br />
Verband der Holzwirtschaft <strong>und</strong> Kunststoffverarbeitung<br />
Bayern/Thür<strong>in</strong>gen e.V.: Sägewerke <strong>in</strong> Mittelfranken.<br />
www.holzverband.de
Vorwort<br />
Sehr geehrte Damen <strong>und</strong> Herren,<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
wir freuen uns über Ihr Interesse an der <strong>Land</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis Ans-<br />
bach. Mit diesem Heft geben wir Ihnen e<strong>in</strong>en Überblick über die Struktur <strong>und</strong> die Entwicklung<br />
der <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> den Zustand, sowie die Nutzung der Wälder.<br />
<strong>Die</strong> landwirtschaftlich <strong>und</strong> forstlich genutzten Flächen bedecken zusammen rd. 84 % dieses<br />
über 2.000 km 2 großen Gebietes. <strong>Die</strong> nachhaltige Bewirtschaftung von Äckern, Wiesen <strong>und</strong><br />
Wäldern ist Existenzgr<strong>und</strong>lage für über 4.000 landwirtschaftliche Betriebe <strong>und</strong> sichert sowohl<br />
deren E<strong>in</strong>kommen wie auch die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hoch-<br />
wertigen Lebensmitteln <strong>und</strong> dem Rohstoff Holz. <strong>Land</strong>wirten <strong>und</strong> Waldbesitzern haben wir die<br />
Pflege <strong>und</strong> die abwechslungsreiche Gestaltung unserer Kulturlandschaft zu verdanken.<br />
<strong>Die</strong>se Zusammenstellung soll nicht nur als Nachschlagewerk für Zahlen <strong>und</strong> Fakten dienen,<br />
sondern sie will auch aufzeigen wie vielfältig, wie <strong>in</strong>novativ <strong>und</strong> kreativ <strong>Land</strong>bewirtschaftung<br />
heute ist <strong>und</strong> se<strong>in</strong> muss, um im <strong>in</strong>ternationalen Wettbewerb bestehen zu können.<br />
<strong>Die</strong> Bewahrung <strong>und</strong> Entwicklung der Wettbewerbs- <strong>und</strong> Zukunftsfähigkeit der <strong>Land</strong>-, Forst-<br />
<strong>und</strong> Ernährungswirtschaft <strong>und</strong> damit möglichst vieler bäuerlicher Existenzen ist e<strong>in</strong> zentrales<br />
Anliegen unseres Amtes für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong>.<br />
So erhalten Sie mit diesem „Werk“ auch e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Aufgaben unseres Amtes.<br />
Wir bedanken uns bei den Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kollegen für ihre Beiträge. Der besondere Dank<br />
gilt den beiden Schriftleitern, Herrn Stefan Berenz <strong>und</strong> Herrn Maximilian Mun<strong>in</strong>ger.<br />
Friedrich Luger Alexander Küßwetter<br />
Behördenleiter stellv. Behördenleiter<br />
Bereichsleiter Forsten Bereichsleiter <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
3
Inhalt<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es zu <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> ............................................. 7<br />
II. Agrarstruktur ................................................................................................. 9<br />
1. Strukturelle Entwicklung der Betriebe .................................................................. 12<br />
2. Bodenproduktion ................................................................................................... 14<br />
2.1 Anbaustatistik ........................................................................................................... 14<br />
2.2 Ökologischer <strong>Land</strong>bau ............................................................................................. 15<br />
2.3 Sonderkulturen ......................................................................................................... 16<br />
3. Tierhaltung ............................................................................................................ 17<br />
3.1 Milchvieh ................................................................................................................. 17<br />
3.2 R<strong>in</strong>dfleisch ............................................................................................................... 19<br />
3.3 Schwe<strong>in</strong>e .................................................................................................................. 19<br />
3.4 Schafe <strong>und</strong> Ziegen .................................................................................................... 22<br />
3.5 Geflügel .................................................................................................................... 22<br />
3.6 Pferde ....................................................................................................................... 23<br />
4. Ernährung .............................................................................................................. 24<br />
5. Energieerzeugung .................................................................................................. 24<br />
5.1 Biogasanlagen .......................................................................................................... 24<br />
5.2 Fotovoltaikanlagen ................................................................................................... 26<br />
6. Gäste auf dem Bauernhof Erlebnisorientierte Angebote ...................................... 27<br />
7. Direktvermarktung ................................................................................................ 27<br />
III. Wertschöpfungspotentiale .......................................................................... 29<br />
IV. Förderung <strong>und</strong> Fördervollzug ..................................................................... 33<br />
1. Nicht <strong>in</strong>vestiver Bereich ........................................................................................ 33<br />
2. Investiver Bereich: E<strong>in</strong>zelbetriebliche Investitionsförderung (EIF) ..................... 34<br />
V. Bildung, Beratung, Schule .......................................................................... 37<br />
1. Bildung .................................................................................................................. 37<br />
2. Beratung ................................................................................................................ 38<br />
3. Schule .................................................................................................................... 39<br />
5
6<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
VI. <strong>Forstwirtschaft</strong>............................................................................................. 41<br />
1. Bereich Forsten ..................................................................................................... 41<br />
2. Wald Heute ........................................................................................................... 44<br />
2.1 Waldfläche ................................................................................................................44<br />
2.2 Erstaufforstung .........................................................................................................45<br />
2.3 Rodung ......................................................................................................................45<br />
2.4 Waldbesitz ................................................................................................................46<br />
2.5 Baumarten .................................................................................................................48<br />
2.6 Vorrat <strong>und</strong> Zuwachs .................................................................................................49<br />
3. Wald Zukunft ........................................................................................................ 50<br />
3.1 Klimawandel .............................................................................................................50<br />
3.2 Waldumbau ...............................................................................................................51<br />
3.3 Waldverjüngung <strong>und</strong> Jagd ........................................................................................52<br />
4. Wald Leistungen <strong>und</strong> Funktionen ......................................................................... 54<br />
4.1 Waldzustandsbericht <strong>und</strong> Kronenzustandserhebung ................................................54<br />
4.2 Waldfunktionsplanung ..............................................................................................54<br />
4.3 Naturschutz ...............................................................................................................55<br />
5. Erneuerbare Energien ............................................................................................ 59<br />
5.1 Scheitholz .................................................................................................................59<br />
5.2 Pellets ........................................................................................................................59<br />
5.3 Hackschnitzel ............................................................................................................60<br />
5.4 Biomasseheizwerke ..................................................................................................61<br />
5.5 Energieholzpotential aus dem Wald .........................................................................61<br />
5.6 Energiewald als Kurzumtriebskultur ........................................................................62<br />
6. Holzwirtschaft ....................................................................................................... 63<br />
6.1 Cluster Forst Holz Bayern ........................................................................................63<br />
6.2 Sägewerke .................................................................................................................64<br />
7. Wertschöpfungspotential ...................................................................................... 65<br />
VII. Amtsgliederung <strong>und</strong> Aufgaben der Sachgebiete ........................................ 67<br />
1. <strong>Die</strong>nststellen .......................................................................................................... 67<br />
2. Forstreviere ........................................................................................................... 68<br />
3. Aufgabenbereiche <strong>und</strong> Sachgebiete ...................................................................... 69<br />
4. Organisation <strong>und</strong> Zuständigkeit im Forst ............................................................. 75<br />
VIII. Verbände <strong>und</strong> Selbsthilfeorganisationen .................................................... 77
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
I. Allgeme<strong>in</strong>es zu <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
Tabelle 1: Vergleich Fläche <strong>und</strong> Bevölkerung <strong>Ansbach</strong>, Bayern <strong>und</strong> Deutschland<br />
Bezeichnung E<strong>in</strong>heit <strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Quellen: LfStaD, StatBA<br />
Tabelle 2: Geographische <strong>und</strong> klimatische Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
Bezeichnung Ausprägung<br />
Höhenlage 300 – 689 m ü. n. N.<br />
Niederschlag 480 – 900 mm (Ø 712 mm)<br />
Ø Jahrestemperatur 8,2°C<br />
Bodenzahl Ø 40<br />
Geologie Keuper ca. 75 %, Jura (um den Hesselberg) ca. 17 %, Muschelkalk <strong>in</strong> der<br />
Quellen: ALF AN<br />
Gegend um Rothenburg mit ca. 8 % der Fläche<br />
Tabelle 3: Vergleich Flächennutzung <strong>Ansbach</strong>, Bayern <strong>und</strong> Deutschland 2007<br />
Quellen: BMELV, INVEKOS, StatBA<br />
Bayern Deutschland<br />
Fläche qkm 2.072 70.551 357.050<br />
Bevölkerung E<strong>in</strong>wohner 222.623 12.520.332 82.217.800<br />
Bvölkerungsdichte E<strong>in</strong>w./qkm 107 177 230<br />
1) Kreisfreie <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
Bezeichnung<br />
1.000 ha % 1.000 ha % 1.000 ha %<br />
Ackerland 76,8 (63%) 2.010 (57%) 11.877 (63%)<br />
Grünland 37,5 (31%) 1.141 (32%) 4.875 (26%)<br />
Dauerkulturen 0,1 (0%) 25 (1%) 198 (1%)<br />
Teichfläche 0,4 (0%) 5 (0%) 828 (4%)<br />
sonst. landw. Flächen 6,5 (5%) 351 (10%) 1.155 (6%)<br />
landwirtschaftliche Fläche gesamt 121,2 (58%) 3.532 (50%) 18.932 (53%)<br />
Waldfläche 57,8 (28%) 2.560 (36%) 11.100 (31%)<br />
Wasserfläche 3,2 (2%) 143 (2%) 828 (2%)<br />
Wohnen 3,7 (2%) 178 (3%) 1.130 (3%)<br />
Gewerbe <strong>und</strong> Industrie 1,1 (1%) 37 (1%) 316 (1%)<br />
Verkehr 12,8 (6%) 330 (5%) 1.745 (5%)<br />
Sonstige 7,5 (4%) 275 (4%) 1.654 (5%)<br />
Gesamtfläche 207,2 7.055 35.705<br />
1) Kreisfreie <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
<strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Bayern Deutschland<br />
7
II. Agrarstruktur<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Im <strong>Stadt</strong>- <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreisgebiet <strong>Ansbach</strong> werden nach Angaben der Mehrfachantragstelle<br />
1.501 Betriebe (35 Prozent) im Haupterwerb <strong>und</strong> 2.734 Betriebe (65 Prozent) im Nebenerwerb<br />
geführt (INVEKOS). E<strong>in</strong> Haupterwerbsbetrieb liegt vor, wenn m<strong>in</strong>destens 0,75 Arbeitskräfte<br />
im Betrieb beschäftigt s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> m<strong>in</strong>destens 50 Prozent des Gesamte<strong>in</strong>kommens aus dem Betrieb<br />
erwirtschaftet werden oder wenn m<strong>in</strong>destens 1,5 Arbeitskräfte im Betrieb beschäftigt<br />
s<strong>in</strong>d. Im Jahr 2000 wurden noch knapp 42 Prozent der ca. 5.100 Betriebe im Haupterwerb geführt.<br />
Gab es 1991 noch r<strong>und</strong> 6.600 landwirtschaftliche Unternehmen so wurden 2008 nur noch<br />
4.235 Betriebe über INVEKOS registriert. Das ist e<strong>in</strong> Rückgang um über 35 Prozent.<br />
Gut e<strong>in</strong> Prozent der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche <strong>in</strong> Bayern werden von der<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft erwirtschaftet. Im Regierungsbezirk Mittelfranken leistet die <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
circa zwei Prozent der Bruttowertschöpfung.<br />
Der Pachtflächenanteil liegt mittlerweile eher bei 50 % der von den Betrieben bewirtschafteten<br />
landwirtschaftlichen Nutzfläche gegenüber 46 Prozent von 1999. Im B<strong>und</strong>esdurchschnitt liegt<br />
der Pachtflächenanteil derzeit bei 65 Prozent.<br />
Tabelle 4: Vergleich Betriebsgrößenstruktur <strong>Ansbach</strong>, Bayern <strong>und</strong> Deutschland (<strong>Land</strong>wirtschaftliche<br />
Betriebe ab 2 ha LF 2007)<br />
Bezeichnung E<strong>in</strong>heit <strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Quellen: StMLF, INVEKOS<br />
Bayern Deutschland<br />
<strong>Land</strong>wirtschaftliche Nutzfläche ha 115.394 3.218.100 16.933.900<br />
prozentualer Anteil Deutschland 0,7% 19% 100%<br />
prozentualer Anteil Bayern 3,6% 100%<br />
Anzahl Betriebe 4.235 117.900 349.000<br />
prozentualer Anteil Deutschland 1,2% 34% 100%<br />
prozentualer Anteil Bayern 3,6% 100%<br />
Durchschnittliche Betriebsgröße ha/Betrieb 27,2 27,3 48,5<br />
1) Kreisfreie <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
E<strong>in</strong> Vergleich der Betriebsgrößenstrukturen des <strong>Land</strong>kreises mit <strong>Stadt</strong>gebiet zu Bayern <strong>und</strong><br />
Deutschland (Tabelle 4) zeigt, dass <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> annähernd gleiche Verhältnisse<br />
vorherrschen wie <strong>in</strong> Bayern <strong>in</strong>sgesamt. Deutlich mehr Flächenausstattung verzeichnen<br />
Betriebe im B<strong>und</strong>esdurchschnitt. <strong>Die</strong> Ausgangslage für die weitere Entwicklung von wettbewerbsfähigen<br />
landwirtschaftlichen Unternehmen ist weiterh<strong>in</strong> durchaus gut.<br />
9
10<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 1: Betriebsstruktur nach landwirtschaftlich genutzter Fläche <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008<br />
30%<br />
Anteil 25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
Abbildung 2: Betriebswirtschaftliche Ausrichtung der landwirtschaftlichen Betriebe<br />
2008<br />
Pflanzenbauverb<strong>und</strong><br />
Pflanzenbau-<br />
Viehhaltungsverb<strong>und</strong><br />
Gartenbau<br />
Quelle: LfStaD<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
Veredelung Viehhaltungsverb<strong>und</strong><br />
Ackerbau<br />
Dauerkultur<br />
Futterbau<br />
(Weidevieh)<br />
Betriebe LF<br />
4.235 Betriebe<br />
115.253 ha LF<br />
Ø 27 ha LF/Betrieb<br />
Pflanzenbau-<br />
Viehhaltungsverb<strong>und</strong><br />
Gartenbau<br />
Pflanzenbau-<br />
Bayern<br />
verb<strong>und</strong> Veredelung<br />
Viehhaltungsverb<strong>und</strong><br />
Ackerbau<br />
Dauerkultur<br />
Futterbau<br />
(Weidevieh)
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Tabelle 5: Erläuterung zur Betriebswirtschaftlichen Ausrichtung landwirtschaftlicher<br />
Betriebe<br />
Betriebsform Erläuterung<br />
spezialisierte Betriebe Anteil von … am gesamten SDB des Betriebes >2/3<br />
Ackerbau Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben, Handelsgewächse,<br />
Feldgemüse, Futterpflanzen, Sämereien, Hopfen<br />
Gartenbau Gemüse, Erdbeeren im Freiland <strong>und</strong> unter Glas, Blumen<br />
<strong>und</strong> Zierpflanzen im Freiland <strong>und</strong> unter Glas, Baumschulen<br />
Dauerkulturen We<strong>in</strong>bau Rebanlagen<br />
Obstbau Obst<br />
Sonstige Dauerkulturen Sonstige Dauerkulturen<br />
Futterbau Milchvieh Milchkühe, Färsen, weibliche Jungr<strong>in</strong>der (=Weidevieh)<br />
Sonstiger Futterbau Zucht- <strong>und</strong> Mastr<strong>in</strong>der, Schafe, Pferde (=Weidevieh)<br />
Veredelung Schwe<strong>in</strong>e, Geflügel<br />
Nicht spezialisierte Betriebe Anteil e<strong>in</strong>zelner Zweige am gesamten SDB des Betriebes<br />
>1/3 aber
12<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
1. Strukturelle Entwicklung der Betriebe<br />
Tabelle 6: Entwicklung Anzahl Betriebe sowie durchschnittliche Schlaggröße <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
Jahr Betriebe Nutzungen 1)<br />
Quelle: INVEKOS<br />
Abbildung 3: Betriebsstruktur nach landwirtschaftlich genutzter Fläche <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> von 1993 bis 2008<br />
Quelle: INVEKOS, LWA AN<br />
Abbildung 4: Altersstruktur der Mehrfachantragsteller <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
2009<br />
Anmerkung: In der Gruppe 20 – 25 Jahre s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige GbR’s mit enthalten.<br />
Quelle: INVEKOS<br />
ha LF Ø Schlaggröße<br />
1993 6.171 108.295 118.554 1,09<br />
1998 5.281 99.494 118.317 1,19<br />
2003 4.397 83.813 116.123 1,39<br />
2008 4.235 74.959 115.852 1,55<br />
1) e<strong>in</strong>zelne mit Mehrfachantrag gemeldete Feldstücke<br />
2.500<br />
Betriebe 2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
20%<br />
18%<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
1993: 6.171 Betriebe<br />
2001: 4.768 Betriebe<br />
2008: 4.235 Betriebe<br />
bis 10 ha 11 - 20 ha 21 - 30 ha 31 - 50 ha über 50 ha<br />
20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90<br />
Altersklassen<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl Betriebe <strong>in</strong>sgesamt sowie e<strong>in</strong>zelne Tierhaltungsverfahren<br />
<strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008<br />
14.000<br />
Betriebe<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Anmerkung: Der kle<strong>in</strong>e Sprung bei der Anzahl der Betriebe zwischen den Jahren 2004 <strong>und</strong> 2005 ergibt<br />
sich durch die neuen Antragsteller, die sich die Zahlungsansprüche für die Betriebsprämie<br />
sichern wollten <strong>und</strong> durch das H<strong>in</strong>zukommen von Betrieben, die ab 2005 VNP-<br />
Maßnahmen beantragen.<br />
Quelle: INVEKOS, <strong>Land</strong>kreisbroschüren früherer Jahre, Dr. Rieder<br />
Waren es 1972 noch r<strong>und</strong> 12.000 Betriebe so wurden 2009 noch r<strong>und</strong> 4.000 Betriebe über den<br />
Mehrfachantrag registriert.<br />
Ökonomisch <strong>und</strong> gesellschaftlich gesehen bedeutet dies:<br />
den Verlust e<strong>in</strong>er enormen Zahl an Arbeitsplätzen im Ländlichen Raum<br />
die Vernichtung von Vermögenssubstanz durch Wegfall der Funktion von Wirtschaftsgebäuden<br />
M<strong>in</strong>derung <strong>und</strong> Verlust von Arbeitsplätzen <strong>in</strong> Handwerk <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistung durch s<strong>in</strong>kende<br />
Nachfrage<br />
M<strong>in</strong>derung der Ref<strong>in</strong>anzierungskraft von Investitionen im Ländlichen Raum<br />
Abwanderung <strong>und</strong> wachsende soziale Probleme<br />
Betriebe (ab 1993 Mehrfachantragsteller)<br />
Milchviehhalter (ab 2001 alle Kühe)<br />
Schwe<strong>in</strong>emäster<br />
Ferkelerzeuger<br />
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
13
14<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
2. Bodenproduktion<br />
2.1 Anbaustatistik<br />
<strong>Die</strong> Anbaustatistik zeigt e<strong>in</strong>e große Vielfalt von im <strong>Land</strong>kreis angebauten Kulturen. Silomais,<br />
W<strong>in</strong>tergerste <strong>und</strong> W<strong>in</strong>terweizen s<strong>in</strong>d die am häufigsten angebauten Kulturen. Silomais <strong>und</strong><br />
W<strong>in</strong>tergerste werden <strong>in</strong>sbesondere benötigt für die leistungsfähige Veredelungs- <strong>und</strong> Milchwirtschaft.<br />
Tabelle 7: Anbaustatistik 2008 für <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> Bayern im Vergleich<br />
Kultur <strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Quelle: INVEKOS<br />
ha ha<br />
Bayern <strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Bayern <strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Anteil von<br />
Bayern<br />
W<strong>in</strong>terweizen 14.715 506.468 19,2% 25,2% 2,9%<br />
Sommerweizen 75 5.835 0,1% 0,3% 1,3%<br />
Roggen 2.276 44.559 3,0% 2,2% 5,1%<br />
Triticale 6.541 71.054 8,5% 3,5% 9,2%<br />
W<strong>in</strong>tergerste 19.585 283.376 25,5% 14,1% 6,9%<br />
Sommergerste 743 148.654 1,0% 7,4% 0,5%<br />
Hafer 1.151 33.496 1,5% 1,7% 3,4%<br />
Kartoffeln 498 42.952 0,6% 2,1% 1,2%<br />
Zuckerrüben 882 62.592 1,1% 3,1% 1,4%<br />
Raps 5.684 164.708 7,4% 8,2% 3,5%<br />
Körnermais/CCM 525 132.014 0,7% 6,6% 0,4%<br />
Silomais 18.758 338.366 24,4% 16,8% 5,5%<br />
Erbsen/Ackerbohnen 480 11.187 0,6% 0,6% 4,3%<br />
Luzerne/Klee/Kleegras 2.812 90.383 3,7% 4,5% 3,1%<br />
Heilpflanzen 60 538 0,1% 0,0% 11,1%<br />
Gemüse 99 10.914 0,1% 0,5% 0,9%<br />
Spargel 24 2.500 0,0% 0,1% 0,9%<br />
Tabak 10 396 0,0% 0,0% 2,6%<br />
Erdbeeren 12 2.316 0,0% 0,1% 0,5%<br />
Obst (<strong>in</strong>cl. Streuobst) 31 4.291 0,0% 0,2% 0,7%<br />
Rebland 13 3.220 0,0% 0,2% 0,4%<br />
Stilllegung 327 4.214 0,4% 0,2% 7,8%<br />
Ackerland gesamt 76.795 2.010.229 3,8%<br />
Grünland gesamt 37.450 1.140.598 3,3%<br />
1) Kreisfreie <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
Anteile an Fruchtfolge<br />
W<strong>in</strong>terweizen ist mit e<strong>in</strong>em Ertragspotential von 60 bis 100 dt/ha die ertragreichste Getreidefrucht<br />
<strong>und</strong> wird <strong>in</strong> größeren Mengen auf den Markt gebracht. Raps, als nachwachsender Roh-
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
stoff <strong>und</strong> als Konsumraps e<strong>in</strong> marktfähiges Produkt, wird gerne wegen se<strong>in</strong>er bodenstabilisierenden<br />
<strong>und</strong> verbessernden Eigenschaften <strong>in</strong> der Fruchtfolge e<strong>in</strong>gesetzt. Ähnliches gilt für den<br />
Erbsen- <strong>und</strong> Ackerbohnenanbau.<br />
Andererseits s<strong>in</strong>d die Gew<strong>in</strong>ne im Getreidebau aufgr<strong>und</strong> der massiv gesenkten M<strong>in</strong>destpreise,<br />
gleich Interventionspreise, seit 1994 drastisch gesunken. Ohne Ausgleichszahlungen subventioniert<br />
<strong>in</strong> vielen Betrieben die Veredelungswirtschaft <strong>und</strong> Milchproduktion zum Teil <strong>in</strong> erheblichem<br />
Maße den Getreidebau bei den bestehenden Kostenstrukturen der Mechanisierung der<br />
Außenwirtschaft. Wobei die Erzeugung von Milch, Fleisch <strong>und</strong> Eiern nur dann ordnungsgemäß<br />
erfolgen kann, wenn die anfallende Gülle bzw. der anfallende Mist nicht nur schadlos, sondern<br />
auch wertschöpfend im Pflanzenbau zur Düngung <strong>und</strong> zur Sicherung des M<strong>in</strong>eralstoffkreislaufes<br />
e<strong>in</strong>gesetzt wird.<br />
Abbildung 6: Verteilung der Nutzung der Ackerflächen 2008<br />
Ölsaaten<br />
7,4%<br />
Hackfrüchte<br />
<strong>in</strong>kl.<br />
Zuckerrüben<br />
1,8%<br />
Ackerfutter <strong>in</strong>kl.<br />
GPS<br />
29,5%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
Eiweißpflanzen<br />
0,6%<br />
2.2 Ökologischer <strong>Land</strong>bau<br />
Sonderkulturen<br />
<strong>in</strong>kl. Gemüse<br />
0,3%<br />
Dauerkulturen<br />
<strong>in</strong>kl. Hopfen<br />
0,2%<br />
Getreide <strong>in</strong>kl.<br />
Körnermais<br />
60,3%<br />
Hackfrüchte<br />
<strong>in</strong>kl.<br />
Zuckerrüben<br />
5,3%<br />
Ölsaaten<br />
8,2%<br />
Ackerfutter <strong>in</strong>kl.<br />
GPS<br />
22,5%<br />
Eiweißpflanzen<br />
0,6%<br />
Bayern<br />
Sonderkulturen<br />
<strong>in</strong>kl. Gemüse<br />
0,7%<br />
77.000 ha 2.036.000 ha<br />
Dauerkulturen<br />
<strong>in</strong>kl. Hopfen<br />
1,8%<br />
Getreide <strong>in</strong>kl.<br />
Körnermais<br />
61,0%<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> wirtschaften 2009 91 Betriebe (KULAP-Betriebe) nach<br />
den Kriterien des ökologischen <strong>Land</strong>baus. <strong>Die</strong>s s<strong>in</strong>d 2,3 % aller landwirtschaftlichen Betriebe.<br />
<strong>Die</strong>se Betriebe bewirtschaften 3.802 ha, bzw. 3,3 % der gesamten LF.<br />
Nach ger<strong>in</strong>gen Umstellungsraten <strong>in</strong> den Vorjahren <strong>in</strong> Nordbayern betrug die Umstellungsrate<br />
im <strong>Land</strong>kreis <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> auf Betriebe bezogen 2008/2009 8,3 % (+ 12 Betriebe)<br />
<strong>und</strong> liegt damit knapp unter der durchschnittlichen mittelfränkischen Neuumstellungsrate von<br />
9,5 %.<br />
<strong>Die</strong> durchschnittliche Betriebsgröße der Ökobetriebe im <strong>Land</strong>kreis <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> liegt<br />
mit 41,8 ha vergleichsweise hoch.<br />
E<strong>in</strong>en deutlichen Schwerpunkt bilden die Milchviehbetriebe mit nahezu ausschließlich Laufstallhaltung.<br />
Vorwiegend handelt es sich dabei um Betriebe des Anbauverbandes „Demeter“<br />
mit größtenteils schon jahrzehntelanger Milchlieferung nach Schrozberg <strong>in</strong> Baden-<br />
Württemberg. Ger<strong>in</strong>ge Milchmengen werden auch von der Molkerei Zott <strong>in</strong> Mert<strong>in</strong>gen verarbeitet.<br />
15
16<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Auch der Freilandgemüseanbau wird von e<strong>in</strong>igen Betrieben stärker durchgeführt.<br />
Für die Vermarktung hat der Raum Nürnberg mit den „ebl“-Läden <strong>und</strong> anderen Naturkosthändlern<br />
sowie die Fa. „tegut“ <strong>in</strong> Fulda mit e<strong>in</strong>er Getreideannahmestelle <strong>und</strong> Vermahlung <strong>in</strong><br />
Alberndorf große Bedeutung.<br />
2.3 Sonderkulturen<br />
Karpfenproduktion im Raum D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
Zwetschgen- <strong>und</strong> Kirschenanbau im Hesselberggebiet<br />
Krautanbau <strong>in</strong> Merkendorf<br />
We<strong>in</strong>baubetriebe im Taubertal<br />
Kartoffelanbau <strong>in</strong> W<strong>in</strong>dsbach<br />
Spargelanbau <strong>in</strong> Heilsbronn<br />
Hopfenanbau <strong>in</strong> W<strong>in</strong>kelhaid<br />
Abbildung 7: Besonderheiten der Flächennutzung im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
Quelle: LWA AN<br />
We<strong>in</strong>bau<br />
Karpfen<br />
Zwetschgen,<br />
Kirschen<br />
Kraut<br />
Spargel<br />
Hopfen<br />
Kartoffeln<br />
Bildquelle: http://www.wifoe-landkreis-ansbach.de
3. Tierhaltung<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>in</strong> der <strong>Land</strong>wirtschaft erzielten Umsätze stammen zu 75 bis 80 Prozent aus der Tierhaltung.<br />
<strong>Die</strong> Hälfte der Umsätze der Tierhaltung <strong>in</strong> Bayern wurden bislang durch die Milcherzeugung<br />
ermöglicht (StMLF).<br />
Tabelle 8: Viehhaltung <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008<br />
Tierart Betriebe Anzahl Tiere Tiere/Betrieb<br />
Milchkühe e<strong>in</strong>schl. Mutter- u. Ammenkühe 1.937 45.034 23<br />
Männl. R<strong>in</strong>der 0,5 - 2 Jahre 2.298 23.621 10<br />
Zuchtsauen 457 15.711 34<br />
Mastschwe<strong>in</strong>e größer 30 kg 1.479 63.213 43<br />
Mutterschafe 380 11.028 29<br />
Ponys u. Pferde 321 2.482 8<br />
Legehennen 1.512 57.775 38<br />
Quelle: INVEKOS<br />
Tabelle 9: Viehhaltung <strong>in</strong> „größeren“ Tierbeständen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
2008<br />
Produktionsrichtung Betriebe über Anteil "Großbetriebe"<br />
Milchkühe 60 Milchkühe 120 von 1.937 Betrieben 6,2%<br />
Mastbullen 100 Mastbullen 8 von 1.240 Betrieben 0,6%<br />
Zuchtsauen 100 Zuchtsauen 50 von 457 Betrieben 10,9%<br />
Mastschwe<strong>in</strong>e 400 Mastplätze 39 von 1.479 Betrieben 2,6%<br />
Legehennen 2.000 Legenhennen 7 von 1.611 Betrieben 0,4%<br />
Schafe 500 Mutterschafen 4 von 363 Betrieben 1,1%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
3.1 Milchvieh<br />
Der <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> e<strong>in</strong>schließlich des <strong>Stadt</strong>gebietes gilt seit jeher als milchviehstarke Region.<br />
Nach Unterallgäu, Ostallgäu <strong>und</strong> Rosenheim zählt <strong>Ansbach</strong> mit e<strong>in</strong>er jährlichen Milchablieferung<br />
von 251.000 Tonnen zu den Spitzenreitern <strong>in</strong> der bayerischen Milchproduktion. Sie<br />
wird gemäß InVeKoS-Daten (2009) von 42.500 Kühen <strong>in</strong> 1.460 Betrieben gewonnen (29 Kühe<br />
je Betrieb). In knapp 500 Laufställen werden fast 60 Prozent aller Kühe gehalten. Bestände<br />
über 50 Kühe zeigen e<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierliches Wachstum. Kuhkomfort e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> Vere<strong>in</strong>fachung<br />
der Arbeitswirtschaft andererseits haben oberste Priorität. Was die Verbreitung des Automatischen<br />
Melksystems (AMS) betrifft, so ist der <strong>Land</strong>kreis mit r<strong>und</strong> 50 <strong>in</strong> Bayern führend.<br />
R<strong>und</strong> 80 Prozent der Kühe stehen unter Milchleistungsprüfung mit sehr guten Leistungen:<br />
Fleckvieh mit r<strong>und</strong> 7.000 kg Milch bei e<strong>in</strong>em Rasseanteil von 85 Prozent bzw. 15 Prozent<br />
17
18<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Holste<strong>in</strong>s mit 8.400 kg Milch. Als Flächenkonkurrent muss die wachsende Zahl von Biogasanlagen<br />
(derzeit 150) gesehen werden, die bereits 15 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche<br />
<strong>in</strong> Anspruch nehmen.<br />
Seit E<strong>in</strong>führung der Milchquotenbörse im Jahr 2000 haben die <strong>Land</strong>wirte von <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> netto e<strong>in</strong>en Quotenabgang von ca. 6.500 Tonnen zu verzeichnen, davon alle<strong>in</strong>e<br />
ca. 2.000 Tonnen Milchquote <strong>in</strong> den Jahren 2007 bis 2009 (LfL/IEM).<br />
Abbildung 8: Betriebsstruktur nach gehaltenen Kühen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
2008<br />
60%<br />
Anteil 50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
Abbildung 9: Strukturentwicklung <strong>in</strong> der Milchviehhaltung nach gehaltenen Kühen <strong>in</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
3.500<br />
Betriebe 3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Quellen: ALuE AN, ALF AN, INVEKOS<br />
Betriebe Kühe<br />
1.937 Betriebe<br />
45.034 Kühe<br />
Ø 23 Kühe/Betrieb<br />
1993: 3.970 Betriebe<br />
1999: 2.776 Betriebe<br />
2008: 1.937 Betriebe<br />
1 bis 20 Kühe 21 bis 40 Kühe 41 bis 60 Kühe 61 bis 80 Kühe 81 bis 100 Kühe über 100 Kühe
3.2 R<strong>in</strong>dfleisch<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Insgesamt halten derzeit 1.240 Betriebe <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> Bullen. Davon halten<br />
841 Betriebe durchschnittlich vier <strong>und</strong> 336 Betriebe durchschnittlich 21 Mastbullen. Im Bereich<br />
über 100 Bullen im Bestand wirtschaften acht Betriebe mit im Mittel 142 Bullen.<br />
3.3 Schwe<strong>in</strong>e<br />
Zweitwichtigster Betriebszweig <strong>in</strong> der Tierhaltung ist die Zuchtsauenhaltung <strong>und</strong> die Schwe<strong>in</strong>emast.<br />
So halten 44,5 % der Betriebe im <strong>Land</strong>kreis Schwe<strong>in</strong>e, die für viele Betriebe entweder<br />
wichtigster oder e<strong>in</strong> wichtiger Betriebszweig s<strong>in</strong>d mit dem das Haupte<strong>in</strong>kommen bzw. beachtliche<br />
Teile davon erwirtschaftet werden.<br />
Wurden 1993 noch <strong>in</strong> 1.523 Betrieben Zuchtsauen gehalten, so war dies 2008 nur noch <strong>in</strong> 457<br />
Betrieben der Fall. Das ist e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>us von 70%. Am stärksten nahmen die Betriebe mit 1 - 50<br />
gehaltenen Zuchtsauen ab (75%). <strong>Die</strong> Abnahme der kle<strong>in</strong>eren Bestände konnte, wie die Zahlen<br />
verdeutlichen, bei weitem nicht durch den Zuwachs der größeren Bestände kompensiert werden.<br />
Abbildung 10: Betriebsstruktur nach gehaltenen Zuchtsauen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> 2008<br />
90%<br />
Anteil 80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
Betriebe Zuchtsauen<br />
457 Betriebe<br />
15.711 Zuchtsauen (ZS)<br />
Ø 34 Zuchtsauen/Betrieb<br />
19
20<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 11: Strukturentwicklung der Ferkelerzeugung nach gehaltenen Zuchtsauen<br />
<strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
1.600<br />
1.400<br />
Betriebe<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Quellen: ALuE AN, ALF AN, INVEKOS<br />
1993: 1.523 Betriebe<br />
1999: 936 Betriebe<br />
2008: 457 Betriebe<br />
1 bis 50 ZS 51 bis 100 ZS 101 bis 200 ZS über 200 ZS<br />
79% der Betriebe halten nach wie vor nicht mehr als 50 Zuchtsauen. Mit dieser Zahl kann auf<br />
Dauer nicht das notwendige Unternehmense<strong>in</strong>kommen erwirtschaftet werden. <strong>Die</strong> Wachstumsschwelle<br />
der Zuchtsauenhaltung bewegt sich <strong>in</strong> Richtung 100 Zuchtsauen im Durchschnitt der<br />
Betriebe. Für die Unternehmerfamilie, die ihr wesentliches E<strong>in</strong>kommen aus der<br />
Zuchtsauenhaltung erwirtschaften will, verschiebt sich die notwendige Zahl der Tiere, bei e<strong>in</strong>er<br />
Ferkelaufzucht von mehr als 22 Ferkeln pro Zuchtsau <strong>und</strong> Jahr, <strong>in</strong> den Bereich von 130 <strong>und</strong><br />
mehr Zuchtsauen.<br />
Gerade für flächenarme Betriebe ist der Betriebszweig Zuchtsauenhaltung e<strong>in</strong>e Unternehmenslösung<br />
mit der das notwendige E<strong>in</strong>kommen über Futterzukauf - <strong>in</strong>direkte Flächenaufstockung -<br />
erwirtschaftet werden kann. Zunehmende Auflagen über die Düngeverordnung setzen aber<br />
auch hier M<strong>in</strong>destflächen zur Gülleunterbr<strong>in</strong>gung voraus <strong>und</strong> begrenzen die Entwicklung für<br />
diesen Betriebszweig.<br />
Gegenüber 1993 nahm die Zahl der Mastschwe<strong>in</strong>e haltenden Betriebe im Jahr 2008 um 65 %<br />
ab. E<strong>in</strong>e besonders starke Abnahme ergab sich wiederum bei den unteren Bestandsgrößen bis<br />
100 Tiere. Dort reduzierten sich die Betriebe um 1.780 bzw. 63,7 %.
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 12: Betriebsstruktur nach gehaltenen Mastschwe<strong>in</strong>en (Durchschnittsbestand)<br />
<strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008<br />
80%<br />
Anteil 70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
Abbildung 13: Strukturentwicklung <strong>in</strong> der Schwe<strong>in</strong>emast nach gehaltenen Mastschwe<strong>in</strong>en<br />
(Durchschnittsbestand) <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
3.000<br />
Betriebe<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Quellen: ALuE AN, ALF AN, INVEKOS<br />
Betriebe Mastschwe<strong>in</strong>e<br />
1.479 Betriebe<br />
63.213 Mastschwe<strong>in</strong>e (MS)<br />
Ø 43 Mastschwe<strong>in</strong>e/Betrieb<br />
1993: 4.094 Betriebe<br />
1999: 2.459 Betriebe<br />
2008: 1.479 Betriebe<br />
1 bis 20 MS 21 bis 40 MS 41 bis 100 MS 101 bis 500 MS 501 bis 1000 MS über 1000 MS<br />
Von den 1.479 über InVeKoS-Daten registrierten Schwe<strong>in</strong>emastbetrieben verfügen 1.300 Betriebe,<br />
das s<strong>in</strong>d 88 %, über nicht mehr als 100 Mastschwe<strong>in</strong>eplätze. Bei diesen Zahlen s<strong>in</strong>d<br />
auch diejenigen erfasst, die ihre Schwe<strong>in</strong>e nur für den Eigenbedarf mästen. Andererseits werden<br />
ca. 70 % der Tiere, das s<strong>in</strong>d rd. 44.300 von 9 % der Betriebe, gemästet. <strong>Die</strong> Wachstumsschwelle,<br />
d. h. die Zahl der Betriebe die noch zunimmt, ist der Bereich ab 500 Mastschwe<strong>in</strong>eplätzen.<br />
Für die schwe<strong>in</strong>ehaltenden Betriebe besteht e<strong>in</strong>e große Konkurrenz zu den Betrieben mit Biogas<br />
aufgr<strong>und</strong> knapper Flächen bzw. hoher Pachtpreise.<br />
21
22<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Bei e<strong>in</strong>er Wachstumsschwelle von 100 Zuchtsauen bzw. 500 Mastplätzen ist das Risiko für<br />
Investitionswillige wegen des großen Investitionsvolumens gestiegen.<br />
3.4 Schafe <strong>und</strong> Ziegen<br />
Unter den gegenwärtigen Wirtschafts- <strong>und</strong> Marktbed<strong>in</strong>gungen kann die Schafhaltung nur dadurch<br />
<strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Betrieben stabil gehalten werden, <strong>in</strong>dem über Ausgleichszahlungen<br />
Honorierungen von landschaftspflegerischen Leistungen <strong>und</strong> damit E<strong>in</strong>kommenstransfers stattf<strong>in</strong>den,<br />
mit denen die Unternehmer ihren notwendigen Lebensunterhalt bestreiten können.<br />
Generell werden Schafe vor allem <strong>in</strong> Nebenerwerbsbetrieben gehalten. Schafhaltung im Vollerwerb<br />
f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> immer weniger Betrieben statt. Deren Entwicklung ist vor allem geprägt durch<br />
e<strong>in</strong>en rapid gesunkenen Nachwuchs an ausgebildeten Schäfern <strong>und</strong> durch e<strong>in</strong>en enormen<br />
Marktdruck aufgr<strong>und</strong> günstiger Fleischimporte <strong>und</strong> Wollimporte, <strong>in</strong>sbesondere aus Übersee.<br />
Professionelle Produktion <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e konsequente Organisation der Vermarktung als Regionalprodukt<br />
s<strong>in</strong>d Lösungsansätze, die die notwendige E<strong>in</strong>kommensentwicklung <strong>und</strong> -sicherung<br />
vorbr<strong>in</strong>gen kann.<br />
Abbildung 14: Betriebsstruktur nach gehaltenen Mutterschafen (Durchschnittsbestand)<br />
<strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008<br />
70%<br />
Anteil<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
3.5 Geflügel<br />
Betriebe Mutterschafe<br />
380 Betriebe<br />
11.028 Mutterschafe (MS)<br />
Ø 29 Mutterschafe/Betrieb<br />
<strong>Die</strong> überwiegende Zahl der Betriebe mit über 50 Prozent E<strong>in</strong>kommensbeitrag aus der<br />
Legehennenhaltung erwirtschaftet ihr E<strong>in</strong>kommen über die Direktvermarktung. Eier s<strong>in</strong>d dabei<br />
immer öfter nur e<strong>in</strong> Teil der Angebotspalette, die von Geflügel über Nudeln <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
anderer Direktvermarktungsprodukte reicht.
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 15: Betriebsstruktur nach gehaltenen Legehennen (Durchschnittsbestand) <strong>in</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008<br />
70%<br />
Anteil<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Quelle: INVEKOS<br />
<strong>Die</strong> Mastgeflügelhaltung ist <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> sehr heterogen. Zum e<strong>in</strong>en halten<br />
wenige Betriebe im Vollerwerb Masthähnchen <strong>und</strong> Puten <strong>in</strong> großen Beständen mit mehr als<br />
10.000 Mastplätzen. Zum anderen werden auf sehr vielen Betrieben Hähnchen, Puten, Enten<br />
<strong>und</strong>/oder Gänse für den Eigenbedarf oder die Direktvermarktung gemästet. Gerade Enten <strong>und</strong><br />
Gänse werden ausschließlich <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Beständen gehalten.<br />
Derzeit werden mehrere Stallungen für Großbestände von Mastgeflügel für e<strong>in</strong>en bekannten<br />
Großabnehmer geplant.<br />
3.6 Pferde<br />
Betriebe Legehennen<br />
1.512 Betriebe<br />
57.775 Legehennen (LH)<br />
Ø 38 Legehennen/Betrieb<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> gibt es ca. 360 landwirtschaftliche Betriebe mit Pferdehaltung. Im Vergleich<br />
zum Jahr 2005 hat sich die Anzahl der Betriebe <strong>und</strong> der Pferde leicht erhöht. Zusätzlich<br />
steht e<strong>in</strong> großer Anteil an Pferden <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>sanlagen, die <strong>in</strong> der <strong>Land</strong>wirtschaftsverwaltung<br />
nicht erfasst s<strong>in</strong>d.<br />
Der größte Teil der landwirtschaftlichen Pferdebetriebe werden im Nebenerwerb geführt. Auch<br />
wenn die Zahl der Pferdebetriebe im Gegensatz zu R<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Schwe<strong>in</strong>ebetrieben ger<strong>in</strong>g ersche<strong>in</strong>t,<br />
so ist die Pferdehaltung von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Pferde verwerten<br />
Grünland <strong>und</strong> pflegen die <strong>Land</strong>schaft. Auch durch die notwendige <strong>Die</strong>nstleistung am Pferd <strong>und</strong><br />
die <strong>Die</strong>nstleistung für den Reiter liegt e<strong>in</strong>e nicht unerhebliche, volkswirtschaftliche Bedeutung<br />
vor. Es wird geschätzt, dass etwa vier Pferde e<strong>in</strong>en Arbeitsplatz sichern (Haltung, Tierarzt,<br />
Schmied, Sattler etc.).<br />
23
24<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
4. Ernährung<br />
Im Juli 2009 wurde <strong>in</strong> jedem Regierungsbezirk e<strong>in</strong>e Vernetzungsstelle „Überregionale Ernährungsbildung“<br />
bzw. seit Oktober 2009 „Geme<strong>in</strong>schaftsverpflegung“ mit Sitz am Amt für Ernährung,<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong> e<strong>in</strong>gerichtet.<br />
Ziel dieser Stellen ist es, Schulen, Heime, Betriebskant<strong>in</strong>en, Krankenhäuser <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dertagese<strong>in</strong>richtungen<br />
bei der Umsetzung e<strong>in</strong>er ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Verpflegung zu unterstützen.<br />
Dazu werden für engagierte Akteure <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>schaftsverpflegung regelmäßig Fachtagungen,<br />
Informationsveranstaltungen, Arbeitskreise <strong>und</strong> Multiplikatorenschulungen angeboten.<br />
Auf diese Art sollen Netzwerke zwischen Behörden, Trägern, Küchenleitern, Sponsoren, Verpflegungsanbietern<br />
aber auch den Tischgästen selbst entstehen.<br />
Für die Unterstützung der Verantwortlichen <strong>in</strong> Betriebskant<strong>in</strong>en, Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Heimen ist Frau<br />
Elke Messerschmidt zuständig.<br />
Frau Mar<strong>in</strong>a Bielenberg betreut die Vernetzungsstelle Schulverpflegung. In diesem Bereich<br />
werden ab November regelmäßige RegioTreffs stattf<strong>in</strong>den.<br />
Frau Kathr<strong>in</strong> Herzog ist die Ansprechpartner<strong>in</strong> für die Verpflegung <strong>in</strong> K<strong>in</strong>dertagesstätten.<br />
5. Energieerzeugung<br />
5.1 Biogasanlagen<br />
Innerhalb der letzten 5 Jahre hat sich die Anzahl der Biogasanlagen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> von r<strong>und</strong> 60 auf über 140 mehr als verdoppelt (Tabelle 10 <strong>und</strong> Abbildung 16). Im<br />
gleichen Zeitraum verzehnfachte sich die <strong>in</strong>stallierte elektrische Leistung von ursprünglich<br />
r<strong>und</strong> 2.900 kWel auf nun über 30.000 kWel. <strong>Die</strong>ser Wachstumsschub erfolgte nicht nur durch<br />
die Verdoppelung der Anlagenzahl, sondern vor allem durch Erweiterungen der schon bestehenden<br />
Biogasanlagen. <strong>Die</strong> durchschnittliche Anlagengröße stieg von knapp 50 kWel auf r<strong>und</strong><br />
220 kWel an. <strong>Die</strong>ser enorme Biogas-Boom wurde zum e<strong>in</strong>en ausgelöst durch die Verabschiedung<br />
des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) zum 1. August 2004, wor<strong>in</strong> die Bed<strong>in</strong>gungen<br />
für die Erzeugung von elektrischem Strom aus Biogas gegenüber der vorhergehenden Regelung<br />
deutlich besser gestellt wurden.
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Tabelle 10: Biogasanlagen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2009<br />
Jahr Anzahl Biogasanlagen<br />
Quelle: AELF AN<br />
Abbildung 16: Verteilung der Biogasanlagen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2009<br />
Quelle: AELF AN<br />
<strong>in</strong>stallierte elektrische<br />
Leistung<br />
E<strong>in</strong> zweites Argument für den neuen Betriebszweig Biogas stellte die angespannte Situation<br />
auf den klassischen Agrarmärkten dar. Novum im EEG war der e<strong>in</strong>geführte Biomasse-Bonus.<br />
Damit wurde der gezielte Anbau von Energiepflanzen, vornehmlich Silomais, für Biogasanlagenbetreiber<br />
<strong>in</strong>teressant. Re<strong>in</strong> rechnerisch ergibt die <strong>in</strong>stallierte Leistung der Biogasanlagen<br />
e<strong>in</strong>e Nachfrage nach ca. 15.000 Hektar Energiepflanzenfläche (13 Prozent der landwirtschaftlichen<br />
Nutzflächen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong>). Lediglich vier der Biogasanlagen werden<br />
derzeit nicht als sogenannte NawaRo-Anlagen betrieben. <strong>Die</strong> Betreiber dieser vier Anlagen<br />
setzen Substrate nicht-landwirtschaftlicher Herkunft e<strong>in</strong> <strong>und</strong> verzichten somit auf den Biomasse-Bonus.<br />
kW el<br />
durchschnittliche<br />
Leistung je Anlage<br />
kW el/Anlage<br />
2004 61 2.900 48<br />
2006 110 21.600 196<br />
2009 144 31.600 219<br />
Bezeichnung Wert E<strong>in</strong>heit<br />
Energiepflanzenfläche 15.000 Hektar<br />
Stromerzeugung 50.000 E<strong>in</strong>familienhäuser<br />
Wärmeversorgung 7.000 E<strong>in</strong>familienhäuser<br />
25
26<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
<strong>Die</strong> Biogasbranche stellt mittlerweile e<strong>in</strong>en nennenswerten Wirtschaftsfaktor dar. Bisher wurden<br />
r<strong>und</strong> 100 Mio. Euro <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> <strong>in</strong> die Errichtung von Biogasanlagen<br />
<strong>in</strong>vestiert. Der erzeugte Strom reicht aus, um über 50.000 E<strong>in</strong>familienhäuser mit Strom zu versorgen.<br />
Mit der verfügbaren Wärme könnte theoretisch der Bedarf von r<strong>und</strong><br />
7.000 E<strong>in</strong>familienhäusern gedeckt werden. Da die Wärme bei Biogasanlagen kont<strong>in</strong>uierlich<br />
über den gesamten Jahresverlauf h<strong>in</strong>weg relativ gleichmäßig anfällt, gilt es, wo noch nicht geschehen,<br />
passende Wärmeabnehmer zu f<strong>in</strong>den.<br />
In Planung bef<strong>in</strong>den sich aktuell nur e<strong>in</strong>zelne Anlagen kle<strong>in</strong>erer Größenordnung. Mit der erneuten<br />
Novellierung des EEG wurde zum 1. Januar 2009 der sogenannte Gülle-Bonus e<strong>in</strong>geführt.<br />
Voraussetzung für den Erhalt dieses Bonus ist die E<strong>in</strong>haltung e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>deste<strong>in</strong>satzmenge<br />
von 30 Masseprozent Gülle am gesamten Substratmix. Damit wird die Größe der Biogasanlage<br />
begrenzt durch die Masse verfügbarer Gülle. Der zur Novellierung prognostizierte Trend zu<br />
wieder kle<strong>in</strong>eren Anlagen <strong>in</strong> der Größenordnung um 150 bis 200 kWel sche<strong>in</strong>t sich zu erfüllen.<br />
Neben den vielen positiven Aspekten der Biogaserzeugung ist auch die Beschäftigungssituation<br />
im ländlichen Raum zu betrachten. S<strong>in</strong>d bei klassischer Milchviehhaltung je Hektar landwirtschaftlicher<br />
Nutzfläche über 100 Arbeitskraftst<strong>und</strong>en (AKh) geb<strong>und</strong>en, so s<strong>in</strong>d es bei der<br />
Veredelung der Ackerfrüchte im Biogasprozess noch circa 30 AKh.<br />
E<strong>in</strong>e Besonderheit unter den Biogasanlagen bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Triesdorf. Dort wird das erzeugte<br />
Biogas <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Stirl<strong>in</strong>gmotor mit e<strong>in</strong>er elektrischen Leistung von 40 kWel <strong>in</strong> elektrischen<br />
Strom umgewandelt.<br />
5.2 Fotovoltaikanlagen<br />
Durch die Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) im Jahr 2004 hat die Zahl<br />
der Fotovoltaikanlagen <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis stark zugenommen. U. a. <strong>Land</strong>wirte sehen <strong>in</strong> der<br />
Fotovoltaik e<strong>in</strong>e zusätzliche E<strong>in</strong>kommensmöglichkeit.<br />
In jüngster Zeit häufen sich Anträge für die Errichtung von Freilandfotovoltaikanlagen. Hierfür<br />
werden von e<strong>in</strong>igen Kommunen spezielle Sondergebiete ausgewiesen. Aufgr<strong>und</strong> der gesetzlichen<br />
Bestimmungen im EEG betrifft dies ausschließlich Ackerland, versiegelte Flächen oder<br />
Konversionsflächen. Mit der Errichtung von Fotovoltaikanlagen im Freiland wird somit wertvolles<br />
Ackerland aus der Produktion genommen. Inwieweit damit das <strong>Land</strong>schaftsbild bee<strong>in</strong>trächtigt<br />
wird, liegt im <strong>in</strong>dividuellen persönlichen Ermessen.
6. Gäste auf dem Bauernhof<br />
Erlebnisorientierte Angebote<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Seit 1991 führten im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> ca. 110 landwirtschaftliche Betriebe den Betriebszweig<br />
„Gäste auf dem Bauernhof“ e<strong>in</strong> <strong>und</strong> bieten derzeit ca. 1.100 Gästebetten an. <strong>Die</strong> Auslastung<br />
liegt dabei mit ca. 175 Belegtagen im Jahr überdurchschnittlich hoch.<br />
Trends:<br />
Stärkere Spezialisierung auf feste Zielgruppen, z.B. Familien mit kle<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dern,<br />
Ges<strong>und</strong>heitsurlaub oder Paarurlaub.<br />
Qualitätsweiterentwicklung<br />
Vernetzung untere<strong>in</strong>ander <strong>und</strong> mit Gastronomie<br />
Erlebnisorientierte Angebote als Zusatz<br />
14 ländliche Gästeführer <strong>und</strong> 13 Gartenbäuer<strong>in</strong>nen ergänzen den <strong>Land</strong>urlaub im <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> durch hochwertige Angebote.<br />
7. Direktvermarktung<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> bieten aktuell ca. 75 landwirtschaftliche Betriebe ihre Erzeugnisse als<br />
Direktvermarkter an. Teilweise vermarkten sie ihre Produkte an die regionale Gastronomie, auf<br />
Bauernmärkten, <strong>in</strong> Bauernläden oder <strong>in</strong> ihren Verkaufsstellen auf den Höfen.<br />
Das Angebot ist vielfältig. So werden Fleisch- <strong>und</strong> Fleischprodukte, Milch- <strong>und</strong> Milchprodukte,<br />
Brot, Gebäck, Eier, Honig, Destillate, Brotaufstriche, Gemüse, Obst, Holz <strong>und</strong> vieles mehr<br />
angeboten.<br />
Mittelfristig zeigt sich, dass Direktvermarktung für den K<strong>und</strong>en hauptsächlich dann <strong>in</strong>teressant<br />
ist, wenn der Betrieb verbrauchernah verkehrsgünstig zu erreichen ist <strong>und</strong> <strong>in</strong>novative, <strong>in</strong>teressante<br />
Produkte angeboten werden.<br />
Der Direktvermarkter muss sich mit se<strong>in</strong>en Produkten vom herkömmlichen E<strong>in</strong>zelhandel abheben<br />
<strong>und</strong> dennoch dessen Qualitätsstandard erfüllen.<br />
27
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
III. Wertschöpfungspotentiale<br />
Das Brutto<strong>in</strong>landsprodukt (BIB) von <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> beträgt 6.445 Mio. € (1,5 %<br />
des BIB <strong>in</strong> Bayern). <strong>Die</strong> Bruttowertschöpfung (BWS) <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> beläuft<br />
sich auf 5.775 Mio. € (1,5 % der BWS <strong>in</strong> Bayern), davon117 Mio. € <strong>in</strong> der <strong>Land</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong><br />
(3,0 % Anteil der BWS der <strong>Land</strong>- <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong> <strong>in</strong> Bayern) (Quelle: Reg.<br />
Mfr.).<br />
Tabelle 11: Wirtschaftsleistung von <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2007<br />
Gebiet<br />
Bruttowertschöpfung = Produktionswert zu Herstellungspreisen m<strong>in</strong>us Vorleistungen<br />
Quellen: Reg. Mfr.<br />
Brutto<strong>in</strong>landsprodukt<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Bruttowertschöpfung<br />
zu Herstellungspreisen<br />
je Erwerbstätigen<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>Land</strong>- u.<br />
<strong>Forstwirtschaft</strong>,<br />
Fischerei<br />
Mio. € € Mio. € Mio. €<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> 1.922 56.797 1.722 5<br />
<strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 4.523 60.618 4.053 112<br />
Mittelfranken 57.723 62.546 51.727 400<br />
Bayern 433.041 66.197 388.057 3.917<br />
„Der Produktionswert zu Erzeugerpreisen ergibt sich aus der Bewertung der Produktion mit<br />
durchschnittlichen Erzeugerpreisen aller Qualitäten ohne Mehrwertsteuer“ (BMELV 2007,<br />
S. 121). <strong>Die</strong>ser Produktionswert wird im Folgenden detailliert für die Erzeugnisse aus pflanzlicher<br />
(Tabelle 12) <strong>und</strong> tierischer Erzeugung (Tabelle 13) ausgewiesen.<br />
29
30<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Tabelle 12: Produktionswert der wichtigsten pflanzlichen Erzeugnisse <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> 2008<br />
Kultur<br />
Quellen: INVEKOS, LfL/ILB, LfStaD<br />
Tabelle 13: Produktionswert der wichtigsten tierischen Erzeugnisse <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> 2008<br />
Quellen: INVEKOS, LfL/ILB, LfStaD, eigene Annahmen<br />
Anbaufläche<br />
<strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Trendertrag<br />
2009 2)<br />
Durchschnittspreis<br />
netto 3)<br />
Produktionswert<br />
ha dt/ha €/dt €<br />
W<strong>in</strong>terweizen 14.715 66 13,10 12.722.700<br />
Roggen 2.276 56 12,20 1.555.200<br />
Triticale 6.541 57 11,30 4.213.000<br />
W<strong>in</strong>tergerste 19.585 57 12,20 13.619.200<br />
Sommergerste 743 42 15,40 480.300<br />
Hafer 1.151 41 11,40 537.700<br />
Kartoffeln 498 350 10,00 1.744.100<br />
Zuckerrüben 882 640 4,20 2.370.500<br />
Raps 5.684 35 25,40 5.053.500<br />
Körnermais/CCM 525 92 13,10 632.200<br />
Summe Produktionswert 42.928.400<br />
1) Kreisfreie <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
2) Basis Zeitreihe von 1983 bis 2008, l<strong>in</strong>earer Trend<br />
3) 5-Jahres Durchschnitt von 2004 bis 2008<br />
Tierart<br />
Anzahl Tiere<br />
<strong>Ansbach</strong> 1)<br />
Leistung<br />
2009 E<strong>in</strong>heit<br />
DurchschnittsProduktionspreis netto wert<br />
€/E<strong>in</strong>heit €<br />
Milchkühe e<strong>in</strong>schl. Mutter- u. Ammenkühe 46.612 7.100 kg Milch/a 0,30 99.283.600<br />
Männl. R<strong>in</strong>der 0,5 - 2 Jahre 23.621 405 kg/Stk. 3,20 30.612.800<br />
Ferkelerzeugung 15.729 19 Ferkel/ZS 54,00 16.138.000<br />
Mastschwe<strong>in</strong>e (2,7 Umtriebe pro Jahr) 170.797 94 kg SG/MS 1,49 23.921.800<br />
Summe Produktionswert 169.956.200<br />
1) Kreisfreie <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
Der Produktionswert zu Herstellerpreisen der Stromerzeugung aus Biogas liegt derzeit bei jährlich<br />
ca. 35 Mio. Euro.<br />
Unter der theoretischen Annahme, dass die jeweilige Produktion auch im <strong>Land</strong>kreis bis auf die<br />
Endverbraucherstufe be-, verarbeitet <strong>und</strong> veredelt werden würde, bestünde e<strong>in</strong> Produktionswertpotential<br />
von <strong>in</strong>sgesamt r<strong>und</strong> 940 Mio. € (Tabelle 14).
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Tabelle 14: Produktionswertpotenzial bei konsumfähigen Produkten<br />
K<br />
uProdukt<br />
Produktionswertpotezial<br />
W<strong>in</strong>terweizen<br />
Milch <strong>und</strong> Milchprodukte 265.000.000 €<br />
Roggen Fleisch 243.000.000 €<br />
Triticale Getreideprodukte, Zucker, Pflanzenöl, Kartoffeln 432.000.000 €<br />
Summe Produktionswert 940.000.000 €<br />
1) Kreisfreie <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
Quelle: eigene Berechnungen<br />
<strong>Die</strong>se Zahlen, hochgerechnet auf Mittelfranken oder Gesamtfranken, müssen Anlass se<strong>in</strong>, <strong>in</strong>tensive<br />
Anstrengungen zum Aufbau leistungsfähiger, regionaler Produkt- <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsschienen<br />
unter e<strong>in</strong>er Marke (die auch für Großhandelsketten <strong>in</strong>teressant ist) zu unternehmen.<br />
Basis dafür ist der Aufbau e<strong>in</strong>es professionellen Regionalmarket<strong>in</strong>gs <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es regionalen Produkt-<br />
<strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsmarket<strong>in</strong>gs, das nicht nur Produkte <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungen aus der<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> deren nachgelagerter Bereiche umfasst, sondern möglichst umfassend die<br />
Leistungen der Region <strong>in</strong> e<strong>in</strong> <strong>in</strong> sich geschlossenes Angebots- <strong>und</strong> Leistungsspektrum br<strong>in</strong>gt.<br />
<strong>Die</strong> regionalen Angebotspotentiale ließen sich dadurch weit besser als bisher ausschöpfen <strong>und</strong><br />
weiter entwickeln. Dadurch ließe sich<br />
e<strong>in</strong>e sehr große Zahl hochwertiger Arbeitsplätze<br />
regionale Identität schaffen, das<br />
regionale Image, als Markenbegriff von unschätzbarer Bedeutung, verbessern,<br />
die Nachfrage nach regionalen Produkten, <strong>Die</strong>nstleistungen <strong>und</strong> deren Pakete <strong>in</strong> Zeit,<br />
Menge <strong>und</strong> Qualität abdecken, letztlich die<br />
wirtschaftliche Wettbewerbskraft der Region stärken <strong>und</strong> weiterentwickeln.<br />
31
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
IV. Förderung <strong>und</strong> Fördervollzug<br />
Unter den augenblicklichen agrarpolitischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen trägt die staatliche Förderung<br />
<strong>in</strong> steigendem Umfang zur E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Überlebenssicherung der landwirtschaftlichen<br />
Unternehmen, aber auch vieler ländlicher Räume bei.<br />
Dabei wird unterschieden <strong>in</strong> Förderung im nicht <strong>in</strong>vestiven Bereich sowie <strong>in</strong> den <strong>in</strong>vestiven<br />
Bereich.<br />
1. Nicht <strong>in</strong>vestiver Bereich<br />
E<strong>in</strong> wesentlicher Teil der Förderungen s<strong>in</strong>d Ausgleichszahlungen für Preissenkungsmaßnahmen<br />
auf EU-Ebene (Betriebsprämie). Erhebliche Fördermittel fließen <strong>in</strong> extensivierende Bewirtschaftungsmaßnahmen<br />
<strong>und</strong> Kulturlandschaftspflegeleistungen z. B. im Rahmen des Bayerischen<br />
Kulturlandschaftsprogrammes.<br />
Des Weiteren werden auch strukturbed<strong>in</strong>gte Wettbewerbsnachteile über Fördermittel ausgeglichen<br />
(Ausgleichszulage), um e<strong>in</strong>e flächendeckende Bewirtschaftung <strong>in</strong> ungünstigen Lagen zu<br />
ermöglichen <strong>und</strong> die Kulturlandschaft zu erhalten.<br />
<strong>Die</strong> seit 2005 geltenden Regelungen für die Förderung sehen e<strong>in</strong>e Entkoppelung der Fördermittel<br />
von e<strong>in</strong>er großen Zahl der bisherigen Förderbed<strong>in</strong>gungen vor. Das heißt, die bisherige<br />
Begründung für die Zahlungen unterschiedlichster Art fällt weg. Ob dies der E<strong>in</strong>stieg zur gesamten<br />
H<strong>in</strong>führung der europäischen Agrarpreise auf das so genannte „Weltmarktniveau“ <strong>und</strong><br />
damit zu größten agrarstrukturellen, gesamtstrukturellen <strong>und</strong> sozialen Umwälzungen ist, diese<br />
Frage wird die Zukunft beantworten.<br />
Genauso wenig wie e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e H<strong>in</strong>führung des Lohnniveaus <strong>in</strong> der EU auf „Weltlohnniveau“<br />
denk- <strong>und</strong> machbar ersche<strong>in</strong>t, genauso wenig sollte mit dem Gedanken gespielt werden<br />
unsere Lebensgr<strong>und</strong>lagen Nahrungsmittelproduktion, Kulturlandschaft <strong>und</strong> natürliche Ressourcen<br />
für, wie auch immer geartete „Weltmarktpreise“, freizugeben. Denn letztere unterliegen bei<br />
weitem nicht der re<strong>in</strong>en Lehre der Betriebswirtschaft für e<strong>in</strong>e Preisbildung, sondern s<strong>in</strong>d weltweit<br />
von e<strong>in</strong>em komplizierten Geflecht politischer Entscheidungen <strong>und</strong> direkter <strong>und</strong> <strong>in</strong>direkter<br />
staatlicher Förderung bestimmt.<br />
Im Jahr 2008 wurden von 4.235 Betrieben rd. 10.500 Anträge auf Betriebsprämie, Kulap-<br />
Förderung <strong>und</strong> Ausgleichszulage beim Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten gestellt<br />
(Abbildung 16). <strong>Die</strong> dabei geflossenen r<strong>und</strong> 50 Mio. Euro leisten nicht nur e<strong>in</strong>en ganz massiven<br />
Gew<strong>in</strong>nbeitrag <strong>in</strong> den beantragenden Unternehmen, sie s<strong>in</strong>d auch volkswirtschaftlich von<br />
außerordentlich großer Bedeutung, weil dieses Geld <strong>in</strong> den volkswirtschaftlichen Kreislauf<br />
(<strong>in</strong>sbesondere des <strong>Land</strong>kreises) e<strong>in</strong>fließt.<br />
33
34<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 17: Förderungen aus dem nicht<strong>in</strong>vestiven Bereich <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> 2008<br />
Anzahl Bewilligungen<br />
10.500<br />
Anträge<br />
Quelle: INVEKOS<br />
Auszahlung<br />
Betriebsprämie<br />
50 Mio. €<br />
Ausgleichszulage<br />
Agrarumweltma<br />
ßnahmen<br />
Betriebsprämie<br />
Ausgleichszulage<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
2. Investiver Bereich: E<strong>in</strong>zelbetriebliche Investitionsförderung<br />
(EIF)<br />
Neben Know-How-Transfer – Ausbildung, Beratung – ist die dritte Säule der Entwicklung der<br />
landwirtschaftlichen <strong>und</strong> der regionalen Wertschöpfungspotentiale, die Investition <strong>in</strong> neue Produkte<br />
<strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungen <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>en die vielfach dazu notwendige <strong>in</strong>vestive Förderung.<br />
Mit ihr sollen<br />
• e<strong>in</strong>e strukturelle Weiterentwicklung ermöglicht<br />
• Wertschöpfungspotentiale erschlossen<br />
• die Wettbewerbskraft der Unternehmen verbessert <strong>und</strong><br />
• unternehmerische Neuentwicklungen im Ländlichen Raum gefördert werden.<br />
Mit denselben Maßnahmen werden aber auch die nachhaltige, ressourcenschonende <strong>Land</strong>bewirtschaftung<br />
<strong>und</strong> die artgerechte Tierhaltung weiter verbessert.<br />
Im Jahr 2008 wurden mit 77 Anträgen knapp vier Mio. Euro Zuschüsse beantragt <strong>und</strong> bewilligt<br />
(Abbildung 18).<br />
Der weit überwiegende Teil der Fördermittel im <strong>in</strong>vestiven Bereich floss <strong>in</strong> den Sektor Milcherzeugung.<br />
Neben Neu<strong>in</strong>vestition ist auch die Aufstockung im Bereich Schwe<strong>in</strong>e- <strong>und</strong> Geflügelhaltung<br />
möglich. Rege Investitionstätigkeit ist im Bereich der erneuerbaren Energien wie<br />
Biogas <strong>und</strong> Fotovoltaik auf Dächern <strong>und</strong> als Freilandanlagen zu beobachten. Hier werden ke<strong>in</strong>e<br />
Investitionszuschüsse gewährt, da die Wettbewerbskraft dieser Produktionszweige durch die<br />
Regelungen im Erneuerbaren-Energien-Gesetz meist mehr als gewährleistet ist. <strong>Die</strong>s lässt sich<br />
u. a. aus den zum Teil weit überdurchschnittlichen Pachtpreisangeboten ableiten.
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 18: Förderungen aus dem <strong>in</strong>vestiven Bereich <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> 2008<br />
Futterlager<br />
Marktfruchtbau<br />
Güllelager<br />
Geflügel<br />
Schwe<strong>in</strong>emast<br />
Ferkelerzeugung<br />
Quelle: Amts<strong>in</strong>terne Statistik<br />
Verteilung Anträge<br />
Diversifizierung<br />
77<br />
Anträge<br />
Mutterkuh<br />
Milchvieh<br />
Marktfruchtbau<br />
Futterlager<br />
Güllelager<br />
Geflügel<br />
Schwe<strong>in</strong>emast<br />
Ferkelerzeugung<br />
Mutterkuh<br />
bewilligte Fördersumme<br />
Diversifizierung<br />
3,9 Mio. €<br />
Zuschüsse<br />
Milchvieh<br />
35
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
V. Bildung, Beratung, Schule<br />
1. Bildung<br />
Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) <strong>in</strong> der Erwachsenenbildung<br />
<strong>Die</strong> Vere<strong>in</strong>e ehemaliger <strong>Land</strong>wirtschaftsschüler s<strong>in</strong>d fast so alt wie die <strong>Land</strong>wirtschaftsschulen.<br />
Im Jahr 1906 gründeten 23 Ehemalige der „Königlich landwirtschaftlichen W<strong>in</strong>terschule<br />
<strong>Ansbach</strong>“ e<strong>in</strong>en der ersten Vere<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Bayern. Mit den kurz danach entstandenen <strong>Land</strong>wirtschaftschulen<br />
<strong>in</strong> D<strong>in</strong>kelsbühl <strong>und</strong> Rothenburg gründeten sich auch dort „Ehemaligenvere<strong>in</strong>e“.<br />
Zuletzt erfolgte im Jahr 2005 die Umbenennung <strong>in</strong> die Verbände für landwirtschaftliche Fachbildung.<br />
Damit sollte den geänderten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen im Bereich der Bildung entsprochen<br />
werden, mit den <strong>in</strong>zwischen so vielgestaltigen <strong>und</strong> unterschiedlichen Bildungswegen.<br />
Schon frühzeitig, zu Beg<strong>in</strong>n des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts wurde die Notwendigkeit des Zusammenschlusses<br />
<strong>und</strong> der Weiterbildung erkannt, um <strong>in</strong> Veranstaltungen mit dem Fortschritt <strong>in</strong> Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Praxis vertraut zu machen. Stand zu Beg<strong>in</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeit knapper Nahrungsmittel<br />
vor allem die Verbesserung der Produktionstechnik im Vordergr<strong>und</strong>, so rücken die zunehmenden<br />
fachrechtlichen Vorgaben, die betriebswirtschaftliche Beurteilung, die strategische<br />
Ausrichtung des e<strong>in</strong>zelnen Betriebs <strong>und</strong> die immer wichtiger werdende Marktbeobachtung <strong>und</strong><br />
Markte<strong>in</strong>schätzung stärker <strong>in</strong> den Mittelpunkt. <strong>Die</strong> Arbeit will aber auch Raum geben für Begegnungen<br />
von Mensch zu Mensch. Dazu dienen geme<strong>in</strong>samen Lehrfahrten, die Organisation<br />
<strong>und</strong> der Besuch von geselligen <strong>und</strong> kulturellen Veranstaltungen. E<strong>in</strong>e neue Aufgabe ergab sich<br />
<strong>in</strong> der Betreuung älterer Menschen. Seit über fünfzehn Jahren bietet Dr. Rieder die sogenannten<br />
„Donnerstagnachmittage“ <strong>in</strong> Elpersdorf an. <strong>Die</strong>se Veranstaltungsreihe soll <strong>in</strong>formieren,<br />
orientieren <strong>und</strong> Begegnungen ermöglichen.<br />
Das Veranstaltungsangebot muss von den Bedürfnissen der jeweiligen Menschen ausgehen.<br />
<strong>Die</strong> Interessen der Teilnehmer stehen im Mittelpunkt. Damit dem nachgekommen werden<br />
kann, legen die Vorstände mit den Hauptausschüssen halbjährig e<strong>in</strong> Veranstaltungsangebot<br />
fest. Mit dem Frühjahrs- <strong>und</strong> dem Herbstr<strong>und</strong>brief werden die Mitglieder über die geplanten<br />
Veranstaltungen sowie über aktuelle Entwicklungen <strong>in</strong>formiert. Seit e<strong>in</strong>igen Jahren s<strong>in</strong>d die<br />
VLF’s <strong>Ansbach</strong>, D<strong>in</strong>kelsbühl <strong>und</strong> Rothenburg o.d.T. mit eigener Homepage, vor allem mit<br />
e<strong>in</strong>er aktualisierten Veranstaltungsübersicht im Internet vertreten, unter www.vlf-an.bayern.de,<br />
www.vlf-dkb.bayern.de sowie www.vlf-rot.bayern.de. <strong>Die</strong> VLF’s werden auch zukünftig ihrer<br />
Aufgabe als Bildungse<strong>in</strong>richtung nachkommen, um weiterh<strong>in</strong> Wissen auch Handlungskompetenz<br />
zu vermitteln, die Kontakte untere<strong>in</strong>ander zu fördern, sich Neuem aufgeschlossen zu zeigen<br />
<strong>und</strong> gewachsene Traditionen mit dem Blick nach vorne zu pflegen.<br />
37
38<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
2. Beratung<br />
<strong>Die</strong> Beratung orientiert sich am Leitbild der bayerischen Agrarpolitik, wettbewerbsfähige,<br />
nachhaltig wirtschaftende bäuerliche Unternehmen, die umwelt- <strong>und</strong> tiergerechte Erzeugungsmethoden<br />
anwenden, <strong>in</strong> ihrer betrieblichen Entwicklung zu fördern <strong>und</strong> zu stärken (StMELF).<br />
<strong>Die</strong> Aufgaben der Beratung der e<strong>in</strong>zelnen Abteilungen <strong>und</strong> Sachgebiete des Amtes für Ernährung,<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten werden im Kapitel VI. Amtsgliederung <strong>und</strong> Aufgaben der<br />
Sachgebiete näher erläutert.<br />
Hervorzuheben ist die Verb<strong>und</strong>beratung, die im Bereich der tierischen Produktion schon langjährig<br />
praktiziert wird (LKV). Im Bereich der pflanzlichen Produktion wird die Verb<strong>und</strong>beratung<br />
ausgebaut, im Bereich der Betriebswirtschaft <strong>und</strong> Unternehmensführung neu e<strong>in</strong>geführt.<br />
<strong>Die</strong> Verb<strong>und</strong>beratung ist e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Beratungsangebot der staatlichen Beratung <strong>und</strong> anerkannter<br />
nichtstaatlicher Beratungsunternehmen für die bayerischen <strong>Land</strong>wirte, Gärtner <strong>und</strong><br />
W<strong>in</strong>zer. Sie basiert auf dem Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) <strong>und</strong> baut auf<br />
der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit der staatlichen Beratung mit den Selbsthilfeorganisationen<br />
der bayerischen <strong>Land</strong>wirtschaft auf.<br />
Dabei schließt der Staat Verträge mit nichtstaatlichen Beratungsunternehmen zur produktionstechnischen<br />
Beratung <strong>in</strong> den Bereichen Pflanzenbau, Milchviehfütterung, Schwe<strong>in</strong>emast, R<strong>in</strong>dermast,<br />
Ferkelerzeugung, Gartenbau, We<strong>in</strong>bau, Hopfenbau <strong>und</strong> Ökolandbau sowie zur Stallklimaberatung<br />
<strong>und</strong> Betriebszweigauswertung.<br />
An der Verb<strong>und</strong>beratung können sich nichtstaatliche Beratungsanbieter beteiligen, soweit sie<br />
nach dem Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetz als Beratungsunternehmen anerkannt s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e<br />
Anerkennung setzt u. a. voraus, dass diese e<strong>in</strong>e Beratung <strong>in</strong> allen genannten Betriebszweigen<br />
anbieten können, ggf. durch Kooperationsverträge mit anderen anerkannten Beratungsunternehmen,<br />
Berater e<strong>in</strong>setzen, die ausreichend qualifiziert s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> die betriebszweigspezifischen<br />
Beratungs<strong>in</strong>halte entsprechend der def<strong>in</strong>ierten Beratungsmodule e<strong>in</strong>schließlich des geltenden<br />
Fachrechts abdecken können, die Beratung landesweit anbieten, e<strong>in</strong>e neutrale Beratung sicherstellen,<br />
bei der Beratungstätigkeit die fachlichen Vorgaben der staatlichen Beratung <strong>in</strong> Bayern<br />
e<strong>in</strong>halten <strong>und</strong> <strong>in</strong> enger Abstimmung mit ihr arbeiten.<br />
Voraussetzung für die Anerkennung ist der Abschluss e<strong>in</strong>es Verb<strong>und</strong>beratungsvertrages mit<br />
dem Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten (StMELF).<br />
Verb<strong>und</strong>partner Ansprechpartner<br />
Anschrift<br />
Tierische Erzeugung<br />
<strong>Land</strong>eskuratorium der Erzeugerr<strong>in</strong>ge<br />
für tierische Veredelung<br />
<strong>in</strong> Bayern e.V. (LKV)<br />
Pflanzliche Erzeugung<br />
<strong>Land</strong>eskuratorium für pflanzliche<br />
Erzeugung <strong>in</strong> Bayern e.V.<br />
(LKP)<br />
Kaltengreutherstr. 1<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Tal 35<br />
80331 München<br />
Kontakt<br />
Tel.: 0981/85453<br />
E-Mail: wolfgang.kreiselmeier@aelf-<br />
an.bayern.de<br />
Tel.: 089/290063-00<br />
E-Mail: poststelle@lkp.bayern.de
Verb<strong>und</strong>partner Ansprechpartner<br />
Anschrift<br />
Betriebswirtschaft<br />
Buchstelle des BBV GmbH Maximilianstr. 36<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft<br />
mbH<br />
LBD <strong>Land</strong>wirtschaftlicher Buchführungsdienst<br />
GmbH<br />
Ökologischer <strong>Land</strong>bau<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Adalbert-Pilipp-Strasse 38<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Breslauer R<strong>in</strong>g 49<br />
91438 Bad W<strong>in</strong>dsheim<br />
BIOLAND Herr Schaller<br />
Erlangen<br />
DEMETER Herr Kremer<br />
Neumarkt<br />
NATURLAND Herr Zw<strong>in</strong>gel<br />
Ingolstadt<br />
Kontakt<br />
Tel.: 0981/9719040<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@bubbv.de<br />
http://www.bubbv.de/<br />
Tel.: 0981/97086-0<br />
E-Mail: ansbach@ecovis.com<br />
http://www.ecovis.com/ansbach/<br />
Tel.: 09841/6621-0<br />
E-Mail:<br />
lbd.badw<strong>in</strong>dsheim@bbjmail.de<br />
http://www.lbd-badw<strong>in</strong>dsheim.de/<br />
Tel.: 09131/43951<br />
Tel.: 09181/510420<br />
Tel.: 08450/9093-30<br />
BIOKREIS Herr Schmid Tel.: 09462/911834<br />
3. Schule<br />
<strong>Die</strong> <strong>Land</strong>wirtschaftsschule ist e<strong>in</strong>e staatliche Fachschule. Sie gliedert sich <strong>in</strong> die Abteilungen<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Hauswirtschaft. Sie hat den Auftrag, die Studierenden <strong>in</strong> der Abteilung<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft auf ihren späteren Beruf als landwirtschaftlicher Unternehmer <strong>und</strong> Betriebsleiter<br />
sowie <strong>in</strong> der Abteilung Hauswirtschaft auf die Leitung e<strong>in</strong>es landwirtschaftlichen Haushalts<br />
<strong>und</strong> auf die Mitwirkung <strong>in</strong> der landwirtschaftlichen Betriebs- <strong>und</strong> Unternehmensführung vorzubereiten.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Land</strong>wirtschaftsschule, Abteilung <strong>Land</strong>wirtschaft mit Meisterausbildung, bereitet auf<br />
die spätere Tätigkeit als landwirtschaftlicher Unternehmer <strong>und</strong> Betriebsleiter vor.<br />
Dabei wird das Wissen <strong>und</strong> Können <strong>in</strong> der Betriebs- <strong>und</strong> Unternehmensführung <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere<br />
die notwendige Handlungs- <strong>und</strong> Entscheidungskompetenz vermittelt. Das Wissen <strong>in</strong> der<br />
umwelt- <strong>und</strong> tiergerechten Produktions- <strong>und</strong> Verfahrenstechnik wird vertieft <strong>und</strong> die fachtheoretischen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Berufsbildung <strong>und</strong> Mitarbeiterführung vermittelt.<br />
Sie umfasst zwei fachtheoretische W<strong>in</strong>tersemester <strong>und</strong> e<strong>in</strong> fachpraktisches Sommersemester<br />
mit jeweils 20 Unterrichtswochen.<br />
<strong>Die</strong> Aufnahme <strong>in</strong> die <strong>Land</strong>wirtschaftsschule setzt e<strong>in</strong>en Berufsabschluss <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anerkannten<br />
Ausbildungsberuf der <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> zusätzlich e<strong>in</strong> sog. Praxisjahr voraus.<br />
Der Unterricht wird mit praxis- <strong>und</strong> studierendenorientierten Unterrichtsverfahren gestaltet.<br />
39
40<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Mit Beg<strong>in</strong>n des W<strong>in</strong>tersemesters 2009/10 wird der neue Lehrplan der <strong>Land</strong>wirtschaftsschule<br />
2010 ungesetzt. Damit werden wesentliche Teile der Meisterprüfung schon im Rahmen der<br />
dreisemestrigen Ausbildung abgelegt. E<strong>in</strong>en Überblick zum Ablauf gibt Abbildung 18.<br />
Abbildung 19: <strong>Land</strong>wirtschaftsschule 2010 <strong>und</strong> Meisterprüfung<br />
ab 10/2009 NEU<br />
Meisterprüfung <strong>Land</strong>wirt<br />
Praxisjahr vor LWS<br />
Abschlussprüfung<br />
BAP/AEP<br />
<strong>Land</strong>wirtschaftsschule<br />
3 Semester<br />
Zulassung zur MP<br />
Arbeitsprojekt<br />
Meisterarbeit Betr.Beurt.<br />
O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J<br />
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7<br />
Abkürzungen: LWS: <strong>Land</strong>wirtschaftsschule; BAP: Berufs- <strong>und</strong> Arbeitspädagogik; AEP: Ausbilder-Eignungs-<br />
Prüfung; MP: Meisterprüfung; Betr.Beurt.: Fremdbetriebsbeurteilung<br />
Quelle: StMELF<br />
<strong>Die</strong> <strong>Land</strong>wirtschaftsschule <strong>Ansbach</strong> bildet nach wie vor jeweils zwei Semester gleichzeitig aus.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus beteiligt sich die <strong>Land</strong>wirtschaftsschule bei der pädagogischen Ausbildung der<br />
künftigen Lehrkräfte (Referendare).<br />
Auskunft zu allen Fragen zur <strong>Land</strong>wirtschaftsschule gibt der Schulleiter Dr. Kalchreuter.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Land</strong>wirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft (Teilzeitschule) bereitet auf die Mitwirkung<br />
<strong>in</strong> der landwirtschaftlichen Betriebs- <strong>und</strong> Unternehmensführung vor. Das Amt für<br />
Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong> - Sachgebiet L 3.2 - Ernährung, Haushaltsleistungen<br />
<strong>und</strong> Bildung führt jeweils im Wechsel zwei e<strong>in</strong>semestrige Studiengänge <strong>in</strong> Teilzeitform<br />
durch. Schulorte s<strong>in</strong>d die <strong>Land</strong>wirtschaftsschule <strong>Ansbach</strong>, Mariusstraße 24 <strong>und</strong> der<br />
<strong>Die</strong>nstsitz D<strong>in</strong>kelsbühl, Luitpoldstraße 5.<br />
In 20 Monaten werden neben theoretischen Lern<strong>in</strong>halten aus der Ernährung <strong>und</strong> Hauswirtschaft<br />
vor allem praktische Fertigkeiten vermittelt. <strong>Die</strong> Gr<strong>und</strong>lagen der Ausbildereignungsverordnung<br />
s<strong>in</strong>d ebenfalls Unterrichts<strong>in</strong>halt. E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> die landwirtschaftliche Produktion <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong>lagen der Betriebsorganisation r<strong>und</strong>en das Lernprogramm ab. <strong>Die</strong> Unterrichtszeiten<br />
können flexibel gestaltet werden.<br />
<strong>Die</strong>se Bildungsmöglichkeit ist für Bäuer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Frauen aus dem ländlichen Bereich, die ihr<br />
Haushaltsmanagement <strong>und</strong> ihre Haushaltsführung optimieren möchten oder sich e<strong>in</strong> zweites<br />
Standbe<strong>in</strong> auf ihren Betrieben <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation schwerpunktmäßig im<br />
hauswirtschaftlichen Bereich schaffen möchten, sehr gut geeignet. Auch die Aufnahme e<strong>in</strong>er<br />
Erwerbstätigkeit im hauswirtschaftlichen Bereich <strong>in</strong> der Vernetzung mit anderen Angeboten<br />
<strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsunternehmen ist denkbar. Sehr gut lässt sich der Studiengang auch mit<br />
K<strong>in</strong>dererziehungszeiten komb<strong>in</strong>ieren.<br />
Anmeldungen bzw. Anfragen zum Schulbesuch richten Sie bitte an Frau Gertrud Habermeyer,<br />
oder Frau Gretel Bauer <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> oder Frau Klara Lausenmeyer <strong>in</strong> D<strong>in</strong>kelsbühl.<br />
Meisterbriefübergabe
VI. <strong>Forstwirtschaft</strong><br />
1. Bereich Forsten<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
<strong>Die</strong> Bayerische Forstverwaltung ist zuständig für alle Belange des Waldes <strong>und</strong> der <strong>Forstwirtschaft</strong><br />
<strong>in</strong> Bayern. Auf der Gr<strong>und</strong>lage des Waldgesetzes für Bayern stellt sie e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße<br />
<strong>und</strong> nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder sicher <strong>und</strong> arbeitet dienstleistungsorientiert<br />
an der Weiterentwicklung des Sektors Forst <strong>und</strong> Holz. Am Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
<strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong> den dazugehörigen Forstrevieren ist sie als Bereich Forsten <strong>in</strong><br />
Heilsbronn vertreten. Nachfolgend e<strong>in</strong> Überblick der Ziele <strong>und</strong> Arbeitsfelder der Bayerischen<br />
Forstverwaltung (Abbildung 20):<br />
Abbildung 20: <strong>Die</strong> Bayerische Forstverwaltung hat 14 Arbeitsfelder ausgeschieden, <strong>in</strong><br />
denen die übergeordneten Kernbotschaften konkret <strong>in</strong> die Praxis umgesetzt<br />
werden.<br />
Am Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere folgende Arbeitsfelder<br />
wichtig:<br />
- Stärkung der forstlichen Zusammenschlüsse<br />
Den örtlichen Forstbetriebsgeme<strong>in</strong>schaften (FBG <strong>Ansbach</strong>-Fürth, FBG Feuchtwangen,<br />
FBG D<strong>in</strong>kelsbühl <strong>und</strong> FBG Rothenburg o.d.T.) sowie der <strong>Forstwirtschaft</strong>lichen Vere<strong>in</strong>igung<br />
Mittelfranken als Dachorganisation s<strong>in</strong>d spezielle Forstliche Berater zur Seite<br />
gestellt. Bei der Beratung stehen zwei Ziele im Vordergr<strong>und</strong>:<br />
� Entwicklung zu wirtschaftlich erfolgreichen, unternehmerisch ausgerichteten <strong>und</strong><br />
wettbewerbsfähigen Organisationen der Waldbesitzer<br />
� Sicherung e<strong>in</strong>er flächenwirksamen, alle Waldbesitzgrößen erreichenden <strong>und</strong> forstfachlich<br />
qualitativ hochwertigen Waldbewirtschaftung<br />
41
42<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
- Beratung<br />
<strong>Die</strong> Revierleiter des Amtes beraten kompetent, objektiv <strong>und</strong> kostenfrei bei der Begründung,<br />
Pflege <strong>und</strong> Sicherung des Privat- <strong>und</strong> Körperschaftswaldes. <strong>Die</strong> Waldbesitzer<br />
werden unterstützt <strong>und</strong> motiviert ihre Wälder nachhaltig zu bewirtschaften. <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>schlägigen<br />
rechtlichen Vorschriften <strong>und</strong> Regelungen werden aufgezeigt. Somit vermittelt<br />
die Bayerische Forstverwaltung den Waldbesitzern <strong>und</strong> Forstbetriebsgeme<strong>in</strong>schaften<br />
(FBG) forstliches <strong>und</strong> jagdliches Wissen sowie praktische Fähigkeiten. Überdies ist<br />
es Ziel, das Bewusstse<strong>in</strong> für die Notwendigkeit angepasster Wildbestände zu stärken,<br />
um auch zukünftig alle Waldfunktionen erfüllen zu können. <strong>Die</strong> Waldbesitzer werden<br />
unterstützt eigenverantwortlich <strong>und</strong> konsequent den gesetzlichen Auftrag „Wald vor<br />
Wild“ e<strong>in</strong>zufordern.<br />
Im Jahr 2009 wurden durch unsere Förster r<strong>und</strong> 5.000 Waldbesitzer bei gut 4.500 Beratungen<br />
<strong>in</strong> ihrem Handeln unterstützt. <strong>Die</strong> staatliche Beratung wird jedoch nicht nur auf<br />
Nachfrage vorgehalten. <strong>Die</strong> Revierleiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Revierleiter gehen auch aktiv auf die<br />
Waldbesitzer zu, um beispielsweise e<strong>in</strong>zuschreiten, wenn sich deren Wälder <strong>in</strong> Gefahr<br />
bef<strong>in</strong>den. Viele Waldbesitzer, vor allem jene, die weit entfernt von ihren Wäldern wohnen,<br />
hätten ohne staatliche Beratung hier oft zu spät reagiert.<br />
Zusätzlich werden jährlich mit den beiden <strong>Forstwirtschaft</strong>smeistern des Amtes über 30<br />
Motorsägenkurse durchgeführt. Daneben werden mehrere Schulungen <strong>und</strong> Praxistage<br />
zur Pflege <strong>und</strong> Durchforstung angeboten.<br />
Erstmals wurde 2009 das Bildungsprogramm Forst (BiFo) gestartet. In den Abendveranstaltungen<br />
<strong>und</strong> zusätzlichen Praxistagen werden den Waldbesitzern die wesentlichen,<br />
sie berührenden, Themenbereiche vermittelt.<br />
- F<strong>in</strong>anzielle Förderung<br />
<strong>Die</strong> forstlichen Förderprogramme schaffen e<strong>in</strong>en f<strong>in</strong>anziellen Ausgleich zwischen den<br />
Belangen der Waldbesitzer <strong>und</strong> denen der Gesellschaft (Tabelle 15 <strong>und</strong> Tabelle 16).<br />
<strong>Die</strong> Waldbesitzer werden durch die Förderung unterstützt um klimastabile, naturnahe<br />
<strong>und</strong> zukunftsfähige Wälder zu begründen, zu sichern <strong>und</strong> zu pflegen. Überdies werden<br />
Maßnahmen zum notwendigen <strong>und</strong> naturschonenden Wegebau im Wald gefördert. Ferner<br />
können Anreize für die Umsetzung besonderer Belange des Naturschutzes gegeben<br />
werden.<br />
Tabelle 15: Übersicht der forstlichen Förderprogramme.<br />
Förderprogramm<br />
WaldFöPR ForstWegR ForstZusR VNPWald bGWL<br />
Ziel Waldbau <strong>und</strong> Erstaufforstung<br />
Wichtige<br />
Aspekte<br />
Antragsberechtigt<br />
- Naturverjüngung<br />
- Pflege<br />
- Waldumbau planmäßig<br />
- Waldumbau nach<br />
Schaden<br />
- Erstaufforstung<br />
Privat- <strong>und</strong> Körperschaftswald<br />
Wegebau FBG / WBV Naturschutz Gesellschaft /<br />
Bürger<br />
- Wegeneubau<br />
- Reparatur nach<br />
Schaden<br />
Privat- <strong>und</strong> Körperschaftswald<br />
- Investitionen<br />
- Projekte wie<br />
überbetriebl.<br />
Holzzusammenfassung,Waldpflegeverträge<br />
- Alt- <strong>und</strong><br />
Biotopbäume<br />
- Totholz<br />
- Nutzungsverzicht<br />
- Nieder- <strong>und</strong><br />
Mittelwald<br />
FBG / WBV Privat- <strong>und</strong> Körperschaftswald<br />
Maßnahmen<br />
im Bereich<br />
Erholung <strong>und</strong><br />
Naturschutz<br />
Staatswald
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Tabelle 16: Übersicht der forstlichen Förderung am AELF <strong>Ansbach</strong> des Jahres 2009.<br />
Waldumbau<br />
Planmäßig<br />
Waldumbau nach<br />
Schadereignis<br />
Auszahlung<br />
Summe<br />
Privat-<br />
wald<br />
Körperschaftswald<br />
Anzahl<br />
Anträge<br />
Menge<br />
Menge/<br />
Antrag<br />
17.576 € 12.919 € 4.657 € 17 5,328 ha 0,313 ha<br />
372.344 € 263.471 € 108.873 € 359 112,507 ha 0,313 ha<br />
Naturverjüngung 8.527 € 8.527 €<br />
Erstaufforstung<br />
Investition<br />
Erstaufforstungs<strong>und</strong><br />
Pflegeprämie<br />
5.020 € 5.020 €<br />
87.544 € 87.968 € 277 € 665<br />
14 7,787 ha 0,556 ha<br />
8 2,402 ha 0,300 ha<br />
Jugendpflege 50.714 € 17.890 € 32.824 € 77 127,856 ha 1,660 ha<br />
Walderschließung<br />
Neubau<br />
Walderschließung -<br />
Reparatur nach<br />
Schadensereignis<br />
Forstliche Zusammenschlüsse<br />
-<br />
Projektförderung<br />
Vertragsnaturschutz<br />
Wald<br />
115.885 € 91.054 € 24.831 € 3 5.622 lfm 1.874 lfm<br />
105.307 € 105.307 €<br />
77.246 €<br />
4.106 € 1.252 € 2.854 € 9<br />
Summe 844.269 € 669.953 € 174.316 € 1168<br />
11 13.066 lfm 1.188 lfm<br />
- <strong>Die</strong>nstleistungen im Körperschaftswald<br />
E<strong>in</strong>e vorbildliche <strong>und</strong> planmäßige Bewirtschaftung der Körperschaftswälder durch<br />
fachk<strong>und</strong>iges Personal ist im Waldgesetz für Bayern (Artikel 19 BayWaldG) festgelegt.<br />
Damit sollen die hohen Ansprüche an die Geme<strong>in</strong>wohlfunktionen dieser Wälder nachhaltig<br />
gesichert werden. Dazu muss, basierend auf Betriebsplänen oder Betriebsgutachten,<br />
planmäßig <strong>und</strong> nachhaltig gewirtschaftet werden. <strong>Die</strong> Erstellung <strong>und</strong> Aktualisierung<br />
dieser Betriebsgr<strong>und</strong>lage obliegt der Unteren Forstbehörde. Meist wird diese Tätigkeit<br />
an freiberufliche Sachverständige vergeben.<br />
Neben der E<strong>in</strong>zelberatung durch die Revierleiter bietet das AELF als kompetenter <strong>und</strong><br />
zuverlässiger <strong>Die</strong>nstleister für den Körperschaftswald die Übernahme der Betriebsleitung<br />
<strong>und</strong> Betriebsausführung an. <strong>Die</strong>se kostenpflichtigen <strong>Die</strong>nstleistungen werden von<br />
den kommunalen Forstbetrieben des <strong>Die</strong>nstgebietes sehr geschätzt. So nutzen über<br />
90 % der Kommunen diese <strong>Die</strong>nstleistung.<br />
- Hoheit<br />
Untere Forstbehörde als „Träger öffentlicher Belange“<br />
Staatliche Behörden <strong>und</strong> kommunale Gebietskörperschaften sollen bei allen Planungen,<br />
Vorhaben <strong>und</strong> Entscheidungen, die Wald betreffen, die Ziele <strong>und</strong> den Zweck des Waldgesetzes<br />
für Bayern (BayWaldG), <strong>in</strong>sbesondere die Funktionen des Waldes <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e<br />
Bedeutung für die biologische Vielfalt berücksichtigen. Darüber h<strong>in</strong>aus ist bei Maßnahmen,<br />
die e<strong>in</strong>e Bee<strong>in</strong>trächtigung des Waldes erwarten lassen, die zuständige Forstbehörde<br />
rechtzeitig zu unterrichten <strong>und</strong> anzuhören.<br />
Wir werden deshalb regelmäßig bei<br />
o Bauleitplanung<br />
o Baugenehmigungsverfahren<br />
o Immissionsschutzrechtlichen Verfahren<br />
o Verfahren der ländlichen Entwicklung<br />
5<br />
43
44<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
o Abfallrechtlichen Verfahren<br />
o Schutzgebietsausweisungen (z.B. Naturschutz oder Wasserschutz)<br />
o Bergrechtlichen Verfahren<br />
von den jeweils zuständigen Stellen im Genehmigungsverfahren beteiligt <strong>und</strong> um e<strong>in</strong>e<br />
Stellungnahme gebeten. Aufgabe des AELF ist es dann, die Belange des Waldes <strong>und</strong><br />
der <strong>Forstwirtschaft</strong> sachgerecht <strong>und</strong> neutral zu vertreten, <strong>in</strong>sbesondere den Wald zu erhalten,<br />
vor Schäden zu bewahren, se<strong>in</strong>e sachgemäße Bewirtschaftung zu sichern <strong>und</strong><br />
dabei e<strong>in</strong>en Ausgleich zwischen den Belangen der Allgeme<strong>in</strong>heit <strong>und</strong> der Waldbesitzer<br />
herbei-zuführen.<br />
Bis 2005 haben die <strong>Land</strong>ratsämter auch waldrechtliche Erlaubnisbescheide erstellt. Seit<br />
01.07.2005 ist das AELF als Untere Forstbehörde für waldrechtliche Genehmigungen<br />
zuständig. Von Bedeutung s<strong>in</strong>d hier die Genehmigung von Rodungen <strong>und</strong> Erstaufforstungen<br />
sowie die Feststellung der Schutzwaldeigenschaft (temporärer Schutzwald /<br />
Sturmschutzwald).<br />
Außerdem übt die Bayerische Forstverwaltung die Forstaufsicht auf alle Waldbesitzarten<br />
aus. <strong>Die</strong>se hoheitliche Tätigkeit dient der Erhaltung des Waldes, der Bewahrung vor<br />
Schäden, der Sicherung e<strong>in</strong>er sachgemäßen Bewirtschaftung sowie der Beachtung normativer<br />
Vorgaben.<br />
- Waldpädagogik<br />
<strong>Die</strong> Forstliche Bildungsarbeit <strong>und</strong> die Waldpädagogik versuchen über persönliche Erlebnisse<br />
das Interesse an der Natur zu wecken <strong>und</strong> zum Staunen über Naturzusammenhänge<br />
anzuregen. Waldpädagogik kann Anstöße geben, über das eigene Wertverständnis<br />
<strong>und</strong> über mögliche Verhaltensänderungen nachzudenken. Dem Erfolg der Waldpädagogik<br />
liegt die E<strong>in</strong>sicht zugr<strong>und</strong>e, dass es nicht die Menge des vermittelten Wissens<br />
ist, an die sich die Waldbesucher h<strong>in</strong>terher er<strong>in</strong>nern, sondern dass vor allem das selbst<br />
Erlebte, Erfühlte, im Wald Erfahrene haften bleibt. Forstliche Bildungsarbeit will als<br />
Waldpädagogik so auch das Verständnis für die Waldeigentümer <strong>und</strong> ihr Wirtschaften<br />
fördern. Ziel ist, dass alle dritten Klassen der Gr<strong>und</strong>schulen e<strong>in</strong>en Tag mit dem Förster<br />
im Wald verbr<strong>in</strong>gen.<br />
- Natura 2000 im Wald<br />
<strong>Die</strong> Abteilung F3 des Amtes ist überregional für Mittelfranken zuständig.<br />
- Forstliche Fachplanung<br />
Das AELF <strong>Ansbach</strong> ist mit der Waldfunktionsplanung überregional für Mittelfranken<br />
tätig.<br />
2. Wald Heute<br />
2.1 Waldfläche<br />
Tabelle 17: Waldfläche <strong>und</strong> Waldanteil (Bewaldungsprozent) im Vergleich.<br />
<strong>Ansbach</strong> (<strong>Land</strong> <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>) Bayern Deutschland<br />
Waldfläche [<strong>in</strong> 1.000 ha] 57,781 2.463 10.649<br />
Bewaldungs-prozent [%] 28 35 30
2.2 Erstaufforstung<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Nach Artikel 16 Absatz 1 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) bedarf die Aufforstung<br />
nicht forstlich genutzter Gr<strong>und</strong>stücke durch Pflanzung oder Saat von Waldbäumen der Erlaubnis.<br />
<strong>Die</strong>s gilt auch für Christbaum-, Schmuckreisig- <strong>und</strong> Kurzumtriebskulturen (Energiewald).<br />
<strong>Die</strong> Erlaubnis zu e<strong>in</strong>er Erstaufforstung wird nach Artikel 39 Absatz 2 BayWaldG von der Unteren<br />
Forstbehörde erteilt. Analog zur Rodung bedarf es ke<strong>in</strong>er weiteren, förmlichen Erlaubnis<br />
durch die Untere Forstbehörde, wenn e<strong>in</strong>e Erstaufforstung Teil e<strong>in</strong>es behördlichen Verfahrens<br />
ist (zum Beispiel <strong>Land</strong>schaftsplan oder Grünordnungsplan). Seit 01.07.2005 bis 31.12.2009<br />
wurden über solche behördliche Verfahren zusätzlich r<strong>und</strong> 7 ha im Amtsgebiet aufgeforstet.<br />
E<strong>in</strong>e unerlaubte Erstaufforstung ist nach Artikel 46 Absatz 2 BayWaldG e<strong>in</strong>e Ordnungswidrigkeit<br />
<strong>und</strong> kann mit e<strong>in</strong>er Geldbuße bis zu 10.000 Euro belegt werden.<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> wurden <strong>in</strong> der Zeit vom 01.07.2005 bis 31.12.2009 <strong>in</strong>sgesamt 92 Erstaufforstungsgenehmigungen<br />
mit e<strong>in</strong>er Gesamtfläche von 45,12 ha erteilt (Tabelle 18). Rechnerisch<br />
wurde 2008 im Amtsgebiet 2,0 % der Erstaufforstungsfläche Bayerns realisiert.<br />
Tabelle 18: Genehmigte Erstaufforstungen seit 01.07.2005 bis 31.12.2009.<br />
Forstrevier 2005 2006 2007 2008 2009 Gesamtergebnis<br />
Bechhofen 3,35 ha 0,10 ha 0,48 ha 5,97 ha 0,46 ha 10,36 ha<br />
D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
2,46 ha<br />
Eh<strong>in</strong>gen 1,40 ha 0,38 ha<br />
2,67 ha 5,13 ha<br />
0,84 ha 2,62 ha<br />
Feuchtwangen 0,25 ha 0,18 ha 0,30 ha 1,04 ha 1,70 ha 3,47 ha<br />
Herrieden<br />
Lehrberg<br />
Rothenburg<br />
Weihenzell<br />
Wettr<strong>in</strong>gen<br />
0,22 ha<br />
0,22 ha<br />
0,48 ha 0,59 ha 0,13 ha 0,42 ha 1,62 ha<br />
0,12 ha<br />
0,23 ha 0,29 ha 0,64 ha<br />
1,95 ha 0,55 ha 2,63 ha 3,90 ha 9,03 ha<br />
0,38 ha<br />
0,35 ha 1,29 ha 2,02 ha<br />
W<strong>in</strong>dsbach 1,27 ha 0,97 ha 1,21 ha 0,80 ha 5,78 ha 10,02 ha<br />
Gesamtergebnis 6,27 ha 7,24 ha 3,13 ha 11,99 ha 16,50 ha 45,12 ha<br />
Anzahl - Anträge 7 18 12 21 34 92<br />
Ø ha je Antrag 0,89 ha 0,40 ha 0,32 ha 0,57 ha 0,49 ha 0,49 ha<br />
2.3 Rodung<br />
<strong>Die</strong> Beseitigung von Wald zugunsten e<strong>in</strong>er anderen Bodennutzungsart (Rodung) bedarf der<br />
Erlaubnis nach Artikel 9 Absatz 2 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG). <strong>Die</strong> Erlaubnis zu<br />
e<strong>in</strong>er Rodung wird nach Artikel 39 Absatz 2 BayWaldG von der Unteren Forstbehörde erteilt.<br />
Soweit <strong>in</strong> Satzungen, Planfeststellungsbeschlüssen, Genehmigungen <strong>und</strong> sonstigen behördlichen<br />
Gestattungen auf Gr<strong>und</strong> anderer Gesetze die Änderung der Nutzung festgelegt oder zugelassen<br />
ist, bedarf es ke<strong>in</strong>er weiteren, förmlichen Erlaubnis durch die Untere Forstbehörde (Artikel<br />
9 Absatz 8 BayWaldG). Seit 01.07.2005 bis 31.12.2009 wurden über solche behördliche<br />
Verfahren zusätzlich r<strong>und</strong> 10 ha im Amtsgebiet gerodet. E<strong>in</strong>e unerlaubte Rodung ist nach Arti-<br />
45
46<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
kel 46 Absatz 1 BayWaldG e<strong>in</strong>e Ordnungswidrigkeit <strong>und</strong> kann mit e<strong>in</strong>er Geldbuße bis zu<br />
25.000 Euro belegt werden.<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> wurden <strong>in</strong> der Zeit vom 01.07.2005 bis 31.12.2009 <strong>in</strong>sgesamt 40 Rodungsgenehmigungen<br />
mit e<strong>in</strong>er Gesamtfläche von 5,52 ha erteilt (Tabelle 19). Rechnerisch<br />
wurde 2008 im Amtsgebiet 0,4 % der Rodungsfläche Bayerns erreicht.<br />
Tabelle 19: Genehmigte Rodungen seit 01.07.2005 bis 31.12.2009.<br />
Forstrevier 2007 2008 2009 Gesamtergebnis<br />
Bechhofen 0,69 ha 0,87 ha<br />
Feuchtwangen 1,89 ha<br />
Lehrberg<br />
Leutershausen 0,80 ha<br />
Rothenburg 0,06 ha<br />
W<strong>in</strong>dsbach 0,91 ha<br />
0,18 ha<br />
1,56 ha<br />
1,89 ha<br />
0,18 ha<br />
0,80 ha<br />
0,06 ha<br />
0,12 ha 1,03 ha<br />
Gesamtergebnis 4,35 ha 1,05 ha 0,12 ha 5,52 ha<br />
Anzahl - Anträge 29 10 1 40<br />
Ø ha je Antrag 0,15 ha 0,11 ha 0,12 ha 0,14 ha<br />
2.4 Waldbesitz<br />
Abbildung 21: Verteilung des Waldbesitzes <strong>und</strong> zum Vergleich Bayern <strong>und</strong> Deutschland.<br />
Begriffsbestimmung Waldeigentümer <strong>und</strong> Waldbesitzer nach Artikel 3 des Waldgesetzes für<br />
Bayern (BayWaldG):<br />
(1) Im S<strong>in</strong>n dieses Gesetzes ist<br />
1. Staatswald derjenige Wald, der im Alle<strong>in</strong>eigentum oder Miteigentum ausschließlich des<br />
Freistaates Bayern, e<strong>in</strong>er vom Freistaat Bayern verwalteten Stiftung, e<strong>in</strong>es anderen <strong>Land</strong>es<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland oder des B<strong>und</strong>es steht,<br />
2. Körperschaftswald derjenige Wald, der im Alle<strong>in</strong>eigentum oder Miteigentum ausschließlich<br />
von kommunalen Gebietskörperschaften <strong>und</strong> von ihnen verwalteten öffentlichen Stiftungen<br />
steht, soweit sie der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehen,
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
3. Privatwald derjenige Wald, der weder Staatswald noch Körperschaftswald ist.<br />
(2) Waldbesitzer im S<strong>in</strong>n dieses Gesetzes s<strong>in</strong>d der Waldeigentümer <strong>und</strong> der Nutzungsberechtigte,<br />
sofern sie unmittelbare Besitzer des Waldes s<strong>in</strong>d.<br />
Besitzstruktur im Staatswald<br />
Der Staatswald im Eigentum des Freistaates Bayern, umfasst im <strong>Land</strong>kreis r<strong>und</strong> 15.200 ha. <strong>Die</strong><br />
heutigen Staatswaldungen stammen aus ehemals kirchlichem, teils auch weltlichem Besitz. Das<br />
Fürstbistum Eichstätt, zu dem das Chorherrenstift Herrieden gehörte, besaß ausgedehnte Wälder.<br />
In den Händen der Markgrafen von <strong>Ansbach</strong> lag ebenfalls e<strong>in</strong> großer Anteil des heutigen<br />
Staatswaldes. Den bedeutendsten Zugew<strong>in</strong>n an Wald brachte dem Staat zu Beg<strong>in</strong>n des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts die Säkularisation. Noch heute künden Waldbezeichnungen wie Klosterwald,<br />
Mönchswald oder Klosterberg von ihren früheren Eigentümern.<br />
Zuständig für die Bewirtschaftung des Staatswaldes im <strong>Land</strong>kreis ist im Wesentlichen der<br />
Forstbetrieb Rothenburg o.d.T. der Bayerische Staatsforsten A.ö.R.<br />
Besitzstruktur im Körperschaftswald<br />
Der Körperschaftswald entstand <strong>in</strong> vielen Fällen aus den früher weit verbreiteten geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Waldungen, den Allmend- oder Genossenschaftswaldungen, dem Allgeme<strong>in</strong>gut der<br />
Siedler. Im <strong>Land</strong>kreis besitzt jede der 58 Geme<strong>in</strong>den Wald (Abbildung 22). Über großen<br />
Waldbesitz verfügen die Städte <strong>Ansbach</strong>, Feuchtwangen, D<strong>in</strong>kelsbühl <strong>und</strong> Rothenburg o.d.T.<br />
Da viele Geme<strong>in</strong>dewälder beziehungsweise Teilflächen mit Nutzungsrechten belastet s<strong>in</strong>d,<br />
sogenannte Rechtlerwälder, gibt es im <strong>Land</strong>kreis über 130 körperschaftliche Forstbetriebe.<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
bis 5 ha 5 - 100 ha über 100 ha<br />
Abbildung 22: Anzahl der kommunalen Forstbetriebe nach Besitzgröße.<br />
Kommunale<br />
Forstbetriebe<br />
Besitzstruktur im Privatwald<br />
Im <strong>Land</strong>kreis überwiegt der Kle<strong>in</strong>-Privatwald (58 %). Er bef<strong>in</strong>det sich meist im bäuerlichen<br />
Besitz <strong>und</strong> entstand vor allem aus der Ablösung von Nutzungsrechten am Wald durch die<br />
Übertragung von Gr<strong>und</strong>eigentum (Abbildung 23). Se<strong>in</strong>e Bewirtschaftung wird durch e<strong>in</strong>e starke<br />
Besitzzersplitterung <strong>und</strong> Parzellierung erheblich erschwert.<br />
Der Groß-Privatwald (6%) ist <strong>in</strong> der Hand von wenigen Adelsfamilien sowie von Stiftungen.<br />
Es handelt sich vorwiegend um altes, ererbtes Familieneigentum, das aus kaiserlichem Lehen<br />
oder altem Besitz der <strong>Land</strong>esfürsten entstanden ist.<br />
47
48<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 23: Anzahl der Waldbesitzer <strong>und</strong> die Summe der Waldfläche nach Besitzgröße.<br />
2.5 Baumarten<br />
Abbildung 24: <strong>Die</strong> Baumarten <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong>, zum Vergleich Bayern <strong>und</strong><br />
Deutschland sowie die Gegenüberstellung der Anteile Laub- <strong>und</strong> Nadelholz.<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> können die Wälder <strong>in</strong> vier typische E<strong>in</strong>heiten unterteilt werden:<br />
Kiefern dom<strong>in</strong>ierte Wälder: Bürgle<strong>in</strong> - Heilsbronn - Mitteleschenbach<br />
Kiefern-Fichten Mischwälder: <strong>Die</strong>tenhofen - Rügland - <strong>Ansbach</strong> - Bechhofen
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Fichten dom<strong>in</strong>ierte Wälder. Oberdachstetten - Schill<strong>in</strong>gsfürst - Feuchtwangen -<br />
Wassertrüd<strong>in</strong>gen<br />
Laubholz dom<strong>in</strong>ierte Wälder: um Rothenburg ob der Tauber<br />
Ursprüngliche Baumartenzusammensetzung<br />
<strong>Die</strong> natürliche Waldgesellschaft ist die Waldgesellschaft der heutigen potentiellen natürlichen<br />
Vegetation e<strong>in</strong>es Standortes. <strong>Die</strong>se ist e<strong>in</strong>e modellhafte Vorstellung der höchstentwickelten<br />
Vegetation, die sich unter den gegenwärtigen Standortbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Florenverhältnissen –<br />
unter Ausschluss bestehender <strong>und</strong> zukünftiger unmittelbarer menschlicher E<strong>in</strong>flüsse – auf e<strong>in</strong>em<br />
Standort bef<strong>in</strong>den kann. Zur natürlichen Waldgesellschaft gehören auch Lichtbaumarten,<br />
die zeitlich <strong>und</strong> räumlich begrenzt <strong>in</strong> Pionierphasen der natürlichen Waldentwicklung auftreten.<br />
(Walentowski et al. 2006: Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns. Seite<br />
424)<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> wären die Wälder natürlicherweise re<strong>in</strong>e Buchen-Wälder oder Buchen-<br />
Tannen-Mischwälder. Vere<strong>in</strong>zelt würde die Eiche mit Ha<strong>in</strong>buche oder mit Tanne das Waldbild<br />
prägen.<br />
2.6 Vorrat <strong>und</strong> Zuwachs<br />
<strong>Die</strong> Werte s<strong>in</strong>d Ergebnis der B<strong>und</strong>eswald<strong>in</strong>ventur II (2002) <strong>und</strong> beziehen sich auf Mittelfranken.<br />
E<strong>in</strong> Vorratsfestmeter (Vfm) ist die Holzmenge mit Ästen <strong>und</strong> R<strong>in</strong>de <strong>in</strong> m 3 .<br />
Tabelle 20: Der Vorrat an Holz <strong>in</strong> Millionen Vorratsfestmeter nach Baumarten <strong>und</strong> der<br />
Vorrat an Holz im Schnitt je 1-Hektar-Fläche.<br />
Vorrat<br />
Mittelfanken<br />
[Mio. Vfm]<br />
Bayern<br />
[Mio. Vfm]<br />
Anteil<br />
[%]<br />
Fichte 22,3 548 4<br />
Kiefer 47,4 196 24<br />
Eiche 8,4 49 17<br />
Buche 14,9 186 8<br />
Gesamt 93,0 979 9<br />
durchschnittlicher Vorrat je Hektar 391 Vfm/ha 403 Vfm/ha 97 %<br />
Tabelle 21: Der Zuwachs an Holz je Baumart <strong>in</strong> Vorratsfestmeter je 1-Hektar-Fläche <strong>und</strong><br />
Jahr sowie dem gegenüber die Nutzung, also Holzernte.<br />
Zuwachs<br />
[Vfm/ha/Jahr]<br />
Nutzung<br />
[Vfm/ha/Jahr]<br />
Verhältnis Nutzung zu<br />
Zuwachs [%]<br />
Fichte 15,5 14,0 90<br />
Kiefer 9,7 5,8 60<br />
sonstiges Nadelholz 12,5 4,1 33<br />
Eiche 10,1 2,0 20<br />
Buche 14,7 3,9 26<br />
sonstiges Laubholz 10,5 2,8 26<br />
49
50<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
3. Wald Zukunft<br />
3.1 Klimawandel<br />
Nach allen derzeit vorliegenden Erkenntnissen der verschiedensten Universitäten <strong>und</strong><br />
Forschungse<strong>in</strong>richtungen ist der Klimawandel bereits <strong>in</strong> Gang. Er wird überwiegend durch<br />
menschliches Verhalten verursacht, <strong>in</strong>sbesondere durch Verbrennung fossiler Energieträger.<br />
E<strong>in</strong> Indiz ist die Verlängerung der Vegetationszeit <strong>in</strong> den letzten Jahren um fast zwei Wochen.<br />
Ohne erfolgreichen Klimaschutz bleiben die notwendigen Anpassungsmaßnahmen jedoch vergebens.<br />
Hierzu s<strong>in</strong>d weltweit alle aufgefordert! So versucht beispielsweise der Weltklimarat<br />
(IPCC: <strong>in</strong>ternational panel on climate change) durch unabhängige Information weltweit die<br />
notwendigen Schritte anzustoßen. Für Bayern s<strong>in</strong>d folgende Veränderungen bis 2100 wahrsche<strong>in</strong>lich:<br />
- Variabilität des Klimas steigt<br />
- Zunahme der Durchschnittstemperatur um +2°C (Sommer + 3-4°C)<br />
- Abnahme der Niederschlag um 5 bis 10 %<br />
- W<strong>in</strong>ter milder <strong>und</strong> nasser (+ 20-30 % Niederschlag)<br />
- Sommer trockener<br />
- Mehr Hitze- <strong>und</strong> Trockenperioden<br />
- Mehr Starkregenereignisse<br />
- Häufigere <strong>und</strong> stärkere Stürme<br />
Daraus ergeben sich wesentliche Auswirkungen auf den Wald:<br />
- Der Wald kann vor dem Klimawandel nicht davonlaufen.<br />
- Waldbäume haben e<strong>in</strong>e sehr lange Lebenszeit.<br />
- Das Klima ändert sich drastisch <strong>und</strong> für den Wald zu schnell.<br />
- Der e<strong>in</strong>zelne Baum kann sich nicht anpassen.<br />
- E<strong>in</strong>e natürliche Anpassung dauert Jahrh<strong>und</strong>erte.<br />
- An das Klima nicht angepasste Wälder s<strong>in</strong>d gefährdet.<br />
<strong>Die</strong> Bayerische <strong>Land</strong>esanstalt für Wald <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong> (LWF) hat deswegen für die derzeit<br />
wichtigsten Baumarten Klimarisikokarten entwickelt mit deren Hilfe sich die Anbaueignung<br />
<strong>und</strong> das zukünftige Risiko für e<strong>in</strong>e Baumart abschätzen lassen. Nach den Berechnungen<br />
der Wissenschaftler s<strong>in</strong>d im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> etwa 8.500 ha (15 % der Waldfläche) dr<strong>in</strong>gendst<br />
umbaunotwendig. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Waldflächen bereits<br />
<strong>in</strong> den nächsten zehn Jahren große Ausfälle zeigen.<br />
Bereits jetzt gibt es klare Zeichen des Klimawandels im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong>. In den letzten<br />
Jahren hat Westmittelfranken, <strong>in</strong>sbesondere <strong>Ansbach</strong> traurige Berühmtheit erlangt <strong>und</strong> ist Ziel<br />
vieler Exkursionen geworden. Aufgr<strong>und</strong> des ungewöhnlich warm-trockenen Witterungsverlaufs<br />
der letzten Jahre <strong>und</strong> des damit verb<strong>und</strong>en Wasserdefizits s<strong>in</strong>d große Waldflächen, die<br />
mit Fichte bestockt waren, durch Trockenheit <strong>und</strong> die darauffolgende Borkenkäfer-<br />
Massenvermehrung ausgefallen. Im Amtsgebiet dürfte so <strong>in</strong> den letzten Jahren über alle Waldbesitzarten<br />
etwa 30 % der Fichtenfläche <strong>und</strong> r<strong>und</strong> 50 % des Fichtenvorrates vernichtet worden<br />
se<strong>in</strong>. In Mengen ausgedrückt r<strong>und</strong> 1,5 Mio. m 3 Fichtenholz <strong>und</strong> etwa 3.500 ha Kahlfläche.<br />
Mit Hilfe der forstlichen Förderprogramme konnte den Waldbesitzern bei der Wiederbewaldung<br />
der Kahlflächen geholfen werden. Im bayernweiten Vergleich sticht so Beispielsweise<br />
2007 das AELF <strong>Ansbach</strong> mit der mehr als fünffachen Förderfläche gegenüber dem Durchschnitt<br />
hervor (Abbildung 25).
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 25: Waldbauliche Förderung 2007. Förderfläche <strong>in</strong> Hektar jedes AELF <strong>in</strong> Bayern. Dicke<br />
L<strong>in</strong>ie ist die durchschnittliche Flächensumme je Amt <strong>und</strong> hervorgehoben <strong>Ansbach</strong>.<br />
3.2 Waldumbau<br />
Waldumbau bedeutet den Wald aktiv auf die Zukunft vor zu bereiten. Der Problemdruck aus<br />
dem Klimawandel ist <strong>in</strong> der <strong>Forstwirtschaft</strong>, aufgr<strong>und</strong> der langen Produktionszeiträume, weit<br />
höher als <strong>in</strong> der <strong>Land</strong>wirtschaft.<br />
Möglichen Anpassungsmaßnahmen s<strong>in</strong>d:<br />
1) Baumartenvielfalt<br />
- Naturnahe, baumartenreiche Mischbestände mit e<strong>in</strong>em hohen Anteil an wärme- <strong>und</strong><br />
trockenresistenten Baumarten<br />
- Bewährte Gastbaumarten beimischen (z.B. Douglasie).<br />
- Naturverjüngung bzw. Verwendung herkunftsgerechten Vermehrungsguts<br />
2) Frühzeitige Verjüngung von Nadelbeständen<br />
- Durch frühzeitige Vorausverjüngung Nadelholzanteile auf kritischen Standorten senken<br />
- Bestockungsziele <strong>und</strong> Baumarteneignung müssen entsprechend angepasst werden<br />
3) Regulierung der Schalenwildbestände auf das waldbaulich notwendige Maß<br />
- Standortsangepasstes Naturverjüngungspotential weitestgehend ausschöpfen<br />
- Verjüngung im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen<br />
4) Wiederbewaldung von Kahlflächen<br />
- Stärkere Beteiligung der Edellaubbäume <strong>und</strong> der Eiche<br />
- Pionierbaumarten e<strong>in</strong>beziehen (Birke, Aspe, Vogelbeere <strong>und</strong> Kiefer)<br />
5) Rechtzeitige Pflege<br />
- Laubbeimischung erhalten <strong>und</strong> Stabilität verbessern<br />
- In dichten Nadelbeständen Wasserspende mittels Durchforstung erhöhen (M<strong>in</strong>derung<br />
der Interzeption)<br />
- Strukturreiche, ungleichaltrige Mischbestände fördern<br />
51
52<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
3.3 Waldverjüngung <strong>und</strong> Jagd<br />
Allgeme<strong>in</strong>es zum Forstlichen Gutachten<br />
Das Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung erfasst <strong>und</strong> bewertet die Situation<br />
der Waldverjüngung sowie des Verbisses <strong>und</strong> der Fegeschäden durch Schalenwild. Es wird<br />
von den Unteren Forstbehörden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em 3-jährigen Turnus für den räumlichen Bereich der<br />
Hegegeme<strong>in</strong>schaften erstellt. Gr<strong>und</strong>lage für die Gutachten s<strong>in</strong>d die Ergebnisse der im Privat-<br />
<strong>und</strong> Körperschaftswald sowie im Staatswald systematisch durchgeführten Stichproben<strong>in</strong>ventur.<br />
Das Forstliche Gutachten gibt es seit 1986.<br />
Gr<strong>und</strong>sätze der Jagd- <strong>und</strong> Forstpolitik<br />
Nach dem Gr<strong>und</strong>satz "Wald vor Wild" soll die Bejagung die natürliche Verjüngung der standortgemäßen<br />
Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen (gesetzlich<br />
Verankert im Bayerischen Jagdgesetz <strong>und</strong> Waldgesetz für Bayern).<br />
Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lage<br />
Gr<strong>und</strong>lage ist der Artikel 32 Absatz 1 Sätze 2 <strong>und</strong> 3 des Bayerischen Jagdgesetzes:<br />
"Bei der Abschussplanung ist neben der körperlichen Verfassung des Wildes vorrangig der<br />
Zustand der Vegetation, <strong>in</strong>sbesondere der Waldverjüngung zu berücksichtigen. Den zuständigen<br />
Forstbehörden ist vorher Gelegenheit zu geben, sich auf der Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>es forstlichen<br />
Gutachtens über e<strong>in</strong>getretene Wildschäden an forstlich genutzten Gr<strong>und</strong>stücken zu äußern <strong>und</strong><br />
ihre Auffassung zur Situation der Waldverjüngung darzulegen."<br />
Für die Unteren Jagdbehörden s<strong>in</strong>d die Forstlichen Gutachten e<strong>in</strong>e wichtige Gr<strong>und</strong>lage für die<br />
Bestätigung oder Festsetzung der Abschusspläne <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>schafts- bzw. Eigenjagdrevieren.<br />
Situation im Amtsgebiet<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> des Klimawandels <strong>und</strong> der zahlreichen Schäden – Kahlflächen – durch<br />
Borkenkäfer <strong>und</strong> Sturm s<strong>in</strong>d erhebliche Aufwendungen der Waldbesitzer notwendig um stabile,<br />
leistungsfähige, klimatolerante Wälder an die Nachkommen zu übergeben. Um dies erfolgreich<br />
<strong>und</strong> rasch zu schaffen, bedarf es der aktiven Mithilfe der Jäger. Da zukünftig Laubbäume,<br />
wie Buche, Eiche, Esche, Bergahorn sowie die Tanne e<strong>in</strong>e führende Rolle <strong>in</strong> unseren Wäldern<br />
bekommen sollen, müssen sich Waldbesitzer wie Jäger dieser großen Aufgabe <strong>und</strong> Herausforderung<br />
stellen. Über die zurückliegenden Jahre konnte die Verbissbelastung gerade auf diese<br />
Baumarten durch das Engagement der Jäger gesenkt werden. <strong>Die</strong>ser positive Trend wurde<br />
2006 verlassen, 2009 <strong>in</strong> der Tendenz wieder verbessert. <strong>Die</strong> Ergebnisse des forstlichen Gutachtens<br />
im Überblick (Tabelle 22):
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Tabelle 22: Ergebnisse des forstlichen Gutachtens zur Situation der Waldverjüngung <strong>in</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong> <strong>Ansbach</strong> der Jahre 2003, 2006 <strong>und</strong> 2009.<br />
HG-<br />
Nr.<br />
Name der HG<br />
E<strong>in</strong>stufung 2003 E<strong>in</strong>stufung 2006 E<strong>in</strong>stufung 2009<br />
Verbiss-<br />
belastung<br />
Abschuß-<br />
empfehlung<br />
Verbiss-<br />
belastung<br />
Abschuß-<br />
empfehlung<br />
Verbiss-<br />
belastung<br />
Abschuß-<br />
empfehlung<br />
485 Bruckberg zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen tragbar beibehalten<br />
486 Colmberg tragbar beibehalten zu hoch erhöhen zu hoch beibehalten<br />
487 <strong>Die</strong>tenhofen günstig senken zu hoch erhöhen zu hoch beibehalten<br />
488 Flachslanden zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen zu hoch beibehalten<br />
489 Heilsbronn günstig senken zu hoch erhöhen tragbar beibehalten<br />
490 Leutershausen zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen<br />
deutlich zu<br />
hoch<br />
deutlich<br />
erhöhen<br />
491 Lichtenau tragbar beibehalten zu hoch<br />
deutlich<br />
erhöhen zu hoch erhöhen<br />
492 Rügland zu hoch beibehalten zu hoch erhöhen zu hoch beibehalten<br />
493 W<strong>in</strong>dsbach<br />
Wolframstragbar<br />
beibehalten tragbar beibehalten zu hoch beibehalten<br />
494 Eschenbach zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen<br />
495 D<strong>in</strong>kelsbühl I tragbar beibehalten tragbar erhöhen zu hoch erhöhen<br />
496 D<strong>in</strong>kelsbühl II tragbar beibehalten tragbar erhöhen zu hoch erhöhen<br />
497 D<strong>in</strong>kelsbühl III tragbar senken tragbar beibehalten zu hoch erhöhen<br />
498 D<strong>in</strong>kelsbühl IV zu hoch erhöhen tragbar beibehalten<br />
deutlich<br />
zu hoch beibehalten<br />
499 Bechhofen<br />
Feuchtwangen<br />
zu hoch beibehalten zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen<br />
500 Ost<br />
Feuchtwangen<br />
zu hoch beibehalten zu hoch erhöhen zu hoch beibehalten<br />
501 West tragbar senken zu hoch erhöhen tragbar beibehalten<br />
502 Herrieden zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen<br />
503 Geslau zu hoch beibehalten<br />
deutlich<br />
tragbar beibehalten zu hoch erhöhen<br />
504 <strong>Land</strong>wehr zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen<br />
505 Oestheim<br />
Rothenburg<br />
zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen zu hoch beibehalten<br />
506 o.d.T. zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen zu hoch erhöhen<br />
507 Schill<strong>in</strong>gsfürst<br />
deutlich zu<br />
hoch<br />
508 Wassertrüd<strong>in</strong>gen zu hoch erhöhen zu hoch<br />
509 <strong>Ansbach</strong> zu hoch erhöhen zu hoch<br />
deutlich<br />
erhöhen zu hoch beibehalten<br />
deutlich<br />
zu hoch erhöhen<br />
erhöhen<br />
deutlich<br />
tragbar beibehalten<br />
erhöhen zu hoch beibehalten<br />
Trotz des zuletzt wieder positiven Trends kann jedoch ke<strong>in</strong>e Entwarnung gegeben werden. Es<br />
bedarf auch weiterh<strong>in</strong> konsequenter Anstrengung der Jäger, um den gesellschaftlichen Auftrag,<br />
die Waldbesitzer zu unterstützen <strong>und</strong> somit die Lebensgr<strong>und</strong>lage zukünftiger Generationen zu<br />
sichern, auch zu erfüllen.<br />
53
54<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
4. Wald Leistungen <strong>und</strong> Funktionen<br />
4.1 Waldzustandsbericht <strong>und</strong> Kronenzustandserhebung<br />
Der Waldzustand wird europaweit <strong>in</strong> verschiedenen Intensitätsstufen überwacht. <strong>Die</strong> bayerischen<br />
Daten sowie die Daten der anderen deutschen Länder gehen <strong>in</strong> den Bericht des B<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> den Europäischen Waldzustandsbericht e<strong>in</strong>. Der Waldzustandsbericht für Bayern wird<br />
jährlich von der <strong>Land</strong>esanstalt für Wald <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong> (LWF) erstellt. Der Zustand der<br />
Wälder ist aber mehr als nur der Kronenzustand der Bäume <strong>und</strong> erst recht als nur Art <strong>und</strong> Umfang<br />
von Schäden im Wald. Deshalb werden zahlreiche weitere Parameter erfasst, die den<br />
Wald bee<strong>in</strong>flussen, z. B. Witterung, Sturmereignisse, Spätfröste oder Schadstoffdeposition.<br />
Auch natürliche Vorgänge wie das Blühen <strong>und</strong> Fruktifizieren der Bäume h<strong>in</strong>terlassen ihre Spuren.<br />
Kronenzustand – Zusammenfassung der Ergebnisse 2009<br />
Der Zustand der Wälder hat sich im Durchschnitt kaum verändert. Mit 20,8 % liegt der durchschnittliche<br />
Nadel- <strong>und</strong> Blattverlust aller Baumarten auf dem Vorjahresniveau von 20,7 %. <strong>Die</strong><br />
Detailergebnisse variieren allerd<strong>in</strong>gs.<br />
Der Nadelverlust hat bei den Nadelbäumen um 2,5 Prozentpunkte abgenommen. <strong>Die</strong> stärkste<br />
Verbesserung ist bei den Tannen mit e<strong>in</strong>er Abnahme von 4,1 Prozentpunkten zu verzeichnen,<br />
aber auch die Kiefern <strong>und</strong> Fichten wiesen bessere Werte als 2008 auf.<br />
Dagegen hat bei den Buchen der Blattverlust 2009 gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Prozentpunkte,<br />
bei den Eichen um 3,4 Prozentpunkte zugenommen. Beide Baumarten wiesen 2009<br />
starken Fruchtbehang auf, was E<strong>in</strong>fluss auf den Kronenzustand hatte. Der durchschnittliche<br />
Blattverlust aller begutachteten Laubbäume stieg um 4,9 Prozentpunkte an. Über die letzten<br />
beiden Jahrzehnte ist die Entwicklung des Kronenzustandes der Laubbäume von ausgeprägten<br />
Phasen stärkerer Kronenverlichtung <strong>und</strong> folgender Erholung geprägt. Künftige Untersuchungen<br />
müssen klären, ob dies – neben den bekannten Schade<strong>in</strong>flüssen wie Schadstoffe<strong>in</strong>trägen,<br />
Insektenfraß bei der Eiche <strong>und</strong> extremer Trockenheit wie im Jahr 2003 – auch mit der Häufung<br />
von Witterungsextremen <strong>und</strong> wiederholter starker Fruktifikation erklärt werden kann.<br />
4.2 Waldfunktionsplanung<br />
<strong>Die</strong> Waldfunktionsplanung stellt für alle Wälder Bayerns die Nutz-, Schutz- <strong>und</strong> Erholungsfunktionen<br />
(Abbildung 26) sowie ihre Bedeutung für die biologische Vielfalt dar <strong>und</strong> bewertet<br />
sie. Sie zeigt die Ziele <strong>und</strong> Maßnahmen sowie Wege zu ihrer Verwirklichung auf, die zur Erfüllung<br />
der Funktionen <strong>und</strong> zum Erhalt der Biodiversität erforderlich s<strong>in</strong>d.<br />
Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen für die forstlichen Fachpläne s<strong>in</strong>d die Artikel 5 <strong>und</strong> 6 des Waldgesetzes<br />
für Bayern (BayWaldG). <strong>Die</strong> Bayerische Forstverwaltung hat für die 18 bayerischen Planungsregionen<br />
Waldfunktionspläne erarbeitet. <strong>Die</strong> ersten Waldfunktionspläne wurden 1982<br />
veröffentlicht. Derzeit werden die Waldfunktionspläne aktualisiert.<br />
Das AELF <strong>Ansbach</strong> übernimmt alle die Waldfunktionsplanung betreffenden Aufgaben für Mittelfranken.
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Der Waldfunktionsplan e<strong>in</strong>er Planungsregion besteht aus e<strong>in</strong>em Textteil <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Waldfunktionskarte.<br />
Der Textteil beschreibt die regionalen Waldfunktionen, Ziele <strong>und</strong> Maßnahmen <strong>und</strong><br />
benennt die Waldgebiete, die besondere Bedeutung für die e<strong>in</strong>zelnen Funktionen besitzen. <strong>Die</strong><br />
Waldfunktionskarte stellt neben den Waldflächen mit besonderer Bedeutung für e<strong>in</strong>zelne<br />
Waldfunktionen auch die amtlich geschützten Gebiete wie Bannwälder, Naturwaldreservate,<br />
Wasserschutzgebiete oder Naturschutzgebiete dar.<br />
Staatliche Behörden <strong>und</strong> Kommunen haben bei allen Planungen, Vorhaben <strong>und</strong> Entscheidungen,<br />
die Wald betreffen, die Waldfunktionen zu berücksichtigen (Artikel 7 BayWaldG). <strong>Die</strong><br />
Waldfunktionspläne s<strong>in</strong>d daher e<strong>in</strong> wichtiges Hilfsmittel, um diese Inanspruchnahme zu beurteilen.<br />
Der Staatswald <strong>und</strong> die Körperschaftswälder dienen dem allgeme<strong>in</strong>en Wohl im besonderen<br />
Maße <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d daher vorbildlich zu bewirtschaften. Dazu zählen <strong>in</strong>sbesondere die Sicherung<br />
<strong>und</strong> Verbesserung der Waldfunktionen. <strong>Die</strong> forstliche Fachplanung ist e<strong>in</strong>e wertvolle<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die vorbildliche <strong>und</strong> funktionengerechte Waldwirtschaft. Für private Waldbesitzer<br />
s<strong>in</strong>d die Waldfunktionspläne nicht b<strong>in</strong>dend.<br />
Abbildung 26: <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>zelnen Waldfunktionen - außer der Nutzfunktion zur Rohstoffgew<strong>in</strong>nung<br />
– <strong>in</strong> Prozentanteilen der Waldfläche <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong>.<br />
4.3 Naturschutz<br />
Gesetzlich geschützte Biotope im Wald<br />
Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />
In Bayern ist durch die äußerst kle<strong>in</strong>räumig wechselnden standörtlichen Bed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> die<br />
Vielzahl an Waldbesitzern über die Jahrh<strong>und</strong>erte e<strong>in</strong> Mosaik vielfältiger Waldökosysteme entstanden.<br />
Im Vergleich zu anderen großflächigen <strong>Land</strong>nutzungen f<strong>in</strong>den sich im Wald Lebensräume<br />
mit hoher Naturnähe <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er großen biologischen Vielfalt. <strong>Die</strong>s gilt <strong>in</strong> ganz besonderem<br />
Maße für die ökologisch besonders wertvollen <strong>und</strong> deshalb gesetzlich geschützten Waldbiotope<br />
nach Art. 13d Abs. 1 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), nachfolgend bezeichnet<br />
als 13d-Biotope. Beispiele solcher Waldbiotope s<strong>in</strong>d die Moor-, Bruch-, Sumpf- <strong>und</strong><br />
Auwälder oder Wälder trockenwarmer Standorte, Schluchtwälder, Block- <strong>und</strong> Hangschuttwälder.<br />
55
56<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Rechtslage<br />
13d-Biotope s<strong>in</strong>d kraft Gesetzes geschützt. <strong>Die</strong> Schutzbestimmungen gelten unabhängig davon,<br />
ob das 13d-Biotop durch die zuständige Behörde registriert <strong>und</strong> ihr Rechtsstatus dem Eigentümer<br />
bekannt gemacht worden ist.<br />
<strong>Die</strong> bisherige forstliche Bewirtschaftung war <strong>in</strong> vielen Fällen der Garant für den Erhalt des<br />
Biotops als Waldstandort. In den meisten Fällen können daher diese Biotope im vollen Umfang<br />
forstlich bewirtschaftet werden. Unzulässig s<strong>in</strong>d lediglich jene Maßnahmen, die zu e<strong>in</strong>er Zerstörung<br />
oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Bee<strong>in</strong>trächtigung des aktuellen Zustandes<br />
führen können.<br />
Naturwaldreservate - kle<strong>in</strong>e "Urwälder" <strong>in</strong> Bayern<br />
Naturwaldreservate s<strong>in</strong>d Wälder, die sich noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weitgehend naturnahen Zustand bef<strong>in</strong>den<br />
oder <strong>in</strong> diesen überführt werden sollen. In den Naturwaldreservaten läuft die natürliche<br />
Waldentwicklung ungestört ab. Es wird – mit Ausnahme von dr<strong>in</strong>gendem Waldschutz <strong>und</strong><br />
Verkehrssicherung - ke<strong>in</strong> Holz genutzt. Im Lauf der Zeit entstehen urwaldähnliche Wälder mit<br />
starken Bäumen <strong>und</strong> viel Totholz. Auch <strong>in</strong> Bayern f<strong>in</strong>den sich noch urwaldähnliche Wälder,<br />
die die Bayerische Forstverwaltung als Naturwaldreservate e<strong>in</strong>richtet.<br />
Wissenschaftler erforschen <strong>in</strong> den Naturwaldreservaten den Kreislauf von Wachsen, Vergehen<br />
<strong>und</strong> Erneuern der Wälder. <strong>Die</strong> Daten liefern wichtige Erkenntnisse für Förster <strong>und</strong> Waldbesitzer,<br />
wie sie ihre Wälder naturnah bewirtschaften können. Gerade <strong>in</strong> Zeiten des Klimawandels<br />
s<strong>in</strong>d diese H<strong>in</strong>weise wichtig, damit auch <strong>in</strong> Zukunft ges<strong>und</strong>e <strong>und</strong> stabile Wälder <strong>in</strong> Bayern<br />
wachsen werden.<br />
In den Naturwaldreservaten bleibt der weitgehend naturnahe Zustand der Wälder mit ihren<br />
typischen Tieren, Pflanzen <strong>und</strong> Pilzen erhalten <strong>und</strong> sie können sich dort auch <strong>in</strong> Zukunft ungestört<br />
weiterentwickeln. Vorteil: <strong>Die</strong> natürlich vorkommenden <strong>und</strong> oft seltenen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />
<strong>in</strong> den Naturwaldreservaten wandern <strong>in</strong> benachbarte Flächen aus <strong>und</strong> besiedeln so<br />
auch die umliegenden Wälder.<br />
Auf e<strong>in</strong>en Blick<br />
<strong>Die</strong> ersten Naturwaldreservate wurden <strong>in</strong> Bayern im Jahr 1978 e<strong>in</strong>gerichtet.<br />
Bayern hat <strong>in</strong>sgesamt 156 Naturwaldreservate auf r<strong>und</strong> 6 800 Hektar, davon<br />
im Staatswald: 152,<br />
im Kommunalwald: 2<br />
im Kommunal- <strong>und</strong> Staatswald: 1<br />
im Privatwald: 1<br />
<strong>Die</strong> Durchschnittsgröße e<strong>in</strong>es Naturwaldreservats <strong>in</strong> Bayern beträgt 44 Hektar.<br />
In <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> gibt es derzeit drei Naturwaldreservate:<br />
o Naturwaldreservat Schwe<strong>in</strong>sdorfer Rangen (36,2 ha Staatswald)<br />
Buchen-Eichenwald auf der Steilstufe der Frankenhöhe<br />
o Naturwaldreservat Höllgraben (24,7 ha Staatswald)<br />
Buchen-Eichen-Ha<strong>in</strong>buchen-Wald der Frankenhöhe<br />
o Naturwaldreservat Schelm (17,5 ha Staatswald)<br />
Artenreicher Laubmischwald am Rande der Frankenhöhe
Natura 2000<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Was bedeutet Natura 2000?<br />
Natura 2000 ist e<strong>in</strong> europäisches Biotopverb<strong>und</strong>-Netz, das sich aus den Fauna-Flora-Habitat-<br />
(FFH) <strong>und</strong> den Vogelschutz- (SPA) Gebieten zusammensetzt. Hauptziel dieser Europäischen<br />
Naturschutzrichtl<strong>in</strong>ie ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt <strong>in</strong> Europa. Bestimmte Lebensraumtypen<br />
<strong>und</strong> Arten <strong>in</strong> diesen Gebieten sollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em günstigen Zustand erhalten oder dieser,<br />
wenn nötig, wiederhergestellt werden.<br />
Bayern hat <strong>in</strong>sgesamt 744 Gebiete mit zusammen r<strong>und</strong> 797.000 ha für das europäische Netz<br />
Natura 2000 gemeldet. Dabei fallen 449.000 ha auf den Wald bzw. 18% der bayerischen Waldfläche.<br />
<strong>Die</strong>se verteilen sich <strong>in</strong> etwa auf 240.000 ha (53 %) Staatswald, 111.000 ha (25 %) Privatwald,<br />
60.000 ha (13 %) Körperschaftswald sowie 26.000 ha (6 %) B<strong>und</strong>eswald. <strong>Die</strong>s verdeutlicht<br />
die hohe Naturschutzqualität der bayerischen Wälder. H<strong>in</strong>zu kommen noch r<strong>und</strong><br />
34.000 ha Offenland im Besitz des Freistaates (überwiegend Moore, Wiesen <strong>und</strong> Felsregionen<br />
im Gebirge).<br />
Tabelle 23: Liste der Natura 2000 Gebiete <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong>.<br />
Gebiets-Nr. LKR Name des Fauna-Flora-Habitatgebiets (FFH)<br />
6428-302 NEA/AN Mausohrkolonien <strong>in</strong> Steigerwald, Frankenhöhe <strong>und</strong> W<strong>in</strong>dsheimer Bucht<br />
6527-371 AN Endseer Berg<br />
6527-372 AN/NEA Naturwaldreservate der Frankenhöhe<br />
6528-371 NEA/AN Anstieg der Frankenhöhe östl. der A 7<br />
6627-301 AN Hutungen der Frankenhöhe<br />
6627-371 AN Taubertal nördlich Rothenburg <strong>und</strong> Ste<strong>in</strong>bachtal<br />
6628-371 AN Hutungen am Rother Berg <strong>und</strong> um Lehrberg<br />
6628-372 AN Kammmolch-Habitate um Eichelberg <strong>und</strong> Fichtholz bei Colmberg<br />
6628-373 AN Tierweiher bei H<strong>in</strong>terholz <strong>und</strong> Weiher am Aubühl<br />
6629-371 AN Sonnensee <strong>und</strong> Birkenfelser Forst<br />
6630-301 AN/FÜ Bibert <strong>und</strong> Haselbach<br />
6727-371 AN Klosterberg <strong>und</strong> Gailnauer Berg<br />
6829-371 AN Feuchtgebiete im südlichen Mittelfränkischen Becken<br />
6830-371 AN/WUG Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau <strong>und</strong> Wiesmet<br />
6832-371 AN/RH/WUG Gewässerverb<strong>und</strong> Schwäbische <strong>und</strong> Fränkische Rezat<br />
6929-371 AN Hesselberg<br />
7029-371 DON/AN Wörnitztal<br />
Gebiets-Nr. LKR Name des Vogelschutzgebiets (SPA)<br />
6627-471 AN Taubertal <strong>in</strong> Mittelfranken<br />
6728-471 AN/WUG Altmühltal mit Brunst-Schwaigau <strong>und</strong> Altmühlsee<br />
7130-471 DON/AN Nördl<strong>in</strong>ger Ries <strong>und</strong> Wörnitztal<br />
<strong>Die</strong> Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten Anhang II der FFH-Richtl<strong>in</strong>ie <strong>und</strong> nach Anhang I der Vogelschutz-<br />
Richl<strong>in</strong>ie (VS-RL) f<strong>in</strong>den sie auf der Homepage des Bayerischen <strong>Land</strong>esamts für Umwelt<br />
(www.lfu.bayern.de).<br />
57
58<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Gebietsmanagement im Wald<br />
Zum Gebietsmanagement gehören die Erstellung <strong>und</strong> Umsetzung von Managementplänen, das<br />
Monitor<strong>in</strong>g des Erhaltungszustands, e<strong>in</strong>e Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnahmen<br />
sowie regelmäßige Berichtspflichten an die EU.<br />
Forst- <strong>und</strong> Naturschutzbehörden teilen sich diese Aufgaben: Im Wald s<strong>in</strong>d die Forstbehörden<br />
zuständig, im Benehmen mit den Naturschutzbehörden. Im Offenland (unbewaldete Flächen)<br />
s<strong>in</strong>d die Naturschutzbehörden zuständig.<br />
<strong>Die</strong> Abteilung F3 am AELF <strong>Ansbach</strong> mit <strong>Die</strong>nstsitz <strong>in</strong> D<strong>in</strong>kelsbühl nimmt die Natura 2000<br />
betreffenden Aufgaben für Mittelfranken wahr. Das Regionale Kartierteam des Amtes nimmt<br />
Vor-Ort alle notwendigen Daten auf <strong>und</strong> fertigt die Managementpläne für ganz Mittelfranken.<br />
Mite<strong>in</strong>ander planen<br />
Um die Belange von <strong>Forstwirtschaft</strong> <strong>und</strong> Naturschutz optimal mite<strong>in</strong>ander zu vere<strong>in</strong>baren,<br />
werden die Managementpläne <strong>und</strong> ihre Umsetzung von allen Beteiligten an R<strong>und</strong>en Tischen<br />
"auf gleicher Augenhöhe" diskutiert.<br />
Innerhalb e<strong>in</strong>es Handlungsrahmens, der zum Schutz <strong>und</strong> Erhalt der Arten <strong>und</strong> Lebensräume<br />
erforderlich ist, soll der Eigentümer zukünftig auch im Natura 2000-Gebiet möglichst frei wirtschaften<br />
können. <strong>Die</strong>s ist meist auch ohne Interessenskonflikte möglich - denn Waldnutzung<br />
<strong>und</strong> Naturschutz s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Bayern ke<strong>in</strong> Widerspruch, sondern zwei Seiten e<strong>in</strong> <strong>und</strong> derselben Medaille.<br />
<strong>Die</strong> biologische Vielfalt im Wirtschaftswald hängt vor allem davon ab, <strong>in</strong>wieweit die folgenden<br />
Punkte erfüllt s<strong>in</strong>d:<br />
- Naturnähe der Baumartenzusammensetzung<br />
- Nischenvielfalt, Schlüsselstrukturen<br />
- Biotoptradition / Habitatkont<strong>in</strong>uität<br />
Für e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte, naturnahe Waldbewirtschaftung im Klimawandel s<strong>in</strong>d Konzepte<br />
notwendig, die sich an Indikatoren der biologischen Vielfalt orientieren, um so, je nach Ausgangsbed<strong>in</strong>gungen,<br />
unterschiedlich dimensionierte, räumliche ökologische Nischen zu schaffen.<br />
Dafür werden Datengr<strong>und</strong>lagen benötigt, um Elemente der natürlichen <strong>Land</strong>schaft wie<br />
Alterungsprozesse <strong>und</strong> Dynamik, Totholz <strong>und</strong> Biotopbäume <strong>in</strong> die forstliche Planung zu <strong>in</strong>tegrieren,<br />
damit die charakteristischen Arten <strong>und</strong> Lebensräume <strong>in</strong> Mitteleuropas Wäldern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
günstigen Zustand erhalten werden können.<br />
Nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Anteil der heimischen Arten ist so stark an Urwald-ähnliche Bestandsstrukturen<br />
angepasst, dass sie nur über e<strong>in</strong> ausreichendes Flächennetz <strong>und</strong> über Korridore<br />
unbewirtschafteter Wälder (z.B. <strong>in</strong> Nationalparken, Biosphärenreservaten <strong>und</strong> Naturwaldreservaten)<br />
erhalten werden <strong>und</strong> klimawandelbed<strong>in</strong>gte Arealverschiebungen stattf<strong>in</strong>den können.
5. Erneuerbare Energien<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
<strong>Die</strong> wesentlichen Vorteile der Energieerzeugung aus Holz s<strong>in</strong>d:<br />
- Nachwachsender Rohstoff<br />
- Regionale Wertschöpfung<br />
- Sichere Bereitstellung<br />
- Beitrag zur energetischen Selbstversorgung<br />
- M<strong>in</strong>derung von Gefahren für die Umwelt<br />
- Emissionsarme Verbrennung<br />
- ausgeglichener CO2-Haushalt<br />
Durch gestiegene Öl- <strong>und</strong> Gaspreise ist der Markt um die regenerativen Energien <strong>in</strong> Bewegung<br />
gekommen. Positive Effekte s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e verbesserte Abnehmersituation, gestiegene Preise <strong>und</strong><br />
neue Technologien im Heizungssektor.<br />
5.1 Scheitholz<br />
- Meist wird Laubholz e<strong>in</strong> höherer Heizwert zugeordnet als Nadelholz. <strong>Die</strong>s ist allerd<strong>in</strong>gs<br />
e<strong>in</strong>e Frage der E<strong>in</strong>heit. So hat das Laubholz e<strong>in</strong>en höheren Heizwert wenn dieser auf das<br />
Volumen bezogen wird (E<strong>in</strong>heit: [kWh/m³]), während das Nadelholz aufgr<strong>und</strong> der Inhaltstoffe<br />
e<strong>in</strong>en etwas höheren Heizwert besitzt, wenn die Angabe auf die Masse bezogen<br />
(E<strong>in</strong>heit [kWh/kg]) wird.<br />
- In der Praxis bedeutet dies für das Betreiben e<strong>in</strong>er Kle<strong>in</strong>feuerungsanlage, dass man, um die<br />
gleiche Wärmeleistung zu erreichen, mit Laubholz weniger oft nachlegen muss <strong>und</strong> dabei<br />
schwerer trägt.<br />
- Der Heizwert von Holz ist jedoch im Wesentlichen abhängig vom Wassergehalt.<br />
- Wassergehalt ist nicht gleich Holzfeuchte!<br />
- Bei frisch geschlagenem Holz ist <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong> Wassergehalt von 50 - 60% anzusetzen.<br />
- Für die Feuerung mit Scheitholz sollte e<strong>in</strong> Wassergehalt von maximal 20% erreicht werden.<br />
Mit zunehmendem Wassergehalt s<strong>in</strong>kt der Heizwert deutlich ab. Gleichzeitig steigen<br />
bei der Verwendung von nassem Holz die Emissionen sowie die Ablagerungen im Ofen<br />
an.<br />
- Sofern dies möglich ist, sollte der Tagesbedarf an Scheitholz (Wassergehalt unter 20 %) <strong>in</strong><br />
beheizten Räumen vorgewärmt <strong>und</strong> noch weiter herunter getrocknet werden.<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> nutzen r<strong>und</strong> 17 % der Privathaushalte zur Wärmeenergieversorgung<br />
e<strong>in</strong>e Scheitholzheizung. In der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> dürfte dieser Anteil ger<strong>in</strong>ger se<strong>in</strong> <strong>und</strong> bei 10 %<br />
liegen.<br />
5.2 Pellets<br />
Merkmale von Pellets:<br />
- gepresste Hobel- <strong>und</strong> Sägespäne<br />
- Durchmesser 4 – 10 mm ( 6 mm)<br />
- Länge < 50 mm<br />
- Heizwert 4,9 kWh/kg<br />
- Wassergehalt bis max. 12%<br />
- Aschegehalt < 1,5 % (0,5 %)<br />
- Schüttdichte 650 kg / m³<br />
- Rohdichte ca. 1,2 kg / dm³<br />
59
60<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
- Klassifizierung: DIN 51731 oder ÖNORM M 7135 (werden abgelöst durch prCEN/TS<br />
14961, vorläufige Euronorm)<br />
- Nur etwa 5% des Energiegehalts von Pellets werden durch Produktion <strong>und</strong> Transport verbraucht<br />
- Bei schlecht ablaufender Verfeuerung können auch höhere Ascherückstände verbleiben.<br />
- <strong>Die</strong> Pellets werden <strong>in</strong> der Regel ohne die Zugabe von B<strong>in</strong>demitteln usw., sondern lediglich<br />
mittels Hochdruck erstellt.<br />
- Aufgr<strong>und</strong> ihrer hohen (Energie-)Dichte benötigen Pellets nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ges Lagervolumen<br />
- E<strong>in</strong>e Pellets-Zentralheizung ist bequem wie e<strong>in</strong>e konventionelle Ölheizung. <strong>Die</strong><br />
Anlieferung erfolgt per Tankwagen (lose Ware; Pellets werden <strong>in</strong>s Lager e<strong>in</strong>geblasen)<br />
oder <strong>in</strong> Säcken (Sackware zu 15, 25 bis zu 1.000 kg (big bags))<br />
- 2 Tonnen bzw. 3 m³ Pellets ersetzen 1.000 Liter bzw. 1 m³ Heizöl<br />
(1l Heizöl = 2kg Pellets = 3l Pellets)<br />
- Industriepellets enthalten <strong>in</strong> der Regel R<strong>in</strong>denanteile <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d nicht mit DIN-Norm-Pellets<br />
vergleich bar. Sie eignen sich nicht zum E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Pelletöfen <strong>und</strong> -zentralheizungskesseln.<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> nutzt r<strong>und</strong> 1 % der Privathaushalte zur Wärmeenergieversorgung e<strong>in</strong>e<br />
Pelletheizung. In der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> dürfte dieser Anteil höher se<strong>in</strong> <strong>und</strong> bei 5 % liegen.<br />
5.3 Hackschnitzel<br />
- Gehackt werden können theoretisch sämtliche Sortimente, Kronenholz sowie dürres, faules<br />
oder krummes Holz.<br />
- <strong>Die</strong> Produktion von Waldhackschnitzeln ermöglicht die kostenneutrale (im Idealfall auch<br />
mit positivem Deckungsbeitrag) Durchführung von Waldschutzmaßnahmen bei Käferkalamitäten<br />
durch die Beseitigung von Brutnestern/-material.<br />
- Nach Möglichkeit sollte das Hackholz vorgetrocknet werden um den Wassergehalt bereits<br />
vor dem Hacken zu reduzieren. <strong>Die</strong>s beugt Fäule- <strong>und</strong> Schimmelbildung, <strong>und</strong> damit Substanzverlust,<br />
vor.<br />
- <strong>Die</strong> Vortrocknung auf e<strong>in</strong>em geeigneten Lagerplatz für nur wenige Monate kann den Wassergehalt<br />
auf 30 % senken (Grenze des Pilzwachstums).<br />
- Gute Lagerplätze s<strong>in</strong>d ordentlich durchlüftet, sonnig, waldnah (Achtung Borkenkäfer) <strong>und</strong><br />
ganzjährig anfahrbar.<br />
- Gr<strong>und</strong>sätzlich sollte die Lagerdauer von Hackschnitzeln möglichst kurz gehalten werden<br />
(Anhaltswert: drei Monate).<br />
- E<strong>in</strong>e schlechte Schnitzelqualität wirkt sich negativ auf die Lagerfähigkeit aus <strong>und</strong> begünstigt<br />
Schimmelbildung (Abbildung 27). Wichtig: Beseitigung von Brutmaterialien für Borkenkäfer<br />
hat Vorrang vor Produktion von hoher Hackschnitzelqualität (Waldschutz!).<br />
- Überlange Hackschnitzel können zu Problemen <strong>in</strong> der Zuförderung von Hackschnitzelheizungen<br />
führen.<br />
- Bei der Vollbaumnutzung bzw. der Aufarbeitung von Kronenmaterial werden dem Wald<br />
erheblich mehr Nährstoffe entzogen als bei der klassischen Stammholznutzung. Äste enthalten<br />
ca. die dreifache, Nadeln enthalten ca. die siebenfache Menge an Nährstoffen (N, P,<br />
K, Ca, Mg).
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abbildung 27: <strong>Die</strong> qualitätsbee<strong>in</strong>flussenden Kenngrößen bei Hackschnitzeln.<br />
Im <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> nutzt r<strong>und</strong> 1,5 % der Privathaushalte zur Wärmeenergieversorgung e<strong>in</strong>e<br />
Hackschnitzelheizung. In der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> dürfte dieser Anteil unter 0,5 % liegen.<br />
5.4 Biomasseheizwerke<br />
In <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> s<strong>in</strong>d ca. 20 Biomasseheiz(kraft)werke im Betrieb. <strong>Die</strong> ältesten<br />
s<strong>in</strong>d jetzt 10 Jahre alt. In Biomasseheizkraftwerken wird Strom (wird <strong>in</strong>s Netz gespeist) <strong>und</strong><br />
Wärme produziert. In Biomasseheizwerken wird nur heißes Wasser erzeugt <strong>und</strong> über Wärmenetze<br />
zum e<strong>in</strong>zelnen Verbraucher transportiert. Beim Endabnehmer steht nur e<strong>in</strong>e<br />
Übergabestation (Größe etwa 3 gestapelte Bierkästen) mit Zählwerk. <strong>Die</strong> Abrechnung erfolgt<br />
nach der Zähler-ablesung entsprechend den verbrauchten Wärmee<strong>in</strong>heiten. <strong>Die</strong> Struktur der<br />
Heiz(kraft)werke ist sehr unterschiedlich. Eigentümer s<strong>in</strong>d Personengeme<strong>in</strong>schaften (Privat<br />
<strong>und</strong> Genossenschaften), Kommunen <strong>und</strong> der Bezirk Mittelfranken. <strong>Die</strong> Dimension reicht von<br />
150 Kilowatt bis <strong>in</strong> den Megawattbereich. Wärmenetze werden oft von e<strong>in</strong>er Biogasanlage <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>er Hackschnitzelheizanlage geme<strong>in</strong>sam gespeist.<br />
5.5 Energieholzpotential aus dem Wald<br />
Aufgr<strong>und</strong> des stetig wachsenden Interesses an Waldholz als regenerativer Energieträger stellt<br />
sich die Frage nach dem verfügbaren Potential an Energieholz aus unseren Wäldern. <strong>Die</strong> bislang<br />
vorgelegten Potentialstudien zeigen das künftige Aufkommen an Energieholz meist auf<br />
Ebene des B<strong>und</strong>es oder der Länder. Bei näherer Betrachtung stellt man allerd<strong>in</strong>gs fest, dass die<br />
räumliche Verteilung der Energieholzressourcen starken Schwankungen unterliegt. Dadurch<br />
kann mit diesen Studien nicht gezeigt werden ob, wo <strong>und</strong> wie viel Energieholz bereitgestellt<br />
<strong>und</strong> ob Energieholzreserven mobilisiert werden können.<br />
Welches Potential ist geme<strong>in</strong>t?<br />
61
62<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Spricht man über e<strong>in</strong> Potential, so muss zunächst def<strong>in</strong>iert werden, um welches Potential es<br />
sich handelt:<br />
Im theoretischen Potential s<strong>in</strong>d sämtliche Holzbestandteile enthalten, unabhängig davon,<br />
ob sie tatsächlich nutzbar s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> solches Potential kann beispielsweise aus der B<strong>und</strong>eswald<strong>in</strong>ventur<br />
(BWI) abgeleitet werden.<br />
Das technische Potential ist die Teilmenge des theoretischen Potentials, die aufgr<strong>und</strong> technischer<br />
E<strong>in</strong>schränkungen tatsächlich nutzbar ist.<br />
Das wirtschaftliche Potential ist die Teilmenge des technischen Potentials, die unter heutigen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen wirtschaftlich nutzbar ist. Es be<strong>in</strong>haltet auch sozioökonomische E<strong>in</strong>flüsse<br />
auf das Energieholzpotential, beispielsweise die Waldbesitzverhältnisse.<br />
Das ökologische Potential ist ke<strong>in</strong>er der bisherigen Potentialarten e<strong>in</strong>deutig zuzuordnen.<br />
Es ergibt sich aus dem E<strong>in</strong>fluss ökologischer Restriktionen sowohl auf das technische als<br />
auch auf das wirtschaftliche Potential. Hierbei spielen nicht nur re<strong>in</strong> ökologische Gesichtspunkte,<br />
sondern auch politische Entscheidungen e<strong>in</strong>e gewichtige Rolle.<br />
Nach Abgleich dieser Varianten kann für <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong> <strong>Ansbach</strong> e<strong>in</strong> Waldenergieholzpotential<br />
von etwa 200.000 Fm je Jahr abgeschätzt werden. Damit könnten jährlich r<strong>und</strong><br />
40 Mio. Liter Heizöl ersetzt werden! Dabei wirken sich zwei Faktoren wesentlich auf die Realisierung<br />
dieses Potentials aus:<br />
Markt- <strong>und</strong> Preisentwicklung des Industrieholzes, das zum Energieholz <strong>in</strong> Konkurrenz<br />
steht <strong>und</strong><br />
etwa 70 % dieses Energieholzes wächst im Kle<strong>in</strong>privatwald. <strong>Die</strong> Aktivierung dieses<br />
Potentials bedarf erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten.<br />
Aus diesen Gründen wird das Waldenergieholzpotential <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> derzeit<br />
nicht ausgeschöpft.<br />
5.6 Energiewald als Kurzumtriebskultur<br />
Haben Sie e<strong>in</strong>e Ölquelle <strong>in</strong> Ihrem Acker?<br />
<strong>Die</strong> fossilen Energieträger werden immer knapper <strong>und</strong> teurer. S<strong>in</strong>nvoll ist natürlich - soweit es<br />
geht - Energie zu sparen <strong>und</strong> die benötigte Energie umweltfre<strong>und</strong>lich zu erzeugen. Dazu ist<br />
e<strong>in</strong>e Möglichkeit: der Energiewald! Energie aus umgerechnet ca. 4000 Liter Heizöl kann man<br />
bei unseren Verhältnissen von e<strong>in</strong>em Energiewald (Kurzumtriebskultur) pro Jahr auf e<strong>in</strong>em<br />
Hektar ernten.<br />
Erlaubnis<br />
Vor Anlage e<strong>in</strong>er Kurzumtriebskultur ist e<strong>in</strong>e Erstaufforstungserlaubnis notwendig. Bitte <strong>in</strong>formieren<br />
Sie sich beim zuständigen Revierleiter ihres AELF. Allerd<strong>in</strong>gs entsteht rechtlich<br />
ke<strong>in</strong> Wald <strong>und</strong> daher kann man jederzeit - ohne Rodungserlaubnis - den Energiewald wieder<br />
beseitigen.<br />
Baumarten<br />
Man verwendet züchterisch bearbeitete Baumarten (Balsampappel, Weide, Aspe) mit sehr raschem<br />
Jugendwachstum <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er hohen Wiederausschlagfähigkeit. Nach e<strong>in</strong>maligem Begründen<br />
des Bestandes wird dann ohne jede Düngung <strong>und</strong> ohne weitere Pflanzenschutzmaß-
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
nahmen mehrmals geerntet, auf guten landwirtschaftlichen Böden nach e<strong>in</strong>er Umtriebszeit von<br />
jeweils 3 bis 6 Jahren.<br />
Anlage<br />
Je nach Vorfrucht kann e<strong>in</strong>e Behandlung mit e<strong>in</strong>em Totalherbizid notwendig se<strong>in</strong>. Im Herbst<br />
tief pflügen; nach der Frostgare im Frühjahr eggen. Es werden ca. 5000 bis 6000 Steckl<strong>in</strong>ge<br />
pro Hektar <strong>in</strong> Reihenabständen von ungefähr 2m mit Hand oder Masch<strong>in</strong>e ausgebracht. S<strong>in</strong>nvoll<br />
ist die Behandlung mit e<strong>in</strong>em Vorauflaufmittel. <strong>Die</strong> Kontrolle auf Mäuse <strong>und</strong> Wildverbiss<br />
ist das erste halbe Jahr notwendig. Auch kann Ausgrasen notwendig se<strong>in</strong>, denn die ersten Triebe<br />
s<strong>in</strong>d empf<strong>in</strong>dlich gegen Seitendruck des Unkrautes (wie Mais).<br />
Wachstum<br />
<strong>Die</strong> Kultur wächst dann zwischen 3 bis 6 Jahre, je nachdem welche Erntetechnik angestrebt<br />
wird.<br />
Ernte<br />
<strong>Die</strong> Ernte im W<strong>in</strong>ter kann mit der Motorsäge oder mit e<strong>in</strong>em Gehölzmähhäcksler erfolgen. Das<br />
Erntegut hat e<strong>in</strong>en Feuchtigkeitsgehalt von ungefähr 50 %. Daher müssen die Hackschnitzel<br />
vor dem Verheizen getrocknet werden.<br />
Ökologische Vorteile<br />
Im Vergleich zu e<strong>in</strong>em Acker hat die Kurzumtriebskultur e<strong>in</strong>e höhere Artenvielfalt <strong>in</strong> Fauna<br />
<strong>und</strong> Flora aufzuweisen. Im laufenden Betrieb erfolgen ke<strong>in</strong>e Dünger- <strong>und</strong> Spritzmittelgaben.<br />
Durch die Dauerbestockung entsteht e<strong>in</strong> hoher Boden- <strong>und</strong> Erosionsschutz. E<strong>in</strong>e deutlich niedrigere<br />
Nitratkonzentration im Gr<strong>und</strong>wasser bestätigt dies.<br />
Ertrag<br />
In nordbayerischen Versuchsflächen der <strong>Land</strong>esanstalt für Wald <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong> wie auch<br />
<strong>in</strong> der Triesdorfer Versuchsfläche wurden ca. 10 Tonnen Trockensubstanz pro Hektar <strong>und</strong> Jahr<br />
erreicht. <strong>Die</strong>s entspricht ungefähr 4000 Liter Heizöläquivalent.<br />
Beratung<br />
Lassen Sie sich von unserem Ansprechpartner für Holzenergiefragen beraten.<br />
6. Holzwirtschaft<br />
6.1 Cluster Forst Holz Bayern<br />
<strong>Die</strong> Forst- <strong>und</strong> Holzwirtschaft ist wirtschafts- <strong>und</strong> gesellschaftspolitisch e<strong>in</strong>e der wichtigsten<br />
Branchen im Freistaat Bayern. Untersuchungen zufolge liegt der Umsatz des Sektors Forst <strong>und</strong><br />
Holz bei jährlich über 25 Milliarden Euro. Daneben bieten die im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich<br />
hohen Holzvorräte <strong>und</strong> Zuwächse, die moderne <strong>und</strong> <strong>in</strong>takte Infrastruktur, die leistungsfähigen<br />
Betriebe <strong>und</strong> der ausgezeichnete Ausbildungsstand der Beschäftigten sowie anerkannte Lehr-,<br />
Forschungs- <strong>und</strong> Prüfe<strong>in</strong>richtungen hervorragende Aussichten für weiteres Wachstum <strong>in</strong> der<br />
bayerischen Forst- <strong>und</strong> Holzwirtschaft.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> wurde der Sektor Forst <strong>und</strong> Holz unter Federführung des Bayerischen<br />
Staatsm<strong>in</strong>isteriums für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>in</strong> die Cluster-Politik der Bayerischen<br />
Staatsregierung (Allianz Bayern Innovativ) aufgenommen. Ziel ist e<strong>in</strong>e landesweite<br />
63
64<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Vernetzung der Potenziale aus Praxis <strong>und</strong> Wissenschaft <strong>in</strong> der Branche. <strong>Die</strong> Cluster-Initiative<br />
Forst <strong>und</strong> Holz versteht sich dabei als Impulsgeber e<strong>in</strong>es sich selbstorganisierenden <strong>und</strong> offenen<br />
Strukturprozesses.<br />
<strong>Die</strong> Forst-, Holz- <strong>und</strong> Papier<strong>in</strong>dustrie zählt schon heute zu den wichtigsten Arbeitgebern Bayerns<br />
– <strong>in</strong>sbesondere im ländlichen Raum. Über 200.000 Menschen, darunter 185.000 <strong>in</strong> sozialversicherungspflichtigen<br />
Arbeitsverhältnissen, s<strong>in</strong>d entlang der Wertschöpfungskette Holz beschäftigt.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Beschäftigtenzahl liegt der Sektor damit im verarbeitenden Gewerbe<br />
<strong>in</strong> Bayern an zweiter Stelle, gleich nach dem Masch<strong>in</strong>enbau <strong>und</strong> vor dem Fahrzeugbau.<br />
E<strong>in</strong>e Besonderheit des Sektors Forst–Holz–Papier liegt <strong>in</strong> der Vielzahl <strong>und</strong> Vielfalt der Akteure.<br />
Das weite Feld der Branchenteilnehmer umfasst die <strong>Forstwirtschaft</strong> (ca. 700.000 Waldbesitzer),<br />
die holzbe- <strong>und</strong> verarbeitende Industrie, die überwiegend <strong>in</strong>ternational agierende Zellstoff-<br />
<strong>und</strong> Papier<strong>in</strong>dustrie, das handwerkliche Holzgewerbe, sowie den Energieholzsektor,<br />
Druckereien, Verlage, den Handel <strong>und</strong> die Zulieferer. Alle<strong>in</strong> das Holzhandwerk (Zimmerer,<br />
Schre<strong>in</strong>er) umfasst über 10.000 überwiegend kle<strong>in</strong>- <strong>und</strong> mittelständisch geprägte Betriebe<br />
(Tabelle 24). Deshalb kommt der Vernetzung der E<strong>in</strong>zelakteure entlang der Wertschöpfungskette<br />
Holz <strong>und</strong> der verbesserten Kooperation von Ausbildung, Forschung <strong>und</strong> Praxis e<strong>in</strong>e besondere<br />
Bedeutung im Rahmen der Cluster-Arbeit zu.<br />
Tabelle 24: Überblick der <strong>in</strong> der Handwerkskammer e<strong>in</strong>getragenen Schre<strong>in</strong>erei- <strong>und</strong><br />
Zimmererbetriebe.<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong><br />
Schre<strong>in</strong>er 11 203<br />
Zimmerer 5 104<br />
6.2 Sägewerke<br />
Nach e<strong>in</strong>er eigenen Erhebung gibt es <strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>kreis <strong>Ansbach</strong> noch r<strong>und</strong> 30 aktive Sägewerke<br />
(Abbildung 28) welche ihren Rohstoff Rohholz überwiegend <strong>in</strong> der Region e<strong>in</strong>kaufen.<br />
Nicht erfasst werden konnten sehr kle<strong>in</strong>e Sägewerke welche nur gelegentlich nach Auftrag<br />
tätig werden sowie re<strong>in</strong>e Lohnschnittsäger.<br />
Abbildung 28: Anzahl der aktiven Sägewerke nach der überwiegend verarbeiteten Holzart.
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
<strong>Die</strong> strukturellen Veränderungen bei den Sägewerken s<strong>in</strong>d auch im <strong>Land</strong>kreis erkennbar<br />
(Abbildung 29). Der klassische kle<strong>in</strong>e Bauholzsäger wird – <strong>in</strong> Bezug auf den Anteil an der<br />
Gesamte<strong>in</strong>schnittmenge – stark verdrängt. E<strong>in</strong> Großteil ist nur mehr im Nebenerwerb tätig. So<br />
sägen ¾ der Betriebe r<strong>und</strong> 10 % der Gesamte<strong>in</strong>schnittmenge. <strong>Die</strong>se Betriebe s<strong>in</strong>d jedoch für<br />
unseren ländlichen Raum wichtige Arbeitgeber <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleister für die Waldbesitzer.<br />
Überdies bleibt die Wertschöpfung bei diesen regionalen Kreisläufen vor Ort erhalten.<br />
Abbildung 29: <strong>Die</strong> Sägewerke im Vergleich: Anzahl der Betriebe je Größenklasse <strong>und</strong><br />
Gesamte<strong>in</strong>schnitt je Klasse.<br />
7. Wertschöpfungspotential<br />
Für die Wertschöpfung im Privat- <strong>und</strong> Körperschaftswald bestehen ke<strong>in</strong>e f<strong>und</strong>ierten, regelmäßigen<br />
Erhebungen. Ausnahme ist das Testbetriebsnetz der <strong>Land</strong>esanstalt für Wald <strong>und</strong> <strong>Forstwirtschaft</strong><br />
(LWF) für ganz Bayern. <strong>Die</strong> Daten werden über freiwillig teilnehmende Betriebe<br />
erhoben <strong>und</strong> repräsentieren eher die großen, aktiven Betriebe. Nachfolgend wird für den Privatwald<br />
<strong>und</strong> den Körperschaftswald <strong>in</strong> unserem Amtsgebiet versucht die Wertschöpfung <strong>und</strong><br />
das mögliche Potential abzuschätzen. Für den Staatswald liegen durch die Bewirtschaftung des<br />
Forstbetriebs Rothenburg der Bayerischen Staatsforsten zwar exakte Zahlen vor, zur Vere<strong>in</strong>heitlichung<br />
wird hier jedoch ebenfalls nur durch Schätzung hochgerechnet.<br />
In dieser Abschätzung wurde nur das Hauptgeschäft der Forstbetriebe - Waldpflege <strong>und</strong> Holzernte<br />
- betrachtet. In der Regel stellt dieser Teil über 90 % des Umsatzes. E<strong>in</strong>nahmen aus Nebennutzung<br />
wie Jagd, Wildbeeren, Pilze, Christbaum- <strong>und</strong> Schmuckreisigverkauf könnten pauschal<br />
mit 5-10 % Aufschlag auf das Wertschöpfungspotential erfasst werden.<br />
Über den Zuwachs der e<strong>in</strong>zelnen Baumarten <strong>und</strong> deren Flächenanteile im Amtsgebiet kann,<br />
multipliziert mit der Waldfläche, auf e<strong>in</strong>en durchschnittlichen jährlichen Gesamtzuwachs<br />
65
66<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
hochgerechnet werden. Damit ergibt sich e<strong>in</strong>e theoretische, nachhaltige Obergrenze der jährlichen<br />
Nutzung (Tabelle 25):<br />
Tabelle 25: Theoretisch mögliche Holznutzung je Jahr <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> (<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>).<br />
Besitzart Efm je Jahr<br />
Kle<strong>in</strong>stprivatwald unter 2 ha 46.000<br />
Kle<strong>in</strong>privatwald 132.000<br />
Privatwald über 20 ha 161.000<br />
Körperschaftswald 52.000<br />
Staatswald 147.000<br />
Efm = Erntefestmeter, also die Holzmenge ohne Derbholz kle<strong>in</strong>er 7 cm Durchmesser <strong>und</strong> ohne R<strong>in</strong>de <strong>in</strong> m 3<br />
Nach Verteilung dieser Nutzungsmenge auf die drei Hauptprodukte Stammholz, Industrieholz<br />
<strong>und</strong> Brennholz <strong>und</strong> die Multiplikation mit jeweils e<strong>in</strong>em durchschnittlichen Erlös beim Holzverkauf<br />
ergibt sich folgende Wertschöpfung (Tabelle 26):<br />
Tabelle 26: Mögliche Erlöse aus Holzverkauf je Jahr <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> (<strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> <strong>Land</strong>) ohne<br />
Aufwendungen für Holzernte <strong>und</strong> notwendige Investitionen <strong>in</strong> Kulturen,<br />
Pflege sowie organisatorischer Aufwand/Verwaltungsaufwand.<br />
Efm Stammholz Industrieholz Brennholz Summe<br />
Menge Erlös Menge Erlös Menge Erlös<br />
Kle<strong>in</strong>stprivatwald 46.000 45% 50 € 5% 20 € 50% 35 € 2.093.000 €<br />
Privatwald 132.000 50% 60 € 8% 20 € 42% 35 € 6.112.000 €<br />
Großprivatwald 161.000 60% 70 € 15% 25 € 25% 40 € 8.010.000 €<br />
Körperschaftswald 51.000 70% 60 € 10% 25 € 20% 35 € 2.270.000 €<br />
Staatswald 147.000 60% 65 € 20% 25 € 20% 40 € 7.644.000 €<br />
Summe 537.000<br />
26.129.000 €<br />
Es ergibt sich e<strong>in</strong>e Wertschöpfung des Waldes <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> je Jahr von gut 26,5 Mio. Euro aus<br />
dem Holzverkauf. Dem steht e<strong>in</strong> Aufwand zur Holzernte (pauschal 18 € je Efm) von r<strong>und</strong><br />
9,6 Mio. Euro entgegen sowie nur schwer erfassbare Aufwendungen für Pflege, Kulturarbeiten,<br />
Waldschutz <strong>und</strong> Verwaltung. Unterstellt man hierfür Zahlen aus dem Testbetriebsnetz, so s<strong>in</strong>d<br />
r<strong>und</strong> 220 Euro je Hektar <strong>und</strong> Jahr für diese Positionen anzusetzen. <strong>Die</strong>s generiert e<strong>in</strong>en weiteren<br />
Aufwand von r<strong>und</strong> 12,5 Mio. Euro. Damit ergibt sich e<strong>in</strong> Gew<strong>in</strong>n von etwa 4,4 Mio. Euro<br />
je Jahr oder umgerechnet 77 Euro je Hektar <strong>und</strong> Jahr.<br />
<strong>Die</strong> Werte s<strong>in</strong>d als Größenordnungen e<strong>in</strong>es Wertschöpfungspotentiales anzusehen, da weder im<br />
Körperschaftswald, noch im Kle<strong>in</strong>stprivatwald oder Privatwald der Zuwachs voll ausgeschöpft<br />
wird. Deswegen dürfte die derzeitige Wertschöpfung unter dem errechneten Wert liegen!
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
VII. Amtsgliederung <strong>und</strong> Aufgaben der Sachgebiete<br />
1. <strong>Die</strong>nststellen<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
Rügländer Str. 1, 91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Tel. 0981 8908-0, Fax 0981 8908-199<br />
E-Mail: poststelle@alf-an.bayern.de<br />
Sachgebiete R<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Schwe<strong>in</strong>ezucht<br />
Kaltengreuther Str. 1, 91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Tel. 0981 4661468-0, Fax 0981 4661468-299<br />
Heilsbronn<br />
Bereich Forsten, Abteilung F1 <strong>und</strong> F2<br />
<strong>Ansbach</strong>er Str. 2, 91560 Heilsbronn<br />
Tel. 09872 9714-3, Fax 09872 9714-59<br />
D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
Bereich <strong>Land</strong>wirtschaft mit Hauswirtschaftsschule<br />
Luitpoldstr. 5 , 91550 D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
Tel. 09851 5777-0, Fax 09851 5777-50<br />
Bereich Forsten, Abteilung F3<br />
Luitpoldstraße 7, 91550 D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
Tel. 09851 5777-0, Fax 09851 5777-44<br />
Rothenburg<br />
Bereich <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
Industriestr. 4, 91541 Rothenburg<br />
Tel. 09861 9421-0, Fax 09861 9421-33<br />
67
68<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
2. Forstreviere
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
3. Aufgabenbereiche <strong>und</strong> Sachgebiete<br />
Bereich Ernährung <strong>und</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
Abteilung Sachgebiet mit Aufgaben<br />
Schule 3-semestrige Fachschule LW mit Meisterausbildung<br />
1 sem. Studiengang HW <strong>in</strong> Teilzeit <strong>in</strong> DKB <strong>und</strong> <strong>Ansbach</strong><br />
Erwachsenenbildung Bildungsprogramm <strong>Land</strong>wirt<br />
Lehrgänge<br />
Kurse<br />
Versammlungen<br />
Arbeitskreise<br />
Sem<strong>in</strong>are<br />
Abteilung L 1<br />
Förderung<br />
Abteilung L 2<br />
Beratung <strong>und</strong> Bildung<br />
Flächenprämien:<br />
Ausgleichszulage<br />
Betriebsprämie<br />
Eiweißpflanzenprämie<br />
Schalenfruchtprämie<br />
GAP-Reform 2005<br />
Betriebsprämienregelung<br />
Zahlungsansprüche<br />
Cross Compliance<br />
Milchreferenzmengenübertragung<br />
Agrarumweltmaßnahmen:<br />
KULAP-A<br />
VNP/EA (Erschwernisausgleich für Feuchtflächen)<br />
Sonstiges<br />
Vollzug der Klärschlamm-VO<br />
Pflanzenges<strong>und</strong>heitszeugnis bei Ausfuhrsendungen<br />
2.1 Pflanzenproduktion<br />
<strong>Land</strong>wirtschaftliche Aus- <strong>und</strong> Fortbildung., berufliche Weiterbildung<br />
Gesamtwirtschaftliche Beratung <strong>in</strong> Fragen der Unternehmensführung<br />
e<strong>in</strong>schließlich sozioökonomischer Fragen<br />
Beratung zur e<strong>in</strong>zelbetrieblichen Investitionsförderung <strong>und</strong> zu<br />
flächenbezogenen Förderprogrammen sowie zur E<strong>in</strong>haltung von<br />
Cross-Compliance-Bestimmungen<br />
Beratung zu e<strong>in</strong>er standort- <strong>und</strong> umweltgerechten, nachhaltigen<br />
<strong>und</strong> ressourcenschonenden <strong>Land</strong>bewirtschaftung<br />
Beratung e<strong>in</strong>er verbraucherorientierten Erzeugung von qualitativ<br />
hochwertigen Lebensmitteln<br />
produktionstechnische <strong>und</strong> betriebswirtschaftlicher Beratung im<br />
Verb<strong>und</strong> mit nichtstaatlichen Beratungsanbietern<br />
fachliche Betreuung des Personals nichtstaatlicher Beratungsanbieter<br />
im Rahmen e<strong>in</strong>es Beratungsverb<strong>und</strong>es<br />
Beratung zu wirtschaftlichen, tier- <strong>und</strong> umweltgerechten sowie<br />
landschaftsangepassten Bauweisen<br />
69
70<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abteilung Sachgebiet mit Aufgaben<br />
Beratung <strong>und</strong> Bildung<br />
Tierische Erzeugung<br />
R<strong>in</strong>der<br />
Beratung zur energetischen <strong>und</strong> stofflichen Verwertung nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Beratung zur Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen,<br />
zu <strong>Die</strong>nstleistungen sowie zur überbetrieblichen Zusammenarbeit<br />
fachliche Mitwirkung bei Stellungnahmen<br />
Mitwirkung beim Vollzug des Pflanzenschutz-, Düngemittel- <strong>und</strong><br />
Saatgutrechts, der Bioabfallverordnung <strong>und</strong> des Bodenschutzrechts<br />
Mitwirkung beim Vollzug der BayGAPV<br />
2.1 A Agrarökologie <strong>und</strong> Boden<br />
<strong>Land</strong>schaftspflege, Agrarökologie<br />
Bodenschutz <strong>und</strong> –verbesserung<br />
Gewässerschutz <strong>in</strong> der <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
Düngung <strong>und</strong> Reststoffverwertung<br />
Vollzug der Düngeverordnung<br />
Stellungnahmen zu agrarökologischen Belangen<br />
2.1 P Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Versuchswesen<br />
Beratungsgr<strong>und</strong>lagen für Pflanzenbau <strong>und</strong> Pflanzenschutz<br />
Saatguterzeugung, Saatenanerkennung <strong>und</strong> Verkehrskontrollen<br />
amtlicher Pflanzenschutzdienst<br />
Pflanzenschutz im Gartenbau<br />
Feldversuche<br />
Entwicklung der Vermarktung<br />
Beratung von<br />
Erzeugerr<strong>in</strong>gen<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaften<br />
2.2 Milchviehhaltung<br />
Unternehmensentwicklung von Milchviehbetrieben<br />
Herdenmanagement<br />
<strong>Land</strong>technik<br />
Bauen <strong>in</strong> der <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
Förderung <strong>und</strong> F<strong>in</strong>anzierung<br />
Qualitätsmilcherzeugung <strong>und</strong> Melktechnik<br />
Überbetriebliche Zusammenarbeit <strong>und</strong> Investitionen <strong>in</strong> der R<strong>in</strong>derhaltung<br />
Arbeitskreise Unternehmensentwicklung<br />
Sem<strong>in</strong>are: Herdenmanagement<br />
E<strong>in</strong>zelbetriebliche Förderabwicklung
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abteilung Sachgebiet mit Aufgaben<br />
Beratung <strong>und</strong> Bildung<br />
Tierische Erzeugung<br />
R<strong>in</strong>der<br />
Schwe<strong>in</strong>e<br />
Schafe<br />
Kle<strong>in</strong>tiere<br />
Pferde<br />
2.2 T R<strong>in</strong>derzucht<br />
R<strong>in</strong>derzucht<br />
Vermarktung von R<strong>in</strong>dern<br />
betriebliche Entwicklung von R<strong>in</strong>derzuchtbetrieben<br />
Milchleistungsprüfung<br />
Betreuung von<br />
Milcherzeugerr<strong>in</strong>g<br />
R<strong>in</strong>derzuchtverbänden<br />
Kälbererzeugergeme<strong>in</strong>schaft<br />
Qualitätssicherung <strong>und</strong> –management<br />
2.3 T Schwe<strong>in</strong>ezucht <strong>und</strong> –haltung<br />
Schwe<strong>in</strong>ezucht <strong>und</strong> Vermarktung<br />
nachhaltige Unternehmensentwicklung von Zucht- <strong>und</strong> Mastschwe<strong>in</strong>ebetrieben<br />
Vermarktung<br />
Fütterungs- <strong>und</strong> Haltungsmanagement<br />
Stallbau<br />
F<strong>in</strong>anzierung <strong>und</strong> Förderung<br />
Überbetriebliche Zusammenarbeit <strong>und</strong> Investitionen <strong>in</strong> der<br />
Schwe<strong>in</strong>ehaltung<br />
Qualitätssicherung <strong>und</strong> –management<br />
Betreuung Arbeitskreise Unternehmensentwicklung -<br />
Produktionsmanagement<br />
Beratung von<br />
Erzeugerzusammenschlüssen<br />
Fleischerzeugerr<strong>in</strong>g<br />
2.4 T Schafe <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>tiere<br />
Zucht <strong>und</strong> Haltung<br />
Beratung <strong>und</strong> Bildung:<br />
Unternehmensentwicklung Geflügel, Schafe, Ziegen ...<br />
Produktionstechnik Schafe, Ziegen<br />
Produktionsmanagement landwirtschaftliche Wildtierhaltung,<br />
Geflügel u. a.<br />
gesamtbetriebliche Beratung <strong>in</strong> den Fragen der Unternehmensführung<br />
e<strong>in</strong>schließlich sozioökonomischer Fragen<br />
Beratung zur e<strong>in</strong>zelbetrieblichen Investitionsförderung <strong>und</strong> zu<br />
flächenbezogenen Förderprogrammen sowie zur Erhaltung von<br />
Cross-Compliance- Bestimmungen<br />
Beratung zur Vermarktung von Produkten <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Beratung zu wirtschaftlichen, tier- <strong>und</strong> umweltgerechten sowie<br />
landwirtschaftlich angepassten Bauweisen<br />
Schaf- <strong>und</strong> Ziegenzucht<br />
Vollzug tierrechtlicher Vorschriften<br />
Überwachung Qualitäts- <strong>und</strong> Leistungsprüfungen<br />
71
72<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abteilung Sachgebiet mit Aufgaben<br />
Abteilung L 3<br />
Strukturentwicklung,<br />
Ernährung <strong>und</strong><br />
Haushaltsleistungen<br />
landwirtschaftliche Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, berufliche Weiterbildung<br />
Beratung von<br />
Zuchtverbänden<br />
Erzeugerzusammenschlüssen<br />
2.5 Pferdehaltung<br />
Unternehmensentwicklung <strong>und</strong> -führung<br />
Beratung beim Bau von Reitanlagen<br />
Beratung der regionalen Pferdesportverbände <strong>und</strong> deren Vere<strong>in</strong>e<br />
Förderung <strong>und</strong> F<strong>in</strong>anzierung<br />
Fachbeiträge zu Gutachten <strong>und</strong> Stellungnahmen<br />
Fachvorträge<br />
Vollzug der Berufsbildungsgesetzes<br />
Mitwirken bei der beruflichen Fortbildung sowie Erwachsenenbildung<br />
Mitwirken bei Ausstellungen <strong>und</strong> Leistungsprüfungen (Absatzförderung<br />
<strong>und</strong> Market<strong>in</strong>g)<br />
Fachberatung im Reit- <strong>und</strong> Fahrwesen sowie des Pferdeleistungsprüfungswesens<br />
Fachberatung <strong>und</strong> Auswertung von betrieblichen Aufzeichnungen<br />
3.1 Ländliche Strukturentwicklung<br />
Beratung <strong>und</strong> Bildung:<br />
Strukturentwicklung, Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>und</strong> Dorferneuerung<br />
E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Erwerbskomb<strong>in</strong>ation<br />
Market<strong>in</strong>g von Produkten <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Qualifizierung<br />
F<strong>in</strong>anz-, Investitionsplanung <strong>und</strong> –förderung<br />
Gutachten, Stellungnahmen, Planungspartner zur Regional- <strong>und</strong><br />
<strong>Land</strong>entwicklung<br />
Aufbau von horizontalen <strong>und</strong> vertikalen, strategischen Allianzen<br />
<strong>in</strong>tegrierte Entwicklung des ländlichen Raumes - Projektentwicklung<br />
<strong>und</strong> –umsetzung<br />
Qualitätssicherung<br />
E<strong>in</strong>zelbetriebliche Förderung - Koord<strong>in</strong>ation<br />
Diversifizierung – Koord<strong>in</strong>ation<br />
sozioökonomische Beratung<br />
3.2 Ernährung, Haushaltsleistungen <strong>und</strong> Bildung<br />
Beratung:<br />
zuständige Stelle für die Gr<strong>und</strong>bildung Hauswirtschaft<br />
Beratung <strong>und</strong> Betreuung von Auszubildenden<br />
Meistervorbereitung<br />
1-semestriger Studiengang<br />
Strukturentwicklung
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abteilung Sachgebiet mit Aufgaben<br />
Verwaltung<br />
<strong>und</strong><br />
Hoheitsaufgaben<br />
Bereich Forsten<br />
Abteilung F 1<br />
Erwerbskomb<strong>in</strong>ation <strong>und</strong> <strong>in</strong>novative E<strong>in</strong>kommensquellen<br />
Market<strong>in</strong>g von Produkten <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungen, Qualitätssicherung<br />
zeitgemäße Haushaltsführung<br />
umweltgerechtem Hausgartenbau<br />
Wohnen <strong>und</strong> Bauen<br />
3.4 Geme<strong>in</strong>schaftsverpflegung<br />
Vernetzung aller Akteure im Bereich der Geme<strong>in</strong>schaftsverpflegung<br />
Unterstützung von Betrieben bei der Umsetzung e<strong>in</strong>er ges<strong>und</strong>heitsfördernder<br />
Ernährung<br />
E<strong>in</strong>richten e<strong>in</strong>er Informationsplattform für Netzwerkpartner<br />
Betreuung von Modelprojekten<br />
Stellungnahmen <strong>und</strong> Gutachten<br />
Fachliche Planungen, Strukturmaßnahmen<br />
Nahrungssicherstellung – Ernährungsnotfallvorsorge<br />
Gesetzesvollzug, Fördervollzug<br />
Forsten 1<br />
Förderung <strong>und</strong> Beratung der Waldbesitzer<br />
Betriebsleitung <strong>und</strong> -ausführung <strong>in</strong> Körperschaftswäldern<br />
Schutz des Waldes vor Schäden<br />
Beratung der Forstzusammenschlüsse<br />
Qualitätssicherung <strong>und</strong> Fachvollzug der Förderung<br />
Fachvollzug Hoheitsaufgaben Natura 2000<br />
Beratung <strong>und</strong> forstfachliche Stellungnahmen im Jagdrecht<br />
Waldpädagogik <strong>und</strong> Bildung für Nachhaltige Entwicklung<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Regionale Zuständigkeit:<br />
Forstrevier Geme<strong>in</strong>de<br />
Lehrberg <strong>Ansbach</strong>, Flachslanden, Lehrberg, Oberdachstetten,<br />
Rügland, Sachsen bei <strong>Ansbach</strong><br />
Leutershausen Leutershausen<br />
Neuendettelsau Neuendettelsau<br />
Rothenburg o.d.T. Adelshofen, Buch am Wald, Colmberg,<br />
Gebsattel, Geslau, Neusitz, Ohrenbach, Rothenburg<br />
o.d.T., Ste<strong>in</strong>sfeld, W<strong>in</strong>delsbach<br />
Weihenzell Bruckberg, <strong>Die</strong>tenhofen, Heilsbronn, Petersaurach,<br />
Weihenzell<br />
Wettr<strong>in</strong>gen <strong>Die</strong>bach, Dombühl, Ins<strong>in</strong>gen, Schill<strong>in</strong>gsfürst,<br />
Schnelldorf, Wettr<strong>in</strong>gen, Wörnitz<br />
73
74<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Abteilung F2<br />
Abteilung F3<br />
Sonderaufgaben<br />
Forsten 2<br />
Förderung <strong>und</strong> Beratung der Waldbesitzer<br />
Betriebsleitung <strong>und</strong> -ausführung <strong>in</strong> Körperschaftswäldern<br />
Forstliche Fachplanung <strong>in</strong> Körperschaftswäldern<br />
Schutz des Waldes vor Schäden<br />
Fachvollzug des Waldgesetzes für Bayern (Hoheitsaufgaben)<br />
Forstfachliche Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange<br />
Waldpädagogik <strong>und</strong> Bildung für Nachhaltige Entwicklung<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Regionale Zuständigkeit:<br />
Forstrevier Geme<strong>in</strong>de<br />
Bechhofen Bechhofen, Burgoberbach, Burk,<br />
Merkendorf, Ornbau, Weidenbach, Wieseth,<br />
Wolframs-Eschenbach<br />
D<strong>in</strong>kelsbühl D<strong>in</strong>kelsbühl, Dürrwangen, Langfurth,<br />
Mönchsroth, Schopfloch, Weilt<strong>in</strong>gen,<br />
Wilburgstetten, Wittelshofen<br />
Eh<strong>in</strong>gen Arberg, Eh<strong>in</strong>gen, Gerolf<strong>in</strong>gen, Röck<strong>in</strong>gen,<br />
Unterschwan<strong>in</strong>gen, Wassertrüd<strong>in</strong>gen<br />
Feuchtwangen Aurach, Dentle<strong>in</strong> am Forst, Feuchtwangen<br />
Herrieden Herrieden<br />
W<strong>in</strong>dsbach Lichtenau, Mitteleschenbach,<br />
Neuendettelsau, W<strong>in</strong>dsbach<br />
Forsten 3<br />
Natura 2000<br />
o Erstellung der Managementpläne <strong>in</strong> den FFH-Gebieten <strong>in</strong> Mittelfranken<br />
o Koord<strong>in</strong>ation der Bearbeitung der SPA-Gebiete <strong>in</strong> Mittelfranken<br />
o Artmonitor<strong>in</strong>g<br />
o Fachberatung der Ämter<br />
o Öffentlichkeitsarbeit<br />
Forstliche Beratung des Naturparks Frankenhöhe<br />
Unterricht im Fach Waldwirtschaft der Lehranstalten <strong>in</strong> Triesdorf<br />
<strong>und</strong> <strong>Land</strong>wirtschaftschule <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong><br />
Holzenergie<br />
o Fachberatung<br />
o Öffentlichkeitsarbeit<br />
Waldfunktionsplanung<br />
Zuständigkeitsbereich Regierungsbezirk Mittelfranken<br />
<strong>Forstwirtschaft</strong>smeister<br />
Praktische <strong>und</strong> theoretische Schulungen für Waldbesitzer
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
4. Organisation <strong>und</strong> Zuständigkeit im Forst<br />
<strong>Die</strong> Bayerische Staatsregierung <strong>und</strong> der Bayerische <strong>Land</strong>tag haben im Jahr 2004 e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legende<br />
Reform der Bayerischen Staatsforstverwaltung beschlossen. Im Gegensatz zu den früheren<br />
Reformen, welche alle am Pr<strong>in</strong>zip der forstlichen E<strong>in</strong>heitsverwaltung festgehalten haben,<br />
wobei Staatswaldbewirtschaftung, Privatwaldberatung <strong>und</strong> Forstaufsicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Verwaltung<br />
zusammengefasst waren, hatte die Reform e<strong>in</strong>e strikte Trennung der Aufgaben im Staatswald<br />
<strong>und</strong> der im Privatwald <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>dewald zur Folge (Abbildung 30). Zusätzlich entfielen die<br />
forstlichen Mittelbehörden (Forstdirektionen) ersatzlos. Dazu waren die gesetzlichen Gr<strong>und</strong>lagen<br />
entsprechend zu ändern. Der Bayerische <strong>Land</strong>tag hat am 21. April 2005 das Gesetz zur<br />
Errichtung des Unternehmens „Bayerische Staatsforsten“ (Staatsforstengesetz) <strong>und</strong> das Gesetz<br />
zur Änderung des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) beschlossen (geändert nach<br />
Zerle/He<strong>in</strong> Forstrecht <strong>in</strong> Bayern, Feb. 2008).<br />
Abbildung 30: Organisation der Bayerischen Forstverwaltung.<br />
Für die Region <strong>Ansbach</strong> bedeutete dies die Auflösung der vier Forstämter D<strong>in</strong>kelsbühl,<br />
Feuchtwangen, Heilsbronn <strong>und</strong> Rothenburg o.d.T. der Bayerischen Staatsforstverwaltung. Sie<br />
wurden zum 01.07.2005 zusammengelegt zu der Unteren Forstbehörde der Bayerischen<br />
Forstverwaltung <strong>und</strong> mit der <strong>Land</strong>wirtschaftsverwaltung als Amt für <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong><br />
Forsten (ALF) mit Hauptsitz <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> neu aufgestellt. Zum 01.04.2009 wurde das ALF um<br />
den Bereich Ernährung / Geme<strong>in</strong>schaftsverpflegung erweitert <strong>und</strong> heißt aktuell<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten (AELF) <strong>Ansbach</strong>.<br />
<strong>Die</strong> bis 30.06.2005 bestehende, regional zuständige Forstdirektion Oberfranken-Mittelfranken<br />
der Bayerischen Staatsforstverwaltung wurde ersatzlos aufgelöst.<br />
<strong>Die</strong> Bewirtschaftung des Staatswaldes <strong>in</strong> der Region wurde zum 01.07.2005 dem<br />
Forstbetrieb Rothenburg o.d.T.<br />
des selbstständig agierenden Unternehmens Bayerischen Staatsforsten AöR mit Firmenzentrale<br />
<strong>in</strong> Regensburg übertragen.<br />
U<br />
75
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
VIII. Verbände <strong>und</strong> Selbsthilfeorganisationen<br />
Organisation Ansprechpartner,<br />
Anschrift<br />
Verbände<br />
Verbände für landwirtschaftliche<br />
Fachbildung im <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
- VLF <strong>Ansbach</strong><br />
- VLF D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
- VLF Rothenburg<br />
R<strong>in</strong>derzuchtverband Mittelfranken<br />
e. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong><br />
Züchtervere<strong>in</strong>igung für Zucht-<br />
<strong>und</strong> Hybridzuchtschwe<strong>in</strong>e <strong>in</strong><br />
Bayern w.V. (EGZH)<br />
Ziegenzuchtvere<strong>in</strong>igung<br />
Mittelfranken e. V.<br />
Berufsvertretung<br />
Bayerischer Bauernverband<br />
Körperschaft des öffentlichen<br />
Rechts<br />
Bayerischer Waldbesitzerverband<br />
e.V.<br />
Bayerischer Gr<strong>und</strong>besitzerverband<br />
e.V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaften<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaften Pflanzenbau<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Qualitätsgetreide<br />
Uffenheim-<br />
Rothenburg w. V.<br />
Geschäftsführer:<br />
Hartmut Schw<strong>in</strong>ghammer<br />
Industriestraße 4<br />
91541 Rothenburg o.d.T.<br />
Kaltengreuther Str. 1<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Geschäftsführung:<br />
Mart<strong>in</strong> König<br />
Haydnstrasse 11<br />
80336 München<br />
1. Vorstand:<br />
Johannes Maibom<br />
1. Vorsitzender:<br />
Ernst Kettemann<br />
H<strong>in</strong>terbreitenthann 2<br />
91555 Feuchtwangen<br />
Geschäftsführer:<br />
Ra<strong>in</strong>er Weiß<br />
Maximilianstraße 36<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Max-Joseph-Straße 9,<br />
Rgb./III<br />
80333 München<br />
Max-Joseph-Straße 9<br />
80333 München<br />
Vorsitzender:<br />
Erich Schirmer,<br />
Welbhausen,<br />
Uffenheim<br />
Kontakt<br />
Tel.: 09861/9421-12<br />
E-Mail: vlf-ansbach@web.de<br />
http://www.vlf-an.de<br />
Tel.: 0981/488420<br />
E-Mail: rzv-mittelfranken@web.de<br />
http://www.lbr.bayern.de/rzvmittelfranken/<br />
Tel.: 089/544141-0<br />
E-Mail: poststelle@egzh-bayern.de<br />
http://www.egzh.de<br />
Tel.: 09101/9772<br />
E-Mail: maibomfam1@aol.com<br />
Tel: 09852/1536<br />
E-Mail: ernst.kettemann@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Tel: 0981/97190-0<br />
E-Mail: <strong>Ansbach</strong><br />
@BayerischerBauernVerband.de<br />
Tel.: 089 580 30 80<br />
E-Mail: bayer.waldbesitzerverband@tonl<strong>in</strong>e.de<br />
www.bayer-waldbesitzerverband.de/<br />
Tel.: 089 55873263<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@bayern-gr<strong>und</strong>besitzer.de<br />
www.bayern-gr<strong>und</strong>besitzer.de<br />
Tel.: 09842/2327<br />
77
78<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Organisation Ansprechpartner,<br />
Anschrift<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Qualitätsgetreide<br />
<strong>Ansbach</strong> w. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Qualitätsgetreide<br />
Fürth u. U. w. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Qualitäts-Durumweizen<br />
Uffenheim u.<br />
U. w. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Qualitätsbraugerste<br />
Neustadt/Aisch-<br />
Bad W<strong>in</strong>dsheim w. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Qualitäts-Raps<br />
Mittelfranken w. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Veredelungskartoffeln<br />
Roth e. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft für Qualitätskartoffeln<br />
Fürth w. V.<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaft Bayern-<br />
Tabak w. V.<br />
Saatkartoffel-<br />
Erzeugervere<strong>in</strong>igung der Sandgebiete<br />
Mittelfranken e.V.<br />
Saatgetreide-<br />
Erzeugervere<strong>in</strong>igung Mittelfranken<br />
e.V.<br />
1. Vorstand:<br />
H. Täufer<br />
Petersaurach<br />
1. Vorstand:<br />
Johannes Strobl<br />
Greimersdorf<br />
Geschäftsführung:<br />
Thomas Zehnter<br />
Bayerischer Bauernverband<br />
Bischof-Meiser-Str. 8<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Geschäftsführung:<br />
Thomas Zehnter<br />
Bayerischer Bauernverband<br />
Bischof-Meiser-Str. 8<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Geschäftsführung:<br />
Thomas Zehnter<br />
Bayerischer Bauernverband<br />
Bischof-Meiser-Str. 8<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
1. Vorstand:<br />
Josef Böhm<br />
Muttenau<br />
1. Vorstand:<br />
Gerhard Tiefel<br />
Fürth<br />
Stellvertreter <strong>und</strong><br />
Geschäftsfürer MR Fürth:<br />
Ra<strong>in</strong>er Tiefel<br />
Geschäftsführung:<br />
Georg He<strong>in</strong>l<br />
Rohr-Kottensdorf<br />
1. Vorstand:<br />
Andreas Heyder<br />
Retzendorf<br />
1. Vorstand:<br />
Herbert Weiskopf<br />
Neudorf<br />
Kontakt<br />
Tel.: 09872/7242<br />
Tel.: 09103/453<br />
Tel.: 0981/97070-32<br />
E-Mail: mittelfranken<br />
@bayerischerbauernverband.de<br />
Tel.: 0981/97070-32<br />
E-Mail: mittelfranken<br />
@bayerischerbauernverband.de<br />
Tel.: 0981/97070-32<br />
E-Mail: mittelfranken<br />
@bayerischerbauernverband.de<br />
Tel.: 09085/695<br />
Tel.: 09127/951190 (Ra<strong>in</strong>er Tiefel)<br />
Tel.: 09122/630890<br />
Tel.: 09871/1521<br />
Tel.: 09824/921744
Organisation Ansprechpartner,<br />
Anschrift<br />
Erzeugergeme<strong>in</strong>schaften Tierhaltung<br />
Franken Vieh <strong>und</strong> Fleisch w.V. Geschäftsführung:<br />
Hans Wolf<br />
Herrieder Str. 101<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Geflügelerzeugergeme<strong>in</strong>schaft<br />
Franken e.V. (EZG)<br />
Erzeugerr<strong>in</strong>ge<br />
Erzeugerr<strong>in</strong>ge Mittelfranken e.V.<br />
- landw. pflanzliche Qualitätsprodukte<br />
- Qualitätskartoffeln<br />
- Saat- <strong>und</strong> Pflanzgut<br />
Erzeugerr<strong>in</strong>ge Tierhaltung<br />
- Milcherzeugerr<strong>in</strong>g<br />
- Fleischerzeugerr<strong>in</strong>g<br />
- Fischerzeugerrr<strong>in</strong>g<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Vorstand:<br />
Then <strong>Die</strong>ter<br />
Ma<strong>in</strong>bernheimer Str. 105<br />
97318 Kitz<strong>in</strong>gen<br />
Geschäftsführer:<br />
Jürgen Re<strong>in</strong>gruber<br />
Mariusstraße 27<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
R<strong>in</strong>gwart e Lkr. AN:<br />
Altlandkr. AN u. DKB:<br />
Gerhard L<strong>in</strong>k,<br />
Dürrenmungenau<br />
Fischhaus 9<br />
91183 Abenberg<br />
Altlandkr. ROT u. FEU:<br />
Georg Hörner<br />
Bößennördl<strong>in</strong>gen 6<br />
91637 Wörnitz<br />
Wolfgang Kreiselmeier<br />
Kaltengreutherstr. 1<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Milcherzeugerr<strong>in</strong>g Vorsitzender:<br />
<strong>Die</strong>ter Fragner<br />
Bretzenberg 25<br />
91555 Feuchtwangen<br />
Fleischerzeugerr<strong>in</strong>g Vorsitzender:<br />
Ewald Geißendörfer<br />
Kle<strong>in</strong>harbach 8<br />
97215 Uffenheim<br />
Fischerzeugerrr<strong>in</strong>g Mittelfranken<br />
e.V.<br />
Vorsitzender:<br />
Günter Gabsteiger, MdL<br />
(a.D.)<br />
Obere Leitenstraße 10<br />
90556 Cadolzburg<br />
Kontakt<br />
Tel.: 09825/942-0<br />
E-Mail: h.wolf@frankenvieh.de<br />
http://www.frankenvieh.de<br />
Tel.: 09321/33672<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@frankenei.de<br />
http://www.frankenei.de<br />
Tel.: 0981/4817700<br />
E-Mail: poststelle@er-mfr.de<br />
Tel.: 09873/355<br />
E-Mail: g_l<strong>in</strong>k@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Tel.: 09868/1542<br />
Tel.: 0981/85453<br />
E-Mail: wolfgang.kreiselmeier@aelfan.bayern.de<br />
Tel.: 09852/9693<br />
Tel.: 09865/9520<br />
Tel.: 09103/5722<br />
E-Mail: Gabsteiger@fischerzeugerr<strong>in</strong>gmittelfranken.de<br />
79
80<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
Organisation Ansprechpartner,<br />
Anschrift<br />
<strong>Forstwirtschaft</strong>liche Zusammenschlüsse<br />
<strong>Forstwirtschaft</strong>liche Vere<strong>in</strong>igung<br />
Mittelfranken<br />
Forstbetriebsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>Ansbach</strong>-<br />
Fürth e.V.<br />
Forstbetriebsgeme<strong>in</strong>schaft D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
Forstbetriebsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Feuchtwangen<br />
Forstbetriebsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Rothenburg o. d. Tauber<br />
Bayerische Staatsforsten<br />
Bayerische Staatsforsten AöR<br />
Forstbetrieb Rothenburg o.d.T.<br />
Genossenschaften<br />
Trocknungsgenossenschaft<br />
W<strong>in</strong>dsbach eG<br />
Masch<strong>in</strong>enr<strong>in</strong>ge<br />
Masch<strong>in</strong>enr<strong>in</strong>g <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong> GmbH<br />
Interessengeme<strong>in</strong>schaften<br />
Geschäftsstelle<br />
BBV-HGSt Mittelfranken<br />
Bischof-Meiser-Str. 8<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
<strong>Ansbach</strong>er Straße 12<br />
91629 Weihenzell<br />
Veitsweiler 23<br />
91744 Weilt<strong>in</strong>gen<br />
Zischendorf 9<br />
91555 Feuchtwangen<br />
Badergasse 1<br />
91608 Geslau<br />
Adam-Hörber-Straße 39<br />
91541 Rothenburg<br />
Fohlenhof 21<br />
91575 W<strong>in</strong>dsbach<br />
Geschäftsführer:<br />
Otmar Bögele<strong>in</strong><br />
Kaltengreuther Str. 1<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
Hauswirtschaftlicher Fachservice HWF <strong>Ansbach</strong><br />
1. Vorsitzende:<br />
Claudia Schuster<br />
Wiesethbruck 15<br />
91572 Bechhofen<br />
IG Gartenbäuer<strong>in</strong>nen im <strong>Land</strong>kreis<br />
<strong>Ansbach</strong><br />
Anita Nixel<br />
Kle<strong>in</strong>haslach 1a<br />
90599 <strong>Die</strong>tenhofen<br />
Christa Obergruber<br />
Bergstr. 6 - Großhaslach<br />
91580 Petersaurach<br />
Kontakt<br />
Tel.: 0981 9707014<br />
E-Mail:<br />
FVMittelfranken@BayerischerBauernv<br />
erband.de<br />
www.wald<strong>und</strong>holz-mittelfranken.de<br />
Tel.: 09802/957004<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@fbg-ansbach-fuerth.de<br />
www.fbg-ansbach-fuerth.de<br />
Tel.: 09853/227<br />
E-Mail: ruck.friedrich@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Tel.: 07950/749<br />
E-Mail: wagemann_fbg@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
www.fbg-feuchtwangen.de/<br />
Tel.: 09867/978207<br />
E-Mail: fbg-rothenburg@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
www.fbg-rothenburg.de/<br />
Tel.: 09861/97499-0<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo-rothenburg@baysf.de<br />
www.baysf.de<br />
Tel.: 09871/261<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@trocknung-w<strong>in</strong>dsbach.de<br />
http://www.trocknung-w<strong>in</strong>dsbach.de<br />
Tel.: 09 81/4 8787-0<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@mr-ansbach.de<br />
http://www.mr-ansbach.de<br />
Tel.: 09822/6050982<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@hwf-ansbach.de<br />
http://www.hwf-ansbach.de<br />
Tel.: 09824/921980<br />
Tel.: 09872/1787
Organisation Ansprechpartner,<br />
Anschrift<br />
IG Family Farm Elke Beißer<br />
Laubenzedel 42<br />
91710 Gunzenhausen<br />
IG Ländliche Gästeführer im<br />
Herzen Frankens<br />
IG Reiten zwischen Ma<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
Donau<br />
Amt für Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>und</strong> Forsten <strong>Ansbach</strong><br />
1.Vorsitzende:<br />
Heidi Haag<br />
Lölldorf 20<br />
91632 Wieseth<br />
Reg<strong>in</strong>a Bremm<br />
Am Kirchberg 4<br />
91598 Colmberg<br />
IG Regionalbuffet Ansprechpartner Romantisches<br />
Franken:<br />
Wolfgang He<strong>in</strong>zel<br />
L<strong>in</strong>den 25<br />
91635 W<strong>in</strong>delsbach<br />
Tourismusgeme<strong>in</strong>schaft Bauernhof<br />
<strong>und</strong> <strong>Land</strong>urlaub<br />
Jägervere<strong>in</strong>igungen<br />
Bayerischen Jagdverband<br />
Jägervere<strong>in</strong>igung <strong>Ansbach</strong> <strong>und</strong><br />
Umgebung<br />
Bayerischen Jagdverband<br />
Jägervere<strong>in</strong>igung Feuchtwangen<br />
Bayerischen Jagdverband<br />
Jägervere<strong>in</strong>igung Rothenburg ob<br />
der Tauber<br />
Bayerischen Jagdverband<br />
Jägervere<strong>in</strong>igung<br />
Wassertrüd<strong>in</strong>gen<br />
Bayerischen Jagdverband<br />
Jägervere<strong>in</strong>igung D<strong>in</strong>kelsbühl<br />
Ökologischer Jagdverband<br />
Bezirksgruppe Mittelfranken<br />
Reg<strong>in</strong>a Bremm<br />
Am Kirchberg 4<br />
91598 Colmberg<br />
1. Vorsitzender<br />
He<strong>in</strong>zpeter Als<br />
Richard-Wagner-Str. 31<br />
91522 <strong>Ansbach</strong><br />
1. Vorsitzender<br />
Manfred Hartnagel<br />
Bergertshofen<br />
74594 Kressberg<br />
1. Vorsitzender<br />
Johannes Schneider<br />
Großharbach 63<br />
91587 Adelshofen<br />
1. Vorsitzender<br />
Waltraud Müller<br />
He<strong>in</strong>ersdorf 42<br />
91572 Bechhofen<br />
1. Vorsitzender<br />
Jürgen Weißmann<br />
Kreuzhofstraße 5<br />
91725 Eh<strong>in</strong>gen<br />
1. Vorsitzender<br />
Anton Rabl<br />
Dettendorfer Str. 10<br />
91456 <strong>Die</strong>speck<br />
Kontakt<br />
Tel.: 09837/437<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@family-farm.de<br />
http://www.family-farm.de<br />
Tel.: 09855/409<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@laendlichegaestefuehrer.de<br />
http://www.gaestefuehrer-an.de<br />
Tel.: 09803/94141<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@reiten-franken.de<br />
http://www.wanderreiten-franken.de<br />
Tel.: 09861/94330<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@gasthof-l<strong>in</strong>den.de<br />
http://www.regionalbuffet.de<br />
Tel.: 09803/94141<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@landurlaub-franken.de<br />
http://www.landurlaub-franken.de<br />
E-Mail: als-ansbach@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
www.jaegervere<strong>in</strong>igung-ansbach.de/<br />
E-Mail: manfred.hartnagel@freenet.de<br />
www.jagd-feuchtwangen.de/<br />
E-Mail: schneider-adelshofen@tonl<strong>in</strong>e.de<br />
E-Mail: mueller.he<strong>in</strong>ersdorf@tonl<strong>in</strong>e.de<br />
E-Mail: juergenweissmann@web.de<br />
www.jaegervere<strong>in</strong>igungd<strong>in</strong>kelsbuehl.de/<br />
E-Mail: rabl@oejv.de<br />
www.oejv.de/landesverbaende/bayer<br />
n/mittelfranken/<strong>in</strong>dex.html<br />
81