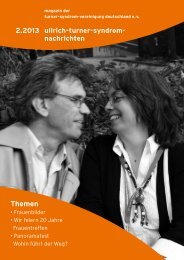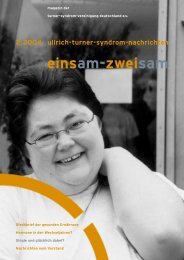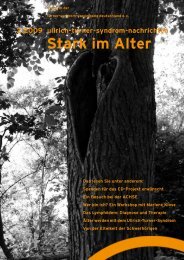im gespräch - Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland eV
im gespräch - Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland eV
im gespräch - Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12<br />
Die Muskel-Knochen-Interaktion und ihre Bedeutung für die<br />
Knochengesundheit be<strong>im</strong> Ullrich-<strong>Turner</strong>-<strong>Syndrom</strong><br />
Privat-Dozent Dr. med. Oliver Fricke, Professor Dr. med. Eckhard Schönau<br />
Pädiatrische Endokrinologie und Osteologie, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universität zu Köln<br />
Dem Wissen um den Nutzen von Bewegung und<br />
körperlicher Aktivität für die Gesunderhaltung und<br />
Gesundung des Körpers wird inzwischen in unserer<br />
Gesellschaft ein breiterer Raum <strong>im</strong> Verständnis einer<br />
gesunden Lebensführung zugestanden, als es noch<br />
vor Jahren der Fall war. Im Vordergrund werden häufig<br />
die positiven Aspekte der körperlichen Aktivität<br />
für den Schutz vor Herkreislauferkrankungen wie<br />
Herzinfarkt und Schlaganfall diskutiert. Körperliche<br />
Aktivität hat aber auch entscheidenden Einfluss auf<br />
die Gesunderhaltung unserer Muskeln und Knochen.<br />
Seit einigen Jahren wissen wir, dass zu gesunden<br />
Knochen gesunde beziehungsweise leistungsfähige<br />
Muskeln unabdingbar dazugehören. Wir möchten<br />
Ihnen <strong>im</strong> folgenden gerne diesen Zusammenhang<br />
näher bringen, damit auch Sie von dem modernen<br />
Wissen über den Zusammenhang zwischen Muskulatur<br />
und Knochenentwicklung für Ihre Gesundheit<br />
profitieren können.<br />
Unser Verständnis vom gesunden Knochen war vor<br />
Jahren vor allem noch von der Vorstellung geprägt,<br />
dass der Zustand eines bruchgefährdeten, häufig<br />
in der Knochensubstanz geminderten Knochens,<br />
vor allem durch einen Mangel an Bausteinen des<br />
Knochens wie zum Beispiel Kalzium oder die Kalziumaufnahme<br />
beeinflussende Botenstoffe wie Vitamin D<br />
bedingt sei. Diese Vorstellung hat sich für die Osteoporose,<br />
dem Fachausdruck für den Knochenschwund,<br />
als nicht korrekt erwiesen. Der gesunde Knochen,<br />
wenn auch in seinen mechanischen Eigenschaften<br />
sehr fest, ist ein ausgesprochen flexibles Gewebe,<br />
das sich <strong>im</strong>merwährend seiner momentanen Beanspruchung<br />
anpasst. Diese Erkenntnis hatte schon vor<br />
mehr als hundert Jahren der deutsche Anatom Julius<br />
Wolff erkannt, der diesen Sachverhalt in seinem<br />
berühmten Transformationsgesetz des Knochens<br />
niedergeschrieben hat. Erst der US-amerikanische<br />
Unfallchirurg und Orthopäde Harold Frost hat diesen<br />
Gedanken in der zweiten Hälfte des zwanzigsten<br />
Jahrhunderts wieder aufgegriffen und zu einer<br />
umfassenden Theorie des Knochenstoffwechsels<br />
ausgebaut. Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass der<br />
Knochen sich in seinen mechanischen Eigenschaften<br />
durch Veränderung seiner Form und Masse an die auf<br />
ihn wirkenden Max<strong>im</strong>alkräfte anpasst, um Knochenbrüche,<br />
in der Fachsprache Frakturen genannt, zu<br />
vermeiden. Diese Max<strong>im</strong>alkräfte entstehen <strong>im</strong> Alltag<br />
und werden <strong>im</strong> wesentlichen <strong>im</strong> Rahmen unserer<br />
muskulären Aktivität entwickelt. In der Quintessenz<br />
heißt dieses: Wer schwache Muskeln hat, der verfügt<br />
über einen schwachen Knochen und eben auch<br />
umgekehrt. Wir können also durch eine gesunde<br />
und hohe Kräfte entwickelnde Muskulatur unseren<br />
Knochen festigen und dadurch Frakturen vermeiden.<br />
Da der Knochen flexibel in seiner Anpassung<br />
ist, bedeutet es aber auch, dass bei nachlassendem<br />
Training und schwindenden Muskelkräften die Festigkeit<br />
des Knochens wieder verloren geht. Wir müssen<br />
demnach ein Leben lang mit unseren Muskeln aktiv<br />
bleiben, um uns vor Knochenbrüchen zu schützen.<br />
Diese Max<strong>im</strong>e gilt vor allem für das Alter, aber auch<br />
für alle die Menschen, die aufgrund einer Knochenerkrankung<br />
ein erhöhtes Risiko haben, Knochenbrüche<br />
zu entwickeln.<br />
In der Regel geht einer Fraktur ein Unfall, sei er noch<br />
so klein, wie zum Beispiel ein Sturz be<strong>im</strong> Gehen<br />
voraus. Wir wissen heute, dass der Sturz und die<br />
Fertigkeit, sich <strong>im</strong> Sturz abzufangen, wesentliche<br />
Faktoren bei der Entwicklung von Frakturen sind.<br />
Beide Aspekte, das Stürzen an sich und auch das<br />
Abfangen <strong>im</strong> Fall, sind von unseren koordinativen<br />
Fertigkeiten abhängig. Darunter verstehen wir, dass<br />
ein motorisches Bewegungsprogramm so geschickt<br />
umgesetzt werden kann, dass nicht gestürzt wird<br />
oder sich möglichst gut <strong>im</strong> Sturz abgefangen werden<br />
kann, um die Einwirkung sehr hoher Kräfte auf den<br />
Knochen zu vermeiden. Koordinative Fertigkeiten<br />
sind sicherlich eine Frage der Begabung und werden<br />
mit dem Alter schlechter, sie lassen sich aber durch<br />
ein entsprechendes Bewegungstraining erhalten und<br />
verbessern. Ein gut trainiertes Muskelsystem trägt<br />
somit in zweierlei Hinsicht zu unserem Schutz vor<br />
Knochenbrüchen bei: Zum einen adaptiert sich der<br />
Knochen mit einer höheren Bruchfestigkeit an die<br />
hohen Verformungsraten des Knochens aufgrund<br />
der kräftigen Muskulatur. Zum anderen schützt uns<br />
ein kompetentes Muskelsystem vor dem Auftreten<br />
von Stürzen und mildert die Kräfte des Sturzes durch<br />
ein sicheres Abfangen.<br />
Wenn in der Allgemeinheit von Knochenschwund, in<br />
der Fachsprache Osteoporose genannt, gesprochen<br />
wird, taucht schnell der Begriff der „Knochendichte“<br />
auf. Unter Dichte verstehen wir physikalisch<br />
das Verhältnis zwischen der Masse und dem von<br />
ihr eingenommenen Raum, dem Volumen. Um eine<br />
Professor Dr. med. Eckhard Schönau<br />
Dichte exakt best<strong>im</strong>men zu können — das gilt auch<br />
für die Knochendichte — müssen also Masse und<br />
auch Volumen bekannt sein. Beides lässt sich be<strong>im</strong><br />
lebenden Menschen von außen nicht best<strong>im</strong>men, so<br />
dass methodisch ein Trick angewandt wird. Röntgenstrahlung<br />
wird in ihrer Intensität von der Zahl der<br />
Moleküle, denen sie in ihrem Strahlengang begegnet,<br />
abgeschwächt. Da Röntgenstrahlen menschliches<br />
Gewebe durchdringen können, ist die Abschwächung<br />
der Strahlung ein Maß für die <strong>im</strong> Strahlengang liegende<br />
Knochenmasse. Setzt man jetzt voraus, dass alle<br />
Erwachsene ungefähr gleich groß sind, das heißt, der<br />
Raum, den ihr Skelett einn<strong>im</strong>mt, sich nicht wesentlich<br />
unterscheidet, so kann das Maß der Abschwächung<br />
der Röntgenstrahlung ein Maß für die Dichte des<br />
Knochens sein. Was bedeutet diese Annahme für<br />
Menschen, die mit sehr großer oder kleiner Körpergröße<br />
untersucht werden, die also ein recht großes<br />
oder recht kleines Knochenvolumen aufweisen? Es<br />
ergibt sich ein Messwert, der bei großen Menschen<br />
eine zu hohe und bei kleinen Menschen ein zu geringe<br />
Knochendichte angibt. Deshalb müssen Menschen<br />
mit sehr großer oder sehr kleiner Körpergröße mit<br />
Verfahren untersucht werden, die auch das Knochenvolumen<br />
in die Messung einbeziehen, um einen<br />
verlässlichen Messwert für die Knochendichte zu<br />
erhalten.<br />
Das Ullrich-<strong>Turner</strong>-<strong>Syndrom</strong> (UTS) führt in der Regel<br />
zu einer kleineren Körpergröße in der Entwicklung<br />
des Skeletts. Wenn die Knochendichte mit einem<br />
Verfahren untersucht wird, welches diesen Aspekt<br />
nicht ausreichend berücksichtigt, wird die Knochendichte<br />
mit einem geringeren Wert best<strong>im</strong>mt, als<br />
es den Tatsachen entspricht. Geeignete Untersuchungsverfahren<br />
für die Knochendichtebest<strong>im</strong>mung<br />
sind bei kleinwüchsigen Menschen Methoden, die<br />
tomographisch arbeiten und deshalb das Kno-<br />
chenvolumen berücksichtigen. Hierzu gehört die<br />
Quantitative Computertomographie (QCT) welche<br />
auch strahlungsarm am Arm oder Bein, also peripher,<br />
angewandt werden kann (pQCT). Quantitative<br />
Ultraschalluntersuchungen können nicht empfohlen<br />
werden. Best<strong>im</strong>mungen der Knochenmasse können<br />
bei Ihnen gut mit der pQCT, aber auch mit der Dual<br />
Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) durchgeführt<br />
werden. Die Best<strong>im</strong>mung der Knochenmasse ist für<br />
Sie sinnvoll, wenn sie auf die Körpergröße und die<br />
Muskulatur, zum Beispiel Lean Body Mass, Muskelquerschnittsfläche,<br />
Muskelkraftmessungen bezogen<br />
wird, da sich der Knochen in Abhängigkeit von der<br />
Muskelaktivität ausbildet. Dabei können sich zwei<br />
Auffälligkeiten <strong>im</strong> Untersuchungsergebnis zeigen.<br />
Der Patient hat insgesamt zu wenig Knochenmasse<br />
für die Körpergröße, aber nicht in Bezug auf ihre<br />
Muskulatur. Dann muss der Patient unbedingt etwas<br />
für seine Muskeln tun, um einen ausreichenden Knochenaufbau<br />
zu erreichen. Wir nennen das Problem<br />
Sarkopenie, also zu wenig Muskulatur. Wenn der<br />
Patient für die Muskulatur eine zu geringe Knochenmasse<br />
hat, dann sprechen wir von einer pr<strong>im</strong>ären,<br />
also echten Knochenerkrankung. Die Knochen<br />
können sich nicht auf die mechanische Belastung<br />
entsprechend einstellen. Solche Probleme können<br />
sich bei Frauen dann ausbilden, wenn nicht genügend<br />
Geschlechtshormone (Östrogene) <strong>im</strong> Körper gebildet<br />
werden. Östrogene spielen eine wichtige Rolle<br />
be<strong>im</strong> Aufbau des Skelettsystems in der Pubertät. Bei<br />
unzureichender Hormonbildung kann die Gabe von<br />
Östrogenen diesen Mangel ausgleichen.<br />
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Mädchen<br />
und Frauen mit Ullrich-<strong>Turner</strong>-<strong>Syndrom</strong> mit Beginn<br />
der Pubertät eine von einem erfahrenen Spezialisten<br />
(endokrinologisch ausgebildeter Kinderarzt<br />
oder Internist, Frauenarzt) betreute Hormonersatztherapie<br />
erhalten. Die Hormone bauen keinen<br />
Knochen auf, sie sorgen aber dafür, dass sich der<br />
Knochen in Abhängigkeit der Muskulatur entwickeln<br />
kann. Bewegung ist demnach für Menschen mit<br />
Ullrich-<strong>Turner</strong>-<strong>Syndrom</strong> genauso wichtig wie für<br />
alle anderen Menschen. Es gilt die Devise: Hormone<br />
können Sie verordnet bekommen, bewegen sollten<br />
Sie sich selber.<br />
medizin aktuell<br />
„Es gilt die Devise: Hormone können Sie verordnet bekommen,<br />
bewegen sollten Sie sich selber.“<br />
Ansprechpartner<br />
Professor Dr. med. Eckhard Schönau<br />
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin<br />
Uniklinik Köln. Kerpener Straße 62<br />
50924 Köln,<br />
ww.uk-koeln.de/medifitreha/kinder_reha/<br />
13