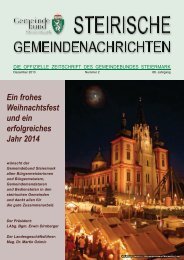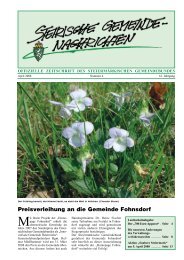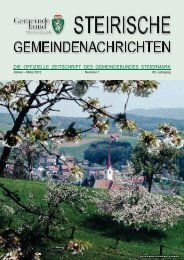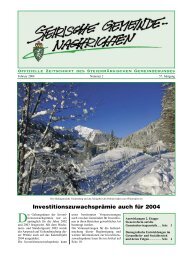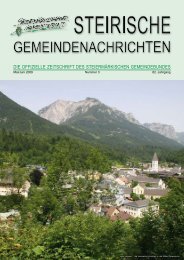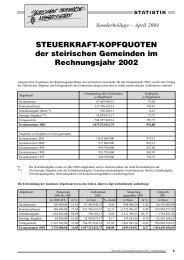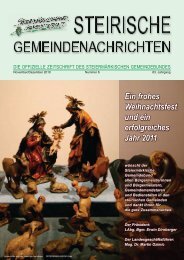10 Steirische Gemeindenachrichten 6/06 - Steiermärkischer ...
10 Steirische Gemeindenachrichten 6/06 - Steiermärkischer ...
10 Steirische Gemeindenachrichten 6/06 - Steiermärkischer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
OFFIZIELLE ZEITSCHRIFT DES STEIERMÄRKISCHEN GEMEINDEBUNDES<br />
Juni 20<strong>06</strong> Nummer 6 59. Jahrgang<br />
Das Ausseerland lädt ein zum Narzissenfest vom 25. bis 28. Mai 20<strong>06</strong> –<br />
Der Höhepunkt des Frühlingsfestes ist der Auto- und Bootskorso am Sonntag, dem 28. Mai.<br />
Neues VwGH-Erkenntnis zur Getränkesteuer<br />
Der Verwaltungsgerichtshof hat<br />
in seinem Urteil vom 27. April<br />
20<strong>06</strong> entschieden, dass die Gemeinden<br />
die vor dem Jahr 2000 in der<br />
Gastronomie eingehobene Steuer auf<br />
alkoholische Getränke nicht rückerstatten<br />
müssen. Damit wurde die Rechtsmeinung<br />
des Gemeindebundes bestätigt<br />
und seine diesbezüglichen Beratungen<br />
der Gemeinden waren erfolgreich.<br />
Ist diese die Gastronomie betreffende<br />
VwGH-Entscheidung auch nur ein<br />
Teilerfolg, so gilt sie doch als wichtiges<br />
Signal für den künftigen Verlauf der<br />
Getränkesteuerverfahren mit dem Handel.<br />
Über die weiteren Entwicklungen<br />
werden wir die Gemeinden selbstverständlich<br />
wie bisher informieren.<br />
Europäischer<br />
Gemeindetag ......................... Seite 3<br />
Erhebung der<br />
Ferienwohnungsabgabe ..... Seite 4<br />
Investition im außerordentlichen<br />
Haushalt ....... Seite 7
DER PRÄSIDENT<br />
Landesbudget 20<strong>06</strong> – Grundlage<br />
für positive Zusammenarbeit<br />
Nach schwierigen Beratungen und zähen<br />
Verhandlungen gelang es den beiden<br />
Regierungsparteien SPÖ und ÖVP ein<br />
Landesbudget für 20<strong>06</strong> zu vereinbaren.<br />
Aufgrund dieser intensiven Budgetverhandlungen<br />
konnte Finanzlandesrat Dr.<br />
Christian Buchmann einen konkreten<br />
Voranschlag vorlegen. In seiner Budgetrede<br />
im Landtag würdigte er auch die<br />
Gemeinden als wichtige Arbeitgeber<br />
und Investoren. Nach erfolgter Zustimmung<br />
durch den Steiermärkischen<br />
Landtag können nun alle Ressorts an<br />
die Umsetzung schreiten. Die Eckdaten<br />
des Voranschlags 20<strong>06</strong> sehen ein Gesamtvolumen<br />
von rund 4.<strong>10</strong>0 Millionen<br />
Euro mit einem Abgang von rund 161,5<br />
Millionen Euro vor. Neben Einsparungen<br />
wurden auch Mehreinnahmen<br />
durch Reserven freigemacht, so dass für<br />
Sondermaßnahmen auch zusätzliche finanzielle<br />
Mittel verfügbar sind. Aus der<br />
Sicht der Gemeinden ist dieses Budget<br />
auch ein tragfähiges Fundament für die<br />
Herausforderungen des Jahres und die<br />
Fortsetzung einer positiven konstruktiven<br />
Zusammenarbeit mit dem Land<br />
Steiermark. Dadurch kann auch eine<br />
spürbare Verbesserung im Sinne der<br />
Maastrichtkriterien erfüllt werden. Nähere<br />
Betrachtungen und Ansätze werden<br />
in Zukunft noch dargestellt werden.<br />
Getränkesteuerrückersatz –<br />
Zwischenerfolg für Kommunen<br />
In der unendlichen Geschichte des<br />
Rechtsstreits betreffend Getränkesteuerrückersatz<br />
1995 bis 2000 hat der Verwaltungsgerichtshof<br />
(VwGH) mit seiner<br />
2 <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister!<br />
Geschätzte Gemeindemandatare und Mitarbeiter!<br />
Verehrte Freunde der steirischen Gemeinden!<br />
jüngst getroffenen Entscheidung der<br />
Argumentation der Kommunen sowie<br />
des Gemeinde- und Städtebundes weitgehend<br />
Rechnung getragen. Bekanntlich<br />
hat ein Wiener Gastronomiebetrieb die<br />
Rückzahlung der Getränkesteuer von<br />
1995 bis 2000 beim VwGH begehrt,<br />
nachdem die Stadt Wien und die Interessenvertretung<br />
einer solchen Forderung<br />
nicht entsprachen. Aus der Sicht des Gemeindebundes<br />
ist die Entscheidung des<br />
VwGH ein wichtiger Teilerfolg. Wurde<br />
damit doch die Rechtsmeinung unserer<br />
Experten bestätigt und ist zu hoffen,<br />
dass der Spruch des VwGH zugunsten<br />
der Kommunen auch helfen möge, im<br />
Bereich der Handelsketten und Betriebe<br />
zu einem positiven Ende der jahrelangen<br />
Diskussionen zu führen. Die Gemeinden<br />
und Städte haben ein großes Interesse<br />
daran, den nunmehr jahrelang andauernden<br />
Rechtsstreit und die tausenden<br />
anhängigen Verfahren möglichst rasch<br />
zu beenden. Dieses Urteil sollte daher<br />
auch den Handelsbetrieben zu denken<br />
geben und sie dazu bewegen, ihre Klagen<br />
zurückzuziehen. Es wäre höchst an<br />
der Zeit, nach dem für die Gemeinden<br />
positiven Spruch des VwGH alle noch<br />
anhängigen Verfahren einzustellen.<br />
Auch danke ich den rechtskundigen Mitarbeitern<br />
im Steiermärkischen Gemeindebund<br />
für ihre bisherigen Bemühungen<br />
in dieser äußerst schwierigen Materie.<br />
ÖPNV – Konzept erfordert<br />
Gespräche mit Gemeinden und<br />
Städten<br />
Die Bedeutung der Gemeinden bei der<br />
Entwicklung der ländlichen Räume<br />
unterstrich der Land- und Forstwirtschaftsminister<br />
Josef Pröll anlässlich<br />
einer großen kommunalen Tagung in<br />
Tirol und verwies auf den Wirtschaftsstandort<br />
ländlicher Raum bzw. ländliche<br />
Regionen. Eine ähnliche Aussage trafen<br />
auch BM Dr. Martin Bartenstein, Landeshauptmann<br />
Mag. Franz Voves und<br />
Erster Landeshauptmannstellvertreter<br />
Hermann Schützenhöfer anlässlich der<br />
kommunalen Länderkonferenz Steiermark<br />
zum Thema Arbeitsplätze im<br />
ländlichen Raum am 31. März in Lannach.<br />
Ein Konzept für den öffentlichen<br />
Personennahverkehr (ÖPNV) für den<br />
obersteirischen Raum wurde kürzlich<br />
im Rahmen der regionalen Planungsbeiratssitzung<br />
für den Bezirk Liezen durch<br />
Vertreter des Landes, der ÖBB sowie<br />
des Planungsbüros vorgestellt. Einer<br />
gut funktionierenden Vernetzung des<br />
öffentlichen Personenverkehrs kommt<br />
in ganz Österreich große Bedeutung zu.<br />
Der ÖPNV hat aber gerade auch für die<br />
entlegenen Landesteile, Talschaften und<br />
kleineren Orte eine große Bedeutung.<br />
Wenn nunmehr die Beratungen über<br />
brauchbare, finanzierbare und sozial ausgewogene<br />
Konzepte anhand von konkreten<br />
Planungsvorstellungen vorliegen, ist<br />
dies grundsätzlich sehr zu begrüßen und<br />
sei es auch anerkennend vermerkt, dass<br />
das vorgestellte Nahverkehrskonzept<br />
Obersteiermark interessante, funktionelle<br />
und organisatorische Verbesserungen<br />
vorsieht. So ist zum Beispiel<br />
im Obersteirertakt ein Verkehrsverbund<br />
von Mürzzuschlag – Neumarkt – Liezen<br />
– Schladming (Radstadt) vorgesehen,<br />
was zweifelsohne die Erreichbarkeit<br />
und damit auch die Lebensqualität der<br />
betroffenen Bevölkerung erhöht. Ich<br />
denke im Besonderen an den Schul- und<br />
Berufsverkehr sowie die Erreichbarkeit<br />
regionaler Zentren für ältere Mitbürger,<br />
welche auf den öffentlichen Personennahverkehr<br />
angewiesen sind. Ein großes<br />
Problem für die Gemeinden sehe<br />
ich allerdings darin, den vorgesehenen<br />
Finanzierungsbeitrag bereitstellen zu<br />
können. Damit die Verhandlungen in ein<br />
konkretes Stadium treten können, ist es<br />
erforderlich, dass die Überlegungen des<br />
ÖPNV für alle Bezirke und Regionen<br />
der Steiermark vorliegen, damit sich der<br />
Steiermärkische Gemeindebund konkret<br />
dazu äußern kann.<br />
Schulgesetznovellen –<br />
Konsultationsmechanismus<br />
wurde ausgelöst<br />
Zu den vorliegenden Schulgesetznovellen<br />
der Steiermärkischen Landesregierung<br />
(FA 6B) hat sowohl die Landesgruppe<br />
Steiermark des Städtebundes als<br />
auch der Steiermärkische Gemeindebund<br />
den Konsultationsmechanismus ausgelöst<br />
und in einer Stellungnahme auf die<br />
völlig unzureichende Kostendarstellung<br />
hingewiesen. Damit sind in dieser Causa<br />
weitere Gespräche zu führen.<br />
Euer<br />
Bürgermeister a. D. Hermann Kröll, NRAbg. a. D.,<br />
Präsident des Steiermärkischen Gemeindebundes
Europäischer Gemeindetag in Innsbruck<br />
Rund 1.300 Vertreter aus Gemeinden<br />
und Regionen Europas<br />
– darunter auch eine Delegation<br />
des Steiermärkischen Gemeindebundes<br />
unter der Leitung von Präsident Hermann<br />
Kröll – nahmen am Europäischen<br />
Gemeindetag teil, der von <strong>10</strong>. bis 12.<br />
Mai 20<strong>06</strong> in Innsbruck stattfand. Hauptthema<br />
der Tagung war die Zukunft der<br />
Daseinsvorsorge.<br />
Der Europäische Gemeindetag wurde<br />
durch Nationalratspräsident Dr. Andreas<br />
Khol eröffnet, der in seiner<br />
Ansprache auf die Wichtigkeit der<br />
Balance zwischen Europäisierung und<br />
Regionalisierung hinwies. Auch RGRE-<br />
Präsident Bgm. Dr. Michael Häupl und<br />
Innsbrucks Bürgermeisterin Hilde Zach<br />
betonten die zentrale Rolle der Gemeinden<br />
in der Versorgung mit möglichst<br />
hochwertigen und leistbaren Dienstleistungen<br />
im Lebensumfeld der Bevölkerung.<br />
70 Prozent des EU-Rechts sind<br />
auf kommunaler Ebene umzusetzen und<br />
Kommunalpolitiker seien stets die erste<br />
Ansprechstation für zufriedene und unzufriedene<br />
Bürger.<br />
Eine bemerkenswerte Rede vor den Mitgliedern<br />
des Ausschusses der Regionen<br />
hielt der Vizepräsident des Österreichischen<br />
Gemeindebundes und des RGRE,<br />
Prof. Walter Zimper. Er unterstrich<br />
ebenfalls, dass die Bürger letztlich<br />
von den Gemeinden die erfolgreiche<br />
Bewältigung der wichtigsten Grundbedürfnisse<br />
des Lebens – darunter Wasser,<br />
sanitäre Versorgung, Kinder-, Alten-<br />
und Krankenpflege, Umweltgestaltung,<br />
öffentlicher Verkehr und Kommunikation<br />
– erwarten. Die Bürger setzen in die<br />
kommunale Ebene auch die Erwartung,<br />
dass nach wie vor die Gleichheit des<br />
Zugangs zu diesen grundlegenden Leistungen,<br />
die nachhaltige Versorgungssicherheit,<br />
die Gemeinwohlbildung<br />
und die Qualität der Dienstleistungen<br />
garantiert sind.<br />
Am letzten Tag der Veranstaltung<br />
schloss der Vorsitzende des Ausschus-<br />
RGRE-Präsident Häupl, Bgm. Zach, NR-Präsident Khol und Landeshauptmann Van Staa<br />
bei der Eröffnung des Europäischen Gemeindetages in Innsbruck<br />
Index der Verbraucherpreise<br />
1966 1976 1986 1996 2000 2005<br />
Februar 20<strong>06</strong> 418,1 238,3 153,3 117,2 111,4 <strong>10</strong>0,7<br />
März 20<strong>06</strong> (vorläufig) 419,4 239,0 153,7 117,6 111,7 <strong>10</strong>1,0<br />
GEMEINDEBUND<br />
ses der Regionen (AdR), Michel Delebarre,<br />
in seiner prägnanten Rede an<br />
die Ausführungen von Prof. Zimper an<br />
und forderte ebenfalls eine vernünftige<br />
Rahmenrichtlinie für Dienstleistungen<br />
zur Schaffung der notwendigen<br />
Rechtssicherheit. Innenministerin Liese<br />
Prokop, die als Überraschungsgast zur<br />
Schlussveranstaltung gekommen war,<br />
betonte, es als ihre Aufgabe zu sehen,<br />
das Subsidiaritätsprinzip zu verteidigen<br />
und mit den Gemeinden in jeder Hinsicht<br />
zusammen zu arbeiten.<br />
Die am Ende der Tagung gemeinsam<br />
verabschiedete und von allen Delegierten<br />
einstimmig angenommene Schlusserklärung<br />
zur Daseinsvorsorge wird nun<br />
als Basis für die weitere Politikgestaltung<br />
des RGRE dienen.<br />
Inhalt<br />
Steuern & Finanzen<br />
Erhebung der<br />
Ferienwohnungsabgabe ............... 4<br />
Investition im<br />
außerordentlichen Haushalt ......... 7<br />
Recht & Gesetz<br />
Tarifbegrenzung für<br />
Kurzparkzonen entfällt .................9<br />
Rechnungslegung für Vereine...... 9<br />
Europa<br />
Neues zu Europa........................ <strong>10</strong><br />
Umwelt<br />
Papierverpackungen als<br />
„Recyclingwunder“ .................. 12<br />
Mobilfunk im Spannungsfeld<br />
zwischen Kommerz, Gesundheit<br />
und demokratischer Kultur........ 12<br />
Parks und Grünflächen –<br />
Natur findet Stadt....................... 13<br />
Land & Gemeinden<br />
Töchtertag.................................. 14<br />
Kurzmeldungen ......................... 15<br />
Termine<br />
<strong>Steirische</strong><br />
Gemeindeverwaltungsakademie<br />
– Seminarprogramm .................. 16<br />
53. Österreichischer<br />
Gemeindetag.............................. 16<br />
Impressum ................................. 16<br />
<strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong> 3
STEUERN & FINANZEN<br />
Erhebung der Ferienwohnungsabgabe<br />
I. Rechtslage<br />
Rechtsgrundlagen<br />
Im gesamten Bundesland Steiermark ist<br />
zwingend – auch in Nicht-Tourismusgemeinden<br />
– bei Vorliegen der inhaltlichen<br />
Voraussetzungen eine jährliche Ferienwohnungsabgabe<br />
(FWA) zu erheben,<br />
somit festzusetzen und einzuheben.<br />
Diese richtet sich inhaltlich nach den<br />
Bestimmungen des Steiermärkischen<br />
Nächtigungs- und Ferienwohnungsabgabegesetzes<br />
(NFWAG) 1980, LGBl. Nr.<br />
54/1980 in der Fassung LGBl. Nr. <strong>10</strong>5/<br />
2005, und ist iSd § 6 Z. 5 Finanz-Verfassungsgesetz<br />
1948, BGBl. Nr. 45/1948<br />
idF BGBl. Nr. 201/1996, als ausschließliche<br />
Gemeindeabgabe ausgestaltet.<br />
Sofern die Erhebung dieser Abgabe bisher<br />
– aus welchen Gründen auch immer<br />
– nicht lückenlos erfolgte, hat diese<br />
auch rückwirkend vollzogen zu werden<br />
(innerhalb der Schranken der grundsätzlich<br />
5-jährigen Bemessungsverjährungsfrist<br />
des § 156 ff Steiermärkische<br />
Landesabgabenordnung – LAO, LGBl.<br />
Nr. 158/1963 in der Fassung LGBl.<br />
Nr. 69/2001).<br />
Begriff der „Ferienwohnung“;<br />
Abgabenbefreiungen<br />
„…eine Wohnung oder eine sonstige Unterkunft<br />
in Gebäuden oder baulichen Anlagen,<br />
die nicht der Deckung eines ganzjährig<br />
gegebenen Wohnbedarfes dient,<br />
sondern überwiegend zu Aufenthalten<br />
während der Freizeit, des Wochenendes,<br />
des Urlaubes, der Ferien oder auch nur<br />
zeitweise für nichtberufliche Zwecke als<br />
Wohnstätte dient“ gilt als Ferienwohnung<br />
iSd § 9a Abs. 2 NFWAG 1980. Für<br />
Häuser und Wohnungen, deren Eigentümer<br />
bzw. Miteigentümer ihren Hauptwohnsitz<br />
nicht in der Gemeinde haben,<br />
gilt zudem automatisch die gesetzliche<br />
Vermutung der Ferienwohnungseigenschaft,<br />
welche aber vom Abgabepflichtigen<br />
widerlegt werden kann (§ 9c Abs. 1<br />
NFWAG 1980).<br />
Abgabenbefreiungen: Wenn allerdings<br />
eine Ferienwohnung ausschließlich (!)<br />
von Personen genutzt wird, die ihren<br />
ständigen Wohnbedarf im Gemeindegebiet<br />
decken, entsteht keine Pflicht zur<br />
Entrichtung der Ferienwohnungsabgabe<br />
(§ 9a Abs. 6 NFWAG 1980).<br />
Wenn eine Ferienwohnung zeitweise<br />
auch für die entgeltliche Unterkunftgewährung<br />
an Personen ohne Hauptwohnsitz<br />
in dieser Gemeinde herangezogen<br />
4 <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
Robert Koch<br />
<strong>Steiermärkischer</strong> Gemeindebund<br />
wird, ruht während dieser Zeit die Verpflichtung<br />
zur Entrichtung der FWA<br />
(§ 9a Abs. 5 NFWAG 1980); es entsteht<br />
aber dadurch während dieser Zeit die<br />
Pflicht zur Entrichtung der Nächtigungsabgabe<br />
(NA).<br />
Festsetzung der<br />
Ferienwohnungsabgabe<br />
Dass die Einhebung der FWA iSd<br />
NFWAG 1980 verpflichtend in allen<br />
Gemeinden der Steiermark gilt, wurde<br />
bereits einleitend erwähnt; ebenso die<br />
Pflicht des Bürgermeisters als Abgabenbehörde<br />
erster Instanz, dies innerhalb<br />
des Bemessungsverjährungszeitraumes<br />
(aus heutiger Sicht rückwirkend für alle<br />
Kalenderjahre ab 2001) erforderlichenfalls<br />
auch „rückwirkend“ auf Basis der<br />
§§ 9a bis 9d NFWAG 1980 iVm §§ 150<br />
und 156 LAO zu vollziehen.<br />
Abgabepflichtig ist der grundbücherliche<br />
Eigentümer der Ferienwohnungsliegenschaft,<br />
sofern dieser aber mit dem<br />
Eigentümer der baulichen Anlage nicht<br />
identisch ist, der Eigentümer der Ferienwohnung,<br />
wobei Miteigentümer als<br />
Gesamtschuldner iSd § 4 LAO gelten<br />
(§ 9a Abs. 3 NFWAG).<br />
Musterbescheide zur Abgabenfestsetzung<br />
werden für Mitgliedsgemeinden<br />
auf der Homepage des Steiermärkischen<br />
Gemeindebundes zum Download bereitgestellt.<br />
Höhe der Ferienwohnungsabgabe<br />
Solange in einer Gemeinde keine Verordnung<br />
iSd § 9b Abs. 3 NFWAG 1980<br />
idgF (mit höheren Steuersätzen bis zu<br />
Euro 300,00) in Kraft getreten ist, sind<br />
die in § 9b Abs. 1 leg. cit. angeführten<br />
Abgabenbeträge für die Festsetzung der<br />
FWA maßgeblich (derzeit zwischen Euro<br />
70,00 und Euro 160,00 pro Jahr).<br />
Tritt bzw. trat eine solche Verordnung<br />
unter dem Jahr bzw. während eines vergangenen<br />
Jahres in Kraft, ist (erst) mit<br />
Wirksamkeit des Inkrafttretens der Verordnung<br />
die „erhöhte“ FWA (neu) festzusetzen<br />
und ist der bis dorthin wirksam<br />
festgesetzte (bezahlte) Abgabenbetrag<br />
bei der Festsetzung (bzw. bei der fällig<br />
werdenden Restschuld) anzurechnen<br />
(§ 15 NFWAG 1980).<br />
Hinweis: Bei einer länger zurück reichenden<br />
Abgabenfestsetzung ist zu<br />
beachten, dass § 9b Abs. 1 NFWAG<br />
1980 Neufassungen per 1. 1. 2002 durch<br />
LGBl. Nr. 69/2001 und per 1. 4. 2002<br />
durch LGBl. Nr. 34/2002 erfahren hat<br />
(Änderungen bei den „Tarifen“ und Größenabstufungen).<br />
Ferienwohnungsabgabe-<br />
Dauerbescheid<br />
Nachdem die FWA mittels LAO-Bescheid<br />
festzusetzen ist und „die einmal<br />
festgesetzte jährliche FWA“ iSd § 9d<br />
Abs. 1 NFWAG 1980 „so lange in derselben<br />
Höhe zu entrichten“ ist, „solange<br />
nicht ein neuer Abgabenbescheid ergeht“,<br />
wobei auf diese Rechtsfolgen im<br />
Bescheid hinzuweisen ist, ist besonders<br />
zu beachten, dass dieser künftige Jahresbetrag<br />
deutlich ersichtlich ist – insbesondere<br />
wenn mit diesem Bescheid auch<br />
(durchaus unterschiedliche) Abgabenfestsetzungen<br />
für mehrere vergangene<br />
Jahre vorgenommen werden.<br />
Bei einer Veränderung der Bemessungsgrundlagen<br />
ist seitens der Abgabenbehörde<br />
ein neuer Abgabenbescheid zu<br />
erlassen.<br />
Natürlich muss auch ein neuer Bescheid<br />
ergehen, wenn sich der Abgabepflichtige<br />
ändert (Eigentümerwechsel).<br />
Zeitweise entgeltliche<br />
Unterkunftgewährung<br />
Bei der Nutzung einer Ferienwohnung<br />
in der Art, dass (in Teilzeiträumen) auch<br />
eine entgeltliche Unterkunftgewährung<br />
statt findet, ist der Abgabenbescheid<br />
– wenn er nicht ohnedies erst(malig) im<br />
Nachhinein ergeht – alljährlich anzupassen,<br />
indem die Zeiträume der entgeltlichen<br />
Unterkunftgewährung von der Festsetzung<br />
der FWA anteilig auszunehmen<br />
sind (§ 9a Abs. 5 NFWAG 1980).<br />
Als praktische (zwar nicht ganz gesetzeskonforme,<br />
aber bewährt verwaltungsökonomische)<br />
Handhabung ist bei einzelnen<br />
Gemeinden zu beobachten, dass diese<br />
natürlich nur im Nachhinein mögliche<br />
jährliche Anpassung des FWA-Betrages<br />
nach unten bei unangetasteter Abgabenfestsetzung<br />
durch Rückerstattung (Gutschrift,<br />
Überweisung, Barauszahlung)<br />
des Minderungsbetrages anlässlich der<br />
Erklärung bzw Abrechnung mit den NA-<br />
Erklärungszeiträumen erfolgt. Diesfalls<br />
kann sogar auch die zuletzt (voll) festgesetzte<br />
FWA vorerst unverändert für das<br />
Folgejahr weiter gelten.<br />
II. Ermittlungsverfahren<br />
Mitwirkung der Wohnungs- und<br />
Liegenschaftseigentümer bei der<br />
Erfassung der Ferienwohnungen
Grundsätzlich sind alle Wohneinheiten<br />
(Häuser und Wohnungen in Häusern),<br />
welche keinen Hauptwohnsitz darstellen<br />
und wo der Eigentümer der baulichen<br />
Anlage nicht in der betreffenden Gemeinde<br />
seinen Hauptwohnsitz hat, Ferienwohnungen;<br />
ausgenommen sie dienen<br />
ausschließlich beruflichen Zwecken als<br />
Wohnstätte.<br />
Gemäß § 9c Abs. 1 NFWAG 1980<br />
müssen Eigentümer von Häusern und<br />
Wohnungen, die ihren Hauptwohnsitz<br />
nicht in der Gemeinde haben, diese Ferienwohnungen<br />
der Gemeinde mitteilen,<br />
es sei denn, sie weisen nach, dass keine<br />
Ferienwohnung vorliegt.<br />
Maßgebliche Größe der<br />
Ferienwohnungen<br />
Wenn die Gemeinde die maßgebliche<br />
Nutzfläche der Ferienwohnung nicht<br />
kennt, muss der Abgabepflichtige diese<br />
nach Aufforderung durch die Gemeinde<br />
bekannt geben (§ 9c Abs. 1 dritter<br />
Satz NFWAG 1980). Dazu war/ist ein<br />
Erhebungsformblatt (Lagerzahl 589)<br />
der Medienfabrik GmbH im Umlauf,<br />
welches allerdings in einer aktuellen<br />
Fassung (NFWAG 1980 idF LGBl.<br />
Nr. <strong>10</strong>5/2005) zu verwenden wäre.<br />
Achtung! Die Nutzfläche ist dabei nach<br />
der Definition des § 6 Abs. 1 und 2 Wohnungseigentumsgesetz<br />
1975, BGBl. Nr.<br />
417/1975, zu ermitteln – und NICHT<br />
nach den im Bauakt angeführten Bruttogeschoßflächen!<br />
Ermittlung der Nutzfläche im Sinne<br />
des Wohnungseigentumsgesetzes 1975<br />
Nachfolgend finden Sie einen Auszug<br />
der maßgeblichen Bestimmungen aus<br />
dem Wohnungseigentumsgesetz 1975<br />
– WEG 1975 idF BGBl. Nr. 417/1975:<br />
Nutzfläche – § 6. (1) Die Nutzfläche ist<br />
die gesamte Bodenfläche einer Wohnung<br />
oder einer sonstigen Räumlichkeit abzüglich<br />
der Wandstärken und der im Verlauf<br />
der Wände befindlichen Durchbrechungen<br />
(Ausnehmungen). Treppen, offene<br />
Balkone und Terrassen sowie Keller-<br />
und Dachbodenräume, soweit sie ihrer<br />
Ausstattung nach nicht für Wohn- oder<br />
Geschäftszwecke geeignet sind, sind bei<br />
der Berechnung der Nutzfläche nicht zu<br />
berücksichtigen; das gleiche gilt für die<br />
im § 1 Abs. 2 sonst genannten Teile der<br />
Liegenschaft, die mit einer Wohnung<br />
oder einer sonstigen Räumlichkeit im<br />
Wohnungseigentum stehen.<br />
(2) Die Nutzfläche ist auf Grund des<br />
behördlich genehmigten Bauplans zu<br />
berechnen, es sei denn, daß eine Abweichung<br />
vom behördlich genehmigten<br />
Bauplan erwiesen wird; in diesem Fall<br />
ist die Nutzfläche nach dem Naturmaß<br />
zu berechnen.<br />
Begriff – § 1 (1) ...<br />
(2) Mit selbständigen Wohnungen oder<br />
sonstigen selbständigen Räumlichkeiten<br />
können auch andere Teile der Liegenschaft,<br />
wie besonders offene Balkone,<br />
Terrassen, Keller- oder Dachbodenräume,<br />
Hausgärten, Abstellplätze für höchstens<br />
zwei Kraftfahrzeuge je selbständige<br />
Wohnung oder sonstige selbständige<br />
Räumlichkeit der Liegenschaft, im Wohnungseigentum<br />
stehen, sofern sie von der<br />
Liegenschaftsgrenze, den allgemeinen<br />
Teilen der Liegenschaft, der Wohnung<br />
oder der sonstigen Räumlichkeit aus zugänglich<br />
und deutlich abgegrenzt sind.<br />
III. Verwendung „anderer“ Daten<br />
Nachdem die Gemeinden über eine<br />
Vielzahl von Informationen verfügen,<br />
welche inhaltliche Anhaltspunkte für<br />
die FWA-Pflicht liefern kann, liegt die<br />
Verwendung verfügbarer Daten nahe.<br />
Nachdem es sich teilweise um sehr<br />
sensible Daten handelt und dies immer<br />
wieder „mit schlechtem Gewissen“ erfolgt<br />
und folglich in Bescheiden auch<br />
sicherheitshalber nicht offen gelegt wird,<br />
weil Unsicherheiten darüber bestehen,<br />
welche Datenverwendungen gesetzlich<br />
zulässig und daher iSd § 92 zweiter Satz<br />
LAO sogar geboten sind, wird nachstehend<br />
untersucht, welche Daten für die<br />
Verwaltung der FWA verwendet werden<br />
dürfen bzw. im Sinne der effizienten Tätigkeit<br />
einer Abgabenbehörde verwendet<br />
werden müssten.<br />
Allgemeine Beobachtungen und<br />
Wahrnehmungen<br />
Im Sinne des § 92 LAO ist die Abgabenbehörde<br />
angehalten, Abgaben<br />
relevante Umstände aktiv (!) sorgfältig<br />
zu ermitteln, zu sammeln, fortlaufend<br />
zu ergänzen und auszutauschen, um die<br />
Abgabepflichtigen gleich zu behandeln<br />
und um Abgabenverkürzungen entgegen<br />
zu wirken:<br />
Alle Wohnungen und Häuser ohne<br />
Hauptwohnsitz und solche mit einem<br />
weiteren Wohnsitz eines außerhalb der<br />
Gemeinde mit Hauptwohnsitz Gemeldeten<br />
sowie leer stehende Wohnungen und<br />
Häuser einer Person, die ihren ständigen<br />
Wohnbedarf nicht in der Gemeinde deckt,<br />
sind somit für die Abgabenbehörde als<br />
grundsätzliche Ferienwohnungen absolut<br />
relevant: Schließlich handelt es sich<br />
hierbei nicht bloß um potentielle Ferienwohnungen,<br />
sondern bereits um abga-<br />
STEUERN & FINANZEN<br />
bepflichtige Ferienwohnungen im Sinne<br />
einer gesetzlichen Vermutung, für welche<br />
der Abgabepflichtige erst aus eigenem<br />
das Gegenteil zu beweisen hätte!<br />
Abfrage und Verwendung von<br />
Meldedaten<br />
Nach der Meldegesetz-Durchführungsverordnung<br />
– MeldeV, BGBl. II<br />
Nr. 66/2002, vergibt der Bundesminister<br />
für Inneres als Betreiber des Zentralen<br />
Melderegisters (ZMR) entsprechende<br />
persönliche Zugriffsberechtigungen,<br />
welche in der Eigenschaft als Organ der<br />
Meldebehörde (Tätigwerden im übertragenen<br />
Wirkungsbereich der Gemeinde)<br />
verwendet werden dürfen.<br />
Die Abgabenbehörden (Bürgermeister,<br />
Gemeinderat) dürfen im Zusammenhang<br />
mit der Ermittlung der Grundlagen der<br />
FWA-Festsetzung, somit einer hoheitlichen<br />
Aufgabenstellung im eigenen Wirkungsbereich<br />
der Gemeinde, auch ihnen<br />
als Meldebehörde bekannt gewordene<br />
Daten verwenden bzw. abgabenrelevante<br />
Daten ohne Weiteres offiziell beim<br />
Zugriffsberechtigten („Meldeamt“) in<br />
Erfahrung bringen, weil die Übermittlung<br />
und/oder Verwendung der Daten<br />
im Rahmen der Vollziehung der Gesetze<br />
erfolgt. Außerdem ist § 16a Abs. 4<br />
Meldegesetz 1991, BGBl. Nr. 9/1992<br />
in der Fassung BGBl. I Nr. 45/20<strong>06</strong>,<br />
ausdrücklich zu entnehmen, dass die Gemeinden<br />
zur Besorgung einer gesetzlich<br />
übertragenen Aufgabe die Ergebnisse der<br />
im Melderegister möglichen Abfrage<br />
(Gesamtdatensatz; inkl. weiterer und<br />
früherer Wohnsitze) im notwendigen<br />
Ausmaß verwenden dürfen.<br />
Der Melderecht-Runderlass des<br />
Bundesministeriums für Inneres,<br />
GZ: 11.000/216-V/7/02, führt zu § 16a<br />
Abs. 4 MeldeG 1991 Folgendes aus:<br />
„Hier wird die Möglichkeit eröffnet,<br />
Organen von Gebietskörperschaften,<br />
Gemeindeverbänden und Sozialversicherungsträgern<br />
einen Online-Zugriff<br />
auf die Daten des ZMR einzuräumen<br />
und zwar dann, wenn sie diese Daten<br />
zur Besorgung einer Aufgabe der Hoheitsverwaltung<br />
benötigen. Von diesem<br />
Zugriffsrecht sind auch Daten, die sonst<br />
einer Auskunftssperre unterliegen, erfasst,<br />
weil in diesen Fällen regelmäßig<br />
davon ausgegangen werden kann, dass<br />
die Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe<br />
regelmäßig höher zu bewerten ist, als<br />
das Interesse eines Betroffenen, seinen<br />
Aufenthaltsort geheim zu halten. Diese<br />
weit reichende Abfrageberechtigung<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
<strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong> 5
STEUERN & FINANZEN<br />
Fortsetzung von Seite 5<br />
ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass<br />
die Nutznießer dieser Regelung allesamt<br />
dem Amtsgeheimnis unterliegen.“<br />
§ 20 Abs. 3 Meldegesetz 1991 lautet:<br />
„Organen der Gebietskörperschaften sind<br />
auf Verlangen die im Melderegister oder<br />
im Zentralen Melderegister enthaltenen<br />
Meldedaten zu übermitteln, wobei das<br />
Verlangen im konkreten Fall nur gestellt<br />
werden darf, wenn es für den Empfänger<br />
zur Wahrnehmung der ihm übertragenen<br />
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung<br />
bildet; Übermittlungen aufgrund<br />
von Verknüpfungsanfragen (§ 16a Abs. 3)<br />
sind überdies nur zulässig, wenn die<br />
Verhältnismäßigkeit zum Anlaß und<br />
zum angestrebten Erfolg gewahrt bleibt.<br />
Die Bürgermeister sind ermächtigt,<br />
die in ihrem Melderegister enthaltenen<br />
oder ihnen gemäß Abs. 2 übermittelten<br />
Meldedaten zu verwenden, sofern diese<br />
zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich<br />
übertragenen Aufgaben eine wesentliche<br />
Voraussetzung bilden.“<br />
Der Melderecht-Runderlass des<br />
Bundesministeriums für Inneres,<br />
GZ: 11.000/216-V/7/02, führt zu § 20<br />
Abs. 3 MeldeG 1991 Folgendes aus:<br />
„Durch die Formulierung „sofern diese<br />
für den Empfänger zur Wahrnehmung<br />
der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben<br />
eine wesentliche Voraussetzung<br />
bilden“ wird klargestellt, dass es sich<br />
hier um Fälle der Amtshilfe iSd Art. 22<br />
B-VG handelt. Die zulässige Bekanntgabe<br />
umfasst sämtliche im Melderegister<br />
enthaltenen Daten; sie ist nicht auf jene<br />
den Inhalt einer Meldeauskunft bildenden<br />
Daten beschränkt. Die Verpflich-<br />
6 <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
tung der Meldebehörden, im Wege der<br />
Amtshilfe anderen Behörden Meldeauskünfte<br />
zu erteilen, wird auch durch die<br />
zugunsten einer bestimmten Person verfügte<br />
Auskunftssperre nicht berührt. Die<br />
Beurteilung der Frage, ob die Bekanntgabe<br />
der Meldedaten für die anfragende<br />
Behörde zur Wahrung der ihr gesetzlich<br />
übertragenen Aufgaben eine wesentliche<br />
Voraussetzung bildet, ist grundsätzlich<br />
nicht Sache der Meldebehörde. Entsprechend<br />
einer auf breiter Linie erhobenen<br />
Forderung werden die Bürgermeister ermächtigt,<br />
die Meldedaten generell – also<br />
unabhängig davon, ob sie Meldebehörde<br />
sind oder nicht – zur Wahrnehmung der<br />
ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben<br />
zu verwenden. Diese Vorgangsweise<br />
entspricht einer seit jeher geübten und<br />
durch das Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes<br />
kaum geänderten Praxis. Es ist<br />
evident, dass die Gemeinden die Meldedaten<br />
zur Wahrnehmung vielfältiger<br />
Planungsaufgaben besonders benötigen.<br />
Dementsprechend wird ihnen nunmehr<br />
durch das Gesetz auch ausdrücklich<br />
diese Befugnis eingeräumt. Die Textierung<br />
dieser Bestimmung wurde an jene<br />
des § 7 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes<br />
angelehnt.“<br />
Verwendung von Daten aus den Bauakten<br />
Auch die Nutzfläche der Ferienwohnung<br />
darf ausdrücklich aus dem behördlich<br />
genehmigten Bauplan berechnet werden,<br />
außer eine Abweichung vom behördlich<br />
genehmigten Bauplan ist bekannt.<br />
Diesfalls gilt die Nutzfläche nach dem<br />
Naturmaß, welche z. B. im Zuge einer<br />
entsprechenden Erhebungsamtshandlung<br />
(§ 114 LAO) oder auch schriftlich in<br />
Erfüllung der Auskunfts-, Offenlegungs-<br />
und Wahrheitspflicht (§§ 117 und 95<br />
LAO) nachvollziehbar detailliert abgefragt<br />
werden kann.<br />
(Eine „Nachschau“ für Zwecke der Abgabenverwaltung<br />
durch die Abgabenbehörde<br />
iSd § 118 LAO wäre nur bei jenen<br />
Personen zulässig, welche nach abgabenrechtlichen<br />
Vorschriften Bücher und<br />
Aufzeichnungen zu führen haben.)<br />
Verwendung von Grundbuchsdaten<br />
Die Gemeinde erhält auch alle Grundbuchsbeschlüsse<br />
vom zuständigen<br />
Grundbuchsgericht, womit Änderungen<br />
beim grundbücherlichen Liegenschaftseigentümer<br />
und somit (grundsätzlich)<br />
beim Abgabepflichtigen nachvollzogen<br />
und in die Abgabenverwaltung eingepflegt<br />
werden können. Es ist daher<br />
zweckmäßig, dass auch die Buchhaltung<br />
(Abgabenverwaltung, Steueramt, …)<br />
einer Gemeinde diese Daten zur Weiterverarbeitung<br />
erhält. Bei diesen Veränderungen<br />
kann die Gemeinde – sofern<br />
Häuser und/oder Wohnungen betroffen<br />
sind – sogleich als Meldebehörde aktiv<br />
werden (Erfüllung der allfälligen Meldepflichten:<br />
Hauptwohnsitz, weiterer<br />
Wohnsitz, kein Wohnsitz) und die Eigenschaft<br />
einer Wohneinheit auf den Status<br />
einer allfälligen Ferienwohnung hin<br />
überprüfen!<br />
Es ist zu beobachten, dass einige Gemeinden<br />
z. B. in typischen Ferienwohnungsanlagen<br />
gleich alle Wohnungseigentümer<br />
ohne gleichzeitigen Hauptwohnsitz in<br />
der Gemeinde mit der FWA belegen und<br />
sich auf eine Berufungsmöglichkeit des<br />
Bescheidadressaten berufen. Dazu wäre<br />
allerdings festzustellen, das die „Einsparung“<br />
des Ermittlungsverfahrens (§ 92 f<br />
LAO) rechtswidrig ist und zudem den<br />
Parteien vor Erlassung (je)des abschließenden<br />
Sachbescheides gemäß § 148<br />
Abs. 4 LAO Gelegenheit zu geben ist,<br />
von den durchgeführten Beweisen und<br />
vom Ergebnis der Beweisaufnahme<br />
Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu<br />
äußern.<br />
Verwendung von Daten aus dem<br />
Grundsteuerakt<br />
Sinngemäß dasselbe gilt für die Weitergabe<br />
und Verwendung der Daten aus<br />
dem Grundsteuerakt: Neue Einheitswertbescheide<br />
bei allfälligen Veränderungen<br />
sollen zu einer Kontrolle dahingehend<br />
führen, wie aktuell die Datenbestände<br />
bei der Verwaltung der FWA sind.
Im Jahr 2004 haben die österreichischen<br />
Gemeinden (ohne Wien) Investitionen<br />
im Gesamtausmaß von 2.090<br />
Mio. Euro getätigt. An Bedarfszuweisungsmitteln<br />
standen den Gemeinden<br />
rund 577 Mio. Euro zur Disposition.<br />
Den Saldo von 1.513 Mio. Euro hatten<br />
die Gemeinden zum größten Teil<br />
über Fremdfinanzierungen und zum<br />
Teil auch über Rücklagenauflösungen<br />
aufzubringen.<br />
Unabhängig, in welcher Rechtskonstruktion<br />
Immobilienvorhaben<br />
umgesetzt werden, stehen neben der<br />
Planung und der Vergabe von Bauaufträgen<br />
die Haushaltsergebnisse<br />
nach Maastricht, die Ausschöpfung<br />
aller steuerlichen Vorteile sowie die<br />
günstigste Finanzierungsvariante<br />
unter Beachtung des Vergaberechtes<br />
im Vordergrund.<br />
In diesem Beitrag wird versucht, anhand<br />
eines Fallbeispieles, und zwar für die<br />
Errichtung einer Mehrzweckhalle mit<br />
geschätzten Gesamtinvestitionskosten<br />
von 2,4 Mio. Euro brutto, die angeschnittenen<br />
Bereiche so darzustellen,<br />
dass sie bei Anwendung den Zielen<br />
einer sparsamen und wirtschaftlichen<br />
Haushaltsführung entsprechen.<br />
Diese Mehrzweckhalle soll – so die<br />
Annahme – nach deren Fertigstellung<br />
an Dritte (Vereine, Einzelpersonen etc.)<br />
gegen Entgelt für kulturelle, gesellige<br />
und sportliche Veranstaltungen in Nutzung<br />
gegeben, also ausnahmslos unternehmerisch<br />
betrieben werden.<br />
Daraus ergeben sich folgende Problemfelder<br />
mit folgenden Lösungsansätzen:<br />
Maastricht-Optimierung<br />
Die österreichischen Gemeinden haben<br />
sich mit dem Österreichischen Stabilitätspakt<br />
2005 verpflichtet, bis zum<br />
Jahr 2008 ihren Haushalt ausgeglichen<br />
zu bilanzieren (Null-Defizit). Neuverschuldungen<br />
im Gemeindehaushalt<br />
sind daher nur mehr bedingt zulässig,<br />
sodass bei Errichtung (und Betreibung)<br />
von Immobilienprojekten im außerordentlichen<br />
Haushalt (aoH) alternative<br />
Maastricht-zulässige Gestaltungsformen<br />
ein ausgeglichenes Haushaltsziel<br />
ermöglichen sollen.<br />
LGF-Stellvertreter Prof. Dietmar Pilz,<br />
<strong>Steiermärkischer</strong> Gemeindebund<br />
Als alternative Finanzierungsformen<br />
bieten sich an:<br />
• die rechnerische Umgliederung in<br />
einen Betrieb mit marktbestimmter<br />
Tätigkeit,<br />
• die rechtliche Ausgliederung in eine<br />
Kapital- oder Personengesellschaft<br />
(z. B. GmbH oder Kommanditerwerbsgesellschaft<br />
– KEG) oder<br />
• das Immobilienleasing<br />
Variante 1:<br />
Betrieb mit<br />
marktbestimmter Tätigkeit<br />
Für dieses Projekt (Errichtung einer<br />
Mehrzweckhalle mit nachfolgender<br />
unternehmerischer Nutzung) bietet<br />
sich als Rechtsform der Betrieb mit<br />
marktbestimmter Tätigkeit an unter der<br />
Voraussetzung, dass die nachstehenden<br />
drei Kriterien nach dem ESVG 1995<br />
für diese institutionelle Einheit erfüllt<br />
werden.<br />
• Diese institutionelle Einheit hat über<br />
eine Entscheidungsfreiheit in der<br />
Ausübung ihrer Tätigkeit („Hauptfunktion“)<br />
zu verfügen; sie muss<br />
keine eigene Rechtsperson, darf aber<br />
auch kein Hilfsbetrieb sein. Für die<br />
Entscheidungsfreiheit hat der Gemeinderat<br />
Satzungen zu beschließen.<br />
• Der Betrieb muss über eine vollständige<br />
Rechnungsführung verfügen.<br />
Diese wird in der VRV in den<br />
Abschnitten 85-89 vorgenommen<br />
(die Immobilienverwaltung wird im<br />
Unterabschnitt 853 geführt).<br />
• Eine weitere Voraussetzung für die<br />
Anerkennung als institutionelle Einheit<br />
und somit als Betrieb mit marktbestimmter<br />
Tätigkeit ist die 50 %-<br />
Regel, d. h. die Produktionskosten<br />
STEUERN & FINANZEN<br />
Investition im außerordentlichen Haushalt<br />
Maastricht-Kriterien – Steuerrecht – Vergaberecht und Finanzierungen<br />
müssen zu 50 % durch Einnahmen<br />
gedeckt sein (Kostendeckungsgrad).<br />
Die Kosten orientieren sich am betriebswirtschaftlichen<br />
Kostenbegriff.<br />
Varianten 2 und 3:<br />
Ausgliederung oder<br />
Immobilienleasing<br />
Zu einer dieser Varianten sollten sich<br />
Gemeinden dann entschließen, wenn es<br />
sich um die Errichtung von Immobilienobjekten<br />
handelt, die überwiegend der<br />
Hoheit dienen (z. B. Amtsgebäude, Bauhöfe,<br />
Schulen etc.). Welche der beiden<br />
Varianten der Vorzug zu geben ist, wird<br />
letztlich von einem Vergleich der jährlichen<br />
Belastung (Darlehensrückzahlungen<br />
oder Leasingraten) abhängen.<br />
Umsatzsteuer – Vorsteuerabzug<br />
Ein wesentlicher Kostenfaktor bei allen<br />
Objekten des aoH ist die Frage, ob die<br />
Vorsteuer von den Gesamtinvestitionskosten<br />
in Abzug gebracht werden kann.<br />
Im Falle der Errichtung und Betreibung<br />
der Mehrzweckhalle durch die Gemeinde<br />
bieten das Umsatzsteuergesetz bzw.<br />
die Umsatzsteuerrichtlinien die Möglichkeit<br />
des Vorsteuerabzuges.<br />
Ab EU-Beitritt (1. 1. 1995) unterliegen<br />
die Mieten und Pachten von Grund und<br />
Boden und Gebäuden nicht der Umsatzsteuer<br />
(unechte Befreiung) bei gleichzeitigem<br />
Vorsteuerabzugsverbot.<br />
Werden hingegen die Miet- und Pachteinnahmen<br />
dem Regelsteuersatz von<br />
derzeit 20 % USt unterworfen (Annahme<br />
der Option gemäß § 6 Abs. 2<br />
UStG 1994 – diese Option ist dem<br />
Der Kostendeckungsgrad wird wie folgt ermittelt:<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
Kostendeckungsgrad =<br />
Umsatz lt. ESVG:<br />
Umsatz<br />
Produktionskosten<br />
> 0,5<br />
- Verkaufserlöse, Gebühreneinnahmen, Interessentenbeiträge, Entgelte<br />
- NICHT: Subventionen, Finanzerträge, Verlustabdeckungen<br />
Produktionskosten lt. ESVG:<br />
- Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen, Löhne und Gehälter,<br />
Abschreibungen, sonstige Produktionskosten<br />
- NICHT: Finanzaufwendungen, Tilgungen, Investitionen, Pensionszahlungen<br />
<strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong> 7
STEUERN & FINANZEN<br />
Fortsetzung von Seite 7<br />
Finanzamt nicht gesondert zur Kenntnis<br />
zu bringen), besteht die Berechtigung<br />
des Vorsteuerabzuges sowohl von den<br />
Errichtungskosten des Objektes als<br />
auch von den laufenden Betriebskosten.<br />
Diese Option muss zumindest <strong>10</strong> Jahre<br />
lang wahrgenommen werden, andernfalls<br />
eine Vorsteuerkorrektur (aliquote<br />
Rückzahlung der beantragten Vorsteuer)<br />
vorzunehmen wäre.<br />
Im Fallbeispiel besteht für die Errichtergemeinde<br />
die Berechtigung, die im<br />
Zuge der Errichtung der Mehrzweckhalle<br />
anfallenden Vorsteuern in Höhe<br />
von 400.000 Euro in Abzug zu bringen,<br />
jedoch nur unter der Voraussetzung,<br />
wenn zumindest die (laufenden) Betriebskosten<br />
nach §§ 21 – 24 Mietrechtsgesetz<br />
durch das Nutzungsentgelt<br />
(Tarife) gedeckt sind. Nur dann<br />
anerkennt die Finanzverwaltung ein<br />
Bestandsverhältnis als Voraussetzung<br />
für eine unternehmerische Tätigkeit im<br />
umsatzsteuerrechtlichen Sinn.<br />
Es empfiehlt sich weiters, die Absicht<br />
der entgeltlichen Innutzunggebung der<br />
Mehrzweckhalle vom Gemeinderat<br />
– nicht zuletzt aus steuerlichen Erfordernissen<br />
heraus – tunlichst noch vor<br />
Baubeginn zu dokumentieren.<br />
Vergaberecht und Finanzierungen<br />
Das neu überarbeitete Bundesvergabegesetz<br />
20<strong>06</strong> ist mit 1. Februar 20<strong>06</strong> in<br />
Kraft getreten und hat im Hinblick auf<br />
Finanzdienstleistungen insoweit eine<br />
gravierende Änderung gebracht, als<br />
diese Dienstleistungen vom Geltungsbereich<br />
des Gesetzes ausgenommen<br />
sind.<br />
㤠<strong>10</strong> Abs. <strong>10</strong> lautet:<br />
Vom Geltungsbereich des Gesetzes<br />
ausgenommen sind u. a. Finanzdienstleistungen<br />
im Zusammenhang mit der<br />
Ausgabe, dem Verkauf, dem Ankauf<br />
oder der Übertragung von Wertpapieren<br />
oder anderen Finanzinstrumenten,<br />
insbesondere für Geschäfte, die der<br />
Geld- oder Kapitalbeschaffung von öffentlichen<br />
Auftraggebern dienen.“<br />
Diese Regelung stellt nach Ansicht<br />
der Mitgliedstaaten nunmehr eindeutig<br />
klar, dass insbesondere alle mit Finanzinstrumenten<br />
(z. B. Schuldscheinen<br />
oder Kreditverträgen usw.) hinterleg-<br />
8 <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
ten Kredit- oder Darlehensaufnahmen<br />
von öffentlichen Auftraggebern und<br />
von Sektorenauftraggebern nicht mehr<br />
dem Vergaberegime unterliegen, und<br />
zwar unabhängig davon, ob es sich um<br />
öffentliches Schuldenmanagement handelt<br />
oder nicht.<br />
Die weitere Vorgangsweise bei der<br />
Aufnahme von Fremdmitteln kann<br />
nunmehr mangels anderer gesetzlicher<br />
Vorschriften nur noch aus den jeweiligen<br />
Gemeindeordnungen der einzelnen<br />
Bundesländer abgeleitet werden. Dort<br />
wird grundsätzlich festgehalten:<br />
„In einem Vergabeverfahren sind die<br />
Grundsätze eines freien und lauteren<br />
Wettbewerbes, der Gleichbehandlung<br />
aller Bewerber und Bieter und der<br />
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und<br />
Zweckmäßigkeit zu beachten.“<br />
Zum Vergabeverfahren sind nur befugte,<br />
leistungsfähige und zuverlässige<br />
Unternehmer zuzulassen. Der Zuschlag<br />
ist dem technisch und wirtschaftlich<br />
günstigsten Angebot entsprechend den<br />
in der Ausschreibung festgelegten und<br />
gewichteten Zuschlagskriterien zu erteilen<br />
(Bestbieterprinzip).<br />
Unternehmer, die an der Erarbeitung<br />
der Unterlagen für das Vergabeverfahren<br />
unmittelbar oder mittelbar beteiligt<br />
waren, sind von der Teilnahme am Vergabeverfahren<br />
um die Leistung auszuschließen.<br />
Vergabeverfahren dürfen nur<br />
bei tatsächlich beabsichtigter Leistungsvergabe<br />
durchgeführt werden.<br />
Der Auftraggeber hat für die Wahrung<br />
des vertraulichen Charakters aller die<br />
Bewerber und Bieter und deren Unterlagen<br />
betreffenden Angaben zu sorgen.<br />
Die wesentlichen Abschnitte des Vergabeverfahrens,<br />
wie die Ausschreibung,<br />
die Entgegennahme und Verwahrung<br />
der Angebote, die Öffnung der Angebote,<br />
die Prüfung der Angebote, die Wahl<br />
des Angebotes für den Zuschlag und der<br />
Zuschlag sind zu dokumentieren. Die<br />
Gründe für die Vergabeentscheidung<br />
sind jedenfalls festzuhalten.<br />
Um dabei einen leichteren Vergleich<br />
zu ermöglichen, sollte bei der Erstellung<br />
der Ausschreibungsunterlagen<br />
insbesondere auf folgende Punkte Wert<br />
gelegt werden:<br />
Genaue Vorgabe der Verzinsungsperiode,<br />
der Zinstageberechnung und eines<br />
bestimmten Wertes des EURIBOR.<br />
Mittelfristig wird mit einem Anstieg<br />
der Zinssätze auf das Niveau des Jahres<br />
2000 gerechnet. Um die Zinsbelastung<br />
zu begrenzen, bieten sich z. B. für die<br />
Gemeinden neben der herkömmlichen<br />
Fremdfinanzierung auf Basis variabler<br />
Zinssätze zwei besondere Finanzierungsprodukte<br />
an:<br />
Variante Fixzins<br />
Bei Neuaufnahme von Krediten sollten<br />
– unter dem Aspekt eines leicht steigenden<br />
Zinsniveaus – die derzeit attraktiven<br />
langfristigen (20-25 Jahre) Fixzinsangebote<br />
genutzt werden.<br />
Variante Zinsobergrenze<br />
Als Alternative einer variablen Verzinsung<br />
wird bei einer Zinsobergrenze das<br />
Risiko steigender Zinsen wie bei der<br />
Fixzinsvariante ebenfalls hintangehalten.<br />
Mit einer dazu vereinbarten Zinsuntergrenze<br />
ergibt sich eine Bandbreite<br />
(z. B: 3M-EURIBOR, mindestens 2 %<br />
und höchstens 4,5 %) innerhalb der<br />
sich das Zinsrisiko bewegt.<br />
Bei diesem strukturierten Modell fallen<br />
neben den Zinsen keine zusätzlichen<br />
Gebühren oder Kosten an, womit sich<br />
auch der finanztechnische Sprachgebrauch<br />
dieses Produktes mit „Zero-<br />
Cost-Collar“ erklärt.<br />
Alle aufgezeigten Problemfelder zeigen<br />
abschließend betrachtet eines ganz deutlich:<br />
Vor Inangriffnahme der Errichtung<br />
von Immobilienprojekten sind neben<br />
der Planung und Bauvergabe die Haushaltskonsolidierung,<br />
die steuerliche<br />
Optimierung sowie die Finanzierung<br />
und Vergabe von Darlehen wesentliche<br />
Elemente zur Umsetzung der Projekte<br />
für die Gemeinden, unabhängig davon,<br />
in welcher Rechtskonstruktion Investitionen<br />
im Immobilienbereich errichtet<br />
oder betrieben werden.<br />
Große Gesinnungen und Gedanken sind uns immerfort nötig.<br />
Goethe
Bereits mit dem Finanzausgleichsgesetz<br />
2005 (FAG), kundgemacht<br />
in BGBl. I Nr. 156/2004,<br />
wurde den Gemeinden in § 15 Abs. 3<br />
Z. 5 mit Wirkung vom 1. 1. 20<strong>06</strong> die<br />
Ermächtigung eingeräumt, Abgaben für<br />
das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge<br />
in Kurzparkzonen gemäß § 25<br />
StVO 1960 einzuheben.<br />
Mit dieser Regelung wurde die Ermächtigung,<br />
derartige Abgaben einzuheben,<br />
in das „freie Beschlussrecht“ der Gemeinden<br />
übertragen.<br />
Bisher basierten die entsprechenden<br />
Gemeindeverordnungen auf dem Stmk.<br />
Parkgebührengesetz 1979, in dem den<br />
Gemeinden sowohl Mindest- als auch<br />
Höchsttarife für Kurzparkzonen als<br />
auch sonstige gebührenpflichtige Parkplätze<br />
vorgegeben waren.<br />
Durften die Gemeinden bislang nur<br />
aufgrund dieser landesgesetzlichen Ermächtigung<br />
Parkgebühren einheben, so<br />
stützt sich nunmehr die Ermächtigung<br />
unmittelbar auf das FAG.<br />
Damit sind zwar einige der Beschränkungen<br />
des Stmk. Parkgebührengesetzes<br />
1979 weggefallen, aber auch das<br />
FAG wiederum sieht einige Befreiungsbestimmungen<br />
vor, an die sich die<br />
Gemeinden zu halten haben.<br />
Von der Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe<br />
sind jedenfalls befreit:<br />
a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge vom<br />
öffentlichen Dienst (§§ 26 und 26a<br />
StVO)<br />
b) Fahrzeuge des Straßendienstes und<br />
der Müllabfuhr (§ 27 StVO)<br />
c) entsprechend gekennzeichnete Fahrzeuge,<br />
die von Ärzten bei einer Fahrt<br />
zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt<br />
werden<br />
d) entsprechend gekennzeichnete Fahrzeuge,<br />
die von Personen im diplomierten<br />
ambulanten Pflegedienst bei<br />
einer Fahrt zur Durchführung solcher<br />
Pflege gelenkt werden<br />
e) entsprechend gekennzeichnete Fahrzeuge,<br />
die von dauernd stark gehbehinderten<br />
Personen abgestellt oder<br />
in denen solche Personen befördert<br />
werden<br />
f) Fahrzeuge – ausgenommen Personenkraftwagen<br />
– die für den Bund,<br />
eine andere Gebietskörperschaft oder<br />
einen Gemeindeverband zugelassen<br />
sind<br />
g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke<br />
des Aus- und Einsteigens von Perso-<br />
Mag. Michael Neuner,<br />
<strong>Steiermärkischer</strong> Gemeindebund<br />
nen oder für die Dauer der Durchführung<br />
einer Ladetätigkeit gehalten<br />
werden.<br />
Gegenüber der bisherigen Rechtslage<br />
fallen insbesondere zwei Neuerungen<br />
zugunsten der Gemeinde ins Gewicht:<br />
Zum einen können Gemeinden in<br />
Kurzparkzonen hinkünftig nicht nur das<br />
Parken, sondern bereits das bloße Abstellen<br />
(d. h. „die ersten <strong>10</strong> Minuten“)<br />
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in<br />
einer Kurzparkzone für abgabepflichtig<br />
erklären, zum anderen sind für die<br />
Kurzparkzonentarife keine Höchstgrenzen<br />
(und auch keine Mindesttarife)<br />
mehr vorgesehen. Gebührenpflichtige<br />
Kurzparkzonen sind durch entsprechende<br />
Beschränkungszeichen gemäß § 52<br />
lit. a Z. 13d StVO samt Zusatz über die<br />
Gebührenpflicht zu kennzeichnen.<br />
Neben der bundesgesetzlichen Regelung<br />
zur Einhebung von Parkgebühren<br />
im FAG hat der Landesgesetzgeber von<br />
seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht,<br />
landesgesetzliche Regelungen über die<br />
Einhebung von Parkgebühren zu treffen.<br />
Mit 28. März 20<strong>06</strong> trat somit das<br />
Steiermärkische Parkgebührengesetz<br />
20<strong>06</strong> (LGBl. Nr. 37/20<strong>06</strong>) in Kraft.<br />
Unabhängig von der Tarifgestaltung für<br />
Kurzparkzonen besteht damit für die<br />
Gemeinden (weiterhin) die Möglichkeit,<br />
auch auf im öffentlichen Eigentum stehenden<br />
oder von Gebietskörperschaften<br />
gemieteten/gepachteten Verkehrsflächen,<br />
die nicht als Kurzparkzonen<br />
ausgewiesen sind, Parkgebühren einzuheben.<br />
Auch die Einhebung derartiger Abgaben<br />
braucht eine Grundlage in der Parkgebührenverordnung<br />
der Gemeinde. Die<br />
dafür bestimmten Verkehrsflächen sind<br />
durch die Hinweistafel „Gebührenpflichtige<br />
Parkplätze“, allenfalls samt<br />
den erforderlichen Zusatztafeln über<br />
die abgabepflichtigen Zeiträume, zu<br />
kennzeichnen.<br />
Bei dieser Parkraumbewirtschaftung ist<br />
jedoch jedenfalls zu beachten, dass der<br />
Landesgesetzgeber zwar keinen Mindesttarif<br />
mehr, sehr wohl jedoch einen<br />
Höchsttarif von € 0,80 je halbe Stunde<br />
festgesetzt hat.<br />
Die Gemeinde kann sowohl für Kurzparkzonen<br />
nach § 45 StVO als auch<br />
für gebührenpflichtige Parkplätze gegen<br />
Leistung einer Pauschalabgabe Ausnahmebewilligungen<br />
zum zeitlich unbeschränkten<br />
Parken erteilen. Diese kann<br />
RECHT & GESETZ<br />
Tarifbegrenzung für Kurzparkzonen entfällt<br />
nicht nur für in der Zone/dem Gebiet<br />
ansässige Bewohner und Unternehmer,<br />
sondern auch für dort tätige Dienstnehmer<br />
erteilt werden.<br />
Die Gemeinden sind angehalten, bestehende<br />
Kurzparkzonenverordnungen<br />
an die neue Gesetzeslage anzupassen.<br />
Seitens der Fachabteilung 7 des Amtes<br />
der Steiermärkischen Landesregierung<br />
wurde dankenswerterweise eine entsprechende<br />
Musterverordnung samt<br />
Erläuterungen ausgearbeitet und den<br />
Gemeinden bereits übermittelt. Diese<br />
Musterverordnung kann auch auf der<br />
Homepage des Steiermärkischen Gemeindebundes<br />
www.gemeindebund.<br />
steiermark.at im Mitgliederservice heruntergeladen<br />
werden.<br />
Rechnungslegung<br />
der Vereine<br />
Lansky/Matznetter/Pätzold/<br />
Steinwandtner/Thunshirn<br />
2. Auflage 20<strong>06</strong>, 574 Seiten, geb.<br />
€ 85,–<br />
ISBN 3-7073-0853-7, Linde Verlag<br />
Durch das Vereinsgesetz 2002<br />
wurden im Hinblick auf die<br />
Vereinsgebarung – insbesondere die<br />
Rechnungslegung der Vereine – und<br />
die damit verbundene Transparenz<br />
und Kontrolle neue Regelungen<br />
geschaffen, die zum Teil erhebliche<br />
Auswirkungen auf jeden einzelnen<br />
der unzähligen Vereine in Österreich<br />
haben.<br />
Im vorliegenden Buch werden – erstmals<br />
in diesem Umfang – Bedeutung,<br />
Aufgaben, Inhalt, Anforderungen<br />
und Auswirkungen der Gebarungsvorschriften,<br />
vor allem derjenigen<br />
über die Vereinsrechnungslegung,<br />
systematisch und verständlich dargestellt.<br />
Geschrieben von Praktikern,<br />
die in ihrer täglichen Arbeit vielfältig<br />
mit Vereinen zu tun haben und<br />
daher die Bedeutung der jeweiligen<br />
Bestimmungen für die Praxis aus<br />
eigener Erfahrung kennen, ist die<br />
Publikation ein hilfreiches Arbeitsmittel<br />
für einzelne Vereinsmitglieder,<br />
Funktionäre, Prüfer wie auch<br />
für beruflich mit Vereinen befasste<br />
Parteienvertreter.<br />
<strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong> 9
EUROPA<br />
Neues zu Europa<br />
Neues Grünbuch zur<br />
Energiepolitik<br />
Die EU-Kommission hat am 8. März ein<br />
weiteres Energie-Grünbuch angenommen<br />
– obwohl das letzte Grünbuch zur<br />
Energieeffizienz noch kein Jahr alt ist.<br />
Grund für dieses neuerliche Tätigwerden<br />
der Kommission war die Anfang<br />
des Jahres aufgetretene Versorgungskrise<br />
am Gasmarkt, wo sich die EU ihrer<br />
Energieabhängigkeit ein weiteres Mal<br />
schmerzlich bewusst wurde.<br />
Das Grünbuch mit dem Titel „Eine<br />
europäische Strategie für nachhaltige,<br />
wettbewerbsfähige und sichere Energie“<br />
soll daher die Basis für eine gemeinsame<br />
europäische Energiepolitik<br />
bilden. Der Aufbau einer gemeinsamen<br />
Außenpolitik im Energiebereich wird<br />
ebenso empfohlen wie eine Diversifizierung<br />
der Energiequellen sowie die<br />
verstärkte Förderung von erneuerbaren<br />
Quellen und innovativen Maßnahmen.<br />
Auch soll dem Klimaschutz verstärkte<br />
Aufmerksamkeit gewidmet und der<br />
europäische Energiebinnenmarkt vorangetrieben<br />
werden.<br />
Die drei Hauptpfeiler des Vorschlags<br />
sind Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit<br />
europäischer Unternehmen<br />
sowie Nachhaltigkeit und<br />
Begrenzung der Umweltauswirkungen.<br />
Eine öffentliche Konsultation soll Reaktionen<br />
auf mehr als 20 Vorschläge<br />
der Kommission ermöglichen, die sich<br />
auf folgende 6 vorrangige Bereiche<br />
konzentrieren: Vollendung des Energiebinnenmarkts,<br />
Solidarität zwischen den<br />
Mitgliedstaaten, nachhaltiger Energieträgermix,<br />
Reaktionen auf den Klimawandel,<br />
Strategie für Energietechnologien,<br />
Aufbau einer gemeinsamen Energieaußenpolitik.<br />
Nähere Informationen<br />
sind folgendem Link zu entnehmen:<br />
http://europa.eu.int/rapid/pressReleases<br />
Action.do?reference=IP/<strong>06</strong>/282&forma<br />
t=HTML&aged=0&language=DE&gui<br />
Language=en<br />
Elektroaltgeräte in RGRE-Abfallgruppe<br />
– interessante Kostenrechnung<br />
in Flandern<br />
Die Arbeitsgruppe Abfall des RGRE<br />
befasste sich in einer Sitzung am<br />
30. März insbesondere mit der Umsetzung<br />
der Elektroaltgeräte-Richtlinie<br />
und ließ dazu Vertreter von Industrie<br />
und Kommunalverbänden zu Wort<br />
kommen. Die Kritik des RGRE lautet,<br />
<strong>10</strong> <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
die Kommunen bekommen die Kosten<br />
der Sammlung und Aufbewahrung von<br />
Elektroaltgeräten nicht zwingend abgegolten,<br />
da die Industrie sich erst ab Abholung<br />
der Altgeräte in den Gemeinden<br />
verantwortlich fühlt und dementsprechende<br />
Kosten übernimmt.<br />
Diese Sichtweise wurde vom Vertreter<br />
von Elektrolux auch bestätigt, der<br />
den Text der Richtlinie dahingehend<br />
interpretierte, dass die Erzeugerverantwortung<br />
erst bei der Abholung der<br />
Altgeräte einsetzt. Er meinte aber,<br />
Kostenverlagerungen auf die kommunale<br />
Ebene, die auch im Interesse der<br />
Industrie seien, würden von dieser allenfalls<br />
auch abgegolten – als Beispiel<br />
nannte er eine detailliertere Trennung<br />
der unterschiedlichen Geräte bereits vor<br />
der Abholung, d. h. in den kommunalen<br />
Sammelstellen. Der Vertreter der Firma<br />
Epson sagte in aller Deutlichkeit, eine<br />
Rücknahme der Geräte durch die Hersteller<br />
wäre zwar ideal, in der Praxis für<br />
diese aber viel zu teuer. So teuer, dass<br />
die Hersteller das Recycling fremder<br />
Produkte eher in Kauf nehmen, als ein<br />
eigenes System zu initiieren.<br />
Hier knüpfte Christof Delatter vom<br />
Verband der flämischen Kommunen<br />
an und zeigte anhand einer Studie des<br />
Verbandes, welche Kosten in den flämischen<br />
Gemeinden für die Elektroaltgerätesammlung<br />
tatsächlich anfallen.<br />
Der Verband wollte im Rahmen einer<br />
groß angelegten Umfrage bei seinen<br />
Mitgliedsgemeinden bzw. bei den kommunalen<br />
Recyclinghöfen den Wahrheitsbeweis<br />
antreten, dass die kommunale<br />
Sammlung die günstigste Form<br />
der Rücknahme von Elektroaltgeräten<br />
ist, und erstmals auch die tatsächlichen<br />
Kosten dieser Rücknahme ermitteln.<br />
Der flämische Verband entwickelte<br />
dazu ein Kostenrechnungsmodell, das<br />
durch die Eingabe bestimmter Parameter<br />
die Durchschnittskosten eines<br />
modellhaften Recyclinghofs ermittelt.<br />
Dieses Modell ergab für den flämischen<br />
Referenzhof jährliche Betriebskosten<br />
von ca. 140.000 Euro für die Versorgung<br />
sämtlicher Abfälle. Die Kosten<br />
für die Versorgung der Elektroaltgeräte<br />
lassen sich am besten über einen Faktor<br />
aus notwendigem Arbeitsaufwand<br />
der Angestellten und notwendigem<br />
Containervolumen errechnen. Mithilfe<br />
dieses Modells konnte der flämische<br />
Umweltminister überzeugt werden,<br />
eine gesetzliche Pauschalvergütung für<br />
Kommunen festzuschreiben, um deren<br />
Aufwand für Abfälle mit Herstellerverantwortung<br />
abzugelten.<br />
Die Flamen planen, ihre Modellrechnung<br />
auch anderen Verbänden über das<br />
Internet zugänglich zu machen – eine<br />
Version in drei Sprachen wird derzeit erarbeitet.<br />
Nähere Informationen sowie die<br />
englische Präsentation des flämischen<br />
Modells können über das Brüsseler<br />
Gemeindebundbüro unter Telefon 0032<br />
2 282 <strong>06</strong>80, Fax 0032 2 282 <strong>06</strong>88 oder<br />
E-Mail oegemeindebund@skynet.be<br />
angefordert werden.<br />
Tourismusplattform bereitet<br />
Kongress vor<br />
Der Verband der öffentlichen Unternehmen<br />
hielt gemeinsam mit dem<br />
Deutschen Städte- und Gemeindebund<br />
am 5. April eine Sitzung seiner Tourismusplattform<br />
ab. Dabei ging es u. a.<br />
um die Vorbereitung des diesjährigen<br />
Kongresses in Bergisch Gladbach. Zu<br />
diesem Kongress, der am 27. und 28.<br />
November 20<strong>06</strong> stattfinden wird, sind<br />
auch österreichische Bürgermeister und<br />
Touristiker herzlich eingeladen.<br />
Zentrales Thema wird die Qualitätssicherung<br />
im Tourismus, mit einem<br />
Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung<br />
sowie Tourismus im Umland<br />
größerer Städte, sein.<br />
Das endgültige Programm wird in<br />
Kürze vorliegen. Interessierte Personen<br />
können nähere Informationen schon<br />
jetzt beim Brüsseler Gemeindebundbüro<br />
unter Telefon 0032 2 282 <strong>06</strong>80,<br />
Fax 0032 2 282 <strong>06</strong>88 oder E-Mail<br />
oegemeindebund@skynet.be anfordern.<br />
Mitteilung zu<br />
Sozialdienstleistungen von<br />
allgemeinem Interesse<br />
Am 26. April veröffentlichte die EU-<br />
Kommission eine Mitteilung über<br />
soziale Dienstleistungen von allgemeinem<br />
Interesse in der Europäischen<br />
Union. Damit knüpft die Kommission<br />
einerseits an das Weißbuch zu Dienstleistungen<br />
von allgemeinem Interesse<br />
von Mai 2004, andererseits an den überarbeiteten<br />
Kommissionsvorschlag zur<br />
Dienstleistungsrichtlinie von Anfang<br />
April 20<strong>06</strong> an.<br />
Grundtenor der Kommissionsmitteilung<br />
ist, dass auch auf Sozialdienstleistungen<br />
grundsätzlich die Binnenmarkt- und<br />
Wettbewerbsregeln anzuwenden sind<br />
– die Kommission spricht diesbezüglich
von einer „in sich schlüssigen Logik“.<br />
Auf der anderen Seite werden in der<br />
Mitteilung aber auch die Besonderheiten<br />
sozialer Dienste anerkannt, wie<br />
z. B. freiwillige und ehrenamtliche<br />
Mitarbeit, asymmetrische Zahlungsverhältnisse<br />
sowie das Funktionieren nach<br />
dem Solidaritätsgrundsatz oder ohne<br />
Erwerbszweck. Die Mitteilung versucht<br />
dennoch, diese Dienste vor allem von<br />
einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt<br />
zu betrachten und bietet neben der<br />
Aufstellung der besonderen Merkmale<br />
auch eine Übersicht über die geltende<br />
Rechtslage auf europäischer Ebene, wo<br />
sich insbesondere Beihilfen- und Vergaberecht<br />
auf die sozialen Dienstleistungen<br />
auswirken.<br />
Die Kommission erkennt einleitend die<br />
Bedeutung von sozialen Diensten für<br />
das europäische Gesellschaftsmodell<br />
an, streicht den Subsidiaritätsgrundsatz<br />
bei der Definition der sozialen Dienstleistungen<br />
durch die Mitgliedstaaten<br />
hervor, betont aber auch, dass den<br />
Mitgliedstaaten gemeinschaftsrechtliche<br />
Schranken in der Gebarung dieser<br />
Dienste auferlegt sind.<br />
So können die Mitgliedstaaten zwar<br />
Aufgaben von allgemeinem Interesse<br />
frei definieren und Organisationsgrundsätze<br />
festlegen. Diese Freiheit muss<br />
nach Ansicht der Kommission jedoch<br />
in transparenter Weise genutzt und das<br />
Konzept des allgemeinen Interesses<br />
darf nicht missbraucht werden. Um<br />
Missbräuche zu verhindern, sind die<br />
öffentlichen Gebietskörperschaften an<br />
den Grundsatz der Nichtdiskriminierung<br />
sowie an die vergaberechtlichen<br />
Regeln gebunden.<br />
Aus kommunaler Sicht stellt sich die<br />
Frage, was mit dem Begriff des möglichen<br />
Missbrauchs gemeint sein könnte<br />
bzw. ob die Kommission potentielle<br />
Missbräuche implizit unterstellen will.<br />
Denn mit der gewählten Definition<br />
wird der Eindruck erweckt, dass die<br />
Mitgliedstaaten vielleicht doch nicht<br />
vollkommen frei in der Definition und<br />
Organisation von Daseinsvorsorgeleistungen<br />
sein könnten, da sie damit das<br />
europäische Wettbewerbs- und Binnenmarktrecht<br />
umgehen könnten.<br />
Außerdem führt die Kommission einschränkend<br />
aus, dass Dienstleistungen<br />
wirtschaftlicher Art mit der Dienstleistungs-<br />
und Niederlassungsfreiheit sowie<br />
mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar<br />
sein müssen. Eine sehr restriktive Definition<br />
der „wirtschaftlichen Tätigkeit“<br />
wird gleich mitgeliefert, wonach praktisch<br />
alle Dienstleistungen im sozialen<br />
Bereich als wirtschaftliche Tätigkeit<br />
im Sinne des EG-V betrachtet werden<br />
können.<br />
Anhand konkreter Beispiele wird ab<br />
Seite 7 der Mitteilung dargestellt, wo<br />
die Kommission die Anwendbarkeit des<br />
gemeinschaftlichen Rechtsrahmens auf<br />
soziale Dienste für gegeben ansieht:<br />
1. Teilweise oder vollständige Delegation<br />
einer sozialen Aufgabe<br />
Sobald die öffentliche Hand Aufgaben<br />
an externe Partner übertragen oder mit<br />
dem privaten Sektor zusammenarbeiten<br />
will, kann (bei Überschreiten der<br />
Schwellenwerte) das Vergaberecht zur<br />
Anwendung gelangen. In diesem Fall<br />
muss die übertragende Gebietskörperschaft<br />
zumindest die Grundsätze der<br />
Transparenz, der Gleichbehandlung<br />
und der Verhältnismäßigkeit beachten.<br />
Es kann aber auch der Fall eintreten,<br />
dass die Vergabebehörde die Auftragsunterlagen<br />
technisch detailliert<br />
zu spezifizieren hat, um den Transparenzgrundsatz<br />
einzuhalten. Dies erscheint<br />
gerade im Bereich der sozialen<br />
Dienstleistungen kompliziert, da sich<br />
diese durch eine hohe Flexibilität und<br />
Reagieren auf den Einzelfall auszeichnen<br />
– was auch von der Kommission<br />
anerkannt wird.<br />
2. Öffentlich-private Partnerschaften<br />
Wenn soziale Dienste im Wege öffentlich-privater<br />
Partnerschaften erbracht<br />
werden, ist unter Verweis auf das Stadt-<br />
Halle-Urteil des EuGH stets ein Vergabeverfahren<br />
anzuwenden. Indem die<br />
Kommission einen Verweis auf dieses<br />
Urteil in die Mitteilung aufnimmt, ver-<br />
Anonyme Schreiben behaupten etwas,<br />
dessen Unrichtigkeit der Verfasser<br />
durch Verweigerung seiner Unterschrift bestätigt.<br />
Peter Rosegger<br />
EUROPA<br />
deutlicht sie ihre Rechtsmeinung, dass<br />
PPP-Modelle auch im Bereich der sozialen<br />
Dienste gegenüber privaten Anbietern<br />
nicht privilegiert werden dürfen.<br />
In der Praxis würde dies bedeuten, dass<br />
gemischt-wirtschaftliche Unternehmen<br />
mit privaten Konkurrenten in Wettbewerb<br />
treten müssen.<br />
3. Kostenerstattung durch die öffentliche<br />
Hand<br />
Wenn Behörden Aufwendungen externer<br />
Einrichtungen im Zusammenhang<br />
mit der Erfüllung sozialer Dienste<br />
abgelten, müssen sie die diesbezüglich<br />
bestehenden Beihilfenregeln beachten.<br />
Ein Großteil der den Sozialdiensten<br />
bezahlten Erstattungen ist gemäß der<br />
Kommissionsentscheidung K(2005)<br />
2673 automatisch mit den Wettbewerbsbestimmungen<br />
vereinbar. Werden bestimmte<br />
Schwellenwerte überschritten,<br />
muss aber nach wie vor die Zustimmung<br />
der Kommission zur Ausgleichsgewährung<br />
eingeholt werden.<br />
Werden Dienstleister jedoch durch<br />
einen Rechtsakt beauftragt, der diesen<br />
als Dienst von allgemeinem Interesse<br />
festschreibt, gelten die genannten Erleichterungen<br />
und Vereinfachungen im<br />
Hinblick auf die Notifizierung nicht.<br />
Eine generalisierende Aufgabenübertragung<br />
z. B. an wohltätige Vereine könnte<br />
dadurch ausgeschlossen werden.<br />
Weitere Begriffsklärungen der Kommission<br />
betreffen Marktregulierungsmaßnahmen<br />
sowie die Aufstellung von<br />
Regeln für den Marktzugang.<br />
Auch wenn die Mitteilung keine Neuigkeiten<br />
enthält, sondern die bereits<br />
bekannte Rechtsmeinung der Kommission<br />
wiedergibt, sollte der Konsultationsprozess<br />
im Auge behalten werden.<br />
Die Kommission schlägt von sich aus<br />
keine Sonderregeln für den sozialen<br />
Bereich vor. Dies wäre daher Aufgabe<br />
der Mitgliedstaaten und Teilnehmer am<br />
Konsultationsprozess.<br />
Bis Mitte 2007 soll eine Studie vorliegen,<br />
die sich mit der Funktionsweise<br />
des Sektors befasst. In der Folge sollen<br />
regelmäßig Berichte erstellt werden, ein<br />
legistisches Vorgehen ist nicht ausgeschlossen.<br />
http://www.europa.eu.int/comm/<br />
employment_social/social_protection/<br />
docs/com_20<strong>06</strong>_177_de.pdf<br />
<strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong> 11
UMWELT<br />
Papierverpackungen als<br />
„Recyclingwunder“<br />
Bereits 87 Prozent aller Papierverpackungen werden<br />
nach Gebrauch wiederverwertet<br />
Das österreichische System der<br />
Sammlung und Wiederverwertung<br />
von Verpackungen<br />
aus Papier, Karton, pappe und Wellpappe<br />
hat sich zum internationalen<br />
Musterbeispiel für eine ökologisch<br />
organisierte Kreislaufwirtschaft entwickelt.<br />
Im Jahr 2005 wurden so viele<br />
Papierverpackungen wie noch nie der<br />
Wiederverwertung zugeführt – und<br />
dies zu den geringen Kosten von<br />
jährlich nur 4 Euro pro Kopf der Bevölkerung.<br />
Dies stellt die Altpapier-<br />
Recycling-Organisationsgesellschaft<br />
(ARO) in ihrem Report 2005 fest.<br />
Die Recycling-Quote von Papierverpackungen<br />
ist im vergangenen Jahrzehnt<br />
von 83 Prozent im Jahr 1995<br />
auf den neuen Rekordwert von 87<br />
Prozent im Jahr 2005 gestiegen. Zu<br />
dieser hohen Quote tragen Handel,<br />
Gewerbe und Industrie sowie Konsumenten<br />
gleichermaßen bei.<br />
Altpapier als wertvoller Rohstoff<br />
Im Jahr 2005 kamen in Österreich<br />
560.000 Tonnen Verpackungen aus<br />
Papier, Karton, Pappe und Wellpappe<br />
auf den Markt. Diese Verpackungen<br />
finden nach Gebrauch bis zu sechsmal<br />
Verwendung als Rohstoff zur<br />
12 <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
Erzeugung neuer Papierverpackungen:<br />
87 Prozent, das sind 487.000 Tonnen,<br />
wanderten bundesweit wieder zurück<br />
in die Papierfabriken. Die Sammelmenge<br />
stammt zu etwa drei Vierteln<br />
aus Handel, Gewerbe und Industrie<br />
und zu einem Viertel aus Österreichs<br />
Haushalten. Im Gewerbe erreichte die<br />
Sammelquote im Vorjahr 90 Prozent,<br />
bei den Haushalten 78 Prozent.<br />
Marktführer bei der Sammlung und<br />
Verwertung von Verpackungen aus Papier,<br />
Karton, Pappe und Wellpappe ist in<br />
Österreich die ARO. Sie sammelte 2005<br />
zwei Drittel aller Papierverpackungen.<br />
Die außerhalb des ARO-Systems gesammelten<br />
Papierverpackungen werden<br />
großteils von den Anfallstellen selbst<br />
gesammelt und an die Papierfabriken<br />
zur Verwertung geliefert.<br />
Der weitere Anstieg der Altpapier-Sammelmenge<br />
ist zu einem Gutteil auch auf<br />
das bequemste Sammelsystem der Welt<br />
zurückzuführen, das wir besitzen. Österreichweit<br />
stehen mittlerweile 833.000<br />
Altpapier-Sammelbehälter – das ist je<br />
ein Behälter für vier Haushalte – zur<br />
Verfügung. Das ist weltweit ein Spitzenwert!<br />
Darüber hinaus belegt das stetige<br />
Ansteigen der Altpapier-Sammelmenge,<br />
dass Städte und Gemeinden sowie die<br />
Entsorgungspartner vor Ort hervorragende<br />
Arbeit leisten.<br />
Mobilfunk im<br />
Spannungsfeld<br />
zwischen<br />
Kommerz,<br />
Gesundheit und<br />
demokratischer<br />
Kultur<br />
In einer Veranstaltung am 26. April<br />
in Kapfenberg wurde über Handy,<br />
WLan und Co. diskutiert<br />
Sind die elektromagnetischen<br />
Felder, die von Mobilfunkgeräten<br />
wie Handy, Schnurlostelefonen<br />
oder kabellosen Netzwerken<br />
(WLan = wireless local area network)<br />
erzeugt werden, gesundheitsschädlich?<br />
Beeinflussen diese Strahlen<br />
unser Wohlbefinden oder das Wachstum<br />
von Pflanzen? Welche rechtlichen<br />
Schritte zur Verhinderung von<br />
Mobilfunkmasten in Wohngebieten<br />
gibt es überhaupt?<br />
Um Fragen wie diese – die immer<br />
mehr Menschen in unserer „mobilen“<br />
Alltagswelt beschäftigen – zu beantworten<br />
und rechtliche Möglichkeiten<br />
aufzuzeigen, hatte die Umweltanwältin<br />
des Landes Steiermark, MMag.<br />
Ute Pöllinger, für 26. April 20<strong>06</strong> eine<br />
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung<br />
mit hochkarätigen Experten in<br />
Kapfenberg organisiert.<br />
Der Umweltmediziner des Landes<br />
Salzburg, Dr. Gerd Oberfeld, zeigte<br />
dem zahlreich erschienenen Publikum<br />
anhand mehrerer wissenschaftlicher<br />
Studien die Auswirkungen von<br />
elektromagnetischer Strahlung auf<br />
menschliches und tierisches Zellmaterial.<br />
Seine Schlussfolgerung lautete,<br />
dass die feldintensive Kurzzeitbelastung<br />
des menschlichen Körpers bei<br />
Mobil- oder digitalen Schnurlostelefonen<br />
bei 24-stündiger Daueranwendung<br />
in etwa der Belastung von 1600<br />
Lungenröntgen entspricht.<br />
Derzeit besteht für Betroffene keinerlei<br />
Möglichkeit, erfolgreich gegen<br />
von Mobilfunkanlagen ausgehende<br />
Immissionen vorzugehen. Rechtliche<br />
Belange erläuterte Dr. Eduard Christian<br />
Schöpfer vom Österreichischen<br />
Institut für Menschenrechte. Dieses<br />
Institut hegt ernste Zweifel, dass
Österreich seiner positiven Verpflichtung<br />
gemäß der Europäischen<br />
Menschenrechtskonvention (EMRK),<br />
das Leben und die Gesundheit seiner<br />
Bürger im Wege geeigneter gesetzgeberischer<br />
Maßnahmen zu schützen<br />
und ihnen effektive Rechtsdurchsetzungsmechanismen<br />
zur Wahrung<br />
ihrer Konventionsrechte zur Verfügung<br />
zu stellen, nachkommt.<br />
Mag. Andrea Teschinegg von der<br />
Fachabteilung 13B des Landes<br />
Steiermark, zuständig für Baurecht,<br />
zeigte auf, dass sich die Baugesetzgebung<br />
im Einflussbereich der<br />
Länder hauptsächlich auf den Landschaftsschutz<br />
bezieht. Eine gern<br />
genutzte Umgehungsmöglichkeit<br />
für Mobilfunkbetreiber sei daher die<br />
Anbringung von Sendeanlagen auf<br />
bereits bestehenden Masten, wie zum<br />
Beispiel Strommasten. Diese Anlagen<br />
sind dann baurechtlich nicht mehr<br />
genehmigungspflichtig, da für die<br />
bestehenden Masten bereits eine Genehmigung<br />
vorliegt.<br />
Mag. Harald Gerstgrasser, Lehrer<br />
für Mathematik, Physik und Informatik<br />
am BORG Bad Aussee,<br />
veranstaltete bereits mehrere Projekte<br />
zu dem Thema „Mobilfunk“,<br />
die vom Bundesministerium für<br />
Bildung, Wissenschaft und Kunst<br />
mehrmals mit dem ersten Preis des<br />
Umweltbildungsfonds ausgezeichnet<br />
wurden. Gerstgrasser möchte mit seinen<br />
Projekten Aufklärung betreiben.<br />
Eltern hätten großteils keine Ahnung,<br />
welches Instrument ihren Kindern<br />
da in die Hand gegeben wurde. Es<br />
werde nach dem Motto agiert „jeder<br />
verwendet es und keiner weiß, wie’s<br />
funktioniert“.<br />
Bürgermeister Otto Marl, Bad Aussee,<br />
brachte abschließend die problematische<br />
Situation des Themas „Mobilfunk“<br />
auf den Punkt: „Das Handy<br />
ist Teil unseres Wohl-Stand(ard)s<br />
geworden, es soll Mittel zum Zweck<br />
bleiben und nicht Mittelpunkt werden.<br />
Niemand kennt die damit verbundenen<br />
Gefahren wirklich. Genau<br />
deshalb ist Vorsicht angebracht!“<br />
Weiterführende Informationen<br />
gibt es unter:<br />
www.umweltanwalt.steiermark.at<br />
www.salzburg.gv.at/themen/gs/<br />
gesundheit/umweltmedizin.htm<br />
www.borg-aussee.at<br />
Parks und Grünflächen –<br />
Natur findet Stadt<br />
Schattige Bäume, blühende Sträucher<br />
und sonnige Grünflächen<br />
laden im Frühling ein, sich zu<br />
entspannen, auszurasten, zu plaudern,<br />
zu spielen und den langen Winter hinter<br />
sich zu lassen. Parks decken den<br />
täglichen Bedarf an Grün für Kinder,<br />
Ältere und weniger mobile Menschen.<br />
Abgesehen von der sozialen Funktion<br />
im überbauten und versiegelten Raum<br />
filtern sie Staub, produzieren Sauerstoff,<br />
befeuchten und kühlen die Luft und sind<br />
Teil von „Grünlungen“, die für Frischluftzufuhr<br />
sorgen.<br />
Park ist nicht gleich Park<br />
Während Zierparks mit wenigen, dafür<br />
aber umso exotischeren Arten bestenfalls<br />
noch der Erholung dienen und<br />
vielleicht etwas Farbe in graue Häuserschluchten<br />
bringen, sind Öko- oder<br />
Wildnisparks – wie bereits in Graz oder<br />
Linz realisiert – wahre Naturinseln in<br />
der Großstadt und Zentren oft erstaunlicher<br />
Artenvielfalt. In den großen<br />
naturnahen Anlagen Berlins wurden<br />
bis zu 400 verschiedene Pflanzenarten<br />
gezählt. Vor allem für Totholz bewohnende<br />
Insekten und Höhlenbrüter haben<br />
mit Altbäumen bestandene Flächen eine<br />
immense Bedeutung als Lebensraum.<br />
Oft aber leiden öffentliche Grünflächen<br />
und damit auch ihre Nutzer an einem<br />
Mangel an Mut und Kreativität ihrer<br />
„Betreuer“: Einheitsbepflanzung, meist<br />
viel zu intensiver Pflegeaufwand, penibles<br />
„Aufräumen“ bis in den letzten<br />
Winkel, lieblose Gestaltung von Kinderspielplätzen<br />
und Aufenthaltsräumen<br />
machen die Naturflächen zum uniformen<br />
Repräsentationsgrün.<br />
Was ist zu tun?<br />
Eine Umstellung von einer gärtnerisch<br />
orientierten hin zur extensiven naturnahen<br />
Pflege ist ein wichtiger Schritt zu<br />
mehr Natur im Siedlungsraum. Erste<br />
Voraussetzung dafür ist der Verzicht<br />
auf Herbizide bei der Beseitigung von<br />
unerwünschtem Gras- und Krautwuchs<br />
sowie der Verzicht von Mineraldünger.<br />
Des weiteren gilt: Möglichst viele heimische<br />
standortgerechte Pflanzen verwenden,<br />
Beete mit einjährigen Blumen,<br />
die einen hohen Kosten- und Arbeitsaufwand<br />
erfordern, in abwechslungsreiche<br />
und pflegeleichte Staudenanlagen verwandeln;<br />
Teile früherer Rasenflächen<br />
könnten als Wiesen „bewirtschaftet“<br />
UMWELT<br />
und Blumenwiesen angesät werden.<br />
In speziellen Schutz- und Ruhezonen<br />
sollte bei allen Pflegemaßnahmen die<br />
Natur Vorrang haben. Besonders wichtig<br />
für die Struktur- und Lebensraumvielfalt<br />
ist es, Gewässer in Parkanlagen<br />
zu erhalten bzw. neue anzulegen. Alte,<br />
auch abgestorbene Bäume sollten<br />
stehen gelassen werden, solange sie<br />
keine unmittelbare Bedrohung für den<br />
Menschen darstellen. Das Anbringen<br />
von Nistkästen für Halbhöhlen- und<br />
Höhlenbrüter, das Mulchen mit Häckselmaterial<br />
zur Förderung der Bodenfauna,<br />
das Belassen von Falllaub, die Pflanzung<br />
von Wildhecken, das Stehenlassen<br />
von Baumstümpfen für Hirschkäfer, die<br />
Schaffung von Winterquartieren für<br />
Igel, der Bau von Trockenmauern usw.<br />
sind weitere Möglichkeiten, die Naturausstattung<br />
zu bereichern.<br />
Ein Inventar der Baumarten – womöglich<br />
gemeinsam mit Schulklassen<br />
erstellt – kann das Bewusstsein für die<br />
Vielfalt und den Wert von Park- und<br />
Alleebäumen fördern.<br />
Für Fragen zu den Themen Naturschutz<br />
und Stadtökologie oder zur Kampagne<br />
NATUR findet Stadt wenden Sie sich<br />
bitte an den Naturschutzbund Steiermark,<br />
Dr. Axel Piswanger, Naturschutzbund<br />
Steiermark, Heinrichstraße<br />
5/II, 80<strong>10</strong> Graz, Tel.: 0316/322377-<br />
2, Fax: DW 4 oder die Homepage<br />
www.naturschutzbund.at.<br />
Quelle: ÖKO-L Zeitschrift für Ökologie, Natur<br />
und Umweltschutz, Naturkundliche Station<br />
der Stadt Linz; www.wien.gv.at/ma22/<br />
Ein Ort der Naherholung und<br />
des Natur-Erlebens<br />
© Foto:<br />
SBZ NaturErlebnisPark Graz-Andritz<br />
<strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong> 13
LAND & GEMEINDEN<br />
Töchtertag<br />
Am 2. Juni 20<strong>06</strong> begleiten Mädchen Eltern in den Betrieb<br />
Am 2. Juni 20<strong>06</strong> ist in den<br />
Bezirken Bruck/Mur,<br />
Deutschlandsberg und Weiz<br />
TöchterTag! An diesem besonderen<br />
Tag begleiten Mädchen im Alter<br />
zwischen <strong>10</strong> bis 14 Jahren einen<br />
Elternteil zur Arbeit, vorzugsweise<br />
in einen handwerklich-technischen<br />
Berufszweig. Betriebe werden<br />
ersucht, sich zu beteiligen, indem<br />
sie die Töchter ihrer Mitarbeiter/innen<br />
einladen. So ermöglichen<br />
Eltern, Wirtschaft und Schule gemeinsam<br />
den Mädchen frühzeitig<br />
einen Einblick in die Arbeitswelt<br />
und helfen mit, die Berufsperspektiven<br />
zu erweitern.<br />
Der Töchtertag, initiiert von der Grazer<br />
Mädcheneinrichtung MAFALDA,<br />
hat sich seit seinem Start vor 2 Jahren<br />
zu einem geschätzten Berufsorientierungstag<br />
entwickelt. Jahr für Jahr<br />
14 <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
kommt ein neuer steirischer Bezirk<br />
hinzu, und die Anzahl der Teilnehmenden<br />
wächst. Die Beteiligung im Vorjahr<br />
war enorm: 700 Schülerinnen<br />
haben in den Bezirken Deutschlandsberg<br />
und Weiz in 500 Betrieben ihren<br />
Eltern bei der Arbeit über die Schulter<br />
geschaut. Der heurige TöchterTag wird<br />
wieder in diesen beiden Bezirken stattfinden.<br />
Der Bezirk Bruck/Mur kommt<br />
neu dazu.<br />
Tatsache ist, dass Mädchen aus einem<br />
engeren Berufswahlspektrum als Buben<br />
wählen und Frauen in technischen Ausbildungen<br />
und Berufen noch immer<br />
Ausnahmen sind. Beispielsweise absolvieren<br />
in der Steiermark fast 70 %<br />
aller jungen Frauen eine Lehre im<br />
Dienstleistungsbereich – Handel, Büro,<br />
Friseur- oder Gastgewerbe. Damit<br />
schöpfen sie ihre Fähigkeiten nicht aus<br />
und verzichten auf gut bezahlte Arbeits-<br />
Neues Magazin für Kultur, Brauchtum und<br />
Tourismus „durchs Steirerland“<br />
Wie gut besucht war Ihre letzte Veranstaltung?<br />
Sie haben viel Geld und Zeit in die Planung und Organisation Ihrer Veranstaltung, wie zum Beispiel Blasmusiktreffen,<br />
Volkstanzen, aber auch Ausstellung oder Konzert, investiert und trotzdem blieben einige Plätze leer. Ihre Veranstaltung hat<br />
das Potenzial, Besucher aus Nah und Fern anzulocken. Allerdings wissen Sie nicht, wie Sie diese Kulturinteressierten kostengünstig<br />
erreichen können. Sie sind im kulturellen Bereich sehr engagiert. Nur leider weiß niemand davon. Dabei ist es<br />
gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, der Bevölkerung ein positives Bild zu vermitteln.<br />
Die Lösung darauf ist das Magazin „durchs Steirerland“.<br />
Sind Ihre touristischen Attraktionen der Öffentlichkeit bekannt?<br />
In Ihrer Gemeinde gibt es bestimmt unbekannte kulturelle Schätze, wie zum Beispiel Kirchen, Ruinen, Schlösser, Museen<br />
oder Sonstiges, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Sie verfügen in Ihrem Gemeindegebiet über Wander- und Radwege<br />
in einer reizvollen Landschaft, auf die sich nur vereinzelt Touristen verirren. Ihre touristischen Attraktionen sind schon<br />
erschlossen und Sie denken nach, wie Sie neue Besucher erreichen können.<br />
Genau dafür gibt es das Magazin „durchs Steirerland“.<br />
„durchs Steirerland“ – Magazin für Kultur, Brauchtum und Tourismus<br />
Das Magazin erscheint steiermarkweit und bietet Ihnen die Möglichkeit auf 140.000 Kontakte! Unsere Leser stammen aus<br />
der A- bzw. B-Schicht und sind sehr an Kultur und Tourismus interessiert. Unser Design ist jung und dynamisch. Wir erscheinen<br />
vierfärbig auf glänzendem Papier und im immer beliebter werdenden Kleinformat DIN A5. Wir bieten Ihnen die<br />
Möglichkeit, sich und Ihre Gemeinde im kulturellen und touristischen Bereich steiermarkweit mit einem redaktionellen PR-<br />
Beitrag zu präsentieren.<br />
Für einen geringen Druckkostenbeitrag erhalten Sie folgende Leistungen:<br />
1/1 Seite inkl. 2 Fotos für nur € 690,- (inkl. 200 Belegexemplare à € 2,50)<br />
1/2 Seite inkl. 1 Foto für nur € 390,- (inkl. <strong>10</strong>0 Belegexemplare à € 2,50)<br />
(Alle Preise verstehen sich netto, exkl. Texterstellung und exkl. Fototermin)<br />
Für Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:<br />
Anton Wilflinger, Telefon <strong>06</strong>99/196 34 261, anton.wilflinger@inode.at<br />
Michaela Feiner, Telefon <strong>06</strong>99/<strong>10</strong>9 67 589, michaela.feiner@inode.at<br />
Rollenmuster kennen lernen.<br />
Der TöchterTag wird vom Land Steiermark Ressort Soz<br />
auf breiter Ebene von den zuständigen Stellen im Land un<br />
unterstützt.<br />
Nähere Informationen finden Sie auf www.mafalda.at<br />
plätze. Den Betrieben aber fehlt gerade<br />
in technischen Berufsfeldern qualifizierter<br />
Nachwuchs.<br />
Nicht mangelnde Fähigkeiten und Interessen,<br />
sondern fehlende weibliche Vorbilder<br />
und unrealistische Vorstellungen<br />
von technischen Berufen beeinflussen<br />
die Berufswahl von Mädchen. Indem<br />
Mädchen am 2. Juni einen Elternteil zur<br />
Arbeit begleiten, erhalten sie realistische<br />
Vorstellungen von der Arbeitswelt<br />
und können Berufe abseits gängiger<br />
Rollenmuster kennen lernen.<br />
Der TöchterTag wird vom Land Steiermark<br />
– Ressort Soziales und Arbeit<br />
finanziert und auf breiter Ebene von den<br />
zuständigen Stellen im Land und in den<br />
Bezirken unterstützt.<br />
Nähere Informationen finden Sie auf<br />
www.mafalda.at<br />
PR
• Eisenerz. – Dass die Kultur in der<br />
Stadtgemeinde eine große Rolle<br />
spielt, beweist das vielfältige Programm<br />
für dieses Jahr. Die ortsansässigen<br />
Vereine leisten unverzichtbare<br />
kulturelle Arbeit und sorgen für abwechslungsreiche<br />
Unterhaltung. So<br />
wird am 5. Juli der Bergmannplatz<br />
Schauplatz eines von der Stadtkapelle<br />
veranstalteten Spektakels, nämlich<br />
der bereits bekannten Klangvision,<br />
sein. Im Oktober folgen die bereits<br />
traditionellen Volkskulturtage mit<br />
dem Echo- und Weisenbläsertreffen<br />
am Leopoldsteinersee und Anfang<br />
Dezember soll erstmals die „Bergmännische<br />
Weihnacht“, die das<br />
Brauchtum der Bergleute zeigt,<br />
stattfinden.<br />
• Fohnsdorf. – Mit Musik, Tanz und<br />
Gedichten läuteten die Schüler der<br />
Hauptschule ein bauliches Großprojekt<br />
ein. Sie umrahmten den<br />
Spatenstich für den Bau einer 800<br />
Quadratmeter großen Sporthalle.<br />
Das Gebäude entsteht auf einer<br />
Wiese westlich der Hauptschule.<br />
In der Halle werden nicht nur die<br />
Schüler ihren Turnunterricht haben,<br />
sondern stehen die Türen auch<br />
verschiedenen Vereinen offen. Die<br />
Eröffnung soll Ende Februar 2007<br />
sein.<br />
• Gleisdorf. – Ende April wurde<br />
die Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft<br />
Weiz im sogenannten<br />
„Life-Center Gleisdorf“ eröffnet.<br />
Diese Niederlassung beherbergt das<br />
Sozialreferat, die Jugendwohlfahrt<br />
und das Forstreferat. Bisher war die<br />
Außenstelle der BH im ehemaligen<br />
Armenhaus der Stadt, das 1883 errichtet<br />
wurde, untergebracht.<br />
• Kainbach bei Graz. – Mit der<br />
Sportanlage wurde ein weiteres Zentrum<br />
für sportlich ambitionierte und<br />
interessierte Bürger geschaffen. Die<br />
Orts- und Kulturentwicklungs-KEG<br />
hat damit einen weiteren Schritt zur<br />
Steigerung der Lebensqualität der<br />
Bewohner dieser Region gesetzt.<br />
Das umfangreiche Eröffnungsprogramm<br />
bot einen Festakt in der<br />
Stockhalle, ein „Spangerlschießen“<br />
sowie ein Fußballturnier.<br />
• Kapfenberg. – Versteckte Kleinode<br />
sollen besser zur Geltung gebracht<br />
werden, und so wurde mit der wenig<br />
bekannten Engelskapelle auf dem<br />
Hühnerberg im Ortsteil Hafendorf<br />
der Anfang gemacht. Durch die Rodung<br />
des Platzes um das Kirchlein<br />
ist die Engelskapelle nun weithin<br />
sichtbar.<br />
• Kraubath an der Mur. – Die<br />
Arbeiten für die Ortschronik, die<br />
im November offiziell präsentiert<br />
werden soll, gehen nun in die Endrunde.<br />
Drei Schwerpunkte werden<br />
die Aufzeichnungen haben: ein Häuserbuch<br />
beleuchtet die Geschichte<br />
der Bauernhöfe im Gemeindegebiet,<br />
dazu kommen volkskundliche Aspekte<br />
und besonderes Augenmerk<br />
wird auf die siedlungsgeschichtliche<br />
Entwicklung gelegt. Eine wesentliche<br />
Grundlage für die Aufarbeitung<br />
der Ortsgeschichte stellt die 17 Jahre<br />
lang verschollene Pfarrchronik dar,<br />
die auf kuriose Art und Weise doch<br />
noch gefunden wurde.<br />
• Leoben. – Ein neues Dienstleistungszentrum,<br />
das modernsten Standards<br />
und höchsten Ansprüchen entspricht,<br />
sorgt für die weitere Stärkung der<br />
Wirtschaftskraft in der Stadtgemeinde.<br />
Bei der Eröffnung Anfang<br />
April würdigten viele Festgäste den<br />
erfolgreichen Weg der Stadt zu wirtschaftlichem<br />
Erfolg. Auch konnte<br />
das Gebäude mit einer Gesamtfläche<br />
von 5.300 Quadratmetern bereits zur<br />
Gänze vermietet werden.<br />
• Sankt Johann in der Haide. – In<br />
sonniger Lage entstehen fünf Doppelhäuser<br />
mit einer zentralen Heizungsanlage<br />
auf biologischer Basis.<br />
Die Vorbereitungsarbeiten für das<br />
Reihenhausprojekt begannen vor<br />
rund fünf Jahren, nun konnte Anfang<br />
April zum Spatenstich geladen werden.<br />
• Stainz. – In einem der ältesten Gebäude<br />
der Marktgemeinde wurde ein<br />
passendes Objekt gefunden, um das<br />
Projekt „Weinhaus“ zu realisieren.<br />
Über vier Stockwerke erstrecken<br />
sich die Räumlichkeiten mit einer<br />
Bar, einer Schauküche und einem<br />
den modernsten Erfordernissen entsprechenden<br />
Seminarraum. Im vollklimatisierten<br />
Keller können auch<br />
Privatpersonen Weinfächer mieten.<br />
Rund 500 Produkte zu 90 Prozent<br />
aus Österreich werden angeboten.<br />
Das Haus soll ein Treffpunkt für<br />
Weinfreunde und Genussliebhaber<br />
werden.<br />
KURZMELDUNGEN<br />
• Voitsberg. – Der Schlossberg wird<br />
neu gestaltet und nach dem Wind-<br />
und Schneebruch sowie der Borkenkäferplage<br />
teilweise aufgeforstet.<br />
Durch die Bewohner der Stadt kann<br />
für jeden Baum eine Patenschaft<br />
übernommen werden. Interessenten<br />
können sich im Bürgerservice-Büro<br />
im Rathaus für die Aktion anmelden<br />
und man erfährt dort den genauen<br />
Termin, wann man selbst unter<br />
fachkundiger Anleitung zum Spaten<br />
greifen und den Setzling in die Erde<br />
stecken kann. Insgesamt werden rund<br />
<strong>10</strong>.000 Bäume gesetzt, in etwa so<br />
viele, wie die Stadt Einwohner hat.<br />
• Wörschach. – Vor einhundert Jahren<br />
erschlossen die Ortsbewohner<br />
in mühevoller Arbeit die Klamm<br />
durch Steige und dieses Jubiläum<br />
wird mit einem vielfältigen Programm<br />
gefeiert. Der Auftakt erfolgt<br />
am letzten Mai-Wochenende mit<br />
Musik, Tanz, Frühschoppen, Kinderprogramm,<br />
geführten Wanderungen<br />
und das Aufstellen eines keltischen<br />
Maibaums. Weiters werden ab 26.<br />
Mai an jedem Freitag Klamm-<br />
Wanderungen samt Weinverkostung<br />
angeboten. Im Jahr 1938 wurde die<br />
wildromantische Schlucht zum Naturdenkmal<br />
ernannt, nach Zerstörungen<br />
durch Unwetter und Erdrutsche<br />
konnten die Schäden immer wieder<br />
saniert werden. Heute führen leicht<br />
begehbare und gesicherte Steige<br />
durch das beeindruckende Gelände.<br />
• Wörth an der Lafnitz. – Auch<br />
heuer fand Ende April in der Gemeinde<br />
wieder der traditionelle<br />
„Georgikirtag“ statt. Diesen Kirtag<br />
gibt es bereits seit der Gründung der<br />
Pfarre im Jahr 1313. Die Kirche in<br />
Wörth ist die älteste im Lafnitztal,<br />
jedes Jahr wird nach dem Kirchgang<br />
auf den Straßen sowie in der<br />
Veranstaltungshalle dieses Ereignis<br />
gefeiert.<br />
• Zeltweg. – Dem Thema „Lesen“<br />
widmeten sich die Kindergärten der<br />
Stadtgemeinde. Hintergrund war, das<br />
Interesse der Kleinen am Lesen zu<br />
wecken. Aufmerksam und mit großer<br />
Begeisterung lauschten sie den<br />
phantasievollen Geschichten, die<br />
von Kindern der ersten und zweiten<br />
Klasse der Volksschule vorgelesen<br />
wurden. Auch künftig sind Aktionen,<br />
an denen Kindergarten und<br />
Volksschule teilnehmen, geplant.<br />
<strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong> 15
TERMINE<br />
<strong>Steirische</strong> Gemeindeverwaltungsakademie<br />
Seminarprogramm Frühjahr 20<strong>06</strong><br />
Für folgende Seminare<br />
sind noch Plätze frei:<br />
Bau- und feuerpolizeiliches<br />
Verfahren<br />
MAG. EUGEN PACHLER<br />
8. 6. 20<strong>06</strong> – Hotel Novapark, Graz<br />
EUR <strong>10</strong>0,–<br />
Dienstrecht für<br />
Gemeindevertragsbedienstete II<br />
DR. WOLFGANG DOMIAN<br />
12. 6. 20<strong>06</strong> – Hotel Novapark, Graz<br />
EUR <strong>10</strong>0,–<br />
P.b.b. – Verlagspostamt 8020 Graz – Erscheinungsort Graz – GZ 02Z031348 M<br />
16 <strong>Steirische</strong> <strong>Gemeindenachrichten</strong> 6/<strong>06</strong><br />
Die Gemeinde als Vermieter<br />
MAG. HEINZ KUPFERSCHMID<br />
21. 6. 20<strong>06</strong> – Hotel Novapark, Graz<br />
EUR <strong>10</strong>0,–<br />
Beschwerdemanagement am Telefon<br />
– Professioneller Umgang mit sich<br />
selbst und dem aufgebrachten<br />
Bürger<br />
MAG. DR. PETRA HAUPTFELD-<br />
GÖLLNER<br />
22. 6. 20<strong>06</strong> – Hotel Novapark, Graz<br />
EUR <strong>10</strong>0,–<br />
-------------------------------<br />
Seminarzeit: jeweils 9.00 bis 17.00<br />
Uhr, bei halbtägigen Seminaren 9.00 bis<br />
13.00 Uhr oder 14.00 bis 18.00 Uhr<br />
Anmeldungen: Nur online möglich,<br />
über unsere Homepage<br />
www.gemeindebund.steiermark.at<br />
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich<br />
bitte an den Steiermärkischen Gemeindebund<br />
(Frau Lamm, Frau Mischinger,<br />
Frau Dr. Wagner), 80<strong>10</strong> Graz, Burgring<br />
18, Telefon (0316) 82 20 79/0, Fax<br />
(0316) 81 05 96, E-Mail:<br />
buchung@gemeindebund.steiermark.at<br />
53. ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG<br />
21. und 22. September 20<strong>06</strong> in WIEN<br />
„Arbeit sichern – Zukunft leben – Gemeinde stärken“<br />
Donnerstag, 21. September:<br />
11.00 Uhr Eröffnung des Gemeindetages<br />
13.30 Uhr Schwerpunktprogramm „Ländlicher Raum“ und Preisverleihung „Innovativste Gemeinde“<br />
18.00 Uhr Galaabend – Circus Roncalli am Rathausplatz<br />
20.00 Uhr Galadinner im Rathaus<br />
Freitag, 22. September:<br />
9.30 Uhr HAUPTTAGUNG des Gemeindetages<br />
mit<br />
Bundespräsident Dr. Heinz FISCHER<br />
Bundeskanzler Dr. Wolfgang SCHÜSSEL<br />
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes Bgm. Helmut MÖDLHAMMER<br />
Mittagsimbiss<br />
Das genaue Tagungsprogramm sowie allgemeine Informationen zur Tagung, zu Anmeldung und Hotelreservierung<br />
finden Sie unter www.gemeindetag.at.<br />
Anmeldungen zum Gemeindetag sind nur online über die genannte Homepage möglich.<br />
Impressum<br />
Herausgeber, Verleger und Redaktion:<br />
<strong>Steiermärkischer</strong> Gemeindebund,<br />
80<strong>10</strong> Graz, Burgring 18;<br />
www.gemeindebund.steiermark.at<br />
Schriftleitung und für den Inhalt<br />
verantwortlich:<br />
Dr. Klaus Wenger;<br />
Produktion:<br />
Ing. Robert Möhner – Public Relations,<br />
8052 Graz, Krottendorfer Straße 5;<br />
Druck:<br />
Universitätsdruckerei Klampfer GmbH,<br />
Barbara-Klampfer-Straße 347,<br />
8181 St. Ruprecht/Raab