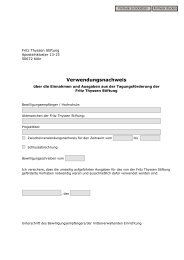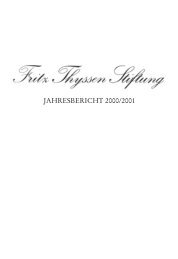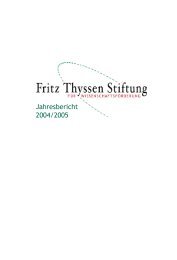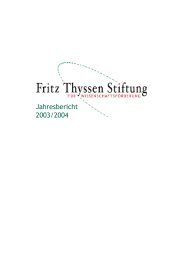Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12<br />
In dem dreijährigen<br />
Forschungsvorhaben<br />
nehmen die Ablehnung und<br />
Bewunderung des Preußen,<br />
die ideologischen Instrumentalisierungen<br />
des<br />
Monarchen und deren<br />
Nachwirkungen einen<br />
bedeutenden Raum ein.<br />
Friedrich der Große in Europa | Das gemeinsam mit der Gerda Henkel <strong>Stiftung</strong> finanzierte<br />
Projekt »Friedrich der Große in Europa. Geschichte einer wechselvollen Beziehung« leitet<br />
prof. b. sösemann, Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin.<br />
Wie wirkte Friedrich der Große auf Europa und welchen europäischen Einflüssen war Preußen<br />
ausgesetzt? Diesen Leitfragen folgte ein transdisziplinäres Netzwerk von 48 Preußen-Forschern<br />
aus sieben europäischen Staaten auf drei Konferenzen und mehreren Sektionstreffen. In konsequent<br />
europäischer Perspektive untersucht, treten die teils nur scheinbaren Widersprüche<br />
der Person und des Königtums in ein neues Licht: Die Härte und Grausamkeit etwa, mit<br />
der der junge Prinz erzogen wurde, waren kein Sonderfall, anders dagegen die Ablehnung<br />
des höfischen Zeremoniells. Nicht mit Desinteresse oder Bescheidenheit, sondern mit dem<br />
bewussten Ignorieren einiger der tradierten<br />
europäischen Codes provozierte der<br />
Monarch und erhob einen europäischen<br />
Hoheitsanspruch. Dass der »Alte <strong>Fritz</strong>«<br />
dabei immer als Apoll und Mars zugleich<br />
auftrat, zeigen Beiträge über sein Wirken<br />
auf dem Schlachtfeld, seine Aneignungen<br />
der Antike, die Musikliebhaberei und philosophische<br />
Vorstellungen.<br />
In dem dreijährigen Vorhaben nehmen<br />
die Ablehnung und Bewunderung des<br />
Preußen, die ideologischen Instrumentalisierungen<br />
des Monarchen und deren<br />
Nachwirkungen einen bedeutenden<br />
Raum ein. Unter welchen Voraussetzungen<br />
wurde Preußen in europäischen<br />
Nationalstaaten und Diktaturen als Vor-<br />
oder Feindbild benutzt? Es ist offenkundig,<br />
dass Stereotypen und Legenden das<br />
Friedrich der Große. Zeitgenössisches Porträt,<br />
100 x 120 cm, Öl auf Leinwand; vermutlich von Anna<br />
Dorothea Lisiewski (1721-1782), die zahlreiche Porträts<br />
in der Art von Antoine Pesne, Hofmaler und<br />
Direktor der Berliner Kunstakademie, gemalt hat.<br />
Prof. Simo sieht die<br />
Schaffung eines friedlichen,<br />
kooperativen<br />
Austausches von Wissen<br />
zwischen dem Norden und<br />
dem Süden als eine der<br />
wichtigsten Herausforderungen<br />
für die Menschheit<br />
im 21. Jahrhundert an.<br />
öffentliche Urteil und Publikationen bis in unsere Tage mitbestimmen. Der »Allgegenwart des<br />
Monarchen« oder dem »preußischen Militarismus«, der »aufklärerischen« Dimension des politischen<br />
Denkens und Handelns und der »friderizianischen Toleranz« gilt daher ein besonderes<br />
Interesse. Die Ergebnisse wurden im November <strong>2011</strong> in zwei Bänden veröffentlicht, die Prof.<br />
Sösemann zusammen mit Prof. Vogt-Spira im Franz Steiner Verlag, Stuttgart, herausgibt. Eine<br />
ausführliche Biographie, ein umfangreicher Anhang mit statistischen Materialien und einer<br />
differenzierten Chronologie bieten dem Leser Verständnishilfen und Anregungen zur weiteren<br />
Beschäftigung. Das Werk wird in acht europäischen Großstädten präsentiert.<br />
Deutsch-Afrikanisches Zentrum | Unter der Leitung von prof. d. simo, Lettres et<br />
Sciences Humaines, Université Yaoundé I, Kamerun, wird ein »Zentrum für deutsch-afrikanische<br />
wissenschaftliche Zusammenarbeit« gegründet.<br />
Das Projekt zielt auf die Errichtung eines Deutsch-Afrikanischen Zentrums an der Universität<br />
Yaounde I in Kamerun. Entsprechend einem Aktionsplan der afrikanischen Bildungsminister<br />
für 2006-2015, worin die Notwendigkeit der Errichtung regionaler und interinstitutioneller<br />
Netzwerke unterstrichen wird, will die Universität von Yaounde I ihr Bildungsangebot und<br />
ihre Organisation neu strukturieren. Prof. Simo sieht die Schaffung eines friedlichen, kooperativen<br />
Austausches von Wissen zwischen dem Norden und dem Süden als eine der wichtigsten<br />
Herausforderungen für die Menschheit im 21. Jahrhundert an und wissenschaftliche Kooperation<br />
als das maßgebliche Mittel, um ethnozentrische Positionen allmählich aufzulösen und<br />
transkulturell gemeinsame Kategorien zu erarbeiten. Mit Blick speziell auf die Germanistik<br />
geht er davon aus, dass der internationale Austausch mit Afrika auch für die Inlandsgermanistik<br />
ein Gewinn sein wird.<br />
Das geplante Zentrum soll eine Koordinationsstelle und ein Katalysator für unterschiedliche<br />
Initiativen sein. Es soll drei Aufgaben wahrnehmen: Vernetzung und Dokumentation; Ausbildung<br />
und Betreuung; Förderung von wissenschaftlichem Austausch und kooperativer<br />
Forschung.<br />
Das Zentrum soll die Vernetzung von bereits existierenden Online-Dokumentationen verschiedener<br />
Germanistik-Abteilungen in Afrika vorantreiben und derartige Ressourcen als Grundlage<br />
für die Forschung von deutscher wie von afrikanischer Seite weiter ausbauen. Außerdem<br />
sollen mittelfristig die Dokumente aus deutschen Kolonialarchiven in Kamerun, Namibia, Tansania<br />
und Togo als Quellen für die Geschichtsschreibung transkribiert, übersetzt und online<br />
verfügbar gemacht werden.<br />
13<br />
Projekte im Fokus