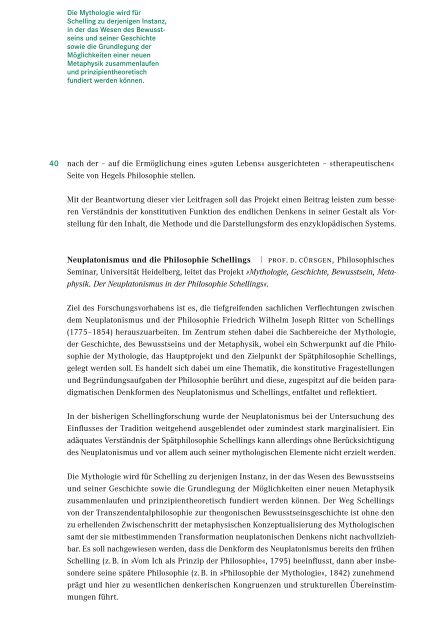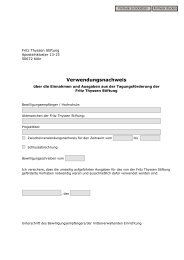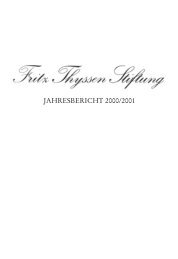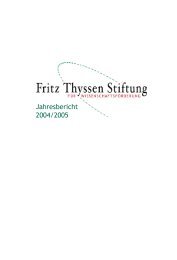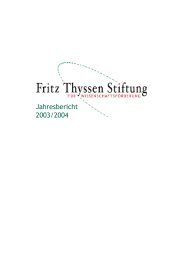Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Mythologie wird für<br />
Schelling zu derjenigen Instanz,<br />
in der das Wesen des Bewusstseins<br />
und seiner Geschichte<br />
sowie die Grundlegung der<br />
Möglichkeiten einer neuen<br />
Metaphysik zusammenlaufen<br />
und prinzipientheoretisch<br />
fundiert werden können.<br />
40 nach der – auf die Ermöglichung eines »guten Lebens« ausgerichteten – »therapeutischen«<br />
Seite von Hegels Philosophie stellen.<br />
Mit der Beantwortung dieser vier Leitfragen soll das Projekt einen Beitrag leisten zum besseren<br />
Verständnis der konstitutiven Funktion des endlichen Denkens in seiner Gestalt als Vorstellung<br />
für den Inhalt, die Methode und die Darstellungsform des enzyklopädischen Systems.<br />
Neuplatonismus und die Philosophie Schellings | prof. d. cürsgen, Philosophisches<br />
Seminar, Universität Heidelberg, leitet das Projekt »Mythologie, Geschichte, Bewusstsein, Metaphysik.<br />
Der Neuplatonismus in der Philosophie Schellings«.<br />
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die tiefgreifenden sachlichen Verflechtungen zwischen<br />
dem Neuplatonismus und der Philosophie Friedrich Wilhelm Joseph Ritter von Schellings<br />
(1775–1854) herauszuarbeiten. Im Zentrum stehen dabei die Sachbereiche der Mythologie,<br />
der Geschichte, des Bewusstseins und der Metaphysik, wobei ein Schwerpunkt auf die Philosophie<br />
der Mythologie, das Hauptprojekt und den Zielpunkt der Spätphilosophie Schellings,<br />
gelegt werden soll. Es handelt sich dabei um eine Thematik, die konstitutive Fragestellungen<br />
und Begründungsaufgaben der Philosophie berührt und diese, zugespitzt auf die beiden paradigmatischen<br />
Denkformen des Neuplatonismus und Schellings, entfaltet und reflektiert.<br />
In der bisherigen Schellingforschung wurde der Neuplatonismus bei der Untersuchung des<br />
Einflusses der Tradition weitgehend ausgeblendet oder zumindest stark marginalisiert. Ein<br />
adäquates Verständnis der Spätphilosophie Schellings kann allerdings ohne Berücksichtigung<br />
des Neuplatonismus und vor allem auch seiner mythologischen Elemente nicht erzielt werden.<br />
Die Mythologie wird für Schelling zu derjenigen Instanz, in der das Wesen des Bewusstseins<br />
und seiner Geschichte sowie die Grundlegung der Möglichkeiten einer neuen Metaphysik<br />
zusammenlaufen und prinzipientheoretisch fundiert werden können. Der Weg Schellings<br />
von der Transzendentalphilosophie zur theogonischen Bewusstseinsgeschichte ist ohne den<br />
zu erhellenden Zwischenschritt der metaphysischen Konzeptualisierung des Mythologischen<br />
samt der sie mitbestimmenden Transformation neuplatonischen Denkens nicht nachvollziehbar.<br />
Es soll nachgewiesen werden, dass die Denkform des Neuplatonismus bereits den frühen<br />
Schelling (z. B. in »Vom Ich als Prinzip der Philosophie«, 1795) beeinflusst, dann aber insbesondere<br />
seine spätere Philosophie (z. B. in »Philosophie der Mythologie«, 1842) zunehmend<br />
prägt und hier zu wesentlichen denkerischen Kongruenzen und strukturellen Übereinstimmungen<br />
führt.<br />
Philosophie<br />
Die folgenden Teilaspekte werden im Rahmen des Projektes näher beleuchtet:<br />
Schellings Intention und Konstruktion der Einheit und Wahrheit der Philosophie implizieren<br />
irreduzibel den Aufweis der Integration ihrer wesentlichen geschichtlichen Gestalten, sowohl<br />
was die Philosophiegeschichte speziell als auch die sie fundierende Bewusstseinsgeschichte<br />
allgemein angeht. Dies fordert nach Schelling vor allem die Durchdringung und Zusammenführung<br />
des Platonismus und der Transzendentalphilosophie auf dem Boden der von ihm<br />
entwickelten Begründungsdisziplin der mythologischen Bewusstseinsgeschichte. Dieses<br />
Vorgehen findet seine innere Spiegelung im neuplatonischen Projekt eines systemimmanent<br />
asymmetrischen und hierarchischen Zusammenschlusses der philosophischen Geschichte<br />
der Antike (etwa Vorsokratik, Platon, Aristoteles, Stoa) unter Einbeziehung ihrer mythologischen<br />
Diversifikationen vor dem Hintergrund eines henologischen Monismus. Das Mittel,<br />
diese Intention zu realisieren, besteht bei Schelling in der Konstitution und im hermeneutischen<br />
Nachvollzug der Geschichte des Bewusstseins in seinen Epochen der Mythologie und<br />
Offenbarung vor dem Hintergrund einer neuartigen Ontotheologie, durch welche Schelling<br />
sogar die neuplatonische Konzeption eines rein negativen Absoluten noch hintergehen und<br />
letztbegründen will. Hierzu entwickelt Schelling einen Gottesbegriff, der auf dem Wesen der<br />
Differenz von Essenz und Existenz beruht. Einerseits kann Gott dadurch als dasjenige erwiesen<br />
werden, das in allem Seienden dessen Existenzgrund ausmacht, wodurch Gott an Welt und<br />
Schöpfung gebunden ist. Andererseits wird Gott als der »Herr des Seienden« frei von allem<br />
Seienden und bleibt ihm transzendent. Mit dieser Konzeption verarbeitet Schelling an einem<br />
zentralen Punkt das neuplatonische Theorem der Transzendenz des Absoluten gegenüber dem<br />
Bestimmten, dem es gleichwohl auch – es ermöglichend – immanent ist.<br />
Jeder genuine Mythos ist im Rahmen der Mythologie ein substanzieller, sinnlicher und weltbildender<br />
Ausdruck metaphysischer Gedanken und göttlichen Seins, weil er zu den Bedingungen<br />
der Reflexionsmöglichkeit des göttlichen Bewusstseins durch die Philosophie zählt. Die<br />
Mythologie ist nichts Gemachtes; vielmehr bildet sie für Schelling ein natürliches, ursprüngliches<br />
und unumgängliches Stadium der zeitlichen Genese des Geistes, speziell die unausweichliche<br />
Entfremdungsgestalt des Bewusstseins, das dieses durchlaufen muss, um vollständig<br />
zu sich selbst zurückkehren zu können. Ohne die Mythologie kann das Selbstbewusstsein in<br />
gar keinem Fall zu einem wahrhaften Geschichtsverständnis und damit wiederum nicht zur<br />
wirklichen, d.h. theogonischen Metaphysik gelangen. Der mythologische Polytheismus beruht<br />
dabei auf einem unvordenklichen und unhintergehbaren Monotheismus, der den Kern des<br />
Bewusstseins konstituiert und der Verfassung des ursprünglich gottsetzenden Bewusstseins<br />
entspricht. Nur durch das Durchlaufen eines Prozesses kann Gott an sich und für das Bewusstsein<br />
am Ende zum wirklichen bzw. wirklich verstandenen Gott werden.<br />
41<br />
Geschichte, Sprache und Kultur