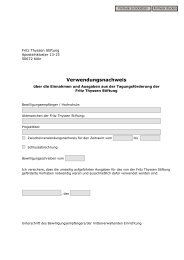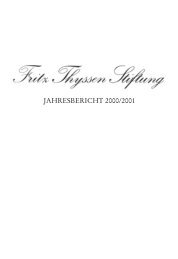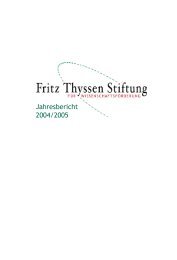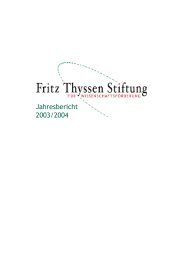Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
36 berühmten »Rede über die praktische Philosophie der Chinesen«, die er 1721 in Halle hielt<br />
und die einen Sturm der Entrüstung auslöste – sodass Wolff 1723 bei Androhung der Todesstrafe<br />
Preußen verlassen musste. Es wird anhand des Noël’schen Meisterwerks untersucht,<br />
warum der Bezug auf die chinesische Philosophie eine solche Erschütterung auslösen konnte.<br />
Weiterhin ist es Ziel, auf der Grundlage der »Rede« und weiterer Schriften Wolffs Kriterien zu<br />
erarbeiten, die eine Bewertung und Einordnung seiner Konfuzianismusrezeption und ihrer<br />
Wirkung auf sein Werk ermöglichen.<br />
Die bisherige Projektarbeit hat ergeben, dass die »Rede« selbst den Schlüssel zur Konfuzianismusrezeption<br />
von Wolff liefert: Vergleicht man das Konfuziusbild, das Wolff in ihr zeichnet,<br />
mit den chinesischen Texten, so ergibt sich, dass Konfuzius nicht ein auswechselbares<br />
Modethema war, sondern eine Quelle der Inspiration für zukunftsweisende Neuerungen in<br />
Wolffs Werk. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist seine »Psychologia Empirica«, die – über<br />
die spätere Rezeption durch Wilhelm Wundt – die moderne Psychologie beeinflusst hat. Aber<br />
auch Wolffs Wirken auf die Politik und das Bildungswesen im Zeitalter der Aufklärung stellt<br />
Parallelen zum konfuzianischen Ethos des Gebildeten dar, der einen Beitrag zu einer menschlicheren<br />
und gerechteren Welt leisten möchte.<br />
Kopernikanische Wende | »Die große Revolution: Kant als Kopernikus, Kepler, Newton« ist<br />
Gegenstand eines Forschungsprojektes von prof. d. schönecker, Lehrstuhl für Praktische Philosophie,<br />
Universität Siegen.<br />
Im Zentrum steht die Analyse der wirkungsgeschichtlich einflussreichen Rede von der »Kopernikanischen<br />
Wende« als einer »Revolution der Denkart« bei Kant.<br />
In einem Vergleich spricht Kant in der »Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen<br />
Vernunft« von der berühmten »Revolution der Denkart« (B XII) oder auch »Umänderung der<br />
Denkart« (B XVI). Diese »Revolution der Denkart« wird von Kant an zwei sehr kurzen, aber<br />
prominenten Stellen u. a. auf Kopernikus und dessen »Revolution der Denkart« in der Astronomie<br />
bezogen. Dadurch ging Kants eigene metaphysische »Revolution der Denkart« in die<br />
Geschichte ein als die berühmte sogenannte »Kopernikanische Wende« oder auch »Kopernikanische<br />
Revolution«.<br />
Ein Interpretationsbedürfnis besteht hier nicht nur dadurch, dass nicht klar wäre, was genau<br />
Kant mit der Subjektabhängigkeit der Erkenntnis und dem Unterschied von »Ding an sich«<br />
und »Erscheinung« meint, die Frage ist vielmehr, worin genau die »Analogie« zu Kopernikus<br />
Philosophie<br />
Das Gesamtcorpus der<br />
Schleiermacher’schen Platon-<br />
Übersetzung umfasste sechs<br />
Bände (1804–1809 in 1. Auflage<br />
und 1817–1826 in 2. Auflage;<br />
sechster Band 1828); es bot mit<br />
29 Dialogen den größten Teil des<br />
platonischen Gesamtwerkes.<br />
besteht. Das einfache Bild eines Kant, der analog zu Kopernikus’ Hypothese von der Sonne als<br />
Zentrum des Planetensystems eine Revolution in der Metaphysik vollzieht, scheint falsch zu<br />
sein. Im Rahmen des Projektes wird daher der Hypothese nachgegangen, dass Kant (gewiss)<br />
auch Newton und (vielleicht) Kepler ins Spiel bringt und sich also auch zu diesen beiden<br />
revolutionären Vorbildern in eine analogische Beziehung setzt. Dass in diesem Zusammenhang<br />
die Frage nicht reflektiert wurde, was Kant mit den »Zentralgesetzen der Bewegungen<br />
der Himmelskörper« (B XXII Anm.) überhaupt meint, ist kennzeichnend für den bisherigen<br />
Forschungsstand. Daher wird Kants Kopernikusanalogie einer präzisen und umfassenden<br />
Analyse unterzogen, um unter der rezeptionsgeschichtlichen Patina eine Analogie erkennbar<br />
zu machen, die Kants eigentliches Projekt einer Revolution in der Metaphysik in ein anderes<br />
und neues Licht zu rücken vermag. Zugleich wird eine Rezeptionsgeschichte dieser Analogie<br />
in der Kant-Forschung und darüber hinaus in der allgemeinen Ideengeschichte erarbeitet.<br />
Platon-Übersetzung | Die »Kritische Edition des Bandes I 1 der Platon-Übersetzung Friedrich<br />
Schleiermachers« wird von prof. l. käppel, Institut für Klassische Altertumskunde, Universität<br />
zu Kiel, vorgenommen.<br />
Ziel des an der Schnittstelle von Philosophiegeschichte, Romantikforschung und Gräzistik<br />
situierten, interdisziplinären Projektes ist die paradigmatische Edition des Eröffnungsbandes<br />
der epochemachenden Platon-Übersetzung Friedrich Schleiermachers (1768–1834), die von<br />
Friedrich Schlegel (1772–1829) als Gemeinschaftsarbeit angeregt worden war, aber dann von<br />
Schleiermacher allein realisiert wurde.<br />
Das Gesamtcorpus der Schleiermacher’schen Platon-Übersetzung umfasste sechs Bände<br />
(1804–1809 in 1. Auflage und 1817–1826 in 2. Auflage; sechster Band 1828); es bot mit<br />
29 Dialogen den größten Teil des platonischen Gesamtwerkes. Gegenstand des Projektes<br />
ist die Edition von Band I 1 (1804/1817) mit Schleiermachers Einleitung zum Gesamtwerk<br />
Platons sowie Einleitungen, Übersetzungen und Anmerkungen zu vier Dialogen: »Phaidros«,<br />
»Lysis«, »Protagoras«, »Laches«.<br />
Die neue Edition soll nicht nur zum ersten Mal die instruktiven handschriftlichen Entwürfe<br />
zugänglich machen, sondern auch die letztmals in der sogenannten 3. Auflage von 1855 gebotenen<br />
kritischen und erläuternden Anmerkungen wieder mit einbeziehen. Mit der Vorlage von<br />
Entwürfen und synoptischem Vergleich der gedruckten Fassungen soll der Entwicklungsprozess<br />
der Übersetzungen von der Rohübersetzung bis hin zur gedruckten literarischen Übersetzung<br />
als »Text eigenen Rechts« dokumentiert werden und gleichzeitig die Schleiermacher’sche<br />
37<br />
Geschichte, Sprache und Kultur