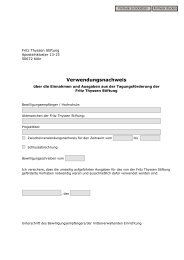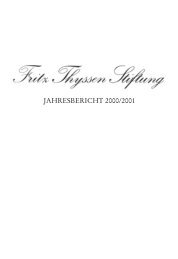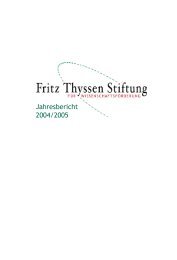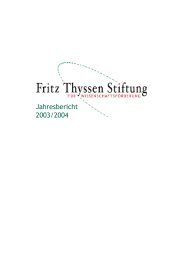Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Spinozas System erscheint als<br />
eine Radikalisierung von<br />
systemisch-systematischen<br />
Grundmomenten des<br />
Vázquez’schen Modells, indem<br />
Spinoza die bei Vázquez<br />
angelegte streng philosophische<br />
Begründung des Naturrechts<br />
kompromisslos zu Ende führt.<br />
32 verstanden, in dem eine sukzessive Ablösung des Naturrechts von theologischen Gründungsfiguren<br />
erfolgt, die zugleich aber die der Neuzeit eigene Tendenz zur »Säkularisierung« noch<br />
nicht radikal vollzieht.<br />
Die bisherige Forschung hat indessen den beschriebenen Prozess einseitig als eine Reihe<br />
zunehmender Versuche verstanden, Naturrecht allein in der menschlichen Vernunft ohne<br />
Rückbezug auf theologische oder metaphysische Momente zu begründen, und sich daher in<br />
der Regel auf eine historische Diskussionslinie verständigt, die über die akademische Philosophie<br />
der Neuzeit zu Kant führt und dort ihr Ende findet. Demgegenüber soll es die systematische<br />
und methodische Grundlegung des beantragten Forschungsvorhabens in der Explikation<br />
des Konnexes von ethischer, metaphysischer und theologischer Theorieform erlauben, eine<br />
historisch viel wirkmächtigere und über Kant weit hinausweisende, indessen in der Forschung<br />
bislang übersehene Entwicklung der Naturrechtsdiskussion zu rekonstruieren. Grundlage der<br />
Kritik Spinozas ist hierbei eine Figur, in der das Verhältnis von Metaphysik, Theologie und<br />
Ethik sowie die Theorie des Naturrechts in »genuin moderner« Weise in Gestalt einer rein<br />
rationalen Systemphilosophie artikuliert wird.<br />
Dass die spanische Spätscholastik bereits systematische Elemente bereitstellt, die auf die<br />
spinozische Philosophie vorwegweisen, soll mit Blick auf den Entwurf von Gabriel Vázquez<br />
deutlich werden. Dessen in der Forschung als »objektivistische Naturrechtslehre« bezeichnete<br />
Konzeption stellt ein radikal über die traditionellen Konzeptionen hinausgehendes Modell dar,<br />
in dem die Geltung naturrechtlicher Normen weder von menschlichem noch göttlichem Willen<br />
oder Intellekt mehr abhängt, sondern vielmehr in ähnlicher Weise wie später bei Spinoza<br />
in einer metaphysischen Verschränkung von göttlicher und menschlicher Essenz gegründet<br />
wird. Dieser Naturrechtsobjektivismus führt zugleich zu einer Naturalisierung, die tendenziell<br />
nicht nur göttliche und menschliche Freiheit nivelliert, sondern im Zuge dessen auch zu<br />
einer Umdeutung der traditionell als Ausdruck des göttlichen Heilsplans verstandenen »lex<br />
aeterna« zu einer bloß metaphysisch-naturalen Prinzipienstruktur der Hervorbringung von<br />
Einzeldingen, die letztlich mit dem Konnex der Ideen im göttlichen Intellekt identisch ist.<br />
Diese Struktur findet ihre Radikalisierung im spinozischen Entwurf, wo das Naturrecht vor<br />
dem Hintergrund einer konsequenten Loslösung der Metaphysik und Ethik von allen offenbarungstheologischen<br />
Momenten in einem naturalistischen und nezessitären Konnex gegründet<br />
wird, in dem Gott in demselben Sinne Ursache seiner selbst (causa sui) ist, als er Ursache der<br />
von ihm hervorgebrachten Dinge (causa rerum) ist. In diesem metaphysischen Konstrukt fungiert<br />
dann die Ethik nicht als eine eigenständige, von der Metaphysik geschiedene philosophische<br />
Disziplin, sondern erfüllt vielmehr im Stil moderner nachkantischer Systemphilosophie<br />
die Funktion der Schließung des Systems.<br />
Philosophie<br />
Eine Schlussbetrachtung soll herausheben, dass Vázquez’ Konzeption nicht etwa dem Systemdenken<br />
Spinozas als historisch früherer und überholter Entwurf bloß gegenübersteht. Wichtig<br />
ist vielmehr, dass Spinozas System als eine Radikalisierung von systemisch-systematischen<br />
Grundmomenten des Vázquez’schen Modells erscheint, indem Spinoza die bei Vázquez angelegte<br />
streng philosophische Begründung des Naturrechts kompromisslos zu Ende führt.<br />
In dieser Perspektive besteht daher die »Säkularisierung« im Übergang zur Neuzeit auch nicht<br />
primär in einer Entkopplung des Naturrechts von einer göttlichen Instanz, sondern in dessen<br />
Einbindung in ein Philosophieren, das sich als ein durch die Ethik sich schließendes metaphysisches<br />
System vollzieht. Von hier aus lässt sich dann auch die Abweichung der Naturrechtskonzeptionen<br />
von Vázquez und Spinoza nicht als bloße Verschiedenheit, sondern vielmehr<br />
als systematischer Lösungsversuch eines nicht zeitgebundenen Problems verstehen. So wird<br />
in methodischer Hinsicht der Schwerpunkt auf dem Nachweis liegen, dass Vázquez’ Entwurf<br />
einer nezessitären Naturrechtskonzeption, deren Kern in einer jeglicher Form von Freiheit<br />
vorgeordneten systemischen Verkopplung von rationaler und göttlicher Essenz besteht, im<br />
Systemdenken Spinozas eine konsequente Weiterentwicklung erfährt, sodass Spinozas<br />
»Ethica« sich gleichsam als eine kritische Weiterführung der neuartigen Ansätze in Vázquez’<br />
»Thomaskommentar« lesen lässt.<br />
Elisabeth von der Pfalz | priv.-doz. dr. s. ebbersmeyer, Seminar für Geistesgeschichte und<br />
Philosophie der Renaissance, Universität München, befasst sich mit »Unsichtbaren Netzen:<br />
Frauen in der Philosophie der Frühen Neuzeit. Rekonstruktion und Dokumentation des intellektuellen<br />
Wirkens von Elisabeth von der Pfalz (1618–1680)«.<br />
Die Erforschung des Beitrags von Frauen zur abendländischen Philosophiegeschichte befindet<br />
sich noch immer in den Anfängen. Dies gilt auch und vor allem für die Historiographie der<br />
Frühen Neuzeit. Obgleich die Bedeutung der intellektuellen Aktivitäten von zahlreichen Denkerinnen<br />
dieser Zeit gut dokumentiert ist, finden sie kaum Eingang in den Kanon der üblichen<br />
Philosophiegeschichtsschreibung. Für diese »Abwesenheit« von Frauen in der Philosophiegeschichte<br />
sind verschiedene Ursachen verantwortlich. Ein zentraler Grund besteht darin, dass<br />
ein bestimmtes akademisches Vorverständnis von Philosophie es verhindert, Frauen überhaupt<br />
als Philosophinnen wahrzunehmen. Da Frauen der Zugang zur akademischen Philosophie<br />
verwehrt war, haben sie in der Regel auch nicht zu akademischen Textformen wie Traktat<br />
und Kommentar gegriffen, sondern zu semi-privaten Formen wie dem Brief. Insofern handelt<br />
es sich bei den Briefwechseln um typische Zeugnisse für die Art und Weise, wie sich Frauen<br />
der Frühen Neuzeit in die Philosophie überhaupt einbringen konnten.<br />
33<br />
Geschichte, Sprache und Kultur