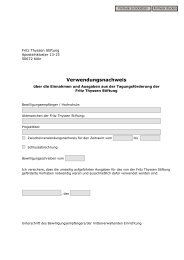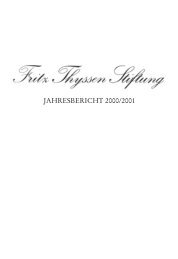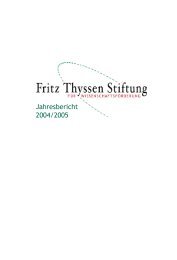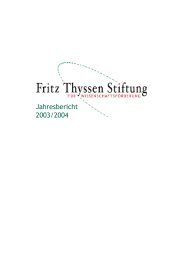Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
16 senschaftlicher Bericht und ein Fallhandbuch wurden dem Ministerium übergeben. Das im<br />
Jahr 2009 begonnene Projekt »Bürger unternehmen Zukunft – Bürgerschaftliches Engagement<br />
von und für ältere Menschen«, gefördert durch den Generali Zukunftsfonds, befindet<br />
sich in der Hauptarbeitsphase und wird 2012 zu ersten Ergebnissen führen. In diesem Projekt<br />
wurden inzwischen neun Promotionsstipendien vergeben (davon drei im Jahr 2010). Durch<br />
die koordinierte Zusammenarbeit der Teilprojekte bzw. Promotionen entsteht ein umfassender<br />
Forschungsschwerpunkt nach einheitlichem Rahmen.<br />
Das Projekt zu Governance-Problemen hybrider Organisationen (FRONTIER-Projekt aus Exzellenzmitteln<br />
der Universität Heidelberg) wurde abgeschlossen. Aus diesem Projekt heraus entstanden<br />
mehrere Konferenzbeiträge und weitere Publikationen. Zudem fließen Erkenntnisse<br />
in das Forschungsthema Sozialunternehmer ein. Im Forschungsnetzwerk der Zeppelin-Universität<br />
Friedrichshafen, der TU München und der Universität Heidelberg (CSI), gefördert von der<br />
<strong>Stiftung</strong> Mercator im Rahmen des Mercator-Forscherverbunds »Innovatives Soziales Handeln –<br />
Social Entrepreneurship«, untersucht das CSI (gemeinsam mit den Partnern) Organisation,<br />
Kommunikation, Finanzierung sowie die Märkte von Sozialunternehmen über eine Online-<br />
Erhebung sowie eine Serie qualitativer Fallstudien.<br />
In der Publikationstätigkeit erschienen aus den diversen Projekten heraus Artikel und Buchbeiträge.<br />
Besonders große Anstrengungen wurden teamübergreifend auf die Erstellung des<br />
programmatischen Sammelbandes »Soziale Investitionen« verwendet, der im Herbst <strong>2011</strong> im<br />
Verlag für Sozialwissenschaften erschienen ist.<br />
Dr. Lorenzo Fioramonti, Universität Bologna, war über das gesamte Jahr als Philantropy Fellow<br />
am CSI. Unter anderem führte er im Herbst 2010 zusammen mit Ekkehard Thümler eine<br />
Online-Befragung zur Reaktion von <strong>Stiftung</strong>en auf die Finanzkrise durch.<br />
Gemeinsam mit dem Max-Weber-Institut für Soziologie der Universität Heidelberg konnte<br />
erfolgreich ein Graduiertenkolleg aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg eingerichtet<br />
werden. Im Herbst 2010 wurden sechs Stipendien vergeben. Mitarbeiter des CSI wirken beim<br />
Lehrprogramm und bei der Betreuung der Graduierten mit.<br />
Der Masterstudiengang des CSI konnte im Jahr 2010 erste Absolventen beglückwünschen.<br />
Alle Studierenden der ersten Kohorte legten erfolgreich die Masterprüfung ab. Zugleich<br />
konnten die Studierendenzahlen mit der dritten Kohorte weiter gesteigert werden. In den<br />
Weiterbildungsangeboten des CSI konzentrierte sich die Arbeit im Jahr 2010 auf »Executive<br />
Training«-Angebote in Kooperation mit verschiedenen Partnern, so der Universität Turin und<br />
70 bis 80 Prozent der<br />
afrikanischen Bevölkerung<br />
leben in kleinbäuerlichen,<br />
lokalen Verhältnissen und<br />
beziehen Saatgut von den<br />
eigenen Feldern.<br />
der ILO zum Nonprofit-Management, und der Charities Aid Foundation (CAF) für die Foundation<br />
School, an der Dozenten des CSI schon in der Vergangenheit mitgewirkt hatten und die<br />
2010 erstmals in Heidelberg stattfand.<br />
Auch die politische Kommunikation wird weiterentwickelt. Im Jahr 2010 konnten erste Mitarbeiter<br />
das provisorische Berliner Büro in den Räumen der Hertie School of Governance<br />
(HSoG) beziehen. Mit dem Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement des Deutschen<br />
Bundestags und Vertretern der Bundesregierung besteht ein reger Austausch. Regelmäßig<br />
tragen Mitarbeiter des CSI zu verschiedenen zivilgesellschaftlichen Themen vor. Eine Podiumsdiskussion<br />
des CSI in Berlin thematisierte im Oktober die Frage, wie viel Mythos und<br />
wie viel Realität in der Erfolgsgeschichte amerikanischer <strong>Stiftung</strong>en steckt. Hierzu diskutierten<br />
Prof. Helmut K. Anheier (CSI), Prof. David Hammack (Case Western Reserve University),<br />
Dr. Diana Leat (CASS Business School) und Dr. Wilhelm Krull (Bundesverband Deutscher<br />
<strong>Stiftung</strong>en).<br />
Saatgut und Sozialsystem | Das Projekt »Saatgut und Sozialsystem – Ernährungssicherung<br />
in ländlichen Entwicklungsgebieten am Beispiel der Ruvuma-Region in Tansania und der Oshana-<br />
Region in Namibia« wird von prof. r. gronemeyer, Institut für Soziologie, Universität Gießen,<br />
geleitet.<br />
Hunger und Ernährungsunsicherheit zählen trotz des weltweit stetig steigenden Wohlstands<br />
zu den gravierenden Problemen der heutigen Zeit: Die Lebensmittelpreise haben im Jahr <strong>2011</strong><br />
wieder das Niveau der Jahre 2007/2008 erreicht, als die Welt eine schwerwiegende Hungerkrise<br />
erlebte. Infolgedessen wenden sich im südlichen Afrika nationale Politiken und Entwicklungsprogramme<br />
der internationalen Gebergemeinschaft wieder verstärkt Fragen der<br />
Sicherstellung der Ernährung und ländlicher Entwicklung zu. Dabei dominieren zwei Sichtweisen<br />
die Debatte: Während auf der einen Seite eine neue »Grüne Revolution« befürwortet<br />
wird, setzen andere auf politische Konzepte wie Ernährungssouveränität und die Unterstützung<br />
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Frage nach<br />
dem Umgang mit Saatgut als Ausgangspunkt landwirtschaftlicher Produktion: 70 bis 80 Prozent<br />
der afrikanischen Bevölkerung leben in kleinbäuerlichen, lokalen Verhältnissen und<br />
beziehen Saatgut von den eigenen Feldern. In diesem Zusammenhang stellt sich nicht nur<br />
die Frage, wie der Umgang mit Saatgut in der Kultur von Kleinbauern in Afrika verankert ist,<br />
sondern vor allem auch, inwieweit spezifische soziale, religiöse, kulturelle und lokale Bedingungen<br />
und Gewohnheiten über den Erfolg und die Effizienz von Saatgutsystemen und damit<br />
über die Ernährungssicherheit mitentscheiden.<br />
17<br />
Projekte im Fokus