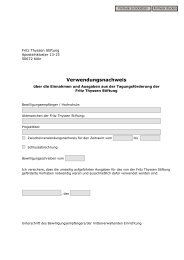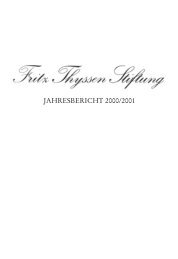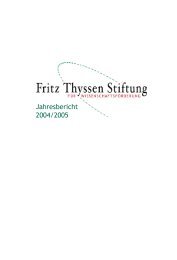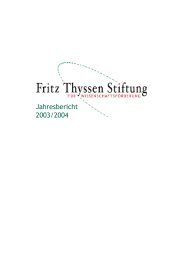Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2011 - Fritz Thyssen Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sokrates charakterisiert den<br />
Eros als ein Zwischenwesen<br />
zwischen Göttern und Menschen,<br />
als einen Daimon, welcher durch<br />
ein Streben mit dem Ziel<br />
gekennzeichnet ist, das Schöne<br />
zu erreichen und die Liebenden<br />
»zur Zeugung im Schönen« zu<br />
motivieren.<br />
28 Platons »Symposion« | prof. c. horn, Institut für Philosophie, Universität Bonn, widmet<br />
sich »Platons ›Symposion‹«.<br />
Das Symposion ist einer der brillantesten Dialoge Platons. In meisterhafter literarischer Form<br />
wird hier ein Trinkgelage dargestellt, bei welchem der Tragödiendichter Agathon und seine<br />
Gäste Lobreden zu Ehren des göttlichen Eros halten. Die Reden des Phaidros, des Pausanias,<br />
des Eryximachos, des Aristophanes und des Agathon heben unterschiedliche begriffliche und<br />
phänomenale Aspekte der erotischen Liebe hervor, ehe Sokrates eine die konkurrierenden<br />
Beiträge deutlich überbietende philosophische Darstellung des Eros liefert, die der Priesterin<br />
Diotima in den Mund gelegt wird. Sokrates charakterisiert den Eros als ein Zwischenwesen<br />
zwischen Göttern und Menschen, als einen Daimon, welcher durch ein Streben mit dem Ziel<br />
gekennzeichnet ist, das Schöne zu erreichen und die Liebenden »zur Zeugung im Schönen« zu<br />
motivieren. Die philosophische Einstellung des Sokrates und seine eigene Haltung zum Eros<br />
werden abschließend in einer Rede beschrieben, die sein Schüler Alkibiades auf ihn hält.<br />
Diese kurze Zusammenfassung verdeutlicht bereits, in welcher inhaltlichen Breite das Symposion<br />
angelegt ist. Es verbindet konventionelle Liebesauffassungen mit reflektierten Liebestheorien<br />
und enthält zudem zentrale Überlegungen Platons zur Ethik, Naturphilosophie,<br />
Epistemologie, Religionsphilosophie und Metaphysik, einschließlich der Ideentheorie. Hinzu<br />
kommen diverse literarische Aspekte, die den Text interessant machen, z. B. die kunstvollindirekte<br />
Erzählform der Einleitungspartie, die einzelnen Redestrategien mitsamt den dazu<br />
gebrauchten Stilmitteln, die eingestreuten Dialogelemente oder die im Text verwendeten<br />
Mythen. Die philosophischen, philologischen sowie historischen (z. B. auch medizinhistorischen)<br />
Kenntnisse, die für eine adäquate Erschließung dieses Textes erforderlich sind, legen<br />
gerade für das Symposion das Modell eines kooperativen Kommentars nahe, wie er bei einem<br />
Kolloquium in Bonn Anfang <strong>2011</strong> versucht wurde.<br />
Die beteiligten Forscherinnen und Forscher waren Pierre Destrée, Dorothea Frede, Christoph<br />
Horn, Nora Kreft, Bernd Manuwald, Jörn Müller, Christian Pietsch, David Reeve, Frisbee Sheffield,<br />
Simon Weber und Jula Wildberger. Der Band erscheint in der von Otfried Höffe herausgegebenen<br />
Reihe »Klassiker Auslegen« (Berlin, Akademie Verlag).<br />
Philosophie<br />
Platon Selbsterkenntnis | prof. v. gerhardt, Institut für Philosophie, Humboldt-Universität<br />
zu Berlin, arbeitet an dem Projekt »Selbsterkenntnis und Leben. Zur Theorie und Praxis der<br />
individuellen Bildung bei Platon«.<br />
Ziel des Forschungsvorhabens ist die Rekonstruktion der sokratisch-platonischen Konzeption<br />
der Selbsterkenntnis. Im Zentrum des Projektes stehen die Fragen nach der Homogenität<br />
der insbesondere im platonischen Frühwerk zur Darstellung gelangenden Theorie einer vom<br />
Individuum zu leistenden Selbstbestimmung sowie nach dem Zusammenhang von Selbsterkenntnis<br />
und gelingender Lebensführung.<br />
In der ersten Projektphase wurde der historische Kontext der platonischen Theorie untersucht.<br />
Die Selbsterkenntnis ist bekanntlich nicht erst von Sokrates und Platon ins Zentrum<br />
der epistemischen Bemühungen gerückt worden, sondern besaß bereits in der religiös-dichterischen<br />
Tradition einen besonderen Stellenwert. Die Entdeckung von Wert und Bedeutung der<br />
Selbsterkenntnis ist auf das Engste mit dem delphischen Heiligtum und seinem Gott Apollon<br />
verknüpft, der bereits bei Homer als Mahner zur Selbstbesinnung in Erscheinung tritt. Der<br />
am Eingang des delphischen Apollontempels angebrachte Spruch »Gnothi sauton« (= Erkenne<br />
Dich selbst), der vermutlich auf die Sieben Weisen zurückgeht und später dem Gott selbst<br />
zugeschrieben wurde, bezeugt die Priorität dieser Einsicht innerhalb der delphischen Ethik.<br />
Im Projekt wurde der Versuch unternommen, auf der Grundlage der dichterisch-historiographischen<br />
Quellen den Gehalt der ursprünglich delphischen Selbsterkenntnis zu rekonstruieren.<br />
Die in der bisherigen Forschung nur ansatzweise erfolgte Auswertung der pindarischen<br />
Epinikien, der sophokleischen Tragödien und der Historien von Herodot konnte zeigen, dass<br />
bereits die dichterisch-religiöse Tradition über ein komplexes Selbsterkenntnis-Konzept verfügte,<br />
das eine große lebenspraktische Relevanz besaß.<br />
In den ausgewählten spätarchaisch-klassischen Texten wird das Selbsterkenntnis-Motiv<br />
zumeist im Zusammenhang mit dem Phänomen der Hybris thematisiert. Nach der in den<br />
relevanten Passagen greifbaren delphischen Auffassung besitzt die Selbstbesinnung die Funktion<br />
einer Prophylaxe und Eindämmung der hybrischen Gesinnung und des entsprechenden<br />
Verhaltens. Durch die Einsicht in die nicht aufzuhebende konstitutionell bedingte Differenz<br />
zwischen Menschen und Göttern sollte die latente oder manifeste Selbstvergöttlichung und<br />
Überhebung korrigiert werden. Im Projekt wurde anhand der Quellen aufgezeigt, dass die<br />
Begrenztheit des menschlichen Seins, die den Kerngehalt der delphischen Selbsterkenntnis<br />
bezeichnet, verschiedene Aspekte umfasst. Gegenstand der geforderten Einsicht ist die zeitliche<br />
Begrenztheit und Endlichkeit des menschlichen Daseins, die Inkonstanz und Instabilität<br />
der menschlichen Kräfte und Güter, die in den Zeugnissen häufig mit dem Gedanken der<br />
29<br />
Geschichte, Sprache und Kultur