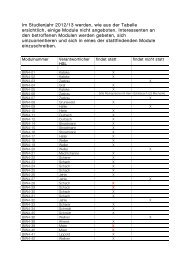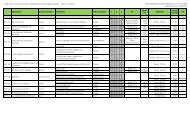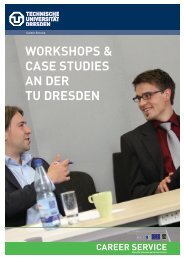Einzelzimmerquote - Technische Universität Dresden
Einzelzimmerquote - Technische Universität Dresden
Einzelzimmerquote - Technische Universität Dresden
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
32 Extra Bauen | Einrichten<br />
<strong>Einzelzimmerquote</strong><br />
Mehr Räume trotz gleicher<br />
Baukosten<br />
Eine Studie der <strong>Technische</strong>n <strong>Universität</strong> <strong>Dresden</strong> zeigt, dass es bei einem Neubau<br />
durchaus möglich ist, den Einzelzimmeranteil auf 85 Prozent anzuheben,<br />
ohne das gegenwärtige Investitionsniveau erhöhen zu müssen.<br />
Von Prof. Dr. Peter Schmieg, Dr. Gesine Marquardt, Stefan Eickmann<br />
Die Festschreibung einer Quote für den Einzelzimmeranteil<br />
in stationären Altenpflegeeinrichtungen<br />
wird anlässlich der Heimgesetzgebungsverfahren<br />
einiger Bundesländer derzeit sehr<br />
kontrovers diskutiert. So ist in Bayern die Festschreibung<br />
eines Einzelzimmeranteils von voraussichtlich<br />
85 Prozent und in Baden-Württemberg<br />
von 100 Prozent geplant.<br />
In Nordrhein-Westfalen wurde bereits eine<br />
Quote von 80 Prozent verabschiedet. Wie sich<br />
das Leben in einem Einzelzimmer oder einem<br />
Doppelzimmer auf die Bewohner auswirkt, und<br />
ob sich aus einer erhöhten <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />
generell erhöhte Investitions- und Betriebskosten<br />
der Einrichtungen ableiten lassen, wurde bisher in<br />
einigen Studien untersucht. Die Ergebnisse sind<br />
jedoch uneinheitlich.<br />
Bedarf an Gemeinschaftsflächen<br />
prüfen und optimieren<br />
Dass mit zunehmendem Einzelzimmeranteil<br />
die Fläche und damit die Baukosten der Einrichtungen<br />
ansteigen, ist zwar unbestritten, dennoch<br />
werden bereits seit einigen Jahren von verschiedener<br />
Seite Kompensationsmöglichkeiten im<br />
Gebäude untersucht. Dieser Ansatz wird in einer<br />
aktuellen, vom Bayerischen Staatsministerium für<br />
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen<br />
(StMAS) beim Lehrstuhl für Sozial- und Gesundheitsbauten<br />
der TU <strong>Dresden</strong> in Auftrag gegebenen<br />
Studie verfolgt. Es wird darin untersucht, mit<br />
welchen Veränderungen in den betrieblichen und<br />
baulichen Konzeptionen zukünftig ein Einzelplatzanteil<br />
von 85 Prozent beim Neubau stationärer<br />
Altenpflegeeinrichtungen in Bayern realisiert<br />
werden kann, ohne die Investitionskosten im Vergleich<br />
zum gegenwärtigen Niveau zu erhöhen.<br />
Basis der Untersuchungen ist eine Analyse der<br />
Raumprogramme in 32 seit 2002 in Bayern erbauten<br />
Pflegeeinrichtungen, die entweder mit Förder-<br />
mitteln des Freistaats oder frei finanziert errichtet<br />
wurden. Aus den erhobenen Daten werden entsprechend<br />
der unterschiedlichen Rahmenbedingungen<br />
der Finanzierung zwei Durchschnittshäuser<br />
generiert.<br />
Deren Funktionsstellen werden mit Kostengewichten<br />
bewertet, womit den unterschiedlich<br />
hohen Investitionskosten von Flächen verschiedener<br />
Funktionen Rechnung getragen wird. So<br />
verursacht beispielsweise ein Quadratmeter Badfläche<br />
etwa doppelt so hohe Baukosten wie eine<br />
Lagerfläche derselben Größe. Anhand der Durchschnittshäuser<br />
kann dargestellt werden, dass sich<br />
die Baukosten und der Flächenbedarf der Häuser<br />
erwartungsgemäß erhöhen, wenn die <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />
angehoben wird.<br />
Gleichzeitig können aber auch Veränderungsvarianten<br />
in den betrieblichen Konzeptionen sowie<br />
im Flächenansatz einzelner Funktionsstellen<br />
vorgenommen und dahingehend untersucht werden,<br />
ob dort Reduktionspotenziale bestehen, mit<br />
denen der entstandene Flächen- und Baukostenzuwachs<br />
kompensiert werden kann.<br />
Ausgangslage der Pflegeheime in Bayern: Die<br />
unterschiedliche Art der Finanzierung wirkt sich<br />
wenig auf den vorgefundenen durchschnittlichen<br />
Einzelplatzanteil von 73 Prozent bei den frei finanzierten<br />
und 76 Prozent bei den geförderten<br />
Einrichtungen aus. Auch die Struktur der Raumprogramme<br />
ist ähnlich. Deutlichere Auswirkungen<br />
der Finanzierungsform sind hingegen in den<br />
durchschnittlichen Flächen je Bewohner sichtbar.<br />
Bei den geförderten Häusern wurden etwa 55<br />
Quadratmeter Nutzfläche (NGF) je Bewohner<br />
über alle Funktionsstellen realisiert, wohingegen<br />
es bei den frei finanzierten nur rund 44 Quadratmeter<br />
waren. Dies ist bei der Analyse von Reserven<br />
in den Flächen bzw. Baukosten von großer<br />
Bedeutung, da die Spielräume für frei finanzierte<br />
Häuser aufgrund derer bereits verdichteten<br />
Raumprogramme schon stark begrenzt sind.<br />
Altenheim 11|2009
Die Platzzahl der Einrichtungen liegt im Mittel<br />
bei 90 Plätzen bei den geförderten Häusern und<br />
bei 104 Plätzen bei den frei finanzierten. Nahezu<br />
alle Bewohnerzimmer der Stichprobe verfügen<br />
über ein eigenes Bad und für jeweils ungefähr 25<br />
bis 30 Bewohner wird ein Pflegebad vorgehalten.<br />
Eine zentrale Speisenproduktion stellt in beiden<br />
Finanzierungsformen das gängige Versorgungsmodell<br />
dar, während Cafeterien überwiegend<br />
Bestandteil von geförderten Häusern sind. Die<br />
Unterschiede zwischen den Häusern liegen also<br />
insgesamt weniger in den zu Grunde gelegten<br />
Raumprogrammen, sondern überwiegend in den<br />
Flächen, die für die einzelnen Funktionen vorgehalten<br />
werden.<br />
Verzicht auf Pflegebäder schafft mehr<br />
Fläche für Einzelzimmer<br />
Um Maßnahmen zur Kompensation der Flächen<br />
und Baukosten anhand von Modellrechnungen<br />
untersuchen und bewerten zu können, werden<br />
Veränderungsvarianten in einzelnen Funktionsstellen<br />
der Raumprogramme bausteinartig<br />
vorgenommen. Ob damit auch ein relevanter<br />
Qualitätsverlust für die Bewohner einhergehen<br />
könnte, wird in dieser Studie nicht untersucht. Es<br />
gibt jedoch für jede vorgenommene Maßnahme<br />
realisierte Praxisbeispiele, und die untersuchten<br />
Veränderungsvarianten können in zukünftigen<br />
Raumprogrammen auch nur teilweise bzw. in<br />
Kombination miteinander angewandt werden.<br />
Standardisierung der Bädergrößen für die Berechnungsgrundlage:<br />
Für die den Bewohnerzimmern<br />
unmittelbar angegliederten Bäder wurde,<br />
unabhängig von der Finanzierungsform des Hauses,<br />
eine durchschnittliche Fläche von 4,3 Quadratmetern<br />
erhoben. Auf dieser Grundfläche lässt<br />
sich ein barrierefreies Bad mit einem Bewegungsradius<br />
von 120 Zentimetern vor Handwaschbecken<br />
und Toilette sowie innerhalb der Dusche<br />
gemäß der DIN 18025-2 realisieren. Für ein von<br />
Bewohnern mit Rollstuhl selbstständig benutzbares<br />
Bad ist jedoch eine Bewegungsfläche von 150<br />
Zentimetern gemäß der DIN 18025-1 notwendig<br />
und die Badgröße von 4,3 Quadratmetern ist dafür<br />
nicht ausreichend.<br />
In den durchgeführten Modellrechnungen wurden<br />
deshalb zwei Mindestgrößen angenommen:<br />
Zum einen barrierefreie Bäder nach DIN 18025-2<br />
mit einer Fläche 3,6 Quadratmetern sowie eine<br />
Anzahl von acht barrierefreien Bädern für Rollstuhlbenutzer<br />
nach DIN 18025-1 mit einer Fläche<br />
von 5,4 Quadratmetern. Insgesamt ergibt sich so<br />
eine Flächenminderung im Bereich der Bäder,<br />
und es besteht bereits ein Potenzial an Flächen<br />
Altenheim 11|2009<br />
Wenn sich Gemeinschaftsaktivitäten mehr auf Wohnbereiche und<br />
Hausgemeinschaften konzentrieren, könnte die Fläche eines multifunktional<br />
nutzbaren Gemeinschaftsraumes kleiner sein.<br />
Foto: Krüper<br />
und Baukosten, das anteilig zur Kompensierung<br />
des erhöhten Einzelzimmeranteils herangezogen<br />
werden könnte. Die Baukostenminderung fällt<br />
hierbei jedoch nicht in größerem Umfang aus, da<br />
die Flächenreduktion im Bereich der Bäder sich<br />
nicht proportional auf deren Baukosten auswirkt.<br />
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anforderungen<br />
an Installation und Ausstattung der Bäder<br />
konstant bleiben.<br />
Jeder Bewohner hat ein Zimmer,<br />
aber je zwei teilen sich ein Bad<br />
Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsflächen:<br />
Die Gemeinschaftsflächen innerhalb der Wohnbereiche<br />
sowie die Individualflächen in den Bewohnerzimmern<br />
sind in dieser Studie nicht der<br />
Gegenstand von Veränderungsmaßnahmen. Es<br />
handelt sich hierbei um Flächen von zentraler<br />
Bedeutung für die Wohnqualität und deren Minimierung<br />
würde in jedem Fall einen nicht anzustrebenden<br />
Qualitätsverlust nach sich ziehen. Es bestehen<br />
jedoch in veränderten Raumzuordnungen<br />
Flächenpotenziale, indem über einen Vorraum<br />
zwei Einzelzimmer und ein Bad erschlossen werden,<br />
was als Doppelappartement bezeichnet wird.<br />
Auch bereits mit der Ausbildung nur eines Teils<br />
der Bewohnerzimmer in dieser Form kann es<br />
möglich sein, die zusätzlichen Flächen und Baukosten,<br />
die aus dem erhöhten Einzelzimmeranteil<br />
resultieren, zu kompensieren.<br />
Bisher war nach Maßgabe der Heimmindestbauverordnung<br />
für jeweils 20 Bewohner ein Pflegebad<br />
notwendig. Diese Anzahl wurde jedoch bereits<br />
in der Stichprobe nicht vorgefunden. Oftmals<br />
ist eine so hohe Pflegebäderzahl auch nicht notwendig,<br />
sodass einige Bäder des Hauses nur selten<br />
genutzt werden. Es erscheint zukünftig in einer w<br />
33
34 Extra Bauen | Einrichten<br />
GEFörDErtE HäuSEr<br />
Modellrechnungen NGF in m² /<br />
Bewohner<br />
Ausgangslage:<br />
gefördertes<br />
Durchschnittsheim<br />
Zielgröße: geför-<br />
dertes Heim mit<br />
85% Einzelzimmern<br />
und standar-<br />
disierter Badgröße<br />
w reduzierten Anzahl an Pflegebädern ein Kompensationspotenzial<br />
für den erhöhten Einzelzimmeranteil<br />
gegeben.<br />
Dezentrale Speisenversorgung und Verzicht<br />
auf Cafeterien spart Grundfäche<br />
Aufgrund der erhöhten Anforderungen an Haustechnik<br />
und Einrichtung sind Flächen zur Speisenversorgung<br />
tendenziell teure Flächen. Untersucht<br />
wird in den Modellrechnungen der Studie,<br />
wie sich der Flächenverbrauch und die Baukosten<br />
verändern, wenn von der zentralen Eigenpro-<br />
Flächendifferenz<br />
zur<br />
Ausgangslage<br />
Kostendifferenz<br />
zur<br />
Ausgangslage<br />
54,87 0 0<br />
55,27 +0,7% +1,2%<br />
Veränderungsmaßnahmen in Bausteinen der Raumprogramme<br />
Reduktion auf ein<br />
Pflegebad<br />
Umstellen auf<br />
dezentrale<br />
Speisenproduktion<br />
Umstellung auf<br />
Fremdproduktion<br />
mit dezentraler<br />
Regeneration<br />
Wegfall der<br />
Cafeteria<br />
Nur noch 40 m²<br />
Mehrzweck- u.<br />
Therapiebereich<br />
Alle Einzelzimmer<br />
nach DIN 18025-2<br />
als Doppelappartements<br />
(2EZ, 1Bad)<br />
54,80 -0,1% -0,2%<br />
54,89 0 % -0,5%<br />
53,97 -1,6% -2,0%<br />
54,33 -1,0% -0,5%<br />
54,53 -0,6% -0,1%<br />
53,41 -2,7% -4,4%<br />
Um die Kosten für die Einhaltung der <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />
nicht explodieren zu lassen, gilt es gut zu planen. Diese<br />
Modellrechnung zeigt Möglichkeiten bei geförderten Heimen.<br />
Tabelle: TU <strong>Dresden</strong><br />
duktion der Speisen auf eine dezentrale Speisenversorgung<br />
in den Wohnbereichen bzw. auf eine<br />
Fremdproduktion der Speisen mit dezentraler Regeneration<br />
umgestellt wird. Es können hier zwar<br />
durchaus Flächenpotenziale identifiziert werden,<br />
die Wahl eines Versorgungssystems kann jedoch<br />
nicht nur nach ökonomischen Interessen erfolgen,<br />
sondern muss vor dem Hintergrund des durch<br />
den Träger formulierten Gesamtkonzepts entschieden<br />
werden. Dies gilt auch für das Vorhalten<br />
einer Cafeteria, die nicht nur zur Nutzung durch<br />
die Bewohner, sondern auch für die Vernetzung<br />
FrEi FinAnZiErtE HäuSEr<br />
Modellrechnungen NGF in m² /<br />
Bewohner<br />
Ausgangslage: frei<br />
finanziertes<br />
Durchschnittsheim<br />
Zielgröße: frei<br />
finanziertes Heim<br />
mit 85% EZ und<br />
standardisierter<br />
Badgröße<br />
Flächendifferenz<br />
zur<br />
Ausgangslage<br />
Kostendifferenz<br />
zur<br />
Ausgangslage<br />
43,90 0 0<br />
44,64 +1,7% +2,2%<br />
Veränderungsmaßnahmen in Bausteinen der Raumprogramme<br />
Reduktion auf ein<br />
Pflegebad<br />
Umstellen auf<br />
dezentrale<br />
Speisenproduktion<br />
Umstellung auf<br />
Fremdproduktion<br />
mit dezentraler<br />
Regeneration<br />
Wegfall der<br />
Cafeteria<br />
Nur noch 40 m²<br />
Mehrzweck- u.<br />
Therapiebereich<br />
Alle Einzelzimmer<br />
nach DIN 18025-2<br />
als Doppelappartements<br />
(2EZ, 1Bad)<br />
44,03 +0,3 % -0,1%<br />
45,06 +2,7% +2,6 %<br />
44,23 +0,7% +0,9%<br />
43,88 0 % +0,6%<br />
44,56 +1,5 % +2,0 %<br />
42,77 -2,6% -4,8%<br />
Freie Bauträger, die Mehrzweckflächen und die Anzahl der<br />
Pflegebäder reduzieren, können die <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />
gewährleisten, ohne dass die Kosten explodieren.<br />
Tabelle: TU <strong>Dresden</strong><br />
Altenheim 11|2009
der Einrichtung in das Wohnquartier von Bedeutung<br />
ist. Der Verzicht auf eine Cafeteria oder auch<br />
deren Ausgliederung stellt nicht unter allen Rahmenbedingungen<br />
eine Flächenressource, die zur<br />
Disposition steht, dar, bietet aber in vielen Fällen<br />
Einsparpotenziale.<br />
Mehrzweck- und therapieräume: In einer weiteren<br />
Modellrechnung wird eine Reduktion der<br />
Mehrzweck- und Therapieräume auf eine Mindestgröße<br />
von 40 Quadratmetern untersucht. Die<br />
Realisierbarkeit dieser Variante ist von der Konzeption<br />
des Hauses abhängig. Wenn sich, wie in<br />
zahlreichen Einrichtungen vorgefunden, die Gemeinschaftsaktivitäten<br />
ohnehin auf die Wohnbereiche<br />
und Hausgemeinschaften konzentrieren,<br />
kann in Abhängigkeit der Anforderungen vor<br />
Ort ein in der Fläche deutlich geminderter multifunktionell<br />
nutzbarer Raum ausreichend sein.<br />
Insbesondere im Bereich der mit Fördermitteln<br />
erbauten Häuser bestehen somit anteilige Kompensationspotenziale.<br />
Die in der Studie vorgenommenen Modellrechnungen<br />
zeigen, dass es durchaus möglich ist, eine<br />
Erhöhung des Einzelzimmeranteils auf 85 Prozent<br />
bei zukünftigen Neubaumaßnahmen flächen- und<br />
kostenneutral gegenüber den derzeitigen baulichen<br />
Standards vorzunehmen. Die Modellrechnungen<br />
zeigen für geförderte und frei finanzierte<br />
Häuser im Trend vergleichbare, in der Ausprägung<br />
jedoch unterschiedliche Ergebnisse auf. Nicht alle<br />
in der Studie untersuchten Varianten werden<br />
sich in allen Häusern auch umsetzen lassen, und<br />
es wird eine Auswahl und Kombination vor dem<br />
Hintergrund der unterschiedlichen Konzeptionen<br />
der Träger bzw. Einrichtungen notwendig werden.<br />
Damit ist es möglich, bei zukünftigen Bauvorhaben<br />
ein den eigenen Anforderungen entsprechendes<br />
Raumprogramm zu entwickeln. ¬<br />
> technische universität <strong>Dresden</strong>, Fakultät Architektur,<br />
Lehrstuhl Sozial- und Gesundheitsbauten,<br />
01062 <strong>Dresden</strong>,tel. (03 51) 46 33 47 24.<br />
Hallo, Frau Marqardt,<br />
haben Sie noch Vorschläge für Zusatzinfos im<br />
Abspann? Kann man die Studie erwerben oder<br />
herunterladen und wo??<br />
Soll Herr Prof. Schmieg zuerst als Autor genannt<br />
werden?<br />
Wo arbeitet bzw. lebt Herr Eickmann, auch in<br />
<strong>Dresden</strong>??<br />
Altenheim 11|2009<br />
DoPPELAPPArtEMEntS SPArEn BAuKoStEn w<br />
Einzel- und Doppelzimmer sowie Doppelappartements nach DIN<br />
18025-2. Ein Platz im Doppelappartement benötigt acht Prozent weniger<br />
Fläche als ein Einzelzimmer, ein gemeinsames Bad senkt Baukosten.<br />
Grafik: TU <strong>Dresden</strong><br />
Dr.-ing. Gesine Marquardt ist Architektin<br />
und wissenschaftliche Mitarbeiterin an<br />
der technischen universität <strong>Dresden</strong>.<br />
Prof. Dr.-ing. Peter Schmieg von der<br />
technischen universität <strong>Dresden</strong>, Fakult<br />
Architektur.<br />
Stefan Eickmann ist Diplom Pflegewirt<br />
(FH).<br />
35