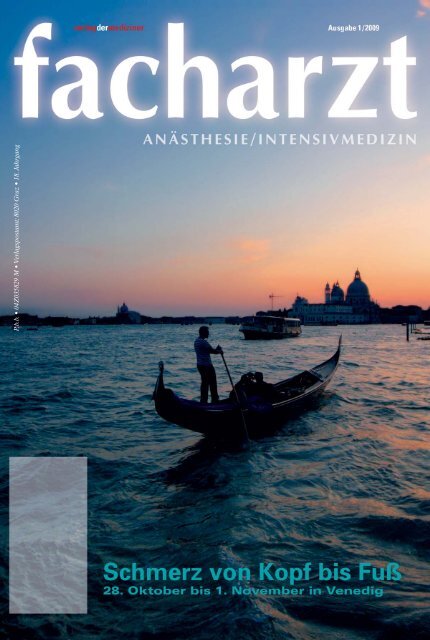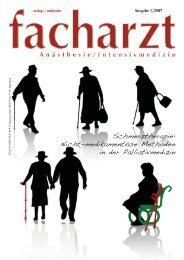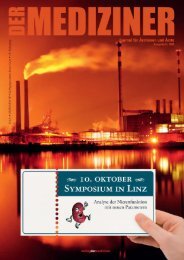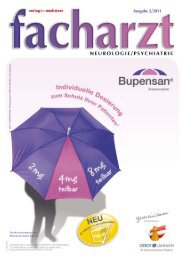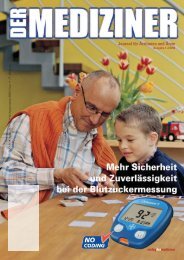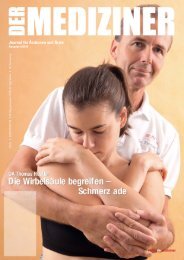P .b .b .• 04Z035829 M • V erlagspostamt:8020 Graz • 18.Jahrgang
P .b .b .• 04Z035829 M • V erlagspostamt:8020 Graz • 18.Jahrgang
P .b .b .• 04Z035829 M • V erlagspostamt:8020 Graz • 18.Jahrgang
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
P.b.b. <strong>•</strong> <strong>04Z035829</strong> M <strong>•</strong> V<strong>erlagspostamt</strong>: <strong>8020</strong> <strong>Graz</strong> <strong>•</strong> 18. Jahrgang
Anzeige Plus<br />
26<br />
COVERSTORY<br />
4<br />
FORTBILDUNG<br />
Schmerztherapie – ganzheitlich gesehen<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wilfried Ilias<br />
Medikamentöse Tumorschmerztherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Univ.-Prof. Dr. Günther Bernatzky<br />
Neuropathische Schmerzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar<br />
Pharmakokinetische Aspekte in der Schmerztherapie<br />
unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit Alkohol . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Josef Donnerer<br />
Neuraltherapie in der Schmerzmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
Dr. Kurt Gold-Szklarski<br />
Symptomatik und Akuttherapie bei primären Kopfschmerzen . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Prim. Univ.-Doz. Dr. Klaus Berek (Bild), OA Dr. Markus Mayr<br />
FORUM MEDICUM<br />
Buchneuerscheinung: Palliativmedizin – Lehrbuch für Ärzte, Psychosoziale<br />
Berufe und Pflegepersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Neue Spezialmatrix für Fentanylpflaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Fachkurzinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
Auf Schnupperreise am Lido – unsere Fotografin des<br />
Titelbildes Marianne Habel beim Selbstportait<br />
Impressum<br />
Verleger: Verlag der Mediziner gmbh. Herausgeber und Geschäftsführer: Peter Hübler. Projektleitung:<br />
Helga Rothenpieler. Redaktion: Andrea Ballasch, Dr. Csilla Putz-Bankuti, Jutta Gruber,<br />
Dr. Birgit Jeschek. Anschrift von Verlag und Herausgeber: A-9375 Hüttenberg, Steirer Straße 24,<br />
Telefon: 04263/200 34. Fax: 04263/200 74. Redaktion: A-<strong>8020</strong> <strong>Graz</strong>, Payer-Weyprecht-Straße<br />
33–35, Telefon: 0316/26 29 88, Fax: 0316/26 29 93. Produktion: Richard Schmidt. Druck: Medienfabrik<br />
<strong>Graz</strong>. E-Mail: office@mediziner.at. Homepage: www.mediziner.at. Einzelpreis: € 3,–.<br />
Erscheinungsweise: periodisch.<br />
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Medieninhaber: Verlag der Mediziner gmbh. Richtung der Zeitschrift: Medizinisch-pharmazeutisches<br />
Informationsjournal für österreichische Ärztinnen und Ärzte. Soweit in diesem Journal eine Dosierung oder eine<br />
Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf<br />
verwandt haben, dass diese Ausgabe dem Wissenstand bei Fertigstellung des Journals entspricht. Für Angaben über<br />
Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer<br />
ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach Konsultation<br />
eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebenen Empfehlungen für Dosierung oder die Beachtung von Kontraindikationen<br />
gegenüber der Angabe in diesem Heft abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten<br />
oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des<br />
Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.<br />
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht immer besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen<br />
Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Die mit FB (Firmenbeitrag)<br />
gekennzeichneten bzw. als Produktbeschreibung erkenntlichen Beiträge sind entgeltliche Einschaltungen und geben nicht unbedingt<br />
die Meinung der Redaktion wieder. Es handelt sich somit um „entgeltliche Einschaltungen“ im Sinne § 26 Mediengesetz.<br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser! Auf vielfachen Wunsch verzichten wir für eine bessere<br />
Lesbarkeit auf das Binnen-I und auf die gesonderte weibliche und männliche Form bei Begriffen<br />
wie Patient oder Arzt. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Zustimmung!<br />
INHALT, IMPRESSUM UND EDITORIAL<br />
Sehr geehrte TeilnehmerInnen<br />
und Teilnehmer!<br />
Liebe LeserInnen und Leserdieser<br />
Ausgabe<br />
Als neu gewählter<br />
Präsident der ÖsterreichischenSchmerzgesellschaft<br />
heisse ich Sie<br />
auf dieser Fortbildungsveranstaltung<br />
in<br />
Venedig sehr herzlich<br />
willkommen. Das Motto dieser<br />
Veranstaltung steht unter dem Thema<br />
„Schmerz von Kopf bis Fuß“. Dieses<br />
Motto kann auch als Leitmotiv für die<br />
Zeit meiner Präsidentschaft gelten. Ich<br />
möchte auf jeden Fall das Ganzheitliche<br />
Konzept der Schmerztherapie mit den<br />
verschiedenen Therapieansätzen aktualisieren<br />
und den niedergelassenen Ärzten<br />
vorstellen. Gerade die niedergelassenen<br />
Ärzte sind als sogenannte Gatekeeper<br />
unmittelbar mit dem betroffenen Patienten<br />
konfrontiert. Ihnen obliegt es letztlich,<br />
den Patienten die neuesten Errungenschaften<br />
der modernen Schmerzmedizin<br />
anzubieten bzw. auch zu erklären.<br />
Auf dieser Tagung werden neben der<br />
Begutachtung von Schmerzen spezielle<br />
Themen über Wirbelsäulen und Rheumatischer<br />
Schmerz, Orthopädische Aspekte,<br />
Tumor- und Neuropathischer sowie Kopfschmerz<br />
ebenso behandelt, wie Chronifizierungsaspekte.<br />
Spezialthemen werden<br />
neben Musiktherapie die Neuraltherapie<br />
bzw.Therapie in der Schwangerschaft und<br />
bei kognitiv beeinträchtigten Personen<br />
sein.Wichtige Aspekte der medikamentösen<br />
Therapie kommen ebenso zur Sprache,<br />
wie z.B. die Therapie mit Cannabinoiden.Ein<br />
wichtiger Aspekt gilt letztlich auch<br />
der Frage, ob bei Schmerzmitteln eine<br />
Suchtgefahr besteht.<br />
Als Referenten haben sich Österreichs<br />
führende Experten in der Schmerzphysiologie<br />
und -therapie bereit erklärt, ihr<br />
Wissen zu den verschiedenen Themen<br />
vorzustellen.<br />
Mein Dank gilt den Teilnehmern dieser<br />
Tagung, an die Referenten, an die Firma<br />
Mondial für die Organisation und an<br />
die Firmen,die durch Ihre Unterstützung<br />
diese Veranstaltung ermöglicht haben.<br />
Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen,<br />
informativen Aufenthalt<br />
Prim.Univ.-Prof. Dr. Wilfried Ilias<br />
1/2009 3
SCHMERZTHERAPIE<br />
Schmerztherapie – ganzheitlich gesehen<br />
4<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wilfried Ilias<br />
Schmerz als Begriff und Empfindung<br />
überstreicht alle nur denkbaren sensorischen<br />
und emotionalen Informationsmuster,<br />
welche dem Individuum Bedrohung,<br />
Verletzung, Verlust, Vernichtung<br />
u.a.m. vermitteln, um dadurch über genetisch<br />
regulierte Lernprozesse und reflektorische<br />
Engramme Vermeidungs- und<br />
Überlebensstrategien zu entwickeln. Das<br />
Ausmaß der jeweils als extrem unangenehm<br />
empfundenen Schmerzreize, seien<br />
diese nun nozizeptiv oder emotional,<br />
hängt jeweils von der Intensität des physischen<br />
oder psychischen Traumas ab und<br />
ist letztlich entscheidend, wie und in welchen<br />
Ebenen das Nervensystem des bedrohten<br />
Individuums reagiert. Die Reaktionen<br />
können kurzfristige und rasch abklingende<br />
aber auch langfristige und sogar<br />
zunehmend selbst verstärkende neuronale<br />
Verlaufsmuster darstellen. In gleicher<br />
Weise kann ein Organismus auf eine<br />
Bedrohung überschießend,bis zur Selbstvernichtung<br />
aber auch Unterdrückung bis<br />
zur totalen Schmerzlosigkeit als Voraussetzung<br />
einer erfolgreichen Flucht oder<br />
Verteidigung reagieren. Die Vielfalt der<br />
körperlichen aber auch seelischen Bedrohungen<br />
und Verletzungsmöglichkeiten,<br />
ist in einer ebenso vielfältigen vegetativen,<br />
emotionalen, nozizeptiven und reparativen<br />
Reaktionsfähigkeit hinterlegt.<br />
Dementsprechend vielfältig hat einerseits<br />
der Zugang zur Diagnose aber auch zur<br />
Therapie von Schmerzzuständen zu sein,<br />
seien diese nun körperlich, seelisch oder<br />
wie in der überwiegenden Mehrheit eine<br />
Repräsentation der Verknüpfung beider<br />
Komponenten.<br />
Für das moderne Konzept von Schmerz<br />
als „Bio-Psycho-soziale Einheit“ muss<br />
eine multimodale Therapie dienen: Hier<br />
hat neben der pharmakologischen The-<br />
1/2009<br />
rapie auch das Wissen um die Einflussnahme<br />
auf die emotionalen Mechanismen<br />
eine Bedeutung. Neben dem Effekt des<br />
Glaubens an eine Therapie oder Ablehnens<br />
derselben (Placebo/Nocebo) gilt es<br />
auch, die Wichtigkeit des Arztes als Persönlichkeit<br />
und Vermittler der jeweils ausgewählten<br />
Therapie und des zu erwartenden<br />
Erfolges in den Vordergrund zu stellen.<br />
Der Glaube an Hilfe ist nicht zuletzt<br />
auch mit Spiritualität verknüpft, ein Umstand,welcher<br />
häufig unterschätzt wird.Gerade<br />
in einer Zeit der zunehmenden Migration<br />
kommt die Berücksichtigung der<br />
Spiritualität oft zu kurz, da die Identifizierung<br />
mit den Glauben und den Auffassungen<br />
anderer ethnischer Kulturen und Religionen<br />
nicht zuletzt aus Unkenntnis oft<br />
nicht umgesetzt werden kann.<br />
Besondere Berücksichtigung erfordert<br />
zweifellos der Umgang mit Personen,<br />
deren Einsichtsfähigkeit beeinträchtigt<br />
ist. Die Fortschritte der Medizin haben<br />
eine erhöhte Lebenserwartung zur Folge,<br />
welche allerdings auch degenerative<br />
Erkrankungen hervorruft. Eine der<br />
unangenehmsten Folgen der Überalterung<br />
ist die senile Demenz, mit dem Verlust,<br />
sich adäquat mitteilen zu können.<br />
Dementsprechend schwierig gestaltet<br />
sich die Schmerztherapie des alten, dementen<br />
Patienten. Nicht zuletzt hängt<br />
der Erfolg einer Schmerztherapie auch<br />
von den angebotenen Bewältigungsstrategien<br />
ab, wo Sachkenntnis ebenso wichtig<br />
wie bedarfsbezogene Phantasie ist.<br />
Hier sind der Psychotherapie alle Möglichkeiten<br />
eröffnet.<br />
Auch die Möglichkeiten des Einsatzes<br />
der Hypnose, werden nicht zuletzt des-<br />
halb unterschätzt, weil das Angebot nicht<br />
breitflächig genug vorhanden ist. In die<br />
Kategorie mangelnden Angebotes fällt<br />
zweifellos auch die Entspannungstherapie.<br />
Gerade bei Krankheitsbildern wie<br />
dem posttraumatischen Belastungssyndrom,<br />
sind die genannten Methoden von<br />
besonderer Bedeutung.<br />
Schmerzempfindung, -Wahrnehmung<br />
und Verarbeitung ist wie Eingangs erwähnt<br />
ein polymodales Geschehen und<br />
kann dementsprechend durch andere<br />
Empfindungen „moduliert“ werden. Die<br />
Einwirkung von Kälte und Wärme auf<br />
die Intensität von Schmerzen ist nicht zuletzt<br />
aus der Sportmedizin hinlänglich<br />
bekannt geworden.<br />
Abschließend soll noch auf die Modulationsmöglichkeit<br />
durch akustische<br />
Überlagerung hingewiesen werden.Dies<br />
betrifft nicht nur den Einfluss von Wohlklang<br />
und Missklang musikalischer Werke,<br />
sondern auch unterschiedlicher nicht<br />
musikalisch angewandter Frequenzen<br />
auf Schmerzintensität und Schmerz- verarbeitung.<br />
Neben einer bestmöglichen Schulung<br />
von Ärzten ist auch eine Sachinformation<br />
für Laien von höchster vordringlicher<br />
Bedeutung!<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wilfried Ilias,<br />
MSc Wien,<br />
Lammgasse 1/12a, A-1080 Wien<br />
Akademisches Lehrkrankenhaus der<br />
Barmherzigen Brüder,<br />
Johannes-von-Gott-Platz 1,A-1020 Wien<br />
Tel.: +43/1/21121-379<br />
wilfried.ilias@bbwien.at<br />
Anzeige Plus<br />
26
TUMORSCHMERZTHERAPIE<br />
Medikamentöse Tumorschmerztherapie<br />
6<br />
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar (Foto), Univ.-Prof. Dr. Günther Bernatzky<br />
In fortgeschrittenen Tumorstadien leiden<br />
70–90% der Patienten unter behandlungsbedürftigenSchmerzzuständen.<br />
Schmerzen sind das häufigste Symptom<br />
maligner Erkrankungen. Deshalb<br />
ist eine frühzeitige interdisziplinäre Diagnostik<br />
und Therapie von Schmerzen bei<br />
Tumorpatienten notwendig. Neben einer<br />
Kausaltherapie muss parallel mit einer<br />
symptomatischen medikamentösen<br />
Schmerzbehandlung begonnen werden.<br />
Nach wie vor existieren Vorurteile und<br />
Informationsdefizite über die Wirkung<br />
von Morphin.<br />
Ätiologie und Pathogenese<br />
von Tumorschmerzen<br />
60–90% der Schmerzzustände bei Tumorpatienten<br />
sind durch Infiltration,<br />
Kompression mit konsekutiver Durchblutungsstörung,<br />
Ödem, Ulzeration oder<br />
Perforation direkt tumorbedingt. 10–25%<br />
1/2009<br />
der Schmerzzustände sind therapiebedingt.<br />
Operation, Chemo-, Hormontherapie<br />
oder Radiatio können schmerzhafte<br />
Folgezustände wie z.B. Neuralgien,<br />
Phantomschmerz, Fibrose, Mukositis<br />
oder Ödem verursachen. Außerdem unterscheidet<br />
man zwischen tumorassoziierten<br />
Schmerzursachen wie z.B. Pneumonie,<br />
Pilzinfektion, Venenthrombose,<br />
Dekubitus (5–20 %) und tumorunabhängigen<br />
Schmerzursachen wie z.B. Migräne<br />
oder Arthritis (3–10%). Neben somatischen<br />
Ursachen beeinflussen kulturelle,<br />
psychosoziale und spirituelle Faktoren<br />
das Schmerzerleben. Pathophysiologisch<br />
unterteilt man den Karzinomschmerz in<br />
Nozizeptorschmerz und neuropathischen<br />
Schmerz.<br />
Therapieprinzipien<br />
Eine erfolgreiche Schmerztherapie<br />
setzt eine gründliche Schmerzanamnese<br />
Abbildung 1<br />
WHO-Stufenschema zur Schmerztherapie bei chronischen Tumorschmerzen<br />
Aufgaben für spezielle Schmerz- und Palliativzentren 4: starke Opioide<br />
(rückenmarksnahe Appl.)<br />
Bei persistierenden und stärker werdenden Schmerzen<br />
3: starke Opioide Buprenorphin<br />
± Nichtopioidanalgetika Fentanyl<br />
± Adjuvantien<br />
Bei persistierenden und stärker werdenden Schmerzen<br />
Hydromorphon oral<br />
Morphin oral<br />
Oxycodon oral<br />
2: schwache Opioide Tramadol<br />
± Nichtopioidanalgetika<br />
± Adjuvantien<br />
Dihydrocodein<br />
Bei persistierenden und stärker werdenden Schmerzen<br />
1: Nichtopioidanalgetika Metamizol<br />
± Adjuvantien Diclofenac, Naproxen, Ibuprofen,<br />
Paracetamol<br />
und Dokumentation voraus. Der Charakter,<br />
die Lokalisation, die Dauer und<br />
Intensität des Schmerzes müssen festgehalten<br />
werden.<br />
Die Schmerztherapie sollte nach ausführlicher<br />
Aufklärung individualisiert erfolgen.<br />
In jeder Phase der Erkrankung<br />
muss erneut die Möglichkeit einer kausalen<br />
Therapie erwogen werden. Eine<br />
transdermale oder orale Medikamentenverabreichung<br />
ist zu bevorzugen, während<br />
eine parenterale Applikation einer<br />
besonderen Indikation bedarf. Die Medikamenteneinnahme<br />
soll regelmäßig und<br />
nach einem festen Zeitschema und nicht<br />
erst beim Eintritt der Schmerzen erfolgen,<br />
da sonst die Gefahr der Entwicklung<br />
einer physischen Abhängigkeit erhöht ist.<br />
Zu bevorzugen sind langwirksame Retardpräparate,<br />
da diese die Compliance<br />
des Patienten steigern. Für Schmerzspitzen<br />
muss dem Patienten eine kurzwirksame<br />
Bedarfsmedikation zur Verfügung<br />
stehen. Begleitsymptome und Nebenwirkungen<br />
müssen konsequent, teilweise<br />
auch prophylaktisch behandelt werden.<br />
Eine regelmäßige Kontrolle der medikamentösen<br />
Schmerztherapie ist notwendig,<br />
um eine effektive Dosisanpassung<br />
auch bei Veränderung der Schmerzsymptomatik<br />
zu ermöglichen.<br />
Erst wenn die orale bzw. transdermale<br />
Applikation nicht mehr wirkungsvoll genug<br />
ist, sollten invasive Verfahren, d. h.<br />
eine subkutane, intravenöse, epidurale<br />
bzw.spinale Medikamentengabe bzw.Nervenblockaden<br />
zum Einsatz kommen, begleitend<br />
Anwendung physikalischer und<br />
psychotherapeutischer Maßnahmen. Für<br />
diese Maßnahmen sind Schmerz- und<br />
Palliativzentren notwendig.<br />
Anzeige Plus<br />
26
WHO-Stufenplan<br />
Die WHO nennt für das von ihr vorgeschlagene<br />
Stufenschema zur medikamentösen<br />
Behandlung der Schmerzen<br />
Erfolgsraten von bis zu 90%, eingeteilt<br />
wird in drei Stufen:<br />
Stufe I: Nichtopioid-Analgetika<br />
Zu den Nichtopioid-Analgetika gehören<br />
die nichtsteroidalen Antirheumatika<br />
(NSAR) wie Azetylsalizylsäure, Ibuprofen<br />
und Diclofenac, Anilinderivate wie<br />
Paracetamol und Pyrazolderivate wie<br />
Metamizol.Bei den meisten dieser Medikamente<br />
treten ab bestimmten Dosierungen<br />
verstärkt Nebenwirkungen ohne<br />
Steigerung des analgetischen Effektes<br />
auf (Ceiling-Effekt). Beim Risiko von<br />
gastrointestinalen Nebenwirkungen sollten<br />
nichtsteroidale Antirheumatika mit<br />
Protonenpumpenhemmer oder Prostaglandin<br />
analog und E2-Ciprostol kombiniert<br />
werden.<br />
Stufe II und III:<br />
schwache und starke Opioide<br />
Kann mit den Nichtopioid-Analgetika<br />
keine akzeptable Schmerzreduktion erzielt<br />
werden,ist die zusätzliche Verschreibung<br />
eines Opioids (meist reiner Agonist)<br />
erforderlich. Eine Kombination von<br />
retardierten Opioiden ist nicht ratsam.<br />
Zur Stufe II gehören Tramadol (Tageshöchstdosis<br />
= THD 600 mg/d) und Dihydrocodein<br />
(THD 240 mg/d). Aufgrund<br />
der Metabolisierung und Elimination<br />
sollte bei Leberschädigung Tramadol bevorzugt<br />
werden. Aufgrund dessen, dass<br />
TUMORSCHMERZTHERAPIE<br />
Tabelle 1<br />
Wirkstoff Handelsname Einzeldosis KG Wirkdauer/h Dosierung Tageshöchstdosis<br />
mg/kg mg/die THD in mg<br />
Ibuprofen Brufen ® /Avallone ® 10 8 3–4 x 400–600 2.400<br />
Diclofenac Voltaren ® 1 8 3–4 x 50 200<br />
Naproxen Miranax ® 5 12 2 x 550 1100<br />
Metamizol Novalgin ® 10 4 4–6 x 500–1.000 6000<br />
Paracetamol Mexalen ® 15 6 4–6 x 500–1.000 6 g (THD: max. 72 h)<br />
Celecoxib Celebrex ® Nichtopioid-Analgetika<br />
1,5–3 12 1–2 x 100–200 400<br />
Tabelle 2<br />
Nichtopioid-Analgetika (Angabenempfehlungen für Erwachsene)<br />
Pyrazolone, Analgetische Säuren, Anilinderivate<br />
z. B. Metamizol z. B. Diclofenac, Ibuprofen z. B. Paracetamol<br />
analgetisch +++ ++ +<br />
antipyretisch ++ + +<br />
antiinflammatorisch (+) ++ 0<br />
spasmolytisch + 0 0<br />
Tramadol in den ersten 14 Tagen Übelkeit<br />
und Erbrechen hervorrufen kann,<br />
sollte in diesem Zeitraum eine Kombination<br />
mit einem Antiemetikum erfolgen.<br />
Tramadol-Präparate mit einer Wirksamkeit<br />
von 24 Stunden berücksichtigen<br />
auch die Chronobiologie des neuropathischen<br />
Tumorschmerzes (Adamon ® long<br />
retard). Dihydrocodein ist bei einer zusätzlich<br />
erwünschten antitussiven Wirkung<br />
indiziert. Allerdings ist wegen ausgeprägter<br />
Obstipation eine prophylaktische<br />
Gabe eines Laxans notwendig. Bei<br />
unzureichender Wirkung sollte zügig auf<br />
ein starkes Opioid der Stufe III umge-<br />
1/2009 7
TUMORSCHMERZTHERAPIE<br />
Wirkstoff Handelsname Angabe im mg<br />
Tramadol oral Adamon ® long retard 150 300 450 600<br />
Tramadol s.c., i.v. Tramal ® 100 200 300 400 500<br />
Morphin Sulfat – oral Mundidol ® 30 60 90 120 150 180 210 240<br />
Morphin Hcl – oral Vendal ® 30 60 90 120 150 180 210 240<br />
Morphin Hcl – s.c. i.v. Vendal ® 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Oxydodon oral Oxycontin ® 30 60 90 120<br />
Hydromorphon oral Hydal ® 4 8 12 16 20 24 28 32<br />
Fentanyl TTS (µg/h) Durogesic ® 25 50 75 100<br />
Buprenorphin s.l. Temgesic ® 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2<br />
Buprenorphin s.c., i.v. Temgesic ® 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4<br />
Buprenorphin TTS (µg/h) Transtec ® Tabelle 3<br />
Umrechnungstabelle für ausgewählte Opioide<br />
35 52,5 70 87,5 105 122,5 150<br />
stellt werden. Hierbei sind die äquianalgetischen<br />
Umrechnungsregeln zu beachten<br />
(Tab. 3). Aufgrund einer inkompletten<br />
Kreuztoleranz wird bei der Opioidrotation<br />
eine Dosisreduktion von bis zu<br />
30% empfohlen.<br />
Auf der Stufe III ist Morphin nach wie<br />
vor das Standardmedikament.Bei Niereninsuffizienz<br />
und älteren Patienten empfiehlt<br />
sich eine Dosisreduktion oder eine<br />
Opioidrotation,da es zu einer Kumulation<br />
der Morphinmetaboliten Morphin-3- und<br />
Morphin-6-Glucuronid kommen kann.<br />
Alternativpräparat wäre in diesem Fall das<br />
Hydromorphon. Es weist im Vergleich zu<br />
Morphin im Trend geringere Nebenwirkungen<br />
wie Übelkeit und Erbrechen auf.<br />
Eine weitere Alternative stellt das transdermale<br />
Fentanyl (Agonist) oder das<br />
transdermale Buprenorphin (Partialagonist)<br />
dar.Die Akzeptanz erhöht sich durch<br />
den nur jeden dritten Tag notwendigen<br />
8<br />
1/2009<br />
WHO-Stufenschema der Schmerztherapie<br />
Aufgaben für spezielle Schmerz- und Palliativzentren<br />
Pflasterwechsel und einer Reduktion von<br />
Übelkeit bzw. Erbrechen gegenüber Morphin.<br />
Bei kachektischen Patienten kann es<br />
notwendig sein, dass das transdermale<br />
Fentanyl alle 48 Stunden gewechselt werden<br />
muss. Die Wirkung der Pflaster tritt<br />
durchschnittlich erst nach 12 Stunden ein.<br />
Die Abklingzeit beträgt nach Entfernung<br />
des Pflasters ca. 16 Stunden.<br />
Bei Morphin, Hydromorphon, transdermalem<br />
Fentanyl und transdermalem<br />
Buprenorphin gibt es keine THD. Allerdings<br />
liegt unserer Erfahrung nach die<br />
Grenze beim transdermalen Fentanyl<br />
bei 300–400 µg/h.<br />
Als Bedarfsmedikation für Schmerzspitzen<br />
kann u.a. auch bei transdermalem<br />
Buprenorphin jedes schnellwirksame<br />
Morphin verwendet werden. Für die<br />
Therapie von Schmerzspitzen steht orales<br />
transmukosales Fentanyl zur Verfü-<br />
4: starke Opioide parenteral<br />
(subkutan, intravenös,<br />
peridural, intrathekal)<br />
Abbildung 2<br />
Bei starken Opioiden antiemetische Prophylaxe und Obstipationsprophylaxe!<br />
3: starke Opioide oral/transdermal ± Nichtopioid – Analgetika<br />
± Adjuvantien<br />
z. b. Morphin retard 3 x 30 mg/die<br />
Bedarfsmedikation: nicht retardiertes Morphin 1/10 – 1/6 der<br />
Tagesdosis<br />
Bedarfsmedikation: z.B. Buprenorphin sublingual 0,2 mg<br />
Bei starken Opioiden antiemetische Prophylaxe und Obstipationsprophylaxe!<br />
2: schwache Opioide ± Nichtopioid-Analgetika ± Adjuvantien<br />
z. B. Tramadol retardiert 3 x 100 mg/die bis 3 x 200 mg/die<br />
Bedarfsmedikation: nicht retardiertes Tramadol, z.B. Tramadol Tropfen,<br />
20 gtt = 50 mg<br />
1: Nichtopioidanalgetika<br />
Somatischer Nozizeptorschmerz Viszeraler Nozizeptorschmerz bei Koliken<br />
Knochenschmerz<br />
z.B. Ibuprofen 3 x 600 mg/die z.B. Metamizol 20–40 gtt alle 4 h<br />
z.B. Diclofenac 3 x 50–100 mg/die z.B. Butylscopolamin<br />
gung – Behandlungsbeginn mit 400 µg –<br />
nach 15 Minuten können bei unzureichender<br />
Wirksamkeit zusätzlich 200 bzw.<br />
400 µg transmukosal appliziert werden.<br />
Die Behandlung eines opioidnaiven Patienten<br />
sollte grundsätzlich mit der niedrigsten<br />
Pflasterstärke begonnen werden.<br />
Entgegen früherer Vorstellungen kann<br />
aufgrund der geringen Anzahl von Rezeptoren,<br />
die durch Buprenorphin besetzt<br />
werden, ohne Unterbrechung der analgetischen<br />
Versorgung bei Notwendigkeit auf<br />
einen reinen Opioidagonisten (z. B. Morphin)<br />
umgestellt werden. Neben der oralen<br />
und transdermalen Opioidanwendung<br />
ist bei entzündlichen Schleimhaut- und<br />
Hautschäden die lokale Anwendung von<br />
0,1%igem Morphingel eine therapeutisch<br />
sinnvolle Option.<br />
Koanalgetika bei Tumorschmerz<br />
Bei vielen Schmerzsyndromen ist eine<br />
Kombination von Opioiden und Nicht-<br />
Opioiden nicht ausreichend effektiv<br />
(Abb. 2). Daher sollte zusätzlich zum<br />
WHO-Stufenschema zur Behandlung<br />
verschiedener Symptome der Tumorerkrankung<br />
immer die Gabe von adjuvanten<br />
Medikamenten und Koanalgetika<br />
erwogen werden. Vor allem bei Patienten<br />
mit neuropathischen Schmerzen ist<br />
der zusätzliche Einsatz von Koanalgetika<br />
in Kombination mit Opioiden zu empfehlen.<br />
Trizyklische Antidepressiva<br />
Trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin<br />
(25–75 mg/Tag) oder Clomipramin<br />
(1–2x 10– 25 mg/Tag) werden vor allem<br />
bei neuropathischen, brennenden<br />
Dauerschmerzen verwendet. Ihre Wirkung<br />
beruht auf einer Verstärkung der<br />
schmerzhemmenden serotonergen und<br />
noradrenergen Bahnen. Die wesentli-
chen Nebenwirkungen sind Mundtrokkenheit,<br />
Sedierung, Schwindel und Tachykardie.<br />
Die analgetische Wirkung der<br />
Antidepressiva setzt erst nach drei bis<br />
vier Tagen ein.<br />
Antikonvulsiva<br />
Antikonvulsiva wie Carbamazepin<br />
(600–1.200 mg/Tag), Gabapentin (Neurontin<br />
® ) (1.200–2.700 mg/Tag) und Pregabalin<br />
(Lyrica ® ) (150–600 mg/Tag) kommen<br />
bei blitzartig einschießenden neuropathischen<br />
Schmerzattacken zum Einsatz.<br />
Antikonvulsiva können Müdigkeit und<br />
Schwindel verursachen.<br />
Kortikosteroide<br />
Kortikosteroide wie Dexamethason<br />
(Fortecortin ® ) finden bei Nerven- und<br />
Weichteilkompressionen, Leberkapselspannung,<br />
Ödemen und Knochenmetastasen<br />
Anwendung und wirken antiphlogistisch.<br />
Gleichzeitig wirkt Dexamethason<br />
appetitsteigernd, euphorisierend und antiemetisch.<br />
Die Therapie sollte mit einer<br />
initialen i.v.-Bolusgabe von 40–100 mg<br />
begonnen werden. Danach folgt eine<br />
orale Gabe von 16 bzw.8 mg Dexamethason.<br />
Zur Appetitsteigerung und Hebung<br />
der Stimmung empfiehlt sich eine Dauertherapie<br />
mit 4 mg Dexamethason p.o.<br />
TUMORSCHMERZTHERAPIE<br />
Tabelle 4<br />
Medikamente Dosierung mg/die Anwendung<br />
Amitriptylin (Saroten ® ) 25–100 Neuropathische Dauerschmerzen<br />
Gabapentin (Neurontin ® ) 900–2.700 Neuropathische Dauerschmerzen<br />
Pregabalin (Lyrica ® ) 150–600 Neuropathische Dauerschmerzen<br />
Carbamazepin (Tegretol ® ) 600–1.200 Neuropathische Dauerschmerzen<br />
Dexamethason (Fortecortin ® ) Bolus 40–100 i.v., danach Nervenschmerzen oder Weichteil<br />
oral, über 2–3 Wochen kompression, Hirnödem, Kapsel<br />
schmerz,Knochenmetastasen, Übelkeit<br />
Zoledronsäure (Zometa ® ) 4 i.v. alle 4 Wochen Knochenschmerzen<br />
z. B. osteolytische Knochenmetastasen<br />
Pamidronsäure (Aredia ® ) 30–90 i.v. 2–4 Wochen alle Knochenschmerzen<br />
z. B. Osteolytische Knochenmetastasen<br />
Butylscopolamin (Buscopan ® ) Akut: 20 mg i.v., 3–5 x Kolikschmerzen<br />
10 mg oral z. B. Spasmen glatter Muskulatur<br />
Midazolam (Dormicum ® ) 10–25 mg Unruhezustände, Angst, Übelkeit<br />
Zusammenfassung<br />
Auch eine optimale Schmerztherapie<br />
kann nicht immer zu Schmerzfreiheit/<br />
Schmerzlinderung führen. Die Behandlung<br />
von Tumorschmerzen wird dann eine<br />
interdisziplinäre Aufgabe. Bei neu<br />
aufgetretenem Schmerz muss primär geklärt<br />
werden, ob eine kausale Behandlung<br />
der Schmerzen, wie z. B. die chirurgische<br />
Entfernung von Metastasen, eine<br />
Bestrahlung bzw. eine hormonell/zytostatische<br />
Behandlung möglich ist. Bei<br />
stärkeren Schmerzen sollte jedoch be-<br />
Koanalgetika: Auswahl nach Schmerzart<br />
reits parallel zur Diagnostik mit einer<br />
suffizienten medikamentösen Schmerztherapie<br />
begonnen werden.<br />
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar<br />
Abteilung für Anästhesiologie und<br />
Allgemeine Intensivmedizin<br />
A.ö. LKH Klagenfurt<br />
St. Veiter Straße 47, A-9020 Klagenfurt<br />
Tel.: +43/463/538-24 403<br />
Fax-Dw: - 23 070<br />
rudolf.likar@lkh-klu.at<br />
Buchneuerscheinung: Palliativmedizin – Lehrbuch für Ärzte,<br />
Psychosoziale Berufe und Pflegepersonen<br />
Dieses Lehrbuch vermittelt umfangreiches<br />
Wissen hinsichtlich der medizinischen,<br />
pflegerischen, psychischen, seelsorglichen<br />
und sozialen Betreuung von<br />
Patienten mit weit fortgeschrittenen<br />
chronischen Erkrankungen, auch bei<br />
Kindern und alten Menschen.<br />
Spezielle Kenntnisse der Therapie tumorbedingter<br />
Schmerzen und Linderung<br />
belastender Symptome wie Luftnot, gastrointestinale<br />
Symptome, Lymphödeme,<br />
neurologische und psychiatrische Symptome<br />
werden fundiert nahe gebracht,<br />
ebenso wird der Stellenwert unkonventioneller<br />
Therapiemethoden, wie z.B.<br />
Musiktherapie diskutiert.<br />
Weiters werden aber auch Kenntnisse<br />
hinsichtlich der Grundlagen der Palliativmedizin<br />
und der vorhandenen Strukturen<br />
zur Umsetzung vermittelt. Ferner<br />
kommen betroffene Menschen in diesem<br />
Buch direkt oder indirekt zu Wort. Die<br />
meisten der insgesamt 57 Autoren sind<br />
langjährige ExpertInnen auf dem Gebiet<br />
der speziellen Palliativmedizin.<br />
Die Herausgeber dieses Buches sind als<br />
Mitglieder der Österreichischen Palliativgesellschaft<br />
sehr interessiert daran, dass<br />
dieses Buch möglichst alle Berufsgruppen<br />
im Gesundheitswesen, aber auch die ehrenamtlichen<br />
MitarbeiterInnen, die in ihrer<br />
täglichen Praxis schwerstkranke und<br />
sterbende Menschen betreuen, erreicht.<br />
Auch für Studierende kann das Buch<br />
einen guten Einstieg in das Fachgebiet<br />
bieten und sie für die Thematik der Betreuung<br />
von Menschen am Lebensende<br />
sensibilisieren<br />
Herausgeber:<br />
M. Werni-Kourig, R. Likar, I. Strohscheer,<br />
F. Zdrahal und G. Bernatzky<br />
Verlag: UNI-MED Science<br />
ISBN: 978-3-8374-1139; 1. Auflage;<br />
Hardcover, 208 Seiten; Preis: Euro 44,80<br />
1/2009 9
NEUROPATHISCHE SCHMERZEN<br />
Neuropathische Schmerzen<br />
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar<br />
Tumorschmerzen sind oft gemischte<br />
Schmerzen, sie bestehen aus einer nozizeptiven<br />
und einer neuropathischen<br />
Schmerzkomponente. Die Schmerzen<br />
sind oft an mehreren Lokalisationen<br />
auftretend, z. b. Mammakarzinom, welches<br />
den Plexus brachialis infiltriert, Metastasen<br />
welche das Rückenmark komprimieren<br />
bzw. auf die Nervenwurzeln<br />
drücken. Bei Tumorpatienten können<br />
neuropathische Schmerzen auch durch<br />
eine Zosterneuralgie bzw. postherpetische<br />
Neuralgie und durch Chemotherapie<br />
auftreten, 1, 2 .<br />
Neuropathische Schmerzen können in<br />
periphere Neuropathien, fokal und diffuse<br />
Polyneuropathien und zentral bedingte<br />
neuropathische Schmerzen eingeteilt<br />
werden. Nervenschmerzen können<br />
aber auch nach Operationen<br />
auftreten sowie nach Amputationen in<br />
30–81% der Fälle. Auch Thoraktomien<br />
ziehen zu 47%, je nach Ausmaß des akuten<br />
postoperativen Schmerzes und der<br />
Interkostalnervendysfunktion, neuropa-<br />
10<br />
1/2009<br />
thische Schmerzen nach sich. Bei Brusteingriffen<br />
kann es aufgrund der interkostobrachialen<br />
Nervenverletzungen in<br />
11–57% zu Nervenschmerzen kommen,<br />
weitere Ursachen sind Gallenblasenoperationen<br />
und Leistenhernien – in<br />
11% aufgrund einer postoperativen<br />
Nervendysfunktion 3 .<br />
Einteilung neuropathischer<br />
Schmerzen<br />
<strong>•</strong> ZNS-Erkrankungen<br />
– Verletzungen des RM, Syringomyelie<br />
– ZNS-Erkrankungen (MS 60% bekommen<br />
Schmerzen)<br />
– Vaskulär bedingte Schmerzen (Insult),<br />
Thalamussyndrom<br />
<strong>•</strong> Radikulopathien, Plexusläsion<br />
<strong>•</strong> Chronische Wurzelreizsyndrome<br />
<strong>•</strong> Plexusverletzungen, -erkrankungen<br />
<strong>•</strong> Komplexe regionale Schmerzsyndrome<br />
(RSD) CRPS-I-Kausalgie (CRPS II)<br />
(Complex Regional Pain Syndrome),<br />
SMP (Sympathetic Maintained Pain)<br />
<strong>•</strong> Periphere Neuropathien: endokrin, to-<br />
Abbildung 1<br />
xisch, ischämisch bedingte Mono- und<br />
Polyneuropathie<br />
<strong>•</strong> Postinfektiöse (postzoster, idiopathisch,<br />
posttraumatisch) Neuralgie mit/<br />
ohne Nervenläsion<br />
<strong>•</strong> Inoperable oder voroperierte Engpasssyndrome<br />
<strong>•</strong> Idiopathischer Gesichtsschmerz<br />
<strong>•</strong> Stumpf-/Phantomschmerz<br />
<strong>•</strong> Neuropathische Schmerzen durch Tumore/Metastasen<br />
Symptome und Lokalisation<br />
Die Symptome der neuropathischen<br />
Schmerzen können brennende und anfallsartig<br />
einschießende Schmerzen sein,<br />
die von neurologischen Symptomen wie<br />
Hypo/Hyperästhesie, Parästhesie, Hyperalgesie,<br />
Allodynie und eventuell wie bei<br />
einer sympathischen Reflexdystrophie<br />
von autonomen Symptomen begleitet<br />
sein können. Lokalisiert ist der Schmerz<br />
im Versorgungsgebiet der betroffenen<br />
nervalen Struktur. Zudem kann es zur<br />
Störung der motorischen Funktion kommen.Bei<br />
leichten Formen von Polyneuropathien<br />
sind nur die Muskeln der distalen<br />
unteren Extremität betroffen. Der Beginn<br />
der Schwäche ist distal nach proximal<br />
fortschreitend. Ist die motorische<br />
Funktion zunehmend gestört,können betroffene<br />
Muskeln über mehrere Monate<br />
atrophieren. Das Ausmaß der Atrophie<br />
ist abhängig von der Zahl der geschädigten<br />
motorischen Fasern. Das Maximum<br />
der Denervationsatrophie ist nach 90 bis<br />
120 Tagen erreicht. Volumenverluste der<br />
Muskeln bis 80% sind möglich. Nur eine<br />
Reinervation innerhalb des ersten Jahres<br />
macht eine Wiederherstellung möglich.<br />
Sensibilitätsstörungen können asymmetrische<br />
Verteilungsmuster haben (mehr
Bein als Arm, distal mehr als proximal)<br />
und alle sensiblen Qualitäten betreffen,<br />
wobei eine Qualität mehr als die andere<br />
beeinträchtigt sein kann (Vibration<br />
mehr als Berührung; Progredienz nach<br />
proximal). Abdomen und Gesicht bleiben<br />
meist ausgespart. Bei den meisten<br />
Polyneuropathien sind motorische und<br />
sensible Funktionen beeinträchtigt. Sie<br />
können jedoch unterschiedliche Ausmaße<br />
haben. Bei den toxischen, metabolischen<br />
Polyneuropathien überwiegen<br />
sensible Ausfälle.<br />
Anamnese<br />
Es ist wichtig, eine genaue Anamnese<br />
durchzuführen, die eine exakte Schmerzanamnese<br />
sowie die Erfassung und Analyse<br />
der individuellen Pathomechanismen<br />
einschließt. Es müssen das Verteilungsmuster<br />
erfasst und festgestellt werden, ob es<br />
sich um eine Polyneuropathie, Mononeuropathie,<br />
Polyradikulopathie oder Plexopathie<br />
handelt. Weiters ist die Dominanz<br />
zu ermitteln und abzuklären,ob es sich um<br />
eine sensible oder/und motorische, autonome<br />
Polyneuropathie handelt. Ebenso<br />
müssen der zeitliche Verlauf (akut, früh<br />
chronisch, spät chronisch) sowie primäre<br />
Markschäden bzw. primärer Axonbefall<br />
durch die Durchführung von NLG und<br />
EMG abgeklärt werden.Wenn notwendig,<br />
sind molekulargenetische sowie biologische<br />
Analysen (metabolische,toxische,nutritive<br />
Effekte) und eine Liquoruntersuchung<br />
durchzuführen, daneben eine Eiweiß-,<br />
Zellzahl-, antineurale Antikörperund<br />
Immunglobulinbestimmung bzw.<br />
Muskel- und Nervenbiopsien (N. suralis).<br />
Therapie<br />
Nach Zuordnung zu einer bestimmten<br />
Kategorie muss versucht werden, den<br />
vorliegenden Fall mit einer bestimmten<br />
Diagnose in Einklang zu bringen. Hier<br />
ist es erforderlich, interdisziplinär mit<br />
Neurologen, Neurochirurgen und anderen<br />
Fachdisziplinen zusammenzuarbeiten.<br />
Therapiekonzepte sollen auf Basis<br />
der individuellen Pathomechanismen<br />
erstellt und wenn möglich eine kausale<br />
Therapie durchgeführt werden. Ist eine<br />
kausale Therapie nicht möglich, bleibt<br />
eine symptomatische Schmerztherapie.<br />
Aufgrund der vorliegenden pathophysiologischen<br />
Mechanismen wie die<br />
periphere Sensibilisierung, ektopische<br />
Reizbildung, Spontanaktivität, zentrale<br />
Sensibilisierung, sympathisch-afferente<br />
NEUROPATHISCHE SCHMERZEN<br />
Tabelle 1<br />
Numbers needed to treat (NNT) für folgende Medikamente bei neuropathischen Schmerzen<br />
Drug Number of Central Peripheral Painful Postherpetic Peripheral Trigeminal HIV Mixed neuropath.<br />
Trials and Type Pain Pain Polyneuropathy Neuralgia Nerve Injury Neuralgia Neuropathy Pain<br />
Tricyclic 16 crossover/ 4.0 2.3 2.1 2.8 2.5 ND Ns NA<br />
antidepressants 4 parallel (2.6–8.5) (2.1–2.7) (1.9–2.6) (2.2–3.8) (1.4–11)<br />
Serotonin 2 crossover/ ND 5.1 5.1 ND NA ND ND ND<br />
noradrenaline<br />
reuptake inhibitors<br />
3 parallel (3.9–7.4) (3.9–7.4)<br />
Gabapentin/ 4 crossover/ NA 4.0 3.9 4.6 NA ND ND 8.0<br />
Pregabalin 13 parallel (3.6–5.4) (3.3–4.7) (4.3–5.4) (5.9–32)<br />
Opioids 6 crossover/ ND 2.7 2.6 2.6 3.0 ND ND 2.1<br />
2 parallel (2.1–3.6) (1.7–6.0) (2.0–3.8) (1.5–74) (1.5–3.3)<br />
Tramadol 1 crossover/ ND 3.9 3.5 4.8 ND ND ND ND<br />
2 parallel (2.7–6.7) (2.4–6.4) (2.6–27)<br />
NMDA 5 crossover/ ND 5.5 2.9 ns ns ND ND ns<br />
antagonists 2 parallel (3.4–14) (1.8–6.6)<br />
Topical 4 crossover ND 4.4 ND NA ND ND NA 4.4<br />
lidocaine (2.5–17) (2.5–17)<br />
Cannabinoids 2 crossover/ 6.0 ND ND ND ND ND ND ns<br />
2 parallel (3.0–718)<br />
Capsaicin 11 parallel ND 6.7 11 3.2 6.5 ND NA NA<br />
(4.6–12) (5.5–317) (2.2–5.9) (3.4–69)<br />
Kopplung kann medikamentös dementsprechend<br />
eingegriffen werden (Abbildung<br />
1).<br />
Bei peripherer Sensibilisierung wird<br />
mit Kortikosteroiden, Lokalanästhetika,<br />
Lidocain lokal und nichtsteroidalen Antirheumatika,<br />
bei ektopischer Reizbildung<br />
und Spontanaktivität wird mit Lidocain<br />
i.v., Carbamazepin, Gabapentin<br />
und Pregabalin, bei zentraler Sensibilisierung<br />
wird mit Opiaten, Antidepressiva<br />
und NMDA-Antagonisten sowie bei<br />
sympathisch afferenter Kopplung wird<br />
mit Sympathikusblockaden behandelt 4 .<br />
Es empfiehlt sich folgender Algorithmus:<br />
Kausale, lokale Therapie, Einsatz<br />
von Antidepressiva,Antikonvulsiva bzw.<br />
Opiaten und bei unzureichender Wir-<br />
Behandlungsalgorithmus nach Finnerup NB. et al<br />
Abbildung 2<br />
1/2009 11
NEUROPATHISCHE SCHMERZEN<br />
kung z.B. die Anwendung neuromodulierender<br />
Verfahren und Sympathikusblockaden<br />
(Abbildung 2).<br />
Die symptomatische Therapie sieht<br />
auf der ersten Stufe den Einsatz eines<br />
Antidepressivums/Antikonvulsivums vor.<br />
Bei den Antidepressiva sind trizyklische<br />
Antidepressiva mit der niedrigsten NNT<br />
(number needed to treat) zu verwenden.<br />
In Tabelle 1 sind die NNT aus der Publikation<br />
Finnerup NB. et al entnommen 5 .<br />
Trizyklische Antidepressiva haben<br />
Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit,<br />
Müdigkeit, Miktionsstörungen, Herzrhythmusstörungen<br />
und sollen hinsichtlich<br />
dieser Nebenwirkungen genauestens<br />
monitiert werden. Venlaflaxin kann<br />
bei Schmerzen durch diabetische Polyneuropathie<br />
verwendet werden. Venlaflaxin<br />
wurde in einer Dosierung von 250<br />
mg versus 150 mg Imipramin untersucht.<br />
Venlaflaxin ist ein Serotonin und schwacher<br />
Noradrenalin – Wiederaufnahmehemmer.<br />
NNT war für Venlaflaxin 5,2,<br />
für Imipramin 2,7. An Nebenwirkungen<br />
traten Übelkeit, Schwindel und Mundtrockenheit<br />
auf 6 .<br />
Mirtazapin ist zentral und präsynaptisch<br />
wirksam und ist ein angreifender<br />
Alpha-2-Antagonist, der die zentrale<br />
noradrenerge und serotonerge Übertragung<br />
verstärkt 7 . Nebenwirkungen sind<br />
verstärkter Appetit, Gewichtszunahme,<br />
Schläfrigkeit, Schwindel und Kopfschmerz.<br />
Auch Mirtazapin wird verwendet,<br />
ist aber den trizyklischen Antidepressiva<br />
unterlegen. Weitere Untersuchungen<br />
zeigen die Wirksamkeit von<br />
Duloxetin, welches serodronerg und noradrenerg<br />
wirksam ist. Duloxetin ist zu-<br />
12<br />
1/2009<br />
gelassen für die Schmerztherapie bei<br />
diabetischer Polyneuropathie und zeigt<br />
in einer Dosierung zwischen 60 und 120<br />
mg pro Tag eine Wirksamkeit bei diabetischer<br />
Polyneuropathie. Von den Antikonvulsiva<br />
werden Carbamazepin und<br />
Gabapentin, bzw. in neueren Studien<br />
Pregabalin verwendet 7, 8 .<br />
Pregabalin ist wie Gabapentin ein potenter<br />
α2d Ligand des spannungsabhängigen<br />
Kalziumkanals und reduziert den<br />
Kalziumeinstrom an den Nervenenden.<br />
Gabapentin soll langsam eingeschleust<br />
werden, Dosierungen von bis zu 2.700–<br />
3.600 mg pro Tag werden angeordnet.<br />
Bei eingeschränkter Nierenfunktion ist<br />
die Dosis zu adaptieren.<br />
Pregabalin ist wirksam bei neuropathischen<br />
Schmerzen, wirkt analgetisch,<br />
zusätzlich anxiolytisch und antikonvulsiv<br />
9, 10 .<br />
Pregabalin ist ein Fortschritt gegenüber<br />
Gabapentin, hat ein lineares, vorhersehbares,<br />
pharmakokinetisches Profil.<br />
Die effektive Dosis zwischen 150 mg<br />
und 600 mg hat einen schnellen Wirkeintritt.<br />
Die 2 x tägliche Verabreichung ist<br />
ein einfaches Dosisregime.<br />
In Abbildung 3 ist nach dem Österreichischen<br />
Konsensusmeeting der mögliche<br />
Algorithmus zur Therapie des chronischen<br />
neuropathischen Schmerzes differenziert<br />
hinsichtlich Pregabalin<br />
dargestellt. Pregabalin hat im Unterschied<br />
zu den trizyklischen Antidepressiva<br />
weniger Nebenwirkungen bei alten<br />
Menschen und stellt daher bei Patienten<br />
mit neuropatischen Schmerzen, die älter<br />
Abbildung 3<br />
TZA: trizyklische Antidepressiva, PGB: Pregabalin, AK, Antikonvulsivum<br />
Möglicher Algorithmus zur Therapie des chronisch neuropathischen Schmerzes<br />
als 65 Jahre sind, nach dem Konsensusmeeting<br />
die erste Wahl dar 11 .<br />
Weiters kann man Lidocain i.v. als<br />
Testsubstanz verwenden, um eine Abschätzung<br />
für die Wirksamkeit einer oralen<br />
Mexiletin-Gabe zu erreichen. Opioide<br />
(Tramadol, Oxycodon, Buprenorphin<br />
sind als zweite Stufe im Therapiekonzept<br />
anzusehen. Hier sollte getestet werden,<br />
ob der Patient mit neuropathischen<br />
Schmerzen ein Responder auf die Opioidtherapie<br />
ist. Von den topisch zu applizierenden<br />
Pharmaka wird Capsaicin und<br />
Lidocain 5% Pflaster verwendet (12).<br />
Polyneuropathie<br />
Eine Polyneuropathie kann in einem<br />
metabolischen, toxischen (Alkohol, Medikamente),<br />
entzündlichen, immunologischen,<br />
paraneoplastischen und hereditären<br />
Ursprung liegen. Hinzu treten Ursachen<br />
wie Mangelernährung und an<br />
vorderster Front Diabetes mellitus. Die<br />
Diabetische Polyneuropathie ist mit einer<br />
Prävalenz von 13–54% die häufigste<br />
Neuropathie und verlangt die Optimierung<br />
der Stoffwechseleinstellung. Am<br />
zweithäufigsten tritt bei chronischen Alkoholikern<br />
mit einer Prävalenz von 10–<br />
38% die alkoholische Neuropathie auf.<br />
Häufig ist diese vom symmetrisch-sensiblen<br />
Manifestationstyp mit einem im<br />
akuten Stadium öfter auftretenden<br />
Waden-Druckschmerz kombiniert. Die<br />
kausale Therapie besteht in einer Alkoholkarenz<br />
und Vitaminsubstitution.<br />
Leitsymptome<br />
Die Leitsymptome der Polyneuropathie<br />
umfassen sensible, motorische und<br />
vegetative Störungen. Die Reizsymptome<br />
sind unterschiedlich ausgeprägt,<br />
auch die Defizite in ihrer Lokalisation<br />
und Ausprägung. Häufig treten strumpfförmige,<br />
brennende Spontanschmerzen<br />
auf; Dysästhesien sind von reißendem,<br />
ziehendem Charakter (Small fibre-Neuropathie).<br />
Therapiemaßnahmen<br />
Kausale Therapiemaßnahmen<br />
Die Therapie erfolgt mit Antikonvulsiva<br />
und Antidepressiva, wenn erforderlich<br />
mit Opioiden. Bei diabetischer Polyneuropathie<br />
konnte auch mit Topiramat<br />
eine Wirksamkeit nachgewiesen werden.<br />
Der Effekt von Thioctsäure bei der<br />
diabetischen Polyneuropathie ist wider-
NEUROPATHISCHE SCHMERZEN<br />
sprüchlich. Die autonome diabetische<br />
Polyneuropathie kann gleichzeitig mit<br />
oder ohne somatische Neuropathie auftreten.<br />
Ein wichtiges Therapieziel ist die<br />
weitgehende Normalisierung der Blut-<br />
Glukosespiegel, Reduktion von Übergewicht<br />
und erhöhten Blutfettwerten. Aldosereduktasehemmer<br />
können die Sorbitol-<br />
und Fruktoseproduktion mindern<br />
und Myoinositolspiegel wieder erhöhen.<br />
Derzeit stehen jedoch keine Aldosereduktasehemmer<br />
in Europa zur Verfügung.<br />
Die Substitution von Nerve-<br />
Growth-Faktor scheint in Studien viel<br />
versprechend zu sein. In einer großen<br />
Multicenterstudie gab es jedoch keinen<br />
Wirksamkeitsnachweis (13).<br />
Symptomatische Schmerzbehandlung<br />
Zur symptomatischen Schmerzbehandlung<br />
können trizyklische Antidepressiva,<br />
selektive Serotonin- und Noradrenalin -<br />
Wiederaufnahme-Hemmer, Antikonvulsiva<br />
(Carbamazepin, Gabapentin, Pregabalin,<br />
Lamotrigin) und Antiarrhythmika<br />
(z.B. Mexiletin) eingesetzt werden. Topisches<br />
Capsaicin kann neuropathische<br />
Schmerzen lindern, verursacht aber zunächst<br />
eine lokale Reizerscheinung und<br />
Hyperalgesie. Vasoaktive Substanzen<br />
konnten bislang keinen sicheren Nutzen<br />
für die Behandlung von schmerzhafter<br />
diabetischer Neuropathie aufzeigen.<br />
Krankengymnastik und sorgfältige Fußpflege<br />
sind von großer Bedeutung und<br />
helfen Sekundärkomplikationen wie<br />
Fußulzerationen oder schließlich Amputationen<br />
zu vermeiden. Bringt die medikamentöse<br />
Therapie keinen Erfolg, ist<br />
hier noch an neuromodulierende Verfahren<br />
zu denken. Es besteht auch die Möglichkeit<br />
eines psychologischen und physikalischen<br />
Therapieverfahrens.<br />
Literatur auf Anfrage beim<br />
Verfasser<br />
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar<br />
Abteilung für Anästhesiologie und<br />
Allgemeine Intensivmedizin<br />
A.ö. LKH Klagenfurt<br />
St. Veiter Straße 47, A-9020 Klagenfurt<br />
Tel.: +43/463/538-24 403<br />
Fax-Dw: - 23 070<br />
rudolf.likar@lkh-klu.at<br />
Anzeige Plus<br />
26<br />
1/2009 13
SCHMERZTHERAPIE<br />
Pharmakokinetische Aspekte in der Schmerztherapie<br />
unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit<br />
Alkohol<br />
ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Josef Donnerer<br />
Obwohl die Pharmakokinetik nicht<br />
gerade das ist, womit man sich als<br />
Schmerztherapeut/in täglich beschäftigt,<br />
hat sie nicht nur experimentelle Bedeutung,<br />
sondern spielt unmittelbar in die<br />
praktische Anwendung der Schmerzmittel<br />
hinein.<br />
Zur pharmakokinetischen Phase in der<br />
Arzneimittelwirkung gehören die Applikation,<br />
die Resorption, die Verteilung der<br />
Arzneistoffe, die Biotransformation und<br />
die Elimination. Blutspiegelkurven oder<br />
Plasmaspiegelkurven der Arzneistoffe<br />
sind ein Abbild aller pharmakokinetischen<br />
Vorgänge und sind bedeutsam in<br />
der Beurteilung der Wirkdauer eines Prä-<br />
14<br />
1/2009<br />
parates, des Dosierungsintervalls, oder in<br />
Bezug auf Wechselwirkungen mit Alkohol.<br />
Beim Paracetamol kann man aus der<br />
Blutspiegelkurve idealerweise die Wirkdauer<br />
direkt ablesen. Nach einer Dosis<br />
von 1.000 mg beim Erwachsenen lässt<br />
sich bei einer Eliminationshalbwertszeit<br />
von 2 h direkt und unter Kenntnis des<br />
min. therapeut. Spiegels eine Wirkdauer<br />
von 3 bis 4 h ableiten. Ebenso das Dosierungsintervall<br />
von 4 bis 6 h, ohne jemals<br />
auf zu hohe Plasmaspiegel zu kommen.<br />
Von Paracetamol werden 90–96% der<br />
Substanz in der Leber glukuronidiert<br />
Abbildung 1<br />
oder sulfatiert und damit inaktiviert. Die<br />
restlichen 4–10% werden zwar über<br />
CYP2E1 zu dem reaktiven Metaboliten<br />
N-Acetyl-Benzochinonimin umgewandelt;<br />
diese geringen Mengen werden normalerweise<br />
durch Glutathionkonjugation<br />
rasch unschädlich gemacht.<br />
Alkohol induziert CYP2E1 geringfügig<br />
und kann unter ungünstigsten Bedingungen<br />
die Menge des reaktiven Metaboliten<br />
um 22% steigern, dies führt jedoch<br />
bei Normdosis und gesunder Leber<br />
noch nicht zu Lebertoxizität, wie detaillierte<br />
Studien gezeigt haben. Bei Paracetamol<br />
ist nur wichtig, dass die maximale<br />
Einzeldosis und Tagesdosis nicht überschritten<br />
werden. Bei bereits geschädigter<br />
Leber kann das aber ein Problem<br />
sein.<br />
Beim Aspirin ist das schon etwas komplexer,<br />
da von der Ausgangssubstanz<br />
Acetylsalicylsäure (ASS) relativ rasch<br />
die Acetylgruppe abgespalten wird und<br />
Salicylsäure entsteht. Von der Blutspiegelkurve<br />
der ASS kann man nicht direkt<br />
auf die analgetische Wirkdauer von etwa<br />
4 h schließen.ASS im Plasma fällt mit einer<br />
Halbwertszeit von 15 min ab, Salicylsäure<br />
dagegen mit 2–3 h.Aber einerseits<br />
wird durch ASS die Cyclooxygenase<br />
(COX) irreversibel acetyliert und bleibt<br />
somit lange blockiert, und zweitens ist<br />
auch Salicylsäure wirksam.<br />
Es gibt zwei Wechselwirkungen mit<br />
Alkohol:<br />
<strong>•</strong> Grundsätzlich kann es durch die<br />
Kombination von ASS und anderer<br />
NSAR mit Alkohol zu mehr Schleimhautläsionen<br />
im Magen kommen;
<strong>•</strong> Werden Alkohol und ASS nach dem<br />
Essen eingenommen, wird die Bioverfügbarkeit<br />
von Alkohol vor allem bei<br />
Männern, weniger bei Frauen bis zu<br />
30% erhöht; d.h. der Alkoholblutspiegel<br />
kann höher als erwartet sein!<br />
[Fahrtüchtigkeit]. Alkohol verbleibt<br />
nach dem Essen länger im Magen, die<br />
Alkoholdehydrogenase in der Magenmukosa<br />
wird durch ASS gehemmt -<br />
der gastrische First-pass-Effekt von<br />
Alkohol reduziert.<br />
Bei den klassischen sauren Analgetika<br />
gibt es Substanzen mit kurzer Eliminationshalbwertszeit<br />
und solche mit langer.<br />
Außerdem verbleiben sie aufgrund<br />
ihres Säurecharakters relativ lange an<br />
Orten mit saurem pH-Wert wie in Entzündungsherden<br />
und Synovialflüssigkeit<br />
(erwünscht), aber auch in Nieren und<br />
Magen (unerwünscht).<br />
Diclofenac als typisches NSAR mit<br />
kurzer Halbwertszeit wird gut resorbiert,<br />
hat eine hohe Affinität zu Plasmaproteine<br />
und zum Entzündungsgewebe.<br />
Nach Biotransformation wird es renal<br />
und biliär ausgeschieden.<br />
Bei dreimal tgl. 50 mg Gabe einer magensaftresistenten<br />
Tablette steigen die<br />
Blutspiegel innerhalb von 2 h an und fallen<br />
auch relativ rasch wieder ab. Es gibt<br />
Phasen im Tagesablauf, in denen der<br />
Spiegel unter der therapeutischen Konzentration<br />
liegt. Auf die entzündungsund<br />
schmerzhemmende Wirkung kann<br />
man das aber nicht direkt umlegen, da<br />
sich Diclofenac, wie erwähnt, länger im<br />
Gewebe als im Plasma befindet.<br />
Nichtsdestotrotz kann man bei den<br />
schnell eliminierten NSARs Retardpräparate<br />
verwenden, die Blutspiegel mit<br />
weniger Schwankungen über 24 h ergeben:<br />
diese Präparate setzen den Wirkstoff<br />
langsam während der gesamten<br />
Darmpassage frei, die Blutspiegel während<br />
des Tages sind gleichmäßig hoch.<br />
Die Fehler, die dabei gemacht werden,<br />
sind zusätzliche Gaben schnell wirksamer<br />
NSAR oder eines Aspirins, obwohl<br />
die erlaubte Tagesdosis von 150 mg<br />
Diclofenac bereits mit einer Retardtablette<br />
abgedeckt ist – die Folge sind nur<br />
mehr Nebenwirkungen auf Niere und<br />
Magen.<br />
Ibuprofen als kurzwirksames NSAR<br />
ist pharmakokinetisch insofern interessant,<br />
als es eine stereoselektive Metabolisierung<br />
zeigt: aus dem 50:50 Razemat<br />
Schmerzmittel und Niereninsuffizienz<br />
Substanz Dosierung GFR Dosierung terminale<br />
20–30 ml/min Niereninsuffizienz<br />
Paracetamol Normal 50%<br />
Acetylsalicylsäure 50% 50%<br />
Metamizol 75% Cave<br />
Diclofenac Normal 50%<br />
Ibuprofen Normal 75%<br />
Naproxen 75% Vorsicht<br />
Meloxicam Normal KI<br />
Celecoxib KI KI<br />
R-(-) und S-(+) Ibuprofen wird das inaktive<br />
R-(-)-Enantiomer teilweise in das<br />
aktive S-(+) Enantiomer umgewandelt<br />
(chirale Inversion). Dies zeigt sich in höheren<br />
Plasmaspiegeln von S-(+) Ibuprofen,<br />
obwohl beide Enantiomere in gleicher<br />
Menge aufgenommen wurden. Abgeleitet<br />
daraus macht es Sinn, gleich von<br />
vornherein nur das reine S-(+)-Ibuprofen<br />
zu verwenden.<br />
Als typisches Beispiel eines NSAR mit<br />
längerer Halbwertszeit wäre das Naproxen<br />
anzuführen: es hat eine Halbwertszeit<br />
von 12 bzw. 15 Stunden, wodurch eine<br />
1 x tgl. Gabe ausreicht, ohne dass die<br />
Gefahr von Kumulation entsteht. Eine<br />
zu lange Verweildauer hat keine Vorteile:<br />
für viele rheumatische Erkrankungen<br />
sind Substanzen mit kurzer Wirkdauer<br />
besser steuerbar, weil man damit die<br />
tageszeitlichen Schwankungen in der<br />
Schmerzsymptomatik gezielter unterdrücken<br />
kann.<br />
Opioid-Analgetika<br />
Da alle Opioide ZNS-dämpfend wirken,<br />
wird die Kombination mit anderen<br />
ZNS-dämpfenden Substanzen wie Alkohol,<br />
Benzodiazepine und analoge Schlafmittel,<br />
sedierende Neuroleptika oder trizyklische<br />
Antidepressiva zu additiver<br />
SCHMERZTHERAPIE<br />
oder supraadditiver ZNS-Hemmung mit<br />
Sedierung, Benommenheit, psychomotorischer<br />
Hemmung, Atemdepression,<br />
Bewusstlosigkeit führen.<br />
Kinetische Besonderheiten<br />
der Opioide<br />
Tabelle 1<br />
Arbeitsgruppe Nephrolog. Zentrum München-Schwabing; Austria Codex FI<br />
Schmerzmittel und Niereninsuffizienz<br />
Bei Tramadol und Codein/Dihydrocodein<br />
entstehen über CYP2D6 aktive<br />
Metaboliten. CYP2D6 weist aber in einzelnen<br />
Personen genetisch bedingt reduzierte<br />
Aktivitäten auf („poor metabolizer“).<br />
Damit wäre die volle Wirksamkeit<br />
nicht immer gegeben.<br />
Bei Tramadol sind diese Effekt nicht<br />
so ausgeprägt, da die Ausgangssubstanz<br />
selbst wirksam ist. Beim Codein und Dihydrocodein,<br />
die selbst weniger stark<br />
analgetisch wirksam sind und erst über<br />
CYP2D6 zu 10% in Morphin bzw. Dihydromorphin<br />
bioaktiviert werden, wäre<br />
eine ineffiziente Umwandlung von Relevanz.<br />
Ansonsten haben die Substanzen<br />
eine relativ kurze Halbwertszeit und<br />
werden deshalb oft als Retardpräparate<br />
eingesetzt.<br />
Oxycodon und Hydromorphon sind<br />
sehr beliebte Opioide, weil sie<br />
<strong>•</strong> etwas stärker analgetisch wirken als<br />
Morphin,<br />
Substanz Dosierung GFR Dosierung terminale<br />
20–30 ml/min Niereninsuffizienz<br />
Tramadol 75% 50%<br />
Dihydrocodein 50% 50%<br />
Morphin 75% 50%<br />
Piritramid Normal Normal<br />
Oxycodon 50% Vorsicht<br />
Hydromorphon Normal Normal<br />
Buprenorphin Normal Normal<br />
Fentanyl 75% 75%<br />
Tabelle 2<br />
Arbeitsgruppe Nephrolog. Zentrum München-Schwabing; Austria Codex FI<br />
1/2009 15
SCHMERZTHERAPIE<br />
Schmerzmittel und Leberfunktionsstörung<br />
Substanz Dos. verminderte Dos. schwere<br />
Leberfunktion Leberinsuffizienz<br />
Paracetamol Vorsicht! KI bei Fettleber KI<br />
Acetylsalicylsäure Vorsicht KI<br />
Metamizol Normal Normal<br />
Diclofenac Normal KI<br />
Ibuprofen Normal Vorsicht!<br />
Naproxen Normal 50%<br />
Meloxicam Normal KI<br />
Celecoxib 50% KI<br />
<strong>•</strong> eine bessere orale Bioverfügbarkeit<br />
haben als Morphin und<br />
<strong>•</strong> auch keine aktiven Metaboliten entstehen,<br />
die bei Niereninsuffizienz akkumulieren<br />
könnten.<br />
Nur ist ihre Halbwertszeit mit 2,5 bis<br />
5 h relativ kurz, was ein Einnahmeintervall<br />
von 4 h (Hydromorphon) oder 4 bis<br />
6 h (Oxycodon) notwendig macht. Deshalb<br />
sind für die Dauertherapie Retardpräparate<br />
von Oxycodon und Hydromorphon<br />
von Vorteil.<br />
Nun kam bei diesen Opioid-Retardpräparaten<br />
eine weitere mögliche Wechselwirkung<br />
mit Alkohol ins Spiel, nämlich<br />
das ‚Dose dumping’ Phänomen.<br />
Aufgrund der guten Lösemitteleigenschaften<br />
von Alkohol könnten dadurch<br />
Arzneistoffe aus Retardformen rascher<br />
freigesetzt werden. Besonders empfindlich<br />
sind in dieser Hinsicht Retardformen<br />
mit 1 x tägl. Dosierung. Die Retardierung<br />
könnte zerstört werden, der<br />
Wirkstoff wird schneller freigesetzt.Dies<br />
bedeutet eine raschere Anflutung, höhere<br />
Plasma-Spitzenkonzentrationen, aber<br />
eine Verkürzung der Wirkdauer. Die Alkohol-induzierte<br />
Überdosierung könnte<br />
für die Patienten eine Gefahr darstellen.<br />
In einem Fall [2004/2005: Palladone ® extended<br />
release – USA, Kanada] kam es<br />
sogar zur Marktrücknahme, in zwei Fällen<br />
[2007: generisches Oxycodon retard,<br />
Deutschland; 2005: Avenza ® extendend<br />
release Morphin, USA] erließ die Arzneimittelbehörde<br />
eine Warnung, dass<br />
das Präparat nicht zusammen mit alkoholischen<br />
Getränken eingenommen<br />
werden darf. Auch bei neu zugelassenen<br />
generischen Oxycodon retard Präparaten<br />
in Österreich ist diese Warnung jetzt<br />
enthalten!<br />
Wie aus den In-vitro-Freisetzungsversuchen<br />
im Labor bekannt ist, müsste für<br />
eine eventuell rascher als geplante Wirk-<br />
16<br />
1/2009<br />
Tabelle 3<br />
Austria Codex FI<br />
stofffreisetzung aus Retardpräparaten<br />
20%iger bis 40%iger Alkohol über einige<br />
Stunden anwesend sein; eine Situation<br />
wie man sie unter praktischen Anwendungsbedingungen<br />
nicht vorfindet.<br />
Insofern ergaben auch neuere Tests an<br />
Probanden kein ‚dose dumping’ Phänomen<br />
mit einem Hydromorphon-Retardpräparat<br />
hergestellt nach der OROS ®<br />
Technologie.<br />
Die sogenannte OROS ® Technologie<br />
[orales osmotisches therapeutisches System]<br />
– osmotische Minipumpen, ist in<br />
dieser Hinsicht sehr sicher.Die Wirkstoffreisetzung<br />
erfolgt durch Osmose und<br />
wird durch Alkohol nicht verändert.Aber<br />
auch die Pelletgalenik ist günstig, da die<br />
kleinen Partikel rasch den Magen verlassen.<br />
Umsetzung in vitro zur in vivo Situation<br />
<strong>•</strong> Es müsste mindestens 20% iger Alkohol<br />
im Magen vorhanden sein; Alkohol<br />
wird aber bereits teilweise im Magen<br />
resorbiert bzw. verdünnt;<br />
<strong>•</strong> Alkohol regt die Produktion der Verdauungssäfte<br />
an – weiterer Verdünnungseffekt<br />
bereits im Magen;<br />
<strong>•</strong> Retardpräparate sind meist ‚multiunits-Einheiten’<br />
= kleine Pellets, die<br />
sich relativ rasch über den gesamten<br />
Darmtrakt verteilen – dort gibt es<br />
noch mehr Verdauungssäfte, Alkohol<br />
wird rasch resorbiert – weiterer Verdünnungseffekt;<br />
<strong>•</strong> Die in vivo Situation entspricht demnach<br />
nicht dem in vitro Testaufbau zum<br />
Einfluss von Alkohol auf die Arzneistofffreisetzung.<br />
Die Gefahr des ‚dose<br />
dumping’ in Zusammenhang mit Alkoholgenuss<br />
war bisher bei den in Österreich<br />
verfügbaren oralen Opioid-retard<br />
Präparaten als gering anzusehen. Leider<br />
trifft das nicht mehr auf generische<br />
Oxycodon Retardtabletten zu, denn sie<br />
enthalten die Warnung in der Fach-/Ge-<br />
brauchsinformation, dass sie nicht zusammen<br />
mit alkoholhaltigen Getränken<br />
eingenommen werden dürfen.<br />
Sehr beliebt sind derzeit transdermale<br />
Systeme (Matrixpflaster) von Opioiden<br />
wegen eventueller weniger Nebenwirkungen<br />
und geringer Applikationsfrequenz.<br />
Bei Fentanyl und Buprenorphin<br />
wurden diese TTS Systeme verwirklicht.<br />
Was ist in Bezug auf die Pharmakokinetik<br />
zu beachten? Bedingt durch das<br />
langsame Anfluten des Wirkstoffs über<br />
die Hautbarriere [es muss zuerst ein<br />
Wirkstoffdepot in den Hautschichten<br />
gesättigt werden, aus dem der Wirkstoff<br />
dann zur systemischen Zirkulation zur<br />
Verfügung steht] wird beim ersten Pflaster<br />
ein analgetischer Effekt erst nach<br />
12–16 h erreicht (‚lag-time').<br />
Transdermale Systeme –<br />
Wechselwirkungen mit Alkohol<br />
Pflasterrückstände auf der Haut dürfen<br />
nur vorsichtig mit Wasser, aber niemals<br />
mit Alkohol oder ähnlichen Lösungsmittel<br />
entfernt werden, da sonst das<br />
subkutan gespeicherte Opioid rasch freigesetzt<br />
werden kann!<br />
Schmerzmittel und Alkohol –<br />
eine gefährliche Kombination?<br />
<strong>•</strong> Ja in Bezug auf NSAR und Organschäden<br />
(Magen, Leber, Niere).<br />
<strong>•</strong> Ja in Bezug auf Opioide und additive<br />
Sedierungseffekte, Unfallgefahr.<br />
<strong>•</strong> Vorsicht in Bezug auf ‚dose dumping’<br />
bei generischen oralen Oxycodon-Retardtabletten.<br />
Abschließend noch einige Anmerkungen<br />
zur Pharmakokinetik bei Organfunktionsstörungen:<br />
der Metabolismus<br />
einer Substanz und deren Eliminationswege<br />
sind insbesondere dann von Bedeutung,<br />
wenn es um Dosisanpassungen<br />
bei Niereninsuffizienz und Leberfunktionsstörungen<br />
geht. Um zu verhindern,<br />
dass es zu Überdosierungen und vermehrten<br />
Nebenwirkungen kommt, muss<br />
man unter folgenden Bedingungen die<br />
Arzneimitteldosis reduzieren:<br />
<strong>•</strong> Werden Ausgangssubstanz und/oder<br />
aktive Metaboliten renal eliminiert -<br />
Dosisreduktion bei Niereninsuffizienz.<br />
<strong>•</strong> Werden nur inaktive Metaboliten, die<br />
auch nicht toxisch sind, renal eliminiert,<br />
so ist keine Dosisreduktion notwendig.<br />
Anzeige Plus<br />
26
Substanz Dos. verminderte Dos. schwere<br />
Leberfunktion Leberinsuffizienz<br />
Tramadol 75% 50%<br />
Dihydrocodein 50% Vorsicht!<br />
Morphin 75% 50%<br />
Piritramid Normal Vorsicht!<br />
Oxycodon 50% Vorsicht<br />
Hydromorphon Normal Normal<br />
Buprenorphin Normal Normal<br />
Fentanyl 75% 50%<br />
<strong>•</strong> Erfolgt eine hepatische Biotransformation<br />
von aktiver Substanz zu inaktiven<br />
Metaboliten-Dosisreduktion bei<br />
Leberfunktionsstörung.<br />
Bei den COX-Hemmern und Nierenfunktionsstörungen<br />
[GFR 20-30 ml/min<br />
bzw noch weniger] kommt erschwerend<br />
dazu, dass die Substanzen schon mechanismusbedingt<br />
die Nierenfunktion verschlechtern<br />
können. Bei Paracetamol,<br />
Diclofenac, Ibuprofen und Meloxicam<br />
kann bei mittelgradiger Einschränkung<br />
der Nierenfunktion noch die Normdosis<br />
verwendet werden. Bei terminaler Niereninsuffizienz<br />
sind bei allen COX-<br />
Schmerzmittel und Leberfunktionsstörung<br />
Tabelle 4<br />
Austria Codex FI<br />
Hemmern Dosiseinschränkungen bzw.<br />
Kontraindikationen zu beachten.<br />
Von den Opioiden können Piritramid,<br />
Hydromorphon und Buprenorphin bei<br />
allen Formen der Niereninsuffizienz in<br />
der Normdosis verabreicht werden, da<br />
sie entweder biliär ausgeschieden oder<br />
als inaktive Metaboliten zur Niere gelangen.<br />
Bei Morphin kann Mo-6-glukuronid<br />
als aktiver Metabolit kumulieren<br />
und deshalb muss die Dosis reduziert<br />
werden.<br />
Bei Leberfunktionsstörungen [am besten<br />
wird die Leberfunktion durch<br />
SCHMERZTHERAPIE<br />
Scores abgebildet, und zwar Child Pugh<br />
Score (Bilirubin,Albumin, INR,Ascites,<br />
Hepat. Enzephalopathie) oder MELD<br />
Score (Bilirubin, Kreatinin, INR)] sollte<br />
Paracetamol wegen der Möglichkeit von<br />
Bildung reaktiver Metaboliten vermieden<br />
werden. Die COX-Hemmer können<br />
bei verminderter Leberfunktion noch<br />
normal dosiert werden und sind erst bei<br />
schwerer Leberinsuffizienz kontraindiziert.<br />
Von den Opioiden können Piritramid,<br />
Hydromorphon und Buprenorphin bei<br />
verminderter Leberfunktion noch in der<br />
Normdosis gegeben werden. Bei Substanzen<br />
mit ausgeprägtem hepatischen<br />
Metabolismus wie Tramadol, Dihydrocodein,<br />
Morphin, Oxycodon und Fentanyl<br />
sind Dosisreduktionen bei Leberschädigung<br />
vorzunehmen.<br />
ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz.<br />
Dr. Josef Donnerer<br />
Meduni <strong>Graz</strong>, Institut für<br />
Exp. und Klin. Pharmakologie<br />
Universitätsplatz 4, A-8010 <strong>Graz</strong>,<br />
Tel.: +43/316-380-4509<br />
josef.donnerer@medunigraz.at<br />
1/2009 17
SCHMERZMEDIZIN<br />
Neuraltherapie in der Schmerzmedizin<br />
Dr. Kurt Gold-Szklarski<br />
NT ist eine Behandlungsmethode, die<br />
sich im Laufe der letzten 100 Jahre in<br />
Europa entwickelt hat. Sie basiert auf der<br />
zufälligen Beobachtung unerwarteter regulativer<br />
Effekte als Folge von anästhesiologischen<br />
Behandlungen (F. Huneke)<br />
und ist beeinflusst von Erkenntnissen der<br />
Akupunktur und manuellen Medizin. Ihr<br />
genauer Wirkmechanismus ist bis heute<br />
nicht vollständig erforscht.<br />
Zahllose Kasuistiken belegen jedoch den<br />
zugrundeliegenden Mechanismus: NT<br />
kann als unspezifischer Reiz vom jeweiligen<br />
Individuum in Abhängigkeit von seiner<br />
momentanen biokybernetischen Situation<br />
spezifisch beantwortet werden.<br />
Das bedeutet, dass NT im Gegensatz zur<br />
Allopathie den Organismus nicht zu einer<br />
vorgegebenen Aktion zwingt, sondern<br />
ihm vereinfachend gesagt drei Möglichkeiten<br />
anbietet:<br />
a. Down-Regulation der bestehenden<br />
Beschwerden;<br />
b. Nichtansprechen;<br />
c. Up-Regulation (temporäre Verstärkung<br />
und Undulation von Beschwerden).<br />
Bevor diese Vorgänge erläutert werden,<br />
soll auf die Eigenschaften der NT<br />
und ihre technische Durchführung eingegangen<br />
werden:<br />
<strong>•</strong> NT ist ein holistisches Diagnose -und<br />
Therapieverfahren. Neuraltherapeuten<br />
bemühen sich, den Fokus weg vom<br />
Lokalgeschehen hin zum gesamten Individuum<br />
zu lenken.<br />
<strong>•</strong> NT ist eine Form der Regulationsmedizin.<br />
Der Therapeut bietet mit dem<br />
Setzen eines Reizes dem Körper die<br />
Möglichkeit, sich aus einer allostatischen<br />
Situation 1 in eine normerge Reaktionslage<br />
2 zurückzubewegen.<br />
<strong>•</strong> NT ist Methode der 1.Wahl zum Erkennen<br />
und Ausschalten von Störfeldern.<br />
18<br />
1/2009<br />
Störfelder stellen klinisch latente Reizzentren<br />
dar,die den Organismus in eine<br />
allostatische Situation versetzen.<br />
<strong>•</strong> NT ist eine Injektionstherapie mit Lokalanästhetika.<br />
Die Effektivität der<br />
Methode wird durch die Kombination<br />
aus Sticheffekt und Applikation kleiner<br />
LA-Mengen am richtigen Ort erreicht.<br />
Die Diagnostik fußt in erster Linie auf<br />
der Erstellung einer speziellen Form der<br />
Anamnese, der Inspektion und Palpation<br />
des Patienten, der Funktionsprüfung und<br />
der Probeinjektion. Bildgebende Verfahren<br />
und Labor ergänzen das Diagnoseprocedere,gelegentlich<br />
können zur Differenzierung<br />
weitere elektrophysiologische<br />
Testverfahren oder Thermoregulationsmessungen<br />
herangezogen werden (Elektroakupunktur,<br />
Infrarotthermographie).<br />
Diese Verfahren haben alle hinweisenden<br />
Charakter, liefern aber aufgrund ihrer<br />
Störanfälligkeit keine harten Fakten.<br />
Kriterien, die durch die Anamnese<br />
erfasst werden:<br />
<strong>•</strong> Aktuelle Beschwerden und das Ausmaß<br />
der durch sie hervorgerufenen<br />
Beeinträchtigung der Lebensqualität,<br />
Schmerzquantifikation und Ausmaß<br />
der Funktionsbeeinträchtigung.<br />
<strong>•</strong> Darstellen einer Enstehungskaskade<br />
(ab dem Zeitpunkt der Geburt).<br />
<strong>•</strong> Ausmaß und Art vegetativer Begleiterscheinungen;<br />
<strong>•</strong> Psychosozialer Status;<br />
<strong>•</strong> Risikobeurteilung, Komedikation, Indikationsstellung.<br />
Kriterien, die bei der Inspektion und<br />
Palpation erfasst werden (Auswahl):<br />
<strong>•</strong> Beeinträchtigung von Haltung, Symmetrie,<br />
Gangbild, Krümmungsanomalien<br />
der Wirbelsäule, Residuen nach<br />
Verletzung oder iatrogenen Eingriffen.<br />
<strong>•</strong> Veränderungen der einzelnen Schichten<br />
der Körperhülle und ihre segmentale<br />
Zuordnung.<br />
<strong>•</strong> Projektionssymptome und ihre Zuordnung<br />
zu Organen und Elementen<br />
des Bewegungsapparats.<br />
<strong>•</strong> Funktionsbeeinträchtigung von Elementen<br />
des Bewegungsapparats.<br />
Kriterien, die durch Probeinjektion<br />
und Palpationskontrolle erfasst werden:<br />
<strong>•</strong> Zuordnung segmentaler Symptome<br />
zur Gesamterscheinung des aktuellen<br />
Syndroms;<br />
<strong>•</strong> Bewertung der Störfeldwirkung im<br />
Rahmen des Syndroms;<br />
<strong>•</strong> Differenzierung funktioneller Anteile<br />
an den Gesamtbeschwerden durch<br />
Aufdeckung ihrer Veränderbarkeit.<br />
Strukturierung eines Schmerzsyndroms;<br />
<strong>•</strong> Erkennen von somatischen Engrammen,<br />
die das Allgemeinbefinden, die<br />
vegetative Regulation und die psychische<br />
Stabilität beeinträchtigen und<br />
Vermeidung von Fehleinschätzung wie<br />
„psychosomatische bzw. somatoforme<br />
Beschwerden“ 3 .<br />
Ein Vorteil, den man durch das diagnostische<br />
Procedere der NT im Rahmen<br />
der Schmerzmedizin erreichen kann, ist<br />
das sofortige Erfassen von funktionellen<br />
Störungen ohne aufwändige apparative<br />
Diagnostik, sowie das Darstellen der<br />
Veränderbarkeit von Beschwerdeanteilen.<br />
Weiters können Beschwerden mit<br />
Befunden in Beziehung gebracht werden,<br />
die in segmentaler oder suprasegmentaler<br />
Beziehung zum Lokalbefund stehen.<br />
Fernstörungen durch muskuläre, arthrogene<br />
oder Faszienbeziehung können entdeckt<br />
werden. Bei einer Reihe von Störfeldern<br />
kann eine Beziehung zum Syn-
drom detektiert werden, obwohl der<br />
Übertragungsweg nicht erklärbar ist. Beziehungen<br />
zum sympathischen Nervensystem<br />
bzw. zur Extrazellulären Matrix<br />
werden diskutiert.<br />
Therapeutisch stehen segmentale Techniken<br />
wie intrakutane Quaddel, intramuskuläre<br />
Infiltration, Triggerpunktinfiltration,<br />
präperiostale Injektion, Injektion<br />
in Bänder, Sehnen und Aponeurosen, peri-und<br />
intraartikuläre Injektion sowie Injektion<br />
an Radix und Spinalganglia, Störfeldbehandlung<br />
durch Injektionen an, in<br />
oder um eine störfeldverdächtige Läsion,<br />
sowie bei speziellen Indikationen Injektionen<br />
an Strukturen des sympathischen<br />
oder parasympathischen Nervensystems<br />
(GLOA, Stellatumblockade, Injektion in<br />
den Hiatus sacralis, an den Plexus unterovaginalis<br />
etc.). Eine systemische Anwendung<br />
in Form von intravenösen/paravenösen<br />
Injektionen sowie der Infusion steht<br />
ebenfalls zur Verfügung.<br />
Die Planung des therapeutischen Vorgehens<br />
ist der schwierigste Teil: nicht vorhersagbare<br />
Faktoren wie die individuelle<br />
regulatorische Situation des Patienten,<br />
teilweise fehlende strukturelle Beziehungen<br />
zwischen Symptomatik und Fernstörung<br />
sowie diffuse Beschwerden wie Müdigkeit,<br />
Leistungsknick und vegetative<br />
Irritabilität zwingen zu einer dynamischen<br />
Vorgangsweise in jeder Dimension.<br />
Probetherapie, präzises Follow-Up und<br />
die dauernde Bereitschaft des Therapeuten<br />
zurÄnderung der Strategie an jedem<br />
Zeitpunkt der Therapie sind unbedingt<br />
erforderlich. Variablen können Fehleinschätzung<br />
durch den Therapeuten, Übersehen<br />
von Fernbeziehungen (Zeitdruck,<br />
Dissimulation, Geringfügigkeit der Läsion),<br />
Störungen des Regulationsverhaltens<br />
durch bestimmte Erkrankungen oder<br />
Medikation 4 oder generell durch individuelle<br />
Beziehungsstörungen zwischen<br />
Arzt und Patient darstellen. Auch psychosoziale<br />
Faktoren wie z.B. sekundärer<br />
Krankheitsgewinn müssen als mögliche<br />
Hindernisse kalkuliert werden.<br />
Die Durchführung der Therapie<br />
kann folgendermaßen skizziert<br />
werden<br />
Nach Erheben der Anamnese und der<br />
5-Sinnediagnostik erfolgt die Entscheidung<br />
NT ja-nein. Ist der Patient geeignet,<br />
dann kann sofort die erste Probetherapie<br />
erfolgen. Gleichzeitig wird eine Ko-Medikation<br />
verordnet und die Planung der<br />
weiteren diagnostischen Schritte und die<br />
Anweisung, welche Beobachtungen seitens<br />
des Patienten erforderlich sind, werden<br />
ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt<br />
besteht lediglich eine hypothetische Diagnose.<br />
Eine vorbestehende Medikation<br />
wird belassen, der Patient wird jedoch<br />
angewiesen, bei Nachlassen der Beschwerden<br />
gewisse Medikamente schrittweise<br />
zu reduzieren.<br />
Bei der Zweitkonsultation wird die<br />
Vorgangsweise an die anamnestischen<br />
und funktionellen Veränderungen angepasst,<br />
morphologische und laborchemische<br />
Resultate werden integriert. Die Medikation<br />
kann variiert werden. Die Planung<br />
der weiteren Intervalle resultiert aus<br />
dem berichteten Ansprechverhalten des<br />
Patienten und der Kontrollexamination.<br />
Nach drei bis vier Konsultationen<br />
kann definitiv entschieden werden, ob<br />
sich der Patient für die Fortführung der<br />
NT eignet (monotherapeutisch oder adjuvant).<br />
Auch zu diesem Zeitpunkt besteht<br />
nur eine hypothetische Diagnose 5 .<br />
Die effektive Diagnostik ist erst am Ende<br />
der Therapie abgeschlossen.<br />
Einschätzung der Methode<br />
NT nützt jedem Therapeuten in allen<br />
klinischen Fächern in Bezug auf Diagnostik<br />
und Therapie. Sie kann mit jeder anderen<br />
Methode ohne erwähnenswerte<br />
Interaktion kombiniert werden. Dualer<br />
oder dreifache Antikoagulation sind die<br />
einzigen praktisch relevanten Kontraindikationen,<br />
auf Patientenseite sind floride<br />
Dermatosen, seltene Allergie auf LA<br />
oder Angst vor Injektionen limitierend.<br />
NT ist eine sehr gut geeignete First-Line-Schmerztherapie.<br />
Sie kann unmittelbar<br />
nach physikalischer Examination<br />
begonnen werden, was einer Chronifizierung<br />
ebenso entgegenwirkt wie ihre<br />
antagonistische Wirkung auf allen Ebenen<br />
der peripheren Sensibilisierung.<br />
Bei länger dauernden Störungen und<br />
auch bei chronischen Schmerzpatienten<br />
können plastische Anteile am Syndrom<br />
entschlüsselt und so zumindest eine Teilentlastung<br />
des Patienten angestrebt werden.<br />
Fehleinschätzungen und fatalistische<br />
Diagnosen können in ihrer Häufigkeit<br />
reduziert werden.<br />
Nachteil der Methode ist der geringe<br />
prädiktive Aussagewert. Die Ergebnisse<br />
sind stark an die Schulung des Therapeuten<br />
gebunden. Daher wirkt sich hier ein<br />
SCHMERZMEDIZIN<br />
Wechsel von Therapeuten, wie er im Ambulanzbetrieb<br />
die Regel ist, erschwerend<br />
aus. Schäden durch NT werden selten<br />
durch methodische, sondern in der Regel<br />
durch Therapeutenfehler verursacht.<br />
Die Arzt-Patienten-Beziehung ist ein<br />
wichtiger Faktor. Der oft diskutierte Plazeboeffekt<br />
ist eine positive Nebenerscheinung<br />
und generell anzustreben!<br />
Durch die intensive Beziehung und den<br />
Körperkontakt bei der Untersuchung ist<br />
das Ausmaß der Zuwendung für den Patienten<br />
deutlicher spürbar als bei medikamentöser<br />
Schmerztherapie.<br />
Derzeit ist die Integration von NT in<br />
den klinischen Alltag zahlreichen Schwierigkeiten<br />
ausgesetzt: Vermeintlicher Zeitdruck,<br />
fehlende Kenntnisse, Fehleinschätzung<br />
bzw. unnötige Vorurteile verhindern<br />
eine flächendeckende Nutzung. Andererseits<br />
betreiben viele Kollegen täglich teilweise<br />
unbewusst NT, indem sie TLA,<br />
Narbeninfiltration, Störfeldelimination<br />
(Zahnextraktion etc.) vornehmen. Könnte<br />
man sämtliche Beobachtungen und Erkenntnisse<br />
zusammenführen, würde ein<br />
für alle Beteiligten spürbarer Nutzen entstehen.<br />
Das System könnte durch weniger<br />
Fehlzuweisungen und geringere Heilmittelkosten<br />
profitieren. Eine breitere Schulung<br />
der praktisch tätigen Therapeuten<br />
und das Hinzuziehen beratender Experten<br />
scheinen für die Realisation dieser<br />
Perspektivenempfehlenswert. Durch eine<br />
breitere Anwendung könnten auch die<br />
schon lange erwünschten klinischen Daten<br />
erhoben werden.<br />
1. Allostatische Situation = Chronische Störung der regulatorischen<br />
Systeme, die mit exzessiver Produktion bestimmter Mediatoren<br />
und inadäquater Produktion anderer Faktoren einhergeht,<br />
z.B. die chronische Steigerung inflammatorischer Zytokine<br />
und niedriger Kortisolspiegel beim Chronic Fatigue<br />
Syndrome (McEwen 2004)<br />
2. Normergie = ausgewogenes Verhältnis zwischen Ergotropie<br />
und Trophotropie sowie die Fähigkeit des Organismus, nach<br />
Beantwortung eines Reizes zeitgerecht wieder in die Ausgangsruhelage<br />
zurückzukehren.<br />
3. Die Diagnose „somatoforme Störung“ wird nicht angezweifelt.<br />
Regulationsmediziner erleben jedoch in der Praxis wiederholt<br />
Fälle, bei denen ursprünglich eine solche Diagnose gestellt<br />
wurde, und die Beschwerden sich schließlich als rein somatisch<br />
entschlüsseln ließen. Die Kenntnis funktioneller somatischer<br />
Diagnostik ist zur Diagnosefindung ebenso erforderlich<br />
wie psychologisches und psychosomatisches Wissen.<br />
4. Immunsuppressive Therapie, Chemotherapeutika, etc.<br />
5. Diagnose (griech.) = durchschauend erkennen.<br />
Dr. Kurt Gold-Szklarski<br />
Arzt für Allgemeinmedizin<br />
Erdbergstraße 126/1/1/2, A-1030 Wien<br />
Tel.: +43/1/712-23-73<br />
Fax: +43/1/712-23-73-40<br />
kurt.gold@chello.at<br />
1/2009 19
MIGRÄNE<br />
Symptomatik und Akuttherapie bei primären<br />
Kopfschmerzen<br />
Prim. Univ.-Doz. Dr. Klaus Berek (Bild), OA Dr. Markus Mayr<br />
Primäre Kopfschmerzen gelten als eigenständige<br />
Krankheit, organisch-strukturelle<br />
Ursachen sind üblicherweise nicht<br />
fassbar. Die wichtigsten primären Kopfschmerzen<br />
sind die Migräne und der episodische<br />
bzw. chronische Kopfschmerz<br />
vom Spannungstyp. Daneben sind die<br />
sogenannten trigeminoautonomen Kopfschmerzen<br />
anzuführen, wobei zu dieser<br />
Gruppe der Clusterkopfschmerz, die episodische<br />
und chronische paroxysmale<br />
Hemicranie, das Sunct-Syndrom und die<br />
Hemicrania continua gehören. Erwähnenswert<br />
sind noch der sogenannte Hypnic<br />
Headache sowie der idiopathisch stechende<br />
Kopfschmerz.<br />
Weitere Kopfschmerzen ohne begleitende<br />
strukturelle Läsion sind Kopfschmerzen<br />
ausgelöst durch äußeren<br />
Druck, der kältebedingte Kopfschmerz,<br />
der benigne Hustenkopfschmerz, der benigne<br />
Kopfschmerz durch körperliche Anstrengung<br />
sowie der Kopfschmerz durch<br />
sexuelle Aktivität. Die primären Kopfschmerzen<br />
finden sich in der internationalen<br />
Kopfschmerzklassifikation in den<br />
Hauptgruppen 1–4.<br />
20<br />
1/2009<br />
Migräne<br />
Die Migräne ist eine chronische Erkrankung<br />
mit periodisch auftretenden<br />
Tabelle 1<br />
Akute Migräneattacke (leicht - mittelschwer)<br />
Analgetika – NSAR<br />
<strong>•</strong> ASS 1.000 mg p.o./i.v. + Metoclopramid 10 mg p.o./iv.<br />
<strong>•</strong> Ibuprofen 200–600 mg p.o.<br />
<strong>•</strong> Naproxen 500–1.000 mg p.o.<br />
<strong>•</strong> Diclofenac 50–100 mg p.o.<br />
<strong>•</strong> Paracetamol 1.000 mg p.o./i.v.<br />
<strong>•</strong> ASS + Paracetamol + Koffein (Thomapyrin)<br />
Kopfschmerzen, typischerweise mit autonomen<br />
Begleitsymptomen einhergehend.<br />
Ein Teil der Patienten leidet kurz<br />
vor Auftreten der Kopfschmerzen unter<br />
einer meist visuellen Aura. Von einem<br />
Status migränosus spricht man bei täglich<br />
auftretenden Migräneattacken.<br />
Die Prävalenz der Migräne liegt zwischen<br />
17% und 18% bei Frauen und 6%<br />
bei Männern, der Erkrankungsbeginn<br />
liegt meistens zwischen Pubertät und<br />
20. Lebensjahr, 90% der Patienten erleben<br />
ihre erste Migräneattacke vor dem<br />
40. Lebensjahr. Prinzipiell unterscheidet<br />
man zwischen der Migräne ohne Aura<br />
(80%) und der Migräne mit Aura (ca.<br />
15–20%), wobei hier in erster Linie die<br />
sogenannte ophtalmoplegische und die<br />
retinale Migräne zu erwähnen sind.<br />
Hypothesen zur Pathophysiologie<br />
der Migräne<br />
Zur Erklärung der Pathophysiologie<br />
der Migräne stehen verschiedene Hypothesen<br />
zur Verfügung, wobei am ehesten<br />
von einer Kombination der angeführten<br />
Entstehungsmöglichkeiten auszugehen<br />
sein dürfte. Die vaskuläre Hypothese<br />
macht die primäre intrakranielle Vasokonstriktion<br />
für die Aura und die darauf<br />
folgende extrakranielle Vasodilatation<br />
für den Kopfschmerz<br />
verantwortlich. Die<br />
neurogene Hypothese<br />
beschreibt eine initiale<br />
kortikale Übererregbarkeit,<br />
die zu einer<br />
sich ausdehnenden<br />
Hemmung der kortikalen<br />
Funktion im<br />
Sinne einer „Sprea-<br />
ding Depression“ führt. Der trigeminovaskuläre<br />
Reflex geht von einer neurogenen<br />
Entzündung im Versorgungsgebiet<br />
des N. trigeminus aus, im Rahmen<br />
derer vasoaktive Substanzen freigesetzt<br />
werden, welche die nozezetiven trigeminalen<br />
Afferenzen reizen. Schließlich<br />
spielt heute die Serotoninrezeptortheorie<br />
eine zunehmende Rolle. Durch die<br />
Wirkung der Serotoninagonisten an den<br />
Serotoninrezeptoren vom 5-HT1D-Subtyp<br />
entsteht ein entzündungshemmender<br />
Effekt durch die Blockade der Freisetzung<br />
von Substanz P an den sogenannten<br />
C-Fasern. Dadurch kommt es<br />
zum Auftreten zentral inhibierender Effekte<br />
auf die Transmission trigeminaler<br />
nozizeptiver Reize und in weiterer Folge<br />
zu einer Hemmung der peripheren und<br />
zentralen Trigeminusaktivität. Des Weiteren<br />
bewirken Serotoninagonisten eine<br />
Vasokonstriktion im Versorgungsbereich<br />
der A. carotis.<br />
Migränegenetik<br />
In vielen Familien zieht sich die Migräne<br />
wie ein roter Faden durch die Generationen,<br />
sodass eine genetische Disposition<br />
immer vermutet worden ist. Dafür<br />
sprechen eine Vielzahl von Zwillingsstudien<br />
sowie Studien in Zusammenhang<br />
mit der familiär hemiplegischen Migräne.<br />
Die vielen genetischen Studien konnten<br />
bisher jedoch keinen eindeutigen genetischen<br />
Defekt als Ursache der Migräne ermitteln.<br />
Es ist davon auszugehen, dass<br />
Migräne nicht als Folge eines genetischen<br />
Defektes entsteht, sondern dass<br />
mehrere Gene involviert sind, die je nach<br />
individuellem Muster auch die individuelle<br />
phänotypische Ausprägung determinieren.<br />
Anzeige Plus<br />
26
MIGRÄNE<br />
Tabelle 2<br />
Akute Migräneattacke (mittelschwer – schwer): Triptane<br />
<strong>•</strong> Sumatriptan (Imigran) 50–100 mg p.o., 25 mg Supp.<br />
10–20 mg Nasenspray, 6 mg s.c.<br />
<strong>•</strong> Zolmitriptan (Zomig) 2,5–5 mg p.o., 2,5–5 mg Schmelztablette<br />
5 mg Nasenspray<br />
<strong>•</strong> Naratriptan (Naramig) 2,5 mg p.o.<br />
<strong>•</strong> Rizatriptan (Maxalt) 10 mg p.o./Schmelztablette<br />
<strong>•</strong> Almotriptan (Almogran) 12,5 mg p.o.<br />
<strong>•</strong> Eletriptan (Relpax) 20 od. 40 mg p.o.<br />
<strong>•</strong> Frovatriptan (Eumitan) 2,5 mg p.o.<br />
22<br />
Migräneklassifikation<br />
Die klinischen Aspekte der Migräne<br />
sind durch die Kriterien der IHS seit vielen<br />
Jahren klar definiert. Danach ist die<br />
Migräne eine chronische Erkrankung<br />
mit episodischer Manifestation.<br />
Migräne ohne Aura<br />
Bei der Migräne ohne Aura kommt es<br />
zu attackenartig auftretenden Kopfschmerzen<br />
mit einer Dauer von 4–72<br />
Stunden, wobei sich der Schmerz bei<br />
2/3 der Patienten einseitig manifestiert.<br />
Grundsätzlich können die Schmerzen<br />
aber auch beidseitig auftreten oder die<br />
Seite wechseln. Der Schmerzcharakter<br />
ist pulsierend von mittlerer bis starker<br />
Intensität und wird durch körperliche<br />
Aktivität weiter verstärkt. Typische autonome<br />
Begleiterscheinungen sind Übelkeit,<br />
Erbrechen, Licht-, Lärm- und Geruchsempfindlichkeit.<br />
Als typisches Verhaltensmuster<br />
versucht der Patient alle<br />
Reizfaktoren von sich fern zu halten,<br />
sich in einen dunklen Raum zurückzuziehen<br />
und nach Möglichkeit zu schlafen.<br />
Zur Diagnose einer Migräne sind<br />
mindestens fünf Attacken der beschriebenen<br />
Art notwendig.<br />
1/2009<br />
Migräne mit Aura<br />
Etwa 10–15% aller Patienten haben<br />
neben den Schmerzen und autonomen<br />
Begleiterscheinungen noch weitere Symptome,<br />
die insbesondere vor der eigentlichen<br />
Schmerzphase auftreten. Bei der<br />
Migräne mit Aura kommt es ferner zu<br />
neurologischen Reiz- und Ausfallserscheinungen,<br />
die sich unterschiedlichen kortikalen<br />
Arealen (Sehstörungen, Skotome,<br />
Fortifikationen, Hemianopsie, Dysästhesien,<br />
Parästhesien, Paresen und neuropsychologische<br />
Defizite) oder auch dem<br />
Hirnstamm zuordnen lassen (Paraparesen,<br />
Schwindel mit Nystagmus, Ataxie,<br />
Doppelbilder). Diese Symptome entstehen<br />
innerhalb eines kurzen Zeitraums<br />
von 5–20 Minuten und<br />
sistieren in den meisten<br />
Fällen wieder vollständig<br />
innerhalb von<br />
60 Minuten. Parallel<br />
oder innerhalb von 60<br />
Minuten nach dem Sistieren<br />
der Aura setzen<br />
dann die typischen<br />
Kopfschmerzen sowie<br />
die autonomen Begleitsymptome<br />
ein.Die<br />
mit Abstand häufig-<br />
sten Störungen sind visuelle Phänomene.<br />
In seltenen Fällen kann die Aurasymptomatik<br />
isoliert, d.h. ohne Kopfschmerzen,<br />
auftreten, was insbesondere bei jüngeren<br />
Patienten beobachtet wird.<br />
Komplizierte Migräne<br />
Sofern neurologische Herdsymptome,<br />
die im Rahmen einer Migräneattacke auftreten,<br />
für mehr als sieben Tage persistieren<br />
oder eine ischämische Läsion in einer<br />
CCT- oder MRT-Untersuchung nachgewiesen<br />
werden kann, liegt eine komplizierte<br />
Migräne vor, wenn andere Ursachen<br />
einer Ischämie ausgeschlossen sind.<br />
Kindliche Migräne<br />
Bei Kindern liegt die Migräneprävalenz<br />
zwischen 2% und 5%, wobei beide<br />
Geschlechter im gleichen Ausmaß betroffen<br />
sind. Bei gut der Hälfte aller Kinder<br />
sistieren die Migräneattacken in der<br />
Pubertät. Anders als bei Erwachsenen<br />
zeichnet sich die kindliche Migräne durch<br />
eine kürzere Attackendauer und eine<br />
meist holokranielle Schmerzausprägung<br />
aus. Autonome Begleiterscheinungen,<br />
insbesondere abdominale Schmerzen und<br />
Erbrechen sind sehr stark ausgeprägt und<br />
klinisch im Vordergrund stehend. Bereits<br />
kurze Schlafphasen können die Symptomatik<br />
deutlich reduzieren.Als Unterformen<br />
treten bei Kindern auch Fälle mit<br />
isolierten Auren ohne Kopfschmerzen,<br />
periodischem Erbrechen und paroxysmalem<br />
Schwindel auf. Triptane sind im<br />
frühen Kindesalter fast unwirksam, mit<br />
einer vollständigen Wirksamkeit kann<br />
erst nach etwa dem 12.Lebensjahr sicher<br />
gerechnet werden.<br />
Migräne und Umwelteinflüsse<br />
Biologische Faktoren und Umwelteinflüsse<br />
wie hormonelle Schwankungen,<br />
Änderungen des Schlaf/Wachrhythmus,<br />
Flackerlicht, Lärm, Aufenthalt in großer<br />
Höhe oder Kälte, Erwartungsangst,<br />
Stress und Entlastungsreaktion,Konsum<br />
von Rotwein, Käse und Schokolade,<br />
Schwankungen des Koffeinspiegels und<br />
Wettereinflüsse können bei entsprechender<br />
Reaktionsbereitschaft Migräneattacken<br />
auslösen.<br />
Therapie der akuten Migräneattacke<br />
Bei einem leichten Migräneanfall genügt<br />
es üblicherweise,unspezifische Analgetika<br />
wie z.B. Aspirin kombiniert mit<br />
Antiemetika zu verabreichen. Wird eine<br />
mittelschwere bis schwere Migräneattakke<br />
zuhause behandelt, empfiehlt sich der<br />
Einsatz von Triptanen, ist eine Behandlung<br />
im Krankenhaus erforderlich, kann<br />
Aspisol i.v. verabreicht werden, daneben<br />
auch Triptane, Antiemetika und Sedativa.<br />
Die früher häufig verwendeten Ergotamine<br />
stellen heute nicht mehr das Mittel<br />
der ersten Wahl dar.<br />
Im Status migränosus kann die Therapie<br />
durch Dexamethason, Phenobarbital<br />
oder Magnesiumsulfat ergänzt werden.<br />
Eine Auflistung der wichtigsten Migränetherapeutika<br />
finden Sie in Tabelle 1 und 2.<br />
Spannungskopfschmerzen<br />
Entsprechend der internationalen<br />
Kopfschmerzklassifikation unterscheiden<br />
wir beim Spannungskopfschmerz<br />
den episodischen und den chronischen<br />
Spannungskopfschmerz.Im Vergleich zur<br />
Migräne stehen beim Spannungskopfschmerz<br />
vegetative Symptome ganz im<br />
Hintergrund, der Kopfschmerz ist in der<br />
Regel beidseitig lokalisiert.<br />
Von einem episodischen Spannungskopfschmerz<br />
spricht man dann, wenn<br />
mindestens zehn und maximal 180 Kopfschmerzattacken<br />
pro Jahr auftreten. Dabei<br />
variiert die Kopfschmerzdauer zwischen<br />
30 Minuten und sieben Tagen und<br />
die Kopfschmerzattacken umfassen mindestens<br />
zwei der folgenden Charakteristika:<br />
<strong>•</strong> bilateraler Kopfschmerz,<br />
<strong>•</strong> drückend-ziehende, nichtpulsierende<br />
Schmerzqualität,<br />
<strong>•</strong> leichte bis mittelschwere Schmerzintensität,<br />
<strong>•</strong> keine Zunahme bei Aktivität,<br />
<strong>•</strong> Phono- und Photophobie fehlen weitgehend.<br />
Die Symptomatik des chronischen<br />
Spannungskopfschmerzes entspricht dem<br />
episodischen Spannungskopfschmerz, ist<br />
aber an mindestens 15 Tagen pro Monat
Episodischer Sp-KS<br />
<strong>•</strong> Analgetika<br />
- ASS<br />
- Paracetamol<br />
- Ibuprofen<br />
- Naproxen<br />
- ASS/Paracetamol, Coffein<br />
<strong>•</strong> Pfefferminzöl lokal<br />
Spannungskopfschmerz-Therapie<br />
oder über mehr als sechs Monate pro<br />
Jahr vorhanden.Vom chronischen Spannungskopfschmerz<br />
sind in erster Linie<br />
symptomatische Ursachen, wie die arterielleHypertonie,Medikamentennebenwirkungen,analgetikainduzierterDauerkopfschmerz,<br />
akuter posttraumatischer<br />
Kopfschmerz, langsam wachsende Tumoren,<br />
das chronische Subduralhämatom,<br />
Sinus- und Hirnvenenthrombosen,<br />
Liquorabflussstörungen, Pseudotumor<br />
cerebri, spontaner Liquorunterdruck,Arteritiis<br />
temporalis, oromandibuläre Dysfunktion<br />
und kraniokervikale Anomalien<br />
abzugrenzen.<br />
Der Spannungskopfschmerz tritt mit<br />
einer Lebenszeitprävalenz von 30–60%<br />
auf, als Auslöser kommen Stresssituationen,<br />
fieberhafte Infekte, Menstruation<br />
und muskuläre Fehlbelastungen in Frage.<br />
Häufig ist der Spannungskopfschmerz mit<br />
Angsterkrankungen, depressiven Symptomen,<br />
Schlafstörungen, muskuloskelettalen<br />
Schmerzen und Medikamentenfehlgebrauch<br />
assoziiert. Pathophysiologisch<br />
ist eine multifaktorielle Genese anzunehmen,<br />
wobei sowohl muskuläre, biochemische<br />
und vaskuläre Faktoren sowie eine<br />
niedrige zentrale Schmerzschwelle bei erhöhter<br />
Sensitivität der peripheren Nozizeption<br />
eine Rolle spielen dürfen.<br />
Therapieempfehlungen für den episodischen<br />
und chronischen Spannungskopfschmerz<br />
sind der Tabelle 3 zu entnehmen.<br />
Clusterkopfschmerz-Therapie<br />
Clusterkopfschmerz<br />
Attackenkupierung<br />
<strong>•</strong> Sauerstofinhalation über<br />
Gesichtsmaske (7 l/min)<br />
<strong>•</strong> Sumatriptan (Imigran) sc.<br />
<strong>•</strong> Zolmitriptan Nasenspray (5 mg)<br />
<strong>•</strong> Lidocain intranasal<br />
<strong>•</strong> DHE i.m./i.v.<br />
Tabelle 3<br />
Chronischer Sp-KS<br />
<strong>•</strong> Nicht medikamentös<br />
- Physio-Manualtherapie<br />
- Entspannungsübungen<br />
- Akupunktur<br />
- Biofeedback<br />
<strong>•</strong> Medikamentös<br />
- Amitryptilin 10–75 mg/ml<br />
- lokale Infiltrationen<br />
- Botulinumtoxin<br />
Clusterkopfschmerz<br />
Prophylaxe<br />
<strong>•</strong> Verapamil<br />
<strong>•</strong> (Lithium)<br />
<strong>•</strong> Akupunktur<br />
<strong>•</strong> Valproinsäure<br />
<strong>•</strong> Methylprednisolon<br />
<strong>•</strong> Topiramat<br />
Trigeminoautonome<br />
Kopfschmerzen<br />
Trigeminoautonome Kopfschmerzen<br />
sind durch kurz<br />
dauernde Schmerzattacken<br />
und fakultativ vorhandene<br />
autonome Begleitsymptome<br />
(ipsilateral) wie Lakrimation,<br />
konjunktivale Injektion, Rhinorrhoe,<br />
nasale Kongestion<br />
und Lidschwellung charakterisiert.<br />
Pathogenetisch ist eine<br />
Überaktivierung des parasympatischen<br />
Systems anzunehmen.<br />
Clusterkopfschmerz<br />
Der Clusterkopfschmerz, der bei Männern<br />
sechsmal so häufig ist wie bei Frauen,<br />
tritt mit einer Prävalenz von 3 auf<br />
1.000 bzw. einer Inzidenz von 10 auf<br />
100.000 auf. Üblicherweise beginnt der<br />
Clusterkopfschmerz zwischen dem 20.<br />
und 40. Lebensjahr, wobei eine familiäre<br />
Häufung beobachtet wird. Die Clusterdauer<br />
liegt zwischen sieben Tagen und<br />
einem Jahr mit unterschiedlich langen<br />
freien Intervallen, die Dauer einer Clusterschmerzepisode<br />
wird mit 15–180 Minuten<br />
angegeben. Die Attackenfrequenz<br />
pro Tag variiert stark. Die Pathophysiologie<br />
des Clusterkopfschmerzes ist unbekannt,<br />
als Auslöser werden Alkohol,<br />
Flackerlicht, Anstrengung sowie Nitroglycerin<br />
beobachtet. Üblicherweise beginnt<br />
der Clusterkopfschmerz ohne Prodromalerscheinungen<br />
und erreicht das<br />
Schmerzmaximum innerhalb weniger Minuten.<br />
Er ist streng halbseitig lokalisiert,<br />
die Seite ist konstant, der Schmerz ist orbital<br />
und frontal lokalisiert und hat eine<br />
unerträglich bohrende Qualität. Dies<br />
führt zu einem ruhelosen Verhalten des<br />
betroffenen Patienten, der üblicherweise<br />
rastlos auf und ab geht. Als Begleitsymptome<br />
können ein Hornersyndrom, Rhinorrhoe,<br />
Lakrimation, konjunktivale Injektion,<br />
einseitiges Gesichtsschwitzen,<br />
aber nur selten Übelkeit auftreten. Die<br />
therapeutischen Möglichkeiten sind der<br />
Tabelle 4 zu entnehmen.<br />
Tabelle 4<br />
Idiopathisch stechender<br />
Kopfschmerz<br />
Der idiopathisch stechende<br />
Kopfschmerz wird bei ca.<br />
2% der Patienten mit<br />
präexistenter Migräne, Spannungskopfschmerz<br />
und Clusterkopfschmerz<br />
beobachtet,<br />
wobei eine ausgeglichene<br />
MIGRÄNE<br />
Geschlechts- und Altersverteilung vorliegt.<br />
Der idiopathisch stechende Kopfschmerz<br />
ist charakterisiert durch paroxysmale,<br />
nur Sekundenbruchteile anhaltende<br />
Schmerzepisoden, die einzeln oder<br />
in Serien auftreten und nur ein umschriebenes<br />
Areal, üblicherweise den 1.<br />
Trigeminusast, betreffen. Der Schmerzcharakter<br />
ist stechend. Die Häufigkeit<br />
der Schmerzepisoden variiert zwischen<br />
einmal pro Jahr bis hundertmal pro Tag,<br />
eine organisch fassbare Grunderkrankung<br />
ist nicht fassbar, autonome Symptome<br />
fehlen. Ätiologisch nimmt man paroxysmale<br />
neuronale Entladungen an, eine<br />
Behandlungsbedürftigkeit ist üblicherweise<br />
nicht gegeben. Bei sehr hoher Frequenz<br />
und hohem Leidensdruck empfiehlt<br />
sich ein Therapieversuch mit Indocid.<br />
Zusammenfassung<br />
Primäre Kopfschmerzen machen ca.<br />
90% aller Kopfschmerzen aus. Primäre<br />
Kopfschmerzen können die Lebensqualität<br />
stark beeinflussen und den Patienten<br />
beunruhigen.<br />
Eine richtige Zuordnung zu den verschiedenen<br />
Gruppen der IHS-Skala ist<br />
sinnvoll und von praktischer Relevanz,<br />
damit eine gezielte Therapie eingeleitet<br />
werden kann.<br />
Auch Patienten mit jahrelangen primären<br />
Kopfschmerzen können zusätzlich<br />
eine andere Erkrankung entwickeln<br />
die sich mit einem symptomatischen sekundären<br />
Kopfschmerz manifestiert.<br />
Literatur<br />
1. Diener HC: Kopfschmerzen. Georg Thieme Verlag, 2003<br />
2. International Headache Society: The International Classification<br />
of Headache Disorders, 2nd edition. Cephalgia 2004; 24<br />
(suppl 1): 1- 160.<br />
Prim. Univ.-Doz. Dr. Klaus Berek,<br />
Dr. Markus Mayr<br />
Abteilung für Neurologie<br />
Endach 27, A-6330 Kufstein<br />
Tel.: +43/05372/6966-4405,<br />
+43/5372/69 66-34 05, Fax-Dw: -19 40<br />
klaus.berek@bkh-kufstein.at<br />
1/2009 23
FORUM MEDICUM<br />
Neue Spezialmatrix für Fentanylpflaster<br />
Mit Matrifen ® erweitert Grünenthal<br />
ab 1. Oktober 2009 sein Produktportfolio<br />
um ein transdermales Matrixpflaster<br />
zur Behandlung von mittelstarken bis<br />
starken chronischen Schmerzen. Das<br />
Schmerzpflaster enthält den Wirkstoff<br />
Fentanyl und zeichnet sich durch eine innovative<br />
Matrixtechnologie sowie durch<br />
eine neuartige Silikon-Klebeschicht aus.<br />
Matrifen ® steht in fünf Wirkstärken von<br />
12, 25, 50, 75, 100 µg pro Stunde zur Verfügung.<br />
Einladung in den<br />
Golden Club<br />
24<br />
&<br />
Wer für ein<br />
Jahres-Abo € 39,–.<br />
investiert, wird mit<br />
„Goodies“ nahezu<br />
überschüttet.<br />
Siehe<br />
www.dinersclub.at<br />
1/2009<br />
und<br />
gratis für die<br />
Dauer des Abos<br />
Nähere Informationen auf<br />
Seite 26 und www.mediziner.at<br />
Spezialmatrix als Besonderheit<br />
Im Unterschied zu den anderen opioidhaltigen,<br />
transdermalen Pflastern enthält<br />
Matrifen ® den Wirkstoff Fentanyl in<br />
Dipropylen-Glykoltröpfchen; eingebettet<br />
in einer innovativen Silikonmatrix.<br />
Eine speziell entwickelte Diffusions-<br />
Kontrollmembran reguliert die Diffusionsgeschwindigkeit<br />
des Wirkstoffs in<br />
die Haut. Durch die spezielle Novo-Matrix-Technologie<br />
wird eine optimale<br />
Wirkstoffnutzung und konstante Wirkstoffabgabe<br />
über 72 Stunden sichergestellt.<br />
Klinische Wirksamkeit<br />
Studien belegen, dass Matrifen ® einer<br />
Behandlung mit oralem Opioid 1 oder<br />
Durogesic gleichwertig bzw. nicht unterlegen<br />
ist. Das Sicherheitsprofil und das<br />
Lebensqualitätsergebnis entsprechen<br />
jenem von Durogesic und den oralen<br />
Opioiden. 1 Die Bioäquivalenz von Matrifen<br />
® und Durogesic konnte in Studien<br />
nachgewiesen werden. 2<br />
Anwendungssicherheit<br />
für den Patienten<br />
Jede Pflasterstärke weist einen unterschiedlichen<br />
Farbcode auf. Des weiteren<br />
sind die Primärverpackung und das Pflaster<br />
beschriftbar. Dies erhöht die Erkennbarkeit<br />
für den Patienten und senkt<br />
die Verwechslungsgefahr zwischen den<br />
Pflasterstärken. 3<br />
Über Grünenthal<br />
Grünenthal ist Experte für Arzneimittel<br />
in Schmerztherapie und Gynäkologie<br />
sowie Vorreiter für intelligente, anwenderfreundliche<br />
Darreichungsformen.Das<br />
Unternehmen erforscht, entwickelt, produziert<br />
und vermarktet Medikamente<br />
mit hohem therapeutischen Wert, die dazu<br />
beitragen,dass die Patienten selbstbestimmt<br />
leben können. Grünenthal ist ein<br />
unabhängiges, deutsches Familienunternehmen,<br />
das weltweit in 32 Ländern Gesellschaften<br />
hat.<br />
FB<br />
Literatur<br />
1. Kress HG, Von der Laage D, Hoerauf KH, et al. A randomised,<br />
open, parallel-group, multi-center trial to investigate analgesic<br />
efficacy and safety of a transdermal fentanyl patch compared to<br />
standard opioid treatment in cancer pain, Journal of Pain and<br />
Symptom Management 2008; 36 (3): 268-279<br />
2. Marier JF, Lor M, Morin J, et al. Comparative bioequivalence<br />
study between a novel matrix transdermal delivery system of<br />
fentanyl and a commercially available reservoir formulation. Br<br />
Clin Pharmacol. 2007; 63(1):121-4<br />
3. Austria Codex Matrifen 12 µg/h Fentanyl, Stand Oktober<br />
2009<br />
Weitere Informationen unter:<br />
Claudia Tuhy<br />
Tel.: +43/2236/379 550 - 23;<br />
Fax: +43/2236/379 504;<br />
claudia.tuhy@grunenthal.com<br />
Grünenthal Ges.m.b.H,<br />
Brunn am Gebirge, Österreich<br />
www.grunenthal.at<br />
Anzeige Plus<br />
26
FORUM MEDICUM<br />
1/2009 25
26<br />
1/2009<br />
A NFORDERUNGSFAX<br />
ABONNEMENT<br />
� Ich bestelle den facharzt Anästhesie/<br />
Intensivmedizin zusammen mit DER<br />
MEDIZINER zum 1-Jahres-Abonnement-Preis<br />
von € 39,– inkl. Porto.<br />
� Ich bestelle den facharzt Anästhesie/<br />
Intensivmedizin zusammen mit DER<br />
MEDIZINER zum 2-Jahres-Abonnement-Preis<br />
von € 76,– inkl. Porto.<br />
Falls ich mein Abonnement nicht verlängern<br />
will, werde ich dies bis spätestens<br />
sechs Wochen vor Auslaufen des Abos<br />
per Einschreiben oder E-Mail mitteilen.<br />
Erhalten Sie keine Nachricht von mir,<br />
verlängert sich mein Abonnement automatisch<br />
um ein Jahr.<br />
Um die DINERS CLUB GOLD CARD<br />
zu erhalten, ist es erforderlich, dem ME-<br />
DIZINER-Club (s.u.) beizutreten (Beitritt<br />
und Mitgliedschaft sind kostenlos).<br />
Titel, Name, Vorname<br />
Straße<br />
PLZ/Ort<br />
Datum<br />
Unterschrift und Stempel (falls vorhanden)<br />
CLUB-<br />
ANMELDUNG<br />
� Ja, ich möchte dem MEDIZINER-<br />
Club beitreten. Es entstehen für<br />
mich dabei keine Kosten.<br />
Als Abonnent des facharzt und des<br />
MEDIZINERs erhalte ich nach Einsendung<br />
dieser Karte ein spezielles<br />
Antragsformular auf Ausstellung einer<br />
DINERS CLUB GOLD CARD von<br />
AIRPLUS, Rainerstraße 1, 1040 Wien.<br />
� Ich möchte für die Dauer meines<br />
Abonnements kostenlos die Diners<br />
Club Gold Card beziehen.<br />
Mir ist klar, dass mein Antrag den<br />
üblichen Kriterien für Privatkarten<br />
entsprechen muss und gegebenenfalls<br />
auch abgelehnt werden kann.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
facharzt<br />
Anästhesie/Intensivmedizin<br />
Wichtig!<br />
Titel, Name, Vorname<br />
Straße, PLZ/Ort<br />
Datum<br />
1/2009<br />
Durch Ankreuzen des gewünschten Produktes können Sie<br />
bequem Literatur bzw. ein Informationsgespräch bestellen.<br />
Das ausgefüllte und unterschriebene Blatt schicken oder<br />
faxen Sie einfach an die untenstehende Adresse.<br />
Wir leiten Ihre Anfrage sofort weiter.<br />
Anzeige + Literatur Informationsgespräch<br />
Adamon � �<br />
Durogesic � �<br />
Matrifen � �<br />
Noax � �<br />
OxyContin � �<br />
Perfalgan � �<br />
Solo-Volon � �<br />
Tradolan � �<br />
Vendal � �<br />
Bei Literaturanforderung bitte<br />
unbedingt hier (Absender) signieren!<br />
Fax: 04263/200 74<br />
verlagdermediziner gmbh Steirer Straße 24, A-9375 Hüttenberg
Bezeichnung des Arzneimittels: Adamon long retard 150 mg-Filmtabletten, Adamon long retard 300 mg-Filmtabletten. Zusammensetzung (arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge): Je<br />
eine Filmtablette enthält 150 mg bzw. 300 mg Tramadolhydrochlorid, als Hilfsstoffe hydriertes Pflanzenöl, Talk, Magnesiumstearat, Lactose-Monohydrat, Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Macrogol<br />
4000. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung mittelstarker bis starker Schmerzen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Tramadol oder einen der sonstigen Bestandteile von Adamon long retard.<br />
Akute Intoxikation mit Alkohol, Schlafmittel, zentral wirksamen Analgetika, Opioiden oder psychotropen Stoffen. Tramadol sollte nicht an PatientInnen verabreicht werden, die MAO-Hemmer erhalten oder<br />
innerhalb der letzten 14 Tage angewendet haben. Tramadol darf nicht zur Opioid-Entzugsbehandlung eingesetzt werden. Pharmakotherapeutische Gruppe: Analgetika, andere Opioide (ATC Code: N02A<br />
X02). Name oder Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers: Meda Pharma GmbH, Guglgass 15, 1110 Wien. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Suchtgift, Abgabe auf Rezept,<br />
wiederholte Abgabe verboten, apothekenpflichtig. Adamon 50 mg – Schmelztabletten: Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Tablette enthält 50 mg Tramadolhydrochlorid, als sonstige<br />
Bestandteile Ethylcellulose, Copovidon, Siliciumdioxid, Mannitol (E421), Crospovidon, Aspartam (E951), Pfefferminz-Rootbeer-Geschmack, Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Behandlung mäßiger bis<br />
starker Schmerzen. Gegenanzeigen: Adamon 50 mg - Schmelztabletten dürfen nicht an Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile verabreicht<br />
werden. Das Produkt darf nicht an Patienten verabreicht werden, die eine akute Vergiftung oder Überdosierung durch Alkohol, Schlafmittel, zentral wirksame Analgetika, Opioide oder Psychopharmaka haben.<br />
Wie bei anderen Opioid-Analgetika darf es nicht an Patienten verabreicht werden, die MAO-Hemmer erhalten oder innerhalb der letzten 14 Tage abgesetzt haben. Es darf nicht gleichzeitig mit Nalbuphin,<br />
Buprenorphin, oder Pentazocin verabreicht werden. Kontraindiziert bei Patienten, die unter unkontrollierter Epilepsie leiden. Wenn eine Langzeittherapie notwendig ist, darf Tramadol in der Stillzeit nicht angewendet<br />
werden. Adamon 50 mg - Schmelztabletten sind für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Pharmakotherapeutische Gruppe: Analgetika, andere Opioide, ATC Code: N02AX02. Pharmazeutischer<br />
Unternehmer: Meda Pharma GmbH, Guglgasse 15, 1110 Wien. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Suchtgift, Abgabe auf Rezept, wiederholte Abgabe verboten, apothekenpflichtig.<br />
Angaben über Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Mitteln, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der<br />
veröffentlichten Fachinformation. www.meda.at<br />
Durogesic 12 μg/h-Depotpflaster, Durogesic 25 μg/h-Depotpflaster, Durogesic 50 μg/h-Depotpflaster, Durogesic 75 μg/h-Depotpflaster,Durogesic 100 μg/h-Depotpflaster. Qualitative und quantitative Zusammensetzung:<br />
Durogesic 12 μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 5,25 cm 2 Wirkfläche enthält 2,1 mg Fentanyl (entsprechend 12,5 μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Durogesic 25 μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 10,5 cm 2 Wirkfläche<br />
enthält 4,2mg Fentanyl (entsprechend 25 μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Durogesic 50 μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 21 cm 2 Wirkfläche enthält 8,4mg Fentanyl (entsprechend 50 μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Durogesic 75 μg/h: 1<br />
Transdermales Pflaster mit 31,5 cm 2 Wirkfläche enthält 12,6 mg Fentanyl (entsprechend 75 μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Durogesic 100 μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 42 cm 2 Wirkfläche enthält 16,8 mg Fentanyl (entsprechend 100<br />
μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Sonstige Bestandteile: Trägerschicht: Polyethylenterephthalat/Ethylvinylacetat-Folie, Orange (Durogesic 12 μg/h)/Rote (Durogesic 25 μg/h)/Grüne (Durogesic 50 μg/h)/Blaue (Durogesic 75<br />
μg/h)/Graue (Durogesic 100 μg/h) Drucktinte. Wirkstoffhaltige Schicht: Adhäsives Polyacrylat. Schutzfolie: Polyesterfolie, silikonisiert. Anwendungsgebiet: Durogesic 12 μg/h: Chronische Schmerzen, die nur mit Opiatanalgetika<br />
ausreichend behandelt werden können und einer längeren, kontinuierlichen Behandlung bedürfen bei Patienten ab 2 Jahren. Durogesic 25-100 μg/h: Chronische Schmerzen, die nur mit Opiatanalgetika ausreichend behandelt werden<br />
können und einer längeren, kontinuierlichen Behandlung bedürfen. Hinweis: In den durchgeführten Studien war eine Zusatzmedikation mit schnellfreisetzenden morphinhaltigen Arzneimitteln bei fast allen Patienten zur Kupierung<br />
von Schmerzspitzen erforderlich. Gegenanzeigen: Durogesic darf nicht angewendet werden: Bei kurzfristigen Schmerzzuständen, zB: nach operativen Eingriffen. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Fentanyl, gegen<br />
andere Opiate oder gegen sonstige Bestandteile des Pflasters. Bei gleichzeitiger Anwendung von Monoaminooxidase (MAO) - Hemmern oder innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung einer Therapie mit MAO - Hemmern. Bei schwer<br />
beeinträchtigter ZNS-Funktion. Weitere Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und sonstige Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und zu Gewöhnungseffekten<br />
und Abhängigkeit sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Abgabe: SG, apothekenpflichtig. ATC Code: N02AB03. Zulassungsinhaber: Janssen-Cilag Pharma, 1232 Wien. Stand: 19.10.2007<br />
Matrifen 12 µg/h - transdermales Pflaster: Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Matrifen 12 µg/h - transdermales Pflaster enthält 1,38 mg Fentanyl in einem Pflaster mit 4,2 cm 2 und setzt 12,5 Mikrogramm Fentanyl<br />
pro Stunde frei. Sonstiger Bestandteil: 6,2 mg Dipropylenglycol. Matrifen 25 µg/h - transdermales Pflaster: Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Matrifen 25 µg/h - transdermales Pflaster enthält 2,75 mg Fentanyl in<br />
einem Pflaster mit 8,4 cm 2 und setzt 25 Mikrogramm Fentanyl pro Stunde frei. Sonstiger Bestandteil: 12,3 mg Dipropylenglycol. Matrifen 50 µg/h - transdermales Pflaster: Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Matrifen<br />
50 µg/h - transdermales Pflaster enthält 5,50 mg Fentanyl in einem Pflaster mit 16,8 cm 2 und setzt 50 Mikrogramm Fentanyl pro Stunde frei. Sonstiger Bestandteil: 24,6 mg Dipropylenglycol. Matrifen 75 µg/h - transdermales Pflaster:<br />
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Matrifen 75 µg/h - transdermales Pflaster enthält 8,25 mg Fentanyl in einem Pflaster mit 25,2 cm 2 und setzt 75 Mikrogramm Fentanyl pro Stunde frei. Sonstiger Bestandteil: 37,0<br />
mg Dipropylenglycol. Matrifen 100 µg/h - transdermales Pflaster: Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Matrifen 100 µg/h - transdermales Pflaster enthält 11,0 mg Fentanyl in einem Pflaster mit 33,6 cm 2 und setzt 100<br />
Mikrogramm Fentanyl pro Stunde frei. Sonstiger Bestandteil: 49,3 mg Dipropylenglycol. Weitere sonstige Bestandteile: Hydroxypropylcellulose, Dimeticon, Siliconadhäsiva (Amin-resistent), Freisetzungsmembran: Ethylen-Vinylacetat<br />
(EVA), Film auf der Rückseite: Polyethylenterephthalatfilm (PET), Entfernbarer Schutzfilm: Fluorpolymerbedeckter Polyesterfilm Anwendungsgebiete: Das Arzneimittel ist indiziert bei schweren chronischen Schmerzen, die nur mit Opioid-<br />
Analgetika ausreichend behandelt werden können. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwere Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems. Gleichzeitige Anwendung<br />
von MAO-Hemmern oder Anwendung innerhalb von 14 Tagen nach Absetzen von MAO-Hemmern. Die Applikation während der Geburt ist wegen möglicher Atemdepression beim Föten/Neugeborenen kontraindiziert. Pharmakotherapeutische<br />
Gruppe: Analgetika, Opioide. ATC-Code: N02AB03. Inhaber der Zulassung: Nycomed Austria GmbH, Linz. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Suchtgift, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept, apothekenpflichtig. Informationen<br />
zu Besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten<br />
sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. [0409]<br />
Noax uno ® 100 mg / 200mg Retardtabletten, Packungsgrössen: 10 und 30 Stück. Zusammensetzung: 1 Retardtablette enthält 100 mg bzw. 200 mg Tramadol Hydrochlorid. Anwendungsgebiete: Behandlung von mittelstarken bis<br />
starken Schmerzen. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit gegen Tramadol oder einen der sonstigen Bestandteile. Akuter Vergiftung oder Überdosierung mit zentral wirkenden Beruhigungsmitteln (Alkohol, Schlafmittel, andere<br />
opioide Analgetika, usw.). Patienten, die gleichzeitig mit MAO Hemmern behandelt werden oder mit MAO Hemmern während der letzten 2 Wochen behandelt wurden. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Linezolid. Bei schwerer Leberinsuffizienz<br />
oder schwerer Niereninsuffizienz (Kreatinin Clearance < 10 ml/min). Bei Epilepsie, die nicht ausreichend durch eine Behandlung kontrolliert wird. Tramadol darf nicht verabreicht werden während der Stillzeit, wenn eine länger dauernder<br />
Behandlung, zum Beispiel mehr als 2 bis 3 Tage erforderlich ist. Hilfsstoffe: Poly(vinylacetat); Povidon; Natriumdodecylsulfat, Siliciumdioxid (Kollidon SR), Xanthangummi, Pflanzenöle hydriert (Baumwollsamenöl), Magnesiumstearat,<br />
Siliciumdioxid, Hydroxypropyldistärkephosphat (E 1442) (Contramid). Zulassungsinhaber: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Heiligenstädter Straße 395b, 1190 Wien. SG, Abgabe auf Rezept, NR, apothekenpflichtig, ATC-Code:<br />
N02AX. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Gewöhnungseffekten und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.<br />
OxyContin ® retard 5, 10, 20, 40, 80 mg-Filmtabletten. Packungsgrößen: 10 und 30 Filmtabletten. Zusammensetzung: Je 1 Filmtablette enthält 5 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 4,5 mg Oxycodon, bzw. 10 mg Oxycodonhydrochlorid<br />
entsprechend 9 mg Oxycodon, bzw. 20 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 18 mg Oxycodon, bzw. 40 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 36 mg Oxycodon, bzw. 80 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 72 mg Oxycodon.<br />
Hilfsstoffe: Lactose, Povidon, Ammoniummethylacrylat Polymere Dispersion, Sorbinsäure, Triacetin, Stearylalkohol, Talkum, Magnesiumstearat. Filmüberzug: Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Macrogol sowie 5 mg: Brilliantblau<br />
(E133); 10 mg: Hydroxypropylcellulose; 20 mg: Polysorbat, Eisenoxid rot (E172); 40 mg: Polysorbat, Eisenoxid gelb (E172); 80 mg: Hydroxypropylcellullose, Eisenoxid gelb (E172), Indigokarmin Lack (E132).Anwendungsgebiete:<br />
Behandlung von starken Schmerzen. Gegenanzeigen: Atemdepression, Kopfverletzung, paralytischer Ileus, akutes Abdomen, verzögerte Magenentleerung, schwere obstruktive Atemwegserkrankung, schweres Bronchialasthma, Hyperkapnie,<br />
bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Oxycodon, Morphin oder anderen Opioiden, akute Lebererkrankung, gleichzeitige Therapie mit Monoaminoxidase-Hemmern oder innerhalb von 2 Wochen nach deren Absetzen. Die Sicherheit<br />
von OxyContin ® bei präoperativer Verabreichung oder Verabreichung innerhalb der ersten 24 Stunden postoperativ wurde nicht geprüft und daher kann die Gabe auch nicht empfohlen werden. Pharmazeutischer Unternehmer:<br />
Mundipharma Ges.m.b.H., Wien. Stand der Information: OxyContin ® retard 5 mg – August 2005, OxyContin ® retard 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg - April 2005. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: SG, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept,<br />
apothekenpflichtig. ATC-Code: N02AA05. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, Schwangerschaft und Stillzeit und zu den Nebenwirkungen<br />
entnehmen Sie bitte den veröffentlichten Fachinformationen.<br />
1) Jarde O et al. Clin Drug Invest 1997; 14(6): 474-8. 2) Whitcomb DC. et al. JAMA 1994; 272 (23): 1845-50. 3) Henrich WL. et al. Am J Kidney Dis 1996; 27 (1): 163-5<br />
Bezeichnung des Arzneimittels: PERFALGAN ® 10 mg/ml - Infusionslösung. Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Analgetika und Antipyretika, ATC-Code: N02BE01. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 ml enthält<br />
10 mg Paracetamol. 1 Durchstechflasche mit 50 ml enthält 500 mg Paracetamol. 1 Durchstechflasche mit 100 ml enthält 1000 mg Paracetamol. Sonstige Bestandteile: Natrium 0,04 mg/ml. Vollständige Auflistung der sonstigen<br />
Bestandteile: Mannitol, Cystein??hydrochlorid-Monohydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumhydroxid, Salzsäure, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: PERFALGAN ® ist angezeigt für die Kurzzeitbehandlung<br />
von mittelstarken Schmerzen, besonders nach Operationen und für die Kurzzeitbehandlung von Fieber, wenn die intravenöse Anwendung aufgrund einer dringend erforderlichen Schmerz- oder Hyperthermiebehandlung klinisch<br />
gerechtfertigt ist und/oder wenn andere Formen der Verabreichung nicht möglich sind. Gegenanzeigen: PERFALGAN ® ist kontraindiziert bei: Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Paracetamol oder gegen Propacetamolhydrochlorid<br />
(Vorstufe von Paracetamol) oder gegen einen der sonstigen Bestandteile; schwerer Leberinsuffizienz. Inhaber der Zulassung: Bristol-Myers Squibb GesmbH, Wien. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig.<br />
Stand: August 2008. Weitere Angaben zu den besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft<br />
und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie den Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.<br />
Solu-Volon ® A. Zusammensetzung: Solu-Volon A 40 mg: 1 Ampulle mit 1 ml Injektionslösung enthält 54,4 mg Triamcinolonacetonid-dikaliumphosphat, entsprechend 40 mg Triamcinolonacetonid. Solu-Volon A 80 mg-Injektionslösung:<br />
1 Ampulle mit 2 ml Injektionslösung enthält 108,8 mg Triamcinolonacetonid-dikaliumphosphat, entsprechend 80 mg Triamcinolonacetonid. Solu-Volon A 200 mg-Injektionslösung: 1 Ampulle bzw. 1 Fertigspritze mit 5 ml Injektionslösung<br />
enthält 272 mg Triamcinolonacetonid-dikaliumphosphat, entsprechend 200 mg Triamcinolonacetonid. Sonstige Bestandteile: Natriumcitrat, Macrogol 300, Wasser für Injektionszwecke, Citronensäurelösung 10% und Natriumhydroxidlösung<br />
4 N zur ph-Einstellung. Anwendungsgebiete: 40 mg/80 mg/200 mg: Eine Glucocorticoidbehandlung mit Solu-Volon A ist angezeigt, wenn eine sehr schnell einsetzende Wirkung erzielt werden soll: Dazu gehören besonders: Glottisödem,<br />
Quinckeödem, Lungenödem infolge Inhalation oder Aufnahme toxischer Substanzen (z.B. Chlorgase, Paraquat, Isocyanid, Schwefelwasserstoff, Phosgen, Nitrosegase). Wenn möglich sollten außerdem frühzeitig hohe Dosen von<br />
Glucocorticoiden inhaliert bzw. aus Dosieraerosolen verabreicht werden, Behandlung und Prophylaxe eines Hirnödems bei Hirntumoren (postoperativ und nach Röntgenbestrahlung), nach Rückenmarkstraumen und bei Apoplexie, Prophylaxe<br />
von Kontrastmittelunverträglichkeit bei Patienten mit allergischer Disposition, Anaphylaktische Schockzustände (z.B. Kontrastmittelzwischenfall) Kombination mit Epinephrin (Adrenalin), Antihistaminika und Volumens-substitution<br />
(cave Mischspritze!), Infektionstoxischer Schock zur Prophylaxe der Schocklunge, Hypovolämischer Schock (peripheres Kreislaufversagen), der nicht allein auf Volumensauffüllung, Sauerstoffzufuhr und Korrektur der Azidose anspricht.<br />
Perakute Formen und akute Schübe von Krankheiten mit hoher entzündlicher oder immunologischer Aktivität können Indikationen für eine zeitlich begrenzte hochdosierte intravenöse Therapie darstellen, wenn es auf einen möglichst raschen<br />
Wirkungseintritt ankommt oder eine perorale Applikation unmöglich ist. Das sind u.a. akute schwere Dermatosen (z.B. Pemphigus vulgaris, Erythrodermie, Lyell-Syndrom), akute hämatologische Krankheiten (akute idiopathische<br />
thrombozyto-penische Purpura, hämolytische Anämie mit schwerer Hämolyse und Hb-Werten unter 6 g%), akute rheumatische Karditis, Bei thyreotoxischen und Addison Krisen muss zusätzlich zu Solu-Volon A ein Corticoid mit mineralocorticotroper<br />
Wirkung verabreicht werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Triamcinolonacetonid. Für eine kurzdauernde Notfalltherapie gibt es keine Gegenanzeigen, ausgenommen systemische Pilzinfektionen,<br />
septischer Schock und Sepsis. In jedem Fall sind die Risiken gegen den zu erwartenden Nutzen abzuwägen. Besondere Vorsicht bei Magen-Darm-Ulcera, ausgeprägter Osteoporose und Psychosen. Bei längerdauernder Glucocorticoid-Anwendung,<br />
die über die Notfalltherapie hinaus geht, gelten die Gegenanzeigen einer systemischen Glucocorticoid-Therapie. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten.<br />
Pharmazeutischer Unternehmer: Dermapharm GmbH, 1090 Wien. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Nebenwirkungen sind der<br />
„Austria-Codex-Fachinformation” zu entnehmen.<br />
Tradolan. Anwendungsgebiete: Behandlung mittelstarker bis starker Schmerzen. Zusammensetzung: Ampullen: 1 Ampulle zu 1 ml bzw. 2 ml enthält 50 mg bzw. 100 mg Tramadol hydrochlorid. Filmtabletten: 1 Filmtablette enthält<br />
50 mg Tramadol hydrochlorid. Retardtabletten: 1 Retardtablette enthält 100 mg, 150 mg bzw. 200 mg Tramadol hydrochlorid. Tropfen: 1 ml Lösung (= 24 Tropfen = 8 Hübe) enthält 100 mg Tramadol hydrochlorid. Zäpfchen: 1 Zäpfchen enthält<br />
100 mg Tramadol hydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Ampullen: Natriumacetat, Wasser. Filmtabletten: Croscarmellose Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Polyvidon, Magnesiumstearat, Polyacrylat<br />
Dispersion 30%, Macrogol 6000, Hypromellose, Talkum, Titandioxid (E 171). Retardtabletten: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, Macrogol 6000, Magnesiumstearat, Propylenglykol, hochdisperses Siliciumdioxid,<br />
Talkum, Titandioxid (E 171). 150 mg: Chinolingelb (E 104), Eisen(III)-oxid rot (E 172). 200 mg: Chinolingelb (E 104), Eisen(III)-oxid rot (E 172), Eisen(III)-oxid braun (E 172). Tropfen: 10 mg Natriumcyclamat, 5 mg Saccharin Natrium, 1,5<br />
mg Kalium¬sorbat, Pfefferminzaroma und gereinigtes Wasser. Zäpfchen: Hartfett, hochdisperses Siliciumdioxid. Gegenanzeigen: Ampullen, Filmtabletten, Tropfen, Zäpfchen: Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Präparates;<br />
Akute Alkohol-, Schlafmittel-, Schmerzmittel- oder Psychopharmakavergiftung; Opioidabhängigkeit; Bewußtseinsstörungen unklarer Genese; Störungen des Atemzentrums und der Atemfunktion; Zustände mit erhöhtem Hirndruck,<br />
wenn nicht eine Beatmung durchgeführt wird; sollen bei Patienten, die MAO-Hemmer erhalten oder innerhalb der letzten 14 Tage verwendet haben, nicht angewendet werden; sind nicht zur Drogensubstitution geeignet; sind nicht für<br />
Kinder unter einem Jahr bestimmt. Retardtabletten: bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Tramadol oder einen der sonstigen Bestandteile; bei akuten Alkohol-, Schlafmittel-, Analgetika-, Opioid- und Psychopharmakavergiftungen;<br />
bei Patienten, die MAO-Hemmer erhalten oder innerhalb der letzten 14 Tage angewendet haben; bei Patienten mit Epilepsie, die durch Behandlung nicht ausreichend kontrolliert werden kann; zur Behandlung bei Drogensubstitution. Wirkstoffgruppe:<br />
Pharmakotherapeutische Gruppe: andere Opioide; ATC-Code: N 02 AX 02. Abgabe: Suchtgift, Abgabe auf Rezept, apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Packungsgrößen: Ampullen: 5 Ampullen zu 1 ml bzw.<br />
2ml. Filmtabletten: 10 und 30 Stück. Retardtabletten: 10, 30 und 60 Stück. Tropfen: Tropfflasche zu 10 ml; Flaschen mit Dosierpumpe zu 30 ml, 50 ml und 96 ml. Zäpfchen: 5 Stück. Pharmazeutischer Unternehmer: LANNACHER HEIL-<br />
MITTEL Ges.m.b.H., 8502 Lannach. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen<br />
sowie Angaben über Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation!<br />
Vendal. Anwendungsgebiete: Zur Linderung schwerer und schwerster Schmerzen, bei denen andere Analgetika nicht mehr ausreichend sind, z.B. Tumorschmerzen, postoperative Schmerzen. Zusammensetzung: Filmtabletten: 1 Tablette<br />
enthält 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg bzw. 200 mg Morphinhydrochlorid-Trihydrat entsprechend 7.6 mg, 22,79 mg, 45,6 mg, 75,95 mg bzw. 151,90 mg Morphin. Stechampullen: 1 Stechampulle enthält 100 mg bzw. 200 mg Morphin<br />
hydrochlorid trihydrat in 10 ml wässriger Lösung. Orale Lösung: 1 ml Lösung (= 1 Pumpstoß) enthält 5 mg Morphin hydrochlorid trihydrat entsprechend 3,8 mg Morphin. Rapid-Filmtabletten: 1 Filmtablette enthält 10 mg bzw. 20 mg Morphinhydrochlorid,<br />
entsprechend 7,59 mg bzw. 15,19 mg Morphin. Sonstige Bestandteile: Filmtabletten: 1 Filmtablette enthält Lactose-Monohydrat (8 mg, 24 mg, 48 mg, 80 mg bzw. 160 mg), Polyacrylat-Dispersion 30%, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer<br />
(1:1), Ammoniummethacrylat-Copolymer Typ B, Hypromellose 4000, Magnesiumstearat, Macrogol 6000, Talkum, Titandioxid (E171), Hypromellose 5, Silicon-Antischaumemulsion SE2MC. 30 mg: Indigocarmin<br />
Aluminiumlack (E 132), Chinolingelb Aluminiumlack (E 104). 60 mg bzw. 100 mg: Chinolingelb Aluminiumlack (E 104), Gelborange S (0,00128 mg bzw. 0,0332 mg) Aluminiumlack (E 110). 200 mg: Ponceau 4R ( 0,0225 mg) Aluminiumlack<br />
(E 124), Gelborange S (0,01375 mg) Aluminiumlack (E 110). Stechampullen: Wasser, Salzsäure. Orale Lösung: 0,6 mg/ml Kaliumsorbat, Zitronensäuremonohydrat, Orangenaroma (Dragoco Nr. 9696973), Sorbit-Lösung 70% (nicht kristallisierend),<br />
gereinigtes Wasser. Rapid-Filmtabletten: Tablettenkern: Lactose-Monohydrat (95 mg bzw. 90 mg), mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Filmüberzug: Macrogol<br />
6000, Talkum, Titandioxid E 171, Hypromellose, Polyacrylat Dispersion 30%. 200 mg: Lebensmittelfarbstoff „Gelbgrün Pulver Farblack“ E 104/132, Lebensmittelfarbstoff „Indigotin-Lack Pulver Farblack“ E 132. Gegenanzeigen: Filmtabletten,<br />
Stechampullen, orale Lösung und Rapid-Filmtabletten: Bekannte Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; Atemdepression; obstruktive Atemwegserkrankungen; Kopfverletzungen; paralytischer<br />
Ileus; akutes Abdomen; verzögerte Magenentleerung; akute Lebererkrankung; Begleittherapie mit Monoaminoxidase-Hemmern oder innerhalb von zwei Wochen nach deren Absetzen; Filmtabletten, Stechampullen und<br />
Rapid-Filmtabletten: Beeinträchtigung der Schleimsekretion; zerebrale Krampfanfälle; Erregungszustände bei Patienten, die unter Einwirkung von Alkohol oder Schlafmitteln stehen. Filmtabletten und Rapid-Filmtabletten: Die Anwendung<br />
von Vendal retard-Tabletten bzw. Vendal rapid-Filmtabeltten wird während der Schwangerschaft und der Geburt sowie präoperativ oder für die ersten 24 Stunden postoperativ nicht empfohlen. 200 mg Stechampullen: vorangegangene<br />
Opiatabhängigkeit; Säuglinge unter 6 Monaten (verlängerte Morphinclearance). Orale Lösung: Kinder unter einem Jahr. Eine präoperative Verabreichung von Vendal 5 mg/ml-orale Lösung wird nicht empfohlen. Wirkstoffgruppe: Pharmakotherapeutische<br />
Gruppe: Opioide. ATC-Code: N02AA01. Abgabe: SG, apothekenpflichtig. Packungsgrößen: Filmtabletten und Rapid-Filmtabletten: 10 und 30 Stück. Stechampullen: 1x10 ml und 5x10 ml Einstichflaschen klar. Orale<br />
Lösung: 100 ml mit Dosierpumpe 5 mg/ml-orale Lösung. Pharmazeutischer Unternehmer: LANNACHER HEILMITTEL Ges.m.b.H., 8502 Lannach. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung,<br />
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Angaben über Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation!