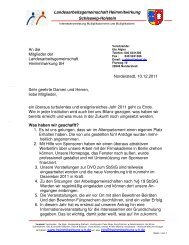Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der ...
Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der ...
Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fünfter <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong>älteren <strong>Generation</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Bundesrepublik DeutschlandPotenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft undGesellschaft – Der Beitrag älterer Menschenzum Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en
Fünfter <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong>älteren <strong>Generation</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Bundesrepublik DeutschlandPotenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft undGesellschaft – Der Beitrag älterer Menschenzum Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>enStellungnahme <strong>der</strong> Bundesregierung
Deutscher Bundestag Drucksache 16/219016. Wahlperiode 6. 7. 2006Unterrichtungdurch die BundesregierungFünfter <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong><strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik DeutschlandPotenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitragälterer Menschen zum Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>enundStellungnahme <strong>der</strong> BundesregierungInhaltsübersichtSeiteStellungnahme <strong>der</strong> Bundesregierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Fünfter <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Potenziale des Alters – E<strong>in</strong>leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Erwerbsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 E<strong>in</strong>kommenslage im Alter und künftige Entwicklung . . . . . . . 1275 Chancen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Deutschland . . . . . . . . . . . 1496 Potenziale des Alters <strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken . . . 1727 Engagement und Teilhabe älterer Menschen . . . . . . . . . . . . . . 1998 Migration und Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft undGesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . 257Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277Zugeleitet mit Schreiben des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 5. Juli 2006 gemäßBeschluss vom 24. Juni 1994 (Bundestagsdrucksache 12/7992).
Stellungnahme <strong>der</strong> Bundesregierung zumFünften <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong><strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/2190Stellungnahme <strong>der</strong> Bundesregierung zum Fünften <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong><strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik DeutschlandInhaltsverzeichnisSeiteA. E<strong>in</strong>leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4B. Potenziale des Alters und Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . 61. Erwerbsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. Familie und private Netzwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. Engagement und Teilhabe älterer Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. E<strong>in</strong>kommenslage im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. Wirtschaftsfaktor Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und Prävention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. Ältere Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Drucksache 16/2190 – 4 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeA. E<strong>in</strong>leitungDer Fünfte Altenbericht ist e<strong>in</strong>e umfassende Darstellung<strong>der</strong> Potenziale älterer Menschen <strong>in</strong> allen zentralen Bereichen<strong>der</strong> Gesellschaft. In <strong>der</strong> vergleichsweise jungen Tradition<strong>der</strong> Altenberichterstattung steht <strong>der</strong> Fünfte Altenberichtdamit als weiterer Gesamtbericht neben früherenGesamt- und Spezialberichten.Der Erste Altenbericht wurde im Jahr 1993 vorgelegt undlieferte erstmals e<strong>in</strong>e umfassende und differenzierteAnalyse <strong>der</strong> Lebenssituation älterer Menschen. Der 1998vorgelegte Zweite Altenbericht behandelt das Schwerpunktthema„Wohnen im Alter“. Mit dem Dritten Altenberichtwurde im Jahr 2001 erneut e<strong>in</strong> Gesamtbericht <strong>zur</strong>Lebenslage älterer Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> BundesrepublikDeutschland verfasst – mit <strong>der</strong> ergänzenden Stellungnahme<strong>der</strong> Bundesregierung liegt zugleich e<strong>in</strong>e Bilanz <strong>der</strong>Altenpolitik und ihrer Perspektiven im soeben begonnenen21. Jahrhun<strong>der</strong>t vor. Der Vierte Altenbericht aus demJahr 2002 ist wie<strong>der</strong>um e<strong>in</strong> Spezialbericht, <strong>der</strong> die Lebensbed<strong>in</strong>gungenund Bedürfnisse e<strong>in</strong>er <strong>in</strong> Zukunft raschweiter wachsenden Gruppe alter Menschen, nämlich <strong>der</strong>über 80-Jährigen behandelt und sich ausführlich mit denAuswirkungen von Hochaltrigkeit und Demenz ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzt.Die Altenberichterstattung fußt auf e<strong>in</strong>em Beschluss desDeutschen Bundestages vom 24. Juni 1994 (Bundestagsdrucksache12/7992), <strong>der</strong> im Zusammenhang mit <strong>der</strong>Debatte über den Ersten Altenbericht für jede Legislaturperiodee<strong>in</strong>en <strong>Bericht</strong> zu e<strong>in</strong>em seniorenpolitischenSchwerpunktthema for<strong>der</strong>t.Die am 21. Mai 2003 berufene, <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är zusammengesetzteFünfte Altenberichtskommission unter Leitungvon Herrn Professor Andreas Kruse hatte den Auftrag,zum Thema „Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft undGesellschaft – Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en“ Erkenntnisse zusammenzutragenund Handlungsempfehlungen zu geben. DieAltenberichtskommission hat während <strong>der</strong> Erarbeitungdes <strong>Bericht</strong>s den Austausch mit <strong>der</strong> parallel arbeitendenFamilienberichts- und <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendberichtskommissiongepflegt, so dass mit dem Siebten Familienbericht,dem Zwölften K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendbericht unddem Fünften Altenbericht e<strong>in</strong> abgerundetes Bild über dieLebenssituation <strong>der</strong> Menschen <strong>in</strong> Deutschland entstandenist.Die elfköpfige Altenberichtskommission hat schon während<strong>der</strong> Erarbeitungsphase <strong>in</strong>tensiv den Dialog mit relevantengesellschaftlichen Akteuren gesucht und dabei anVeranstaltungen mit Seniorenorganisationen sowie mitWirtschaft, Politik und Wissenschaft mitgewirkt.Es wurden geme<strong>in</strong>same Fachtagungen und Workshops zuzentralen Themen des Altenberichts durchgeführt; danebengab es Konsultationen mit den Kirchen. Damit hat dieKommission bereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erarbeitungsphase <strong>in</strong> neuartigerForm e<strong>in</strong>en Beitrag <strong>zur</strong> Neubestimmung <strong>der</strong> Politikfür ältere Menschen im gesellschaftlichen Diskurs geleistet.Für die <strong>Bericht</strong>erstellung standen knapp zwei Jahre <strong>zur</strong>Verfügung. Umso bemerkenswerter ist die sorgfältig recherchierteund außerordentlich fundierte Darlegung zuden Potenzialen des Alters, die auf umfassende Weise aktuelleForschungsergebnisse e<strong>in</strong>bezieht und aufbereitet.Dabei werden alle Themen, die <strong>in</strong> diesem Kontext vonBedeutung s<strong>in</strong>d, wie die Potenziale <strong>in</strong> Familie und an<strong>der</strong>ensozialen Netzwerken, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt und <strong>in</strong> <strong>der</strong>Bildung, <strong>der</strong> Wirtschaftsfaktor Alter, das Engagementund die Partizipation älterer Menschen <strong>in</strong> den Blickgenommen. Der Kommission ist es gelungen, zu e<strong>in</strong>embisher noch wenig aufbereiteten Thema substanzielle Erkenntnissezusammenzutragen. Dabei wird das gesellschaftlicheNegativbild des Alters als Defizit erweitertum den Blick auf die Potenziale älterer Menschen <strong>in</strong>Wirtschaft und Gesellschaft.Altenpolitische Leitl<strong>in</strong>ien im demografischen WandelDer demografische Wandel br<strong>in</strong>gt es mit sich, dass diegesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsaufgabenvon weniger und im Durchschnitt älteren Menschen bewältigtwerden müssen. Die Potenziale älterer Menschenmüssen daher deutlich stärker als bisher genutzt werden.In <strong>der</strong> Öffentlichkeit wird allerd<strong>in</strong>gs mit dem demografischenWandel vielfach noch e<strong>in</strong>e verkürzte Debatte überdie sozialen Sicherungssysteme verbunden. Das zeigt,dass unser Bild des Alters erneuerungsbedürftig ist. Altse<strong>in</strong> heißt nicht mehr <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie hilfe- und pflegebedürftigse<strong>in</strong>. Die heutigen Senior<strong>in</strong>nen und Senioren s<strong>in</strong>dim Durchschnitt gesün<strong>der</strong>, besser ausgebildet und vitalerals frühere <strong>Generation</strong>en. Die Bundesregierung hat deshalbbewusst den Schwerpunkt des von ihr <strong>in</strong> Auftrag gegebenenAltenberichts auf die Potenziale älterer Menschengelegt. Sie begrüßt ausdrücklich, dass <strong>der</strong> FünfteAltenbericht die Stärken des Alters hervorhebt und dieChancen aufzeigt, die mit dem demografischen Wandele<strong>in</strong>hergehen. Die Bundesregierung sieht es als grundlegendesZiel <strong>der</strong> Altenpolitik, die Entwicklung und Verankerunge<strong>in</strong>es neuen Leitbildes des Alters voranzutreiben.Das von <strong>der</strong> Kommission vermittelte revidierte Altersbildist e<strong>in</strong>e hilfreiche Basis für die Weiterentwicklung undGestaltung <strong>der</strong> Altenpolitik.Der Anteil jener älteren Menschen, die über wertvolle Erfahrungen,über reichhaltiges Wissen und über beruflicheKompetenzen verfügen, hat sich im Vergleich zu früherdeutlich erhöht. Dieser Reichtum an Erfahrungswissendarf auch im Interesse des e<strong>in</strong>zelnen Menschen selbstnicht vernachlässigt werden. Die Kommission machtdeutlich, dass unsere Gesellschaft auf die Potenziale Älterer,die damit auch e<strong>in</strong>en bedeutenden Beitrag <strong>zur</strong> Solidaritätzwischen den <strong>Generation</strong>en leisten, nicht verzichtenkann – we<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt noch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wirtschafto<strong>der</strong> im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.Welche Konsequenzen Politik und gesellschaftliche Akteureaus <strong>der</strong> demografischen Entwicklung ziehen und obsie bestehende Chancen auch tatsächlich nutzen, wirdmaßgeblich darüber entscheiden, ob unser Land dendurch Globalisierung, Strukturwandel und <strong>in</strong>ternationalenWettbewerb gestellten Herausfor<strong>der</strong>ungen gewachsen ist
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 5 – Drucksache 16/2190und die erfor<strong>der</strong>liche Fähigkeit zu Innovation besitzt.Dazu bedarf es e<strong>in</strong>es Altersbildes, das die Fähigkeitenund Stärken älterer Menschen betont und dazu beiträgt,dass diese gefragt s<strong>in</strong>d, mit ihrer Kompetenz und ihrer Erfahrunge<strong>in</strong>en anerkannten Beitrag <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaftzu leisten.Fünf Leitbil<strong>der</strong> hat die Kommission ihrem <strong>Bericht</strong> vorangestellt:Mitverantwortung, Alter als Motor für Innovation,Nachhaltigkeit und <strong>Generation</strong>ensolidarität, LebenslangesLernen und Prävention. Die Bundesregierung siehtes als grundlegendes Ziel <strong>der</strong> Altenpolitik an, die Entwicklungund Verankerung e<strong>in</strong>es neuen Leitbildes des Altersvoranzutreiben. Sie unterstützt deshalb die Ansicht<strong>der</strong> Sachverständigen, dass ältere Menschen viel stärkerals aktive und kompetente Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger angesprochenwerden müssen. Sie begrüßt das von <strong>der</strong> Kommissionvermittelte revidierte Altersbild als hilfreiche Basisfür die Weiterentwicklung und Gestaltung <strong>der</strong>Altenpolitik. Die Bundesregierung dankt <strong>der</strong> Expertenkommissionfür ihren überaus detaillierten und wissenschaftlichfundierten <strong>Bericht</strong>, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en komprimiertenSchatz an Erkenntnissen und Handlungsanregungen füralle bereit hält, die sich <strong>in</strong> Politik, Wissenschaft und Gesellschaftim S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er zukunftsfähigen Altenpolitik engagieren.Die Folgen des demographischen Wandels s<strong>in</strong>d gestaltbar.Sie bergen Chancen für Wachstum, Beschäftigungund gesellschaftliche Entwicklung. Diese Chancen greiftdie Bundesregierung <strong>in</strong> allen Politikfel<strong>der</strong>n auf. Für dieBundesregierung ist die Soziale Marktwirtschaft <strong>der</strong> geeigneteRahmen, um den wirtschaftspolitischen Herausfor<strong>der</strong>ungendes demografischen Wandels zu begegnen.Die Soziale Marktwirtschaft för<strong>der</strong>t Wettbewerb, Kreativität,Leistung und Eigen<strong>in</strong>itiative im Interesse desE<strong>in</strong>zelnen und des Ganzen und ist damit zugleich die materielleBasis für soziale Sicherheit und ökologischeNachhaltigkeit. E<strong>in</strong>en beson<strong>der</strong>en Stellenwert <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ungvon Wachstum und Beschäftigung haben neben denwirtschaftspolitischen auch die familienpolitischen undseniorenpolitischen Maßnahmen.Entscheidend ist die För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>es selbstständigen undselbst bestimmten Lebens bis <strong>in</strong>s hohe Alter. Dafür mussPolitik die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen schaffen.Da <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>jenigen, die bis <strong>in</strong>s hohe Alter aktiv undmobil s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> den nächsten Jahren weiter zunehmen wird,müssen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e neue Möglichkeiten eröffnet werden,um die Potenziale, Fähigkeiten und Kompetenzen ältererMenschen <strong>in</strong> allen gesellschaftlichen Bereichen stärkere<strong>in</strong>beziehen zu können. Gerade ältere Menschenhaben Fachwissen, berufliche Erfahrung und dank ihresAlters auch mehr Lebenserfahrung als Jüngere. Die meistenÄlteren haben auch e<strong>in</strong>e positive E<strong>in</strong>stellung zum eigenenAlter und s<strong>in</strong>d gleichzeitig ke<strong>in</strong>eswegs an e<strong>in</strong>emRückzug aus <strong>der</strong> Gesellschaft <strong>in</strong>teressiert. Viele s<strong>in</strong>d zue<strong>in</strong>er Fortsetzung ihres Engagements <strong>in</strong> Beruf, Wirtschaftund Gesellschaft bereit. Diese älteren Menschen sehen <strong>in</strong>ihrem Engagement auch e<strong>in</strong>en Gew<strong>in</strong>n für sich selbst –über e<strong>in</strong> höheres Selbstwertgefühl und größere gesellschaftlicheAnerkennung. Die Bundesregierung för<strong>der</strong>tdie Möglichkeiten e<strong>in</strong>es freiwilligen Engagements ältererMenschen, zum Beispiel durch die Initiierung und För<strong>der</strong>unggenerationenübergreifen<strong>der</strong> Freiwilligendienste füralle Altersgruppen. Der Lebensabschnitt <strong>der</strong> „gewonnenenJahre“ wird so <strong>zur</strong> Bereicherung für alle. Dies macht<strong>der</strong> Fünfte Altenbericht deutlich.Auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt gilt es, die Erfahrungen ältererArbeitnehmer stärker zu nutzen. Von den 55- bis 64-jährigens<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Deutschland u. a. als Folge <strong>der</strong> Frühverrentungspraxis<strong>der</strong>zeit nur rd. 41 Prozent erwerbstätig. DieEuropäische Beschäftigungsstrategie erwartet von denMitgliedstaaten bis 2010 e<strong>in</strong>e Erwerbsquote älterer Menschenvon m<strong>in</strong>destens 50 Prozent. Die Bundesregierunghat bereits Fehlanreize für e<strong>in</strong> frühes Ausscheiden ältererArbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmer aus dem Arbeitslebenabgebaut und positive Anreize für Arbeitgeber geschaffen,ältere Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter zubeschäftigen. Daneben wird sie e<strong>in</strong>e gesellschaftliche Debatteüber die Potenziale älterer Menschen anstoßen, <strong>in</strong><strong>der</strong>en Mittelpunkt e<strong>in</strong> Leitbild des produktiven Alterssteht. Leistungsfähigkeit, Kreativität und Innovationskrafts<strong>in</strong>d auch jenseits <strong>der</strong> Lebensmitte vorhanden.Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass die För<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer stärker <strong>in</strong> den Blick genommenwerden muss. Lebenslanges Lernen ist <strong>in</strong> unserer Informationsgesellschaftauch für ältere Menschen von großerBedeutung. Lebenslange Bildungsangebote und Bildungsaktivitätenför<strong>der</strong>n die Beschäftigungsfähigkeit ältererArbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmer und tragensomit zu e<strong>in</strong>er Erhöhung des Wirtschaftswachstums bei.Die Bundesregierung begrüßt, dass <strong>der</strong> Fünfte Altenberichtdem Thema „Potenziale des Alters <strong>in</strong> Familie undprivaten Netzwerken“ e<strong>in</strong> Kapitel gewidmet hat.Nie zuvor haben <strong>in</strong> Familien so viele <strong>Generation</strong>engleichzeitig mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gelebt und das <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gutenKlima des generationenübergreifenden Zusammenhalts.Die Bundesregierung hat e<strong>in</strong>en deutlichen Schwerpunktim Bereich <strong>der</strong> Familienpolitik gesetzt und hierbei e<strong>in</strong>enPolitikwechsel e<strong>in</strong>geleitet: Für die notwendige Neugestaltungdes Verhältnisses zwischen Lebensphasen undLebensbereichen verfolgt die Bundesregierung e<strong>in</strong>e Zeitpolitik,die Optionen für mehr Flexibilität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsarbeit,Familienarbeit, Sozial- und Bildungszeit fürFrauen und Männer schafft. Im Alltag und im Lebenslaufsollen Großeltern, <strong>der</strong>en K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> mehrZeit füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong> haben.Die Bundesregierung stimmt <strong>der</strong> Altenberichtskommissiondar<strong>in</strong> zu, dass bürgerschaftliches Engagement e<strong>in</strong>tragendes Element des Zusammenhalts <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>endarstellt. Sie sieht ebenso wie die Altenberichtskommissionund die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages„Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“die Notwendigkeit, för<strong>der</strong>liche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen fürfreiwilliges Engagement im Alter und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e e<strong>in</strong>edas Engagement unterstützende Infrastruktur zu schaffen.Die Bundesregierung setzt <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungvon Mehrgenerationenhäusern e<strong>in</strong>en besonde-
Drucksache 16/2190 – 6 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperio<strong>der</strong>en Schwerpunkt. Mehrgenerationenhäuser verstärken <strong>in</strong>neuer Art Infrastruktur, die die Gesellschaft zusammenhält.Sie sollen dazu beitragen, K<strong>in</strong><strong>der</strong> gut zu för<strong>der</strong>n, Eltern<strong>in</strong> <strong>der</strong> Erziehung zu unterstützen, e<strong>in</strong>e Plattform fürfamiliennahe Dienstleistungen zu schaffen und dem Zusammenhalt<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en auch außerhalb des Familienverbandeszu stärken.Die Bundesregierung setzt auf neue, strategische Partnerschaftenund bürgerschaftliches Engagement als Ergänzungbereits bestehen<strong>der</strong> professioneller Dienste.Ältere Menschen leisten mit ihrer Kaufkraft e<strong>in</strong>en wichtigenBeitrag zu Wachstum und Beschäftigung. Die Nachfragenach Produkten und Dienstleistungen für ältereMenschen wird <strong>in</strong> den nächsten Jahren weiter zunehmen,da sie e<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung für e<strong>in</strong> selbstbestimmtesund selbstständiges Leben im Alter s<strong>in</strong>d und dieLebensqualität verbessern. Ältere Menschen verfügenzum Teil nicht nur über sehr gute f<strong>in</strong>anzielle Ressourcenson<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d auch bereit, für verbesserte Angebote mehrGeld auszugeben. Die ältere <strong>Generation</strong> kann durch ihreKaufkraft, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> haushaltsnahenDienstleistungen, zu mehr Wachstum und Beschäftigungbeitragen.Wichtig für e<strong>in</strong> selbstständiges Leben bis <strong>in</strong>s hohe Alterist <strong>der</strong> Bereich des Wohnens. Mehr als 80 Prozent <strong>der</strong> Älterenwollen so lange als möglich – auch im Fall vonHilfe- o<strong>der</strong> Betreuungsbedürftigkeit – <strong>in</strong> ihrer Wohnungbleiben. Für Wohnzwecke verwenden Seniorenhaushaltezwischen 34 und 41 Prozent ihrer Konsumausgaben –verglichen mit rund 32 Prozent im Durchschnitt allerHaushalte. Ziel <strong>der</strong> Bundesregierung ist es darauf h<strong>in</strong>zuwirken,dass neue, kle<strong>in</strong>teilige und quartierbezogene undteils auch generationenübergreifende Wohnformen geschaffenwerden, die Chancen für e<strong>in</strong> selbstständiges Leben<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft bieten.Die Bundesregierung ist wie die Altenberichtskommission<strong>der</strong> Auffassung, dass <strong>der</strong> Gesundheitszustand bis <strong>in</strong>ssehr hohe Alter durch die Reduzierung bzw. Beseitigungvon Risikofaktoren sowie durch e<strong>in</strong>e gesunde Ernährungund e<strong>in</strong> ausreichendes Maß an körperlicher Bewegunggeför<strong>der</strong>t werden kann. Sie sieht daher die Notwendigkeit,den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälftegezielte Informationen über gesunde Ernährung,körperliche Betätigung, Stressbewältigung, dieRisiken des Rauchens und e<strong>in</strong>es übermäßigen Alkoholkonsumszu geben und damit die Eigenverantwortungund Kompetenz zu stärken. Das Bundesm<strong>in</strong>isterium fürGesundheit (BMG) hat hierzu e<strong>in</strong>e Reihe von Maßnahmen,Projekten und Kampagnen aufgelegt. E<strong>in</strong>e nachhaltigeGesundheitspolitik und e<strong>in</strong>e betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ungs<strong>in</strong>d überdies stützende Maßnahmen,Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmern Gesundheit undBeschäftigungsfähigkeit bis <strong>in</strong>s Alter zu sichern.Die Bundesregierung begrüßt es, dass sich die Kommissionbei allen ihren Betrachtungen auch <strong>der</strong> älteren Migrantenbevölkerungzugewandt und spezifische Themenüberdies <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigenen Kapitel behandelt hat. Die Anfor<strong>der</strong>ungenan die Integrationspolitik haben sich imLaufe <strong>der</strong> letzten fünf Jahrzehnte entscheidend gewandelt.Die Integration von rechtmäßig und dauerhaft <strong>in</strong>Deutschland lebenden Zuwan<strong>der</strong>ern gehört zu denSchwerpunktaufgaben <strong>der</strong> Bundesregierung. Dabei setztsich immer stärker die Erkenntnis durch, dass Integrationsbelangee<strong>in</strong>e Vielzahl von Politikbereichen durchdr<strong>in</strong>genund als gesamtgesellschaftliches Anliegen vonunterschiedlichen Akteuren wahrgenommen und geför<strong>der</strong>twerden müssen. Das Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetz ermöglichtden E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e systematische Integrationspolitik,die diesem Leitgedanken folgt. Der Koalitionsvertragunterstreicht die Bedeutung des Dialogs mit Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten als wichtigen Bestandteil von Integrationspolitikund politischer Bildung. Neben dem Dialogzu religionsspezifischen Fragen bemüht sich das Bundesm<strong>in</strong>isteriumdes Innern (BMI) dabei auch um e<strong>in</strong>en Dialogmit Migrantenorganisationen zu allgeme<strong>in</strong>en Fragen<strong>der</strong> Integrations- und Migrationspolitik.B. Potenziale des Alters undHandlungsempfehlungen1. ErwerbsarbeitDie Bundesregierung stimmt ohne E<strong>in</strong>schränkung <strong>der</strong>Kommission zu, die nachdrücklich die Potenziale ältererMenschen als Arbeitskräfte hervorhebt und die <strong>in</strong>Deutschland lange verbreitete Auffassung entkräftet, beiälteren Beschäftigten ließen Leistungskraft und Belastbarkeitnach. Verbunden mit häufig praktizierten Frühverrentungenführte diese Fehle<strong>in</strong>schätzung dazu, dass vergleichsweisewenige Menschen über 55 Jahren noch imErwerbsleben stehen. Nur 41 Prozent <strong>der</strong> Deutschen imAlter zwischen 55 und 64 Jahren s<strong>in</strong>d <strong>der</strong>zeit erwerbstätig.Von dem <strong>in</strong> Stockholm 2001 von den EU-Staaten beschlossenZiel, dass bis zum Jahr 2010 <strong>in</strong> jedem EU-Mitgliedslanddie Hälfte <strong>der</strong> 55-bis 64-Jährigen erwerbstätigse<strong>in</strong> sollte, ist die Bundesrepublik Deutschland damitnoch um E<strong>in</strong>iges entfernt. E<strong>in</strong>e solche Entwicklung kannnicht länger fortgeschrieben werden; denn es werdenmaßgeblich auch die Älteren se<strong>in</strong>, die sich <strong>in</strong> die gesellschaftlichenund wirtschaftlichen Zukunftsaufgaben e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>genmüssen.Die Bundesregierung unternimmt alle Anstrengungen,um hier Verbesserungen zu erzielen. Neben Än<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> rechtlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen muss vor allem e<strong>in</strong>neues Bild des Alters <strong>in</strong>s öffentliche Bewusstse<strong>in</strong> gerufenwerden. Zutreffend weist die Kommission darauf h<strong>in</strong>,dass die Leistungspotenziale älterer Menschen nicht angemessenwahrgenommen werden, und dass damit e<strong>in</strong>hergehenddie Chancen, diese Potenziale gesellschaftlichstärker nachzufragen, nicht h<strong>in</strong>reichend genutzt werden.Die Bundesregierung hat deshalb mit ihrer bereits angelaufenenInitiative „Erfahrung ist Zukunft“ e<strong>in</strong>en gesellschaftlichenDiskurs angeschoben, <strong>der</strong> die Chancen <strong>der</strong>älter werdenden Gesellschaft beleuchten und e<strong>in</strong> neuesBild vom Alter vermitteln soll. E<strong>in</strong> Schwerpunkt <strong>der</strong> füre<strong>in</strong>e Beteiligung von Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaftund Gesellschaft offenen Initiative ist das Themenfeld„Beschäftigung im Alter“.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 7 – Drucksache 16/2190Erwerbsbeteiligung älterer MenschenDie Bundesregierung begrüßt die umfassende Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungmit <strong>der</strong> Beschäftigungssituation älterer Menschenim Fünften Altenbericht. Sie teilt die E<strong>in</strong>schätzung<strong>der</strong> Kommission, dass Anreize <strong>zur</strong> Frühverrentung beseitigtund Maßnahmen zum Erhalt und <strong>zur</strong> Verbesserung<strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen auf denWeg gebracht werden müssen.Das Maßnahmenpaket <strong>der</strong> Bundesregierung bezieht sichauf drei vordr<strong>in</strong>gliche Aktionsfel<strong>der</strong>:– Verbesserung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungschancen durch aktiveFör<strong>der</strong>ung;– Beschäftigungsstabilisierung durch Abbau von Fehlanreizen,d. h. <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Fortschreibung <strong>der</strong> Maßnahmen<strong>zur</strong> Beseitigung von Anreizen <strong>zur</strong> Frühverrentung;– Abbau von Vorurteilen h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Qualifikation,Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit von Älteren.Der komplexen Fragestellung „Beschäftigungssituationälterer Menschen“ kann allerd<strong>in</strong>gs nicht alle<strong>in</strong>e dadurchbegegnet werden, dass „Vorruhestandsanreize“ beseitigtund das Rentene<strong>in</strong>trittsalter erhöht werden, auch wenndiese beiden von <strong>der</strong> Bundesregierung verfolgten Maßnahmenfür sich genommen sehr wichtig s<strong>in</strong>d. Die Koalitionsparteienhaben daher ebenfalls deutlich gemacht,dass die geplante schrittweise Anhebung <strong>der</strong> Regelaltersgrenzeauf 67 Jahre e<strong>in</strong>e nachhaltige Verbesserung <strong>der</strong>Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen undArbeitnehmer notwendig macht. Die Bundesregierungwird daher den rechtlichen Rahmen für e<strong>in</strong>e Erhöhung<strong>der</strong> Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen undArbeitnehmer verbessern.In Anbetracht <strong>der</strong> Tatsache, dass die Verbesserung <strong>der</strong>Beschäftigungslage <strong>der</strong> Älteren nicht nur e<strong>in</strong>e Aufgabe<strong>der</strong> Politik ist, ist es zu begrüßen, dass die Kommissionnicht nur die Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik analysiert,son<strong>der</strong>n auch die Ausgestaltung von Tarifverträgen– Aufgabe <strong>der</strong> Sozialpartner – sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verantwortung<strong>der</strong> Unternehmer liegende betriebliche Aktivitätenbeleuchtet.Der Kommission ist auch dar<strong>in</strong> zuzustimmen, dass alleMaßnahmen <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Beschäftigungsquote Ältererletztlich nur greifen werden, wenn die Wirtschaftwächst und e<strong>in</strong>e steigende Arbeitskräftenachfrage dieMotivationslage <strong>der</strong> Betriebe und <strong>der</strong> Beschäftigten verän<strong>der</strong>t,die bisher vielfach e<strong>in</strong>er Weiterbeschäftigung Ältererentgegensteht. Auch wenn sich die Perspektiven fürdie deutsche Wirtschaft zu Beg<strong>in</strong>n des Jahres 2006 aufhellen,muss die Investitionstätigkeit <strong>in</strong> Deutschlandweiter verstärkt und <strong>der</strong> immer noch schwache privateKonsum wie<strong>der</strong> belebt werden. Daher wird die Bundesregierung<strong>in</strong> dieser Legislaturperiode mit e<strong>in</strong>em Gesamtvolumenvon rd. 25 Milliarden Euro konkrete Impulse <strong>in</strong>fünf zentralen Bereichen für mehr Wachstum, Beschäftigungund Innovation setzen.Auch die „Initiative 50 plus“ <strong>der</strong> Bundesregierung wirde<strong>in</strong>en grundlegenden Beitrag dazu leisten, die ChancenÄlterer am Arbeitsmarkt zu verbessern. Die vom Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend(BMFSFJ) <strong>in</strong>itiierte Studie „Erfahrung rechnetsich“ soll ergänzend mit ökonomisch harten Argumentenbelegen, dass es sich für Unternehmen wirtschaftlich„rechnet“ und sie langfristig im Wettbewerb besser aufgestellts<strong>in</strong>d, wenn sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er altersgemischten Belegschaftauch ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenbeschäftigen.Die Sachverständigenkommission stellt auch fest, dassdie deutschen Tarifverträge viele Vere<strong>in</strong>barungen im H<strong>in</strong>blickauf das Lebensalter enthalten und empfiehlt den Tarifpartnern,künftig passive Schutzregeln für Ältere durchVere<strong>in</strong>barungen zu e<strong>in</strong>er präventiven För<strong>der</strong>ung zu ergänzenund <strong>in</strong> neu auszuhandelnden Tarifverträgen die BereicheQualifizierung und Weiterbildung, Gesundheitsschutzund Gesundheitsför<strong>der</strong>ung, Arbeitsorganisation sowieflexible Lebensarbeitszeiten zu berücksichtigen.Auch die Bundesregierung sieht die Tarifpartner <strong>in</strong> <strong>der</strong>Verantwortung. Der Koalitionsvertrag weist darauf h<strong>in</strong>,dass <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Beschäftigung Älterer auf tariflicherund betrieblicher Ebene präventive Elemente stärkerausgebaut werden müssen. Er identifiziert Handlungsbedarfim Bereich <strong>der</strong> altersgerechten Arbeitszeitgestaltungund beim Ausbau <strong>der</strong> gleitenden Übergänge <strong>in</strong> den Ruhestand.Erwerbsbeteiligung von FrauenDer <strong>Bericht</strong> zeigt bei <strong>der</strong> Erwerbsquote <strong>der</strong> 55- bis 64-jährigenFrauen zwar für die letzten Jahre e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>genAnstieg (2,2 Prozent) an; nach wie vor ist die Erwerbsquotevon Frauen <strong>in</strong> dieser Altersgruppe jedoch mit33,5 Prozent im Vergleich zu den Männern <strong>in</strong> Höhe von52,4 Prozent (Angaben für das Jahr 2000) recht ger<strong>in</strong>g.Die <strong>in</strong> den vergangenen Jahrzehnten <strong>in</strong> <strong>der</strong> ehemaligenBundesrepublik allgeme<strong>in</strong> eher kritische gesellschaftlicheBewertung von Müttererwerbstätigkeit verbunden mitknappen K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungsangeboten haben die Erwerbsbiographienälterer Frauen bee<strong>in</strong>flusst. Folgen warenfehlende o<strong>der</strong> gem<strong>in</strong><strong>der</strong>te Erwerbsorientierung, e<strong>in</strong>geschränktesArbeitszeitvolumen, fehlende o<strong>der</strong> unterbrocheneErwerbsbiographien und damit verbunden ger<strong>in</strong>geeigene Rentenansprüche und Altersarmut.In den vergangenen Jahren ist die Frauenerwerbstätigkeit<strong>in</strong> Deutschland jedoch stetig gestiegen. Während nachAngaben des Statistischen Amtes <strong>der</strong> Europäischen Geme<strong>in</strong>schaften(Eurostat) im Jahr 1993 <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> erwerbstätigenFrauen an <strong>der</strong> weiblichen Bevölkerung imAlter von 15 bis 64 Jahren noch bei 55,1 Prozent lag, beliefer sich im Jahr 2005 bereits auf 59,6 Prozent (Männer:71,2 Prozent). Damit hat Deutschland das Ziel <strong>der</strong>Lissabon-Strategie, bis zum Jahr 2010 e<strong>in</strong>e Frauenerwerbstätigenquotevon m<strong>in</strong>destens 60 Prozent zu erreichen,schon jetzt nahezu erreicht.Die Bundesregierung ist bestrebt, die Rahmenbed<strong>in</strong>gungenfür die Erwerbsbeteiligung von Frauen weiter zu
Drucksache 16/2190 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeverbessern. Sie hat hierzu bereits e<strong>in</strong>e Vielzahl von Maßnahmene<strong>in</strong>geleitet, die auf die Erhöhung des Beschäftigtenanteilsvon Frauen <strong>in</strong>sgesamt und auf die Steigerungihres Anteils <strong>in</strong> zukunftsorientierten Berufen und <strong>in</strong> Führungspositionenabzielen.Wesentliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für e<strong>in</strong>e gleichberechtigteTeilhabe von Frauen und Männern am Erwerbslebens<strong>in</strong>d die För<strong>der</strong>ung Existenz sichern<strong>der</strong> Erwerbstätigkeitsowie e<strong>in</strong> bedarfsgerechtes Angebot an K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungsplätzen,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für die unter Dreijährigen.Gleiches gilt für die Tagespflege als Alternative, die Stärkungvon Initiativen <strong>zur</strong> betrieblich unterstützten K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungund den Ausbau von Ganztagsschulen. E<strong>in</strong>estärkere steuerrechtliche Berücksichtigung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungskosten– wie sie mit dem rückwirkend zum 1. Januar2006 <strong>in</strong> Kraft getreten ist – wird daneben <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eerwerbstätige Mütter und Väter <strong>in</strong> erheblichemMaße f<strong>in</strong>anziell entlasten.Mit <strong>der</strong> „Vere<strong>in</strong>barung zwischen <strong>der</strong> Bundesregierungund den Spitzenverbände <strong>der</strong> deutschen Wirtschaft <strong>zur</strong>För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Chancengleichheit von Frauen und Männern<strong>in</strong> <strong>der</strong> Privatwirtschaft“, die <strong>in</strong> regelmäßigen Abständenbilanziert wird, ist e<strong>in</strong> weiterer wichtiger Schritt<strong>zur</strong> Gleichstellung von Frauen und Männern <strong>in</strong> <strong>der</strong> Privatwirtschaftvollzogen worden. Die Spitzenverbände <strong>der</strong>deutschen Wirtschaft haben sich damit erstmals zu e<strong>in</strong>eraktiven Gleichstellungspolitik verpflichtet. Der von <strong>der</strong>Bundesregierung jährlich durchgeführte Aktionstag„Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag“ soll überdies dieOrientierung von Mädchen und jungen Frauen auf technikorientierteund vielfach besser bezahlte Berufe erhöhen.Zielgenaue Informationen über Beruf und Karriere sowiee<strong>in</strong>e bessere Vernetzung von Frauen bietet auch das mitBundesmitteln geför<strong>der</strong>te Internet-Portal „Beruf und Karrierefür Frauen“.Auch unterstützt die Bundesregierung das Audit „berufund familie“ <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>nützigen Hertie-Stiftung. Es istdas strategische Management<strong>in</strong>strument <strong>zur</strong> besserenVere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und Familie, welches konsequentauf die passgenaue, <strong>in</strong>dividuelle Umsetzung vonpraktischen Maßnahmen, z. B. flexible Arbeitszeitgestaltung,im Unternehmen abzielt. E<strong>in</strong>ige Bundesm<strong>in</strong>isteriens<strong>in</strong>d bereits als familienfreundliche E<strong>in</strong>richtungen zertifiziertund dienen zusammen mit den Spitzenverbänden <strong>der</strong>Deutschen Wirtschaft als Multiplikatoren und Vorbil<strong>der</strong>e<strong>in</strong>er familienbewussten Personalpolitik, die auch zu e<strong>in</strong>erhöheren Erwerbsbeteiligung von Frauen beiträgt.Verbesserung <strong>der</strong> Erwerbssituationschwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter PersonenDie Bundesregierung teilt die E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Kommission,dass die Beschäftigungssituation schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>terPersonen verbessert werden muss. Die Kommission empfiehlthierzu die Prüfung, <strong>in</strong>wiefern die gegenwärtige Arbeitsmarktpolitikum jene För<strong>der</strong>maßnahmen für schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschen ergänzt werden könnte, die sich <strong>in</strong><strong>der</strong> Initiative „50 000 Jobs für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te“ bewährthaben.Die Bundesregierung hat nach Beendigung <strong>der</strong> Aktion„50 000 Jobs für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te“ im Oktober 2002diese evaluiert. Der sich ergebende Handlungsbedarf istdurch das „Gesetz <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ausbildung und Beschäftigungschwer beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen“ vom 23. April2004 umgesetzt worden. Die Initiative „job – Jobs ohneBarrieren“, die <strong>in</strong> den Jahren 2004 bis 2006 durchgeführtwird, berücksichtigt, dass die Ausbildungs- und Beschäftigungssituationschwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen sowie diebetriebliche Prävention durch Än<strong>der</strong>ung gesetzlicher Regelungenalle<strong>in</strong> nicht verbessert wird. Durch Projekte undAktivitäten im Rahmen <strong>der</strong> Initiative „job – Jobs ohneBarrieren“ werden daher beispielhaft die rechtlichen Regelungen<strong>zur</strong> Teilhabe beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter und schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>terMenschen am Arbeitsleben umgesetzt.Die Koalitionsparteien haben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Koalitionsvere<strong>in</strong>barungdeutlich gemacht, dass die Initiative „job – Jobsohne Barrieren“ fortgesetzt werden soll. Ferner sollen beh<strong>in</strong><strong>der</strong>teMenschen öfter die Möglichkeit erhalten, außerhalbvon Werkstätten für beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschen ihren Lebensunterhaltim allgeme<strong>in</strong>en Arbeitsmarkt erarbeiten zukönnen. Auch bei den E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungszuschüssen an Arbeitgebernwird geprüft, welcher konkrete Neuregelungsbedarffür e<strong>in</strong>e dauerhafte Integration von beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenArbeitnehmern <strong>in</strong> Beschäftigung bestehtSchaffung e<strong>in</strong>er demografiesensiblenUnternehmenskulturDie Empfehlung <strong>der</strong> Kommission, <strong>zur</strong> Schaffung e<strong>in</strong>erdemografiesensiblen Unternehmenskultur beizutragen,wird bereits umgesetzt. Die Bundesregierung will <strong>zur</strong>Verbesserung <strong>der</strong> Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer mit den Sozialpartnernzu Fragen <strong>der</strong> Qualifizierung Älterer, des Erhalts und <strong>der</strong>Verbesserung <strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit, <strong>der</strong> altersgerechtenArbeitszeitgestaltung und zu den Möglichkeiten<strong>der</strong> Arbeitsför<strong>der</strong>ung Absprachen treffen.Die Schaffung e<strong>in</strong>er demografiesensiblen Unternehmenskulturwird auch durch die „Initiative Neue Qualität <strong>der</strong>Arbeit“ (INQA) unterstützt. Darüber h<strong>in</strong>aus führenUnternehmen nach § 84 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch(SGB IX) e<strong>in</strong> betriebliches E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsmanagementdurch, um die Leistungsfähigkeit <strong>der</strong>Beschäftigten langfristig zu erhalten.Zu den Konsequenzen des demografischen Wandels fürUnternehmen und Arbeitswelt wurden im Initiativkreis„30, 40, 50plus – Älterwerden <strong>in</strong> Beschäftigung“ folgendeHandlungsfel<strong>der</strong> identifiziert:– Gesundheit – Arbeitsfähigkeit für alle Altergruppenbis <strong>zur</strong> Rente gewährleisten;– Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung – nicht nurdie Arbeitsplätze, son<strong>der</strong>n auch die Arbeit selbst alternsgerechtgestalten;– Qualifikation, Weiterbildung und lebensbegleitendesLernen – betrieblich relevante Wissensbestände kont<strong>in</strong>uierlicherneuern;– Führung – Unternehmenskultur an e<strong>in</strong>em Mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong><strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en orientieren;
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 9 – Drucksache 16/2190– Demografiegerechte Personal- und Rekrutierungspolitik– Personalarbeit muss sich rechtzeitig <strong>der</strong> altersstrukturellenHerausfor<strong>der</strong>ung stellen.Durch die Kampagne „30, 40, 50plus – Gesund arbeitenbis <strong>in</strong>s Alter“ wurden die Unternehmen zunächst auf ihreMöglichkeiten aufmerksam gemacht, was sie tun können,um mit e<strong>in</strong>er künftig älteren Belegschaft wettbewerbsfähigzu bleiben.„Das Demografie-Netzwerk“, kurz: ddn, von INQAwurde im März 2006 gegründet und lädt Unternehmerdazu e<strong>in</strong>, den anstehenden Herausfor<strong>der</strong>ungen offensiv zubegegnen. Die Netzwerkunternehmen werden demThema „demografischer Wandel“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wirtschaft mehrGewicht verleihen und durch eigene Projekte an<strong>der</strong>e Unternehmensensibilisieren und zu gestalterischen Maßnahmenim S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er alternsgerechten Personalpolitik anregen.Sie haben sich auf dem INQA-Know-how-Kongress„Demografie als Chance“ am 29. November 2005 bereitsvor <strong>der</strong> Netzwerkgründung 10 goldene Regeln für demografiefesteUnternehmen gegeben: Altersneutrale Rekrutierung,altersneutrale Personalauswahl, altersneutralePersonalplanung, altersneutrale <strong>in</strong>nerbetriebliche Beför<strong>der</strong>ungund Arbeitsplatzwechsel. altersneutrale Lern-,Fort- und Weiterbildungsangebote, Vorruhestandsregelungenvermeiden, altersgerechte Arbeitsplatzgestaltungund betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung, altersneutralesMite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>, beschäftigungsför<strong>der</strong>liche Arbeitszeit- undVergütungsmodelle, neue Perspektiven für Ältere.Durch die Entwicklung e<strong>in</strong>es Demografie-Panels erhaltendie Netzwerkteilnehmer die Möglichkeit e<strong>in</strong>es Demografie-Benchmark<strong>in</strong>gs.Es wird e<strong>in</strong> „Handbuch Demografie –Handlungsleitfaden für e<strong>in</strong>e alternsgerechte Organisationskulturund Personalpolitik“ für die betrieblicheEbene erarbeitet, das sowohl Personalverantwortlichen,Betriebsräten und Führungskräften praxisnahe Informationenbereitstellen als auch betriebliche Berater (z. B.Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Arbeitsmediz<strong>in</strong>er, Unternehmensberater)ansprechen soll.Im Rahmen des Projektes „DemoKomp – Kompetenz fürden demografischen Wandel“ s<strong>in</strong>d bereits <strong>in</strong> vier Arbeitspaketenverschiedene Produkte und Dienstleistungen entstanden,die als komplettes Dienstleistungspaket den Unternehmen<strong>zur</strong> Bewältigung des demografischen Wandels<strong>zur</strong> Verfügung stehen.Die e<strong>in</strong>zelnen Produkte– Unternehmens-Check <strong>zur</strong> demografischen Standortbestimmung,– problemorientierte Beratung,– Qualifizierung von Demografie-Beratern/Berater<strong>in</strong>nen,– Interviewleitfaden <strong>zur</strong> Kompetenzanalyse älterer Führungskräftef<strong>in</strong>den <strong>der</strong>zeit bundesweit Verbreitung und werden vonden Projektpartnern kont<strong>in</strong>uierlich weiterentwickelt und<strong>in</strong> ihrer Anwendung und Praxistauglichkeit erprobt.Wie die Altenberichtskommission sieht die Bundesregierungzudem die Notwendigkeit, Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen undArbeitnehmer im Lauf ihres Erwerbslebens durch betrieblicheund überbetriebliche Maßnahmen <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<strong>in</strong> die <strong>Lage</strong> zu versetzen, den Anfor<strong>der</strong>ungendes Erwerbslebens gerecht werden zu können. Das DeutscheForum Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung hat mit<strong>der</strong> INQA e<strong>in</strong>e Arbeitsgruppe „Betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung“e<strong>in</strong>gerichtet, <strong>der</strong>en Aktivitäten mit demDeutschen Netzwerk Betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung(DNBGF) verknüpft und <strong>in</strong> den Zusammenhang e<strong>in</strong>erumfassenden Präventionspolitik <strong>der</strong> Bundesregierung gestelltwerden. Diese Arbeitsgruppe arbeitet u. a. an <strong>der</strong>Entwicklung und Umsetzung e<strong>in</strong>es umfassenden Ansatzese<strong>in</strong>er alternsgerechten Gestaltung <strong>der</strong> Erwerbsarbeitunter Berücksichtigung von Gen<strong>der</strong>-Aspekten.Die Krankenkassen haben gemäß § 20 Abs. 2 des FünftenBuches Sozialgesetzbuch (SGB V) die Möglichkeit, denArbeitsschutz ergänzende Maßnahmen <strong>der</strong> betrieblichenGesundheitsför<strong>der</strong>ung durchzuführen. Darüber h<strong>in</strong>auswurde den Krankenkassen mit dem GKV-Mo<strong>der</strong>nisierungsgesetz(§ 65a SGB V) die Möglichkeit eröffnet, Arbeitgebernund Arbeitgeber<strong>in</strong>nen sowie den Beschäftigten– wie von <strong>der</strong> Kommission gefor<strong>der</strong>t – e<strong>in</strong>en Bonusfür Maßnahmen <strong>der</strong> betrieblichen Gesundheitsför<strong>der</strong>unganzubieten.Altersteilzeitmodelle und KündigungsschutzIm Bereich des öffentlichen Dienstes ist <strong>der</strong> Vorschlag<strong>der</strong> Kommission, Altersteilzeit als Blockvariante nichtmehr zu för<strong>der</strong>n, über die von <strong>der</strong> Bundesregierung h<strong>in</strong>ausvorgenommene Befristung <strong>der</strong> Altersteilzeit bis 2009weitestgehend umgesetzt. Altersteilzeit für Beamt<strong>in</strong>nenund Beamte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesverwaltung und ebenso für Tarifbeschäftigtedes Bundes ist <strong>in</strong> Form des Blockmodells generelle<strong>in</strong>geschränkt und nur noch <strong>in</strong> Stellenabbaubereichenmöglich, wenn die Stelle e<strong>in</strong>gespart wird.Zweck des 1996 für die gewerbliche Wirtschaft geschaffenenAltersteilzeitgesetzes war es, e<strong>in</strong> Gegenmodell <strong>zur</strong>Frühverrentung zu schaffen. 1998 wurde die Altersteilzeitauch für den öffentlichen Dienst möglich. Es g<strong>in</strong>g dabeium die Eröffnung von Möglichkeiten e<strong>in</strong>es flexiblen undgraduellen Übergangs von Beschäftigung <strong>in</strong> den Ruhestandund die Schaffung von Zugangschancen für jüngereArbeitslose o<strong>der</strong> Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung.Grundsätzlich kann Altersteilzeit auch nach Auffassung<strong>der</strong> Bundesregierung e<strong>in</strong>en Anreiz für ältere Arbeitnehmerschaffen, ihr Beschäftigungsverhältnis <strong>in</strong> reduziertemUmfang fortzuführen und damit <strong>zur</strong> Stabilisierung <strong>der</strong>Beschäftigungsverhältnisse älterer Arbeitnehmer beitragen.Private Arbeitgeber, die sich ansonsten von älteren Arbeitnehmerndurch Kündigung bzw. Aufhebungsvertragund Zahlung e<strong>in</strong>er Abf<strong>in</strong>dung trennen und damit letztlichältere Arbeitnehmer auf Kosten <strong>der</strong> Arbeitslosenversicherungaus dem Erwerbsleben drängen würden, nutzen dieAltersteilzeit als alternative Gestaltungsmöglichkeit <strong>zur</strong>
Drucksache 16/2190 – 10 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodePersonalanpassung. Die Altersteilzeit kann damit e<strong>in</strong>enBeitrag <strong>zur</strong> Vermeidung altersbed<strong>in</strong>gter Arbeitslosigkeitund <strong>zur</strong> Steigerung <strong>der</strong> Erwerbsquote Älterer leisten.Arbeitszeitflexibilisierung wird auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> öffentlichenDiskussion als gewünschte und geeignete Reaktion aufgeän<strong>der</strong>te berufliche und persönliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungenverstanden.Lebensarbeitszeitkonten s<strong>in</strong>d als Ausdruck e<strong>in</strong>er solchenerwünschten Arbeitszeitflexibilisierung anerkannt. Die<strong>der</strong>zeit möglichen Altersteilzeitmodelle bieten e<strong>in</strong>Höchstmaß an Flexibilität, da die Beteiligten die für sieim E<strong>in</strong>zelfall attraktivste Möglichkeit vere<strong>in</strong>baren können.Dem Vorschlag <strong>der</strong> Kommission, im Teilzeit- und Befristungsgesetz(TzBfG) e<strong>in</strong>e spezielle Variante <strong>der</strong> Arbeitszeitflexibilisierungfür über 50-Jährige e<strong>in</strong>zuführen, folgtdie Bundesregierung allerd<strong>in</strong>gs nicht. In § 8 TzBfG istbereits e<strong>in</strong> grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeitverankert, den je<strong>der</strong> Arbeitnehmer/jede Arbeitnehmer<strong>in</strong>– auch die über 50-Jährigen – geltend machen kann. E<strong>in</strong>eseparate Regelung für über 50-Jährige ist deshalb nichterfor<strong>der</strong>lich.Als Haupth<strong>in</strong><strong>der</strong>nis für e<strong>in</strong>e Verkürzung <strong>der</strong> Arbeitszeitfür Ältere sieht die Kommission spätere Rentene<strong>in</strong>schnitte.E<strong>in</strong>e von <strong>der</strong> Kommission vorgeschlagene Übernahme<strong>der</strong> Rentenbeiträge für die verkürzte Arbeitzeit <strong>der</strong>Menschen zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr durchdie öffentliche Hand ist überdies aufgrund <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigenHaushaltssituation nicht zu realisieren.Zur Frage <strong>der</strong> erleichterten Befristung von Arbeitsverträgenmit älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenbis zum Rentenbezug erklärt die Bundesregierung, dassim Koalitionsvertrag vorgesehen ist, die erleichterten Befristungsregelungenfür Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmerab dem 52. Lebensjahr als Dauerregelung undeuroparechtskonform gestalten zu wollen.Die Bundesregierung begrüßt Maßnahmen, die <strong>der</strong> Beschäftigungälterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmerdienen. Sie weist aber darauf h<strong>in</strong>, dass die Umsetzung desVorschlags <strong>der</strong> Kommission, die aus ihrer Sicht oft starrentariflichen Regelungen e<strong>in</strong>es Ausscheidens mit dem65. Lebensjahr zu lockern, Sache <strong>der</strong> Tarifpartner wäre.Abzulehnen ist allerd<strong>in</strong>gs <strong>der</strong> <strong>in</strong> diesem Zusammenhangvorgelegte Kommissionsvorschlag e<strong>in</strong>er Begrenzung desKündigungsschutzes bis zum 65. Lebensjahr. Wegen <strong>der</strong>Diskrim<strong>in</strong>ierung älterer Beschäftigter stieße e<strong>in</strong>e solcheRegelung auf europarechtliche und verfassungsrechtlicheBedenken.Die Bundesregierung sieht den Zielkonflikt zwischendem Schutzbedarf älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmer<strong>in</strong>nene<strong>in</strong>erseits und <strong>der</strong> für diesen Personenkreis erschwertenNeue<strong>in</strong>stellung an<strong>der</strong>erseits. Die von <strong>der</strong> Kommissionvorgeschlagene Streichung des Lebensalters alsKriterium bei <strong>der</strong> Sozialauswahl, die bei betriebsbed<strong>in</strong>gtenKündigungen durchzuführen ist, stellt e<strong>in</strong>e möglicheOption <strong>zur</strong> Verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung von E<strong>in</strong>stellungsbarrieren Ältererdar. Diese müsste jedoch mit möglichen Nachteilenfür ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen abgewogenwerden.Arbeitsmarktpolitische InstrumenteDie Bundesregierung för<strong>der</strong>t mit e<strong>in</strong>er Reihe unterschiedlicherInstrumente die Integration <strong>in</strong> Beschäftigung unddie Aufnahme e<strong>in</strong>er selbstständigen Erwerbstätigkeit unddabei auch gezielt die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer. Im H<strong>in</strong>blick auf <strong>der</strong>en beson<strong>der</strong>sschwierige <strong>Lage</strong> auf dem Arbeitsmarkt s<strong>in</strong>dbeson<strong>der</strong>e Maßnahmen <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Beschäftigungschancenund <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeiterfor<strong>der</strong>lich.Die Kommission stellt fest, dass die arbeitsmarktpolitischenInstrumente <strong>zur</strong> Beschäftigungsför<strong>der</strong>ung Ältererunterschiedlich <strong>in</strong>tensiv genutzt werden und empfiehlt dieBündelung <strong>der</strong> Maßnahmen. E<strong>in</strong> wichtiger Grund für dieger<strong>in</strong>ge Inanspruchnahme <strong>der</strong> neuen Instrumente ist ausSicht <strong>der</strong> Bundesregierung allerd<strong>in</strong>gs, dass die Nachfragenach Arbeitskräften <strong>in</strong>sgesamt und nach älteren Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmern im Beson<strong>der</strong>en zu ger<strong>in</strong>gist, so dass auch die arbeitsmarktpolitischen Instrumentefür die E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ung Älterer <strong>in</strong> Beschäftigungnoch nicht voll wirken. Die Geltungsdauer <strong>der</strong> Instrumenteist verlängert worden, um ausreichend Zeit für e<strong>in</strong>egründliche Analyse <strong>der</strong> Evaluationsergebnisse und e<strong>in</strong>edarauf aufbauende gesetzliche Vere<strong>in</strong>fachung des arbeitsmarktpolitischenInstrumentariums zu haben.Die Evaluation be<strong>in</strong>haltet neben <strong>der</strong> Ermittlung von Effektivitätund Effizienz <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Instrumente auch<strong>in</strong>strumentenübergreifende Analysen. In die vorgeseheneÜberprüfung aller arbeitsmarktpolitischen Instrumentes<strong>in</strong>d auch die För<strong>der</strong><strong>in</strong>strumente für ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer e<strong>in</strong>bezogen. Die Bundesregierunghat dafür Sorge getragen, dass bei <strong>der</strong> Evaluierungdurch unabhängige wissenschaftliche Institute durchgängigdas Pr<strong>in</strong>zip des Gen<strong>der</strong>-Ma<strong>in</strong>stream<strong>in</strong>g berücksichtigtwird.E<strong>in</strong>e grundlegende gesetzliche Neuausrichtung <strong>der</strong> aktivenArbeitsmarktpolitik mit Konzentration und Vere<strong>in</strong>fachung<strong>der</strong> Instrumente ist entsprechend des Koalitionsvertragesim Jahr 2007 geplant. Damit wird auch demAnliegen <strong>der</strong> Kommission, e<strong>in</strong>e Bündelung <strong>der</strong> Arbeitsmarkt<strong>in</strong>strumentezu prüfen, Rechnung getragen.Um Beschäftigungschancen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch ältererFrauen zu erhöhen, die dem Arbeitsmarkt <strong>zur</strong> Verfügungstehen, bieten das Recht <strong>der</strong> Arbeitsför<strong>der</strong>ung (SGB III)und das Recht <strong>der</strong> Grundsicherung für Arbeitsuchende(SGB II) e<strong>in</strong> zusätzliches Instrumentarium. So ist gemäßden Beschäftigungspolitischen Leitl<strong>in</strong>ien <strong>der</strong> EuropäischenUnion zum e<strong>in</strong>en die Gleichstellung von Männernund Frauen <strong>in</strong> allen Regelungsbereichen <strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitikals durchgängiges Leitpr<strong>in</strong>zip zu verfolgen(§ 1 Abs. 1 Satz 3 SGB III und §1 Abs. 1 Satz 3 SGB II).Zum an<strong>der</strong>en ist <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> beruflichen Situationvon Frauen durch die Leistungen <strong>der</strong> aktiven Arbeitsför<strong>der</strong>ungauf die Beseitigung bestehen<strong>der</strong> Nachteile sowieauf die Überw<strong>in</strong>dung des geschlechtsspezifischen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 11 – Drucksache 16/2190Ausbildungs- und Arbeitsmarkts h<strong>in</strong>zuwirken. Frauensollen deshalb m<strong>in</strong>destens entsprechend ihres Anteils an<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit geför<strong>der</strong>t werden (§ 8 SGB III sowiedie auf diese Norm verweisende Regelung <strong>in</strong> § 16 Abs. 1Satz 4 SGB II). Zur Verstetigung <strong>der</strong> Erwerbsbiografienvon Frauen leisten darüber h<strong>in</strong>aus die Regelungen imRecht <strong>der</strong> Arbeitsför<strong>der</strong>ung <strong>zur</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit von Familieund Beruf (§ 8a SGB III) und <strong>zur</strong> beson<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>ungvon Berufsrückkehrenden (§ 8b SGB III) e<strong>in</strong>en wichtigenBeitrag.Übergang vom Erwerbsleben <strong>in</strong> dieNacherwerbsphaseDie Kommission plädiert für mehr Flexibilität beimÜbergang vom Erwerbsleben <strong>in</strong> die Nacherwerbsphaseetwa durch Teilrenten. Zu ihren Ausführungen im E<strong>in</strong>zelnenhält die Bundesregierung allerd<strong>in</strong>gs folgende Klarstellungenfür nötig: Die H<strong>in</strong>zuverdienstgrenzen werdenvom Rentenversicherungsträger ermittelt und dem Versichertenim Rentenbescheid mitgeteilt. Sowohl <strong>der</strong> Rentnerals auch se<strong>in</strong> Arbeitgeber können sich auf diese Grenzene<strong>in</strong>stellen.Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag <strong>der</strong> Kommission,den Übergang von <strong>der</strong> Erwerbs- <strong>in</strong> die Ruhestandsphasedurch die Inanspruchnahme privater und betrieblicherVorsorge zu überbrücken, ab. BetrieblicheAltersversorgung und staatlich geför<strong>der</strong>te zusätzliche Altersvorsorgedienen dem Ziel, e<strong>in</strong>e lebenslange Altersversorgungzu gewähren. Sie s<strong>in</strong>d nicht geeignet, als „Überbrückungsleistung“den Zeitraum zwischen teilweisembzw. vollständigem Ausstieg aus dem Erwerbsleben bis<strong>zur</strong> Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Altersrente zu f<strong>in</strong>anzieren.Leistungen <strong>der</strong> staatlich geför<strong>der</strong>ten zusätzlichen Altersvorsorge(Riester-Rente) dürfen frühestens ab Vollendungdes 60. Lebensjahres o<strong>der</strong> dem Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>er Altersrenteaus e<strong>in</strong>em gesetzlichen Alterssicherungssystem wegenErreichens <strong>der</strong> Altersgrenze erbracht werden. Auch Altersleistungen<strong>der</strong> betrieblichen Altersversorgung können– wenn dies im Leistungsplan geregelt ist – vor Vollendungdes 65. Lebensjahres, z. B. ab Vollendung des60. Lebensjahres, gewährt werden. Das Betriebsrentengesetzschreibt vor, dass bei Inanspruchnahme vorzeitigerAltersrenten aus <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung <strong>der</strong>Arbeitgeber ebenfalls und gleichzeitig e<strong>in</strong>e Betriebsrentezahlen muss, wenn <strong>der</strong> Arbeitnehmer dies verlangt. Diesgilt jedoch nicht für Teilrenten. Die Möglichkeit e<strong>in</strong>er Inanspruchnahmevor dem 60. Lebensjahr ist nicht zuletzt<strong>in</strong> Anbetracht <strong>der</strong> steigenden Lebenserwartung und <strong>der</strong>damit verbundenen längeren Rentenbezugszeit abzulehnen.Zum Kommissionsvorschlag e<strong>in</strong>er Erhöhung des Zuschlagsbei H<strong>in</strong>ausschieben <strong>der</strong> Altersrente macht dieBundesregierung deutlich, dass bereits heute <strong>der</strong> zeitweiseVerzicht auf e<strong>in</strong>e Altersrente nach dem 65. Lebensjahrdurch e<strong>in</strong>en Zuschlag von 6 Prozent pro Jahr ausgeglichenwird. Wer also z. B. bis zum 70. Lebensjahrweiterarbeiten würde, erhielte e<strong>in</strong>en Zuschlag von30 Prozent. E<strong>in</strong>e weitere Erhöhung des Zuschlags würdedas Verhältnis zwischen dem normalen „Rentenvolumen“ab 65 Jahren und den Rentenvolumen für länger Arbeitendeverzerren und bei tatsächlicher Nutzung zu erheblichenf<strong>in</strong>anziellen Belastungen <strong>der</strong> Rentenversicherungführen.Weiterh<strong>in</strong> spricht sich die Kommission für e<strong>in</strong>e Erhöhungdes Rentenanspruchs durch Erwerbstätigkeit nach Inanspruchnahme<strong>der</strong> Altersrente aus und weist auf die Möglichkeith<strong>in</strong>, <strong>in</strong> diesen Fällen den Arbeitgeberbeitrag zustreichen. Hierzu erklärt die Bundesregierung, dass dieRegelung, nach <strong>der</strong> <strong>der</strong> Arbeitgeberbeitrag bei <strong>der</strong> Beschäftigungvon Altersrentnern und -rentner<strong>in</strong>nen nichtentfällt, ausschließlich arbeitsmarktpolitischen und wettbewerbspolitischenZwecken dient. Der Arbeitgeberseitesoll <strong>der</strong> Anreiz genommen werden, unter zwei Bewerbungendiejenige Person zu wählen, für die wegen Versicherungsfreiheitke<strong>in</strong> Beitragsanteil zu entrichten ist. Die von<strong>der</strong> Arbeitgeberseite zu leistenden Beitragsanteile s<strong>in</strong>dke<strong>in</strong>e Beiträge, die zu Beitragszeiten führen. Diese E<strong>in</strong>nahmenfließen vielmehr <strong>der</strong> Versichertengeme<strong>in</strong>schaftzu. Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriftdurch Beschluss vom 16. Oktober 1962 als mit demGrundgesetz vere<strong>in</strong>bar erklärt.Der Kommission ersche<strong>in</strong>t unter H<strong>in</strong>weis darauf, dasssich die Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter<strong>in</strong>nen undMitarbeiter branchenspezifisch sehr unterschiedlich gestaltet,weniger e<strong>in</strong>e generelle Erhöhung als vielmehr e<strong>in</strong>eFlexibilisierung des Rentene<strong>in</strong>trittsalters als angemessen.Im H<strong>in</strong>blick auf die konkrete Ausgestaltung kommt siejedoch nicht zu e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>heitlichen Ansicht.Nur e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Kommission vertritt die Position, die Ankündigung<strong>der</strong> Anhebung <strong>der</strong> Altersgrenze für den abschlagfreienBezug e<strong>in</strong>er Altersrente und ihr Wirksamwerdenbei verän<strong>der</strong>ter Arbeitsmarktlage stelle e<strong>in</strong>e <strong>der</strong>Maßnahmen dar, um e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> ErwerbsbeteiligungÄlterer zu beför<strong>der</strong>n. Tatsache ist aber, dass die Lebenserwartungund damit die Rentenbezugsdauer ständigsteigen. Die Bundesregierung will die solidarische Alterssicherungerhalten. Sie beabsichtigt deshalb, die Altersgrenzefür die Regelaltersrente vom Jahr 2012 an schrittweisevon 65 auf 67 Jahre anzuheben. In vollem Umfangsoll die Anhebung spätestens im Jahr 2029 abgeschlossense<strong>in</strong>. Versicherte mit m<strong>in</strong>destens 45 Versicherungsjahrenaus Beschäftigung, K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung und Pflege sollen jedochweiterh<strong>in</strong> abschlagsfrei mit 65 Jahren <strong>in</strong> Rente gehenkönnen.2. BildungDie Bundesregierung teilt den umfassenden und alle Lebensphasene<strong>in</strong>beziehenden Bildungsbegriff <strong>der</strong> Altenberichtskommission.Lernen ist mehr als nur Wissenserwerb;Bildung erfor<strong>der</strong>t e<strong>in</strong>e lernför<strong>der</strong>nde Umgebungund die Möglichkeit <strong>zur</strong> sozialen Teilhabe. Mit <strong>der</strong> Altenberichtskommissionist sich die Bundesregierung dar<strong>in</strong>e<strong>in</strong>ig, dass <strong>der</strong> Bildung <strong>in</strong> <strong>der</strong> nachberuflichen Lebensphasestärkeres Augenmerk gewidmet werden sollte. Bildunghat auch <strong>in</strong> dieser Lebensphase e<strong>in</strong>e wichtige Bedeutungfür die Weiterentwicklung <strong>der</strong> Persönlichkeit und<strong>der</strong> Lebensqualität im Alter. Sie för<strong>der</strong>t die Erhaltung <strong>der</strong>geistigen Leistungsfähigkeit und <strong>der</strong> selbstständigen Le-
Drucksache 16/2190 – 12 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodebensführung, die Ausbildung e<strong>in</strong>es s<strong>in</strong>nstiftenden Lebenskonzeptsund die damit verbundene Fähigkeit <strong>zur</strong>Bewältigung von Lebenskrisen sowie den Ausbau und dieSicherung sozialer Kontakte. Das im Bildungskontext erworbeneSelbstvertrauen sowie die Selbstvergewisserungüber die eigenen Fähigkeiten und Entwicklungspotenzialeschaffen Voraussetzungen für die soziale Teilhabe undPartizipation im Alter.Bedeutung <strong>der</strong> Bildung und WeiterbildungVon steigen<strong>der</strong> Bedeutung ist die Weiterbildung im Bereichdes Freiwilligen Engagements. Die Motivation zumEngagement richtet sich zunehmend an den Möglichkeiten<strong>zur</strong> selbst bestimmten Gestaltung <strong>der</strong> freiwilligen Tätigkeitaus und bezieht sich auf qualitativ gehaltvolleTätigkeiten jenseits e<strong>in</strong>er re<strong>in</strong>en Helferrolle für professionelleKräfte. Weiterbildung schafft die notwendigen Voraussetzungenfür Qualitätssicherung, Autonomie undMitbestimmung.Mit <strong>der</strong> Kommission ist sich die Bundesregierung dar<strong>in</strong>e<strong>in</strong>ig, dass e<strong>in</strong>em hochwertigen, differenzierten und diegesamte Lebensspanne <strong>der</strong> Menschen umfassenden Bildungssystem<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft mit e<strong>in</strong>em stetig wachsendenAnteil älterer Menschen bei gleichzeitig abnehmendenJahrgangsstärken <strong>der</strong> jungen <strong>Generation</strong> e<strong>in</strong>ehohe und weiterh<strong>in</strong> steigende Bedeutung zukommt.Die Fähigkeit <strong>der</strong> Gesellschaft, die Folgen <strong>der</strong> demografischenVerän<strong>der</strong>ungen sowohl wirtschaftlich zu bewältigenals auch den sozialen Zusammenhalt, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eden Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en zu wahren, wirdwesentlich davon abhängen, dass es gel<strong>in</strong>gt, die Kompetenzen<strong>der</strong> Menschen über ihre gesamte Lebensspanne zuentwickeln und auch alten Menschen die Chance zu geben,sich mit ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungenaktiv <strong>in</strong> die Gesellschaft e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.E<strong>in</strong>e verengte Jugendorientierung <strong>der</strong> Politik würde dieserwachsenden Herausfor<strong>der</strong>ung nicht gerecht. E<strong>in</strong>e guteallgeme<strong>in</strong>e und berufliche Bildung, die bereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Jugen<strong>der</strong>worben werden muss, ist e<strong>in</strong> wesentliches Fundamentfür lebenslanges Lernen. Die Kommission hat vordiesem H<strong>in</strong>tergrund bildungspolitische Fragen weit überdie eigentliche Altersthematik h<strong>in</strong>aus aufgegriffen.Die Kommission hat sich im Ergebnis wesentliche For<strong>der</strong>ungenzu eigen gemacht, die bereits die vom Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Bildung und Forschung (BMBF) aufWunsch des Deutschen Bundestags e<strong>in</strong>gesetzte Kommission<strong>zur</strong> „F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“ <strong>in</strong> ihremAbschlussbericht vom 28. Juli 2004 (Bundestagsdrucksache15/3636) formuliert hatte. Zu diesem <strong>Bericht</strong> hat dieBundesregierung mit Datum vom 29. April 2005 e<strong>in</strong>e Stellungnahmeabgegeben (Bundestagsdrucksache 15/5427).Verbesserung von BildungsangebotenDie Bundesregierung schließt sich dem Appell <strong>der</strong> Altenberichtskommission<strong>zur</strong> Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>er flächendeckendenGrundversorgung mit Angeboten allgeme<strong>in</strong>politischerund kultureller Weiterbildung an die Län<strong>der</strong>und Kommunen an. Sie unterstreicht <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auchdie Notwendigkeit von ausreichenden und zielgruppenspezifischenAngeboten <strong>zur</strong> Alphabetisierung und zumNachholen von Schulabschlüssen. Dies ist umso dr<strong>in</strong>glicher,als die Zahl junger Menschen steigt, die die Schuleohne Abschluss verlassen. Zudem gehen Schätzungenvon bis zu vier Millionen funktionaler Analphabeten aus.Der Bund för<strong>der</strong>t <strong>in</strong> diesem Bereich <strong>in</strong>novative Entwicklungenmit exemplarischem Charakter, auch unter Nutzungneuer Medien. Bundesweite Aktionen sollen dieöffentliche Wahrnehmung <strong>der</strong> Notwendigkeit e<strong>in</strong>es verstärktenEngagements steigern und auch die betroffenenBürger<strong>in</strong>nen und Bürger unmittelbar ansprechen.Das BMBF beabsichtigt, <strong>in</strong> dieser Legislaturperiode zusätzlicheAnstrengungen zu unternehmen, wie dies <strong>in</strong> <strong>der</strong>Koalitionsvere<strong>in</strong>barung vom 11. November 2005 festgehaltenist.Angesichts <strong>der</strong> sich abzeichnenden stark ansteigendenBildungsnachfrage durch ältere Menschen sollten danebenselbst organisierte Bildungsangebote wie Seniorenakademienetc. e<strong>in</strong>e stärkere Unterstützung erhalten.Die Bundesregierung beabsichtigt ferner, den sowohl von<strong>der</strong> Altenberichtskommission wie von <strong>der</strong> Bildungsf<strong>in</strong>anzierungskommissionfavorisierten und auch im Koalitionsvertragfestgehaltenen Gedanken des Bildungssparensaufzugreifen und damit e<strong>in</strong> zusätzliches Instrument<strong>der</strong> Bildungsf<strong>in</strong>anzierung zu entwickeln.Die Verbesserung <strong>der</strong> Durchlässigkeit des Bildungswesensund <strong>der</strong> Verzahnung se<strong>in</strong>er vielfältigen Angeboteund Niveaus ist e<strong>in</strong>e wesentliche Komponente des Systemsdes Lebenslangen Lernens. Bund und Län<strong>der</strong> haben<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanungund Forschungsför<strong>der</strong>ung am 5. Juli 2004 die „Strategiefür Lebenslanges Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland“beschlossen. Ziel <strong>der</strong> Strategie ist es, alle Bürger<strong>in</strong>nenund Bürger zum lebenslangen Lernen <strong>in</strong> allenLebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenenLernorten und <strong>in</strong> vielfältigen Lernformen an<strong>zur</strong>egen undzu unterstützen. Die Verwirklichung des Ziels des lebenslangenLernens ist ebenso e<strong>in</strong> Ziel <strong>der</strong> Politik <strong>in</strong>nerhalb<strong>der</strong> Europäischen Union und <strong>in</strong> <strong>der</strong> OECD.För<strong>der</strong>maßnahmen des BundesDas BMBF för<strong>der</strong>t Maßnahmen <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Informationsmöglichkeiten,<strong>der</strong> Transparenz und <strong>der</strong> Qualitätssicherung<strong>in</strong> <strong>der</strong> Weiterbildung. Hierzu zählt <strong>der</strong>erfolgte Aufbau <strong>der</strong> Metasuchmasch<strong>in</strong>e „InfoWeb Weiterbildung“,die bundesweit e<strong>in</strong>en Überblick über Weiterbildungsangebotefür alle Altergruppen bietet. Ferner för<strong>der</strong>tdas BMBF unter dem Titel „Lernende Regionen“ <strong>in</strong> engerAbstimmung mit den Län<strong>der</strong>n ca. 70 regionale Netzwerke,<strong>in</strong> denen regional passgenaue Modelle LebenslangenLernens erarbeitet werden. Die <strong>in</strong> den Lernenden Regionengeschaffenen <strong>in</strong>novativen Strukturen orientierensich am gesamten Bildungssystem und den spezifischenBedürfnissen <strong>der</strong> Nutzer<strong>in</strong>nen und Nutzer. Im Rahmendes Verbundprojekts „Qualitätstestierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Weiterbildung“stärkt das BMBF sowohl die Qualitätsorientie-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 13 – Drucksache 16/2190rung <strong>der</strong> Angebotsseite als auch die Markttransparenz fürdie Nutzer<strong>in</strong>nen und Nutzer. H<strong>in</strong>zu kommen Weiterbildungstests,die die Stiftung Warentest mit Unterstützungdes BMBF durchführt.Mit dem Verbundprojekt „Weiterbildungspass mit Zertifizierung<strong>in</strong>formellen Lernens/ProfilPASS“ unterstützt dasBMBF die Arbeits- und Bildungsberatung und för<strong>der</strong>te<strong>in</strong>e systematische, <strong>in</strong>dividuelle Positionsbestimmung,wie sie die Kommission unter dem Stichwort „Profil<strong>in</strong>g“vorgeschlagen hat. Ziel <strong>der</strong> bereits am 1. Juli 2004 <strong>in</strong>Kraft getretenen Anerkennungs- und Zulassungsverordnung-Weiterbildungist es, im Bereich <strong>der</strong> Arbeitsför<strong>der</strong>unge<strong>in</strong>e nachhaltige Qualitätsentwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichenWeiterbildung <strong>in</strong> Gang zu setzen.Das BMBF för<strong>der</strong>t ferner modellhafte Entwicklungen <strong>in</strong><strong>der</strong> Weiterbildung für ältere Menschen und für e<strong>in</strong> konstruktivesZusammenwirken <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en. Dazu gehörenKonzepte des geme<strong>in</strong>samen Lernens von Alt undJung und des Dialogs <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en als Thema vonWeiterbildungsangeboten ebenso wie die Entwicklungvon Angeboten, <strong>in</strong> denen aus dem Erwerbsleben ausgeschiedeneBerufstätige auf ehrenamtliche Tätigkeitenvorbereitet o<strong>der</strong> ältere Menschen als Internetredakteur<strong>in</strong>nenund -redakteure ausgebildet werden. Dabei wird gezeigt,wie ältere Menschen die neuen Medien <strong>zur</strong> aktivenPartizipation an gesellschaftlichen Diskursen nutzen können.Im Rahmen des Programms „Lernkultur Kompetenzentwicklung“,das beispielhafte Modelle im Bereich <strong>der</strong>beruflichen Weiterbildung für Betriebe und für das Lernen<strong>in</strong>nerhalb und außerhalb <strong>der</strong> Erwerbsarbeit entwickelt,werden Projekte geför<strong>der</strong>t, die das geme<strong>in</strong>sameLernen von jüngeren und älteren Beschäftigten im Betriebzum Schwerpunkt haben.Weiterbildung und betriebliche PraxisDie Bundesregierung tritt <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>stimmung mit <strong>der</strong>Kommission für die Vere<strong>in</strong>barung von Bildungszeitkonten<strong>in</strong> Tarifverträgen e<strong>in</strong>, um den Herausfor<strong>der</strong>ungen e<strong>in</strong>er<strong>in</strong> schnellem Wandel bef<strong>in</strong>dlichen Arbeitswelt gerechtzu werden. Sie bekennt sich zu <strong>der</strong> Aufgabe desStaates, dabei für angemessene Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zusorgen, zu denen etwa die Insolvenzsicherung von Langzeitarbeitszeitkontengehört.Die von <strong>der</strong> Kommission betonte Notwendigkeit vonFortbildungsangeboten an Berufstätige, um ihr beruflichesWissen auf den neuesten Stand zu br<strong>in</strong>gen, wirdunterstützt. Dabei muss Weiterbildung flexibel und spezifischauf die differenzierten Bedürfnisse unterschiedlicherZielgruppen – von Personen und Betrieben – e<strong>in</strong>gehen.Die Bundesregierung unterstützt die Feststellung <strong>der</strong>Kommission, es sei unzutreffend, dass Menschen mitfortschreitendem Alter die Fähigkeit verlören, sich wechselndenBed<strong>in</strong>gungen psychisch anzupassen, und dass sienicht mehr zu kreativen Leistungen fähig seien.Vielmehr kann durch e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Weiterbildung– neben altersgerechter Arbeitsgestaltung und gezieltenMaßnahmen <strong>zur</strong> Motivation älterer Arbeitnehmer – <strong>der</strong>enInnovationsfähigkeit erhalten und verbessert werden.Wichtiger Ansatzpunkt <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Beschäftigungsquoteälterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmerist es, dem Risiko möglicher Arbeitslosigkeit durch Qualifizierungvorzubeugen. Dies ist grundsätzlich Aufgabe<strong>der</strong> Betriebe selbst.Auch aus demografischen Gründen wird die deutscheWirtschaft langfristig nicht auf das Beschäftigungspotenzialälterer Arbeitnehmer verzichten können. DieBundesregierung teilt die Kritik <strong>der</strong> Kommission an e<strong>in</strong>erPersonalpolitik, die älteren Arbeitnehmern Fort- und Weiterbildungsangebotevorenthält, auf Maßnahmen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter verzichtetund konjunkturbed<strong>in</strong>gte Kapazitätsprobleme vorzugsweisedurch Freisetzung älterer Arbeitskräfte löst und daherals nicht zukunftsfähig angesehen werden kannDas im Rahmen <strong>der</strong> Reform des Betriebsverfassungsgesetzes2001 e<strong>in</strong>geführte Mitbestimmungsrecht des Betriebsratsversetzt diesen <strong>in</strong> die <strong>Lage</strong>, gerade <strong>in</strong> vomArbeitgeber veranlassten Fällen e<strong>in</strong>es drohenden Qualifikationsverlustesfrühzeitig und präventiv betrieblicheBerufsbildungsmaßnahmen zugunsten <strong>der</strong> betroffenenArbeitnehmer durchsetzen zu können, um <strong>der</strong>en Beschäftigungzu sichern. Auf betrieblicher Ebene kann <strong>der</strong> Betriebsratdamit e<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag <strong>zur</strong> Erhaltung <strong>der</strong>Qualifikation auch <strong>der</strong> älteren Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen undArbeitnehmer leisten.Die von <strong>der</strong> Kommission empfohlene Bündelung vonQualifikationen <strong>in</strong> zusätzlichen anerkannten Berufen istallerd<strong>in</strong>gs nur im Rahmen von Artikel 12 des Grundgesetzesmöglich. Neben den rund 350 nach dem Berufsbildungsgesetzund <strong>der</strong> Handwerksordnung anerkannten Berufenweitere Bereiche zusätzlich zu verrechtlichen– nach Expertenschätzungen gibt es <strong>der</strong>zeit ca. 20 000 verschiedeneBerufstätigkeiten – kann schon aus re<strong>in</strong> praktischenGründen nicht das Ziel se<strong>in</strong>.Maßnahmen <strong>der</strong> Bundesagentur für ArbeitDie Bundesregierung begrüßt die Aufmerksamkeit, welchedie Kommission <strong>der</strong> Weiterbildungsför<strong>der</strong>ung durchdie Bundesagentur für Arbeit als „mit Abstand größte(m)För<strong>der</strong>programm für die Weiterbildung Erwachsener“widmet. Bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildungwird jedoch <strong>der</strong> Rückgang des För<strong>der</strong>volumens bzw. dieTeilnehmere<strong>in</strong>tritte zu e<strong>in</strong>seitig dargestellt und hierdurche<strong>in</strong> verzerrtes Bild vermittelt.Der e<strong>in</strong>seitige Blick auf die berufliche Weiterbildungsför<strong>der</strong>ungberücksichtigt nicht die deutlich gestiegene Zahlan E<strong>in</strong>tritten <strong>in</strong> Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsmaßnahmen, die ebenso zu dengeför<strong>der</strong>ten Bildungsmaßnahmen zu zählen s<strong>in</strong>d, sowiedas erhebliche För<strong>der</strong>engagement <strong>der</strong> Bundesagentur fürArbeit im Bereich <strong>der</strong> beruflichen Qualifizierung beh<strong>in</strong><strong>der</strong>terMenschen.Tatsächlich ist mit den Gesetzen für Mo<strong>der</strong>ne Dienstleistungenam Arbeitsmarkt die aktive Arbeitsför<strong>der</strong>ung qualitativerheblich verbessert worden; sie richtet sich nunkonsequent auf die rasche Integration <strong>in</strong> reguläre Beschäftigung.Im Zuge dieser Neuausrichtung <strong>der</strong> Arbeits-
Drucksache 16/2190 – 14 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodemarktpolitik mit e<strong>in</strong>er stärkeren Konzentration auf Wirksamkeitund Wirtschaftlichkeit werden Weiterbildungennur geför<strong>der</strong>t, wenn durch sie e<strong>in</strong>e berufliche E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungschneller erreicht werden kann. Dies hat bereits zuspürbaren Verbesserungen geführt: So konnten die Dauer<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit vor E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> Weiterbildung gesenkt,die Abbruchquote reduziert und die E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsquoteverbessert werden.Die Kommission führt zutreffend aus, dass e<strong>in</strong>e Risikosicherungüber e<strong>in</strong>e Solidargeme<strong>in</strong>schaft notwendig ist, daArbeitslosigkeit und Qualifikationsverlust bei raschemStrukturwandel <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von den betroffenen Personennur begrenzt voraussehbar und vom E<strong>in</strong>zelnen kaumzu bee<strong>in</strong>flussen s<strong>in</strong>d. Es ist folgerichtig, <strong>in</strong> <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ungvon Weiterbildungsmaßnahmen durch die Bundesagenturfür Arbeit daher weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Kernelement für e<strong>in</strong>System Lebenslangen Lernens zu sehen. Allerd<strong>in</strong>gsverkennt die ankl<strong>in</strong>gende Kritik <strong>der</strong> Kommission anprognostizierten Verbleibsquoten bei Weiterbildungsmaßnahmen<strong>der</strong>en Intention. Die wirkungsorientierte Steuerung<strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitik durch die Bundesagentur fürArbeit ist darauf ausgerichtet, Integrationen <strong>in</strong> den Arbeitsmarktzu beschleunigen und die <strong>zur</strong> Verfügung stehendenMittel effektiv und effizient e<strong>in</strong>zusetzen. E<strong>in</strong>eFör<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung kommt danachnur <strong>in</strong> Betracht, wenn nur durch sie e<strong>in</strong>e schnellere Integration<strong>in</strong> den Arbeitsmarkt erreicht werden kann.Zur Verbesserung <strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit Ger<strong>in</strong>gqualifizierterund älterer Arbeitnehmer hat die Bundesagenturfür Arbeit e<strong>in</strong> Son<strong>der</strong>programm aufgelegt, <strong>in</strong>dessen Rahmen u. a. Zuschüsse für Arbeitgeber <strong>zur</strong>Nachqualifizierung beschäftigter Arbeitnehmer geleistetwerden können. Zur F<strong>in</strong>anzierung des Son<strong>der</strong>programmswurde <strong>der</strong> E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungstitel im Haushalt <strong>der</strong> Bundesagenturfür Arbeit um 200 Mio. Euro aufgestockt. Die von<strong>der</strong> Kommission gefor<strong>der</strong>te stärkere För<strong>der</strong>ung von Modulenist bereits weitgehend Realität. Die zentrale Vorgabee<strong>in</strong>er bestimmten Verbleibsquote für e<strong>in</strong>e Maßnahmezulassungerfolgt nicht mehr.3. Familie und private NetzwerkeDie Bundesregierung begrüßt, dass sich <strong>der</strong> Fünfte Altenberichtmit den Potenzialen des Alters <strong>in</strong> Familie und privatenNetzwerken beschäftigt. Die Familie ist die sozialeund aktive Mitte <strong>der</strong> Gesellschaft. Sie bietet verlässlichewechselseitige Unterstützung und gewährleistet den generationenübergreifendenZusammenhalt. Nie zuvor haben<strong>in</strong> Familien so viele <strong>Generation</strong>en gleichzeitig mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>gelebt, mitunter an verschiedenen Orten, aberdoch <strong>in</strong> engem Kontakt. Selten zuvor gab es e<strong>in</strong> besseresKlima zwischen den <strong>Generation</strong>en. Ältere Menschenübernehmen <strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken vielfältigeAufgaben. Sie pflegen ihre Angehörigen und s<strong>in</strong>d alsGroßeltern an <strong>der</strong> Entwicklung und Werteerziehung ihrerEnkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> beteiligt. Ebenso wie die Kommission desFünften Altenberichts schätzt die Bundesregierung freiwilligeUnterstützungsleistungen <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong>.E<strong>in</strong> adäquates Angebot sozialer Dienstleistungenist allerd<strong>in</strong>gs unerlässlich, um die Potenziale vonFamilien zu stärken.Nachhaltige FamilienpolitikDie Bundesregierung hat die Familienpolitik vom Rand<strong>in</strong> die Mitte des politischen Planens und Handelns gebracht.Sie hat die Anfor<strong>der</strong>ungen an e<strong>in</strong>e zukunftssichereFamilienpolitik über Kriterien <strong>der</strong> Nachhaltigkeit def<strong>in</strong>iert.Leitl<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>er nachhaltigen Politik für Familien ist:mehr K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> die Familien und mehr Familie <strong>in</strong> die Gesellschaftbr<strong>in</strong>gen. Mit diesem Ziel hat die Bundesregierunge<strong>in</strong>en Politikwechsel e<strong>in</strong>geleitet, von <strong>der</strong> Konzentrationauf f<strong>in</strong>anzielle Transferleistungen als staatlicheFürsorge h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er optimalen För<strong>der</strong>ung von Balancenim Lebenslauf. Familien brauchen Zeit, unterstützendeInfrastrukturen und zielgerichtete f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung.Durch den Ausbau <strong>der</strong> bedarfsgerechten K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungfür unter Dreijährige und die Weiterentwicklunge<strong>in</strong>es breiten Angebots an Familien unterstützendenDienstleistungen sollen sowohl Voraussetzungen fürmehr Zeit für Familien geschaffen als auch zusätzlichePotenziale für Wachstum und Beschäftigung erschlossenwerden. Für die notwendige Neugestaltung des Verhältnisseszwischen Lebensphasen und Lebensbereichen verfolgtdie Bundesregierung e<strong>in</strong>e Zeitpolitik, die Optionenfür mehr Flexibilität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsarbeit, Familienarbeit,Sozial- und Bildungszeit für Frauen und Männer schafft.Im Alltag und im Lebenslauf sollen Großeltern, <strong>der</strong>enK<strong>in</strong><strong>der</strong> und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> mehr Zeit füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong> haben.Gesellschaftliche Allianzen und lokale Bündnissefür FamilienNachhaltige Familienpolitik be<strong>in</strong>haltet geme<strong>in</strong>sames gesellschaftlichesHandeln. Mit strategisch angelegten Initiativenwerden Kräfte gebündelt und Netzwerke relevantergesellschaftlicher Akteure gebildet. Deshalb hat das Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Familie und Jugend(BMFSFJ) im Januar 2006 das Unternehmensprogramm„Erfolgsfaktor Familie. Unternehmen gew<strong>in</strong>nen“gestartet. Familienfreundlichkeit soll e<strong>in</strong> Markenzeichen<strong>der</strong> deutschen Wirtschaft werden. Mehr Unternehmensollen für e<strong>in</strong>e familienfreundliche Arbeitswelt gewonnenwerden. Zu den zentralen Zielen des Unternehmensprogrammsgehören Vorschläge <strong>zur</strong> Verbesserung des beruflichenWie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>stiegs und <strong>zur</strong> betrieblichen K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung.Diese Handlungsfel<strong>der</strong> wurden <strong>in</strong> <strong>der</strong> „Allianzfür die Familie“ als zentral identifiziert. Die auf Initiativedes BMFSFJ gegründete Allianz für die Familie br<strong>in</strong>gtseit 2003 vielfältige Projekte und strategische Kooperationenfür e<strong>in</strong>e familienfreundliche Unternehmenspolitikerfolgreich auf den Weg. In „Lokalen Bündnissen für Familie“engagieren sich Politik und Verwaltung, Unternehmen,Kammern und Gewerkschaften, Kirchen und sozialeE<strong>in</strong>richtungen, Vere<strong>in</strong>e und Verbände für Familienfreundlichkeitvor Ort. Seit 2004 entstanden über 270 Bündnissefür Familie, von <strong>der</strong> Initiative im Stadtviertel bis zumregionalen Zusammenschluss. In allen Regionen gibt esPotenziale für e<strong>in</strong>e familienfreundliche Entwicklung,wenn sich starke Partner zusammenschließen und geme<strong>in</strong>sametwas bewegen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 15 – Drucksache 16/2190För<strong>der</strong>ung des <strong>Generation</strong>enzusammenhalts:neue Balancen im LebenslaufWie <strong>der</strong> Fünfte Altenbericht hat auch <strong>der</strong> Siebte Familienberichte<strong>in</strong>e neue Perspektive auf Familie entwickeltals „e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>schaft mit starken B<strong>in</strong>dungen, <strong>in</strong> <strong>der</strong>mehrere <strong>Generation</strong>en füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong> sorgen und gegenseitigVerantwortung tragen“. Lebensläufe, <strong>in</strong> denen Familieund Familienentwicklung nachhaltig gelebt werden können,s<strong>in</strong>d durch adäquate Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu ermöglichen.Der <strong>Bericht</strong> unterstützt damit den von <strong>der</strong> Bundesregierunge<strong>in</strong>geleiteten Perspektivwechsel zu e<strong>in</strong>ernachhaltigen Familienpolitik. Empfohlen wird beispielsweisee<strong>in</strong> Optionszeitenmodell (Sozialzeiten), das Platzfür Fürsorge und den Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>enschafft. Ziel ist, dass Männer und Frauen sich Fürsorgeaufgabenund ökonomische Verantwortung besser teilen.Die Formel <strong>der</strong> Industriegesellschaft „entwe<strong>der</strong> Familieo<strong>der</strong> Beruf und später Rente“ kann überwundenwerden. Die Bundesregierung wird im Rahmen e<strong>in</strong>ernachhaltigen Familienpolitik dem Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en<strong>in</strong> Familien verstärkte Aufmerksamkeit widmenund Initiativen zu diesem Thema aufgreifen. Soför<strong>der</strong>t sie z. B. die zweijährige Arbeitsphase des BundesforumsFamilie zum Thema „Familie und <strong>Generation</strong>en“.MehrgenerationenhäuserDie Bundesregierung will die Begegnung, die Kommunikationund den Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong>mit Mehrgenerationenhäusern als Familien unterstützendenZentren för<strong>der</strong>n. Mehrgenerationenhäusererschließen bürgerschaftliches Engagement, machen Zusammenhalterfahrbar und geben Alltagskompetenzenund Erziehungswissen weiter. In aktiven und aktivierendenZentren für Jung und Alt wird gegenseitige Hilfe bei<strong>der</strong> Bewältigung von Alltagsaufgaben praktiziert und e<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>sames Erleben von Solidarität ermöglicht. Derwechselseitige Austausch von Wissen und Erfahrung sollu. a. junge Eltern <strong>in</strong> ihrer Erziehungskompetenz stärkenund älteren Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichenLeben erleichtern. Die Häuser entwickeln dabei zum e<strong>in</strong>eneigene Angebote <strong>der</strong> Frühför<strong>der</strong>ung, Betreuung, Bildungund Lebenshilfe. Zum an<strong>der</strong>en s<strong>in</strong>d sie Anlaufstelle,Netzwerk und Drehscheibe für familienorientierte Dienstleistungen,Erziehungs- und Familienberatung, Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,Krisen<strong>in</strong>tervention und Hilfeplanung.Ziel ist es, im Rahmen e<strong>in</strong>es mehrjährigen Aktionsprogramms<strong>in</strong> jedem Landkreis und <strong>in</strong> je<strong>der</strong> kreisfreien Stadte<strong>in</strong> geför<strong>der</strong>tes Mehrgenerationenhaus zu etablieren.Familien- und altengerechte StadtquartiereÜber konkrete <strong>Generation</strong>enprojekte h<strong>in</strong>aus will die Bundesregierungdas Zusammenleben aller <strong>Generation</strong>en <strong>in</strong>ihren Wohnquartieren verbessern. Hierfür hat sie e<strong>in</strong>neues Forschungsfeld „Innovationen für familien- undaltengerechte Stadtquartiere“ im Rahmen des ExperimentellenWohnungs- und Städtebaus beim Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)<strong>in</strong>s Leben gerufen. Mittels Wettbewerb sollen <strong>in</strong>novativevorbildliche Projekte <strong>zur</strong> k<strong>in</strong><strong>der</strong>- und familienfreundlichenGestaltung von Wohnquartieren sowie zum barrierefreienund altengerechten Umbau <strong>der</strong> Infrastrukturermittelt, ausgewertet und dokumentiert werden, die <strong>zur</strong>Schaffung und Sicherung lebenswerter Stadtquartiere fürJung und Alt beitragen. Als räumlich-bauliche Themenschwerpunktesollen Geme<strong>in</strong>schaftse<strong>in</strong>richtungen imQuartier, Gestaltung urbaner Freiräume und attraktivesWohnen im Quartier untersucht werden, um Städte andiesen Beispielen dabei zu unterstützen, den demografischenWandel zu bewältigen. Die Erkenntnisse aus diesenProjekten können dann bei <strong>der</strong> Erarbeitung <strong>in</strong>tegrierterStadtentwicklungskonzepte, z. B. im Rahmen des Bund-Län<strong>der</strong>-Programms „Stadtteile mit beson<strong>der</strong>em Entwicklungsbedarf– die soziale Stadt“, berücksichtigt und zusammengeführtwerden.Pflege und Betreuung älterer MenschenDie Kommission legt mit ihrem <strong>Bericht</strong> auch e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme<strong>der</strong> familialen und privaten Netzwerkeim Bereich <strong>der</strong> Pflege vor, verbunden mit e<strong>in</strong>er ausgewogenenBewertung positiver Aspekte, aber auch <strong>der</strong>Darstellung nicht gedeckter Bedarfe und un<strong>zur</strong>eichen<strong>der</strong>Nutzung von Angeboten. Die Kommission zeigt Möglichkeiten<strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen auf,damit alte Menschen ihr Leben möglichst lange selbst bestimmtund selbstständig gestalten können. Mit Blick aufFamilien und soziale Netze sollte Seniorenpolitik zweigrundlegende Ziele verfolgen, nämlich e<strong>in</strong>erseits dazubeitragen, vorhandene Potenziale des Alters <strong>in</strong> Familieund privaten Netzwerken zu erhalten und an<strong>der</strong>erseits bestrebtse<strong>in</strong>, neue Potenziale zu wecken und zu stärken.Diese Aussage <strong>der</strong> Kommission bestätigt, dass sich dieBundesregierung auf dem richtigen Weg bef<strong>in</strong>det, wennsie bewährte Strukturen ausbaut, aber auch neue Aktivitätenför<strong>der</strong>t. Ausbau und Weiterentwicklung angemessenerBetreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschensowie wirksamer Hilfen für pflegende Angehörigegehören zu den wichtigen altenpolitischen Aufgaben <strong>der</strong>Bundesregierung, die nur im Dialog mit Betroffenen undNutzern effizient zu lösen s<strong>in</strong>d.Die im <strong>Bericht</strong> dargestellte Notwendigkeit <strong>der</strong> Vernetzungund Kooperation <strong>der</strong> verschiedenen Hilfs- und Leistungsangebotefür Ältere und Pflegebedürftige sowie dieKonzeption und Bereitstellung neuer Dienstleistungens<strong>in</strong>d wesentliche Elemente für e<strong>in</strong>e bedarfsgerechte undselbst bestimmte Versorgung, Unterstützung und Pflegeim Alter. Sie för<strong>der</strong>n nicht nur Lebensqualität, Selbstständigkeitund persönliche Zufriedenheit <strong>der</strong> Betroffenen.Sie för<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong>en ökonomisch s<strong>in</strong>nvollen E<strong>in</strong>satzvon Ressourcen. Sie tragen somit durch Optimierung <strong>der</strong>Versorgung gleichzeitig auch zu mehr Wirtschaftlichkeitbei. Dies ist e<strong>in</strong> Effekt, <strong>der</strong> <strong>in</strong> Zeiten knappen Geldes e<strong>in</strong>ensehr hohen Stellenwert haben muss.Der Fünfte Altenbericht h<strong>in</strong>terfragt zudem die bisherigenAngebote und Strukturen im Bereich <strong>der</strong> Altenhilfe und<strong>der</strong> Pflege, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e angesichts <strong>der</strong> weiteren Zunahmevon Demenzerkrankungen, <strong>der</strong> zu erwartenden Abnahmefamiliärer Betreuungs- und Pflegepotenziale sowie <strong>der</strong> Zunahmevon E<strong>in</strong>-Personen-Haushalten. Es bedarf neuer
Drucksache 16/2190 – 16 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeWege, Strukturen, Angebote und Serviceleistungen, umdie sich aus <strong>der</strong> Bevölkerungsentwicklung ergebendenProbleme und Aufgabenstellungen angemessen und menschenwürdigbewältigen zu können. Da die Mehrzahl sowohl<strong>der</strong> älteren Menschen, die gepflegt werden, als auch<strong>der</strong>er, die Pflegeleistungen für ihre Angehörigen erbr<strong>in</strong>gen,Frauen s<strong>in</strong>d, haben geschlechtsspezifische Aspektehier e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Bedeutung.Die Organisation und För<strong>der</strong>ung komplementärer Hilfensowie die Vernetzungen <strong>in</strong>formeller und professionellerAngebote zu e<strong>in</strong>em ausgewogenen, bedürfnisgerechtenund bezahlbaren „Hilfe-Mix“ müssen forciert und nachdrücklichgeme<strong>in</strong>sam von allen Beteiligten im Bereich<strong>der</strong> Altenhilfe und <strong>der</strong> Pflege unterstützt und effektiv umgesetztwerden.Insbeson<strong>der</strong>e begleitende Angebote und Hilfen <strong>zur</strong> Bewältigungdes Alltags im angestammten Lebensbereichwerden <strong>zur</strong> Bewahrung und För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Selbstständigkeit,<strong>zur</strong> Vermeidung o<strong>der</strong> zum H<strong>in</strong>auszögern von Pflegebedürftigkeitbenötigt. Dabei kommt <strong>der</strong> von <strong>der</strong> überwiegendenMehrheit <strong>der</strong> älteren Menschen gewünschtenhäuslichen Betreuung und Versorgung im Vor- und Umfeld<strong>der</strong> Pflege e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>es Gewicht zu. Stehen dieUnterstützungs- und Hilfsangebote, die sich an den Wünschenund Bedürfnissen <strong>der</strong> Menschen orientieren, <strong>in</strong> ausreichendemUmfang <strong>zur</strong> Verfügung und s<strong>in</strong>d zugleich bezahlbar,dann können sie e<strong>in</strong>en wesentlichen Beitrag <strong>zur</strong>Vermeidung vorzeitiger Heimaufnahmen leisten. Dies ist<strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel nicht nur menschlicher, son<strong>der</strong>n vielfachauch kostengünstiger als e<strong>in</strong>e stationäre Versorgung.Die Ergebnisse und Empfehlungen im Fünften Altenberichtwerden <strong>in</strong> die Vorbereitung und Ausgestaltung <strong>der</strong>anstehenden Reform <strong>der</strong> Pflegeversicherung e<strong>in</strong>bezogenund <strong>in</strong> <strong>der</strong> Diskussion dieses bedeutenden Reformvorhabense<strong>in</strong>e wichtige Rolle spielen.Dies gilt u. a. für die im Fünften Altenbericht gefor<strong>der</strong>teweitere Stärkung <strong>der</strong> häuslichen Pflege, die Dynamisierung<strong>der</strong> Leistungen <strong>der</strong> Pflegeversicherung sowie diestärkere Berücksichtigung des beson<strong>der</strong>en Hilfebedarfs<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von demenziell erkrankten Menschen; dazubedarf es mittelfristig auch <strong>der</strong> Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs.Zum Pflegebedürftigkeitsbegriffhat sich die Bundesregierung bereits ausführlich <strong>in</strong> ihrenStellungnahmen zum Dritten und Vierten Altenberichtgeäußert.Im Zuständigkeitsbereich des Bundesm<strong>in</strong>isteriums fürArbeit und Soziales (BMAS) wurde bereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitslosenversicherungdie soziale Absicherung von Personen,die e<strong>in</strong>en Angehörigen pflegen, weiter verbessert.Seit 1. Februar 2006 besteht auch für diese Pflegepersonendie Möglichkeit, sich auf Antrag bei <strong>der</strong> Bundesagenturfür Arbeit freiwillig weiter zu versichern. Vorraussetzungfür diese „freiwillige Weiterversicherung“ nach§ 28a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) ist,dass die Pflegeperson entwe<strong>der</strong> <strong>in</strong> den 24 Monaten vorAufnahme <strong>der</strong> Pflegetätigkeit bereits zwölf Monate langVersicherte <strong>zur</strong> Arbeitslosenversicherung war o<strong>der</strong> Arbeitslosengeldbezogen hat. Der Antrag ist b<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>esMonats nach Aufnahme <strong>der</strong> Pflegetätigkeit bei <strong>der</strong> örtlichzuständigen Agentur für Arbeit zu stellen.Der Fünfte Altenbericht würdigt u. a. den mit demPflegeleistungs-Ergänzungsgesetz e<strong>in</strong>geschlagenen Weg,niedrigschwellige Angebote und vernetzte Versorgungsstrukturenauch mit Mitteln <strong>der</strong> Pflegeversicherung aufundauszubauen sowie ehrenamtliches Engagement imBereich <strong>der</strong> Pflege und Betreuung <strong>zur</strong> Entlastung <strong>der</strong> familiärenHauptpflegepersonen zu för<strong>der</strong>n. Die Ausführungenim Altenbericht können als Bestätigung <strong>der</strong> Koalitionsvere<strong>in</strong>barungvom 11. November 2005 angesehenwerden, die vorsieht, dass die Instrumente des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzesim Rahmen <strong>der</strong> Weiterentwicklung<strong>der</strong> Pflegeversicherung ausgebaut werden sollen.Soweit <strong>der</strong> Altenbericht das K<strong>in</strong><strong>der</strong>-Berücksichtigungsgesetzkritisiert (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e weil es ke<strong>in</strong>e Differenzierungnach <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> vorsieht und e<strong>in</strong>e Son<strong>der</strong>regelungfür die vor 1940 geborenen k<strong>in</strong><strong>der</strong>losenVersicherten enthält) und sich dann für e<strong>in</strong>en steuerf<strong>in</strong>anziertenFamilienleistungs- und -lastenausgleich ausspricht,ist dem entgegen zu halten, dass e<strong>in</strong>e steuerf<strong>in</strong>anzierte Lösungnicht ohne weiteres mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtsvere<strong>in</strong>bar ist, wonach e<strong>in</strong> Ausgleichzwischen K<strong>in</strong><strong>der</strong>losen und K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehenden im System<strong>der</strong> sozialen Pflegeversicherung erfolgen müsse.Seniorenpolitische MaßnahmenDie Empfehlungen <strong>der</strong> Kommission <strong>zur</strong> Weiterentwicklungvon Angebotsstrukturen orientiert an den Bedürfnissen<strong>der</strong> Nutzer, unter E<strong>in</strong>bezug bürgerschaftlichen Engagementsund unter Berücksichtigung von Vernetzungs<strong>in</strong>d <strong>in</strong> wesentlichen Teilen bereits im Rahmen von Modell-und Forschungsprojekten des BMFSFJ erprobt worden.Ihre Ergebnisse liefern wertvolle Impulse für e<strong>in</strong>eangemessene Betreuung pflegebedürftiger und demenzkrankerMenschen.Zu diesen guten Beispielen gehören die vielfältigen Projekteaus dem Modellprogramm „Altenhilfestrukturen <strong>der</strong>Zukunft“. Von den 20 ausgewählten Projekten <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesamtenBundesrepublik widmen sich alle<strong>in</strong> acht e<strong>in</strong>er verbessertenVersorgung Demenzerkrankter und vier <strong>der</strong>Vernetzung geriatrischer Rehabilitation mit <strong>der</strong> Altenhilfe.Sie repräsentieren dabei e<strong>in</strong> breites Spektrum möglicherund <strong>in</strong>novativer Ansätze.Die Ergebnisse haben u. a. gezeigt, dass das Engagementehrenamtlicher Laien als Zukunftspotenzial bei <strong>der</strong> BetreuungDemenzerkrankter gepflegt und weiterentwickeltwerden muss. Sowohl die Beteiligung entsprechend vorbereiteterund begleiteter Helfer als auch e<strong>in</strong>e verbesserteBeratung pflegen<strong>der</strong> Angehöriger kann <strong>der</strong>en Belastungspürbar abmil<strong>der</strong>n.Dieses Potenzial auszubauen, ist e<strong>in</strong>e zentrale Handlungsempfehlung<strong>der</strong> Kommission, <strong>der</strong> sich die Bundesregierunganschließt. In Projekten wie „Pflegebegleiter“sollen gut befähigte und begleitete Ehrenamtliche dazubeitragen, Hilfearrangements für pflegende Angehörigezu verbessern.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 17 – Drucksache 16/2190Häusliche Pflege kann nur dann auf Dauer geleistet werden,wenn es e<strong>in</strong> professionelles Versorgungsumfeld gibt.Das bestätigen Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchung desBMFSFJ „Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger Lebensführungim Privathaushalt“ (MUG III). Die Feststellung<strong>der</strong> Kommission, dass Personen im Umfeld e<strong>in</strong>esPflegebedürftigen oft nur un<strong>zur</strong>eichend über Angebotehauswirtschaftlicher, pflegerischer und sonstiger Dienste<strong>in</strong>formiert s<strong>in</strong>d, stimmt mit den Erfahrungen <strong>der</strong> Bundesregierungübere<strong>in</strong>. Hier müssen neue Wege beschrittenwerden, um Hilfemöglichkeiten wahrnehmbar und Angebotetransparent zu machen. An<strong>der</strong>erseits nehmen pflegendeAngehörige nämlich auch bei ausreichen<strong>der</strong> Informationprofessionelle Hilfen zu selten <strong>in</strong> Anspruch. Ihreneigenen Beratungs- und Unterstützungsbedarf reflektierensie selten. Die weitere Umsetzung von Prävention undGesundheitsför<strong>der</strong>ung wird diesen Mangel an Selbstpflege-Potenzialverstärkt berücksichtigen müssen. Auchdas Wissen über Bedarfe e<strong>in</strong>es hilfe- und pflegebedürftigenMenschen, gerade im Fall demenzieller Verän<strong>der</strong>ungen,ist oft nicht ausreichend.In Kenntnis dieser Situation hat die Bundesregierung Forschungsvorhabenauf den Weg gebracht, die die Welt vonDemenzerkrankten für Außenstehende besser erschließensollen.Messung und Sicherung von Pflegequalität für Menschenmit Demenz haben dabei e<strong>in</strong>en beson<strong>der</strong>en Stellenwert,da sie selbst, vor allem <strong>in</strong> späten Krankheitsstadien, dazunicht mehr verlässlich Auskunft geben können. In laufendenProjekten werden daher Verfahren weiterentwickelt,die Struktur-, Prozess- und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Ergebnisqualitätdemenzgerechter Pflege gewährleisten sollen. Imzweijährigen Forschungsprojekt „Identifizierung bzw.Entwicklung von Instrumenten <strong>zur</strong> Erfassung von Lebensqualitätgerontopsychiatrisch erkrankter Menschen <strong>in</strong>stationären E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Altenhilfe“ (H.I.L.DE)werden Verfahren entwickelt, mit denen Ergebnisqualitätdementengerechter Pflege <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis messbar wird. Ine<strong>in</strong>em weiteren Schritt soll das Verfahren auch für denambulanten Bereich nutzbar gemacht werden.Ausdrücklich unterstützt die Bundesregierung die For<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> Kommission, die Öffentlichkeit mehr für die Belange<strong>der</strong> Demenzerkrankten zu sensibilisieren. Mit <strong>der</strong>vom BMFSFJ geför<strong>der</strong>ten Kampagne <strong>der</strong> Deutschen AlzheimerGesellschaft „Helfen nicht vergessen“ und <strong>der</strong>konsequenten Unterstützung <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> DeutschenAlzheimer Gesellschaft trägt die Bundesregierung dazubei, dass Aufklärung, Beratung und <strong>der</strong> Aufbau von hilfreichenNetzwerken gewährleistet und ausgebaut werdenkönnen.Um <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung durch die demografisch bed<strong>in</strong>gtwachsende Anzahl demenz-erkrankter älterer Menschenauf Dauer gerecht werden zu können, bedarf es jedochauch e<strong>in</strong>er nachhaltigen Informations- und Qualifizierungsaktion,e<strong>in</strong>er For<strong>der</strong>ung des Vierten Altenberichts,die die Bundesregierung mit dem langfristig angelegtenAktionsprogramm Demenz umsetzt. Das Programm dient<strong>zur</strong> Aufklärung und Information über Hilfen vor Ort undwird von e<strong>in</strong>schlägigen Projekten begleitet. Basiselementist die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es von <strong>der</strong> Deutschen AlzheimerGesellschaft betriebenen zentralen Beratungstelefons fürRatsuchende.Die Bundesregierung teilt die Ansicht <strong>der</strong> Kommission,dass die Unterstützungsangebote für pflegende Angehörigeweiter auszubauen s<strong>in</strong>d. Gerade die häusliche Pflegesituationist sehr schwer zugänglich. Deshalb müssenHilfeangebote passgenau verfügbar se<strong>in</strong>. Im Rahmene<strong>in</strong>er Längsschnittstudie <strong>zur</strong> Belastung pflegen<strong>der</strong> Angehörigervon demenziell Erkrankten (LEANDER) ist esgelungen, e<strong>in</strong> Instrument zu entwickeln, das die persönlichkeitsspezifischeBelastung pflegen<strong>der</strong> Angehörigerabbildet und die <strong>in</strong>dividuelle Effektivität von Entlastungsangebotenerfasst.Neuregelungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesundheitsversorgung haben stetsauch Auswirkungen auf die Altenhilfe. E<strong>in</strong>e stärkere Vernetzungvon Altenhilfe und Gesundheitswesen, wie von<strong>der</strong> Kommission empfohlen, kann diese abfe<strong>der</strong>n.Mit E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> diagnosebezogenen Fallpauschalen2004 <strong>in</strong> den Krankenhäusern zeichnete sich die Gefahrab, dass gerade ältere und multimorbide Patienten, für diedas Leistungsgeschehen im neuen System nicht angemessenabgebildet und nicht ausreichend vergütet werdenkann, zu rasch und ohne angemessene Nachsorge ausdem Akutbereich entlassen werden. Durch e<strong>in</strong>e nachhaltigeNetzwerkarbeit, wie sie im GeReNet Wiesbaden unterRegie <strong>der</strong> kommunalen Altenhilfe erprobt wird, kanndieser Gefahr wirkungsvoll begegnet werden und <strong>der</strong>Weg zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrativen Versorgung, wie ihn das Gesundheitsmo<strong>der</strong>nisierungsgesetzeröffnet, gebahnt werden.Das vom BMFSFJ geför<strong>der</strong>te Projekt wird 2007 abgeschlossen.Fortschritte s<strong>in</strong>d auch bei <strong>der</strong> Zugänglichkeit von Informationenerzielt worden. E<strong>in</strong>e Basis für e<strong>in</strong>e Vernetzungauf kommunaler Ebene soll von dem Projekt „Entwicklunge<strong>in</strong>er Arbeitshilfe für Kommunen <strong>zur</strong> Erfassung undDarstellung <strong>der</strong> Leistungen und Merkmale von Altenhilfee<strong>in</strong>richtungen“ausgehen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> auch Versorgungsstrukturenfür Menschen mit Demenz erfasst werden. Damitwird auch <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kommission nach e<strong>in</strong>er Verbesserung<strong>der</strong> Datenlage Rechnung getragen. Mit e<strong>in</strong>em„Telekolleg Demenz“ soll über TV e<strong>in</strong> zusätzlicher Zuganggenutzt werden, um pflegende Angehörige mitHilfeangeboten zu erreichen und Hilfen zu vermitteln.Die Bundesregierung setzt auch im Bereich <strong>der</strong> Seniorenpolitikauf die Pr<strong>in</strong>zipien von Normalität und Individualität<strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebensführung. Auch hier stimmt sie mit denErkenntnissen <strong>der</strong> Kommission übere<strong>in</strong>. Mit Projektenund Modellprogrammen wie „Wohnen im Alter“ werdenauch neue Wohnformen wie ambulante Wohngeme<strong>in</strong>schaftengeför<strong>der</strong>t. Für Angehörige und für ambulante Diensteergeben sich damit ungewohnte Herausfor<strong>der</strong>ungen. ImFreiburger Projekt „Vernetzte Wohngeme<strong>in</strong>schaften“ solldie E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von Angehörigen und Ehrenamtlichenerprobt und e<strong>in</strong> Erfahrungsaustausch unterschiedlicherArten von Wohngeme<strong>in</strong>schaften ermöglicht werden. Generellgilt es, im Dialog mit Selbsthilfe, Nutzern undDiensten Qualitätsmerkmale für die Wohngeme<strong>in</strong>schaf-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 19 – Drucksache 16/2190gen von zentraler Bedeutung. Das BMFSFJ hat diese Fragestellungmit dem Modellprogramm „Selbstorganisationälterer Menschen im Umbau des Sozialstaats“ aufgegriffen.Die Sozialstaatsdiskussion führt ebenso wie die obenskizzierte verän<strong>der</strong>te Motivationslage für e<strong>in</strong> Engagement<strong>zur</strong> Frage <strong>der</strong> politischen und gesellschaftlichen Partizipationälterer Menschen.Die Bundesregierung schließt sich <strong>der</strong> Auffassung <strong>der</strong>Altenberichtskommission an, dass dies e<strong>in</strong>e zentrale gesellschaftlicheFrage ist, die verstärkte Aufmerksamkeitverdient. Hierzu ist e<strong>in</strong>e Strukturanpassung <strong>der</strong> Verwaltungenebenso erfor<strong>der</strong>lich wie die Öffnung gesellschaftlicherInstitutionen für das selbst bestimmte Engagementälterer Menschen.Das Engagementpotenzial <strong>der</strong> Älteren verstärkt zu för<strong>der</strong>n,ist e<strong>in</strong> Ziel, das die Bundesregierung vor dem H<strong>in</strong>tergrunddes demografischen Wandels und des Umbausdes Sozialstaates z. B. mit dem bereits gestarteten Modellprogrammdes BMFSFJ <strong>zur</strong> Erprobung generationsübergreifen<strong>der</strong>Freiwilligendienste verfolgt. Basierendauf den Empfehlungen <strong>der</strong> Kommission „Impulse für dieZivilgesellschaft“ wird Menschen aller Altersgruppen dieMöglichkeit eröffnet, sich freiwillig zu engagieren unddamit zum Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en beizutragen.Das Programm mit e<strong>in</strong>er Laufzeit von drei Jahren und e<strong>in</strong>emHaushaltsvolumen von 10 Mio. Euro umfasst über50 Projekte, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e neue Angebotsstruktur fürFreiwilligendienste erprobt wird. E<strong>in</strong>satzfel<strong>der</strong> für dieFreiwilligen aller <strong>Generation</strong>en s<strong>in</strong>d u. a. Schulen, Familien,Stadtteilzentren, stationäre E<strong>in</strong>richtungen und Hospize.Bei <strong>der</strong> Entwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturens<strong>in</strong>d alle Sektoren – Wirtschaft, Staat und Gesellschaftgefor<strong>der</strong>t, daneben auch <strong>der</strong> familiäre Bereich. Es entsprichtdaher <strong>der</strong> Position <strong>der</strong> Bundesregierung, dass <strong>der</strong><strong>Bericht</strong> z. B. für den Pflegebereich gemischte Hilfearrangementsfamiliärer, professioneller und ehrenamtlicherPflege befürwortet, sich für e<strong>in</strong>e Öffnung <strong>der</strong> Institutionenund Verbände ausspricht und zugleich darauf h<strong>in</strong>weist,dass im Bereich Corporate Social Responsibility,bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen, e<strong>in</strong> erheblichesWissens- und Erfahrungsdefizit sowie Entwicklungspotenzialbesteht. Formen trisektoraler Vernetzungför<strong>der</strong>t das BMFSFJ beispielsweise mit den lokalenBündnissen für Familie und dem Bundesnetzwerk BürgerschaftlichesEngagement.Die Handlungsempfehlungen <strong>der</strong> Kommission werden<strong>in</strong>sgesamt begrüßt. Auch die Kommission „Impulse fürdie Zivilgesellschaft“ hat monetäre und nicht monetäreFormen <strong>der</strong> Anerkennung z. B. durch Auslagenersatz undVersicherungsschutz für Engagierte als e<strong>in</strong>e wichtige For<strong>der</strong>ungh<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeitbewertet.Im Bereich <strong>der</strong> gesetzlichen Unfallversicherung ist schonam 1. Januar 2005 das Gesetz <strong>zur</strong> Verbesserung des unfallversicherungsrechtlichenSchutzes bürgerschaftlichEngagierter und weiterer Personen <strong>in</strong> Kraft getreten. Dabeihandelt es sich um– bürgerschaftlich Engagierte, die <strong>in</strong> privatrechtlichenOrganisationen im Auftrag o<strong>der</strong> mit Zustimmung vonGebietskörperschaften (i. d. R. Kommunen) tätig werden,– bürgerschaftlich Engagierte, die für E<strong>in</strong>richtungen öffentlich-rechtlicherReligionsgeme<strong>in</strong>schaften tätigwerden o<strong>der</strong> sich <strong>in</strong> privatrechtlichen Organisationenim Auftrag o<strong>der</strong> mit Zustimmung von öffentlich-rechtlichenReligionsgeme<strong>in</strong>schaften e<strong>in</strong>setzen,– gewählte Ehrenamtsträger <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>nützigen Organisationen,die die Möglichkeit <strong>zur</strong> freiwilligen Versicherungerhalten,– ehrenamtliche Helfer <strong>in</strong> Rettungsunternehmen, dienun auch Ersatz ihrer Sachschäden erhalten können.Bezüglich <strong>der</strong> Aussagen <strong>der</strong> Kommission <strong>zur</strong> Unterstützunge<strong>in</strong>es bürgerschaftlichen Engagements bei Mitarbeiter<strong>in</strong>nenund Mitarbeitern auf Seite <strong>der</strong> Unternehmenwird ergänzend auf den <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Enquête-Kommission„Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ verwiesen.Diese ist zu dem Ergebnis gekommen, dass im S<strong>in</strong>nedes Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zips durch die Vere<strong>in</strong>barung vonFreistellungsregelungen <strong>in</strong> Tarifverträgen o<strong>der</strong> <strong>in</strong> betriebs<strong>in</strong>ternenRegelungen flexiblere und sachnähereRegelungen erreicht werden können als dies durch allgeme<strong>in</strong>egesetzliche Vorschriften möglich ist.Die Bundesregierung begrüßt nachdrücklich die Schlussfolgerung<strong>der</strong> Kommission, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stärkung des bürgerschaftlichenEngagements e<strong>in</strong>en Weg <strong>zur</strong> Unterstützungälterer Menschen zu sehen, ihre Potenziale und Kompetenzenfür sich selbst und für die Gesellschaft s<strong>in</strong>nvolle<strong>in</strong>zusetzen. Schon <strong>in</strong> ihrer Koalitionsvere<strong>in</strong>barung hatdie Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie e<strong>in</strong> starkesehrenamtliches Engagement <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er aktiven Bürgergesellschaftfür unerlässlich hält und dieses durch dieVerbesserung <strong>der</strong> rechtlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen unde<strong>in</strong>e gezielte Anerkennungskultur weiter för<strong>der</strong>n wird.5. E<strong>in</strong>kommenslage im AlterDie Kommission geht ausführlich auf die gegenwärtigeE<strong>in</strong>kommens- und Vermögenssituation Älterer e<strong>in</strong> und erörtertmögliche Entwicklungsperspektiven. Sie ergänztdamit eigene Anstrengungen <strong>der</strong> Bundesregierung imRahmen <strong>der</strong> Studien über Alterssicherung und -vorsorgesowie <strong>der</strong> Armuts- und Reichtumsberichterstattung.Ebenso wie diese kommt die Kommission zu <strong>der</strong> Erkenntnis,dass Ältere heute – bezogen auf die Gesamtbevölkerungwie auch gemessen an an<strong>der</strong>en Bevölkerungsgruppen– e<strong>in</strong> unterdurchschnittliches Armutsrisiko aufweisen.Anzumerken ist, dass ältere Frauen durchschnittlichüber e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres E<strong>in</strong>kommen verfügen als Männer.Die Bundesregierung wird die Armuts- und Reichtumsberichterstattung,mit <strong>der</strong> sie verlässliche und regelmäßigeDaten <strong>zur</strong> sozialen <strong>Lage</strong>, e<strong>in</strong>en Indikator für den sozialenZusammenhalt und H<strong>in</strong>weise auf etwaigen Handlungsbe-
Drucksache 16/2190 – 20 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodedarf erhält, als wichtiges Instrument <strong>der</strong> Politikbeobachtungfortführen und weiterentwickeln. Aussagen über zukünftigeE<strong>in</strong>kommensverteilung bedürfen ergänzende<strong>in</strong>er mikrodatenbasierten Fortschreibung von Erwerbsbiografien<strong>der</strong> <strong>in</strong>s Rentenalter nachrückenden Jahrgängeund <strong>der</strong> Bewertung ihrer Anwartschaften auf Alterse<strong>in</strong>kommen,wie sie die Studien über Alterssicherung <strong>in</strong>Deutschland <strong>zur</strong> Verfügung stellen.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungDie Bundesregierung teilt die E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Kommission,dass <strong>der</strong> konstant niedrige und deutlich unter demVergleichswert für die Gesamtbevölkerung liegende Anteilvon 65-Jährigen und Älteren im Sozialhilfebezug belegt,dass ältere Menschen über ausreichende f<strong>in</strong>anzielleMittel verfügen. So bezogen 2003 nur 1,7 Prozent <strong>der</strong> älterenMenschen Leistungen <strong>der</strong> Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung im Vergleich zu 3,3 Prozent<strong>der</strong> Gesamtbevölkerung, die Hilfe zum Lebensunterhaltbezogen. Die E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung – im Jahr 2003 durch das Gesetzüber e<strong>in</strong>e bedarfsorientierte Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, seit 2005 Bestandteil des Sozialhilferechtsim Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – hatdaran nach bisher vorliegenden statistischen Daten nichtsWesentliches verän<strong>der</strong>t. Die Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung wurde e<strong>in</strong>geführt, um die Inanspruchnahmevon Sozialhilfeleistungen für 65-Jährigeund Ältere sowie dauerhaft voll erwerbsgem<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschenzu erleichtern und so <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e verschämte Altersarmutzu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n.Allerd<strong>in</strong>gs wi<strong>der</strong>spricht die Bundesregierung <strong>der</strong> im <strong>Bericht</strong>enthaltenen Auffassung, dass Sozialhilfebezug mitArmut gleichzusetzen ist und <strong>der</strong> sozialhilferechtlicheBedarf e<strong>in</strong>e „quasi offizielle Armutsgrenze“ darstellt.Steuerf<strong>in</strong>anzierte und bedarfsabhängige Sozialleistungen– neben <strong>der</strong> Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungdie Hilfe zum Lebensunterhalt sowie ArbeitslosengeldII und Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch(Grundsicherung für Arbeitsuchende) –decken das soziokulturelle Existenzm<strong>in</strong>imum und damitmehr als das physische Existenzm<strong>in</strong>imum ab.Die Höhe dieser Leistungen orientiert sich am statistischermittelten Verbrauchsverhalten <strong>der</strong> e<strong>in</strong>kommensschwächeren20 Prozent <strong>der</strong> Bevölkerung ohne Sozialhilfebezieherund ermöglicht dadurch den Sozialhilfebezieherne<strong>in</strong>en <strong>der</strong> als Referenzgruppe dienenden Bevölkerungvergleichbaren Lebensstandard. Die konkrete Höhe desdaraus resultierenden sozialhilferechtlichen Bedarfs istvon den Lebensumständen im E<strong>in</strong>zelfall abhängig.Gesetzliche Rentenversicherung undbetriebliche/private AltersvorsorgeZur Empfehlung <strong>der</strong> Kommission, dass die gesetzlicheRentenversicherung bei längerer Versicherungsdauer weiterh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> Leistungsniveau beibehalten soll, das deutlichüber <strong>der</strong> steuerf<strong>in</strong>anzierten bedarfs- o<strong>der</strong> bedürftigkeitsgeprüftenM<strong>in</strong>destsicherung liegt, stellt die Bundesregierungfest, dass dies geltendem Recht entspricht. Bereitsdurch das gesetzlich fixierte M<strong>in</strong>destsicherungsniveau istgewährleistet, dass Versicherte mit längerer Versicherungsdauerauch künftig im Alter e<strong>in</strong>e Rente beziehen,die die Höhe bedarfsabhängiger M<strong>in</strong>destsicherungsleistungendeutlich übersteigt. Das M<strong>in</strong>destniveau beschreibtden Verhältniswert zwischen Standardrente und Durchschnittsentgeltvor Steuern und hat die Funktion e<strong>in</strong>er Untergrenze.Es beträgt m<strong>in</strong>destens 46 Prozent bis zum Jahr2020 und m<strong>in</strong>destens 43 Prozent bis zum Jahr 2030.Zudem nennt das Gesetz als weitergehendes Ziel e<strong>in</strong> Niveauvon 46 Prozent auch über 2020 h<strong>in</strong>aus. Die gesetzlicheRentenversicherung ist und bleibt damit auch <strong>in</strong> Zukunftdie wichtigste Säule <strong>der</strong> Altersversorgung.Versicherte, die die staatlich geför<strong>der</strong>te zusätzliche Altersvorsorge(Riester-Rente) nutzen und auch die E<strong>in</strong>sparungenaus <strong>der</strong> Steuerfreistellung <strong>der</strong> Rentenversicherungsbeiträgenach dem Alterse<strong>in</strong>künftegesetz für e<strong>in</strong>eergänzende Altersvorsorge (Privat-Rente) ansparen, könnendavon ausgehen, dass sie – wie die heutigen Rentner –e<strong>in</strong>e ihren Lebensstandard sichernde Versorgung habenwerden.Die Handlungsempfehlung <strong>der</strong> Kommission, e<strong>in</strong> vergleichbaresSicherungsniveau durch Verr<strong>in</strong>gerung <strong>der</strong>privaten Altersvorsorge unter H<strong>in</strong>nahme e<strong>in</strong>es höherenBeitragssatzes <strong>zur</strong> gesetzlichen Rentenversicherung zuerreichen, ist abzulehnen. Es ist Ansicht <strong>der</strong> Bundesregierung– und hier besteht breiter politischer Konsens –, dassdie Alterssicherung auf e<strong>in</strong>e breitere f<strong>in</strong>anzielle Grundlagegestellt werden muss.Für die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> freiwilligen zusätzlichen kapitalgedecktenAltersvorsorge steht e<strong>in</strong> umfangreiches Instrumentariummit steuerlichen Elementen und Zulagen <strong>zur</strong>Verfügung.Um die För<strong>der</strong>ung von Familien mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zu verbessernwird die K<strong>in</strong><strong>der</strong>zulage für die ab 1. Januar 2008 geborenenK<strong>in</strong><strong>der</strong>n von dann 185 Euro auf 300 Euro jährlicherhöht.Im Jahr 2007 wird die Bundesregierung erneut prüfen,welchen Verbreitungsgrad die betriebliche und privateAltersvorsorge erreicht hat und wie die weitere Entwicklungdes Ausbaus e<strong>in</strong>zuschätzen ist. Wenn sich zeigt, dassdurch die För<strong>der</strong>ung mit den bisherigen Instrumentene<strong>in</strong>e ausreichende Verbreitung <strong>der</strong> freiwilligen, staatlichgeför<strong>der</strong>ten zusätzlichen Altersvorsorge nicht erreichtwerden kann, ist über geeignete weitere Maßnahmen zuentscheiden.Mit <strong>der</strong> Kommission ist die Bundesregierung <strong>der</strong> Ansicht,dass auch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung aller Selbstständigen, diebisher ke<strong>in</strong>em obligatorischen Alterssicherungssystemangehören, ke<strong>in</strong>e dauerhaften f<strong>in</strong>anziellen Vorteile für diegesetzliche Rentenversicherung hätte.H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> weiteren Handlungsempfehlung <strong>der</strong>Kommission, e<strong>in</strong>e enge Beitrags-Leistungs-Beziehung <strong>in</strong><strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung zu erhalten, teilt dieBundesregierung die E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Kommission, dassdas Äquivalenzpr<strong>in</strong>zip von hoher Bedeutung für die Legi-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 21 – Drucksache 16/2190timation und Akzeptanz <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungist. Auch e<strong>in</strong> s<strong>in</strong>kendes Rentenniveau bedeutet allerd<strong>in</strong>gske<strong>in</strong>e Abkehr vom Grundsatz <strong>der</strong> Äquivalenz;selbst wenn kle<strong>in</strong>ere Renten unterhalb des Grundsicherungsniveausliegen, hat dies se<strong>in</strong>e Ursache gerade <strong>in</strong> <strong>der</strong>Entsprechung von Leistung und Gegenleistung.Hierbei handelt es sich im Übrigen häufig um Fälle, <strong>in</strong>denen die Rente nur auf wenigen Beitragsjahren beruhtund <strong>der</strong> Aufbau <strong>der</strong> Altersvorsorge während e<strong>in</strong>es Großteilsdes Erwerbslebens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en Alterssicherungssystemerfolgte.Ferner for<strong>der</strong>t die Kommission <strong>zur</strong> sachgerechten F<strong>in</strong>anzierungvon Umverteilungsaufgaben <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung die Steuerf<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong>H<strong>in</strong>terbliebenenrenten, da die Höhe des Zahlbetrags unterBerücksichtigung aller an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>künfte ermittelt wird.Ferner for<strong>der</strong>t die Kommission <strong>zur</strong> sachgerechten F<strong>in</strong>anzierungvon Umverteilungsaufgaben <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung die Steuerf<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong>H<strong>in</strong>terbliebenenrenten, da die Höhe des Zahlbetrags unterBerücksichtigung aller an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>künfte ermittelt wird.Die Bundesregierung hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>Bericht</strong> an den Haushaltsausschussdes Deutschen Bundestages im Herbst2004 dargelegt, dass die H<strong>in</strong>terbliebenenrente <strong>in</strong> demUmfang als beitragsgedeckt e<strong>in</strong>geordnet werden muss, <strong>in</strong>dem Ehepaare anstelle <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbliebenenversorgungdas 2002 neu e<strong>in</strong>geführte, versicherungsadäquate Rentensplitt<strong>in</strong>gwählen können (das Rentensplitt<strong>in</strong>g ist dem Versorgungsausgleichbei Scheidungen nachgebildet wordenund führt dazu, dass je<strong>der</strong> Ehegatte 50 Prozent <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Ehezeit von beiden Ehegatten erworbenen Anwartschaftenerhält). Insoweit wäre e<strong>in</strong>e Steuerf<strong>in</strong>anzierung nichtsachgerecht.6. Wirtschaftsfaktor AlterDie Bundesregierung unterstreicht die Notwendigkeit,dass sich die Kommission differenziert mit dem Thema„Wirtschaftsfaktor Alter“ ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gesetzt hat. DieNachfrage nach Produkten und Dienstleistungen für ältereMenschen wird <strong>in</strong> den folgenden Jahren weiter zunehmen.Mit <strong>der</strong> Kommission ist sich die Bundesregierungdar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ig, dass die Wachstumschancen <strong>der</strong>deutschen Wirtschaft <strong>in</strong> Zukunft auch davon abhängen,<strong>in</strong>wieweit es gel<strong>in</strong>gt, bei <strong>der</strong> Entwicklung und dem Angebotvon Produkten und Dienstleistungen den Interessenund Bedürfnissen älterer Menschen <strong>in</strong> geeigneter WeiseRechnung zu tragen.Wenn die Wirtschaft die Interessen älterer Menschen stärkeraufgreift, werden sich für die Entwicklung des Marktes,für Wachstum und Beschäftigung neue Perspektivenergeben. Der Freizeit- und Tourismusmarkt, aber auchDienstleistungen im Wohnumfeld, F<strong>in</strong>anzdienstleistungen,Gesundheit o<strong>der</strong> Pflege s<strong>in</strong>d hierfür Beispiele. E<strong>in</strong>ebessere Berücksichtigung <strong>der</strong> Belange Älterer führt zue<strong>in</strong>er höheren Lebensqualität. Zugleich werden mit verfügbarenAlternativangeboten <strong>in</strong> den Gesundheits- undPflegesystemen drohende Fehl- und Mehrausgaben vermiedenund die Chancen auf Schaffung neuer Arbeitsplätzeerhöht.Senior<strong>in</strong>nen und Senioren als WirtschaftsmotorIm Fünften Altenbericht werden die beträchtlichen ökonomischenPotenziale <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft nachvollziehbarbeschrieben und durch Fakten belegt.Die Kommission analysiert den Wirtschaftsfaktor Alterauf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Seite unter dem Aspekt, welche Dienste undAngebote die Lebensqualität älterer Menschen erhöhenund betrachtet ihn gleichzeitig als Impulsgeber für wirtschaftlichesWachstum und Beschäftigung. Da sich beimbeobachteten Anstieg <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebenserwartung vor alleme<strong>in</strong> Gew<strong>in</strong>n an den „aktiven Jahren“ abzeichnet, s<strong>in</strong>d dieAusführungen <strong>der</strong> Kommission von großer Bedeutung.Unter dem Gesichtspunkt <strong>der</strong> festgestellten erheblichenPotenziale unterstreicht die Bundesregierung die For<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> Kommission nach e<strong>in</strong>em Paradigmenwechselbei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong>. Die auchheute noch weit verbreitete Sicht, ältere Menschen seien<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie „Nutzer“ öffentlicher Güter im Bereich <strong>der</strong>sozialen Dienstleistungen und nicht das Angebot lenkendeKonsument<strong>in</strong>nen und Konsumenten, ist zu revidieren.In diesem Zusammenhang vertritt die Kommissiondezidiert die Me<strong>in</strong>ung, dass es ke<strong>in</strong>e Berührungsängste zuprivatwirtschaftlichem Engagement geben könne, wennes um die Erhaltung und Verbesserung <strong>der</strong> Lebenslageund Lebensqualität im Alter gehe. Diesem stimmt dieBundesregierung zu.Die Kommission beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Frage e<strong>in</strong>errückläufigen Konsumnachfrage <strong>in</strong>folge <strong>der</strong> Alterung <strong>der</strong>Gesellschaft. Sie macht deutlich, dass die Älteren e<strong>in</strong>ekaufkräftige Konsumentengruppe darstellen, die denKonsumausfall <strong>der</strong> Jüngeren <strong>in</strong>folge abnehmen<strong>der</strong> Geburtsjahrgängeausgleichen könnten. Dabei wird die demografischeEntwicklung e<strong>in</strong>e Verschiebung <strong>der</strong> Nachfragenach Gütern und Dienstleistungen mit sich br<strong>in</strong>gen,denn ältere Menschen weisen an<strong>der</strong>e spezifische Konsumbedürfnisseals Jüngere auf. Altengerechtes Bauen,Bedienung <strong>der</strong> Rollläden per Knopfdruck, „<strong>in</strong>telligenteHäuser“, akustische Signale für Bl<strong>in</strong>de u. ä., um e<strong>in</strong>ige<strong>der</strong> Vorschläge <strong>der</strong> Kommission hier aufzugreifen, habensich bereits am Markt etabliert und die Bundesregierungist überzeugt, dass e<strong>in</strong>e weitere Ausrichtung des Marktesauf die Bedürfnisse Älterer erfolgen muss und dafür auchgute Chancen bestehen.Auch für die weitere Ausrichtung <strong>der</strong> landwirtschaftlichenE<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ationen können die im 5. Altenberichtaufgezeigten Nachfragepotenziale <strong>der</strong> älteren<strong>Generation</strong> von nicht unerheblicher Bedeutung se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ationens<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> wirksames und an Verbraucher<strong>in</strong>teressenorientiertes Instrument <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenssicherungfür landwirtschaftliche Betriebe. Mehr alsdie Hälfte <strong>der</strong> landwirtschaftlichen E<strong>in</strong>zelunternehmennutzen daher dieses Modell, um zusätzliche E<strong>in</strong>künftedurch Angebote beispielsweise <strong>in</strong> den Bereichen hauswirtschaftlicheund soziale Dienstleistungen o<strong>der</strong> Landtourismuszu erzielen. Bereits heute bestehen <strong>in</strong> diesen
Drucksache 16/2190 – 22 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeBereichen Angebote, die <strong>der</strong> Nachfrage <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong>nach bestimmten Dienstleistungen entsprechen.Aus diesem Nachfragepotenzial lassen sich weitere E<strong>in</strong>kommensmöglichkeitenbzw. e<strong>in</strong>e Erweiterung des bereitsbestehenden Dienstleistungsspektrums <strong>in</strong> ländlichenRäumen ableiten. Durch entsprechende Dienstleistungsangebotesowie e<strong>in</strong>e angepasste Qualifizierung <strong>der</strong> landwirtschaftlichenFamilien können <strong>in</strong> Zukunft diese Potenzialeauch für die ländlichen Räume erschlossen werden.Maßnahmen <strong>der</strong> BundesregierungDer Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 greift dasThema „Wirtschaftsfaktor Alter“ gezielt auf und for<strong>der</strong>tvon den Akteuren <strong>in</strong> Politik und Gesellschaft, konkreteund nachhaltige Angebote zu entwickeln, vorhandeneHemmschwellen abzubauen und Wirtschaftsprozessenicht nur verstärkt auf die Bedürfnisse und Wünsche,son<strong>der</strong>n auch auf das beachtliche ökonomische Potenzialälterer Menschen aus<strong>zur</strong>ichten.Den hierzu erfor<strong>der</strong>lichen Bewusstse<strong>in</strong>swandel hat dasBMFSFJ durch e<strong>in</strong>e Reihe von Maßnahmen bereits e<strong>in</strong>geleitet.Die Studie „Motoren des Seniorenmarktes“ gibtals Basisuntersuchung unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungendes Konsumverhaltens im E<strong>in</strong>zelnen Aufschlussüber Marktvolumen, Wachstums- und Beschäftigungspotenziale.Mit „<strong>in</strong>telligenten“, an den Bedürfnissen Älterer ausgerichtetenProdukten und Dienstleistungen bieten sichChancen, nicht nur e<strong>in</strong>e kaufkräftige, son<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong>egenerationenübergreifende Kundschaft zu gew<strong>in</strong>nen unddie Lebensqualität älterer Menschen zu steigern. DiesesZiel verfolgen e<strong>in</strong>e Reihe weiterer, vom BMFSFJ teils <strong>in</strong>Kooperation mit <strong>der</strong> Wirtschaft <strong>in</strong>itiierter Projekte.Hierzu zählen z. B. das Projekt „Zukunftschancen durchProdukte und Dienstleistungen“ mit Fachforen etwa zuden Themen „Wohnen“ und „Handwerk“ – letzteres <strong>in</strong>Kooperation mit dem Zentralverband des deutschenHandwerks. Die gewonnenen Erkenntnisse werden öffentlichkeitswirksamgebündelt und geme<strong>in</strong>sam mit <strong>der</strong>Wirtschaft für die Anbieter von Produkten und Dienstleistungenaufbereitet. Hierzu soll geme<strong>in</strong>sam mit Unternehmenund Handwerk e<strong>in</strong>e Strategie für e<strong>in</strong>e bundesweiteOnl<strong>in</strong>e-Plattform „Wirtschaftsfaktor Alter“entwickelt werden.Verbraucher<strong>in</strong>nen und Verbrauchern bietet das Informationsportal„Aber sicher: Produkte und Dienste für alleLebensalter“ niedrigschwellige Informationen zum Umgangmit Verbrauchsgütern und Dienstleistungen.Bei <strong>der</strong> Handhabung von Verpackungen haben nicht nurältere Menschen häufig Schwierigkeiten. In dem vomBMFSFJ geme<strong>in</strong>sam mit <strong>der</strong> Berl<strong>in</strong>er Universität <strong>der</strong>Künste durchgeführten Wettbewerb „Design für Alt undJung“ entwickeln Studierende und junge Designer<strong>in</strong>nenund Designer Verpackungen, die die Bedürfnisse Ältereraufgreifen und gleichzeitig generationenübergreifend attraktivs<strong>in</strong>d.In e<strong>in</strong>em Kooperationsprojekt ( „Kompetenz 50 plus“)des BMFSFJ mit dem Hauptverband des deutschen E<strong>in</strong>zelhandels(HDE) und <strong>der</strong> gewerkschaftlichen Bildungse<strong>in</strong>richtung„Arbeit und Leben“ sollen Arbeitslose undvon Arbeitslosigkeit bedrohte ältere Fachkräfte speziell <strong>in</strong><strong>der</strong> Beratung älterer Kunden geschult werden. Auf dieseWeise können Betriebe e<strong>in</strong>erseits für die Notwendigkeitvon Schulungen älterer Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeitersensibilisiert werden. Aufbauend auf dem Kaufkraftpotenzial<strong>der</strong> über 50-Jährigen kann gleichzeitig durchdie Art und Weise <strong>der</strong> Angebote, <strong>der</strong> Präsentation und <strong>der</strong>Beratung e<strong>in</strong>e positive Kaufentscheidung beför<strong>der</strong>t werden.VerbraucherschutzEs ist anzuerkennen, dass die Kommission Ältere nichtnur als mündige Verbraucher<strong>in</strong>nen und Verbraucher <strong>in</strong>den Blick nimmt, son<strong>der</strong>n sich auch mit <strong>der</strong> notwendigenAufrechterhaltung e<strong>in</strong>er souveränen Konsumentenrolleim Alter beschäftigt. Sie konstatiert <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e beikranken sowie pflege- und hilfebedürftigen Verbraucher<strong>in</strong>nenund Verbrauchern e<strong>in</strong>en beson<strong>der</strong>en Bedarf, <strong>der</strong>enKonsumentenrolle zu schützen.Der Verbraucherschutz steht im Spannungsfeld zwischenEigenverantwortung <strong>der</strong> älteren Konsumenten und berechtigtenSchutzansprüche. Die von <strong>der</strong> Kommissionkonstatierten verbraucherpolitisch relevanten ProblemeÄlterer spiegeln die Erkenntnisse e<strong>in</strong>er Reihe von Maßnahmenwi<strong>der</strong>, die das Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ernährung,Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) im Interessee<strong>in</strong>er Verbesserung des Verbraucherschutzes fürSenioren durchgeführt hat. So wurde im Wege <strong>der</strong> Projektför<strong>der</strong>ungdie E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es viel genutzten „Internet-Beschwerdepoolsfür ältere Verbraucher“ auf <strong>der</strong> Homepage<strong>der</strong> Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>der</strong> Senioren-Organisationen (BAGSO) unterstützt. In e<strong>in</strong>em Projekt<strong>der</strong> Verbraucherzentrale NRW standen Wege <strong>zur</strong> Umsetzunge<strong>in</strong>er „Zielgruppenorientierten Verbraucherarbeitfür und mit Senioren“ im Mittelpunkt. Darüber h<strong>in</strong>auswurde mit dem Projekt, „Bedürfnisse älterer Menschenals Konsumenten – Verbesserung <strong>der</strong> Information übernutzergerechte technische Produkte im Haushalt“ des Institutsfür Haushaltstechnik und Ökotrophologie e<strong>in</strong> weiteresvon den Sachverständigen angesprochenes Problemfeldvertieft analysiert.Die Ergebnisse wurden <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er verbrauchernahenBroschüre umgesetzt. Erwähnenswert ist auch die Ernährungsaufklärungskampagne„Fit im Alter – gesund essen,besser leben“.E<strong>in</strong> Schwerpunkt dieser Kampagne ist e<strong>in</strong> bundesweiterBeratungsservice <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für Ernährunge. V. (DGE) zum Thema „Ernährung von Senioren“mit Schulungen für Mitarbeiter/-<strong>in</strong>nen von Seniorene<strong>in</strong>richtungen,Cater<strong>in</strong>g-Unternehmen und ambulanten Pflegediensten.E<strong>in</strong>en weiteren Schwerpunkt <strong>der</strong> Kampagne„Fit im Alter“ bilden Schulungen <strong>zur</strong> gesunden und altersgerechtenErnährung von Senior<strong>in</strong>nen und Senioren,die die Verbraucherzentralen anbieten.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 23 – Drucksache 16/2190Die Kommission äußert <strong>in</strong> Bezug auf den festgestelltenRückzug des Staates aus Teilbereichen <strong>der</strong> Dase<strong>in</strong>svorsorge(z. B. Gesundheits- und Pflegewesen, Strom, Gas,Altersvorsorge) wie auch auf die EU-Dienstleistungsrichtl<strong>in</strong>iedie Sorge, dass damit ältere Bürger <strong>in</strong> sensiblenpersonenbezogenen Dienstleistungsbereichen stärker <strong>in</strong>die Rolle von Verbrauchern gedrängt werden, ohne dassdie dazu nötige Konsumkompetenz gesichert ist. DieBundesregierung ist hier allerd<strong>in</strong>gs <strong>der</strong> Überzeugung,dass die Liberalisierung öffentlicher Dienste die Versorgungdurch e<strong>in</strong> privatwirtschaftliches Angebot an qualitativbesseren, kostengünstigeren, auf die spezifischen Bedarfe<strong>der</strong> Verbraucher ausgerichteten Dienstleistungenverbessern kann. Wie die EuGH-Rechtsprechung geht dieBundesregierung vom Leitbild e<strong>in</strong>es durchschnittlich <strong>in</strong>formiertenund verständigen älteren Verbrauchers aus.Was die EU-Dienstleistungsrichtl<strong>in</strong>ie anbelangt, weist dieBundesregierung darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>der</strong> geän<strong>der</strong>te Richtl<strong>in</strong>ienentwurf<strong>der</strong> EU-Kommission vom 4. April 2006 unddie auf dieser Grundlage erzielte Ratse<strong>in</strong>igung vom29. Mai 2006 wichtige Ausnahmen für personenbezogeneDienstleistungen vorsehen. So s<strong>in</strong>d nun <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dasgesamte Arbeitsrecht, die Rechtsvorschriften über die sozialeSicherheit <strong>in</strong> den Mitgliedstaaten und GesundheitssowieSozialdienstleistungen e<strong>in</strong>schließlich Pflege vomRichtl<strong>in</strong>ienentwurf ausgenommen7. Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und -präventionAlter kann heute nicht mehr mit Krankheit und Unproduktivitätgleichgesetzt werden. Ebenso wie die Kommissionsieht die Bundesregierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Prävention e<strong>in</strong>egroße Chance für e<strong>in</strong> langes Leben <strong>in</strong> Gesundheit, Selbstständigkeitund Eigenverantwortung.Daher unterstreicht sie die im Fünften Altenbericht enthalteneFor<strong>der</strong>ung nach <strong>der</strong> gezielten Nutzung präventiverPotenziale im Alter durch e<strong>in</strong>e stärker präventiveAusrichtung des Gesundheitswesens, e<strong>in</strong>e Kultur präventivenHandelns und e<strong>in</strong>e flächendeckende E<strong>in</strong>führung vonbetrieblichen gesundheitsför<strong>der</strong>lichen Maßnahmen.Die Stärkung <strong>der</strong> gesundheitlichen Prävention und <strong>der</strong>Gesundheitsför<strong>der</strong>ung ist <strong>der</strong> beste Weg, um die Gesundheit<strong>der</strong> Bevölkerung, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die gesundheitlicheSituation von benachteiligten Gruppen – nachhaltig zuverbessern. Mit e<strong>in</strong>em Präventionsgesetz, das die Zusammenarbeit<strong>der</strong> Akteure sowie die Qualität <strong>der</strong> Maßnahmenverbessert und auf geme<strong>in</strong>same Präventionszieleausrichtet, soll dieser Aspekt <strong>der</strong> gesundheitlichen Versorgungausgebaut werden.In Übere<strong>in</strong>stimmung mit dem Fünften Altenbericht hältdie Bundesregierung frühzeitige und lebensbegleitendeMaßnahmen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung des gesunden Alterns und <strong>der</strong>Erhaltung <strong>der</strong> Gesundheit im Alter für wichtig und erfor<strong>der</strong>lich.Das Alter soll als Chance und Erfolg gewertetwerden und unter dem Aspekt des Zugew<strong>in</strong>ns an Lebensqualitätgestaltet se<strong>in</strong>. Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und Präventions<strong>in</strong>d nicht nur <strong>in</strong> jungen Jahren sehr wichtig. Auchnoch im Alter können bereits verlorene Fähigkeiten wie<strong>der</strong>gewonnen werden. Die Bundesregierung setzt daherim H<strong>in</strong>blick auf die Prävention für die Zielgruppe <strong>der</strong>Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte auf Information,Kooperation mit den wichtigsten Akteuren des Gesundheitswesensund auf das breite Angebot an Früherkennungsuntersuchungen.PräventionsmaßnahmenLebensqualität im Alter steht <strong>in</strong> engem Zusammenhangmit Selbstständigkeit und guter gesundheitlicher Verfassung.Sie ist e<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzung, um Potenzialedes Alters auch nutzen zu können. Diese Auffassung wirdvon <strong>der</strong> Bundesregierung une<strong>in</strong>geschränkt geteilt. VielenErkrankungen und damit e<strong>in</strong>hergehenden Funktionse<strong>in</strong>schränkungenim Alter kann durch geeignete präventiveAnsätze im Vorfeld entgegengewirkt werden.Als e<strong>in</strong>e wirksame Maßnahme gilt <strong>der</strong> so genannte präventiveHausbesuch, <strong>der</strong> im Konzept des Präventionsprogramms„Aktive Gesundheitsför<strong>der</strong>ung im Alter“ vomAlbert<strong>in</strong>en Haus <strong>in</strong> Hamburg auf neuartige Weise umgesetztwird. Diesem vom BMFSFJ geför<strong>der</strong>ten Projektwurde <strong>der</strong> Deutsche Präventionspreis 2005 verliehen.Mit e<strong>in</strong>em ganzheitlichen Programm als Komb<strong>in</strong>ationvon gesun<strong>der</strong> ausgewogener Ernährung, Bewegung undsozialem Umfeld werden ältere Menschen befähigt, längergesund zu bleiben und selbstständig zu Hause alt werdenzu können. Der Deutsche Präventionspreis ist e<strong>in</strong>Kooperationsprojekt des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Gesundheit,<strong>der</strong> Bertelsmann Stiftung und <strong>der</strong> Bundeszentralefür gesundheitliche Aufklärung und identifiziert,prämiert und veröffentlicht vorbildhafte Maßnahmen <strong>der</strong>Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung für ältere Menschen,die <strong>zur</strong> Nachahmung motivieren sollen.Die Bundesregierung ist wie die Altenberichtskommission<strong>der</strong> Auffassung, dass <strong>der</strong> Gesundheitszustand bis <strong>in</strong>ssehr hohe Alter durch die Reduzierung bzw. Beseitigungvon Risikofaktoren sowie durch e<strong>in</strong>e gesunde Ernährungund e<strong>in</strong> ausreichendes Maß an körperlicher Bewegunggeför<strong>der</strong>t werden kann. Sie sieht daher die Notwendigkeit,den Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälftegezielte Informationen über gesunde Ernährung,körperliche Betätigung, Stressbewältigung, dieRisiken des Rauchens und e<strong>in</strong>es übermäßigen Alkoholkonsumszu geben und damit die Eigenverantwortungund Kompetenz zu stärken.Wichtig ist <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch e<strong>in</strong> abgestimmtes Zusammenwirken<strong>der</strong> wesentlichen Akteure des Gesundheitswesens.Im Deutschen Forum Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,das auf Initiative des Bundesm<strong>in</strong>isteriums fürGesundheit (BMG) gegründet wurde, s<strong>in</strong>d über 70 wesentlicheAkteure des Gesundheitswesens zusammengeschlossen.Diese arbeiten bei <strong>der</strong> Entwicklung undUmsetzung breitenwirksamer, ganzheitlicher Präventionskonzepteund an <strong>der</strong> Bündelung <strong>der</strong> verschiedenen Präventionsaktivitätenund -strategien <strong>in</strong> Bund, Län<strong>der</strong>n undKommunen zusammen. Mit se<strong>in</strong>er Arbeitsgruppe „Gesundaltern“ will das Forum die körperliche und geistigeLeistungsfähigkeit älterer Menschen nachhaltig stärken.Mit den im Internet veröffentlichten und über die Mit-
Drucksache 16/2190 – 24 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodegliedsverbände verbreiteten „Botschaften für gesundesÄlterwerden“ hat die Arbeitsgruppe mit <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>espositiven Altersbildes begonnen.Das vom BMG durchgeführte Forschungsprojekt „Gesundheitspräventionbei Frauen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte(ab 55 Jahre)“ soll Erkenntnisse über die Notwendigkeitspezifischer Präventionsangebote für dieseZielgruppe erarbeiten.PatientenrechteIm Zusammenhang mit <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung gesundheitsbezogenerKompetenzen älterer Menschen wird im FünftenAltenbericht auf die aktuelle Diskussion <strong>zur</strong> Patientenorientierungund <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung nach mehr Selbstbestimmungim Gesundheitswesen Bezug genommen.Beson<strong>der</strong>s ältere Patient<strong>in</strong>nen und Patienten bemängelten<strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit fehlende Mitbestimmung <strong>in</strong> <strong>der</strong>Gesundheitspolitik und <strong>der</strong> Selbstverwaltung sowie un<strong>zur</strong>eichenddurchgesetzte Patientenrechte, Defizite an Informationund Aufklärung und Intransparenz des Leistungsangebots.Mit dem Gesetz <strong>zur</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> gesetzlichenKrankenversicherung (GKV-Mo<strong>der</strong>nisierungsgesetz)wurden <strong>in</strong>zwischen die Patientensouveränität und die <strong>in</strong>dividuellewie die kollektive Patientenbeteiligung bereitsdeutlich gestärkt.Für die e<strong>in</strong>zelne Patient<strong>in</strong> bzw. den e<strong>in</strong>zelnen Patientenbedeutet das, dass Versicherte auf ihr Verlangen von <strong>der</strong>Ärzt<strong>in</strong> bzw. vom Arzt, von <strong>der</strong> Zahnärzt<strong>in</strong> bzw. vomZahnarzt o<strong>der</strong> vom Krankenhaus e<strong>in</strong>e Kosten- und Leistungs<strong>in</strong>formation<strong>in</strong> verständlicher Form erhalten können.Hiermit wird die Transparenz von Leistung und Kostenerkennbar erhöht.Darüber h<strong>in</strong>aus werden seit Februar 2006 Patienten<strong>in</strong>formationenbarrierefrei über das Institut für Qualität undWirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) <strong>zur</strong>Verfügung gestellt, die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgern Kenntnisseüber die Diagnostik und Therapie von Erkrankungenvermitteln. Dies erleichtert vielen Patient<strong>in</strong>nen undPatienten, sich sachgerecht zu orientieren und e<strong>in</strong>e aufqualitätsgesicherten Informationen beruhende Entscheidungfür o<strong>der</strong> gegen e<strong>in</strong>e diagnostische und therapeutischeMaßnahme zu fällen. Die E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> elektronischenGesundheitskarte mit <strong>der</strong> Abrufbarkeit von Behandlungs<strong>in</strong>formationenwird ebenfalls <strong>zur</strong> Transparenz und Qualitätssicherungim Gesundheitswesen beitragen. Auch anwichtigen Entscheidungen des Gesundheitswesens <strong>in</strong>Gremien <strong>der</strong> gesetzlichen Krankenversicherung werdenPatient<strong>in</strong>nen und Patienten nunmehr beratend beteiligt.Schließlich betont die Kommission die auch aus <strong>der</strong> Sicht<strong>der</strong> Bundesregierung wichtige Rolle <strong>der</strong> Selbsthilfe imS<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Beratung und Unterstützung Betroffener durchBetroffene. Hierbei kommt aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Kommission<strong>der</strong> Infrastruktur wie Seniorenbüros, Freiwilligenagenturenund Selbsthilfekontaktstellen e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Bedeutungzu. Die Bundesregierung unterstützt f<strong>in</strong>anziell imBereich <strong>der</strong> Selbsthilfe verschiedene Selbsthilfeorganisationenund nach § 20 Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch(SGB V) för<strong>der</strong>n auch gesetzliche Krankenkassendie Selbsthilfe.8. Ältere Migrant<strong>in</strong>nen und MigrantenDie Bundesregierung begrüßt es, dass sich die Kommissionbei allen ihren Betrachtungen auch <strong>der</strong> älterenMigrantenbevölkerung zugewandt hat und spezifischeThemen überdies <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigenen Kapitel behandelt hat.Migration und Integration s<strong>in</strong>d zentrale Herausfor<strong>der</strong>ungenfür Politik und Gesellschaft. Ihre Bewältigung kannnur im Mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> aller Beteiligten gel<strong>in</strong>gen.Die Heterogenität älterer Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten istwie die <strong>der</strong> e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerung groß. Gründe dafürs<strong>in</strong>d neben sozioökonomischen Merkmalen u. a. unterschiedlicheKulturzugehörigkeiten, Migrationsh<strong>in</strong>tergründeund Grad <strong>der</strong> kulturellen Integration.Die kulturelle Integration von Migranten und Migrant<strong>in</strong>nenf<strong>in</strong>det <strong>in</strong> Wechselwirkung zwischen Unterstützungsangeboten<strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft e<strong>in</strong>erseits und <strong>der</strong>Integrationsbereitschaft <strong>der</strong> Zugewan<strong>der</strong>ten an<strong>der</strong>erseitsstatt.Die ältere <strong>Generation</strong> <strong>der</strong> Migrant<strong>in</strong>nen und Migrantenverfügt über e<strong>in</strong> zufrieden stellendes Alterse<strong>in</strong>kommenund ist zunehmend besser <strong>in</strong> das System <strong>der</strong> Alterssicherunge<strong>in</strong>gebunden. Gleichwohl s<strong>in</strong>d ausländische Seniorenaufgrund <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Anwerbung von ausländischenArbeitskräften <strong>in</strong> e<strong>in</strong>fache Tätigkeiten <strong>in</strong> <strong>der</strong>Industrie (und damit zumeist ger<strong>in</strong>g bezahlte Tätigkeiten)sowie <strong>der</strong> überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeithäufiger im Alter e<strong>in</strong>em erhöhtem Armutsrisiko ausgesetzt.Darauf verweist auch <strong>der</strong> Zweite Armuts- undReichtumsbericht <strong>der</strong> Bundesregierung von 2005 sowie<strong>der</strong> Sechste <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Beauftragten <strong>der</strong> Bundesregierungfür Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration (2005), <strong>in</strong>dem dargelegt wird, dass die Armutsrisikoquote ältererAuslän<strong>der</strong> (über 60 Jahre) 32,1 Prozent beträgt, die vonDeutschen dagegen nur 9,7 Prozent (Basis: Sozio-OekonomischesPanel 2003). Dennoch ist die fiskalische Bilanzvon älteren Zuwan<strong>der</strong>ern mit langem Aufenthalt <strong>in</strong>Deutschland <strong>in</strong>sgesamt eher positiv – Unterschiede zwischenDeutschen und Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten gibt esbei <strong>der</strong> Erwerbstätigenquote. So s<strong>in</strong>d z. B. nur noch wenigerals die Hälfte aller Türken im erwerbsfähigen Alter<strong>der</strong>zeit erwerbstätig, bei den 45- bis 64-jährigen sogar nur35 Prozent.Menschen ausländischer Herkunft haben generell e<strong>in</strong>deutlich höheres Arbeitsmarktrisiko.Hauptursache hierfür s<strong>in</strong>d neben un<strong>zur</strong>eichen<strong>der</strong> schulischerund beruflicher Qualifikation vor allem Defizite bei<strong>der</strong> sprachlichen Kompetenz. So lag z. B. <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>ausländischen Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung<strong>in</strong> 2005 bei rund 75 Prozent (Deutsche32,7 Prozent). Die Kommission hat angemerkt, dass e<strong>in</strong>eger<strong>in</strong>ge Beschäftigungsquote älterer Auslän<strong>der</strong> auch mite<strong>in</strong>e Folge ihrer außerordentlich ger<strong>in</strong>gen Teilnahme anWeiterbildungsmaßnahmen ist, die gleichfalls durch un<strong>zur</strong>eichendeSprach-, Lese- und Schreibfähigkeiten e<strong>in</strong>geschränktist.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 25 – Drucksache 16/2190IntegrationsmaßnahmenGrundsätzlich steht Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten gleichwelchen Alters, die e<strong>in</strong>e auf Dauer angelegte Aufenthaltsperspektivehaben, <strong>der</strong> Zugang zu allen arbeitsmarktpolitischenRegel<strong>in</strong>strumenten offen. Grundlage hierfür bildetdie Feststellung berufsbezogener <strong>in</strong>dividueller Stärkenund Schwächen, mit dem <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch migrationsspezifischeBedarfe (wie z. B. fehlende Sprachkenntnisse)o<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>e Fähigkeiten (z. B. im <strong>in</strong>terkulturellenBereich) festgestellt werden.So besteht für arbeitslose Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten,die Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch(SGB III) beziehen und über mangelnde berufsbezogeneSprachkenntnisse verfügen, die Möglichkeit, über dieBundesagentur für Arbeit an e<strong>in</strong>em berufsbezogenenSprachkurs teilzunehmen. Derzeit wird e<strong>in</strong>e Ausweitung<strong>der</strong> Maßnahme auf Bezieher von Arbeitslosengeld II nachdem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) geprüft.Die For<strong>der</strong>ung, dass auch für bereits <strong>in</strong> Deutschland lebendeMigranten, die über ke<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> nur mangelhafteDeutschkenntnisse verfügen, e<strong>in</strong>e Teilnahme an Integrationskursenermöglicht wird, ist bereits dem Grunde nachim Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetz verwirklicht worden. Es bestehtgemäß § 44a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sogare<strong>in</strong>e Verpflichtung <strong>zur</strong> Teilnahme an e<strong>in</strong>em Integrationskurs,wenn die Auslän<strong>der</strong>behörde e<strong>in</strong>en Migranten imRahmen verfügbarer Kursplätze <strong>zur</strong> Teilnahme an Integrationskursenauffor<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> wenn e<strong>in</strong> Migrant Leistungennach den Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)erhält und die Leistung bewilligende Stelle die Teilnahmean e<strong>in</strong>em Integrationskurs anregt.Aus Sicht des BMAS ist e<strong>in</strong>e von <strong>der</strong> Kommission angeregteKont<strong>in</strong>gentierung <strong>der</strong> Kursplätze nicht erfor<strong>der</strong>lich,da <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>ungssaldo Deutschlands wesentlich ger<strong>in</strong>gerist als erwartet und <strong>in</strong>sofern die für die Integrationsmaßnahmenveranschlagten Mittel den sog. „Bestandsauslän<strong>der</strong>n“bereits im größeren Umfang als erwartet zuGute kommen.Migration als WirtschaftsfaktorZuwan<strong>der</strong>er und Zuwan<strong>der</strong><strong>in</strong>nen stärken sowohl als Unternehmerund Arbeitgeber als auch als Konsumenten dieWirtschaftskraft <strong>der</strong> Bundesrepublik. Damit leisten sienicht nur wie die e<strong>in</strong>heimische Bevökerung F<strong>in</strong>anzierungsbeiträgezu den von ihnen <strong>in</strong> Anspruch genommenenLeistungen, son<strong>der</strong>n sie entlasten die e<strong>in</strong>heimischeBevölkerung auch von Kosten, die nicht im unmittelbarenZusammenhang mit ihrem Aufenthalt stehen (z. B. Solidaritätsbeitrag).Die Bundesregierung weist daher ergänzend zu den Darlegungen<strong>der</strong> Kommission auf die im Auftrag des früherenBundesm<strong>in</strong>isteriums für Arbeit (BMA) erstellteStudie des ifo Institutes „EU-Erweiterung und Arbeitskräftemigration:Wege zu e<strong>in</strong>er schrittweisen Annäherung<strong>der</strong> Arbeitskräfte“ h<strong>in</strong>. Diese Untersuchung kommt zudem Ergebnis, dass die fiskalische Bilanz von Zuwan<strong>der</strong>ern<strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Aufenthaltsdauer <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ersteht.Bei e<strong>in</strong>er Aufenthaltsdauer von mehr als 25 Jahren (diess<strong>in</strong>d mehr als e<strong>in</strong> Viertel aller <strong>in</strong> Deutschland lebendenAuslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Auslän<strong>der</strong>) erhält die BundesrepublikDeutschland pro Kopf und Jahr 850 Euro an E<strong>in</strong>nahmen.Betrachtet man die e<strong>in</strong>zelnen Sozialversicherungszweige,ist sogar festzustellen, dass bei <strong>der</strong> Renten- undPflegeversicherung Zuwan<strong>der</strong>er Nettozahler, die DeutschenNettoempfänger s<strong>in</strong>d.Pflegebedürftigkeit von Migrant<strong>in</strong>nen und MigrantenDer Fünfte Altenbericht benennt auch die zunehmendeBetroffenheit von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten durchPflegebedürftigkeit. Derzeit leben <strong>in</strong> <strong>der</strong> BundesrepublikDeutschland ca. e<strong>in</strong>e halbe Million Menschen nicht-deutscherHerkunft, die älter als 60 Jahre s<strong>in</strong>d. Statistikerprognostizieren e<strong>in</strong> schnelles Anwachsen dieser Bevölkerungsgruppe<strong>in</strong> den nächsten Jahrzehnten. Damit wird eszunehmend wichtiger, die Leistungsangebote verstärktauch an den Bedürfnissen <strong>der</strong> Menschen aus an<strong>der</strong>en Kulturkreisenaus<strong>zur</strong>ichten und e<strong>in</strong>e bedarfsgerechte Versorgungsicherzustellen.Nach den Ergebnissen e<strong>in</strong>er vom BMFSFJ <strong>in</strong> Auftrag gegebenenStudie über „Die vergessenen Frauen aus <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ergeneration“ist vor allem <strong>der</strong> Gesundheitszustandalle<strong>in</strong> stehen<strong>der</strong> älterer Migrant<strong>in</strong>nen durchpsychische und psychosomatische Belastungen bee<strong>in</strong>trächtigt.Ihr gravierendes Informationsdefizit über dasSystem und die Versorgungsleistungen <strong>der</strong> Altenhilfe verschärftdie Situation und erfor<strong>der</strong>t e<strong>in</strong> Hilfe- und Unterstützungsangebot,das vor allem alters- und anfor<strong>der</strong>ungsgerechtausgelegt ist, damit auch bildungsferneAuslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen quantitativ und qualitativ besser versorgtwerden können.Auch im Rahmen se<strong>in</strong>er Baumodellför<strong>der</strong>ung berücksichtigtdas BMFSFJ die <strong>in</strong>dividuellen Lebensh<strong>in</strong>tergründeund Lebensgewohnheiten <strong>der</strong> älteren Menschen. Das mitMitteln des BMFSFJ neu gestaltete AltenhilfezentrumVictor-Gollancz-Haus <strong>in</strong> Frankfurt am Ma<strong>in</strong> greift <strong>in</strong> beispielgeben<strong>der</strong>Weise die spezifischen Bedürfnisse ältererMenschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund auf, hält maßgeschnei<strong>der</strong>teAngebote des Wohnens und <strong>der</strong> Pflege bereitund stärkt die Möglichkeit gesellschaftlicher Integration.Damit entspricht das Projekt <strong>der</strong> wachsenden gesellschaftlichenAufgabe, für pflegebedürftige Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten Angebote <strong>der</strong> stationären Betreuung zu erproben.Dies gel<strong>in</strong>gt vorbildlich sowohl durch das Leitbild <strong>der</strong>kultursensiblen Pflege als auch durch e<strong>in</strong>e anspruchsvolle,auf Privatheit und Individualität ausgerichtete Architektur(www.baumodelle-bmfsfj.de).Auch das BMG erprobt seit 1996 <strong>in</strong> verschiedenen Regionen<strong>der</strong> Bundesrepublik im Rahmen des Modellprogramms<strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Versorgung Pflegebedürftigerpraxisnah e<strong>in</strong>zelne Modellmaßnahmen für Menschenmit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund. Hierfür hat die Bundesregierungrund 5 Millionen Euro bereitgestellt. Die Modellprojektebetreffen auch den Bereich <strong>der</strong> stationären Pflege.So werden z. B. <strong>in</strong> den Pflegee<strong>in</strong>richtungen des Landes-
Drucksache 16/2190 – 26 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeverbandes für Innere Mission <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pfalz e.V. gegenwärtigrd. 250 pflegebedürftige Personen ausländischer Herkunftunter an<strong>der</strong>em durch 15 Pflegekräfte aus ihremjeweiligen Kulturkreis betreut.Die Erfahrungen mit diesen Modellen s<strong>in</strong>d durchweg positiv,weil kulturelle und sprachliche Barrieren überwundenwerden und viele Pflegekräfte ausländischer Herkunft,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e aus Osteuropa, sich sehr sensibel aufdie Situation <strong>der</strong> Pflegebedürftigen e<strong>in</strong>stellen.Integrationspolitik <strong>der</strong> BundesregierungDie Anfor<strong>der</strong>ungen an die Integrationspolitik haben sichim Laufe <strong>der</strong> letzten fünf Jahrzehnte entscheidend gewandelt.Sie s<strong>in</strong>d umfassen<strong>der</strong>, vielschichtiger und damitschwieriger geworden. Die Bedürfnisse und Problemeälterer Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten s<strong>in</strong>d dabei e<strong>in</strong> wichtigerTeilbereich. Die Integration von rechtmäßig unddauerhaft <strong>in</strong> Deutschland lebenden Zuwan<strong>der</strong>ern gehörtzu den Schwerpunktaufgaben <strong>der</strong> Bundesregierung. Dabeisetzt sich immer stärker die Erkenntnis durch, dass Integrationsbelangee<strong>in</strong>e Vielzahl von Politikbereichendurchdr<strong>in</strong>gen und als gesamtgesellschaftliches Anliegenvon unterschiedlichen Akteuren wahrgenommen und geför<strong>der</strong>twerden müssen. Integrationspolitik muss zu e<strong>in</strong>erbereichs- und verantwortungsübergreifenden Aufgabewerden. Das Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetz ermöglicht den E<strong>in</strong>stieg<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e systematische Integrationspolitik, die diesemLeitgedanken folgt.Der Koalitionsvertrag unterstreicht die Bedeutung e<strong>in</strong>esDialogs mit Migranten als wichtigem Bestandteil von Integrationspolitikund politischer Bildung. Neben e<strong>in</strong>emDialog zu religionsspezifischen Fragen bemüht sich dasBundesm<strong>in</strong>isterium des Innern dabei auch um e<strong>in</strong>en Dialogmit Migrantenorganisationen zu allgeme<strong>in</strong>en Fragen<strong>der</strong> Integrations- und Migrationspolitik. Diese Bemühungenbasieren auf <strong>der</strong> Überzeugung, dass Migrantenorganisationendank ihres Erfahrungswissens, ihres spezifischenProblembewusstse<strong>in</strong>s und ihres Selbsthilfepotenzials e<strong>in</strong>ezentrale Mittlerrolle im Integrationsprozess e<strong>in</strong>nehmenkönnen.Angesichts knapper gewordener F<strong>in</strong>anzmittel ist es wichtig,dass sich alle Kräfte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Integrationspolitik besservernetzen und mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> kooperieren.Neben <strong>der</strong> Aneignung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verbesserung deutscherSprachkenntnisse und <strong>der</strong> Aneignung von Grundkenntnissenüber die deutsche Gesellschaft ist e<strong>in</strong>e aktive Mitwirkung<strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er notwendig: Eigen<strong>in</strong>itiative,Hilfe <strong>zur</strong> Selbsthilfe und vor allem ehrenamtliches Engagement<strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er s<strong>in</strong>d vor allem auch bei älterenMigranten erfor<strong>der</strong>lich.Um muslimischen Frauen den Zugang <strong>zur</strong> politischen undgesellschaftlichen Teilhabe zu erleichtern, hat dasBMFSFJ geme<strong>in</strong>sam mit <strong>der</strong> Integrationsbeauftragten <strong>der</strong>Bundesregierung und <strong>der</strong> Muslimischen Akademie <strong>in</strong>Deutschland e.V. e<strong>in</strong> Dialogforum mit Vertreter<strong>in</strong>nenmuslimischer Frauenorganisationen den Frauenbeauftragten<strong>der</strong> islamischen Dachverbände und <strong>der</strong> überregionalenZusammenschlüsse von Muslimen <strong>in</strong> Deutschlandaufgebaut.Das Dialogforum, das zweimal im Jahr tagt, will e<strong>in</strong>enBeitrag dazu leisten, dass muslimische Frauen <strong>in</strong>Deutschland ihre Religion frei von ungerechtfertigten Benachteiligungenleben und ihre Vertreter<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Gesellschaftund Politik mit eigener Stimme sprechen und gehörtwerden können.Die Bundesregierung unterstützt die Feststellung des5. Altenberichts, dass Migration per se ke<strong>in</strong>e Lösung desdemografischen Problems darstellt. Sie kann nur danne<strong>in</strong>e Antwort auf Probleme <strong>der</strong> Arbeitsmarktentwicklungdarstellen, wenn Zuwan<strong>der</strong>ung bedarfsorientiert gesteuertwird. Mit dem Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetz wurden deshalb flexibleZulassungs- und Steuerungs<strong>in</strong>strumente für e<strong>in</strong>e bedarfsgerechteBerücksichtigung e<strong>in</strong>er jeweils spezifischenFachkräftenachfrage <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>geführt.Primäres arbeitsmarktpolitisches Ziel ist die Ausschöpfungdes <strong>in</strong> Deutschland lebenden Erwerbspersonenpotenzialsbei gleichzeitiger vorsichtiger Öffnung desArbeitsmarktes für beson<strong>der</strong>s Hochqualifizierte. Die Öffnungfür Hochqualifizierte aus dem Ausland ist dabei wenigerambivalent zu bewerten als dies seitens <strong>der</strong> Kommissionerfolgt. Die Abwan<strong>der</strong>ung Hochqualifizierterbedeutet zwar zunächst immer e<strong>in</strong>en Verlust an Humanressourcenfür das Herkunftsland. Dieser kann jedochwie<strong>der</strong> kompensiert werden, wenn Migranten durch denAufbau neuer Geschäftsbeziehungen, durch Rücküberweisungen,Investitionen und Knowhow-Transfer <strong>in</strong> ihrenHerkunftsregionen Fortschritt, Innovation und wirtschaftlichenAufschwung auslösen. Migration ist unter diesenUmständen primär als Motor für die gesellschaftlicheEntwicklung zu sehen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 27 – Drucksache 16/2190Fünfter <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Bundesrepublik DeutschlandPotenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft und GesellschaftDer Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en<strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Sachverständigenkommissionan dasBundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und JugendBerl<strong>in</strong>, im August 2005
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 29 – Drucksache 16/2190InhaltsverzeichnisSeiteVorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Potenziale des Alters – E<strong>in</strong>leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.1 Der Auftrag des 5. Altenberichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.2 Potenziale des Alters im Verständnis <strong>der</strong> 5. Altenberichtskommission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.2.1 Gew<strong>in</strong>n an aktiven Jahren und <strong>in</strong>dividuelle Potenziale . . . . . . . . . 481.2.2 Kollektives Altern und gesellschaftliche Entwicklung . . . . . . . . . 491.2.3 Altersbil<strong>der</strong> und Potenziale des Alters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.3 Der demografische Wandel als H<strong>in</strong>tergrund für die wachsendeBedeutung <strong>der</strong> Potenziale des Alters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.4 Leitbil<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531.5 Möglichkeiten und Wirklichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541.6 Überblick über den <strong>Bericht</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Erwerbsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.1 E<strong>in</strong>leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.2 <strong>Lage</strong>analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.2.1 Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 55- bis 64-jährigen Männer undFrauen, 1970 und 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.2.2 Der Zusammenhang von Qualifikation und BeschäftigungsquoteÄlterer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622.2.3 Zum erhöhten Arbeitsmarktrisiko älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642.2.4 Zur Situation schwer beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitsweltund auf dem Arbeitsmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662.2.5 Der E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> Nationalität auf das Erwerbsverhalten Älterer . . 662.2.6 Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland . . . . . . . . . . . . 682.2.7 E<strong>in</strong>kommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.2.8 Arbeitszeit Älterer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.2.9 Gesundheit, Alter und Erwerbsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762.2.10 Betrieb, Arbeitsorganisation und Beschäftigung Älterer . . . . . . . . 782.2.11 Die subjektive Seite: Wächst <strong>der</strong> Wunsch, länger erwerbstätigzu bleiben? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792.3 Erste Schlussfolgerungen und Zielsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 812.3.1 Schlussfolgerungen aus <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812.3.2 Zielsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Drucksache 16/2190 – 30 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSeite2.4 Die bisherigen Reaktionen <strong>der</strong> Politik und <strong>der</strong> Sozialpartner . . . . 842.4.1 Die Reform <strong>der</strong> Rentensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842.4.2 Reformen <strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852.4.3 Tarifpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.4.4 Betriebsbezogene Aktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882.4.4.1 För<strong>der</strong>- und Modellprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882.4.4.2 Betriebliche Gesundheitspolitik und -för<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . . . . 882.4.4.3 Arbeitsgestaltung, Gruppenarbeit, Personalentwicklung undLaufbahnplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892.4.4.4 Arbeitszeitgestaltung und -anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902.4.4.5 Lebensarbeitszeitgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.5 Handlungsgrundsätze und -empfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.5.1 Handlungsgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.5.2 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973.1 E<strong>in</strong>leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973.2 Zum Bildungsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983.3 Bildung und Lernen im Erwerbsalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003.3.1 Allgeme<strong>in</strong>e Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.3.2 Berufliche Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033.3.3 Erträge und Nutzen von beruflicher Weiterbildung . . . . . . . . . . . . 1073.4 Bildung und Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase . . . . . . . . . . . . . . . . 1093.4.1 Partizipation an Bildungsangeboten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093.4.2 Bildungsangebote für Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase . . . . . . 1093.4.3 Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Qualifikation älterer Menschen als e<strong>in</strong>eHerausfor<strong>der</strong>ung für die Erwachsenenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . 1103.4.4 För<strong>der</strong>ung von gesundheitsbezogenen Kompetenzen . . . . . . . . . . 1113.5 Handlungsgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123.5.1 Zur Notwendigkeit des Ausbaus lebenslangen Lernens <strong>in</strong> <strong>der</strong>Erwerbs- und Nacherwerbsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133.5.2 Die F<strong>in</strong>anzierung lebenslangen Lernens als politische Wertentscheidung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153.5.3 Grundsätze <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierung lebenslangen Lernens . . . . . . . . . . . 1163.5.3.1 Erwachsenenbildungsför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163.5.3.2 Grundversorgung mit allgeme<strong>in</strong>er Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183.5.3.3 Bildungssparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.5.3.4 Ausbau betrieblicher Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.5.3.5 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.5.3.6 Sprachkurse für Zuwan<strong>der</strong>er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 31 – Drucksache 16/2190Seite3.5.4 Empfehlungen <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen fürlebenslanges Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213.5.4.1 Informations- und Beratungsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213.5.4.2 Anerkannte Abschlüsse und Module als Orientierungspunktefür Weiterbildungsentscheidungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213.5.4.3 Profil<strong>in</strong>g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213.5.4.4 Zertifizierung von vorhandenem Wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213.5.4.5 Zeitliche Flexibilisierung <strong>der</strong> Weiterbildungsangebote . . . . . . . . . 1223.5.4.6 Lernför<strong>der</strong>liche Arbeitsorganisation und non formales und<strong>in</strong>formelles Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223.5.4.7 Anreize zum lebenslangen Lernen durch Entwicklungen <strong>in</strong>Arbeits- und Produktmärkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223.5.4.8 Gezielte För<strong>der</strong>ung bildungsferner Schichten . . . . . . . . . . . . . . . . 1233.5.4.9 För<strong>der</strong>ung von Eigenverantwortung im Gesundheitssystem . . . . . 1233.5.4.10 Entwicklung von Qualitätsstandards als Grundlage gezielterFör<strong>der</strong>ung von Bildungsbeteiligung nach <strong>der</strong> Erwerbsphase . . . . . 1233.5.4.11 Vermehrte Ansprache älterer Menschen als mitverantwortlicheBürger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233.5.5 För<strong>der</strong>ung des geme<strong>in</strong>samen Lernens <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en . . . . . . . . 1233.6 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244 E<strong>in</strong>kommenslage im Alter und künftige Entwicklung . . . . . . . 1274.1 Zu den Schwerpunkten des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274.2 Zur <strong>der</strong>zeitigen E<strong>in</strong>kommenslage im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274.2.1 Heterogenität <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenslage im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284.2.2 E<strong>in</strong>kommensarmut im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354.3 Zur <strong>der</strong>zeitigen Vermögenslage im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374.4 Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung und die gesamtwirtschaftlicheProduktivitäts- und E<strong>in</strong>kommensentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . 1394.4.1 Altersspezifische Produktivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394.4.2 Rückgang <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404.4.3 Kapitalfundierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialen Sicherung als positiverWachstumsfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414.5 Perspektiven <strong>der</strong> künftigen E<strong>in</strong>kommensentwicklung im Alterangesichts bereits beschlossener Reformmaßnahmen . . . . . . . . . . 1424.6 Beurteilungskriterien für die E<strong>in</strong>kommenslage im Alter . . . . . . . . 1474.7 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475 Chancen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Deutschland . . . . . . . . . . . 1495.1 Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Drucksache 16/2190 – 32 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSeite5.2 E<strong>in</strong>kommensverwendung im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505.2.1 Gesamtausgaben älterer Haushalte – auch im Vergleich zuHaushalten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Spätphase des Erwerbslebens –die Situation des Jahres 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505.2.2 Ausgaben für wichtige Gütergruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515.2.3 Ersparnisbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515.2.4 Erste Folgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515.3 Entwicklungsstand <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Deutschland . . . . . . 1525.3.1 Ausgewählte Gestaltungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft . . . . . . . . . 1535.3.1.1 Wohnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535.3.1.2 Mobilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545.3.1.3 Reisen und Tourismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555.3.1.4 Neue Medien und Telekommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565.3.1.5 Gesundheitswirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575.3.1.6 Freizeit, Gesundheit und Wellness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585.3.1.7 F<strong>in</strong>anzdienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595.4 Exkurs: Der japanische Silbermarkt (‚shirubâ maketto‘) . . . . . . . . 1605.5 Seniorenwirtschaftliche Initiativen <strong>in</strong> Bund, Län<strong>der</strong>n undGeme<strong>in</strong>den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515.6 Verbraucherpolitik und Verbraucherschutz für ältere Menschen . . 1645.6.1 Das Spannungsfeld <strong>der</strong> altersspezifischen Verbraucherpolitik . . . 1665.6.2 Ausgewählte verbraucherpolitisch relevante Probleme Älterer . . . 1665.6.3 Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1695.7 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 Potenziale des Alters <strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken . . . 1726.1 E<strong>in</strong>leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726.2 <strong>Lage</strong>analyse: Potenziale <strong>in</strong> Familien und privaten Netzwerken . . . 1746.2.1 Hilfe und Unterstützung <strong>in</strong> verschiedenen Beziehungstypen . . . . . 1746.2.1.1 Heterosexuelle Partnerschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1746.2.1.2 Homosexuelle Partnerschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1786.2.1.3 Eltern und ihre erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816.2.1.4 Großeltern und ihre Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1856.2.2 Bedeutung sozialer Netze für pflegebedürftige Menschen . . . . . . . 1876.2.2.1 Leistungen familialer und privater Netzwerke im Bereich Pflege 1886.2.2.2 Ungedeckte Bedarfe und un<strong>zur</strong>eichende Nutzung von Angeboten 1886.3 Schlussfolgerungen und Zielsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906.3.1 Schlussfolgerungen aus <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906.3.2 Ziele und Handlungsgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916.3.2.1 Vorhandene Potenziale erhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916.3.2.2 Neue Potenziale stärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 33 – Drucksache 16/2190Seite6.4 Maßnahmen zum Erhalt und <strong>zur</strong> Stärkung familialer undprivater Netzwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916.5 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 Engagement und Teilhabe älterer Menschen . . . . . . . . . . . . . . 1997.1 E<strong>in</strong>leitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997.1.1 Zeit für e<strong>in</strong>e Zwischenbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997.1.2 Potenziale und gesellschaftliche Erwartungen . . . . . . . . . . . . . . . . 1997.1.3 Aufbau des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007.2 Neuere Entwicklungen beim bürgerschaftlichen Engagementälterer Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007.2.1 Allgeme<strong>in</strong>e Trends im Feld „bürgerschaftliches Engagement“ . . . 2017.2.2 Entwicklungen im Feld des freiwilligen Engagements von undfür ältere Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2027.3 Empirische Befunde zum freiwilligen Engagement ältererMenschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2067.3.1 Faktisches Engagement von älteren Menschen . . . . . . . . . . . . . . . 2067.3.2 Engagementpotenziale und Engagementmobilität . . . . . . . . . . . . . 2107.3.3 Soziale Ungleichheiten im freiwilligen Engagement . . . . . . . . . . . 2137.3.4 Produktivität im Alter: Fazit und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167.4 Ziele und Ambivalenzen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . 2177.4.1 Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177.4.2 Ambivalenzen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187.5 Optionen und Maßnahmen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . 2217.5.1 Voraussetzungen und Anfor<strong>der</strong>ungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2217.5.2 Neue Wege <strong>der</strong> Erprobung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2227.5.3 Unterstützende Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2227.6 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238 Migration und Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft undGesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278.1 Kulturübergreifende und kulturspezifische Def<strong>in</strong>itionenvon Potenzialen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278.2 Migration: Prognosen und Szenarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288.3 Zur Datenlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318.4 Demografische Struktur und Entwicklung <strong>der</strong> Migrantenbevölkerung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2328.5 Ältere Migrantenbevölkerung als Wirtschaftsfaktor:E<strong>in</strong>kommenssituation und E<strong>in</strong>kommensquellen . . . . . . . . . . . . . . 2348.5.1 Erwerbsquote und Erwerbstätigenquote älterer Migranten . . . . . . 235
Drucksache 16/2190 – 34 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSeite8.5.2 Arbeitslosigkeit älterer Migranten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388.5.3 Makroökonomische Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2408.5.4 Bezug öffentlicher Transferleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2418.5.5 Bezug von Sozialhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2418.6 Sprachkenntnisse und Bildungssituation älterer Migranten . . . . . . 2438.7 Gesundheitliche Situation älterer Auslän<strong>der</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . 2448.8 Familien und soziale Netzwerke älterer Migranten . . . . . . . . . . . . 2458.8.1 Potenziale älterer Migranten <strong>in</strong> familialen und weiterensozialen Netzwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2478.8.2 Potenziale im freiwilligem Engagement älterer Migranten . . . . . . 2488.9 Mobilitätspotenziale und Wan<strong>der</strong>ungsverhalten ältererMigranten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518.9.1 Rückkehr <strong>in</strong>s Herkunftsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518.9.2 Beziehungen zum Herkunftsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2528.9.3 Pendelmigration / Transmigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2528.10 Handlungsgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2538.11 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2549 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . 2579.1 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2579.1.1 Auftrag <strong>der</strong> 5. Altenberichtskommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2579.1.2 Was leisten ältere Menschen für die Gesellschaft? . . . . . . . . . . . . 2589.1.3 Was könnten ältere Menschen für die Gesellschaft leisten? . . . . . 2609.1.4 Alternde Gesellschaft und die Neugestaltung des Lebenslaufs . . . 2629.1.5 Sozial differenzierte Maßnahmen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung vonPotenzialen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639.2 Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 35 – Drucksache 16/2190AbbildungsverzeichnisSeiteAbbildung 1 Altersaufbau <strong>der</strong> Bevölkerung im Erwerbsalter . . . . . . . . . 51Abbildung 2Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 25- bis 44-Jährigen und<strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> <strong>der</strong> EuropäischenUnion (15) 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Abbildung 3 Erwerbspersonenpotenzial <strong>in</strong> Mio. Personen (<strong>in</strong> Prozent) . . 58Abbildung 4Abbildung 5Abbildung 6Abbildung 7Abbildung 8Abbildung 9Erwerbsquoten <strong>in</strong> Deutschland und EU 15 <strong>in</strong> Prozent<strong>der</strong> Bevölkerung im Alter von 55 bis 64 Jahren,1970 und 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Erwerbsquoten <strong>in</strong> Dänemark und Schweden <strong>in</strong> Prozent<strong>der</strong> Bevölkerung im Alter von 55 bis 64 Jahren,1970 und 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen nachQualifikation <strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Union (EU-15),2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen und<strong>der</strong> 45- bis 54-Jährigen nach Qualifikation undGeschlecht <strong>in</strong> Deutschland, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Arbeitslosenquote <strong>der</strong> 55- bis 61-Jährigen <strong>in</strong> Relation<strong>zur</strong> durchschnittlichen Arbeitslosenquote 2003 . . . . . . . . . . 64Ältere Arbeitslose (55 bis unter 65 Jahre) <strong>in</strong> Deutschland,1992 bis 2002, Anteile an allen Arbeitslosen . . . . . . . . . . . 65Abbildung 10 Situation vor Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Altersrente nach Landesteil . . . . . 68Abbildung 11Anteil <strong>der</strong> Erwerbstätigen, Erwerbslosen und Nichterwerbspersonenan <strong>der</strong> weiblichen Bevölkerungim Erwerbsalter (20- bis 64-Jährige), West- undOst-Deutschland 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Abbildung 12 E<strong>in</strong>kommen nach Alter und Geschlecht . . . . . . . . . . . . . . . 71Abbildung 13Abbildung 14Abbildung 15Abbildung 16Abbildung 17Abbildung 18Durchschnittliche gewöhnliche Wochenarbeitszeiten<strong>der</strong> 25- bis 44-jährigen und <strong>der</strong> 55- bis 64-jährigenArbeitnehmer <strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Union (15), 2004 . . . . . 73Verteilung <strong>der</strong> Wochenarbeitszeit <strong>der</strong> 25- bis 44-Jährigenund <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> Deutschland, 2004 . . . . . . . 73Verteilung <strong>der</strong> Wochenarbeitszeit <strong>der</strong> 25- bis 44-Jährigenund <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> Schweden, 2004, 1995 . . . . 74Gesundheitliche und an<strong>der</strong>e Gründe für Nicht-Erwerbstätigkeitim Geschlechtervergleich (Angaben <strong>in</strong> Prozent;Mehrfachnennungen möglich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Erwerbstätige nach Altersgruppen und Betriebsgröße,2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Monatsverdienst <strong>in</strong> Deutschland nach Ausbildungund Geschlecht, 2002 (Vollzeitbeschäftigte) . . . . . . . . . . . . 87Abbildung 19 Allgeme<strong>in</strong>e Weiterbildung 1979 bis 2003 im Vergleich . . . 103Abbildung 20Anteil weiterbilden<strong>der</strong> Unternehmen an allenUnternehmen 1999 – <strong>in</strong> Prozent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Abbildung 21: Öffentliche För<strong>der</strong>ung des Lebensunterhalts: Status quoim Vergleich zu den Empfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Drucksache 16/2190 – 36 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSeiteAbbildung 22Abbildung 23Abbildung 24Abbildung 25Abbildung 26Abbildung 27Abbildung 28Abbildung 29Abbildung 30Abbildung 31Abbildung 32Staffelung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung nach öffentlichem undprivatem Interesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Alterssicherung für verschiedene Gruppen vonErwerbstätigen <strong>in</strong> Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129E<strong>in</strong>kommensstruktur nach E<strong>in</strong>kommensarten bei E<strong>in</strong>- undZweipersonenhaushalten von Rentner<strong>in</strong>nen und Rentnern<strong>in</strong> West- und Ostdeutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Verteilung <strong>der</strong> Altersrenten nach Zahlbetragsklassenim Bestand <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungam 31.12.2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Schichtung des Nettoe<strong>in</strong>kommens von 65-Jährigen undÄlteren – Westdeutschland 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Schichtung des Nettoe<strong>in</strong>kommens von 65-Jährigen undÄlteren – Ostdeutschland 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Ausländische Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland nach Staatsangehörigkeitenim Jahr 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Altersstruktur ausgewählter Staatsangehörigkeitenim Jahr 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Erwerbstätigenquoten für ausgewählte Nationalitäten<strong>in</strong> Deutschland-West, 1982 - 1992 - 2002 . . . . . . . . . . . . . . 236Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte <strong>in</strong> <strong>der</strong> BundesrepublikDeutschland nach Wirtschaftszweigen1975-2001; <strong>in</strong> Prozent <strong>der</strong> gesamten ausländischenbzw. deutschen Beschäftigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Erwerbstätigkeit nach Alter von Deutschen undAuslän<strong>der</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 37 – Drucksache 16/2190TabellenverzeichnisSeiteTabelle 1Tabelle 2Tabelle 3Tabelle 4Tabelle 5Tabelle 6Tabelle 7Tabelle 8Tabelle 9Tabelle 10Tabelle 11Tabelle 12Tabelle 13Tabelle 14Tabelle 15Tabelle 16Entwicklung <strong>der</strong> Bevölkerungszahl und des Anteils ältererMenschen <strong>in</strong> Deutschland, 1953 - 2050 . . . . . . . . . . . . . . . . 51Beschäftigungsquoten Älterer <strong>in</strong> Deutschland, Schweden,Norwegen und <strong>der</strong> Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Rentenzugänge wegen verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Erwerbsfähigkeit beideutschen und ausländischen Versicherten im Jahr 2004 . . 67Beschäftigungsquote, nach Altersgruppen im früherenBundesgebiet und <strong>in</strong> den Neuen Bundeslän<strong>der</strong>n, 1991und 2003, sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> DDR 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Gründe für den Wunsch nach Arbeitszeitverkürzungnach Altersgruppen (Angaben <strong>in</strong> Prozent) . . . . . . . . . . . . . . 75Teilnahme an Weiterbildung nach Altersgruppen1979 - 2003 im früheren Bundesgebiet, Teilnahmequoten<strong>in</strong> Prozent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Beteiligung an verschiedenen Arten des <strong>in</strong>formellenberuflichen Kenntniserwerbs bei Erwerbstätigenim Jahr 2003 im Bundesgebiet und im Ost-West-Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> beruflichen Situation durch beruflicheWeiterbildung im Bundesgebiet 1997, 2000 und 2003 . . . . 108Netto-Gesamte<strong>in</strong>kommen von ehemals abhängigBeschäftigten (Männer ab 65 Jahre) nach Art<strong>der</strong> Alterssicherung 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Mittelwerte <strong>der</strong> Zahlbeträge und Berechnungsgrundlagenvon Altersrenten aus <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Nettoe<strong>in</strong>kommen im Alter ab 65 – nach Geschlecht undFamilienstand <strong>in</strong> West- und Ostdeutschland 2003<strong>in</strong> Euro/Monat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Die wichtigsten E<strong>in</strong>kommensquellen <strong>der</strong> Bevölkerungab 65 Jahren (<strong>in</strong> Prozent des Bruttoe<strong>in</strong>kommensvolumens). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Gruppenspezifische Armutsrisikoquoten <strong>in</strong> Prozent<strong>in</strong> Deutschland nach Geschlecht, Alter, Erwerbsstatusund Haushaltstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Armutsgrenzen bzw. -risikoschwellen 2003 beialternativen Datengrundlagen und Äquivalenzziffern –Grenze <strong>in</strong> Prozent des Medians des gesamtdeutschenNettoäquivalenze<strong>in</strong>kommens – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Gruppenspezifische Armutsrisikoquoten von„Altenhaushalten“ 2003 nach Haushaltstyp– <strong>in</strong> Prozent – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Mittelwerte des Nettovermögens und Verän<strong>der</strong>ungenzwischen 1993 und 2003 nach sozialen Gruppen(1000 Euro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Tabelle 17 Nettovermögen von Rentnern 2003 (<strong>in</strong> 1000 Euro) . . . . . . 138Tabelle 18Nettovermögen von „Altenhaushalten“ (65 Jahre und älter)2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Drucksache 16/2190 – 38 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 19SeiteReformbed<strong>in</strong>gte Reale<strong>in</strong>kommensän<strong>der</strong>ung (gesetzlicheund private Rente) für e<strong>in</strong>en ledigen „Eckrentner“im Monat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Tabelle 20 Sparquoten <strong>in</strong> Prozent, 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Tabelle 21Tabelle 22Tabelle 23Tabelle 24Tabelle 25Tabelle 26Tabelle 27Tabelle 28Tabelle 29Tabelle 30Tabelle 31Familienstandsstrukturen <strong>der</strong> 65 Jahre und älteren Männerund Frauen, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Familienstandsstrukturen <strong>der</strong> 65 Jahre und Älteren nachAltersgruppen (Deutschland 2002 und 2030) . . . . . . . . . . . 176Anteil <strong>der</strong> Alle<strong>in</strong>lebenden 40- bis 85-jährigen Nicht-Deutschen und Deutschen im Jahr 2002 . . . . . . . . . . . . . . . 177Wohnentfernung zum nächstwohnenden K<strong>in</strong>d ab 16 Jahrennach Altersgruppen, 1996 und 2002, für Deutsche undNicht-Deutsche (<strong>in</strong> Prozent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Kontakthäufigkeit zu dem K<strong>in</strong>d ab 16 Jahren mit denmeisten Kontakten, nach Altersgruppen, 1996 und 2002,für Deutsche und Nicht-Deutsche (<strong>in</strong> Prozent) . . . . . . . . . . 183Geleistete <strong>in</strong>formelle Unterstützung <strong>in</strong> den vergangenen12 Monaten (<strong>in</strong> Prozent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Erhaltene <strong>in</strong>formelle Unterstützung <strong>in</strong> den vergangenen12 Monaten (<strong>in</strong> Prozent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184<strong>Generation</strong>enkonstellationen im Familienverbund nachAltersgruppen, 1996 und 2002 (<strong>in</strong> Prozent) . . . . . . . . . . . . . 186Beteiligung am bürgerschaftlichen Engagement <strong>in</strong>verschiedenen Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Aufgewendete Zeit für bürgerschaftliches Engagement<strong>in</strong> verschiedenen Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Bereitschaft zum freiwilligen Engagement nachGeschlecht und Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Tabelle 32 Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> ehrenamtlichen Tätigkeiten 1996-2002(Reihenprozente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Tabelle 33 Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> ehrenamtlichen Tätigkeiten 1996-2002(Kennziffern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Tabelle 34Tabelle 35Tabelle 36Tabelle 37Soziale Ungleichheit des freiwilligen Engagements:Anteile <strong>in</strong> sozialen Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Soziale Ungleichheit des freiwilligen Engagements:Ost-West-Unterschiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Soziale Ungleichheit des freiwilligen Engagements:Geschlechterproportionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Mittel- und osteuropäische Programmarbeiter<strong>in</strong> Deutschland, 1991 bis 2002, <strong>in</strong>sgesamt . . . . . . . . . . . . . . 229Tabelle 38 Altersstruktur ausgewählter Staatsangehörigkeiten 2003 . . 233Tabelle 39Tabelle 40Ausländische und deutsche Altersbevölkerung <strong>in</strong>Deutschland, 1991-2003 – <strong>in</strong> 1.000 Personen . . . . . . . . . . . 233Übersicht zu den betrieblichen und gesamtwirtschaftlichenLeistungspotenzialen ausländischstämmigerSelbstständigkeit <strong>in</strong> Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 39 – Drucksache 16/2190Tabelle 41Tabelle 42SeiteInanspruchnahme von Sozialhilfe <strong>der</strong> älteren ausländischenund deutschen Bevölkerung, 31.12.2003 nach Geschlecht . . 242Armutsrisikoquoten bei <strong>der</strong> Bevölkerung mit und ohneMigrationsh<strong>in</strong>tergrund 1998-2003 <strong>in</strong> Prozent . . . . . . . . . . . 242Tabelle 43 Familienstand nach Nationalität und Alter, 1997/2002,<strong>in</strong> Prozent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Tabelle 44Gesamtbesuchsdauer <strong>in</strong> den letzten zwei Jahrennach Alter, 1996/2002, <strong>in</strong> Prozent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Drucksache 16/2190 – 40 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeÜbersichtenverzeichnisSeiteÜbersicht 1Übersicht 2Reformen <strong>der</strong> Alterssicherung – Schwerpunkte<strong>der</strong> Jahre 2001 bis 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Begriffe: Aktive Beteiligung, freiwilliges Engagementund ehrenamtliche Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 41 – Drucksache 16/2190VorwortDer Kommission <strong>zur</strong> Erstellung des 5. Altenberichts wurden drei Aufgaben gestellt.Erstens sollte sie e<strong>in</strong>e Beschreibung <strong>der</strong> Potenziale des Alters sowie ihrer Entwicklungbis zum Jahre 2020 vornehmen. Zweitens sollte sie Antwort auf die Frage geben,<strong>in</strong>wieweit die Potenziale des Alters gesellschaftlich besser genutzt werden können.Und drittens sollte sie Empfehlungen für Politik und Gesellschaft <strong>zur</strong> besserenNutzung <strong>der</strong> Potenziale des Alters entwickeln.Die Kommission, die im Mai 2003 von <strong>der</strong> Bundesm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> für Familie, Senioren,Frauen und Jugend, Renate Schmidt, berufen wurde, hat <strong>in</strong> 19 Sitzungen den vorliegenden<strong>Bericht</strong> erarbeitet. Die e<strong>in</strong>zelnen Kapitel bilden das Ergebnis ausführlicherDiskussionen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kommission; für die Ausformulierung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Kapitelwaren jeweils e<strong>in</strong>zelne Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kommission und <strong>der</strong> Geschäftsstelle zuständig.Für das Kapitel 1 (Potenziale des Alters – E<strong>in</strong>leitung) Herr Kruse, für das Kapitel2 (Erwerbsarbeit) Herr Bosch und Herr Naegele, für das Kapitel 3 (Bildung) HerrBosch und Herr Kruse, für das Kapitel 4 (E<strong>in</strong>kommenslage im Alter und zukünftigeEntwicklung) Herr Schmähl, für das Kapitel 5 (Chancen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong>Deutschland) Herr He<strong>in</strong>ze und Herr Naegele, für das Kapitel 6 (Potenziale des Alters<strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken) Frau Kuhlmey und Herr Tesch-Römer, für dasKapitel 7 (Engagement und Teilhabe älterer Menschen) Frau Backes, Herr He<strong>in</strong>zeund Herr Kreibich, für Kapitel 8 (Migration und Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaftund Gesellschaft) Frau Dietzel-Papakyriakou, für Kapitel 9 (Zusammenfassung)Frau Backes, Herr Kruse und Herr Volkholz.Im Zeitraum <strong>der</strong> Erstellung des Altenberichts fanden vier Tagungen sowie mehrereWorkshops statt, auf denen die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kommission die Möglichkeit hatten,zentrale Thesen des Altenberichts vorzutragen und mit <strong>der</strong> <strong>in</strong>teressierten Öffentlichkeitzu diskutieren. Die vier Tagungen behandelten folgende Themen: „WirtschaftlichePotenziale des Alters“, „Seniorengerechte Produkte und Dienstleistungen“,„Wirtschaftliche und gesellschaftliche Produktivität älterer Menschen“ sowie „Austauschmit den Seniorenverbänden und Seniorenorganisationen“. Wesentliche Thesen<strong>der</strong> Kommission wurden zudem vor dem Bundestagsausschuss für Familie, Senioren,Frauen und Jugend vorgetragen sowie mit Vertretern des Zentralrats <strong>der</strong> EKDund <strong>der</strong> deutschen Bischofskonferenz diskutiert.Der Dank <strong>der</strong> Kommission richtet sich zunächst an das Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend für das Vertrauen, das dieses <strong>der</strong> Kommission mit<strong>der</strong> Berufung <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> entgegengebracht hat. Er richtet sich weiterh<strong>in</strong> an dieKolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen, die Expertisen für den 5. Altenbericht erstellt haben, sowiean die Teilnehmer<strong>in</strong>nen und Teilnehmer <strong>der</strong> Tagungen, Workshops und Anhörungenfür die wichtigen Anregungen, die diese gegeben haben – viele dieser Anregungens<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den vorliegenden <strong>Bericht</strong> e<strong>in</strong>gegangen. Die Kommission danktschließlich Herrn Adolph, Frau He<strong>in</strong>emann und Herrn Schwitzer (wissenschaftlicheMitarbeiter <strong>der</strong> Geschäftsstelle) für die hervorragende Arbeit, die sich nicht auf dieUnterstützung <strong>der</strong> Kommissionsmitglie<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Datenrecherche beschränkte, son<strong>der</strong>ndie auch die <strong>in</strong>tensive Beteiligung an den Diskussionen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kommission sowiehöchst produktive Beiträge bei <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> Kapitel e<strong>in</strong>schloss. In denDank <strong>der</strong> Kommission ist ausdrücklich auch Frau Hesse (Sekretariat <strong>der</strong> Geschäftsstelle)e<strong>in</strong>zuschließen, die sich durch hohe organisatorische Kompetenz auszeichnete.Der Vorsitzende <strong>der</strong> Kommission dankt den Mitglie<strong>der</strong>n für die lebendigen und kreativenDiskussionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er fachlich wie menschlich bereichernden Atmosphäre.Andreas KruseVorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> 5. Altenberichtskommission
Drucksache 16/2190 – 42 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeListe <strong>der</strong> Kommissionsmitglie<strong>der</strong>Prof. Dr. Gertrud M. Backes (stellvertretende Vorsitzende)Universität KasselLehrstuhl Soziale Gerontologie, FB SozialwesenArnold-Bode-Str. 1034109 KasselProf. Dr. Gerhard BoschInstitut Arbeit und Technik (IAT)Munscheidstr. 1445886 GelsenkirchenProf. Dr. Maria Dietzel-PapakyriakouUniversität Duisburg-EssenFachbereich ErziehungswissenschaftUniversitätsstr. 1145117 EssenProf. Dr. Rolf G. He<strong>in</strong>zeRuhr-Universität BochumLehrstuhl für Arbeits- und WirtschaftssoziologieUniversitätsstr. 15044780 BochumProf. Dr. Rolf KreibichIZT Institut für Zukunftsstudien undTechnologiebewertung Berl<strong>in</strong>Schopenhauerstr. 2614129 Berl<strong>in</strong>Prof. Dr. Andreas Kruse (Vorsitzen<strong>der</strong>)Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergInstitut für GerontologieBergheimer Str. 2069115 HeidelbergProf. Dr. Adelheid KuhlmeyZentrum für Human- und Gesundheitswissenschaften<strong>der</strong> Berl<strong>in</strong>er Hochschulmediz<strong>in</strong> (ZHGB)Institut für Mediz<strong>in</strong>ische SoziologieThielallee 4714195 Berl<strong>in</strong>Prof. Dr. Gerhard NaegeleInstitut für Gerontologie an <strong>der</strong>Universität DortmundEv<strong>in</strong>ger Platz 1344339 DortmundProf. Dr. W<strong>in</strong>fried SchmählZentrum für Sozialpolitik (ZES)Wirtschaftswissenschaftliche AbteilungParkallee 3928209 Bremen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 43 – Drucksache 16/2190Prof. Dr. Clemens Tesch-RömerDeutsches Zentrum für Altersfragen (DZA)Manfred-von-Richthofen-Str. 212101 Berl<strong>in</strong>Dr. Volker VolkholzGesellschaft für Arbeitsschutz- undHumanisierungsforschung (GfAH)Friedensplatz 644135 DortmundGeschäftsstelle <strong>der</strong> KommissionHolger Adolph (Leiter <strong>der</strong> Geschäftsstelle)Heike He<strong>in</strong>emann (wiss. Mitarbeiter<strong>in</strong>)Dr. Klaus-Peter Schwitzer (wiss. Mitarbeiter)Angela Hesse (Sachbearbeiter<strong>in</strong>)Katja Rackow (stud. Mitarbeiter<strong>in</strong>)Kontaktanschrift:Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA)Geschäftsstelle <strong>der</strong> Sachverständigenkommission „5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“Manfred-von-Richthofen-Str. 212101 Berl<strong>in</strong>Tel.: 030/ 26 07 40 76Fax: 030/ 78 54 35 0E-mail:adolph@dza.dehe<strong>in</strong>emann@dza.deschwitzer@dza.deListe <strong>der</strong> Expertisennehmer<strong>in</strong>nen und ExpertisennehmerAnton AmannUnentdeckte und ungenützte Ressourcen und Potenziale des Alter(n)sFolkert Aust, Helmut Schrö<strong>der</strong>Weiterbildungsbeteiligung älterer ErwerbspersonenCor<strong>in</strong>na BarkholdtUmgestaltung <strong>der</strong> Altersteilzeit: von e<strong>in</strong>em Ausglie<strong>der</strong>ungs- zu e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungs<strong>in</strong>strumentCor<strong>in</strong>na Barkholdt, Vera LaschVere<strong>in</strong>barkeit von Pflege und ErwerbstätigkeitRe<strong>in</strong>hard Bisp<strong>in</strong>ckSenioritätsregeln <strong>in</strong> TarifverträgenThomas K. Bauer, Hans Dietrich von Loeffelholz, Christoph M. SchmidtWirtschaftsfaktor ältere Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten <strong>in</strong> Deutschland. Stand und Perspektiven
Drucksache 16/2190 – 44 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeMart<strong>in</strong> Brussig, Matthias Knuth, Walter WeißArbeiten ab 50 <strong>in</strong> Deutschland. E<strong>in</strong>e Landkarte <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit auf <strong>der</strong> Grundlage des Mikrozensus 1996 bis 2001Michael Cirkel, Josef Hilbert, Christa SchalkProdukte und Dienstleistungen für mehr Lebensqualität im AlterUwe Fach<strong>in</strong>gerE<strong>in</strong>kommensverwendung im AlterElmar HönekoppArbeitsmarktpotenziale älterer Auslän<strong>der</strong> bzw. E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>er – RechercheAndreas HoffIntergenerationale und <strong>in</strong>tragenerationale Beziehungen und Transfers <strong>in</strong> Familien. Empirische Datenanalysen auf Basisdes AlterssurveysAnnegret Köchl<strong>in</strong>g, Michael DeimelÄltere Beschäftigte und altersausgewogene PersonalpolitikJohannes Korporal, Bärbel DangelDie Gesundheit von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten als Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit im AlterHarald KünemundPartizipation und Engagement älterer MenschenRalf Mai, Juliane RoloffEntwicklung und Struktur <strong>der</strong> deutsch-deutschen Wan<strong>der</strong>ungenRalf Mai, Juliane RoloffZukunft von Potenzialen <strong>in</strong> Paarbeziehungen älterer Menschen. Perspektiven von Frauen und MännernSonja Menn<strong>in</strong>gDie Zeitverwendung älterer Menschen und die Nutzung von Zeitpotenzialen für <strong>in</strong>formelle Hilfeleistungen und bürgerschaftlichesEngagementHans-W. Micklitz, Lucia A. ReischVerbraucherpolitik und Verbraucherschutz für das AlterVeysel Özcan, Wolfgang SeifertLebenslage älterer Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten <strong>in</strong> DeutschlandUdo ReifnerAlternsgerechte F<strong>in</strong>anzdienstleistungen. Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> gesellschaftlichen Alterung für die Entwicklung neuerF<strong>in</strong>anzdienstleistungen und den VerbraucherschutzSebastian SchiefBeschäftigungsquoten, Arbeitszeiten und Arbeitsvolum<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Union, <strong>der</strong> Schweiz und NorwegenHolger ViebrokKünftige E<strong>in</strong>kommenslage im AlterHolger ViebrokAbsicherung bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungClaudia We<strong>in</strong>kopfHaushaltsnahe Dienstleistungen für ÄltereSusanne WurmGesundheitliche Potenziale und Grenzen älterer Erwerbspersonen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 45 – Drucksache 16/2190Fachtagungen, Workshops und Anhörungen <strong>zur</strong> Unterstützung <strong>der</strong> KommissionsarbeitWorkshop „För<strong>der</strong>ung des Engagements und <strong>der</strong> Partizipation von SeniorInnen und älteren ArbeitnehmerInnen“ <strong>der</strong>Sachverständigenkommission für den 5. Altenbericht23.03.2004 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Workshop „Ältere Beschäftigte und altersausgewogene Personalpolitik“18.04.2004 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Gespräch mit dem Staatssekretär Peter Ruhenstroth-Bauer20.04.2004 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Fachtagung „Wirtschaftliche Potenziale des Alters“ des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugendund <strong>der</strong> Sachverständigenkommission für den 5. Altenbericht05.07.2004 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Workshop „Nutzergerechte Produkte“ <strong>der</strong> Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>der</strong> Senioren-Organisationen (BAGSO)08.07.2004 <strong>in</strong> IserlohnWorkshop „Dienstleistungen – Service für Ältere?“ <strong>der</strong> Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>der</strong> Senioren-Organisationen(BAGSO)30.09.2004 <strong>in</strong> BonnSymposium „Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft“ im Rahmen <strong>der</strong> Jahrestagung 2004 <strong>der</strong> DeutschenGesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG) „Älterwerden hat Zukunft“08.10.2004 <strong>in</strong> HamburgFachtagung „Seniorengerechte Produkte und Dienstleistungen“ des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugend und <strong>der</strong> Sachverständigenkommission für den 5. Altenbericht06.12.2004 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Anhörung vor dem Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend18.02.2005 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Diskussion mit <strong>der</strong> Beauftragten <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration, Marieluise Beck17.03.2005 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Diskussion mit Vertretern des Zentralrats <strong>der</strong> EKD und <strong>der</strong> deutschen Bischofskonferenz18.04.2005 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Fachtagung „Vorstellung und Diskussion zentraler Positionen des 5. Altenberichts <strong>der</strong> Bundesregierung mit Senioren,Seniorenverbänden und Seniorenorganisationen“ des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugendund <strong>der</strong> Sachverständigenkommission für den 5. Altenbericht02.05.2005 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Fachtagung „Wirtschaftliche und gesellschaftliche Produktivität älterer Menschen“ des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie,Senioren, Frauen und Jugend und <strong>der</strong> Sachverständigenkommission für den 5. Altenbericht10.05.2005 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>Diskussion mit <strong>der</strong> Parlamentarischen Staatssekretär<strong>in</strong> Christel Riemann-Hanew<strong>in</strong>ckel30.05.2005 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 47 – Drucksache 16/21901 Potenziale des Alters – E<strong>in</strong>leitung1.1 Der Auftrag des 5. AltenberichtsDie Bundesregierung hat die Sachverständigenkommissionfür den 5. Altenbericht beauftragt, auf Basis e<strong>in</strong>erwissenschaftlichen Bestandsaufnahme Potenziale des Alters<strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft aufzuzeigen und politikrelevanteHandlungsempfehlungen im H<strong>in</strong>blick auf diebessere Nutzung <strong>der</strong> Potenziale älterer Menschen zu geben.Die 5. Altenberichtskommission soll gegenüber <strong>der</strong> weitgehendvon ökonomischen Belastungsargumenten geprägtenDiskussion e<strong>in</strong>e differenziertere Beschreibung<strong>der</strong> Folgen des demografischen Wandels vornehmen unddie Chancen dieser Entwicklung <strong>in</strong> das Zentrum ihrer Argumentationstellen.Kapitelübergreifend wird danach gefragt, welchen Beitragältere Menschen bereits heute zum solidarischen Zusammenleben<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en erbr<strong>in</strong>gen bzw. <strong>in</strong> Zukunfterbr<strong>in</strong>gen könnten. Gleichzeitig werden dieVoraussetzungen untersucht, auf <strong>der</strong>en Basis Potenzialeerst entstehen und erhalten werden können. Welche gesundheitsför<strong>der</strong>ndenRahmenbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d dafür notwendig?Welche präventiven Anstrengungen müssen <strong>in</strong><strong>der</strong> Arbeitswelt und den Unternehmen sowie im Bildungs-und Sozialbereich realisiert werden, um die Potenzialeälterer Menschen auch <strong>in</strong> Zukunft zu erhalten undauszubauen? Wo liegt die <strong>in</strong>dividuelle Verantwortung fürden Aufbau und Erhalt von Kompetenzen und Potenzialenfür das Alter und im Alter? Wie müssen Altersbil<strong>der</strong>verän<strong>der</strong>t werden, damit die Potenziale deutlicher wahrgenommenwerden und welche Barrieren müssen abgebautwerden, damit diese besser genutzt werden?Stärker als <strong>in</strong> den bisherigen Altenberichten hat die Kommissiondazu schon während <strong>der</strong> Erarbeitung des <strong>Bericht</strong>sden Austausch mit Expert<strong>in</strong>nen und Experten, Seniorenvertreter<strong>in</strong>nenund -vertretern, Verbänden, Kirchen, Politikund Wirtschaft gesucht und ist mit ihnen <strong>in</strong> den fachlichenAustausch getreten. Die Ergebnisse aus e<strong>in</strong>er Reihevon Tagungen und Workshops, die die Kommission parallel<strong>zur</strong> Arbeit am <strong>Bericht</strong> durchgeführt hat, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesen<strong>Bericht</strong> e<strong>in</strong>geflossen.Die Herausfor<strong>der</strong>ungen des demografischen Wandels zubewältigen, ist e<strong>in</strong>e Aufgabe, die nur durch e<strong>in</strong> Umdenkenaller gesellschaftlichen Akteure gemeistert werdenkann. Dies gilt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e, wenn es darum geht, e<strong>in</strong>ealters<strong>in</strong>tegrierende Kultur zu entwickeln, die es älterenMenschen <strong>in</strong> stärkerem Maße als bisher ermöglicht, ihrePotenziale <strong>in</strong> die Gesellschaft e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen und die altersgerechteGestaltung von politischen, rechtlichen undgesellschaftlichen Strukturen voranzutreiben. Diese solltenes erlauben, den Beitrag älterer Menschen zum Geme<strong>in</strong>wohlbesser als bisher zu nutzen. Der Altenberichtwendet sich – da se<strong>in</strong>e Auftraggeber <strong>der</strong> Deutsche Bundestagund die Bundesregierung s<strong>in</strong>d – primär an politischeEntscheidungsträger auf <strong>der</strong> Bundesebene. Er hatdarüber h<strong>in</strong>aus aber das Ziel, im Rahmen des gestelltenAuftrags <strong>zur</strong> Aufklärung über die soziale <strong>Lage</strong> ältererMenschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft beizutragen und an<strong>der</strong>e Akteurewie Arbeitgeber, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlicheOrganisationen, aber auch die E<strong>in</strong>zelne undden E<strong>in</strong>zelnen anzusprechen.1.2 Potenziale des Alters im Verständnis <strong>der</strong>5. AltenberichtskommissionDer Begriff Potenzial wird allgeme<strong>in</strong> im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er nochnicht verwirklichten Möglichkeit def<strong>in</strong>iert. Unter „Potenzialendes Alters“ s<strong>in</strong>d sowohl vom Individuum o<strong>der</strong> <strong>der</strong>Gesellschaft präferierte Lebensentwürfe und Lebensformen,die <strong>zur</strong> Wirklichkeit werden können, als auch dieden älteren Menschen für die Verwirklichung von Lebensentwürfenund Lebensformen <strong>zur</strong> Verfügung stehendenRessourcen zu verstehen. Dabei kann zwischen e<strong>in</strong>er stärker<strong>in</strong>dividuellen und e<strong>in</strong>er stärker gesellschaftlichen Perspektivedifferenziert werden. Während aus e<strong>in</strong>er stärker<strong>in</strong>dividuellen Perspektive die Verwirklichung persönlicherZiel- und Wertvorstellungen im Vor<strong>der</strong>grund steht,ist aus gesellschaftlicher Perspektive vor allem von Interesse,<strong>in</strong>wieweit ältere Menschen zum e<strong>in</strong>en auf Leistungen<strong>der</strong> Solidargeme<strong>in</strong>schaft angewiesen und zum an<strong>der</strong>en<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>en Beitrag zum Wohl <strong>der</strong>Solidargeme<strong>in</strong>schaft zu leisten.Der öffentliche Diskurs über Potenziale des Alters wirdprimär vor dem H<strong>in</strong>tergrund des demografischen Wandelsgeführt: Die 5. Altenberichtskommission <strong>in</strong>teressiertdabei vor allem die Frage, <strong>in</strong>wieweit durch e<strong>in</strong>e gezielteErweiterung und Nutzung <strong>der</strong> Potenziale des Alters <strong>in</strong>tergenerationelleSolidarität geför<strong>der</strong>t werden kann?Wenn über Potenziale des Alters diskutiert wird, dann stehen– <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e aus gesellschaftlicher Perspektive –häufig materielle Gesichtspunkte im Vor<strong>der</strong>grund. Dochumfasst <strong>der</strong> Begriff Potenziale des Alters weit mehr alsdie Nutzung materieller Ressourcen älterer Menschen. Zuden Potenzialen im Alter gehören neben materiellen Ressourcen<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Gesundheit, Leistungsfähigkeit,Lernfähigkeit, Interesse, Zeit, Erfahrungen und Wissen.Potenziale des Alters entwickeln sich nicht schon alle<strong>in</strong>deshalb, weil Menschen älter werden o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Anteil ältererMenschen zunimmt. Auch ist durch den H<strong>in</strong>weis aufbestehende Potenziale noch ke<strong>in</strong>e optimistische Prognoseh<strong>in</strong>sichtlich des Verlaufs von Alternsprozessen von späterenGeburtsjahrgängen, <strong>der</strong> Entwicklung von Arbeitsmarktund Innovationsfähigkeit o<strong>der</strong> des Bestandes und<strong>der</strong> Tragfähigkeit bestehen<strong>der</strong> Unterstützungssysteme getroffen.Potenziale des Alters verweisen vielmehr auf e<strong>in</strong>e
Drucksache 16/2190 – 48 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodedoppelte Gestaltungsmöglichkeit, die ausdrücklich imS<strong>in</strong>ne von Chance und Herausfor<strong>der</strong>ung (für den E<strong>in</strong>zelnenund die Gesellschaft) zu verstehen ist: Aus <strong>in</strong>dividuellerPerspektive ergeben sich im Vergleich zu früheren<strong>Generation</strong>en deutlich bessere Möglichkeiten, e<strong>in</strong> an eigenenLebensentwürfen, Ziel- und Wertvorstellungenorientiertes Leben zu führen, an gesellschaftlicher Entwicklungteilzuhaben und sich für an<strong>der</strong>e und die Geme<strong>in</strong>schaftzu engagieren. Aus gesellschaftlicher Perspektiveverweisen die Potenziale des Alters auf dieMöglichkeit, durch motivationale, soziale, kulturelle und<strong>in</strong>stitutionelle Rahmenbed<strong>in</strong>gungen dazu beizutragen,dass <strong>der</strong> wachsende Anteil älterer Menschen möglichstlange e<strong>in</strong> mitverantwortliches, selbstständiges und selbstverantwortlichesLeben führt.1.2.1 Gew<strong>in</strong>n an aktiven Jahren und<strong>in</strong>dividuelle PotenzialeDer <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten beobachtete Anstieg <strong>in</strong> <strong>der</strong>Lebenserwartung ist vor allem mit e<strong>in</strong>em Gew<strong>in</strong>n an „aktivenJahren“ verbunden, also e<strong>in</strong>er Verlängerung jenerLebensphase, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Menschen zu e<strong>in</strong>er selbstständigenund selbstverantwortlichen Lebensführung fähig s<strong>in</strong>d.Angesichts e<strong>in</strong>er im Durchschnitt besseren Gesundheit,e<strong>in</strong>es im Durchschnitt höheren Bildungsniveaus, e<strong>in</strong>er imDurchschnitt höheren Vertrautheit mit Bildungsangebotenund Lernsituationen sowie e<strong>in</strong>er im Durchschnitt besserenf<strong>in</strong>anziellen Situation kann davon ausgegangen werden,dass zukünftige <strong>Generation</strong>en älterer Menschen länger<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> se<strong>in</strong> werden, e<strong>in</strong>en aktiven Beitrag zumWohle <strong>der</strong> Gesellschaft zu leisten und e<strong>in</strong> gewisses Maßan Reziprozität zwischen den von an<strong>der</strong>en <strong>in</strong> Anspruchgenommenen und den für an<strong>der</strong>e erbrachten Leistungenaufrechtzuerhalten.Dabei ist zu beachten, dass die Potenziale des Alters dasErgebnis e<strong>in</strong>er lebenslangen Entwicklung s<strong>in</strong>d und e<strong>in</strong>eFör<strong>der</strong>ung von Potenzialen des Alters vor allem dann Erfolgverspricht, wenn sie möglichst früh beg<strong>in</strong>nt. Die imAlter verfügbaren Ressourcen <strong>zur</strong> Verwirklichung vonLebensentwürfen, Ziel- und Wertvorstellungen s<strong>in</strong>d nichtnur durch frühere Abschnitte <strong>der</strong> Erwerbs- und Bildungsbiografie,son<strong>der</strong>n bereits durch die soziale Herkunft, dasGeschlecht o<strong>der</strong> für das soziale Umfeld charakteristischeLebenslagen, Normen und Rollenvorstellungen bee<strong>in</strong>flusst.Damit s<strong>in</strong>d die vorf<strong>in</strong>dbaren Lebenssituationen ältererMenschen durch große soziale Ungleichheiten geprägt.Entsprechend spiegelt sich <strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuellenLebensläufen und den auf diesen gründenden, aktuellenHandlungsspielräumen zum Teil e<strong>in</strong>e Kumulation vonVorteilen, zum Teil auch e<strong>in</strong>e Kumulation von Nachteilenwi<strong>der</strong>. Als e<strong>in</strong> Beispiel sei hier das vor allem unter älterenFrauen immer noch bestehende Problem <strong>der</strong> Armut genannt,das <strong>in</strong> vielen Fällen e<strong>in</strong> Ergebnis des Zusammenwirkenszahlreicher Benachteiligungen darstellt, wie z.B.ger<strong>in</strong>geren Bildungschancen <strong>in</strong>folge von sozialer Herkunftund Geschlechtszugehörigkeit, ger<strong>in</strong>gen Berufschancen<strong>in</strong>folge von niedrigem Bildungsabschluss undlückenhafter Erwerbsbiografie auf Grund fehlen<strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeitvon Familie und Beruf. Das Armutsrisiko nachEhescheidung ist für Frauen deutlich größer als für Männer,<strong>in</strong> Deutschland f<strong>in</strong>det sich gegenwärtig unter den geschiedenenFrauen die höchste Armutsquote. E<strong>in</strong>e ähnlichegeschlechtsspezifische Benachteiligung ist für dief<strong>in</strong>anzielle Situation nach Verwitwung festzustellen, e<strong>in</strong>eVerschlechterung ist hier lediglich für Frauen festzustellen,für Männer gilt demgegenüber, dass die f<strong>in</strong>anzielleSituation nach Verwitwung eher besser als schlechter ist.Ähnlich wie <strong>der</strong> Gesundheitszustand und das Bildungsniveauhaben auch Mit- und Selbstverantwortung sowieSelbstsorge im Alter ihre biografischen und lebenslagespezifischenVoraussetzungen. Wer se<strong>in</strong> Leben <strong>in</strong>K<strong>in</strong>dheit, mittlerem und höherem Erwachsenenalter bereitsals <strong>in</strong> hohem Maße fremdbestimmt und wenig kontrollierbarerfährt und dadurch die e<strong>in</strong>er selbstverantwortlichenLebensführung för<strong>der</strong>lichen Fertigkeiten undGewohnheiten nur e<strong>in</strong>geschränkt ausbilden konnte, wirdauch im Alter se<strong>in</strong>e vorhandenen Fähigkeiten nur selten<strong>in</strong> mit- und selbstverantwortlicher Weise e<strong>in</strong>setzen. AlsBeispiel sei die Entwicklung <strong>der</strong> Lern- und Leistungsfähigkeitvon Arbeitnehmern und Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen, die<strong>in</strong> mehr o<strong>der</strong> weniger <strong>in</strong>novationsfe<strong>in</strong>dlichen Betriebenbeschäftigt s<strong>in</strong>d, angeführt. Wenn berufliche Anfor<strong>der</strong>ungenüber lange Zeiträume we<strong>der</strong> verän<strong>der</strong>t noch reflektiertwerden und gleichzeitig Möglichkeiten <strong>der</strong> Fort- undWeiterbildung nicht <strong>zur</strong> Verfügung stehen, besteht dieGefahr, dass kreative Potenziale – zu denen auch die <strong>in</strong>dividuelleInnovationsfähigkeit zu rechnen ist – zu Gunstene<strong>in</strong>er zunehmenden Rigidität im Alter verloren gehen.Der Beitrag <strong>der</strong> älteren Menschen zum solidarischen Zusammenleben<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en beschränkt sich nicht aufdas Ende des „zweiten“ (55- bis 65-Jährige) und das„dritte Lebensalter“, <strong>in</strong> dem die Möglichkeiten e<strong>in</strong>erselbstständigen und aktiven Lebensführung im Allgeme<strong>in</strong>enerhalten s<strong>in</strong>d. Mit <strong>der</strong> im „vierten Lebensalter“ zunehmendenVerletzlichkeit des Alters wird die Verwirklichungvon Potenzialen zum e<strong>in</strong>en schwieriger, zuman<strong>der</strong>en verschiebt sie sich möglicherweise auf an<strong>der</strong>eDimensionen. Auch wenn gesundheitliche und sozialeVerluste die für die Verwirklichung e<strong>in</strong>er mitverantwortlichenLebensführung <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Ressourcenerheblich reduzieren können, ist dies nicht gleichbedeutenddamit, dass <strong>der</strong> Mensch über ke<strong>in</strong>e Potenzialemehr verfügt, von <strong>der</strong>en Verwirklichung er selbst o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e<strong>in</strong> erheblichem Maße profitieren könnten. Vielmehrspiegeln sich gerade <strong>in</strong> <strong>der</strong> Haltung <strong>der</strong> bewusst angenommenenAbhängigkeit aus ethischer wie aus gesellschaftlicherPerspektive bedeutsame Potenziale wi<strong>der</strong>.Aus ethischer Perspektive ist diese Haltung als Bewältigunge<strong>in</strong>er zentralen Herausfor<strong>der</strong>ung des Alters (und damitim S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es „guten Lebens“) zu <strong>in</strong>terpretieren(Kruse 2005a u. 2005b). Aus gesellschaftlicher Perspektiveist zu betonen, dass Menschen durch die Haltung, diesie gegenüber <strong>der</strong> eigenen Situation e<strong>in</strong>nehmen, e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>emotionaler wie motivationaler H<strong>in</strong>sicht „produktivenKontext“ für an<strong>der</strong>e Menschen bilden (Montada 1996,Staud<strong>in</strong>ger 1996).Bei aller Betonung <strong>der</strong> sozialen und biografischen Voraussetzungenvon Potenzialen des Alters darf nicht übersehenwerden, dass Menschen bis <strong>in</strong>s sehr hohe Alter <strong>in</strong>
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 49 – Drucksache 16/2190<strong>der</strong> <strong>Lage</strong> s<strong>in</strong>d, die Entwicklung entsprechen<strong>der</strong> Potenzialedurch eigenes Verhalten zu för<strong>der</strong>n. So kann etwa<strong>der</strong> Gesundheitszustand bis <strong>in</strong>s sehr hohe Alter durch denVerzicht auf Risikofaktoren, gesunde Ernährung und e<strong>in</strong>ausreichendes Maß an körperlicher und geistiger Aktivitätgeför<strong>der</strong>t werden.1.2.2 Kollektives Altern und gesellschaftlicheEntwicklungE<strong>in</strong>e verbesserte Lebenssituation älterer Menschen entspricht– solange nachfolgende <strong>Generation</strong>en nicht <strong>in</strong> unzulässigerWeise benachteiligt werden – auch dem Interesse<strong>der</strong> Gesellschaft <strong>in</strong>sgesamt, da e<strong>in</strong>e gesün<strong>der</strong>e undf<strong>in</strong>anziell besser gestellte ältere Bevölkerung <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geremMaße auf Leistungen <strong>der</strong> Solidargeme<strong>in</strong>schaft angewiesenist. Darüber h<strong>in</strong>aus stellt sich die Frage, <strong>in</strong>wieweitdie im Kontext <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Perspektive angesprochenenPotenziale des Alters auch gesamtgesellschaftlichnutzbar s<strong>in</strong>d. Sieht man von <strong>der</strong> Frage ab, <strong>in</strong> welchemUmfang ältere Menschen angemessenerweise an <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungdes sozialen Sicherungssystems beteiligt werdensollen, dann wird die gesellschaftliche Nutzung <strong>der</strong>Potenziale des Alters gegenwärtig vor allem im Zusammenhangmit <strong>der</strong> Arbeitswelt, und hier <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e imZusammenhang mit <strong>der</strong> Frage nach e<strong>in</strong>er Erhöhung desRentene<strong>in</strong>trittsalters und <strong>der</strong> Flexibilisierung <strong>der</strong> Altersgrenze,diskutiert. Dabei ist <strong>der</strong> öffentliche Diskurs nichtselten durch die Auffassung geprägt, dass <strong>der</strong> demografischeWandel bei gleich bleibenden Rahmenbed<strong>in</strong>gungendie Konkurrenzfähigkeit des WirtschaftsstandortesDeutschland gefährdet. Dies zum e<strong>in</strong>en, weil die F<strong>in</strong>anzierung<strong>der</strong> von e<strong>in</strong>em wachsenden Anteil älterer Menschenbeanspruchten Leistungen des sozialen Sicherungssystemsmit hohen Lohnnebenkosten e<strong>in</strong>hergeht, die dieAbsatzchancen auf e<strong>in</strong>em globalisierten Markt erheblichreduzieren könnte, zum an<strong>der</strong>en weil Kreativität und Innovationsfähigkeitvor allem mit Jugend – und eben nichtmit Alter – assoziiert werden. Dagegen wird nach wie vornicht <strong>in</strong> ausreichendem Maße <strong>zur</strong> Kenntnis genommen,dass Menschen sehr unterschiedlich altern, wobei Alternsprozesseke<strong>in</strong>en schicksalhaften Verlauf nehmen, son<strong>der</strong>nvielmehr als offen und gestaltbar zu charakterisieren s<strong>in</strong>d.So ist etwa das biologische Alter durch Prävention, dassoziale Alter durch <strong>in</strong>stitutionelle Rahmenbed<strong>in</strong>gungenbee<strong>in</strong>flussbar. Entsprechend s<strong>in</strong>d Unterschiede <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellenInnovationsfähigkeit nicht durch das Lebensalter,son<strong>der</strong>n vielmehr durch Unterschiede <strong>in</strong> relevantenPersönlichkeitsmerkmalen (Offenheit, Rigidität, Risikobereitschaftetc.), Lernerfahrungen und Wissenssystemensowie nicht zuletzt durch die Zugehörigkeit zu <strong>in</strong>novationsfreundlichenversus <strong>in</strong>novationsfe<strong>in</strong>dlichen Betriebenzu erklären.Diese Diskussion verdeutlicht, dass die gesellschaftlicheNutzung von Potenzialen des Alters entsprechende Rahmenbed<strong>in</strong>gungenvoraussetzt. Wenn etwa Unternehmendazu neigen, die Freisetzung älterer Arbeitnehmer als bevorzugtesInstrument des Personalabbaus zu betrachten,dies von den Gewerkschaften als „sozialverträglich“ unterstütztwird, und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Folge entsprechend auf geeigneteWeiterbildungsangebote o<strong>der</strong> Arbeitsplatzanpassungen<strong>zur</strong> Erhaltung <strong>der</strong> Arbeitsfähigkeit im Alter verzichten,wird nicht nur das Leistungspotenzial ältererArbeitnehmer ungenutzt bleiben, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong>en Motivation,vorhandene Potenziale zu nutzen, unterm<strong>in</strong>iert.Die Auffassung, dass Menschen mit fortschreitendem Alterrigide werden – also die Fähigkeit verlieren, sichwechselnden Bed<strong>in</strong>gungen psychisch anzupassen – undnicht mehr zu kreativen Leistungen fähig s<strong>in</strong>d, ist ebensoweit verbreitet wie unzutreffend. Wer mit 60 rigide ist,war es mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit bereits mit 30. DasAlter spielt hierbei nur e<strong>in</strong>e untergeordnete Rolle. Insofernwird auch hier die Notwendigkeit e<strong>in</strong>es differenziertenAltersbildes deutlich. Durch e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Weiterbildung,e<strong>in</strong>e altersgrechte Arbeitsgestaltung undgezielte Maßnahmen <strong>zur</strong> Motivation älterer Arbeitnehmerkann <strong>der</strong>en Innovationsfähigkeit erhalten und verbessertwerden. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bedeutet <strong>der</strong>zunehmende Bevölkerungsanteil älterer Menschen auch,dass sozialer Wandel auf Dauer ohne die Älteren (auchals Wähler) nicht gestaltbar ist. Damit stellen sich dieFragen, <strong>in</strong>wieweit ältere Menschen stärker als bisher angesellschaftlicher Verän<strong>der</strong>ung zu beteiligen, neue Altersrollenzu schaffen o<strong>der</strong> für spezifische soziale Rollen charakteristischeAltersgrenzen zu flexibilisieren s<strong>in</strong>d.Angesichts <strong>der</strong> im Vergleich zu früheren Geburtsjahrgängendeutlich verbesserten f<strong>in</strong>anziellen Situation ältererMenschen werden auch <strong>der</strong>en Konsumgewohnheiten diewirtschaftliche Entwicklung nachhaltig bee<strong>in</strong>flussen. ÄltereMenschen werden stärker als bisher als Zielgruppeangesprochen werden müssen. Die Konsumkraft ältererMenschen muss für die Schaffung neuer Arbeitsplätze genutztwerden.Außerhalb <strong>der</strong> Arbeitswelt wird e<strong>in</strong>e Nutzung <strong>der</strong> imKontext <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Perspektive angesprochenenPotenziale des Alters vor allem für den Bereich des bürgerschaftlichenEngagements diskutiert. Hier wird zunächstdie Bedeutung weiterer Potenziale des Alters deutlich,zu denen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Zeit und Interesse zu rechnens<strong>in</strong>d. Während das im Alter <strong>zur</strong> Verfügung stehende Zeitbudgetdie Nutzung von Potenzialen des Alters begünstigt(ältere Menschen haben im Allgeme<strong>in</strong>en genügend freieZeit, um Bildungsangebote zu nutzen, e<strong>in</strong>en gesundenLebensstil zu pflegen und sich für an<strong>der</strong>e e<strong>in</strong>zusetzen), istdie Motivation für e<strong>in</strong> <strong>der</strong>artiges Engagement als e<strong>in</strong>eeher „fragile“ Ressource anzusehen. Dies hat zunächstdamit zu tun, dass die Bereitschaft, sich für an<strong>der</strong>e zu engagieren,sowohl von <strong>der</strong> Überzeugung, etwas bewirkenzu können, als auch von <strong>der</strong> Erwartung, von an<strong>der</strong>en <strong>in</strong><strong>der</strong> Rolle des engagierten Bürgers akzeptiert zu werden,abhängt. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Bereitschaftzu bürgerschaftlichem Engagement auf Dauernur erhalten bleibt, wenn die mit dem Engagement verbundenenTätigkeiten als s<strong>in</strong>nvoll erlebt werden und sichdie Person <strong>in</strong> ihrer Tätigkeit ernst genommen und akzeptiertfühlt.Die Potenziale des Alters s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den letzten Jahren verstärktGegenstand e<strong>in</strong>es öffentlichen Diskurses geworden.Dieser hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Produktivitätälterer Menschen und die dem demografischen Wan-
Drucksache 16/2190 – 50 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodedel <strong>in</strong>newohnenden Chancen stärker <strong>zur</strong> Kenntnis genommenwurden. Nicht zuletzt <strong>in</strong>folge dieser Entwicklunghaben sich Altersbil<strong>der</strong> differenziert und neue Perspektiven<strong>der</strong> Gestaltung des gesellschaftlichen Alterungsprozessesdurch Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> <strong>in</strong>stitutionellen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<strong>in</strong> Staat, Wirtschaft und Gesellschafteröffnet. Nicht übersehen werden sollte allerd<strong>in</strong>gs die Gefahre<strong>in</strong>er Instrumentalisierung <strong>der</strong> Potenzialdiskussion,etwa im Zusammenhang mit Privatisierungstendenzen <strong>in</strong><strong>der</strong> Sozialversicherung durch bürgerschaftliches Engagement.1.2.3 Altersbil<strong>der</strong> und Potenziale des AltersDie Chancen e<strong>in</strong>er Nutzung von Potenzialen des Altershängen <strong>in</strong> mehrfacher H<strong>in</strong>sicht von den jeweils dom<strong>in</strong>antenAltersbil<strong>der</strong>n ab: Wenn Altern primär mit e<strong>in</strong>er Abnahme<strong>der</strong> Lern-, Leistungs- und Umstellungsfähigkeitassoziiert wird, werden ältere Menschen ihre <strong>in</strong>dividuellenMöglichkeiten <strong>in</strong> vielen Fällen we<strong>der</strong> zu erkennennoch zu nutzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> se<strong>in</strong>. Aus negativ akzentuiertenAltersbil<strong>der</strong>n abgeleitete Erwartungen an den eigenenAlternsprozess können dazu beitragen, dass sich Menschene<strong>in</strong>e an persönlichen Ziel- und Wertvorstellungenorientierte Lebensführung nicht zutrauen und vorhandenePotenziale auf Dauer verkümmern. Des Weiteren könnennegativ akzentuierte Altersbil<strong>der</strong> dazu beitragen, dass dievorhandene Bereitschaft, sich für an<strong>der</strong>e zu engagieren,nicht <strong>in</strong> Anspruch genommen o<strong>der</strong> sogar <strong>zur</strong>ückgewiesenwird. Mit Blick auf die zunehmende Anzahl älterer Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten ist festzustellen, dass bislangwe<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Lern- und Anpassungsfähigkeit <strong>in</strong> ausreichendemMaße <strong>zur</strong> Kenntnis genommen noch die Fragegestellt wird, <strong>in</strong>wieweit <strong>der</strong>en beson<strong>der</strong>e Erfahrungen mitspezifischen, gesellschaftlich nutzbaren Stärken verbundens<strong>in</strong>d.Auch positiv überzeichnete Altersbil<strong>der</strong> können dazu beitragen,dass vorhandene Potenziale nicht für an<strong>der</strong>e Menschengenutzt werden; dies vor allem dann, wenn aus vorhandenenMöglichkeiten Verpflichtungen abgeleitetwerden und sich ältere Menschen überfor<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> ausgenutztfühlen. Unter <strong>der</strong> Voraussetzung, dass die Vielfalt<strong>der</strong> Lebensformen im Alter stärker <strong>zur</strong> Kenntnis genommenund mögliche Stärken des Alters differenzierter betrachtetwerden, kann die Produktivität des Alters erheblichgesteigert werden. Organisationen müssen dievorhandenen Kompetenzen aber auch nachfragen und abrufen,ansonsten liegen diese Potenziale brach. Die vorhandenenPotenziale zu erkennen und selbstverständlichals Ressource zu begreifen und zu nutzen ist e<strong>in</strong>e Aufgabe<strong>der</strong> Organisationsentwicklung für Betriebe, Verbände,Vere<strong>in</strong>e und Verwaltungen. In diesem Zusammenhangist zu berücksichtigen, dass sich nicht nur Menschenim mittleren Erwachsenenalter <strong>in</strong> ihren Lebensplanungenund Lebensentwürfen auch an ihren auf den eigenen Alternsprozessgerichteten Erwartungen orientieren. In ähnlicherWeise ersche<strong>in</strong>t die Antizipation e<strong>in</strong>er alterndenBelegschaft bedeutsam für die <strong>in</strong> Unternehmen verwirklichteBeschäftigungspolitik. Mith<strong>in</strong> ist die For<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>esdifferenzierten Altersbildes auch im Zusammenhangmit <strong>der</strong> Notwendigkeit e<strong>in</strong>er angemessenen Antizipationvon Alternsprozessen und entsprechenden Bemühungen<strong>zur</strong> Gestaltung dieser Alternsprozesse zu sehen.1.3 Der demografische Wandel alsH<strong>in</strong>tergrund für die wachsendeBedeutung <strong>der</strong> Potenziale des AltersDieser Altenbericht wird nicht noch e<strong>in</strong>mal im Detail aufdie Gründe und Faktoren e<strong>in</strong>gehen, welche den Prozessen<strong>der</strong> gesellschaftlichen Alterung und <strong>der</strong> Abnahme <strong>der</strong> Bevölkerungszahlzugrunde liegen. In den letzten Jahrenwurde unter an<strong>der</strong>em durch die zehnjährige Arbeit <strong>der</strong>Enquete-Kommission „Demographischer Wandel“, dieAltenberichte <strong>der</strong> Bundesregierung, die Bevölkerungsvorausberechnungendes Statistischen Bundesamtes unde<strong>in</strong>e Fülle von weiteren Publikationen e<strong>in</strong>e umfassendeAnalyse des demografischen Wandels geleistet. 1Die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2050 wirdnach <strong>der</strong> Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes(2003) von folgenden Entwicklungen gekennzeichnetse<strong>in</strong>. Es ist zum e<strong>in</strong>en mit e<strong>in</strong>er kont<strong>in</strong>uierlichen Alterung<strong>der</strong> Bevölkerung zu rechnen. Die Zahl <strong>der</strong> älteren Menschenwird zunehmen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Zahl <strong>der</strong> Hochaltrigenwird überproportional steigen. 2 Zum an<strong>der</strong>enwird nach dem Jahr 2020 e<strong>in</strong>e Abnahme <strong>der</strong> Gesamtbevölkerungszahlerwartet, wobei die Bevölkerung im Erwerbsalterprozentual stärker schrumpfen wird als die Gesamtbevölkerung(Tabelle 1).Nach <strong>der</strong> mittleren Variante 3 <strong>der</strong> aktuellen 10. koord<strong>in</strong>iertenBevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamteswird die Gesamtbevölkerung bis 2050 um etwa9 Prozent <strong>zur</strong>ückgehen und die Bevölkerung im Erwerbsaltervoraussichtlich überproportional um 20 Prozentschrumpfen, während die Anzahl <strong>der</strong> über 65-Jährigenund <strong>der</strong> über 80-Jährigen um 54 Prozent bzw. 174 Prozentzunehmen wird. Deren Bevölkerungsanteil wird dann29,6 Prozent bzw. 12 Prozent betragen (Tabelle 1).Auch <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Bevölkerung im Erwerbsalter f<strong>in</strong>dete<strong>in</strong> Alterungsprozess statt. Abbildung 1 verdeutlicht diewachsenden Anteile <strong>der</strong> 50- bis 64-Jährigen. Deren Anteilan <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 20- bis 64-Jährigen steigt vonheute 30 Prozent auf 39 Prozent im Jahr 2020 an und gehtnach dem Ausscheiden <strong>der</strong> Baby-Boomer-Jahrgänge aus1 Stellvertretend für viele an<strong>der</strong>e Publikationen: Enquete-Kommission„Demographischer Wandel (Deutscher Bundestag 1994; 1998;2002), Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie und Senioren 1993, Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2002a; 2001;1998), Birg 2001 und sehr anschaulich Mai 2003, das Son<strong>der</strong>heft desBundes<strong>in</strong>stituts für Bevölkerungsforschung (BIB) „Bevölkerung“aus dem Jahr 2004, und zu den Problemen <strong>der</strong> Schrumpfung <strong>der</strong> BevölkerungszahlKaufmann 2005.2 Auf die daraus resultierenden beson<strong>der</strong>en Herausfor<strong>der</strong>ungen an dieGesellschaft und die Versorgungssysteme hat ausführlich <strong>der</strong> VierteAltenbericht h<strong>in</strong>gewiesen (BMFSFJ 2002a).3 Variante 5 geht davon aus, dass die durchschnittliche Geburtenzifferpro Frau bis 2050 bei 1,4 konstant bleiben wird, mittelfristig per saldojährlich 200.000 Menschen nach Deutschland kommen (Nettozuwan<strong>der</strong>ung).Angenommen wird ferner, dass die durchschnittlicheLebenserwartung Neugeborener im Jahr 2050 bei 81 Jahren für Jungenund 87 Jahren für Mädchen liegen wird.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 51 – Drucksache 16/2190Entwicklung <strong>der</strong> Bevölkerungszahl 1 und des Anteils älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland, 1953 – 2050Tabelle 1AlterKalen<strong>der</strong>jahr (jeweils 31.12.)Zu-/Abnahme(<strong>in</strong> Jahren) 1953 1971 2003 2020 2 2050 2 1953-2003 2003-2050 2Bevölkerungszahl:Insgesamt 70.565.928 78.556.202 82.531.671 82.882.100 75.117.300 17,0 % – 9,0 %20 bis u. 65 41.786.897 44.083.040 50.767.361 50.050.823 40.783.328 21,5 % – 19,7 %65 und älter 7.314.832 10.995.701 14.859.995 18.219.000 22.240.200 103,1 % 49,7 %80 und älter 825.713 1.575.056 3.448.363 5.727.000 9.124.700 317,6 % 164,6 %90 und älter 33.934 109.414 598.227 882.900 1.904.500 1.662,9 % 218,4 %Anteil <strong>der</strong> Altersgruppen an <strong>der</strong> Bevölkerung (<strong>in</strong> %):20 bis u. 65 59,2 56,12 61,5 60,4 54,3 + 2,3 %-Pkte. – 7,2 %-Pkte.65 und älter 10,4 14,00 18,0 21,9 29,6 + 7,6 %-Pkte. + 11,6 %-Pkte.80 und älter 1,4 2,01 4,2 6,9 12,2 + 3,0 %-Pkte. + 8,0 %-Pkte.90 und älter 0,1 0,1 0,7 1,1 2,5 + 0,7 %-Pkte. + 1,8 %-Pkte.Altenquotient 3 17,5 24,9 29,3 36,4 54,5 67,2 % 86,3 %1) Wohnbevölkerung am Jahresende.2) Die Angaben für die Jahre 2020 und 2050 s<strong>in</strong>d Schätzwerte auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> 10. koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung des StatistischenBundesamts (Variante 5).3) Altenquotient: Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren je 100 20- bis 64-Jährige.Quellen: GeroStat - Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berl<strong>in</strong>; Statistisches Bundesamt 1996; Statistisches Bundesamt 2003; eigene Berechnungen.Altersaufbau <strong>der</strong> Bevölkerung im ErwerbsalterAbbildung 1Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, 10. koord<strong>in</strong>ierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 5.
Drucksache 16/2190 – 52 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodedem Erwerbsleben wie<strong>der</strong> auf 37 Prozent im Jahr 2050<strong>zur</strong>ück.Je nach Zeithorizont, <strong>der</strong> für die Betrachtung <strong>der</strong> Folgendes demografischen Wandels gewählt wird, treten unterschiedlicheProblemlagen <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>grund. Der Auftrag<strong>der</strong> Bundesregierung an die 5. Altenberichtskommissionsieht vor, dass <strong>der</strong> Altenbericht zukunftsgerichteteAussagen für die weitere Entwicklung bis zum Jahr2020 treffen soll. Für das Thema <strong>der</strong> Arbeitsmarktentwicklungbedeutet dieser Zeitraum, dass Deutschlandmit e<strong>in</strong>er alternden Erwerbsbevölkerung und alterndenBelegschaften konfrontiert se<strong>in</strong> wird. Es ist für dienächsten 15 Jahre aber kaum mit e<strong>in</strong>er nennenswertenEntlastung des Arbeitsmarktes durch e<strong>in</strong>e schrumpfendeBevölkerung im Erwerbsalter zu rechnen. Nach den Jahren2020 und 2050 wird die Alterung noch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>eBeschleunigung erfahren. Grund s<strong>in</strong>d die geburtenstarkenJahrgänge, die ab dem ersten Zeitpunkt die Grenzezum Rentenalter erreichen und nach dem zweiten Zeitpunktvoraussichtlich <strong>in</strong> ihrer Mehrheit verstorben se<strong>in</strong>werden. Ab dem Jahr 2020 wird sich bei <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong>Personen im Erwerbsalter e<strong>in</strong> deutlicher Rückgang vollziehen(Abbildung 1). Über das Jahr 2050 h<strong>in</strong>ausreichendeBevölkerungsprojektionen zeigen, dass bei e<strong>in</strong>erFortschreibung <strong>der</strong> heutigen Geburtenraten, des für dienächsten Jahre erwarteten Wan<strong>der</strong>ungssaldos und e<strong>in</strong>ermo<strong>der</strong>aten Erhöhung <strong>der</strong> Lebenserwartung <strong>der</strong> bereitsvorher e<strong>in</strong>setzende Schrumpfungsprozess noch e<strong>in</strong>malbeschleunigt wird. Ohne „Gegenmaßnahmen“ (etwa steigendeGeburtenraten und erhöhte Zuwan<strong>der</strong>ung) würdedie Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland im Jahr 2100 nahezuum die Hälfte kle<strong>in</strong>er se<strong>in</strong> als heute.Auf regionaler sowie Stadt- und Landkreisebene f<strong>in</strong>densich zum Teil gegensätzliche Entwicklungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bevölkerungsstruktur:– e<strong>in</strong>mal, weil die Geburtenhäufigkeiten regional sehrunterschiedlich s<strong>in</strong>d,– zum an<strong>der</strong>en, weil die Zuwan<strong>der</strong>er sich <strong>in</strong> ihrer Verteilungim Lande eher an den ökonomischen Stärken <strong>der</strong>Regionen orientieren und– zum dritten, weil auch die B<strong>in</strong>nenwan<strong>der</strong>ung vorwiegendökonomischen Sachverhalten folgt.In verschiedenen Regionen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den neuenBundeslän<strong>der</strong>n, die von massenhafter Abwan<strong>der</strong>ung jungerMenschen betroffen s<strong>in</strong>d, zeigen sich die möglichenFolgeprobleme e<strong>in</strong>er alternden und schrumpfenden Bevölkerungdamit schon früher als im Bundesdurchschnitt.Diese Entwicklung ist nicht auf Deutschland beschränkt.Auch im europäischen Raum s<strong>in</strong>d die demografischenProzesse mit denen <strong>in</strong> Deutschland vergleichbar. In <strong>der</strong>EU wird <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> 65-Jährigen und Älteren <strong>in</strong> ähnlichemUmfang ansteigen wie <strong>in</strong> Deutschland. So nimmtihr Anteil nach e<strong>in</strong>er Eurostat Bevölkerungsprojektion(2004) <strong>in</strong> <strong>der</strong> EU (25 Län<strong>der</strong>) von 15,7 Prozent (2000) auf30,3 Prozent (2050) zu. Laut e<strong>in</strong>em aktuellen <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong>EU-Kommission (2005) läuft auch <strong>der</strong> Schrumpfungsprozess<strong>der</strong> EU-Bevölkerung parallel <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>in</strong>Deutschland. „Die Bevölkerung <strong>der</strong> Union dürfte bis2025 nur noch leicht anwachsen, und dies vor allem dank<strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>ung, um danach zu schrumpfen: 458 MillionenE<strong>in</strong>wohner im Jahre 2005, 469,5 Millionen im Jahre2025 (+ 2 Prozent), dann 468,7 Millionen im Jahre 2030.Aber 55 <strong>der</strong> 211 Regionen <strong>der</strong> Europäischen Union mit15 Mitgliedstaaten verzeichneten schon <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweitenHälfte <strong>der</strong> 1990er-Jahre e<strong>in</strong>en Bevölkerungsrückgang;dies gilt auch für die meisten Regionen <strong>der</strong> neuen Mitgliedstaaten(35 von 55), bed<strong>in</strong>gt durch natürlichen Rückgangund Nettoabwan<strong>der</strong>ung. Dieser Rückgang ist nochrascher und tief greifen<strong>der</strong>, wenn man sich nur die Bevölkerungim erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) ansieht:zwischen 2005 und 2030 dürfte hier e<strong>in</strong> Rückgang um20,8 Millionen zu verzeichnen se<strong>in</strong>“ (Kommission <strong>der</strong>Europäischen Geme<strong>in</strong>schaften 2005).Aus dem demografischen Wandel ergibt sich langfristige<strong>in</strong> Mangel an qualifizierten jüngeren Arbeitskräften. Damitist e<strong>in</strong>e Personalpolitik, die älteren ArbeitnehmernFort- und Weiterbildungsangebote vorenthält, auf Maßnahmen<strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiterverzichtet und konjunkturbed<strong>in</strong>gte Kapazitätsproblemevorzugsweise durch Freisetzung ältererArbeitskräfte löst, nicht zukunftsfähig. Die deutscheWirtschaft wird langfristig nicht auf das Beschäftigungspotenzialälterer Arbeitnehmer verzichten können. Innovationsfähigkeitwird auf Dauer nicht mehr alle<strong>in</strong> durchjüngere Arbeitnehmer zu sichern se<strong>in</strong>.Als entscheidende Konsequenz aus dem demografischenWandel ergibt sich die Notwendigkeit, <strong>der</strong> anhaltendniedrigen Fertilitätsraten mit gezielten Maßnahmen <strong>zur</strong>Schaffung e<strong>in</strong>er k<strong>in</strong><strong>der</strong>freundlichen Gesellschaft zu begegnen(Kaufmann 2005). Alle europäischen Nachbarlän<strong>der</strong>versuchen durch Zuwan<strong>der</strong>ung qualifizierter Fachkräfteaus Drittstaaten ihre demografischen Probleme,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e den Fachkräftemangel, abzumil<strong>der</strong>n, sodasse<strong>in</strong>e noch stärkere Konkurrenz um junge gut ausgebildeteZuwan<strong>der</strong>er zwischen den europäischen Mitgliedstaatene<strong>in</strong>setzen wird als es schon heute <strong>der</strong> Fall ist. Es ist daherfraglich, ob die gut qualifizierten Zuwan<strong>der</strong>er überhauptim benötigten Maß für den deutschen Arbeitsmarkt <strong>zur</strong>Verfügung stehen werden. Zuwan<strong>der</strong>ung kann also immernur e<strong>in</strong> Teil e<strong>in</strong>er Bewältigungsstrategie für die Folgendes demografischen Wandels se<strong>in</strong>. Die Verbesserung <strong>der</strong>Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für Familien mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ist daherdr<strong>in</strong>gend notwendig, damit sich mehr junge Menschen ihrenK<strong>in</strong><strong>der</strong>wunsch bereits frühzeitig im Lebenslauf erfüllenkönnen. Arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitisch liegen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Herstellung <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit vonK<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung und Beruf für Frauen und Männer unde<strong>in</strong>er Verbesserung <strong>der</strong> Situation junger Familien und Alle<strong>in</strong>erziehen<strong>der</strong>die vorrangigen Aufgaben. Auf Grund<strong>der</strong> „Trägheit“ demografischer Entwicklungen und <strong>der</strong>langen Zeiträume, die notwendig s<strong>in</strong>d, damit sich Än<strong>der</strong>ungenim Geburtenverhalten auf die Bevölkerungsstrukturauswirken, gibt es aber ke<strong>in</strong>e Alternative <strong>zur</strong> verstärktenNutzung <strong>der</strong> Potenziale älterer Menschen, um denerreichten gesellschaftlichen Wohlstand zu erhalten unddie Innovationsfähigkeit Deutschlands zu sichern.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 53 – Drucksache 16/21901.4 Leitbil<strong>der</strong> <strong>der</strong> KommissionMitverantwortliches Leben älterer Menschen undSolidaritätDas Leitbild e<strong>in</strong>es mitverantwortlichen Lebens gründetauf dem von Nell-Breun<strong>in</strong>g <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er christlichen Soziallehre(1977) explizierten Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip. Dieses besagt,dass Probleme vorzugsweise dort zu lösen s<strong>in</strong>d, wosie entstehen, bzw. dass größere soziale E<strong>in</strong>heiten erstdann für Problemlösungen zuständig s<strong>in</strong>d und unterstützend(„subsidiär“) tätig werden, wenn die jeweils kle<strong>in</strong>erensozialen E<strong>in</strong>heiten nicht zu e<strong>in</strong>er selbstständigen Lösung<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> s<strong>in</strong>d. Das Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip betontdamit gleichermaßen die Nutzung bestehen<strong>der</strong> Problemlösepotenziale(des E<strong>in</strong>zelnen, <strong>der</strong> Familie, <strong>der</strong> Kommuneusw.) durch För<strong>der</strong>ung von Eigenverantwortung sowiedie Verpflichtung übergeordneter sozialer E<strong>in</strong>heiten (<strong>der</strong>Familie, <strong>der</strong> Kommune, des Staates) im Bedarfsfalle unterstützendtätig zu werden. In se<strong>in</strong>er Anlehnung an dasSubsidiaritätspr<strong>in</strong>zip verweist das Leitbild e<strong>in</strong>es mitverantwortlichenLebens entsprechend sowohl auf die Verpflichtungdes E<strong>in</strong>zelnen, durch e<strong>in</strong>e selbstverantwortlicheLebensführung Potenziale auszubilden und für sichselbst und an<strong>der</strong>e zu nutzen als auch auf die Verpflichtungdes Staates, für Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu sorgen, die Individuene<strong>in</strong>e angemessene Ausbildung und Verwirklichungvon Potenzialen ermöglichen.Der Zusammenhalt und die Funktionsfähigkeit unsererGesellschaft beruht auf dem Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Solidarität. Diesist für das Thema dieses Altenberichtes gleichbedeutenddamit, dass von jenen, die dazu <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> s<strong>in</strong>d, auche<strong>in</strong>e Unterstützung <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft e<strong>in</strong>gefor<strong>der</strong>t werdenkann – von älteren Menschen und für ältere Menschen.Wenn <strong>in</strong> weiten Teilen <strong>der</strong> Bevölkerung die beruflicheLeistungsfähigkeit über das Erreichen <strong>der</strong> gegenwärtigenAltersgrenze h<strong>in</strong>aus erhalten und gleichzeitigdie Geme<strong>in</strong>schaft auf e<strong>in</strong>e optimale Ausschöpfung desErwerbspersonenpotenzials angewiesen ist, dann sollteverstärkt über e<strong>in</strong>e Flexibilisierung des Übergangs <strong>in</strong> denRuhestand, die von <strong>der</strong> Tendenz auf e<strong>in</strong>e Anhebung desRentene<strong>in</strong>trittsalters zielt, diskutiert werden. Auf Grund<strong>der</strong> sehr unterschiedlich verteilten körperlichen und psychischenBelastungen zwischen den Berufsgruppen, s<strong>in</strong>dallerd<strong>in</strong>gs differenzierte Antworten nötig. Ansonstenkönnten gerade diejenigen Gruppen von Arbeitnehmernund Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen, die <strong>in</strong> ihrer Jugend früh <strong>in</strong>s Arbeitslebene<strong>in</strong>treten mussten, damit lange Beitragszahlungengeleistet haben, belastende Arbeitsverhältnisse hattenund krankheitsbed<strong>in</strong>gt häufig früh ausscheiden, zusätzlichdurch hohe Rentenabschläge bestraft werden.Voraussetzung für e<strong>in</strong>e faktische Anhebung des Rentene<strong>in</strong>trittsalterswie auch für e<strong>in</strong>e Flexibilisierung o<strong>der</strong> Erhöhung<strong>der</strong> Regelaltersgrenze ist zum e<strong>in</strong>en, dass die Arbeitnehmerim Verlauf ihres Erwerbslebens durchbetriebliche und überbetriebliche Maßnahmen <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund <strong>der</strong> Qualifizierung <strong>in</strong> die <strong>Lage</strong>versetzt werden, diesen Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong>dividuell gerechtwerden zu können. Zum an<strong>der</strong>en muss die Arbeitsmarktlageso beschaffen se<strong>in</strong>, dass sie es älteren Arbeitnehmernund Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Selbstständigenauch erlaubt, ihre Arbeitskraft e<strong>in</strong>zusetzen. Da sich dieArbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter und Mitarbeiter<strong>in</strong>nenbranchenspezifisch sehr unterschiedlich gestaltet, ersche<strong>in</strong>tweniger e<strong>in</strong>e generelle Erhöhung, als vielmehre<strong>in</strong>e Flexibilisierung des Rentene<strong>in</strong>trittsalters als angemessen.Die am Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Solidarität orientierte For<strong>der</strong>ung nache<strong>in</strong>er stärkeren Nutzung <strong>der</strong> Potenziale älterer Menschenfür die Gesellschaft beschränkt sich nicht auf die Arbeitswelt,son<strong>der</strong>n gilt <strong>in</strong> gleicher Weise für das bürgerschaftlicheEngagement. E<strong>in</strong>e Stärkung des bürgerschaftlichenEngagements setzt voraus, dass ältere Menschen <strong>in</strong>stärkerem Maße als mitverantwortlich Handelnde angesprochenwerden. Nur auf <strong>der</strong> Grundlage von realen gesellschaftlichenGestaltungsmöglichkeiten, e<strong>in</strong>er gesellschaftlichenAnerkennung <strong>der</strong> Potenziale des Alters unde<strong>in</strong>es glaubwürdigen Appells an ihre Solidarität werdenältere Menschen auch die Motivation zu mitverantwortlichemHandeln empf<strong>in</strong>den und sich entsprechend für an<strong>der</strong>ee<strong>in</strong>setzen.Alter als Innovationsmotor stärkenE<strong>in</strong> weiteres Leitbild kommt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Auffassung zum Ausdruck,dass gesellschaftlicher Wohlstand nur mit kreativenÄlteren erhalten werden kann. Mit <strong>der</strong> Alterung desErwerbspersonenpotenzials und von Betriebsbelegschaftensteigt die Notwendigkeit, die <strong>in</strong>novativen und kreativenFähigkeiten älterer Beschäftigter und Selbstständigerzu erkennen und zu för<strong>der</strong>n. Entsprechend s<strong>in</strong>d von betrieblicherund gesellschaftlicher Seite die Voraussetzungenfür den Erhalt und die Entwicklung von Kreativitätim Alter zu schaffen. Zu diesen Voraussetzungen zählennicht zuletzt die Schaffung von lernför<strong>der</strong>nden Arbeitsumgebungenfür Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmernaller Altersgruppen und spezifischen Bildungsmaßnahmenfür ältere Beschäftigte und Arbeitssuchende.Mit dem zunehmenden Anteil älterer Menschen gew<strong>in</strong>ntauch das bürgerschaftliche Engagement an Bedeutung fürdie Erhaltung gesellschaftlicher Produktivität und Innovationsfähigkeit.Die im Vergleich zu früheren Geburtsjahrgängenbessere Ausstattung mit den Potenzialen Gesundheit,Bildung, f<strong>in</strong>anzielle Ressourcen und Zeitrechtfertigt hier e<strong>in</strong>e optimistische Prognose unter <strong>der</strong> Voraussetzung,dass es gel<strong>in</strong>gt, ältere Menschen <strong>in</strong> angemessenerWeise <strong>zur</strong> Übernahme e<strong>in</strong>er entsprechenden Aufgabezu motivieren. Angesichts verän<strong>der</strong>ter Erwerbs- undBildungsbiografien ist hier davon auszugehen, dass <strong>in</strong>Zukunft vor allem anspruchsvolle Aufgaben und Tätigkeitennachgefragt werden, die eigenverantwortlichesHandeln zulassen und gleichzeitig Möglichkeiten zumAustausch von Erfahrungen und <strong>zur</strong> gezielten Fort- undWeiterbildung eröffnen. Ältere Menschen können auchim sozialen und politischen Engagement zukünftig stärkerInitiatoren von Innovationen werden.Nachhaltigkeit und <strong>Generation</strong>ensolidaritätDas Leitbild <strong>der</strong> Nachhaltigkeit und <strong>Generation</strong>ensolidaritätbesagt, dass die För<strong>der</strong>ung und Verwirklichung von
Drucksache 16/2190 – 54 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodePotenzialen des Alters nicht zu Lasten an<strong>der</strong>er <strong>Generation</strong>eno<strong>der</strong> späterer Geburtsjahrgänge gehen darf.Die För<strong>der</strong>ung von Potenzialen des Alters ist grundsätzlichauch im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Notwendigkeit, e<strong>in</strong>ek<strong>in</strong><strong>der</strong>freundliche Gesellschaft zu schaffen, zu sehen. Dasentscheidende Problem des demografischen Wandels bestehtnicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> höheren Lebenserwartung, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong><strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geren Fertilitätsrate. Aufbau, Erhalt und bessereNutzung <strong>der</strong> Potenziale des Alters sollten nicht isoliertvon ihren Auswirkungen auf nachfolgende <strong>Generation</strong>endiskutiert werden (<strong>Generation</strong>ensolidarität), vielmehrstellt sich aus gesellschaftlicher Perspektive auch dieFrage, <strong>in</strong>wieweit die Potenziale des Alters für nachfolgende<strong>Generation</strong>en genutzt werden können. E<strong>in</strong>e k<strong>in</strong><strong>der</strong>fe<strong>in</strong>dlicheGesellschaft ist auf Dauer nicht überlebensfähig,e<strong>in</strong>e Verwirklichung von Potenzialen des Alterslangfristig nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er k<strong>in</strong><strong>der</strong>freundlichen Gesellschaftmöglich. Entsprechend erweist sich die För<strong>der</strong>ung generationenübergreifen<strong>der</strong>Kontakte im Kontext <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ungund Nutzung von Potenzialen des Alters als e<strong>in</strong>ezentrale Aufgabe.Lebenslanges LernenLebenslanges berufsbezogenes Lernen wie allgeme<strong>in</strong>elebenslange Lernprozesse werden <strong>in</strong> Zukunft an Bedeutunggew<strong>in</strong>nen. Ältere Menschen verfügen heute über e<strong>in</strong>enim Vergleich zu früheren Kohorten höheren durchschnittlichenBildungsstand sowie über e<strong>in</strong>e imDurchschnitt höhere Vertrautheit im Umgang mit Bildungsangeboten.Derart verän<strong>der</strong>te Bildungsbiografiengehen auch mit e<strong>in</strong>er gesteigerten Lernfähigkeit im Altere<strong>in</strong>her. Technische Innovationen und gestiegene Lebenserwartungenbe<strong>in</strong>halten auch das Risiko, dass Wissenssystemeschneller veralten, bereichsspezifische Erfahrungenmith<strong>in</strong> nutzlos werden. Entsprechend ist dieVorstellung, man könne berufliche Bildungsprozesse ausschließlichauf e<strong>in</strong>en frühen Abschnitt <strong>der</strong> Biografie konzentrieren,nicht mehr zeitgemäß. Ebenso wie sich nachfolgende<strong>Generation</strong>en lebenslang weiterbilden müssen,sollten sich auch ältere Menschen für Bildungsangeboteöffnen. Angesichts <strong>der</strong> gegenüber früheren Geburtsjahrgängenverän<strong>der</strong>ten Bildungsbiografien geht die Kommissionhier davon aus, dass sich <strong>der</strong> Trend zu e<strong>in</strong>em höherenBildungsniveau im Alter weiter fortsetzen wird.Auf dieser Grundlage ist e<strong>in</strong>e Neugestaltung des Lebenslaufsim S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er alters<strong>in</strong>tegrierten Gesellschaft zu for<strong>der</strong>n,wobei <strong>der</strong> Verknüpfung von beruflicher Tätigkeitmit lebenslangem Lernen, K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung und Pflegee<strong>in</strong>e große Rolle zukommt.PräventionDie Möglichkeiten <strong>der</strong> gezielten Nutzung von Potenzialendes Alters beruhen sowohl darauf, dass die Menschenimmer älter werden als auch darauf, dass sie bei guter Gesundheite<strong>in</strong> hohes Alter erreichen. In <strong>der</strong> Prävention liegtsomit e<strong>in</strong>e große Chance für e<strong>in</strong> langes Leben <strong>in</strong> guterGesundheit, Selbstständigkeit und Mitverantwortung. Gegenüberfrüheren Geburtsjahrgängen verfügen die heuteälteren Menschen im Durchschnitt auch über e<strong>in</strong>e deutlichbessere Gesundheit. Dennoch s<strong>in</strong>d die bis <strong>in</strong>s hoheAlter bestehenden Präventionspotenziale bei weitem nochnicht ausgeschöpft.Durch e<strong>in</strong>e stärker präventive Ausrichtung des Gesundheitssystems,e<strong>in</strong>e Kultur des präventiven Handelns unde<strong>in</strong>er flächendeckenden E<strong>in</strong>führung von betrieblichen gesundheitsför<strong>der</strong>ndenMaßnahmen lässt sich nicht nur dieKostenentwicklung im Gesundheitssystem positiv bee<strong>in</strong>flussen,son<strong>der</strong>n auch die Produktivität älterer Arbeitnehmerund Senioren erheblich erhöhen. Die Arbeitsfähigkeitälterer Arbeitnehmer bleibt länger erhalten, dieZugänge <strong>zur</strong> Erwerbsunfähigkeitsrente verr<strong>in</strong>gern sichund die Voraussetzungen für nachberufliche Produktivitätwerden verbessert. Für die Nacherwerbsphase ist festzustellen,dass sich die Entwicklung <strong>der</strong> körperlichen undgeistigen Leistungsfähigkeit durch geeignete Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsundBildungsangebote erheblich bee<strong>in</strong>flussen lässt. DesWeiteren ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass durch e<strong>in</strong>e bessereAusschöpfung von Rehabilitationspotenzialen <strong>in</strong> vielenFällen zu verbesserten Möglichkeiten e<strong>in</strong>er selbstständigen,selbstverantwortlichen und mitverantwortlichen Lebensführungbeigetragen werden kann (Kruse 2002a).Das Zusammenspiel von Verhältnisprävention, die <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>ean den Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den Betrieben ansetzenmuss, und <strong>der</strong> Verantwortung des E<strong>in</strong>zelnen für dieAufrechterhaltung se<strong>in</strong>er Gesundheit wird stärker betontwerden müssen.1.5 Möglichkeiten und WirklichkeitenIn dynamischen Gesellschaften s<strong>in</strong>d Chancen, die sich füre<strong>in</strong>e Gruppe ergeben, nicht selten mit Risiken für an<strong>der</strong>eGruppen verbunden. Entsprechend ist es denkbar, dassdie gezielte För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Nutzung von Ressourcen desAlters zu Lasten <strong>der</strong> für nachfolgende <strong>Generation</strong>en bestehendenMöglichkeiten, ihre eigenen Ressourcen zuvermehren o<strong>der</strong> zu verwirklichen, geht, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e unter<strong>der</strong> Bed<strong>in</strong>gung <strong>der</strong> Knappheit von Ressourcen. DieKommission trägt diesem Umstand durch das Leitbild <strong>der</strong><strong>Generation</strong>ensolidarität Rechnung. Entscheidend ist hier<strong>der</strong> Gedanke, dass etwa e<strong>in</strong>e Verbesserung <strong>der</strong> Partizipationsmöglichkeitenälterer Menschen letztlich auch immernachfolgenden <strong>Generation</strong>en zugute kommen sollte. E<strong>in</strong>e„optimierte“ Altersschichtung ersche<strong>in</strong>t nicht nur im H<strong>in</strong>blickauf die Nutzung von Potenzialen älterer Menschen<strong>in</strong> gesamtgesellschaftlichem Interesse, son<strong>der</strong>n darüberh<strong>in</strong>aus auch, weil für nachfolgende <strong>Generation</strong>en dieAussicht besteht, von e<strong>in</strong>er solchermaßen verän<strong>der</strong>ten Altersschichtungzu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt ebenfalls zuprofitieren. Dennoch sollte nicht übersehen werden, dassgesellschaftliche Innovationen subjektiv – und eben nichtnotwendigerweise objektiven Gegebenheiten entsprechend– wahrgenommen und bewertet werden. Unter <strong>der</strong>Voraussetzung, dass die für weite Teile unserer Gesellschaftcharakteristische kulturelle Reserviertheit gegenüberdem Alter weiter bestehen bleibt, ist es durchausdenkbar, dass etwa e<strong>in</strong>e Verbesserung <strong>der</strong> Erwerbschanceno<strong>der</strong> Teilhabechancen Älterer von Jüngeren im S<strong>in</strong>nee<strong>in</strong>er Konkurrenz um knappe Ressourcen o<strong>der</strong> im S<strong>in</strong>nee<strong>in</strong>er nicht gerechtfertigten Benachteiligung <strong>der</strong> eigenen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 55 – Drucksache 16/2190<strong>Generation</strong> <strong>in</strong>terpretiert wird (gerade unter den Bed<strong>in</strong>gungene<strong>in</strong>er dauerhaften Beschäftigungskrise).Die hier angesprochene Bedeutung gesellschaftlicher Altersbil<strong>der</strong>für die Akzeptanz von Bemühungen um dieDurchsetzung neuer Sichtweisen von Lebenslauf, Jugendund Alter (im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Überw<strong>in</strong>dung klassischer Segmentierungendes Lebenslaufs) verweist auf die Rahmenbed<strong>in</strong>gungenund Schwierigkeiten, unter denen die von<strong>der</strong> Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen realisiertund kont<strong>in</strong>uierlich neu erarbeitet werden müssen. Entsprechendist e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung von Potenzialen ältererMenschen – worauf bereits im Zusammenhang mit demLeitbild <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>ensolidarität h<strong>in</strong>gewiesen wurde –nur im Kontext e<strong>in</strong>er generationenübergreifenden Perspektivemöglich, die sich gleichzeitig kont<strong>in</strong>uierlich umdie Transparenz von Zielsetzungen und Maßnahmen bemüht.1.6 Überblick über den <strong>Bericht</strong>Auf Grund <strong>der</strong> oben beschriebenen Themenstellung wirde<strong>in</strong>e Reihe von Themen <strong>in</strong> diesem Altenbericht nicht o<strong>der</strong>nur am Rande behandelt, obwohl diese ebenfalls unterdas Thema <strong>der</strong> „Potenziale des Alters und für das Alter“fallen könnten. Dies gilt zum Beispiel für Fragen <strong>der</strong> altersangemessenenAusgestaltung <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen undpflegerischen Versorgungssysteme und des Wohnens imAlter, die <strong>in</strong> den bisherigen Altenberichten breiten Raume<strong>in</strong>genommen haben. Die 5. Altenberichtskommissionbehandelt die F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> Sozialversicherungssystemenur am Rande und geht stattdessen stärker auf dieAuswirkungen <strong>der</strong> e<strong>in</strong>geleiteten Reformen für den <strong>in</strong>dividuellenf<strong>in</strong>anziellen Handlungsspielraum im Alter e<strong>in</strong>.Der 5. Altenbericht ist <strong>in</strong> neun Kapitel geglie<strong>der</strong>t. Daserste Kapitel führt <strong>in</strong> das Thema e<strong>in</strong>, bestimmt den BegriffPotenziale des Alters vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> öffentlichenDiskussion über die Folgen des demografischenWandels und expliziert die Leitbil<strong>der</strong>, von denensich die Kommission <strong>in</strong> ihrer Arbeit hat führen lassen.Das zweite Kapitel gibt e<strong>in</strong>e Analyse <strong>der</strong> Erwerbstätigkeitälterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmer und beantwortetdie Frage, wie die Erwerbsbeteiligung ältererMenschen erhöht werden kann. Dies geschieht mit Blickauf Deutschland, schließt aber auch den <strong>in</strong>ternationalenVergleich mit e<strong>in</strong>.Das dritte Kapitel befasst sich mit Bildung und Lernen imErwerbsalter und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase und verweistauf die Notwendigkeit des Ausbaus lebenslangen Lernens.Es wird, unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong>ternationaler Erfahrungen,dargestellt, wie Bildung zum Aufbau und Erhaltvon Potenzialen älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmersowie älterer Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphasebeitragen kann.Im vierten Kapitel werden die E<strong>in</strong>kommens- und Vermögenslagenals Voraussetzung für die Entfaltung von Potenzialenälterer Menschen analysiert. Die Auswirkungen<strong>der</strong> e<strong>in</strong>geleiteten Sozialreformen auf die künftige E<strong>in</strong>kommensentwicklungund -verteilung im Alter werdenuntersucht und e<strong>in</strong> alternativer Reformpfad skizziert.Das fünfte Kapitel stellt dar, welche Chancen die stärkerzu entwickelnde „Seniorenwirtschaft“ bietet, die sich mit<strong>der</strong> Produktion von Gütern und Dienstleistungen für ältereMenschen befasst, um negative wirtschaftliche Konsequenzendes demografischen Wandels zu kompensieren.Im sechsten Kapitel geht es um die vielfältigen Unterstützungsleistungen,die ältere Menschen <strong>in</strong> Familien undprivaten Netzwerken erbr<strong>in</strong>gen und um die Fragen, wiediese Potenziale älterer Menschen geför<strong>der</strong>t werden könnenund wo die Grenzen familialer Unterstützungspotenzialeliegen. Daran anknüpfend werden Maßnahmen zumErhalt und <strong>zur</strong> Stärkung familialer und privater Netzwerkediskutiert.Das siebte Kapitel gibt e<strong>in</strong>e Analyse des bürgerschaftlichenEngagements älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland undzeigt <strong>der</strong>en Beitrag <strong>zur</strong> <strong>Generation</strong>ensolidarität und gesellschaftlichenMo<strong>der</strong>nisierung auf. Weiterh<strong>in</strong> werdenZiele, Optionen und Maßnahmen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ungbehandelt.Im achten Kapitel werden die Potenziale älterer Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten analysiert, und es wird <strong>der</strong> Fragenachgegangen, wie diese geför<strong>der</strong>t und besser für dieSelbsthilfe und für gesellschaftliches Engagement genutztwerden können.Im neunten Kapitel werden die zentralen Anliegen undErgebnisse des 5. Altenberichts zusammengefasst. Anschließendwerden alle von <strong>der</strong> Kommission <strong>in</strong> den Fachkapitelnerarbeiteten Handlungsempfehlungen noch e<strong>in</strong>malaufgeführt.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 57 – Drucksache 16/21902 Erwerbsarbeit2.1 E<strong>in</strong>leitungIn Deutschland waren im Jahre 2004 nur 41,4 Prozent allerPersonen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren beschäftigt(Abbildung 2). Die Differenz zwischen den Beschäftigungsquoten<strong>der</strong> Älteren und <strong>der</strong> Personen imHaupterwerbsalter zwischen 25 und 44 Jahren liegt bei46 Prozent. E<strong>in</strong>e solch ger<strong>in</strong>ge Nutzung des ErwerbspersonenpotenzialsÄlterer <strong>in</strong> Deutschland und auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>eneuropäischen Län<strong>der</strong>n ist angesichts <strong>der</strong> demografischenEntwicklung auf Dauer nicht vertretbar. Bis zumJahre 2020 wird das Erwerbspersonenpotenzial <strong>der</strong> über50-Jährigen <strong>in</strong> Deutschland um fast 5 Millionen Personenund ihr Anteil am Erwerbspersonenpotenzial <strong>in</strong>sgesamtvon 22 auf 34 Prozent steigen. Entsprechend s<strong>in</strong>ken dieAnteile <strong>der</strong> übrigen Altersklassen (Prognos 2002) (Abbildung3). Die Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Arbeitswelt von morgenund übermorgen müssen somit von <strong>in</strong>sgesamt wenigerund zugleich älteren Erwerbspersonen bewältigt werden.Angesichts dieser Entwicklung wird e<strong>in</strong>e bessere Nutzungdes Potenzials älterer Arbeitnehmer aus mehrerenGründen befürwortet: So wird vielfach e<strong>in</strong> sonst rückläufigesArbeitsangebot als Hemmnis für die künftige wirtschaftlicheEntwicklung angesehen. Außerdem wird e<strong>in</strong>Anstieg von Sozialversicherungsbeiträgen gebremst, dasich die Relation von Leistungsempfängern zu Beitragszahlernverbessert und beträchtliche Ausgaben für dieunterschiedlichen Wege zum „Vorruhestand“ entfallen.Zudem liegt heute e<strong>in</strong> erheblicher Wissens- und ErfahrungsschatzÄlterer brach, <strong>der</strong> durch Jüngere nicht e<strong>in</strong>fachersetzt werden kann und künftig gehoben werdensollte. Darüber h<strong>in</strong>aus ist bei zunehmendem Lebensaltere<strong>in</strong>e längere Erwerbsphase e<strong>in</strong> wichtiges Element e<strong>in</strong>erAbbildung 2Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 25- bis 44-Jährigen und <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Union (15) 2004Beschäftigungsquoten(Prozent)908025 - 44 Jahre55 - 64 JahreDifferenz zw. beiden QuotenDifferenz(Prozent)908070605040306762596253484546 4737403730277060504030Ziel Stockholm20100A B I L F EL E D NL IRL P FIN UK DK S1720100Quelle: Bosch & Schief 2005a. Datenbasis: Europäische Arbeitskräftestichprobe 2004.
Drucksache 16/2190 – 58 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeAbbildung 3Erwerbspersonenpotenzial <strong>in</strong> Mio. Personen (<strong>in</strong> Prozent)<strong>in</strong> Mio. Personen(<strong>in</strong> Prozent )9,5(22%)11,1(26%)12,6(29%)10,4(24%)12,5(29%)10,7(25%)11,9(27%)12,8(29%)9,1(21%)13,7(32%)10,9(25%)9,2(21%)14,4(34%)9,4(22%)9,6(23%)Alter 50+Alter 40-49Alter 30-39Alter 16-299,5(22%)9,7(22%)9,7(22%)9,4(22%)8,7(21%)2000 2005 2010 2015 2020Quelle: Prognos 2002: 62erfüllten Lebensgestaltung, die heute vielen Älteren <strong>in</strong>den Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt versagt wird.Und schließlich ist es auch gesellschaftlich nicht vertretbar,bei e<strong>in</strong>er auch künftig weiter steigenden Lebenserwartungund angesichts wachsen<strong>der</strong> Potenziale <strong>der</strong>jeweils nachrückenden Geburtsjahrgänge älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer im Zusammenwirken mitihren Arbeitgebern die bisherige Praxis <strong>der</strong> frühen „Freisetzungdes Alters“ fortzusetzen. Es ist also e<strong>in</strong>e Umkehre<strong>in</strong>er aus dem Zusammenwirken von Politik, Sozialpartnern,Betrieben und Arbeitnehmern erwachsenen Befürwortungdes frühen Ruhestandes erfor<strong>der</strong>lich. Dies setzte<strong>in</strong> Umdenken bei allen Akteuren voraus. Die Erhöhung<strong>der</strong> Beschäftigungsquote Älterer steht <strong>in</strong>zwischen nichtnur <strong>in</strong> Deutschland, son<strong>der</strong>n auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en europäischenLän<strong>der</strong>n auf <strong>der</strong> politischen Tagesordnung. Die Herausfor<strong>der</strong>ungist umso größer, da es nicht alle<strong>in</strong>e um dieBewältigung des <strong>in</strong>dividuellen, son<strong>der</strong>n erstmals <strong>in</strong> <strong>der</strong>Geschichte <strong>der</strong> Industriegesellschaften um e<strong>in</strong>e Verbesserung<strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Beschäftigungsfähigkeit im Zusammenhangmit e<strong>in</strong>em kollektiven Altern <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerunggeht (Volkholz 2004a; Volkholz, Kiel &W<strong>in</strong>gen 2002).Was langfristig notwendig und vernünftig ersche<strong>in</strong>t, istkurzfristig allerd<strong>in</strong>gs nicht so ohne weiteres umsetzbar.Wie <strong>in</strong> Abbildung 3 erkennbar ist, wird das Erwerbspersonenpotenzialbis 2020 fast konstant bleiben und erst danachs<strong>in</strong>ken. Auch bezüglich <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit wird erwartet,dass sie noch lange auf e<strong>in</strong>em hohen Niveauverharrt (2010 bei 8,8 Prozent und bis 2020 bei 7,0 Prozent;Bundesm<strong>in</strong>isterium für Gesundheit und Soziale Sicherung2003a: 63). Bei e<strong>in</strong>em solchen gesamtwirtschaftlichenArbeitskräfteüberschuss ist nicht auszuschließen,dass durch e<strong>in</strong>e Erhöhung des faktischen Rentene<strong>in</strong>trittsaltersfür e<strong>in</strong>e lange Übergangsfrist nicht die Beschäftigungsquote,son<strong>der</strong>n nur die Arbeitslosenquote <strong>der</strong> Älterensteigt (Kistler & Huber 2002).In <strong>der</strong> öffentlichen Diskussion dom<strong>in</strong>ieren Vorstellungen,dass man lediglich die heutige Vorruhestandspraxis beendenund zum Rentene<strong>in</strong>trittsalter <strong>der</strong> 1960er-Jahre <strong>zur</strong>ückkehrenmüsse, um die Beschäftigungsquote Ältererzu erhöhen. Mit so e<strong>in</strong>fachen Rezepten wird man nicht erfolgreichse<strong>in</strong>. Die bloße Anhebung <strong>der</strong> Altersgrenzenund das damit verbundene Hoffen auf den „Selbstlauf <strong>der</strong>D<strong>in</strong>ge“ muss als re<strong>in</strong>e rententechnische Lösung wirkungslosbleiben, weil sie nicht auf die eigentlichen Faktoren<strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerund Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und schon gar nicht auf die jeweilsnotwendigen för<strong>der</strong>lichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen abzielt.Auch verbergen sich h<strong>in</strong>ter e<strong>in</strong>er durchschnittlichenBeschäftigungsquote viele unterschiedliche Lebens- undErwerbsverläufe. Schon e<strong>in</strong> kurzer Blick <strong>zur</strong>ück zeigt,dass 1970 – also vor <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> flexiblenAltersgrenze im Rentenrecht und den Vorruhestandsprogrammen– zwar die Männer <strong>in</strong> <strong>der</strong> hier betrachteten Altersgruppe<strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen mit damals 80,7 Prozenterheblich höhere Erwerbsquoten aufwiesen alsheute. Demgegenüber lag auf Grund <strong>der</strong> traditionellen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 59 – Drucksache 16/2190Familienmodelle damals die Erwerbsquote <strong>der</strong> Frauen <strong>in</strong>dieser Altersgruppe aber nur bei 31,3 Prozent 4 (EuropäischeKommission 2003: 167). Zu beachten s<strong>in</strong>d neue Differenzierungen<strong>der</strong> Erwerbsverläufe nach dem Qualifikationsniveau,<strong>der</strong> Nationalität, dem Gesundheitszustand,den Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen und nicht zuletzt nach dem Familienstando<strong>der</strong> <strong>der</strong> Lebensformen (Bosch & Schief2005b).Es gibt daher nicht „die“ Älteren zwischen 55 und 64 Jahren.Vielmehr teilen sie sich <strong>in</strong> Gruppen mit höchst unterschiedlichenBeschäftigungsmöglichkeiten und -erwartungenauf. Manche von ihnen können und wollen biszum 65. Lebensjahr und möglicherweise auch darüber h<strong>in</strong>ausarbeiten; an<strong>der</strong>e s<strong>in</strong>d angesichts ihrer subjektivenVoraussetzungen (Qualifikation und Gesundheitszustand)o<strong>der</strong> objektiver Ausgangsbed<strong>in</strong>gungen (Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen,vorhandenes Arbeitsplatzangebot) dazu aber garnicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>; weitere schließlich könnten durchauslänger arbeiten, präferieren aber aus unterschiedlichenGründen e<strong>in</strong>en früheren Ausstieg und können sich diesentrotz <strong>der</strong> Erschwerung und Verteuerung des „Vorruhestands“vielleicht auch leisten, da sie z.B. zeitlebens gutverdient o<strong>der</strong> geerbt haben o<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushalt mitmehreren Verdienern leben. Auch die zunehmende E<strong>in</strong>kommens-und Vermögensdifferenzierung wird die Art<strong>der</strong> Übergänge <strong>in</strong>s Alter immer stärker bee<strong>in</strong>flussen(siehe dazu Kapitel E<strong>in</strong>kommenslage im Alter).Zwar lassen sich durch e<strong>in</strong>e humanere Gestaltung <strong>der</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungeno<strong>der</strong> durch gezielte Investitionen <strong>in</strong> dieBeschäftigungsfähigkeit die Chancen für e<strong>in</strong>ige Gruppen<strong>der</strong> Älteren verbessern, länger erwerbstätig zu se<strong>in</strong>. Angesichts<strong>der</strong> noch für längere Zeit prognostizierten hohenArbeitslosigkeit, des Weiterbestehens von Arbeitsplätzenmit begrenzter Tätigkeitsdauer und <strong>in</strong>dividueller Gesundheitsrisikenwird es jedoch auch <strong>in</strong> Zukunft Gruppengeben, die nicht bis zum „normalen“ Rentenalter erwerbstätigse<strong>in</strong> können. Die Politik steht vor <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung,neben allgeme<strong>in</strong>en Antworten auch differenzierteLösungen für e<strong>in</strong>en differenzierten Personenkreisbereitzustellen.Um realistische Szenarien <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> BeschäftigungsquoteÄlterer zu entwerfen, ist es daher notwendig,sich die Erwerbsverläufe unterschiedlicher Gruppen Ältererzwischen 55 und 64 Jahren genauer anzuschauen.Darauf zielt die <strong>Lage</strong>analyse <strong>in</strong> Abschnitt 2.2. Anschließendwerden auf dieser Basis Zielvorstellungen für diePolitik formuliert (Abschnitt 2.3), bisherige politischeMaßnahmen <strong>zur</strong> Erhöhung des BeschäftigungsniveausÄlterer dargestellt (Abschnitt 2.4), um dann notwendigeMaßnahmen <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Beschäftigungsquote Älterer<strong>in</strong>sgesamt, auch durch differenzierte Lösungen für beson<strong>der</strong>eGruppen, vorzuschlagen (Abschnitt 2.5).4 Die Erwerbsquote schließt im Unterschied <strong>zur</strong> Beschäftigungs- o<strong>der</strong>Erwerbstätigenquote die Arbeitslosen mit e<strong>in</strong>. Im Folgenden werdenwir vor allem Beschäftigungsquoten verwenden, werden aber auch –mangels an<strong>der</strong>er Daten – auf den Langzeitvergleich <strong>der</strong> Erwerbsquotenzwischen 1970 und 2000 durch die Europäische Kommission <strong>zur</strong>ückgreifen.2.2 <strong>Lage</strong>analyse2.2.1 Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 55- bis 64-jährigen Männer und Frauen, 1970 und2000Zwischen 1970 und 2000 ist <strong>in</strong> Deutschland die Erwerbsquote<strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen um 9 Prozentpunkte von51,9 auf 42,9 Prozent <strong>zur</strong>ückgegangen (Abbildung 4).Das heißt, dass das Humankapital Älterer um fast e<strong>in</strong>Fünftel weniger genutzt wurde als vor 30 Jahren. H<strong>in</strong>terdiesen Durchschnittszahlen verbergen sich völlig gegensätzlicheEntwicklungen bei Männern und Frauen. DieErwerbsquote <strong>der</strong> Männer ist <strong>in</strong> Deutschland vor allem<strong>in</strong>folge <strong>der</strong> Frühverrentung um 28,3 Prozentpunkte, dasentspricht mehr als e<strong>in</strong>em Drittel, gesunken. Demgegenüberist aber die Erwerbsquote <strong>der</strong> Frauen im gleichenZeitraum von e<strong>in</strong>em sehr niedrigen Ausgangsniveau um2,2 Prozentpunkte gestiegen. Bei den Frauen schneidensich dabei zwei Entwicklungstendenzen: Zum e<strong>in</strong>en verr<strong>in</strong>gertsich durch die Nutzung von Vorruhestandsmöglichkeitenauch bei ihnen die Erwerbsquote, zum an<strong>der</strong>enwachsen jüngere, besser ausgebildete und stärker erwerbsorientierteFrauen <strong>in</strong> diese Altersgruppe h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>, wodurchsich die Erwerbsquote erhöht. Die Zunahme <strong>der</strong>Frauenerwerbstätigkeit war aber nicht stark genug, umden Rückgang <strong>der</strong> Erwerbsquote <strong>in</strong>sgesamt aufhalten zukönnen.Deutschland liegt mit <strong>der</strong> Entwicklung se<strong>in</strong>er Erwerbsquoten<strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen zwar ziemlich genau imDurchschnitt <strong>der</strong> EU-15, wobei sich dieser EU-Durchschnittwie<strong>der</strong>um aus sehr unterschiedlichen Län<strong>der</strong>profilenergibt. In Frankreich und Belgien waren die Vorruhestandsangebotenoch großzügiger als <strong>in</strong> Deutschland, und<strong>in</strong> den südeuropäischen Län<strong>der</strong>n treffen Traditionen desfrühen Ausstiegs <strong>der</strong> Männer aus dem Erwerbsleben mitsehr traditionellen Familienmodellen zusammen. So waren<strong>in</strong> Italien im Jahre 2000 nur 29 Prozent aller 55- bis64-Jährigen erwerbstätig und <strong>in</strong> Belgien waren es sogarnur 27,1 Prozent (Europäische Kommission 2003: 167).Ganz an<strong>der</strong>s dagegen verlief die Entwicklung <strong>in</strong> denskand<strong>in</strong>avischen Län<strong>der</strong>n (Abbildung 5): In Schwedenund Dänemark lagen noch 1970 die Erwerbsquoten <strong>der</strong>55- bis 64-jährigen Männer und Frauen nahe an den deutschenWerten. Seitdem g<strong>in</strong>gen zwar auch <strong>in</strong> diesen Län<strong>der</strong>ndie Erwerbsquoten <strong>der</strong> Männer <strong>zur</strong>ück, allerd<strong>in</strong>gsbei weitem nicht so stark wie <strong>in</strong> Deutschland. E<strong>in</strong> Grundist, dass nur zeitlich begrenzte o<strong>der</strong> auf bestimmte Personengruppenzielende Vorruhestandsoptionen angebotenwurden, wie etwa die mittlerweile wie<strong>der</strong> abgeschaffteTeilrente <strong>in</strong> Schweden (Ebb<strong>in</strong>ghaus 2003). Gleichzeitighat aber die frühzeitig e<strong>in</strong>geleitete Gleichstellungspolitikihre Wirkungen entfaltet. Die Erwerbstätigkeit <strong>der</strong> Frauen<strong>in</strong> Schweden (die <strong>in</strong> beträchtlichem Ausmaß im öffentlichenSektor erfolgt) wurde vor allem durch e<strong>in</strong>en Ausbau<strong>der</strong> Betreuung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Schülern sowie durch dieverbesserte Bezahlung von Frauen geför<strong>der</strong>t. Allerd<strong>in</strong>gsbesteht auch oft die ökonomische Notwendigkeit zu e<strong>in</strong>emzweiten Erwerbse<strong>in</strong>kommen im Haushalt. Insgesamthat <strong>in</strong> Schweden die steigende Frauen-Beschäftigungsquoteden Rückgang bei den Männern überkompensiert.
Drucksache 16/2190 – 60 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeAbbildung 4Erwerbsquoten <strong>in</strong> Deutschland und EU 15 <strong>in</strong> Prozent <strong>der</strong> Bevölkerung im Alter von 55 bis 64 Jahren,1970 und 20001970 20001970 2000100908070605040302010-9,051,942,980,7-28,352,4+2,231,1 33,5100908070605040302010-9,249,940,776,9-25,451,5+2,930,227,300Gesamt Männer FrauenGesamt Männer FrauenDeutschlandEU 15Quelle: Europäische Kommission 2003: 167.Abbildung 5Erwerbsquoten <strong>in</strong> Dänemark und Schweden <strong>in</strong> Prozent <strong>der</strong> Bevölkerung im Alter von 55 bis 64 Jahren,1970 und 2000Prozent1009080706050403020100-2,060,2 58,21970 2000-21,588,2+14,866,749,034,2Gesamt Männer FrauenDänemarkProzent1009080706050403020100+9,159,5 68,61970 2000-10,3+27,982,472,165,237,3Gesamt Männer FrauenSchwedenQuelle: Europäische Kommission 2003: 167.In Dänemark, das bis Anfang <strong>der</strong> 1990er-Jahre ausgeprägtePhasen passiver Arbeitsmarktpolitik durchlebteund erst danach auf e<strong>in</strong>e aktive Arbeitsmarktpolitik umgeschwenktist (D<strong>in</strong>geldey 2005), reichte <strong>der</strong> starke Anstieg<strong>der</strong> Frauenerwerbstätigkeit nicht aus, den starkenRückgang <strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung von Männern zu kompensieren,sodass es zu e<strong>in</strong>em leichten Rückgang <strong>der</strong> BeschäftigungsquoteÄlterer kam.Die Frauenerwerbstätigkeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> hier betrachteten Altersgruppeist <strong>in</strong> Deutschland aus den folgenden Gründenvergleichsweise niedrig:– So bestehen u.a. ger<strong>in</strong>gere berufliche Aufstiegschancen,ger<strong>in</strong>gere Arbeitse<strong>in</strong>kommen, e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres Arbeitszeitvolumen,bed<strong>in</strong>gt vor allem durch den hohenAnteil von (arbeitszeitlich ger<strong>in</strong>ger) Teilzeitbeschäftigung,sowie häufigere Beschäftigung <strong>in</strong> sozial wenigerabgesicherten Beschäftigungsverhältnissen.– Vor allem für Mütter lässt sich die Realisierung desWunsches nach Gleichzeitigkeit von Berufstätigkeitund K<strong>in</strong><strong>der</strong>wunsch und -erziehung nach wie vor nurunter deutlich erschwerten Bed<strong>in</strong>gungen verwirklichen.Maßnahmen <strong>zur</strong> besseren Vere<strong>in</strong>barkeit von Er-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 61 – Drucksache 16/2190werbstätigkeit und Familie <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Bereich<strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>dbetreuung, vorschulischer und schulischerBegleitdienste s<strong>in</strong>d – obwohl seit Jahren wie<strong>der</strong>holtgefor<strong>der</strong>t – immer noch „Mangelware“. Dies allesgilt umso mehr angesichts des engen Zusammenhangszwischen Berufstätigkeit (von Frauen) e<strong>in</strong>erseits undK<strong>in</strong><strong>der</strong>losigkeit an<strong>der</strong>erseits. Vor allem höher qualifizierteFrauen und/o<strong>der</strong> Akademiker<strong>in</strong>nen bleiben <strong>in</strong>wachsendem Ausmaß k<strong>in</strong><strong>der</strong>los, was wesentlich mitun<strong>zur</strong>eichen<strong>der</strong> Unterstützung bei <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeitvon K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Beruf und beson<strong>der</strong>s hohen Opportunitätskostenerklärt wird (Zielfe 2004; Wirth &Dümmler 2004). Es „rächt sich“ jetzt, dass noch bisvor kurzem Frauen- und Müttererwerbsarbeit auf <strong>der</strong>e<strong>in</strong>en sowie vorschulische Betreuung, Ganztagsschulenund dgl. auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite vielfach gesellschaftlichnegativ sanktioniert waren, sowie an<strong>der</strong>erseitsauch <strong>der</strong> Verzicht auf Erwerbsarbeit von Frauenzu Gunsten von Familienarbeit. H<strong>in</strong>zu kommen die„demografischen Fernwirkungen“ e<strong>in</strong>er „k<strong>in</strong><strong>der</strong>fe<strong>in</strong>dlichen“,da e<strong>in</strong> Leben mit (Kle<strong>in</strong>-)K<strong>in</strong><strong>der</strong>n nicht unterstützendenBildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik.Die „strukturelle Rücksichtslosigkeit“(Kaufmann 1995) <strong>der</strong> Gesellschaft gegenüber e<strong>in</strong>emLeben mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n bestimmt noch immer <strong>in</strong> vielenFällen die Erwerbsmöglichkeiten und -chancen vonMüttern.– Weitgehend ungelöst s<strong>in</strong>d auch die Probleme <strong>der</strong>„neuen“ Variante <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeitsproblematik imzweiten Abschnitt des Erwerbslebens, nämlich <strong>der</strong>Vere<strong>in</strong>barkeit von Berufstätigkeit und Pflege. Fürviele betroffene Frauen bedeutet die Pflege älterer Angehörigerde facto das „Aus“ <strong>der</strong> Berufskarriere undnicht selten die Inkaufnahme von Nachteilen bei <strong>der</strong>sozialen Sicherung.– Insgesamt geht es somit um Zielkonflikte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emganz erheblichen Ausmaß: so zwischen Frauenerwerbsarbeitund Reduzierung des K<strong>in</strong><strong>der</strong>wunschesund damit <strong>der</strong> Geburtenrate. Wenn man sich mit denKonsequenzen <strong>der</strong> demografischen Alterung <strong>der</strong> Gesellschaftfür die Arbeitswelt beschäftigt, dann gilt esauch dies zu beachten.Es gibt e<strong>in</strong>e Reihe von Län<strong>der</strong>n, die deutlich höhere ErwerbsquotenÄlterer aufweisen als Deutschland. Dafürgibt es viele E<strong>in</strong>flussfaktoren, auch struktureller Art – wie<strong>der</strong> Umfang des öffentlichen Sektors mit hoher Frauenerwerbsbeteiligung–, es ist aber z.T. auch Folge ökonomischerNotwendigkeit, z.B. wenn e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>kommen <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierungdes Familienunterhalts nicht mehr ausreicht.Trennt man die Altersgruppe <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong>zwei Teilgruppen (55 bis 59 und 60 bis 64), so erreichtdie Erwerbsbeteiligung <strong>der</strong> 55- bis 59-Jährigen <strong>in</strong>Deutschland mit etwa 60 Prozent nur rund Dreiviertel desNiveaus z.B. <strong>in</strong> Schweden, Norwegen und <strong>der</strong> Schweiz(dort 75 o<strong>der</strong> gar mehr Prozent) (Tabelle 2).Doch auch <strong>in</strong> Län<strong>der</strong>n wie Schweden und Norwegens<strong>in</strong>kt die Erwerbsbeteiligung ab dem 60. Lebensjahr deutlich– etwa um e<strong>in</strong> Drittel auf ca. 55 Prozent verglichenmit <strong>der</strong> davor liegenden Fünfjahresgruppe. Es gibt alsoauch <strong>in</strong> den Län<strong>der</strong>n mit e<strong>in</strong>er vergleichsweise hohen ErwerbsbeteiligungÄlterer so etwas wie e<strong>in</strong>en alterstypischenRückzugseffekt vom Arbeitsmarkt jenseits des60. Lebensjahres. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>kt <strong>in</strong> Deutschland die Beschäftigungsquote<strong>der</strong> 60- bis 64-Jährigen bei ohneh<strong>in</strong>schon erheblich niedrigerem Ausgangsniveau noch weitausstärker als <strong>in</strong> diesen Län<strong>der</strong>n, und zwar um knappzwei Drittel auf rund 25 Prozent. Will man also e<strong>in</strong>e Erhöhung<strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung Älterer erreichen, dannwird <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch das Augenmerk auf die Altersgruppe<strong>der</strong> 60-Jährigen und Älteren zu richten se<strong>in</strong>. Zwarsagen Beschäftigungsquoten und Erwerbsquoten nichtsüber die Arbeitszeit und Produktivität <strong>in</strong> den Altersgruppenaus, dennoch s<strong>in</strong>d sie e<strong>in</strong> Indikator für e<strong>in</strong> <strong>in</strong>Deutschland ökonomisch nicht genutztes Potenzial.Tabelle 2Beschäftigungsquoten Älterer <strong>in</strong> Deutschland, Schweden, Norwegen und <strong>der</strong> SchweizBeschäftigungsquoten 2004 <strong>in</strong> ProzentAltersgruppe 55-59 60-64Land E A I E A IDeutschland 61,3% 9,7% 29,1% 25,3% 3,2% 71,6%Schweden 78,1% 3,4% 18,5% 57,8% 3,8% 38,4%Norwegen 74,8% 1,0% 24,2% 54,2% 0,5% 45,4%Schweiz 77,5% 2,3% 20,2% 50,0% 2,1% 47,9%E = Erwerbstätig, A = Arbeitslos, I = Inaktiv.Quelle: Schief 2005. Datenbasis: Europäischen Arbeitskräftestichprobe 2004.
Drucksache 16/2190 – 62 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode2.2.2 Der Zusammenhang von Qualifikationund Beschäftigungsquote ÄltererZu <strong>der</strong> markanten Geschlechterdifferenzierung <strong>in</strong> vielen,aber längst nicht mehr allen EU-Län<strong>der</strong>n ist heute e<strong>in</strong>ezweite zentrale Dimension sozialer Ungleichheit h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung, nämlich die nach Qualifikation,getreten. Während sich die Ungleichheit <strong>in</strong> den Beschäftigungsquotenzwischen den Geschlechtern <strong>in</strong> denletzten Jahrzehnten <strong>in</strong> <strong>der</strong> EU deutlich verr<strong>in</strong>gert hat, habendie Ungleichheiten nach Qualifikation erheblich zugenommen.E<strong>in</strong>e gute schulische und berufliche Bildungist mittlerweile zum E<strong>in</strong>trittsbillett und – was <strong>zur</strong> Erklärung<strong>der</strong> Beschäftigungsquoten Älterer fast noch wichtigerist – auch <strong>zur</strong> Voraussetzung des längerfristigen Verbleibsauf dem Arbeitsmarkt geworden. In allen Län<strong>der</strong>n<strong>der</strong> EU 15 steigen die Beschäftigungsquoten sowohl <strong>der</strong>25- bis 44-Jährigen als auch <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen fürMänner und Frauen mit dem Qualifikationsniveau (Abbildung6). Wer besser qualifiziert ist, hat größere Chancene<strong>in</strong>e Stelle zu f<strong>in</strong>den und dann auch nach dem 55. Lebensjahrbeschäftigt zu bleiben 5 .5 Nur <strong>in</strong> Portugal f<strong>in</strong>den sich noch rudimentäre Reste des traditionellenMusters, dass die weniger Qualifizierten längere Lebensarbeitszeitenhaben und die besser Qualifizierten sich frühzeitig aus dem Erwerbsleben<strong>zur</strong>ückziehen.Abbildung 6Zwar verr<strong>in</strong>gern sich <strong>in</strong> allen EU-Län<strong>der</strong>n die Beschäftigungsquoten<strong>in</strong> den drei Qualifikationsgruppen nach dem55. Lebensjahr, allerd<strong>in</strong>gs gibt es jenseits dieses generellenMusters ganz erhebliche Län<strong>der</strong>unterschiede: In D, A,F, NL, B weisen vor allem die ger<strong>in</strong>ger Qualifiziertenüber 55 Jahre e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Erwerbsbeteiligung auf. Auchzeigt sich <strong>in</strong> diesen Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> vorzeitige „Ruhestand“bereits bei den Mittelqualifizierten, während die Hochqualifiziertenzwischen 55 und 64 Jahren zumeist nochsehr hohe Beschäftigungsquoten aufweisen.Die Gründe für die nach Qualifikationsniveau abnehmendenBeschäftigungsquoten lassen sich für Deutschlandwie folgt zusammenfassen:– Im verarbeitenden Gewerbe, das zwischen 1970 und2004 <strong>in</strong>sgesamt 3,16 Millionen Arbeitsplätze verlor,wurden <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Arbeitsplätze für ger<strong>in</strong>g Qualifizierteabgebaut. Die im Zusammenhang mit dem Personalabbauaufgelegten Vorruhestandsmaßnahmen imverarbeitenden Gewerbe haben somit selektiv gewirkt.– Ger<strong>in</strong>ger qualifizierte Beschäftigte s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong>ejahrzehntelange Konzentration <strong>der</strong> Arbeitstätigkeit aufbestimmte Verfahren, Arbeitsbereiche, betriebs- o<strong>der</strong>arbeitsplatztypische Arbeitsvorgänge vom Risiko e<strong>in</strong>erweiteren Verengung ihrer Qualifikation betroffen.Dadurch werden die weiteren beruflichen E<strong>in</strong>satzmög-Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen nach Qualifikation<strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Union (EU-15), 2004Beschäftigungsquote (<strong>in</strong> %)1009080706050403020100A B I L D F EE G GR FI N P IRL DK NO CH GB SLandHohe Qual. 55 - 64 Mittlere Qual. 55 - 64 Niedrige Qual. 55 - 64Hohe Qual. 25 - 44 Mittlere Qual. 25 - 44Niedrige Qual. 25 - 44Quelle: Schief 2005. Datenbasis: Europäische Arbeitskräftestichprobe 2004.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 63 – Drucksache 16/2190lichkeiten deutlich reduziert („Spezialisierungsfalle“)(Naegele 1996; Wolf, Spiess & Mohr 1999). Die Weiterbildungsbeteiligungsteigt mit dem Qualifikationsniveau(siehe Kapitel Bildung).– Schließlich ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass sich Geschlechts-und Qualifikationsaspekt gegenseitig verstärken.In Deutschland haben im Jahr 2004 die formalger<strong>in</strong>g qualifizierten Frauen mit nur 23,7 Prozent dieger<strong>in</strong>gsten Beschäftigungsquoten unter den 55- bis64-jährigen (Bosch & Schief 2005a). Alle<strong>in</strong> die hochqualifizierten Männer und Frauen erreichen e<strong>in</strong>e Beschäftigungsquotevon mehr als 50 Prozent, also <strong>der</strong>Zielmarke, die <strong>der</strong> Europäische Rat <strong>in</strong> Stockholm imRahmen <strong>der</strong> europäischen Beschäftigungsstrategie fürdie Beschäftigung Älterer bis zum Jahre 2010 gesetzthat (Kommission <strong>der</strong> Europäischen Geme<strong>in</strong>schaften(KOM) 2004) (Abbildung 7). Nur zum Vergleich:Schweden erreicht diese Quote für Männer und Frauen<strong>in</strong> allen sechs Qualifikationsgruppen und neben Portugalals e<strong>in</strong>ziges EU-Land auch bei den ger<strong>in</strong>g qualifiziertenFrauen (53,8 Prozent).E<strong>in</strong> früheres Rentene<strong>in</strong>trittsalter von ger<strong>in</strong>ger Qualifiziertenbedeutet im Übrigen nicht unbed<strong>in</strong>gt kürzere Lebensarbeitszeitendieser Gruppe. Die heute ger<strong>in</strong>g qualifizierten55- bis 64-Jährigen haben <strong>in</strong> Deutschland 3,3 Jahre früherals die Hochqualifizierten e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit aufgenommen(Europäische Kommission 2003: 170). Dies ist e<strong>in</strong>er<strong>der</strong> Gründe, warum <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Bezug <strong>der</strong> vollenRente nicht nur an e<strong>in</strong>e Altersgrenze, son<strong>der</strong>n auch andie Dauer <strong>der</strong> Lebensarbeitszeit gebunden ist.Beschäftigungsquoten <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen und <strong>der</strong> 45- bis 54-Jährigen nach Qualifikationund Geschlecht <strong>in</strong> Deutschland, 2004Abbildung 7Beschäftigungsquote (<strong>in</strong> %)1009080706050403084,250,739,845-54-Jährige 55-64-Jährige72,154,953,133,856,823,791,361,432,880,84643,165,235,554,5Ziel Stockholm20100Hohe Qual.MittlereQual.NiedrigeQual.Hohe Qual.MittlereQual.NiedrigeQual.FrauenMännerQuelle: Bosch & Schief 2005a. Datenbasis: Europäische Arbeitskräftestichprobe 2004.
Drucksache 16/2190 – 64 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode2.2.3 Zum erhöhten Arbeitsmarktrisiko ältererArbeitnehmer<strong>in</strong>nen und ArbeitnehmerIm Unterschied zu den meisten an<strong>der</strong>en entwickelten Industrielän<strong>der</strong>nliegt die Arbeitslosigkeit Älterer <strong>in</strong>Deutschland über <strong>der</strong> durchschnittlichen Arbeitslosenquotealler Beschäftigten (Abbildung 8). Dies gilt sowohlim Vergleich mit Län<strong>der</strong>n mit hohen BeschäftigungsquotenÄlterer (S, DK, CH, N, UK, USA), als auch mit Län<strong>der</strong>nmit sehr niedrigen Beschäftigungsquoten (NL, B, F).Dies spricht dafür, dass es auch sehr unterschiedlicheGründe für die relativ niedrigen Arbeitslosenquoten Älterer<strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n gibt. Dort s<strong>in</strong>d Ältere entwe<strong>der</strong>besser vor Entlassungen geschützt, unterliegen wenigerDiskrim<strong>in</strong>ierungen bei E<strong>in</strong>stellungen, haben mehr Ausstiegsoptionenaus dem Erwerbsleben o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ausstiegwird nicht über Phasen <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit, son<strong>der</strong>n z.B.direkt über die Rentensysteme abgewickelt. Umgekehrthat Deutschland die relativ niedrigsten Arbeitslosenquotenfür Jugendliche (OECD 2004a). Vor allem durch denstarken politischen Druck, allen Ausbildungsnachfragerne<strong>in</strong>en Ausbildungsvertrag anzubieten, gel<strong>in</strong>gt es <strong>in</strong>Deutschland, die Jugendarbeitslosigkeit im <strong>in</strong>ternationalenVergleich niedrig zu halten. Häufig bed<strong>in</strong>gt dies verr<strong>in</strong>gerteE<strong>in</strong>stellungen o<strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geren Personalabbau aman<strong>der</strong>en Ende <strong>der</strong> betrieblichen Alterspyramide. In denan<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n liegt die Jugendarbeitslosenquote h<strong>in</strong>gegenim Durchschnitt doppelt so hoch wie die durchschnittlicheArbeitslosigkeit.Ältere s<strong>in</strong>d durch ihre lange Betriebszugehörigkeit zwarbesser als Jüngere gegen Entlassungen geschützt. WennSie aber arbeitslos werden, haben sie größere Schwierigkeiten,wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en neuen Arbeitsplatz zu f<strong>in</strong>den, undbleiben oft sehr lange arbeitslos. Deshalb unterscheidetsich das Profil <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit Älterer deutlich vondem <strong>der</strong> jüngeren und mittleren Jahrgänge. Bei denÄlteren ist <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Langzeitarbeitslosen erheblichhöher. Ende September 2004 lag dieser Anteil bei den50- bis 64-Jährigen im Durchschnitt bei 55,9 Prozent gegenüber40,5 Prozent bei den unter 50-Jährigen (Bundesagenturfür Arbeit 2005a).Die Vermischung von Altersübergängen als Phasen verdeckterArbeitslosigkeit mit offener Arbeitslosigkeitmacht es so schwierig, Arbeitslosenquoten Älterer zu <strong>in</strong>terpretieren.H<strong>in</strong>zu kommen demografische E<strong>in</strong>flüsse.Diese E<strong>in</strong>flussfaktoren werden an <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong>Arbeitslosigkeit Älterer <strong>in</strong> Ost- und Westdeutschland <strong>in</strong>den letzten Jahren deutlich. Die überdurchschnittliche Arbeitslosigkeitbei Älteren ist erstens auf das E<strong>in</strong>stellungsverhalten<strong>der</strong> Betriebe <strong>zur</strong>ückzuführen, bei denen siche<strong>in</strong>e nur ger<strong>in</strong>ge Bereitschaft zeigt, freie Stellen mit älterenArbeitnehmer<strong>in</strong>nen o<strong>der</strong> Arbeitnehmern zu besetzen(Naegele 1992, Bäcker 1999). Zweitens erfolgt <strong>in</strong>Deutschland <strong>der</strong> Übergang <strong>in</strong> den „Ruhestand“ <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eüber e<strong>in</strong>e vorübergehende Arbeitslosigkeit.Mit diesen beiden Gründen alle<strong>in</strong> lässt sich aber die Entwicklung<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit Älterer <strong>in</strong> den letzten Jah-Abbildung 8Arbeitslosenquote <strong>der</strong> 55- bis 61-Jährigen <strong>in</strong> Relation <strong>zur</strong> durchschnittlichen Arbeitslosenquote 2003D F B NL CH S DK N UK USAArbeitslosenquote<strong>der</strong> 55-61-JährigenAllgeme<strong>in</strong>eArbeitslosenquote9,7 5,8 1,7 2,2 2,5 4,8 3,9 1,6 3,3 4,18,9 10,4 8,0 3,8 4,5 5,3 5,8 4,0 4,1 5,7Quelle: OECD 2004a, eigene Berechnung.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 65 – Drucksache 16/2190ren nicht erklären. In den 1990er-Jahren stiegen dieArbeitslosenzahlen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 55- bis unter60-Jährigen <strong>in</strong> Westdeutschland und mit e<strong>in</strong>iger Verzögerungab 1992 auch <strong>in</strong> Ostdeutschland beständig und stärkerals die <strong>der</strong> Arbeitslosen <strong>in</strong>sgesamt, sodass <strong>der</strong> Anteil<strong>der</strong> Arbeitslosen dieser Altersgruppe an allen Arbeitslosenkont<strong>in</strong>uierlich zunahm (Abbildung 9). 6Ab dem Jahr 2000 ist e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Abnahme <strong>der</strong>Anteilswerte Älterer an allen Arbeitslosen zu verzeichnen.Selbst im Jahr 2002 – als die allgeme<strong>in</strong>e Arbeitslosigkeitdeutlich zunahm (um 170.000 im früheren Bundesgebiet)– sank die Zahl <strong>der</strong> älteren Arbeitslosen weiter.E<strong>in</strong> Grund hierfür ist die demografische Entwicklung. Sowachsen <strong>der</strong>zeit die geburtenschwachen Jahrgänge <strong>der</strong>letzen Kriegs- und <strong>der</strong> ersten Nachkriegsjahre <strong>in</strong> die Altersspanne<strong>der</strong> 55- bis unter 65-Jährigen h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> (Clemens2003; Koller et al. 2003). Der zweite Grund war die stärkereInanspruchnahme <strong>der</strong> vorruhestandsähnlichen Regelungdes § 428 SGB III. Danach können Arbeitslose abdem 58. Lebensjahr auch Arbeitslosengeld erhalten, wennsie nicht mehr arbeitsbereit s<strong>in</strong>d. Sie werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitslosenstatistiknicht mehr als Arbeitslose geführt (Kal<strong>in</strong>a& Knuth 2002). Die Zahl dieser älteren Quasi-Arbeitslosenist <strong>in</strong> Deutschland von 192.074 (2000) auf6 Die zunächst ger<strong>in</strong>ge und dann stark ansteigende Arbeitslosigkeit Älterer<strong>in</strong> Ostdeutschland ist auf die bis zum 31.12.1992 befristete Altersübergangsregelung<strong>zur</strong>ückzuführen. Diese Regelung eröffneteden Arbeitslosen ab 55 Jahren e<strong>in</strong>e Art Vorruhestand und führte dazu,dass <strong>der</strong> größte Teil <strong>der</strong> Erwerbspersonen vom Arbeitsmarkt genommenwurde und damit auch nicht arbeitslos war.395.373 (2004) und <strong>in</strong> Westdeutschland von 103.684(2000) auf 259.088 (2004) gestiegen. Im gleichen Zeitraumist die Arbeitslosigkeit Älterer (50 bis unter65 Jahre) <strong>in</strong> Deutschland von 1.259.168 (2000) auf1.079.940 (2004) und <strong>in</strong> Westdeutschland von820.927 (2000) auf 675.861 (2004) gesunken (Bundesagenturfür Arbeit 2005a). Mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung des§ 428 III hat <strong>der</strong> Gesetzgeber e<strong>in</strong>en längst üblichen Statusälterer Arbeitsloser legalisiert. Viele Ältere s<strong>in</strong>d im Rahmenvon Sozialplänen aus den Betrieben ausgeschiedenund warten <strong>in</strong> Arbeitslosigkeit auf den vorzeitigen Rentenbezug.Ihre Arbeitslosenunterstützung wird zumeistdurch Sozialplanleistungen aufgestockt. Diese Arbeitslosenmussten bislang zwar für die Vermittlung <strong>zur</strong> Verfügungstehen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis haben die Arbeitsämter aberdie Arbeitslosigkeit toleriert. Befragungen älterer Arbeitsloserkommen daher zu dem nicht überraschendenErgebnis, dass die meisten älteren Arbeitslosen ke<strong>in</strong>e Arbeitmehr suchten. So beabsichtigten Mitte <strong>der</strong> 1990er-Jahre 90,4 Prozent <strong>der</strong> Arbeitslosen unter 55 Jahren, abernur 13,9 Prozent <strong>der</strong> Arbeitslosen über 55 Jahren <strong>in</strong> Zukunftwie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit aufzunehmen (Wagner& Muth 1998: 194).Interessante E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> die Selbste<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Betroffenenzu den Gründen für ihre Arbeitslosigkeit bietenSon<strong>der</strong>auswertungen des Alterssurvey 2002. Sie zeigen,dass ältere Arbeitslose speziell ihr höheres Alter als ganzwesentliche Grenze für e<strong>in</strong>e Rückkehr <strong>in</strong> das Erwerbslebenansehen. Dies gilt sowohl für solche Befragten, diefür sich selbst bereits die Entscheidung getroffen haben,nicht wie<strong>der</strong> arbeiten zu wollen (Nicht-Erwerbsbereite),Abbildung 9Ältere Arbeitslose (55 bis unter 65 Jahre) <strong>in</strong> Deutschland, 1992 bis 2002, Anteile an allen Arbeitslosen(<strong>in</strong> Prozent)Ost West Deutschland3025201510501992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002JahrQuelle: Koller, Bach & Brixy 2003. Datenbasis: Bundesanstalt für Arbeit.
Drucksache 16/2190 – 66 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeals auch für jene, die noch Interesse an <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>aufnahmee<strong>in</strong>er beruflichen Tätigkeit haben (Erwerbsbereite).Letztere – <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe zwischen 45 und64 Jahren – geben zu 53 Prozent an, ihr Alter sei „auf jedenFall“, bei weiteren 16 Prozent „eher“ e<strong>in</strong> Hemmnisdafür, wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Arbeitsstelle zu f<strong>in</strong>den (Wurm 2004).2.2.4 Zur Situation schwer beh<strong>in</strong><strong>der</strong>terMenschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt und aufdem ArbeitsmarktNach SGB IX gelten Menschen als beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t, „wenn ihrekörperliche Funktion, geistige Fähigkeit o<strong>der</strong> seelischeGesundheit mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit länger als6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustandabweichen und daher ihre Teilhabe am Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong>Gesellschaft bee<strong>in</strong>trächtigt ist“ (§ 2 Abs. 1). DiesesVerständnis orientiert sich an <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternational gebräuchlichenWHO-Klassifikation, <strong>der</strong> zufolge die Funktionstüchtigkeitdes Menschen unter drei Dimensionen zu betrachtenist. Dabei bezieht sich die erste Dimension aufphysische und psychische Funktionen, die zweite Dimensionauf Aktivität und selbstständiges Handeln, die dritteDimension auf die soziale Partizipation. Zu letzterer ist<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch die Teilhabe am Erwerbsleben zu zählen(World Health Organisation 2001). Als „schwer beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t“gelten Menschen mit e<strong>in</strong>em Grad <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungvon m<strong>in</strong>destens 50, wobei Menschen mit e<strong>in</strong>emGrad <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung zwischen 30 und 50 Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>tengleichgestellt werden können, sofern sie ohne e<strong>in</strong>esolche Gleichstellung e<strong>in</strong>en geeigneten Arbeitsplatz nichterlangen o<strong>der</strong> behalten können. Sowohl für die absoluteAnzahl schwer beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen als auch für <strong>der</strong>enAnteil an <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung weist das StatistischeBundesamt seit 1981 e<strong>in</strong>en kont<strong>in</strong>uierlichen Anstieg aus.E<strong>in</strong>e Differenzierung <strong>der</strong> Gruppe schwer beh<strong>in</strong><strong>der</strong>terMenschen nach Altersgruppen zeigt – ähnlich wie <strong>in</strong> <strong>der</strong>Gesamtbevölkerung – e<strong>in</strong>en leichten Rückgang des Anteilsan Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis65 Jahre) bei gleichzeitigem Anstieg des Anteils <strong>der</strong>65-Jährigen und Älteren.E<strong>in</strong>e Son<strong>der</strong>auswertung des Sozioökonomischen Panelszeigt, dass – an<strong>der</strong>s als häufig unterstellt – <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>beruflich ger<strong>in</strong>g Qualifizierten unter Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>tennicht wesentlich höher ist als <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesamtgruppe(Rauch & Brehm 2003). An<strong>der</strong>s als für die Gesamtbevölkerungf<strong>in</strong>den sich für die Gruppe <strong>der</strong> Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenbis zum Jahre 2001 nicht steigende, son<strong>der</strong>n fallende Erwerbsquoten.Diese Entwicklung geht weniger auf e<strong>in</strong>endemografischen Effekt (Abnahme des Anteils an Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenim erwerbsfähigen Alter) als vielmehr aufe<strong>in</strong>e Verdrängung schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen aus demArbeitsmarkt <strong>zur</strong>ück. Im Jahre 2001 war die Erwerbsquote<strong>der</strong> Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten nicht e<strong>in</strong>mal halb so hochwie die Erwerbsquote <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung.Für die Zahl <strong>der</strong> arbeitslosen Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten f<strong>in</strong>detsich bis 2004 e<strong>in</strong> stärkerer Rückgang als für die Zahl <strong>der</strong>schwer beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Beschäftigten. So weist die Statistikunter den Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten für das Jahr 2003 <strong>in</strong>sgesamt247.798 Zugänge <strong>in</strong> Arbeitslosigkeit und 256.995 Abgängeaus Arbeitslosigkeit, für das Jahr 2004 268.678 Zugänge<strong>in</strong> Arbeitslosigkeit und 279.115 Abgänge aus Arbeitslosigkeitaus (Bundesagentur für Arbeit 2005d).Diese Entwicklung spiegelt jedoch allenfalls zum Teilgünstigere Bed<strong>in</strong>gungen auf dem Arbeitsmarkt fürSchwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te o<strong>der</strong> erfolgreiche Bemühungen ume<strong>in</strong>e Integration Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter auf dem Arbeitsmarkt7 wi<strong>der</strong>. E<strong>in</strong>e Analyse <strong>der</strong> Abmeldegründe aus <strong>der</strong>Arbeitslosigkeit zeigt, dass nur gut je<strong>der</strong> Fünfte <strong>in</strong> Arbeitabgeht, also entwe<strong>der</strong> selbst Arbeit f<strong>in</strong>det o<strong>der</strong> durch dasArbeitsamt o<strong>der</strong> beauftragte Dritte erfolgreich vermitteltwird (Berechnungen des IAB). Mit e<strong>in</strong>em Anteil vonetwa 30 Prozent ist unter Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Krankheit(bzw. Arbeitsunfähigkeit) <strong>der</strong> häufigste Grund für e<strong>in</strong>enAbgang aus Arbeitslosigkeit. Des Weiteren scheidet imVergleich <strong>zur</strong> Statistik für die Gesamtbevölkerung e<strong>in</strong>größerer Anteil aus dem Erwerbsleben aus. Die BenachteiligungSchwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter auf dem Arbeitsmarkt zeigtsich noch deutlicher, wenn man lediglich die Gruppe <strong>der</strong>55- bis 65-Jährigen betrachtet: <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Abgänge <strong>in</strong>Arbeit liegt hier bei 10 Prozent.Der aktuelle Anstieg <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter– die Bundesagentur für Arbeit berichtete für 2003e<strong>in</strong>e Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 7,0 Prozentund für das Jahr 2004 von 3,6 Prozent sowie für Juni2005 e<strong>in</strong>e Steigerung von 11,0 Prozent gegenüber demVorjahresmonat (Bundesagentur für Arbeit 2005c) –zeigt, dass es nicht gelungen ist, die beim Abbau <strong>der</strong> ArbeitslosigkeitSchwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter erzielten Erfolge langfristigzu sichern. Die Beibehaltung e<strong>in</strong>er Pflichtquotevon 5 Prozent trotz Verfehlen <strong>der</strong> gesetzlich festgeschriebenenReduktion <strong>der</strong> Anzahl arbeitsloser Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>terum 25 Prozent, die Beschränkung <strong>der</strong> Ausgleichsabgabeauf Betriebe ab 20 Arbeitsplätzen und e<strong>in</strong>eallgeme<strong>in</strong>e Reduktion von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmenhaben dazu beigetragen, dass sich die SituationSchwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter am Arbeitsmarkt wie<strong>der</strong> verschlechterthat. Damit zeigt sich <strong>in</strong>sgesamt, dass die Initiative„50.000 Jobs für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te“ nicht zu e<strong>in</strong>er nachhaltigenVerbesserung <strong>der</strong> Situation schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>terMenschen am Arbeitsmarkt geführt hat. Der überproportionaleAnstieg schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Arbeitsloser im Jahr2003 verdeutlicht, dass sich konjunkturelle Probleme beson<strong>der</strong>sgravierend auf die Integration dieser Menschenauswirken. Aus diesem Grunde sollte geprüft werden, <strong>in</strong>wieferndie gegenwärtige Arbeitsmarktpolitik um jeneflankierende För<strong>der</strong>maßnahmen für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te,die sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Initiative „50.000 Jobs für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te“bewährt haben, ergänzt werden könnte.2.2.5 Der E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> Nationalität auf dasErwerbsverhalten ÄltererDie Situation <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> auf dem deutschen Arbeitsmarkthat sich <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten deutlich verschlechtert.Dies kann man an den Arbeitslosenquotenund den Beschäftigungsquoten ablesen. 1970 lag die Ar-7 Zu nennen s<strong>in</strong>d hier <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die im Oktober 1999 gestartete Initiative„50.000 Jobs für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te“ <strong>der</strong> Bundesregierung, dasGesetz <strong>zur</strong> Bekämpfung <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter (Oktober2000), das Gesetz <strong>zur</strong> Gleichstellung beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen(April 2002) und das Aktionsprogramm berufliche IntegrationSchwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter (ABIS) <strong>der</strong> Bundesanstalt für Arbeit.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 67 – Drucksache 16/2190beitslosenquote <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> mit 0,3 Prozent noch unter<strong>der</strong> <strong>der</strong> Deutschen, was nicht verwun<strong>der</strong>t, da ja nur arbeitsfähigeAuslän<strong>der</strong> rekrutiert wurden, ihr Altersdurchschnittnoch niedrig und die Familien noch nicht nachgezogenwaren. Bis 2004 ist dann die Arbeitslosenquote <strong>der</strong>Auslän<strong>der</strong> auf 20,5 Prozent gestiegen und liegt damit fastdoppelt so hoch wie die <strong>der</strong> Deutschen (11,7 Prozent)(Bundesagentur für Arbeit 2005a). Die verschlechtertenArbeitsmarktchancen von Auslän<strong>der</strong>n spiegeln sich auch<strong>in</strong> ihrer Beschäftigungsquote wi<strong>der</strong>, die bis 1982 stetsüber den Werten <strong>der</strong> Deutschen lag. Von 1982 bis 2003 istdie Beschäftigungsquote <strong>der</strong> Deutschen vor allem <strong>in</strong>folge<strong>der</strong> gestiegenen Erwerbsbeteiligung <strong>der</strong> Frauen um 3 Prozentangestiegen, während die <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> um 13 Prozentpunkteabnahm (Hönekopp 2004). Nur noch wenigerals die Hälfte aller Türken im erwerbsfähigen Alter ist<strong>der</strong>zeit abhängig o<strong>der</strong> selbstständig beschäftigt, bei den50- bis 64-jährigen s<strong>in</strong>d es nur noch 20 Prozent aller türkischenMänner und kaum mehr als 10 Prozent <strong>der</strong> türkischenFrauen (Hönekopp 2004). Bei den an<strong>der</strong>en Auslän<strong>der</strong>gruppensieht es etwas günstiger aus.Die drastische Abnahme <strong>der</strong> Beschäftigungsquote vonAuslän<strong>der</strong>n – und zwar <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei den älteren Auslän<strong>der</strong>n– ist Folge des Strukturwandels und <strong>der</strong> steigendenE<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsprobleme bei zunehmen<strong>der</strong> Konkurrenzauf dem Arbeitsmarkt. Ausländische Beschäftigtes<strong>in</strong>d vorwiegend für e<strong>in</strong>fache Tätigkeiten im produzierendenGewerbe e<strong>in</strong>gestellt worden, die gerade <strong>in</strong> den letztenJahren beson<strong>der</strong>s abgebaut worden s<strong>in</strong>d. 1974 waren fast80 Prozent aller Auslän<strong>der</strong> (<strong>in</strong>sgesamt: ca. 56 Prozent) improduzierenden Bereich beschäftigt, 2000 nur noch ca.53 Prozent (<strong>in</strong>sgesamt ca. 40 Prozent). Gleichzeitig s<strong>in</strong>ddie entsprechenden Anteile <strong>der</strong> Beschäftigung <strong>in</strong> denDienstleistungsbereichen stark gestiegen. Dies könnte aufden ersten Blick zunächst positiv als „Normalisierung“<strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>beschäftigung <strong>in</strong>terpretiert werden. Tatsächlichzeigt jedoch e<strong>in</strong>e detailliertere Analyse <strong>der</strong> Beschäftigungsentwicklung,dass – zum<strong>in</strong>dest <strong>der</strong>zeit – auchdie Tertiarisierung <strong>der</strong> Beschäftigung für Auslän<strong>der</strong> wie<strong>der</strong>nach e<strong>in</strong>em ähnlichen Muster abläuft wie früher <strong>der</strong>Prozess im Produktionsbereich: Während für Deutschedie Arbeitsplätze v.a. <strong>in</strong> Dienstleistungsbereichen mitqualitativ höherwertiger Beschäftigung entstanden s<strong>in</strong>d,werden Auslän<strong>der</strong> <strong>in</strong> großer Zahl auf E<strong>in</strong>facharbeitsplätze<strong>in</strong> Gaststätten, Wäschereien und Re<strong>in</strong>igungsfirmen verwiesen(Hönekopp 2004).H<strong>in</strong>tergrund dafür ist vor allem ihre ungünstige Qualifikationsstruktur,die neben Vorurteilen, Diskrim<strong>in</strong>ierungen,aber auch kulturellen Barrieren die E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungnach Arbeitsplatzverlusten o<strong>der</strong> <strong>der</strong> nachwachsenden <strong>Generation</strong>erschwert. Bei den Auslän<strong>der</strong>n liegt <strong>der</strong> Anteilvon Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau mehrals doppelt so hoch wie bei Deutschen, und zwar sowohlbei den Älteren als auch bei den Nachwuchskräften. Auchhat <strong>in</strong> den letzten 20 Jahren <strong>der</strong> Anteil von ausländischenund türkischen Beschäftigten mit niedrigem Qualifikationsniveaukaum abgenommen. 2002 übertraf er mit ca.60 Prozent (Türken: über 70 Prozent) die Werte <strong>der</strong> Deutschenum mehr als das Doppelte.Es mag überraschen, dass sich ab dem 60. Lebensjahr dieBeschäftigtenquote <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> den deutschen Zahlenauf allerd<strong>in</strong>gs für beide Gruppen sehr niedrigem Niveauannähert und wegen <strong>der</strong> höheren Selbstständigenquote abdem 63. Lebensjahr sogar über dem deutschen Niveauliegt (siehe auch Abbildung 32). Dah<strong>in</strong>ter dürfte u.a. stehen,dass e<strong>in</strong>ige Auslän<strong>der</strong>, die <strong>in</strong> Deutschland Rentenansprücheerworben haben, nach dem Ende des Erwerbslebens<strong>in</strong> ihr Heimatland <strong>zur</strong>ückgekehrt s<strong>in</strong>d und von dortihre Rente beziehen. Sie gehören dann nicht mehr <strong>der</strong>Wohnbevölkerung <strong>in</strong> Deutschland an und werden folglichauch vom Mikrozensus nicht erfasst (Brussig, Knuth &Weiß 2004).Bei vielen Auslän<strong>der</strong>n kumulieren unterschiedliche Risiken,wie niedrige Qualifikation, vorherige Beschäftigung<strong>in</strong> Krisenbranchen und auf beson<strong>der</strong>s von Rationalisierungeno<strong>der</strong> Verlagerungen betroffenen Arbeitsplätzen.Die Betroffenheit von gesundheitsbed<strong>in</strong>gter vorzeitigerM<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit (Früh<strong>in</strong>validität) hat sichallerd<strong>in</strong>gs zwischen Deutschen und Auslän<strong>der</strong>n weitgehendangeglichen; lediglich bei den ausländischen Frauenzeigt sich noch e<strong>in</strong> höherer Rentenzugang wegen verm<strong>in</strong><strong>der</strong>terErwerbsfähigkeit (siehe Tabelle 3). Häufig treffendie spezifischen Risiken <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> zudem mit e<strong>in</strong>erstarken Erwartungshaltung e<strong>in</strong>es vorzeitigen Ausscheidensaus dem Erwerbsleben zusammen.Tabelle 3Rentenzugänge wegen verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Erwerbsfähigkeit bei deutschen und ausländischen Versichertenim Jahr 2004Renten wegen verm<strong>in</strong><strong>der</strong>terErwerbsfähigkeit(<strong>in</strong> %)Renten wegen Alters(<strong>in</strong> %)Quelle: VDR-Statistik (2005): Rentenzugang des Jahres 2004, eigene Berechnungen.DeutscheAuslän<strong>der</strong>Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt83.084(20,5 %)320.802(79,4 %)Zusammen 403.886(100,0 %)65.185(14,3 %)389.645(85,6 %)454.830(100,0 %)148.269(17,3 %)710.447(82,7 %)858.716(100,0 %)13.516(17,2 %)64.862(82,8 %)78.378(100,0 %)7.675(18,8 %)33.092(81,1 %)40.767(100,0 %)21.191(17,8 %)97.954(82,2 %)119.145(100,0 %)
Drucksache 16/2190 – 68 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode2.2.6 Unterschiede zwischen Ost- undWestdeutschlandDer Strukturbruch <strong>in</strong> Ostdeutschland hat zu massiven Arbeitsplatzverlustengeführt. Von den e<strong>in</strong>stmals fast9,8 Millionen Arbeitsplätzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> alten DDR s<strong>in</strong>d ungefährvier Millionen verloren gegangen (Bosch & Knuth2003: 139). Die Beschäftigungsverluste wurden durch arbeitsmarktpolitischeMaßnahmen abgefe<strong>der</strong>t, wozu auchverschiedene Instrumente <strong>der</strong> Frühverrentung zählten(ausführlich Ernst 1995, zum Überblick Schmähl 2003b:579ff.). Auf Grund des Umfangs des Personalabbaus war<strong>der</strong> Zugang zu diesen Maßnahmen Anfang <strong>der</strong> 1990er-Jahre weniger selektiv als <strong>in</strong> Westdeutschland und betrafgleichermaßen alle Qualifikationsgruppen. So s<strong>in</strong>d nachneuesten Auswertungen des Alterssurveys <strong>in</strong> Ostdeutschland44,9 Prozent aller Personen aus den Jahrgängen1933-1937, also den Jahrgängen, die 1990 53 bis 57 Jahrealt waren, aus Arbeitslosigkeit o<strong>der</strong> Vorruhestand <strong>in</strong> dieAltersrente gegangen, gegenüber 11,1 Prozent <strong>in</strong> Westdeutschland.Von diesen Jahrgängen traten <strong>in</strong> Ostdeutschlandnur noch 42 Prozent aus Beschäftigung <strong>in</strong> die Altersrentee<strong>in</strong> gegenüber fast 70 Prozent <strong>in</strong> Westdeutschland(Abbildung 10). Dies zeigen auch Daten <strong>der</strong> Rentenversicherungsträger.So g<strong>in</strong>gen z.B. 1995 bis 1997 rund60 Prozent <strong>der</strong> männlichen Rentenantragsteller aus demStatus <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit <strong>in</strong> die Altersrente (Schmähl2003b: 581f). Während des ostdeutschen Strukturbruchswar also <strong>der</strong> vorzeitige Ausstieg aus Beschäftigung, ansonsteneher als Ausnahme gedacht, für viele Jahrgängedas „Normale“. Die Übergänge aus Hausfrauentätigkeitblieben auch nach <strong>der</strong> Wende <strong>in</strong> Ostdeutschland die Ausnahme.Diese Frühverrentungspraxis sowie die hohe Arbeitslosigkeithaben ebenfalls starke Spuren <strong>in</strong> den Beschäftigungsquoten<strong>in</strong> Ostdeutschland h<strong>in</strong>terlassen (Tabelle 4).Vor <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>vere<strong>in</strong>igung lagen die Beschäftigungsquoten<strong>der</strong> 55- bis 64-jährigen Frauen und Männer <strong>in</strong> <strong>der</strong>DDR noch erheblich über den westdeutschen Werten. Allerd<strong>in</strong>gssank die Beschäftigungsquote <strong>der</strong> Frauen auch <strong>in</strong><strong>der</strong> DDR nach dem 60. Lebensjahr stark ab, da die Rentenaltersgrenzefür Frauen damals bei 60 Jahren lag imUnterschied zu Männern, bei denen sie 65 Jahre betrug.Schon 1991 waren die ostdeutschen Werte unter die westdeutschengesunken (Tabelle 4). Auf Grund <strong>der</strong> schlechtenBeschäftigungssituation <strong>in</strong> Ostdeutschland galt diesbei den Männern auch noch 2003. Bei den ostdeutschenFrauen ist die Beschäftigungsquote <strong>der</strong> 55- bis 59-jährigenseit 1991 aber wie<strong>der</strong> um 23,5 Prozent angestiegenund übertrifft trotz des ger<strong>in</strong>gen Arbeitsplatzangebots <strong>in</strong>Ostdeutschland mittlerweile wie<strong>der</strong> den westdeutschenWert. Nach den großen Entlassungswellen zu Anfang <strong>der</strong>1990er-Jahre haben die ostdeutschen Frauen mit ihrer höherenErwerbsorientierung und -tradition also wie<strong>der</strong> angewohnte Erwerbsmuster angeknüpft. Auch <strong>in</strong> den jüngerenJahrgängen <strong>der</strong> ostdeutschen Frauen ist e<strong>in</strong> erheblichhöherer Prozentsatz <strong>der</strong> Frauen beschäftigt o<strong>der</strong> sucht Arbeit(Abbildung 11). Die Gleichstellungspolitik <strong>in</strong> <strong>der</strong>DDR entfaltet hier trotz <strong>der</strong> hohen Arbeitslosigkeit <strong>in</strong>Ostdeutschland ihre Nachwirkungen, was günstige Voraussetzungenfür die Bewältigung <strong>der</strong> demografischenProbleme schafft.Abbildung 10Situation vor Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Altersrente nach Landesteil10080West5,3 7,8 6,5 8,422,8 16,213,4 10,75,07,5 11,110080Ost12,0 8,7 8,5 11,625,560%60%44,94069,3 70,9 72,6 69,84088,0 87,066,0202042,001917/22 1923/27 1928/32 1933/3701917/22 1923/27 1928/32 1933/3780-85 75-79 70-74 65-69Geburtsjahrgang/AlterÜbergang ...aus sonstigem Statusnach Tätigkeit als Hausfrau/-mannaus <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit o<strong>der</strong> dem Vorruhestanddirekt aus <strong>der</strong> Erw erbstätigkeit*80-85 75-79 70-74 65-69Übergang ...Geburtsjahrgang/Alteraus sonstigem Statusnach Tätigkeit als Hausfrau/-mannaus <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit o<strong>der</strong> dem Vorruhestanddirekt aus <strong>der</strong> Erw erbstätigkeit** e<strong>in</strong>schl. aus Freistellungsphase <strong>der</strong> Altersteilzeit.Quelle: Engstler 2004: 111. Datenbasis: Alterssurvey 2002.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 69 – Drucksache 16/2190Tabelle 4Beschäftigungsquote, nach Altersgruppen im früheren Bundesgebiet und <strong>in</strong> den Neuen Bundeslän<strong>der</strong>n,1991 und 2003, sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> DDR 19891991200319912003Alter von… bis unter… JahrenNeue Bundeslän<strong>der</strong>und Berl<strong>in</strong>-OstMännlichDDR198950 – 60 83,0 78,0 90,060 – 65 32,9 23,0 75,850 – 60 77,0 68,5 /60 – 65 33,1 23,0 /Weiblich50 – 60 48,1 57,1 77,560 – 65 11,4 4,3 28,450 – 60 59,6 62,6 /60 – 65 17,2 10,9 /Quelle: GeroStat – Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berl<strong>in</strong>. Datenbasis: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden – Mikrozensus 1991, 2003, Förster 1991.Abbildung 11Anteil <strong>der</strong> Erwerbstätigen, Erwerbslosen und Nichterwerbspersonen an <strong>der</strong> weiblichen Bevölkerungim Erwerbsalter (20- bis 64-Jährige), West- und Ost-Deutschland 2003100%80%ErwerbsloseErwerbstätigeNichterwerbspersonen60%40%20%Früheres Bundesgebiet20-34 35-49 50-6420-34 35-4950-64nach Altersgruppen (<strong>in</strong> Jahren)Früheres BundesgebietNeue Län<strong>der</strong>Quelle: GeroStat – Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berl<strong>in</strong>. Datenbasis: Mikrozensus 2003, Statistisches Bundesamt.
Drucksache 16/2190 – 70 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode2.2.7 E<strong>in</strong>kommenÜber den Zusammenhang von Lebensalter und E<strong>in</strong>kommengibt es sehr unterschiedliche Theorien. Aus humankapitaltheoretischerSicht wird hervorgehoben, dassältere Beschäftigte <strong>in</strong> ihrem Erwerbsleben zunehmendWissen und Erfahrungen sammeln, also zusätzliches Humankapitalerwerben, dass ihre Produktivität erhöht unde<strong>in</strong> höheres E<strong>in</strong>kommen rechtfertigt. Die Akkumulationvon Wissen kann mehrere Ursachen haben: Investitionendes Unternehmens <strong>in</strong> die Weiterbildung des Beschäftigten,eigene Investitionen, Beschäftigung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er lernför<strong>der</strong>lichenArbeitsumgebung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e entwicklungsför<strong>der</strong>ndeMobilität <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Unternehmens o<strong>der</strong> übermehrere Unternehmen. Falls jedoch im Erwerbslebendurch e<strong>in</strong>e wenig lernför<strong>der</strong>liche Arbeitsumgebung undger<strong>in</strong>ge Innovation vorhandenes Wissen nur teilweise abgerufenwird und deshalb verkümmert, dann s<strong>in</strong>kt dieProduktivität, was bei Entlohnung gemäß <strong>der</strong> Produktivitäte<strong>in</strong>e Absenkung <strong>der</strong> Entlohnung nach sich ziehenwürde. Allerd<strong>in</strong>gs wirken auf die Entlohnung viele weitereFaktoren e<strong>in</strong>.Die <strong>in</strong>stitutionelle Arbeitsmarkttheorie nimmt stärker dieRegulierungen <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Unternehmen o<strong>der</strong> unternehmensübergreifend<strong>in</strong> den Blick, die Lernprozesse, Mobilitätund E<strong>in</strong>kommen im Erwerbsverlauf strukturieren. Siezeigt, dass es für unterschiedliche Beschäftigtengruppenganz unterschiedliche Mobilitäts- und Lernchancen gibt.Unüberw<strong>in</strong>dbare Barrieren zwischen Teilsegmenten desArbeitsmarktes können Lernchancen und auch E<strong>in</strong>kommensentwicklungenfür bestimmte Gruppen blockieren.E<strong>in</strong>e solche Segmentierung kann ganz unterschiedlicheUrsachen haben, wie etwa die Restriktion des Zugangs zubestimmten Tätigkeiten durch ständische Berufs<strong>in</strong>teresseno<strong>der</strong> tayloristische Konzepte <strong>der</strong> Arbeitsorganisationmit festen Grenzen zwischen ausführenden und planendenTätigkeiten. Darüber h<strong>in</strong>aus folgen Karrieren undMobilitätswege <strong>in</strong> Unternehmen zumeist bestimmten Regeln,die jedes Unternehmen braucht, um Konkurrenz zukanalisieren und Kooperation zu erhalten. Schließlichkönnen durch betriebsübergreifende Regulierungen wieüber Tarifverträge o<strong>der</strong> Gesetze betriebliche Entscheidungsprozesseüber Lernangebote, Mobilität und E<strong>in</strong>kommenbee<strong>in</strong>flusst werden. Die <strong>in</strong>stitutionelle Arbeitsmarkttheoriegeht davon aus, dass die ökonomischenRationalitäten, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Humankapitaltheorie formulierts<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e starke Rolle spielen, aber an Regelungen gebundens<strong>in</strong>d und entsprechend modifiziert werden. E<strong>in</strong>esomit gebundene Rationalität kann für den Betrieb o<strong>der</strong>die Volkswirtschaft als Ganzes im Übrigen effektiver se<strong>in</strong>als die Maximierung <strong>in</strong>dividueller Bildungsrenditen aufKosten <strong>der</strong> betrieblichen Kooperation und <strong>der</strong> gesellschaftlichenKohäsion. In den Regelwerken spiegeln sichniemals alle<strong>in</strong>e Leitbil<strong>der</strong> betrieblicher Organisation. GesellschaftlicheLeitbil<strong>der</strong>, wie die Absicherung des männlichenAlle<strong>in</strong>verdieners spielen traditionell e<strong>in</strong>e ebensowichtige Rolle. Aus <strong>der</strong> Theorie kann man daher nicht ableiten,welche Entlohnungsstruktur betriebswirtschaftlichund gesamtwirtschaftlich optimal ist.Schaut man sich die empirisch gewachsenen E<strong>in</strong>kommensstrukturenim <strong>in</strong>ternationalen Vergleich an, erkenntman sofort, wie viele unterschiedliche nationale Modelle<strong>der</strong> altersbezogenen Entlohnung mit oft nicht bewusstenWertentscheidungen nebene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> existieren und oft zuähnlichen wirtschaftlichen Ergebnissen führen. DieOECD hat die E<strong>in</strong>kommensprofile für Männer undFrauen nach Lebensalter <strong>in</strong> zehn entwickelten Län<strong>der</strong>nmite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verglichen (Blöndal, Field, Girouard 2002).Die Daten beziehen sich je nach Land auf die Jahre 1998bis 2000 (Deutschland 1998). Verglichen wurden Querschnittsdatenzum E<strong>in</strong>kommen nach <strong>der</strong> Besteuerung,wodurch <strong>in</strong> Län<strong>der</strong>n mit hohem Grenzsteuersatz (Schweden,Dänemark) die Kurven für die Personen mit höheremBruttoe<strong>in</strong>kommen abgeflacht wurden.Aus den Daten (Abbildung 12) lassen sich vier generelleTrends feststellen: Erstens steigen überall mit wachsendemAlter die E<strong>in</strong>kommensunterschiede zwischen denQualifikationsgruppen. Zweitens zahlt sich e<strong>in</strong>e guteQualifikation im Erwerbsverlauf für Frauen weniger ausals für Männern. Drittens haben Län<strong>der</strong> mit e<strong>in</strong>er solidarischenLohnpolitik, die E<strong>in</strong>kommensunterschiede zwischenRegionen, Tätigkeiten und den Geschlechtern e<strong>in</strong>grenzensoll, egalitärere Verlaufsmuster zwischen denQualifikationsgruppen und zwischen Männern undFrauen (Dänemark und Schweden). Viertens stagnierendie E<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong> Beschäftigten ohne e<strong>in</strong>en Abschluss<strong>der</strong> Sekundarstufe II schon sehr früh und gehen vielfachim Alter deutlich <strong>zur</strong>ück. Diese Gruppe <strong>der</strong> Beschäftigtenarbeitet am häufigsten auf wenig lernför<strong>der</strong>lichen Arbeitsplätzenund muss häufig am Ende des Erwerbslebensauf schlechter bezahlte Tätigkeiten (zum Beispiel ohneSchicht- o<strong>der</strong> Leistungszuschläge) wechseln.Bemerkenswert s<strong>in</strong>d die im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich sehrger<strong>in</strong>gen altersbezogenen E<strong>in</strong>kommenssteigerungen <strong>in</strong>Deutschland. Bei den Männern mit e<strong>in</strong>em Hochschulabschlussüber 55 Jahre kann man noch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>en deutlichenE<strong>in</strong>kommenssprung, wohl im Zusammenhang mite<strong>in</strong>em Karrieresprung, feststellen. Die E<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong>Männer ohne Sekundarabschluss II stagnieren ab demmittleren Lebensalter und werden wahrsche<strong>in</strong>lich nurdurch die tarifvertraglich vere<strong>in</strong>barten Verdienstsicherungen(siehe Abschnitt 2.4.3) vor e<strong>in</strong>em Abs<strong>in</strong>ken bewahrt.Frauen mit e<strong>in</strong>em Hochschulabschluss können ke<strong>in</strong>enähnlichen E<strong>in</strong>kommenssprung wie Männer ab 55 verzeichnen;bei ihnen stagnieren auch die E<strong>in</strong>kommen mite<strong>in</strong>em Sekundarabschluss II schon ab dem mittleren Lebensalter.Die Schaubil<strong>der</strong> für Japan zeigen die starkensenioritätsbezogenen Anstiege des E<strong>in</strong>kommens für qualifizierteMänner bis zum 55. Lebensjahr. Danach wechselnviele Japaner aller Qualifikationsstufen auf e<strong>in</strong>enschlechter bezahlten „Altersjob“ und ihre E<strong>in</strong>kommens<strong>in</strong>ken deutlich. Für japanische Frauen h<strong>in</strong>gegen geltendie Senioritätsregeln häufig nicht. Die altersbezogenenLohnsteigerungen für „office ladies“ reichen vielfach nurbis zum 25. Lebensjahr.Überraschend ist die starke Altersabhängigkeit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenvor allem hoch Qualifizierter <strong>in</strong> Län<strong>der</strong>n miteher <strong>der</strong>egulierten Arbeitsmärkten, wie den USA o<strong>der</strong>
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 71 – Drucksache 16/2190Großbritannien. Dies kann daran liegen, dass <strong>in</strong> diesenLän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> An- und Ungelernten sehr hoch istund damit Qualifikationen <strong>in</strong>sgesamt knapp s<strong>in</strong>d (dies giltauch für Frankreich und die Nie<strong>der</strong>lande). Darüber h<strong>in</strong>ausdifferenzieren Betriebe, wenn sie nicht an tarifliche Regelungengebunden s<strong>in</strong>d, möglicherweise ihre E<strong>in</strong>kommennoch stärker nach dem Alter, um bestimmte Beschäftigtean den Betrieb zu b<strong>in</strong>den. Das deutsche Lohnsystemsche<strong>in</strong>t ebenso wie das schwedische o<strong>der</strong> dänische mitse<strong>in</strong>en Strukturen weitgehend „demografiefest“ zu se<strong>in</strong>,d.h. durch die Alterung <strong>der</strong> Belegschaften kommt es nichtzu strukturbed<strong>in</strong>gten Lohnsteigerungen, wie etwa <strong>in</strong> Frankreich,den USA o<strong>der</strong> Japan (die Ausnahme des öffentlichenDienstes <strong>in</strong> Deutschland wird <strong>in</strong> Abschnitt 2.4.3 diskutiert).Abbildung 12E<strong>in</strong>kommen nach Alter und Geschlecht
Drucksache 16/2190 – 72 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperioden o c h Abbildung 12Quelle: Blöndal, Field & Girouard 2002. Datenbasis: OECD Economic Studies.2.2.8 Arbeitszeit ÄltererAls e<strong>in</strong> Instrument <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> BeschäftigungsquoteÄlterer wurde <strong>der</strong> gleitende Übergang <strong>in</strong> die Rentepropagiert. Durch kürzere Arbeitszeiten am Ende des Erwerbslebenssollte e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong> längeres Verbleiben <strong>in</strong>Beschäftigung möglich und attraktiv werden und gleichzeitige<strong>in</strong> „Pensionsschock“ beim abrupten Übergang verr<strong>in</strong>gertwerden. Mit dieser Begründung wurden <strong>in</strong>Deutschland mit <strong>der</strong> Altersteilzeit und <strong>der</strong> Teilrenteebenso wie <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en EU-Län<strong>der</strong>n (z.B. Teilrente <strong>in</strong>Schweden) beson<strong>der</strong>e Instrumente zum gleitenden Übergangvom Erwerbsleben <strong>in</strong> die Rente entwickelt. Trotzdieser Programme ist <strong>der</strong> gleitende Übergang <strong>in</strong> die Rentedie Ausnahme geblieben. Die Inanspruchnahme <strong>der</strong> Teilrenteist äußerst ger<strong>in</strong>g.Die 55- bis 64-Jährigen arbeiteten 2004 im Durchschnitt<strong>in</strong> Deutschland nur 45 M<strong>in</strong>uten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Woche weniger alsdie 25- bis 44-Jährigen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> EU-15 betrug die Differenzimmerh<strong>in</strong> rund 1,5 Wochenstunden (Abbildung 13). Diedurchschnittliche Arbeitszeit <strong>der</strong> 55- bis 64-jährigenMänner lag <strong>in</strong> Deutschland mit 38,5 Wochenstunden naheam üblichen Vollzeitstandard. Bei den Frauen g<strong>in</strong>g dieWochenarbeitszeit zwischen den beiden Altersgruppen <strong>in</strong><strong>der</strong> EU ebenso wie <strong>in</strong> Deutschland immerh<strong>in</strong> um 2,1 Wochenstundenauf 28,0 Wochenstunden <strong>zur</strong>ück. Da vieleFrauen schon vor dem 55. Lebensjahr Teilzeit arbeiten,s<strong>in</strong>d Arbeitszeitreduzierung für sie nicht wie für die meistenMänner mit e<strong>in</strong>er Verän<strong>der</strong>ung ihres Status als Vollzeitbeschäftigteverbunden, was offensichtlich Arbeitszeitvariationenerleichtert. Dieses Muster f<strong>in</strong>det sich auch beimVergleich <strong>der</strong> Teilzeitquoten wie<strong>der</strong>. Die Teilzeitquoten <strong>der</strong>
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 73 – Drucksache 16/2190Abbildung 13Durchschnittliche gewöhnliche Wochenarbeitszeiten <strong>der</strong> 25- bis 44-jährigen und <strong>der</strong> 55- bis 64-jährigenArbeitnehmer <strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Union (15), 2004413925 - 44 Jahre 55 bis 64 JahreArbeitszeit (<strong>in</strong> Stunden)37353331292725NL IR B D GB FIN FR DK LUX IT S AUT P ESP GRLandQuelle: Schief 2005. Datenbasis: Europäische Arbeitskräftestichprobe 2004.Abbildung 14Verteilung <strong>der</strong> Wochenarbeitszeit <strong>der</strong> 25- bis 44-Jährigen und <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> Deutschland, 200435302525-44 Jahre55 - 64 JahreProzent2015105049+4847464544434241403938373630-3525-2920-2415-1910-141-9Wochenarbeitszeit <strong>in</strong> StundenQuelle: Schief 2005. Datenbasis: Europäische Arbeitskräftestichprobe 2004.
Drucksache 16/2190 – 74 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode55- bis 64-Jährigen s<strong>in</strong>d vor allem <strong>in</strong> den Län<strong>der</strong>n hoch,<strong>in</strong> denen die Teilzeitquoten auch <strong>in</strong> den jüngeren Altersgruppenschon hoch s<strong>in</strong>d (wie <strong>in</strong> UK o<strong>der</strong> NL). H<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> Arbeitszeit lässt sich am Ende des Erwerbslebensnur e<strong>in</strong> Flexibilitätsschub erkennen, wenn schon vorhervom Vollzeitstatus abgewichen wurde.E<strong>in</strong> Vergleich <strong>der</strong> Verteilung <strong>der</strong> Arbeitszeiten von 25- bis44-Jährigen mit denen <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen zeigt, dassdie etwas ger<strong>in</strong>gere Arbeitszeit <strong>der</strong> Älteren vor allemFolge e<strong>in</strong>es höheren Anteils von marg<strong>in</strong>aler Teilzeit unter15 Stunden ist. Auch ist nicht auszuschließen, dass sichhierunter auch Frührentner und Arbeitslosenunterstützungsempfängerbef<strong>in</strong>den, die sich etwas h<strong>in</strong>zuverdienen(Abbildung 14). Möglicherweise holen sich e<strong>in</strong>ige Ältereim Ruhestand über M<strong>in</strong>ijobs die Flexibilität, die sie aufGrund <strong>der</strong> starren Arbeitszeitkulturen <strong>in</strong> den Betriebennicht realisieren konnten. E<strong>in</strong>en echten gleitendenÜbergang <strong>in</strong> die Rente verzeichnen wir erst bei den über65-Jährigen, die ihre Erwerbstätigkeit allerd<strong>in</strong>gs erheblichreduziert fortsetzen. Ihre Arbeitszeit geht auf rund 17 Wochenstunden<strong>zur</strong>ück. Es handelt sich dabei allerd<strong>in</strong>gs zue<strong>in</strong>em hohen Teil um Selbstständige (etwa 45 Prozent)(Brussig, Knuth & Weiß 2004), was auf auf e<strong>in</strong> hohesMaß an Freiheit und Selbstbestimmung bei <strong>der</strong> Organisationvon Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen und -belastungen sowie diebeson<strong>der</strong>e Vitalität dieser Gruppe schließen lässt. Darunterf<strong>in</strong>den sich weiterh<strong>in</strong> auch viele Bezieher von Altersrentenmit e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gfügigen Tätigkeit. Im Jahre 2002waren nach Angaben des Alterssurveys noch 9,5 Prozent<strong>der</strong> 65- bis 69-jährigen Bezieher e<strong>in</strong>er Altersrente erwerbstätig.Bei den 70- bis 74-Jährigen waren es noch5,6 Prozent (Engstler 2004). Die Erwerbstätigkeit <strong>der</strong> über65-Jährigen sche<strong>in</strong>t sogar leicht gegenüber 1996 zugenommenzu haben, wo (nach dem Alterssurvey) 7,1 Prozent <strong>der</strong>65- bis 69-jährigen und 2,4 Prozent <strong>der</strong> 70- bis 74-jährigenBezieher e<strong>in</strong>er Altersrente noch erwerbstätig waren.(Auffällig s<strong>in</strong>d die höheren Werte <strong>in</strong> Westdeutschland, diedarauf schließen lassen, dass bei <strong>in</strong>sgesamt günstigererArbeitsmarktsituation mehr Ältere als bisher zum<strong>in</strong>destan e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gfügigen Tätigkeit <strong>in</strong>teressiert se<strong>in</strong> könnten.)In Deutschland wurde die Altersteilzeit vor allem alsBlockmodell mit traditionellen Arbeitszeitstrukturen genutzt.Es gibt allerd<strong>in</strong>gs auch erfolgreiche Beispiele „echter“Altersteilzeit. So war z.B. die Teilrente <strong>in</strong> Schwedenan Wochenarbeitszeitverkürzungen geknüpft und konntenicht geblockt werden (Ebb<strong>in</strong>ghaus 2003). Sie hat Mitte<strong>der</strong> 1990er-Jahre zu e<strong>in</strong>em beträchtlichen Anstieg <strong>der</strong>substanziellen Teilzeit über 20 Stunden geführt. Mit demAuslaufen dieses Programms ist die durchschnittliche Arbeitszeit<strong>der</strong> Älteren <strong>in</strong> Schweden wie<strong>der</strong> aufs europäischeNormalmaß <strong>zur</strong>ückgekehrt (Abbildung 15). Aller-Abbildung 15Verteilung <strong>der</strong> Wochenarbeitszeit <strong>der</strong> 25- bis 44-Jährigen und <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> Schweden,2004, 1995706025 - 44 55 - 64 55 - 64 1995504030201001-910-1415-1920-2425-2930-353637383940414243444546Anteil <strong>in</strong> Prozent474849+Wochenarbeitszeit <strong>in</strong> StundenQuelle: Schief 2005. Datenbasis: Europäische Arbeitskräftestichprobe 2004.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 75 – Drucksache 16/2190d<strong>in</strong>gs zeigen die schwedischen Erfahrungen, dassAltersübergänge durch Politik flexibler gestaltet und daherflexiblere Lösungen für die Betroffenen auch attraktivergemacht werden können.Es ist im Übrigen im EU-Europa auch ke<strong>in</strong> Zusammenhangzwischen <strong>der</strong> Dauer <strong>der</strong> Arbeitszeit <strong>der</strong> 55- bis64-Jährigen und ihrer Beschäftigungsquote festzustellen,d.h. dort wo die Älteren pro Woche kürzer gearbeitet haben,war ihre Beschäftigungsquote auch nicht höher alsdort, wo sie länger gearbeitet haben. Das überrascht nicht:Die Programme zum gleitenden Übergang haben sich anBeschäftigte gerichtet, die ansonsten länger im Erwerbslebengeblieben wären. E<strong>in</strong> gleiten<strong>der</strong> Übergang war alsomit e<strong>in</strong>em identischen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em früheren Ausstieg ausdem Erwerbsleben verbunden, nicht aber mit e<strong>in</strong>er Erhöhung<strong>der</strong> Beschäftigungsquote durch e<strong>in</strong>e Verlängerung<strong>der</strong> Erwerbsphase. Programme, die Älteren Arbeitszeitverkürzungenanbieten, um sie länger im Beschäftigungssystemzu halten, stehen noch aus.Die immer wie<strong>der</strong> vor allem von Gerontologen gefor<strong>der</strong>teAuflösung <strong>der</strong> starren Abgrenzung von Erwerbsleben undRentenalter hat hierzulande bislang nicht stattgefundenund wurde zudem von <strong>der</strong> Politik auch nicht geför<strong>der</strong>t.Das Altersteilzeitgesetz <strong>in</strong> Deutschland ist – nimmt manden Titel ernst – e<strong>in</strong>e Mogelpackung (Bäcker 1999), da esauch den abrupten Ausstieg über die Blockfreizeit zulässt,die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis auf Grund traditioneller Orientierungen<strong>der</strong> Betriebe und <strong>der</strong> Beschäftigten die Regel gewordenist (Barkholdt 2004).Dabei gibt es viele unerfüllte Wünsche nach Arbeitszeitverkürzungen,die vermutlich den Betrieben auch großeGestaltungsspielräume bei <strong>der</strong> Arbeitszeit <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>stimmungmit ihren Beschäftigten geben (Bielenski,Bosch & Wagner 2002). Die tatsächliche Arbeitszeit <strong>der</strong>Vollzeitbeschäftigten lag nach e<strong>in</strong>er Befragung des ISO-Institutes <strong>in</strong> Deutschland im Jahre 2003 bei 42,1 Wochenstunden(Bauer, et al. 2004). Die gewünschte Arbeitszeitbetrug h<strong>in</strong>gegen 38,9 Wochenstunden. E<strong>in</strong>e Son<strong>der</strong>auswertung<strong>der</strong> Arbeitszeitwünsche nach Alter für die 5. Altenberichtskommissionergab allerd<strong>in</strong>gs, dass die 55- bis64-jährigen Vollzeitbeschäftigten ihre Arbeitszeit nichtstärker als die Jüngeren verr<strong>in</strong>gern wollen. Die Wunscharbeitszeit<strong>der</strong> 18- bis 53-jährigen Vollzeitbeschäftigtenliegt bei 37,8 Wochenstunden und bei den 54- bis 59-jährigenbei 37,7 Wochenstunden. Bei den 60- bis 65-Jährigensteigt sie sogar leicht auf 38,2 Wochenstunden an.Während die Vollzeitbeschäftigten aller Altersgruppenihre Wochenarbeitszeit verr<strong>in</strong>gern wollten, möchten alleTeilzeitbeschäftigten ihre Wochenarbeitszeit ger<strong>in</strong>gfügigerhöhen.Auch wenn die Arbeitszeitwünsche <strong>der</strong> verschiedenenAltersgruppen <strong>in</strong> etwa <strong>in</strong> die gleiche Richtung gehen, s<strong>in</strong>ddie Gründe hierfür sehr unterschiedlich. Bei den Älterensteht die Reduzierung von Belastungen an erster Stelle(Tabelle 5). Zu diesen zählen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Doppelbelastungdurch Familie und Beruf, die von 23 Prozent <strong>der</strong>55- bis 64-Jährigen als Grund für Teilzeiterwerbstätigkeitgenannt wird, sowie gesundheitliche Belastungen(12 Prozent) (Wurm 2004). Man kann davon ausgehen,dass hierbei auch enge gesundheitliche Zusammenhängebestehen. Insgesamt jedoch stützen die Daten <strong>zur</strong> gewünschtenArbeitszeit die These, dass das Blockmodell<strong>der</strong> Altersteilzeit gegenwärtig den Präferenzen <strong>der</strong> meistenBeschäftigten entspricht.Tabelle 5Gründe für den Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung nach Altersgruppen(Angaben <strong>in</strong> Prozent)18-29 Jahre 30-49 Jahre 50-65 Jahre Alle BeschäftigteBelastungen reduzieren 26 29 41 31Außerberufliche Verpflichtungen 20 30 11 24Zeit wichtiger als Geld 32 25 27 27Sonstiges 22 16 21 18Insgesamt 100 100 100 100Quelle: Bauer 2004: 71.
Drucksache 16/2190 – 76 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode2.2.9 Gesundheit, Alter und ErwerbsarbeitIn <strong>der</strong> niedrigen Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer spiegeln sich neben Arbeitslosigkeitund <strong>der</strong> Vorruhestandspolitik und -praxis <strong>der</strong>vergangenen Jahre und Jahrzehnte auch ihr höheresKrankheitsrisiko wi<strong>der</strong>, u.a. mit <strong>der</strong> Konsequenz gesundheitsbed<strong>in</strong>gterM<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erwerbsfähigkeit und <strong>in</strong><strong>der</strong> Folge krankheitsbed<strong>in</strong>gter Frühverrentungen(Viebrok 2004a). Das alterstypisch höhere Krankheitsrisikowird <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Kontext arbeitsbed<strong>in</strong>gter Belastungenim erwerbsbiografischen Kontext thematisiertund gilt bei bestimmten Tätigkeiten als „Karriererisiko“.Für viele „typische“ Erkrankungen älterer Beschäftigterkönnen dabei biologische Alterungsprozesse als nahezuirrelevant angesehen werden (Behrens 2003). Neben denphysischen Arbeitsbelastungen, die ke<strong>in</strong>eswegs rückläufigs<strong>in</strong>d, wie lange Zeit erwartet, s<strong>in</strong>d vielfältige psychischeBelastungsarten als neue E<strong>in</strong>flussgrößen deshöheren Krankheitsrisikos Älterer h<strong>in</strong>zugekommen, die<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von älteren Beschäftigten empf<strong>in</strong>dlichwahrgenommen werden. Dies gilt vor allem für solche,z.T. eher unspezifischen Faktoren wie hohe Mobilitätserfor<strong>der</strong>nisse,Hektik, Zeitdruck, Stress, Überfor<strong>der</strong>ung, sozialeIsolation und „altersunfreundliches“ Arbeitsklima.So wird im Alterssurvey 2002 von e<strong>in</strong>em hohen Maß anStresserleben bei den 55- bis 64-jährigen Erwerbstätigenberichtet. Fast die Hälfte <strong>der</strong> erwerbstätigen Männer(46 Prozent) gibt dabei an, durch Stress „ziemlich“ o<strong>der</strong>sogar „sehr belastet“ zu se<strong>in</strong>. Bei den erwerbstätigenFrauen liegt dieser Anteil etwas niedriger (37 Prozent).Auch längsschnittliche Son<strong>der</strong>auswertungen des Alterssurveys2002 bestätigen das mit dem Alter parallele Ansteigendes Erkrankungsrisikos. Dies ist auch <strong>in</strong>sofern bemerkenswert,als vor allem jenseits des 55. Lebensjahresdie Erwerbsbeteiligung ohneh<strong>in</strong> s<strong>in</strong>kt und dies vor allemgesundheitlich bee<strong>in</strong>trächtigte ältere Beschäftigte betrifft.Wie vorliegende Krankenkassendaten übere<strong>in</strong>stimmendausweisen, dokumentiert sich das alterstypische Krankheitsrisiko<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dar<strong>in</strong>, dass Ältere zwar seltenerkrank, aber bei weitem häufiger von langwierigen undvon Mehrfacherkrankungen betroffen s<strong>in</strong>d; mit <strong>der</strong> Folgehöherer Krankenstände – jeweils gemessen an den AU-Dauern/Fall (zuletzt Vetter 2003). Insgesamt nimmt vorallem die Bedeutung chronisch-degenerativer Krankheitenmit dem Alter <strong>der</strong> Beschäftigten zu. Insbeson<strong>der</strong>eHerz-/Kreislauferkrankungen und Muskel- und Skeletterkrankungenweisen dabei am stärksten altersabhängigeSteigerungsraten auf (Wurm 2004). Beide s<strong>in</strong>d für dengrößten Teil <strong>der</strong> krankheitsbed<strong>in</strong>gten Ausfallzeiten Ältererverantwortlich (Vetter 2003).Von wachsen<strong>der</strong> Bedeutung – dabei überdurchschnittlichbei (älteren) Frauen - s<strong>in</strong>d darüber h<strong>in</strong>aus psychische Erkrankungsbil<strong>der</strong>,so vor allem affektive Störungen wieDepressionen sowie neurotische, Belastungs- und somatoformeStörungen (u.a. Phobien und an<strong>der</strong>e Angststörungen),auf die 2002 etwa e<strong>in</strong> knappes Viertel <strong>der</strong> Frühverrentungenentfielen, mit wie<strong>der</strong>um deutlich höherenAnteilen bei Frauen (BKK Gesundheitsreport 2004; BarmerGesundheitsreport 2004; DAK Gesundheitsreport2004).Die Arbeits- und Leistungsfähigkeit älterer Erwerbstätigerhängt neben dem Gesundheitszustand und den Arbeitsbelastungenzudem von <strong>der</strong> Arbeitszufriedenheit ab.Die Arbeitszufriedenheit von älteren Erwerbstätigen ist,beson<strong>der</strong>s was die beruflichen Entwicklungs- und betrieblichenWeiterbildungsmöglichkeiten angeht, deutlichniedriger als jene von jüngeren Erwerbstätigen. Vonden 55- bis 64-jährigen Erwerbstätigen geben 39 Prozentan, ke<strong>in</strong>e Möglichkeiten beruflicher Weiterentwicklungzu haben, bei den 45- bis 54-Jährigen s<strong>in</strong>d dies nur etwahalb so viele (21 Prozent) (Wurm 2004).Das höhere Krankheitsrisiko älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer lässt sich ke<strong>in</strong>eswegs als „alterstypischerAutomatismus“ <strong>in</strong>terpretieren, son<strong>der</strong>n muss wegense<strong>in</strong>er spezifischen Verteilung auf bestimmte Branchen,Berufe bzw. Tätigkeiten als typisches „Berufsrisiko“ angesehenwerden. Es dom<strong>in</strong>iert <strong>in</strong> vorwiegend ger<strong>in</strong>g qualifiziertenBeschäftigtengruppen mit hohen Anteilen anschweren körperlichen Tätigkeiten und ger<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>dividuellenHandlungsspielräumen und/o<strong>der</strong> <strong>in</strong> solchen Arbeitsbereichen,<strong>in</strong> denen typische Arbeiter- und/o<strong>der</strong> Produktionstätigkeitenvorherrschen (Vetter 2003). In diesemZusammenhang weisen repräsentative Befragungsergebnissekörperliche Fehlbeanspruchungen (Heben und Tragenschwerer Lasten, e<strong>in</strong>seitig belastende Tätigkeitenetc.), Arbeitsumgebungsbelastungen (Hitze, Lärm,schlechte Beleuchtungsverhältnisse), hohe bzw. starreLeistungsvorgaben, hohe psychische Belastungen (Isolation,schlechtes Arbeitsklima etc.) sowie Schicht- undNachtarbeit als beson<strong>der</strong>e alternskritische Arbeitsanfor<strong>der</strong>ungenaus (Morschhäuser 2003; zu früheren BefundenKarazmann et al. 1995; Ilmar<strong>in</strong>en 1999).Insgesamt weisen Angehörige höher qualifizierter Berufemit höherem Sozialprestige und größeren Entscheidungsspielräumen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit sowohl ger<strong>in</strong>gere AU-Zeitenauf und beziehen auch deutlich seltener Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsrenten,Angehörige körperlich anstrengen<strong>der</strong>, niedrigqualifizierter Berufe mit ger<strong>in</strong>gerem Sozialprestigedagegen jeweils deutlich häufiger (Morschhäuser 2003).Folglich gibt es auch e<strong>in</strong>e Vielzahl von Berufen mit so genannten„begrenzten Tätigkeitsdauern“, also solchen, <strong>in</strong>denen man unter normalen Bed<strong>in</strong>gungen gar nicht „alt“werden kann (z.B. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Montage im Automobilbereich,bei vielen Zuliefertätigkeiten für die Automobil<strong>in</strong>dustrie,auf dem Bau o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alten- und Krankenpflege)(Behrens 1999; 2003).Wie<strong>der</strong>holt wurde vermutet, die Verschiebung des Beschäftigungsschwerpunktesauf den Dienstleistungssektorkönnte sich <strong>in</strong>sgesamt positiv auf die Entwicklung <strong>der</strong>Arbeitsbelastungen und damit auf das arbeitsbed<strong>in</strong>gteKrankheitsrisiko älterer Beschäftigter auswirken. RepräsentativeUntersuchungen zeigen jedoch, dass auch imDienstleistungssektor die klassischen Belastungsfaktoren<strong>der</strong> Arbeitsumgebung und -bed<strong>in</strong>gungen sowie <strong>der</strong> körperlichenBeanspruchungen weit verbreitet s<strong>in</strong>d (Jansen& Müller 2000). Exemplarisch sei an das hohe Arbeitsbelastungsprofildes Altenpflegeberufs er<strong>in</strong>nert, das durch
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 77 – Drucksache 16/2190enorme psychische wie physische Belastungen geprägt ist(Zimber & Weyerer 1999). H<strong>in</strong>zu kommen psychosozialeBelastungen aus <strong>der</strong> Organisation und <strong>der</strong> zeitlichenStrukturierung <strong>der</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen, die <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>evon älteren Beschäftigten als deutlich belastend empfundenwerden (Jansen & Müller 2000). Letzteres wird auchdurch <strong>in</strong>ternationale Vergleichsstudien belegt (Mol<strong>in</strong>ie2003).In zahlreichen Fällen mündet das höhere Krankheitsrisiko<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e vorzeitige M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> den vollen Verlust <strong>der</strong>Erwerbsfähigkeit, wobei sich auch bei den Verrentungenwegen vorzeitiger Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung neben Alterseffektenbranchen- und/o<strong>der</strong> berufsgruppentypische Verteilungsmustererkennen lassen. So gilt z.B. für den Geburtsjahrgang1938 <strong>der</strong> VDR-Rentner, dass männlicheArbeiter mit rund 37 Prozent e<strong>in</strong>e mehr als doppelt sohohe Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungshäufigkeit aufweisen als männlicheAngestellte (15 Prozent) und dass vom berentetenGeburtsjahrgang 1938 <strong>in</strong> Westdeutschland fast je<strong>der</strong>dritte Mann (29 Prozent) und jede sechste Frau (16 Prozent)e<strong>in</strong>e Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsrente erhielt. Letzteres entsprach<strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>em Anteil von 23 Prozent aller Versichertenrentenzugänge<strong>in</strong> <strong>der</strong> ArV und AnV zusammen(VDR 2004: 66-71). Ergänzende H<strong>in</strong>weise bieten aktuelleRentenzugangsstatistiken: Nach <strong>der</strong> VDR-Statistikfür 2004 g<strong>in</strong>gen etwa 97 Prozent <strong>der</strong> Ärzte, 92 Prozent<strong>der</strong> Hochschullehrer, 93 Prozent <strong>der</strong> Rechtsberater und91 Prozent <strong>der</strong> Ingenieure wegen Alters <strong>in</strong> Rente. Dagegenwar bei 86 Prozent <strong>der</strong> Bergleute, 37 Prozent <strong>der</strong> Maurer,32 Prozent <strong>der</strong> Schweißer und 36 Prozent <strong>der</strong> Rohr<strong>in</strong>stallateure<strong>der</strong> Rentenzugang auf e<strong>in</strong>e verm<strong>in</strong><strong>der</strong>te Leistungsfähigkeit<strong>zur</strong>ückzuführen (VDR 2005: 10-13). Und unterden Gründen dom<strong>in</strong>ierten bei den Männern wie bei denFrauen mit Abstand die psychischen Erkrankungen vorden Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und desB<strong>in</strong>degewebes an zweiter Stelle sowie den Herz-, Kreislauferkrankungenan dritter Stelle; bei den Frauen rangierenlediglich die Neubildungen noch vor den Krankheitendes Kreislaufsystems an dritter Stelle (VDR 2005).E<strong>in</strong>deutige Kausalitätsbeziehungen s<strong>in</strong>d jedoch nurschwer nachweisbar, da zusätzlich Lebensgewohnheiten,vor allem das Gesundheitsverhalten, Umweltfaktoren und<strong>in</strong>dividuelle Prädispositionen, <strong>in</strong>tervenieren können, dieihrerseits aber wie<strong>der</strong>um bestimmten sozialen Verteilungsmusternfolgen und von daher <strong>in</strong> ihrer kumulativenWirkung gesehen werden müssen. Zudem verbergen sichh<strong>in</strong>ter vielen Verrentungen wegen M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erwerbsfähigkeit– nach VDR-Berechnungen zu rund15 Prozent (Stichnoth & Wichmann 2001; Moll & Stichnoth2003) – E<strong>in</strong>flüsse des Arbeitsmarktes.Neben den aus gesundheitlichen Gründen Frühverrentetengibt es darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e Gruppe von ehemals erwerbstätigenÄlteren, die sich im Zwischenstadium vonNicht-Arbeit und Berentung bef<strong>in</strong>den. Neben Arbeitslosigkeit(vor allem bei Männern) und familiären Gründen(vor allem bei Frauen) spielen auch hier gesundheitlicheGründe – e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> „Doppelbelastung“ beiFrauen – e<strong>in</strong>e große Rolle (Abbildung 16). Von Interesseist auch, dass rund 6 Prozent <strong>der</strong> betroffenen Frauen ihreArbeit deswegen aufgegeben haben, um kranke Personbetreuen zu können (Wurm 2004).Gesundheitliche und an<strong>der</strong>e Gründe für Nicht-Erwerbstätigkeit im Geschlechtervergleich(Angaben <strong>in</strong> Prozent; Mehrfachnennungen möglich)Abbildung 1645- bis 54-jährige Nicht-Erwerbstätige 55- bis 64-jährige Nicht-Erwerbstätige4323Arbeitslos geworden923410Familiäre Gründe6462818Gesundheitliche Gründe21392718Betriebliche Gründe1533120Doppelbelastung2950Betreuung kranker Person0605Wunsch, mögl. früh aufzuhören21030Zeit für sich selbst14FrauenMänner30Partner im Ruhestand10FrauenMänner50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50Quelle: Wurm 2004. Datenbasis: Replikationsstichprobe des Alterssurveys 2002, gewichtet.
Drucksache 16/2190 – 78 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeEU-Vergleichsstudien bestätigen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Grundtendenz diedeutschen Befunde zum Gesundheitszustand älterer Erwerbstätiger:So leiden nach repräsentativen Befragungsergebnissen<strong>in</strong> den Staaten <strong>der</strong> Europäischen Union18,4 Prozent <strong>der</strong> über 45-jährigen Männer und 21,6 Prozent<strong>der</strong> über 45-jährigen Frauen nach eigenen Angabenunter e<strong>in</strong>em chronischen o<strong>der</strong> lang andauernden Gesundheitsproblem,das ihre Arbeit erschwert (Ilmar<strong>in</strong>en1999). Vergleicht man den Anteil <strong>der</strong> über 45-Jährigenmit e<strong>in</strong>er <strong>der</strong>artigen Arbeitserschwernis mit jenem <strong>der</strong> unter45-Jährigen, so zeigt sich für Deutschland bei denMännern e<strong>in</strong>e Zunahme von 10,3 Prozent, bei den Frauene<strong>in</strong>e Zunahme von 14,1 Prozent. Mit Ausnahme von Luxemburg,Slowenien und Spanien weisen <strong>in</strong> allen europäischenStaaten Frauen mehr Fehlzeiten auf als Männer.Im E<strong>in</strong>zelnen zeigt sich dabei, dass erstens verheirateteFrauen mehr Fehlzeiten aufweisen als verheiratete Männerund zweitens ältere Frauen mehr Fehlzeiten aufweisenals ältere Männer. Auch variiert nach den Befunden<strong>der</strong> Luxemburg Employment Study <strong>der</strong> Verlauf von Fehlzeitenüber das Erwerbsleben geschlechterspezifisch.Während sich bei Männern e<strong>in</strong> u-förmiger Verlauf f<strong>in</strong>det,nimmt das Ausmaß an Fehlzeiten bei Frauen kont<strong>in</strong>uierlichzu (Barmby, Ercolani & Treble 2002).2.2.10 Betrieb, Arbeitsorganisation undBeschäftigung ÄltererObgleich die demografisch bed<strong>in</strong>gte Alterung <strong>der</strong> Belegschaften<strong>in</strong> <strong>der</strong> Fachöffentlichkeit seit Jahren heftig diskutiertwird, sehen nach e<strong>in</strong>er kürzlich durchgeführtenBetriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung(IAB) <strong>in</strong> Nürnberg lediglich 4 Prozent <strong>der</strong>Betriebe die „Überalterung“ ihrer Belegschaften als personalpolitischesProblem <strong>der</strong> nächsten Jahre an. Dieskann teilweise aber auch darauf <strong>zur</strong>ückgeführt werden,dass <strong>in</strong> <strong>der</strong>selben Studie 57 Prozent <strong>der</strong> untersuchten Betriebe(mit 18 Prozent aller Beschäftigten) angegeben haben,überhaupt ke<strong>in</strong>e Älteren zu beschäftigen. Kle<strong>in</strong>- undKle<strong>in</strong>stbetriebe hatten dabei noch den höchsten Anteil anjenen Betrieben, die mehr als 40 Prozent Ältere beschäftigen.Gleichzeitig f<strong>in</strong>det man unter diesen Betrieben aberauch den höchsten Anteil <strong>der</strong> Unternehmen, <strong>in</strong> denenüberhaupt ke<strong>in</strong>e Älteren anzutreffen s<strong>in</strong>d (Hübner &Wahse 2002).In diesem Zusammenhang werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literatur unterschiedlicheFormen <strong>der</strong> betrieblichen BenachteiligungÄlterer thematisiert, für die mitunter auch <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong>„Altersdiskrim<strong>in</strong>ierung“ benutzt wird. Derartige Formenlassen sich nach den Ergebnissen des BMBF-Forschungsverbundes„Demografischer Wandel <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt“wie folgt systematisieren (Wolff, Spieß & Mohr 2001):– e<strong>in</strong>e altersselektive Personale<strong>in</strong>stellungs- und -rekrutierungspolitik,– alterssegmentierte Aufgabenzuweisungen – mit <strong>der</strong>häufigen Folge <strong>der</strong> Reduzierung <strong>der</strong> breiten E<strong>in</strong>setzbarkeit<strong>der</strong> betroffenen Arbeitskräfte,– unterdurchschnittliche Beteiligung vor allem <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gerqualifizierten älteren Beschäftigten an betrieblichorganisierter Fort- und Weiterbildung (siehe KapitelBildung),– Benachteiligung bei <strong>in</strong>nerbetrieblichen Aufstiegsprozessen,– Ger<strong>in</strong>gschätzung ihres Erfahrungswissens sowie– kurzfristige Kalküle bei Personalentscheidungen zuLasten älterer Belegschaftsmitglie<strong>der</strong>.Es spricht vieles dafür, dass e<strong>in</strong>e <strong>der</strong>artige Praxis <strong>der</strong> Altersdiskrim<strong>in</strong>ierung<strong>in</strong> Großbetrieben ausgeprägter ist als<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en und mittleren Unternehmen, denn größere Betriebebeschäftigen deutlich weniger Ältere als Kle<strong>in</strong>- undMittelbetriebe (Abbildung 17) (Bosch 2003a). Dies hatmehrere Gründe:– Großbetriebe haben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit sehr vielhäufiger Frühverrentungsmaßnahmen durchgeführt.– Größere Betriebe und Großbetriebe betreiben ehere<strong>in</strong>e formalisierte alterselektive Politik, die es Älterenschwer macht, die aus juristischen Gründen meist „unsichtbaren“,aber gleichwohl sehr rigiden Altersgrenzenzu überspr<strong>in</strong>gen. In kle<strong>in</strong>- und mittelständischenUnternehmen dom<strong>in</strong>ieren E<strong>in</strong>zelfallentscheidungen,die Älteren eher e<strong>in</strong>e Chance geben, e<strong>in</strong>gestellt, fortgebildeto<strong>der</strong> weiter beschäftigt zu werden.– Großbetriebe s<strong>in</strong>d arbeitsteiliger organisiert, wodurchBeschäftigte oft jahrelang <strong>in</strong> Tätigkeiten mit e<strong>in</strong>emsehr engen Aufgabenzuschnitt arbeiten. Prozesse betriebsspezifischerDequalifizierung s<strong>in</strong>d somit hiersehr viel häufiger und s<strong>in</strong>d nur noch mit hohem Fortbildungsaufwandzu überw<strong>in</strong>den, den die Betriebescheuen. In Kle<strong>in</strong>- und Mittelbetrieben än<strong>der</strong>n sich dieArbeitsanfor<strong>der</strong>ungen häufiger, wodurch Dequalifizierungsprozessetendenziell seltener vorkommen, das<strong>in</strong>formelle Lernen geför<strong>der</strong>t und die potenziellen E<strong>in</strong>satzfel<strong>der</strong>erweitert werden.– Größere Betriebe und Großbetriebe s<strong>in</strong>d stärker <strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationalenWettbewerbsstrukturen und <strong>in</strong> Globalisierungsprozessene<strong>in</strong>gebunden und unterliegen auchvon daher e<strong>in</strong>er stärkeren betrieblichen Innovationsdynamikund e<strong>in</strong>em erhöhten Kostendruck.– Die physisch-psychischen Belastungen gelten <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>undmittelständischen Unternehmen auf Grund <strong>der</strong>breiteren E<strong>in</strong>satzfel<strong>der</strong> als ger<strong>in</strong>ger. Zudem kann aufGrund <strong>der</strong> hohen Flexibilitätsanfor<strong>der</strong>ungen Erfahrungswissenhäufiger e<strong>in</strong>gebracht werden, und oftmalsbestehen „altersfreundlichere“ Führungs- und Leitungsstileund/o<strong>der</strong> Kooperationsbeziehungen.Mit Blick auf den Dienstleistungssektor kann die Theseals wi<strong>der</strong>legt gelten, dass die „Tertiarisierung <strong>der</strong> Arbeit“geradezu automatisch zu gesün<strong>der</strong>en und/o<strong>der</strong> altersfreundlichenArbeitsplätzen führen würde. Sowohl <strong>in</strong> denunternehmensbezogenen Diensten als auch im Handelwie auch <strong>in</strong> den personenbezogenen sozialen Dienstleistungens<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Vielzahl von Arbeitsplätzen mit hohenkörperlichen und zunehmend psychischen Belastungenentstanden, die überdies vielfach mit erheblichen Erfor<strong>der</strong>nissene<strong>in</strong>er Arbeitszeitflexibilisierung verbunden
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 79 – Drucksache 16/2190Erwerbstätige nach Altersgruppen und Betriebsgröße, 2001Abbildung 17100%90%80%70%50 u.mehr Beschäftigte11 bis 49 Beschäftigtebis 10 Beschäftigte60%50%40%30%20%10%0%15 bis 24 J.25 bis 49 J.50 Jahre51 Jahre52 Jahre53 Jahre54 Jahre55 Jahre56 Jahre57 Jahre58 Jahre59 Jahre60 Jahre61 Jahre62 Jahre63 Jahre64 Jahre65 bis 69 J.Quelle: Brussig, Knuth & Weiß 2004.s<strong>in</strong>d. Exemplarisch kann auf die Entwicklung im Bereich<strong>der</strong> Pflegeberufe verwiesen werden, <strong>in</strong> denen man heutefaktisch nur noch <strong>in</strong> Ausnahmefällen gesund alt werdenkann (siehe Abschnitt 2.2.9).Mehrere Untersuchungen belegen zudem, wie sehr <strong>der</strong>E<strong>in</strong>satz Älterer von <strong>der</strong> Arbeitsorganisation und dem Innovationstempo<strong>in</strong> den Betrieben abhängt. So zeigt z.B.Frerichs (1998), dass die Beschäftigungschancen Ältererzwischen unterschiedlichen Produktionsregimes und/o<strong>der</strong>Branchen variieren. Sie s<strong>in</strong>d ger<strong>in</strong>ger <strong>in</strong> Branchen undBetrieben mit tayloristischen Produktionsregimes aufGrund des hier hohen Anteils an typischen Verschleißarbeitsplätzen,dem engen Aufgabenzuschnitt und <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>genBedeutung an Erfahrungswissen. Demgegenüberbieten Branchen und Betriebe <strong>der</strong> diversifizierten Qualitätsproduktion,aber auch im Bereich <strong>der</strong> Qualitätsdienstleistung,vor allem auf Grund <strong>der</strong> Möglichkeit, Erfahrungswissenanzuwenden, und des hohen Anteils anmanueller Facharbeit sehr viel günstigere Beschäftigungsperspektiven.Branchen und Betriebe <strong>der</strong> <strong>in</strong>novativenQualitätsproduktion verlangen demgegenüber hoheAnfor<strong>der</strong>ungen an Humanressourcen und Qualifikationen,denen ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmernur gerecht werden können, wenn diese ständig gepflegtund aktualisiert werden. Fast e<strong>in</strong> Drittel aller Arbeitskräfte,vor allem auch Jüngere, s<strong>in</strong>d auf ihrem gegenwärtigenArbeitsplatz unterfor<strong>der</strong>t und werden langfristigihre Qualifikationen verlieren. Die Unterfor<strong>der</strong>ung nimmtim Übrigen wohl wegen e<strong>in</strong>es passgenaueren E<strong>in</strong>satzesmit steigen<strong>der</strong> Betriebszugehörigkeit ab (Volkholz2004b).Darüber h<strong>in</strong>aus ist die Beschäftigung Älterer auch Ausdruck<strong>der</strong> jeweiligen betrieblichen Arbeitsanfor<strong>der</strong>ungenund -belastungen. Vor allem <strong>in</strong> jenen Branchen, <strong>in</strong> denene<strong>in</strong> hohes physisch-psychisches Belastungsprofil anzutreffenist, s<strong>in</strong>ken die Beschäftigungsanteile Älterer. Diesgilt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für Betriebe mit e<strong>in</strong>em hohen Anteil anArbeitsplätzen mit „begrenzten Tätigkeitsdauern“, so <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<strong>in</strong> den Montagebereichen <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie,im privaten und öffentlichen Verkehrs- und Transportgewerbe,bei Zulieferern für die Automobil<strong>in</strong>dustrie,auf dem Bau sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alten- und Krankenpflege(Behrens 2003).2.2.11 Die subjektive Seite: Wächst <strong>der</strong>Wunsch, länger erwerbstätig zu bleiben?Die Vorruhestandspolitik und -praxis <strong>in</strong> Deutschland entstand<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em jahrzehntelang gewachsenen Zusammenspielbetrieblicher Ausglie<strong>der</strong>ungsstrategien mit staatlichenAusglie<strong>der</strong>ungsanreizen und konnte sich stets aufe<strong>in</strong> hohes Maß an Übere<strong>in</strong>stimmung bei fast allen Beteiligten(u.a. Betroffene, Gewerkschaften, Betriebsräte,Arbeitgeber, Arbeitsverwaltungen) stützen. Im Rahmendieses „gesellschaftlichen Konsenses“ wurde die
Drucksache 16/2190 – 80 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeFrühverrentung nicht nur „stillschweigend“ akzeptiert,son<strong>der</strong>n vielfach sogar staatlicher- wie betrieblicherseitsaktiv geför<strong>der</strong>t und obendre<strong>in</strong> den Betroffenen noch f<strong>in</strong>anziell„versüßt". E<strong>in</strong> wesentlicher Grund dafür war zunächstdie <strong>Lage</strong> auf dem Arbeitsmarkt. Ausgehend vondem Gedanken <strong>der</strong> „<strong>Generation</strong>ensolidarität“ sollten Älterefür Jüngere Arbeitsplätze freimachen und im Gegenzugdafür sozial abgesichert werden; e<strong>in</strong> Gedanke, <strong>der</strong>auch heute noch weit verbreitet ist und angesichts <strong>der</strong> ungünstigenArbeitsmarktlage und den starken Geburtsjahrgängenvon jugendlichen Ausbildungsplatznachfragernauch nicht völlig von <strong>der</strong> Hand zu weisen ist.Während sich Ende <strong>der</strong> 1960er- und Anfang <strong>der</strong> 1970er-Jahre viele Vorruheständler noch gesellschaftlich ausgegrenztfühlten und sich oft dafür schämten, <strong>der</strong> Gesellschaft<strong>zur</strong> Last zu fallen, wird die Frührente schon langenicht mehr als „<strong>in</strong>dividuelles E<strong>in</strong>zelschicksal“ mit negativemStigma angesehen. Sie ist mittlerweile nicht nur akzeptiert,son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> hohem Maße populär. Insofern ist esunberechtigt, das Frühverrentungsgeschehen lediglichmit betrieblichen Praktiken und <strong>der</strong>en staatlicher Alimentierung<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung zu br<strong>in</strong>gen und die Betroffenen als„passive Manövriermasse“ zu sehen. Parallel hat sich <strong>der</strong>weit verbreitete Wunsch vieler Beschäftigter nach e<strong>in</strong>ermöglichst frühen Beendigung <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit entwickelt,ist e<strong>in</strong> „verän<strong>der</strong>tes Ruhestandsbewusstse<strong>in</strong>“ gewachsenund weit verbreitet, nicht selten immer nochnach dem Muster “je früher, desto besser“. Die vorzeitigeBeendigung <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit wird vielfach als e<strong>in</strong>e„zivilisatorische Errungenschaft“ gesehen und hat sich zue<strong>in</strong>em „sozialen Besitzstand“ entwickelt.Allerd<strong>in</strong>gs gilt auch, dass prekäre f<strong>in</strong>anzielle und gesundheitlicheBed<strong>in</strong>gungen, e<strong>in</strong>e als problembeladen erlebteprivate/familiäre Situation, fehlende soziale Netzwerkesowie ganz generell mangelnde Fähigkeiten und Dispositionen<strong>zur</strong> Bewältigung ungewohnter Situationen dieWahrsche<strong>in</strong>lichkeit erhöhen, dass <strong>der</strong> (frühe) E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong>den Lebensabschnitt „Alter“ hierzulande oft auch alsschwierig erlebt wird. Dabei zeigen sich erneut E<strong>in</strong>flüsse<strong>der</strong> vorherigen Erwerbsbiografie, denn als positiv erlebteArbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den letzten Jahren des Erwerbslebensund/o<strong>der</strong> <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e höhere berufliche Positionenwirken sich auch positiv auf die Situation im Ruhestandund auf die Bewältigung <strong>der</strong> neuen Anfor<strong>der</strong>ungen aus(Bertelsmann Stiftung 1997; Clemens 2001). Heute giltdies selbst für große Teile <strong>der</strong> Betroffenen <strong>in</strong> Ostdeutschland,obgleich <strong>in</strong> <strong>der</strong> DDR Ende <strong>der</strong> 1980er-Jahre Arbeitim Alter u.a. auf Grund e<strong>in</strong>es an<strong>der</strong>en Arbeitsbewusstse<strong>in</strong>straditionell positiver als <strong>in</strong> Westdeutschland beurteiltwurde.Erleichtert wurde <strong>der</strong> Bewusstse<strong>in</strong>swandel durch e<strong>in</strong>e zumeistvorteilhafte soziale Absicherung, die es erst e<strong>in</strong>malermöglicht hat, den auf das Private gerichteten Nachholbedarfauch zu realisieren (Naegele 1992; BertelsmannStiftung 1997). Zwar war <strong>in</strong> Ostdeutschland die sozialeAbsicherung ungünstiger, wurde aber <strong>in</strong> Relation zumvorherigen Lebensstandard immer noch als vorteilhaft bewertet(Ernst 1995; Schwitzer 1999).In <strong>der</strong> Konsequenz überrascht daher nicht, dass auch dieGewerkschaften und ihre Betriebsräte die Freisetzung Ältererweitgehend konsensual mitgetragen und häufig sogarnoch forciert haben. Dies gilt <strong>in</strong> Teilen selbst heutenoch, wie die Instrumentalisierung <strong>der</strong> Altersteilzeit <strong>zur</strong>Fortsetzung <strong>der</strong> Frühverrentungspraxis zeigt, da sie heutenahezu ausschließlich <strong>in</strong> „geblockter“ Form stattf<strong>in</strong>det.Das neue Ruhestandsbewusstse<strong>in</strong> hat sich nicht bei allenBeschäftigtengruppen gleichermaßen entwickelt, son<strong>der</strong>nnach Qualifikationen unterschiedlich. Das Interessean e<strong>in</strong>er Weiterbeschäftigung ist umso höher, je besser<strong>der</strong> Gesundheitszustand, je höher das E<strong>in</strong>kommen, je höherdie Motivation, je erträglicher die Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen,je höher <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuelle Handlungsspielraum <strong>in</strong> <strong>der</strong>Arbeit, je höher die schulische und berufliche Qualifikation,je höher <strong>der</strong> berufliche Status und je besser die sozialeE<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> den Betrieb (u.a. Henke 2000; Naegele2002a).Wir können mittlerweile davon ausgehen, dass sich zweiunterschiedliche Kulturen am Ende des Erwerbslebensherausgebildet haben: Arbeitskräfte, die sich selbst <strong>in</strong> ihrerArbeit realisieren können und dafür noch die nötigenFähigkeiten, Energien und Gesundheit haben, wollenlange arbeiten, oft länger als bis zum Rentenalter. An<strong>der</strong>emit ger<strong>in</strong>gen Handlungsspielräumen und Gesundheitsproblemenwollen ihre verbleibenden Energien eher <strong>in</strong> dieneuen Freiheiten e<strong>in</strong>es vorzeitigen Austritts aus dem Erwerbsleben<strong>in</strong>vestieren. Die sche<strong>in</strong>bar so polarisiertenKulturen unterscheiden sich allerd<strong>in</strong>gs weniger, als es denAnsche<strong>in</strong> hat, wenn man die verbleibende Lebenserwartung<strong>in</strong> Rechnung stellt. Die gesundheitlich beson<strong>der</strong>s belastetenGruppen mit ihren überdurchschnittlich ausgeprägtenWünschen nach e<strong>in</strong>em vorzeitigen Ausstieghaben e<strong>in</strong>e erheblich ger<strong>in</strong>gere Lebenserwartung und damitauch e<strong>in</strong>e durchschnittlich kürzere Rentenbezugsdauerals die ger<strong>in</strong>ger belasteten Gruppen. Da sie imwahrsten S<strong>in</strong>ne des Wortes „weniger Zeit“ im Ruhestandhaben, ist ihr neues Rentenbewusstse<strong>in</strong> nichts an<strong>der</strong>es als<strong>der</strong> Versuch, nach <strong>der</strong> Erwerbsphase wie die meisten an<strong>der</strong>en,private Vorhaben realisieren zu können. Bei ungleichenArbeitsbed<strong>in</strong>gungen produzieren schematischeRentengrenzen somit erhebliche soziale Ungleichheiten,da die ger<strong>in</strong>ger qualifizierten und höher belasteten Arbeitskräftewegen ihrer ger<strong>in</strong>geren Lebenserwartung dieRenten <strong>der</strong> Höherqualifizierten und zumeist noch Besserverdienendensubventionieren (Myles 2002; Naegele2004a).Zwar hat nun mittlerweile die Politik die Überw<strong>in</strong>dung<strong>der</strong> Frührente e<strong>in</strong>geläutet, dennoch ist es <strong>in</strong>sgesamt fraglich,wie sich dies mit <strong>der</strong> immer noch weit verbreitetenVorruhestandsorientierung und den Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Arbeitswelt sowie den Lebenslagen, Lebensformen, Lebensentwürfenund Biografien <strong>der</strong> Menschen verträgt.Aktuelle Auswertungen des Alterssurveys zeigen, dasssich zum<strong>in</strong>dest die nachrückenden Kohorten älterer Arbeitnehmerauf e<strong>in</strong>e Heraufsetzung des Rentene<strong>in</strong>trittsalterse<strong>in</strong>zustellen beg<strong>in</strong>nen (Engstler 2004). Dort wurdeu.a. nach den Erwartungen und Plänen <strong>der</strong> Erwerbstätigenh<strong>in</strong>sichtlich des Ausstiegsalters aus <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 81 – Drucksache 16/2190gefragt. Es wurde deutlich, dass <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Erwerbstätigenab 40 Jahren, die planen, mit spätestens 60 Jahrenihre Erwerbstätigkeit zu beenden, zwischen den Jahren1996 und 2002 von 50 auf 35 Prozent gefallen ist. Allerd<strong>in</strong>gsnimmt <strong>der</strong>zeit angesichts <strong>der</strong> verän<strong>der</strong>ten Rahmenbed<strong>in</strong>gungendie Planungsunsicherheit h<strong>in</strong>sichtlich desgenauen Zeitpunkts des Austritts aus dem Erwerbslebenzu.Neuere VDR-Daten weisen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tendenz auf erste Verschiebungenim Rentenzugangsgeschehen h<strong>in</strong>. Erste Analysen<strong>der</strong> Rentenzugangsstruktur 2003 zeigen, dass dieAnhebung <strong>der</strong> Altersgrenzen und die E<strong>in</strong>führung von Abschlägenbei vielen Versicherten zu e<strong>in</strong>em (allerd<strong>in</strong>gs nurger<strong>in</strong>gfügig) späteren Beg<strong>in</strong>n des Altersrentenbezugs führen.Allerd<strong>in</strong>gs g<strong>in</strong>gen aber immer noch rund zwei Drittel<strong>der</strong> Versicherten vor <strong>der</strong> (neuen) Regelaltersgrenze von65 Jahren <strong>in</strong> Rente. Obwohl bereits von e<strong>in</strong>em „Vormarsch<strong>der</strong> Regelaltersrenten“ gesprochen wird (Büttner& Knuth 2004), ist es noch zu früh, von e<strong>in</strong>er „Trendwende“auszugehen, zumal aktuell noch demografischeund „Aufschiebe-Effekte“ wirksam s<strong>in</strong>d (Ruland 2004).Allerd<strong>in</strong>gs werden zunehmend Abschläge bei vorzeitigemRentenbeg<strong>in</strong>n <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung(GRV) wirksam. So hatten vom Rentenzugang <strong>der</strong>Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) imJahr 2004 42,6 Prozent <strong>der</strong> Altersrentner Abschläge h<strong>in</strong>zunehmen– sei es freiwillig o<strong>der</strong> erzwungen. Dies führteim Durchschnitt zu e<strong>in</strong>er Rentenm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung von gut10 Prozent (Kaldybajewa 2005).Ob die subjektive Bereitschaft <strong>zur</strong> Weiterarbeit überhauptund, wenn ja, <strong>in</strong> welchem Umfang durch rentenpolitischeVorgaben alle<strong>in</strong> zu bee<strong>in</strong>flussen se<strong>in</strong> wird, ist e<strong>in</strong>e offeneFrage. Folgende Gründe sprechen dafür, dass trotz erschwerterBed<strong>in</strong>gungen viele ältere Beschäftigte weiterh<strong>in</strong>vorzeitig aus dem Erwerbsleben aussteigen wollen:– Arbeit ist für viele Menschen nur e<strong>in</strong> – wenn auch e<strong>in</strong>zentraler – Bereich für die S<strong>in</strong>nerfüllung im Leben. Inden nachwachsenden <strong>Generation</strong>en haben sich dieWertorientierungen erweitert (Gleichzeitigkeit vonArbeits-, Familien- und Freizeitorientierung). Nach e<strong>in</strong>emlängeren Arbeitsleben mit se<strong>in</strong>en Zwängen, <strong>in</strong> denendie Realisierung an<strong>der</strong>er Lebenswünsche zu kurzkam, können sich dann die aktuellen Gewichte <strong>der</strong>Werte zu Gunsten <strong>der</strong> Freizeitorientierung verschieben.– Es gibt ökonomische Zwänge, die e<strong>in</strong>e Weiterarbeitauch im höheren Lebensalter erfor<strong>der</strong>lich machen.Gleichzeitig s<strong>in</strong>d durch steigende E<strong>in</strong>kommen undVermögen („Erbengeneration“) neue ökonomische„Freiheiten“ entstanden, da mit <strong>der</strong> wachsenden Frauenerwerbstätigkeit<strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Haushalte mit zweiE<strong>in</strong>kommen zunehmen wird. Dadurch erhöhen sichdie ökonomischen Handlungsspielräume, sodass auchRentenabschläge bei e<strong>in</strong>em früheren Austritt aus demErwerbsleben <strong>in</strong> Kauf genommen werden.– Individuelle Verrentungsentscheidungen erfolgen zunehmendim familiären o<strong>der</strong> partnerschaftlichen Kontextbzw. werden im Zusammenhang von Verän<strong>der</strong>ungen<strong>in</strong> den Biografien <strong>der</strong> Menschen vorgenommen.Die Konsequenzen entsprechen<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen(weniger K<strong>in</strong><strong>der</strong>, längere Ausbildungszeiten, Berufstätigkeitbei<strong>der</strong> Partner, Trennungen, Scheidungen, Elternpflege)s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>sichtlich des Themas „Arbeit imAlter“ noch gar nicht untersucht worden.– Möglicherweise werden nachrückende Geburtsjahrgängeälterer Arbeitnehmer, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die höherQualifizierten unter ihnen, auch höherwertige Anfor<strong>der</strong>ungenan Arbeits<strong>in</strong>halte, -bed<strong>in</strong>gungen und -belastungenstellen. Damit wird die Weiterarbeitsbereitschaftbezüglich <strong>der</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen voraussetzungsvoller.Offen ist die Reaktion im Falle nicht h<strong>in</strong>reichen<strong>der</strong>Realisierung.– Nach wie vor gibt es e<strong>in</strong> hohes Maß an krankheitsbed<strong>in</strong>gterund qualifikatorischer E<strong>in</strong>schränkung <strong>in</strong> <strong>der</strong>beruflichen Leistungsfähigkeit, sowie e<strong>in</strong> hohes Maßan krankheitsbed<strong>in</strong>gter vorzeitiger M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erwerbsfähigkeit.Für viele davon Betroffene bleibt <strong>der</strong>vorgezogene Berufsaustritt die e<strong>in</strong>zig realistische„Fluchtperspektive“ – selbst unter Inkaufnahme erheblicherf<strong>in</strong>anzieller E<strong>in</strong>bußen.– Schließlich bleibt die Frage, ob es überhaupt geeigneteArbeitsplätze <strong>in</strong> ausreichen<strong>der</strong> Zahl für Ältere gibt, diebis zum 65. Lebensjahr o<strong>der</strong> gar darüber h<strong>in</strong>aus arbeitenwollen o<strong>der</strong> müssen. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den neuenLän<strong>der</strong>n dürfte <strong>der</strong> eklatante Arbeitsplatzmangel denZuwachs <strong>der</strong> Beschäftigungsquoten Älterer bremsen.2.3 Erste Schlussfolgerungen undZielsetzungen2.3.1 Schlussfolgerungen aus <strong>der</strong><strong>Lage</strong>analyseDie Gruppe <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen ist nicht nur äußerstheterogen, son<strong>der</strong>n ihre Erwerbstätigkeit bzw. ihr vorzeitigerRuhestand hängen auch von e<strong>in</strong>er Vielzahl unterschiedlicherBed<strong>in</strong>gungen und Ereignisse <strong>in</strong> Lebensverläufenund Erwerbsbiografien ab. Politik sollte dahernicht flächendeckend auf alle älteren Erwerbspersonenzielen, son<strong>der</strong>n auf erkennbare Probleme möglichst präventivreagieren.In diesem S<strong>in</strong>ne lassen sich aus <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>analyse folgendeSchlussfolgerungen ziehen:– Auf Grund ihres Gesundheitszustandes werden nichtalle älteren Erwerbspersonen bis zum gesetzlichenRentenalter erwerbstätig se<strong>in</strong> können. Dies trifft <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>efür solche Beschäftigten zu, die auf Arbeitsplätzenmit hohen körperlichen und psychischenBelastungen tätig s<strong>in</strong>d, die nur e<strong>in</strong>e begrenzte Tätigkeitsdauerzulassen. Deshalb s<strong>in</strong>d differenzierte Optionennotwendig, die auch den vorzeitigen Ausstiegermöglichen.– Differenzierte vorzeitige Ausstiegsoptionen s<strong>in</strong>d z.B.auch für die älteren (häufig Langfrist-)Arbeitslosen erfor<strong>der</strong>lich,für die unter gegebenen Arbeitsmarktbed<strong>in</strong>gungene<strong>in</strong>e Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ung <strong>in</strong>s Erwerbsleben<strong>in</strong> kurz- wie vermutlich auch <strong>in</strong> mittelfristiger
Drucksache 16/2190 – 82 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodePerspektive wenig wahrsche<strong>in</strong>lich ist (Koller et al.2003).– Noch immer verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t das alterstypisch höhereKrankheitsrisiko maßgeblich die Chancen und Möglichkeitene<strong>in</strong>es Großteils <strong>der</strong> älteren Beschäftigten,auf ihren angestammten Arbeitsplätzen alt zu werden.Die empirischen Befunde zeigen dabei, dass es sichsowohl um e<strong>in</strong> „Karriererisiko“ als auch um e<strong>in</strong> „Berufsrisiko“handelt. Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und präventiverGesundheitsschutz s<strong>in</strong>d auch künftig e<strong>in</strong>ewichtige Voraussetzung für e<strong>in</strong>en längeren Verbleib <strong>in</strong><strong>der</strong> Arbeitswelt.– Zu den alten Ungleichheiten nach Arbeitsbed<strong>in</strong>gungenund Arbeitsbelastungen, Arbeitslosigkeit und arbeitsbed<strong>in</strong>gtenErkrankungsrisiken s<strong>in</strong>d neue Ungleichheitennach Qualifikation getreten. So haben sich <strong>in</strong> denletzten Jahrzehnten die Erwerbsverläufe nach demQualifikationsniveau ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong> entwickelt. Die Unterschiede<strong>in</strong> den Erwerbsverläufen verschärfen sichim Alter, da hier die Versäumnisse e<strong>in</strong>er präventivenWeiterbildungspolitik <strong>in</strong> früheren Lebensjahren sichtbarwerden. Außerdem wird es für Beschäftigte immerwichtiger, durch <strong>in</strong>formelles Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit dietechnologische und organisatorische Entwicklungnachzuvollziehen. Viele hatten speziell dazu <strong>in</strong> <strong>der</strong>Vergangenheit ke<strong>in</strong>e Gelegenheit. Wer das Pech hat,jahrelang <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weniger <strong>in</strong>novativen Betrieb gearbeitetzu haben, hat es schwer, nach e<strong>in</strong>em Arbeitsplatzverlustwie<strong>der</strong> den Anschluss zu f<strong>in</strong>den. Es gehtalso nicht alle<strong>in</strong>e um betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,son<strong>der</strong>n auch um die <strong>in</strong>novative Gestaltung <strong>der</strong>Arbeitsaufgaben und -umgebung.– Kaum beachtet ist das Gleichstellungsproblem. Dieniedrige Beschäftigungsquote <strong>der</strong> Frauen zwischen55 bis 64 Jahren <strong>in</strong> West-Deutschland ist im Unterschiedzu <strong>der</strong> <strong>der</strong> Männer weniger Folge <strong>der</strong> Vorruhestandspolitik,son<strong>der</strong>n vor allem Folge traditionellerErwerbsmuster von Frauen <strong>in</strong>folge un<strong>zur</strong>eichen<strong>der</strong>Gleichstellung <strong>der</strong> Frauen im Erwerbsleben sowie <strong>der</strong>Unvere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> den jüngerensowie Beruf und Pflege <strong>in</strong> den mittleren Lebensjahren.Die Erhöhung <strong>der</strong> Beschäftigungsquote <strong>der</strong>55- bis 64-jährigen Frauen erfor<strong>der</strong>t e<strong>in</strong>e Verbesserung<strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und Familienaufgaben sowiePflege und e<strong>in</strong>e Gleichstellungspolitik. Erst diesschafft die Möglichkeit, dass die Beschäftigungsquotejüngerer Geburtsjahrgänge ansteigt und diese Jahrgängedann <strong>in</strong> die Altersgruppe <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigenh<strong>in</strong>e<strong>in</strong>wachsen. Da e<strong>in</strong>e Gleichstellungspolitik<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Erwerbsorientierung jüngerer Frauenbee<strong>in</strong>flusst, s<strong>in</strong>d kurzfristige Effekte <strong>der</strong> neuen Programme<strong>zur</strong> Ganztagsschule und des Ausbaus <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungfür die höheren Altersgruppen nicht zuerwarten. Eher noch trifft dies auf Maßnahmen <strong>zur</strong>besseren Vere<strong>in</strong>barkeit von Erwerbstätigkeit undPflege zu. Überdies s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Ostdeutschland die Ausgangsbed<strong>in</strong>gungengünstiger. Die 55- bis 64-jährigenFrauen s<strong>in</strong>d bereits <strong>in</strong> hohem Maße „erwerbsorientiert“,da die Vere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und Familie seitlangem besser geregelt ist, sie scheitern aber bei <strong>der</strong>Arbeitsplatzsuche zumeist an dem ger<strong>in</strong>gen Arbeitsplatzangebot.– E<strong>in</strong> Blick auf die Motivationslage <strong>der</strong> Betriebe und<strong>der</strong> Beschäftigten zeigt, dass die Abkehr von <strong>der</strong>Ruhestandspolitik trotz deutlicher Signale aus demRentensystem noch nicht vollzogen ist. In vielen Betriebenwird gegenwärtig unter dem Stichwort „demografischeArbeitszeit“ an Nachfolgeregelungen zumbisherigen Vorruhestand gebastelt. Heute auf Lebensarbeitszeitkontenangesparte Mehrarbeit soll zum früherenAusscheiden aus dem Erwerbsleben genutztwerden. Diese Ambivalenzen betrieblicher Politikspiegeln sich <strong>in</strong> den Erwartungshaltungen <strong>der</strong> Beschäftigtenwi<strong>der</strong>. Gerade <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Land, <strong>in</strong> dem <strong>der</strong>Vorruhestand weit <strong>in</strong> die Gruppe <strong>der</strong> Personen mitmittlerer Qualifikation h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>reicht, von denen sicherlichviele ohne Gesundheits- und Qualifikationsproblemeweiter arbeiten könnten, s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>deutigeMotivationsän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> Richtung längerer Lebensarbeitszeitenauf Seiten <strong>der</strong> Betriebe und <strong>der</strong> Beschäftigtenfür e<strong>in</strong>en Strukturwandel erfor<strong>der</strong>lich.– Mit e<strong>in</strong>iger Ernüchterung ist festzustellen, dass dievon Gerontologen gefor<strong>der</strong>te Flexibilisierung desÜbergangs <strong>in</strong> den Ruhestand unter den gegenwärtigenBed<strong>in</strong>gungen we<strong>der</strong> von den Betrieben noch von denBeschäftigten <strong>in</strong> nennenswertem Ausmaß gewünschtwird. Es ist offen, ob sich dies än<strong>der</strong>n wird, wenn <strong>der</strong>Druck <strong>zur</strong> Verlängerung <strong>der</strong> Lebensarbeitszeit zunimmtund die Politik, wie zeitweise <strong>in</strong> Schweden mit<strong>der</strong> Teilrentenregelung, klare Angebote unterbreitet.Es ist zu vermuten, dass Verkürzungen <strong>der</strong> Arbeitszeitam Ende des Erwerbslebens am ehesten akzeptiertwerden, wenn die Betriebe und die Beschäftigten zuvorschon Erfahrungen mit flexiblen Erwerbsverläufengesammelt haben. Treibende Motive für die Verän<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> Arbeitszeit können Elternschaft, Pflegeund Weiterbildung se<strong>in</strong>, sodass die Erhöhung <strong>der</strong> Beschäftigungsquote<strong>der</strong> Frauen und e<strong>in</strong> Ausbau lebenslangenLernens zusätzlich die Chance bieten, auch dieÜbergänge <strong>in</strong> die Rente flexibler zu gestalten.– Bemerkenswert ist die ausgesprochen ger<strong>in</strong>ge Beschäftigungsquoteälterer Auslän<strong>der</strong>. Sie ist nicht nurFolge <strong>der</strong> hohen Konzentration von Auslän<strong>der</strong>n <strong>in</strong> gesundheitsbelastendenTätigkeiten und ihrer beson<strong>der</strong>enBetroffenheit durch den Abbau e<strong>in</strong>facher Tätigkeiten<strong>in</strong> <strong>der</strong> Industrie. H<strong>in</strong>zu kommt ihre außerordentlichger<strong>in</strong>ge Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, dienicht zuletzt durch un<strong>zur</strong>eichende Sprach-, Lese- undSchreibfähigkeiten e<strong>in</strong>geschränkt wird. In e<strong>in</strong>erDienstleistungsgesellschaft ist die Beschäftigungsfähigkeit<strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> <strong>in</strong> allen Altersgruppen viel stärkerals <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit an höhere Bildungsvoraussetzungengebunden. Auch e<strong>in</strong>fache Tätigkeitenerfor<strong>der</strong>n nicht mehr wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Industrieproduktionnur „Muskelkraft“, son<strong>der</strong>n wegen <strong>der</strong> Kundenkontakteund des kont<strong>in</strong>uierlichen Umgangs mit abstraktenSymbolen, gute Sprach-, Lese-, Rechen- undSchreibfähigkeiten.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 83 – Drucksache 16/2190– Überall <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>analyse begegnete man dem Tatbestand<strong>der</strong> Altersdiskrim<strong>in</strong>ierung, ob <strong>in</strong> offener o<strong>der</strong>eher verdeckter Form. Vor allem <strong>in</strong> größeren Betriebenstoßen Ältere an sichtbare und mehr noch unsichtbareAltersgrenzen bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellung, Entlassung,Weiterbildung und Beför<strong>der</strong>ung von Beschäftigten,die oft auf Vorurteilen und e<strong>in</strong>er systematischen Unterschätzungdes Erfahrungswissens Älterer beruhen.Diese Altersdiskrim<strong>in</strong>ierung muss zu Gunsten e<strong>in</strong>erBetrachtung des E<strong>in</strong>zelfalls bei Personalentscheidungenverän<strong>der</strong>t werden, wie wir dies heute zunehmendvor allem <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren und mittleren Betrieben beobachtenkönnen. Es wäre allerd<strong>in</strong>gs verkürzt, Vorurteilegegenüber Älteren lediglich <strong>in</strong> den Betrieben zu vermuten.Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Bil<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>er nachlassendenTatkraft und Innovationsfähigkeit, die unsere Gesellschaftvon Älteren hat, tief verankert.– Alle Maßnahmen <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> BeschäftigungsquoteÄlterer werden nur greifen, wenn die Wirtschaftwächst. E<strong>in</strong>e steigende Arbeitskräftenachfrage wirddie Motivationslage <strong>der</strong> Betriebe und <strong>der</strong> Beschäftigtenverän<strong>der</strong>n und über Arbeitskräfteengpässe auchQualifizierungsnotwendigkeiten erkennen lassen. Allerd<strong>in</strong>gsist selbst bei schwachem Wachstum e<strong>in</strong>eErhöhung <strong>der</strong> Beschäftigungsquote Älterer nichtzwangsläufig mit e<strong>in</strong>em Nachfragerückgang nach Jüngerenverbunden, ebenso wie e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong>Beschäftigungsquote <strong>der</strong> Frauen nicht zu e<strong>in</strong>em Rückgangbei den Männern führt. Denn die Mehrbeschäftigungbestimmter Gruppen löst zusätzlicheNachfrageeffekte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wirtschaft aus, sodass <strong>der</strong> Beschäftigungseffektpositiv se<strong>in</strong> kann.2.3.2 ZielsetzungenAngesichts <strong>der</strong> Alterung <strong>der</strong> Gesellschaft ist e<strong>in</strong>e Erhöhung<strong>der</strong> Beschäftigungsquote <strong>der</strong> über 55-Jährigen ausmehreren Gründen unumgänglich:– Erstens ist dies e<strong>in</strong> Beitrag <strong>zur</strong> Belastungsverteilungzwischen <strong>Generation</strong>en. Durch e<strong>in</strong>e längere ErwerbstätigkeitÄlterer ergeben sich positive Effekte für dieF<strong>in</strong>anzlage <strong>der</strong> Sozialversicherungsträger und <strong>der</strong> Beitragsbedarfreduziert sich. Die nachwachsenden <strong>Generation</strong>enwerden im Erwerbsalter ger<strong>in</strong>ger belastet.Dies verbessert nicht nur ihre Nettoe<strong>in</strong>kommen, son<strong>der</strong>ndurch die Entlastung des Faktors Arbeit auch ihreBeschäftigungschancen.– Zweitens sollen <strong>der</strong> erhebliche Wissens- und ErfahrungsschatzÄlterer gehoben werden, <strong>der</strong> heute weitgehendger<strong>in</strong>g bewertet wird und brach liegt. Die beson<strong>der</strong>enFähigkeiten können durch Jüngere nichte<strong>in</strong>fach ersetzt werden. Die größten Potenziale siehtdie Kommission <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verknüpfung <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>enFähigkeiten von Jüngeren und Älteren.– Drittens kann bei zunehmen<strong>der</strong> Lebensdauer e<strong>in</strong>e längereErwerbsphase e<strong>in</strong> wichtiges Element e<strong>in</strong>er erfülltenLebensgestaltung se<strong>in</strong>, die heute vielen durch dieDiskrim<strong>in</strong>ierung Älterer auf dem Arbeitsmarkt versagtwird.Mit dem Übergang <strong>zur</strong> Dienstleistungsgesellschaft, <strong>der</strong>Zunahme des Anteils höher qualifizierter Beschäftigterauf Arbeitsplätzen mit hohem Autonomiespielraum und<strong>der</strong> Nutzung des technischen Fortschritts <strong>zur</strong> ergonomischenVerbesserung vieler Arbeitsplätze, steigen dieMöglichkeiten, die Lebensarbeitszeit wie<strong>der</strong> auszudehnen.Das Weiterbestehen alter Belastungen (z.B. monotoneTätigkeiten, Nacht- und Schichtarbeit) und die Verbreitungneuer Belastungen – allen voran <strong>der</strong> wachsendeZeitdruck <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit – wirken jedoch eher <strong>in</strong> Richtungkürzerer Lebensarbeitszeiten (Bosch 1998, Bosch u.a.2002). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass mit wachsendemLebensalter die gesundheitlichen E<strong>in</strong>schränkungenzunehmen. Dies hat zum e<strong>in</strong>en die Konsequenz, dassauch <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Beschäftigten nicht bis zumgesetzlichen Rentenalter beschäftigt se<strong>in</strong> kann und e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>erTeil dies nur bei verr<strong>in</strong>gerter Belastung schaffenwird. Diese E<strong>in</strong>schränkungen s<strong>in</strong>d bei <strong>der</strong> Formulierungvon Zielvorgaben zu berücksichtigen.Auf <strong>der</strong> Basis dieser Grundsätze und <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>analyse ergebensich folgende Zielsetzungen:1. Die Beschäftigungsquote <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen sollerhöht werden. Hierzu wurde auf EU-Ebene bereitse<strong>in</strong> quantitatives Ziel gesetzt. Im März 2001 formulierte<strong>der</strong> Europäische Rat unter Zustimmung <strong>der</strong> Bundesregierung<strong>in</strong> Stockholm das Ziel, dass bis 2010m<strong>in</strong>destens die Hälfte <strong>der</strong> EU-Bevölkerung im Altervon 55 bis 64 Jahre beschäftigt se<strong>in</strong> soll.2. Zur Verr<strong>in</strong>gerung <strong>der</strong> Belastungen Älterer sollten dieÜbergänge <strong>in</strong> die Rente künftig sehr viel flexibler gestaltetse<strong>in</strong>. Selbst die wenigen bestehenden flexiblenÜbergangsregelungen wurden und werden (wie dieAltersteilzeit) entwe<strong>der</strong> als Möglichkeit <strong>der</strong> Frühverrentunggenutzt o<strong>der</strong> (wie die Teilrente) nichtangenommen. Im Kern geht die deutsche Altersgrenzengesetzgebungnoch immer von <strong>der</strong> Fiktion desklassischen männlichen Normalarbeitsverhältnissese<strong>in</strong>er lebenslangen Vollzeiterwerbskarriere aus. Gesundheits-und erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsbed<strong>in</strong>gte Abweichungenbleiben dabei ebenso „Fremdkörper“ wie z.B.familienbed<strong>in</strong>gte Unterbrechungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsarbeitauf Grund von familiären Pflegeverpflichtungen.Im Unterschied <strong>zur</strong> bisher dom<strong>in</strong>ierenden Praxis <strong>der</strong>Altersteilzeit, die über das Blockmodell zum vorzeitigenAusstieg aus dem Erwerbsleben genutzt wurde,muss es künftig um e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung <strong>der</strong> zeitlichenBelastungen durch Erwerbsarbeit im Zusammenhangmit e<strong>in</strong>er längeren Lebensarbeitszeit gehen.3. Personen auf Tätigkeiten mit begrenzter Beschäftigungsdauer,erwerbsgem<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Personen sowie älterenLangzeitarbeitslosen sollte auch weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>früherer Austritt aus dem Erwerbsleben möglich se<strong>in</strong>.Es wäre nicht nachvollziehbar, dass für bestimmte sicherheitsrelevantePersonengruppen, wie Fluglotsen,Piloten o<strong>der</strong> Feuerwehrleute, unabhängig vom <strong>in</strong>dividuellenGesundheitszustand, vorzeitige Ruhestandsmöglichkeitenoffen stehen, nicht aber für Beschäftigtengruppenmit ähnlichen hohen Arbeitsbelastungen <strong>in</strong>ihrem Erwerbsleben bzw. mit aussichtsloser Beschäf-
Drucksache 16/2190 – 84 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodetigungsperspektive. Im Unterschied zu den bisherigenFrühverrentungsregelungen müssen solche Austrittsmöglichkeitenaber an klare Kriterien gebunden werden.4. E<strong>in</strong>e generelle Heraufsetzung des abschlagfreien Rentenalters– wie vielfach vorgeschlagen wird – hält dieKommission aus mehreren Gründen nicht für zielführend.Erstens ist heute nur e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong><strong>der</strong>heit <strong>der</strong> Personenim Erwerbsalter bis zum 65. Lebensjahr beschäftigt.Alle<strong>in</strong> schon diese Quote zu erhöhen, erfor<strong>der</strong>terhebliche Anstrengungen und Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> vielenBereichen. Zweitens werden angesichts <strong>der</strong> hohenkörperlichen und gesundheitlichen Belastungen vieleBeschäftigte nicht bis zum 65. Lebensjahr o<strong>der</strong> gardarüber h<strong>in</strong>aus arbeiten können. Die Kommission hältes für s<strong>in</strong>nvoll, differenzierte Lösungen – auch unterBerücksichtigung erwerbsgem<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Personen – e<strong>in</strong>zuführen.2.4 Die bisherigen Reaktionen <strong>der</strong> Politikund <strong>der</strong> SozialpartnerDie Zahlen <strong>zur</strong> Beschäftigung und Arbeitslosigkeit Ältererspiegeln vor allem die Politik des Staates und <strong>der</strong> Sozialpartner<strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit wi<strong>der</strong>, die wirtschaftlichenStrukturbrüche <strong>in</strong> Ost- und Westdeutschland durchdas Ausscheiden Älterer aus dem Erwerbsleben zu bewältigen.Auf Grund <strong>der</strong> absehbaren demografischen Verschiebungsowie <strong>der</strong> staatlichen F<strong>in</strong>anzengpässe wurde <strong>in</strong>den letzten Jahren e<strong>in</strong> Politikwandel e<strong>in</strong>geleitet, <strong>der</strong> vorallem das Ziel hat, die Beschäftigungsquote Älterer zu erhöhen.Er bezieht sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auf die Begrenzung<strong>der</strong> Frühverrentung sowie die Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ung vonälteren Arbeitslosen. Viele <strong>der</strong> Maßnahmen s<strong>in</strong>d jedocherst seit kurzem <strong>in</strong> Kraft, sodass ihre Wirkungen auf demArbeitsmarkt noch nicht voll absehbar s<strong>in</strong>d.2.4.1 Die Reform <strong>der</strong> RentensystemeDie wichtigsten Verän<strong>der</strong>ungen <strong>zur</strong> Begrenzung <strong>der</strong> Frühverrentunghaben im Rentenrecht stattgefunden. Im H<strong>in</strong>blicku.a. auf die künftige demografische Entwicklungwurde – beg<strong>in</strong>nend mit dem Rentenreformgesetz von1992 – das Rentenalter stufenweise heraufgesetzt bzw.e<strong>in</strong> vorzeitiger Rentene<strong>in</strong>tritt mit Abschlägen belegt.Diese Verän<strong>der</strong>ungen s<strong>in</strong>d aus Gründen des Bestandsschutzesmit unterschiedlichen Übergangsfristen e<strong>in</strong>geführtworden. Die wichtigsten Än<strong>der</strong>ungen lassen sichwie folgt zusammenfassen:– Mit Ausnahme <strong>der</strong> Altersgrenze für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>tewird die abschlagfreie Rente bei allen an<strong>der</strong>en Rentnernab 65 Jahren möglich se<strong>in</strong>. 2006 ist die Heraufsetzungdieser Grenze für Renten nach Arbeitslosigkeitund Altersteilzeit (auf 65) bzw. Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te(63) abgeschlossen.– E<strong>in</strong> vorzeitiger Rentene<strong>in</strong>tritt ab dem 60. Lebensjahrist zwar zunächst nach Arbeitslosigkeit und Altersteilzeitweiterh<strong>in</strong> möglich – allerd<strong>in</strong>gs nur mit e<strong>in</strong>em Abschlagvon 3,6 Prozent pro Jahr (maximal 18,6 Prozent).Für langjährig Versicherte ist <strong>der</strong> Prozess bereitsabgeschlossen.– Bei den ab 2001 neu geregelten Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsrentenerfolgen gleichfalls Abschläge. Sie orientierensich an <strong>der</strong> frühestmöglichen Altersgrenze für Altersrenten(60 Jahre) und <strong>der</strong> oberen Grenze für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te(63 Jahre), betragen bei Rentenbeg<strong>in</strong>n ab2006 (o<strong>der</strong> später) maximal 10,8 Prozent.– Ende 2009 wird die Anhebung <strong>der</strong> abschlagfreien Altersgrenzefür Frauenaltersruhegel<strong>der</strong> auf 65 Jahre abgeschlossense<strong>in</strong>.– Durch das Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetzist zusätzlich e<strong>in</strong>e stufenweise Heraufsetzung <strong>der</strong> unterenAltersgrenze (also für den frühestmöglichen Bezuge<strong>in</strong>er Altersrente) für Rente nach Arbeitslosigkeitund Altersteilzeit von 60 auf 63 Jahre beschlossenworden.E<strong>in</strong> vorzeitiger Rentene<strong>in</strong>tritt ist zwar noch möglich,doch müssen nun Abschläge <strong>in</strong> Kauf genommen werden,durch die vorher bestehende Anreize zum früheren Ausscheidenreduziert werden sollen. Die Wirkungen auf denArbeitsmarkt hängen u.a. davon ab, wie diese f<strong>in</strong>anziellenAnreize wirken. Es ist e<strong>in</strong>erseits davon auszugehen, dassauch mit Abschlägen e<strong>in</strong> vorzeitiger Rentene<strong>in</strong>tritt fürnicht unbeträchtliche Gruppen, die sich f<strong>in</strong>anzielle Abschlägeleisten können, attraktiv bleibt. Dieses gilt ebenfallsfür Personen, denen <strong>der</strong> Verbleib auf dem Arbeitsmarktgegenüber <strong>der</strong> vorzeitigen Berentung e<strong>in</strong>eschlechtere Perspektive bietet. Insbeson<strong>der</strong>e mit <strong>der</strong> zunehmendenErwerbstätigkeit <strong>der</strong> Frauen wird die Zahl <strong>der</strong>Haushalte mit mehreren E<strong>in</strong>kommensquellen wachsen.Damit werden auch die Handlungsoptionen am Ende desErwerbslebens zunehmen.Allerd<strong>in</strong>gs verkennt die Kommission nicht, dass die zwischenzeitlichvollzogene gesetzliche Altersgrenzenanhebungke<strong>in</strong>eswegs automatisch auch e<strong>in</strong> Steigen <strong>der</strong> ErwerbsquotenÄlterer bedeutet. E<strong>in</strong>e von den realenBeschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen und -problemen <strong>der</strong> Betroffenenabgekoppelte Renten- und Altersgrenzenpolitik, dieke<strong>in</strong>e gleichzeitige „Unterfütterung“ durch parallel dazuerfolgende Maßnahmen <strong>der</strong> Beschäftigungssicherung und-för<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> den Betrieben und Verwaltungen sowie aufden Arbeitsmärkten f<strong>in</strong>det, hat mit se<strong>in</strong>en nur begrenztenAnreizwirkungen als isoliertes Politikkonzept nur ger<strong>in</strong>geErfolgsaussichten. Damit lässt sich zwar <strong>der</strong> Rentenbezugszeitpunktnach oben korrigieren, nicht aber gleichzeitigauch die Erwerbsbeteiligung.An<strong>der</strong>erseits wird durch die Senkung des Rentenniveaus<strong>der</strong> Kreis <strong>der</strong> Personen größer, die aus f<strong>in</strong>anziellen Gründenlänger arbeiten müssen. Durch die neue Rentenformel,die ab 2001 im Rahmen <strong>der</strong> Rentenstrukturreform <strong>in</strong>Kraft trat und durch e<strong>in</strong>en Nachhaltigkeitsfaktor des Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetzesvon 2004 ergänztwurde, wird das Rentenniveau <strong>in</strong> den nächsten Jahrenspürbar reduziert. Die Rentenanpassung folgt zwar<strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Lohnentwicklung; allerd<strong>in</strong>gs wird nebendem Beitrag <strong>zur</strong> gesetzlichen Rentenversicherung (GRV)auch <strong>der</strong> staatlich geför<strong>der</strong>te maximal mögliche Eigenbei-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 85 – Drucksache 16/2190trag zu e<strong>in</strong>er privaten Altersvorsorge (die so genannteRiester-Rente) als Belastung <strong>der</strong> Arbeitnehmer e<strong>in</strong>gerechnetund verm<strong>in</strong><strong>der</strong>t die für die Anpassung maßgebendeLohngröße, und zwar unabhängig davon ob e<strong>in</strong> Eigenbeitragtatsächlich geleistet wird o<strong>der</strong> nicht bzw. <strong>in</strong>welcher Höhe. Außerdem wirkt e<strong>in</strong> Nachhaltigkeitsfaktor,<strong>der</strong> u.a. an Verän<strong>der</strong>ungen des „Rentnerquotienten“(Zahl <strong>der</strong> Rentner <strong>zur</strong> Zahl <strong>der</strong> Beitragspflichtigen) anknüpft,anpassungsm<strong>in</strong><strong>der</strong>nd. Insgesamt reduziert sich– wenngleich stufenweise – das Leistungsniveau <strong>der</strong>GRV um rund e<strong>in</strong> Viertel (siehe Kapitel E<strong>in</strong>kommenslageim Alter und künftige Entwicklung). Dabei ist zu berücksichtigen,dass es neben dem Leistungsniveau <strong>der</strong> GRVdarauf ankommt, welche Ansprüche e<strong>in</strong> Versicherter erwirbt.Hierauf wirken viele weitere Faktoren e<strong>in</strong>, wie dieSituation auf dem Arbeitsmarkt, die Bewertung von Zeiten<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit etc.Optionen für e<strong>in</strong>en früheren Ausstieg eröffnet noch dasAltersteilzeitgesetz von 1996, das allerd<strong>in</strong>gs ebenfalls begrenztist, und zwar vorerst bis 2009.Danach wird e<strong>in</strong>e Arbeitszeitverr<strong>in</strong>gerung e<strong>in</strong>es älterenVollzeitbeschäftigten (ab 55 Jahre) auf die Hälfte <strong>der</strong> bisherigenArbeitszeit vor Bezug <strong>der</strong> Rente von <strong>der</strong> Bundesanstaltfür Arbeit geför<strong>der</strong>t, wenn dadurch die E<strong>in</strong>stellunge<strong>in</strong>es Arbeitslosen bzw. die Übernahme e<strong>in</strong>es Auszubildendenmöglich wird. E<strong>in</strong> Arbeitgeber erhält für diesenFall für längstens 6 Jahre 20 Prozent des Altersteilzeite<strong>in</strong>kommenssowie die Aufstockung des Rentenversicherungsbeitragsauf 90 Prozent erstattet, vorausgesetzt, erbeschäftigt e<strong>in</strong>e/n Ältere/n <strong>in</strong> Altersteilzeit (50 ProzentVollzeit), zahlt ihm e<strong>in</strong> (Netto-)E<strong>in</strong>kommen von m<strong>in</strong>destens70 Prozent und e<strong>in</strong>en Rentenbeitrag bezogen auf90 Prozent des Vollzeite<strong>in</strong>kommens. Durch tarifvertraglicheZusatzregelungen f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis zumeist Aufstockungendieser Beträge statt. Im Jahre 2004 wurdenvon <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit 79.632 (gegenüber69.673 <strong>in</strong> 2003) Personen <strong>in</strong> Altersteilzeit geför<strong>der</strong>t(+ 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr) (Bundesagenturfür Arbeit 2005a).2.4.2 Reformen <strong>der</strong> ArbeitsmarktpolitikDie bisherigen Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitikzielen zum e<strong>in</strong>en darauf, die über Beitrags- und Steuermittelf<strong>in</strong>anzierten Überbrückungsphasen bis zum Vorruhestandzu verkürzen und unattraktiver zu gestalten undzum an<strong>der</strong>en, die Integrationschancen älterer Arbeitsloser<strong>in</strong> den Arbeitsmarkt zu verbessern.In <strong>der</strong> Vergangenheit wurde die Dauer des Anspruchs aufArbeitslosengeld für Ältere mehrfach ausgedehnt. Währende<strong>in</strong> 44-Jähriger maximal 12 Monate Arbeitslosengeldbeziehen konnte, wurde die maximale Bezugsdauerschrittweise bis zum 57. Lebensjahr auf 32 Monate erhöht.Gleichzeitig konnte bei betrieblichen Personalanpassungsmaßnahmen<strong>zur</strong> Vermeidung von Entlassungenbis zu zwei Jahren Strukturkurzarbeitergeld bezogen werden.Dies ermöglichte Überbrückungsperioden von fast5 Jahren bis zum Bezug des vorgezogenen Altersgeldes.Mit dem Hartz-IV-Gesetz wurde die Dauer des maximalenArbeitslosengeldanspruchs deutlich gekürzt. Die maximaleBezugsdauer von Arbeitslosengeld liegt ab dem1.2.2006 künftig für 55-Jährige bei 18 Monaten. Allerd<strong>in</strong>gsgelten Vertrauensschutzregelungen. E<strong>in</strong> Gesetzentwurf,diese Regelung angesichts <strong>der</strong> hohen Arbeitslosigkeitzwei Jahre später wirksam werden zu lassen, wurdeim Juli 2005 <strong>in</strong> den Vermittlungsausschuss überwiesen.Ab dem 01.01.2005 wurde die maximale Dauer des Bezugsauf Strukturkurzarbeitergeld auf e<strong>in</strong> Jahr verr<strong>in</strong>gert.Gleichzeitig wurde mit Hartz IV das Arbeitslosengeld IIauf das Niveau <strong>der</strong> Sozialhilfe gesenkt. Dies ist geradebei zuvor gut verdienenden Beschäftigten mit erheblichenE<strong>in</strong>bußen verbunden. Insgesamt verteuern sich damit diebisherigen Sozialpläne <strong>der</strong> Unternehmen erheblich o<strong>der</strong>sie werden auf Grund zu hoher E<strong>in</strong>kommense<strong>in</strong>bußen fürdie Beschäftigten unattraktiv.Parallel zu den E<strong>in</strong>schränkungen bei <strong>der</strong> Bezugsdauer desArbeitslosen- und Strukturkurzarbeitergelds wurden folgendeneue Maßnahmen <strong>zur</strong> Erleichterung <strong>der</strong> Integrationälterer Arbeitsloser e<strong>in</strong>geführt, die allesamt bis zum1.1.2006 befristet s<strong>in</strong>d (Ausnahme: E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungszuschuss,befristet bis zum 31.12.2009; Ausnahme: Entgeltsicherung,nach dem 1.1.2006 können bei erneuter Antragstellungdie Leistungen längstens bis zum 31.08.2008bezogen werden):– E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungszuschuss: Arbeitgeber, die ältere Arbeitnehmerab dem 50. Lebensjahr e<strong>in</strong>stellen, könnenLohnkostenzuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten.Bis zum 31.12.2009 besteht die Möglichkeit e<strong>in</strong>er degressivenFör<strong>der</strong>ung mit e<strong>in</strong>er För<strong>der</strong>dauer von bis zu36 Monaten.– För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Weiterbildung: In kle<strong>in</strong>en und mittlerenUnternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten wirddie Qualifizierung von Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmernab dem 50. Lebensjahr durch Übernahme<strong>der</strong> Weiterbildungskosten von <strong>der</strong> Bundesagentur fürArbeit geför<strong>der</strong>t, wenn <strong>der</strong> Arbeitgeber das Arbeitsentgeltfortzahlt.– Entgeltsicherung: Ältere Arbeitnehmer ab Vollendungdes 50. Lebensjahres, die e<strong>in</strong>e im Vergleich zu ihremvorherigen Verdienst niedriger entlohnte Beschäftigungaufnehmen, erhalten e<strong>in</strong>en Zuschuss <strong>in</strong> Höhevon 50 Prozent <strong>der</strong> Entgeltdifferenz zwischen demletzten und dem neuen pauschalierten Nettoentgelt.Der Zuschuss wird allerd<strong>in</strong>gs nur noch gezahlt, solangedie Arbeitslosen noch e<strong>in</strong>en Anspruch auf180 Tage Arbeitslosengeld haben.– Befreiung des Arbeitgebers vom Beitragsanteil <strong>zur</strong> Arbeitsför<strong>der</strong>ung:Arbeitgeber, die e<strong>in</strong>en Arbeitnehmere<strong>in</strong>stellen, <strong>der</strong> das 55. Lebensjahr vollendet hat, werdenvon <strong>der</strong> Pflicht <strong>zur</strong> Zahlung des Arbeitslosenversicherungsbeitragsbefreit. Für den Arbeitnehmer bleibt<strong>der</strong> volle Schutz <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitslosenversicherung gewahrt.– Erleichterte Befristung von Arbeitsverhältnissen: MitArbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet
Drucksache 16/2190 – 86 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodehaben, können befristete Arbeitsverträge mit o<strong>der</strong>ohne sachlichen Grund und ohne Beschränkung <strong>der</strong>Höchstdauer abgeschlossen werden.Die E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungszuschüsse für Ältere werden <strong>in</strong> hohemMaße <strong>in</strong> Anspruch genommen, während die an<strong>der</strong>en Instrumentekaum genutzt werden. So wurde 2004 zumBeispiel <strong>in</strong> nur 1.469 Fällen die berufliche WeiterbildungÄlterer (m<strong>in</strong>d. 50 Jahre) <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>- und Mittelbetrieben(nicht mehr als 100 Arbeitnehmer) geför<strong>der</strong>t, bei <strong>der</strong> Entgeltsicherunggab es nur 4.596 Fälle und nur ca. 5.970Arbeitgeber wurden bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellung Älterer (55- bis64-Jähriger) von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen befreit(Bundesagentur für Arbeit 2005a). Weiterh<strong>in</strong> s<strong>in</strong>dtrotz <strong>der</strong> Gesetzesän<strong>der</strong>ung weitaus weniger Ältere alsJüngere befristet beschäftigt (OECD 2005). Die Gründefür die ger<strong>in</strong>ge Inanspruchnahme dieser Instrumente lassensich wie folgt zusammenfassen: Erstens s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>igeInstrumente bei den Unternehmen und Arbeitslosen kaumbekannt, zweitens vermarktet die Bundesagentur für Arbeitangesichts ihrer hohen Belastung und <strong>der</strong> Vielfalt <strong>der</strong>neuen Instrumente nur e<strong>in</strong>ige Instrumente aktiv, und drittenskann man die f<strong>in</strong>anziellen Zuschüsse an die Arbeitgeberüber die E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungszuschüsse so flexibel gestalten,dass an<strong>der</strong>e Instrumente überflüssig werden. Dieger<strong>in</strong>ge Befristungsrate Älterer ist vor allem Folge <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>genE<strong>in</strong>stellungsquoten bei dieser Gruppe.2.4.3 TarifpolitikDie Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Entlohnung und Beschäftigungälterer Arbeitnehmer werden im deutschenSystem <strong>der</strong> <strong>in</strong>dustriellen Beziehungen mit se<strong>in</strong>er Tarifautonomieweitgehend über Tarifverträge geregelt, die dannwie<strong>der</strong>um <strong>in</strong> Betriebsvere<strong>in</strong>barungen konkretisiert undweiterentwickelt werden. Aktuelle Untersuchungen zuden Regelungs<strong>in</strong>halten von Betriebsvere<strong>in</strong>barungen liegennicht vor. E<strong>in</strong>e eigens für die 5. Altenberichtskommissiondurchgeführte Analyse deutscher Tarifverträgeergab, dass viele Vere<strong>in</strong>barungen im H<strong>in</strong>blick auf das Lebensalterdirekt o<strong>der</strong> <strong>in</strong>direkt an <strong>der</strong> Betriebszugehörigkeitansetzen. Im E<strong>in</strong>zelnen ergab die Son<strong>der</strong>auswertungfolgende Ergebnisse (Bisp<strong>in</strong>ck &WSI-Tarifarchiv 2004):– Senioritätsentlohnung: E<strong>in</strong>en direkten Altersbezug<strong>der</strong> Entlohnung f<strong>in</strong>det man <strong>in</strong> <strong>der</strong> privaten Wirtschaftnur bei Angestellten und meist auch nur bis zum28. Lebensjahr. Im öffentlichen Dienst h<strong>in</strong>gegen werdendie Entgelte von Arbeitern und Angestellten mitsteigendem Alter alle zwei Jahre angepasst (maximalbis zum 45. Lebensjahr). Hier führt die senioritätsbezogeneEntlohnung zu so starken Lohn- und Gehaltsdifferenzenzwischen Jüngeren und Älteren, dass Älterekaum noch E<strong>in</strong>stellungschancen haben.– Kündigungsschutz: Der gesetzliche Kündigungsschutzknüpft an die Betriebszugehörigkeit an. Mitzunehmen<strong>der</strong> Betriebszugehörigkeit steigt die Kündigungsfristvon e<strong>in</strong>em Monat (2 Jahre Betriebszugehörigkeit)auf sieben Monate (bei 20 Jahren Betriebszugehörigkeit).Diese gesetzlichen Regelungen könnendurch Tarifverträge geän<strong>der</strong>t werden. In manchen Tarifverträgenwird die Kündigungsfrist verkürzt (z.B.Chemische Industrie maximale Kündigungsfrist 6 Monate);<strong>in</strong> an<strong>der</strong>en werden zusätzliche Stufen o<strong>der</strong>Komb<strong>in</strong>ationen von Lebensalter und Betriebszugehörigkeite<strong>in</strong>geführt. In e<strong>in</strong>igen Tarifbereichen wurde e<strong>in</strong>Kündigungsschutz für Ältere vere<strong>in</strong>bart. So kann <strong>in</strong><strong>der</strong> Metall<strong>in</strong>dustrie Nordwürttemberg/Nordbaden ke<strong>in</strong>emBeschäftigten ab 53 Jahren mit e<strong>in</strong>er Betriebszugehörigkeitvon 3 Jahren e<strong>in</strong>e ordentliche Kündigungmehr ausgesprochen werden. Durch die tariflichen Bestimmungenist <strong>in</strong>sgesamt <strong>der</strong> Bestandsschutz für ältereBeschäftigte mit langer Betriebszugehörigkeitausgebaut worden.– Entgeltsicherung: In vielen Tarifverträgen f<strong>in</strong>det manVerdienstsicherungen für Ältere (z.B. Bankgewerbe,Metall<strong>in</strong>dustrie, E<strong>in</strong>zelhandel). Dadurch werden ältereBeschäftigte bei Versetzungen o<strong>der</strong> Umgestaltung ihrerArbeitsplätze dauerhaft o<strong>der</strong> für Übergangszeitengegen Verdienstverluste geschützt. Bei Arbeitsplatzverlustwerden sie durch beson<strong>der</strong>e Abf<strong>in</strong>dungsregelungenbeson<strong>der</strong>s entschädigt.– Arbeitszeit: In e<strong>in</strong>igen Tarifbereichen s<strong>in</strong>d für Ältere,teils <strong>in</strong> Abhängigkeit von belasten<strong>der</strong> Arbeit, kürzereArbeitszeiten vere<strong>in</strong>bart worden. In <strong>der</strong> chemischenIndustrie wird die Wochenarbeitszeit <strong>der</strong> über 57-Jährigenum 2,5 Stunden abgesenkt. In mehreren Tarifbereichenwerden zusätzlich freie Tage pro Jahr gewährt(Energiewirtschaft NRW 3 bis 4 zusätzliche freie Tagebei m<strong>in</strong>destens 40 Nachtschichten im Vorjahr). Neuerd<strong>in</strong>gswurde vere<strong>in</strong>bart, dass für Ältere Langzeitkontene<strong>in</strong>gerichtet werden, auf dem Arbeitszeit <strong>zur</strong> späterenArbeitszeitverkürzung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em vorzeitigenÜbergang <strong>in</strong> den Ruhestand gespart werden kann (<strong>in</strong><strong>der</strong> Stahl<strong>in</strong>dustrie können z.B. bis zu 15 Prozent desJahrese<strong>in</strong>kommens gespart werden, ab 45 Jahre sogar20 Prozent).– Arbeitsorganisation/Arbeitssicherheit: Auf die oftverr<strong>in</strong>gerte Leistungsfähigkeit Älterer ist unterschiedlichreagiert worden. Zum Teil versucht man die Arbeitsbed<strong>in</strong>gungenpräventiv so zu gestalten, dass siebis zum Erreichen des normalen Rentenalters ausgeübtwerden können. Dieser Grundsatz ist vor allem beiden leistungsbezogenen Entgelten (z.B. Akkord) festgeschrieben.So heißt es im Manteltarifvertrag für dieArbeiter <strong>der</strong> Textil<strong>in</strong>dustrie Baden-Württemberg: „AlsNormalleistung gilt jene menschliche Leistung, dievon e<strong>in</strong>em geeigneten, e<strong>in</strong>gearbeiteten und geübtenArbeitnehmer auf Dauer erreicht werden kann, ohnedas Gesundheitsschäden e<strong>in</strong>treten“. In an<strong>der</strong>en Tarifverträgenwerden Ältere vor bestimmten Belastungengeschützt. In den deutschen Seehafenbetrieben s<strong>in</strong>dz.B. über 55-Jährige von <strong>der</strong> Nachtschicht befreit. Bei<strong>der</strong> Deutschen Post AG und <strong>der</strong> Deutschen TelekomAG erfolgt bei Bildschirmarbeit alle 5 Jahre e<strong>in</strong>e Untersuchung;ab 45 Jahren (Deutsche Telekom ab40 Jahren) jedoch alle drei Jahre. Fluglotsen könnenmit 55 Jahren <strong>in</strong> den Ruhestand gehen.– Qualifizierung: Zur Weiterbildung Älterer f<strong>in</strong>densich nur wenige Regelungen. Bei <strong>der</strong> Deutschen Telekomund im öffentlichen Dienst haben über 55-Jährige
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 87 – Drucksache 16/2190das Recht, Qualifizierungsmaßnahmen abzulehnen.Im Qualifizierungsvertrag <strong>der</strong> IG Metall Nordwürttemberg/Nordbadenwurde e<strong>in</strong> Anspruch aller Beschäftigtenauf e<strong>in</strong> regelmäßiges Gespräch mit demArbeitgeber über den Qualifizierungsbedarf vere<strong>in</strong>bart.Dabei heißt es: „Soweit erfor<strong>der</strong>lich wird imRahmen <strong>der</strong> Gespräche bei älteren Beschäftigten beson<strong>der</strong>sauf <strong>der</strong>en Basiswissen im eigenen Aufgabengebiete<strong>in</strong>gegangen. Ziel ist, <strong>der</strong>en Qualifikationen aufdem jeweils erfor<strong>der</strong>lichen Stand für ihre Aufgabenerledigungzu halten“.Die Bewertung dieser auf Ältere bezogenen Maßnahmen<strong>der</strong> Tarifpolitik ist durchaus kontrovers. Im Zentrum <strong>der</strong>Debatte stehen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Regelungen, die sich aufden Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses beziehen(Kündigungsfristen und beson<strong>der</strong>er Kündigungsschutz)sowie die Frage nach Vergütungsstrukturen bzw. <strong>der</strong> Verdienstsicherung.Vor allem von den Arbeitgeberorganisationen wird dieAuffassung vertreten, dass das dichte Regelwerk gesetzlicherund tariflicher Schutzbestimmungen e<strong>in</strong>er positivenBeschäftigungsentwicklung Älterer im Wege stehe. Zu rigideKündigungsschutzbestimmungen, Bestandssicherungfür Ältere sowie überhaupt e<strong>in</strong> ausgeprägtes Senioritätspr<strong>in</strong>zip<strong>in</strong> den tariflichen Bestimmungen werden alsfür Ältere kontraproduktiv und beschäftigungsfe<strong>in</strong>dlichangesehen. Vor allem die verme<strong>in</strong>tlich zu hohen senioritätsbezogenenPersonalkosten gelten als ganz wesentlichesE<strong>in</strong>stellungshemmnis. Diese Argumentation folgtdamit <strong>der</strong> generellen For<strong>der</strong>ung nach e<strong>in</strong>er stärkeren Deregulierungdes Arbeitsmarktes und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e nachAbbau <strong>der</strong> lohnbezogenen Senioritätsregelungen (zuletztBundesvere<strong>in</strong>igung <strong>der</strong> Deutschen Arbeitgeberverbände2002).Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite sehen vor allem die Gewerkschaftendie Schutzbestimmungen angesichts <strong>der</strong> spezifischenRisikolage älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmerals unabd<strong>in</strong>gbar an. Ohne diese, so die Argumentation,wären die konkreten Beschäftigungsprobleme Älterernoch sehr viel größer und für die Betroffenen <strong>in</strong> ihrenWirkungen noch e<strong>in</strong>schneiden<strong>der</strong>, gäbe es z.B. noch mehrältere Arbeitslose und wären die Absicherungsbed<strong>in</strong>gungenbei Frühverrentungsregelungen materiell sehr vielungünstiger. In <strong>der</strong> Konsequenz wird e<strong>in</strong> weiterer Ausbau<strong>der</strong> tariflichen Regelungen <strong>zur</strong> Gestaltung <strong>der</strong> ArbeitsundLeistungsbed<strong>in</strong>gungen gefor<strong>der</strong>t, um auf diese Weisefür die Betroffenen weitere Verschlechterungen zu vermeidenund solche lern- und gesundheitsför<strong>der</strong>lichen Arbeitsbed<strong>in</strong>gungenzu schaffen, die e<strong>in</strong>en längeren Verbleibim Erwerbsleben ermöglichen.Diese Kontroverse kann zum Teil durch empirische Untersuchungenentschärft werden. So konnte durch dieSon<strong>der</strong>auswertung <strong>der</strong> Tarifverträge gezeigt werden, dass– entgegen e<strong>in</strong>er weit verbreiteten Annahme – <strong>in</strong> <strong>der</strong> Privatwirtschaftdie senioritätsbezogene Entlohnung wenigerstark verbreitet ist als behauptet. Senioritätsentlohnungenwie im öffentlichen Dienst s<strong>in</strong>d hier eher dieAusnahme. Die OECD hat E<strong>in</strong>kommensdaten aus <strong>der</strong> Beschäftigtenstichprobe<strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit ausgewertetund ist zu dem selben Schluss gekommen (Abbildung18). Im öffentlichen Dienst s<strong>in</strong>d mittlerweile mitdem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen DienstMonatsverdienst <strong>in</strong> Deutschland nach Ausbildung und Geschlecht, 2002 (Vollzeitbeschäftigte)Abbildung 18Quelle: OECD 2005.
Drucksache 16/2190 – 88 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode(TVöD 8 ) E<strong>in</strong>schränkungen bis Aufhebungen im Senioritätspr<strong>in</strong>zipbeschlossen.Unmittelbar an <strong>der</strong> Entlohnung ansetzende Senioritätsregelungenf<strong>in</strong>det man allerd<strong>in</strong>gs vergleichsweise häufig imBereich e<strong>in</strong>zelbetrieblicher Regelungen, und zwar vor allemim außertariflichen Bereich – also bei den höherenAngestellten. Mit an<strong>der</strong>en Worten: Die Kritik an <strong>der</strong> Senioritätsentlohnungund se<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>stellungshemmendenWirkungen zielt tendenziell weitgehend an den tariflichenRegelungen vorbei. Sie hat allerd<strong>in</strong>gs Relevanz für dieEntlohnung außertariflich bezahlter Angestellter, dienicht Gegenstand von Tarifverhandlungen s<strong>in</strong>d.2.4.4 Betriebsbezogene Aktivitäten2.4.4.1 För<strong>der</strong>- und ModellprogrammeAuf die verantwortliche Rolle <strong>der</strong> Betriebe und die entsprechendenbetrieblichen Akteure zielen verschiedeneFör<strong>der</strong>- und Modellprogramme, im Wesentlichen angestoßendurch staatliche sowie durch Initiativen von Stiftungen(wie Hans-Böckler-Stiftung o<strong>der</strong> Bertelsmann-Stiftung). Sie richten sich allerd<strong>in</strong>gs nur teilweise unmittelbarauf die Beschäftigungsför<strong>der</strong>ung für alternde bzw.ältere Arbeitnehmer, greifen diese jedoch stets explizitmit auf. Sie alle haben ihren Ursprung mehr o<strong>der</strong> wenigerdirekt <strong>in</strong> den vorliegenden demografischen Prognosen,<strong>der</strong> gewandelten E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> die Bedeutung des „ProduktivfaktorsHumankapital“ e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> Gesundheitsrisikenund <strong>der</strong> Qualifikationsdimensionen o<strong>der</strong> lassensich als Reaktionen <strong>der</strong> Politik auf die EU-beschäftigungspolitischenVorgaben <strong>in</strong>terpretieren. H<strong>in</strong>zu kommenE<strong>in</strong>zel-Initiativen von Betrieben mit e<strong>in</strong>er bemerkenswertendemografieorientierten Personalplanung und Beschäftigungspolitik(so z.B. Fahrion, Daimler-Benz AG, dieKölner Ford Werke).8 In <strong>der</strong> neuen Struktur des Tarifvertrages Öffentlicher Dienst (TVöD)wird die nicht mehr zeitgemäße Unterscheidung <strong>in</strong> Angestellte, Arbeiter<strong>in</strong>nenund Arbeiter aufgegeben und die Zahl <strong>der</strong> altersabhängigenLohnstufen von 12 auf sechs verr<strong>in</strong>gert. Ab dem 01. Oktober2005 werden die Beschäftigten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e neue Entgelttabelle TVöDübergeleitet, nach <strong>der</strong> es nur noch 15 Entgeltgruppen gibt mit jeweilse<strong>in</strong>em Grundentgelt mit zwei Stufen sowie vier weiteren Entwicklungsstufen,die nach 3, 6, 10 bzw. 15 Jahren erreicht werden. DieZeit <strong>der</strong> Entwicklungsstufen kann durch leistungsabhängige Stufenaufstiegeverkürzt werden. Allgeme<strong>in</strong>e Zulage sowie Orts- und Sozialzuschläge(bis auf k<strong>in</strong><strong>der</strong>bezogene Zuschläge für bis zum31.12.2005 geborene K<strong>in</strong><strong>der</strong>) entfallen. Zusätzlich sollen ab 2007 biszu acht Prozent <strong>der</strong> Entgeltsumme <strong>der</strong> Tarifbeschäftigten e<strong>in</strong>es Arbeitsgebersfür variable Leistungsbezahlung <strong>zur</strong> Verfügung stehen,welche neben das Monatsentgelt tritt. Somit erfolgt die Bezahlungzukünftig nicht mehr nach Lebensalter, Familienstand und K<strong>in</strong><strong>der</strong>zahl,son<strong>der</strong>n nach <strong>in</strong>dividueller Leistung und Berufserfahrung.All diesen Programmen, Maßnahmen und Projekten geme<strong>in</strong>samist, dass sie auf e<strong>in</strong>e bessere Integration ältererBeschäftigter <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt und dabei wesentlich aufdie För<strong>der</strong>ung ihrer Beschäftigungsfähigkeit durch starkbetriebsbezogene Maßnahmen zielen. Geme<strong>in</strong>sam istihnen allerd<strong>in</strong>gs auch, dass sie damit bislang noch nichtwesentlich über das Stadium von „Modellprojekten“,„Modellprogrammen“, „Leuchtturm<strong>in</strong>itiativen“ etc. h<strong>in</strong>ausgelangts<strong>in</strong>d, d.h. noch ke<strong>in</strong>e flächendeckende Breitenwirkunghaben entfalten und <strong>in</strong>folgedessen noch nichtmerklich auf die betriebliche Beschäftigungspraxis mitälteren Arbeitnehmern e<strong>in</strong>wirken können. So stellt z.B.<strong>der</strong> jüngste „Altersübergangs-Report“ (2005-02) <strong>in</strong> Interpretationdes IAB-Betriebspanels von 2002 (Brussig2005) fest, dass die meisten bundesdeutschen Betriebebislang ke<strong>in</strong>e „altersspezifischen Personalstrategien“ verfolgenund dass Altersstrukturen für sie „nur <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen“e<strong>in</strong> Gestaltungsfeld bilden. Auch gilt, dass rund40 Prozent aller bundesdeutschen Betriebe, vornehmlichaus dem Bereich <strong>der</strong> Kle<strong>in</strong>- und Mittelbetriebe, überhauptke<strong>in</strong>e Älteren beschäftigen.E<strong>in</strong>e Sichtung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Projekte und Maßnahmenlässt die nachstehend behandelten zentralen betrieblichenGestaltungsfel<strong>der</strong> erkennen, ohne dass hier allerd<strong>in</strong>gs aufe<strong>in</strong>zelne Beispiele e<strong>in</strong>gegangen werden kann.2.4.4.2 Betriebliche Gesundheitspolitik und-för<strong>der</strong>ungBetriebliche Gesundheitspolitik umfasst alle Strategien,<strong>in</strong> die Humanressourcen unserer Wirtschaft zu <strong>in</strong>vestieren.Sie zielt darauf ab, die Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeitergesund und leistungsfähig zu erhalten. Dazu gehörenStrategien des Arbeits- und Gesundheitsschutzesebenso wie die den Arbeitsschutz ergänzenden Maßnahmen<strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung. Ziel ist die Verr<strong>in</strong>gerungbzw. Vermeidung gesundheitsgefährden<strong>der</strong> bzw. risikobehafteterArbeitsanfor<strong>der</strong>ungen. Mit Blick auf ältere Beschäftigtes<strong>in</strong>d vor allem zwei Perspektiven bedeutsam.– Zum e<strong>in</strong>en geht es um die Sicherung <strong>der</strong> Beschäftigungbereits gesundheitlich e<strong>in</strong>geschränkter und/o<strong>der</strong>leistungsgem<strong>in</strong><strong>der</strong>ter älterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen undArbeitnehmer, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e durch so genannte alterns-und beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tengerechte Arbeitsgestaltung.Hierzu liegt bereits aus früheren Programmen (z.B.Humanisierung <strong>der</strong> Arbeitswelt – HdA) e<strong>in</strong> reichhaltigerWissens- und Erfahrungsschatz vor.– Darüber h<strong>in</strong>aus geht es um die Reduzierung spezifischerBelastungsmomente an bestimmten, als risikohaftidentifizierten Arbeitsplätzen. Im Idealfall werdensolche Aspekte bereits im Vorfeld, d.h. schon bei <strong>der</strong>Planung von Arbeitssystemen <strong>in</strong> die Gestaltungsüberlegungene<strong>in</strong>bezogen (Morschhäuser 1999).U.a. wegen des Prozesscharakters vor allem arbeitsbed<strong>in</strong>gterErkrankungen wird gefor<strong>der</strong>t, <strong>der</strong>artige Maßnahmen<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e erwerbsbiografische Perspektive e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den,um auch jüngeren, auf diesen Arbeitsplätzennachrückenden Beschäftigten e<strong>in</strong> belastungsreduziertes(eres)Arbeiten zu ermöglichen. Die so genannte „alternsgerechte“Arbeitsgestaltung müsse demnach immerzugleich auch auch e<strong>in</strong>e „menschengerechte“ Arbeitsgestaltungse<strong>in</strong>, um damit den Erfor<strong>der</strong>nissen <strong>der</strong> Gesun<strong>der</strong>haltungaller Beschäftigten über den gesamten Erwerbsverlaufh<strong>in</strong>weg zu entsprechen (Adamy 2003).In diesem Zusammenhang wichtige betriebliche Gestaltungsansätzes<strong>in</strong>d (auf ältere Beschäftigte ausgerichtete)Gesundheitszirkel, ergonomische Maßnahmen, Arbeitszeitanpassung,Arbeitsumfeldgestaltung, des Weiteren die
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 89 – Drucksache 16/2190Umstrukturierung von Arbeitsaufgaben und Kooperationsbeziehungensowie die Ermöglichung von Gruppenarbeit(siehe unten) (Morschhäuser 1999). Dazu zählt auch,vorherrschende Entgeltformen und vergleichbare f<strong>in</strong>anzielleAnreize für Produktivitätssteigerungen auf ihre gesundheitlichenFolgerisiken h<strong>in</strong> zu überprüfen.Auf bislang ungenutzte präventive Möglichkeiten <strong>der</strong> Arbeitsplatzgestaltung(nicht nur) für Ältere <strong>in</strong> Deutschlandverweisen die Ergebnisse e<strong>in</strong>er vom Bundes<strong>in</strong>stitut fürBerufsbildung (BIBB) durchgeführten repräsentativenBefragung <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung <strong>in</strong> Deutschland zuBelastungen, Beanspruchungen und arbeitsbed<strong>in</strong>gten Erkrankungen(Jansen & Müller 2000). Dieser Untersuchungzufolge ist für ca. 10 Millionen Beschäftigte davonauszugehen, dass un<strong>zur</strong>eichende ergonomische und organisatorischeArbeitsbed<strong>in</strong>gungen zu (späteren) Bee<strong>in</strong>trächtigungen<strong>der</strong> Muskulatur, <strong>der</strong> Gelenke und des B<strong>in</strong>degewebesim Nacken und Schulterbereich führenwerden.Auch im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich sche<strong>in</strong>t Deutschlandeher schlecht abzuschneiden. So zeigen z.B. die Ergebnissedes Second European Survey on Work<strong>in</strong>g Conditions(Ilmar<strong>in</strong>en 2002), dass sich zwischen den EuropäischenStaaten erhebliche Unterschiede im Ausmaß <strong>der</strong>Arbeitsplatzanpassung e<strong>in</strong>erseits und körperlicher Anfor<strong>der</strong>ungenan<strong>der</strong>erseits f<strong>in</strong>den lassen, mit denen ältere Arbeitnehmerim Erwerbsleben konfrontiert werden. Sowerden z.B. für Dänemark, Schweden und die Nie<strong>der</strong>landejeweils optimale Werte ermittelt, woh<strong>in</strong>gegen sich<strong>in</strong> den südeuropäischen Staaten ke<strong>in</strong>e wesentlichen Unterschiede<strong>in</strong> den an ältere und jüngere Arbeitnehmer gestelltenkörperlichen Arbeitsanfor<strong>der</strong>ungen f<strong>in</strong>den lassen.Unter den 15 <strong>in</strong> den Survey e<strong>in</strong>bezogenen Staatenbelegte Deutschland h<strong>in</strong>sichtlich des Unterschieds zwischenden an ältere und jüngere Arbeitnehmer gestelltenkörperlichen Anfor<strong>der</strong>ungen geme<strong>in</strong>sam mit Italien den13. Platz, lediglich für Griechenland wurde e<strong>in</strong> schlechtererWert ermittelt.Neben den eher gestalterischen Maßnahmen <strong>der</strong> Verhältnispräventionlassen sich begrenzte Effekte auch durchMaßnahmen <strong>der</strong> Verhaltensprävention erzielen. Diese setzenbei gesundheitsbewusstem Verhalten <strong>der</strong> Beschäftigtenan und versuchen, <strong>der</strong>en diesbezügliche Ressourcenzu för<strong>der</strong>n und stärken (z.B. Stressmanagement, Rückenschulen,allgeme<strong>in</strong>e Fitnessprogramme). Ist schon <strong>in</strong>sgesamtdie Frage, wie das auf betrieblicher Ebene konkretzu organisieren ist, e<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> betrieblichen Gesundheitspolitiknur ger<strong>in</strong>g beachtetes Thema, so gilt dieserst recht mit Blick auf ältere Beschäftigte.Exkurs: Berufliche und mediz<strong>in</strong>ische RehabilitationE<strong>in</strong>e Analyse sozialmediz<strong>in</strong>ischer 2-Jahresprognosen fürpflichtversicherte Rehabilitanden <strong>der</strong> Arbeiterrentenversicherungdes Jahres 1996 belegt, dass auch für älterePersonen e<strong>in</strong>e Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> das Erwerbslebenerreicht werden kann. Von den Rehabilitanden, die zumZeitpunkt <strong>der</strong> Rehabilitation bis 49 Jahre alt waren, standenzwei Jahre später 92 Prozent im Erwerbsleben, von jenen,die zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Rehabilitation 50 bis 54 Jahrealt waren, 82 Prozent, von jenen, die zum Zeitpunkt <strong>der</strong>Rehabilitation 55 bis 59 Jahre alt waren, 61 Prozent undvon jenen, die zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Rehabilitation 60 bis64 Jahre alt waren, immerh<strong>in</strong> noch 23 Prozent. Ohne Arbeitsmarktprüfungfrühberentet wurden <strong>in</strong> den beidenhöchsten Altersgruppen lediglich 18 Prozent bzw. 16 Prozent.Damit ist anzunehmen, dass bei geän<strong>der</strong>ten Arbeitsmarkt-und betrieblichen Bed<strong>in</strong>gungen gute Chancen bestehen,auch <strong>in</strong> ihrer Leistungsfähigkeit e<strong>in</strong>geschränkteältere Arbeitnehmer durch mediz<strong>in</strong>ische Rehabilitationdauerhaft <strong>in</strong> das Erwerbsleben zu <strong>in</strong>tegrieren. Auch Rehabilitationsmaßnahmenbei Personen mit degenerativenErkrankungen s<strong>in</strong>d mit guten Chancen auf e<strong>in</strong>e dauerhafteberufliche Integration verbunden; dagegen s<strong>in</strong>d dieChancen bei Menschen mit neurologischen Erkrankungendeutlich ger<strong>in</strong>ger (Zollmann & Schliehe 2003). Die Tatsache,dass <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> 60-Jährigen und Älteren an denRehabilitanden vergleichsweise ger<strong>in</strong>g ist (etwa 4,1 Prozent),spricht dafür, dass vielfach auf die Durchführunge<strong>in</strong>er Rehabilitation verzichtet wird, weil die mit <strong>der</strong> aktuellenArbeitsmarktsituation verbundenen Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungschancenals ger<strong>in</strong>g angesehen werden.2.4.4.3 Arbeitsgestaltung, Gruppenarbeit,Personalentwicklung undLaufbahnplanungDie jeweilige Form <strong>der</strong> Arbeitsorganisation, d.h. die Art,wie gearbeitet wird, ist e<strong>in</strong>e weitere zentrale Stellgrößefür die Erhöhung <strong>der</strong> betrieblichen BeschäftigungschancenÄlterer und <strong>zur</strong> Überw<strong>in</strong>dung von Altersdiskrim<strong>in</strong>ierung.Alte tayloristische Produktionskonzepte – die entgegenoptimistischen Erwartungen nicht vollständig aus<strong>der</strong> Arbeitswelt verschwunden s<strong>in</strong>d, son<strong>der</strong>n noch <strong>in</strong> weitenTeilen <strong>der</strong> Industrie und auch im Dienstleistungssektorfortbestehen – beruhen dabei auf e<strong>in</strong>er striktenTrennung <strong>der</strong> Bereiche Planung, Ausführung und Leistungskontrolleund s<strong>in</strong>d nicht selten mit qualifikatorischenund gesundheitlichen Risiken <strong>der</strong> Beschäftigtenverbunden, vor allem bei jahrzehntelang ertragenen e<strong>in</strong>seitigenund monotonen Belastungen (Frerichs 1998).Neuere Produktionskonzepte streben demgegenüber diezunehmende Integration verschiedener Tätigkeiten undFunktionen, verbunden mit e<strong>in</strong>em Abbau von Hierarchieebenenan. Wenn auch unzutreffend ist, dass die E<strong>in</strong>führung<strong>der</strong> neuen Produktionskonzepte per se undgleichsam automatisch mit Verbesserungen <strong>der</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungenund e<strong>in</strong>em Belastungsabbau e<strong>in</strong>her gehe(Frerichs 1998), so trifft doch zu, dass die neuen Formen<strong>der</strong> Arbeitsorganisation durchaus Potenziale für e<strong>in</strong>e sogenannte „alternsgerechte“ Arbeitsgestaltung bieten, dieaber <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis viel zu wenig genutzt werden. GroßeHoffnungen beruhen <strong>in</strong> diesem Zusammenhang auf <strong>der</strong>Gruppenarbeit. Diese s<strong>in</strong>d jedoch an bestimmte Voraussetzungengebunden; so <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e, dass die Möglichkeitzu e<strong>in</strong>em regelmäßigen Wechsel zwischen verschiedenenArbeitsplätzen und Tätigkeiten gegeben ist. Obund <strong>in</strong>wiefern Gruppenarbeit tatsächlich e<strong>in</strong> auch die Gesundheitschonendes Arbeiten ermöglicht, hängt weiterh<strong>in</strong><strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie von <strong>der</strong> Konzeption <strong>der</strong> Arbeitsaufgabeab. Betriebliche Erfahrungen zeigen dabei, dass, je mehr
Drucksache 16/2190 – 90 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeE<strong>in</strong>zeltätigkeiten es gibt, die körperlich und psychischwenig belasten, desto größer dann auch <strong>der</strong> Spielraum fürdie Integration weniger leistungsfähiger Mitarbeiter<strong>in</strong>nenund Mitarbeiter ist (Morschhäuser 1999).Es ist allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e Illusion zu glauben, alle Arbeitsplätzekönnten „alternsgerecht“ „umorganisiert“ werden.Vielmehr wird es auch <strong>in</strong> Zukunft noch viele geben, dieauf Grund hoher Belastungsstrukturen nur e<strong>in</strong>e begrenzteTätigkeitsdauer erlauben, d.h. auf denen man nicht unternormalen Umständen „alt“ werden kann.Als e<strong>in</strong>e Internalisierungsstrategie und nachhaltige Alternativegelten die Laufbahnplanung und -gestaltung. Sies<strong>in</strong>d Elemente e<strong>in</strong>er umfassenden, auf die gesamte Erwerbsbiografiebezogenen Organisation von Erwerbsarbeit.Laufbahnen „ordnen“ gleichsam Anfor<strong>der</strong>ungen,Anreize und Belastungen im Berufsverlauf so h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>an<strong>der</strong>,dass im Idealfall die Arbeit bis <strong>in</strong>s gesetzliche Rentenalterh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> möglich ist, und zwar auch dann, wenn diee<strong>in</strong>zelne Tätigkeit nur befristet auszuüben ist. Ziel ist diemöglichst lange produktive Beschäftigung im angestammtenBetrieb o<strong>der</strong> Beruf, das im Idealfall über diegleichzeitige Verknüpfung von drei mit Arbeitsplatzwechsel/Rotationpr<strong>in</strong>zipiell möglichen Unterzielen erreichtwerden kann: Abbau von Belastungen, Höherqualifizierungo<strong>der</strong> Neuerwerb von Qualifikationen undKompetenzen sowie Erleben e<strong>in</strong>er positiven beruflichenVerän<strong>der</strong>ung (Clemens 2003). Betriebliche Laufbahngestaltungist somit e<strong>in</strong>e Personalentwicklungsaufgabe, bei<strong>der</strong> es im Kern um e<strong>in</strong>en die gesamte berufliche Karriereumfassenden, „passgenauen“ Abgleich alterstypischerLeistungsverän<strong>der</strong>ungen mit spezifischen Arbeitsanfor<strong>der</strong>ungsprofilen,d.h. um die Organisation <strong>in</strong>nerbetrieblicher/beruflicherKarrieren entlang des altersspezifischenLeistungswandels geht. Am Ende sollten dann solche Tätigkeitenstehen, die von älteren Beschäftigten beson<strong>der</strong>squalifiziert ausgefüllt werden können bzw. mit dem spezifischenErfahrungspotenzial Älterer beson<strong>der</strong>s harmonieren.Betriebliche Laufbahnplanung umfasst ganz unterschiedlicheGestaltungsmöglichkeiten. Denkbar ist z.B. dieKompensation von alterstypischem Verlust bedrohterQualifikationselemente, etwa durch Verbesserung <strong>der</strong> Arbeitstechniken(Wolff, Spieß & Mohr 2001). In mo<strong>der</strong>nenProduktions- und Dienstleistungsformen kommen Leistungsmerkmaledes kundenbezogenen Arbeitens (z.B. imE<strong>in</strong>zelhandel), <strong>der</strong> Qualitätssicherung o<strong>der</strong> des ressourcenschonendenMateriale<strong>in</strong>satzes <strong>in</strong> Frage (BertelsmannStiftung & Bundesvere<strong>in</strong>igung <strong>der</strong> Deutschen Arbeitgeberverbände2003). Auch die Entwicklung neuer Geschäftsfel<strong>der</strong>kann <strong>in</strong>sgesamt die bessere „Vermarktung“alterstypischer Fähigkeiten begünstigen (z.B. bei speziellenRenovierungs-/Wartungsarbeiten).Die Idee <strong>der</strong> erwerbsbiografischen Laufbahngestaltungsetzt freilich die Existenz e<strong>in</strong>er betrieblichen Personalplanung<strong>in</strong> längerfristiger Perspektive voraus, was bislangfür die Bundesrepublik eher untypisch ist. Es gilt also, <strong>in</strong>den Betrieben dafür die Sensibilität zu wecken bzw. zuför<strong>der</strong>n. Angesprochen s<strong>in</strong>d hierbei neben den Personalverantwortlichenauch die Betriebs- und Personalräte.2.4.4.4 Arbeitszeitgestaltung und -anpassungSchon lange gelten Gestaltung von <strong>Lage</strong> und Dauer <strong>der</strong>Arbeitszeit als relevante Aktionsparameter sowohl untergesundheitsschonenden Gesichtspunkten als auch wegenihres möglichen Beitrags bei <strong>der</strong> Verlängerung <strong>der</strong> Erwerbsphase.So s<strong>in</strong>d z.B. die gesundheitsschädigendenWirkungen dauerhafter Schichtarbeit, und speziell vonNachtschichtarbeit, <strong>in</strong> zahlreichen Studien belegt.Im E<strong>in</strong>zelnen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Verkürzung <strong>der</strong> regelmäßigenWochen- bzw. Jahresarbeitszeit (spezielle Pausenregelungen,Altersfreizeiten, Altersteilzeit, altersgestaffelteReduktion <strong>der</strong> Wochenarbeitszeit, zusätzlicherUrlaub und freie Tage) zu erwähnen. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d entsprechendeMaßnahmen bislang nur <strong>in</strong> wenigen Betriebenund Branchen e<strong>in</strong>geführt, und wenn, dann teilweiseals Ergebnis tarifvertraglicher Regelungen. Demgegenübernoch vergleichsweise jung s<strong>in</strong>d strategische Überlegungen,mittels spezieller Arbeitszeitregelungen e<strong>in</strong>ebessere Vere<strong>in</strong>barkeit von Arbeit mit übrigen lebensweltlichenInteressen zu ermöglichen und somit <strong>in</strong>sgesamtdem Ziel e<strong>in</strong>er besseren Work-Life-Balance zu dienen.Letzteres wird vor allem <strong>in</strong> Anbetracht zunehmend variablerLebensläufe und – nicht zuletzt wegen <strong>der</strong> demografischenEntwicklung – neuer biografischer Herausfor<strong>der</strong>ungen(wie z.B. Weiterbildungsnotwendigkeiten o<strong>der</strong>häusliche Altenpflege) immer bedeutsamer. Bei e<strong>in</strong>em<strong>in</strong>sgesamt alternden Erwerbspersonenpotenzial könnenArbeitszeitgestaltung und -anpassung somit strategischeMehrfachfunktionen übernehmen, so z.B. als Instrument<strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung, <strong>der</strong> Schaffung von Freiräumenfür berufliche Qualifizierung, <strong>zur</strong> besseren Vere<strong>in</strong>barkeitvon Berufstätigkeit und Pflege, <strong>zur</strong> Vorbereitung auf„zweite“ o<strong>der</strong> „dritte Karrieren“ o<strong>der</strong> <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>erVorbereitung auf nachberufliche Tätigkeiten (z.B. bürgerschaftlichesEngagement) (Naegele et al. 2003).Weniger e<strong>in</strong>deutig ist die Bewertung flexibler Beschäftigungsformen,wie befristete Beschäftigungsverhältnisse,selbstständige Tätigkeiten o<strong>der</strong> Leiharbeit. Sie s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gstrotz zunehmen<strong>der</strong> Verbreitung bei Älteren bislangnoch eher die Ausnahme. Zu fragen ist, ob überhaupt undunter welchen Bed<strong>in</strong>gungen sie speziell <strong>in</strong> <strong>der</strong> Spätphasedes Erwerbslebens zu e<strong>in</strong>er besseren Integration <strong>in</strong> dasErwerbsleben beitragen können. An<strong>der</strong>erseits wird befürchtet,dass <strong>in</strong> ihrem Gefolge neue „prekäre“ Beschäftigungsverhältnissefür Ältere o<strong>der</strong> gar zusätzliche Frühverrentungsanreizeentstehen.Sollen Arbeitszeitgestaltung und -anpassung explizit <strong>in</strong>den Dienst <strong>der</strong> Ausweitung <strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung Älterergestellt werden, gilt es somit <strong>in</strong>sgesamt darauf zu achten,dass es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um die erwähnten strategischenMehrfachfunktionen gehen muss, so <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e um positiveWirkungen auf: Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und Gesundheitsschutz,Verbesserung <strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Arbeit,För<strong>der</strong>ung beruflicher/betrieblicher Qualifizierung, Erhöhung<strong>der</strong> (Weiter-)Arbeitsmotivation, Realisierung verän<strong>der</strong>terArbeitnehmer<strong>in</strong>teressen <strong>in</strong> ihrer Work-Life-Balance sowie För<strong>der</strong>ung von bürgerschaftlichemEngagement und „active age<strong>in</strong>g“.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 91 – Drucksache 16/2190Neben „w<strong>in</strong>“-Effekten für die (älteren) Beschäftigtenselbst und für die Betriebe (z.B. Erhöhung <strong>der</strong> corporateidentity)s<strong>in</strong>d somit auch gesamtgesellschaftliche „w<strong>in</strong>“-Effekte denkbar. An<strong>der</strong>erseits gilt es gleichzeitig auch,mögliche unerwünschte Nebeneffekte und Folgerisikenzu vermeiden, wie z.B. <strong>der</strong> Verlust von sozialer Sicherheit,die Erhöhung von Arbeitsbelastungen durch wachsendenZeitdruck o<strong>der</strong> E<strong>in</strong>schränkungen <strong>in</strong> späteren beruflichenEntwicklungschancen, von denen bislangschwerpunktmäßig Frauen betroffen s<strong>in</strong>d.Mit Blick auf diese Prüfkriterien haben vor allem die folgendenArbeitszeitoptionen das grundsätzliche Potenzialfür „w<strong>in</strong>-w<strong>in</strong>-w<strong>in</strong>-Effekte“ <strong>der</strong> o.g. Art:„Echte“ AltersteilzeitHierzu hat die Kommission e<strong>in</strong>e Expertise vergeben(Barkholdt 2004), die u.a. zeigt, dass beispielsweise <strong>in</strong>kle<strong>in</strong>en und mittleren (Handwerks-)Betrieben Altersteilzeitgerade nicht vorrangig als Frühverrentungsoption genutztwird. Stattdessen dient sie speziell hier häufig– vorzugsweise als Tandem-Lösung (d.h. <strong>der</strong> erfahreneÄltere gibt im Team mit e<strong>in</strong>em Auszubildenden se<strong>in</strong>Erfahrungswissen im Rahmen se<strong>in</strong>er Altersteilzeitbeschäftigungweiter),– dazu, den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, diePflege Angehöriger mit <strong>der</strong> Erwerbsarbeit zu vere<strong>in</strong>baren,– dazu, auf gesundheitliche E<strong>in</strong>schränkungen <strong>der</strong> BeschäftigtenRücksicht zu nehmen.– Auch hat sie grundsätzlich das Potenzial, auf nachberuflichesbürgerschaftliches Engagement vorzubereiten.Arbeitszeitregelungen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mitLaufbahngestaltungErfolgreiche Initiativen <strong>in</strong> den Nie<strong>der</strong>landen wie auchhierzulande greifen die Idee <strong>der</strong> Laufbahngestaltungdurch Arbeitszeitregelungen auf. Diese wird dabei <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>efür Beschäftigte auf Arbeitsplätzen mit begrenzterTätigkeitsdauer diskutiert. Die systematische Beratungund För<strong>der</strong>ung z.B. von An- und Ungelernten, aberauch die systematische E<strong>in</strong>leitung e<strong>in</strong>es rechtzeitigenWechsels <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Tätigkeit (z.B. unter E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>erso genannten Bildungsteilzeit), kann unter bestimmtenBed<strong>in</strong>gungen ebenfalls e<strong>in</strong>en sonst erfolgenden frühzeitigenAustritt aus dem Erwerbsleben verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n(Barkholdt 2004).2.4.4.5 LebensarbeitszeitgestaltungBei <strong>der</strong> Idee e<strong>in</strong>er lebensbiografisch ausgerichtetenArbeitszeitgestaltung („Lebensarbeitszeitgestaltung“)(Barkholdt 1998) geht es im Grundsatz darum, Arbeitszeitenso an die verän<strong>der</strong>ten arbeitsphysiologischen Erfor<strong>der</strong>nisseanzupassen, dass es für die Betroffenen zugleichmöglich wird, lebensbiografisch unterschiedlicheZeitverwendungserfor<strong>der</strong>nisse und -bedürfnisse zu realisieren(Naegele 2005). Inzwischen wird dieser Vorschlagaber auch beschäftigungs-, humanisierungs-, sozial-, bildungs-und familienpolitisch begründet. Vermutet werdenu.a. hohe Ausstrahlungseffekte auf Produktivität (<strong>in</strong>kl.Gesundheitszustand), Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit,ferner auf überbetriebliche und gesellschaftspolitischeZiele wie lebenslanges Lernen o<strong>der</strong> bürgerschaftlichesEngagement. H<strong>in</strong>zu kommen Erwartungen, e<strong>in</strong>eAn<strong>der</strong>sverteilung von Arbeit im Lebenslauf könnte auchdie Weiterarbeitsbereitschaft <strong>in</strong> <strong>der</strong> Spätphase des Erwerbslebenserhöhen. Es geht also auch um die E<strong>in</strong>bettung<strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung nach e<strong>in</strong>er Verlängerung <strong>der</strong> Erwerbsphase<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e die gesamte Erwerbsphase umfassendeKonzeption als Teil e<strong>in</strong>er „lebensphasenorientierten Arbeitszeitpolitik“.Um diese zu realisieren fehlt es <strong>der</strong>zeitallerd<strong>in</strong>gs weniger an Gestaltungsphantasie als vielmehran tragfähigen Konzepten <strong>der</strong> Bildungs-, Familien- undVere<strong>in</strong>barkeitspolitik e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> sozialen Absicherung.Bei <strong>der</strong> praktischen Umsetzung s<strong>in</strong>d neben den betrieblichenImplementierungsproblemen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Konsequenzenfür die <strong>in</strong>dividuelle soziale Sicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong>Diskussion; letzteres vor allem wegen <strong>der</strong> traditionell engenVerknüpfung von sozialer Sicherung und (möglichst)lebenslanger bzw. vollkont<strong>in</strong>uierlicher Erwerbsarbeit. DieAnwendung <strong>der</strong> Idee <strong>der</strong> „Flexicurity“ auf die Lebensarbeitszeitorganisation– und schon gar nicht mit Blick aufältere Beschäftigte – ist <strong>der</strong>zeit aber noch nicht konzeptualisiert.Für die hier betrachtete Zielsetzung e<strong>in</strong>er Verlängerung<strong>der</strong> Lebensarbeitszeit kann vermutet werden, dass sichsowohl (Weiter-)Arbeitsbereitschaft als auch Ruhestandsorientierungenbeträchtlich vor dem H<strong>in</strong>tergrund variablerwerden<strong>der</strong> Lebensbiografien verän<strong>der</strong>n. So dürftenflexiblere Arbeitszeiten <strong>in</strong> früheren Stadien des BerufsverlaufsMöglichkeit und Bereitschaft för<strong>der</strong>n, später e<strong>in</strong>mallänger im Erwerbsleben zu verbleiben. Aber auch fürdie Betriebe gilt, dass grundsätzliche Erfahrungen mit Arbeitszeitflexibilisierungdie Bereitschaft för<strong>der</strong>n, diesauch für ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmer anzubieten.Die Lebensverlaufsperspektive ist mittlerweile konzeptionellbereits seit längerem <strong>in</strong> <strong>der</strong> Forschung aufgegriffen,nicht jedoch explizit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Politik. Allerd<strong>in</strong>gs siehtz.B. die Bundestags-Enquete-Kommission „DemographischerWandel“ <strong>in</strong> den Empfehlungen ihres Abschlussberichtesdar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en zentralen Ansatzpunkt für dieAusweitung <strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung Älterer (DeutscherBundestag 2002).2.5 Handlungsgrundsätze und-empfehlungen2.5.1 HandlungsgrundsätzeDie nachstehend angeführten Handlungsgrundsätze bildenden übergeordneten Gesamtrahmen für konkreteHandlungsempfehlungen, auf die sich die 5. Altenberichtskommissionverständigt hat. Dabei geht die Kommissionvon unterschiedlichen Handlungsebenen mitjeweils unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verant-
Drucksache 16/2190 – 92 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodewortlichkeiten aus. Zu unterscheiden ist dabei e<strong>in</strong>erseitszwischen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividuellen Verantwortung des e<strong>in</strong>zelnenälteren Beschäftigten, e<strong>in</strong>er Verantwortung <strong>der</strong> Betriebesowie e<strong>in</strong>er Verantwortung relevanter Akteursgruppenwie Staat und Sozialpartnern.Oberstes Ziel ist, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit praktiziertevorzeitige „Freisetzung des Alters aus <strong>der</strong> Arbeitswelt“zu überw<strong>in</strong>den. Nachdem die verschiedenen (gesetzlichen,steuerlichen wie betrieblichen) Anreize <strong>zur</strong> Frühverrentungweitgehend abgebaut wurden, gilt es, vor allem<strong>in</strong> den Betrieben und Verwaltungen für Bed<strong>in</strong>gungenzu sorgen, dass die Verlängerung <strong>der</strong> Lebensarbeitszeitmachbar und auch für die Betroffenen möglich und ggf.auch wünschenswert ist. Insgesamt muss es darum gehen,die konkreten Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen so zu gestalten,dass es möglich wird, im angestammten Beruf bzw.im Betrieb auch wirklich alt werden zu können.Angesichts von aktuell mehr als 5 Mio. offiziell registriertenArbeitslosen die Weiterbeschäftigung Älterer zufor<strong>der</strong>n bzw. sich für die Ausweitung <strong>der</strong> Beschäftigungbislang „unterbeschäftigter“ Bevölkerungsgruppen auszusprechen,muss zunächst verwun<strong>der</strong>n. Dies gilt auchvor dem H<strong>in</strong>tergrund des <strong>der</strong>zeit für Deutschland bestehendenArbeitsplatzdefizits, vor allem im Bereich <strong>der</strong>qualifizierten Arbeitsplätze. Alle<strong>in</strong> <strong>zur</strong> Umsetzung <strong>der</strong>EU-Richtl<strong>in</strong>ien von Stockholm <strong>zur</strong> Beschäftigungsausweitungvon älteren Arbeitnehmern würden bis 2010 rund800.000 zusätzliche Arbeitsplätze benötigt 9 . Die Kommissionist sich bewusst, dass zwischen dem, was aktuellerfor<strong>der</strong>lich ist und dem, was mittel- und längerfristig alsnotwendig angesehen wird, e<strong>in</strong> Gegensatz bestehen kann,doch nicht zwangsläufig bestehen muss. Auch bei gegenwartsnahzu treffenden Entscheidungen kann durchaus etwasbeabsichtigt und angestrebt werden, was erst späterwirksam wird. Damit können auch den Akteuren verän<strong>der</strong>teRahmenbed<strong>in</strong>gungen frühzeitig bekannt gemachtwerden, sodass sie sich darauf e<strong>in</strong>stellen und reagierenkönnen.Das demografische Altern des Erwerbspersonenpotenzialswie <strong>der</strong> gesamten Bevölkerung ist bis auf weiterese<strong>in</strong> irreversibler Trend. Betriebe und Verwaltungen müssendaher rechtzeitig ihre bisherige „Jugendzentrierung“<strong>in</strong> <strong>der</strong> Personal- und Beschäftigungspolitik aufgeben undsich auf die beson<strong>der</strong>en Beschäftigungsvoraussetzungen,-bedürfnisse und -erwartungen altersmäßig an<strong>der</strong>s zusammengesetzterBelegschaften <strong>in</strong> strategischer Weise e<strong>in</strong>stellen.Hier ist <strong>der</strong> Zeithorizont zu beachten. Der Rückgangdes Erwerbspersonenpotenzials setzt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>enach 2015/20 massiv e<strong>in</strong>. An<strong>der</strong>erseits benötigen speziell9 Diese Zahl wurde auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Europäischen Arbeitskräftestichprobe2004 berechnet. Im Jahre 2010 werden die im Jahre 200449-bis 58-Jährigen <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen angehören.Für diese Kohorte wurde e<strong>in</strong>e Beschäftigungsquote von 50 Prozentzugrunde gelegt. Die Differenz zwischen <strong>der</strong> sich daraus ergebendenabsoluten Beschäftigtenzahl zu <strong>der</strong> im Jahre 2002Beschäftigten zwischen 55 und 64 Jahren ergibt die Zahl <strong>der</strong> zusätzlichnotwendigen Arbeitsplätze für die 55-64-Jährigen, die sowohlden Quoten- als auch den Kohorteneffekt enthält (Bosch & Schief2005a).größere und Groß-Betriebe e<strong>in</strong>e „strategische Umstellungszeit“für ihre Personalpolitik von teilweise bis zu 10Jahren. Aber auch das unter den Beschäftigten selbst weitverbreitete „verän<strong>der</strong>te Ruhestandsbewusstse<strong>in</strong>“ bzw. dieweit verbreitete Frühverrentungsmentalität lassen sichnur <strong>in</strong> mittel- bis längerfristiger Perspektive <strong>in</strong> entscheiden<strong>der</strong>Weise verän<strong>der</strong>n.Dabei muss es wichtigstes Ziel se<strong>in</strong>, die Arbeits- undBeschäftigungsfähigkeit (workability, employability) e<strong>in</strong>es<strong>in</strong>sgesamt alternden Erwerbspersonenpotenzials zuerhalten bzw. ggf. noch zu steigern. Die Beschäftigungsfähigkeite<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>zelnen wird wesentlich durch dieKomponenten Gesundheit, Qualifikation, Motivation, Arbeitsumgebungund privates Umfeld sowie durch daraufgerichtete för<strong>der</strong>liche betriebliche, tarifvertragliche undstaatliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Bildungspolitikund des Gesundheitsschutzes) bestimmt.Speziell die „Karriereverläufe“ alterstypischer Beschäftigungsrisikenlassen die Erfor<strong>der</strong>nis präventiver Strategienund Konzepte e<strong>in</strong>erseits sowie die Begrenztheit „altersspezifischerInsellösungen“ an<strong>der</strong>erseits erkennen. Schondie Bundestags-Enquete-Kommission „DemographischerWandel“ hat sich aus diesem Grunde <strong>in</strong> ihrem 2002 vorgelegtenAbschlussbericht (Deutscher Bundestag 2002)für e<strong>in</strong>e „lebenslaufbezogene Politik <strong>der</strong> Beschäftigungsför<strong>der</strong>ungaltern<strong>der</strong> Belegschaften“ ausgesprochen. Derenwichtigste Handlungsfel<strong>der</strong> (wie Arbeitsgestaltung,Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung/-schutz im Betrieb,Personalplanung und -entwicklung <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mitKarriereplanung, Arbeitszeitgestaltung sowie beruflicheQualifizierung und Lernen im Alter) dürfen allerd<strong>in</strong>gsnicht isoliert vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong> betrachtet werden. Vielmehrbilden sie <strong>in</strong>tegrierte Teilaspekte e<strong>in</strong>er gesamtbetrieblichenSichtweise und Strategie ab, bei <strong>der</strong> unterschiedlicheEbenen <strong>der</strong> Betriebs- bzw. betrieblichen Beschäftigungspolitikmite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verzahnt werden, wie z.B.Arbeitszeitpolitik mit betrieblicher Fort- und Weiterbildungo<strong>der</strong> Personalpolitik mit Organisations- und Technikentwicklung,und die sich überdies nicht ausschließlichauf ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmer, son<strong>der</strong>ngleichermaßen auf e<strong>in</strong>e alternsgerechte und damit <strong>in</strong>sgesamtmenschengerechte Arbeitstätigkeit bezieht. ImGrunde muss es also um e<strong>in</strong>e Doppelstrategie gehen, diesowohl akute Maßnahmen für die jetzt älteren als auchpräventive Maßnahmen für die <strong>zur</strong> Zeit noch jüngerenbzw. mittelalten Beschäftigtengruppen umfasst. Zudemmüssen die Betroffenen als „Experten <strong>in</strong> eigener Sache“e<strong>in</strong>bezogen werden. Dabei kann es jedoch ke<strong>in</strong>e Standardlösungengeben. Ebenso wenig wie es den/die ältereArbeitnehmer/<strong>in</strong> gibt, gibt es den Betrieb. HeterogeneStrukturen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt verlangen jeweils differenzierteAntworten und zwar bezogen auf die Beschäftigtenwie die Betriebe gleichermaßen. Konzeptionell gilt esdabei, die beson<strong>der</strong>en Unterstützungsbedarfe bestimmterZielgruppen (An- und Ungelernte, Migranten etc.) zu berücksichtigen.Auf Grund ihres überdurchschnittlich hohenAnteils Älterer an den Belegschaften s<strong>in</strong>d Kle<strong>in</strong>- undMittelbetriebe durch das demografisch bed<strong>in</strong>gte Altern<strong>der</strong> Arbeitswelt <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Weise herausgefor<strong>der</strong>t.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 93 – Drucksache 16/2190Wie <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Erfolge des f<strong>in</strong>nischen „NationalProgramme for Age<strong>in</strong>g Workers“ (Arnkil et al. 2002) erkennenlassen, kommt es zum Zweck <strong>der</strong> Ausweitung <strong>der</strong>Erwerbsbeteiligung Älterer auf <strong>in</strong>tegrierte, politikfeldübergreifendeStrategien und Konzepte an. Auf staatlicherEbene gilt es dabei vor allem, e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tegrierten„policy mix“ <strong>der</strong> zuständigen Teilpolitiken (u.a. Renten-,Altersgrenzen-, Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Gesundheits-,Familienpolitik) zu organisieren und <strong>in</strong>stitutionell abzusichern.Darüber h<strong>in</strong>aus kommt <strong>der</strong> Politik die Rolle zu,Prozesse zu <strong>in</strong>itiieren, zu mo<strong>der</strong>ieren und ggf. die gesetzlichenRahmenbed<strong>in</strong>gungen (z.B. <strong>zur</strong> <strong>in</strong>nerbetrieblichenUmsetzung <strong>der</strong> Formel vom Lebenslangen Lernen) zuverän<strong>der</strong>n.2.5.2 HandlungsempfehlungenDie Kommission spricht sich für e<strong>in</strong>en Paradigmenwechsel<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> Lebensarbeitszeit aus. Dazu bedarfes <strong>in</strong>tegrierter Anstrengungen auf unterschiedlichenFel<strong>der</strong>n und Politikebenen. Angesprochen ist neben denälteren Erwerbstätigen, den betrieblichen Akteuren undden Tarifparteien auch <strong>der</strong> Staat. Dieser muss – <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesundheitspolitik, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bildungspolitik, <strong>in</strong><strong>der</strong> Familienpolitik und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitik – Rahmenbed<strong>in</strong>gungenschaffen, durch die e<strong>in</strong>e Verlängerung<strong>der</strong> Lebensarbeitszeit weiter geför<strong>der</strong>t wird.1 Schaffung e<strong>in</strong>er „demografiesensiblen“ Unternehmenskulturund Entwicklung von „Leitl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>erguten Praxis“: Damit ist geme<strong>in</strong>t, dass Betriebe e<strong>in</strong>e Personal-und Beschäftigungspolitik mit dem Ziel <strong>der</strong> gleichberechtigtenBehandlung aller Altersgruppen im Betriebpraktizieren. Insbeson<strong>der</strong>e geht es darum, die Vorteile altersgemischterArbeits- und Lernteams und e<strong>in</strong>er ausgewogenenPersonalstruktur im Unternehmen mit e<strong>in</strong>er h<strong>in</strong>reichendenVertretung auch des ErfahrungswissensÄlterer deutlich zu machen. Hilfreich können auch „Leitl<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>er Guten Praxis“ se<strong>in</strong>, wie sie bereits auf EU-Ebene e<strong>in</strong>geführt, <strong>in</strong> Deutschland aber bislang kaum imE<strong>in</strong>satz s<strong>in</strong>d. Darüber h<strong>in</strong>aus hält die Kommission dieVerbreitung von Beispielen hervorragen<strong>der</strong> betrieblicherPraxis für geeignet.2 Anreizstrukturen für Gesundheitsschutz, Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund Prävention: Die Kommission hältes für notwendig, jene Betriebe zu belohnen, die Maßnahmendes Gesundheitsschutzes, <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund <strong>der</strong> Prävention umsetzen. Die Kommission sieht dabeiPrüfungsbedarf h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Wirkung von entsprechendenAnreizen (zum Beispiel Bonus- und Malussysteme).3 Demografiegerechte Tarifverträge abschließen:Die Kommission empfiehlt den Tarifpartnern, passiveSchutzregelungen für Ältere, wie etwa Entgeltsicherung,Aufstockung von Altersteilzeitphasen o<strong>der</strong> spezifischeKündigungsschutzbestimmungen, durch Vere<strong>in</strong>barungenzu e<strong>in</strong>er präventiven För<strong>der</strong>ung zu ergänzen. Insbeson<strong>der</strong>es<strong>in</strong>d Tarifvere<strong>in</strong>barungen zu den Themen Qualifizierungund Weiterbildung, Gesundheitsschutz und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,Arbeitsorganisation sowie flexibleLebensarbeitszeiten auszuhandeln. Die Kommission begrüßt,dass im neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstesdie Zahl <strong>der</strong> Altersstufen bereits von 12 auf 6 reduziertwurde. Sie plädiert dafür, <strong>in</strong> den nächsten Jahren <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er zweiten Reformstufe die Altersstufen beim Entgeltim öffentlichen Dienst, und soweit notwendig, auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>enBranchen weiter zu reduzieren.4 „Echte“ Altersteilzeit als Bestandteil flexibler Lebensarbeitszeiten:Die Altersteilzeit sollte als Blockvariantenicht mehr geför<strong>der</strong>t werden. Die Kommissionschlägt vor, im Teilzeitgesetz, das zu e<strong>in</strong>em Gesetz fürWahlarbeitszeiten weiterentwickelt werden könnte, e<strong>in</strong>espezielle Variante <strong>der</strong> Arbeitszeitflexibilisierung für über50-Jährige e<strong>in</strong>zuführen. Da das Haupth<strong>in</strong><strong>der</strong>nis für e<strong>in</strong>eVerkürzung <strong>der</strong> Arbeitszeit für Ältere spätere E<strong>in</strong>schnittebei <strong>der</strong> Rente s<strong>in</strong>d, sollten zwischen dem 50. und 65. Lebensjahrfür e<strong>in</strong>e maximale Periode von 5 Jahren die Rentenbeiträgefür die verkürzte Arbeitszeit (auf maximal50 Prozent) durch die öffentliche Hand übernommen werden.Die bisherige Aufstockung <strong>der</strong> Entgelte sollte entfallen;dies könnten die Tarifpartner regeln.5 Ke<strong>in</strong>e Lockerung des Kündigungsschutzes für ältereBeschäftigte, aber Abbau <strong>der</strong> Barrieren bei <strong>der</strong>E<strong>in</strong>stellung Älterer: Die Kommission spricht sich gegendie Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere Beschäftigteaus. Denn e<strong>in</strong>e Lockerung des Kündigungsschutzeswürde zu mehr Entlassungen Älterer und ihrenErsatz durch Jüngere führen. Gleichzeitig ist nicht zuübersehen, dass die Sorge vor hohen Entlassungskosteno<strong>der</strong> <strong>der</strong> Unkündbarkeit Älterer e<strong>in</strong> zentrales E<strong>in</strong>stellungshemmnisist. Der Gesetzgeber hat darauf reagiertund die Befristung Älterer ab dem 52. Lebensjahr bis zumRentenbezug ohne sachlichen Grund ermöglicht. Esspricht vieles dafür, dass diese Regelung juristisch ke<strong>in</strong>enBestand haben wird, nachdem <strong>der</strong> EuGH beson<strong>der</strong>e Befristungsmöglichkeitenfür Ältere als altersdiskrim<strong>in</strong>ierendbezeichnet hat. Die Kommission schlägt deshalbvor, im Kündigungsschutz das Lebensalter als Kriteriumbei <strong>der</strong> Sozialwahl zu streichen. Langjährig Beschäftigtewürden damit über das Kriterium „Betriebszugehörigkeit“geschützt; E<strong>in</strong>stellungsbarrieren für Ältere würdenverm<strong>in</strong><strong>der</strong>t.6 Ke<strong>in</strong>e starren Regelungen des Ausscheidens mit65 Jahren: Die <strong>in</strong> Tarifverträgen und im Beamtenrechtoft starren Regelungen e<strong>in</strong>es Ausscheidens mit dem65. Lebensjahr sollten gelockert werden. Allerd<strong>in</strong>gs müssendabei betriebliche Interessen an e<strong>in</strong>er ausgeglichenenPersonalstruktur und e<strong>in</strong>er regelmäßigen Neubesetzungvon Führungspositionen berücksichtigt werden. Dieswäre etwa durch die Begrenzung des Kündigungsschutzesbis zum 65. Lebensjahr zu ermöglichen.7 Arbeitsmarktpolitische Instrumente vere<strong>in</strong>fachen:In den letzten Jahren s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Reihe von neuen Instrumenten<strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitik <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung Älterere<strong>in</strong>geführt worden. E<strong>in</strong>ige dieser Maßnahmen, wie etwa<strong>der</strong> Beitragsbonus für Arbeitgeber bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellung Älterer,werden kaum genutzt, da die Arbeitsvermittler nure<strong>in</strong>e begrenzte Anzahl von Instrumenten vermarkten könnenund die Nutzer angesichts <strong>der</strong> komplexen För<strong>der</strong>landschaftebenfalls nur wenige Instrumente kennen. Die
Drucksache 16/2190 – 94 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeKommission empfiehlt daher die Bündelung zu wenigenschlagkräftigen Instrumenten mit hohem Wie<strong>der</strong>erkennungswert.So könnte man alle f<strong>in</strong>anziellen Zuwendungenan die Arbeitgeber und die Beschäftigten bei den E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungszuschüssenbündeln, die ohneh<strong>in</strong> sehr flexibelgehandhabt werden. Dies wäre mit e<strong>in</strong>em erheblichenBürokratieabbau verbunden.8 Für mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben<strong>in</strong> die Nacherwerbsphase: Die Kommissionist <strong>der</strong> Auffassung, dass <strong>in</strong> höherem Maße als bisher e<strong>in</strong>eFlexibilisierung beim Übergang vom Erwerbsleben <strong>in</strong> dieNacherwerbsphase erfor<strong>der</strong>lich ist. Dazu schlägt dieKommission vor:– Die Regelungen für die Inanspruchnahme <strong>der</strong> Teilrente(bei Alters- und Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsrenten)aus <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung solltenvere<strong>in</strong>facht werden. Dies betrifft vor allem die Regelungenfür den möglichen H<strong>in</strong>zuverdienst.– E<strong>in</strong>e weitere Maßnahme <strong>zur</strong> Erhöhung des Flexibilisierungsgradesfür den Übergang von <strong>der</strong> Erwerbs-<strong>in</strong> die Ruhestandsphase wird von <strong>der</strong> Kommission<strong>in</strong> <strong>der</strong> Möglichkeit gesehen, den Zeitpunktzwischen dem vollständigen o<strong>der</strong> teilweisen Ausscheidenaus dem Erwerbsleben und dem Zeitpunkt<strong>der</strong> Inanspruchnahme e<strong>in</strong>er Altersrente durchprivate und betriebliche Vorsorge zu überbrücken.Dafür sollten auch die Mittel <strong>der</strong> geför<strong>der</strong>ten Privatvorsorgee<strong>in</strong>gesetzt werden können, was bislangnur <strong>in</strong> begrenztem Umfang <strong>der</strong> Fall ist.– Die Zuschläge für e<strong>in</strong> H<strong>in</strong>ausschieben <strong>der</strong> Inanspruchnahme<strong>der</strong> Altersrente über den Zeitpunkt<strong>der</strong> Regel- bzw. Referenzaltersgrenze (ab <strong>der</strong> dieRente abschlagfrei <strong>in</strong> Anspruch genommen werdenkann) sollten erhöht werden, um e<strong>in</strong>en tatsächlichenf<strong>in</strong>anziellen Anreiz <strong>zur</strong> Weiterarbeit zu bieten.– Wird nach Inanspruchnahme <strong>der</strong> Altersrente ab <strong>der</strong>Regel-(Referenz)Altersgrenze e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeitausgeübt, so ist <strong>der</strong>zeit – um Wettbewerbsverzerrungzu vermeiden – vom Arbeitgeber <strong>der</strong> halbeRentenversicherungsbeitrag zu entrichten. Allerd<strong>in</strong>gsführt diese Beitragszahlung zu ke<strong>in</strong>em erhöhtenRentenanspruch. Dies ist mit dem Konzept<strong>der</strong> Rentenversicherung, nach dem Beitragszahlungenzu Rentenansprüchen führen sollen, nicht vere<strong>in</strong>bar.Deshalb sollte nach Beendigung <strong>der</strong> Erwerbstätigkeitdes Rentners e<strong>in</strong>e entsprechendeNeuberechnung <strong>der</strong> Rente (also e<strong>in</strong>e Rentenanhebung)erfolgen.9 Zur Höhe des abschlagfreien Rentenalters gab es<strong>in</strong> <strong>der</strong> Kommission drei Me<strong>in</strong>ungen:(a) E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Kommission spricht sich dafür aus,dass ke<strong>in</strong>e Erhöhung des abschlagfreien Rentenalterserfolgen darf, um weitere soziale Ungleichheiten zuvermeiden. Zum Ersten ist die Arbeitsmarktlage bism<strong>in</strong>destens 2015 angespannt, was bei Heraufsetzungdes abschlagfreien Rentenalters zu e<strong>in</strong>er Zunahme <strong>der</strong>Langzeitarbeitslosigkeit Älterer, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gerQualifizierten und <strong>der</strong> Älteren mit gesundheitlichenBee<strong>in</strong>trächtigungen, führen würde. Zum Zweitengeht e<strong>in</strong>e Erhöhung des abschlagfreien Rentenalters zuLasten <strong>der</strong> Beschäftigten auf Arbeitsplätzen mit begrenzterTätigkeitsdauer, <strong>der</strong>en quantitative Bedeutungke<strong>in</strong>esfalls rückläufig ist. Auf solchen Arbeitsplätzenist e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit schon bis zumheutigen Rentenalter nicht möglich. Zum Dritten s<strong>in</strong>ddie Lebenserwartung und damit das Rentenbezugsalter<strong>der</strong> Beschäftigten mit kumulativen Belastungen deutlichger<strong>in</strong>ger als die <strong>der</strong> Beschäftigten, die das künftigerhöhte Rentenalter erreichen können. E<strong>in</strong>e Erhöhungdes abschlagfreien Rentenalters würde die sozialenUngleichheiten h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> möglichen Rentenbezugsdauerverschärfen.(b) E<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er Teil <strong>der</strong> Kommission vertritt demgegenüberfolgende Position: Im Interesse e<strong>in</strong>er Verlängerung<strong>der</strong> Erwerbsphase stellt die Anhebung <strong>der</strong> Altersgrenzefür den abschlagfreien Bezug e<strong>in</strong>erAltersrente <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung imZuge <strong>der</strong> weiter steigenden Lebenserwartung e<strong>in</strong>e <strong>der</strong>Maßnahmen dar, um e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> ErwerbsbeteiligungÄlterer zu beför<strong>der</strong>n. Das Wirksamwerden setztallerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e verän<strong>der</strong>te Arbeitsmarktlage (wie auchweitere flankierende Maßnahmen, so z.B. <strong>zur</strong> erhöhtenWeiterbildung u.a. <strong>der</strong> älteren Erwerbstätigen) voraus,die es den älteren Versicherten ermöglicht, längerim Erwerbsleben verbleiben zu können. Die Ankündigungdieser Maßnahme jetzt, aber das Wirksamwerdenunter <strong>der</strong> oben erwähnten Bed<strong>in</strong>gung, ermöglichtVersicherten wie Arbeitgebern e<strong>in</strong>e frühzeitige Orientierungund ggf. Anpassung an die sich <strong>in</strong> Zukunft än<strong>der</strong>ndensozialrechtlichen Bed<strong>in</strong>gungen. Dieser Teil<strong>der</strong> Kommission hält e<strong>in</strong>e solche Maßnahme unterverteilungs- und sozialpolitischen Gesichtspunktendann für vertretbar, wenn – wofür sie plädiert – dasLeistungsniveau <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungnicht <strong>in</strong> dem Maße reduziert wird, wie dies durchdie bislang beschlossenen Maßnahmen erfolgen würde(siehe Kapitel E<strong>in</strong>kommenslage im Alter). E<strong>in</strong>e (imDurchschnitt) steigende Lebenserwartung bei unverän<strong>der</strong>temAlter des abschlagfreien Rentenbezugs stellte<strong>in</strong>e Leistungsverbesserung dar. Durch die vorgeschlageneMaßnahme erfolgt bei späterem Rentenbeg<strong>in</strong>ne<strong>in</strong>e Aufteilung <strong>der</strong> zusätzlichen Lebenszeit zwischenErwerbs- und Rentnerphase und damit e<strong>in</strong>eM<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>der</strong> sonst e<strong>in</strong>tretenden zusätzlichen F<strong>in</strong>anzbelastung.(c) E<strong>in</strong> Kommissionsmitglied (Prof. Dr. Kreibich) vertrittdie Position, dass es ke<strong>in</strong>e auf e<strong>in</strong> bestimmtes Lebensalterfestgelegte allgeme<strong>in</strong>e Rentene<strong>in</strong>trittsgrenzegeben sollte. Die Folgen e<strong>in</strong>es für alle Arbeitnehmergleichermaßen geltendes Rentene<strong>in</strong>trittsalter habengezeigt, dass alle Modelle mit starren Altersgrenzengescheitert s<strong>in</strong>d. Sie müssen scheitern, weil sich e<strong>in</strong>erseitsdie das Rentene<strong>in</strong>trittsalter bestimmenden Paramenterständig verän<strong>der</strong>n (demografischer Wandel,
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 95 – Drucksache 16/2190ansteigende Lebenszeiten, rasante Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong>allgeme<strong>in</strong>en und beruflichen Qualifikationsanfor<strong>der</strong>ungen,anhalten<strong>der</strong> Trend zu <strong>in</strong>dividualistischen Lebens-und Arbeitsformen etc.) und an<strong>der</strong>erseits diepersönlichen Voraussetzungen für Leistungsmöglichkeitund Motivation im Arbeitsleben für jeden Arbeitnehmervöllig unterschiedlich s<strong>in</strong>d (physische, psychischeund geistige Leistungsfähigkeit, Gesundheit,Qualifikationserwerb und Qualifikationsbereitschaft,<strong>in</strong>dividuelle und familiäre Lebensverhältnisse und Lebensplanungenetc.). Hieraus ergibt sich, dass e<strong>in</strong> fixesRentene<strong>in</strong>trittsalter für alle Arbeitnehmer e<strong>in</strong> Anachronismusist und zudem mit <strong>der</strong> irreversiblen Zunahmevon Informations- und Wissensarbeit <strong>in</strong> <strong>der</strong>mo<strong>der</strong>nen Wissensgesellschaft nicht vere<strong>in</strong>bar se<strong>in</strong>kann. Deshalb wird für die Festlegung e<strong>in</strong>es Grundarbeitsvolumens(auf <strong>der</strong> Grundlage von Arbeitszeitkonten)plädiert, dass e<strong>in</strong>e abschlagfreie Grundrente unddurch sie e<strong>in</strong>e sichere Altersversorgung garantiert. Fürjeden Arbeitnehmer, <strong>der</strong> auf Grund von Arbeitsunfähigkeitnach strengen Prüfungsmaßstäben das Grundarbeitsvolumennicht erbr<strong>in</strong>gen kann, werden Fehlzeitenvon <strong>der</strong> Solidargeme<strong>in</strong>schaft ausgeglichen.Alle Arbeitnehmer können ansonsten je nach Motivation,Arbeitsbereitschaft und Interesse ihrer Fähigkeitenund Kenntnisse so lange und mit je flexiblen Arbeitsvolum<strong>in</strong>ae<strong>in</strong>setzen wie sie das wünschen. Siekönnen somit flexibler auf Anfor<strong>der</strong>ungen des Arbeitsmarktesreagieren. Gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischergibt sich mittel- und langfristig e<strong>in</strong> anArbeitsleistung und Produktivität besser angepasstesf<strong>in</strong>anzierbares Rentenniveau. Die Vorteile <strong>der</strong> Erhaltungvon leistungsfähigen, zuverlässigen, erfahrenenund <strong>in</strong>novativen älteren Arbeitskräften im Arbeitsprozesss<strong>in</strong>d für die Gesellschaft und die Volkswirtschaftunschätzbar und empirisch gut nachgewiesen.10 Erwerbsunfähigkeitsrenten möglichst streng anmediz<strong>in</strong>ische Kriterien koppeln: Die Inanspruchnahmevon Erwerbsunfähigkeitsrenten sollte möglichst streng anmediz<strong>in</strong>ische Kriterien gekoppelt und das Vorliegen <strong>der</strong>mediz<strong>in</strong>ischen Voraussetzungen wirksam überprüft werden.Damit brauchen die Abschläge für Altersrente beivorzeitiger Inanspruchnahme nicht mehr <strong>in</strong> gleichemMaße auf die Erwerbsunfähigkeitsrenten übertragen zuwerden, um Anreize für e<strong>in</strong> Ausweichen <strong>in</strong> diese Rentenartzu vermeiden.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 97 – Drucksache 16/21903 Bildung3.1 E<strong>in</strong>leitungDie OECD hat Deutschland schlechte Noten für se<strong>in</strong> Bildungssystemausgestellt. Die Erzieher<strong>in</strong>nen seien zuschlecht ausgebildet, es würden – vor allem <strong>in</strong> Westdeutschland– zu wenige K<strong>in</strong><strong>der</strong>krippenplätze angeboten,das Schulsystem sei zu selektiv und es würden zu wenigAkademiker ausgebildet. Vor allem <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> Vorschulerziehung,die Verbesserung <strong>der</strong> Ausbildung <strong>der</strong> Erzieher<strong>in</strong>nen,die nicht ohne Folgen für die Bezahlungbleiben kann, die E<strong>in</strong>richtung von Ganztagsschulen unddie Erhöhung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Hochschulabsolventen wirdselbst bei Ausschöpfung aller Effizienzreserven nichtohne zusätzliche Mittel zu bewältigen se<strong>in</strong>. Diese Themenbeherrschen gegenwärtig die bildungspolitische Diskussion<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland.Angesichts <strong>der</strong> Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung ist diese Jugendorientierung<strong>der</strong> bildungspolitischen Diskussion als ambivalentzu beurteilen:– E<strong>in</strong>erseits ist festzuhalten, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> frühk<strong>in</strong>dlichenSozialisation und <strong>der</strong> schulischen Ausbildung dieGrundlagen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>bildung (Sprach- und Lesefähigkeitetc.) und <strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichen Erstausbildungdie Grundlagen für e<strong>in</strong>e erste Berufsausübung und e<strong>in</strong>berufliches Weiterlernen gelegt werden. Bildungsversäumnisse<strong>in</strong> <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>bildung lassen sich nichtbeliebig nachholen. Sie h<strong>in</strong>terlassen bleibende Spuren<strong>in</strong> Form von nicht entwickelter Lernfähigkeit (Bosch2005a). E<strong>in</strong>e berufliche Ausbildung h<strong>in</strong>gegen kanndurchaus im Erwachsenenalter nachgeholt werden, istaber dann wegen des Verdienstausfalls mit höherenKosten verbunden und eröffnet angesichts <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gerenVerbleibsdauer auf dem Arbeitsmarkt oft kaumnoch Aufstiegschancen. E<strong>in</strong> gutes Fundament <strong>in</strong> <strong>der</strong>Allgeme<strong>in</strong>- und Berufsbildung ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alterndenGesellschaft somit e<strong>in</strong>e günstige Voraussetzung fürdas Weiterlernen im Erwachsenenalter. Die Erhöhung<strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen und aktivesAltern erfor<strong>der</strong>n begleitendes Lernen, das se<strong>in</strong>evolle Wirkung nur entfalten kann, wenn es auf präventivenBildungsmaßnahmen aufbaut, die frühzeitig ansetzen.– An<strong>der</strong>erseits ist aber auch unübersehbar, dass <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>emBereich <strong>der</strong> Gegensatz zwischen Anspruch undRealität weiter ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong> klafft als bei den For<strong>der</strong>ungenzum Ausbau des lebenslangen Lernens. Es istbislang <strong>in</strong> Deutschland noch nicht gelungen, dem Lernenim Erwachsenenalter den ihm gebührenden hohenStellenwert <strong>in</strong> den politischen und wirtschaftlichenEntscheidungsprozessen e<strong>in</strong><strong>zur</strong>äumen. Im Gegenteil:Das mit Abstand größte För<strong>der</strong>programm für die WeiterbildungErwachsener, die berufliche Weiterbildung<strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit, wurde <strong>in</strong> den letztenJahren von nahezu 7 Mrd. Euro (13,7 Mrd. DM) imJahre 2001 auf 3,6 Mrd. Euro im Jahr 2004 <strong>zur</strong>ück gefahren.Die Zahl <strong>der</strong> E<strong>in</strong>tritte <strong>in</strong> berufliche Weiterbildungsmaßnahmenbei <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeithat sich von 449.622 (2001) auf 185.041 (2004) verr<strong>in</strong>gert,was e<strong>in</strong>em Rückgang von 59 Prozent entspricht(Bundesagentur für Arbeit 2002, 2005b). Beson<strong>der</strong>sdrastisch war <strong>der</strong> Rückgang <strong>der</strong> E<strong>in</strong>tritte <strong>in</strong>Weiterbildungsmaßnahmen von über 45-jährigen Arbeitslosen,Un- und Angelernten sowie Auslän<strong>der</strong>n,also genau den Beschäftigtengruppen, welche die größtenProbleme haben, bis zum Rentenalter beschäftigt zubleiben. Obgleich alle wichtigen Akteure immer wie<strong>der</strong>die Notwendigkeit e<strong>in</strong>es lebenslangen Lernens über dieJugendphase und die Erstausbildung h<strong>in</strong>weg betonen,sprechen die konkreten Budgetentscheidungen desBundes, <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> und <strong>der</strong> Kommunen bislang lei<strong>der</strong>e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Sprache. Die Bildungsbudgets werden zuGunsten <strong>der</strong> Jüngeren umgeschichtet.Die 5. Altenberichtskommission sieht angesichts <strong>der</strong> demografischenVerän<strong>der</strong>ungen die Notwendigkeit, dieLernmöglichkeiten für Erwachsene sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs-als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase auszubauen.Sie sieht enge Beziehungen zwischen beiden Bereichen.Der Erhalt <strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit bis zum Rentenaltererfor<strong>der</strong>t nicht nur zusätzliche berufsfachliche Kompetenzen,son<strong>der</strong>n zugleich auch im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es ganzheitlichenBildungsbegriffs auch Fähigkeiten <strong>der</strong> Teilhabe anbetrieblichen Entscheidungen und Kompetenzen zum Erhalt<strong>der</strong> eigenen Gesundheit. Diese Fähigkeiten s<strong>in</strong>d beiehrenamtlichen Tätigkeiten und <strong>der</strong> selbstständigen Lebensgestaltung<strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase von Nutzen. DieHerausfor<strong>der</strong>ung ist umso größer, als es heute nicht alle<strong>in</strong>um die Qualifizierung aus <strong>in</strong>dividueller Perspektive zumErhalt <strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit geht, son<strong>der</strong>n um dieQualifizierung im Rahmen e<strong>in</strong>es kollektiven Alterns <strong>der</strong>Erwerbsbevölkerung (Volkholz 2004). Infolge <strong>der</strong> abnehmendenStärke <strong>der</strong> nachwachsenden <strong>Generation</strong>en könnendie ausscheidenden Fachkräfte nicht mehr ersetztwerden, und es ist denkbar, dass „längerfristig auch dieZahl <strong>der</strong> Arbeitsplätze auf Grund von Fachkräftemangels<strong>in</strong>ken wird“ (Volkholz, Kiel & W<strong>in</strong>gen 2002: 271). Derkünftige Fachkräftemangel kann zudem durch den heutigenunterwertigen E<strong>in</strong>satz qualifizierter Arbeitskräfteverstärkt werden (Volkholz 2004b).Im Folgenden werden wir zunächst unseren Bildungsbegriffpräzisieren (3.2). Dabei soll deutlich gemacht werden,dass Lernen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Erwachsenenalter <strong>in</strong>unterschiedlichen Formen und nicht alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> formalenLernstrukturen erfolgt. Anschließend werden Ergebnisseüber die Teilnahme an beruflicher und allgeme<strong>in</strong>er Wei-
Drucksache 16/2190 – 98 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeterbildung dargestellt (3.3). Dabei wird erkennbar, dass esgroße Unterschiede <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bildungsbeteiligung gibt undAlter an sich ke<strong>in</strong> Erklärungsmerkmal für abnehmendeBildungsteilnahme ist. Es folgt e<strong>in</strong>e Zusammenfassung<strong>der</strong> Forschungsergebnisse zum Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase(3.4). Zum Abschluss werden Vorschläge <strong>zur</strong>För<strong>der</strong>ung lebenslangen Lernens unterbreitet, wobei sichdie 5. Altenberichtskommission vor allem auf die Überlegungen<strong>der</strong> OECD sowie <strong>der</strong> Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierungLebenslangen Lernens“ stützt (Expertenkommission„F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“ 2004).Staatliche Zuschüsse sollten nur bei Vorliegen e<strong>in</strong>es öffentlichenInteresses erfolgen. E<strong>in</strong> solches öffentliches Interessebesteht <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dar<strong>in</strong>, den Personen, die sichaus eigener Kraft nicht helfen können, Unterstützung zugewähren. Auch die För<strong>der</strong>ung politischer und gesellschaftlicherTeilhabe und wirtschaftlicher Innovation liegenim öffentlichen Interesse.3.2 Zum BildungsbegriffBildung beschreibt zum e<strong>in</strong>en den Prozess <strong>der</strong> Aneignungund Erweiterung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungenund Wissenssysteme, zum an<strong>der</strong>en das Ergebnis diesesProzesses (Kruse 1997). Konkrete Bildungs<strong>in</strong>haltespiegeln allgeme<strong>in</strong>e kulturelle Werthaltungen und gesellschaftlichePräferenzen ebenso wi<strong>der</strong>, wie die sich ausdem sozialen und wirtschaftlichen Wandel ergebendenfachlichen Inhalte. Bildungsaktivitäten des Individuumss<strong>in</strong>d über den gesamten Lebenslauf bestimmt von denWechselwirkungen zwischen objektiv bestehenden Möglichkeitenund Notwendigkeiten, Neues zu lernen, sowiedem Grad <strong>der</strong> Offenheit des Individuums für neue Erfahrungenund Wissenserwerb.E<strong>in</strong> umfassen<strong>der</strong> Bildungsbegriff beschränkt sich nichtauf die Vermittlung und Aneignung von kodifiziertenWissenssystemen, son<strong>der</strong>n berücksichtigt ausdrücklichauch Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen, die denkreativen E<strong>in</strong>satz von Wissen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er effektivenAuse<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit aktuellen o<strong>der</strong> (potenziell) zukünftigenAufgaben und Anfor<strong>der</strong>ungen för<strong>der</strong>n. Dabeikann man zwischen formalem, non formalem und <strong>in</strong>formellemLernen unterscheiden. Formales Lernen ist hierbeitypischerweise an <strong>in</strong>stitutionelle Kontexte gebunden,ist auf <strong>der</strong> Grundlage von Lernzielen, Dauer, Inhalt, Methodeund Beurteilung strukturiert und wird nicht selten<strong>in</strong> Form von Zeugnissen o<strong>der</strong> Zertifikaten dokumentiert.Non formales ist ebenso wie formales Lernen <strong>in</strong>tendiertesLernen, unterscheidet sich aber <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lernform. Es istnicht auf <strong>der</strong> Grundlage von Lernzielen, Inhalten, Methodenetc. strukturiert, son<strong>der</strong>n beruht auf Erfahrungslernenvor allem im Kontext von Arbeit. Typische Formen desnon formalen Lernens s<strong>in</strong>d Praktika, Lernen am Arbeitsplatzo<strong>der</strong> Jobrotation. In dem <strong>in</strong>tendierten Lernerfolgliegt <strong>der</strong> Unterschied zum <strong>in</strong>formellen Lernen, <strong>der</strong> sichebenfalls auf Lernprozesse <strong>in</strong> Alltagssituationen außerhalbvon klassischen Bildungs<strong>in</strong>stitutionen <strong>in</strong> allen Lebensbereichenbezieht. E<strong>in</strong> gutes Beispiel für <strong>in</strong>formellesLernen ist <strong>der</strong> Austausch von Erfahrungen <strong>in</strong> sozialen Interaktionen,wie er natürlicher Bestandteil gleichberechtigterKommunikation über Alltag und Lebenswelt ist.Unter <strong>der</strong> Voraussetzung, dass die Erfahrungen <strong>der</strong> älteren<strong>Generation</strong> ernst genommen werden, bieten zum Beispielbereits alltägliche, sche<strong>in</strong>bar beiläufige <strong>in</strong>tergenerationelleKontakte für Angehörige jüngerer <strong>Generation</strong>endie pr<strong>in</strong>zipielle Möglichkeit, von den <strong>in</strong> konkreten Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungsformenund Problemlösungen zum Ausdruckkommenden kreativen Potenzialen Älterer zu profitieren.Die häufig mit Analysen zum <strong>in</strong>formellen Lernen verknüpftenAussagen, dass man <strong>in</strong> allen Lebenssituationenlernt und allenfalls 20 Prozent des erlernten Wissens <strong>in</strong>formalen und 80 Prozent <strong>in</strong> non formalen o<strong>der</strong> <strong>in</strong>formellenLernzusammenhängen erworben wird (Dohmen2001), s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs im H<strong>in</strong>blick auf das Lernen Ältereraus zwei Gründen mit größter Vorsicht zu behandeln. Erstenskann man durch Unterfor<strong>der</strong>ung Gelerntes wie<strong>der</strong>verlernen, und Neues lässt sich nur bei vorhandener Lernbereitschaft,Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen und e<strong>in</strong>erlernför<strong>der</strong>lichen Umgebung erlernen (Bosch 2000). DieBiografien unterscheiden sich h<strong>in</strong>sichtlich aller dieser Bed<strong>in</strong>gungenaber erheblich, sodass es Ältere gibt, die kont<strong>in</strong>uierlich<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er lernför<strong>der</strong>lichen Umgebung dazu gelernthaben und sich auch selbst diese Umgebung mitgeschaffen haben, und an<strong>der</strong>e ältere Menschen, die sichnicht entwickeln konnten. Zweitens wird durch e<strong>in</strong>e solchestatische Gegenüberstellung von Prozentanteilen <strong>der</strong>Zusammenhang <strong>der</strong> Lernformen ausgeblendet. Das <strong>in</strong>formalen Lernsituationen erworbene Allgeme<strong>in</strong>- und beruflicheBasiswissen ist vor allem <strong>der</strong> Türöffner für dieStrukturierung und Verarbeitung von Erfahrungswissen.Das dann durch zusätzliche Kenntnisse und Kontextbezügeangereicherte Wissen ermöglicht Handeln <strong>in</strong> komplexenSituationen, was e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> großen Stärken Ältererse<strong>in</strong> kann.Die Bedeutung <strong>der</strong> Bildung für die Entwicklung des Individuumsbeschränkt sich we<strong>der</strong> auf die Zeit <strong>der</strong> Berufstätigkeitnoch auf den beruflichen Bereich. Nebenberufsbezogenen Zielsetzungen, wie Sicherung von wirtschaftlicherEntwicklung und Innovationsfähigkeit o<strong>der</strong>Erhaltung und För<strong>der</strong>ung von Beschäftigungsfähigkeit,s<strong>in</strong>d unter an<strong>der</strong>em Selbstständigkeit, Selbstbestimmungund soziale Teilhabe als bedeutende allgeme<strong>in</strong>e Zielsetzungenvon Erwachsenen- und Altenbildung ebenso zunennen wie die Unterstützung des Individuums bei <strong>der</strong>Verwirklichung o<strong>der</strong> Vervollkommnung unterschiedlichsterFreizeitaktivitäten und Freizeit<strong>in</strong>teressen (Kruse &Schmitt 2001a).In den letzten Jahrzehnten wurde das traditionelle (d.h.e<strong>in</strong> ausschließlich auf die K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugendphase unde<strong>in</strong> am formellen Lernen orientiertes) Bildungsverständnisschrittweise zum Konzept des Lebenslangen Lernenserweitert. Die Geme<strong>in</strong>samkeit aller Konzepte besteht dar<strong>in</strong>,dass das Lernen <strong>in</strong> unterschiedlichen Lebensphasen,<strong>in</strong> unterschiedlichen Erfahrungszusammenhängen und <strong>in</strong>unterschiedlichen Formen als unverzichtbare Bestandteilelebenslangen Lernens gesehen werden. Dies schließtnicht aus, dass sich Lernformen, Lern<strong>in</strong>halte und Lernmotivationen<strong>in</strong> verschiedenen Lebensphasen deutlichunterscheiden:
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 99 – Drucksache 16/2190– In <strong>der</strong> K<strong>in</strong>des- und Jugendphase steht das formalisierteLernen <strong>in</strong> Schule und <strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichen Erstausbildungim Vor<strong>der</strong>grund. Die Entscheidungen über dieBildungsteilnahme werden zunächst vor allem vonden Eltern getroffen. Die Eigenverantwortlichkeit gew<strong>in</strong>ntdann im Übergang zum Erwachsenenalter kont<strong>in</strong>uierlichan Bedeutung. Die Ungleichheiten <strong>der</strong> Bildungschancenwerden stark durch die soziale Herkunftgeprägt.– In <strong>der</strong> Berufsausbildung tritt dann das Verwertungs<strong>in</strong>teressestärker <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>grund als bei <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>bildung<strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule.– In <strong>der</strong> Erwerbsphase gew<strong>in</strong>nt das non formale und <strong>in</strong>formelleLernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit gegenüber formellemLernen an Bedeutung; formelles Lernen spielt allerd<strong>in</strong>gsweiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e wichtige Rolle, wie etwa beimNachholen schulischer und beruflicher Abschlüsseo<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Aufstiegsfortbildung. Beschäftigte <strong>in</strong> Positionenmit hohen Entscheidungsspielräumen, mit gutenAufstiegschancen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>novationsfreudigenbetrieblichen Umfeld erhalten zahlreiche Anstößeund Gelegenheiten für weiteres Lernen. H<strong>in</strong>gegenverkümmern die Fähigkeiten bei Beschäftigten <strong>in</strong> monotonenTätigkeiten mit wenigen Entscheidungsspielräumendurch langjährige Unterfor<strong>der</strong>ung und un<strong>zur</strong>eichendeBildungsangebote (Bosch 2003). Da die<strong>in</strong>dividuellen Ressourcen beschränkt und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwachsenenphasedurch Unterhaltspflichten gebundens<strong>in</strong>d, und <strong>der</strong> Arbeitsmarkt solchen Arbeitskräftenmeist nur ger<strong>in</strong>ge Chancen bietet, können sich die Beschäftigtendieser Verr<strong>in</strong>gerung ihrer Beschäftigungsfähigkeitoft nicht entziehen. Sie verlieren vor Erreichungdes Rentenalters ihre Beschäftigungsfähigkeit.Erwachsene haben e<strong>in</strong>e höhere Eigenverantwortungals K<strong>in</strong><strong>der</strong> o<strong>der</strong> Jugendliche für ihre Bildung. DerGrad <strong>der</strong> Eigenverantwortung und <strong>der</strong> Fähigkeit <strong>zur</strong>Selbststeuerung des Lernens ist <strong>in</strong> hohem Maße abhängigvom erreichten Bildungsniveau. Angesichts<strong>der</strong> Bildungsdefizite vieler Erwachsener o<strong>der</strong> <strong>der</strong>Zwänge, denen sie <strong>in</strong> ihrem Erwerbsleben unterliegen,laufen Appelle an die Eigenverantwortung für die eigeneBeschäftigungsfähigkeit im Erwachsenenalterbei e<strong>in</strong>igen Gruppen <strong>in</strong>s Leere.– In <strong>der</strong> Nacherwerbsphase entfällt <strong>der</strong> unmittelbareVerwertungsdruck, <strong>der</strong> das Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsphaseund heute zunehmend auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Jugend prägt.Es entfällt aber auch das Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeit, was allerd<strong>in</strong>gsdurch neue Formen des Lernens etwa <strong>in</strong> ehrenamtlichenTätigkeiten ersetzt werden kann. Auf <strong>der</strong>e<strong>in</strong>en Seite können die Älteren ihre neuen Freiheitennutzen und sich aus Interesse und Freude an bestimmtenInhalten weiterbilden und sich damit unter an<strong>der</strong>emauch Tätigungsfel<strong>der</strong>, wie etwa <strong>in</strong> Ehrenämternerschließen; auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite ist <strong>der</strong> Erhalt <strong>der</strong> eigenenGesundheit und <strong>der</strong> sozialen Selbstständigkeitan Lernen gebunden (Kruse 2004).Durch diese Ausführungen sollte verdeutlicht werden,dass– erstens Lernen im Erwachsenenalter <strong>in</strong> unterschiedlichenLernformen mit stärkerem, aber nicht ausschließlichemAkzent auf non formalem und <strong>in</strong>formellemLernen stattf<strong>in</strong>det mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schränkung, dass vieleErwachsene ke<strong>in</strong>en Zugang zum non formalen und <strong>in</strong>formellenLernen haben,– zweitens die Eigenverantwortung und die Fähigkeit<strong>der</strong> Selbststeuerung des Lernens zunimmt, was allerd<strong>in</strong>gsnicht bei allen vorausgesetzt werden kann, und– drittens aus unterschiedlichen Motiven gelernt wird,wobei im Erwerbsalter die berufliche Verwertbarkeite<strong>in</strong>e große Rolle spielt und dieses Motiv <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphaseentfällt.Diese unterschiedlichen Lernaspekte wurden 1972 imFaure-<strong>Bericht</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em emphatischen Bildungsbegriff zusammengefasst,<strong>in</strong> dem es heißt: „E<strong>in</strong>e weite Def<strong>in</strong>itiondes Bildungsziels könnte heißen: Schaffung <strong>der</strong> körperlichen,geistigen, emotionalen und moralischen Ganzheitdes Menschen“ (Faure 1972). Die 5. Altenberichtskommissionbefasst sich vor allem mit dem Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs-und Nacherwerbsphase. Die bisherigen Def<strong>in</strong>itionendes lebenslangen Lernens s<strong>in</strong>d dabei e<strong>in</strong> guterAusgangspunkt, wenngleich sie durch ihr beson<strong>der</strong>es Augenmerkauf die Erwachsenen bis zum Rentenalter „erwerbslastig“s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>dem sie vor allem die Berufsorientierungsowie Verwertungs- und Mobilitätsaspekte betonen.Zudem s<strong>in</strong>d die Def<strong>in</strong>itionen oft „normativ“, <strong>in</strong>dem sieMotivationen, Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und Bildungsverhaltenunterstellen, die erst noch herzustellen s<strong>in</strong>d.Die unabhängige Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierung LebenslangenLernens“ expliziert ihr Konzept des LebenslangenLernens anhand von sieben Punkten:– Lebenslanges Lernen umfasst die Gesamtheit allenformalen, non formalen und <strong>in</strong>formellen Lernens überden gesamten Lebenszyklus e<strong>in</strong>es Menschen h<strong>in</strong>weg.– Lebenslanges Lernen ist e<strong>in</strong> Lernen auf durchlässigenund zugleich mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verzahnten Bildungspfaden.– Lebenslanges Lernen ist e<strong>in</strong> Lernen <strong>in</strong> Eigenverantwortung,wobei eigenverantwortliches Handeln selbstwie<strong>der</strong>um e<strong>in</strong>en Lernprozess voraussetzt.– Lebenslanges Lernen ist e<strong>in</strong> Lernen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er vielfältigenund transparenten Angebotslandschaft.– Lebenslanges Lernen heißt, Lernen durch die Bereitstellungvon ausreichenden Ressourcen zu ermöglichen.– Lebenslanges Lernen ist e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle, unternehmerischeund gesellschaftliche Investition.– Lebenslanges Lernen heißt Lernen unter den Bed<strong>in</strong>gungenvon Transparenz, begleiten<strong>der</strong> Beratung undQualitätssicherung („F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“2004: 21).Die Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanung undForschungsför<strong>der</strong>ung hat mit <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Strategie„Lebenslangen Lernens“ das Ziel verfolgt, „darzustellen,wie das Lernen 10 aller Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger <strong>in</strong>
Drucksache 16/2190 – 100 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeallen Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenenLernorten und <strong>in</strong> vielfältigen Lernformen angeregtund unterstützt werden kann“ (Bund-Län<strong>der</strong>-Kommissionfür Bildungsplanung und Forschungsför<strong>der</strong>ung 2004: 4).Die Strategie orientiert sich zum e<strong>in</strong>en an den Lebensphasenvon <strong>der</strong> frühen K<strong>in</strong>dheit bis <strong>in</strong>s hohe Alter, zum an<strong>der</strong>enan wesentlichen Elementen für lebenslanges Lernen,so genannten Entwicklungsschwerpunkten. Zu diesenzählen:– E<strong>in</strong>beziehung <strong>in</strong>formellen Lernens,– Selbststeuerung,– Kompetenzentwicklung,– Vernetzung,– Modularisierung,– Lernberatung,– Neue Lernkultur/Popularisierung des Lernens,– Chancengerechter Zugang.Infolge von zunehmenden Verän<strong>der</strong>ungen, die zum Teilauch als Brüche beschrieben werden können (zu nennens<strong>in</strong>d hier etwa Elternzeit, unterschiedliche berufliche Tätigkeiteno<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit), ergibt sich nach <strong>der</strong>Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission die Notwendigkeit des lebenslangenLernens für Erwachsene. Lernen sei hier im Vergleichzu früheren Lebensabschnitten weniger <strong>in</strong>stitutionellgeprägt, wegen <strong>der</strong> stärkeren E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> Familieund Beruf seien vor allem selbststrukturierbare Angebote(Fernunterricht, computergestütztes Lernen), die e<strong>in</strong>e flexibleAnpassung von Lernzeiten an <strong>in</strong>dividuelle Bedürfnisseerlauben, bedeutsam (= EntwicklungsschwerpunktSelbststeuerung). Die durch <strong>in</strong>formelles Lernen im Kontextvon Arbeit und Familie erworbenen Qualifikationenund Kompetenzen sollten durch Dokumentation und Anerkennung(Zertifizierung) verwertbar gemacht werden.Im Zuge e<strong>in</strong>er „Popularisierung des Lernens“ sei deutlichzu machen, dass sich Lernen für den Lernenden auszahle.Durch die Nutzung von Modulen aus formalen Bildungsgängensei es möglich, schrittweise <strong>in</strong>dividuelle Kompetenzprofileaufzubauen.Des Weiteren sei im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Strategie zu for<strong>der</strong>n, dasssich Unternehmen, Bildungse<strong>in</strong>richtungen und Arbeitsvermittlungen<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Form vernetzen, die den „beson<strong>der</strong>enUmständen Erwachsener“ entspricht, d.h. „den Anfor<strong>der</strong>ungenan Transparenz und Beratung im Kontextvielseitiger, zeitlich b<strong>in</strong>den<strong>der</strong>, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e familiärerVerpflichtungen“ gerecht wird. Ähnlich gelte für dieLernberatung Erwachsener, dass sie <strong>der</strong> Vielzahl ausgeübterBerufe ebenso gerecht werden muss wie <strong>in</strong>dividuellenBegabungen, Interessen und Lebenssituationen: „DieBeratung ist – ausgerichtet an realistischen Lern- und Berufszielen– behilflich bei <strong>der</strong> selbst gesteuerten Gestaltungvon Lernarrangements durch umfassende Informationenüber Möglichkeiten <strong>der</strong> Weiterqualifizierung und10 Hier verstanden als „konstruktives Verarbeiten von Informationenund Erfahrungen zu Kenntnissen, E<strong>in</strong>sichten und Kompetenzen“.<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>ung. Die Lernberatung für Erwachsene arbeitetvernetzt, d.h. sie gibt Informationen über Hilfen <strong>in</strong>beson<strong>der</strong>en Lebenslagen und vermittelt Kontakte. Siehilft bei Krisen im Lernprozess. Sie leistet dabei bildungsbereichsübergreifendeBeratung und Hilfestellung“(Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanung undForschungsför<strong>der</strong>ung 2004: 24f.).Wie man solch anspruchsvolle Konzepte lebenslangenLernens realisieren kann, wird Gegenstand <strong>der</strong> Abschnitte3.5 und 3.6 se<strong>in</strong>. Zuvor werden wir aber e<strong>in</strong>enBlick auf die Ungleichheiten <strong>der</strong> Teilnahme an Bildungim Erwachsenenalter werfen, die deutlich machen, wieweit wir noch von <strong>der</strong> Realisierung solcher Visionen entfernts<strong>in</strong>d.3.3 Bildung und Lernen im ErwerbsalterDie Lernkapazität ist im Alter im Durchschnitt ger<strong>in</strong>gerals <strong>in</strong> früheren Abschnitten des Lebenslaufs, doch zeigenauch ältere Menschen <strong>in</strong> neuartigen Situationen e<strong>in</strong>deutignachweisbare Lernerfolge. Neben diesen mittelwertbasiertenAussagen, die für e<strong>in</strong>e Abnahme <strong>der</strong> Leistungskapazitätim Alter sprechen, ist die sehr stark ausgeprägte<strong>in</strong>ter<strong>in</strong>dividuelle Variabilität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lernkapazität zu berücksichtigen,die vor allem auf die Lerngeschichte desIndividuums und die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lerngeschichte entwickeltenWissenssysteme und Lernstrategien verweist (Kruse &Schmitt 2004; Zimprich 2004).Zahlreiche Studien belegen, dass im Lebenslauf entwickelteWissenssysteme und Handlungsstrategien vielfachE<strong>in</strong>bußen <strong>in</strong> Funktionen ausgleichen können, <strong>der</strong>en Leistungskapazitätvon basalen neuronalen Prozessen bestimmtist und <strong>in</strong> denen zum Teil schon ab dem viertenLebensjahrzehnt, zum Teil ab dem fünften o<strong>der</strong> sechstenLebensjahrzehnt Alterungsprozesse erkennbar s<strong>in</strong>d: Zunennen s<strong>in</strong>d die Verarbeitungsgeschw<strong>in</strong>digkeit, die Umstellungsfähigkeitund die Psychomotorik sowie das Arbeitsgedächtnis(Kliegl & Mayr 1997; L<strong>in</strong>denberger2000).Hoch entwickelte und leicht abrufbare Wissenssystemedes Menschen s<strong>in</strong>d auch im S<strong>in</strong>ne von Vorwissen zu <strong>in</strong>terpretieren.Dieses Vorwissen kann Abrufstrukturen bereitstellen,mit <strong>der</strong>en Hilfe E<strong>in</strong>bußen im Arbeitsgedächtnisteilweise kompensiert werden. Der Prozess des Vorausdenkens,<strong>der</strong> <strong>in</strong> hohem Maße von <strong>der</strong> Kapazität des Arbeitsgedächtnissesabhängt, wird durch reichhaltigesVorwissen, vor allem durch wissensabhängige Abrufstrukturen,<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Effizienz unterstützt (Kruse &Rud<strong>in</strong>ger 1997). Wissens- und handlungsbasierte Erfahrungenführen vor allem bei komplexen Tätigkeiten zu e<strong>in</strong>emLeistungszuwachs. Bei komplexen Arbeitstätigkeitenwerden die besten Leistungen vielfach erst imhöheren Alter gezeigt, da hier e<strong>in</strong>e längere Lernzeit <strong>zur</strong>Akkumulation von Erfahrung und Expertise führen kann(Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993; Kruse & Packebuschim Druck); bei sehr e<strong>in</strong>fachen Tätigkeiten lässtsich <strong>der</strong> E<strong>in</strong>fluss von Erfahrung h<strong>in</strong>gegen nicht nachweisen.Positive Effekte des Alters (auch hier verstanden imS<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er längeren Lernzeit) ließen sich auch auf <strong>der</strong>Ebene <strong>der</strong> Führungstätigkeiten nachweisen: In e<strong>in</strong>er Stu-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 101 – Drucksache 16/2190die wurden Managerqualitäten mithilfe von Entscheidungsf<strong>in</strong>dungstestsuntersucht. Ältere Manager warenzwar langsamer, sie bezogen jedoch mehr Informationene<strong>in</strong> und waren umsichtiger, flexibler und selbstkritischer.Das ‚implizite Wissen‘ über den Beruf kommt hier <strong>zur</strong>Geltung. Dieses för<strong>der</strong>t die effektive Ausrichtung auf entscheidendeMerkmale des beruflichen Erfolgs (Klempp &McClelland 1986).Neben den Wissenssystemen und Handlungsstrategienkommt dem Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e bedeutende kompensatorischeFunktion für alterskorrelierte E<strong>in</strong>bußen <strong>in</strong> Funktionen zu.In mehreren Studien konnte nachgewiesen werden, dass<strong>in</strong> Bezug auf Geschw<strong>in</strong>digkeit Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gseffekte größers<strong>in</strong>d als Alterseffekte; das Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g kann zum Teil Alterseffektevollständig aufheben. Hohe Spezifität des Inhalts,hohe persönliche Relevanz und langfristige zeitlicheInvestitionen s<strong>in</strong>d Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für e<strong>in</strong>erfolgreiches Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramm (Kruse & Schmitt2001b).In Bezug auf die Leistungsgrenzen s<strong>in</strong>d Untersuchungenzu nennen, <strong>in</strong> denen gezeigt werden konnte, dass Altersunterschiede<strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichen Leistungsfähigkeit dannauftreten, wenn Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter <strong>in</strong> <strong>der</strong>ausgeübten Tätigkeit nur über ger<strong>in</strong>ge Erfahrungen verfügenund somit Leistungse<strong>in</strong>bußen nicht kompensierenkönnen. Zudem s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> kognitiv beson<strong>der</strong>s stark belastendenBerufen alterskorrelierte E<strong>in</strong>bußen durch Erfahrungnicht mehr kompensierbar (Kliegl & Mayr 1997).Schließlich bleiben auch bei großer Erfahrung alterskorrelierteVerluste <strong>in</strong> solchen Tätigkeiten nicht aus, die <strong>in</strong>beson<strong>der</strong>s hohem Maße von <strong>der</strong> Verarbeitungskapazitätbee<strong>in</strong>flusst s<strong>in</strong>d; zu nennen s<strong>in</strong>d hier Ergebnisse aus Studien,an denen Architekten o<strong>der</strong> Designer teilgenommenhaben (L<strong>in</strong>denberger, Kliegl & Baltes 1992).Aus Befunden <strong>der</strong> MacArthur Studie geht hervor, dass dieDom<strong>in</strong>anz monotoner Tätigkeiten im Berufsleben dazubeitragen kann, dass die geistige Flexibilität <strong>zur</strong>ückgeht,während Problemlösefähigkeiten von Menschen, die sichim Beruf immer wie<strong>der</strong> mit neuen Aufgaben und Herausfor<strong>der</strong>ungenause<strong>in</strong>an<strong>der</strong> setzen mussten und die auchnach Austritt aus dem Beruf neue Aufgaben und Herausfor<strong>der</strong>ungengesucht haben, im Alter ke<strong>in</strong>e wesentlicheVerän<strong>der</strong>ung zeigen (Rowe & Kahn 1998). Daraus lässtsich folgern, dass das Nicht-Abrufen elaborierter Wissenssystemeauf Dauer dazu beiträgt, dass diese <strong>zur</strong>ückgeheno<strong>der</strong> ganz verloren gehen. Die Orientierung an e<strong>in</strong>emnegativen Stereotyp beruflicher Leistungsfähigkeitälterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmer kann entsprechenddazu beitragen, dass die Lern- und Leistungsfähigkeitälterer Arbeiter auf Dauer <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er sichselbst erfüllenden Prophezeiung <strong>zur</strong>ückgeht (Naegele2002b; Schmitt 2004).Im Folgenden sollen die wichtigsten Forschungsergebnisse<strong>zur</strong> Weiterbildungsteilnahme und den Auswirkungen<strong>der</strong> Weiterbildung zusammengefasst werden. Wir unterscheidendabei zwischen allgeme<strong>in</strong>er und beruflicherWeiterbildung. Berufliche Weiterbildung hat e<strong>in</strong>en konkretenVerwertungsbezug. Sie dient <strong>der</strong> Erweiterung e<strong>in</strong>erberufsfachlichen Qualifikation o<strong>der</strong> ist auf die Bewältigungneuer Arbeitsplatzanfor<strong>der</strong>ungen ausgerichtet. Allgeme<strong>in</strong>eWeiterbildung wird aus sehr unterschiedlichenZielsetzungen verfolgt, die von dem Nachholen von schulischenQualifikationen, über kulturelle und politischeBildung bis h<strong>in</strong> <strong>zur</strong> Weiterbildung als konkrete Lebenshilfe(K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung, gesunde Lebensführung) und fürehrenamtliches Engagement reicht. Die Abgrenzung <strong>der</strong>verschiedenen Formen <strong>der</strong> Weiterbildung ist nicht e<strong>in</strong>deutig.Klavierunterricht ist für e<strong>in</strong>en Pianisten beruflicheBildung, für an<strong>der</strong>e Allgeme<strong>in</strong>bildung. Auch die Abgrenzungzwischen Bildung und Konsum und Freizeit istnicht immer e<strong>in</strong>fach. Bildungsmaßnahmen – gerade imkulturellen Bereich – s<strong>in</strong>d oft e<strong>in</strong>e Mischung zwischenWeiterbildung und aktiver Lebensführung und Freizeitgestaltung.Für e<strong>in</strong> aktives Altern ist diese Form <strong>der</strong> Lebensführunge<strong>in</strong>e zentrale Voraussetzung.3.3.1 Allgeme<strong>in</strong>e WeiterbildungDie Teilnahme an formeller allgeme<strong>in</strong>er Weiterbildung(Kurse, Vorträge, Lehrgänge) ist nach den Ergebnissendes <strong>Bericht</strong>ssystems Weiterbildung zwischen 1979 und1997 deutlich gestiegen. Seitdem ist die Teilnahme wie<strong>der</strong>auf das Niveau von 1997 <strong>zur</strong>ückgegangen (Abbildung19). Es ist nicht auszuschließen, dass die Verlängerung<strong>der</strong> Arbeitszeiten seit 1997 und die wachsende Sorge umden Arbeitsplatz die Nachfrage nach allgeme<strong>in</strong>er Weiterbildunghat <strong>zur</strong>ückgehen lassen.In Ostdeutschland liegt die Teilnahme an allgeme<strong>in</strong>erWeiterbildung niedriger als <strong>in</strong> Westdeutschland (Teilnahmequote2003 <strong>in</strong> Westdeutschland 27 Prozent, <strong>in</strong> Ostdeutschland21 Prozent 2003). Viele Ostdeutsche habensich seit <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>vere<strong>in</strong>igung beruflich neu orientierenmüssen und daher relativ mehr <strong>in</strong> berufliche als <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>eWeiterbildung <strong>in</strong>vestiert (siehe Abschnitt 3.3.2).Die höchsten Teilnahmequoten wurden <strong>in</strong> den ThemenbereichenSprachkenntnisse (5 Prozent), Computer und Internet(5 Prozent), Gesundheit und gesundheitsgerechteLebensführung (4 Prozent), Rechtsfragen (2 Prozent),K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung (2 Prozent), Kultur (2 Prozent), Sport(2 Prozent), praktische Kenntnisse (2 Prozent) und Politik(1 Prozent) erreicht.Die Teilnahmequoten unterscheiden sich erheblich nach<strong>in</strong>dividuellen Merkmalen, Stellung im Beruf sowie Geme<strong>in</strong>detyp.Die wichtigsten E<strong>in</strong>flussfaktoren für die Teilnahmes<strong>in</strong>d:– Der Schulabschluss (Personen mit niedrigem Schulabschluss17 Prozent und mit Abitur 37 Prozent),– Die Berufsausbildung (Personen ohne Berufsausbildung16 Prozent und mit Hochschulabschluss 38 Prozent),– Erwerbstätigkeit (Erwerbstätige 28 Prozent, Nichterwerbstätige20 Prozent),– Stellung im Betrieb (Arbeiter 18 Prozent, Angestellte32 Prozent),– Geschlecht (Frauen 27 Prozent, Männer 24 Prozent),
Drucksache 16/2190 – 102 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode– Nationalität (Deutsche 26 Prozent, Auslän<strong>der</strong> 21 Prozent,Deutsche mit Migratonsh<strong>in</strong>tergrund 18 Prozent),– Geme<strong>in</strong>detyp (weniger als 20.000 E<strong>in</strong>wohner 23 Prozent,mehr als 500.000 28 Prozent).Das <strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung zeigt ferner, dass dieTeilnahme an allgeme<strong>in</strong>er Weiterbildung mit dem Alters<strong>in</strong>kt (Tabelle 6). Die Unterschiede zwischen den Altersgruppenhaben sich von 1979 bis 1997 verr<strong>in</strong>gert unds<strong>in</strong>d seitdem etwa unverän<strong>der</strong>t. Die re<strong>in</strong> deskriptive Statistikim <strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung ist nicht ganz befriedigend.Sie lässt nicht erkennen, ob die unterschiedlichenTeilnahmequoten nach Alter nicht durch an<strong>der</strong>eGründe (etwa unterschiedliche Qualifikationsprofile) erklärtwerden können. Es ist zudem zu vermuten, dass dieAltersunterschiede je nach Thema ganz unterschiedlichausfallen. Bei den Computer- und Internetkursen undKursen <strong>zur</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung werden die Teilnahmequoten<strong>der</strong> Älteren möglicherweise unter, bei politischer undkultureller Weiterbildung über dem Durchschnitt liegen.Das non formale Lernen im Bereich <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>bildungwurde über Fragen zum Selbstlernen außerhalb <strong>der</strong>Arbeitszeit erhoben. Hier liegen die Teilnahmequotenüber denen <strong>der</strong> formalen Weiterbildung. 35 Prozent <strong>der</strong>Befragten gaben an, über verschiedene Medien (Fachbücher,Computerkurse, Videokassetten o<strong>der</strong> auch Hilfe vonan<strong>der</strong>en Personen) gelernt zu haben. Hier standen dieThemengebiete Computer/Internet, Sprachen, Gesundheit,Reparaturen/Heimwerken im Vor<strong>der</strong>grund. Je<strong>der</strong>zweite Selbstlerner wendete dafür mehr als e<strong>in</strong>e Wocheim Jahr auf. 28 Prozent sahen e<strong>in</strong>en vollen Lernerfolg,54 Prozent me<strong>in</strong>ten, zum größten Teil ihre Lernziele erreichtzu haben, und 17 Prozent beurteilten den Lernerfolgmit „e<strong>in</strong>igermaßen“. Die Daten s<strong>in</strong>d nicht nachAlter aufgeschlüsselt worden (Bundesm<strong>in</strong>isterium fürBildung und Forschung 2005: 60ff.).Aus diesen Daten lässt sich nicht mit letzter Sicherheit erkennen,ob e<strong>in</strong>e generelle „Benachteiligung“ Älterer vorliegt.Ger<strong>in</strong>gere Teilnahmequoten Älterer alle<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d jedenfallske<strong>in</strong> h<strong>in</strong>reichen<strong>der</strong> Indikator, da Bildung ja denGrundstock für aktives Handeln und <strong>in</strong>formelles Weiter-Lernen <strong>in</strong> Handlungssituationen bildet und man denGrundstock für die Allgeme<strong>in</strong>bildung <strong>in</strong> jüngeren Lebensjahrenlegen sollte. Allgeme<strong>in</strong>bildung ist im bestenFalle im Lebensablauf e<strong>in</strong>e frühe Investition, <strong>der</strong>enFrüchte man dann bei Pflege und Verbesserung des Bestandsernten kann. Gleichwohl ist davon auszugehen,dass die hohen Unterschiede <strong>in</strong> den Teilnahmequoten vorallem nach Qualifikation und Stellung im Betrieb <strong>in</strong> jüngerenebenso wie <strong>in</strong> höheren Lebensjahren auf erheblicheUngleichheiten h<strong>in</strong>weisen mit erheblichen Barrieren beimZugang <strong>zur</strong> beruflichen Weiterbildung, <strong>zur</strong> selbstgestaltetenLebensführung und gesellschaftlichen Teilhabe fürdie Benachteiligten.Tabelle 6Teilnahme an Weiterbildung nach Altersgruppen 1979 - 2003 im früheren Bundesgebiet,Teilnahmequoten <strong>in</strong> ProzentWeiterbildung<strong>in</strong>sgesamtAllgeme<strong>in</strong>eWeiterbildungBeruflicheWeiterbildungAltersgruppe 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 200319 - 34 Jahre 34 38 32 43 44 49 53 47 4635 - 49 Jahre 21 31 25 37 40 47 54 49 4650 - 64 Jahre 11 14 14 20 23 28 36 31 3119 - 34 Jahre 23 28 23 27 25 30 35 29 2935 - 49 Jahre 16 21 17 24 24 29 33 29 2750 - 64 Jahre 9 11 12 14 15 19 26 21 2019 - 34 Jahre 16 15 14 23 25 27 33 31 2935 - 49 Jahre 9 15 14 20 24 29 36 36 3150 - 64 Jahre 4 4 6 8 11 14 20 18 17Quelle: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung 2005: 26. Datenbasis: <strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung IX.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 103 – Drucksache 16/2190Allgeme<strong>in</strong>e Weiterbildung 1979 bis 2003 im VergleichAbbildung 1935%30%31%26%26% 26%25%21%22% 22%Teilnahme <strong>in</strong> Prozent20%15%18%18%10%5%0%1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003Quelle: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung 2005: 16. Datenbasis: <strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung IX.3.3.2 Berufliche WeiterbildungH<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung verfügen wirüber deutlich mehr Datenquellen. Neben den Daten des<strong>Bericht</strong>ssystems Weiterbildung IX liegen Information ausan<strong>der</strong>en Befragungen von Individuen und Betrieben auchim <strong>in</strong>ternationalen Vergleich vor. Wir werden im Folgendenzunächst die wichtigsten Ergebnisse aus dem <strong>Bericht</strong>ssystemberufliche Weiterbildung vorstellen und siedurch Erkenntnisse aus an<strong>der</strong>en Studien ergänzen.Die Teilnahmequote <strong>der</strong> Personen im Erwerbsalter bei <strong>der</strong>formalen beruflichen Weiterbildung (Lehrgänge, Kurse)hat sich zwischen 1979 und 1997 verdreifacht und istdeutlich stärker angestiegen als die <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Weiterbildung.Seit 1997 ist die Teilnahmequote jedoch wie<strong>der</strong>um 4 Prozentpunkte gesunken. Dafür s<strong>in</strong>d vermutlichdrei Gründe verantwortlich. Die Unternehmen <strong>in</strong>vestierenheute weniger als Ende <strong>der</strong> 1990er-Jahre <strong>in</strong> Weiterbildung,da die Wirtschaft nur wenig wächst und viele Unternehmenaus kurzfristigen Überlegungen ihre Budgetsfür Weiterbildungs<strong>in</strong>vestitionen <strong>zur</strong>ückfahren (Expertenkommission„F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“ 2002:89f.). E<strong>in</strong> zweiter Grund liegt <strong>in</strong> verän<strong>der</strong>ten E<strong>in</strong>schätzungen<strong>der</strong> Befragten. 2003 me<strong>in</strong>ten 38 Prozent, dass sieauch ohne Weiterbildung auf dem Arbeitsmarkt guteChancen hätten, 1997 waren es nur 34 Prozent (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Bildung und Forschung 2005: 97). E<strong>in</strong>dritter Grund ist <strong>in</strong> den starken E<strong>in</strong>schnitten bei den Weiterbildungsmaßnahmen<strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit zusehen.Im Unterschied zu <strong>der</strong> Teilnahme an allgeme<strong>in</strong>er Weiterbildunglag die an beruflicher Weiterbildung <strong>in</strong> Ostdeutschlandzwischen 1991 und 2000 teilweise deutlichüber dem Niveau <strong>in</strong> Westdeutschland. Dies ist vor allemFolge <strong>der</strong> beruflichen Re-Orientierung <strong>der</strong> meisten Ostdeutschennach <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>igung. Vor allem die beruflichenUmschulungen hatten <strong>in</strong> Ostdeutschland e<strong>in</strong> wesentlichhöheres Gewicht als <strong>in</strong> Westdeutschland. DieserProzess sche<strong>in</strong>t nun abgeschlossen, da sich im Jahre 2003die Teilnahmequoten <strong>in</strong> Ost- und Westdeutschland nunmehrangeglichen haben.Ebenso wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Bildung zeigen sich erheblichesoziale Ungleichheiten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Teilnahme an beruflicherBildung. Die wichtigsten E<strong>in</strong>flussfaktoren s<strong>in</strong>d:– Der Schulabschluss (Personen mit niedrigem Schulabschluss16 Prozent und mit Abitur 38 Prozent),– Die Berufsausbildung (Personen ohne Berufsausbildung11 Prozent und mit Hochschulabschluss 44 Prozent),– Erwerbstätigkeit (Erwerbstätige 34 Prozent, Nichterwerbstätige8 Prozent),– Stellung im Betrieb (ungelernte Arbeiter 13 Prozent,leitende Angestellte 47 Prozent),
Drucksache 16/2190 – 104 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode– Geschlecht (Frauen 24 Prozent, Männer 28 Prozent),11 Im <strong>Bericht</strong>ssystem wird hierfür <strong>der</strong> Begriff des <strong>in</strong>formellen Lernensverwendet, den die Kommission allerd<strong>in</strong>gs so breit genutzt nicht fürtrennscharf hält, da er nicht zwischen <strong>in</strong>tendiertem und nicht<strong>in</strong>tendiertemLernen unterscheidet.– Nationalität (Deutsche 31 Prozent, Auslän<strong>der</strong> 15 Prozent,Deutsche mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund 19 Prozent),– Geme<strong>in</strong>detyp (weniger als 20.000 E<strong>in</strong>wohner 26 Prozent,mehr als 500.000 27 Prozent),– Alter (19 bis 34 Jahre 29 Prozent, 50 bis 64 Jahre17 Prozent).Die E<strong>in</strong>flussfaktoren s<strong>in</strong>d ähnlich wie bei <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>enBildung, allerd<strong>in</strong>gs gibt es e<strong>in</strong>ige Unterschiede. Die Unterschiede<strong>in</strong> <strong>der</strong> Teilnahme an beruflicher Weiterbildungnach Alter, Bildungsabschlüssen, Stellung im Betrieb,Nationalität und Erwerbstätigkeit s<strong>in</strong>d stärker ausgeprägtals bei <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Weiterbildung. Der Geme<strong>in</strong>detypbee<strong>in</strong>flusst die Teilnahme an beruflicher Bildung nicht,und beim Geschlecht vertauschen sich die Unterschiede.In <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung weisen Frauen ger<strong>in</strong>gereTeilnahmequoten auf.Diese Unterschiede lassen sich wie folgt erklären: Erstensspielen <strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung die Zuweisungzu bestimmten Typen von Arbeitsplätzen und die Verlagerung<strong>der</strong> Teilnahmeentscheidung vom Individuum zumUnternehmen e<strong>in</strong>e große Rolle. Es ist bekannt, dass geradeger<strong>in</strong>ger Qualifizierte, Frauen und Auslän<strong>der</strong> häufigerauf Arbeitsplätzen mit restriktiven Anfor<strong>der</strong>ungen zuf<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d und von den Unternehmen weniger <strong>in</strong> Weiterbildunge<strong>in</strong>bezogen werden. Es ist nicht auszuschließen,dass die oben erwähnte E<strong>in</strong>schätzung, man komme im beruflichenLeben auch ohne Weiterbildung <strong>zur</strong>echt, aufkonkreten betrieblichen Erfahrungen <strong>der</strong> Zunahme wenigerlernför<strong>der</strong>licher Arbeitsplätze und e<strong>in</strong>er breiten Unterfor<strong>der</strong>ungvieler Beschäftigter beruht. Zweitens erweistsich das ger<strong>in</strong>gere Bildungsangebot <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>enGeme<strong>in</strong>den bei <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung nicht unbed<strong>in</strong>gtals restriktiver Faktor, da die Betriebe ihre eigenenBildungsangebote organisieren können.An<strong>der</strong>s als bei <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Weiterbildung kann mandie Altersunterschiede nur teilweise mit dem Bild <strong>der</strong> frühenInvestition und <strong>der</strong> späteren Ernte erläutern. BeruflicheWeiterbildung hat gerade die Funktion <strong>der</strong> Auffrischung,<strong>der</strong> Anpassung und <strong>der</strong> Erweiterung <strong>der</strong>Kompetenzen, die fast alle Beschäftigten nötig haben.Gefragt wurde auch nach dem non formalen beruflichenLernen. 11 Den Befragten wurde e<strong>in</strong>e breite Palette vonLernformen angeboten, die von Unterweisungen am Arbeitsplatzbis h<strong>in</strong> zum Lesen von Fachliteratur reicht. DieTeilnahmequoten s<strong>in</strong>d hier mit 61 Prozent deutlich höherals bei <strong>der</strong> formalen Weiterbildung (Tabelle 7).Bemerkenswert ist vor allem, dass hier die Ungleichheitenger<strong>in</strong>ger s<strong>in</strong>d als bei <strong>der</strong> formalen Weiterbildung. UngelernteArbeiter haben hier e<strong>in</strong>e Teilnahmequote von immerh<strong>in</strong>43 Prozent gegenüber leitenden Angestellten von79 Prozent. Allerd<strong>in</strong>gs werden im Detail klare Unterschiede<strong>in</strong> den Lernformen erkennbar. Für Ungelerntespielt die fremdbestimmte Unterweisung e<strong>in</strong>e größereRolle, während leitende Angestellte eher das Internet nutzenund mehr am Arbeitsplatz ausprobieren können. E<strong>in</strong>edifferenzierte Auswertung nach dem Alter erfolgte nochnicht. Allerd<strong>in</strong>gs enthält <strong>der</strong> <strong>Bericht</strong> den H<strong>in</strong>weis, dass60- bis 64-Jährige das Internet zum Lernen ebenso nutzenwie Jüngere, und dass Jüngere eher durch ältere Kollegenund Vorgesetzte e<strong>in</strong>gewiesen werden, was kaum überrascht.Die überragende Bedeutung des Betriebs als Auslöser füre<strong>in</strong>e Weiterbildungsteilnahme wird erkennbar, wenn dieTeilnahmequoten sowohl am formalen als auch non formalenLernen <strong>in</strong> Abhängigkeiten zu solchen Verän<strong>der</strong>ungenund zu betrieblichen Planungen gesehen werden(Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung 2005:65-78). So weisen Erwerbstätige deutlich höhere Teilnahmequoten<strong>in</strong> beiden Lernformen auf, wenn– sie e<strong>in</strong>en Anstieg ihrer Qualifikationsanfor<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong>den letzten drei Jahren beobachtet haben,– <strong>der</strong> Betrieb reorganisiert wurde,– neue Produkte o<strong>der</strong> Dienstleistungen e<strong>in</strong>geführt wurden,– neue Masch<strong>in</strong>en o<strong>der</strong> Verfahren e<strong>in</strong>geführt wurden,– die Arbeit reorganisiert wurde (breitere o<strong>der</strong> abwechslungsreichereAufgaben),– <strong>der</strong> Betrieb e<strong>in</strong>e eigene Weiterbildungse<strong>in</strong>heit hat,über e<strong>in</strong>e Weiterbildungsplanung verfügt, e<strong>in</strong>e entsprechendeBetriebsvere<strong>in</strong>barung abgeschlossen hatund selbst Lehrgänge durchführt,– es dem Betrieb wirtschaftlich gut geht.Von zentraler Bedeutung für die Bewertung <strong>der</strong> sozialenUnterschiede <strong>in</strong> den Teilnahmequoten s<strong>in</strong>d noch H<strong>in</strong>weiseauf Lerndispositionen. 33 Prozent <strong>der</strong> Befragtengeben an, Anstöße von außen für berufliche Weiterbildungzu brauchen. Es überrascht nicht, dass hier die Prozentsätzebei den ger<strong>in</strong>ger Qualifizierten und den Auslän<strong>der</strong>nwesentlich über dem Durchschnitt liegen. Bei diesenGruppen ist die Befürchtung, im Lernprozess zu scheitern,beson<strong>der</strong>s ausgeprägt. Die Anstöße aus dem betrieblichenKontext s<strong>in</strong>d daher von zentraler Bedeutung. Ausdem <strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung VIII (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Bildung und Forschung 2003: 60f.) geht dazuhervor, dass die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung<strong>in</strong> <strong>der</strong> Mehrzahl <strong>der</strong> Fälle auf den Arbeitgeber <strong>zur</strong>ückgeht.Betriebliche Anordnung wurde von 32 Prozent <strong>der</strong>Teilnehmer <strong>in</strong> den alten und 35 Prozent <strong>der</strong> Teilnehmer <strong>in</strong>den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n als Anlass genannt. Auf Vorschlagvon Vorgesetzten nahmen 25 Prozent <strong>der</strong> Teilnehmer<strong>in</strong> den alten und 21 Prozent <strong>der</strong> Teilnehmer <strong>in</strong> denneuen Bundeslän<strong>der</strong>n an beruflicher Weiterbildung teil.Jeweils 42 Prozent gaben an, die Teilnahme an beruflicherWeiterbildung sei von ihnen selbst ausgegangen(Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung 2003:71).
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 105 – Drucksache 16/2190Tabelle 7Beteiligung an verschiedenen Arten des <strong>in</strong>formellen beruflichen Kenntniserwerbs bei Erwerbstätigenim Jahr 2003 im Bundesgebiet und im Ost-West-VergleichArt des <strong>in</strong>formellen beruflichen KenntniserwerbsQuelle: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung 2005: 54. Datenbasis: <strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung IX.Anteilswerte <strong>in</strong> %Bund West OstLernen durch Beobachten und Ausprobieren am Arbeitsplatz 38 37 44Lesen von berufsbezogener Fachliteratur am Arbeitsplatz 35 34 37Unterweisung o<strong>der</strong> Anlernen am Arbeitsplatz durch Kollegen 25 24 26Unterweisung o<strong>der</strong> Anlernen am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte 22 21 26Berufsbezogener Besuch von Fachmessen o<strong>der</strong> Kongressen 17 18 16Unterweisung o<strong>der</strong> Anlernen am Arbeitsplatz durch außerbetriebliche Personen 13 13 13Vom Betrieb organisierte Fachbesuche <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Abteilungen o<strong>der</strong> planmäßigerArbeitse<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> unterschiedlichen Abteilungen <strong>zur</strong> gezielten Lernför<strong>der</strong>ung 10 10 12Lernen am Arbeitsplatz mit Hilfe von computerunterstützten Selbstlernprogrammen,berufsbezogenen Ton- o<strong>der</strong> Videokassetten usw. 8 8 8Qualitätszirkel, Werkstattzirkel, Lernstatt, Beteiligungsgruppe 8 9 7Nutzung von Lernangeboten o.a. im Internet am Arbeitsplatz 7 7 7Supervision am Arbeitsplatz o<strong>der</strong> Coach<strong>in</strong>g 6 7 5Systematischer Arbeitsplatzwechsel (z.B. Jobrotation) 4 3 4Austauschprogramme mit an<strong>der</strong>en Firmen 3 2 5Teilnahmequote an <strong>in</strong>formeller beruflicher Weiterbildung <strong>in</strong>sgesamt 61 60 66Aus <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Weiterbildungsbeteiligung lassen sichnur dann Rückschlüsse auf Weiterbildungsmotivationenziehen, wenn <strong>der</strong> Weiterbildungsmarkt e<strong>in</strong>e gewisseTransparenz aufweist, die potenziellen Teilnehmer alsovon den jeweils <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Weiterbildungsangebotenwissen. E<strong>in</strong>en guten Überblick über Weiterbildungsmaßnahmenzu haben, gaben im Jahre 2003 52 Prozent<strong>der</strong> 19- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> den alten Bundeslän<strong>der</strong>nund 45 Prozent <strong>der</strong> 19- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> den neuen Bundeslän<strong>der</strong>nan. Mehr Information und Beratung wurde <strong>in</strong>den alten Bundeslän<strong>der</strong>n von 34 Prozent, <strong>in</strong> den neuenBundeslän<strong>der</strong>n von 39 Prozent gewünscht. Für die neuenBundeslän<strong>der</strong> lässt sich feststellen, dass sich die Transparenzdes Weiterbildungsmarktes seit 1991 deutlich verbesserthat, auch wenn sich diese aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> potenziellenWeiterbildungsnachfrager <strong>in</strong> den neuenBundeslän<strong>der</strong>n nach wie vor schlechter darstellt als <strong>in</strong> denalten Bundeslän<strong>der</strong>n (Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildungund Forschung 2003: 79f.).Auf die Grenzen <strong>der</strong> re<strong>in</strong> deskriptiven Statistik im <strong>Bericht</strong>ssystemWeiterbildung haben wir schon verwiesen.Sie erschwert es, den E<strong>in</strong>fluss des Alters auf die Teilnahmean beruflicher Weiterbildung zu erkennen, da dasAlter durch an<strong>der</strong>e Faktoren überlagert werden kann. In<strong>der</strong> Auswertung e<strong>in</strong>er zwischen November 2002 und Mai2003 durchgeführten telefonischen Befragung von 5.058Erwerbspersonen im Alter von 19 bis 64 Jahren (Aust &Schrö<strong>der</strong> 2004) wurde durch Regressionsanalysen diesesDefizit behoben. Die Autoren legten e<strong>in</strong>en sehr breitenWeiterbildungsbegriff zugrunde, <strong>der</strong> formales und nonformales Lernen <strong>in</strong>tegriert. Sie ermittelten e<strong>in</strong>e Teilnahmequotevon 68 Prozent. E<strong>in</strong>e Differenzierung nachAltersgruppen ergab, dass 69,5 Prozent von den 25- bis34-Jährigen, 69,1 Prozent von den 35- bis 44-Jährigen,66,2 Prozent von den 45- bis 54-Jährigen und 64 Prozentvon den 55- bis 64-Jährigen <strong>in</strong> den letzten 12 Monaten anm<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>er Weiterbildungsmaßnahme teilgenommenhatten. Bei gleichzeitiger Berücksichtigung mehrererpotenzieller E<strong>in</strong>flüsse auf die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit <strong>der</strong>Teilnahme zeigte sich jedoch, dass dem Alter ke<strong>in</strong> eigenständigerErklärungswert zukommt. Bestimmte Beschäftigtengruppen,wie hoch qualifizierte Beschäftigte, zeigenam Ende des Erwerbsleben sogar steigende Teilnahmequoten.Bei den ger<strong>in</strong>g Qualifizierten geht die Teilnahmequotejedoch schon ab dem 30. Lebensjahr <strong>zur</strong>ück (Aust& Schrö<strong>der</strong> 2004: 5ff.).Es ist allerd<strong>in</strong>gs festzustellen, dass gerade bei älteren Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmern e<strong>in</strong>e deutliche Ku-
Drucksache 16/2190 – 106 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodemulation von Risikofaktoren für die Teilhabe an Lernprozessenbesteht: „Ältere Arbeitnehmer weisen heute imDurchschnitt ger<strong>in</strong>gere Qualifikationen auf als die jüngere<strong>Generation</strong> und nehmen <strong>in</strong> stärkerem Maße wenigerweiterbildungs<strong>in</strong>tensive Arbeitsplätze e<strong>in</strong> als jüngere.Insbeson<strong>der</strong>e für ältere Beschäftigte <strong>in</strong> Teilzeitarbeitwurde bei Durchführung beruflicher Weiterbildung dieger<strong>in</strong>gste Zeit, gemessen an <strong>der</strong> Dauer <strong>der</strong> Maßnahmen,aufgewandt“ (Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierung LebenslangenLernens“ 2004: 110).Die Autoren belegen, dass die Unterschiede <strong>in</strong> den Teilnahmequotendurch die Geschlechtszugehörigkeit, dieSchul- und Berufsabschlüsse, die Arbeitszeit, die beruflicheStellung, das Haushaltsse<strong>in</strong>kommen, die Selbste<strong>in</strong>schätzungund die Investitionsbereitschaft bee<strong>in</strong>flusstwird. Die ger<strong>in</strong>gste Weiterbildungsteilnahme weisendemnach teilzeitarbeitende Frauen ohne Schul- und Berufsabschluss,<strong>in</strong> ausführenden Tätigkeiten, mit ger<strong>in</strong>gemHaushaltse<strong>in</strong>kommen und Selbstvertrauen sowie ger<strong>in</strong>gerBereitschaft, <strong>in</strong> Weiterbildung zu <strong>in</strong>vestieren auf.Bislang haben wir nur Ergebnisse aus Befragungen vonPersonen im Erwerbsalter dargestellt. Ebenso wichtig istdie Perspektive <strong>der</strong> Betriebe selbst. Betriebsbefragungengeben Aufschluss über den Anteil <strong>der</strong> Betriebe, die Weiterbildungsmaßnahmenanbieten. Im IAB-Betriebspanel2002 (Bellmann & Leber 2004) gaben 60 Prozent allerBetriebe an, über 50-jährige Mitarbeiter zu beschäftigen.Von diesen gaben 6 Prozent <strong>in</strong> den alten und 7 Prozent <strong>in</strong>den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n an, ältere Mitarbeiter <strong>in</strong> Weiterbildungsangebotee<strong>in</strong>zubeziehen. Spezielle Weiterbildungsangebotefür Ältere unterbreiten nach IAB-Panelnur etwa 1 Prozent aller Betriebe. Differenziertere Analysenzeigen zunächst, dass für ältere Beschäftigte mit zunehmen<strong>der</strong>Betriebsgröße e<strong>in</strong>e höhere Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit,an Weiterbildungsmaßnahmen zu partizipieren,e<strong>in</strong>hergeht. Des Weiteren „erweisen sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eMerkmale <strong>der</strong> Personalstruktur, aber auch Indikatoren <strong>der</strong>technischen Ausstattung, die Verwendung weiterer altersspezifischerMaßnahmen sowie betriebsstrukturelle Charakteristikaals signifikant“ (Bellmann & Leber 2004:32). Insgesamt lassen sich die Ergebnisse des IAB-Panelsdah<strong>in</strong>gehend zusammenfassen, „dass es zwar e<strong>in</strong> gewissesSegment von Betrieben gibt, die etwas für die Qualifizierungihrer älteren Mitarbeiter tun, dass aber <strong>der</strong> Großteil<strong>der</strong> Betriebe <strong>in</strong> diesem Bereich wenig engagiert ist“(Bellmann & Leber 2004: 32).Die deutsche Betriebsbefragung im Rahmen <strong>der</strong> ZweitenEuropäischen Erhebung <strong>zur</strong> Betrieblichen Weiterbildung(CVTS2) zeigt zudem, dass lediglich 24 Prozent <strong>der</strong> BetriebeAnalysen zum zukünftigen Personal- und Qualifikationsbedarfdurchführen, nur 22 Prozent e<strong>in</strong>en Weiterbildungsplano<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Weiterbildungsprogramm erstellen,nur 17 Prozent Weiterbildungsmaßnahmen aus e<strong>in</strong>emspeziellen Budget f<strong>in</strong>anzieren, 4 Prozent e<strong>in</strong>en eigenständigenArbeitsbereich als „berufliche Weiterbildung“ ausweisen,2 Prozent Mitarbeiter beschäftigen, <strong>der</strong>en Aufgabenbereichausschließlich berufliche Weiterbildungumfasst und 44 Prozent den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmenüberprüfen. Diese Ergebnisse lassen dieSchlussfolgerung zu, dass „<strong>der</strong> Professionalisierungsgrad<strong>in</strong> <strong>der</strong> betrieblichen Weiterbildung <strong>in</strong> Deutschland nochnicht sehr hoch“ ist (Statistisches Bundesamt 2002).Für e<strong>in</strong>e kritische Selbste<strong>in</strong>schätzung, ob die Weiterbildungsquoten<strong>in</strong> Deutschland ausreichend o<strong>der</strong> zu ger<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>d, ist <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationale Vergleich hilfreich. InternationaleVergleiche von Weiterbildungsdaten s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gsmit methodischen Problemen verbunden, da es nationalunterschiedliche Verständnisse von Weiterbildung gibt.So wird <strong>in</strong> Län<strong>der</strong>n etwa mit e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>g entwickeltenSystem <strong>der</strong> beruflichen Erstausbildung, wie etwa <strong>in</strong>Großbritannien, jede berufliche Bildungsmaßnahme fürErwerbstätige als Weiterbildung gezählt, während man <strong>in</strong>Deutschland zwischen Erstaus- und Weiterbildung unterscheidet.Tendenziell unterschätzen <strong>in</strong>ternationale Vergleiche diePosition Deutschlands (Werner, Flüter-Hoffmann &Zedler 2003). OECD-Studien zeigen die hohe Jugendorientierung<strong>der</strong> Bildung <strong>in</strong> Deutschland. Während <strong>in</strong>Deutschland nach Angaben <strong>der</strong> OECD nur 2,8 Prozent<strong>der</strong> 30- bis 39-jährigen Vollzeit- o<strong>der</strong> Teilzeitstudierende<strong>in</strong> privaten o<strong>der</strong> öffentlichen Bildungse<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d,liegen diese Werte <strong>in</strong> F<strong>in</strong>nland bei 10,4 Prozent und <strong>in</strong>Schweden bei 14,6 Prozent (OECD 2003a: 300). Zu ähnlichenErgebnissen kommt die Zweite Europäische Erhebung<strong>zur</strong> Betrieblichen Weiterbildung (CVTS2) <strong>in</strong> <strong>der</strong>EU: In <strong>der</strong> EU 15 liegt Deutschland nur im Mittelfeld.Schwedische o<strong>der</strong> dänische, aber auch nie<strong>der</strong>ländischeund britische Unternehmen <strong>in</strong>vestieren mehr <strong>in</strong> Weiterbildungals deutsche. Zum gleichen Ergebnis kommt man,wenn man sich an<strong>der</strong>e Indikatoren, wie etwa die Teilnahmequotenvon Beschäftigten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesamtwirtschaft(Abbildung 20) aber auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Branchen anschaut.Während <strong>in</strong> allen an<strong>der</strong>en 14 Län<strong>der</strong>n, die bereitsan <strong>der</strong> ersten Erhebung teilgenommen haben, <strong>der</strong> entsprechendeAnteil seit 1993 gestiegen ist (<strong>in</strong> den Nie<strong>der</strong>landenetwa von 56 auf 88 Prozent), hat sich dieser <strong>in</strong>Deutschland um 10 Prozent reduziert (Grünewald & Moraal2002). E<strong>in</strong>e differenziertere Auswertung des Weiterbildungsangebotszeigt, dass dieses mit den betrachtetenWirtschaftsbereichen erheblich variiert. So bieten alleKredit<strong>in</strong>stitute, Versicherungen und Datenverarbeitungsunternehmenbetriebliche Weiterbildung an, im BereichVerkehr, Nachrichtenübermittlung liegt <strong>der</strong> entsprechendeAnteil dagegen nur bei 58 Prozent.E<strong>in</strong> Grund für die niedrigere deutsche Weiterbildungsquoteliegt sicherlich <strong>in</strong> <strong>der</strong> guten Erstausbildung. Dieserklärt zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>en Teil <strong>der</strong> höheren Weiterbildungsquoten<strong>in</strong> Großbritannien, Frankreich und <strong>in</strong> den Nie<strong>der</strong>landen,die auf Grund ihrer un<strong>zur</strong>eichenden Berufsbildungssysteme<strong>in</strong> <strong>der</strong> Weiterbildung nachholen, was <strong>in</strong> <strong>der</strong>beruflichen Erstausbildung versäumt wurde. Die Unterschiedezu Schweden, Norwegen, Dänemark o<strong>der</strong> F<strong>in</strong>nlandlassen sich damit aber nicht erklären. Diese Län<strong>der</strong>s<strong>in</strong>d – allerd<strong>in</strong>gs mit unterschiedlichen Systemen –ebenso gut wie Deutschland <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erstausbildung undtun gleichzeitig erheblich mehr für die Weiterbildung. Siehaben zudem gezeigt, wie man durch Investitionen <strong>in</strong> die„Vorauswirtschaft“ (Helmstädter 1996) wirtschaftliche
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 107 – Drucksache 16/2190Anteil weiterbilden<strong>der</strong> Unternehmen an allen Unternehmen 1999 – <strong>in</strong> ProzentAbbildung 20120%100%96%91%88%86%80%82%79%76% 75%71% 70%In Prozent60%40%36%24%22%20%18%0%DK S NL NOR IRL FIN F D L B E J P ELQuelle: Grünewald, Moraal & Schönfeld 2003:16.Krisen erfolgreich überw<strong>in</strong>den kann. Bildungsausgabenwerden <strong>in</strong> diesen Län<strong>der</strong>n nicht als Kosten, son<strong>der</strong>n alsentscheidende Zukunfts<strong>in</strong>vestition begriffen. Der Vorsprung<strong>der</strong> skand<strong>in</strong>avischen Län<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Weiterbildungist möglicherweise noch ausgeprägter als es die Statistikenerkennen lassen, da diese Län<strong>der</strong> ihre Arbeitsorganisationgrundlegen<strong>der</strong> als an<strong>der</strong>e Län<strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nisiert haben.Sie haben nicht nur Produkte und Verfahren erneuert,son<strong>der</strong>n auch traditionelle hierarchische Strukturen abgebautund den Spielraum für selbstständiges und kreativesHandeln <strong>der</strong> Beschäftigten ausgeweitet. Da die skand<strong>in</strong>avischenLän<strong>der</strong> mo<strong>der</strong>ne und lernför<strong>der</strong>liche Formen <strong>der</strong>Arbeitsorganisation e<strong>in</strong>geführt haben, wächst <strong>der</strong> Abstandvermutlich noch, wenn <strong>in</strong>formelles Lernen am Arbeitsplatzberücksichtigt würde (Bosch 2005b).Die genannten Erklärungsfaktoren verdeutlichen die Notwendigkeite<strong>in</strong>er differenziellen Perspektive, die nicht bei<strong>der</strong> Analyse von Auswirkungen e<strong>in</strong>zelner Merkmale wieAlter o<strong>der</strong> Geschlecht stehen bleibt, son<strong>der</strong>n gezielt sozialeUngleichheiten, wie sie sich aus charakteristischenKomb<strong>in</strong>ationen <strong>der</strong> aufgeführten Merkmale ergeben, <strong>in</strong>Betracht zieht. Über e<strong>in</strong>e solchermaßen auf <strong>in</strong>dividuelleMerkmale von Arbeitnehmern fokussierende Perspektiveh<strong>in</strong>aus ist zu beachten, dass die Partizipation an beruflichenWeiterbildungsmaßnahmen <strong>in</strong> hohem Maße von <strong>der</strong>jeweiligen Arbeitsorganisation abhängt. Entsprechends<strong>in</strong>d die Arbeit <strong>in</strong> Betrieben mit ger<strong>in</strong>gem technologischenund organisatorischen Wandel und die Beschäftigungauf wenig lernför<strong>der</strong>lichen Arbeitsplätzen alszentrale Gründe für die Nichtteilnahme an Weiterbildungsmaßnahmenzu nennen.3.3.3 Erträge und Nutzen von beruflicherWeiterbildungDie Entscheidung <strong>zur</strong> Weiterbildungsteilnahme wird zumeist<strong>in</strong> Erwägung e<strong>in</strong>es konkreten Nutzens getroffen. Eswird zudem erwartet, dass <strong>der</strong> Nutzen bei demjenigen anfällt,<strong>der</strong> die Entscheidung trifft und die Weiterbildung f<strong>in</strong>anziert.Dies kann <strong>der</strong> Betrieb, <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelne und auch<strong>der</strong> Staat (vor allem über die Bundesagentur für Arbeit)se<strong>in</strong>. Wir wollen an dieser Stelle nur e<strong>in</strong>ige Erkenntnissezum Nutzen für die Erwerbspersonen selbst zusammenfassen.Dabei kann man zwischen dem Output <strong>der</strong> Bildungsmaßnahme,also ihrem lernpolitischen Erfolg, unddem Outcome, dem Ertrag für die <strong>in</strong>dividuelle Beschäftigungsfähigkeitunterscheiden.Zum Output und Outcome liefert das <strong>Bericht</strong>ssystemWeiterbildung IX wichtige Erkenntnisse (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Bildung und Forschung 2005: 108f.). Die Befragtengeben an, dass sie die höchsten Lernerfolge beimLernen durch Beobachten und Ausprobieren am Arbeitsplatz,durch die Unterweisung durch Vorgesetzte undKollegen und durch Lehrgänge und Kurse erzielen. DerLernerfolg bei computergestütztem Selbstlernen und <strong>in</strong>
Drucksache 16/2190 – 108 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeQualitätszirkeln wird deutlich niedriger, aber durchausnoch hoch e<strong>in</strong>geschätzt. Dabei s<strong>in</strong>d die Unterschiedenach Personengruppen deutlich. Anlernen am Arbeitsplatzund Unterweisung durch Vorgesetzte haben beispielsweisedie größten Lernerfolge bei ger<strong>in</strong>g Qualifizierten.Personen mit guten Bildungsvoraussetzungensche<strong>in</strong>en mehr von Lehrgängen und Kursen zu profitierenals Personen mit ger<strong>in</strong>geren Bildungsvoraussetzungen.Lernen über Praxiserfahrungen sche<strong>in</strong>t offensichtlich fürger<strong>in</strong>ger Qualifizierte e<strong>in</strong> besserer E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> Qualifizierungals formale Lernangebote.Auch <strong>der</strong> Outcome <strong>der</strong> Weiterbildungsteilnahme wird außerordentlichpositiv bewertet. Die höchste Zustimmungerreicht die Aussage, dass man die Arbeit besser als zuvorerledigen kann und dass sich die beruflichen Chancenverbessern. Von Gehaltsverbesserungen berichten 14 Prozent<strong>der</strong> Teilnehmer (Tabelle 8). In den positiven Aussagenmischen sich Aussagen <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Qualität<strong>der</strong> Arbeit (mehr Kompetenz, mehr Überblickswissen,besserer Kontakt zu Kollegen), die alle Belastungen reduzierenkönnen, <strong>zur</strong> Qualität des Lebens (Hilfe im Alltag)und Aussagen zu konkreten ökonomischen Wirkungen(Aufstieg, Bezahlung, Arbeitsplatzsicherheit). Bemerkenswertist, dass ger<strong>in</strong>ger Qualifizierte die ökonomischenAuswirkungen <strong>der</strong> Weiterbildungsteilnahme höherbewerten als die höher Qualifizierten, die sich <strong>in</strong>sgesamtsicherer fühlen. Lei<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d die Aussagen nicht nach Alterdifferenziert worden.Bei solchen Aussagen bleibt immer offen, ob die ökonomischenWirkungen auch ohne e<strong>in</strong>e Teilnahme an Weiterbildungerzielt worden wären. Dieser Frage s<strong>in</strong>d Büchel& Panneberg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Auswertung des Sozio-oekonomischenPanels (Büchel & Pannenberg 2004) nachgegangen,<strong>in</strong> <strong>der</strong> sie Teilnehmer an formaler beruflicher Weiterbildungmit Nichtteilnehmern verglichen haben. DieseStudie zeigt, dass Ältere nicht <strong>in</strong> gleichem Umfang von<strong>der</strong> Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen profitierenwie jüngere Altersgruppen. Für die alten Bundeslän<strong>der</strong>erhöhte sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 20- bis 44-Jährigendas Bruttomonatse<strong>in</strong>kommen nach e<strong>in</strong>er Weiterbildungsmaßnahmeum durchschnittlich 4,5 Prozent, während <strong>in</strong><strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 45- bis 64-Jährigen ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kommenssteigerungvorlag. Es ist zu vermuten, dass dies zum e<strong>in</strong>ene<strong>in</strong>e Auswirkung von Vorruhestandsregelungen ist.Die verbleibende Verweildauer im Betrieb ist zu kurz, sodasssich Weiterbildung nicht mehr auszahlt. Zum ande-Tabelle 8Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> beruflichen Situation durch berufliche Weiterbildungim Bundesgebiet 1997, 2000 und 2003*Anteilswerte <strong>in</strong> %Nutzenaspekte1997 2000 2003Kann Arbeit besser als vorher erledigen 82 78 76Verbesserung <strong>der</strong> beruflichen Chancen 65 62 60Hilfe, im Alltag besser <strong>zur</strong>echtzukommen 45 39 41Besseres Wissen über Zusammenhänge im Betrieb 42 39 37Kollegen im Unternehmen besser kennen gelernt 40 40 36In höhere Gehaltsgruppe e<strong>in</strong>gestuft 17 18 15Beruflich aufgestiegen 18 23 14Hätte ansonsten Stelle verloren 13 12 13Neue Stelle bekommen 11 11 9Nichts davon / Ke<strong>in</strong>e Angabe 6 8 9Wesentliche Verän<strong>der</strong>ungJa 52 57 61Ne<strong>in</strong> 45 40 38Ke<strong>in</strong>e Angabe 3 3 2Summe 100 100 101* Basis: Erwerbstätige Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung im jeweiligen Bezugsjahr.Quelle: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung 2005: 102. Datenbasis: <strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung IX.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 109 – Drucksache 16/2190ren dürften <strong>in</strong>formelle Altersgrenzen bei Beför<strong>der</strong>ungene<strong>in</strong>e Rolle spielen. In den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n erhöhtesich dagegen das durchschnittliche Bruttomonatse<strong>in</strong>kommenfür beide Gruppen signifikant auf Grund e<strong>in</strong>er Weiterbildungsteilnahme(7 Prozent bzw. 8 Prozent). Diesstellt angesichts e<strong>in</strong>es durchschnittlich <strong>in</strong>vestierten Stundenvolumensvon gut e<strong>in</strong>er Arbeitswoche e<strong>in</strong>e beachtenswerteE<strong>in</strong>kommenssteigerung dar. Die im Vergleich zuden alten Bundeslän<strong>der</strong>n <strong>in</strong> den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n höhereBildungsrendite für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer<strong>in</strong>nengeht wahrsche<strong>in</strong>lich darauf <strong>zur</strong>ück, dass diemeisten älteren Arbeitnehmer bereits vorzeitig ausgeschiedens<strong>in</strong>d und nur wenige Schlüsselpersonen im Betriebgeblieben s<strong>in</strong>d.Das Risiko, arbeitslos zu werden, verr<strong>in</strong>gert sich durchberufliche Weiterbildung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 20- bis44-Jährigen <strong>in</strong> den alten Bundeslän<strong>der</strong>n um 2 Prozentpunkte,<strong>in</strong> den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n um 5 Prozentpunkte.Für die Gruppe <strong>der</strong> 45- bis 64-jährigen Arbeitnehmer ließsich demgegenüber ke<strong>in</strong> entsprechen<strong>der</strong> Zusammenhangzwischen Weiterbildungsteilnahme und Arbeitslosigkeitsrisikonachweisen. Dies bedeutet, das man mit Weiterbildungsmaßnahmenalle<strong>in</strong> die Beschäftigungsbarrieren fürÄltere auf dem Arbeitsmarkt nicht verr<strong>in</strong>gern kann. DesWeiteren ist festzustellen, dass Weiterbildung im Allgeme<strong>in</strong>enFrauen auf dem Arbeitsmarkt weniger hilft, wasebenfalls auf Arbeitsmarktsegmentierungen verweist.3.4 Bildung und Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Nacherwerbsphase3.4.1 Partizipation an BildungsangebotenIn <strong>der</strong> Partizipation an Bildungsangeboten spiegeln sichauch die <strong>in</strong> früheren Lebensphasen erworbenen Bildungsgewohnheitenwi<strong>der</strong>, die Grundlagen lebenslangen Lernenswerden also bereits <strong>in</strong> den frühen Bildungsphasengeschaffen (Sommer, Künemund & Kohli 2001). Im Alterssurveyvon 1996 (Kohli et al. 2000b) hatten von den258 Teilnehmern an Bildungsangeboten 46,2 Prozent e<strong>in</strong>enVolks- o<strong>der</strong> Hauptschulabschluss, 27,8 Prozent e<strong>in</strong>enRealschulabschluss und 18,8 Prozent Abitur, Hochschulreifeo<strong>der</strong> EOS. Unter den Nicht-Teilnehmern hatten dagegen75,5 Prozent e<strong>in</strong>en Volks- o<strong>der</strong> Hauptschulabschluss,11,9 Prozent e<strong>in</strong>en Realschulabschluss und nur5,6 Prozent Abitur, Hochschulreife o<strong>der</strong> EOS.Neben dem Schulabschluss erwiesen sich auch die Berufsausbildungund das Äquivalenze<strong>in</strong>kommen als vonzentraler Bedeutung für die Bildungspartizipation im Alter.13,1 Prozent <strong>der</strong> Teilnehmer hatten e<strong>in</strong>en Hochschulabschluss,6,0 Prozent e<strong>in</strong>en Fachhochschulabschluss und14,8 Prozent e<strong>in</strong>e Fachschule, Meister- bzw. Technikerschuleabgeschlossen. Unter den Nicht-Teilnehmern hattendagegen lediglich 2,8 Prozent e<strong>in</strong>en Hochschulabschluss,2,8 Prozent e<strong>in</strong>en Fachhochschulabschluss und7,1 Prozent Fachschule, Meister- bzw. Technikerschuleabgeschlossen. Von den Teilnehmern gehörten 38,5 Prozentzum fünften und 24,1 Prozent zum vierten Qu<strong>in</strong>til<strong>der</strong> Verteilung des Äquivalenze<strong>in</strong>kommens. Unter denNicht-Teilnehmern waren dies lediglich 17,0 Prozentbzw. 19,1 Prozent. Das Äquivalenze<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong> Teilnehmerlag im Jahre 1996 im Durchschnitt etwa 500 DMhöher als jenes <strong>der</strong> Nicht-Teilnehmer.Insgesamt zeigen die Befunde, dass Personen mit höhererSchul- und Berufsausbildung überproportional an Bildungsangebotenpartizipieren, sodass Bildungsungleichheitenim Alter eher verstärkt werden. Daraus lässt sichals e<strong>in</strong>e vorrangige Aufgabe von Bildungspolitik ableiten,verstärkt bildungsungewohnte Personen für Bildungsaktivitätenim Alter zu gew<strong>in</strong>nen.3.4.2 Bildungsangebote für Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong>NacherwerbsphaseIn e<strong>in</strong>er 1999 durchgeführten repräsentativen Fragebogenerhebung(Sommer, Künemund & Kohli 2001) wurdenAnbieter aus 150 Geme<strong>in</strong>den zu Themenschwerpunktenund Adressaten ihres Angebots und zum Verhältnis vonAngebot und Nachfrage befragt. Der Bereich „Gesundheit/Ernährung“erwies sich sowohl als <strong>der</strong> am häufigstenangebotene als auch als <strong>der</strong> aus Sicht <strong>der</strong> Anbieter amhäufigsten nachgefragte Themenschwerpunkt. E<strong>in</strong>e 2001durchgeführte Nachfrageuntersuchung (<strong>in</strong>fas 2001)spricht ebenfalls dafür, dass das Thema „Gesundheit/Ernährung“mit zunehmendem Alter an Bedeutung gew<strong>in</strong>ntund Menschen entsprechend e<strong>in</strong>erseits zunehmendKenntnisse über Möglichkeiten <strong>der</strong> Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ungnachfragen, an<strong>der</strong>erseits lernen wollen,mit E<strong>in</strong>schränkungen und Erkrankungen zu leben(Kruse 2002a, 2004, 2005c; Meier-Baumgartner, Dapp &An<strong>der</strong>s 2004; Kliegel 2004). In <strong>der</strong> Berl<strong>in</strong>er Altersstudiewurde das „Investment“ <strong>in</strong> die Verwirklichung von Lebenszielenim höheren Erwachsenenalter analysiert. Dabeizeigte sich, dass <strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> Gesundheit nicht nurmit zunehmendem Lebensalter an Bedeutung gew<strong>in</strong>nt,son<strong>der</strong>n im hohen Alter auch durch den größten E<strong>in</strong>satzverfügbarer Ressourcen gekennzeichnet ist (Staud<strong>in</strong>ger1996).Als nächstbedeutsame Themenschwerpunkte wurden <strong>in</strong><strong>der</strong> Anbieteruntersuchung „Gedächtnistra<strong>in</strong><strong>in</strong>g“, „Kommunikation,Konfliktbewältigung, Sozialkompetenzen“,„Rechts-, Versicherungs- und Rentenfragen“, „Kunst,Musik, Konzerte, Museen“ sowie „Gesellschaft, Geschichte,Politik“ ermittelt. Für die genannten Themengebietewurde von den Anbietern e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel hoheNachfrage konstatiert. Die Bedeutung von Gedächtnistra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsaus <strong>der</strong> Nachfrageperspektive wird durch denaus <strong>der</strong> <strong>in</strong>fas-Untersuchung berichteten Befund, dass e<strong>in</strong>eBeteiligung an Bildungsangeboten <strong>in</strong> 87 Prozent <strong>der</strong> Fälledurch den Wunsch, geistige Fähigkeiten zu tra<strong>in</strong>ieren,motiviert wird, gestützt. Lediglich für den Bereich „Kommunikation,Konfliktbewältigung und Sozialkompetenzen“sche<strong>in</strong>t dem Angebot ke<strong>in</strong>e vergleichbare Nachfragegegenüber zu stehen. Ähnlich ist für Veranstaltungen imBereich „Technik, Computer“ e<strong>in</strong> vergleichsweise hohes,durch die Nachfrage nicht gedecktes Angebot festzustellen.Obwohl Befunde <strong>der</strong> Nachfrageuntersuchung e<strong>in</strong> etwashöheres Interesse vermuten lassen, zählen ComputerundTechnikkurse vergleichsweise häufig zu den schlechtbesuchten Angeboten <strong>der</strong> befragten Anbieter.
Drucksache 16/2190 – 110 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeUne<strong>in</strong>heitliche Ergebnisse werden für den BereichFremdsprachen berichtet. Diese zählen sowohl zu den amhäufigsten als auch zu den am schlechtesten nachgefragtenAngeboten. Dabei ist zu vermuten, dass die Akzeptanz<strong>der</strong>artiger Angebote <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>em Maße vomPrestige des Veranstalters abhängt. So werden Fremdsprachenangebotevon Volksschulen etwa häufig, solchevon Kirchen dagegen selten nachgefragt. Für Angeboteaus dem Bereich Sport bleiben die Angebote <strong>der</strong>zeit zumTeil deutlich h<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> Nachfrage <strong>zur</strong>ück. Dieser sowohldurch die Anbieter, als auch durch die Nachfrageuntersuchunggestützte Befund geht zu e<strong>in</strong>em guten Teil darauf<strong>zur</strong>ück, dass viele mo<strong>der</strong>ne Sportarten unzulässigerweiseals exklusive Domänen junger Leute angesehen werden(Sommer & Künemund 1999).Mit 62 Prozent beschrieb <strong>der</strong> größte Teil <strong>der</strong> Anbieter dieAdressaten <strong>der</strong> Bildungsangebote als „alle Älteren“, etwae<strong>in</strong> Drittel nannte über 75-Jährige als beson<strong>der</strong>en Adressatenkreis,fast die Hälfte nannte die Gruppe <strong>der</strong> 60- bis75-Jährigen. Mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Anbieter (56 Prozent)konzentrierte sich darauf, Bewohner des jeweiligenStadtteils anzusprechen, etwa e<strong>in</strong> Fünftel nannte Organisationsmitglie<strong>der</strong>(Vere<strong>in</strong>, Partei, Gewerkschaft) alsprimäre Adressatengruppe. Alters<strong>in</strong>tegrierende Lernkonzepteerwiesen sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Anbieterbefragung als vergleichsweiseunbedeutend, lediglich 11 Prozent versuchtenmit ihren Bildungsangeboten „alle Altersgruppen“anzusprechen. Immerh<strong>in</strong> 21 Prozent <strong>der</strong> Anbieter gabenan, mit ihren Bildungsangeboten auch gezielt Bildungsungewohnteerreichen zu wollen.H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Altersstruktur <strong>der</strong> durch die Bildungsangebotetatsächlich erreichten Teilnehmer zeigte sich, dassetwa vier Fünftel <strong>der</strong> Anbieter 66- bis 75-Jährige erreichen,54 Prozent gaben an, auch jüngere, 48 Prozent auchältere Teilnehmer zu gew<strong>in</strong>nen. Dabei zeigte sich auch,dass sich e<strong>in</strong>zelne Altersgruppen <strong>in</strong> ihren Bildungs<strong>in</strong>teressenzum Teil deutlich unterscheiden. Jüngere sprechenvor allem Themen aus den Bereichen „Technik und Computer“,„Fremdsprachen“ sowie „Erziehung“ und „Psychologie“an, während sich Ältere offenbar beson<strong>der</strong>s fürden Bereich „Religion und Philosophie“ <strong>in</strong>teressieren.In e<strong>in</strong>er neueren, vom Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildungund Forschung geför<strong>der</strong>ten Untersuchung (Tippelt &Barz 2004) erwiesen sich die Volkshochschulen vor privatenTrägern, Verbänden und kirchlichen Anbietern alsdie quantitativ bedeutsamsten Bildungs<strong>in</strong>stitutionen. Geradeam Beispiel <strong>der</strong> Volkshochschulen wurde aber auchdie milieuspezifische Akzeptanz von Bildungsanbieterndeutlich: Volkshochschulangebote wurden überwiegendvon Personen, die e<strong>in</strong>em traditionellen o<strong>der</strong> neuen (Kle<strong>in</strong>)Bürgermilieu zuzuordnen waren, besucht. Dagegen wurdenJüngere, Personen mit hohen Bildungsabschlüssen,Männer, Erwerbstätige und Adressaten <strong>in</strong> den neuen Bundeslän<strong>der</strong>ndeutlich schlechter erreicht.E<strong>in</strong> <strong>in</strong>novatives, Stärken des Alters explizit berücksichtigendesVerständnis von Altenbildung liegt dem vom Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugendseit 2002 geför<strong>der</strong>ten Modellprogramm Erfahrungswissenfür Initiativen (EFI) zugrunde. Die Zielsetzung diesesModellprogramms besteht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erprobung neuer Verantwortungsrollenfür Senioren. Die Beratungstätigkeitsolcher „seniorTra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen“ wird <strong>in</strong> <strong>der</strong>zeit 35 Kommunenaus zehn Bundeslän<strong>der</strong>n mit Unterstützung <strong>der</strong> Seniorenbüros,Freiwilligenagenturen und Selbsthilfekontaktstellenvermittelt. Durch überörtliche Bildungsträgerwerden <strong>zur</strong> Vorbereitung Fortbildungsveranstaltungen angeboten.Ziel dieser Qualifizierungsmaßnahmen ist ausdrücklichnicht e<strong>in</strong>e quasi berufliche Weiterbildung zumTra<strong>in</strong>er o<strong>der</strong> Berater. Die Fortbildung soll vielmehr <strong>zur</strong>Identifikation mit e<strong>in</strong>er neuen Verantwortungsrolle führenund die zu Beg<strong>in</strong>n erklärte Bereitschaft <strong>zur</strong> Weitergabeeigenen Erfahrungswissens <strong>in</strong> verschiedenen Rollen festigen.Des Weiteren dienen die Qualifizierungsmaßnahmen(a.) <strong>der</strong> Klärung <strong>der</strong> Frage, <strong>in</strong> welchem Kontext mitgebrachteKompetenzen und Erfahrungswissen für die Unterstützungzivilgesellschaftlichen Engagements genutztwerden können, (b.) <strong>der</strong> Herausarbeitung von Unterschiedenzwischen dem bisherigen E<strong>in</strong>satz des Erfahrungswissens<strong>in</strong> Beruf und Familie und dem Bereich des zivilgesellschaftlichenEngagements, (c.) <strong>der</strong> Sensibilisierungfür aktuelle Entwicklungen, Rahmenbed<strong>in</strong>gungen undZugangswege zivilgesellschaftlichen Engagements, (d.)<strong>der</strong> Herstellung e<strong>in</strong>er Passung zwischen mitgebrachtenKompetenzen und möglichen Unterstützungsleistungen.Über die Evaluation dieses bis 2006 laufenden Programmswird kont<strong>in</strong>uierlich im Internet 12 berichtet. Diebislang vorliegenden Erfahrungen sprechen für den Erfolgdieses Modellprogramms.3.4.3 Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Qualifikationälterer Menschen als e<strong>in</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ungfür die ErwachsenenbildungDie über 60-Jährigen unterscheiden sich <strong>in</strong> ihrer schulischenund beruflichen Qualifikation gegenwärtig erheblichvom Durchschnitt <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung. Betrachtetman die entsprechenden Abschlüsse <strong>in</strong> <strong>der</strong>Altersgruppe <strong>der</strong> 50- bis 59-Jährigen, so wird deutlich,dass e<strong>in</strong> vergleichbarer Kohorteneffekt <strong>in</strong> Zukunft nichtmehr zu beobachten se<strong>in</strong> wird.Die Mikrozensuserhebung 2002 (Statistisches Bundesamt2003: 39ff.) weist die Haupt- bzw. Volksschule als die unter<strong>der</strong> älteren Bevölkerung mit weitem Abstand dom<strong>in</strong>ierendeSchulform aus. Unter den über 60-Jährigen liegt<strong>der</strong> Anteil mit e<strong>in</strong>em entsprechenden Bildungsabschlussbei 73,6 Prozent, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 50- bis 59-Jährigenbei 52,7 Prozent, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesamtgruppe <strong>der</strong> über 15-Jährigenbei 45,3 Prozent. Allgeme<strong>in</strong>es Abitur o<strong>der</strong> Fachabiturhaben nach Mikrozensus 2002 20 Prozent <strong>der</strong> über15-jährigen Bevölkerung, <strong>der</strong> entsprechende Anteil liegt<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 50- bis 59-Jährigen bei 17,8 Prozent, <strong>in</strong><strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> über 60-Jährigen bei 9,9 Prozent.Noch deutlicher als bei den Schulabschlüssen zeigen sichaltersgruppenspezifische Unterschiede <strong>in</strong> den beruflichenBildungsabschlüssen. In <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> über 60-Jäh-12 Unter <strong>der</strong> Adresse www.efi-programm.de s<strong>in</strong>d zahlreiche Publikationene<strong>in</strong>zusehen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 111 – Drucksache 16/2190rigen haben 32 Prozent ke<strong>in</strong>en beruflichen Bildungsabschluss,<strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 50- bis 59-Jährigen liegt<strong>der</strong> entsprechende Anteil lediglich bei 16,5 Prozent.Die dargestellten Unterschiede zwischen den über 60-Jährigenund den 50- bis 59-Jährigen machen die Herausfor<strong>der</strong>ungendeutlich, denen sich die Erwachsenenbildung <strong>in</strong>den kommenden Jahren stellen müssen wird. Angesichtse<strong>in</strong>er zunehmend höheren Qualifikation <strong>der</strong> Teilnehmerwerden neue, anspruchsvollere Angebote zu entwickelnse<strong>in</strong>, die zunehmend stärker <strong>in</strong>dividuellen Bildungsbiografiengerecht werden müssen. Gleichzeitig kann prognostiziertwerden, dass die Bedeutung formalen Lernenszu Gunsten e<strong>in</strong>er ausgeprägteren Selbststeuerung <strong>zur</strong>ückgehenwird (im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er größeren Freiheit <strong>der</strong> Lernenden,selbst zu bestimmen, ob, wie und wofür sie lernen)(Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanung undForschungsför<strong>der</strong>ung 2004).3.4.4 För<strong>der</strong>ung von gesundheitsbezogenenKompetenzenDie Bedeutung <strong>der</strong> Bildung für die Gesundheit wirddurch empirische Untersuchungen <strong>in</strong> dreifacher Weisegestützt:– Erstens ist <strong>der</strong> Zusammenhang zwischen Bildung undLebenserwartung evident. So zeigen die Befunde desSozio-oekonomischen Panels, dass ab dem 16. Lebensjahrdie Männer ohne Abitur e<strong>in</strong>e um 3,3 Jahrekürzere Lebenserwartung aufweisen als die mit Abitur,bei den Frauen beträgt dieser Unterschied sogar3,9 Jahre (Kle<strong>in</strong> 1996).– Zweitens lassen die empirischen Ergebnisse ke<strong>in</strong>enZweifel daran, dass <strong>in</strong> Deutschland Personen mit niedrigemsozioökonomischen Status erheblich kränkerund größeren gesundheitlichen Belastungen ausgesetzts<strong>in</strong>d (Kle<strong>in</strong> 2004; Kruse, Gaber, Heuft, Re & Schulz-Nieswandt 2002). Schon Befragungen von Schülern<strong>der</strong> vierten und fünften Klassen ergaben, dass Hauptschülerhäufiger als Gymnasiasten über Kopf-, Hals-,Bauch-, o<strong>der</strong> Rückenschmerzen klagen (Pötschke-Langer 1998). Bildungsspezifische Unterschiede imGesundheitszustand werden über Möglichkeiten <strong>der</strong>gesunden Lebensführung, gesundheitliche Belastungendurch die Berufstätigkeit, Kompetenzen im Umgangmit Krankheit sowie über Verhaltensmuster bei<strong>der</strong> Inanspruchnahme gesundheitsbezogener Leistungenund Fähigkeiten <strong>zur</strong> Kommunikation mit Vertreterndes Gesundheitswesens erklärt.– Solche Erklärungen verweisen drittens auf die Möglichkeit,über Bildung die Fähigkeit <strong>zur</strong> E<strong>in</strong>flussnahmeauf die eigene Gesundheit bzw. <strong>zur</strong> Mitgestaltungdes Behandlungsprozesses im Krankheitsfall zuerhöhen (Kruse 2002a; Lepp<strong>in</strong> 2004). EmpirischeBefunde belegen, dass mehr Wissen z.B. durch e<strong>in</strong>e Patientenschulungdie Leistungs<strong>in</strong>anspruchnahme chronischkranker Menschen senkt und ihre Compliancesteigert (Kiewel 2000).Kompetenzen für die eigene Gesundheit entwickeln, bedeutetdie Fähigkeit, Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungenzum Ausdruck zu br<strong>in</strong>gen, sich zu <strong>in</strong>formieren, zuwählen, entscheiden, urteilen zu können, mitzubestimmen,zu steuern und zu kontrollieren (Bahlo & Kern1999).In <strong>der</strong> aktuellen Diskussion <strong>zur</strong> Patientenorientierung <strong>in</strong><strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen und pflegerischen Versorgung wird e<strong>in</strong>Mehr an Selbstbestimmung für die Patienten und e<strong>in</strong>eStärkung <strong>der</strong> Eigenverantwortung für die Gesundheit gefor<strong>der</strong>t.Diese For<strong>der</strong>ung wird von e<strong>in</strong>em neuen Selbstbewusstse<strong>in</strong>auch <strong>der</strong> älteren Patienten getragen. Sie bemängelnimmer nachdrücklicher fehlende Mitbestimmung <strong>in</strong><strong>der</strong> Gesundheitspolitik und <strong>der</strong> Selbstverwaltung, un<strong>zur</strong>eichenddurchgesetzte Patientenrechte, Defizite an Informationenund Aufklärung, Intransparenz des Leistungsangebots,<strong>der</strong> Strukturen und Abläufe und nicht zuletztden Zustand, unmündiger Patient statt Partner im Behandlungsprozesszu se<strong>in</strong>. Diese kritische Perspektivewird durch Ergebnisse des Gesundheitsmonitors 2002zum Thema Entscheidungsbeteiligung gestützt. Der Studiezufolge werden Betroffene <strong>in</strong> nur 30 bis 40 Prozent allerFälle an Therapieentscheidungen beteiligt.Die Zielsetzungen, die sich mit mehr Selbstbestimmungim Falle von Krankheit und stärkerer Eigenverantwortung<strong>der</strong> Gesundheit gegenüber verb<strong>in</strong>den, lassen sich wiefolgt beschreiben: 1. Kompetente Nutzer nehmen das Gesundheitswesen<strong>in</strong> angemessener Weise, z.B. nachdemEigenhilfe sachgerecht ausgeschöpft wurde, <strong>in</strong> Anspruch.2. Sie verfügen im Falle eigener, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e chronischerKrankheit, über ausreichende Kompetenz, umsoweit als möglich eigenständig mit ihrer Krankheit und <strong>der</strong>erfor<strong>der</strong>lichen Behandlung im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es eigenen „Case-Management” umzugehen. 3. Kompetente Nutzer verhaltensich h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> e<strong>in</strong>vernehmlich mit dem Arztfestgesetzten Verfahrenswege kooperativ, sodass e<strong>in</strong>Fehle<strong>in</strong>satz mediz<strong>in</strong>ischer Ressourcen durch schlechteCompliance vermieden wird. 4. Sie zeigen Verantwortungsbewusstse<strong>in</strong>gegenüber <strong>der</strong> Solidargeme<strong>in</strong>schaft.5. Kompetente Nutzer entwickeln e<strong>in</strong> besseres Verständnisdafür, dass mediz<strong>in</strong>ische bzw. professionelle Entscheidungenbzgl. Gesundheit grundsätzlich nicht frei von Ermessensspielräumense<strong>in</strong> können, und dass Spielräumeim Rahmen des mediz<strong>in</strong>ischen Fortschritts sowie Kompetenzenund Erfahrungen des e<strong>in</strong>zelnen Arztes zu vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong>abweichenden Urteilen führen können, ohne dassdar<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Qualitätsmangel zu sehen ist. 6. Insgesamt entstehtbei kompetenten Nutzern e<strong>in</strong>e „Ent-B<strong>in</strong>dung“ vomGesundheitswesen im S<strong>in</strong>ne m<strong>in</strong>imierter Kontaktratenund -dauer bei gleich bleibendem o<strong>der</strong> verbessertem Versorgungsergebnish<strong>in</strong>sichtlich Morbidität, Mortalität, Lebensqualitätund Kosten (Sachverständigenrat für dieKonzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2001)Die genannten Kompetenzen werden durch e<strong>in</strong>e Vielzahlvon Faktoren bee<strong>in</strong>flusst. Zu diesen gehören (1.) personaleRessourcen, wie z.B. das Gesundheitskonzept o<strong>der</strong>die Erfahrungen, die Menschen im Umgang mit Krankheithaben, (2.) umweltliche und soziale Faktoren, wie diefür e<strong>in</strong> gesundes Leben <strong>zur</strong> Verfügung stehenden WohnundLebensbed<strong>in</strong>gungen, die Organisation des Gesundheitssystemsund die im Krankheitsfall verfügbarensozialen Unterstützungsleistungen, (3.) edukative, kommunikativeund <strong>in</strong>formative Faktoren, die sich sowohl aufgesundheitsbezogene Kontrollüberzeugungen und damit
Drucksache 16/2190 – 112 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeauf die Motivation, vorhandene Ressourcen für dieKrankheitsbewältigung e<strong>in</strong>zusetzen, auswirken als auch<strong>zur</strong> Entwicklung effektiver Bewältigungsstrategien beitragen(Bexfield 1995) .Schulungskonzepte, die dem Patienten e<strong>in</strong> eigenes Managementse<strong>in</strong>er Krankheit ermöglichen, liegen heute fürviele chronische Krankheiten vor. Neben dem Erlernenbestimmter Techniken ist auch die Vermittlung e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>vernehmlichfestgelegten Steuerung <strong>der</strong> Inanspruchnahmedes Versorgungssystems Bestandteil solcher Konzepte.Der Patient lernt, welche Ersche<strong>in</strong>ungen für se<strong>in</strong>enKrankheitsverlauf relevant s<strong>in</strong>d, was er selbst tun kannund wann ärztliche Hilfe erfor<strong>der</strong>lich ist. Wie das Beispielholländischer Allgeme<strong>in</strong>ärzte o<strong>der</strong> auch mehrjährigeKampagnen bei deutschen Krankenkassen (GEK Versicherten<strong>in</strong>itiative<strong>zur</strong> Nasenspülung) zeigen, lässt sich dieInanspruchnahme z.B. bei Erkältungskrankheiten durchsolche edukatorischen Maßnahmen deutlich reduzieren.Kommunikation stellt e<strong>in</strong>e unabd<strong>in</strong>gbare Voraussetzungfür Partizipation und Kompetenzsteigerung dar. Der amhäufigsten genannte Grund für das Aufsuchen von Patienten<strong>in</strong>itiativens<strong>in</strong>d Kommunikationsstörungen zwischenPatient und Arzt. Patienten fühlen sich häufig nicht ernstgenommen, ungenügend aufgeklärt und zu wenig <strong>in</strong>formiert.Nicht als mündiger Patient wahrgenommen zuwerden, trifft nicht selten alte und beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschen,denen auf Grund körperlicher E<strong>in</strong>schränkungen Kompetenzenabgesprochen werden und die als hilfsbedürftigund unselbstständig wahrgenommen werden.Information umfasst alle Maßnahmen, um Patienten daserfor<strong>der</strong>liche Wissen zum Verstehen <strong>der</strong> gesundheitlichenSituation zu vermitteln. Informationen stehen heute aussehr vielen Datenquellen <strong>zur</strong> Verfügung. Mit dieser quantitativenInformationsflut geht die Gefahr e<strong>in</strong>her, dass dieQualität <strong>der</strong> Informationen s<strong>in</strong>kt und <strong>der</strong> Nutzen je<strong>der</strong> zusätzlichenInformation ger<strong>in</strong>g ist. Das Problem, überhauptInformationen zu bekommen, wird zunehmend verdrängtdurch das Problem, die Qualität von Informationen richtige<strong>in</strong>schätzen zu können. Übertragen auf das Gesundheitssystembedeutet dieser Wandel für den Patienten,dass er durch den E<strong>in</strong>satz <strong>der</strong> neuen Technologien dieMöglichkeit hat, zeitnah umfangreiche Informationenüber se<strong>in</strong>e Erkrankungen und <strong>der</strong>en Behandlung o<strong>der</strong>über Prävention zu beziehen, die ihn zum<strong>in</strong>dest teilweiseunabhängig von dem bisherigen Informationsmonopoldes Arztes o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er aufwendigen Literaturrecherche <strong>in</strong>Experten- und Laienliteratur machen.Auch <strong>der</strong> Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktionim Gesundheitswesen hat <strong>in</strong> mehreren Gutachten daraufh<strong>in</strong>gewiesen, dass Transparenz im Gesundheitswesen fürden Versicherten und den Patienten nachhaltig verbessertwerden muss, wenn die politisch immer wie<strong>der</strong> angemahntestärkere Eigenverantwortung von Patienten undVersicherten mehr als f<strong>in</strong>anzielle Selbstbeteiligung se<strong>in</strong>soll. Die Bundesregierung hat erstmals E<strong>in</strong>richtungen <strong>zur</strong>Verbraucher- und Patientenberatung verankert (§ 65bSGB V), wenngleich zunächst nur im Rahmen von Modellvorhaben.3.5 HandlungsgrundsätzeE<strong>in</strong>e effektive Nutzung von Potenzialen älterer Menschen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs- und Nacherwerbsphase ist ohne e<strong>in</strong> effizientesBildungssystem nicht möglich. Die <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eunter An- und Ungelernten ger<strong>in</strong>ge Weiterbildungsbeteiligungund das damit e<strong>in</strong>hergehende Risiko reduzierterBeschäftigungsfähigkeit verweisen – ebenso wie die Tatsache,dass Bildungsangebote <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase<strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung von Möglichkeiten selbstständiger, selbstundmitverantwortlicher Lebensführung bildungsferneSchichten im Allgeme<strong>in</strong>en nur <strong>in</strong> un<strong>zur</strong>eichendem Maßeerreichen – auf die Notwendigkeit möglichst frühzeitige<strong>in</strong>setzen<strong>der</strong>, präventiver Bildungsmaßnahmen. Die dargestelltenErgebnisse machen deutlich, dass Qualifikationsrisikensowie Verluste von Lern- und Leistungskapazität<strong>in</strong> vielen Fällen weniger auf das Alter als vielmehrauf kumulative Benachteiligungen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong>Bildungs- und Erwerbsbiografie, <strong>zur</strong>ückzuführen s<strong>in</strong>d.Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass dieMöglichkeiten, im Alter auftretende Verluste (z.B. <strong>in</strong> <strong>der</strong>Informationsverarbeitungsgeschw<strong>in</strong>digkeit) durch dieVermittlung von Wissenssystemen und Handlungsstrategieno<strong>der</strong> geeignete Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs zu kompensieren, dann erheblichreduziert s<strong>in</strong>d, wenn entsprechende Maßnahmennicht an zuvor ausgebildeten Erfahrungen und Wissensbeständenanknüpfen können. Bildungsversäumnisse lassensich nicht beliebig nachholen, da sie bleibende Spuren<strong>in</strong> Form von nicht entwickelter Lernfähigkeit, nichtmehr kompensierbarer Entwertung von Qualifikationenund bleibenden Gesundheitsschäden h<strong>in</strong>terlassen (sieheauch die beiden Kapitel Erwerbsarbeit und Migration).Die Kommission sieht die Notwendigkeit, die Lernmöglichkeiten<strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs- und Nacherwerbsphase auszubauen,wobei enge Beziehungen zwischen beiden Bereichenbestehen. Sowohl für die Erwerbs- als auch für dieNacherwerbsphase ist von e<strong>in</strong>em umfassenden Verständnisvon Bildung auszugehen. Der Erhalt <strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeitbis zum Rentenalter erfor<strong>der</strong>t nicht nurzusätzliche berufsfachliche Kompetenzen, son<strong>der</strong>n zugleichauch – ganz im S<strong>in</strong>ne des explizierten Bildungsbegriffsvon Faure – Kompetenzen zum Erhalt <strong>der</strong> eigenenGesundheit. In ähnlicher Weise erweisen sich Fähigkeiten<strong>der</strong> Teilhabe an betrieblichen Entscheidungen <strong>in</strong> späterenLebensabschnitten als hilfreich für die Ausübung ehrenamtlicherTätigkeiten sowie für die Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>erselbstständigen und selbstverantwortlichen Lebensgestaltung.Da Deutschland im Vergleich zu an<strong>der</strong>en europäischenStaaten, die das vorhandene Erwerbspersonenpotenzialdeutlich besser ausschöpfen, <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnteneher wenig <strong>in</strong> den Bereich Bildung <strong>in</strong>vestiert hat, mussdieser Bereich auch für Erwachsene e<strong>in</strong>e höhere Prioritätals bisher erhalten. Entsprechend empfiehlt die Kommission,lebenslanges Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs- und Nacherwerbsphase<strong>in</strong> stärkerem Maße als bisher zu för<strong>der</strong>n.Im Folgenden soll zunächst die Notwendigkeit des Ausbauslebenslangen Lernens <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs- und Nacherwerbsphasebegründet werden. Da dieser sowohl <strong>in</strong> öffentlichemwie <strong>in</strong> privatem Interesse ist, wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emzweiten Teil die F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens alspolitische Wertentscheidung diskutiert. Daran schließen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 113 – Drucksache 16/2190sich <strong>in</strong> zwei weiteren Teilen Empfehlungen <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierunglebenslangen Lernens sowie Empfehlungen <strong>zur</strong> Verbesserung<strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für lebenslanges Lernenan: Überlegungen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung lebenslangenLernens müssen e<strong>in</strong>erseits Antworten darauf geben, wieF<strong>in</strong>anzierungsengpässe beseitigt werden, die viele Erwachsenean <strong>der</strong> Teilnahme an Weiterbildung h<strong>in</strong><strong>der</strong>n.Zum an<strong>der</strong>en s<strong>in</strong>d aber weitere begleitende Maßnahmennotwendig, da gerade bei den ger<strong>in</strong>ger Qualifizierten dasLernen nicht alle<strong>in</strong>e an zu ger<strong>in</strong>gen Ressourcen, son<strong>der</strong>noftmals auch an an<strong>der</strong>en Faktoren (un<strong>zur</strong>eichende Motivation,Intransparenz des Angebots etc.) scheitert.3.5.1 Zur Notwendigkeit des Ausbauslebenslangen Lernens <strong>in</strong> <strong>der</strong> ErwerbsundNacherwerbsphaseDie Notwendigkeit verstärkter Investitionen <strong>in</strong> lebenslangesLernen ergibt sich aus vier Zielsetzungen:(1) Der Verbesserung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Entwicklungund <strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit,(2) <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Beschäftigungsfähigkeit,(3) <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Selbstständigkeit im Alter und(4) <strong>der</strong> Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.Ad 1: Deutschland ist <strong>in</strong> den letzten 15 Jahren <strong>zur</strong> Wachstumsbremse<strong>in</strong> Europa geworden. Die Kosten <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>vere<strong>in</strong>igungs<strong>in</strong>d über e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung <strong>der</strong> Zukunfts<strong>in</strong>vestitionenf<strong>in</strong>anziert worden. Die Ausgaben fürForschung, Entwicklung, Bildung und Infrastruktur liegenmittlerweile deutlich unter dem Niveau <strong>der</strong> USA o<strong>der</strong>von Schweden und F<strong>in</strong>nland. Vor allem die beiden letztgenanntenLän<strong>der</strong> haben sich aus e<strong>in</strong>er tiefen Krise ihresSozialstaats durch Investitionen <strong>in</strong> die „Vorauswirtschaft“(Helmstädter 1996) befreit, was sich heute <strong>in</strong> ihrer gutenBeschäftigungsbilanz auszahlt. E<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung <strong>der</strong> Arbeitslosigkeitist nur über e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> Wachstumsdynamikmöglich. Da seit Jahren im Zuge <strong>der</strong> Öffnung<strong>der</strong> Grenzen e<strong>in</strong>fache Arbeit kont<strong>in</strong>uierlich <strong>in</strong> an<strong>der</strong>eLän<strong>der</strong> verlagert wird, hängt die Wettbewerbsfähigkeit<strong>der</strong> deutschen Wirtschaft immer mehr von ihrer Innovationskraftund <strong>der</strong> Qualifikation <strong>der</strong> Beschäftigten ab. Dieserfor<strong>der</strong>t mehr Ressourcen für Bildung, darunter auch fürdie Weiterbildung Erwachsener.Ad 2: Die Beschäftigungsquoten Älterer differieren sehrstark nach dem Qualifikationsniveau. Vor allem die gutqualifizierten Beschäftigten, die auch an Weiterbildungenteilgenommen haben, s<strong>in</strong>d bis zum Rentenalter beschäftigt.Die ger<strong>in</strong>ger qualifizierten über 55-Jährigen habene<strong>in</strong>e äußerst niedrige Beschäftigungsquote. Dies war solangeke<strong>in</strong> Problem, als diese Gruppen zu sozial akzeptablenBed<strong>in</strong>gungen vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheidenkonnten. Die Vorruhestandsmaßnahmen habengewissermaßen präventive Investitionen <strong>in</strong> Qualifikationenerspart. Mittlerweile s<strong>in</strong>d die Möglichkeiten, vorzeitig<strong>in</strong> den Ruhestand zu gehen, weitgehend e<strong>in</strong>geschränktworden, sodass auf solche Investitionen <strong>in</strong> die Beschäftigungsfähigkeitgerade <strong>der</strong> Bildungsbenachteiligten nichtmehr verzichtet werden kann (Bosch 2004a).Ad 3: Gute Gesundheit und geistige Beweglichkeit s<strong>in</strong>dzentrale Voraussetzungen für e<strong>in</strong> selbstständiges und erfülltesLeben im Alter. Zahlreiche nationale und <strong>in</strong>ternationaleStudien belegen, dass sich die alltagspraktischeKompetenz sowie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeitdurch geeignete Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramme erheblichbee<strong>in</strong>flussen lassen, wobei diese Aussage relativ unabhängigvom Lebensalter und von bereits vorhandenenE<strong>in</strong>schränkungen <strong>der</strong> Leistungsfähigkeit getroffen werdenkann. Aus <strong>der</strong> SIMA-Studie liegen H<strong>in</strong>weise vor,dass selbst das Fortschreiten demenzieller Erkrankungendurch e<strong>in</strong>e geeignete Komb<strong>in</strong>ation von Gedächtnistra<strong>in</strong><strong>in</strong>gund psychomotorischem Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g verlangsamt werdenkann (Oswald, Hagen & Rupprecht 2001). Die positivenEffekte von Sport und Bewegung auf die körperlicheund geistige Leistungsfähigkeit s<strong>in</strong>d bis <strong>in</strong> die höchstenAltersgruppen nachgewiesen (Kruse 2002a).Die Bedeutung lebenslangen Lernens für die Gesundheitund Leistungsfähigkeit im Alter wird zunächst aus <strong>der</strong>Tatsache deutlich, dass die Ausbildung e<strong>in</strong>es gesundenLebensstils (wie er <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e durch e<strong>in</strong> ausreichendesAusmaß an körperlicher und geistiger Aktivität, e<strong>in</strong>e gesundeErnährung und die Vermeidung von Risikofaktorengekennzeichnet ist) lebenslang protektiv wirkt. Entsprechendkönnen Bildungsangebote, <strong>in</strong> denen jüngere Altersgruppenfür die Abhängigkeit des Gesundheitszustandesim Alter von gesundheitsbezogenen Gewohnheitenund Verhaltensweisen <strong>in</strong> früheren Lebensabschnitten– und damit für die Gestaltbarkeit von Alternsprozessen –sensibilisiert werden, als e<strong>in</strong> wichtiger Beitrag <strong>zur</strong> Präventionfür das Alter gewertet werden. Neben e<strong>in</strong>er solchenPrävention für das Alter hat aber auch e<strong>in</strong>e Präventionim Alter noch erhebliche Auswirkungen auf dieEntwicklung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit.Aus diesem Grunde sollten entsprechende Bildungsangebote,die sich primär an ältere Menschen wenden, als zentralerBestandteil e<strong>in</strong>er Strategie Lebenslangen Lernensangesehen werden. Lernangebote <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung von Gesundheitund Leistungsfähigkeit (nicht nur im Alter) werdennicht nur durch die klassischen Bildungsträger unterbreitet,son<strong>der</strong>n zunehmend auch durch Krankenkassenund Sportvere<strong>in</strong>e. Des Weiteren gew<strong>in</strong>nen Selbsthilfegruppenhier immer mehr an Bedeutung. Gerade im letztgenanntenBereich wird deutlich, dass die Akzeptanz vonBildungsangeboten für ältere Menschen häufig geradedann zunimmt, wenn zum<strong>in</strong>dest Elemente von Selbstorganisationverwirklicht s<strong>in</strong>d. Nicht zu unterschätzen istauch die Bedeutung <strong>der</strong> Medien. Diese bee<strong>in</strong>flussen zunächstdurch die Vermittlung und Akzentuierung von Altersbil<strong>der</strong>ndie Bemühungen älterer Menschen, ihren eigenenAlternsprozess zu gestalten. Neben dieser eherallgeme<strong>in</strong> motivierenden o<strong>der</strong> demotivierenden Wirkunghaben die Medien auch e<strong>in</strong>e wichtige aufklärerischeFunktion, <strong>in</strong>dem sie etwa über mediz<strong>in</strong>ische Zusammenhängeo<strong>der</strong> das Spektrum vorhandener Gesundheitsangeboteund -produkte <strong>in</strong>formieren.Die Bedeutung lebenslangen Lernens für die Entwicklungvon Gesundheit und Leistungsfähigkeit wird auch dadurchdeutlich, dass sich <strong>in</strong> eher bildungsfernen Schichtene<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere durchschnittliche Lebenserwartungund e<strong>in</strong>e höhere Krankheitsbelastung f<strong>in</strong>den. Daraus
Drucksache 16/2190 – 114 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeergibt sich die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er stärkeren Zielgruppenorientierung,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Entwicklung von Angebotenund Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, durch die Angehörigeunterprivilegierter Sozialschichten besser angesprochenwerden.Ad 4: Allgeme<strong>in</strong>es, politisches und kulturelles Lernenvermittelt den Menschen Grundorientierungen und Kompetenzen,damit sie den politischen und gesellschaftlichenWandel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er komplexer werdenden Gesellschaft aktivmitgestalten können. Es befähigt <strong>in</strong> allen Lebensphasenzum bürgerschaftlichen Engagement, ohne das viele Aufgaben<strong>der</strong> heutigen Zivilgesellschaft nicht mehr leistbars<strong>in</strong>d. Gute Kenntnisse <strong>in</strong> <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>bildung s<strong>in</strong>d nichtnur die Voraussetzung für die Teilnahme an Maßnahmen<strong>der</strong> beruflichen Erstaus- und Weiterbildung, son<strong>der</strong>n auchfür eigenverantwortliche Entscheidungen im Beruf undPrivatleben. Die heute zunehmend gefor<strong>der</strong>te stärkereEigenverantwortung des E<strong>in</strong>zelnen für die F<strong>in</strong>anzierungund Beteiligung an lebenslangem Lernen kann nicht– wie <strong>in</strong> marktliberalen Denkmodellen – e<strong>in</strong>fach vorausgesetztwerden, son<strong>der</strong>n entwickelt sich erst mit gelungenenBildungsprozessen und positiven Beteiligungserfahrungen(Bosch 2004b). Auch die Teilnahme anallgeme<strong>in</strong>er Bildung unterscheidet sich stark nach dengleichen sozialen und ökonomischen Merkmalen. Diesschwächt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und untergräbtdie Handlungsmöglichkeiten e<strong>in</strong>es Teils <strong>der</strong> Bevölkerung<strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft.Das gegenwärtige Niveau <strong>der</strong> Beteiligung Erwachseneran allgeme<strong>in</strong>er und beruflicher Bildung hält die Kommissionaus mehreren Gründen für nicht ausreichend:– Das Innovationstempo ist so gestiegen, dass die Erstausbildungim Berufsleben nicht mehr ausreicht. Siemuss kont<strong>in</strong>uierlich durch Lernen am und außerhalbdes Arbeitsplatzes aufgefrischt, ergänzt und erweitertwerden.– Der Anteil <strong>der</strong> über 50-Jährigen am Erwerbspersonenpotenzialwird von heute 22 Prozent auf 36 Prozent imJahre 2020 steigen (Prognos 2002). Durch die Heraufsetzung<strong>der</strong> Altersgrenzen und die erhebliche Verteuerungdes Vorruhestands s<strong>in</strong>d die bisherigen Strategien<strong>der</strong> Ausglie<strong>der</strong>ung ger<strong>in</strong>g Qualifizierter nicht mehrgangbar. Die Rentenreform muss bildungspolitischunterfüttert werden, damit sie nicht nur die ArbeitslosigkeitÄlterer ansteigen lässt. Die entscheidende Herausfor<strong>der</strong>ungist dabei das kollektive Altern <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung,wodurch es nicht mehr alle<strong>in</strong> umdie Verbesserung <strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit e<strong>in</strong>zelnerIndividuen, son<strong>der</strong>n um den Erhalt <strong>der</strong> Innovationsfähigkeit<strong>der</strong> gesamten Wirtschaft geht. Nur durchdeutlich vermehrte Bildungsanstrengungen <strong>in</strong> den Bereichen<strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en und beruflichen WeiterbildungErwachsener wird chronischer Fachkräftemangelvermieden werden können (Volkholz, Kiel & W<strong>in</strong>gen2002).– Die Bundesrepublik Deutschland hat unter den großeneuropäischen Län<strong>der</strong>n den bei weitem höchsten Anteilan ausländischer Bevölkerung, <strong>der</strong> durch Zuwan<strong>der</strong>ungnoch zunehmen wird. E<strong>in</strong> beträchtlicher Teil <strong>der</strong>ausländischen Bevölkerung – darunter auch viele <strong>der</strong>Dritten <strong>Generation</strong> – weist erhebliche Mängel <strong>in</strong> <strong>der</strong>Schreib- und Lesefähigkeit auf. Dies fiel <strong>in</strong> <strong>der</strong> Industriegesellschaftmit se<strong>in</strong>en zahlreichen e<strong>in</strong>fachen körperlichenTätigkeiten nicht auf, erschwert <strong>in</strong> <strong>der</strong>Dienstleistungsgesellschaft aber den Zugang zum Arbeitsmarkt.– Schließlich differenzieren sich Bildungsbiografien <strong>in</strong>Deutschland aus. Nicht je<strong>der</strong> nimmt den gradl<strong>in</strong>igenWeg durch das Bildungssystem: So ist <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss von 8,2 Prozent1992 auf 9,6 Prozent 2001 gestiegen. Etwa e<strong>in</strong>Viertel <strong>der</strong> Auszubildenden löst se<strong>in</strong> Ausbildungsverhältnisauf. 1984 waren es nur 14 Prozent. 30 Prozent<strong>der</strong> Studenten brechen ihr Studium ab. In <strong>der</strong> deutschenZertifikatsgesellschaft haben es Personen ohneSchul- und Berufsabschlüsse sehr schwer, obgleichQuere<strong>in</strong>steiger mit ihren vielfältigen Lebenserfahrungene<strong>in</strong>e erhebliche Bereicherung von oft sterilenUnternehmenskulturen darstellen können. Mit <strong>der</strong>Verschärfung <strong>der</strong> Zumutbarkeitsregelungen, <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schränkungdes Kündigungsschutzes, <strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellenPrivilegierung prekärer Beschäftigungsformen (M<strong>in</strong>i-,Midijobs, Ich-AG) för<strong>der</strong>t die Politik heute zielgerichtetsolche Karrieren. Wer aber mehr externe Flexibilitätauf dem Arbeitsmarkt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Wissensgesellschaftohne ihre negativen Begleitersche<strong>in</strong>ungen, wie Fachkräftemangelund wachsende soziale Polarisierungwill, muss die Beschäftigungsfähigkeit dieser mobilenArbeitskräfte durch zusätzliche Lernangebote stärken.– Mit Blick auf die Nacherwerbsphase ergibt sich aus<strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Kommission die Aufgabe, allgeme<strong>in</strong>eBildungse<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> zweierlei H<strong>in</strong>sicht gezielt zuför<strong>der</strong>n. Zum e<strong>in</strong>en werden mehr Angebote für dashohe Alter (Personen über 75 Jahre werden aktuell nurun<strong>zur</strong>eichend erreicht), zum an<strong>der</strong>en mehr generationenübergreifendeAngebote benötigt. Des Weiteren istvon e<strong>in</strong>em zukunftsfähigen Bildungssystem zu for<strong>der</strong>n,dass es auch attraktive Bildungsangebote für bildungsgewohnteältere Menschen zu unterbreiten <strong>in</strong> <strong>der</strong><strong>Lage</strong> se<strong>in</strong> sollte, dies vor allem auch angesichts des <strong>in</strong>späteren Geburtsjahrgängen höheren durchschnittlichenBildungsstandes. Zu erwähnen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem Zusammenhangzum e<strong>in</strong>en Seniorenakademien und -universitäten,zum an<strong>der</strong>en Versuche, Bildungsangebote fürSenioren <strong>in</strong> den regulären Universitätsbetrieb zu <strong>in</strong>tegrieren(sei es <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Seniorenstudiums, <strong>in</strong>Form e<strong>in</strong>es Gasthörerstatus o<strong>der</strong> <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es regulärenStudiums).E<strong>in</strong> effizientes Bildungssystem hat auch <strong>der</strong> TatsacheRechnung zu tragen, dass e<strong>in</strong>e hohe Kont<strong>in</strong>uität von Bildungs<strong>in</strong>teressenüber den Lebenslauf besteht. Die Verwirklichunge<strong>in</strong>er Strategie Lebenslangen Lernens hängtaußerdem davon ab, <strong>in</strong>wieweit es gel<strong>in</strong>gt, <strong>in</strong> früheren Lebensalterndas Interesse an Allgeme<strong>in</strong>bildung zu för<strong>der</strong>n(Bosch 2005a). Aus gerontologischer Perspektive ist dieAusbildung e<strong>in</strong>es möglichst breiten Interessenspektrums<strong>in</strong> früheren Jahren auch im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Vorsorge für das eigeneAlter zu betrachten. Zahlreiche Studien legen nahe,dass die Herstellung und Aufrechterhaltung von Lebenszufriedenheitim Alter durch die Möglichkeit, sich <strong>in</strong> früherenLebensabschnitten ausgeübten Aktivitäten und In-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 115 – Drucksache 16/2190teressen wie<strong>der</strong> neu o<strong>der</strong> verstärkt zuzuwenden, erheblichbegünstigt werden.Für die Bewältigung <strong>der</strong> neuen Herausfor<strong>der</strong>ungen ist unserBildungssystem nicht gerüstet: Es gibt Bildungsabbrechernüber 30 Jahre kaum e<strong>in</strong>e zweite Chance. Die Aufstiegsfortbildungaus dem dualen System ist gut, esmangelt aber an <strong>der</strong> Durchlässigkeit <strong>zur</strong> Hochschulausbildung.Die berufliche Erstausbildung ist mo<strong>der</strong>nisiert worden,die Module für die Weiterbildung fehlen. Die Teilnahmean allgeme<strong>in</strong>er und beruflicher Weiterbildung istselektiv. Es gel<strong>in</strong>gt un<strong>zur</strong>eichend, formal ger<strong>in</strong>g Qualifizierte,Randbelegschaften und Personen mit hohen familiärenBelastungen e<strong>in</strong>zubeziehen. Bildungsangebote fürältere Menschen erreichen Angehörige unterprivilegierterSozialschichten, also gerade jene Personen, die am stärkstenvon Bildungsangeboten profitieren könnten 13 , nur un<strong>zur</strong>eichend.Angebote für bildungsgewohnte ältere Menschens<strong>in</strong>d nicht flächendeckend verfügbar. Angebote fürdas hohe Alter s<strong>in</strong>d gegenwärtig ebenso wenig <strong>in</strong> ausreichen<strong>der</strong>Anzahl vorhanden wie <strong>in</strong>tergenerationelle Angebote.3.5.2 Die F<strong>in</strong>anzierung lebenslangen Lernensals politische WertentscheidungSelbst wenn unbestritten ist, dass künftig mehr Ressourcenfür die allgeme<strong>in</strong>e und berufliche Weiterbildung Erwachseneraufgebracht werden müssen als bisher, ist damitnoch nichts darüber ausgesagt, ob und <strong>in</strong> welchemAusmaß die öffentliche Hand diese Ressourcen aufbr<strong>in</strong>gensoll. E<strong>in</strong>en öffentlichen Auftrag <strong>in</strong> <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung<strong>der</strong> Bildung Erwachsener zu def<strong>in</strong>ieren, ist schwieriger,als bei <strong>der</strong> von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen. Denn im Unterschiedzu K<strong>in</strong><strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d Erwachsene mündig und fürsich selbst verantwortlich. Zudem führen viele Bildungsmaßnahmen,vor allem Aufstiegsfortbildungen, zu hohen<strong>in</strong>dividuellen Renditen, die e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzierung durch dasIndividuum, das von diesen Renditen profitiert, nahe legen.Allerd<strong>in</strong>gs haben Bildungs<strong>in</strong>vestitionen auch hoheexterne Effekte, wie die Erhöhung <strong>der</strong> Innovationsfähigkeitund des wirtschaftlichen Wachstums, die Verr<strong>in</strong>gerungvon Armut sowie die Stärkung des gesellschaftlichenZusammenhalts und <strong>der</strong> Demokratie. Nicht allediese Effekte lassen sich quantifizieren. Daher lässt sichdie öffentliche Verantwortung nicht alle<strong>in</strong> aus ökonomischerSachlogik ableiten, wie das manche Bildungsökonomenme<strong>in</strong>en, son<strong>der</strong>n hängt von politischen Wertentscheidungenab.13 In diesem Zusammenhang sei auf die <strong>in</strong> bildungsfernen Schichtenhöheren Mortalitäts- und Morbiditätsraten verwiesen (Kruse 2002;Kruse, Gaber, Heuft, Re & Schulz-Nieswandt, 2002).Die OECD hat gezeigt, dass die besten Ergebnisse durche<strong>in</strong>e Ko-F<strong>in</strong>anzierung zu erzielen s<strong>in</strong>d (OECD 2003b).Wenn e<strong>in</strong>zelne Akteure nur <strong>in</strong> die Bildungsmaßnahmen<strong>in</strong>vestieren, die sich für sie auszahlen (höhere Produktivitätfür die Unternehmen, höheres E<strong>in</strong>kommen für denE<strong>in</strong>zelnen, höhere Steuere<strong>in</strong>nahmen für den Staat, um nurdie monetären Erträge von Bildungs<strong>in</strong>vestitionen zu erwähnen),kommt es <strong>zur</strong> Unter<strong>in</strong>vestition. E<strong>in</strong>e zweite Ursache<strong>der</strong> Unter<strong>in</strong>vestition ergibt sich daraus, dass Lernergebnissenur zum Teil, etwa <strong>in</strong> Form von Abschlüsseno<strong>der</strong> Zertifikaten, sichtbar werden. Wenn aber die Lernergebnisse<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für den potenziellen Arbeitgebernicht transparent werden, zahlen sie sich für den <strong>in</strong>dividuellenLerner nur un<strong>zur</strong>eichend aus.E<strong>in</strong> weiterer Grund kann neben den von <strong>der</strong> OECD erwähntenUrsachen h<strong>in</strong>zugefügt werden: Kosten lassensich zumeist sehr genau messen, Erträge jedoch häufignicht. Diese treten oft erst langfristig auf, und es bleibenimmer hohe Unsicherheitsgrade, <strong>in</strong>wieweit sie dem lebenslangenLernen zu<strong>zur</strong>echnen s<strong>in</strong>d. In e<strong>in</strong>er Wirtschaftund Gesellschaft, die kurzfristig auf Kosten schaut, wirddaher zu wenig <strong>in</strong> lebenslanges Lernen <strong>in</strong>vestiert. E<strong>in</strong> Teil<strong>der</strong> Erträge von Bildungsmaßnahmen – vor allem die sozialenErträge (Verbesserung <strong>der</strong> Lebensqualität, Erhöhungdes sozialen Zusammenhalts, För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Demokratieetc.) – die ke<strong>in</strong>en direkten Verwertungsbezughaben, s<strong>in</strong>d gar nicht o<strong>der</strong> nur schwer messbar. Ihre F<strong>in</strong>anzierungkann nicht aus Ertrags<strong>zur</strong>echnungen abgeleitetwerden.Ko-F<strong>in</strong>anzierung, langfristiges Denken und marktgängigeTransparenz <strong>der</strong> erworbenen Qualifikationen s<strong>in</strong>d alsoVoraussetzungen für die Vermeidung von Unter<strong>in</strong>vestition<strong>in</strong> lebenslanges Lernen. Der Logik <strong>der</strong> Ko-F<strong>in</strong>anzierungfolgen bereits viele Betriebsvere<strong>in</strong>barungen und Tarifverträge.Typisch ist etwa folgende Kostenteilung: Fürdie F<strong>in</strong>anzierung re<strong>in</strong> betriebsbezogener Bildungsmaßnahmens<strong>in</strong>d die Betriebe verantwortlich. Falls dieseMaßnahmen jedoch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e breitere arbeitsmarktgängigeQualifikation münden, hat <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelne e<strong>in</strong>en größerenNutzen und es wird e<strong>in</strong> Beitrag von ihm gefor<strong>der</strong>t. Fallsschließlich die Maßnahmen ke<strong>in</strong>e betriebsnotwendigenAnteile enthalten, liegt die F<strong>in</strong>anzierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verantwortungdes E<strong>in</strong>zelnen. Der Beitrag <strong>der</strong> Beschäftigtenkann durchaus auch <strong>in</strong> Zeitaufwendungen bestehen, diee<strong>in</strong>e wesentliche Ressource ist und sich als entgangenesE<strong>in</strong>kommen monetär quantifizieren lässt.In allen Kostenteilungsmodellen ist allerd<strong>in</strong>gs die E<strong>in</strong>kommens-und Vermögenslage zu berücksichtigen. E<strong>in</strong>ef<strong>in</strong>anzielle Eigenbeteiligung kann nur vom leistungsfähigenTeil <strong>der</strong> Bevölkerung erwartet werden. E<strong>in</strong> Gutachtenim Auftrag <strong>der</strong> unabhängigen Kommission <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierunglebenslangen Lernens zeigte, dass 20 Prozent <strong>der</strong>Haushalte <strong>in</strong> <strong>der</strong> untersten E<strong>in</strong>kommenshierarchie Schuldenhaben und nur sehr begrenzt eigene Beiträge leistenkönnen. E<strong>in</strong> beachtlicher Teil <strong>der</strong> Haushalte verfügt allerd<strong>in</strong>gsüber erhebliche Ersparnisse, die sich auch für Bildungmobilisieren lassen (Arens & Qu<strong>in</strong>ke 2003).Den unterschiedlichen Vorschlägen <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierung lebenslangenLernens liegen unterschiedliche Vorstellungenüber die öffentliche Verantwortung zugrunde, diesich nicht alle<strong>in</strong> aus ökonomischer Sachlogik ableiten lassen,son<strong>der</strong>n von politischen Wertentscheidungen abhängen.Zur Entwicklung e<strong>in</strong>es Bündels konsistenter F<strong>in</strong>anzierungsvorschlägemüssen diese Wertentscheidungenpräzisiert werden. Die 5. Altenberichtskommission sieht<strong>in</strong> <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung von Maßnahmen <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en,politischen und kulturellen Weiterbildung, die Orte <strong>der</strong>Kommunikation und des Lernens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er demokratischenGesellschaft s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e öffentliche Aufgabe. Die Kom-
Drucksache 16/2190 – 116 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodemission geht weiterh<strong>in</strong> davon aus, dass <strong>der</strong> Staat künftigauch jedem Bürger im Erwachsen- und nicht mehr alle<strong>in</strong>im Jugendalter freien Zugang zu e<strong>in</strong>em bestimmten Niveau<strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>bildung und zu e<strong>in</strong>er beruflichen Erstausbildunggewährleistet. Er trägt die Maßnahmekosten(Schulen, Universitäten) und unterstützt die Familien vonLernenden und die erwachsenen Lernenden bei <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungdes Lebensunterhalts. Den Grund für dieseErweiterung des öffentlichen Bildungsauftrags sieht dieKommission <strong>in</strong> Strukturverän<strong>der</strong>ungen auf dem Arbeitsmarkt<strong>in</strong> <strong>der</strong> Wissensgesellschaft. E<strong>in</strong>fache Tätigkeiten,die ohne M<strong>in</strong>destkenntnisse <strong>in</strong> <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>bildung(Sprache, Mathematik etc.) und nur mit ger<strong>in</strong>gen Sozialkompetenzenausgeübt werden können, verlieren quantitativan Bedeutung. Gleichzeitig hat <strong>der</strong> Staat die Aufgabe,durch die Gewährung von Mitteln für beruflicheBildung, Bedürftige zu unterstützen. In <strong>der</strong> f<strong>in</strong>anzwissenschaftlichenLiteratur wurde vielfach darauf h<strong>in</strong>gewiesen,dass Humankapital nicht beleihbar ist und <strong>der</strong> Staat aufGrund dieses Marktversagens helfen müsse, Liquiditätsproblemedurch Darlehen zu überbrücken und das Ausfallrisikobei Rückzahlungsproblemen zu tragen.Die meisten Überlegungen <strong>zur</strong> Def<strong>in</strong>ition des öffentlichenBildungsauftrags s<strong>in</strong>d ebenso wie die Def<strong>in</strong>itionenlebenslangen Lernens „erwerbslastig“. Der öffentlicheBildungsauftrag für die Nacherwerbsphase ist bislangnicht erörtert worden und hat sich eher naturwüchsig entwickelt.Die älteren Bildungsbürger s<strong>in</strong>d die Hauptkonsumentenöffentlich geför<strong>der</strong>ter Kulturangebote. Die Angebote<strong>der</strong> Volkshochschulen haben sich <strong>in</strong>folge desgestiegenen Gesundheitsbewusstse<strong>in</strong>s als Folge <strong>der</strong> Alterung<strong>der</strong> Gesellschaft <strong>in</strong> Richtung <strong>der</strong> Gesundheitsbildungverschoben. Das Seniorenstudium war bislanggebührenfrei. Mittlerweile wurden – weniger aus systematischenÜberlegungen denn aus f<strong>in</strong>anziellen Engpässenheraus – kostendeckende Gebühren für Angeboteaußerhalb e<strong>in</strong>es def<strong>in</strong>ierten Grundangebots von Maßnahmenim öffentlichen Interesse e<strong>in</strong>geführt. Dies gilt etwafür Bildungsreisen, die ebenfalls stark von Älteren genutztwurden. Auch das Seniorenstudium ist mit E<strong>in</strong>führunge<strong>in</strong>es Studienkontos <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Bundeslän<strong>der</strong>n gebührenpflichtiggeworden. Nach diesem Kontenmodellhat jedes Landesk<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>en Anspruch auf e<strong>in</strong> gebührenfreiesErststudium. Bei Überschreiten <strong>der</strong> Regelstudienzeitenund Zweitstudien fallen Gebühren an.Dabei s<strong>in</strong>d die externen Effekte im Auge zu behalten. Esgibt sehr hohe externe Effekte bei <strong>der</strong> Gesundheitsbildungund bei <strong>der</strong> Bildung für Ehrenämter. Nach Auffassung<strong>der</strong> Kommission s<strong>in</strong>d gemäßigte Gebühren für e<strong>in</strong>Studium im Alter vertretbar. Allgeme<strong>in</strong>e Grundbildung,politische und kulturelle Grundbildung sollten ohneh<strong>in</strong>frei se<strong>in</strong>. Bei Älteren geht es nur noch um die Kursgebühren.Unterhaltsgel<strong>der</strong> fallen, wie bei Jüngeren und Erwerbstätigen,ohneh<strong>in</strong> nicht mehr an.3.5.3 Grundsätze <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierunglebenslangen LernensDie Kommission lässt sich im E<strong>in</strong>zelnen von folgendenGrundsätzen leiten:3.5.3.1 Erwachsenenbildungsför<strong>der</strong>ungDie un<strong>zur</strong>eichende Bildungsför<strong>der</strong>ung ger<strong>in</strong>g qualifizierterErwachsener fiel als bildungs-politisches Problemnicht auf, solange genügend Arbeitsplätze für ger<strong>in</strong>gQualifizierte vorhanden waren und die Praxis <strong>der</strong> Frühverrentungdie Möglichkeit bot, frühzeitig aus dem Erwerbslebenauszuscheiden. Der Anteil von Arbeitsplätzenfür ger<strong>in</strong>g Qualifizierte hat jedoch <strong>in</strong> den letzten Jahrendeutlich abgenommen. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeitvon Personen ohne beruflichen und schulischen Abschlussdrastisch gestiegen. Durch die Beendigung <strong>der</strong>bisherigen Vorruhestandspraxis und die Heraufsetzungdes faktischen Rentene<strong>in</strong>trittsalters <strong>in</strong> den nächsten Jahrenist <strong>der</strong> Ausweg des vorzeitigen Ausscheidens potenziellerArbeitsloser künftig versperrt. Gleichzeitig wachsengroße Gruppen von Beschäftigten nach, die auf Grund ihrerBildungsbiografie (ke<strong>in</strong> Schul- o<strong>der</strong> Berufsabschluss,ke<strong>in</strong>e ausgebildete Fähigkeit des Lernens) nicht über ausreichendeVoraussetzungen für lebenslanges Lernen verfügen.Die Heraufsetzung des Rentene<strong>in</strong>trittsalters mussbildungspolitisch flankiert werden, da ansonsten die ArbeitslosigkeitÄlterer steigen würde. Dabei muss die präventiveKomponente <strong>in</strong> <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung gestärkt werden:Es ist nicht s<strong>in</strong>nvoll, erst den E<strong>in</strong>tritt <strong>der</strong> Arbeitslosigkeitabzuwarten und dann zu för<strong>der</strong>n.Ger<strong>in</strong>ger qualifizierte Beschäftigte müssen möglichstfrühzeitig durch e<strong>in</strong> Nachholen von schulischen, beruflichenund Hochschulabschlüssen <strong>in</strong> die <strong>Lage</strong> versetzt werden,ihre Beschäftigungsfähigkeit so zu verbessern, dasssie möglichst bis zum normalen Rentenalter erwerbstätigse<strong>in</strong> können. Im Anschluss an die positiven schwedischenErfahrungen sollen Maßnahmekosten und Lebensunterhaltbeim Nachholen schulischer und beruflicher Abschlüssevon Erwachsenen auch über 30 Jahre mit niedrigemE<strong>in</strong>kommen und ger<strong>in</strong>gem eigenem Vermögen durchZuschüsse und Darlehen geför<strong>der</strong>t werden. Die vorgeschlagenenneuen Instrumente sollen mit dem AFBG(„Meisterbafög“) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Erwachsenenbildungsför<strong>der</strong>ungsgesetz(EBiFG) zusammengefasst werden.Langfristig sollen die Leistungen nach dem Erwachsenenbildungsför<strong>der</strong>ungsgesetzund dem BAföG <strong>in</strong> e<strong>in</strong>eme<strong>in</strong>heitlichen Bildungsför<strong>der</strong>ungsgesetz zusammengefasstwerden. Die bisherigen Bildungstransfers an die Elternsollten dann <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Bildungsgeldes direkt andie Lernenden ausgezahlt werden. Leitbild ist <strong>der</strong> selbstständigeerwachsene Bildungsteilnehmer, <strong>der</strong> nicht mehr,wie bislang, bis zum 27. Lebensjahr als abhängiges K<strong>in</strong>dbetrachtet wird. Alle Tranfers sollen harmonisiert undvon e<strong>in</strong>heitlichen Kriterien abhängig gemacht werden.Der Bund soll die Kompetenz für die Regelung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungenfür lebenslanges Lernen erhalten. DieserVorschlag <strong>der</strong> Kommission kann schrittweise umgesetztwerden. Die Strukturierung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>landschaftdurch diese beiden Gesetze im Verhältnis zum Status quoist <strong>in</strong> Abbildung 21 dargestellt. Die öffentliche För<strong>der</strong>ungnimmt bei steigendem privaten Interesse an den Maßnahmenab (Abbildung 22).
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 117 – Drucksache 16/2190Abbildung 21Öffentliche För<strong>der</strong>ung des Lebensunterhalts: Status quo im Vergleich zu den Empfehlungenpf gQuelle: Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“ 2004.Staffelung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung nach öffentlichem und privatem InteresseAbbildung 22Quelle: Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“ 2004.
Drucksache 16/2190 – 118 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode3.5.3.2 Grundversorgung mit allgeme<strong>in</strong>erBildungIn e<strong>in</strong>er Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft, <strong>in</strong><strong>der</strong> e<strong>in</strong>fache körperliche Arbeit zunehmend durch Kommunikationsarbeitersetzt wird und <strong>in</strong> <strong>der</strong> AbstraktionssowieSprachfähigkeit und ähnliche Kompetenzen e<strong>in</strong>egrößere Rolle spielen, steigen die Anfor<strong>der</strong>ungen an dieallgeme<strong>in</strong>en Basisqualifikationen. Allgeme<strong>in</strong>e Bildungdient hierbei nicht nur dazu, die fortschreitende Technisierungdes Alltags zu bewältigen o<strong>der</strong> bürgerschaftlichesEngagement zu fundieren, son<strong>der</strong>n sie ist heutzutage e<strong>in</strong>eVoraussetzung für den Zugang zu e<strong>in</strong>er Berufsausbildungund zum Verbleib auf dem Arbeitsmarkt bis zum Rentenalter.Auch die Internationalisierung und Globalisierung<strong>der</strong> wirtschaftlichen und zwischenmenschlichenBeziehungen erzeugen Bedarf nach Fremdsprachenkompetenzenund soziokultureller Kenntnis für e<strong>in</strong>en kompetentenUmgang mit unterschiedlichen Kulturen <strong>in</strong>nerhalbund außerhalb Europas. Die Zunahme von Auslandsreisenund beruflichen Auslandskontakten deutscher Mitbürgerwirken sich z.T. bereits <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er wachsenden Nachfragenach Sprach- und Kulturangeboten aus. Durch dieAlterung <strong>der</strong> Gesellschaft steigt die Nachfrage nachBildungsmaßnahmen <strong>zur</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung. Schließlichbedürfen die Zuwan<strong>der</strong>er e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsunterstützung,z.B. <strong>in</strong> Form von Deutsch- und Integrationskursen.Die Geme<strong>in</strong>den und Kreise halten e<strong>in</strong> Angebot anProgrammen und Kursen bereit, das <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> ist, verschiedeneNachfragen zu erfüllen. Gegenüber e<strong>in</strong>er Vorstellungvon Politik, die staatliche Intervention nur aus e<strong>in</strong>emnachgewiesenen o<strong>der</strong> vermuteten Marktversagenableitet, ist an <strong>der</strong> öffentlichen Verantwortung für die bürgerschaftliche,allgeme<strong>in</strong>e, politische und kulturelle Bildungund damit auch für das lebenslange Lernen festzuhalten.Als Kriterium <strong>der</strong> Mitverantwortung des Staatesgilt hierbei das öffentliche Interesse.Die Bundeslän<strong>der</strong> haben <strong>in</strong> Kooperation mit den Geme<strong>in</strong>denund Kreisen sowie den Trägern <strong>der</strong> ErwachsenenundWeiterbildung seit Mitte <strong>der</strong> 1970er-Jahre durch Arrangements<strong>der</strong> Ko-F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong> flächendeckendesAngebot an E<strong>in</strong>richtungen geschaffen, welches den Bürgerne<strong>in</strong>en offenen Zugang zu Veranstaltungen <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en,politischen und kulturellen Bildung ermöglichensoll. Sie haben damit <strong>in</strong> den Kommunen Dialogforen <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em öffentlichen Raum geschaffen, <strong>in</strong> dem sich Bürgersowohl artikulieren wie auch engagieren und zugleiche<strong>in</strong>e Wissensbasis für ihr bürgerschaftliches bzw. zivilgesellschaftlichesEngagement aneignen können.Diese Lern<strong>in</strong>frastruktur für Erwachsene ist als gesellschaftlicheund kulturelle Errungenschaft zu würdigen.Es gilt sie nicht nur zu erhalten, son<strong>der</strong>n zu stabilisierenund, wo erfor<strong>der</strong>lich, auszubauen. Allerd<strong>in</strong>gs stimmt dieKommission mit <strong>der</strong> Auffassung <strong>der</strong> Evaluationskommission<strong>der</strong> Weiterbildung des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalenübere<strong>in</strong>, dass nicht alle Lernwünsche, die seitens <strong>der</strong> Bürgerartikuliert werden, durch öffentliche För<strong>der</strong>ung Unterstützungerfahren können und sollen.Vor dem H<strong>in</strong>tergrund des <strong>in</strong> Zukunft weiter zunehmendengesellschaftlichen Lern- und Kompetenzbedarfs sowohle<strong>in</strong>er alternden Erwerbsgesellschaft als auch für ehrenamtlichesEngagement und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für die gesellschaftlicheIntegration von Randgruppen, besteht angesichts<strong>der</strong> Stagnation <strong>der</strong> öffentlichen För<strong>der</strong>ung fürallgeme<strong>in</strong>es, politisches und kulturelles Lernen und deskont<strong>in</strong>uierlich wachsenden Anteils <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungdurch die Teilnehmer <strong>in</strong> diesem Bereich Handlungsbedarf.Die stetige Verlagerung <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungsanteile aufdie Lernenden überfor<strong>der</strong>t die F<strong>in</strong>anzierungskraft bestimmterNachfragergruppen, die gerade gehalten o<strong>der</strong>gewonnen werden sollen. Sie kann e<strong>in</strong>e Umschichtung<strong>der</strong> Lernenden zu Lasten e<strong>in</strong>kommensschwacher und zuGunsten e<strong>in</strong>kommensstärkerer Bevölkerungsgruppen <strong>zur</strong>Folge haben. Auch die erwachsenen Lernenden, die <strong>in</strong> ihrerJugend entwe<strong>der</strong> ke<strong>in</strong>en Schulabschluss erreicht o<strong>der</strong>ke<strong>in</strong>e Berufsausbildung absolviert haben, sowie die Zuwan<strong>der</strong>er,die bestimmte Grundkenntnisse erwerben müssen,sollten auch auf e<strong>in</strong>e öffentlich geför<strong>der</strong>te Infrastrukturdes lebenslangen Lernens <strong>zur</strong>ückgreifen können, umihre Bildungsziele verwirklichen zu können. In ähnlicherWeise gilt für die Nacherwerbsphase, dass für Angehörigeunterprivilegierter sozialer Schichten e<strong>in</strong> angemessenerZugang zu Angeboten, mit <strong>der</strong>en Hilfe die Aufrechterhaltungo<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>herstellung von Gesundheit,Leistungsfähigkeit sowie Selbstständigkeit und Selbstverantwortunggeför<strong>der</strong>t werden kann, garantiert werdenmuss.Die Sicherung <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en, politischen und kulturellenWeiterbildung ist auch bei angespannter Haushaltslagevon Bund, Län<strong>der</strong>n und Kommunen e<strong>in</strong>e öffentlicheAufgabe von höchster Priorität. Ziel soll es se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>erseitsdie öffentlichen und privaten Anbieter von allgeme<strong>in</strong>er,politischer und kultureller Weiterbildung zum Erhalte<strong>in</strong>es quantitativ und qualitativ sowie regional ausreichendenAngebotes zu motivieren und an<strong>der</strong>erseits dieLern- und Bildungsbereitschaft sowie die Eigenverantwortung<strong>der</strong> Individuen zu stützen und zu stärken. Dabeisoll sich die öffentliche, d.h. die Landes- und die kommunaleFör<strong>der</strong>ung im Bereich <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en, politischenund kulturellen Weiterbildung auf solche Angebote beschränkenbzw. konzentrieren, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em öffentlichenInteresse liegen.Die bewertende Sichtung von Weiterbildungsprogrammenlegt es nahe, e<strong>in</strong> öffentliches Interesse bei folgendenAngebots<strong>in</strong>halten anzunehmen: Veranstaltungen <strong>zur</strong> politischenBildung, <strong>zur</strong> arbeitswelt- und berufsbezogenenBildung und <strong>zur</strong> kompensatorischen Grundbildung (Alphabetisierungskurse,Deutsch als Fremdsprache), Angebote,die e<strong>in</strong>e abschlussbezogene Allgeme<strong>in</strong>bildung ermöglichen,Angebote <strong>zur</strong> lebensgestaltenden Bildunge<strong>in</strong>schließlich des Bereichs <strong>der</strong> sozialen und <strong>in</strong>terkulturellenBeziehungen sowie <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung, Angebote<strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung von Schlüsselqualifikationen (Fremdsprachen-und Medienkompetenz), Angebote <strong>zur</strong>För<strong>der</strong>ung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit undSelbstständigkeit (nicht nur im Alter) und Angebote <strong>zur</strong>Familienbildung. Beson<strong>der</strong>es öffentliches Interesse giltdem bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagement.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 119 – Drucksache 16/21903.5.3.3 BildungssparenNach Angaben des Bundes<strong>in</strong>stituts für Berufsbildung(BIBB) wurden im Jahr 2002 von den <strong>in</strong>sgesamt27,8 Mio. Teilnehmern ca. 13,9 Mrd. Euro für die eigeneberufliche Weiterbildung ausgegeben. Die durchschnittlichenKosten beruflicher Weiterbildung belaufen sich damitauf 502 Euro je Teilnehmer. H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong>Kostenverteilung lässt sich auf <strong>der</strong> Grundlage e<strong>in</strong>er Befragungvon 2.000 Personen feststellen, dass für 45 Prozent<strong>der</strong> Teilnehmer ke<strong>in</strong>erlei Kosten, für 14 Prozent relativniedrige Kosten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Umfang von unter 100 Euro,für 28 Prozent spürbare Kosten im Umfang von 100-999Euro und für 11 Prozent hohe Kosten im Umfang vonüber 1.000 Euro und für 2 Prozent extrem hohe Kosten <strong>in</strong>Höhe von m<strong>in</strong>destens 5.000 Euro entstanden s<strong>in</strong>d. Derdurchschnittliche Umfang <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildungsmaßnahmenlag bei 138 Stunden, von denen 74nicht <strong>in</strong> die betriebliche Arbeitszeit fallen. Rechnet manden Zeitaufwand für unbezahlte Überstunden wegen <strong>der</strong>Weiterbildung, vorheriger Information, Vor- und Nachbereitungsowie Fahrzeiten h<strong>in</strong>zu, dann ergibt sich lautBIBB e<strong>in</strong> durchschnittlicher Freizeitverlust <strong>in</strong>folge beruflicherWeiterbildung <strong>in</strong> Höhe von 133 Stunden pro Teilnehmerund Jahr (Bundes<strong>in</strong>stitut für Berufsbildung2004).In Deutschland wird die Bildung von Geldvermögen, Kapitalbeteiligungen,Eigenkapital zum Immobilienerwerbsowie Alterssicherungsvermögen bis zu e<strong>in</strong>er bestimmtenHöhe des zu versteuernden E<strong>in</strong>kommens durch staatlicheSparprämien und Zulagen geför<strong>der</strong>t. In die Kontenkönnen, wie bei den an<strong>der</strong>en Formen <strong>der</strong> staatlichen För<strong>der</strong>ungprivater Vermögensbildung auch, die vermögenswirksamenLeistungen des Arbeitgebers e<strong>in</strong>gebrachtwerden. Die Kommission ist <strong>der</strong> Auffassung, dass diestaatliche Sparför<strong>der</strong>ung um e<strong>in</strong>e regelmäßige Geldanlage<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es speziellen Bildungssparkontos erweitertwerden soll. E<strong>in</strong> System des Lebenslangen Lernensfor<strong>der</strong>t auch von den privaten Haushalten eigene Beiträgezu Gunsten <strong>der</strong> Bildung und Weiterbildung ihrer Mitglie<strong>der</strong>.Die oftmals nicht ger<strong>in</strong>gen Kosten von Weiterbildungs<strong>in</strong>d häufig nicht aus dem laufenden E<strong>in</strong>kommen zu f<strong>in</strong>anzieren,vor allem, wenn die Teilnahme am Erwerbslebenzu diesem Zweck vorübergehend unterbrochen o<strong>der</strong>reduziert werden muss und dabei Kosten des Lebensunterhaltso<strong>der</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung mit abgedeckt werdenmüssen. Daher müssen für lebenslanges Lernen Prozessedes Sparens und Entsparens mit e<strong>in</strong>er Vorf<strong>in</strong>anzierungsmöglichkeitüber Kreditaufnahme und Tilgung sowie mitnachgelagerter Verz<strong>in</strong>sung verbunden se<strong>in</strong>. Haushalte mitger<strong>in</strong>gem E<strong>in</strong>kommen weisen typischer Weise e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>geSparfähigkeit und -neigung auf und haben <strong>in</strong>folgedessenauch ger<strong>in</strong>gere Möglichkeiten <strong>zur</strong> Selbstf<strong>in</strong>anzierungvon Maßnahmen des lebenslangen Lernens.3.5.3.4 Ausbau betrieblicher WeiterbildungDer Betrieb ist für die meisten erwerbstätigen Erwachsenen<strong>der</strong> wichtigste Lernort für die formale und non formaleBerufsbildung, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e aber für das arbeitsplatzbezogene<strong>in</strong>formelle „Lernen durch Arbeiten“.Insbeson<strong>der</strong>e ger<strong>in</strong>g qualifizierte Beschäftigte, die schonlange den Zugang zu formellen Bildungsmaßnahmen verlorenhaben, können über arbeitsplatzbezogenes Lernenwie<strong>der</strong> <strong>zur</strong> Weiterbildung motiviert werden.Grundsätzlich ist es Aufgabe <strong>der</strong> Unternehmen, die imbetrieblichen Interesse liegende Weiterbildung ihrerBeschäftigten zu f<strong>in</strong>anzieren. Sie tragen das unternehmerischeRisiko für die Bildungs<strong>in</strong>vestitionen, und ihnenfließen auch die Erträge zu. Sofern betriebliche Weiterbildungsmaßnahmenvon den Beschäftigten <strong>in</strong>itiiert werdenund sie ihre Beschäftigungsfähigkeit auch über den Betriebh<strong>in</strong>aus verbessern, kann e<strong>in</strong>e Kostenteilung bzw.Ko-F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> Maßnahmen s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>. Die Sozialpartnerhaben <strong>in</strong> den letzten Jahren vere<strong>in</strong>zelt tariflicheVere<strong>in</strong>barungen zu Qualifizierung geschlossen.H<strong>in</strong>zu kommen <strong>in</strong> wachsendem Umfang Betriebsvere<strong>in</strong>barungen.Die Kommission hält es für e<strong>in</strong>en großen Fortschritt, dassVere<strong>in</strong>barungen <strong>zur</strong> Weiterbildung getroffen werden, ausdenen sich Verb<strong>in</strong>dlichkeiten für die Weiterbildungspflichtim engeren S<strong>in</strong>ne, für Verfahren <strong>zur</strong> Feststellungdes Weiterbildungsbedarfs und <strong>der</strong> Weiterbildungs<strong>in</strong>haltesowie für Freistellungs- und F<strong>in</strong>anzierungsregelungen ergeben.Darüber h<strong>in</strong>aus ist zu begrüßen, dass nach demMuster <strong>der</strong> Tarifverträge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Metall<strong>in</strong>dustrie Baden-Württembergs und <strong>der</strong> chemischen Industrie, organisatorischeVerankerungen <strong>der</strong> Weiterbildung <strong>in</strong> Agentureno<strong>der</strong> ähnlichen Institutionen getroffen o<strong>der</strong> empfohlenwerden. Auf <strong>der</strong> Grundlage von Tarifverträgen können <strong>in</strong>Betriebsvere<strong>in</strong>barungen die F<strong>in</strong>anzierungsregelungenkonkretisiert und die Organisation <strong>der</strong> Weiterbildung ausgestaltetwerden. Firmentarifverträge s<strong>in</strong>d vor allem danns<strong>in</strong>nvoll, wenn ke<strong>in</strong> überbetrieblicher tariflicher Rahmenvorgegeben ist.Schließlich s<strong>in</strong>d die gesetzlichen Regelungen zu erwähnen,die <strong>in</strong> Form von Bildungsurlaubsgesetzen und entsprechendenFreistellungsansprüchen nach dem Recht <strong>der</strong>jeweiligen Län<strong>der</strong> und <strong>in</strong> Form an<strong>der</strong>er Weiterbildungsnormen,wie den Regelungen <strong>in</strong> § 37 c SGB III (Kurzzeit-Qualifizierung <strong>der</strong> Beschäftigten von Personal-Service-Agenturen <strong>in</strong> verleihfreien Zeiten), getroffen wurden. Ansie kann bei den betrieblichen und tarifvertraglichen Regelungenangeknüpft werden. So kann z.B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Betriebsvere<strong>in</strong>barungfestgehalten werden, wie viele Tagepro Arbeitnehmer e<strong>in</strong> Unternehmen m<strong>in</strong>destens für diejährliche berufliche Weiterbildung verwenden muss.3.5.3.5 Arbeitsmarktpolitische MaßnahmenMit <strong>der</strong> Hartz-Reform ist die Anzahl <strong>der</strong> Teilnehmere<strong>in</strong>tritte<strong>in</strong> geför<strong>der</strong>te Bildungsmaßnahmen zwischen 2001und 2004 um 59 Prozent <strong>zur</strong>ückgegangen (von 449.622auf 184. 418) (Bundesagentur für Arbeit 2002; 2005b).E<strong>in</strong>e Differenzierung <strong>der</strong> Teilnehmere<strong>in</strong>tritte im Vergleich<strong>der</strong> Jahre 2002 und 2003 nach „beson<strong>der</strong>s för<strong>der</strong>ungsbedürftigenPersonengruppen“ zeigt die deutlichstenRückgänge für Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te (um 70 Prozent),Personen im Alter von über 50 Jahren (um 61 Prozent),Spätaussiedler<strong>in</strong>nen und Spätaussiedler (um 57 Prozent),Langzeitarbeitslose (56 Prozent), Personen ohne Berufs-
Drucksache 16/2190 – 120 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeausbildung (um 51 Prozent), Berufsrückkehrer<strong>in</strong>nen (um51 Prozent), Auslän<strong>der</strong> und Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Frauen(jeweils um 48 Prozent). Die Teilnehmere<strong>in</strong>tritte von Personenunter 25 Jahre s<strong>in</strong>d im gleichen Zeitraum um25 Prozent <strong>zur</strong>ückgegangen (Schuldt & Troost 2004: 22).Die erfolgreiche und vor allem auch nachhaltige Vermittlungvon Arbeitslosen setzt <strong>in</strong> vielen Fällen Weiterbildungsmaßnahmenvoraus, soweit ihre erworbenenQualifikationen nicht ausreichen o<strong>der</strong> durch den wirtschaftlichenund technischen Strukturwandel überholtwurden. Solche Weiterbildungsmaßnahmen liegen nichtalle<strong>in</strong> im Interesse <strong>der</strong> Betroffenen, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong>Volkswirtschaft <strong>in</strong>sgesamt, damit vorhandene Qualifikationennicht dauerhaft entwertet werden und e<strong>in</strong>em trotzhoher Arbeitslosigkeit partiell bereits spürbaren Fachkräftemangelauf dem Arbeitsmarkt vorgebeugt werdenkann. Angesichts <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> hohen und zukünftig nochzunehmenden Geschw<strong>in</strong>digkeit des Strukturwandelse<strong>in</strong>hergehenden Steigerung <strong>der</strong> Qualifikationsanfor<strong>der</strong>ungenan die Beschäftigten und des <strong>in</strong>folge des demografischenWandels zu erwartenden chronischen Fachkräftemangelsgeht die Kommission davon aus, dass dieBedeutung von Weiterbildungsmaßnahmen für die Vermeidungvon Arbeitslosigkeit und die Verbesserung <strong>der</strong>Vermittlungsaussichten von Arbeitslosen nicht ab-, son<strong>der</strong>nweiter zunehmen wird. Die bisherige För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>Weiterbildung von Arbeitslosen und die stärker präventiveFör<strong>der</strong>ung von Arbeitslosigkeit bedrohter Gruppen,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von An- und Ungelernten, durch die Bundesagenturfür Arbeit s<strong>in</strong>d daher e<strong>in</strong> Kernelement e<strong>in</strong>eszukunftsfähigen Systems <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung lebenslangenLernens und müssen f<strong>in</strong>anziell ausreichend ausgestattetwerden.Da Arbeitslosigkeit und Qualifikationsverluste bei raschemStrukturwandel <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von den betroffenenPersonen nur begrenzt voraussehbar und vom E<strong>in</strong>zelnenkaum zu bee<strong>in</strong>flussen s<strong>in</strong>d, ist e<strong>in</strong>e Risikosicherung übere<strong>in</strong>e Solidargeme<strong>in</strong>schaft notwendig. Dies schließt <strong>in</strong>dividuelleVorsorge durch selbst<strong>in</strong>itiierte und -f<strong>in</strong>anzierteWeiterbildungsmaßnahmen nicht aus. Allerd<strong>in</strong>gs läuftdieses Engagement ebenfalls stets Gefahr, durch denStrukturwandel überholt zu werden.Im Unterschied <strong>zur</strong> <strong>in</strong>dividuellen Weiterbildung s<strong>in</strong>d arbeitsmarktpolitischeMaßnahmen häufig fremd<strong>in</strong>itiiertund nicht <strong>in</strong> jedem Fall freiwillig. Weiterbildungsmaßnahmens<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Amtssprache dem Arbeitslosen „zumutbar“,sodass bei Nichtteilnahme Sperrzeiten verhängtwerden können. E<strong>in</strong>e aktive Arbeitsmarktpolitik sollnicht nur för<strong>der</strong>n, son<strong>der</strong>n auch die für die Vermittlungnotwendige Eigen<strong>in</strong>itiative for<strong>der</strong>n.Seit Anfang 2002 kann durch das Gesetz <strong>zur</strong> Reform <strong>der</strong>arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQTIV-Gesetz)(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmediz<strong>in</strong>2003) die Teilnahme an anerkannten Weiterbildungsmaßnahmenvon Beschäftigten ab dem vollendeten 50. Lebensjahr<strong>in</strong> Betrieben mit weniger als 100 Arbeitnehmerndurch die Übernahme <strong>der</strong> Weiterbildungskosten geför<strong>der</strong>twerden (SGB III § 417 Abs. 2). Die Kommission siehttrotz <strong>der</strong> demografischen Entwicklung ke<strong>in</strong>e Notwendigkeitfür altersspezifische Instrumente <strong>der</strong> Bildungsför<strong>der</strong>ung<strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitik. Erfahrungen mit entsprechendenInstrumenten im Job-AQTIV-Gesetz (För<strong>der</strong>ungvon über 50-Jährigen <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>betrieben) haben gezeigt,dass diese kaum <strong>in</strong> Anspruch genommen werden, da siezu spät ansetzen. Die adäquate Antwort auf die demografischeHerausfor<strong>der</strong>ung ist die präventive Weiterbildung.Die Bundesagentur für Arbeit, die gegenwärtig nur nochBildungsmaßnahmen för<strong>der</strong>t, bei denen e<strong>in</strong>e Verbleibsquote<strong>in</strong> <strong>der</strong> Beschäftigung von 70 Prozent zu erwartenist, soll künftig stärker als bisher präventiv die Weiterbildung<strong>der</strong> auf dem Arbeitsmarkt am stärksten gefährdetenGruppe <strong>der</strong> An- und Ungelernten im Betrieb för<strong>der</strong>n.Weiterqualifizierung von Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweitenLebenshälfteE<strong>in</strong> Beispiel für Möglichkeiten <strong>der</strong> Weiterqualifizierungvon Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte bildet e<strong>in</strong>vom Wirtschaftsm<strong>in</strong>isterium des Landes Baden-Württemberg seit 2004 geför<strong>der</strong>tes Projekt mit dem Titel„Comeback – 45+“. In diesem Projekt werdenFrauen, die auf Grund familiärer Verpflichtungen ihreErwerbstätigkeit für längere Zeit unterbrochen haben, <strong>in</strong>verschiedenen Schlüsselkompetenzen geschult, um aufdiese Weise die Chancen <strong>der</strong> Rückkehr <strong>in</strong> den Beruf zuerhöhen. Zu diesen Schlüsselkompetenzen gehörenStrategien <strong>der</strong> Problemlösung, <strong>der</strong> Verhandlungsführungund <strong>der</strong> Bewerbung, sozialkommunikative Fertigkeitenwie Gesprächsführung im Dialog und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe,Techniken <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ation und Präsentation sowieFertigkeiten <strong>zur</strong> Bedienung von Computern und <strong>zur</strong> gezieltenRecherche im Internet. E<strong>in</strong>e bedeutende Komponentedes Programms bildet e<strong>in</strong> m<strong>in</strong>destens sechswöchiges,fachlich begleitetes Praktikum.Die Weiterbildungsangebote für Berufsrückkehrer<strong>in</strong>nen,die an verschiedenen Standorten des Bundeslandes unterbreitetwerden, f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zielgruppe sehr hoheResonanz und Akzeptanz. Dabei zeigen die Interviewsund Gruppengespräche mit den Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>der</strong>enstark ausgeprägte Motivation <strong>zur</strong> Rückkehr <strong>in</strong> das Erwerbslebenund <strong>der</strong> Nutzung entsprechen<strong>der</strong> Weiterbildungsangebote.Die Evaluation <strong>der</strong> Sem<strong>in</strong>arprogrammeerbrachte nicht nur e<strong>in</strong>en deutlichen Kompetenzzuwachs<strong>in</strong> den tra<strong>in</strong>ierten Fertigkeiten, son<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong>edeutliche Steigerung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebenszufriedenheit <strong>der</strong>Frauen sowie e<strong>in</strong>e Differenzierung ihrer eigenen beruflichenPerspektiven.3.5.3.6 Sprachkurse für Zuwan<strong>der</strong>erIn <strong>der</strong> <strong>in</strong>fas-Studie liegt die Weiterbildungsbeteiligung<strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er weit unter jener <strong>der</strong> deutschen Vergleichsgruppe,wobei zu vermuten ist, „dass <strong>der</strong> Mangelan allgeme<strong>in</strong>en Grundqualifikationen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e anSprachkenntnissen, neben kulturellen Hemmschwellenfür die bisherige Distanz <strong>zur</strong> Weiterbildung verantwort-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 121 – Drucksache 16/2190lich ist“ (Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierung LebenslangenLernens“ 2004: 110). So gibt e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> über8.000.000 über 16-jährigen Zuwan<strong>der</strong>er an, schlechtDeutsch zu sprechen, etwa 50 Prozent geben an, schlechtDeutsch zu schreiben. Der Anteil <strong>der</strong> Zuwan<strong>der</strong>er mitSprachdefiziten wird auf 40 Prozent, <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Aussiedlermit Sprachdefiziten auf 25 Prozent geschätzt (Expertenkommission„F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“2004: 123). Die ger<strong>in</strong>ge Weiterbildungsbeteiligung vonZuwan<strong>der</strong>ern steht im Gegensatz zu e<strong>in</strong>em bedeutsamenUnterschied <strong>in</strong> <strong>der</strong> Weiterbildungsmotivation; <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geAnteil an Zuwan<strong>der</strong>ern, <strong>der</strong> Weiterbildungsangebote besucht,zeichnet sich durch e<strong>in</strong> überdurchschnittliches Engagementaus, was <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> besuchtenMaßnahmen zum Ausdruck kommt.Nach Auffassung <strong>der</strong> Kommission sollen Zuwan<strong>der</strong>er e<strong>in</strong>enRechtsanspruch auf Integrationsmaßnahmen beigleichzeitiger Teilnahmepflicht haben. Durch das Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetzwurde für Neuzuwan<strong>der</strong>er e<strong>in</strong> Rechtsanspruchauf Integrationsmaßnahmen bei gleichzeitigerTeilnahmepflicht geschaffen. Über die Gruppe <strong>der</strong> Neuzuwan<strong>der</strong>erh<strong>in</strong>aus soll auch bereits dauerhaft <strong>in</strong> Deutschlandlebenden Migranten, die über ke<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> nur mangelhafteDeutschkenntnisse verfügen, im Rahmen vonKont<strong>in</strong>genten die Teilnahme an Integrationskursen ermöglichtwerden. Die Höhe dieser Kont<strong>in</strong>gente soll jährlichüberprüft und schrittweise angehoben werden. Vorallem arbeitslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte undger<strong>in</strong>g qualifizierte Migranten sollen e<strong>in</strong>e bevorzugteTeilnahme an Integrationskursen erhalten. Die Teilnahmeberechtigungsoll durch das jeweilige Arbeitsamt festgestelltwerden. Jugendlichen Flüchtl<strong>in</strong>gen soll e<strong>in</strong>eArbeitserlaubnis zum Zweck <strong>der</strong> Aufnahme e<strong>in</strong>er Ausbildungim dualen Ausbildungssystem erteilt werden.3.5.4 Empfehlungen <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong>Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für lebenslangesLernenDie vorgeschlagenen F<strong>in</strong>anzierungs<strong>in</strong>strumente müssendurch folgende <strong>in</strong>stitutionelle Rahmenbed<strong>in</strong>gungen flankiertwerden, sodass im Zusammenwirken aller Instrumentestärkere Anreize zum lebenslangen Lernen sowohlbei den Individuen als auch bei den Betrieben entstehen:3.5.4.1 Informations- und BeratungsstrukturE<strong>in</strong>e nachfragerfreundliche Informations- und Beratungs<strong>in</strong>frastrukturist e<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung dafür,dass Lernende eigenverantwortliche Entscheidungen fürihren Bildungsweg treffen können. Gleichzeitig ist dasWeiterbildungsangebot sehr unübersichtlich, weshalb sowohldie Qualität als auch <strong>der</strong> Nutzen e<strong>in</strong>zelner Angebotevom Nachfrager (Individuum o<strong>der</strong> Unternehmen) oft nurschwer e<strong>in</strong>zuschätzen s<strong>in</strong>d. Mit Blick auf die Erhaltungvon Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Selbstständigkeitsollten im Gesundheitssystem Möglichkeiten zu e<strong>in</strong>erStärkung eigenverantwortlichen Patientenhandelns geprüftwerden. In diesem Zusammenhang ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>eStärkung <strong>der</strong> Rolle des Hausarztes ebenso bedeutsam,wie e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong> besser koord<strong>in</strong>ierte Zusammenarbeitzwischen den Akteuren des Gesundheitssystems.3.5.4.2 Anerkannte Abschlüsse und Module alsOrientierungspunkte fürWeiterbildungsentscheidungenIn e<strong>in</strong>em unstrukturierten Bildungsmarkt ist es wegen <strong>der</strong>hohen Informations- und Suchkosten für Individuen undBetriebe, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für kle<strong>in</strong>e und mittlere Unternehmen,aufwendig, unter <strong>der</strong> Fülle <strong>der</strong> Angebote bedarfsgerechtauszuwählen. Durch die Bündelung von Qualifikationen<strong>in</strong> anerkannten Berufen o<strong>der</strong> Fortbildungsgängenwird die Transparenz auf dem Markt erhöht. AnerkannteAbschlüsse erhöhen wegen ihrer Arbeitsmarktgängigkeitdie Attraktivität von Angeboten für die Beschäftigten un<strong>der</strong>leichtern den Betrieben den Zuschnitt ihrer Arbeitsorganisationund die Personalrekrutierung, was die Transaktionskostensenkt. Vor allem im Weiterbildungsbereichfehlt es noch an solchen Orientierungsmarken, die Pfadedurch das Dickicht <strong>der</strong> Bildungslandschaft legen. Ganzoffensichtlich weist dieses System im Bereich <strong>der</strong> WeiterbildungLücken auf, die geschlossen werden müssen. Esist daher zu empfehlen, bei <strong>der</strong> Neuordnung von BerufenWeiterbildungsmodule zu entwickeln, um Beschäftigten,die <strong>in</strong> ihrer Jugend e<strong>in</strong>en Beruf erlernt haben, e<strong>in</strong>e Anpassungan den neuesten Stand zu ermöglichen.3.5.4.3 Profil<strong>in</strong>gE<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Form <strong>der</strong> Beratung stellt das Bildungsprofil<strong>in</strong>gdar. Diese systematische <strong>in</strong>dividuelle Positionsbestimmungsoll aufzeigen, welche Qualifikationszielee<strong>in</strong> Individuum bei gegebenen Fähigkeiten und Neigungenrealistisch erreichen kann. Bildungsprofil<strong>in</strong>g mussdas Ziel haben, Erwerbspersonen vor und im Verlauf solcherVerän<strong>der</strong>ungsprozesse <strong>in</strong>dividuell und organisatorischzu unterstützen. Dazu gilt es zunächst, den beruflichenund qualifikatorischen Status <strong>der</strong> jeweiligenErwerbsperson zu erkennen und zu analysieren, was siekann und welche Stärken sie hat. Daraus resultierendmuss geprüft werden, <strong>in</strong> welche Richtung sich die Personweiterentwickeln will und kann und <strong>in</strong> welchen Schrittendies realisierbar ist. Die Kommission hält es z.B. für s<strong>in</strong>nvoll,dass <strong>der</strong> Bezug von Leistungen nach dem EBifG ane<strong>in</strong> vorangegangenes Profil<strong>in</strong>g geknüpft wird. Dadurchsoll sichergestellt werden, dass <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e erwachseneLerner ihre Fähigkeiten, beruflichen Ziele und Entwicklungsmöglichkeitenrealistisch e<strong>in</strong>schätzen, bevor sie Bildungsabschlüssenachholen bzw. sich im Berufsleben erworbeneKenntnisse zertifizieren lassen. Ebenso solldadurch gewährleistet werden, dass Effizienzverluste,welche durch am Bedarf vorbeigehende Qualifizierungenerzeugt werden, m<strong>in</strong>imiert werden.3.5.4.4 Zertifizierung von vorhandenem WissenLebenslanges Lernen kann nicht nur durch die Teilnahmean formalen Weiterbildungsmaßnahmen, son<strong>der</strong>n auchdurch ständig neue Herausfor<strong>der</strong>ungen im Rahmen des„Learn<strong>in</strong>g by Do<strong>in</strong>g“ am Arbeitsplatz o<strong>der</strong> im Bereich
Drucksache 16/2190 – 122 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode<strong>der</strong> privaten Lebensführung stattf<strong>in</strong>den. Um diesen Formendes lebenslangen Lernens gerecht zu werden und siefür formale Weiterbildungsmaßnahmen anschlussfähig zumachen, muss zukünftig verstärkt die Zertifizierung vonim Berufsleben o<strong>der</strong> im außerberuflichen Alltag erworbenenKenntnissen und Fähigkeiten stimuliert und unterstütztwerden. Hier s<strong>in</strong>d im Zusammenhang mit <strong>der</strong> erhöhtenDurchlässigkeit zwischen Berufstätigkeit undHochschulzugang <strong>in</strong>teressante Entwicklungen zu nennen.Schon heute besteht z.B. <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Schleswig-Holste<strong>in</strong>und Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz die Möglichkeit fürqualifizierte Beschäftigte, über E<strong>in</strong>stufungsprüfungenden Hochschulzugang zu erlangen. Weitere Möglichkeitens<strong>in</strong>d vorgesehen 14 (Sekretariat <strong>der</strong> ständigen Konferenz<strong>der</strong> Kultusm<strong>in</strong>ister <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> 2003). Dr<strong>in</strong>gendnotwendig ist e<strong>in</strong>e nachträgliche Zertifizierung von Kompetenzen<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für Lerner ohne Schulabschluss,denen erst durch die Anerkennung von im Berufsleben erworbenemWissen <strong>der</strong> Erwerb e<strong>in</strong>es Schulabschlusses erleichtertwird, wodurch weitere Möglichkeiten zumlebenslangen Lernen eröffnet werden. Hier kann auf Erfahrungenaus <strong>der</strong> so genannten Externenprüfung für e<strong>in</strong>enHauptschul- o<strong>der</strong> dualen Ausbildungsabschluss <strong>zur</strong>ückgegriffenwerden.3.5.4.5 Zeitliche Flexibilisierung <strong>der</strong>WeiterbildungsangeboteE<strong>in</strong>e weitere wesentliche Rahmenbed<strong>in</strong>gung für die Möglichkeit<strong>der</strong> Teilnahme an lebenslangem Lernen ist diezeitliche Struktur des Weiterbildungsangebots, da hierdurchdie Opportunitätskosten (<strong>in</strong> Form von entgangenemE<strong>in</strong>kommen und entgangener Zeit) maßgeblich bestimmtwerden. Der größte Kostenfaktor beim lebenslangenLernen für erwachsene Beschäftigte ist entgangenes E<strong>in</strong>kommen.Kaum weniger bedeutsam ist aber, dass WeiterbildungsteilnehmerZeit <strong>in</strong>vestieren müssen, um an Weiterbildungsmaßnahmenteilnehmen zu können. Dies stellt<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für Frauen mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n (o<strong>der</strong> pflegebedürftigenAngehörigen), aber auch für Selbstständige e<strong>in</strong> gravierendesProblem dar, da beide Gruppen <strong>in</strong> hohem Maßezeitlich <strong>in</strong>flexibel s<strong>in</strong>d. Damit Lernwillige den E<strong>in</strong>kommensverlustund die zeitlichen Opportunitätskosten <strong>in</strong>Grenzen halten können, müssen Bildungse<strong>in</strong>richtungenihre Angebote zunehmend zeitlich flexibilisieren. DieAngebote müssen je nach Bedarf fortlaufend o<strong>der</strong> geblockt,zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten,berufsbegleitend, <strong>in</strong> Form von Teilzeitmaßnahmen o<strong>der</strong><strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation von berufsbegleitendem Lernen mitBlockveranstaltungen <strong>in</strong> Abschlussnähe angeboten werden.E<strong>in</strong> solche Flexibilisierung liegt wegen <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gerenE<strong>in</strong>kommensverluste und zeitlichen Opportunitätskostensowohl im Interesse <strong>der</strong> Individuen, seien sie beschäftigto<strong>der</strong> nicht, als auch im Interesse <strong>der</strong> Betriebe, welche dieLerner beschäftigen. Für viele Bildungse<strong>in</strong>richtungen erfor<strong>der</strong>tdies e<strong>in</strong>e Än<strong>der</strong>ung ihres Selbstverständnisses <strong>in</strong>14 Vgl. den Beschluss <strong>der</strong> Kultusm<strong>in</strong>isterkonferenz vom 28.06.02 <strong>zur</strong>Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenenKenntnissen und Fähigkeiten auf e<strong>in</strong> Hochschulstudium.Bezug auf die Bereitstellung von Bildungsangeboten (Programmkataloge)und e<strong>in</strong> kundenorientiertes Dienstleistungsbewusstse<strong>in</strong>.3.5.4.6 Lernför<strong>der</strong>liche Arbeitsorganisation undnon formales und <strong>in</strong>formelles LernenDie Anfor<strong>der</strong>ungen am Arbeitsplatz s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> wesentlichenMotivatoren und Antreiber lebenslangen Lernens,da sie die Notwendigkeit und den Nutzen des Lernens,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auch für bildungsfernere Personen,offensichtlich werden lassen. Viele Anregungen zum lebenslangenLernen kommen aus betrieblichen Arbeitserfahrungen.Im betrieblichen Alltag und vor allem bei betrieblichenInnovationen lernen Beschäftigte <strong>in</strong>formellund müssen, um Sprünge <strong>in</strong> <strong>der</strong> technologischen Entwicklungnachvollziehen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Arbeitsplätze e<strong>in</strong>nehmenzu können, <strong>in</strong> bestimmten Abständen dieses<strong>in</strong>formell erworbene Wissen durch formales Lernen fundierenund erweitern. Insofern bilden <strong>in</strong>formelles undformales Lernen e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit. Die Entwicklung lernför<strong>der</strong>licherFormen <strong>der</strong> Arbeitsorganisation ist e<strong>in</strong>er <strong>der</strong>wichtigsten Ansätze <strong>der</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Lernmotivation(Bosch 2000). Erfor<strong>der</strong>lich s<strong>in</strong>d zum e<strong>in</strong>en dezentraleFormen <strong>der</strong> Arbeitsorganisation mit größeren <strong>in</strong>dividuellenHandlungsspielräumen und zum an<strong>der</strong>en Formen <strong>der</strong>Arbeitsorganisation, <strong>in</strong> denen <strong>in</strong>formelles und non formalesLernen direkt angeregt und gesichert wird, z.B. überJobrotation, Qualitätszirkel, Systeme <strong>der</strong> Rückmeldungenvon Erfolgen und Fehlern sowie notwendigen Lernschritten.Wenn es stimmt, dass betriebliches Lernen e<strong>in</strong>er <strong>der</strong>wichtigsten Motivatoren für berufliches Lernen ist undangesichts <strong>der</strong> steigenden Beschäftigungsquoten und <strong>der</strong>Dualisierung des Lernens (Lernen am Arbeitsplatz und <strong>in</strong>Weiterbildungse<strong>in</strong>richtungen) an Bedeutung gew<strong>in</strong>nt,dann ist es äußerst beunruhigend, dass sich die Arbeitsorganisation<strong>in</strong> Deutschland nicht <strong>in</strong> Richtung lernför<strong>der</strong>licherpost-tayloristischer Systeme entwickelt, son<strong>der</strong>nsich als zunehmend polarisiert darstellt. Polarisierung bedeutetAusschluss bestimmter Beschäftigungsgruppenvom formalen, aber auch vom <strong>in</strong>formellen Lernen. DieEntwicklung lernför<strong>der</strong>licher Formen <strong>der</strong> Arbeitsorganisationmuss e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> zentralen Zielsetzungen <strong>der</strong> Unternehmen,aber auch von Vere<strong>in</strong>barungen <strong>der</strong> Tarifparteiense<strong>in</strong>, die durch geeignete Rahmensetzungen etwa <strong>in</strong> <strong>der</strong>Lohn- und Gehaltspolitik entsprechende Anreize gebenkönnen. Die Kommission hält die Vere<strong>in</strong>barungen, z.B. <strong>in</strong><strong>der</strong> Metall<strong>in</strong>dustrie zu neuen Entgelt-Tarifvere<strong>in</strong>barungen,<strong>in</strong> denen die Bezahlung zunehmend vom HandlungsundEntscheidungsspielraum o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Teamarbeit abhängiggemacht wird, für Schritte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Richtung, die ausgebautwerden sollte.3.5.4.7 Anreize zum lebenslangen Lernen durchEntwicklungen <strong>in</strong> Arbeits- undProduktmärktenDa <strong>der</strong> Staat die F<strong>in</strong>anzierung lebenslangen Lernens nichtalle<strong>in</strong>e tragen kann und soll, müssen neben den Individuenauch die Unternehmen e<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag leis-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 123 – Drucksache 16/2190ten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch Rahmensetzungen<strong>in</strong> Produkt- und Arbeitsmärkten vielfältigeAnreize für die betriebliche Weiterbildung erzeugt werden.Hierzu zählen beispielsweise e<strong>in</strong>e gesundheitsför<strong>der</strong>licheArbeitsgesetzgebung, welche die langfristigeNutzung <strong>der</strong> Arbeitsvermögen <strong>der</strong> Beschäftigten unterstützt,e<strong>in</strong>e Innovationspolitik, welche die Nutzung undImplementierung neuer Technologien und Organisationsformenerleichtert, Qualitätsstandards auf Produktmärkten(mittels Normen wie <strong>der</strong> VOB im Bau o<strong>der</strong> auchdurch Stärkung des Verbraucherschutzes) sowie das Produkthaftungs-,Geräte- und Produktsicherheitsrecht sowieStandards zum Gesundheitsschutz <strong>der</strong> Kunden und zumArbeits- und Unfallschutz <strong>der</strong> Beschäftigten. Die Unternehmenreagieren auf die vielfältigen Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong>Märkte und auf die Regulierung <strong>der</strong> betrieblichen Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel mit <strong>in</strong>tegrierten Konzepten<strong>der</strong> Qualitätssicherung, des Gesundheitsschutzes o<strong>der</strong> desArbeits- und Unfallschutzes, <strong>in</strong> denen die Qualifizierung<strong>der</strong> Beschäftigten und ihrer Vorgesetzten e<strong>in</strong>e entscheidendeRolle spielt.3.5.4.8 Gezielte För<strong>der</strong>ung bildungsfernerSchichtenDie vorliegenden Befunde <strong>zur</strong> Partizipation an Bildungsangebotenmachen deutlich, dass Personen mit höhererSchul- und Berufsausbildung überproportional an Bildungsangebotenpartizipieren, sodass Bildungsungleichheitenim Alter eher verstärkt werden. Daraus lässt sichals e<strong>in</strong>e vorrangige Aufgabe von Bildungspolitik ableiten,verstärkt bildungsungewohnte Personen für Bildungsaktivitätenim Alter zu gew<strong>in</strong>nen. Die Bewältigung dieserAufgabe setzt neben e<strong>in</strong>er schichtspezifischen f<strong>in</strong>anziellenFör<strong>der</strong>ung und e<strong>in</strong>er stärkeren Zielgruppenorientierungauch e<strong>in</strong>e effektivere Aufklärung über die Gestaltbarkeitvon Alternsprozessen <strong>der</strong> potenziellen Nutzer vonBildungsangeboten voraus. In diesem Zusammenhang istdarauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass gerade <strong>in</strong> bildungsfernenSchichten die fehlende Partizipation an Bildungsangebotenzum Teil auch auf e<strong>in</strong>seitig negativ akzentuierte Altersbil<strong>der</strong><strong>zur</strong>ückgeht, <strong>der</strong>en Differenzierung als e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>eAufgabe von Bildungs- wie Gesundheitspolitikverstanden werden kann.3.5.4.9 För<strong>der</strong>ung von Eigenverantwortung imGesundheitssystemAus gesundheitspolitischer Perspektive s<strong>in</strong>d Bildungsangebotewegen ihrer Bedeutung für Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund Prävention unverzichtbar. Die Kommission geht davonaus, dass die Teilnahme an gesundheitsbezogenenBildungsangeboten zunehmen wird, wenn es gel<strong>in</strong>gt, die(Mit-)Bestimmungsrechte von Patienten zu stärken, etwadurch die Möglichkeit e<strong>in</strong>er stärker <strong>in</strong>formierten E<strong>in</strong>flussnahmeauf die Art <strong>der</strong> Behandlung o<strong>der</strong> durch mehrTransparenz und Differenzierung <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Leistungenund Tarife <strong>der</strong> Krankenversicherung.3.5.4.10 Entwicklung von Qualitätsstandardsals Grundlage gezielter För<strong>der</strong>ung vonBildungsbeteiligung nach <strong>der</strong>ErwerbsphaseWenn es etwa möglich ist, die kognitive Leistungsfähigkeitdurch die Teilnahme an spezifischen Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogrammennachhaltig zu verbessern o<strong>der</strong> den Verlauf e<strong>in</strong>erdemenziellen Erkrankung durch spezifische Programmegünstig zu bee<strong>in</strong>flussen, dann besteht schon unter demGesichtspunkt <strong>der</strong> Entwicklung von Gesundheitskostene<strong>in</strong> starkes gesellschaftliches Interesse an <strong>der</strong> Nutzungentsprechen<strong>der</strong> Angebote durch ältere Menschen. Unterdieser Voraussetzung ersche<strong>in</strong>t es folgerichtig, die Teilnahmebereitschaftälterer Menschen auch durch die Bereitstellungf<strong>in</strong>anzieller Mittel zu för<strong>der</strong>n. Der <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>fas-Untersuchungermittelte Befund, dass <strong>in</strong> etwa87 Prozent aller Fälle die Nutzung von Bildungsangebotenim Alter durch den Wunsch, geistige Leistungsfähigkeitzu verbessern, motiviert ist, verweist auf e<strong>in</strong> erheblichesEigen<strong>in</strong>teresse, was gleichbedeutend damit ist, dassdie entsprechenden Kosten nicht <strong>in</strong> vollem Umfang übernommenwerden sollten. Wichtiger ersche<strong>in</strong>t es aus <strong>der</strong>Sicht <strong>der</strong> Kommission, bildungsmotivierte Ältere <strong>in</strong> die<strong>Lage</strong> zu versetzen, den potenziellen Nutzen e<strong>in</strong>es Bildungsangebotsvorab abzuschätzen und auf dieser Grundlageauch jene Angebote auszuwählen, die den größtenNutzen versprechen.3.5.4.11 Vermehrte Ansprache älterer Menschenals mitverantwortliche BürgerDie Nutzung von Bildungsangeboten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphaseist auch unter dem Gesichtspunkt <strong>der</strong> sozialen Integrationund Partizipation älterer Menschen sowie <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ungvon Beziehungen zwischen den <strong>Generation</strong>en zubegrüßen. E<strong>in</strong>e Verwirklichung <strong>der</strong> entsprechendenPotenziale älterer Menschen wird aber nur gel<strong>in</strong>gen,wenn diese den E<strong>in</strong>druck haben, dass auch jenseits vonF<strong>in</strong>anzierungsfragen e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>es gesellschaftlichesInteresse an e<strong>in</strong>er kompetenten älteren <strong>Generation</strong> besteht.Gerade im Alter ist die Bildungsmotivation <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>erWeise an den E<strong>in</strong>druck, erworbene Bildungs<strong>in</strong>haltefür sich selbst und an<strong>der</strong>e nutzen zu können,gebunden. Aus diesem Grunde kann die Bildungsbeteiligungälterer Menschen nicht unabhängig von den zentralenAnnahmen und Positionen im gesellschaftlichen Diskursüber das Alter gesehen werden.3.5.5 För<strong>der</strong>ung des geme<strong>in</strong>samen Lernens<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>enSowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong>Erwachsenenbildung wird <strong>der</strong> Aspekt des <strong>Generation</strong>enaustauschsim Kontext von Bildungsaktivitäten vermehrtthematisiert. Weiterbildungsangebote, die auch unter demAspekt potenzieller Stärken durch die Umsetzung <strong>der</strong>Mehrgenerationenperspektive evaluiert wurden, machendeutlich, dass <strong>der</strong> Austausch zwischen den <strong>Generation</strong>enfür Jung und Alt von hohem zusätzlichen Wert ist – unddies sowohl h<strong>in</strong>sichtlich des Erfahrungs- und Wissens-
Drucksache 16/2190 – 124 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodetransfers als auch h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Motivation, die <strong>in</strong> beidenGruppen erkennbar zunimmt.Mit den vorliegenden Vorschlägen <strong>zur</strong> Verbesserung vonLernmöglichkeiten für Ältere soll deshalb nicht e<strong>in</strong> getrenntesLernen von Älteren und Jüngeren geför<strong>der</strong>t werden.Durch geme<strong>in</strong>sames Lernen wird <strong>der</strong> ErfahrungsundWissenstransfer zwischen den <strong>Generation</strong>en geför<strong>der</strong>t,was gerade im H<strong>in</strong>blick auf das kollektive Altern <strong>der</strong>Gesellschaft und den drohenden Fachkräftemangel an Bedeutunggew<strong>in</strong>nt. Gerade die Unternehmen, die überdurchschnittlichviele Ältere beschäftigen, zeichnen sichdurch e<strong>in</strong>e aktive För<strong>der</strong>ung des Wissenstransfers zwischenden <strong>Generation</strong>en aus. Sie setzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> betrieblichenArbeitsorganisation auf altersgemischte Arbeitsgruppenund organisieren formale, non formale und<strong>in</strong>formelle Lernprozesse auch <strong>in</strong> altersgemischten Lerngruppen,um e<strong>in</strong>er Ausgrenzung <strong>der</strong> Älteren vorzubeugen.Die tägliche Erfahrung des geme<strong>in</strong>samen Arbeitensund Lernens ist zudem e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> wichtigsten Voraussetzungenfür den Abbau von Altersstereotypen. Das Gleichegilt für das Lernen <strong>der</strong> Älteren <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase.Befragungen haben gezeigt, dass auch <strong>in</strong> <strong>der</strong>Nacherwerbsphase die Älteren beim Lernen nicht untersich bleiben wollen, son<strong>der</strong>n den Austausch und denKontakt mit an<strong>der</strong>en Altersgruppen suchen. Nur bei Veranstaltungenzu Themen des „Alterns“ und zu Rentenfragenwollen sie mehrheitlich unter sich bleiben (Schrö<strong>der</strong>& Gilberg 2005: 113).3.6 HandlungsempfehlungenDie 5. Altenberichtskommission schließt sich den Überlegungen<strong>der</strong> unabhängigen Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierungLebenslangen Lernens“ für Personen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsphaseweitgehend an und ergänzt sie durchVorschläge <strong>zur</strong> Nacherwerbsphase. Die Empfehlungenorientieren sich auch an den positiven Erfahrungen mitErwachsenenstipendien <strong>in</strong> Schweden beim Nachholenvon Schul- und Studienabschlüssen, an den französischenErfahrungen <strong>der</strong> Umlagef<strong>in</strong>anzierung <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e fürbefristete Beschäftigte und Leiharbeiter sowie am neuenfranzösischen Weiterbildungsgesetz, das jedem Beschäftigtenjährlich e<strong>in</strong>en Weiterbildungsanspruch von 20 Stundene<strong>in</strong>räumt.1 Erwachsenenbildungsför<strong>der</strong>ung: Ger<strong>in</strong>ger qualifizierteBeschäftigte müssen frühzeitig durch e<strong>in</strong> Nachholenvon schulischen, beruflichen und Hochschulabschlüssen <strong>in</strong>die <strong>Lage</strong> versetzt werden, ihre Beschäftigungsfähigkeit sozu verbessern, dass sie möglichst bis zum normalen Rentenaltererwerbstätig se<strong>in</strong> können. Zu den ger<strong>in</strong>ger qualifiziertenBeschäftigten gehören viele Migranten aus denehemaligen Anwerbelän<strong>der</strong>n. Grundvoraussetzung fürdie Verbesserung <strong>der</strong>er Beschäftigungsfähigkeit ist dieFör<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> deutschen Sprachkenntnisse. Die hierzuvorgesehenen Integrationskurse sollen auch die dauerhaft<strong>in</strong> Deutschland lebenden Migranten e<strong>in</strong>beziehen.2 Grundversorgung mit allgeme<strong>in</strong>er Bildung: DieBundeslän<strong>der</strong> und Kommunen sollen wie bislang e<strong>in</strong>e flächendeckendeGrundversorgung mit Angeboten allgeme<strong>in</strong>er,politischer und kultureller Weiterbildung gewährleisten.Dazu zählt auch die Infrastruktur für dasNachholen von Schulabschlüssen, für die Sprach- und Integrationsför<strong>der</strong>ungvon Zuwan<strong>der</strong>ern und für die För<strong>der</strong>ungdes Erwerbs von <strong>in</strong>ternationaler Kompetenz (z.B.Sprache und kulturelle Kompetenz). Län<strong>der</strong> und Kommunensollen sich auf e<strong>in</strong>en bestimmten Prozentsatz ihresHaushalts verständigen, <strong>der</strong> jährlich für die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>allgeme<strong>in</strong>en, politischen und kulturellen Weiterbildung<strong>zur</strong> Verfügung gestellt wird.3 Bildungssparen: Die staatliche För<strong>der</strong>ung nach dem5. Vermögensbildungsgesetz (VermBG) soll um die Möglichkeiterweitert werden, auch Bildungssparen staatlichzu för<strong>der</strong>n. Damit sollen auch für bisher bildungsfernePersonengruppen mit niedrigem E<strong>in</strong>kommen und ger<strong>in</strong>gemeigenen Vermögen Anreize geschaffen werden,e<strong>in</strong>en Teil ihres E<strong>in</strong>kommens <strong>in</strong> lebenslanges Lernen zu<strong>in</strong>vestieren. Erwachsene Lernende sollen auch e<strong>in</strong> kostengünstigesDarlehen für Bildungszwecke aufnehmen können.In das Bildungskonto können auch vermögenswirksameLeistungen des Arbeitgebers e<strong>in</strong>gebracht werden.Um Anreize zum Sparen zu erhalten, müssen die Kontenvor staatlichen Zugriffen, z.B. auf das Vermögen Arbeitsloser,geschützt werden.4 Ausbau betrieblicher Weiterbildung: Die F<strong>in</strong>anzierungbetrieblicher Weiterbildung ist orig<strong>in</strong>äre Aufgabe<strong>der</strong> Betriebe. Der Staat kann allerd<strong>in</strong>gs die Rahmenbed<strong>in</strong>gungenfür betriebliche Weiterbildung verbessern. Vere<strong>in</strong>barungenzu betrieblichen Lernzeitkonten zwischenden Sozialpartnern sollen durch gesetzliche Regelungen<strong>zur</strong> Insolvenzsicherung <strong>der</strong> Guthaben, durch e<strong>in</strong>e nachgelagerteBesteuerung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zahlungen sowie durch dieAllgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeitserklärung von freiwilligen Vere<strong>in</strong>barungen<strong>zur</strong> Umlagef<strong>in</strong>anzierung wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bauwirtschaftverbessert werden. Ähnlich wie <strong>in</strong> Dänemark,Schweden o<strong>der</strong> Frankreich sollen Beschäftigte für Bildungsmaßnahmenmit e<strong>in</strong>em Rückkehrrecht freigestelltwerden. Angesichts <strong>der</strong> hohen Arbeitsmarktrisiken vonLeiharbeitnehmern soll e<strong>in</strong>e Umlage von e<strong>in</strong>em Prozent<strong>der</strong> Lohnsumme für Qualifizierung erhoben werden. DieUmlagemittel sollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en von den Sozialpartnern verwaltetenFonds fließen und <strong>in</strong> verleihfreien Zeiten für dieWeiterbildung genutzt werden.5 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: Die Bundesagenturfür Arbeit soll nach Vorstellung <strong>der</strong> Kommissionkünftig stärker als bisher präventiv die Weiterbildung<strong>der</strong> auf dem Arbeitsmarkt am stärksten gefährdetenGruppe <strong>der</strong> An- und Ungelernten im Betrieb för<strong>der</strong>n. Dabeisollen nicht nur wie bisher Maßnahmen geför<strong>der</strong>twerden, die mit e<strong>in</strong>em Berufsabschluss enden, son<strong>der</strong>nauch anerkannte Module, die zu solchen Abschlüssenh<strong>in</strong>führen können. Weiterh<strong>in</strong> sollen die Bildungsbemühungenvon Arbeitslosen durch Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchsbei eigen<strong>in</strong>itiierter Weiterbildung gestärktwerden.Zur Vermeidung von negativen Selektionseffekten zumNachteil ger<strong>in</strong>g Qualifizierter sollen die prognostizierten
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 125 – Drucksache 16/2190Verbleibsquoten bei Weiterbildungsmaßnahmen flexiblergehandhabt werden. Je<strong>der</strong> potenziell von Arbeitslosigkeitbedrohte über 40-Jährige sollte Anrecht auf e<strong>in</strong> Bildungsprofil<strong>in</strong>ghaben, das den <strong>in</strong>dividuellen Bildungsbedarffeststellt.6 Verbesserung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für lebenslangesLernen: Die Kommission empfiehlt– die Möglichkeiten <strong>zur</strong> Stärkung eigenverantwortlichenPatientenhandelns durch verän<strong>der</strong>te Informations- undBeratungsstrukturen zu för<strong>der</strong>n,– die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt durch die Bündelungvon Qualifikationen <strong>in</strong> anerkannten Berufeno<strong>der</strong> Fortbildungsgängen zu erhöhen,– zukünftig die Zertifizierung von im Berufsleben o<strong>der</strong>im außerberuflichen Alltag erworbenen Kenntnissenund Fähigkeiten verstärkt zu stimulieren und zu unterstützen,– die Weiterbildungsangebote zeitlich zu flexibilisieren,damit Erwachsene Beruf und Lernen besser mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>komb<strong>in</strong>ieren können,– lernför<strong>der</strong>liche (dezentrale) Formen <strong>der</strong> Arbeitsorganisationmit größeren <strong>in</strong>dividuellen Handlungsspielräumenzu entwickeln, <strong>in</strong> denen <strong>in</strong>formelles und nonformales Lernen direkt angeregt und gesichert wird,– durch Rahmensetzungen <strong>in</strong> Arbeits- und Produktmärktenvielfältige Anreize für die betriebliche Weiterbildungund lebenslanges Lernen zu erzeugen.7 För<strong>der</strong>ung von Eigenverantwortung im Gesundheitssystem:Aus gesundheitspolitischer Perspektive s<strong>in</strong>dBildungsangebote wegen ihrer Bedeutung für Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund Prävention unverzichtbar. Angesichts<strong>der</strong> nachgewiesenen Erfolge <strong>der</strong>artiger Programme liegtes nahe, gezielte Anreizsysteme zu schaffen. Gleiches giltfür Schulungen mit dem Ziel e<strong>in</strong>es besseren Krankheitsmanagementsund e<strong>in</strong>er effektiveren Nutzung von Möglichkeitendes Versorgungssystems.8 Entwicklung von Qualitätsstandards als Grundlagegezielter För<strong>der</strong>ung von Bildungsbeteiligungnach <strong>der</strong> Erwerbsphase: Im Bereich von Gesundheit,Leistungsfähigkeit und Krankheitsmanagement soll dieEntwicklung von Qualitätsstandards, anhand <strong>der</strong>er sichdie Effektivität von Bildungsmaßnahmen abbilden lässt,gezielt vorangetrieben werden.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 127 – Drucksache 16/21904 E<strong>in</strong>kommenslage im Alter und künftige Entwicklung4.1 Zu den Schwerpunkten des KapitelsDieses Kapitel hat vor allem zwei Themenkomplexe zumGegenstand: Zum e<strong>in</strong>en wird auf die gegenwärtige E<strong>in</strong>kommens-und Vermögenssituation Älterer e<strong>in</strong>gegangen.Sodann werden mögliche Entwicklungsperspektiven fürdie künftige E<strong>in</strong>kommenslage erörtert. Sie dürfte sich aufGrund ökonomischer und politischer Entwicklungendeutlich von <strong>der</strong> jetzigen <strong>Lage</strong> unterscheiden. Dabei gehtes sowohl um das Niveau von E<strong>in</strong>kommen als auch umdie Verteilung des E<strong>in</strong>kommens und die Struktur <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommennach E<strong>in</strong>kunftsarten (E<strong>in</strong>künfte aus gesetzlichen,betrieblichen und privaten Systemen).H<strong>in</strong>sichtlich des E<strong>in</strong>kommens konzentrieren sich die Darlegungenauf solche E<strong>in</strong>künfte, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase(also bei Bezug von Renten/Pensionen) bezogenwerden. Damit bleiben Aspekte <strong>der</strong> ökonomischen PotenzialeÄlterer, die mit <strong>der</strong> „Erwerbsarbeit“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsphase<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stehen, ausgeklammert und werdenim entsprechenden Kapitel behandelt (siehe Kapitel Erwerbsarbeit).Allerd<strong>in</strong>gs liegen kaum differenzierte Informationenüber E<strong>in</strong>künfte aus Erwerbsarbeit während desBezugs z.B. von Altersrenten vor.Die E<strong>in</strong>kommenslage im Alter ist von herausragen<strong>der</strong> Bedeutungfür die E<strong>in</strong>kommensverwendung <strong>in</strong> dieser Lebensphaseund damit für die durch Ältere entfaltete Nachfrageund <strong>der</strong>en mögliche Beschäftigungseffekte. DiesemAspekt wird im folgenden Kapitel, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e unterdem Stichwort „Seniorenwirtschaft“, nachgegangen(siehe auch Kapitel Chancen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong>Deutschland). Inwieweit sich dieses Potenzial auch <strong>in</strong> Zukunftentwickeln wird und gesamtwirtschaftlich, wie <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eauch beschäftigungsrelevant, nutzen lässt,hängt nicht zuletzt von <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensentwicklung Älterer<strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft ab.Das E<strong>in</strong>kommensniveau allgeme<strong>in</strong> wird maßgeblich von<strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Hierzuwird von Wissenschaftlern wie Politikern vielfach dieAuffassung vertreten, dass die demografische Entwicklung– sowohl was den Umfang (vor allem) <strong>der</strong> Bevölkerungim erwerbsfähigen Alter als auch <strong>der</strong>en Altersstruktur(zunehmen<strong>der</strong> Anteil Älterer) betrifft – negativeKonsequenzen für die Produktivitätsentwicklung und damitauch die künftige E<strong>in</strong>kommensentwicklung habenwird. Hierauf wird gleichfalls kurz e<strong>in</strong>gegangen.H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> künftigen Entwicklung <strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommenwerden bereits heute absehbare Folgen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<strong>der</strong> Neuausrichtung <strong>der</strong> Alterssicherungspolitikerörtert. Zusätzlich s<strong>in</strong>d Wirkungen sowohl <strong>der</strong> verän<strong>der</strong>ten<strong>Lage</strong> auf dem Arbeitsmarkt als auch von Entscheidungen<strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Bereichen des sozialen Sicherungssystems(wie Kranken- und Pflegeversicherung sowie Arbeitsför<strong>der</strong>ungund <strong>der</strong> neuen Grundsicherungssysteme, wie„Arbeitslosengeld II“) zu berücksichtigen. Dies allesunterstreicht die Aussage, dass von <strong>der</strong> heutigen E<strong>in</strong>kommenslageim Alter nicht auf die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft geschlossenwerden kann. Sowohl das Risiko von E<strong>in</strong>kommensarmutals auch e<strong>in</strong>er steigenden E<strong>in</strong>kommensungleichheitim Alter s<strong>in</strong>d absehbare Folgen verschiedener <strong>in</strong> dieWege geleiteter Verän<strong>der</strong>ungen im Zusammenspiel mit<strong>der</strong> ökonomischen und demografischen Entwicklung. Auf<strong>der</strong> Basis von Beurteilungskriterien wird schließlich dieFrage aufgeworfen, ob es auch Alternativen dazu gibt, diean<strong>der</strong>s zu beurteilende sozial- und verteilungspolitischeEffekte erwarten lassen. Auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> vorangegangenenAnalyse werden schließlich e<strong>in</strong>ige Handlungsempfehlungenabgeleitet.4.2 Zur <strong>der</strong>zeitigen E<strong>in</strong>kommenslageim AlterIm 3. Altenbericht wurde ausführlich auf die (differenziertzu betrachtende) E<strong>in</strong>kommenslage Älterer und diezu ihrer Analyse vorhandenen Datenquellen e<strong>in</strong>gegangen.Deshalb wird nachfolgend nur noch kurz auf die vielfachnicht h<strong>in</strong>reichend beachtete Heterogenität <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen– bezüglich Höhe wie auch Struktur – h<strong>in</strong>gewiesen.Dabei werden Unterschiede zwischen Männern undFrauen und vor allem auch zwischen Ost- und Westdeutschlandbeson<strong>der</strong>s beachtet, da <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e letzterenoch für längere Zeit bestehen werden.Seit <strong>der</strong> Vorlage des 3. Altenberichts im Sommer 2000s<strong>in</strong>d jedoch <strong>in</strong> verschiedenen Bereichen z.T. tief greifendeVerän<strong>der</strong>ungen erfolgt, auf die wir uns im Folgendenkonzentrieren. Auf die dadurch verän<strong>der</strong>te <strong>Lage</strong> und dieE<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> künftigen Entwicklung wird deshalbdas Schwergewicht im Zusammenhang mit E<strong>in</strong>kommenÄlterer gelegt.Die E<strong>in</strong>kommenslage älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschlandsteht <strong>in</strong> jüngerer Zeit vielfach im Blickpunkt, wenn Vorschläge<strong>zur</strong> „Reform“ im Bereich sozialer Sicherung begründetwerden, durch die es zu E<strong>in</strong>kommensbelastungenfür die Gruppe <strong>der</strong> jetzt Älteren kommt. Solche Maßnahmenhaben allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel auch Konsequenzenfür die künftige E<strong>in</strong>kommenslage diejenigen, die erst <strong>in</strong>Zukunft <strong>zur</strong> Gruppe <strong>der</strong> Älteren zählen werden.Oft wird darauf verwiesen, dass heutige Ältere – sowohl imVergleich zu Älteren früher als auch zu Jüngeren heute –ökonomisch günstig dastehen und e<strong>in</strong> hohes „Konsumpotenzial“auf sich vere<strong>in</strong>igen. Deshalb s<strong>in</strong>d Ältere alsKonsumenten – und <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht als „Wirtschaftsfaktor“– zunehmend <strong>in</strong> das Blickfeld von Marktforschung,Unternehmensstrategien aber auch politischerEntscheidungsträger gerückt. Aus <strong>der</strong> (absoluten o<strong>der</strong> re-
Drucksache 16/2190 – 128 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodelativen) E<strong>in</strong>kommenslage Älterer wird vielfach aber auchabgeleitet, dass sie stärker mit Abgaben (seien es Steuerno<strong>der</strong> Sozialbeiträgen) belastet werden können (was danndas E<strong>in</strong>kommensverwendungspotenzial reduziert), wieauch vermehrt belastet werden können durch Zuzahlungen,z.B. im Krankheits- und Pflegefall. Generell wurdenmit H<strong>in</strong>weis auf die künftige demografische EntwicklungVorschläge <strong>zur</strong> Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> ökonomischen Situationzwischen „<strong>Generation</strong>en“ begründet, die e<strong>in</strong>e – im Vergleichzum Status quo – Verän<strong>der</strong>ung zu Gunsten Jüngererund zu Lasten Älterer vorsehen. Dabei wurde die politischeDiskussion (gezielt) auf die Verteilung zwischen„<strong>Generation</strong>en“ – meist im S<strong>in</strong>ne von Geburtsjahrgängen– fokussiert, während die Verteilung <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong><strong>Generation</strong>en, also Verteilung <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> PersonenundHaushaltsgruppen, dagegen weitgehend ausgeblendetblieb. Die Folge waren und s<strong>in</strong>d oft pauschale Aussagen,die <strong>zur</strong> Begründung von Vorschlägen o<strong>der</strong> Maßnahmenmit herangezogen werden. Dabei werden – zumeist implizit– Informationen für die gegenwärtige Altenpopulationauf künftige Ältere übertragen. Aus diesem Grunde wird<strong>in</strong> diesem Kapitel solchen Fragen beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeitgewidmet.4.2.1 Heterogenität <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenslage imAlterDas E<strong>in</strong>kommensverwendungspotenzial im Alter wirddurch E<strong>in</strong>kommen und Vermögen geprägt. Beideswie<strong>der</strong>um wird maßgeblich durch ökonomische, demografischeund politische Bed<strong>in</strong>gungen, aber auch durch<strong>in</strong>dividuelle Entscheidungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> vorgelagerten Erwerbsphasebee<strong>in</strong>flusst (u.a. dort getroffene Vorsorgeentscheidungen),darüber h<strong>in</strong>aus dann aber auch durch die <strong>in</strong><strong>der</strong> Altersphase herrschenden politischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungenund Regelungen – z.B. des SozialversicherungsundSteuerrechtes – sowie „im Alter“ getroffene <strong>in</strong>dividuelleEntscheidungen. Die Folge ist e<strong>in</strong>e hohe Heterogenität<strong>in</strong> <strong>der</strong> Höhe wie auch <strong>der</strong> Struktur von E<strong>in</strong>kommenund Vermögen im Alter. Im 3. Altenbericht wurden ausführlichdie verschiedenen Determ<strong>in</strong>anten <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommens-und Vermögenslage im Alter aufgezeigt (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend2001: 186 ff.).Zu beachten ist u.a., dass unterschiedliche Geburtsjahrgänge<strong>in</strong> verschiedenen Phasen ihres Lebensablaufs unterschiedlichlange von bestimmten Bed<strong>in</strong>gungen betroffenwerden – so z.B. durch die sich im Zeitablauf z.T. tiefgreifend verän<strong>der</strong>nde <strong>Lage</strong> auf dem Arbeitsmarkt. Sowerden sich die Folgen <strong>der</strong> verschlechterten Arbeitsmarktsituation<strong>der</strong> vergangenen Jahrzehnte für die Alterse<strong>in</strong>kommenüberwiegend erst <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft zeigen.Bereits diese wenigen H<strong>in</strong>weise machen unmittelbarplausibel, dass sich e<strong>in</strong>fache Fortschreibungen e<strong>in</strong>es jetztvorf<strong>in</strong>dbaren Zustands (z.B. von Rentenansprüchen o<strong>der</strong><strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenslage heute Älterer im Vergleich zu <strong>der</strong>von Erwerbstätigen) als Grundlage für Aussagen über dieSituation <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft und damit auch als Grundlagefür Entscheidungen über Maßnahmen verbieten.E<strong>in</strong> weiterer Grund für die Heterogenität ergibt sich auchaus den <strong>in</strong> Deutschland vielgestaltigen Alterssicherungssystemenmit ihren z.T. beträchtlich unterschiedlichenRegelungen für die verschiedenen Gruppen von Erwerbstätigen– für unselbstständig Beschäftigte im privaten undöffentlichen Bereich wie auch für verschiedene Gruppenvon Selbstständigen. 15 Das deutsche Alterssicherungssystem,das sich schon seit langem aus mehreren Schichtenzusammensetzt 16 , hat vor wenigen Jahren durch die E<strong>in</strong>führunge<strong>in</strong>er „bedarfsorientierten Grundsicherung“ beiAlter und Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung nun e<strong>in</strong>e vierte Schichterhalten, die – wie vorher schon die Sozialhilfe – bedürftigkeitsgeprüfteLeistungen im Falle un<strong>zur</strong>eichendenAlterse<strong>in</strong>kommens bereitstellt. Abbildung 23 gibt e<strong>in</strong>en zusammenfassendenÜberblick über die <strong>in</strong>stitutionelleStruktur des deutschen Alterssicherungssystems. Ausführlichwird auf die verschiedenen Alterssicherungssystemeund ihre Leistungen im neuesten Alterssicherungsbericht<strong>der</strong> Bundesregierung e<strong>in</strong>gegangen, <strong>der</strong> im Herbst2005 vorliegen dürfte.Zu den Faktoren, die <strong>zur</strong> Heterogenität <strong>in</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenslagebeitragen, zählen auch die zwischen Ost- undWestdeutschland bestehenden beträchtlichen Unterschiede<strong>in</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensstruktur. Sie resultieren aus<strong>der</strong> unterschiedlichen Bedeutung e<strong>in</strong>zelner Alterssicherungssystemeund <strong>der</strong> daraus fließenden E<strong>in</strong>künfte. Hierwirken sich nach wie vor die verschiedenen Konzeptionenund Strukturen <strong>der</strong> Alterssicherungssysteme vonDDR und Bundesrepublik aus (Schmähl 1991), trotz <strong>der</strong><strong>in</strong>zwischen erfolgten Angleichung rechtlicher Rahmenbed<strong>in</strong>gungen.So dom<strong>in</strong>ieren beispielsweise <strong>in</strong> Ostdeutschland<strong>der</strong>zeit die Fälle, <strong>in</strong> denen die Alterse<strong>in</strong>kommenausschließlich auf dem Bezug von Renten aus <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung (GRV) basieren (Tabelle 9),während dies <strong>in</strong> Westdeutschland nur für rund e<strong>in</strong> Drittelehemals abhängig Beschäftigter gilt. Derzeit s<strong>in</strong>d betrieblicheAlterssicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Privatwirtschaft (BAV) wieim öffentlichen Dienst (ZöD) und auch die Privatvorsorgefür die E<strong>in</strong>kommenslage ostdeutscher Rentner kaum relevant.Diese Quelle <strong>der</strong> Heterogenität <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensstrukturzwischen Ost- und Westdeutschland wird nochlängere Zeit bedeutsam bleiben, denn die auf Kapitalfundierungbasierende private Vorsorge und die betrieblicheAlterssicherung werden <strong>in</strong> Ostdeutschland erst allmählichund längerfristig größere Bedeutung für die Zusammensetzung<strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommen erlangen.Die unterschiedliche strukturelle Zusammensetzung <strong>der</strong>E<strong>in</strong>kommen von ost- und westdeutschen Rentnern <strong>in</strong> E<strong>in</strong>undZweipersonenhaushalten spiegeln auch Daten <strong>der</strong>E<strong>in</strong>kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) wi<strong>der</strong>.Hier zeigt sich gleichfalls die herausragende Bedeutung<strong>der</strong> GRV-Renten als Quelle <strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommen (Abbildung24).15 Für die letztgenannte heterogene Gruppe von Selbstständigen liegenbislang z.T. nur un<strong>zur</strong>eichende statistische Daten über <strong>der</strong>en Altersvorsorgewie auch die Absicherung im Alter vor (Fach<strong>in</strong>ger, Oelschläger& Schmähl 2004).16 Der Begriff „Schicht“ charakterisiert die Realität weitaus zutreffen<strong>der</strong>als <strong>der</strong> häufig verwendete Ausdruck „Säule“.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 129 – Drucksache 16/2190Abbildung 23Alterssicherung für verschiedene Gruppen von Erwerbstätigen <strong>in</strong> DeutschlandIndividuelleergänzendeSicherungNicht geför<strong>der</strong>te private Alterssicherung (Lebensversicherungen, Ersparnisse, Altenteil usw.)Freiw.Versicherung(GRV)Geför<strong>der</strong>te zertifizierte private Alterssicherung (*)ZusatzsystemeBetriebl.AltersversorgungZusatzversorgungim öff. DienstGesetzlichverankerteSystemeBerufsständ.Vers.-werke(***)Alterssicherung<strong>der</strong> Landwirte(**)Son<strong>der</strong>e<strong>in</strong>richtungeno<strong>der</strong> -regelungen fürSelbstständige<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> GRVKnappschaftGesetzliche Rentenversicherung (GRV)BfA undLandesversicherungsanstalten,SeekasseBedarfsorientierte GrundsicherungPersonenkreisNicht pflichtversicherteSelbstständigeFreie Berufe LandwirteSelbstständige nach§§ 2 + 4 SGB VI(Handwerker,Künstler u.a.,VersicherungspflichtigeaufAntrag)Beschäftigte imBergbauSonstigeSelbstständigeArbeiter und AngestellteAbhängig BeschäftigtePrivater Sektor Öffentlicher Dienst(*) För<strong>der</strong>ung auch für Ehepartner ohne eigenen Anspruch, wenn <strong>der</strong> erste Ehepartner den vollen M<strong>in</strong>desteigenbetrag leistet und e<strong>in</strong> eigener Vertrag besteht.(**) E<strong>in</strong>schließlich mithelfen<strong>der</strong> Familienangehöriger; als Teilversorgung, ergänzt durch betriebliche Maßnahmen (Altenteil).(***) Berufsständische Versorgungswerke, teilweise auch für abhängig Beschäftigte <strong>in</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Branche.Quelle: Schmähl (1986: 686), mit Än<strong>der</strong>ungen und Ergänzungen.BeamtenversorgungBeamte,Richter undBerufssoldaten
Drucksache 16/2190 – 130 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 9Netto-Gesamte<strong>in</strong>kommen von ehemals abhängig Beschäftigten (Männer ab 65 Jahre)nach Art <strong>der</strong> Alterssicherung 1999E<strong>in</strong>künfte aus AlterssicherungssystemenAnteil(<strong>in</strong> %)alte Bundeslän<strong>der</strong>Netto-Gesamte<strong>in</strong>kommen(<strong>in</strong> €/Monat)Anteil(<strong>in</strong> %)neue Bundeslän<strong>der</strong>Netto-Gesamte<strong>in</strong>kommen(<strong>in</strong> €/Monat)nur GRV 34 1.510 89 1.606GRV + BAV 28 2.041 1 1.892GRV + ZöD 10 1.935 1 2.120mit BV 11 2.463 0 /Anmerkung: Im Alterssicherungsbericht werden ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kommensangaben für Frauen vorgelegt.Abkürzungen: GRV= Gesetzliche Rentenversicherung, BAV = Betriebliche Altersversorgung, ZöD = Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst,BV = Beamtenversorgung.Quelle: Bundesregierung 2001. Dort wurden empirisch <strong>in</strong> <strong>der</strong> ASID 99 (Bundesm<strong>in</strong>isterium für Arbeit und Sozialordnung 2001) ermittelte Brutto-E<strong>in</strong>künfte <strong>in</strong> Nettoe<strong>in</strong>kommen umgerechnet.Abbildung 24E<strong>in</strong>kommensstruktur nach E<strong>in</strong>kommensarten bei E<strong>in</strong>- und Zweipersonenhaushalten von Rentner<strong>in</strong>nenund Rentnern <strong>in</strong> West- und OstdeutschlandQuelle Münnich 2001. Datenbasis: EVS 1998, eigene Darstellung.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 131 – Drucksache 16/2190Diese unterschiedlichen E<strong>in</strong>kommensstrukturen machenes übrigens unmittelbar plausibel, dass z.B. reduzierendeMaßnahmen <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung vorallem diejenigen e<strong>in</strong>kommensmäßig treffen, <strong>der</strong>en Alterse<strong>in</strong>kommenhauptsächlich aus Rentene<strong>in</strong>künften <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung besteht. Dies gilt – außerfür ostdeutsche Altenhaushalte – generell <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>efür Altenhaushalte mit niedrigem E<strong>in</strong>kommen.17 Zusätzlich nach Art <strong>der</strong> Altersrente und (<strong>der</strong>zeit noch nach) Versicherungszweig,worauf hier – ebenso wie auf Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsrenten –nicht e<strong>in</strong>gegangen wird.18 Entgeltpunkte determ<strong>in</strong>ieren <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungdie relative (<strong>in</strong>dividuelle) Rentenhöhe (z.B. wird bei Durchschnittsverdienst<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Jahr e<strong>in</strong> Entgeltpunkt gutgeschrieben), währendfür die absolute Höhe <strong>der</strong> Rente die <strong>in</strong>sgesamt während <strong>der</strong> Versicherungsdauerakkumulierten Entgeltpunkte mit dem „aktuellen Rentenwert“multipliziert werden. Der aktuelle Rentenwert verän<strong>der</strong>t sichim Ausmaß <strong>der</strong> jeweiligen Rentenanpassungssätze.Bereits <strong>der</strong> Blick alle<strong>in</strong> auf Renten aus <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung – die <strong>der</strong>zeit noch die wichtigste E<strong>in</strong>kunftsquellefür e<strong>in</strong>en Großteil des nicht mehr erwerbstätigenTeils <strong>der</strong> Bevölkerung s<strong>in</strong>d – offenbart e<strong>in</strong> hohesMaß an Heterogenität <strong>der</strong> Rentenhöhe sowohl zwischenMännern und Frauen als z.B. auch zwischen Ost- undWestdeutschland. 17 In <strong>der</strong> öffentlichen Diskussion spielendiese Unterschiede jedoch e<strong>in</strong>e untergeordnete Rolle, dabei Diskussionen über Verän<strong>der</strong>ungen im Rentenrecht zumeistAngaben für die so genannte Eck- o<strong>der</strong> Standardrente<strong>in</strong>s Zentrum gerückt werden. Bei <strong>der</strong> Eckrente handeltes sich jedoch um e<strong>in</strong>en hypothetischen Rentenfall,basierend auf 45 so genannten Entgeltpunkten, die z.B.bei 45 Versicherungsjahren und durchschnittlichem Bruttoarbeitsentgelterreichbar s<strong>in</strong>d. 18 Unabhängig von Än<strong>der</strong>ungendes Leistungsrechts, die sich auf die Höhe <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellim Zeitablauf akkumulierten Entgeltpunkteauswirken (z.B. <strong>der</strong> Reduzierung von anrechenbaren Ausbildungszeitenfür die Rentenansprüche o<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungenbei K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehungszeiten), werden für die Eckrentestets 45 Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Das heißt auch,dass die Frage, ob und <strong>in</strong>wieweit Entgeltpunkte – zumal<strong>in</strong> dieser Höhe – von den Versicherten erworben werdenkönnen, ausgeblendet bleibt. Die <strong>in</strong>dividuelle Rentenhöheergibt sich aus <strong>der</strong> Multiplikation <strong>der</strong> vom Versichertenerreichten Summe an Entgeltpunkten mit dem so genannten„aktuellen Rentenwert“, <strong>der</strong> sich für Ost- und Westdeutschlandnach wie vor unterscheidet. 19In Westdeutschland betrug die Eckrente nach Abzug vonKranken- und Pflegeversicherungsbeitrag 2002 im Jahresdurchschnittrund 1060 Euro monatlich; <strong>in</strong> Ostdeutschlandwaren es knapp 930 Euro (wegen des dort niedrigeren„aktuellen Rentenwerts“). Da <strong>in</strong> <strong>der</strong> öffentlichenDiskussion immer wie<strong>der</strong> die Höhe <strong>der</strong> Eckrente herangezogenwird, erweckt dies vielfach den E<strong>in</strong>druck, als obdiese Rentenhöhe weit verbreitet und typisch sei. Oftmalswird die Eckrente auch mit <strong>der</strong> „Durchschnittsrente“gleichgesetzt. Beides ist allerd<strong>in</strong>gs unzutreffend und vermittelte<strong>in</strong> falsches Bild <strong>der</strong> tatsächlichen Situation. Umdies zu verdeutlichen, enthält zunächst Tabelle 10 verschiedeneMittelwerte <strong>zur</strong> Höhe <strong>der</strong> tatsächlich gezahltenAltersrenten – wie<strong>der</strong>um (wie <strong>in</strong> Tabelle 9) nach Abzug<strong>der</strong> von <strong>der</strong> Rente e<strong>in</strong>behaltenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.Die ostdeutschen Renten s<strong>in</strong>d trotz des dort niedrigeren„aktuellen Rentenwerts“ im Durchschnitt höher als <strong>in</strong>Westdeutschland, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auf Grund <strong>der</strong> höherenZahl von Versicherungsjahren und (bei Männern imDurchschnitt) auch e<strong>in</strong>er höheren – <strong>der</strong> Rentenberechnungzugrunde liegenden – relativen Entgeltposition.H<strong>in</strong>ter solchen Mittelwerten verbirgt sich aber e<strong>in</strong>e beträchtlicheStreuung <strong>der</strong> Renten: So erhielten 50 Prozent19 Er betrug beispielsweise im Jahresdurchschnitt 2002 25,58 Euro <strong>in</strong>West- und 22,38 Euro <strong>in</strong> Ostdeutschland.Tabelle 10Mittelwerte <strong>der</strong> Zahlbeträge und Berechnungsgrundlagen von Altersrentenaus <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung 2002Maßzahlbezogen aufWestdeutschland OstdeutschlandMänner Frauen Männer FrauenRente (<strong>in</strong> €) 997 466 1.085 654Durchschnitt(arithmetisches Mittel)Entgeltpunkte 44,8 19,4 51,1 33,3Versicherungsjahre 40,4 25,5 45,7 39,7Median *) Rente (<strong>in</strong> €) 1.055 382 1.030 627Modus **) Rente (<strong>in</strong> €) 1.175 175 975 675Erläuterungen: Monatliche Zahlbeträge. Von den Zahlbeträgen s<strong>in</strong>d Beiträge <strong>zur</strong> gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bereits abgezogenworden.Alle Angaben wurden aus klassifizierten Daten (Klassenbreite 50 Euro / 0,1 Entgeltpunkte) errechnet.*) 50% <strong>der</strong> Renten liegen unter bzw. über dem Median.**) Klassenmitte <strong>der</strong> am stärksten besetzten Klasse.Quelle: Viebrok, Himmelreicher & Schmähl 2004. Datenbasis: Statistik des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) 2003.
Drucksache 16/2190 – 132 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeAbbildung 25Verteilung <strong>der</strong> Altersrenten nach Zahlbetragsklassen im Bestand <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungam 31.12.200214%Frauen Ost12%10%Frauen WestMänner OstAnteil8%6%4%Männer West2%0%unter 50250-300500-550750-8001000-10501250-13001500-15501750-1800Zahlbetragsklasse (€)Quelle: Schmähl 2005a: 158. Datenbasis: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) 2003.<strong>der</strong> west- wie ostdeutschen Männer e<strong>in</strong>e Rente von wenigerals etwa 1.000 Euro monatlich – also auch weniger alsdie Eckrente. Bei den Frauen waren es sogar etwa 95 Prozent,die e<strong>in</strong>e Rente bezogen, die niedriger als die Eckrentewar. Die Abbildung 25 vermittelt e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druckvon <strong>der</strong> Streuung <strong>der</strong> Höhe von Frauen- und Männerrenten<strong>in</strong> West- sowie Ostdeutschland.Zugleich wird daran aber auch deutlich, dass die höherenDurchschnittsrenten ostdeutscher Männer im Vergleichzu westdeutschen Männern e<strong>in</strong>en verzerrten E<strong>in</strong>druckvermitteln, denn <strong>der</strong> für Westdeutschland niedrigereDurchschnittswert kommt durch e<strong>in</strong>en hohen Anteil relativniedriger Renten zustande. E<strong>in</strong> Blick auf Abbildung 25zeigt, dass die Häufung <strong>der</strong> Rentenfälle <strong>in</strong> Westdeutschland<strong>in</strong> höheren Zahlbetragsklassen liegt als bei den Männerrenten<strong>in</strong> Ostdeutschland.In Ostdeutschland treffen jedoch auf Grund <strong>der</strong> höherenErwerbsbeteiligung von Frauen – zumal meist als Vollzeittätigkeit– im Haushalt e<strong>in</strong>es Rentnerehepaares häufigerzwei höhere Renten zusammen. Allerd<strong>in</strong>gs fehlen –wie erwähnt – <strong>in</strong> Ostdeutschland bislang weitgehend dieBetriebsrenten, und auch die private Altersvorsorge ist alsQuelle <strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommen quantitativ noch kaum vonBedeutung, was noch längere Zeit zutreffen wird. 20Von <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Renten aus <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungkann aber <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Westdeutschland zumeistnicht auf die <strong>in</strong>dividuelle E<strong>in</strong>kommenssituationgeschlossen werden o<strong>der</strong> gar auf die e<strong>in</strong>es mehrere Personenumfassenden „Rentner-Haushalts“. Zudem werdenbeson<strong>der</strong>s niedrige Renten vielfach durch weitere E<strong>in</strong>künfteergänzt. 21 Insofern – dies machen Abbildung 26 undAbbildung 27 deutlich – unterscheidet sich auch die E<strong>in</strong>kommensschichtung<strong>in</strong> Westdeutschland weitaus mehrvon <strong>der</strong> Rentenschichtung (Abbildung 25) <strong>in</strong> Ostdeutschland.Die neuesten Daten <strong>der</strong> repräsentativen Untersuchung„Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland“ (ASID ’03) für das Jahr2003 über E<strong>in</strong>kommen von E<strong>in</strong>zelpersonen und Ehepaa-20 E<strong>in</strong>e ausführlichere Darstellung im H<strong>in</strong>blick auf die Heterogenität<strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenslage im Alter – basierend auf Daten für Anfang <strong>der</strong>neunziger Jahre – f<strong>in</strong>det sich im 3. Altenbericht, Kapitel 5. 3 und 5.4.21 Dies wurde bereits vor nun fast 30 Jahren mit Daten <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommens-und Verbrauchsstichprobe empirisch belegt (Schmähl 1977:402 ff.).
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 133 – Drucksache 16/2190Schichtung des Nettoe<strong>in</strong>kommens von 65-Jährigen und Älteren – Westdeutschland 1999Abbildung 26141210Relative Häufigkeit <strong>in</strong> %86MännerFrauen420u. 26 26 - 51 52 -103103 -205205 -307307 -409409 -512512 -614614 -716716 -818818 -921921 -10231023 -11251125 -1228E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> Euro pro Monat1228 -13301330 -14321432 -15341534 -17901790 -20462046 -25572557 -51135113u.mehrQuelle: BMA 2001a, ASID 1999.Schichtung des Nettoe<strong>in</strong>kommens von 65-Jährigen und Älteren – Ostdeutschland 1999Abbildung 27201816Relative Häufigkeit <strong>in</strong> %14121086MännerFrauen420u. 26 26 - 51 52 -103103 -205205 -307307 -409409 -512512 -614614 -716716 -818818 -921921 -10231023 -11251125 -1228E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> Euro pro Monat1228 -13301330 -14321432 -15341534 -17901790 -20462046 -25572557 -51135113u.mehrQuelle: BMA 2001a, ASID 1999.
Drucksache 16/2190 – 134 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperio<strong>der</strong>en unterstreichen nochmals Unterschiede zwischenWest- und Ostdeutschland, aber auch <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong>Gruppe <strong>der</strong> älteren (d.h. 65 Jahre alten und älteren) Alle<strong>in</strong>stehenden(Tabelle 11).Die Durchschnittswerte für das Nettoe<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong> Ehepaares<strong>in</strong>d zwar höher als die von Alle<strong>in</strong>stehenden, doch istzu beachten, dass vom E<strong>in</strong>kommen zwei Personen leben.Trotz <strong>der</strong> im Durchschnitt höheren Renten <strong>in</strong> Ostdeutschlandliegt das Gesamte<strong>in</strong>kommen im Westen über dem imOsten (abgesehen von ledigen Männern und verwitwetenFrauen, wo die Durchschnittswerte <strong>in</strong> beiden Gebietsteilengleich s<strong>in</strong>d). Wie schon die Abbildung 26 und 5 verdeutlichten,ist die Streuung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen auch für Alle<strong>in</strong>stehendeund Ehepaare nach den aktuellen ASID-Daten imWesten stärker als im Osten. So lag 2003 für rund ¾ allerEhepaare <strong>in</strong> Ostdeutschland das Nettoe<strong>in</strong>kommen zwischen1.500 und 2.500 Euro monatlich, während <strong>in</strong> diesemE<strong>in</strong>kommensbereich <strong>in</strong> Westdeutschland weniger als dieHälfte <strong>der</strong> Ehepaar-E<strong>in</strong>kommen entfiel.Schließlich zeigt sich auch <strong>in</strong> den Daten <strong>der</strong> ASID `03,dass nachweisbar die verschiedenen E<strong>in</strong>kommensartenzwischen West- und Ostdeutschland unterschiedliche Bedeutungbesitzen. Die dom<strong>in</strong>ierende Bedeutung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenaus <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung bestehtzwar auch <strong>in</strong> Westdeutschland, doch ist sie <strong>in</strong> Ostdeutschlandbei weitem ausgeprägter (Tabelle 12).Tabelle 11Nettoe<strong>in</strong>kommen im Alter ab 65 – nach Geschlecht und Familienstand <strong>in</strong> West- und Ostdeutschland 2003<strong>in</strong> Euro/MonatMännerFamilienstandOst : WestWest Ost(<strong>in</strong> %)Ehepaare 1) 2.209 1.938 881) Ehemann ab 65,2) E<strong>in</strong>schließlich getrennt leben<strong>der</strong> Ehemänner.Quelle: Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland 2003 (ASID ’03), Angaben des BMWA 2005.WestFrauenOstOst : West(<strong>in</strong> %)Alle<strong>in</strong>stehende 1.513 1.282 85 1.166 1.119 96darunter:Verwitwete 1.598 1.314 82 1.176 1.195 102Geschiedene 2) 1.427 1.132 79 1.050 827 79Ledige 1.386 1.403 101 1.187 953 80Tabelle 12Die wichtigsten E<strong>in</strong>kommensquellen <strong>der</strong> Bevölkerung ab 65 Jahren(<strong>in</strong> Prozent des Bruttoe<strong>in</strong>kommensvolumens)E<strong>in</strong>kommensquelleAlleEhepaare Alle<strong>in</strong>st. Männer Alle<strong>in</strong>st. FrauenWest Ost West Ost West OstGesetzliche Rentenversicherung 66 57 89 60 87 68 95An<strong>der</strong>e Alterssicherungssysteme 21 26 2 26 5 22 2ErwerbstätigkeitZ<strong>in</strong>sen, Vermietung, 4 7 5 3 1 1 0Lebensversicherung u. a. 7 9 3 9 6 6 2Wohngeld/Sozialhilfe/Grundsicherung 1 0 0 1 1 1 1Summe 100 100 100 100 100 100 1000 = weniger als 0,5, jedoch mehr als 0Abweichungen <strong>der</strong> Summe von 100% s<strong>in</strong>d rundungsbed<strong>in</strong>gt.Quelle: Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland 2003 (ASID `03), Angaben des BMWA 2005.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 135 – Drucksache 16/21904.2.2 E<strong>in</strong>kommensarmut im AlterE<strong>in</strong>e „Erfolgsgeschichte“ <strong>der</strong> deutschen Alterssicherungspolitik– <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e ausgelöst mit <strong>der</strong> Rentenreform desJahres 1957 durch die E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> „dynamischenRente“ und dem damit verbundenen Paradigmenwechsel(Rente als „Lohnersatz“ und nicht mehr länger als primärnur Altersarmut vermeidendes „Zubrot“) – ist, dass <strong>in</strong>zwischen<strong>der</strong> Anteil von Altenhaushalten, die <strong>in</strong> E<strong>in</strong>kommensarmutleben, deutlich gesunken ist. Ältere s<strong>in</strong>d heute– bezogen auf die Gesamtbevölkerung wie auch gemessenan an<strong>der</strong>en Bevölkerungsgruppen – nur noch unterdurchschnittlich<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Armen vertreten. DieserTatbestand wird allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literatur manchmalgeradezu gegen diese Bevölkerungsgruppe gewendet, <strong>in</strong>demihre <strong>in</strong>sofern günstigere Situation – z.B. verglichenmit <strong>der</strong> Gruppe Alle<strong>in</strong>erziehen<strong>der</strong> – als Argument für vertretbareo<strong>der</strong> gar erfor<strong>der</strong>liche E<strong>in</strong>schnitte bei Alterse<strong>in</strong>kommenherangezogen wird.In Untersuchungen, die auf Vergleichbarkeit zwischenden EU-Län<strong>der</strong>n angelegt s<strong>in</strong>d, wie auch im 2. ArmutsundReichtumsbericht <strong>der</strong> Bundesregierung, wird e<strong>in</strong>e„Armutsrisikoquote“ ausgewiesen, gemessen als 60 Prozentdes „Medians <strong>der</strong> laufend verfügbaren Äquivalenze<strong>in</strong>kommen“aller Haushalte <strong>in</strong> Deutschland. 22 AlsDatenbasis dient dort die E<strong>in</strong>kommens- und Verbrauchsstichprobe.Nach dieser Vorgehensweise ergibt sich beiVerwendung <strong>der</strong> neuen OECD-Skala für Äquivalenzgewichtefür die Gesamtheit aller Haushalte e<strong>in</strong>e Armutsrisikoquotevon 13,5 Prozent für das Jahr 2003 (Westdeutschland12,2 Prozent, Ostdeutschland 19,3 Prozent,Bundesregierung 2005: 20). Für Personen im Alter von65 und mehr Jahren wird diese Quote für Gesamtdeutschlandmit 11,4 Prozent und für Rentner/Pensionäre mit11,8 Prozent angegeben, im Vergleich zu 35,4 Prozent fürAlle<strong>in</strong>erziehende (Tabelle 13).Die Ergebnisse solcher Vergleiche s<strong>in</strong>d von e<strong>in</strong>er Vielzahlvon Annahmen und Abgrenzungen abhängig. Dazu gehören:– die statistische Datengrundlage,– die verwendete Äquivalenzskala, 23– <strong>der</strong> verwendete Mittelwert (hier Median),– <strong>der</strong> Prozentsatz des jeweiligen Mittelwerts (hier60 Prozent).Die Bedeutung <strong>der</strong> Äquivalenzgewichte wird an e<strong>in</strong>emVergleich nach alter und neuer OECD-Skala für dieseWerte <strong>der</strong> Rentner/Pensionäre offenkundig: Nach <strong>der</strong> altenSkala wurde für alle Haushalte e<strong>in</strong>e Quote von13,1 Prozent und für Rentner/Pensionäre von 7,8 Prozenterrechnet, nach <strong>der</strong> neuen bei nur wenig verän<strong>der</strong>terQuote für alle Haushalte (13,5 Prozent) e<strong>in</strong> deutlich höhererWert für Rentner/Pensionäre (11,8 Prozent). Im Vergleichzu 1998 ist – bei e<strong>in</strong>em Anstieg <strong>der</strong> Quote für alleHaushalte – e<strong>in</strong> Rückgang sowohl bei Rentnern/Pensionärenals auch bei Personen im Alter von 65 und mehrJahren zu verzeichnen.E<strong>in</strong> Vergleich <strong>der</strong> Berechnungen basierend auf <strong>der</strong> EVSund dem sozio-oekonomischen Panel (SOEP) verdeutlichtdie Bedeutung <strong>der</strong> unterschiedlichen Datenquellenfür die Ergebnisse: So wird – bei identischer Äquivalenzskala(OECD-neu) – für 2003 e<strong>in</strong> Anteil von 14 Prozentfür alle Haushalte errechnet und für 65 Jahre und ältervon 9,6 Prozent. Hiernach s<strong>in</strong>d die Älteren im Vergleichzum Durchschnitt <strong>der</strong> Bevölkerung noch ger<strong>in</strong>ger vom„Armutsrisiko“ betroffen als nach den Berechnungen auf<strong>der</strong> EVS-Basis (dort 13,5 Prozent als Gesamtdurchschnitt,11,4 Prozent für Ältere) (Noll & Weick 2005). 24Allerd<strong>in</strong>gs ergeben sich beträchtliche Schwankungen <strong>der</strong>Werte von e<strong>in</strong>em Jahr zum an<strong>der</strong>en (2001: 8,9 Prozent,2002: 11,9 Prozent, 2003: 9,6 Prozent), was die Sensitivität<strong>der</strong> Berechnungsergebnisse erahnen lässt. WieTabelle 14 zeigt, ergeben sich je nach Äquivalenzskala,Datenquelle und Prozentsatz des Mittelwerts (hier desMedians) deutlich unterschiedliche Armutsgrenzen o<strong>der</strong>Armutsrisikoschwellen.Bei <strong>der</strong> Abgrenzung <strong>der</strong> jeweiligen Haushaltsgruppens<strong>in</strong>d z.B. die Haushaltsgröße und -zusammensetzung vonBedeutung. Wie Tabelle 15 für „Altenhaushalte“ verdeutlicht,bestehen große Unterschiede zwischen E<strong>in</strong>- undZweipersonen-Haushalten: Hiernach s<strong>in</strong>d die Armutsrisikoquoten<strong>der</strong> „alten“ E<strong>in</strong>personenhaushalte weit überdurchschnittlich,während für alle Haushalte mit e<strong>in</strong>em22 Hier erfolgt also e<strong>in</strong>e Berücksichtigung von Haushaltsgröße und -zusammensetzung.Durch das „Äquivalenze<strong>in</strong>kommen“ soll e<strong>in</strong> gleichesMaß an Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeit damit ausgedrücktwerden, <strong>in</strong>dem stets das erste (erwachsene) Haushaltsmitglied dasGewicht 1, alle weiteren Gewichte kle<strong>in</strong>er als 1 zugewiesen erhalten(um z.B. geme<strong>in</strong>sames Wirtschaften im Haushalt zu berücksichtigen).Diese Äquivalenzgewichte können allerd<strong>in</strong>gs unterschiedlichfestgelegt werden.23 Dabei geht <strong>in</strong> <strong>der</strong> neuen (alten) OECD-Skala die erste erwachsenePerson mit e<strong>in</strong>em Gewicht von 1,0, je<strong>der</strong> weitere Erwachsene mit 0,5(0,7) und jedes K<strong>in</strong>d unter 14 Jahren mit 0,3 (0,5) <strong>in</strong> die Berechnungdes äquivalenzgewichteten Pro-Kopf-E<strong>in</strong>kommens e<strong>in</strong>. In <strong>der</strong> neuenSkala werden die E<strong>in</strong>sparungen durch geme<strong>in</strong>sames Wirtschaften imHaushalt also höher angesetzt als <strong>in</strong> <strong>der</strong> alten OECD-Skala.24 Zum „Armutsrisiko“ von Migranten siehe Abschnitt „Ältere Migrantenals Wirtschaftsfaktor“.
Drucksache 16/2190 – 136 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 13Gruppenspezifische Armutsrisikoquoten 1 <strong>in</strong> Prozent <strong>in</strong> Deutschland nach Geschlecht, Alter,Erwerbsstatus und HaushaltstypenBevölkerungsgruppeNeue OECD-SkalaAlte OECD-Skala1998 2003 1998 2003Differenzierung nach GeschlechtMänner 10,7 12,6 11,6 12,9Frauen 13,3 14,4 12,6 13,3Differenzierung nach Alterbis 15 Jahre 13,8 15,0 18,6 18,616 bis 24 Jahre 14,9 19,1 14,6 19,025 bis 49 Jahre 11,5 13,5 12,3 13,550 bis 64 Jahre 9,7 11,5 7,7 9,865 und mehr Jahre 13,3 11,4 9,3 7,5Differenzierung nach Erwerbsstatus 2)Selbstständige(r) 11,2 9,3 11,2 9,6Arbeitnehmer(<strong>in</strong>) 5,7 7,1 5,9 6,8Arbeitslose(r) 33,1 40,9 31,2 37,4Rentner(<strong>in</strong>)/Pensionär(<strong>in</strong>) 12,2 11,8 8,4 7,8Personen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>personenhaushaltenInsgesamt 22,4 22,8 13,7 14,1Männer 20,3 22,5 13,8 15,0Frauen 23,5 23,0 13,7 13,6Personen <strong>in</strong> Haushalten mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>(ern) 3)Alle<strong>in</strong>erziehende 35,4 35,4 37,0 36,42 Erwachsene mit K<strong>in</strong>d(ern) 10,8 11,6 14,6 14,6Armutsrisikoquote <strong>in</strong>sgesamt 12,1 13,5 12,1 13,11) Armutsrisikogrenze 60 % des Medians <strong>der</strong> laufend verfügbaren Äquivalenze<strong>in</strong>kommen,2) Nur Personen im Alter ab 16 Jahren,3) K<strong>in</strong><strong>der</strong>: Personen unter 16 Jahren sowie Personen von 16 bis 24 Jahren, sofern sie nichterwerbstätig s<strong>in</strong>d und m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> Elternteil im Haushaltlebt.Quelle: Bundesregierung 2005, 2. Armuts- und Reichtumsbericht: 21. Datenbasis: E<strong>in</strong>kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) (Halbjahresergebnisse).Berechnungen von Becker & Hauser (Verteilung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen 1999-2003), <strong>Bericht</strong> im Auftrag des BMGS 2004.Tabelle 14Armutsgrenzen bzw. -risikoschwellen 2003 bei alternativen Datengrundlagen und Äquivalenzziffern– Grenze <strong>in</strong> Prozent des Medians des gesamtdeutschen Nettoäquivalenze<strong>in</strong>kommens –Grenze<strong>in</strong> %EVSEuro pro MonatOECD-SkalaQuelle: Zusammengestellt aus Becker & Hauser 2004, Tab. 3.2.1.1.SOEPEuro pro MonatOECD-Skalaalt neu alt neu40 % 532 626 488 57250 % 666 782 610 71560 % 799 938 732 858
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 137 – Drucksache 16/2190Haushaltsvorstand im Alter 65 o<strong>der</strong> mehr e<strong>in</strong> unterdurchschnittlicherWert nachgewiesen wird.Becker und Hauser (2004: 145) betonen: „Untersuchungenzu gruppenspezifischen Armutsquoten lassen … ke<strong>in</strong>e verallgeme<strong>in</strong>erndeAussage über das ‚Verschw<strong>in</strong>den’ von Altersarmutund die Ausbreitung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>armut zu.“Tabelle 15Gruppenspezifische Armutsrisikoquoten 1) von„Altenhaushalten“ 2003 nach Haushaltstyp– <strong>in</strong> Prozent –EVS SOEPE<strong>in</strong>personenhaushalte(65 Jahre und älter) 18,2 21,5Zweipersonenhaushalte 2) 7,7 7,0Alle Haushalte 13,5 15,41) 60% des Medians des Nettoäquivalenzvolumens neue OECD-Skala,2) Bezugsperson 65 Jahre o<strong>der</strong> älter.Quelle: Zusammengestellt aus Becker & Hauser 2004, Tab. 3.2.2.4.Schließlich reagieren solche Daten sehr sensitiv auf die<strong>Lage</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Grenzen, da Armuts- o<strong>der</strong> Armutsrisikogrenzen<strong>in</strong> dem relativ steilen l<strong>in</strong>ken Ast e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>kommens-(Häufigkeits-)schichtungliegen. So beträgte<strong>in</strong>e Armutsrisikoquote für Deutschland <strong>in</strong>sgesamt imJahre 2003 bei 40 Prozent des Mediane<strong>in</strong>kommens1,9 Prozent, bei 60 Prozent dagegen – wie erwähnt –13,5 Prozent. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund s<strong>in</strong>d auch die normativenBewertungen über die Situation verschiedenerBevölkerungsgruppen zu sehen.Darüber h<strong>in</strong>aus ist zu beachten, dass wir <strong>in</strong> Deutschlandmit <strong>der</strong> Sozialhilfe – bzw. den nun verschiedenen bedarfsorientiertenGrundsicherungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen– quasi offizielle Armutsgrenzen haben.Blickt man <strong>in</strong> die Sozialhilfestatistik, so s<strong>in</strong>d (2002)bei <strong>der</strong> laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt die Bezieherquoten(d.h. die Zahl <strong>der</strong> Bezieher an <strong>der</strong> jeweiligenBevölkerungsgruppe) bei den Personen im Alter von65 und mehr Jahren mit 1,3 Prozent deutlich unterdurchschnittlich(Gesamtbevölkerung 3,3 Prozent). Dieser Anteilist <strong>in</strong> den letzten Jahren weitgehend konstant geblieben(Bundesregierung 2005).Die neue bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung im Fallevoller Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> im Alter von 65 und mehrJahren, die weitgehend die laufende Hilfe zum Lebensunterhaltfür diesen Personenkreis ablösen soll, wurde Ende 2003an 439.000 Personen gezahlt. Hiervon waren rund 260.000(= 59 Prozent) 65 Jahre und älter. Das wären 1,7 Prozent allerPersonen dieser Altersgruppe (Weber 2005: 382).Im Durchschnitt (über alle Grundsicherungsempfänger)bestand Ende 2003 e<strong>in</strong> monatlicher E<strong>in</strong>kommensbedarfvon 572 Euro, wovon deutlich mehr als e<strong>in</strong> Drittel auf Kostenfür Unterkunft und Heizung entfiel (227 Euro). Da dieGrundsicherungsleistung un<strong>zur</strong>eichendes E<strong>in</strong>kommen (dasangerechnet wird) aufstockt, betrugen die ausgezahltenLeistungen im Durchschnitt 298 Euro (im Durchschnittwurden 274 Euro auf die Grundsicherung angerechnet).Für die E<strong>in</strong>kommensverteilung <strong>in</strong> Deutschland deutetsich <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> jüngster Zeit e<strong>in</strong> Anstieg <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensungleichheitan (Goebel, Habich & Krause 2004).Welche Perspektiven sich für die Entwicklung <strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommenund ihrer Verteilung aus heutiger Sicht ergeben,wird <strong>in</strong> Abschnitt 4.5 dieses Kapitels erörtert.4.3 Zur <strong>der</strong>zeitigen Vermögenslage im AlterStatistische Angaben über die Höhe und Verteilung vonVermögen s<strong>in</strong>d mit (noch) größeren Unsicherheiten behaftetals diejenigen über E<strong>in</strong>kommen. Da <strong>der</strong> Aufbauvon Geld- und Sachvermögen – sieht man von Erbschaftenund Schenkungen ab – sukzessive im Lebenslauf erfolgt,kann es nicht verwun<strong>der</strong>n, dass tendenziell diehöchsten Vermögen jeweils <strong>in</strong> höherem Lebensalter anzutreffens<strong>in</strong>d. Inwieweit e<strong>in</strong> Vermögensabbau <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersphaseerfolgt, hängt nicht zuletzt von <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> laufendenE<strong>in</strong>künfte ab.In e<strong>in</strong>em für das BMGS erstellten <strong>Bericht</strong> (Ammermüller,Weber & Westerheide 2005) wird für 2003 das (Netto-)Geld- und Immobilienvermögen <strong>der</strong> Haushalte <strong>in</strong>Deutschland im Durchschnitt mit rund 133.000 Euro beziffert,wobei es <strong>in</strong> Ostdeutschland mit rund 60.000 nichte<strong>in</strong>mal die Hälfte des Durchschnittsvermögens <strong>in</strong> Westdeutschland(rund 150.000) erreichte. Allerd<strong>in</strong>gs signalisierthier – wie auch bei Verteilungen des E<strong>in</strong>kommens –<strong>der</strong> Durchschnitt (arithmetisches Mittel) e<strong>in</strong>en zu hohenWert für die Masse <strong>der</strong> Haushalte, denn die Hälfte <strong>der</strong>Haushalte verfügt über weniger als 50.000 Euro (bzw.22.000 <strong>in</strong> Ost- und 64.000 <strong>in</strong> Westdeutschland).Betrachtet man verschiedene sozio-oekonomische Gruppen– Tabelle 16 –, so haben im Durchschnitt die Rentnerhaushalte(West- und Ostdeutschland zusammen betrachtet)Vermögen, das 2003 etwa dem Durchschnittaller Haushalte entspricht, wobei die ostdeutschen Rentnerhaushaltejedoch nur rund e<strong>in</strong> Drittel des Vermögensbestandes(jeweils <strong>in</strong> <strong>der</strong> obigen Abgrenzung) <strong>der</strong> westdeutschenRentnerhaushalte erreichten.E<strong>in</strong> Vergleich z.B. mit Arbeitnehmerhaushalten lässt allerd<strong>in</strong>gsdie höchst unterschiedliche Altersverteilung außerBetracht und ist im Querschnittsvergleich deshalb– auch wenn solche Vergleiche gerne angestellt werden –wenig aussagekräftig.Auch hier gilt, dass die „Mittelwerte“ (arithmetischesMittel) e<strong>in</strong>en verzerrten E<strong>in</strong>druck vermitteln, vergleichtman sie mit den Median-Werten (Tabelle 17). 25Es kann kaum überraschen, dass E<strong>in</strong>personenhaushalteim Alter von 65 o<strong>der</strong> mehr Jahren im Durchschnitt überniedrigere Vermögen als Zweipersonenhaushalte mit e<strong>in</strong>erBezugsperson (o<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>er Person) <strong>in</strong> dieserAltersgruppe verfügen und die Vermögen <strong>der</strong> alle<strong>in</strong>stehendenFrauen dieser Altersgruppe unter <strong>der</strong> von Männernliegen (hier allerd<strong>in</strong>gs über alle sozio-oekonomischenGruppen, also Rentner, Pensionäre und an<strong>der</strong>e, wie z.B.(ggf. ehemals) Selbstständige, betrachtet, siehe Tabelle 18).25 Für die Auswertung danken wir P. Westerheide.
Drucksache 16/2190 – 138 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 16Mittelwerte des Nettovermögens und Verän<strong>der</strong>ungen zwischen 1993 und 2003nach sozialen Gruppen (1000 Euro)Gesamt 1993 1998 2003 93-98 98-03 93-03DeutschlandArbeitnehmer 99,8 106,7 120,1 6,9% 12,6% 20,3%Selbstständige 268,7 274,2 296,9 2,0% 8,3% 10,5%Nichterwerbstätigedarunter:89,2 99,0 122,0 10,9% 23,3% 36,7%Rentner 99,2 101,9 129,2 2,7% 26,9% 30,3%Pensionäre 178,0 195,7 252,4 10,0% 28,9% 41,8%Arbeitslose 48,6 55,5 48,2 14,2% – 13,2% – 0,9%WestdeutschlandArbeitnehmer 116,0 120,0 131,5 3,4% 9,5% 13,3%Selbstständige 288,9 284,9 309,5 – 1,4% 8,6% 7,1%Nichterwerbstätigedarunter:109,9 116,5 141,4 6,0% 21,3% 28,7%Rentner 119,7 121,5 150,0 1,5% 23,4% 25,3%Pensionäre 184,6 196,7 253,3 6,6% 28,8% 37,2%Arbeitslose 64,6 68,7 58,1 6,3% – 15,5% – 10,1%OstdeutschlandArbeitnehmer 40,8 53,3 66,9 30,4% 26,1% 64,4%Selbstständige 96,4 106,4 142,5 10,5% 34,7% 47,9%Nichterwerbstätigedarunter:26,7 31,3 42,9 17,1% 37,7% 60,5%Rentner 26,5 33,6 48,8 27,0% 45,7% 84,5%Arbeitslose 25,3 26,3 30,2 4,1% 15,3% 19,6%Quelle: Ammermüller, Weber & Westerheide 2005, Tab. 83, Datenbasis: EVS 2003, ZEW-Berechnungen. Die Haushalte wurden nach <strong>der</strong> sozialenStellung des Haushaltsvorstands klassifiziert.Tabelle 17Nettovermögen von Rentnern 2003(<strong>in</strong> 1000 Euro)Arithmetisches MittelMedianWestdeutschland 150,0 70,2Ostdeutschland 48,8 20,4Deutschland <strong>in</strong>sgesamt 129,2 49,4Quelle: ZEW-Berechnungen, EVS 2003, Son<strong>der</strong>auswertung.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 139 – Drucksache 16/2190Nettovermögen von „Altenhaushalten“(65 Jahre und älter) 2003Tabelle 18HaushaltstypArithmetisches Mittel – <strong>in</strong> 1.000 Euro –West Ost DeutschlandAlle<strong>in</strong>leben<strong>der</strong> Mann 135,7 35,7 128,1Alle<strong>in</strong>lebende Frau 103,6 22,5 88,8Ehepaar 231,7 72,5 200,4Quelle: Zusammengestellt aus Ammermüller, Weber & Westerheide 2005, Tab. 85, Datenbasis: EVS 2003, ZEW-Berechnungen.Geld- und Immobilienvermögen <strong>in</strong> dieser Größe verdeutlichenauch, warum bei den laufenden E<strong>in</strong>kommen dieVermögense<strong>in</strong>künfte im Gesamtbudget älterer Haushalte<strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel e<strong>in</strong>e untergeordnete Bedeutung besitzen, zumalwie<strong>der</strong>um die Mittelwerte e<strong>in</strong>en „nach oben“ verzerrtenE<strong>in</strong>druck vermitteln. Nach den politischen Vorstellungenund Weichenstellungen soll dies durch e<strong>in</strong>en Ausbauprivater kapitalfundierter (e<strong>in</strong>schließlich betrieblicher)Altersvermögen für die Zukunft verän<strong>der</strong>t werden. Bei e<strong>in</strong>erReduzierung <strong>der</strong> laufenden E<strong>in</strong>künfte z.B. aus <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung und e<strong>in</strong>er größeren Bedeutungkapitalfundierter privater Altersvermögen könntesich dann e<strong>in</strong>e Entwicklung e<strong>in</strong>stellen, die aus theoretischenModellen <strong>zur</strong> Konsum- und Sparentwicklung imLebenszyklus abgeleitet wird, dass nämlich e<strong>in</strong> Abbauz.B. von Geldvermögen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase erfolgt.Dies hat es – im Regelfall – bisher <strong>in</strong> Deutschland für Altenhaushalteaber nicht gegeben. 264.4 Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung und diegesamtwirtschaftliche ProduktivitätsundE<strong>in</strong>kommensentwicklung26 So wird <strong>in</strong> dem <strong>Bericht</strong> von Ammermüller et al. 2005 (S. 129) auchfestgestellt, dass zwar mit „dem Alter des Haushaltsvorstands …dieVermögen tendenziell (steigen), e<strong>in</strong> typisches Lebenszyklusprofil mitwachsendem Vermögen über die aktive Erwerbsphase und anschließendemVermögensverzehr im Rentenalter lässt sich für Deutschlandbislang nicht beobachten.“Für die künftige E<strong>in</strong>kommenssituation Älterer ist u.a. dieallgeme<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kommensentwicklung von großer Bedeutung.Für diese werden vielfach aus <strong>der</strong> Alterung <strong>der</strong> Bevölkerungresultierend negative Effekte unterstellt bzw.vermutet. Angesichts <strong>der</strong> üblicherweise mit dem Negativbegriff„Überalterung“ bezeichneten Entwicklung sei damitzu rechnen, „dass ältere Leute dem technischen Fortschrittgegenüber weniger aufgeschlossen s<strong>in</strong>d, dass dieInnovationskraft <strong>in</strong> überalterten Gesellschaften abnimmt… .“ Es sei davon auszugehen, „dass ältere Leute langsamerlernen als junge Menschen. All dies bedeutet e<strong>in</strong>langsameres Wirtschaftswachstum“. 27Die negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstumwerden vor allem aus drei Argumentationssträngenabgeleitet:– Die Produktivität Älterer sei ger<strong>in</strong>ger als die Jüngerer.– Die Schrumpfung <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung stelle e<strong>in</strong>eBegrenzung für die Produktionskapazität dar.– Die Alterung <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung führe bei ausgebautenSystemen <strong>der</strong> umlagef<strong>in</strong>anzierten Sozialversicherungzu steigenden Beiträgen und damit Lohnkosten.Daraus wird die Folgerung gezogen: Es„müssen die Renten- und Sozialversicherungssysteme<strong>in</strong> Richtung Kapitaldeckung umgebaut werden, sonststeigen die Beitragssätze weiter und damit die Arbeitskosten“(Donges 2005 ; Fußnote 27).– Auf alle drei Aspekte wird hier kurz e<strong>in</strong>gegangen,ohne allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> diesem <strong>Bericht</strong> die jeweils damitverbundenen komplexen – und zum Teil <strong>in</strong> <strong>der</strong> Forschungseit langem strittig diskutierten Fragen – nähererörtern zu können.4.4.1 Altersspezifische ProduktivitätDer erste Aspekt betrifft die Frage nach <strong>der</strong> altersspezifischenProduktivität und wie sie sich möglicherweise <strong>in</strong>Zukunft (also bei nachwachsenden Geburtsjahrgängen)verän<strong>der</strong>t. Wird davon ausgegangen, dass – zum<strong>in</strong>dest ab27 So <strong>in</strong> exemplarischer Weise die Aussagen des (früheren) Mitgliedsdes Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung,Juergen B. Donges (2005); ähnlich auch Bert Rürup (Mitglied desSachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung):Durch die „Bevölkerungsalterung werden … die Wachstumsaussichtenbee<strong>in</strong>trächtigt, wenn nicht auf mehreren Politikfel<strong>der</strong>n Konsequenzengezogen werden“ (2004: 2). Relativierend zu den <strong>in</strong> diesemZusammenhang vertretenen Thesen bereits Enquete-Kommission„Demographischer Wandel“ 1988: 181ff.
Drucksache 16/2190 – 140 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodee<strong>in</strong>em bestimmten Lebensalter – die Produktivität rückläufigist, so würde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Bevölkerung, <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>der</strong>Anteil Älterer sowie das Durchschnittsalter <strong>der</strong> Erwerbspersonensteigen, e<strong>in</strong> negativer E<strong>in</strong>fluss auf das gesamtwirtschaftlicheProduktivitätsniveau die Folge se<strong>in</strong>. DiesesErgebnis resultiert – abgesehen von allen Problemen<strong>der</strong> Produktivitätsmessung 28 – aus e<strong>in</strong>er statischen Vorstellung,nach <strong>der</strong> das Alters-Produktivitäts-Profil, wieman es unter Umständen zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt ermittelnkönnte, im Zeitablauf unverän<strong>der</strong>t bleibt. 29Aus Querschnittsdaten wurden vielfach Aussagen überdie E<strong>in</strong>kommensentwicklung im Lebensablauf anhandvon (Querschnitts-)Alters-E<strong>in</strong>kommens-(bzw. Lohn-)Profilenabgeleitet. Hierzu ist <strong>in</strong>zwischen h<strong>in</strong>länglich bekannt,dass sich die aus Längsschnittdaten gewonnenenE<strong>in</strong>kommens-(Lohn-)verläufe von den Querschnittsprofilenunterscheiden (also ke<strong>in</strong> – wie aus Querschnittsdatenabgeleitet – ausgeprägt zunächst ansteigendes und dannauch wie<strong>der</strong> rückläufiges Profil (<strong>in</strong>vers-u-förmig) anzutreffenist (Schmähl 1981, Göbel 1983)) und dass im Zeitablaufdas Niveau <strong>der</strong> Profile (für jüngere im Vergleich zuälteren Kohorten) Än<strong>der</strong>ungen unterliegt (Schmähl1986). Dieser Aspekt ist auch bei <strong>der</strong> Frage zu berücksichtigen,wie sich die Alters-Produktivitäts-Profile entwickeln.Würde man davon ausgehen können, dass dieEntlohnung stets gemäß <strong>der</strong> altersspezifischen Produktivitäterfolgt, so könnte man von den Lohn<strong>in</strong>formationenauf die Produktivität schließen. Allerd<strong>in</strong>gs gibt es zusätzliche,die Entlohnung bee<strong>in</strong>flussende Faktoren, wozu u.a.die Senioritätsregeln gehören, <strong>der</strong>en Bedeutung allerd<strong>in</strong>gshäufig überschätzt wird (Bisp<strong>in</strong>ck 2005). Auch diealtersspezifische Arbeitsproduktivität ist von vielen Faktorenabhängig, wie beispielsweise vom technischen Wissenund se<strong>in</strong>er Umsetzung, vom E<strong>in</strong>satz von Realkapitalsowie <strong>der</strong> „Qualität“ des Humankapitals <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung.28 Beson<strong>der</strong>s augenfällig im Dienstleistungsbereich o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Tätigkeit<strong>in</strong> Arbeitsgruppen.29 Begründet wird dies manchmal auch mit dem H<strong>in</strong>weis auf die ger<strong>in</strong>gereBeteiligung Älterer an <strong>der</strong> Weiterbildung. Dies steht allerd<strong>in</strong>gs<strong>in</strong> Beziehung <strong>zur</strong> Frage nach <strong>der</strong> „Restverwertungsdauer“ von Investitionen<strong>in</strong> Humankapital durch Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, alsonach <strong>der</strong> Länge <strong>der</strong> Erwerbsphase und <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> Altersgrenzen;siehe dazu Kapitel Erwerbsarbeit.Die Annahme ist plausibel, dass sich im Zeitablauf aufGrund verbesserter Ausbildung die <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> Produktivitätsprofileverän<strong>der</strong>t, also die altersspezifische Produktivität<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bestimmten Lebensalter (z.B. im Alter 55)im Jahre 2005 (also bei 1950 Geborenen) niedriger ist alsbei Gleichaltrigen im Jahre 2015. Ist das <strong>der</strong> Fall, sowürde bei e<strong>in</strong>er stärkeren Besetzung von höheren Altersklassendem (negativen) Effekt entgegen gewirkt, <strong>der</strong> ause<strong>in</strong>em konstanten <strong>in</strong>vers-u-förmigen Produktivitätsprofilabgeleitet wird. Dies würde noch verstärkt, wenn es zuke<strong>in</strong>er signifikanten Reduktion <strong>der</strong> altersspezifischenProduktivität im Verlauf <strong>der</strong> Erwerbsphase kommt, dasProfil (e<strong>in</strong>es Geburtsjahrganges) ab e<strong>in</strong>em bestimmtenLebensalter also weitgehend konstant bleibt. Dann würdees bei steigendem Durchschnittsalter <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerungzum<strong>in</strong>dest zu ke<strong>in</strong>em Rückgang, ggf. sogar zu e<strong>in</strong>emAnstieg <strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichen Produktivitätkommen (Mart<strong>in</strong>s u.a. 2005). Allerd<strong>in</strong>gs ist bei allen solchenmechanischen Fortschreibungen Vorsicht geboten,da die komplexen Rück- und Wechselwirkungen dabei <strong>in</strong><strong>der</strong> Regel ausgeblendet bleiben. Darüber h<strong>in</strong>aus wirdübersehen, dass – sofern e<strong>in</strong> altersbed<strong>in</strong>gter Produktivitätsrückgangbefürchtet wird – diesem durch vermehrteWeiterqualifikation entgegengewirkt werden kann (sieheKapitel Bildung).Bislang liegen allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>e verlässlichen empirischenAussagen über die altersspezifische Produktivität <strong>in</strong> verschiedenenTätigkeitsbereichen vor. Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literaturanzutreffende Hypothese über e<strong>in</strong>e ab e<strong>in</strong>em bestimmtenAlter rückläufige Produktivität sche<strong>in</strong>t weitgehend vonAussagen über die Entwicklung <strong>der</strong> physischen Leistungsfähigkeitabgeleitet zu se<strong>in</strong>. 30 In e<strong>in</strong>er Gegenüberstellung<strong>der</strong> Argumente, die für und gegen Produktivitätsfortschritte<strong>in</strong> alternden Gesellschaften e<strong>in</strong>e Rolle spielen,wird z.B. hervorgehoben, dass e<strong>in</strong>e „e<strong>in</strong>deutige Antwortauf die Frage, welche Faktoren überwiegen, … nicht gegebenwerden (kann), da breit angelegte empirische Untersuchungen<strong>zur</strong> Entwicklung <strong>der</strong> altersspezifischenQualität des Faktors Arbeit fehlen“ (Gräf 2003: 5).4.4.2 Rückgang <strong>der</strong> ErwerbsbevölkerungAussagen über negative Auswirkungen auf die Produktivitäts-und E<strong>in</strong>kommensentwicklung resultieren darüberh<strong>in</strong>aus aus e<strong>in</strong>em weiteren Argumentationsstrang, nämlich<strong>der</strong> Schrumpfung <strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung, wodurchu.a. e<strong>in</strong>e Begrenzung <strong>der</strong> Produktionskapazität resultiere.31 Von e<strong>in</strong>em generellen Mangel an Arbeitskräftenwird für e<strong>in</strong>e noch absehbare Zeit angesichts des hohenungenutzten Potenzials an Arbeitskräften <strong>in</strong> Deutschlandnicht ausgegangen werden können. Zudem unterstreichtdies die Bedeutung und Notwendigkeit e<strong>in</strong>er besseren30 “Der Glaube an e<strong>in</strong>e sich rasch verr<strong>in</strong>gernde Produktivität <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emAlter schon lange vor dem Regele<strong>in</strong>trittsalter <strong>in</strong> die gesetzliche Rentenversicherungist weit verbreitet. Es gibt jedoch ke<strong>in</strong>e verlässlicheAbschätzung dieses Effekts. Die quantitativ belegten Beziehungenbeschränken sich auf e<strong>in</strong>fach zu messende Konzepte, während dieWirkungen komplexer Zusammenhänge weitgehend unbekannt s<strong>in</strong>d.Dies hat zu e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>seitigen Sichtweise des Produktivitätsverlustesim Alter geführt“, so <strong>der</strong> Wissenschaftliche Beirat beim Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Wirtschaft und Arbeit <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Gutachten „Alterungund Familienpolitik“ (BMWA 2005: Kapitel 11). Zum Überblicküber den – unbefriedigenden – Stand <strong>der</strong> Forschung siehe Börsch-Supan, Düzgün & Weiss 2005.31 „Gewichtet man die für Deutschland zu erwartenden Abnahmeratendes Arbeitsangebots mit dem Wachstumsbeitrag <strong>der</strong> Arbeit, <strong>der</strong> bei0,7 liegt, so bedeutet dies, für sich betrachtet, e<strong>in</strong>e negative Rate desBrutto<strong>in</strong>landsprodukts im Bereich von 0,6 Prozentpunkten pro Jahrim Zeitraum von 2020 bis 2030 und 0,4 Prozentpunkten im Jahrzehntdarauf … Alternde Volkswirtschaften bewegen sich … auf e<strong>in</strong>emniedrigeren Wachstumspfad; ihr Produktionspotential – die Angebotsseite<strong>der</strong> Volkswirtschaft – entwickelt sich schwächer,“ so Siebert(2004: 28) (gleichfalls ehemaliges Mitglied des Sachverständigenratsfür die gesamtwirtschaftliche Entwicklung); analog Rürup <strong>in</strong>Siebert (2004): Die „Verr<strong>in</strong>gerung des Arbeitskräfteangebots (bedeutet)für sich alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en jährlichen Wachstumsverlust <strong>in</strong> <strong>der</strong> Größenordnungvon etwa e<strong>in</strong>em Prozentpunkt pro Jahr“ im Zeitraum 2010bis 2040 (S. 2); vgl. auch Siebert 2003.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 141 – Drucksache 16/2190Nutzung des Potenzials älterer Arbeitskräfte (siehe dazuKapitel Erwerbsarbeit). Außerdem könnte dem auchdurch e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> Arbeitsproduktivität entgegengewirktwerden, sodass <strong>in</strong> <strong>der</strong> Diskussion nicht nur aufdie Zahl <strong>der</strong> Erwerbstätigen abgestellt werden sollte. 324.4.3 Kapitalfundierung <strong>in</strong> <strong>der</strong> sozialenSicherung als positiverWachstumsfaktorE<strong>in</strong> dritter Argumentationsstrang ist eher <strong>in</strong>direkter Art.Dabei wird darauf verwiesen, dass umlagef<strong>in</strong>anzierte Sicherungssystemeim Vergleich zu kapitalfundierten negativeAuswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklunghaben und angesichts e<strong>in</strong>es steigenden AnteilsÄlterer an <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung <strong>der</strong> sonst erfor<strong>der</strong>lichenAusweitung <strong>der</strong> quantitativen Bedeutung <strong>der</strong> Umlagef<strong>in</strong>anzierungentgegengewirkt werden müsse durch denzum<strong>in</strong>dest partiellen Übergang zu kapitalfundierten Formen(so <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alterssicherung und <strong>in</strong> <strong>der</strong>Pflegeversicherung). Durch den Übergang zu kapitalfundierterAlterssicherung – so e<strong>in</strong>e vielfach <strong>in</strong> <strong>der</strong> wirtschaftswissenschaftlichenLiteratur vertretene Position –werde die gesamtwirtschaftliche Ersparnis erhöht, damitauch das Volumen (<strong>in</strong>flationsfrei f<strong>in</strong>anzierter) Investitionengesteigert und hierdurch das Niveau <strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichenProduktion und/o<strong>der</strong> Rate des Wirtschaftswachstumserhöht. 33Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel <strong>zur</strong> Ableitung solch positiver gesamtwirtschaftlicherWirkungen herangezogenen theoretischenBegründungen halten allerd<strong>in</strong>gs <strong>der</strong> empirischenÜberprüfung kaum stand. Inzwischen – nachdem <strong>in</strong>Deutschland im Rahmen <strong>der</strong> jüngsten Reformentscheidungene<strong>in</strong>e Ausdehnung kapitalfundierter Alterssicherungzu e<strong>in</strong>em wichtigen politischen Ziel erklärt wurde –ist die Argumentation auch nicht mehr so e<strong>in</strong>seitig gegendie Umlagef<strong>in</strong>anzierung gerichtet wie noch vor wenigenJahren vor dem „Paradigmenwechsel“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alterssicherungspolitik<strong>in</strong> Deutschland. So vertrat z.B. <strong>der</strong> se<strong>in</strong>erzeitigeVorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beimBundeswirtschaftsm<strong>in</strong>isterium nach Vorlage e<strong>in</strong>es hieraufzielenden Gutachtens die Auffassung, das Kapitaldeckungsverfahrensei <strong>der</strong> Umlagef<strong>in</strong>anzierung „<strong>in</strong> fast32 So formuliert die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahresbericht2004 (S. 58f.) vorsichtig: „Der prognostizierte Rückgang <strong>der</strong> Bevölkerungim erwerbsfähigen Alter wird e<strong>in</strong>en Abwärtsdruck auf dasPotenzialwachstum des Euroraums ausüben, wenn er nicht durch an<strong>der</strong>eWachstumsfaktoren wie e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> Erwerbsbeteilung,<strong>der</strong> Arbeitsproduktivität bzw. des produktiven E<strong>in</strong>satzes an<strong>der</strong>er Ressourcen(z.B. Kapital) kompensiert werden kann“ (Hervorhebungnicht im Orig<strong>in</strong>al).33 Die Diskussion über Vor- und Nachteile <strong>der</strong> beiden grundlegendenF<strong>in</strong>anzierungsverfahren (Umlagef<strong>in</strong>anzierung und Kapitalfundierung)wird seit mehr als e<strong>in</strong>em Jahrhun<strong>der</strong>t geführt, beg<strong>in</strong>nend vorE<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> Sozialversicherung <strong>in</strong> Deutschland; vgl. hierzuSchmähl 1980, 2004c; Manow 2000. Aus <strong>der</strong> Fülle <strong>der</strong> prononciertvorgetragenen Aussagen über die ökonomische Vorteilhaftigkeit kapitalfundierterVorsorge sei exemplarisch nur verwiesen auf die Beiträgevon Siebert & Feldste<strong>in</strong> <strong>in</strong> Siebert 1998. Kritisch dazu Schmähl1998 im gleichen Band. Zum Überblick über verschiedene Aspektedes Vergleichs zwischen den Verfahren siehe u.a. Breyer 2000;Thompson, Ol<strong>der</strong> & Wiser 1998, <strong>in</strong>sbes. Kapitel 4; Eisen 2004.je<strong>der</strong> H<strong>in</strong>sicht überlegen. Altersvorsorge durch Umlagef<strong>in</strong>anzierungfunktioniert nach dem Vorsorgepr<strong>in</strong>zipprimitiver Gesellschaften“ (Neumann 1998). Inzwischenist selbst die Weltbank, die stets e<strong>in</strong>e Notwendigkeit vermehrterKapitalfundierung im Interesse <strong>der</strong> wirtschaftlichenEntwicklung propagiert hat, vorsichtiger <strong>in</strong> <strong>der</strong>Beurteilung möglicher positiver Wachstumseffekte geworden.34Von e<strong>in</strong>em Mangel an F<strong>in</strong>anzierungsmitteln für Investitionenkann <strong>der</strong>zeit und wohl auch für die nähere Zukunft<strong>in</strong> Deutschland nicht ausgegangen werden – ganz im Unterschied<strong>zur</strong> Situation <strong>in</strong> den USA mit e<strong>in</strong>er geradezu„traditionell“ niedrigen privaten Sparquote, was wohlauch den Blick vieler dortiger Ökonomen im H<strong>in</strong>blick aufdie Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Erhöhung <strong>der</strong> Ersparnisbildung,die durch e<strong>in</strong>e Ausweitung kapitalfundierter Alterssicherungerreicht werden sollte, geprägt hat.Inzwischen wird auch akzeptiert, dass kapitalfundierteVerfahren von <strong>der</strong> demografischen Entwicklung abhängen.Allerd<strong>in</strong>gs wird dies häufig dann nicht mehr beachtet,wenn <strong>in</strong> Modellberechnungen gezeigt werden soll,dass die „Rendite“ kapitalfundierter Verfahren <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Umlagef<strong>in</strong>anzierung überlegen ist, es also auch für denE<strong>in</strong>zelnen vorteilhaft sei, <strong>in</strong> dieser Weise vorzusorgen. Sowird z.B. <strong>in</strong> Berechnungen <strong>der</strong> Nachhaltigkeitskommission– die dann vom Sachverständigenrat <strong>zur</strong> Begutachtung<strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichen Entwicklung übernommenwurde – e<strong>in</strong> Renditerückgang im Umlageverfahrenauf Grund des sich verän<strong>der</strong>nden Zahlenverhältnisseszwischen Rentnern und Beitragszahlern errechnet,während für die kapitalfundierte private Alterssicherungunbeschadet <strong>der</strong> demografischen Verän<strong>der</strong>ungen stetsmit e<strong>in</strong>em konstanten Z<strong>in</strong>ssatz gerechnet wird (BMGS2003a: 109). 35Ob und <strong>in</strong>wieweit <strong>der</strong> Abbau umlagef<strong>in</strong>anzierter Rentenund e<strong>in</strong>e Ausweitung kapitalfundierter Renten zu e<strong>in</strong>erVerbesserung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenslage im Alter führt, wird<strong>in</strong> Abschnitt 4.5 anhand <strong>der</strong> deutschen Situation noch erörtert.Hier sei nur darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass es zudemnicht alle<strong>in</strong> auf die Höhe von Renditen ankommt, son<strong>der</strong>nauch <strong>der</strong>en größere Volatilität <strong>in</strong> kapitalfundierten Systemenim Zeitablauf zu berücksichtigen ist, wie auch dieTatsache, dass dort Renditen je nach Anlagestrategie,Höhe <strong>der</strong> Vorsorgeaufwendungen und damit verbundenenKosten weitaus mehr streuen als <strong>in</strong> umlagef<strong>in</strong>anziertenSystemen. Das heißt, auch hier kommt es u.a. auf die z.T.beträchtlichen Unterschiede <strong>in</strong>nerhalb von Geburtsjahrgängenan – also zwischen Männern und Frauen, Alle<strong>in</strong>stehendenund Verheirateten, zwischen Versicherten mitK<strong>in</strong><strong>der</strong>n und ohne K<strong>in</strong><strong>der</strong>. In <strong>der</strong> öffentlichen Diskussionwurde <strong>der</strong> Blick dagegen vor allem auf Unterschiede zwischenGeburtsjahrgängen gelenkt und postuliert, dass <strong>der</strong>34 Deutlich macht dies e<strong>in</strong> Vergleich <strong>der</strong> Ausführungen von Holzmann& H<strong>in</strong>z (2005) mit denen <strong>in</strong> <strong>der</strong> e<strong>in</strong>flussreichen Veröffentlichung <strong>der</strong>World Bank 1994.35 Kritisch auch zu <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> ökonomischen Literatur postulierten höherenRendite privater Altersvorsorge im Vergleich zu Umlagef<strong>in</strong>anzierung(Orszag & Stiglitz 2001).
Drucksache 16/2190 – 142 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode(partielle) Übergang zu kapitalfundierter Alterssicherungim Interesse von (mehr) „<strong>Generation</strong>engerechtigkeit“ erfor<strong>der</strong>lichsei. 36 E<strong>in</strong>e (Teil-)Privatisierung wird aber Gew<strong>in</strong>nerund Verlierer mit sich br<strong>in</strong>gen. 374.5 Perspektiven <strong>der</strong> künftigenE<strong>in</strong>kommensentwicklung im Alterangesichts bereits beschlossenerReformmaßnahmenMit den Entscheidungen <strong>zur</strong> Alterssicherung seit <strong>der</strong>Jahrtausendwende ist e<strong>in</strong> tief greifen<strong>der</strong> Wandel im deutschenAlterssicherungssystem e<strong>in</strong>geleitet worden. 38 Indiesem <strong>Bericht</strong> geht es vor allem um die Beschlüsse desJahres 2001, die durch die Maßnahmen des Nachhaltigkeitsgesetzesim Jahre 2004 fortgeführt wurden, u.a. <strong>in</strong>Komb<strong>in</strong>ation mit <strong>der</strong> Neuregelung <strong>der</strong> Besteuerung vonVorsorgeaufwendungen und Alterse<strong>in</strong>künften. Bereits diere<strong>in</strong>e Auflistung von Maßnahmen <strong>in</strong> Übersicht 1 lässt erwarten,dass dadurch komplexe und vielgestaltige Wirkungenausgelöst werden. 39Der mit den Maßnahmen <strong>der</strong> Jahre 2001 und 2004 vorgenommene„Paradigmenwechsel“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alterssicherungspolitikdrückt sich u.a. <strong>in</strong> Folgendem aus: Wurde mit dem1989 verabschiedeten „Rentenreformgesetz 1992“ explizite<strong>in</strong> Verteilungs-(Leistungs-)ziel für die gesetzlicheRentenversicherung def<strong>in</strong>iert, so ist dies nun abgelöstworden durch die Dom<strong>in</strong>anz e<strong>in</strong>es Beitragszieles, verbundenmit e<strong>in</strong>er partiellen Substitution <strong>der</strong> umlagef<strong>in</strong>anziertenGRV durch kapitalfundierte private bzw. betrieblicheVorsorge.In den Mittelpunkt <strong>der</strong> Begründungen für diesen „Paradigmenwechsel“wurde die Belastung durch Arbeitgeberbeiträgegerückt (Stichwort: Lohnnebenkosten). In <strong>der</strong>Öffentlichkeit wird <strong>der</strong> E<strong>in</strong>druck erweckt, als ob es vonzentraler Bedeutung für die künftige <strong>Lage</strong> auf dem Arbeitsmarktsei, dass die sonst durch steigende Arbeitgeberbeiträgebewirkten Lohnkostenerhöhungen verh<strong>in</strong><strong>der</strong>twerden. Ohne die ökonomische Bedeutung <strong>der</strong> Lohnkostenentwicklungzu bestreiten, ersche<strong>in</strong>t diese Begründungfür die gewählten Reformmaßnahmen <strong>in</strong> <strong>der</strong> politischenDiskussion jedoch überzogen dargestellt zu werden.Denn betrachtet man die Lohnkostenentwicklung <strong>in</strong> zeitlicherPerspektive, so kann man z.B. fragen, um wie vieldie jährliche Bruttolohnentwicklung niedriger ausfallenmüsste, um die Lohnkostensteigerungen <strong>in</strong>folge sich erhöhen<strong>der</strong>Arbeitgeberbeiträge gerade zu kompensieren. 40Geht man dabei von den Daten <strong>der</strong> Nachhaltigkeitskommissionaus (BMGS 2003a), wie sie <strong>in</strong> <strong>der</strong>en <strong>Bericht</strong> fürdie Situation vor dem Reformgesetz von 2001 zugrundegelegt wurden (also ohne die im Jahre 2001 wie natürlichauch ohne die dann 2004 zusätzlich ergriffenen Maßnahmen),so zeigt sich, dass im Mittel <strong>der</strong> Jahre bis 2040 e<strong>in</strong>eLohn<strong>zur</strong>ückhaltung von deutlich weniger als 0,1 Prozentpunkten(genauer: 0,06) pro Jahr erfor<strong>der</strong>lich wäre, umdie Lohnkosten konstant zu halten.Die ergriffenen o<strong>der</strong> gar noch weitere Maßnahmen folglichprimär mit den dadurch verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten negativen Beschäftigungseffektenzu begründen, kann alle<strong>in</strong> angesichts<strong>der</strong> damit verbundenen Größenordnung nichtüberzeugen. Zudem: Wenn es tatsächlich um den dieLohnkosten erhöhenden Effekt von Sozialbeiträgen geht,so hätte man politisch die Weichen <strong>in</strong> Richtung auf e<strong>in</strong>eaufgabenadäquate F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> Sozialversicherungssystemestellen sollen und können. Denn das Ausmaß <strong>der</strong>vorhandenen Fehlf<strong>in</strong>anzierung ist beträchtlich und seitlangem bekannt. 41Bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> ergriffenen Maßnahmen solltenauch weitere Effekte berücksichtigt werden. So werdenfür lange Zeit die von den Bürgern aufzubr<strong>in</strong>genden Vorsorgeaufwendungenhöher se<strong>in</strong> als ohne die ergriffenenMaßnahmen. Zwar wird <strong>in</strong>sgesamt für öffentliche Haushalteund die Arbeitgeber e<strong>in</strong>e Entlastung erreicht, dochsteht dem e<strong>in</strong>e steigende höhere direkte Belastung <strong>der</strong>Privathaushalte gegenüber. In die gleiche Richtung wirkt<strong>in</strong> <strong>der</strong> betrieblichen Alterssicherung die zunehmende Verlagerungvon <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungsbeteiligung <strong>der</strong> Arbeitgeberh<strong>in</strong> <strong>zur</strong> direkten Selbstf<strong>in</strong>anzierung durch die Arbeitnehmer.Die Entgeltumwandlung ist dafür e<strong>in</strong> markantesBeispiel. In Form <strong>der</strong> zunächst bis 2008 begrenzten beitragsfreienEntgeltumwandlung entstehen im Umfang ihrerInanspruchnahme auch ke<strong>in</strong>e Ansprüche <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung. Dort wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichenKrankenversicherung reduziert sie die Beitragse<strong>in</strong>nahmen,was möglicherweise angesichts e<strong>in</strong>er u.a. damit verschlechtertenF<strong>in</strong>anzlage <strong>der</strong> Rentenversicherung Anstoßzu weiteren Leistungse<strong>in</strong>schränkungen geben kann. 42Darüber h<strong>in</strong>aus führt e<strong>in</strong>e Steigerung <strong>der</strong> (beitragsfreien)Entgeltumwandlung zu e<strong>in</strong>em schwächeren Anstieg desnun für die Rentenanpassung maßgebenden (Durchschnitts-)Lohnes<strong>der</strong> Versicherten und folglich zu e<strong>in</strong>erverm<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Steigerung des „aktuellen Rentenwerts“.Dies reduziert nicht nur die Rentensteigerung für jetzige36 Kritisch hierzu Schmähl 2005c. Zudem ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass<strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel höhere Renditen mit e<strong>in</strong>em höheren Risiko verbundens<strong>in</strong>d. Beim Vergleich kommt es entscheidend auf die Höhe <strong>der</strong> risikoadjustiertenNettorenditen (nach Kosten und Steuern) an.37 Zu den Gew<strong>in</strong>nern gehören <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Manager von privatenInvestmentfonds (so Stiglitz 2005).38 Siehe vertiefend zu diesen Ausführungen – mit weiteren VerweisenSchmähl 2005a.39 Zu verschiedenen Aspekten <strong>der</strong> Reformstrategie, die <strong>in</strong>zwischen beschlossenwurden, s. u.a. Schmähl 1998, 2000, 2001, 2004a. Generellzu Verän<strong>der</strong>ungen im Rentenrecht <strong>in</strong> jüngerer Zeit Ruland 2005.40 Dabei wird hier nicht auf die Überwälzung von Abgaben e<strong>in</strong>gegangen.41 Siehe u.a. Schmähl 1995 und Schmähl 2002b. Dort wurde <strong>der</strong> Umfang<strong>der</strong> <strong>in</strong>sgesamt (<strong>in</strong> allen Sozialversicherungszweigen) bestehendenFehlf<strong>in</strong>anzierung mit rund 8 Beitragspunkten beziffert. Das DIWkommt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er 2005 abgeschlossenen Studie zu <strong>in</strong>sgesamt 9 Beitragspunkten(Me<strong>in</strong>hard & Zwiener 2005). Für e<strong>in</strong>e sachadäquate F<strong>in</strong>anzierungsprechen sowohl verteilungs- als auch beschäftigungspolitischeGründe.42 Vgl. hierzu Schmähl 2002c. Dort wurde u.a. darauf h<strong>in</strong>gewiesen,dass bei e<strong>in</strong>er im Durchschnitt erfolgenden Nutzung <strong>der</strong> Entgeltumwandlungim Umfang von 2% des Bruttoentgelts <strong>der</strong> Beitragssatz <strong>in</strong><strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung (ceteris paribus) um 0,4 Beitragspunkte(<strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Krankenversicherung um 0,3 Punkte)höher liegen müsste.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 143 – Drucksache 16/2190Reformen <strong>der</strong> Alterssicherung – Schwerpunkte <strong>der</strong> Jahre 2001 bis 2004Übersicht 12001:(A) Gesetzliche Rentenversicherung– Reform <strong>der</strong> Renten wegen Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung– E<strong>in</strong>e neue Rentenanpassungsformel <strong>zur</strong> Reduzierung des Rentenniveaus und des Beitragsanstiegs– Reform <strong>der</strong> Alterssicherung von Frauen und <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbliebenenrenten– Verbesserungen bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung und für jüngere Versicherte(B) Betriebliche Altersversorgung– E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung– Reduzierung <strong>der</strong> Unverfallbarkeitsvorschriften– E<strong>in</strong>führung von Pensionsfonds– Zulassung von Beitragszusagen(C) E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> „Bedarfsorientierten Grundsicherung“(D) För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> freiwilligen privaten Vorsorge, mit den Elementen– Zertifizierung– Zulage bzw. verbesserte steuerliche Abzugsfähigkeit von Altersvorsorgeaufwendungen (zugleich E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong>die nachgelagerte Besteuerung)2004:(A) RV-Nachhaltigkeitsgesetz– neuerliche Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Anpassungsformel <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV und noch stärkere Reduzierung des Rentenniveaus– Anhebung des Rentene<strong>in</strong>trittsalters bei <strong>der</strong> Rente nach Arbeitslosigkeit und Altersteilzeit– die Anrechnung von Schulausbildungszeiten bei <strong>der</strong> Rente weitgehend abgeschafft, soweit es sich nicht umBerufsausbildung handelt.(B) Alterse<strong>in</strong>künftegesetz– Stufenweiser Übergang <strong>zur</strong> nachgelagerten Besteuerung <strong>der</strong> gesetzlichen Renten und Leistungen aus kapitalfundierterbetrieblicher Altersversorgung– Än<strong>der</strong>ungen bei <strong>der</strong> Zertifizierung und För<strong>der</strong>ung privater AltersvorsorgeAußerdem erfolgte e<strong>in</strong>e Reduzierung <strong>der</strong> (M<strong>in</strong>dest-)Rücklage <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung auf <strong>in</strong>zwischen0,2 MonatsausgabenRentner, son<strong>der</strong>n wirkt sich entsprechend auch <strong>in</strong> Zukunftfür künftige Rentner (also heutige Beitragszahler) aus.Insgesamt steigt durch die ergriffenen Reformmaßnahmendie Belastung <strong>der</strong> Bevölkerung mit Vorsorgeaufwendungen.Mit den Maßnahmen werden außerdem vielfältigeweitere Verän<strong>der</strong>ungen ausgelöst, u.a. da gesetzlicheund private Versicherung mit unterschiedlichen Verteilungseffektenverbunden s<strong>in</strong>d. Auf e<strong>in</strong>ige wird nachfolgendh<strong>in</strong>gewiesen. 4343 Die quantitativen Ergebnisse basieren auf zwei Studien, die am Zentrumfür Sozialpolitik <strong>der</strong> Universität Bremen durchgeführt wurden:Viebrok, Himmelreicher & Schmähl 2004; Viebrok 2004. Siehe außerdemHimmelreicher & Viebrok 2003; Schmähl 2003a.
Drucksache 16/2190 – 144 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeWären die 2001 bis 2004 beschlossenen Maßnahmen, diestufenweise ihre Wirkung entfalten sollen, bereits heutevoll wirksam, so würde z.B. e<strong>in</strong>e Rente <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung von 1.000 Euro (was etwa <strong>der</strong> Netto-Eckrente entspricht) bei optimistischer Rechnung nurnoch 750 Euro betragen – also e<strong>in</strong> Viertel weniger.War durch das „Renten-Reformgesetz 1992“ als Ziel fürdie so genannte Eckrente e<strong>in</strong> Niveau von 70 Prozent desdurchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts festgelegt worden,so zielen die jetzt beschlossenen Maßnahmen auf e<strong>in</strong>Niveau von 52 Prozent. Geht man davon aus, dass <strong>zur</strong> Armutsvermeidungetwa weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Rente <strong>in</strong> Höhe von40 Prozent des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgeltesangemessen ist, dann brauchte e<strong>in</strong> Durchschnittsverdienerrund 35 Beitragsjahre, um e<strong>in</strong>e Rente gerade <strong>in</strong> Höhez.B. e<strong>in</strong>er armutsvermeidenden bedarfsorientiertenGrundsicherung zu erhalten. Diese Grundsicherung istaber ohne jegliche Vorleistung zu erzielen. Jemand, <strong>der</strong>über se<strong>in</strong>en gesamten Lebensablauf gesehen unterdurchschnittlichverdient, benötigt e<strong>in</strong>e entsprechend längereVersicherungszeit, um e<strong>in</strong>e Rente <strong>in</strong> Höhe <strong>der</strong> armutsvermeidendenGrundsicherung zu erreichen: So s<strong>in</strong>d z.B. bei86 Prozent des Durchschnittsverdienstes bereits 40 Versicherungsjahreerfor<strong>der</strong>lich.Es geht somit nicht nur um die M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung des Leistungsniveaus,son<strong>der</strong>n zugleich wird damit faktisch auch e<strong>in</strong>eAbkehr vom Grundsatz des bisherigen gesetzlichen Rentenversicherungssystems– <strong>der</strong> maßgebend geprägt istvom Gedanken <strong>der</strong> Entsprechung (e<strong>in</strong>er Äquivalenz) vonLeistung und Gegenleistung – verbunden se<strong>in</strong>. Insbeson<strong>der</strong>eim unteren E<strong>in</strong>kommensbereich – man denke dabeiauch an Auswirkungen sich än<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Erwerbsbiografien<strong>in</strong> Zeiten lang anhalten<strong>der</strong> hoher Arbeitslosigkeit – ist mitniedrigen gesetzlichen Rentenansprüchen, aber angesichtsger<strong>in</strong>ger Vorsorgefähigkeit auch mit ger<strong>in</strong>gen o<strong>der</strong>fehlenden privaten Vorsorgeansprüchen zu rechnen, sodass<strong>der</strong> Ruf nach Verstärkung von M<strong>in</strong>destsicherungselementenlauter werden dürfte.44 Die For<strong>der</strong>ung nach e<strong>in</strong>er obligatorischen privaten und/o<strong>der</strong> betrieblichenAltersvorsorge – die auch von Politikern bereits mehrfach erhobenwurde – wird <strong>zur</strong> Zeit von e<strong>in</strong>igen F<strong>in</strong>anzmarktakteuren vertreten,<strong>in</strong>dem sie auf die un<strong>zur</strong>eichende Höhe <strong>der</strong> gesetzlichen Renteh<strong>in</strong>weisen und daraus die Notwendigkeit verpflichten<strong>der</strong> kapitalfundierterVorsorge ableiten.Insgesamt deutet sich damit <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong> von <strong>der</strong>Weltbank seit langem propagierter Weg an: E<strong>in</strong> umverteilendes,auf Armutsvermeidung im Alter zielendes staatliches(umlagef<strong>in</strong>anziertes) System, das komb<strong>in</strong>iert wirdmit e<strong>in</strong>em Vorsorgefähigkeit und Vorsorgebereitschaft <strong>in</strong><strong>der</strong> Erwerbsphase voraussetzenden privaten (kapitalfundierten)System. 44 Die deutsche gesetzliche Rentenversicherung,die bislang – auch im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich –stark vom Gedanken e<strong>in</strong>er Entsprechung von Leistungund Gegenleistung geprägt war, würde <strong>in</strong> e<strong>in</strong> stark umverteilendesSystem transformiert (Schmähl 2001). E<strong>in</strong>esolche tief greifende Systemän<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersvorsorgewürde u.a. die Anreize <strong>zur</strong> Arbeitsaufnahme für Beziehersehr niedriger E<strong>in</strong>kommen weiter reduzieren wieauch die Anreize <strong>zur</strong> privaten Vorsorge.Ob, von wem und <strong>in</strong>wieweit die Leistungsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung durch privateVorsorge tatsächlich kompensiert werden, ist – trotz <strong>der</strong>För<strong>der</strong>ung durch öffentliche Mittel – noch e<strong>in</strong>e offeneFrage. Allerd<strong>in</strong>gs ist offensichtlich, dass diejenigen, diebereits Rentner s<strong>in</strong>d o<strong>der</strong> es bald se<strong>in</strong> werden, die Leistungsreduktionenselbst bei vorhandener Sparfähigkeitund -bereitschaft nicht mehr durch eigene Vorsorgeaktivitätenkompensieren können. Diese Gruppe wird aberwährend ihrer tendenziell immer länger gewordenenRentnerphase zunehmend von den beschlossenen Leistungsreduktionenbetroffen. Bei Jüngeren ist zu beachten,dass die Sparfähigkeit recht unterschiedlich ist und dieSparbereitschaft angesichts e<strong>in</strong>er Ausweitung von bedarfsgeprüftenM<strong>in</strong>destelementen und <strong>der</strong> Gefahr e<strong>in</strong>esvorzeitigen E<strong>in</strong>satzes von Vermögen (z.B. bei längererArbeitslosigkeit) negativ berührt werden dürfte.Von <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung privater Vorsorge können im Pr<strong>in</strong>zipvor allem Personen mit sehr niedrigen o<strong>der</strong> sehr hohenE<strong>in</strong>kommen profitieren. 45 An <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ungs<strong>in</strong>d im Zweifel aber auch diejenigen beteiligt, diee<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung nicht o<strong>der</strong> nur partiell nutzen (können). 46Vor allem dann, wenn <strong>der</strong> Anteil <strong>in</strong>direkter Abgaben an<strong>der</strong> Aufbr<strong>in</strong>gung <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungsmittel weiter steigt,betrifft dies <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>em Maße große Haushalte wieauch solche im unteren E<strong>in</strong>kommensbereich. 47 Währendalso im unterem E<strong>in</strong>kommensbereich viele die För<strong>der</strong>ungnicht werden nutzen (können), aber an <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungmitbeteiligt s<strong>in</strong>d, wird man im höheren E<strong>in</strong>kommensbereichvon nicht unbeträchtlichen Mitnahmeeffekten durchVermögensumschichtung bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> privatenVorsorge ausgehen können 48 – und folglich auch kaumvon e<strong>in</strong>em durch die För<strong>der</strong>ung ausgelösten zusätzlichenAltersvorsorgesparen.Zu beachten ist auch, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> Rentnerphase bislang <strong>in</strong><strong>der</strong> Regel die E<strong>in</strong>künfte aus privater Altersvorsorge statischund nicht dynamisch s<strong>in</strong>d, also z.B. nicht analog <strong>der</strong>Lohnentwicklung steigen. Dies hat <strong>zur</strong> Folge, dass imVerlauf <strong>der</strong> Rentnerphase die Bedeutung <strong>der</strong> privatenRente immer weiter h<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>kommensentwicklung<strong>zur</strong>ückbleibt – während mit steigendem Altermöglicherweise zunehmen<strong>der</strong> Hilfebedarf entstehtund zu f<strong>in</strong>anzieren ist. So s<strong>in</strong>kt z.B. <strong>der</strong> Realwert e<strong>in</strong>er45 Zur unterschiedlichen relativen Bedeutung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung nach Familienstandund E<strong>in</strong>kommenshöhe vgl. ausführlich Viebrok, Himmelreicher& Schmähl 2004.46 So gibt es Schätzungen, nach denen je<strong>der</strong> zehnte Privathaushalt überschuldetsei (Frankfurter Allgeme<strong>in</strong>e Zeitung vom 25.6.2004 – DieInsolvenzwelle ebbt kaum ab). Unabhängig davon dürfte trotz För<strong>der</strong>ungdie Sparfähigkeit im unteren E<strong>in</strong>kommensbereich oft nicht ausreichen,um e<strong>in</strong>e Kompensation <strong>der</strong> Leistungsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung zu erreichen (Korczak 2004).47 Die Senkung des Leistungsniveaus <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungführt auch dazu, dass <strong>der</strong> Wert k<strong>in</strong>dbezogener Leistungen –so <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehungszeiten – gleichfalls s<strong>in</strong>kt, also <strong>der</strong> angestrebteFör<strong>der</strong>ungseffekt für Familien reduziert wird.48 Vgl. dazu auch Schwarze, Wagner & Wun<strong>der</strong> (2004) und Börsch-Supan(2004).
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 145 – Drucksache 16/2190nom<strong>in</strong>al konstanten Rente bereits bei e<strong>in</strong>er Inflationsratevon nur 2 Prozent <strong>in</strong> 15 Jahren auf rund Dreiviertel.Es reicht folglich nicht, so genannte Ersatzraten bei Beg<strong>in</strong>n<strong>der</strong> Altersphase zu berechnen, also Gesamtalterse<strong>in</strong>künfte<strong>in</strong> Relation zu den vorherigen Erwerbse<strong>in</strong>künften– worauf z.B. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Diskussion über die Reformen desJahres 2001 und 2004 immer wie<strong>der</strong> abgestellt wird –,vielmehr ist auch die Entwicklung während <strong>der</strong> immerlänger gewordenen Altersphase zu beachten.Dafür ist auch die Neuregelung <strong>der</strong> Rentenbesteuerungvon Bedeutung, denn bei Rentenbeg<strong>in</strong>n wird e<strong>in</strong> steuerlicherFreibetrag für die E<strong>in</strong>künfte aus <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung errechnet. Dieser Freibetrag bleibtaber <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesamten Rentenlaufzeit nom<strong>in</strong>al konstant,verliert also im Zuge <strong>der</strong> Rentenanpassungen relativ immermehr an Bedeutung und kann angesichts e<strong>in</strong>es progressivenSteuertarifs mit zunehmendem Alter des Rentnerszu steigen<strong>der</strong> Steuerbelastung und damitverr<strong>in</strong>gertem E<strong>in</strong>kommen führen, während demgegenübermöglicherweise <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensbedarf mit steigendemLebensalter sogar steigt.Auch für Frauen ergeben sich Verän<strong>der</strong>ungen, wenn anstelledes <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV geltenden Unisex-Tarifs bei vielenFormen privater Vorsorge geschlechtsspezifische Prämien<strong>zur</strong> Anwendung kommen, mit <strong>der</strong> Folge e<strong>in</strong>er höherenPrämie auf Grund <strong>der</strong> höheren weiblichen durchschnittlichenLebenserwartung. Zwar wurden im Rahmendes Alterse<strong>in</strong>künftegesetzes Unisex-Tarife für „Riester-Verträge“ beschlossen, doch bleibt abzuwarten, wie dieBürger darauf reagieren, verschlechtert dies doch im Vergleich<strong>zur</strong> vorherigen Situation bei den Riester-Produktendie Rendite für Männer. Möglicherweise dient die E<strong>in</strong>führungvon Unisex-Tarifen als politischer Hebel, um privateVorsorge demnächst <strong>zur</strong> Pflicht zu machen und damitdie (geför<strong>der</strong>te) private Vorsorge verstärkt <strong>in</strong> denDienst sozial- und verteilungspolitischer Ziele zu stellen.Diese Frage dürfte nach Vorlage des im Herbst 2005 von<strong>der</strong> Bundesregierung vorzulegenden <strong>Bericht</strong>s über Erfahrungenmit <strong>der</strong> geför<strong>der</strong>ten privaten Vorsorge auf die Tagesordnungrücken – nachdem schon früher verschiedentlichVorstöße <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>es Obligatoriums gemachtwurden.Die Ergebnisse aus Simulationsberechnungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er fürdie 5. Altenberichtskommission erstellten Expertise(Viebrok 2004b) zeigen die Auswirkungen <strong>der</strong> jüngsten(seit 2001 ergriffenen) Reformen auf Brutto- und Netto-Alterse<strong>in</strong>kommen für unterschiedliche Geburtsjahrgängelediger Männer und Frauen sowie zu zwei Zeitpunkten imLebenszyklus (65 und 75 Jahre). Diese Berechnungen basierenu.a. auf zwei optimistischen Annahmen:– Es handelt sich stets um Versicherte mit 45 Entgeltpunkten(<strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV) – also um (männliche o<strong>der</strong>weibliche) „Eckrentner“ – mit e<strong>in</strong>em ununterbrochenenErwerbsverlauf.– Die För<strong>der</strong>möglichkeiten für die private Altersvorsorgewerden jeweils maximal ausgeschöpft.Im Übrigen werden demografische und ökonomische Annahmenverwendet, die auch die „Nachhaltigkeitskommission“ihrem <strong>Bericht</strong> zugrunde legte. So wird u.a. e<strong>in</strong>eRealverz<strong>in</strong>sung unterstellt, <strong>der</strong>en Prozentsatz doppelt sohoch ist wie die reale Lohnzuwachsrate. Die Berechnungsergebnissegeben Realwerte wie<strong>der</strong> (was damit implizite<strong>in</strong>e Inflationsanpassung bei den privaten Rentenenthält).Verglichen wird die Situation nach den Reformen (2001,2004, e<strong>in</strong>schließlich des Alterse<strong>in</strong>künftegesetzes) mit <strong>der</strong>Situation ohne diese Reformen. Das Alterse<strong>in</strong>kommensetzt sich zusammen aus <strong>der</strong> Rente <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungund aus <strong>der</strong> geför<strong>der</strong>ten privaten Vorsorge(Tabelle 19).Diejenigen „Eckrenter“, die (mit 65) im Jahre 2011 erstmalsihre Rente <strong>in</strong> Anspruch nehmen (Jahrgang 1945),haben ger<strong>in</strong>gere Brutto- und Nettoe<strong>in</strong>kommen zu erwartenals bei Fortdauer <strong>der</strong> Regelungen, die vor den Reformmaßnahmengalten. Diesen Rentnern bleibt aberauch kaum Zeit für kompensierende Privatvorsorge.An<strong>der</strong>s sche<strong>in</strong>t es für Jüngere zu se<strong>in</strong>, hier diejenigen(Jahrgang 1965), die 2031 mit 65 „<strong>in</strong> Rente gehen“. DieBruttoe<strong>in</strong>kommen liegen höher als sie ohne die Reformmaßnahmengewesen wären. Dieses zunächst positiveBild än<strong>der</strong>t sich aber, wenn man die Nettoe<strong>in</strong>kommen– unter Berücksichtigung <strong>der</strong> nun stärkeren Besteuerung –betrachtet. Zwar ist für e<strong>in</strong>en männlichen Eckrentner beiRentenbeg<strong>in</strong>n das gesamte Renten-Nettoe<strong>in</strong>kommennoch höher als ohne Reform, doch 10 Jahre später zeigtsich auch hier e<strong>in</strong> Reale<strong>in</strong>kommensverlust. Für die Eckrentner<strong>in</strong>ist die neue Situation von Anbeg<strong>in</strong>n ungünstigerals vor <strong>der</strong> Reform. Um es nochmals zu betonen: Hierwerden lange und ununterbrochene Erwerbsverläufe undvolle Ausnutzung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>möglichkeiten unterstellt.Relativ – bezogen auf Arbeitse<strong>in</strong>kommen – s<strong>in</strong>kt nichtnur das Niveau <strong>der</strong> gesetzlichen Rente, son<strong>der</strong>n auch das<strong>der</strong> Privatrente, sofern diese Rente nom<strong>in</strong>al konstant isto<strong>der</strong> nur mit <strong>der</strong> Inflationsrate dynamisiert wird. Diesverstärkt also den Effekt des s<strong>in</strong>kenden Niveaus <strong>der</strong> gesetzlichenRente während <strong>der</strong> Rentenlaufzeit. GeradeHochbetagte können so von E<strong>in</strong>kommense<strong>in</strong>bußen betroffenwerden, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Lebensphase, <strong>in</strong> <strong>der</strong> vermehrterE<strong>in</strong>kommensbedarf wegen Krankheit-, Hilfs- o<strong>der</strong> Pflegebedürftigkeitauftreten kann. In <strong>der</strong> öffentlichen Diskussionwird allerd<strong>in</strong>gs alle<strong>in</strong> auf die Situation beim erstmaligenRentenbezug abgestellt. Damit bleibt e<strong>in</strong>wichtiger Aspekt ausgeblendet.Die Reduzierung des Leistungsniveaus <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV verr<strong>in</strong>gertauch die dort vorhanden Ausgleichselemente, seies den Wert <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehungsleistungen, sei es dieZurechnungszeit im Falle von Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung o<strong>der</strong>die Rentenansprüche im Falle von Arbeitslosigkeit (aufdie im Falle von Arbeitslosigkeit direkt ansetzenden Verän<strong>der</strong>ungenwird weiter unten h<strong>in</strong>gewiesen). Demgegenübers<strong>in</strong>d mit privater Vorsorge zusätzliche Risikenverbunden, z.B. je nach Anlageentscheidung und erreichbarerVerz<strong>in</strong>sung, durch Kosten, die im Falle <strong>der</strong> Unterbrechungvon Verträgen entstehen können u.a.m. Diese
Drucksache 16/2190 – 146 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 19Reformbed<strong>in</strong>gte Reale<strong>in</strong>kommensän<strong>der</strong>ung (gesetzliche und private Rente)für e<strong>in</strong>en ledigen „Eckrentner“ im MonatJahr(Alter)2011(65)Jahrgang 1945Bruttoe<strong>in</strong>kommenNachrichtlich: Brutto-Eckrente (1.7.2003 – 30.6.2004)West1176 €/MonatOst1034 €/MonatQuelle: Viebrok 2004b.2021(75)2011(65)Nettoe<strong>in</strong>kommenvor Reform 1246 1427 1144 1308nach ReformMannFrau11801169131413041077106611941183Jahrgang 1965Bruttoe<strong>in</strong>kommenNettoe<strong>in</strong>kommenJahr(Alter)2031(65)vor Reform 1610 1852 1472 1692nach ReformMannFrau174916591910182015161445166415912041(75)2031(65)2021(75)2041(75)Risiken treffen aber – im Unterschied <strong>zur</strong> GRV – nichtalle Sparer gleich, son<strong>der</strong>n unterschiedlich und tragen damitauch zu e<strong>in</strong>er steigenden Ungleichheit <strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommenbei.Weitere Effekte, die für die Höhe von Alterse<strong>in</strong>kommenwie auch die Beurteilung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen (gemessen amE<strong>in</strong>kommensbedarf und damit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensverwendungsmöglichkeit)und auch des Nachfragepotenzials <strong>in</strong>verschiedenen Bereichen von Bedeutung s<strong>in</strong>d, resultierenaus Entwicklungen und Entscheidungen <strong>in</strong> weiteren Bereichendes sozialen Sicherungssystems und aus <strong>der</strong> Entwicklungauf dem Arbeitsmarkt (Beschäftigung, Lohnhöhe).Dazu gehören neben verän<strong>der</strong>ten steuerlichen Regelungenund Sozialbeiträgen (so <strong>in</strong> <strong>der</strong> Pflegeversicherung,<strong>der</strong> Krankenversicherung und bei Betriebsrenten) z.B.:– Im SGB III: Welche Beiträge werden für Leistungsbezieheran die GRV abgeführt und führen dort zu Rentenansprüchen?Wird z.B. die Bezugsdauer für Arbeitslosengeldreduziert – wie <strong>in</strong>zwischen beschlossen –und schließt sich ke<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit an, so reduziertdies beträchtlich die Rentenansprüche (z.B. be<strong>in</strong>achfolgendem Bezug von „Arbeitslosengeld II“).– Beim neuen „Arbeitslosengeld II“ werden zwar Beiträgean die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt,jedoch auf <strong>der</strong> Basis von monatlich 400 Euro. Das entspricht<strong>der</strong>zeit e<strong>in</strong>em Anspruch von 1/6 Entgeltpunkt,also e<strong>in</strong>em Sechstel des Rentenanspruchs, den e<strong>in</strong>Durchschnittsverdiener erwirbt. Bei längeren Phasendes Bezugs dieser Leistung bzw. bei steigen<strong>der</strong> Langzeitarbeitslosigkeitkann dies mit zu Armut im Alterbeitragen. Dieser Effekt wird dann noch verstärkt,wenn es zu ke<strong>in</strong>er Dynamisierung <strong>der</strong> Beitragsbemessungsgrundlagefür das „Arbeitslosengeld II“ kommt,denn dann s<strong>in</strong>kt bei steigenden Durchschnittsentgelten<strong>der</strong> damit erreichbare Rentenanspruch (Entgeltpunkt)immer weiter. Bislang ist ke<strong>in</strong>e Dynamisierung vorgesehen.– Bei allen bedürftigkeitsgeprüften Leistungen: In welchemUmfang ist z.B. Vermögen vor Erreichen <strong>der</strong> Altersgrenze„e<strong>in</strong>zusetzen“?– In <strong>der</strong> Krankenversicherung: Wie entwickelt sich dieDef<strong>in</strong>ition des Leistungskatalogs, das Ausmaß vonZuzahlungen, die Höhe des Krankenversicherungsbeitragsauf Alterse<strong>in</strong>künfte gesetzlicher, betrieblicherund privater Art?– In <strong>der</strong> Pflegeversicherung: Wie werden sich die Leistungenentwickeln? Seit E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> Pflegeversicherungfehlt e<strong>in</strong>e Leistungsdynamisierung.Bislang gibt es ke<strong>in</strong>e Zusammenschau <strong>der</strong> Auswirkungenvon Maßnahmen, die <strong>in</strong> verschiedenen Bereichen ergriffenwurden o<strong>der</strong> geplant s<strong>in</strong>d, auf die E<strong>in</strong>kommenslage
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 147 – Drucksache 16/2190<strong>der</strong> verschiedenen Bevölkerungsgruppen, so auch <strong>der</strong>jenigen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase. Stattdessen s<strong>in</strong>d allenfallsbereichsspezifische Teil<strong>in</strong>formationen über Auswirkungenvorhanden.Insgesamt ist auf Grund des mit den Reformmaßnahmene<strong>in</strong>geschlagenen Weges zu erwarten, dass <strong>in</strong> Zukunft dieE<strong>in</strong>kommensverteilung im Alter deutlich ungleicher wird,d.h. dass sich die E<strong>in</strong>kommensunterschiede erheblich verstärkenwerden. Zudem ist damit zu rechnen, dass <strong>in</strong> Zukunftvermehrt bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen – wie diebedarfsorientierte Grundsicherung bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungund im Alter – erfor<strong>der</strong>lich werden, um E<strong>in</strong>kommensarmutim Alter zu vermeiden bzw. zu bekämpfen.Es besteht die Gefahr, dass die GRV angesichts <strong>der</strong> Reduktionihres Leistungsniveaus zunehmend an Legitimationverliert, wenn für e<strong>in</strong>en Großteil <strong>der</strong> Versicherten selbstnach langer Versicherungsdauer kaum e<strong>in</strong>e Versicherungsleistungzu erwarten ist, die deutlich das Niveau armutsvermeiden<strong>der</strong>Sozialleistungen (ohne Vorleistung) übersteigt.Zudem ist dann nicht auszuschließen, dass – wie vielfachgefor<strong>der</strong>t (z.B. mit H<strong>in</strong>weis auf die AHV <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz) –<strong>in</strong> die GRV zusätzliche Umverteilungselemente e<strong>in</strong>gefügtwerden, die die bislang noch vorhandene Leistungs-Gegenleistungs-Beziehungimmer weiter abschwächen undden Beitrag damit immer mehr zu e<strong>in</strong>er Steuer werden lassen,was die Bereitschaft <strong>zur</strong> Beitragszahlung unterm<strong>in</strong>iert.E<strong>in</strong>e Verknüpfung dieser im Niveau erheblich reduziertenGRV mit <strong>der</strong> bedürftigkeitsgeprüften Grundsicherung istdann e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> möglichen Optionen.4.6 Beurteilungskriterien für dieE<strong>in</strong>kommenslage im AlterUm die sich abzeichnende Entwicklung beurteilen zukönnen und ggf. (<strong>in</strong>strumentelle) Alternativen zu entwickeln,bedarf es e<strong>in</strong>iger Kriterien. Allgeme<strong>in</strong> könnten folgendeZielsetzungen für die E<strong>in</strong>kommenssituation im Alterzugrunde gelegt werden:– E<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>destanfor<strong>der</strong>ung ist die Vermeidung von E<strong>in</strong>kommensarmutim Alter.Allerd<strong>in</strong>gs reicht dies im Regelfall aus Sicht <strong>der</strong> Bürgernicht aus. Dies zeigt die Entwicklung <strong>der</strong> Alterssicherungspolitik<strong>in</strong> vielen Län<strong>der</strong>n. Gewünscht wird vielmehr– e<strong>in</strong>e Verstetigung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommens- und Konsumentwicklungim Lebenslauf <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den Fällen, <strong>in</strong>denen bestimmte „Risiken“ e<strong>in</strong>treten. Im hier behandeltenZusammenhang handelt es sich vor allem umden E<strong>in</strong>tritt von Erwerbsunfähigkeit, die Situationbeim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und die Absicherung<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er immer länger gewordenen Nacherwerbsphaseund ggf. beim Tod des Ehegatten.Damit verbunden ist also auch– die Teilhabe an <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>kommensentwicklungnach E<strong>in</strong>tritt <strong>der</strong> erwähnten „Risiken“, vor allemalso auch während <strong>der</strong> Nacherwerbsphase.Nicht alle<strong>in</strong> bei <strong>der</strong> Verwirklichung des Ziels, E<strong>in</strong>kommensarmutzu vermeiden, son<strong>der</strong>n auch darüber h<strong>in</strong>ausreichend,spielt auch die Vorstellung e<strong>in</strong>e Rolle, dass dieE<strong>in</strong>kommensungleichheit ggf. reduziert werden soll(„Umverteilung“).Um allgeme<strong>in</strong> das Gefühl von „Sicherheit“ zu erlangenbzw. zu vermitteln, bedarf es allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>es erheblichenMaßes an Verlässlichkeit von Regeln, ihrer Verständlichkeitund <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schätzbarkeit (Kalkulierbarkeit) <strong>der</strong> vermutlichzu erwartenden Wirkungen von Maßnahmen.Selbst wenn Übere<strong>in</strong>kunft über die grundlegenden Zielvorstellungenbesteht, so kann auf unterschiedlichen Wegen(mit unterschiedlichen Instrumenten) versucht werden,diese zu realisieren. Generell besteht immer e<strong>in</strong>beträchtliches Maß an Unsicherheit über die Wirkungenvon Maßnahmen gerade <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alterssicherung, da es hierum Langfristiges geht, um Jahrzehnte überspannendeProzesse <strong>der</strong> Vorsorge und Absicherung.So geht es <strong>in</strong> <strong>der</strong> aktuellen Diskussion <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e darum,<strong>in</strong>wieweit durch öffentliche E<strong>in</strong>richtungen undMaßnahmen <strong>der</strong> Verstetigungsfunktion Rechnung getragenwerden soll o<strong>der</strong> ob die staatlichen E<strong>in</strong>richtungen primärauf die Armutsvermeidung ausgerichtet werden sollenund die Aufgabe <strong>der</strong> Verstetigung primär <strong>der</strong> privatenVorsorge überlassen bleibt.Darüber h<strong>in</strong>aus bestehen für die Gestaltung <strong>der</strong> staatlichenE<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Alterssicherung (im Zentrumsteht dabei die gesetzliche Rentenversicherung) unterschiedlicheVorstellungen: Soll auch durch sie – und nichtnur bei privater Vorsorge – e<strong>in</strong>e (enge) Beziehung zwischen<strong>in</strong>dividueller Vorleistungen (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Formvon Beitragszahlungen) und späteren Gegenleistungen(<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Rentenzahlungen) realisiert werden o<strong>der</strong>soll das staatliche Alterssicherungssystem vor allem (<strong>in</strong>terpersonelle)Umverteilung realisieren, also vor alleme<strong>in</strong> E<strong>in</strong>kommensausgleich zwischen Personen (Haushalten)unterschiedlich hohen E<strong>in</strong>kommens sowie zwischendem, was <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsphase an Beiträgen aufgebrachtwurde und den Renten im Alter. Hierbei wird häufig dasRegelsystem <strong>der</strong> Alterssicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz – dieAHV – als Leitbild genannt.Es ist offensichtlich, dass unterschiedliche Antworten aufdiese Fragen gegeben werden können. Zur Aufgabe <strong>der</strong>5. Altenberichtskommission gehört zwar nicht, e<strong>in</strong>e Diskussionüber „Rentenreformen“ zu führen. Wohl abers<strong>in</strong>d die Folgen bereits beschlossener Reformmaßnahmenim H<strong>in</strong>blick auf die E<strong>in</strong>kommenslage im Alter zu beurteilenund ggf. – unter Verdeutlichung <strong>der</strong> hierfür als maßgebendherangezogenen Zielvorstellungen und <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schätzung<strong>der</strong> Wirkung von Maßnahmen – Alternativen<strong>zur</strong> Diskussion zu stellen. Im Kern geht es also um dieFrage, welches „E<strong>in</strong>kommens- und E<strong>in</strong>kommensverwendungspotenzial“Älterer <strong>in</strong> Zukunft zu erwarten ist o<strong>der</strong>erreicht werden soll.4.7 HandlungsempfehlungenDie Gefahr ist nicht von <strong>der</strong> Hand zu weisen, dass die gesetzlicheRentenversicherung (GRV) mit ihrer engenLeistungs-Gegenleistungs-Beziehung angesichts des Niveauabbausihre Legitimation zunehmend verlieren und
Drucksache 16/2190 – 148 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodedie Transformation <strong>in</strong> e<strong>in</strong> eher allgeme<strong>in</strong>es Umverteilungssystem(ggf. sogar verknüpft mit Bedürftigkeitsüberprüfung)e<strong>in</strong>treten könnte. Zudem lässt die Beitragsorientierung<strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV vermuten, dass es immer dannzu weiteren E<strong>in</strong>schnitten im Leistungsrecht kommenkönnte, wenn das Beitragsziel verletzt zu werden droht.Des Weiteren ist ebenfalls nicht von <strong>der</strong> Hand zu weisen,dass es angesichts des drastisch verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Leistungsniveaus<strong>der</strong> GRV für die Bürger zu verpflichtenden Formen<strong>der</strong> kapitalfundierten <strong>in</strong>dividuellen o<strong>der</strong> über Betriebe abgewickeltenAlterssicherung kommen wird, also faktischzu e<strong>in</strong>em zweiten obligatorischen System neben <strong>der</strong> GRV.Allerd<strong>in</strong>gs ließen sich damit zum<strong>in</strong>dest Ungleichheiten <strong>in</strong><strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensverteilung auf Grund von selektiver Nutzung<strong>der</strong> privaten Altersvorsorgemöglichkeiten vermeiden.Die Kommission spricht sich demgegenüber für folgendeStrategie im H<strong>in</strong>blick auf die künftige Entwicklung <strong>der</strong>Alterse<strong>in</strong>kommen aus, <strong>der</strong>en zentrale Elemente s<strong>in</strong>d:1 Leistungsniveau <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV: Die gesetzliche Rentenversicherung(GRV) soll bei längerer Versicherungsdauerweiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Leistungsniveau beibehalten, das aberdeutlich über <strong>der</strong> steuerf<strong>in</strong>anzierten bedarfs- o<strong>der</strong> bedürftigkeitsgeprüftenarmutsvermeidenden M<strong>in</strong>destsicherungliegt.2 Enge Beitrags-Leistungs-Beziehung <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRVherstellen: Für die GRV soll e<strong>in</strong>e enge Beitrags-Leistungs-Beziehungerhalten bleiben. Dies soll auch durchdie sachgerechte F<strong>in</strong>anzierung von Umverteilungsaufgaben<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> GRV verdeutlicht werden. Das betrifft<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>em Maße die F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbliebenenversorgung.Der Zahlbetrag <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbliebenenrentenist abhängig von e<strong>in</strong>er im Pr<strong>in</strong>zip alle an<strong>der</strong>enE<strong>in</strong>künfte berücksichtigenden Bedarfsprüfung. Die F<strong>in</strong>anzierunge<strong>in</strong>er solchen bedarfsgerechten Transferzahlungerfor<strong>der</strong>t allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsmittel und nicht dieDeckung durch am Arbeitsverhältnis anknüpfende Sozialversicherungsbeiträge.Durch e<strong>in</strong>e sachadäquate F<strong>in</strong>anzierungwürde die Beitragsbelastung (auch <strong>der</strong> Arbeitgeber)reduziert.3 Erhöhung <strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung Älterer: Für e<strong>in</strong>enTeil <strong>der</strong> Kommission ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhange<strong>in</strong>e Anpassung <strong>der</strong> Regelungen für den Bezug e<strong>in</strong>er abschlagfreienAltersrente im Zuge <strong>der</strong> sich hoffentlich weitererhöhenden Lebenserwartung e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> Möglichkeiten.Sie wäre nach dieser Sicht auch sozial- und verteilungspolitischvertretbar, wenn das Leistungsniveau <strong>der</strong> GRVauf e<strong>in</strong>em von <strong>der</strong> Kommission für erfor<strong>der</strong>lich gehaltenenNiveau verbleibt. An<strong>der</strong>enfalls bestünde die Gefahr,dass primär <strong>zur</strong> Vermeidung von E<strong>in</strong>kommensarmut imAlter e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit weiter nachgegangen werdenmuss. Das Wirksamwerden e<strong>in</strong>er solchen jetzt anzukündigendenVerän<strong>der</strong>ung setzt allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e verän<strong>der</strong>te Arbeitsmarktlagevoraus und erfor<strong>der</strong>t flankierende Maßnahmen.Für e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Teil <strong>der</strong> Kommission bildetdie Anpassung <strong>der</strong> Altersgrenze für den abschlagfreienBezug e<strong>in</strong>er Altersrente <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV unter den gegenwärtigenArbeitsmarktbed<strong>in</strong>gungen und wegen <strong>der</strong> aktuellenbetrieblichen Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen Älterer ke<strong>in</strong>edafür geeignete Maßnahme, da ansonsten weitere sozialeUngleichheiten drohen (siehe hierzu auch die Empfehlungenzum Kapitel Erwerbsarbeit).4 Statt Subventionierung von F<strong>in</strong>anzkapital För<strong>der</strong>ungvon „Humankapital“: Wenn für die wirtschaftlicheEntwicklung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em rohstoffarmen Land wieDeutschland das „Humankapital“ von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutungist, dann liegt es nahe, bei knappen öffentlichenMitteln statt <strong>der</strong> Subventionierung von F<strong>in</strong>anzkapital fürdie Privatvorsorge (verbunden mit erheblichen Mitnahmeeffekten)vermehrt öffentliche Mittel für die Weiterqualifizierunge<strong>in</strong>zusetzen. Weiterqualifizierung ist e<strong>in</strong>wichtiger Faktor für die künftige Entwicklung von Produktivitätund E<strong>in</strong>kommen und damit zugleich für dieMöglichkeit, steigende Vorsorgeaufwendungen zu akzeptierenund zu tragen, bei gleichzeitig noch steigenden laufendenNettoe<strong>in</strong>kommen (siehe Empfehlung zum KapitelBildung).5 Private und betriebliche Alterssicherung als Ergänzungbei <strong>in</strong>sgesamt reduzierter Gesamtbelastung:Insgesamt würde durch diese Maßnahmen kaum e<strong>in</strong> höhererBeitragssatz <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV als jetzt politisch angestrebterfor<strong>der</strong>lich. Um das bisherige Absicherungsniveauim Alter aufrecht zu erhalten, verr<strong>in</strong>gert sich die Notwendigkeitfür private Vorsorge. Private und betriebliche Vorsorgewürden ihre Ergänzungsfunktion behalten und nichtzum (partiellen) Ersatz für die GRV werden. Tendenziellkönnte damit sogar die Gesamtbelastung für die privatenHaushalte bei vergleichbarem Sicherungsniveau niedrigerse<strong>in</strong> als bei <strong>der</strong> jetzt e<strong>in</strong>geschlagenen politischen Strategie,da die Übergangskosten von Umlage- zu Kapitaldeckungger<strong>in</strong>ger würden.6 E<strong>in</strong>bezug aller bislang nicht obligatorisch abgesichertenSelbstständigen <strong>in</strong> die GRV: Ergänzend läge esnahe, alle Selbstständigen, die bislang ke<strong>in</strong>em obligatorischenAlterssicherungssystem angehören, <strong>in</strong> die GRVe<strong>in</strong>zubeziehen. Der Hauptgrund dafür ist nicht <strong>der</strong> (ggf.nur vorübergehende) E<strong>in</strong>fluss auf die F<strong>in</strong>anzlage <strong>der</strong>GRV, son<strong>der</strong>n vielmehr die Vermeidung von E<strong>in</strong>kommensarmutbei dieser Personengruppe, die bisher schonsehr heterogen war und durch neue Formen von Selbstständigkeitnoch heterogener wird.7 Für e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tegrierten Ansatz <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alterssicherungspolitik:E<strong>in</strong>e nachhaltige Alterssicherungspolitikdarf sich aber nicht alle<strong>in</strong> auf die Alterssicherungssysteme(<strong>der</strong>en F<strong>in</strong>anzierung, Leistungen und Besteuerung)beschränken, son<strong>der</strong>n hat auch weitere für die (reale)E<strong>in</strong>kommenslage im Alter wichtige – und politisch gestaltbare– Entwicklungen zu berücksichtigen, wie <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eHöhe und Struktur von Sozialversicherungsleistungenim Falle von Krankheit und Pflegebedürftigkeit,was aus den laufenden Alterse<strong>in</strong>kommen (wegen Zuzahlung,Begrenzungen des Leistungskatalogs u.a.m.) zu f<strong>in</strong>anzierenist. E<strong>in</strong>e <strong>der</strong>artige <strong>in</strong>tegrierte Sicht und Entscheidungsvorbereitungwird von <strong>der</strong> Kommission fürdr<strong>in</strong>gend erfor<strong>der</strong>lich gehalten.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 149 – Drucksache 16/21905 Chancen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Deutschland5.1 ProblemstellungHäufig wird mit <strong>der</strong> Alterung <strong>der</strong> Gesellschaft e<strong>in</strong>Rückgang <strong>der</strong> Innovationskraft, <strong>der</strong> Produktivität undnachlassende Konsumnachfrage nach den Produkten undDienstleistungen, die <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von den jüngeren <strong>Generation</strong>ennachgefragt werden, verbunden. Dabei wir<strong>der</strong>stens übersehen, dass die Innovationskraft und ProduktivitätÄlterer durch lebenslanges Lernen, e<strong>in</strong>e altersgerechteGestaltung <strong>der</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen und e<strong>in</strong>e aktiveGesundheitsför<strong>der</strong>ung erhöht werden kann. Darüberh<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d die Älteren kaufkräftige Konsumenten undkönnen zum<strong>in</strong>dest zum Teil den Konsumausfall Jüngerer<strong>in</strong>folge abnehmen<strong>der</strong> Geburtsjahrgänge ausgleichen.Selbst wenn sich <strong>in</strong> Zukunft die E<strong>in</strong>kommen differenzierenwerden, bleibt die Konsumkraft <strong>der</strong> Älteren hoch.Die Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung wird e<strong>in</strong>e Verschiebung<strong>der</strong> Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen mit sichbr<strong>in</strong>gen. „Branchen, <strong>der</strong>en Leistungen verstärkt von älterenMenschen bzw. von Menschen, die sich auf das Altervorbereiten, gekauft werden, zählen zu den ‚Struktur-Gew<strong>in</strong>nern’.Dazu gehören die Gesundheitsbranche, <strong>der</strong>Bereich Freizeit/Unterhaltung/Kultur, aber auch F<strong>in</strong>anzdienstleistungenim Zusammenhang mit dem Aufbau privaterAltersvorsorge. ‚Strukturneutrale’ Branchen setzenihre Produkte und Dienste an alle Altersgruppen <strong>in</strong> relativgleicher Quantität ab. Allerd<strong>in</strong>gs muss das Angebot qualitativ(Produktgestaltung, Market<strong>in</strong>g, Vertriebswege) andie älteren Abnehmer angepasst werden“ (Deutsche BankResearch 2002: 32).Wenn im Folgenden die „Seniorenwirtschaft“ als eigenständigerTeilbereich behandelt wird, dann s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>efolgende Überlegungen maßgeblich– Bislang haben ältere Menschen mit ihren spezifischenKonsumbedürfnissen <strong>in</strong> wichtigen Marktsegmentenangebotsseitig nicht h<strong>in</strong>reichende Entsprechung gefunden,d.h. private wie öffentliche „Seniorenmärkte“können als nur un<strong>zur</strong>eichend entwickelt gelten. DieKonsequenzen s<strong>in</strong>d vielfältig: Sie reichen vom Verlustan Lebensqualität für viele ältere Menschen über FehlundMehrausgaben <strong>in</strong> den Gesundheits- und Pflegesystemendurch fehlende bzw. un<strong>zur</strong>eichend verfügbareAlternativangebote (z.B. im Bereich <strong>der</strong> häuslichenVersorgung) bis dah<strong>in</strong>, dass „demografiesensible“ Reservoirsfür hierzulande dr<strong>in</strong>gend benötigte neue Arbeitsplätzeunausgeschöpft brachliegen.– In den so genannten „Seniorenmärkten“ liegen z.T. beträchtlicheökonomische Potenziale. Diese betreffenArbeitsplätze wie Absatzmärkte gleichermaßen. Insofernkönnen die Konsumhandlungen Älterer <strong>in</strong> <strong>der</strong> Seniorenwirtschaftselbst auch zu e<strong>in</strong>er Relativierungund Versachlichung <strong>der</strong> These vom demografischenKrisenszenarium beitragen.– Auch ist davon auszugehen, dass künftig viele Bedürfnisse,die bisher <strong>in</strong> sozialen Netzwerken o<strong>der</strong> durchdie öffentliche Hand befriedigt werden konnten, zunehmendüber den Markt befriedigt werden müssen.Speziell im Bereich <strong>der</strong> haushaltsnahen Dienste ist zudemdie öffentliche För<strong>der</strong>ung unterentwickelt bzw. <strong>in</strong>Teilen – <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e seit E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> Pflegeversicherung– sogar rückläufig, sodass sich für privatwirtschaftlichgetragene Initiativen zunehmendMarktchancen eröffnen.– Aber auch wenn es e<strong>in</strong> vorrangiges sozialpolitischesZiel ist, zum Erhalt und <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Lebensqualitätälterer Menschen beizutragen und wenn darunterdas Ausmaß verstanden wird, „<strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>er Personmobilisierbare Ressourcen <strong>zur</strong> Verfügung stehen, mitdenen sie ihre Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> bewusster Weiseund zielgerichtet bee<strong>in</strong>flussen kann“ (BMFSFJ 2002a:65), dann darf e<strong>in</strong>e zunehmend wichtige Ressourcenicht ausgespart bleiben, nämlich die des privatenKonsums. Damit ist für die Kommission zugleich e<strong>in</strong>ezentrale Messlatte für die Beurteilung von privatwirtschaftlichemEngagement im Seniorenmarkt benannt:Dort, wo es begründeter Maßen das Ziel ist, Lebenslageund Lebensqualität im Alter zu erhalten und/o<strong>der</strong>zu verbessern, kann es auch ke<strong>in</strong>e „Berührungsängste“zu privatwirtschaftlich organisiertem Engagement geben.– Die wachsende Thematisierung <strong>der</strong> Rolle älterer Menschenals gewichtige Gruppe von Verbrauchern istdarüber h<strong>in</strong>aus auch Reaktion auf verän<strong>der</strong>te empirischeRealitäten zu Konsumbedürfnissen, -<strong>in</strong>teressenund -verhalten älterer Menschen. Gerontologen gehtes daneben auch um die Korrektur häufig negativ akzentuierterAltersbil<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em relevanten und zunehmendbedeutsamen Teilsegment <strong>der</strong> Gesellschaft,nämlich dem des privaten Konsums.– Wegen <strong>der</strong> erwähnten Heterogenität <strong>in</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenssituationälterer Menschen kann festgestellt werden,dass <strong>der</strong> Bereich <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft auch <strong>in</strong>verbraucherpolitischer H<strong>in</strong>sicht wenig entwickelt ist.Gilt Verbraucherschutz schon auf sozialen Dienstleistungsmärktenwegen ihrer spezifischen F<strong>in</strong>anzierungsbed<strong>in</strong>gungen(„Sozialwirtschaftliches Dreieck“) unde<strong>in</strong>em hohen Anteil an Vertrauens- und Erfahrungsgüternals e<strong>in</strong>e äußerst schwierige Angelegenheit, sotrifft dies ebenfalls und <strong>in</strong> Teilen erst recht auf privateKonsumgüter- und Dienstleistungsmärkte zu. Speziellbei älteren Verbrauchern können nicht die <strong>in</strong> <strong>der</strong> rei-
Drucksache 16/2190 – 150 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodenen marktwirtschaftlichen Theorie vorausgesetztenMerkmale des homo oeconomicus erwartet werden.Im Folgenden wird zunächst die E<strong>in</strong>kommensverwendungim Alter untersucht, um die unterschiedlichenKonsumprofile <strong>der</strong> Gruppen von Älteren und die altersabhängigenAusgabenschwerpunkte zu identifizieren. Aufdieser Basis werden danach die wichtigsten Teilfel<strong>der</strong> <strong>der</strong>Seniorenwirtschaft mit ihren Entwicklungspotenzialenanalysiert. Der japanische Silbermarkt als <strong>in</strong>ternationalwichtiges Beispiel e<strong>in</strong>er entwickelten Seniorenwirtschaftist Thema des Folgeabschnitts. Anschließend werden dieverschiedenen Initiativen des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> <strong>zur</strong>Entwicklung <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft beschrieben. ZumAbschluss werden spezifische Verbraucherprobleme Ältererbehandelt, die von <strong>der</strong> altersgerechten Produktgestaltungbis h<strong>in</strong> zum Schutz <strong>der</strong> Verbraucher reichen.5.2 E<strong>in</strong>kommensverwendung im AlterBei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> privaten E<strong>in</strong>kommensverwendungsstrukturenzeigen sich bei älteren Menschen gegenüberjüngeren Altersgruppen zunächst folgende generelleAbweichungen (Gerl<strong>in</strong>g, Naegele & Scharfenorth 2004):– Vergleichsweise hohe Ausgabenanteile entfallen beiälteren Menschen auf die Bereiche Wohnen, Energieund Wohnungs<strong>in</strong>standhaltung. Hier spiegelt sich u.a.die Weiternutzung großer und kostspieliger Wohnungenbei gleichzeitiger Reduktion <strong>der</strong> Haushaltsgrößenund -e<strong>in</strong>kommen wi<strong>der</strong>.– Demgegenüber gibt es wegen <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geren Mobilitätnach Beendigung <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit rückläufigeAusgabenanteile für Verkehr und Mobilität.– Mit dem Lebensalter steigen die Ausgabenanteile fürGüter <strong>der</strong> Gesundheitspflege kont<strong>in</strong>uierlich.– Bei den Ausgaben für Körperpflege dom<strong>in</strong>ieren beiÄlteren solche für gesundheitsbezogene Dienstleistungen,während bei den Jüngeren solche für Produktedom<strong>in</strong>ieren.– Mit dem Alter wachsen die Ausgabeanteile für Pauschalreisen.Für e<strong>in</strong>e differenziertere Betrachtung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensverwendungälterer Menschen stehen die E<strong>in</strong>kommensundVerbrauchsstichproben (EVS) des Statistischen Bundesamtes<strong>zur</strong> Verfügung. Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erstellungdieses <strong>Bericht</strong>s konnte allerd<strong>in</strong>gs noch nicht auf die Daten<strong>der</strong> EVS 2003 <strong>zur</strong>ückgegriffen werden, sodass weitgehendmit den Informationen für das Jahr 1998 argumentiertwird.5.2.1 Gesamtausgaben älterer Haushalte– auch im Vergleich zu Haushalten <strong>in</strong><strong>der</strong> Spätphase des Erwerbslebens –die Situation des Jahres 1998H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Gesamtausgaben älterer Menschen zeigtdie EVS 1998 e<strong>in</strong> mit dem Alter rückläufiges Ausgabenprofil,d.h. die absoluten Ausgaben s<strong>in</strong>d ab etwa dem50. Lebensjahr umso niedriger, je höher das Alter <strong>der</strong> Bezugspersondes Haushalts ist. Bei den Haushalten mit e<strong>in</strong>er85 Jahre o<strong>der</strong> älteren Bezugsperson betragen die Ausgabenannähernd nur rund zwei Drittel <strong>der</strong>jenigenHaushalte mit e<strong>in</strong>er Bezugsperson im Alter von 50 bis54 Jahren. Ausgehend von <strong>der</strong> jüngsten Altersgruppes<strong>in</strong>kt die Konsumquote, also das Verhältnis von Ausgabenzu E<strong>in</strong>nahmen, sukzessive bis <strong>zur</strong> Altersgruppe50 bis 54. Danach steigt sie wie<strong>der</strong> bis <strong>zur</strong> Gruppe <strong>der</strong>65- bis 69-Jährigen, um anschließend kont<strong>in</strong>uierlich zus<strong>in</strong>ken. Bemerkenswert ist, dass die Haushalte mit den ältestenBezugspersonen, die über die ger<strong>in</strong>gsten ausgabefähigenE<strong>in</strong>kommen und E<strong>in</strong>nahmen verfügen, sehr niedrigeKonsumquoten aufweisen.Differenziert man die Haushalte nach weiteren soziodemografischenKriterien, so zeigen sich folgende systematischeUnterschiede:– die Konsumquoten von E<strong>in</strong>personenhaushalten s<strong>in</strong>dgrundsätzlich höher als die <strong>der</strong> Zweipersonenhaushalte;– die Konsumquoten <strong>in</strong> Westdeutschland s<strong>in</strong>d niedrigerals <strong>in</strong> Ostdeutschland;– die Konsumquoten <strong>der</strong> Haushalte mit e<strong>in</strong>er männlichenBezugsperson s<strong>in</strong>d niedriger als die von denenmit e<strong>in</strong>er weiblichen Bezugsperson.E<strong>in</strong> wellenförmiges Profil – mit höheren Konsumquotenbei den jüngeren Haushalten, niedrigen Konsumquotenbei den Haushalten mit Haushaltsvorständen zwischen40 und 50 Jahren, hohen Konsumquoten bei den 60- bis70-Jährigen und dann wie<strong>der</strong> <strong>zur</strong>ückgehenden Konsumquotenbei den älteren Haushalten – liegt <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>ebei den weiblichen E<strong>in</strong>personenhaushalten und bei denZweipersonenhaushalten mit e<strong>in</strong>er männlichen Bezugspersonvor.Unterteilt man die E<strong>in</strong>- und Zweipersonenhaushalte nachdem Geschlecht, so wird deutlich, dass sich die Strukturen,die auf <strong>der</strong> Aggregatsebene <strong>der</strong> E<strong>in</strong>- und Zweipersonenhaushaltezu beobachten s<strong>in</strong>d, auch bei <strong>der</strong> tieferenGlie<strong>der</strong>ung nach dem Geschlecht wie<strong>der</strong> f<strong>in</strong>den. Fernerist unabhängig von <strong>der</strong> Haushaltsgröße Folgendes zukonstatieren:– Die durchschnittlichen Ausgaben für den privaten Verbrauchbei Haushalten mit e<strong>in</strong>er Frau als Bezugspersons<strong>in</strong>d grundsätzlich niedriger als bei den Haushaltenmit e<strong>in</strong>er männlichen Bezugsperson.– In Westdeutschland s<strong>in</strong>d die durchschnittlichen Ausgabenhöher als <strong>in</strong> Ostdeutschland.– In den Alterskategorien ab 65 bis 69 Jahre geben dieHaushalte weniger aus als die Haushalte, <strong>der</strong>en Bezugsperson<strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsphase steht.Als letztes Unterscheidungskriterium wurde die E<strong>in</strong>kommenshöheverwendet. Es wurden drei Gruppen unterschieden:Haushalte mit e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>kommen unter 50 Prozent,zwischen 95 und 105 und über 150 Prozent desDurchschnittse<strong>in</strong>kommens. Dabei lässt sich konstatie-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 151 – Drucksache 16/2190ren, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> jeweils niedrigeren E<strong>in</strong>kommensschichtim Durchschnitt auch ger<strong>in</strong>gere Ausgaben für den privatenVerbrauch getätigt werden. Dies könnte darauf h<strong>in</strong>weisen,dass e<strong>in</strong>e zunehmende E<strong>in</strong>kommensdifferenzierungbei den Älteren <strong>der</strong>en Konsumkraft bee<strong>in</strong>trächtigenkönnte.5.2.2 Ausgaben für wichtige GütergruppenBetrachtet man die Ausgaben älterer Menschen (ab65 Jahre), die auf die e<strong>in</strong>zelnen Gütergruppen entfallen,so dom<strong>in</strong>ieren nach <strong>der</strong> EVS 1998 <strong>in</strong> absoluten Beträgengemessen vier Ausgabenkategorien:– Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren;– Wohnen, Wohnungs<strong>in</strong>standsetzung;– Freizeit, Unterhaltung und Kultur sowie– Verkehr.Allerd<strong>in</strong>gs gilt dies für die letztgenannte Gütergruppe nur<strong>in</strong> den Altersgruppen bis 69 Jahre.Auch bei <strong>der</strong> Differenzierung nach <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenshöhebleibt im Pr<strong>in</strong>zip die Dom<strong>in</strong>anz <strong>der</strong> vier Gütergruppen erhalten.Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die relativen Ausgaben für die GütergruppenWohnung, Wohnungs<strong>in</strong>standsetzung sowie fürNahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren <strong>in</strong> den höherenE<strong>in</strong>kommensschichten deutlich ger<strong>in</strong>ger als bei den unterenE<strong>in</strong>kommensschichten. Weiterh<strong>in</strong> wenden die unterstenE<strong>in</strong>kommenskategorien weniger für die Gesundheitspflege,Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungensowie für an<strong>der</strong>e Waren und Dienstleistungen auf, während<strong>in</strong> <strong>der</strong> obersten E<strong>in</strong>kommenskategorie die Anteilswertefür Gesundheitspflege annähernd so hoch wie fürWohnung und Wohnungs<strong>in</strong>standsetzung s<strong>in</strong>d.5.2.3 ErsparnisbildungH<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Ersparnisbildung älterer Menschen zeigtdie EVS, dass die E<strong>in</strong>- und Zweipersonenhaushalte auch<strong>in</strong> <strong>der</strong> Ersparnis die gleichen Verhaltensweisen zeigen(Tabelle 20). So s<strong>in</strong>d die Absolutbeträge <strong>der</strong> Ersparnis <strong>in</strong>Westdeutschland höher als <strong>in</strong> Ostdeutschland und bei denHaushalten mit e<strong>in</strong>er männlichen Bezugsperson höher alsbei denen mit e<strong>in</strong>er weiblichen Bezugsperson. Es sei betont,dass im Durchschnitt <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Alterskategorie e<strong>in</strong>eVermögensauflösung stattf<strong>in</strong>det.In den jüngeren Altersklassen s<strong>in</strong>d nicht nur die Absolutbeträgehöher, son<strong>der</strong>n auch die Sparquoten: Sie s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>Spiegelbild <strong>der</strong> Konsumquoten. Haushalte mit e<strong>in</strong>er Bezugspersonim erwerbsfähigen Alter, die im Durchschnittüber e<strong>in</strong>e höhere Sparfähigkeit verfügen, weisen auche<strong>in</strong>e höhere Sparbereitschaft auf.Grundsätzlich zeigt sich e<strong>in</strong>e beträchtliche Heterogenitätsowohl zwischen als auch <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> soziodemografischenGruppen.AlterSparquoten <strong>in</strong> Prozent, 1998Tabelle 20Quelle: Fach<strong>in</strong>ger 2004, Datenbasis: Grundfile <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommens- undVerbrauchsstichprobe 1998.5.2.4 Erste FolgerungenFür die E<strong>in</strong>kommensverwendung <strong>der</strong> Haushalte <strong>in</strong>sgesamtsowie für die Verwendung für bestimmte Ausgabenzweckeist auch von Bedeutung, welche Arbeiten Ältereselbst ausführen, die nicht monetär vergütet werden undnicht <strong>in</strong> die Berechnung des Sozialprodukts bzw. E<strong>in</strong>kommense<strong>in</strong>gehen (z.B. <strong>in</strong> Form von K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungo<strong>der</strong> Versorgung von Familienangehörigen im Krankheits-o<strong>der</strong> Pflegefall). So wird <strong>der</strong>zeit rund e<strong>in</strong> Drittel allerPflegebedürftigen vom (Ehe-)Partner gepflegt. In <strong>der</strong>Regel s<strong>in</strong>d es ältere Menschen, die solche Pflegeleistun-E<strong>in</strong>personenhaushalteZweipersonenhaushalte30 bis 34 13,7 16,535 bis 39 14,3 17,740 bis 44 16,5 16,045 bis 49 13,4 17,150 bis 54 14,2 15,155 bis 59 7,8 13,160 bis 64 5,8 8,165 bis 69 0,4 1,370 bis 74 5,2 5,875 bis 79 10,9 8,380 bis 84 10,1 6,885 und älter 5,9 15,2Die zunehmende Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung wird zu e<strong>in</strong>emsteigenden Anteil Älterer an <strong>der</strong> gesamten E<strong>in</strong>kommensverwendungführen, vor allem auch zu ansteigendenAusgaben für (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e personennahe) Dienstleistungen.In diesem Zusammenhang wird speziell <strong>der</strong> Gesundheitsbereichnicht nur als e<strong>in</strong> Kostenfaktor, son<strong>der</strong>n auchals e<strong>in</strong>e beschäftigungs<strong>in</strong>tensive Zukunftsbranche angesehen.Bereits heute s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesundheitswirtschaftrund 14 Prozent <strong>der</strong> Erwerbstätigen beschäftigt. Wie sichallerd<strong>in</strong>gs die Gesamtnachfrage Älterer nach Gesundheitsleistungenabsolut und relativ entwickeln wird, hängtu.a. maßgeblich auch davon ab, <strong>in</strong> welchem Umfang z.B.bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit zusätzliche Ausgabenprivat getragen werden müssen – z.B. <strong>in</strong> Form vonZuzahlungen o<strong>der</strong> <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierung nicht mehr im Leistungskatalog<strong>der</strong> Kranken- o<strong>der</strong> Pflegeversicherung enthaltenerLeistungen o<strong>der</strong> <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>es gesenkten Leistungsniveaus.
Drucksache 16/2190 – 152 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodegen erbr<strong>in</strong>gen (vgl. hierzu auch das Kapitel Potenzialedes Alters <strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken).Das Statistische Bundesamt hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeitverwendungserhebungfür 2001 e<strong>in</strong> Jahresvolumen von <strong>in</strong>sgesamt96 Mrd. Stunden an unbezahlter Arbeit (Haus- undGartenarbeit, handwerkliche Tätigkeiten, E<strong>in</strong>kaufen,Haushaltsplanung, Pflege und Betreuung, Ehrenamt/Hilfen)ermittelt. . Von diesem unbezahlten Arbeitsvolumenerbr<strong>in</strong>gen Menschen im Alter über 65 Jahre 24 Prozent.Bewertet man dieses – wie es das Bundesamt tut – mit e<strong>in</strong>emNettolohnsatz von 7 Euro pro Stunde, so ergibt sichfür 2001 e<strong>in</strong>e Summe von 160 Mrd. Euro – was bezogenauf die Summe <strong>der</strong> Nettolöhne und -gehälter gut 27 Prozentausmacht. Diese weith<strong>in</strong> unbeachteten Aktivitätenersparen aber Ausgaben, und zwar zunächst eigene Ausgaben,aber auch <strong>in</strong> erheblichem Maße Ausgaben vonJüngeren. O<strong>der</strong> es werden dadurch sonst ggf. erfor<strong>der</strong>licheöffentliche Ausgaben reduziert, so im Falle vonHilfs- und Pflegebedürftigkeit.Während angesichts <strong>der</strong> Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung <strong>der</strong>Bedarf an Hilfs- und Pflegediensten – und generell anpersonengebundenen Dienstleistungen – steigen wird, istlängerfristig mit e<strong>in</strong>em S<strong>in</strong>ken des Potenzials <strong>der</strong> durchFamilien erbrachten Hilfe zu rechnen. Daraus folgt, dass<strong>in</strong> Zukunft <strong>der</strong> Bedarf an nicht-familiären Hilfs- und Pflegedienstensteigen wird, auch an professioneller Hilfe. Jemehr das Leistungsniveau öffentlicher E<strong>in</strong>richtungens<strong>in</strong>kt, umso stärker werden Ältere ihr E<strong>in</strong>kommen alsF<strong>in</strong>anzierungsquelle für private Ausgaben e<strong>in</strong>zusetzenhaben.5.3 Entwicklungsstand <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft<strong>in</strong> DeutschlandIdee und Konzept e<strong>in</strong>er eigenständigen „Seniorenwirtschaft“s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik noch vergleichsweisejung. Zwar hat es bereits <strong>in</strong> den 1970er-Jahren erste zaghafteVersuche gegeben, den bereits damals so benannten„Seniorenmarkt“ systematisch <strong>in</strong> den Blick zu nehmenund auch wissenschaftlich zu erkunden. Rückwirkend betrachtetgilt jedoch, dass entsprechende Bemühungen defacto erfolglos geblieben s<strong>in</strong>d; u.a. wegen des zu ger<strong>in</strong>genInteresses <strong>der</strong> Wirtschaft sowie am fehlenden ökonomischenPotenzial <strong>der</strong> Älteren zu dieser Zeit.H<strong>in</strong>zu kam, dass sich damals die älteren Menschen nichtals Gruppe älterer Verbraucher dargestellt haben, die sieals eigenständige, klar von an<strong>der</strong>en Altersgruppen abgrenzbareKonsumentengruppe mit genu<strong>in</strong> altenspezifischenKonsumwünschen und -bedürfnissen identifizierbarund von daher auch für die Wirtschaft <strong>in</strong>teressantgemacht hätte. Infolgedessen gab es hierzulande langeZeit auch ke<strong>in</strong>e, explizit auf das Alter bezogene Konsumforschung,wie <strong>in</strong> den USA.Demgegenüber war es hierzulande lange Zeit üblich, ältereMenschen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie als „Nutzer“ vor allem vonöffentlichen Gütern im Bereich sozialer Dienstleistungenzu sehen; dabei aber nicht primär <strong>in</strong> ihrer Rolle als handelnde,das Angebot lenkende Wirtschaftssubjekte, son<strong>der</strong>nganz e<strong>in</strong>deutig als Objekt sozialer Dienstleistungsproduktion.Diese Sichtweise ist im Grunde auch heutenoch sehr weit verbreitet: Ältere Menschen gelten vielfachnoch immer als „Klienten“, nicht selten – zum<strong>in</strong>dest,was die sehr alten Menschen betrifft – als „dankbare Nehmer“von zumeist kostenfrei <strong>zur</strong> Verfügung gestellten sozialenDiensten. Auch wenn man heute im Bereich <strong>der</strong>sozialen Dienste Bemühungen erkennen kann, dieselange Zeit vorherrschende Sicht vom älteren Menschenals Klient und Objekt öffentlicher Fürsorge zu revidieren,ist auffällig, dass vor allem immer noch vielen Praktikern<strong>der</strong> Paradigmenwechsel weg von <strong>der</strong> Rolle des abhängigenKlienten sozialer Dienste und h<strong>in</strong> <strong>zur</strong> unabhängigenund eigenständigen Verbraucherrolle auf öffentlichenKonsumgütermärkten schwer fällt.Gilt somit die Verbraucherrolle älterer Menschen schonauf öffentlichen Konsumgüter- und Dienstleistungsmärktenlange Zeit wissenschaftlich wie praktisch als unterbelichtet,so trifft dies erst Recht auf ihre Rolle auf privatenKonsumgüter- und Dienstleistungsmärkten zu. Dennochlässt sich seit Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> 1980er-Jahre so etwas wie e<strong>in</strong>elangsame Entdeckung des „Seniorenmarktes“ erkennen,was sich u.a. am Beispiel <strong>der</strong> kommerziellen Werbungverdeutlichen lässt. Waren <strong>in</strong> den 1970er- und frühen1980er-Jahren ältere Menschen vor allem Objekt vonpharmazeutisch ausgerichteten Werbebotschaften, so hatsich seither das Bild zunehmend gewandelt. Heute f<strong>in</strong>detman sie als Werbeträger für zahlreiche Konsumgüter- undDienstleistungsangebote jenseits von Pharmazeutika, Geriatrika,Pflegehilfsmittel und <strong>der</strong>gleichen. Auch werbenältere Menschen ke<strong>in</strong>eswegs nur für altersspezifischeProdukte und Dienstleistungen, son<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d zunehmendauch als Zielgruppe für eigenständige, nicht-geriatrikagebundene,speziell auf sie abgestellte Werbebotschaften<strong>in</strong> den Medien vertreten.Der Bereich <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft ist nicht exakt abgegrenzt.Klare Def<strong>in</strong>itionen gibt es nicht. Ganz allgeme<strong>in</strong>werden aber dazu die folgenden Segmente gezählt:– Gerontologisch relevante Bereiche <strong>der</strong> Gesundheitswirtschaft;– Innovatives Wohnen, Wohnraumanpassungen undwohnbegleitende Dienste;– För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> selbstständigen Lebensführung;– Bildung und Kultur;– IT & Medien;– Freizeit, Reisen, Kultur, Kommunikation und Unterhaltung;– Fitness & Wellness für Ältere;– Kleidung und Mode;– Alltagserleichternde Produkte und Dienste;– So genannte „Anti-Age<strong>in</strong>g-Produkte“;– Demografiesensible F<strong>in</strong>anzdienstleistungen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 153 – Drucksache 16/21905.3.1 Ausgewählte Gestaltungsfel<strong>der</strong><strong>der</strong> SeniorenwirtschaftIm Folgenden sollen exemplarisch die Fel<strong>der</strong> Wohnen,haushaltsnahe Dienste, Mobilität, Seniorentourismus,Neue Medien und Telekommunikation, F<strong>in</strong>anzdienstleistungenund die Gesundheitswirtschaft behandelt werden.Sie gelten nicht nur wegen ihrer möglichen Beschäftigungseffekteals ökonomisch vielversprechend, son<strong>der</strong>n<strong>in</strong> ihnen liegt auch e<strong>in</strong> beträchtliches Potenzial <strong>zur</strong> Verbesserungvon Lebensqualität und Lebenslagen im Alter.5.3.1.1 WohnenDer Wunsch, <strong>in</strong> den „eigenen vier Wänden“ alt zu werdenwar vor 20 Jahren so stark wie heute und <strong>der</strong> „Wohnalltag“spielte sich damals wie heute <strong>in</strong> quantitativer H<strong>in</strong>sichtvor allem im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> traditionellen Form des privatenWohnens ab. Doch s<strong>in</strong>d mittlerweile relativgravierende Verän<strong>der</strong>ungen zu konstatieren: den älterenMenschen steht heute e<strong>in</strong>e Vielzahl von Optionen gegenüber,um ihr Leben <strong>in</strong> traditionellen Wohnformen abzusichern,aber es existiert auch e<strong>in</strong>e Fülle von „neuen“Wohnalternativen.Die selbstständigkeitserhaltende bzw. -för<strong>der</strong>nde Gestaltung<strong>der</strong> Wohnung gilt <strong>in</strong> Expertenkreisen als zentralesMerkmal von Wohnqualität. E<strong>in</strong>e adäquat gestaltete Wohnungkann – im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es präventiven Technik- undDienstleistungse<strong>in</strong>satzes – dazu beitragen, Hilfe- undPflegebedürftigkeit zu vermeiden o<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest aufzuschieben.Mögliche Ansatzpunkte für e<strong>in</strong>e seniorenorientierteGestaltung bieten nicht nur Geräte, E<strong>in</strong>richtungsgegenständeund Installationen selbst, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong>enAnordnung im Innenbereich über die Gesamtarchitektur<strong>der</strong> Wohnung bis h<strong>in</strong> <strong>zur</strong> Wohnumfeldgestaltung.Die altengerechte Umgestaltung <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Wohnungeröffnet <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dem Handwerk neue Betätigungsfel<strong>der</strong>.Die Gestaltungsmöglichkeiten s<strong>in</strong>d außerordentlichgroß: Barrieren können aus dem Wege geräumt,Stolperfallen und Ausrutschmöglichkeiten beseitigt, dieBä<strong>der</strong> breiter und schwellenarm gestaltet und mit zusätzlichenHaltegriffen und Stützmöglichkeiten versehenwerden. Rollläden werden per Knopfdruck bedient undWege werden durch Fernbedienung e<strong>in</strong>gespart. IntelligenteHaustechnik erleichtert nicht nur die Alltagsorganisation,sie verm<strong>in</strong><strong>der</strong>t darüber h<strong>in</strong>aus auch Risiken, diez.B. durch den Umgang mit elektrischen Geräten entstehen.Die mo<strong>der</strong>ne Computertechnologie ermöglicht sogar„<strong>in</strong>telligente Häuser“, <strong>in</strong> denen nicht nur e<strong>in</strong> Großteil <strong>der</strong>Wohnungssteuerung (Licht, Klima, Sicherheit) automatischerfolgt, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> denen auch Unterstützungsleistungenfür ältere und bee<strong>in</strong>trächtigte Bewohner gebotenwerden, z.B. akustische Signale für Bl<strong>in</strong>de und optischeOrientierungsmöglichkeiten für Hörbee<strong>in</strong>trächtigte, Gedächtnishilfeno<strong>der</strong> Sicherheitstechnik.Technisch ist bei <strong>der</strong> altenorientierten Mo<strong>der</strong>nisierungvon Wohnungen sehr viel möglich. Bislang jedoch ist esden anbietenden Branchen noch nicht gelungen, auf breiterBasis den Zugang zu den Kunden zu f<strong>in</strong>den. Dies liegtke<strong>in</strong>eswegs daran, dass die potenziellen Kunden denAngeboten grundsätzlich reserviert gegenüberstehen,son<strong>der</strong>n daran, dass sich die Wirtschaft schwer tut, dievorhandenen Chancen tatsächlich aufzugreifen. Viele Unternehmenaus dem Handwerk wissen we<strong>der</strong>, welchetechnischen Möglichkeiten bestehen, noch verfügen sieüber das notwendige Wissen über die Bedarfe ältererMenschen und über das Market<strong>in</strong>g-Know-How, um Kundenfür solche Angebote zu <strong>in</strong>teressieren. Mit Blick aufdie neuen Chancen, die die Informations- und Kommunikationstechnologienbieten, ist darüber h<strong>in</strong>aus zu bemerken,dass bei den <strong>zur</strong>zeit laufenden Entwicklungs- undErprobungsarbeiten vor allem das technisch Machbare imVor<strong>der</strong>grund steht und <strong>der</strong> Abgleich mit dem, was ältereMenschen wünschen und was ihren Alltag zu vertretbarenKosten schnell und nachhaltig erleichtert, zu kurz kommt.Auch im Bereich <strong>der</strong> stationären Pflege wird über neueKonzepte und Organisationsformen nachgedacht, z.B.über Wohnformen, die e<strong>in</strong>e umfassende Hilfe anbietenund trotz hohen Hilfebedarfs <strong>der</strong> Bewohner auf Selbstbestimmungsetzen. Der Bedarf an diesen Angeboten wirdweiter wachsen, wobei sich „mo<strong>der</strong>ne“ Altenheime heutemehr und mehr nach den Pr<strong>in</strong>zipien ausrichten, die dasKuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Hausgeme<strong>in</strong>schaftskonzeptentwickelt hat. Danach besteht dasPflegeheim selbst aus Geme<strong>in</strong>schaften, <strong>in</strong> denen rundacht Personen <strong>in</strong> Wohngruppen zusammenleben und dabeiunterstützt werden, ihren Alltag selbst zu gestaltenund zu organisieren.Die Initiierung und Unterstützung von neuen Wohnformenim Alter (Wohn-, Haus- o<strong>der</strong> Nachbarschaftsgeme<strong>in</strong>schaften),die nur bestimmte gezielte Unterstützungsmaßnahmenanbieten, könnte e<strong>in</strong> Nischenmarkt für <strong>in</strong>novativeDienstleister werden. Solche Wohnformen spielen bislangauf dem Wohnungsmarkt nur e<strong>in</strong>e untergeordnete Rolle,werden aber dennoch von e<strong>in</strong>er wachsenden Zahl ältererMenschen als attraktiv angesehen. Dabei zeigen nicht nurdie Älteren zunehmendes Interesse an geme<strong>in</strong>schaftlichenWohnformen. Auch jüngere Menschen öffnen sich verstärktneuen Lebensformen geme<strong>in</strong>schaftlichen und <strong>in</strong>tergenerativenWohnens. Im Vor<strong>der</strong>grund dieser Wohnoptionenstehen neue Formen von Selbstständigkeit undGeme<strong>in</strong>schaft.Die Betreuung älterer Menschen <strong>in</strong> ihren privaten Wohnungeneröffnet <strong>der</strong> Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,aber auch vielen Dienstleistungsunternehmen,neue Chancen. Allgeme<strong>in</strong> gew<strong>in</strong>nen mit zunehmendemAlter – und vor allem bei e<strong>in</strong>tretenden gesundheitlichenE<strong>in</strong>schränkungen – wohnungsnahe Dienstleistungen undsolche des Alltagsmanagements an Bedeutung. Zu denwohnungsnahen Dienstleistungen gehören vor allem solcheDienste, die <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung des selbstständigen Wohnensdienen. Bezogen auf das Alltagsmanagement stehenDienstleistungen im Vor<strong>der</strong>grund, die bei <strong>der</strong> häuslichenGrundversorgung helfen. E<strong>in</strong> flächendeckendes Angebotan haushaltsnahen Dienstleistungen kann wesentlich zumVerbleib <strong>in</strong> <strong>der</strong> eigenen Wohnung bzw. <strong>zur</strong> selbstständigenLebensführung beitragen.Diese Form des privat organisierten „Service-Wohnens“kann e<strong>in</strong>e Palette von Dienstleistungen be<strong>in</strong>halten, die
Drucksache 16/2190 – 154 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodevom Notruftelefon über Re<strong>in</strong>igungs-, E<strong>in</strong>kaufs- undHaushaltsdienste bis h<strong>in</strong> zu Kommunikations- und Unterhaltungsangebotenund leichten gesundheitsbezogenenDiensten reichen. In den letzten Jahren wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wohnungswirtschaftzunehmend Interesse an solchen Dienstenverzeichnet.Letztlich entscheidet über die Marktfähigkeit solcherDienstleistungen die Zahlungsbereitschaft <strong>der</strong> potenziellenNutzer. Laut Hochrechnung <strong>der</strong> Gesellschaft für Konsumforschung(2002) ergibt sich für haushaltsnahe undpflegerische Dienstleistungen e<strong>in</strong> hohes Potenzial vonrund 26 Mrd. Euro pro Jahr, die die 50- bis 79-Jährigen<strong>in</strong>sgesamt bereit s<strong>in</strong>d, für haushalts- und personenbezogeneDienstleistungen auszugeben. Selbst wenn <strong>der</strong> sozio-demografischeWandel auf gute Aussichten <strong>in</strong> dieserBranche h<strong>in</strong>deutet, so ist die Schaffung sozialversicherungspflichtigerArbeitsplätze im Bereich haushaltsbezogenerDienstleistungen noch mit e<strong>in</strong>er Fülle ungelösterProbleme, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Konkurrenz zum Schwarzmarkt,verbunden. Die allgeme<strong>in</strong>e Zahlungsbereitschaftbedeutet also noch lange nicht, dass diese Dienstleistungenreal nachgefragt werden.Was die Motive für e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme <strong>der</strong> haushaltsnahenDienstleistungen betrifft, können pr<strong>in</strong>zipiell zweiverschiedene Gruppen ausgemacht werden: e<strong>in</strong>mal <strong>der</strong>Bedarf auf Grund von Zeitmangel und zweitens <strong>der</strong> Bedarfauf Grund mangeln<strong>der</strong> Fähigkeiten, diese Arbeitenselbst auszuführen. Der Bedarf älterer Menschen kannsich auf e<strong>in</strong>e Entlastung bezogen auf die Pflege- undHilfsleistungen selbst, als auch auf Entlastung bei sonstigenArbeiten beziehen, um mehr Zeit und Kraft für dieVersorgung von Angehörigen zu haben. Mit zunehmendemAlter und/o<strong>der</strong> mit altersbed<strong>in</strong>gten Bee<strong>in</strong>trächtigungengew<strong>in</strong>nt jedoch die zweite zentrale Ursache für e<strong>in</strong>enBedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen an Bedeutung:die mangelnde Fähigkeit, diese Arbeiten selbst auszuführen.Betrifft dies zunächst vielleicht nur beson<strong>der</strong>e,gelegentlich anfallende Arbeiten wie das Waschen undAufhängen von Gard<strong>in</strong>en o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e körperlich beson<strong>der</strong>sanstrengende Tätigkeiten, so kann sich Unterstützungsbedarfzunehmend auch auf alltägliche Verrichtungenwie E<strong>in</strong>käufe, das tägliche Kochen bis h<strong>in</strong> zupflegerischen Dienstleistungen erstrecken.Professionelle Dienstleistungsagenturen können vor diesemH<strong>in</strong>tergrund zunehmend an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen.Auf Seiten <strong>der</strong> Beschäftigten ist damit i.d.R. die Zielsetzungverknüpft, die stundenweisen E<strong>in</strong>sätze <strong>in</strong> Privathaushaltenzu regulären sozialversicherungspflichtigenArbeitsverhältnissen zu bündeln, betriebliche Strukturenzu schaffen und bei Bedarf ergänzende Qualifizierung anzubieten.An<strong>der</strong>s als im Schwarzmarkt haben die Beschäftigtendamit Anspruch auf bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlungim Krankheitsfall, Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegenzum Erfahrungsaustausch und e<strong>in</strong> Management, das sichum die Kundengew<strong>in</strong>nung, Organisation und Abwicklung<strong>der</strong> E<strong>in</strong>sätze und um sämtliche Abrechnungsfragenkümmert. Den Privathaushalten bietet dieser Ansatz denVorteil, dass sie sich we<strong>der</strong> um die Rekrutierung, Auswahlund Anleitung <strong>der</strong> Haushaltshilfen noch um Anmeldung,Abrechnung und Ähnliches kümmern müssen. BeiUrlaub o<strong>der</strong> Krankheit <strong>der</strong> angestammten Hilfe wird Ersatzgestellt und die Agentur bürgt für Qualität und bietetVersicherungsschutz bei Schäden.Wenig überraschend ist die Tatsache, dass die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeite<strong>in</strong>er regelmäßigen Inanspruchnahme vonHaushaltshilfen stark abhängig von <strong>der</strong> jeweiligen E<strong>in</strong>kommenssituationist. Je höher das verfügbare monatlicheNettoe<strong>in</strong>kommen, desto größer ist <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>Haushalte, <strong>der</strong> (regelmäßig) e<strong>in</strong>e Haushaltshilfe <strong>in</strong> Anspruchnimmt. E<strong>in</strong> weiteres Kriterium dafür ist die Haushaltsgröße.Ungelöst ist weiterh<strong>in</strong> das Problem <strong>der</strong> Zugänglichkeit zuhaushaltsnahen Dienstleistungen für e<strong>in</strong>kommensschwacheGruppen, <strong>der</strong>en eigenes E<strong>in</strong>kommen nicht ausreicht,um notwendige Unterstützungsleistungen zu Marktpreisene<strong>in</strong>zukaufen. Die früheren För<strong>der</strong>maßnahmen haushaltsnaherDienstleistungen standen traditionell unterdem Vorwurf, vorrangig diejenigen zu begünstigen, diesich diese Dienstleistungen leisten können (Stichwort„Dienstmädchenprivileg“). Die Pflegeversicherung hatzweifellos zu Verbesserungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Versorgung geführt,aber nur für diejenigen, die bereits erhebliche gesundheitlicheE<strong>in</strong>schränkungen aufweisen. Es gibt aber e<strong>in</strong>e großeund unzweifelhaft wachsende Gruppe von Älteren, dienoch ke<strong>in</strong>e Leistungen <strong>der</strong> Pflegekassen erhalten, abergleichwohl Unterstützung benötigen.Politik sollte im Wesentlichen auf drei Ebenen för<strong>der</strong>ndauf den Bereich <strong>der</strong> haushaltsnahen Dienstleistungen E<strong>in</strong>flussnehmen:– durch Unterstützung <strong>der</strong> Privatwirtschaft bei <strong>der</strong> Entwicklunge<strong>in</strong>es breiteren, qualitativ hochwertigen undbedarfsgerechten Dienstleistungsangebots für Ältere,– durch f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung <strong>der</strong> Nachfrage nachhaushaltsnahen Dienstleistungen (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auchvon e<strong>in</strong>kommensschwachen Senior<strong>in</strong>nen und Senioren),– durch die künftige Gestaltung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungenim Pflegebereich (z.B. För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> hauswirtschaftlichenVersorgung).5.3.1.2 MobilitätAngebote <strong>zur</strong> Mobilitätsför<strong>der</strong>ung bee<strong>in</strong>flussen die Lebensqualität<strong>der</strong> älteren Menschen <strong>in</strong> ganz maßgeblicherWeise. Mobilität gilt als e<strong>in</strong>e entscheidende Grundvoraussetzungfür die Selbstständigkeit und die gesellschaftlichePartizipation älterer Menschen und gewährleistet somite<strong>in</strong> flexibles und eigenständiges Leben. Mobilitätse<strong>in</strong>bußengehen immer mit e<strong>in</strong>em Verlust an Lebensqualitäte<strong>in</strong>her. Mit dem Trend <strong>zur</strong> S<strong>in</strong>gularisierung gew<strong>in</strong>nt <strong>der</strong>Themenkomplex <strong>in</strong> Bezug auf gesellschaftliche Teilnahmenoch an Bedeutung.Im Wesentlichen ist die Mobilität <strong>der</strong> älteren Menschendurch zwei Faktoren geprägt: Zum e<strong>in</strong>en nimmt die <strong>in</strong>dividuellekörperliche Verfassung wesentlich E<strong>in</strong>fluss aufden Mobilitätserhalt. In diesem Bereich spielen gesundheitsbed<strong>in</strong>gtetypische Altersersche<strong>in</strong>ungen e<strong>in</strong>e maßgeb-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 155 – Drucksache 16/2190liche Rolle. Im Alter nimmt die Seh- und Hörfähigkeit ab,schw<strong>in</strong>dende Muskelkraft reduziert die Beweglichkeitund die Flexibilität <strong>der</strong> Sensomotorik ist verm<strong>in</strong><strong>der</strong>t, sodassmit zunehmendem Alter auch das Unfallrisiko steigt(Cohen 2002). Zum an<strong>der</strong>en wirken sich die räumlichenBed<strong>in</strong>gungen auf den Mobilitätserhalt <strong>der</strong> älteren Menschenaus. Hierzu zählen u.a. die Angebots- und Versorgungsstrukturdes Öffentlichen Personennahverkehrs(ÖPNV) sowie die Ausstattung des Wohnumfelds und <strong>der</strong>Infrastruktur.Mit dem Wandel <strong>der</strong> Bedürfnisse <strong>der</strong> älteren Menschenh<strong>in</strong> zu mehr Selbstständigkeit gehen auch Verän<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> Mobilitätsgewohnheiten <strong>der</strong> Älteren e<strong>in</strong>her. So ist e<strong>in</strong>erseitsdavon auszugehen, dass die Anzahl <strong>der</strong> motorisiertenÄlteren zunehmen wird. Hier sprechen die Zahlene<strong>in</strong>e deutliche Sprache: Voraussichtlich wird die Motorisierung<strong>der</strong> männlichen Personen (ab dem 65. Lebensjahr)bis zum Jahr 2030 von 767 auf 850 PKW pro Tsd.E<strong>in</strong>wohner ansteigen. Noch deutlicher wird <strong>der</strong> Anstiegweiblicher Verkehrsteilnehmer<strong>in</strong>nen ausfallen. Mit146 PKW pro Tsd. E<strong>in</strong>wohner<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d die älterenFrauen <strong>in</strong> dieser Altersgruppe heute sehr ger<strong>in</strong>g motorisiert.In den nächsten Jahren wird sich diese Zahl allerd<strong>in</strong>gsdeutlich erhöhen. Somit wird <strong>in</strong> Zukunft bei <strong>der</strong> benutzerfreundlichenGestaltung von Fahrzeugen vermehrtauf die Bedürfnisse <strong>der</strong> älteren Fahrer und Fahrer<strong>in</strong>nen zuachten se<strong>in</strong>. Untersuchungen haben ergeben, dass beispielsweiseüberhöhte Geschw<strong>in</strong>digkeit o<strong>der</strong> zu ger<strong>in</strong>gerAbstand als Unfallursache im Alter nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>geRolle spielen. Vielmehr entstehen Risikosituationen,wenn ältere Autofahrer und Autofahrer<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> komplexenBegebenheiten <strong>in</strong> knapp bemessener Zeit Entscheidungentreffen müssen (Kütt<strong>in</strong>g & Krüger 2002). Vor diesemH<strong>in</strong>tergrund können Fahrerassistenzsysteme, die von<strong>der</strong> Navigation <strong>in</strong> unbekannten Regionen bis h<strong>in</strong> <strong>zur</strong>Übernahme <strong>der</strong> Fahraufgabe <strong>zur</strong> Kollisionsvermeidungaktiv <strong>in</strong> das Fahrverhalten e<strong>in</strong>greifen, e<strong>in</strong>en positivenBeitrag <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Sicherheit älterer Autofahrerund Autofahrer<strong>in</strong>nen liefern. Viele dieser neuen Technikenbef<strong>in</strong>den sich momentan noch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung,werden aber angesichts <strong>der</strong> sich än<strong>der</strong>nden Altersstruktur<strong>der</strong> Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer<strong>in</strong>nen zunehmendan Bedeutung gew<strong>in</strong>nen.Aber nicht nur die Anzahl <strong>der</strong> älteren Autofahrer und Autofahrer<strong>in</strong>nenwird sich <strong>in</strong> Zukunft deutlich erhöhen. Esist davon auszugehen, dass durch die Zunahme an Hochbetagtenauch die Anzahl <strong>der</strong> Personen zunehmen wird,die auf Grund von körperlichen E<strong>in</strong>schränkungen nichtmehr <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong> Kraftfahrzeug zu steuern undsomit auf die Angebote des ÖPNV o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Alternativangeboteangewiesen s<strong>in</strong>d. Gerade für diese Altersgruppetragen die öffentlichen Verkehrsmittel entscheidendzum Mobilitätserhalt bei. Gerade im ländlichenBereich ist die Versorgungsstruktur oftmals nicht flächendeckendo<strong>der</strong> es entstehen längere Fußwege <strong>zur</strong> nächstgelegenenHaltestelle, die von <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bewegung e<strong>in</strong>geschränktenSenioren und Senior<strong>in</strong>nen nicht bewältigtwerden können. Mancherorts s<strong>in</strong>d die Zugänge zu denBahnstationen nicht barrierefrei, Bahnhöfe werden <strong>in</strong> Bezugauf Krim<strong>in</strong>alität als unsicher empfunden, das Informations-und Beratungsangebot ist un<strong>zur</strong>eichend o<strong>der</strong> eswird über die Schwierigkeiten im Umgang mit Fahrkartenautomatenberichtet. Häufig halten diese Barrierenauch ältere Autofahrer und Autofahrer<strong>in</strong>nen davon ab,auch im höheren Alter auf attraktive Ausweichangebotedes ÖPNV umzusteigen (Engeln, Schlag & Deubel 2002).Gerade im ländlichen Raum, <strong>in</strong> dem oft e<strong>in</strong>e für ältereMenschen un<strong>zur</strong>eichende Versorgungsstruktur gegebenist, werden <strong>in</strong> Zukunft alternative Fahrangebote wie Rufbusseo<strong>der</strong> Sammeltaxis an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen. Beidiesen Angeboten entfallen für die Älteren längere Strecken,die vor Fahrtantritt zu Fuß <strong>zur</strong>ückgelegt werdenmüssen und es entfallen lange Wartezeiten.5.3.1.3 Reisen und TourismusDie f<strong>in</strong>anzielle <strong>Lage</strong> und die zeitlichen Ressourcen <strong>der</strong> älterenMenschen zeigen e<strong>in</strong> hohes Potenzial für Tourismusangebote,und auch die Zahlen sprechen e<strong>in</strong>e deutlicheSprache: Für e<strong>in</strong> Viertel <strong>der</strong> über 50-Jährigen ist Reisen,e<strong>in</strong> „geradezu elementares Bedürfnis, für weitere 36 Prozentist es zum<strong>in</strong>dest wichtig zu verreisen“ (Gesellschaftfür Konsumforschung 2002: 10). Zwar liegt die Reise<strong>in</strong>tensität<strong>der</strong> Senioren mit 67 Prozent etwas unter demDurchschnitt <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung (76 Prozent), dochwar e<strong>in</strong> Viertel aller urlaubsreisenden erwachsenen Deutschenälter als 60 Jahre. Die Bereitschaft, für Reisen Geldauszugeben, ist bei älteren Deutschen ausgeprägt: „Seniorenpaareliegen zwar mit durchschnittlich 798 Euro proPerson nur knapp über dem Gesamtdurchschnitt aller Urlaubsreisen(793 Euro), dafür greifen alle<strong>in</strong> stehende Seniorenim Urlaub wesentlich tiefer <strong>in</strong> die Tasche. Sie <strong>in</strong>vestieren965 Euro pro Person und Urlaubsreise. Beihochgerechneten 17,5 Millionen Urlaubsreisen ergebensich Gesamtausgaben von ca. 15 Mrd. Euro“ (Tödter2004). Seniorenreisen gelten bereits als „Wachstumsmotor<strong>der</strong> Zukunft“, dies gilt vor allem für den so genanntenGesundheitstourismus (Institut für Freizeitwirtschaft2003a).Das Reiseverhalten verän<strong>der</strong>t sich im Alter nicht vonGrund auf. Wer se<strong>in</strong> ganzes Leben lang Fernreisen gemachthat, wird auch im Alter versuchen, dies fortzusetzen.Die gewohnten Reise- und Verhaltensmuster im Urlaubwerden also beibehalten, aber an den aktuellenGesundheitszustand angepasst und dementsprechend modifiziert.Dennoch gibt es e<strong>in</strong>ige typische altersbed<strong>in</strong>gteVerhaltensweisen. Ältere Menschen verreisen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regellänger und öfter als jüngere Menschen. Innerhalb <strong>der</strong>Gruppe <strong>der</strong> Älteren nimmt die Intensität mit zunehmendemAlter ab. Während die jungen Alten noch durchschnittlichzweimal im Jahr verreisen, geht die Reisetätigkeit<strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe über 70 Jahre deutlich <strong>zur</strong>ück.Dies ist auch darauf <strong>zur</strong>ückzuführen, dass <strong>in</strong> dieserGruppe über e<strong>in</strong> Drittel überhaupt ke<strong>in</strong>e Reisen mehr unternimmtund kann als e<strong>in</strong> Indiz dafür gewertet werden,dass e<strong>in</strong> spezielles Angebot für körperlich bee<strong>in</strong>trächtigteSenioren und Senior<strong>in</strong>nen noch unterentwickelt ist. Diejenigen,die <strong>in</strong> diesem Alter verreisen, s<strong>in</strong>d durchschnittlichnoch 1,9-mal im Jahr unterwegs. Im Durchschnitt beträgtdie Verweildauer <strong>der</strong> Älteren 22 Tage. Innerhalb <strong>der</strong>Altersgruppe verreisen die jüngeren Senioren und Senio-
Drucksache 16/2190 – 156 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperio<strong>der</strong><strong>in</strong>nen vergleichsweise am längsten (Gesellschaft fürKonsumforschung 2002). Dies ist auch nicht verwun<strong>der</strong>lich:Durch den E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> den beruflichen Ruhestand verfügensie e<strong>in</strong>erseits über die nötige Zeit, an<strong>der</strong>erseits s<strong>in</strong>dsie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel noch nicht von altersbed<strong>in</strong>gten körperlichenE<strong>in</strong>schränkungen betroffen.Bezüglich <strong>der</strong> Wahl des Reiseziels ergeben sich auch Unterschiedezu an<strong>der</strong>en Altersgruppen. Während <strong>in</strong>nerhalb<strong>der</strong> Gesamtbevölkerung nur rund e<strong>in</strong> Drittel den Urlaubim eigenen Land verbr<strong>in</strong>gt, s<strong>in</strong>d es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Älterentrotz leicht abnehmen<strong>der</strong> Tendenzen rund 50 Prozent.Im H<strong>in</strong>blick auf die bevorzugte Reiseform machtsich die hohe Heterogenität <strong>der</strong> Altersgruppe bemerkbar.Beson<strong>der</strong>s beliebt s<strong>in</strong>d Strandurlaube mit Sonnengarantie,wobei e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Wert auf e<strong>in</strong>e komfortable Umgebunggelegt wird. Aber auch Wan<strong>der</strong>urlaube und Kulturreisens<strong>in</strong>d beliebt. Insbeson<strong>der</strong>e Gesundheitsangebotegew<strong>in</strong>nen an Bedeutung. Geme<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d hierbei vor allemHotelanlagen, <strong>in</strong> denen man neben <strong>der</strong> Übernachtungnoch spezielle Angebote für Gesundheit und Wellness buchenkann. In Anlehnung an das klassische Kurhotel halten65 Prozent <strong>der</strong> Senioren und Senior<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong> Wellnesshotelfür e<strong>in</strong>e lohnenswerte Alternative (Gesellschaftfür Konsumforschung 2002).Des Weiteren spielt <strong>der</strong> Faktor Sicherheit bei älteren Reisendene<strong>in</strong>e zentrale Rolle. Ältere reisen ungern alle<strong>in</strong>und bevorzugen klassische Gruppenreisen mit e<strong>in</strong>em persönlichbekannten Veranstalter o<strong>der</strong> Organisator. Diehierdurch gewährleistete adäquate Betreuung und Unterstützungam Urlaubsort ist für ältere Reisende von hoherBedeutung. Dies gilt für mediz<strong>in</strong>ische Versorgung ebensowie für zuverlässige Informationsservices und Unterstützungsangebote.Die E<strong>in</strong>richtungen am Urlaubsort solltenbeispielsweise e<strong>in</strong>e barrierearme Gestaltung aufweisen.Die beschriebenen Merkmale und Bedürfnisse ältererMenschen stellen e<strong>in</strong>e große Chance für Reiseanbieterdeutscher Urlaubsregionen dar. Pr<strong>in</strong>zipiell haben sie alleVoraussetzungen, um <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong>ländischen, aberz.T. auch ausländischen älteren Menschen attraktive Angebotemachen zu können. E<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Vorteil ist,dass die mediz<strong>in</strong>ische Versorgung <strong>in</strong> Deutschland als ausgesprochengut gilt und <strong>in</strong> den Kur- und Heilbä<strong>der</strong>n <strong>der</strong>Gesundheits-, Wellness- und Fitnessbereich mit Urlaubsangebotenverknüpft wird. Nach e<strong>in</strong>er Befragung des Institutsfür Freizeitwirtschaft München (2003a) liegt dasgrößte Zielgruppenpotenzial für Gesundheitstourismus <strong>in</strong><strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> e<strong>in</strong>kommensstarken über 50-Jährigen.Mit Blick auf die Mobilisierung <strong>der</strong> Wirtschaftskraft Alterfür deutsche Reisedest<strong>in</strong>ationen werden aus den vorstehendenÜberlegungen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die folgendenSchlussfolgerungen für e<strong>in</strong>e Erfolg versprechende Produktpolitikgezogen:– Die Tourismusanbieter müssen die Chancen des Seniorenmarkteserkennen und für die Zielgruppe verstärktmaßgeschnei<strong>der</strong>te Angebote und Market<strong>in</strong>gkonzepteentwickeln. Insbeson<strong>der</strong>e Kurregionen tendieren dazu,sich auf bestimmte Spezialkompetenzen im Gesundheitsbereichzu konzentrieren und ansonsten – mitBlick auf die breite Kundschaft – auf junge Alte zuzielen. Es wäre wahrsche<strong>in</strong>lich s<strong>in</strong>nvoll, sich stärkeram Reisemarkt für ältere Menschen zu präsentieren,<strong>in</strong>dem die vorhandenen gesundheitsbezogenen E<strong>in</strong>richtungenverstärkt mit Fitness-, Gesundheits- sowieSicherheits- und Betreuungsangeboten verknüpft werden.Zudem müssen <strong>in</strong>tensiver Reiseangebote für Pflegebedürftigeentwickelt werden– Die Qualifikationen <strong>der</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter<strong>in</strong> den Branchen, die für die Entwicklung altenorientierterReiseangebote zuständig s<strong>in</strong>d (von <strong>der</strong>Reisebranche über das Beherbergungsgewerbe und dieGastronomie bis h<strong>in</strong> zu den Gesundheits- und Sozialdienstleistern),reichen oft nicht aus, um dem Tourismus<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft gerecht werden zukönnen. Neben Weiterbildungsangeboten für Beschäftigteist e<strong>in</strong>e Qualifizierungsoffensive vorstellbar, dieüber die verschiedenen Berufsgruppen h<strong>in</strong>weg, e<strong>in</strong>eVerankerung von Ausbildungselementen mit seniorenorientierterAusrichtung vorsieht.5.3.1.4 Neue Medien und TelekommunikationWirtschaftliche Entwicklungsimpulse <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität im Alter werden<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von den mo<strong>der</strong>nen Informations- undKommunikationstechnologien erwartet, die e<strong>in</strong>e Füllevon Möglichkeiten bieten, vorhandene Angebote neu zuorganisieren und neue Angebote zu entwickeln. Diesewerden <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für den Bereich professioneller Anwendungen<strong>in</strong> Gesundheit und Pflege gesehen, aber auchim Bereich <strong>der</strong> privaten Nutzung und <strong>der</strong> gesellschaftlichenTeilhabe. Nach empirischen Studien stehen ältereMenschen <strong>der</strong> Nutzung von Informations- und Kommunikations-(IuK) Technologien durchaus offen gegenüber.Die europaweite Studie „senior-watch“ erstellt für über50-jährige Deutsche folgende Nutzer-Typologie (Anteile<strong>in</strong> Prozent):– Die „älteren Neue<strong>in</strong>steiger“, d.h. Computernutzer mitGrundkenntnissen bei ger<strong>in</strong>ger Nutzungshäufigkeit(14 Prozent).– Die „erfahrenen Vorreiter“ s<strong>in</strong>d Computernutzer mitguten Kenntnissen bei häufiger Nutzung (35 Prozent).– Die „gedanklich Offenen“, die ke<strong>in</strong>en Computer nutzen,neuen Technologien gegenüber aber aufgeschlossens<strong>in</strong>d (32 Prozent) sowie die– „Verweigerer“, die ke<strong>in</strong>en Computer nutzen und auchke<strong>in</strong> Interesse an <strong>der</strong> Nutzung neuer Technologien haben(19 Prozent).Eng e<strong>in</strong>her mit <strong>der</strong> Computernutzung geht die Nutzungdes Internets. Auch für die Senioren und Senior<strong>in</strong>nen hatdas Internet deutlich an Bedeutung gewonnen. Mittlerweileist davon auszugehen das jede vierte Person zwischen50 und 79 Jahre zum<strong>in</strong>dest gelegentlich onl<strong>in</strong>e ist.Auffällig s<strong>in</strong>d die Unterschiede <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Altersgruppe.Liegt die Altersklasse von 50 bis 59 Jahren mit43 Prozent sogar leicht über dem Bundesdurchschnitt(40 Prozent), nutzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersklasse 70 bis 79 Jahre
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 157 – Drucksache 16/2190nur noch 7 Prozent das Internet. Zudem verfügen überdurchschnittlichviele Nutzer und Nutzer<strong>in</strong>nen über e<strong>in</strong>höheres Bildungsniveau (Abitur/Studium). BevorzugteAngebotsseiten, die von älteren Menschen besucht werden,s<strong>in</strong>d die Bereiche Nachrichten, Wohnen, Reisen(<strong>in</strong>kl. Buchung) und <strong>der</strong> Themenkomplex Gesundheit/Wohlbef<strong>in</strong>den/Wellness. In letzterem Bereich überwiegtdas Informations<strong>in</strong>teresse mit über 40 Prozent, aber auchdie Konsultation e<strong>in</strong>es Arztes per E-Mail (26,5 Prozent)o<strong>der</strong> per Bildübertragung (19,1 Prozent) stößt zunehmend– vor allem mit höherem Bildungsgrad – auf Interesse.Limitierend wirkt auf Seiten <strong>der</strong> älteren Nutzer und Nutzer<strong>in</strong>nenvor allem die nicht angemessene Berücksichtigungfunktionaler E<strong>in</strong>schränkungen bei <strong>der</strong> Produktgestaltung.Interessant sche<strong>in</strong>t <strong>der</strong> Blick auf zukünftigePotenziale: Etwa 15 Prozent <strong>der</strong> momentanen Nichtnutzerund Nichtnutzer<strong>in</strong>nen bekunden generelles Interesse an<strong>der</strong> Nutzung des Mediums Internet, umgerechnet s<strong>in</strong>d dasfast 3 Mio. Menschen (Seniorwatch 2002).Ähnlich wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesamten Bevölkerung hat auch <strong>in</strong> <strong>der</strong>älteren Altersklasse das mobile Telefonieren e<strong>in</strong>en deutlichenBedeutungszuwachs erfahren. Meist mit demBeweggrund, immer erreichbar zu se<strong>in</strong> und das Mobiltelefonfür Notfallsituationen zu nutzen, verwenden mittlerweile43 Prozent <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersklasse 60 bis 69 Jahre e<strong>in</strong>Handy, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersklasse 70 bis 79 Jahre s<strong>in</strong>d es immerh<strong>in</strong>noch 24 Prozent (Gesellschaft für Konsumforschung2002). Dennoch s<strong>in</strong>d die Älteren verglichen mit <strong>der</strong> Gesamtbevölkerungunterdurchschnittlich mit Mobiltelefonenausgestattet. Dies ist sicherlich auch dadurch zu erklären,dass Händler und Hersteller bisher kaum auf dieseZielgruppe reagiert haben. So sprechen Werbung und Informationsmaterialoftmals nur jüngere Zielgruppen an.Auch die Geräte werden von vielen Älteren als zu kompliziertempfunden und die zusätzlichen Funktionen lassenden ursprünglichen Benutzungszweck kaum noch erkennen.Mit e<strong>in</strong>em den Bedürfnissen <strong>der</strong> Älterenentsprechenden Geräteangebot und e<strong>in</strong>em Zusatzangebotan Information und Beratung für die neue Zielgruppekönnen <strong>in</strong> diesem Bereich noch unausgeschöpfte Potenzialeaktiviert werden.E<strong>in</strong> weiteres Potenzial für privat genutzte Angebote liegtim Bereich <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> selbstständigenLebensführung im Alter. Grundsätzlich lassen sich fünfverschiedene Gestaltungsbereiche ausmachen, <strong>in</strong> denenInformations- und Kommunikationstechnik für die Unterstützungzu Hause leben<strong>der</strong> bee<strong>in</strong>trächtigter o<strong>der</strong> ältererMenschen genutzt werden können:– Die Haus-Notruf-Systeme werden erweitert und verwandelnsich zu e<strong>in</strong>em Serviceruf, <strong>der</strong> auch <strong>zur</strong> Kontaktvermittlungund <strong>zur</strong> Vermittlung von Dienstleistungengenutzt werden kann.– Über das Internet (per E-Mail, Kontaktvermittlungsbörsen,Chat Rooms usw.) werden älteren Menschenzusätzliche Informations-, Orientierungs- und Kommunikationsmöglichkeitengeboten.– Mit Hilfe <strong>der</strong> Videokonferenztechnologie können Servicezentralenmit älteren Menschen Netzwerke bildenund ihnen e<strong>in</strong>e breite Leistungspalette anbieten, vomseelsorgerischen Gespräch über die Vermittlung vonDienstleistungen bis h<strong>in</strong> zum virtuellen Kaffeeklatsch.Obwohl e<strong>in</strong>zelne Modellprojekte liefen und laufen,gibt es allerd<strong>in</strong>gs noch immer ke<strong>in</strong>e wirklich tragfähigenBus<strong>in</strong>ess-Konzepte und ke<strong>in</strong>e angemessene undpreislich akzeptable Technik, sodass die Verbreitungbisher auf die Projekträume beschränkt ist.– Unter dem Stichwort "<strong>in</strong>telligente Häuser" entstehentechnische Lösungen, die Menschen bei e<strong>in</strong>er komfortablenLebensführung unterstützen, Sicherheit bietenund es <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e älteren und bee<strong>in</strong>trächtigten Menschenleichter machen, selbstständig zu leben. RauchundFeuermel<strong>der</strong> spielen <strong>in</strong> diesem Zusammenhangebenso e<strong>in</strong>e Rolle wie automatische Rollläden, Fallsensoreno<strong>der</strong> sprachgesteuerte Haushaltsgeräte. DieTechnik ist aber nur als Mittel <strong>zur</strong> Steigerung <strong>der</strong> Lebensqualitätzu sehen und dementsprechend müssendie Anfor<strong>der</strong>ungen an <strong>der</strong>en Gestalter formuliert werden.– Neue telepflegerische o<strong>der</strong> telemediz<strong>in</strong>ische Anwendungenermöglichen es, neue Monitor<strong>in</strong>gdienste zuentwickeln und viele bereits bekannte Sozial- und Gesundheitsdienstebedarfsgerechter zu gestalten; zunennen s<strong>in</strong>d hier etwa automatisierte Verfahren <strong>der</strong>Messung und Überwachung von Vitalparametern,Sturzmel<strong>der</strong> o<strong>der</strong> die Beratung und Unterstützungpflegen<strong>der</strong> Angehöriger mithilfe bildbasierter Übertragungstechnik.5.3.1.5 GesundheitswirtschaftZweifelsohne steigen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft dieMarktchancen für gesundheitsbezogene Produkte undDienstleistungen, zumal sich auch <strong>in</strong>ternational zeigt,dass Gesundheit für ältere Menschen e<strong>in</strong>en hohen <strong>in</strong>dividuellenWert besitzt. Doch das Gesundheitswesen stehtauf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Seite unter hohem Mo<strong>der</strong>nisierungs- undauch Kostendruck, auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite gelten Gesundheitund Soziales als Wirtschaftsbranchen, die <strong>in</strong> Zukunftnachhaltig positive Beiträge für die wirtschaftliche Entwicklungund die Beschäftigung leisten werden. Die Gesundheitswirtschaftzählt zu den wichtigsten Wachstumsbranchen<strong>der</strong> letzten zwei Dekaden; beschäftigungsmäßigwaren <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die gesundheitsbezogenen und sozialenDienste von beson<strong>der</strong>er Bedeutung. Der soziodemografischeWandel, <strong>der</strong> technische Fortschritt und dieInnovationen sowie neue Ansätze für Produkte undDienstleistungen im Bereich <strong>der</strong> Lifestyle-, Alternativundganzheitlichen Mediz<strong>in</strong> lassen darauf schließen, dassdieser positive Trend auch <strong>in</strong> den nächsten Jahren anhaltenwird. Im E<strong>in</strong>zelnen lassen sich vier konkrete Gestaltungsfel<strong>der</strong>beschreiben.Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung (vor allem h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> kle<strong>in</strong>er werdenden Familien) ist davon auszugehen,dass mit dem demografischen Wandel zukünftige<strong>in</strong> Mehrbedarf an professionellen Hilfs- und Pflegeangebotensowie mediz<strong>in</strong>ischen Leistungen e<strong>in</strong>her gehenwird, <strong>der</strong> nur durch e<strong>in</strong>en weiteren Ausbau <strong>der</strong> entsprechendenKapazitäten im Kernbereich <strong>der</strong> Gesundheits-
Drucksache 16/2190 – 158 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodewirtschaft gedeckt werden kann. Im H<strong>in</strong>blick auf diePflegebedürftigkeit zeigt sich exemplarisch, dass sich zukünftiggravierende Verän<strong>der</strong>ungen für den Gesundheitsmarktergeben werden. Die Etablierung <strong>der</strong> Pflegeversicherungim Jahr 1994 hat e<strong>in</strong>en Beitrag <strong>zur</strong> Sicherstellung<strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung entsprechen<strong>der</strong> Dienstleistungen geleistet.Neben dem Ausbau stationärer E<strong>in</strong>richtungen müssenjedoch neue Formen <strong>der</strong> Betreuung und Versorgung treten,die die familiäre Unterstützung ergänzen o<strong>der</strong> auchersetzen können. Dienstleistungsangebote sollten dabeidas Spektrum von Beratungsangeboten bis h<strong>in</strong> zu flexiblenHilfeformen abdecken, die von allen Beteiligten– sprich den älteren Menschen, <strong>der</strong>en Familien und auchProfessionellen – <strong>in</strong> Anspruch genommen werden können.In diesem Kontext soll auf die wachsende Zahl Demenzkrankerh<strong>in</strong>gewiesen werden, die <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Pflegebedürftigene<strong>in</strong>e spezifische Zielgruppe darstellen.Diesem Kernbereich <strong>der</strong> Gesundheitswirtschaft s<strong>in</strong>ddurch politische Regulierung und F<strong>in</strong>anzierung durch dieKrankenkassen allerd<strong>in</strong>gs auch enge Grenzen h<strong>in</strong>sichtlichExpansion und Preisgestaltung gesetzt. Bereits heute zahlendie gesetzlich Krankenversicherten ca. 7 Prozent ihrerAufwendungen für Gesundheit aus eigener Tasche, bis2015 wird e<strong>in</strong> deutlicher Anstieg dieser Eigenleistungprognostiziert. Damit e<strong>in</strong>her geht aber auch e<strong>in</strong> Wandel<strong>der</strong> Ansprüche. Die Patienten werden sich weitere Kompetenzen<strong>zur</strong> Steigerung ihrer Lebensqualität aneignenund werden sich vom Hilfeempfänger zum mündigenKunden entwickeln. Große wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeitens<strong>in</strong>d vor allem <strong>in</strong> den Rand- und Nachbarbranchen<strong>der</strong> Gesundheitswirtschaft zu sehen, also denBereichen, die von den Kunden und Kund<strong>in</strong>nen privat f<strong>in</strong>anziertwerden.Als weiteres Gestaltungsfeld lassen sich technische Hilfsmittelausmachen, die gesundheitliche Bee<strong>in</strong>trächtigungenim Alter kompensieren o<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest l<strong>in</strong><strong>der</strong>n können.Bislang gibt es <strong>in</strong> Deutschland allerd<strong>in</strong>gs nur wenigerenommierte Gesundheits- und Gerontotechnikunternehmen.Gerade durch die <strong>in</strong> Zukunft deutliche Zunahme <strong>der</strong>hochaltrigen Senioren und Senior<strong>in</strong>nen und <strong>der</strong> damitverbundenen Zunahme <strong>der</strong> Morbidität ist mit e<strong>in</strong>em weiterenWachstum <strong>der</strong> Märkte für Gesundheits-, GerontoundRehabilitationstechnik zu rechnen.Insgesamt wird <strong>der</strong> versorgungsorientierte und privatf<strong>in</strong>anzierteTeil des Gesundheitsmarktes erheblich wachsen,unter <strong>der</strong> Voraussetzung, dass die älteren Menschenauch dazu bereit und <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong> s<strong>in</strong>d, mehr Geld für gesundheitsbezogeneProdukte und Dienstleistungen zu <strong>in</strong>vestieren.Hierfür ist die Bereitschaft gewachsen: In e<strong>in</strong>erUmfrage <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen rangiert Gesundheit aufe<strong>in</strong>er Spitzenposition <strong>der</strong> Ausgabenpläne für disponibleE<strong>in</strong>kommen älterer Menschen. Dies betrifft auch die angrenzendenLeistungsbereiche Wellness, functional-food,pharmazeutische Produkte u.a.m.Die verstärkte Wahrnehmung des Gesundheitswesens alsaussichtsreiche Wirtschaftsbranche bedeutet für dessenzukünftige Entwicklung, dass <strong>der</strong> Innovations-, Wettbewerbs-und Profilierungsdruck für die e<strong>in</strong>zelnen Anbietersteigen wird. Die E<strong>in</strong>richtungen und Unternehmen <strong>der</strong>Gesundheitswirtschaft können allerd<strong>in</strong>gs nur dann an dieserprospektiven Entwicklung partizipieren, wenn sie sichden wandelnden Rahmenbed<strong>in</strong>gungen des Marktes undden sich än<strong>der</strong>nden Kunden- und Patienten<strong>in</strong>teressen stellen.Ganz zentral gehört hierzu die Entwicklung von neuenProdukten und Dienstleistungen – komplementär zu dembestehenden Dienstleistungsangebot. Mit neuen Produktenund Dienstleistungen kann die Gesundheits- und Sozialwirtschaftauf die verän<strong>der</strong>te Bedarfslage reagierenund verstärkt privat f<strong>in</strong>anzierte Nachfrage mobilisieren.Dazu müssen die Leistungsprofile bestehen<strong>der</strong> Angebotekritisch auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüft werden. Ergänzungenund Verän<strong>der</strong>ungen sowie Kooperationen mitUnternehmen aus an<strong>der</strong>en Branchen (z.B. mit <strong>der</strong> Wohnungswirtschaft),um optimierte Angebote für die Unterstützungim häuslichen Umfeld entwickeln zu können,s<strong>in</strong>d notwendig.5.3.1.6 Freizeit, Gesundheit und WellnessE<strong>in</strong> weiteres Gestaltungsfeld, das oftmals <strong>der</strong> Gesundheitswirtschaftzugewiesen wird, ist geprägt durch dieVerb<strong>in</strong>dung von Freizeit und Gesundheit. Der BereichFreizeitsport wies jahrzehntelang e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierlicheAufwärtsentwicklung auf, die sich <strong>in</strong> steigenden Umsätzenund e<strong>in</strong>er wachsenden volkswirtschaftlichen Bedeutungnie<strong>der</strong>schlägt. Ergänzend vollzog sich e<strong>in</strong> positiverImagewandel im Sektor Sport und Fitness e<strong>in</strong>hergehendmit e<strong>in</strong>er Erhöhung <strong>der</strong> gesellschaftlichen Akzeptanz.Dieses Wachstum verlangsamte sich allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> denletzten Jahren. Das Institut für Freizeitwirtschaft München(IFF) erklärt diesen Trend nicht nur auf Grund e<strong>in</strong>erschwachen allgeme<strong>in</strong>en Konjunktur und ger<strong>in</strong>ger werdendenFreizeit (Bezugsbasis: Gesamtbevölkerung),son<strong>der</strong>n führt ihn <strong>in</strong> wesentlichen Teilen auch auf die demografischeEntwicklung <strong>zur</strong>ück. Das Altern <strong>der</strong> Gesellschaftwurde hier – wie <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Wirtschaftsbranchenauch – nicht als Zukunftstrend identifiziert.Insgesamt waren im Jahr 2002 rund 50,2 Mio. Menschensportlich aktiv, d.h. sie haben zum<strong>in</strong>dest gelegentlich e<strong>in</strong>esportliche Aktivität ausgeübt. Bei e<strong>in</strong>er Befragung desIFF gaben knapp e<strong>in</strong> Drittel (28,3 Prozent) <strong>der</strong> Bevölkerungan, ke<strong>in</strong>e sportlichen Aktivität auszuüben, fast e<strong>in</strong>Drittel treibt gelegentlich Sport (37,7 Prozent), währendimmerh<strong>in</strong> 34,6 Prozent <strong>der</strong> Bevölkerung m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>malpro Woche e<strong>in</strong>er sportlichen Aktivität nachgeht, überdie Hälfte dieser Gruppe sogar täglich bzw. mehrmals dieWoche. Die Ausgaben im Freizeitsportbereich lagen 2002bei <strong>in</strong>sgesamt 36,5 Mrd. Euro, davon wurden 58,1 Prozent(21,2 Mrd. Euro) für Dienstleistungsausgaben aufgewendet.Auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe 55 bis 69 Jahre s<strong>in</strong>d immernoch 64,8 Prozent und bei den über 70-Jährigen 35,6 Prozentsportlich aktiv (Institut für Freizeitwirtschaft München2003b). Angesichts <strong>der</strong> positiven gesundheitlichenEntwicklung <strong>der</strong> letzten Jahrzehnte und des guten gesundheitlichenAllgeme<strong>in</strong>zustandes, <strong>in</strong> dem sich auchMenschen jenseits <strong>der</strong> Fünfzig noch für lange Zeit bef<strong>in</strong>den,muss alle<strong>in</strong> die körperliche Leistungsfähigkeit ke<strong>in</strong>
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 159 – Drucksache 16/2190Grund für den ger<strong>in</strong>gen Anteil sportlicher Aktivitäten <strong>in</strong>den Altersgruppen über 54 Jahren se<strong>in</strong>. Vielmehr ist esansche<strong>in</strong>end immer noch so, dass <strong>der</strong> überwiegende Teil<strong>der</strong> Sportangebote vorrangig an den Interessen und Bedürfnissenjugendlicher Sporttreiben<strong>der</strong> orientiert ist.Obwohl sich die ökonomischen Zuwächse abgeschwächthaben, ist <strong>der</strong> Sektor Freizeit- und Gesundheitssport immernoch e<strong>in</strong> Wachstumsmarkt, von dem starke Beschäftigungsimpulseausgehen. Neben dem kommerziellen Aspektist auch unter dem gesundheitspolitischen Aspekt(Präventionsfunktion) die Bedeutung dieses Bereichs fürdie Volkswirtschaft nicht zu vernachlässigen. Allerd<strong>in</strong>gsmuss die Nachfrage <strong>in</strong> vielen Bereichen erst noch gewecktwerden und müssen die Angebote auf die Anfor<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> älteren Kunden abgestimmt werden. Speziellauf Seiten <strong>der</strong> Sportwirtschaft ist noch erheblicher Nachhol-und Verbesserungsbedarf festzustellen, so <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>efür die Qualifikation sowohl auf <strong>der</strong> konzeptionellenund Managementebene, als auch auf <strong>der</strong> Umsetzungsebene.5.3.1.7 F<strong>in</strong>anzdienstleistungenObwohl ältere Menschen auch für die F<strong>in</strong>anzwirtschafte<strong>in</strong>e sehr lukrative Zielgruppe se<strong>in</strong> können, ist es immernoch gängige Praxis, dass es zu Benachteiligungen undDiskrim<strong>in</strong>ierungen auf Grund des Alters kommt. Ausdrücklicheund versteckt formulierte Altersgrenzen <strong>in</strong>rechtlichen und vertraglichen Bestimmungen, die dieKreditvergabe an ältere Menschen erheblich e<strong>in</strong>schränken,s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> oft zitiertes Beispiel, das <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e imZusammenhang mit den begrenzten Möglichkeiten für ältereUnternehmensgrün<strong>der</strong> genannt wird. Die Kreditvergabewird oft so rigoros gehandhabt, dass Älteren selbstKonsumkredite von ger<strong>in</strong>gem Umfang verwehrt bleiben,ohne dass ihre Vermögensverhältnisse überhaupt e<strong>in</strong>erÜberprüfung unterzogen werden.Die Versicherungs- und Bankenbranchen haben langeZeit die Gruppe <strong>der</strong> Älteren vernachlässigt, obwohl dieseAltersgruppe über e<strong>in</strong>e relativ gute E<strong>in</strong>kommens- undVermögenssituation verfügt und zudem auch für dieseBranche die e<strong>in</strong>zige wachsende Zielgruppe bildet. Nichtnur das momentan vorhandene Vermögen, son<strong>der</strong>n auchdie Vermögenszuwächse s<strong>in</strong>d bei <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellenSituation älterer Menschen e<strong>in</strong> entscheiden<strong>der</strong>Faktor. In diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d Vermögenszuwächsedurch Vererbung von großer Bedeutung.Seit e<strong>in</strong>iger Zeit ist allerd<strong>in</strong>gs zu beobachten, dass sichdie Banken und Versicherungsunternehmen mit zielgerichtetenAngeboten <strong>der</strong> „neuen“ Kundengruppe nähern.Bei dem Ausbau <strong>der</strong> bisherigen Angebote gibt es allerd<strong>in</strong>gszahlreiche Son<strong>der</strong>heiten, die beachtet werden müssen.Grundsätzlich haben F<strong>in</strong>anzdienstleistungen für ältereMenschen die gleiche Funktion wie auch für an<strong>der</strong>eAltersgruppen. Sie dienen dazu, das E<strong>in</strong>kommen für dieAusgaben verfügbar zu machen und dabei die AnlageundKreditbeziehungen adäquat zu pflegen. Dennoch gibtes e<strong>in</strong>ige Beson<strong>der</strong>heiten, da F<strong>in</strong>anzdienstleistungen ihreStrukturen und Wirkungen im Lebenszyklus <strong>der</strong> Menschenverän<strong>der</strong>n und somit altersabhängig s<strong>in</strong>d (Reifner2005). So s<strong>in</strong>kt die Sparquote bei den 55- bis 74-Jährigendeutlich ab, um bei den 75- bis 85-Jährigen wie<strong>der</strong> anzusteigen(Fach<strong>in</strong>ger 2004). Bezüglich ihrer Anlagestrukturgreifen sie eher auf traditionelle Formen des Sparens <strong>zur</strong>ück(Sparbuch, Sparkonto), wobei das Interesse an risikoreichenAnlageformen mit zunehmendem Alter rückläufigist. Dies zeigt sich auch an den Anlagemotiven <strong>der</strong>älteren Menschen: Während die Aspekte Sicherheit undschnelle Verfügbarkeit von den Senioren und Senior<strong>in</strong>nenals zentrale Kriterien genannt werden, treten spekulativeMotive <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergrund (Gesellschaft für Konsumforschung2002). Des Weiteren wird <strong>der</strong> Bedarf nach Informations-und Beratungsangebot weiter zunehmen. Hierzuergab e<strong>in</strong>e bundesweite Umfrage unter Senioren und Senior<strong>in</strong>nen,dass gerade im Bankenbereich e<strong>in</strong>e persönlicheBetreuung gewünscht ist. Zudem stellen Bankautomatenund Computerterm<strong>in</strong>als ältere Menschen oftmalsvor Probleme, weil <strong>der</strong> Umgang als zu kompliziert empfundenwird. In diesem Bereich würden sich ältere Kundenund Kund<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong> erhöhtes Beratungsangebot durche<strong>in</strong>e persönliche Bezugsperson wünschen.Auch im Bereich des Versicherungsbedarfs ergeben sichaltersspezifische Verän<strong>der</strong>ungen. Arbeitsbezogene Risikenentfallen weitestgehend, dafür entstehen im Alterneue Unfallrisiken o<strong>der</strong> das Risiko Pflegebedürftigkeit,die zunehmend <strong>in</strong> den Interessenvor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> älterenMenschen rücken. Außerdem wird auch die hohe Heterogenität<strong>der</strong> Altersgruppe Auswirkungen auf die Angebote<strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzbranche haben. E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> älteren Kundenwird immer höhere Ansprüche an Produkt und Beratungstellen und e<strong>in</strong> Anlagekonzept erwarten, das se<strong>in</strong>e persönlichenAnlageziele und Rendite- und Risikoprofilee<strong>in</strong>bezieht, während an<strong>der</strong>e sich auf möglichst e<strong>in</strong>facheund nachvollziehbare Versicherungs- und Sparformenbeschränken. Produktseitig lassen sich zwei Tendenzenbeschreiben: Zum e<strong>in</strong>en die e<strong>in</strong>fachen, alltäglichen Formen<strong>der</strong> Vermögensverwaltung, <strong>der</strong> Versicherung und desZahlungsverkehrs, die im Wesentlichen e<strong>in</strong>e nutzerfreundlicheBanktechnik erfor<strong>der</strong>n; zum an<strong>der</strong>en komplexeund beratungs<strong>in</strong>tensive Produkte, die bedarfsgerechtan die Lebenssituation und die <strong>in</strong>dividuellenKundenbedürfnisse angepasst s<strong>in</strong>d. Dies können spezielle„Seniorenprodukte“ se<strong>in</strong>, überwiegend wird es sich aberum Varianten bestehen<strong>der</strong> Produkte handeln, die flexibelgestaltet s<strong>in</strong>d und baukastenartig an <strong>in</strong>dividuelle Bedarfslagenangepasst werden können.Die Entwicklung und Erprobung <strong>in</strong>novativer F<strong>in</strong>anzdienstleistungenist e<strong>in</strong> Schlüsselthema <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft.In Japan zum Beispiel werden seit e<strong>in</strong>iger Zeitneue F<strong>in</strong>anzkonstruktionen erprobt: Dort gibt es viele ältereMenschen mit Immobilienbesitz, die oftmals nur ungernverkauft werden (wie <strong>in</strong> Deutschland auch). ÄltereHausbesitzer und Hausbesitzer<strong>in</strong>nen können Teile ihresHauses an F<strong>in</strong>anzdienstleister verkaufen und erhalten dafürmonatliche Zahlungen, quasi als Zusatzrente. DieseAktivitäten s<strong>in</strong>d noch nicht sehr weit gediehen und mitgroßen Unsicherheiten behaftet, z.B. bei <strong>der</strong> Bewertung<strong>der</strong> Immobilien. Aber sie zeigen doch e<strong>in</strong>erseits Möglichkeitenauf, wie ältere Menschen ihren monatlichen Lebensunterhaltverbessern können. An<strong>der</strong>erseits wird das
Drucksache 16/2190 – 160 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeim Immobilienbesitz gebundene Kapital wie<strong>der</strong> demvolkswirtschaftlichen Kreislauf zugeführt. VergleichbareProdukte („Reverse Mortgage“, „Home Reversion“) werdenvor allem <strong>in</strong> den USA und Großbritannien angeboten,während <strong>in</strong> Deutschland ähnliche Produkte bisher eherdie Ausnahme s<strong>in</strong>d. Auch Versicherungsprodukte, diesich an den geän<strong>der</strong>ten Bedarfen e<strong>in</strong>er älter werdendenGesellschaft orientieren und flexibel auf unterschiedlicheLebensphasen angepasst werden, s<strong>in</strong>d für die Zukunftvorstellbar. Das bekannte Modell <strong>der</strong> privaten Absicherungim Krankheits- o<strong>der</strong> Pflegefall könnte durch e<strong>in</strong> Modell,das die wohnbegleitende Unterstützung für Älteref<strong>in</strong>anziell und – bestenfalls – auch organisatorisch absichert,ergänzt werden.5.4 Exkurs: Der japanische Silbermarkt(‚shirubâ maketto‘)Die gewachsene Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Alterlässt sich auch am Beispiel des japanischen Silbermarktserkennen. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> im Vergleich zu an<strong>der</strong>enIndustrienationen außerordentlich schnell stattf<strong>in</strong>dendengesellschaftlichen Alterung und <strong>der</strong> weltweit höchstenAnteile Älterer s<strong>in</strong>d auf die Bedürfnisse von Seniorenund Senior<strong>in</strong>nen ausgerichtete Produkte und Dienstleistungen<strong>in</strong> Japan von großer Bedeutung. In e<strong>in</strong>igen Marktsegmentenwurde <strong>in</strong> Japan schon sehr früh erkannt, wiegroß die Konsumentenrolle <strong>der</strong> älteren Japaner und Japaner<strong>in</strong>nenist und entsprechende Angebote entwickelt. Folgende,beson<strong>der</strong>s erfolgreiche Sektoren im japanischensilver market lassen sich anführen (Gerl<strong>in</strong>g & Conrad2002):Wohnen: Als positive Beispiele s<strong>in</strong>d barrierefreies Wohnen,altengerechte Wohnraumanpassungsmaßnahmen,wohnbegleitende Unterstützungsdienste und – neben demklassischen Altenhilfeangebot – spezielle Wohnangebotefür Senior<strong>in</strong>nen und Senioren zu nennen. Seit 1996 wirddie Vergabe von beson<strong>der</strong>s günstigen Baukrediten <strong>der</strong> öffentlichenWohnungsbauf<strong>in</strong>anzierer von <strong>der</strong> E<strong>in</strong>haltung<strong>der</strong> dort fest gelegten Konstruktionsrichtl<strong>in</strong>ien abhängiggemacht (Nenk<strong>in</strong> Shik<strong>in</strong> Un’yô Kik<strong>in</strong> 2001). Auch hatdas japanische Baum<strong>in</strong>isterium bereits seit 1991 e<strong>in</strong>eReihe von Richtl<strong>in</strong>ien für das barrierefreie (bariafur)Wohnen erlassen. Insgesamt soll <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> barrierefreienWohnungen bis zum Jahr 2015 auf 20 Prozent erhöhtwerden (Kokudo Kôtsûshô 2001).Haushaltsbezogene Dienstleistungen: (verstanden alsDienste, die neben und über die grundpflegerische Versorgungh<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e selbstständige Lebensführung <strong>in</strong> <strong>der</strong>eigenen Häuslichkeit ermöglichen) haben <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eseit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> Pflegeversicherung im April 2004deutlich zugenommen und können als e<strong>in</strong> ganz beson<strong>der</strong>sdynamischer Wachstumsmarkt im japanischen Silbermarktbezeichnet werden. Neben <strong>der</strong> Pflegeversicherunggibt es aber auch e<strong>in</strong>e kommunale sowie e<strong>in</strong>e privateF<strong>in</strong>anzierungsbasis (bei allerd<strong>in</strong>gs mehrheitlicher F<strong>in</strong>anzierungdurch die Pflegeversicherung). Im e<strong>in</strong>zelnen umfassendie Maßnahmen u.a. Leistungen <strong>der</strong> Hauswirtschaft(z.B. Putz- und Waschdienste, E<strong>in</strong>kaufs- undMahlzeitendienste), <strong>der</strong> Kommunikation (z.B. Kontaktserviceper Telefon o<strong>der</strong> Internet) und <strong>der</strong> Integration(z.B. Fahr- und Sicherheitsdienste) (Conrad 2002; Conrad,Gerl<strong>in</strong>g & Naegele 2005). Zu beachten ist jedoch,dass privat f<strong>in</strong>anzierte hauswirtschaftliche Dienste <strong>in</strong>Japan bereits über e<strong>in</strong>e lange Tradition verfügen. Siewenden sich allerd<strong>in</strong>gs nicht nur an Senior<strong>in</strong>nen und Senioren,son<strong>der</strong>n an alle Bevölkerungsgruppen (z.B. Grabpflege,Versorgung von Haustieren, Rasenmähen o<strong>der</strong>Auswechseln von Glühbirnen).Seniorentourismus: Hier fällt u.a. zunächst die Erfolgversprechende Aufteilung <strong>der</strong> verschiedenen Seniorengruppenzwischen den Reiseveranstaltern auf. Dabei gel<strong>in</strong>gtdurch die Konzentration auf bestimmte Zielgruppendie Berücksichtigung unterschiedlicher Reisebedürfnisse<strong>in</strong> sehr hohem Maße. Generell lässt sich am Beispiel diesesMarktsegments verdeutlichen, dass sich die Konsumbedürfnisse<strong>der</strong> japanischen Älteren nicht auf e<strong>in</strong>en Nennerbr<strong>in</strong>gen lassen, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong>tern differenziert werdenmüssen.Neue Medien: Dieser Bereich ist Gegenstand <strong>der</strong> För<strong>der</strong>politikdes japanischen M<strong>in</strong>isteriums für Wirtschaft, Handelund Industrie (METI), das explizit auf die Erleichterung<strong>der</strong> Nutzung neuer Medien durch Ältere und auf diegezielte Entwicklung von auf die Bedürfnisse von älterenMenschen ausgerichteten neuen Medien zielt. Unter an<strong>der</strong>emgeht es um spezielle Software für die leichtereNutzung von Computern, Emails und Internet von Senior<strong>in</strong>nenund Senioren und Körperbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten. Darüber h<strong>in</strong>ausvergibt das METI für Projekte aus dem Bereich‚Barrierefreie Medien‘ (Jôhô bariafur projekto) e<strong>in</strong>e100 prozentige För<strong>der</strong>ung.Die Voraussetzungen für die Entwicklung des Silbermarktss<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Japan <strong>in</strong>sgesamt deshalb günstig, weil dieE<strong>in</strong>kommenssituation älterer Menschen <strong>in</strong> weiten Teilengut ist und zudem das Bewusstse<strong>in</strong> für die Chancen diesesMarktes auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Unternehmen und zuständigenM<strong>in</strong>isterien stark ausgeprägt ist. Im Zuge e<strong>in</strong>es sichän<strong>der</strong>nden Bildes älterer und beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen wirdseit Mitte <strong>der</strong> 1990er-Jahre verstärkt <strong>in</strong> so genannteKyoyô-h<strong>in</strong>-Produkte (wörtlich: geme<strong>in</strong>sam nutzbare Produkte)<strong>in</strong>vestiert, die durch benutzerfreundliche Handhabungund Barrierefreiheit gekennzeichnet s<strong>in</strong>d und denBedürfnissen aller Bevölkerungsgruppen entgegenkommensollen (Yoshikazu 2002: 25). Daneben bietet die imApril 2000 nach deutschem Vorbild e<strong>in</strong>geführte Pflegeversicherungzusätzliche Anreize <strong>zur</strong> Entwicklung desPflegeprodukt- und Dienstleistungsmarktes.Vor dem H<strong>in</strong>tergrund gleichzeitig bestehen<strong>der</strong> hemmen<strong>der</strong>Faktoren – wie <strong>der</strong> Heterogenität <strong>der</strong> Zielgruppe, demschlechten Image von Produkten für Ältere und <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>genGröße <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Herstellung von Pflegeprodukten arbeitendenBetriebe – ist <strong>der</strong> weitere Ausbau dieses Marktesjedoch auch <strong>in</strong> Japan ke<strong>in</strong> Selbstläufer und bedarfgezielter Strategien. Das japanische M<strong>in</strong>isterium fürWirtschaft, Handel und Industrie betrachtet die demografischeEntwicklung als große Chance für die weitere wirtschaftlicheEntwicklung des Landes und führt spezielleMaßnahmen durch, „die nötig s<strong>in</strong>d, um die Bevölkerungsalterungzu e<strong>in</strong>er Wachstumsmasch<strong>in</strong>e zu machen“.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 161 – Drucksache 16/2190Dazu zählen För<strong>der</strong>programme, die auf die Entwicklungvon Produkten und Geräten ausgerichtet s<strong>in</strong>d, die das Alltagslebenund die Pflege von Senioren und Senior<strong>in</strong>nensowie die Nutzung neuer Medien durch diese Zielgruppeerleichtern. Daneben wird auf e<strong>in</strong>e verstärkte Zusammenarbeitvon Industrie, Forschung und Verwaltung sowie e<strong>in</strong>erWeiterentwicklung <strong>der</strong> Pflegepolitik <strong>in</strong> Richtunge<strong>in</strong>er gesundheitlichen Prävention aller Bevölkerungsgruppenabgezielt (Gerl<strong>in</strong>g & Conrad 2002: 16 ff.). ZurStärkung des japanischen Silver Market wurde 1987 darüberh<strong>in</strong>aus die „El<strong>der</strong>ly Service Provi<strong>der</strong>s Association“gegründet, die als halbstaatliche Randorganisation desGesundheitsm<strong>in</strong>isteriums u.a. <strong>in</strong> den Bereichen Forschung,Fort- und Weiterbildung sowie <strong>der</strong> Qualitätssicherungtätig ist.Die Marktpotenziale <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft werden allgeme<strong>in</strong>als sehr hoch e<strong>in</strong>geschätzt. So prognostizierte dasWirtschaftsm<strong>in</strong>isterium 1997 15 neue Wachstumsmärkte,worunter <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ische und wohlfahrtsorientierte Bereichals <strong>der</strong> größte e<strong>in</strong>geschätzt wurde. In diesem Bereichsollen bis 2010 1,3 Mio. neue Arbeitsplätzegeschaffen und se<strong>in</strong> Marktvolumen soll von heute 38 BillionenYen (ca. 327 Mrd. Euro) auf 91 Billionen Yen (ca.784 Mrd. Euro) ansteigen (JETRO 2000:6). Nach denvorliegenden Veröffentlichungen und den Untersuchungen<strong>der</strong> Market<strong>in</strong>gagenturen Hakkuhodo und Itôchû liegendie größten Marktpotenziale <strong>in</strong> den Bereichen Pflegeim weitesten S<strong>in</strong>ne (wie Toilettenartikel, Kosmetika undNahrungsmittel), Reisen, Automobile, Neue Medien,F<strong>in</strong>anzwesen und Bekleidung. Der so genannte ‚welfareapparatus‘ Markt – unter den alle Produkte und technischenGeräte subsumiert werden, die <strong>zur</strong> Wohlfahrtspflegee<strong>in</strong>gesetzt werden – hat seit Mitte <strong>der</strong> 1990er-Jahremit e<strong>in</strong>er durchschnittliche jährlichen Wachstumsrate vonca. 15 Prozent sehr stark zugenommen. Der Markt fürKyôyo-h<strong>in</strong>-Produkte hat im gleichen Zeitraum um knapp22 Prozent zugenommen, womit er bei <strong>der</strong> Entwicklungdes ‚welfare-apparatus‘-Markts e<strong>in</strong>e zentrale Rolle spielt.Der Markt für Pflegeprodukte im engeren S<strong>in</strong>n (4,8 Prozent)und für Produkte <strong>der</strong> persönlichen Pflege (5,5 Prozent)hat demgegenüber weit weniger stark zugenommen(Keizai Sangyôshu 2002; Yoshikazu 2002: 26).Insgesamt lassen sich folgende wichtigen „Erfolgskriterien“des japanischen Beispiels benennen:– Politische Impulse <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft,z.B. durch die Zusammenführung und Ergänzungbestehen<strong>der</strong> Handlungsansätze, <strong>der</strong> Entwicklunge<strong>in</strong>er gezielten För<strong>der</strong>praxis und <strong>der</strong> Unterstützungvon Kooperation und Vernetzung.– Gezielte öffentliche Sensibilisierung <strong>der</strong> Wirtschaft,z.B. durch die Durchführung von Untersuchungenüber deutsche Ansätze <strong>der</strong> Entwicklung des Silbermarktesund zum Marktpotenzial.– Entwicklung und Unterstützung <strong>in</strong>novativer Marktforschungund Market<strong>in</strong>gstrategien, z.B. durch dieDurchführung von Marktforschung (siehe das BeispielHakuhodo) <strong>der</strong> Verwendung ausgefallener Market<strong>in</strong>gansätze(siehe das Beispiel Shiseido) und <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ungdes Universal Design Ansatzes.– Differenzierte Markterschließung und Zielgruppenansprache,z.B. durch die Untersuchung bislang nicht berücksichtigterMarktsegmente <strong>der</strong> japanischen Seniorenwirtschaft,die Ausweitung <strong>der</strong> Handlungsfel<strong>der</strong>auch auf an<strong>der</strong>e Bereiche und <strong>der</strong> gezielten Ausrichtung<strong>der</strong> Produkte und Dienstleistungen auf die verschiedenenTeilgruppen <strong>der</strong> Zielgruppe.– Intensivierung des <strong>in</strong>ternationalen wissenschaftlichen,wirtschaftlichen und unternehmerischen Austauschs.5.5 Seniorenwirtschaftliche Initiativen <strong>in</strong>Bund, Län<strong>der</strong>n und Geme<strong>in</strong>denObwohl das Alter(n) und die älteren Menschen zu e<strong>in</strong>emwichtigen Objekt und <strong>zur</strong> Zielgruppe für e<strong>in</strong>e Reihe vonInstitutionen, Akteuren und Aktivitäten auch außerhalbdes sozialen Sektors geworden s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d abgestimmteund Ressort übergreifende politische Initiativen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> Seniorenwirtschaft noch die Ausnahme. Trotze<strong>in</strong>er zunehmenden, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel allerd<strong>in</strong>gs noch diffusenWahrnehmung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Chancen, die sichdurch die Alterung <strong>der</strong> Gesellschaft bieten, zeigen dievorliegenden Gestaltungsansätze e<strong>in</strong> klares Bild: Konsistentewirtschaftliche Strategien o<strong>der</strong> politisch abgestimmteLangfristplanungen liegen nur bruchstückhaftvor.Die aufgeführten Gestaltungsfel<strong>der</strong> für seniorenorientierteProdukte und Dienstleistungen zeigen allerd<strong>in</strong>gs,dass das Altern <strong>der</strong> Gesellschaft als Wirtschaftskraft langsamerkannt wird. Stellt doch <strong>der</strong> Faktor Seniorenwirtschaftfür die Volkswirtschaft e<strong>in</strong>en erheblichen wirtschaftlichenEntwicklungsimpuls dar und trägt mit se<strong>in</strong>enDienstleistungen und Produkten enorm <strong>zur</strong> volkswirtschaftlichenWertschöpfung mit entsprechenden positivenAuswirkungen auf den Arbeitsmarkt bei.Im Folgenden wird e<strong>in</strong> Überblick über erste Erfahrungenmit landespolitischen Initiativen gegeben, die versuchendurch e<strong>in</strong> strukturiertes Vorgehen die Aktivitäten <strong>der</strong> Seniorenwirtschaftauf Landesebene zu bündeln, zu unterstützenund weitere an<strong>zur</strong>egen. Diese Ansätze bieten e<strong>in</strong>enÜberblick über den Stand <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong>Deutschland und zeigen, <strong>in</strong> welcher Form die Chancendes demografischen Wandels durch die politische Aktivierung<strong>der</strong> Seniorenwirtschaft ergriffen werden.Bundes- und landesweit gibt es sehr viele und sehr unterschiedlicheAnsätze, sich mit älteren Menschen zu befassen.Auf landespolitischer Ebene lassen sich viele Aktivitätenbeobachten, die den Fokus auf den Bereich desWohnens im Alter richten. Allerd<strong>in</strong>gs konnten nur wenigabgestimmte Aktivitäten <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Seniorenwirtschaftlokalisiert werden. Auch die Bundesregierungweist auf die Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschafth<strong>in</strong>. Die dezidierte Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit denwirtschaftlichen Potenzialen älterer Menschen erfolgt jedocherst <strong>in</strong> jüngster Zeit.
Drucksache 16/2190 – 162 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDie Landes<strong>in</strong>itiative Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-WestfalenVor dem H<strong>in</strong>tergrund, die ökonomischen Potenziale <strong>der</strong>älteren Menschen gezielter zu nutzen, hat das nordrhe<strong>in</strong>westfälischeBündnis für Arbeit bereits im August 1999e<strong>in</strong>e eigenständige Arbeitsgruppe Seniorenwirtschaft <strong>in</strong>itiiert,die im weiteren Verlauf <strong>in</strong> die Landes<strong>in</strong>itiative Seniorenwirtschaftüberführt worden ist. Die geme<strong>in</strong>sameTrägerschaft wird von den nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Arbeitgeberverbändenund Gewerkschaften, Kammern undFachverbänden von Handwerk, Industrie und Handel und<strong>der</strong> nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Landesregierung mit den fürdie Bereiche Familie, Soziales, Wirtschaft und Wohnenzuständigen M<strong>in</strong>isterien gebildet.Ziel <strong>der</strong> Landes<strong>in</strong>itiative Seniorenwirtschaft ist die Entwicklungseniorenorientierter Dienstleistungen und Produkte<strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> älteren Bevölkerung und dieFör<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> damit <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stehenden Beschäftigungschancen.Des Weiteren soll sich durch die Initiativedas Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen als Kompetenzstandort fürFragen <strong>der</strong> demografischen Entwicklung, des Alters und<strong>der</strong> Seniorenwirtschaft profilieren (Cirkel, Frerichs &Gerl<strong>in</strong>g 2000). In diesem Zusammenhang wurden bisherdrei Themenkomplexe als Handlungsfel<strong>der</strong> identifiziert,zu denen sich die jeweiligen Unterarbeitsgruppen gebildethaben:– Telekommunikation und Neue Medien für Ältere;– Wohnen, Handwerk und Dienstleistungswirtschaft;– Freizeit, Tourismus, Sport und Wellness.Im Rahmen <strong>der</strong> Arbeitsgruppen und weiteren Arbeitskreisenwurden <strong>in</strong> den drei Handlungsfel<strong>der</strong>n u.a. folgendeProjekte <strong>in</strong>itiiert und durchgeführt:– Entwicklung des Qualitätssiegels „Wohnen mit Servicefür ältere Menschen“;– Aufbau spezieller Internetangebote für ältere Menschen;– Aufbau von Internetcafés für ältere Menschen <strong>zur</strong> Vermittlungvon Medienkompetenz;– Qualifizierung von Reisebegleiter<strong>in</strong>nen und -begleiternim Seniorentourismus;– Entwicklung des Leitfadens „Ältere Menschen aufReisen“;– För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>es wissenschaftlichen Weiterbildungsangebotsfür ältere Menschen auf privatwirtschaftlicherBasis („Seniorenuniversität“).Des Weiteren wurden handlungsfeldübergreifend mehrereFachtagungen durchgeführt, mit dem Ziel, die relevantenwirtschaftlichen Akteure <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen für dieThematik zu sensibilisieren (Gerl<strong>in</strong>g, Naegele &Scharfenorth 2004).Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Schleswig-Holste<strong>in</strong>Um die Chancen und Herausfor<strong>der</strong>ungen zu verdeutlichen,die e<strong>in</strong>e alternde Gesellschaft mit sich br<strong>in</strong>gt, hatdas Land Schleswig-Holste<strong>in</strong> im Jahr 2003 die Studie„Zukunftsfähiges Schleswig-Holste<strong>in</strong> – Konsequenzendes demografischen Wandels“ <strong>in</strong> Auftrag gegeben. Alszentrale Fragen wurden e<strong>in</strong>erseits die verän<strong>der</strong>te Nachfrage<strong>der</strong> älteren Menschen untersucht, an<strong>der</strong>erseits aberauch die Anfor<strong>der</strong>ungen, die sich daraus für Wirtschaft,Politik und Gesellschaft ergeben. Ferner wurde das Zusammenleben<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en thematisiert (Cirkel, Hilbert& Schalk 2004). Insgesamt wurden die Chancen undHerausfor<strong>der</strong>ungen des demografischen Wandels unterfolgenden vier Themenschwerpunkten untersucht:– Wirtschaft und Arbeitswelt: Zukünftiger Arbeitskräftebedarf,verän<strong>der</strong>te Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen, Verän<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> Konsumgewohnheiten und die Auswirkungenauf die Wirtschaft;– Lebenslanges Lernen: Zukunft von Schulen undHochschulen, Seniorenuniversitäten, berufsbezogeneQualifizierung, Weiterbildung für ältere Arbeitnehmerund Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen;– Infrastruktur und Lebensumfeld: Gesundheitsversorgung,Verkehr, Wohnen unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigungaltersgerechter Wohnformen;– Gesellschaftliches Leben: Soziale Netzwerke, <strong>in</strong>tergenerationelleProjekte, Freizeitangebote.Auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Studie hat die Landesregierungu.a. folgende Projekte beschlossen (LandesregierungSchleswig-Holste<strong>in</strong> 2004):– Lebenslanges Lernen von Hochschulabsolventen:Hierbei geht es sowohl um die Weiterqualifizierungaltern<strong>der</strong> Belegschaften, als auch um die Schaffungspezieller Angebote für ältere Hochschulabsolventenund Hochschulabsolvent<strong>in</strong>nen;– Wachstumspotenziale für den Tourismus: In e<strong>in</strong>er Studiesollen die Anfor<strong>der</strong>ungen an die Tourismusbrancheuntersucht werden, welche die Zielgruppe <strong>der</strong>Älteren mit sich br<strong>in</strong>gen, zu dem soll e<strong>in</strong> Handlungskatalogfür die Anbieter und die Tourismuspolitik erstelltwerden;– Wohnen im Alter: Mit dem Ziel, den Wunsch <strong>der</strong> älterenMenschen nach dem Verbleiben <strong>in</strong> <strong>der</strong> eigenenWohnung so lang wie möglich aufrecht zu erhalten,sollen gezielt altersgerechte Wohnformen entwickeltwerden;– Gesundheitsland Schleswig-Holste<strong>in</strong> 2015: Ziel soll esse<strong>in</strong>, die gesundheitliche Versorgung für alle Bevölkerungsgruppenauf e<strong>in</strong>em qualitativ hohen Niveau zu f<strong>in</strong>anzierbarenKonditionen zu erhalten;– Anpassung des Verbraucherschutzes an e<strong>in</strong>e älter werdendeGesellschaft.In diesen Projekten lassen sich die konkreten Ansätze e<strong>in</strong>erseniorenwirtschaftlich ausgerichteten Landespolitikerkennen. Ferner wird betont, dass alle Ergebnisse dialogorientiertmit den Vertretern und Vertreter<strong>in</strong>nen <strong>der</strong> Wirtschaft,den Wohlfahrtsverbänden, den Seniorenorganisa-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 163 – Drucksache 16/2190tionen und allen weiteren beteiligten Akteuren erarbeitetwerden.Initiativen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> BayernIn Bayern ist im Rahmen <strong>der</strong> regionalen Hightech-Offensive(HTO) Bayern e<strong>in</strong> Programm <strong>zur</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären<strong>Generation</strong>en-Forschung – das „<strong>Generation</strong> ResearchProgram“ (GRP) - mit Fokussierung auf die 50+ <strong>Generation</strong>e<strong>in</strong>gerichtet worden. Standorte des GRP s<strong>in</strong>d Münchenund Bad Tölz, mit dem Behörden- und Dienstleistungszentrum„Forum <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en“.Das „<strong>Generation</strong> Research Program“ ist e<strong>in</strong>e Initiative imRahmen des Humanwissenschaftlichen Zentrums (HWZ)<strong>der</strong> Ludwig-Maximilians-Universität München <strong>zur</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ärenAlternsforschung. Die ForschungsschwerpunkteForschung, Mediz<strong>in</strong> und soziale Dienste sowieWirtschaft beschäftigen sich mit Fragen <strong>der</strong> generationenübergreifendenGrundlagenforschung, <strong>der</strong> Anwendungvon Wissen <strong>in</strong> mediz<strong>in</strong>ischen und sozialen E<strong>in</strong>richtungenund mit <strong>der</strong> Konzeption von <strong>in</strong>novativenTechnologien, wobei beson<strong>der</strong>es Augenmerk auf die Umsetzungvon Forschungsergebnissen, <strong>in</strong> Produkte undTechnologien gelegt wird, die älteren Menschen das Lebenerleichtern. Im Programm arbeiten Forscher unterschiedlicherFachrichtungen geme<strong>in</strong>sam an <strong>der</strong> Beantwortung<strong>der</strong> Frage: „Wie können wir im Alter besserleben?“. Sie versuchen, das Wissen <strong>der</strong> Grundlagenforschung<strong>in</strong> die Alltagspraxis mit neuen Verfahren und Produktenumzusetzen. Gearbeitet wird u.a. an Projekten ausden Bereichen Ernährung und Chemosensorik, Zeit undKognition, visuelle Wahrnehmung sowie Mensch-Masch<strong>in</strong>eInterface. Das formulierte Ziel dieser Initiativelautet: Erhöhung <strong>der</strong> Lebensqualität aller, vor allem <strong>der</strong>Älteren.Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Mecklenburg-VorpommernDas Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Gesundheitswirtschaftals e<strong>in</strong>en erheblichen Wachstums- undWirtschaftsfaktor identifiziert. In diesem Zusammenhangwurde e<strong>in</strong>e Expertise erstellt, die die Seniorenwirtschaftals e<strong>in</strong>en Teilbereich <strong>der</strong> Gesundheitswirtschaft hervorhebt.Auf Grund <strong>der</strong> demografischen Entwicklung wirdgerade diesem Teilbereich e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>s günstigeWachstumsrate besche<strong>in</strong>igt. Neben dem „klassischen“Gesundheitsmarkt (pflegerische Versorgung) s<strong>in</strong>d es geradedie Randbereiche <strong>der</strong> Gesundheitswirtschaft, für diesich neue wirtschaftspolitisch relevante Chancen undMöglichkeiten ergeben: Produkte und Dienstleistungenfür mehr Lebensqualität im Alter, <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> Geronto-Technik,Gesundheitsprophylaxe und <strong>der</strong> Bereichdes Seniorentourismus werden als aussichtsreiche Wachstumsfel<strong>der</strong>beschrieben. Gerade <strong>der</strong> Tourismus <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dungmit gesundheitlichen Angeboten kann aus <strong>der</strong> gutausgebauten Kur- und Bä<strong>der</strong>landschaft <strong>in</strong> Mecklenburg-Vorpommern resultieren.In dem aus den Ergebnissen <strong>der</strong> Expertise entstandenen„Masterplan für Mecklenburg-Vorpommern“ werdenzwar ke<strong>in</strong>e konkreten Pläne <strong>zur</strong> Etablierung e<strong>in</strong>er Seniorenwirtschaftgenannt, dennoch lassen sich verschiedeneAktivitäten mit entsprechendem seniorenwirtschaftlichemH<strong>in</strong>tergrund erkennen. Im Wesentlichen setzt sich<strong>der</strong> Plan aus drei so genannten Erfolgselementen zusammen:– Zusammenarbeit: Bildung von Netzwerken;– För<strong>der</strong>ung von Produkten und Projekten;– Zielgerichtetes Market<strong>in</strong>g.Um diese Elemente zu vere<strong>in</strong>en, wurde e<strong>in</strong> Maßnahmenkatalogentwickelt, <strong>der</strong> im Wesentlichen auf den Ausbau<strong>der</strong> Tourismus- und Gesundheitsbranche abzielt. Erwähnenswertist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang unter seniorenwirtschaftlichemAspekt <strong>der</strong> barrierefreie Ausbau <strong>der</strong> Gesundheitse<strong>in</strong>richtungenund die Absicht des Landes, das„Ruhestands-El-Dorado“ und das „Florida des Nordens“zu werden (Wirtschaftsm<strong>in</strong>isterium Mecklenburg-Vorpommern2003).Regionale Initiativen: Die K.E.R.N.-RegionBei <strong>der</strong> K.E.R.N.-Region handelt es sich um e<strong>in</strong> regionalesBündnis <strong>der</strong> schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Städte Kiel,Eckernförde, Rendsburg und Neumünster, dem KreisRendsburg-Eckernförde sowie <strong>der</strong> Industrie- und HandelskammerKiel, verschiedenen Unternehmensverbändenund dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Ziel diesesBündnisses ist die Intensivierung <strong>der</strong> Kooperation <strong>der</strong>Kommunen, die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> technologischen Entwicklungund <strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft undVerbänden.Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund haben die Bündnispartner <strong>der</strong>Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> <strong>der</strong> Region beson<strong>der</strong>e Beachtunggeschenkt. Mit dem Projekt „Seniorenorientierter WirtschaftsraumK.E.R.N.“ stellt sich die Region auf das zukünftigeNachfragepotenzial e<strong>in</strong>. Im Mittelpunkt stehendabei die Wünsche und Bedürfnisse <strong>der</strong> älteren Menschen.Um diese besser abschätzen zu können, wurde <strong>in</strong><strong>der</strong> Region e<strong>in</strong>e Befragung <strong>der</strong> älteren Menschen durchgeführt,<strong>in</strong> <strong>der</strong> u.a. <strong>der</strong> Bedarf nach Kultur- und Freizeitangeboten,nach E<strong>in</strong>zelhandel- und ärztlicher Versorgungund nach Wohnungsangeboten erfasst wird. Die Ergebnissesollen dazu dienen, Handlungsempfehlungen fürWirtschaft und Kommunen zu erstellen, um somit die Seniorenwirtschaft<strong>in</strong> <strong>der</strong> Region zu e<strong>in</strong>em Zukunftsmarktmit großem Wachstumspotenzial zu entwickeln.Beson<strong>der</strong>s im Bereich des Seniorentourismus erwartet dieRegion <strong>in</strong> den nächsten Jahren e<strong>in</strong>en deutlichen Zuwachs,aus dem sich positive Beschäftigungseffekte ergebenkönnen.Regionale Initiativen im RuhrgebietE<strong>in</strong>e weitere Initiative (getragen u.a. von <strong>der</strong> IHK Dortmundund <strong>der</strong> IHK Bochum sowie dem Projekt Ruhr) istdurch e<strong>in</strong>e „Best-Practice-Studie“ <strong>in</strong>itiiert worden. Dazuwurde Ende 2004, Anfang 2005 von <strong>der</strong> Forschungsgesellschaftfür Gerontogie e.V. und <strong>der</strong> Ruhr-Universität-Bochum e<strong>in</strong>e Umfrage bei rund 350 Unternehmen zum
Drucksache 16/2190 – 164 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeThema „Perspektiven <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft – wo gibt esunternehmerische Interessen und Anknüpfungspunkte“durchgeführt, die von über 50 mündlichen Interviews untermauertwurde. Die Ergebnisse <strong>der</strong> Studie lassen sichwie folgt zusammenfassen:– Das Interesse an <strong>der</strong> „Seniorenwirtschaft“ ist groß.Viele Unternehmen sehen <strong>in</strong>teressante wirtschaftlicheEntwicklungsperspektiven.– Diese betreffen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die vier Brachen Gesundheit/Wellness,Wohnen/Immobilien, IT & NeueMedien sowie F<strong>in</strong>anzdienstleistungen.– Konkrete Gestaltungsfel<strong>der</strong> werden gesehen <strong>in</strong> denBereichen För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> selbstständigen Lebensführungdurch technische Unterstützung, <strong>in</strong>novativesWohnen im Alter, beson<strong>der</strong>e Urlaubs-, Fitness- undWellnessangebote, <strong>in</strong>telligente Kommunikationstechniksowie „Entsparberatung“.– Insgesamt gefragt s<strong>in</strong>d sogenannte Netzwerk- undClusterlösungen, also solche Lösungen, die aufSchnittstellenprojekte zwischen unterschiedlichenBranchen und Unternehmen angelegt s<strong>in</strong>d, also z.B.zwischen IT und sozialen Diensten o<strong>der</strong> zwischenTourismus<strong>in</strong>dustrie und Wellnessbranche.– Entwicklungsperspektiven liegen ebenfalls <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kooperationprivater Anbieter mit frei-geme<strong>in</strong>nützigenund öffentlichen Trägern.– Beson<strong>der</strong>e Potenziale werden <strong>in</strong> Public-Private-PartnershipModellen gesehen.In den vorstehenden Kapiteln s<strong>in</strong>d die programmatischenVorsätze und konkreten Ansätze (soweit erkennbar undnachvollziehbar) <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Seniorenwirtschaftaus mehreren Bundeslän<strong>der</strong>n dargestellt worden. SystematischeErhebungen und Analysen zu den Wirkungendieser Ansätze liegen allerd<strong>in</strong>gs bislang lei<strong>der</strong> nicht vorund konnten auch im Zusammenhang mit <strong>der</strong> vorliegendenExpertise aus Zeit- und Kostengründen nicht erstelltwerden. Nicht nur <strong>in</strong> NRW ist <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong>breites Netzwerk von Akteuren entstanden, das sich mit<strong>der</strong> Seniorenwirtschaft befasst. Es reicht von <strong>der</strong> Wirtschafts-und Sozialpolitik, <strong>der</strong> freien Wohlfahrtspflege,<strong>der</strong> Landesseniorenvertretung über Handwerks-, Industrie-und Handelsorganisationen bis h<strong>in</strong> zu Verkehrs- undTouristikanbietern. Nach zwei Jahren hat die Landes<strong>in</strong>itiativeSeniorenwirtschaft e<strong>in</strong>en ersten <strong>Bericht</strong> vorgelegt,aus dem hervorgeht, dass <strong>in</strong> Projekten und Initiativen, dieim unmittelbaren Kontakt <strong>zur</strong> Landes<strong>in</strong>itiative stehen,rund 2000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden s<strong>in</strong>d. Darüberh<strong>in</strong>aus wird mit e<strong>in</strong>er sehr breiten Multiplikatorwirkunggerechnet, jedoch gibt es ke<strong>in</strong>e Anhaltspunkte überdie Größe dieses Effekts. In etwa im gleichen Zeitraum(1999 bis 2001) entstanden <strong>in</strong> <strong>der</strong> ambulanten, teilstationärenund stationären Pflege ca. 10.300 zusätzliche Arbeitsplätze.Diese Informationen verdeutlichen, dass– das Altern <strong>der</strong> Gesellschaft e<strong>in</strong> wichtiger Beschäftigungsmotorist.– die größte Schubkraft wahrsche<strong>in</strong>lich aus dem Pflegebereichkommt.– neben <strong>der</strong> Pflege <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Bereichen <strong>in</strong> signifikanterGrößenordnung weitere seniorenwirtschaftliche Arbeitsplätzeentstehen können.5.6 Verbraucherpolitik und Verbraucherschutzfür ältere MenschenMit <strong>der</strong> Entdeckung <strong>der</strong> Senioren als kaufkräftige Zielgruppetritt auch die Frage nach <strong>der</strong> Notwendigkeit e<strong>in</strong>erspezifischen Verbraucherpolitik und Maßnahmen desVerbraucherschutzes für ältere Menschen stärker als bisher<strong>in</strong> den alten- und verbraucherpolitischen Fokus. 49Dieses neu erwachte Interesse an e<strong>in</strong>er altenspezifischenVerbraucherpolitik ist auf mehrere gesellschaftliche, ökonomischeund rechtliche Entwicklungen <strong>zur</strong>ückzuführen(Micklitz & Reisch 2004): Zum e<strong>in</strong>en ist e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>erhöhte Sensibilität bezüglich <strong>der</strong> demografischen Entwicklungh<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaft festzustellen,auch im Politikfeld Verbraucherpolitik. Verbraucherpolitikals „Politik im Interesse <strong>der</strong> Verbraucher“ mussdarauf reagieren, wenn sich die Altersstruktur ihresKlientels – und damit dessen Bedürfnisse, Werte und Bildungsniveausowie die ökonomischen Möglichkeiten –än<strong>der</strong>t.Zum an<strong>der</strong>en wird immer deutlicher, dass die Alterung<strong>der</strong> Bevölkerung e<strong>in</strong>e Verschiebung <strong>der</strong> Nachfrage nachGütern und Dienstleistungen mit sich br<strong>in</strong>gen wird. Zuden Struktur-Gew<strong>in</strong>nern werden die Produzenten vonWaren und Dienstleistungen zählen, <strong>der</strong>en Angebote sichan ältere Menschen richten, wie beispielsweise die Gesundheits-und Pflegebranche und die Freizeit- und Kultur<strong>in</strong>dustrie.Mit dieser Nachfrageverschiebung geht e<strong>in</strong>e aus verbraucherpolitischerPerspektive bedeutsame Verlagerung vonso genannten Suchgütern zu Erfahrungs- und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eVertrauensgütern e<strong>in</strong>her. Bei Suchgütern haben dieVerbraucher die Möglichkeit, sich vor dem Kauf über Eigenschaftenund Qualität mit überschaubarem Zeit- undKostenaufwand zu <strong>in</strong>formieren. Bei Erfahrungsgüternkönnen Eigenschaften und Qualität erst nach dem mehrmaligenGebrauch o<strong>der</strong> Kauf e<strong>in</strong>geschätzt werden. BeiVertrauensgütern kann <strong>der</strong> Verbraucher auch nach dem(mehrmaligen) Gebrauch o<strong>der</strong> Kauf e<strong>in</strong>er Dienstleistungo<strong>der</strong> Ware die zentralen Eigenschaften und die Qualitätnicht effektiv e<strong>in</strong>schätzen, da die Geld- und Zeit<strong>in</strong>vestitionen,um zu e<strong>in</strong>er validen E<strong>in</strong>schätzung zu kommen,unverhältnismäßig hoch o<strong>der</strong> nicht möglich wären, da sieaußerhalb <strong>der</strong> Erfahrungsmöglichkeiten <strong>der</strong> Konsumentenliegen o<strong>der</strong> aber entsprechende Testmethoden nichtentwickelt s<strong>in</strong>d. Ob beispielsweise e<strong>in</strong>e ärztliche Leistung49 Die Ausführungen dieses Abschnitts zu Verbraucherfragen basierenweit gehend auf zwei Expertisen, die die 5. Altenberichtskommissionan Herrn Prof. Dr. Micklitz und Frau Dr. Reisch zum Thema „Verbraucherpolitikund Verbraucherschutz für das Alter“ sowie an HerrnProf. Dr. Reifner zum Thema „Altengerechte F<strong>in</strong>anzdienstleistungen“vergeben hat.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 165 – Drucksache 16/2190dem Stand <strong>der</strong> Künste entspricht, kann <strong>der</strong> Patient i.d.R.auch nach <strong>der</strong> Inanspruchnahme nicht beurteilen. Verbrauchers<strong>in</strong>d bei dieser Art Waren o<strong>der</strong> Dienstleistungenauf Vertrauen <strong>in</strong> Qualitätskennzeichen/-signale angewiesen.Allgeme<strong>in</strong> geht man davon aus, dass sich die ohneh<strong>in</strong>ungleiche Informationsverteilung zwischen WarenundDienstleistungsanbietern auf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en und Verbrauchernauf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite von den Suchgütern h<strong>in</strong> zuden Vertrauensgütern noch weiter zu Lasten <strong>der</strong> Verbraucherverschiebt. „Danach s<strong>in</strong>d Vertrauensgütermärkte dieeigentlichen verbraucherpolitischen Problembereiche.Falls hier kompensierende Marktsignale <strong>in</strong> Form von anbieterseitigemSignall<strong>in</strong>g (Lizenzen, Garantien, Gütezeichen,Marken etc.) und konsumentenseitigem Screen<strong>in</strong>gnicht greifen, ist <strong>der</strong> Staat verbraucherpolitisch legitimiertwenn nicht verpflichtet, tätig zu werden, um den Präferenzen<strong>der</strong> Verbraucher zum Zuge zu verhelfen“ (WissenschaftlicherBeirat „Verbraucher- und Ernährungspolitik“des BMVEL 2003b).Die Kommission sieht <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei funktional bee<strong>in</strong>trächtigten,kranken sowie pflege- und hilfebedürftigenVerbrauchern e<strong>in</strong>en beson<strong>der</strong>en Bedarf, diese durch verbraucherpolitischeInterventionen, wie Markttransparenzschaffende Maßnahmen o<strong>der</strong> reglementierende Verbraucherschutzvorschriften,<strong>in</strong> ihrer Konsumentenrolle zustützen.Des Weiteren haben sich <strong>in</strong> den letzen Jahren auf Grund<strong>der</strong> Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung dieMärkte für wichtige Güter und Dienstleistungen dynamisiertund verän<strong>der</strong>t. Man denke nur an die Reformen imGesundheits- und Pflegewesen, bei <strong>der</strong> Telekommunikation,bei den Grundversorgungsgütern wie Strom und Gassowie <strong>der</strong> Liberalisierung im Bereich <strong>der</strong> Altersvorsorgeund <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzdienstleistungen. Der Rückzug des Wohlfahrtsstaatesaus Teilbereichen <strong>der</strong> Dase<strong>in</strong>svorsorgedrängt auch ältere Bürger <strong>in</strong> sensiblen personenbezogenenDienstleistungsbereichen stärker <strong>in</strong> die Rolle vonVerbrauchern, ohne dass <strong>in</strong> jedem Fall h<strong>in</strong>reichend gesichertist, dass auch die dazu nötige Konsumkompetenzaufgebaut werden kann. Auch die Rolle des Staates verschiebtsich vom Anbieter zum „Kontrolleur“ <strong>der</strong> privatwirtschaftlichangebotenen Leistungen.Die zum Redaktionsschluss dieses <strong>Bericht</strong>s noch nichtabgeschlossene Diskussion um die EU-Dienstleistungsrichtl<strong>in</strong>iehat überdies deutlich gemacht, dass die EU alsAkteur <strong>der</strong> Gestaltung von sozialen Dienstleistungen weiteram Abbau von nationalstaatlichen Regulierungen <strong>in</strong>teressiertist, worunter im Bereich <strong>der</strong> personenbezogenenDienstleistungen auch als notwendig erachtete Schutzmechanismenfür hilfebedürftige ältere Menschen fallenkönnen.Schließlich br<strong>in</strong>gt die immer schnellere Technisierung,Digitalisierung und Informatisierung <strong>der</strong> Produkte undDienste sowie ihrer Vertriebswege sowohl Chancen, aberauch Probleme für jene älteren Konsumenten mit sich, diemit <strong>der</strong> technischen Entwicklung <strong>der</strong> Produkte nichtSchritt halten können bzw. die die Chancen und Risikendieser Technologien schlecht abschätzen können.E<strong>in</strong>e zielgruppenspezifische Verbraucherpolitik für ältereMenschen bedeutet die Chance, Informationsdefizite abzubauen,<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Verletzlichkeit vieler ältererKunden Rechnung zu tragen, ihre Stellung als <strong>in</strong>formierterVerbraucher auf Waren- und Dienstleistungsmärktenzu verbessern, ihre Rechte gegenüber Waren- und Dienstleistungsanbieternkennen zu lernen und erhöht die Möglichkeit,diese Rechte auch durchzusetzen. Zivil- undwettbewerbsrechtliche Regelungen sorgen für e<strong>in</strong>en Ausgleichzwischen Anbieter- und Nachfrager<strong>in</strong>teressen.E<strong>in</strong>e zielgerichtete Verbraucherpolitik kann materiellschlechter gestellten Gruppen älterer Menschen aber auchdar<strong>in</strong> unterstützen, die ihnen <strong>zur</strong> Verfügung stehenden begrenztenMittel effizienter e<strong>in</strong>zusetzen und nicht überdem Marktpreis liegende Angebote wählen zu müssen,weil ihnen Informationen zum Preis und Qualitätsvergleichfehlen. Sie dient außerdem dem Schutz <strong>der</strong> Interessen<strong>der</strong> (älteren) Menschen, <strong>in</strong>dem sie vor den Folgen vonwirtschaftlich nachteiligen Geschäften schützt. Verbraucherpolitikist damit auch Sozialpolitik und kann <strong>zur</strong> Armutsvermeidungbeitragen.Stand <strong>der</strong> verbraucherpolitischen DiskussionDie Diskussion über e<strong>in</strong>e spezifische Verbraucherpolitikfür ältere Menschen steht noch am Anfang und auch dieForschung hat dieses Thema lange Zeit kaum beachtet.Allerd<strong>in</strong>gs beg<strong>in</strong>nt das Bundesm<strong>in</strong>isterium für Verbraucherschutz,Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)sich zunehmend <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> Verbraucherpolitik fürSenioren zu stellen. So wurde das Forschungsprojekt„Zielgruppenorientierte Verbraucherarbeit für und mit Senioren“geför<strong>der</strong>t, das unter Fe<strong>der</strong>führung <strong>der</strong> VerbraucherzentralenNordrhe<strong>in</strong>-Westfalens, Brandenburgs undRhe<strong>in</strong>land-Pfalz <strong>in</strong> Kooperation mit <strong>der</strong> Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<strong>der</strong> Senioren-Organisationen (BAGSO)durchgeführt wurde. In Verbraucherkonferenzen wurdeunter aktiver Teilnahme älterer Verbraucher untersucht,mit welchen Problemen Senioren heute als Verbraucherkonfrontiert und welche Themen für sie von beson<strong>der</strong>emInteresse s<strong>in</strong>d (Verbraucherzentrale NRW 2005). Zum an<strong>der</strong>enhat die BAGSO auf ihrer Homepage e<strong>in</strong> Verbraucherforume<strong>in</strong>gerichtet und dort explorative, <strong>in</strong>ternetgestützteBefragungsdaten zu Verbraucherproblemen ältererMenschen erhoben.Das Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauenund Jugend (BMFSFJ) hat im Dezember 2004 geme<strong>in</strong>sammit <strong>der</strong> Sachverständigenkommission des 5. Altenberichts<strong>der</strong> Bundesregierung e<strong>in</strong>e Tagung zu „SeniorengerechtenProdukten und Dienstleistungen“ und imRahmen <strong>der</strong> Arbeiten an diesem Altenbericht zwei Workshopsgeme<strong>in</strong>sam mit <strong>der</strong> BAGSO durchgeführt, um denDiskussionsstand bezüglich verbraucherpolitischer Fragensowie Anfor<strong>der</strong>ungen an seniorengerechte Waren undDienstleistungen aufzuarbeiten (BAGSO 2004b). Im Modellprogramm„Altenhilfestrukturen <strong>der</strong> Zukunft“ ist dasThema des Verbraucherschutzes <strong>in</strong> <strong>der</strong> ambulanten undstationären Pflegeversorgung bereits vorher vom Seniorenm<strong>in</strong>isteriumaufgegriffen worden (BMFSFJ 2004).
Drucksache 16/2190 – 166 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode5.6.1 Das Spannungsfeld <strong>der</strong> altersspezifischenVerbraucherpolitikStärker als <strong>in</strong> <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Diskussion steht bei <strong>der</strong>Gruppe <strong>der</strong> älteren Menschen – aber auch bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>nund Jugendlichen – die Verbraucherpolitik im Spannungsfeldzwischen zumutbarer und erwartbarer Eigenverantwortung<strong>der</strong> Konsumenten und berechtigtenSchutzansprüchen. Grundsätzlich gilt, dass Eigenverantwortungfür die Konsumentscheidungen nur dann übernommenwerden kann (und dann auch e<strong>in</strong>gefor<strong>der</strong>t werdensollte), wenn beim Handelnden e<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichendeökonomisch-technisch-rechtlich-kognitive Konsumkompetenzvermutet werden kann. Nur dann kann er als „souveränerKonsument“ agieren, se<strong>in</strong>e „wahren“ Bedürfnissebefriedigen und durch Abwan<strong>der</strong>ung, Wi<strong>der</strong>spruch undLoyalität die Märkte mitbestimmen (Micklitz & Reisch2004).Seit langem s<strong>in</strong>d aus <strong>der</strong> Konsumentenforschung sozialstrukturelleDifferenzen h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Wahrnehmung<strong>der</strong> souveränen Konsumentenrolle bekannt. Je nach sozialerSchicht und Bildungsgrad wird sich unterschiedlich<strong>in</strong>tensiv vor Kaufentscheidungen <strong>in</strong>formiert und unterschiedlicheInformationsquellen <strong>in</strong> Anspruch genommen.Auch die Art <strong>der</strong> Produkte wirkt sich auf das Informationsverhaltenaus. Die Heterogenität <strong>der</strong> Verbraucherspiegelt sich u.a. <strong>in</strong> den Diskursen zu Verbraucherleitbil<strong>der</strong>nwi<strong>der</strong> (Wissenschaftlicher Beirat „Verbraucher- undErnährungspolitik“ des BMVEL 2003a). In <strong>der</strong> Altersphasekommen weitere differenzierende Aspekte h<strong>in</strong>zu,welche die Heterogenität <strong>der</strong> Verbrauchergruppe erhöhen.Zum e<strong>in</strong>en ist die Phase des Alterns e<strong>in</strong> dynamischer Prozess,<strong>der</strong> sowohl mit Zugew<strong>in</strong>nen als auch mit Risikenund Verlusten verbunden ist. Zu den möglichen Verlusten<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im hohen Alter zählen die E<strong>in</strong>schränkungenvon Seh- und Hörfähigkeit, <strong>der</strong> Rückgang von motorischenFähigkeiten und krankhafte E<strong>in</strong>schränkungen <strong>der</strong>kognitiven Leistungsfähigkeit, wie sie beispielsweise mitDemenzerkrankungen e<strong>in</strong>hergehen, sowie <strong>der</strong> E<strong>in</strong>tritt vonHilfe- und Pflegebedürftigkeit. Gesunde und mobile ältereMenschen unterscheiden sich aus verbraucherpolitischerSicht zunächst nicht pr<strong>in</strong>zipiell von jüngeren Menschen.Das Alter kann auf Grund <strong>der</strong> über lange Zeiterworbenen Konsumerfahrung mit Vorteilen verbundense<strong>in</strong>. Nicht ohne Grund gelten ältere Verbraucher als qualitätsbewusste,schwer für flüchtige Trends zu mobilisierendeKäufergruppe. Es gibt aber e<strong>in</strong>ige Spezifika h<strong>in</strong>sichtlichihrer Möglichkeiten, sich verbraucherrelevanteInformationen zu beschaffen, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Summe als Risikofür die Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>er souveränen Konsumentenrolleersche<strong>in</strong>en. Zum an<strong>der</strong>en hat <strong>in</strong> den letztenJahren e<strong>in</strong>e Verlagerung <strong>der</strong> Informationswege für verbraucherrelevanteFragen auf technikgestützte Systemeund das Internet stattgefunden. Dies gilt nicht nur für denVertrieb von Fahrkarten, E<strong>in</strong>trittskarten und Geldgeschäften,son<strong>der</strong>n auch für unabhängige Verbraucher<strong>in</strong>formationenund Beratungsleistungen. Da <strong>der</strong> Computerbesitzunter älteren Menschen zwar ansteigt, aber immer nochh<strong>in</strong>ter dem jüngerer Jahrgänge <strong>zur</strong>ückbleibt (dies ist vorallem bei Frauen <strong>der</strong> Fall), besteht die Gefahr, dass Älterehier von Informationswegen abgeschnitten werden bzw.e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>er Informations- und Schulungsbedarf entsteht.Die familiären und sozialen Netzwerke spielen bei älterenMenschen e<strong>in</strong> bedeutende Rolle bei <strong>der</strong> Informationsbeschaffungvor dem Kauf von Waren und Dienstleistungen.Mit den durchschnittlich im Alter schrumpfendensozialen Netzwerken geht auch die Möglichkeit <strong>zur</strong>ück,sich im Freundes- und Bekanntenkreis über Vorteile undProbleme mit altersspezifischen Waren o<strong>der</strong> Dienstleistungenauszutauschen. K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> werden<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei technischen Produkten als Warentesterund Berater genutzt. Mit <strong>der</strong> Zunahme <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>losigkeitim Alter könnte hier langfristig e<strong>in</strong> Informationsproblementstehen.5.6.2 Ausgewählte verbraucherpolitischrelevante Probleme ÄltererZwar gibt es zu e<strong>in</strong>zelnen Aspekten des Konsums ältererMenschen – wie z.B. Alter und Technik, Qualität vonPflegeleistungen, F<strong>in</strong>anzdienstleistungen für ältere Menschen– <strong>in</strong>zwischen Literatur und Informationen, bisherf<strong>in</strong>det sich aber ke<strong>in</strong> systematischer Überblick <strong>zur</strong> Frage,was die spezifischen Anfor<strong>der</strong>ungen älterer Menschen anProdukte und Dienstleistungen ausmacht, wie nutzergerechteAngebote für diese Gruppe aussehen müssen undwo die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er spezifischen Verbraucherpolitikfür Senioren liegt. Bei e<strong>in</strong>er Untersuchung <strong>der</strong>Themen, wegen <strong>der</strong>er sich ältere Menschen an die Verbraucherzentralen<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> Brandenburg, Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen und Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz wenden, zeigte sich folgendesErgebnis: „In allen drei beteiligten Bundeslän<strong>der</strong>nspielen Problemlagen rund um Kaffeefahrten, Gew<strong>in</strong>nreisenund Haustürgeschäften u.Ä. die Hauptrolle. E<strong>in</strong> weitereswichtiges Themenfeld ist die Kommunikationstechnologiemit zahlreichen Anfragen zu Mobiltelefonen undVerträgen bzw. Angeboten im Kontext <strong>der</strong> Telekommunikation.Der dritte große Bereich ist das Themenfeld Geldanlagenund Erben bzw. Vererben“ (VerbraucherzentraleNRW 2005).Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> vorliegenden Befragungenzutage getretenen Probleme älterer Menschen mitGebrauchsgegenständen und technischen Geräten imHaushalt liegen auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> mangelnden Benutzerfreundlichkeitund Barrierefreiheit sowie <strong>der</strong> seniorengerechtenGestaltung von Produkten. E<strong>in</strong> bedeutendes Problemkönnen nach den Befragungen <strong>der</strong> BAGSO bereitsProduktverpackungen darstellen. Hier werden schlechtlesbare Beschriftungen auf Packungen und Gebrauchsanleitungenbeklagt, die es älteren Menschen mit E<strong>in</strong>schränkungen<strong>der</strong> Sehfähigkeit erschweren, beispielsweiseInformationen über Inhaltsstoffe, Verfallsdaten bei Lebensmittelnzu erkennen, o<strong>der</strong> Informationen über denGebrauch von Produkten zu erkennen bzw. zu entziffern.Die Befragung <strong>der</strong> BAGSO legt außerdem nahe, dass annähernddie Hälfte <strong>der</strong> Befragten mehrmals pro WocheProbleme damit hat, Verpackungen auf Anhieb zu öffnen,weil die Öffnungsmechanismen nicht funktionieren,schlecht erklärt s<strong>in</strong>d o<strong>der</strong> von älteren Menschen zu viel
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 167 – Drucksache 16/2190Kraft o<strong>der</strong> fe<strong>in</strong>motorische Geschicklichkeit erfor<strong>der</strong>n.Die BAGSO kommt im Vergleich zu früheren Studien zudem Ergebnis, „dass bei Unzufriedenheit mit <strong>der</strong> Verpackunge<strong>in</strong>es Produktes weit mehr als die Hälfte zukünftige<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es Produkt kaufen wollen“ und dass dieser Anteil<strong>in</strong> den letzten Jahren angewachsen ist (BAGSO2004b: 18).Ähnlich häufig wie bei den Verpackungen treten Problemebei Gebrauchsgegenständen und technischen Gerätenim Haushalt auf. Die am häufigsten angeführtenGründe s<strong>in</strong>d bei den mechanischen Gebrauchsgegenständen<strong>der</strong> hohe benötigte Kraftaufwand, die Unhandlichkeitvon Geräten o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e unbefriedigende Funktionsweise.Bei elektrischen Hausgeräten stehen Probleme mit mangelhaftenGebrauchsanweisungen, undeutlichen Beschriftungenund komplizierter Bedienung im Vor<strong>der</strong>grund.Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d beispielsweise bei Handys seit langemProbleme mit zu kle<strong>in</strong>en Tasten o<strong>der</strong> Anzeigefel<strong>der</strong>nund funktionsüberfrachteten Geräten bekannt. Die Befragung<strong>der</strong> BAGSO macht aber deutlich, dass die leichteHandhabbarkeit und e<strong>in</strong>e gute Funktionalität bei den Auswahlgründenfür bestimmte Produkte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bewertung<strong>der</strong> befragten älteren Verbraucher neben <strong>der</strong> Qualität undHaltbarkeit e<strong>in</strong>es Produktes die höchste Bedeutung haben.Die von <strong>der</strong> Verbraucherzentrale NRW durchgeführtenVerbraucherkonferenzen haben neben Kritik an Verpackungenund Produkteigenschaften auch Probleme <strong>der</strong>Werbung und seniorenspezifischer Vertriebswege unterdem Titel „Geschäfte mit dem Alter“ aufgegriffen. Derwachsende Seniorenmarkt for<strong>der</strong>t erhöhte Werbeaktivitätengeradezu heraus. Beklagt wurden irreführende Versprechungenund unlautere Geschäfte bei auf ältere Menschenzielende Produkte und Dienstleistungen.Micklitz und Reisch (2004) weisen darauf h<strong>in</strong>, dass dieGerichte ältere Menschen auf Grund e<strong>in</strong>er verme<strong>in</strong>tlichen„Leichtgläubigkeit und ger<strong>in</strong>geren Kritikfähigkeit“ bisher<strong>in</strong> Rechtsstreitigkeiten zu Heilmittelverkauf, Haustürgeschäftenund Kaffeefahrten häufig als beson<strong>der</strong>e schutzbedürftigeGruppe behandelt und zu Gunsten Älterer aufe<strong>in</strong>en Verstoß gegen die guten Sitten im S<strong>in</strong>ne des § 1UWG a.F. entschieden haben. Nach <strong>der</strong> Novellierung desGesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geht<strong>der</strong> Bundesgerichtshof (BGH) <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er neueren Rechtsprechung<strong>in</strong> Anlehnung an die Rechtsprechung des EuropäischenGerichtshofes <strong>in</strong>zwischen vom Leitbild e<strong>in</strong>esdurchschnittlich <strong>in</strong>formierten, aufmerksamen und verständigen(älteren) Verbrauchers aus, welcher das Werbeverhaltenmit e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> Situation angemessenen Aufmerksamkeitverfolge. Älteren Menschen wird nicht mehrpauschal e<strong>in</strong>e „Leichtgläubigkeit“ unterstellt. E<strong>in</strong>e Berufungauf Leichtgläubigkeit wird überwiegend nur nochdann <strong>in</strong> Betracht kommen, wenn Lese-, Schreib- o<strong>der</strong>Sprachunkundigkeit, psychische o<strong>der</strong> körperliche Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungenwie Bl<strong>in</strong>dheit o<strong>der</strong> Taubheit vorliegen. Offenist, welche Auswirkungen diese Europäisierung für dieRechtsstellung älterer Menschen <strong>in</strong> den genannten Verfahrenhat.Das deutsche Verbraucherrecht bietet Möglichkeiten, sichgegen unlautere Werbung und Verkaufsmethoden zu wehren,wenngleich die Entwicklung <strong>der</strong> Rechtsprechung imZusammenhang mit <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung des Verbraucherleitbildes<strong>in</strong> den e<strong>in</strong>schlägigen Gesetzen kritisch beobachtetwerden muss. Insgesamt bewertet ist die Forschungslage<strong>zur</strong> Frage, ob e<strong>in</strong> spezifischer rechtlicher Verbraucherschutzfür ältere Menschen notwendig ist, unbefriedigend.Dieser Frage konnte im Rahmen dieses <strong>Bericht</strong>esnicht nachgegangen werden. Es besteht hier aber e<strong>in</strong> echtesForschungsdefizit.E<strong>in</strong> Problem liegt darüber h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> <strong>der</strong> Durchsetzungvon Rechtsansprüchen. In den Verbraucherkonferenzenwurde darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass beson<strong>der</strong>s für ältereMenschen die psychologischen und f<strong>in</strong>anziellen Hürden,mit rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen, hoch seien,da aus Sorge um die möglicherweise entstehenden Kosten,auf e<strong>in</strong> juristisches Vorgehen gegen Unrecht eher verzichtetwürde. Um unlauteren Geschäften mit älterenMenschen vorzubeugen, wurde e<strong>in</strong>e umfangreichere Aufklärung<strong>in</strong> den Medien und von Verbänden gefor<strong>der</strong>t.F<strong>in</strong>anzdienstleistungenFür auftretende Probleme bei Dienstleistungen soll hierexemplarisch auf den Bereich <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzdienstleistungene<strong>in</strong>gegangen werden, <strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Expertise für den 5. Altenberichtvon Reifner (2005) ausführlich aufgearbeitetist. In dieser Expertise werden Problembereiche aufgeführt,die bei F<strong>in</strong>anzdienstleitungen für ältere Menschenhäufiger auftreten.Falsche Risikoversicherung: Die durch Versicherungeno<strong>der</strong> Anlageprodukte abzusichernden Risiken än<strong>der</strong>n sichim Alter erheblich. E<strong>in</strong>e Reihe von Risiken entfallen, fürdie evtl. aber noch privater Versicherungsschutz besteht,von dem sich die Verbraucher befreien müssten. Dafürentstehen aber e<strong>in</strong>e Reihe neuer Risiken im Kranken-,Pflege- und Unfallbereich o<strong>der</strong> bei bleibenden Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen.Hier müssen ältere Menschen ihre Risiken klar abschätzen.Helfen können dabei alle<strong>in</strong> die Anbieter, die die Risikostatistikenkennen und sogar geme<strong>in</strong>sam führen undaustauschen. Sie könnten die spezifischen Altersrisikentransparent machen und danach ihre Produkte bestimmen.Bei Versicherungsproblemen geht es häufig nicht so sehrum mangelhafte Produkte son<strong>der</strong>n um zu viele Versicherungenund falsche bzw. unnütze Versicherungen.Bestehende Policen s<strong>in</strong>d teilweise wenig geeignet, dieProbleme älterer Menschen abzusichern. So sichern diebestehenden Unfallversicherungen häufig Unfälle nichtab, die auf längeren Leiden beruhen. 70 Prozent <strong>der</strong> versicherungsrelevantenUnfälle älterer Menschen umfassenKnochenbrüche auf Grund von Stürzen im Haushalt.Viele <strong>der</strong> bestehenden Unfallversicherungen fassen solcheUnfälle dann nicht als beson<strong>der</strong>en Umstand auf, son<strong>der</strong>nführen sie auf nichtversicherte Gebrechlichkeit<strong>zur</strong>ück und s<strong>in</strong>d damit <strong>in</strong>sgesamt ungeeignet. Viele Unfallversicherungenhaben auch e<strong>in</strong>e Altersgrenze von75 Jahren, sodass danach überhaupt ke<strong>in</strong>e Versicherung
Drucksache 16/2190 – 168 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodemehr e<strong>in</strong>tritt. Schließlich versprechen die meisten Unfallversicherungennur e<strong>in</strong>e Verrentung <strong>der</strong> Ansprüche, wasbei länger kalkulierten Altersperioden zu entsprechendniedrigen Renditen führt. Im Bereich <strong>der</strong> Hausratversicherungfehlen ebenfalls altersgerechte Policen. Nach e<strong>in</strong>emE<strong>in</strong>bruchsdiebstahl ist es ke<strong>in</strong>eswegs nur <strong>der</strong> Sachwert,<strong>der</strong> beschädigt ist. Alte Menschen fühlen sichdanach nicht mehr sicher und müssen umfangreiche, von<strong>der</strong> Police nicht gedeckte, zusätzliche Sicherungsmaßnahmenergreifen.Unflexible und teure Kredite: Kredite begleiteten ältereMenschen <strong>in</strong> dreifacher Form im Alter: zum e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>dsie als Hypothekenkredite die zentralen Dienstleistungen,mit denen die Wohnung <strong>der</strong> Hälfte aller alten Menschenaufrechterhalten und dann auch bei Wechsel, Renovierungetc. verwaltet wird. Zum an<strong>der</strong>en dienen Krediteetwa als Überziehungs- o<strong>der</strong> Ratenkredit weiterh<strong>in</strong> <strong>der</strong>Verstetigung des Lebense<strong>in</strong>kommens, das zwar nichtmehr auf <strong>der</strong> E<strong>in</strong>nahmeseite jedoch auf <strong>der</strong> Ausgabenseitestarken Friktionen (private Krankheitskosten, Autoreparaturo<strong>der</strong> Erneuerung, Nothilfe für K<strong>in</strong><strong>der</strong> undEnkel) unterliegen kann und zum Dritten s<strong>in</strong>d Konsumkreditesowie Existenzgrün<strong>der</strong>darlehen wichtig, um ihreArbeitskraft <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersselbstständigkeit noch verwertenund damit Zusatze<strong>in</strong>kommen erzielen zu können. In allendrei Bereichen gibt es erhebliche Probleme, weil F<strong>in</strong>anzdienstleisterdie alten Menschen nur als Anleger und Sparer,nicht jedoch als Kreditnehmer akzeptieren.Die Verweigerung von Krediten wirkt aber zugleich alsBarriere gegen die Erwerbstätigkeit im Alter. Mangels e<strong>in</strong>esfunktionierenden Kreditsystems für Existenzgrün<strong>der</strong>,die ke<strong>in</strong>e Kreditgeschichte und ke<strong>in</strong>e klaren Aussichtenaufweisen, nutzten die meisten Personen, die sich selbstständigmachen, dabei weltweit den Konsumkredit undihre dortige Kreditgeschichte bei SCHUFA und Bank.Dies ist dann allerd<strong>in</strong>gs nicht mehr möglich, wenn sie mitdem objektiven Kriterium ihres Alters konfrontiert werden.Will man den H<strong>in</strong>zuverdienst im Alter för<strong>der</strong>n unddamit die Alterserwerbstätigkeit aufbauen, so muss dieDiskrim<strong>in</strong>ierung im Konsumkredit abgebaut werden. IntelligenteModelle wie Gruppenbürgschaften ältererSelbstständiger <strong>zur</strong> Streuung des Risikos, Sicherungsfondso<strong>der</strong> die E<strong>in</strong>beziehung von Existenzgrün<strong>der</strong>bürgschaftenvon Kreditanstalt für Wie<strong>der</strong>aufbau (KfW) o<strong>der</strong>Bürgschaftsbanken könnten hier Wegweiser se<strong>in</strong>.Anlagen: Senioren nur e<strong>in</strong> Label: Banken sehen ältereMenschen vor allem als Rentiers und Sparer. Das vorherrschendeBild ist das begüterte Ehepaar, das se<strong>in</strong>e Gel<strong>der</strong>zu verwalten hat. So konzentrieren sich die meisten Anbieterim Altersmarket<strong>in</strong>g auch auf Angebote im Sparbereich,wobei es häufig um konventionelle Produkte geht,die lediglich e<strong>in</strong> altengerechtes Image erhalten. Wirklichneue Sparprodukte speziell für Rentner gibt es praktischnicht. Interessen wie die spätere Sicherstellung <strong>der</strong> Ausbildung<strong>der</strong> Enkel werden un<strong>zur</strong>eichend aufgenommen.Das Bildungssparen ist ke<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>es Produkt, obwohles eigentlich e<strong>in</strong>en späteren Ausbildungskredit ermöglichensollte, weil die Sparbeträge selber zu ger<strong>in</strong>g se<strong>in</strong>können. Auch im Spendenbereich gibt es ke<strong>in</strong>e Sparprodukte,die es den Älteren ermöglichen, größere Beträgezielgerichteter anzusparen und darüber Rechenschaft zuerhalten. Erst e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensive Beschäftigung mit den Sparzielen<strong>der</strong> Älteren und ihren Liquiditäts-, Sicherheits-,Zugangs- und Nachhaltigkeitsbedürfnissen wird zu solchenProdukten führen können.Fehlende Altersergonomie: Wenn im Alter die Mobilitäte<strong>in</strong>geschränkt ist, muss für Bankgeschäfte zunehmendauf technische Hilfen wie Computer o<strong>der</strong> Telefon <strong>zur</strong>ückgegriffenwerden. Callcenter werden von älteren Menschenzum Teil als problematisch erachtet, weil es ihnennicht alle<strong>in</strong> um die Information, son<strong>der</strong>n um die Vermittlungvon Vertrauen durch ihre Bank geht. Dies gilt auchfür die Verlagerung von persönlicher Beratung auf Internetbank<strong>in</strong>g.Aus Verbraucherkonferenzen wurde berichtet,dass ältere Menschen sich unter Druck gesetzt sehen,e<strong>in</strong>en Computer anzuschaffen. Da mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung desInternetbank<strong>in</strong>g häufig nicht e<strong>in</strong> zusätzlicher Zugang zuBankdienstleistungen geschaffen wird, son<strong>der</strong>n persönlicheBeratungsmöglichkeiten dadurch verdrängt werden,sehen sich ältere Menschen ungewollt mit AnschaffungsundLernkosten konfrontiert, die sie ausschließlich für ihrenBankzugang tätigen müssen.Darüber h<strong>in</strong>aus wird es alten Menschen erschwert, sichbei <strong>der</strong> Beschaffung von Bargeld <strong>der</strong> Hilfe an<strong>der</strong>er Menschenzu bedienen. Die Rechtslage bei Karten sieht vor,dass nur <strong>der</strong> Inhaber befugt ist, sie zu benutzen. Die Weitergabe<strong>der</strong> PIN ist damit e<strong>in</strong> Vertragsbruch und lastetdem Träger die gesamten Risiken auf. Dies ist ke<strong>in</strong>eswegsaltersgerecht. Da Postüberweisungen mit Bargeldaustrage<strong>in</strong>gestellt worden s<strong>in</strong>d, wird es immerschwieriger, Bargeld vor Ort sicher zu erhalten. Insgesamtmüssten die Anbieter <strong>in</strong> diesem Bereich Möglichkeitene<strong>in</strong>er gesicherten Stellvertretung schaffen, die etwadie Auszahlungsbeträge im Voraus festlegt und damit e<strong>in</strong>enweiteren Missbrauch ausschließt.Im Bankbereich wird darüber h<strong>in</strong>aus die mangelnde Bedienerfreundlichkeitvon Automaten, zu kle<strong>in</strong>e Schriftgrößenund die fehlende technische Anknüpfung anbekannte Bedienelemente des Haushalts kritisiert. BeiAutomatenbildschirmen verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n außerdem spiegelndeLichtquellen die Sicht. Spezifisch für den Bankenbereichdürften Fragen des Sicherheitsgefühls se<strong>in</strong>. Sowurden auf Verbraucherkonferenzen Bedenken gegen dieZuverlässigkeit <strong>der</strong> Automaten und des Internetbank<strong>in</strong>gsgenannt und Angst vor bewusster Manipulation, demAusspähen von Geheimnummern sowie Raubüberfällenan Geldautomaten geäußert (Verbraucherzentrale NRW2005).Mangelnde Beratung: Das Angebot an persönlicher Beratungwird durch die Automatisierung <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzdienstleistungsvergabeund ihrer Verwaltung immer knapper.Da die Beratungskosten bei älteren Menschen hoch s<strong>in</strong>d,orientiert sich Beratung immer mehr an den vermögendenAlten. Für das Massenpublikum <strong>der</strong> Älteren müssen rationelleaber zielgerichtete Verfahren gefunden werden,welche die Beratung e<strong>in</strong>erseits sicherstellen, an<strong>der</strong>erseitsaber verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, dass die Kosten zu hoch werden. GruppenspezifischeBeratungsprozesse <strong>in</strong> Banken wären hier
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 169 – Drucksache 16/2190e<strong>in</strong> Ausweg. Ferner wird darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass ältereMenschen auch ältere Berater brauchten, weil die Spracheverschieden ist und jüngere häufig nach kurzer Zeitaufsteigen und nicht mehr verfügbar s<strong>in</strong>d.Verbraucherproblematik bei Hilfe- undPflegebedürftigenDer E<strong>in</strong>tritt von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit erschwertes betroffenen älteren Menschen als souveräne Konsumentenauf Wohlfahrtsmärkten aufzutreten. Obwohl die<strong>in</strong>dividuelle Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit relativ hoch ist, im Verlaufdes Alters e<strong>in</strong>mal Kunde von Pflegediensten o<strong>der</strong>Pflegeheimen zu werden, werden ältere Menschen undihre Angehörigen häufig von dem E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>er Hilfebedürftigkeitüberrascht. Auch bei e<strong>in</strong>er bereits bestehendenPflegebedürftigkeit erfolgt <strong>der</strong> Übergang von <strong>der</strong> häuslichenUmgebung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Pflegeheim <strong>in</strong> vielen Fällen ungeplant.Die Gründe dafür s<strong>in</strong>d sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> mangelndenBereitschaft zu suchen, sich frühzeitig mit dem angstbehaftetenund tabuisierten Thema „Hilfebedürftigkeit“ zubeschäftigen, als auch <strong>in</strong> den un<strong>zur</strong>eichenden Informationsangebotenzu diesem Thema. Mit dem E<strong>in</strong>tritt vonHilfe- und Pflegebedürftigkeit werden weitergehendeverbraucherpolitische Instrumente <strong>zur</strong> Wahrung <strong>der</strong> Interessendieser beson<strong>der</strong>s verletzlichen Gruppe notwendig.Dazu zählen Beratungsleistungen <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong>Markttransparenz, beispielsweise durch Pflege- und Angehörigenberatungsstellen,sowie Beschwerdestellen undPflegenottelefone, Maßnahmen <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong>Rechtsposition älterer Verbraucher gegenüber Leistungsanbietern,aber auch <strong>der</strong> Schutz vor gefährlichen Produktenund Dienstleistungspraktiken.Die E<strong>in</strong>setzung e<strong>in</strong>er Patientenbeauftragten und die Vorlage<strong>der</strong> Patientencharta und des Entwurfes <strong>der</strong> „Charta<strong>der</strong> Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ hatdas Thema „Verbraucherrechte im Gesundheits- und Pflegebereich“<strong>in</strong> <strong>der</strong> letzten Zeit gestärkt. Verbraucherfragenim Bereich <strong>der</strong> Pflege und mediz<strong>in</strong>ischen Versorgungs<strong>in</strong>d eng verbunden mit <strong>der</strong>en spezifischen Qualitätsdiskursen.In diesen Qualitätsdiskursen dom<strong>in</strong>ieren die häufigkonfligierenden Perspektiven <strong>der</strong> Leistungserbr<strong>in</strong>ger,Kranken- und Pflegekassen, an <strong>der</strong> Versorgung beteiligtenProfessionen sowie <strong>der</strong> zuständigen M<strong>in</strong>isterien. Esnehmen zwar alle diese Gruppen grundsätzlich für sich <strong>in</strong>Anspruch, die Interessen <strong>der</strong> Verbraucher, sprich <strong>der</strong> Pflegebedürftigen,bei ihrem Handeln zu berücksichtigen. Esfehlt aber nach wie vor an starken spezifischen Verbraucherorganisationen,welche den Standpunkt und die Interessen<strong>der</strong> Patienten und Pflegebedürftigen im politischenDiskurs, aber auch <strong>in</strong> Leistungsverhandlungen vertreten.Obwohl Fragen <strong>der</strong> Pflegequalität von <strong>der</strong> Kommissionaus Verbraucherperspektive als sehr bedeutend e<strong>in</strong>geschätztwerden, soll <strong>in</strong> diesem <strong>Bericht</strong> nicht ausführlichdarauf e<strong>in</strong>gegangen werden. Grund dafür ist, dass parallel<strong>zur</strong> 5. Altenberichtskommission <strong>der</strong> „Runde TischPflege“ an Maßnahmen <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> pflegerischenVersorgung älterer Menschen arbeitet. An dieserInitiative nehmen Vertreter<strong>in</strong>nen und Vertreter aus Verbänden,aus Bund, Län<strong>der</strong>n und Kommunen, Praxis undWissenschaft teil. In vier Arbeitsgruppen werden Empfehlungen<strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Qualität und <strong>der</strong> Versorgungsstrukturen<strong>in</strong> <strong>der</strong> stationären und häuslichen Pflegeerarbeitet, Vorschläge <strong>zur</strong> Entbürokratisierung im Bereich<strong>der</strong> ambulanten und stationären Betreuung und Pflegeentwickelt sowie e<strong>in</strong>e „Charta <strong>der</strong> Rechte hilfe- und pflegebedürftigerMenschen“ entworfen. Die Kommissionbegrüßt diese Aktivitäten des BMFSFJ und des BMGSausdrücklich und erwartet von <strong>der</strong> öffentlichen Diskussion<strong>der</strong> „Charta <strong>der</strong> Rechte hilfe- und pflegebedürftigerMenschen“ sowie <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> weiteren Arbeitsgruppenwichtige Impulse <strong>zur</strong> Stärkung <strong>der</strong> Verbraucher<strong>in</strong>teressenvon älteren Pflegebedürftigen.5.6.3 MaßnahmenMicklitz und Reisch (2004) kommen <strong>in</strong> ihrer Expertisefür den 5. Altenbericht zu dem Ergebnis, dass bisherke<strong>in</strong>e entwickelte altenspezifische Verbraucherpolitik erkennbarist. Für das BMVEL konstatieren sie <strong>in</strong> Bezugauf die Zielgruppe ältere Menschen: „E<strong>in</strong>zelne Initiativens<strong>in</strong>d auf den Ernährungsbereich fokussiert. Im Vor<strong>der</strong>grunde<strong>in</strong>er altersspezifischen Politik stehen bislangvielmehr die Jugendlichen und K<strong>in</strong><strong>der</strong>. We<strong>der</strong> im„Aktionsplan Verbraucherschutz“ noch im „Ersten Verbraucherpolitischen<strong>Bericht</strong>“ <strong>der</strong> Bundesregierung(2004b) wird explizit auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> älterenKonsumenten abgehoben.“ Ihrer E<strong>in</strong>schätzung nachkönnte sich dies mit zunehmen<strong>der</strong> Organisierung, Mobilisierungund Wählerwirksamkeit von Senioren<strong>in</strong>teressenjedoch än<strong>der</strong>n. Dies umso mehr, als sich die „neue Verbraucherpolitik“zunehmend als sektorübergreifendeQuerschnittspolitik und „Lebensqualitätspolitik“ versteht.Dabei kann und wird die spezifische Lebensqualität e<strong>in</strong>esimmer größer werdenden Teils <strong>der</strong> Gesellschaft die entsprechendeBeachtung f<strong>in</strong>den müssen. Die positiven Ansätzevon politischer Seite wurden bereits genannt: Eswurden sowohl vom BMVEL als auch vom BMFSFJProjekte <strong>in</strong>itiiert, die zunächst die spezifischen Verbraucherbedürfnisseälterer Menschen untersuchen sollten.Für die Gruppe <strong>der</strong> Pflegebedürftigen wurden durch dasPflegequalitätssicherungsgesetz sowie <strong>der</strong> Novellierungdes Heimgesetzes erste erfolgreiche verbraucherpolitischeMaßnahmen e<strong>in</strong>geleitet. In diesem Zusammenhangwurden erstmals Anfor<strong>der</strong>ungen an die Transparenz <strong>der</strong>Preis- und Leistungsgestaltung sowie Schutznormen fürdie Heimverträge festgelegt. Die E<strong>in</strong>richtung des „RundenTischs Pflege“ zeigt aber, dass auch <strong>der</strong> Gesetzgeberweiterh<strong>in</strong> große Probleme bei <strong>der</strong> Pflegequalität <strong>in</strong>Deutschland sieht.Um die Verbraucherrolle älterer Menschen – im S<strong>in</strong>nesouveräner Marktteilnehmer und aktiver Konsumenten –<strong>in</strong> Zukunft weiter zu stärken, s<strong>in</strong>d Anstrengungen <strong>in</strong> mehrerenHandlungsfel<strong>der</strong>n notwendig. Verantwortlich dafürs<strong>in</strong>d nicht nur Politik und ältere Menschen selbst, son<strong>der</strong>nauch Wirtschaft und Verbände.Partizipation: Die Mitwirkung älterer Menschen bei <strong>der</strong>Entwicklung und Gestaltung des Dienstleistungs- undWarenangebots sollte <strong>in</strong> Zukunft erhöht werden. Hier liegennicht nur Chancen für die älteren Menschen, solche
Drucksache 16/2190 – 170 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeProdukte zu erhalten, die ihren Bedürfnissen am ehestenangemessen s<strong>in</strong>d. Es ist auch aus Sicht <strong>der</strong> Wirtschaft vonInteresse mit zielgenauen Angeboten die Käuferschicht<strong>der</strong> älteren Menschen zu erschließen. E<strong>in</strong>ige Unternehmenmachen sich bereits heute bei <strong>der</strong> Entwicklung technischerGeräte die so genannte „Lupenfunktion“ <strong>der</strong> Verbrauchergruppe<strong>der</strong> älteren Menschen gezielt zunutze. Sieb<strong>in</strong>den die Erfahrung älterer Menschen frühzeitig <strong>in</strong> dieProduktentwicklung e<strong>in</strong>, um beispielsweise auf Probleme<strong>der</strong> Handhabung h<strong>in</strong>gewiesen zu werden.Auch Kommunen können von <strong>der</strong> Beteiligung ältererMenschen profitieren, wenn sie beispielsweise <strong>der</strong>enKompetenz <strong>in</strong> lokale Initiativen von Kommunen und E<strong>in</strong>zelhändlernbei <strong>der</strong> Entwicklung von City-Market<strong>in</strong>g-Konzepten nutzen und so auch für diese Zielgruppe attraktiverwerden.Verbraucher<strong>in</strong>formation, Verbraucherberatung, Verbraucherbildungund Verbrauchererziehung: Es besteht nachden Ergebnissen <strong>der</strong> Verbraucherkonferenzen e<strong>in</strong> bedeutendesInformationsbedürfnis unter älteren Menschenüber allgeme<strong>in</strong>e Informationen zu ihrer Rechtspositionals Verbraucher, aber auch zu Risiken und Schutzmaßnahmenbei Haustürgeschäften und den so genanntenKaffeefahrten. Außerdem seien ältere Menschen wenigervertraut mit den Mechanismen von Adresshandel und namentlich<strong>in</strong>dividualisierten Werbeanschreiben, was sieanfälliger für solche Formen von Werbung mache. Hiers<strong>in</strong>d sowohl traditionelle Formen <strong>der</strong> Verbraucheraufklärungdurch Informationsmaterialien und Broschüren sowieVorträge gefragt als auch neue Kooperationen zwischenverbraucherpolitischen Akteuren und Medien.Dabei sollte auch an kostenlos erhältliche Medien wieApothekenzeitschriften und Stadtteilzeitungen gedachtwerden.Aus den Seniorenverbänden wurde bereits häufiger angeregt,dass die Stiftung Warentest <strong>in</strong> ihren Produkttests dieKriterien <strong>der</strong> Nutzer- und Bedienerfreundlichkeit aufnehmenbzw. stärker gewichten sollte. Die Kommissionbegrüßt die Ansätze, dass die Ergebnisse <strong>zur</strong> Bedienerfreundlichkeitund Verständlichkeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zusammenfassungvon Tests hervorgehoben werden. Diese Anregunggilt auch für an<strong>der</strong>e Zeitschriften, die Tests zu technischenGeräten anbieten und älteren Menschen als Informationsquellefür Anschaffungen dienen.Gütesiegel gew<strong>in</strong>nen angesichts <strong>der</strong> Unübersichtlichkeitdes Angebots an Waren und Dienstleistungen unter älterenMenschen als Orientierung an Bedeutung. Der Verbraucherpolitische<strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Bundesregierung (2004b)weist auf mögliche positive Funktionen h<strong>in</strong>: „KomplexeInhalte wie Gebrauchseigenschaften o<strong>der</strong> auch üblicheNormen überschreitende Umwelt-, Sozial- o<strong>der</strong> Gesundheitsschutzstandardskönnen seriöse und von unabhängigerStelle geprüfte Qualitätssiegel o<strong>der</strong> Kennzeichenzuverlässig und verbrauchernah zusammenfassen. Anerkannteund transparente Zertifizierungen s<strong>in</strong>d für Verbraucher<strong>in</strong>nenund Verbraucher e<strong>in</strong> gutes Hilfsmittel bei<strong>der</strong> Auswahl von Produkten o<strong>der</strong> Dienstleistungen undför<strong>der</strong>n zugleich den Leistungswettbewerb.“ Im Interesse<strong>der</strong> älteren Verbraucher sollten Politik und Seniorenverbändeaber darauf h<strong>in</strong>wirken, dass sich wenige Gütesiegelmit hohen Standards durchsetzen. Der orientierende Effektdroht ansonsten durch e<strong>in</strong> Überangebot an Gütesiegelnverloren zu gehen.Unabhängige Akteure <strong>der</strong> Verbraucherberatung und -<strong>in</strong>formations<strong>in</strong>d für ältere Menschen beson<strong>der</strong>s wichtigeAnsprechpartner. E<strong>in</strong>e herausgehobene Stellung nehmendabei die Verbraucherzentralen e<strong>in</strong>, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong>Älteren hohes Vertrauen genießen. E<strong>in</strong>schnitte <strong>in</strong> ihremLeistungsangebot treffen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e ältere Menschen.Die Kommission sieht hier eher die Notwendigkeit, dasTätigkeitsspektrum <strong>der</strong> Verbraucherzentralen gezielt umdie Kooperation auf lokaler Ebene mit an<strong>der</strong>en Gesundheits-und Pflegeberatungs<strong>in</strong>stitutionen zu erweitern.Bereits <strong>der</strong> 3. und 4. Altenbericht haben darauf h<strong>in</strong>gewiesen,dass auf Grund <strong>der</strong> Zersplitterung des Leistungsaberauch des Informationsangebotes im Pflegebereichdie flächendekkende E<strong>in</strong>führung von <strong>in</strong>tegrierten kommunalenBeratungsstellen erfor<strong>der</strong>lich ist, die älterenMenschen und ihren Angehörigen e<strong>in</strong>e Orientierung bei<strong>der</strong> Auswahl des jeweils zu e<strong>in</strong>er spezifischen Problemlagepassenden Angebots an professionellen Pflegeleistungenbieten. Die Alten- und Angehörigenberatungsollte die Funktion e<strong>in</strong>es zentralen E<strong>in</strong>gangsportals fürdie Beratungsbedürfnisse älterer Menschen übernehmen.Können spezifische Beratungsbedürfnisse nicht <strong>in</strong> den <strong>in</strong>tegriertenBeratungsstellen befriedigt werden, sollten diezuständigen Spezialisten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Schritt zu erreichense<strong>in</strong>. Zentraler Bestandteil <strong>der</strong> Alten- und Angehörigenberatungist die Pflegeberatung, die spezifischerfachlicher Kompetenz bedarf. Voraussetzung für gute Beratungist die Trägerunabhängigkeit <strong>der</strong> Beratungsstellen,um Interessenkonflikte mit Leistungsanbietern auszuschließen.Darüber h<strong>in</strong>aus sollten flächendeckend unabhängigeBeschwerdestellen <strong>in</strong> Form von Nottelefoneno<strong>der</strong> Ombudspersonen geschaffen werden. Ihre Aufgabeist es, bei Problemen <strong>in</strong> professionellen und familialenPflegebeziehungen zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln,Gewaltprävention zu leisten und ggf. an<strong>der</strong>e Beratungs-o<strong>der</strong> Aufsichtsbehörden e<strong>in</strong>zuschalten.Das Bundesmodellprogramm „Altenhilfestrukturen <strong>der</strong>Zukunft“ hat gezeigt, wie die fachliche Kooperation zwischenPflege- und Verbraucherschutzexperten <strong>der</strong> Verbraucherzentralenim Bereich <strong>der</strong> Informations- und Beschwerdestellenmöglich ist. Es konnte e<strong>in</strong> abgestuftesVerfahren für das Beschwerde- bzw. Beratungsmanagementetabliert werden, <strong>in</strong> dem sich die Kompetenzen <strong>der</strong>Kooperationspartner erfolgreich ergänzten.Speziell für die stationäre Altenhilfe gilt zusätzlich, dassdie Qualitätsberichterstattung – etwa im Vergleich zu denjüngsten Reformen im SGB V – weit h<strong>in</strong>terher h<strong>in</strong>kt. Hiergilt die für die sozialen Dienste typische Problematik <strong>der</strong>„Vertrauensgüter“ (Naegele 2004c) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ganz beson<strong>der</strong>enWeise. E<strong>in</strong>e entsprechende Möglichkeit könnte z.B.dar<strong>in</strong> bestehen, regelmäßig die Ergebnisse <strong>der</strong> Heimprüfungensowie <strong>der</strong> Heimaufsicht <strong>in</strong> verbraucherpolitischverständlicher und <strong>in</strong>formativer Weise aufzubereiten undzu veröffentlichen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 171 – Drucksache 16/2190För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbrauchervertretung und Verbraucherorganisierung:Auf die Bedeutung <strong>der</strong> Verbraucherzentralenals Kristallisationskern <strong>der</strong> Verbraucherorganisierung<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für ältere Menschen wurde bereitsweiter oben h<strong>in</strong>gewiesen. Die Kommission sieht weitereAnknüpfungspunkte <strong>zur</strong> Stärkung <strong>der</strong> Verbraucherpositionälterer Konsumenten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Unterstützung von verbraucherpolitischrelevanten Projekten <strong>der</strong> Seniorenorganisationenund <strong>der</strong> Seniorenvertretungen. Angeknüpftwerden könnte hier auch an die neuen Entwicklungen imSGB V und an die hier <strong>in</strong>stitutionalisierten Mitwirkungsmöglichkeiten<strong>der</strong> Leistungsempfänger. VergleichbareRegelungen sucht man im SGB XI bislang vergeblich.Zukünftig sollte die Rolle von bürgerschaftlich Engagierten<strong>in</strong> <strong>der</strong> verbraucherpolitischen Organisierung von Senioren<strong>in</strong>teressenan Bedeutung gew<strong>in</strong>nen (siehe auch dasKapitel Engagement und Partizipation). Modellprojektezeigen, dass beispielsweise die „<strong>in</strong>formatorische und partiellauch advokatorische Funktion des Verbraucherschutzesim stationären Versorgungssektor ... durch die Unterstützungsarbeitfreiwillig engagierter Senior<strong>in</strong>nen undSenioren für die Heimbeiräte bzw. durch die Mitarbeit gewählterExterner sehr gut realisierbar“ ist (BMFSFJ 2004:104). Es wurden bei <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> Erfahrungenaber auch Grenzen <strong>der</strong> bürgerschaftlichen Verbrauchervertretungdeutlich. „Zur Sicherstellung e<strong>in</strong>er weiterreichendenadvokatorischen Funktion des Verbraucherschutzes<strong>in</strong> <strong>der</strong> Heimversorgung bedarf es e<strong>in</strong>erunparteiischen, offiziellen und formellen Charakter ausweisendenBeschwerdestelle (z.B. beim Amt für Altenhilfeo<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er entsprechenden Instanz), die ähnlich denVerbraucherzentralen im ambulanten Pflegesektor wirksameSchritte z.B. über die Heimaufsicht o<strong>der</strong> durch juristischenBeistand e<strong>in</strong>leiten kann“ (BMFSFJ 2005: 105).Rechtlicher Verbraucherschutz: Im Rahmen dieses Altenberichtskonnte auf Grund des Auftrags und <strong>der</strong> Zusammensetzung<strong>der</strong> Kommission die Frage nach <strong>der</strong> Verbesserungdes rechtlichen Verbraucherschutzes nichte<strong>in</strong>gehend behandelt werden. Es ist jedoch deutlich geworden,dass e<strong>in</strong> Forschungs- und politischer Klärungsbedarfbesteht, ob die Entwicklung e<strong>in</strong>es spezifischenrechtlichen Verbraucherschutzes für ältere Menschen notwendigist und wie dieser ggf. auszugestalten se<strong>in</strong> wird.Noch ist nicht abzusehen, welche konkreten Folgen dieNovellierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb(UWG) für ältere Menschen haben wird. Hier solltedie Rechtsprechung beobachtet und auf evtl. neu entstehendeProbleme bei beson<strong>der</strong>s verletzlichen Teilen <strong>der</strong> älterenBevölkerung h<strong>in</strong> untersucht werden.Aus Sicht <strong>der</strong> Kommission s<strong>in</strong>d ebenfalls Schritte zu e<strong>in</strong>erVerbesserung des Verbandsklagerechts für die Verbraucherzentralenzu begrüßen.Neben den etablierten Formen des rechtlichen Verbraucherschutzeswie <strong>der</strong> gerichtlichen Klage – die von beson<strong>der</strong>sschutzbedürftigen älteren Verbrauchern aberkaum <strong>zur</strong> Durchsetzung von Rechtsansprüchen genutztwird – sollten für die Verbraucherkonflikte älterer Menschenverstärkt „niedrigschwellige“ rechtliche Konfliktlösungsmöglichkeitenerprobt werden, wie beispielsweiseMediations-/Schiedsstellen. Diese sollten allerd<strong>in</strong>gs nichtnur Rechtsverstöße, son<strong>der</strong>n auch vorgelagerte Beschwerdenüber Qualitätsmängel behandeln.5.7 HandlungsempfehlungenDie Kommission begreift die „Seniorenwirtschaft“ e<strong>in</strong>erseitsals Element <strong>zur</strong> Steigerung <strong>der</strong> Lebensqualität ältererMenschen durch Dienste und Angebote auf privatenKonsumgüter- und Dienstleistungsmärkten. An<strong>der</strong>erseitsbegreift sie die „Seniorenwirtschaft“ auch als e<strong>in</strong>en neuenImpulsgeber für wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung.Allerd<strong>in</strong>gs ist dies e<strong>in</strong>e ambitionierte Aufgabe,die zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> <strong>der</strong> Anfangsphase noch öffentlicherFör<strong>der</strong>ung und Unterstützung bedarf.1 Differenzierte Markterschließung und Sensibilisierung<strong>der</strong> Akteure: E<strong>in</strong>e <strong>der</strong> wichtigsten zukünftigenAufgaben <strong>der</strong> Wissenschaft und <strong>der</strong> Marktforschung bestehtnach Auffassung <strong>der</strong> Kommission dar<strong>in</strong>, die differenziertenBedürfnisse und Interessen <strong>der</strong> älteren Menschennoch systematischer <strong>in</strong> den Blick zu nehmen,transparent zu machen und dieses Wissen auch zu verbreiten.Die Kommission ist <strong>der</strong> Ansicht, dass hierfür aufBundesebene e<strong>in</strong> „Masterplan Seniorenwirtschaft“ erarbeitetwerden sollte, <strong>der</strong> sowohl die Nachfrageseite mitihren speziellen Bedürfnissen als auch die Angebotsseiteberücksichtigt und die Potenziale auch auf die Ebene <strong>der</strong>Akteure „herunterbricht“. Durch Kooperation und Wissenstransferunter den beteiligten Akteuren können verstreuteE<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>itiativen sichtbar gemacht sowie neue Impulsefür die Weiterentwicklung des „silver market“gegeben werden.2 Berücksichtigung auch <strong>der</strong> Konsumbedürfnissesozial schwacher älterer Menschen: SeniorenwirtschaftlicheProdukte und Dienste müssen für das gesamteSpektrum <strong>der</strong> älteren Bevölkerung zugänglich se<strong>in</strong>, dasheißt u.a. auch für sozial und E<strong>in</strong>kommensschwache sowiefür ältere Personen <strong>in</strong> strukturschwachen Regionenbezahlbar und verfügbar se<strong>in</strong>. Dies wie<strong>der</strong>um erfor<strong>der</strong>tvielfach auch den f<strong>in</strong>anziellen E<strong>in</strong>satz <strong>der</strong> kommunalenEbene. Berührt s<strong>in</strong>d dabei nicht nur freiwillige Leistungen,son<strong>der</strong>n auch Soll- und Mussleistungen (z.B. gemäßden Bestimmungen im Sozialhilferecht). Auch das SGBIX ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang anzusprechen, dennviele ältere, vor allem pflegebedürftige Menschen s<strong>in</strong>dzugleich beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t und von daher potenziell leistungsberechtigtfür Hilfen <strong>zur</strong> Teilhabe <strong>in</strong> <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft.3 Befähigung <strong>zur</strong> Selbstorganisation und stärkerekonsumrelevante Interessenvertretung <strong>der</strong> älteren<strong>Generation</strong>: Auch für die älteren Menschen selbst bestehtdie Aufgabe, sich ihren Bedürfnissen und Ansprüchennoch stärker als bisher bewusst zu werden und Erwartungenzu formulieren. Als Mediator dieser Interessensollten beispielsweise die Seniorenorganisationen auftreten,zumal sich bereits die Dachorganisationen <strong>der</strong> Seniorenverbände(BAGSO) sowie <strong>der</strong> Verbraucherzentralenund Verbraucherverbände seit kurzem den Konsum<strong>in</strong>teressenälterer Menschen angenommen haben. Gerade
Drucksache 16/2190 – 172 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeauf örtlicher Ebene bietet sich für die lokalen Seniorenvertretungenhier e<strong>in</strong> neues Aktionsfeld an.4 Dialogische Produkt- und Dienstleistungsentwicklung:Die Kommission ist <strong>der</strong> Auffassung, dass das spezifischeVerbraucherwissen <strong>der</strong> älteren Menschen selbstbislang bei <strong>der</strong> Markt- und Produktentwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Seniorenwirtschaftviel zu kurz gekommen ist. Sie for<strong>der</strong>t<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong>novative Unternehmen auf, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en konkretenDialog mit den potenziellen Abnehmern und Nutzernseniorenwirtschaftlicher Produkte und Dienste zutreten. Solche Formen „dialogischer Produkt- und Dienstleistungsentwicklung“und e<strong>in</strong> darauf bezogenesBenchmark<strong>in</strong>g-Konzept hätten nach Auffassung <strong>der</strong>Kommission gute Chancen mitzuhelfen, die immer nochdom<strong>in</strong>ierende Distanz zwischen Privatwirtschaft undKunden aus <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> älteren Menschen zu überbrücken.5 Verbesserung und Erweiterung <strong>der</strong> vorhandenenProdukte und Dienstleistungen: Vor diesem H<strong>in</strong>tergrundmüssen die bereits vorhandenen Angebote verbessertund erweitert werden. Notwendig dafür ist dassystematische E<strong>in</strong>holen von Kundenerfahrungen und -me<strong>in</strong>ungen.Notwendig ist weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e diversifizierte Produktstrategie,die sich an den <strong>in</strong>dividuellen Bedürfnissen<strong>der</strong> älteren Abnehmer ausrichtet. Bei <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>enProduktgestaltung gilt es zukünftig verstärkt darauf zuachten, dass die Produkte nutzer- und bedienungsfreundlichund dementsprechend e<strong>in</strong>fach auch von älteren Menschenzu handhaben s<strong>in</strong>d. Gleichzeitig ist bei dem Designvon speziellen Produkten für Senior<strong>in</strong>nen und Seniorendarauf zu achten, dass man dieses den Produkten nichtansieht („Design for all Ages“).6 Senioren-Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung – dabei stärkereBerücksichtigung kle<strong>in</strong>er Unternehmen: Die bislang <strong>in</strong>e<strong>in</strong>igen Bundeslän<strong>der</strong>n gesammelten Erfahrungen habengezeigt, dass durch Vorgabe gezielter wirtschaftlicher undpolitischer Impulse das ökonomische QuerschnittsfeldSeniorenwirtschaft <strong>in</strong>itiiert, geför<strong>der</strong>t und gestärkt werdenkann. Von diesen Erfahrungen könnte auch die lokaleWirtschaftsför<strong>der</strong>ung an<strong>der</strong>norts profitieren. Zur gesamtwirtschaftlichenUnterstützung seniorenwirtschaftlicherInitiativen ist nach Auffassung <strong>der</strong> Kommission e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>politikzu entwickeln, die sich auch an den Bedürfnissenkle<strong>in</strong>er, gerade erst gegründeter Unternehmen orientiert.7 E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Verbraucherschutzes für ältereMenschen: E<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>s wichtige Aufgabe besteht <strong>in</strong><strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es funktionierenden und öffentlichkeitswirksamenVerbraucherschutzes. Die Kommissionist <strong>der</strong> Auffassung, dass die „Seniorenwirtschaft“ bislangvon den etablierten Anbietern Verbraucher<strong>in</strong>formationund -beratung nur un<strong>zur</strong>eichend ernst genommen wordenist. Sie begrüßt aus diesem Grunde die jüngsten Initiativendes organisierten Verbraucherschutzes zu Gunsten ältererMenschen. An<strong>der</strong>erseits s<strong>in</strong>d viele ältere Konsumentenauf Grund e<strong>in</strong>geschränkter Lebensverhältnissegerade nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>, e<strong>in</strong>e aktive Rolle als „kritischeVerbraucher“ auszuüben und s<strong>in</strong>d dabei auf externe Unterstützungangewiesen. Dabei geht es <strong>der</strong> Kommissionnicht nur um geeignete Prüf<strong>in</strong>stitutionen und e<strong>in</strong>e zielgenauere„Vermarktungsstrategie“, son<strong>der</strong>n auch um dieEntwicklung entsprechen<strong>der</strong> Instrumente und Verfahren.Exemplarisch verweist die Kommission hier auf das Prüfsiegel„Komfort und Qualität“.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 173 – Drucksache 16/21906 Potenziale des Alters <strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken6.1 E<strong>in</strong>leitungFamilie hat e<strong>in</strong>e zentrale gesellschaftliche Bedeutung.Nach wie vor ist die Familie e<strong>in</strong>e fundamentale Institution<strong>in</strong>nerhalb sich wandeln<strong>der</strong> Gesellschaften (Hill &Kopp 2002). Junge und alte Menschen leben <strong>in</strong>nerhalbvon Familienverbänden o<strong>der</strong> wünschen sich dies zum<strong>in</strong>dest.Allerd<strong>in</strong>gs wird die Familie nicht mehr durch e<strong>in</strong>enbestimmten Typus dom<strong>in</strong>iert, son<strong>der</strong>n ist <strong>in</strong> den letztenJahrzehnten facettenreicher und pluralistischer geworden(Mai 2003). Nicht alle<strong>in</strong> die Familienformen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gründungsphase<strong>der</strong> Familie haben sich verän<strong>der</strong>t, son<strong>der</strong>nauch die Gestalt <strong>der</strong> Familie am Ende des Familienzyklus.Dies wird sehr deutlich, wenn man den Blick auf dieMischung jüngerer und älterer Familienmitglie<strong>der</strong> richtet.Die zahlenmäßige Zunahme älterer Eltern und Großelternund die Abnahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> unserer Gesellschafthatten zudem e<strong>in</strong>e deutliche Funktionsverlagerung<strong>zur</strong> Folge. Das heißt, die Familie hat <strong>in</strong> den letzten fünfzigJahren e<strong>in</strong>en Bedeutungszuwachs durch Funktionszuwachserlebt: Familien haben im Zuge sich verlängern<strong>der</strong>Lebenszeit neue Aufgaben <strong>in</strong> Pflege und Betreuung alterFamilienmitglie<strong>der</strong> übernommen (Hoff & Tesch-Römerim Druck). Gleichzeitig unterstützen viele Angehörige<strong>der</strong> Großelterngeneration ihre (erwachsenen) K<strong>in</strong><strong>der</strong> durchf<strong>in</strong>anzielle Transfers und übernehmen Verantwortung <strong>in</strong><strong>der</strong> Betreuung ihrer Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> (Kohli et al. 2000a). Neben<strong>der</strong> Sozialisations-, Reproduktions- und Regenerationsfunktionist die Funktion <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>ensolidaritäte<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil familialer Beziehungen unddamit <strong>der</strong> Familie geworden (Höpfl<strong>in</strong>ger 1999).Der Wandel von Verwandtschaftsstrukturen und Intergenerationenbeziehungenwird <strong>in</strong> <strong>der</strong> familienpolitischenDebatte zum Teil mit großer Sorge betrachtet. Es wirdvermutet, dass die B<strong>in</strong>dungs- und Solidaritätsfähigkeit<strong>der</strong> grundlegenden gesellschaftlichen Institution „Familie“s<strong>in</strong>ken könnte (W<strong>in</strong>gen 1997). Häufig wird daraufh<strong>in</strong>gewiesen, dass – auf Grund ger<strong>in</strong>gerer K<strong>in</strong><strong>der</strong>zahlenund höherer Mobilität <strong>der</strong> jüngeren <strong>Generation</strong> – die Unterstützungälterer Menschen durch die Familie <strong>in</strong>Zukunft weniger sicher se<strong>in</strong> wird. Allerd<strong>in</strong>gs birgt <strong>der</strong>Wandel <strong>der</strong> Familie auch positive Perspektiven: Die Lebenszeitist sicherer geworden und damit ist – bei gleichzeitigsich verbessern<strong>der</strong> Gesundheit im höheren Erwachsenenalter– die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit größer geworden,dass Menschen länger <strong>in</strong> Partnerschaft und Familiezusammenleben können. Zudem zeigen empirische Untersuchungen,dass im europäischen Vergleich die Bereitschaft<strong>zur</strong> <strong>in</strong>tergenerationalen Unterstützung <strong>in</strong> Deutschlandsehr hoch ist (Daatland & Herlofson 2003).Private Netzwerke bilden den Rahmen, <strong>in</strong> den Familienund familiale Beziehungen e<strong>in</strong>gebettet s<strong>in</strong>d (Antonucci2001). Freundschaften werden nicht selten über Jahrzehntegepflegt, können aber auch im höheren Alter neuentstehen (Wenger & Jerrome 1999). Beziehungen zuMenschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nachbarschaft stellen ebenfalls e<strong>in</strong>eQuelle von Kontaktmöglichkeiten und Unterstützungspotenzialendar, wenngleich private Netzwerke durch an<strong>der</strong>eNormen konstituiert werden als familiale Beziehungen.Während familialen Beziehungen häufig das Pr<strong>in</strong>zipe<strong>in</strong>er bedürfnisorientierten Solidarität zugrunde liegt undlangfristige Hilfe und Unterstützung auch ohne Aussichtauf Gegenleistung erbracht werden, beruhen Freundschaftenstärker auf dem ausgleichsorientierten Reziprozitätspr<strong>in</strong>zip,das für alle erhaltenen o<strong>der</strong> gegebenenLeistungen e<strong>in</strong>en entsprechenden Ausgleich verlangt (Ingersoll-Dayton& Antonucci 1988). Freundschaften undBekanntschaften s<strong>in</strong>d daher eher durch geme<strong>in</strong>same Aktivitätenund Unternehmungen als durch die Übernahmeb<strong>in</strong>den<strong>der</strong> Unterstützungsleistungen charakterisiert. Dennochübernehmen Freunde und Nachbarn nicht seltenwichtige Aufgaben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Betreuung und Pflege alterMenschen, <strong>der</strong>en Bedeutung sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft aufGrund <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen von Familienstrukturen (etwa<strong>der</strong> zunehmenden K<strong>in</strong><strong>der</strong>losigkeit älter werden<strong>der</strong> Menschen)noch verstärken könnte. Demzufolge kann davonausgegangen werden, dass private Netzwerke ältererMenschen, zumal diese nicht nur nützlich s<strong>in</strong>d, son<strong>der</strong>n– als freiwillige Beziehungen zu Bekannten, Freundenund Nachbarn – zugleich Nähe, Vertrautheit, Emotionalitätund Sicherheit erzeugen, auch künftig e<strong>in</strong>e zentraleBedeutung für die Lebenslage und Lebensqualität im Alterhaben werden.Geht es um die Unterstützungsleistungen von Familienund sozialen Netzen, so werden älter werdende und alteMenschen häufig als Empfänger von Hilfe und Betreuungdargestellt. Seltener werden jene Unterstützungsleistungen<strong>in</strong> den Blick genommen, die ältere Menschen <strong>in</strong>nerhalbihrer Familie und <strong>in</strong> sozialen Netzen erbr<strong>in</strong>gen (Attias-Donfut2000). Im vorliegenden Kapitel soll es um dieFrage gehen, welche Potenziale des Alters <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familievorhanden s<strong>in</strong>d, wie diese Potenziale unterstützt werdenkönnen und wo die Grenzen familialer Unterstützungspotenzialeälterer Menschen liegen. Dabei ist zu bedenken,dass <strong>in</strong> sozialpolitischer Perspektive Familien bereitsjetzt das primäre Solidaritätsnetz e<strong>in</strong>er Gesellschaft bilden.Sozialstaatliche Leistungen s<strong>in</strong>d – zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong>Deutschland – den familiären Hilfeleistungen nachgeordnetund ergänzen sie. Das Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip, das fürviele Bereiche <strong>der</strong> Sozialpolitik <strong>in</strong> Deutschland grundlegendist, hat <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit dazu geführt, dass Familiene<strong>in</strong>e Vielzahl von Aufgaben erfüllen, die <strong>in</strong> an<strong>der</strong>enGesellschaften Institutionen, wie ambulanten PflegeundHauswirtschaftsdiensten (kommunaler o<strong>der</strong> marktlicherNatur), übertragen wurden. Hierbei ist zu berücksichtigen,dass sich die Strukturen <strong>der</strong> Familie <strong>in</strong>
Drucksache 16/2190 – 174 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeDeutschland, bed<strong>in</strong>gt durch die demografischen Entwicklungstendenzenund durch verän<strong>der</strong>te Familienformen<strong>der</strong>art verän<strong>der</strong>n, dass die Zahl pflegebereiter Personenlangfristig <strong>zur</strong>ückgehen könnte (Klie 2004a; Bl<strong>in</strong>kert &Klie 2004). Die entsprechenden sozialrechtlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungenmüssen beachtet werden, wenn es zunächstdarum geht, jene Potenziale zu beschreiben, die älterwerdende und alte Männer und Frauen <strong>in</strong>nerhalb vonFamilien und privaten Netzen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen, und darauf aufbauendMaßnahmen zu skizzieren, durch die die Potenzialedes Alters für Familie und soziale Netzwerke erhalteno<strong>der</strong> gestärkt werden.In dem – diesem ersten E<strong>in</strong>leitungsabschnitt folgenden –zweiten Abschnitt des Kapitels wird e<strong>in</strong>e <strong>Lage</strong>analyse zuden Potenzialen von älter werdenden Männern undFrauen <strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken vorgenommen.Dabei werden zunächst die kognitiven, emotionalen,<strong>in</strong>strumentellen und f<strong>in</strong>anziellen Unterstützungsleistungen<strong>in</strong> ausgewählten Beziehungstypen dargestellt.Anschließend wird die Bedeutung von privaten Netzwerkenfür die Betreuung und Unterstützung hilfe- und pflegebedürftigerMenschen vor dem H<strong>in</strong>tergrund aktuellerDiskussionen <strong>zur</strong> sozialen Pflegeversicherung (SGB XI)dargestellt. Hier, wie auch im folgenden Abschnitt, wirde<strong>in</strong>e Beschränkung auf den Bereich <strong>der</strong> Unterstützunghilfe- und pflegebedürftiger Menschen vorgenommen, daan<strong>der</strong>e Potenzialbereiche, wie „Weiterbildung“ und „Prävention“im Kapitel „Bildung“ behandelt werden. Im drittenAbschnitt des Kapitels werden aus <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>analyseSchlussfolgerungen gezogen und Ziele <strong>zur</strong> Erhaltung undStärkung von Potenzialen des Alters <strong>in</strong> Familie und privatenNetzwerken formuliert. Die Potenziale des Alters <strong>in</strong>nerhalbvon Familien und privaten Netzwerken zu erhaltenund zu stärken, werden dabei als die wesentlichenZiele identifiziert. Die Kommission geht davon aus, dassdiese Ziele für die Senioren- und Familienpolitik <strong>der</strong> Zukunftvon Bedeutung s<strong>in</strong>d. Im vierten Abschnitt des Kapitelswerden mögliche Maßnahmen und Interventionendiskutiert, die angesichts <strong>der</strong> aktuellen Ist-Situation dabeihelfen könnten, die angestrebten Ziele zu realisieren.Schließlich werden im fünften Abschnitt des KapitelsEmpfehlungen an unterschiedliche Akteure <strong>der</strong> SeniorenundFamilienpolitik formuliert.6.2 <strong>Lage</strong>analyse: Potenziale <strong>in</strong> Familien undprivaten NetzwerkenIn diesem Abschnitt wird e<strong>in</strong>e <strong>Lage</strong>analyse zu Unterstützungsleistungenund -potenzialen von älter werdendenMännern und Frauen <strong>in</strong>nerhalb von Familien und sozialenNetzen vorgenommen. Hierbei liegt <strong>der</strong> Fokus auf jenenUnterstützungsleistungen, die von älteren Menschen füran<strong>der</strong>e Mitglie<strong>der</strong> ihrer familialen o<strong>der</strong> privatenNetzwerke erbracht werden. Bei <strong>der</strong> Darstellung von Unterstützungsleistungenwerden die unterschiedlichen Situationenvon Frauen und Männern, von Ost- und Westdeutschen,von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten sowie vonAngehörigen unterschiedlicher sozialer Schichten differenziertberücksichtigt, soweit dies die empirische Befundlagezulässt. Dabei werden wie<strong>der</strong>holt Ergebnissedes Alterssurveys vorgestellt, e<strong>in</strong>er repräsentativen Studie40- bis 85-jähriger Menschen, die <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> privatenHaushalten leben (Tesch-Römer 2004b). Im Anschlussan die Darstellung <strong>der</strong> vielfältigen Leistungen, dieim Rahmen familialer und an<strong>der</strong>er privater Netzwerke erbrachtwerden, wird die Bedeutung privater Netze für dieUnterstützung hilfe- und pflegebedürftiger Menschendargelegt. Hierbei wird die Frage gestellt, ob die durchSGB XI festgelegten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen das Potenzialälterer Menschen für die Unterstützung hilfe- und pflegebedürftigerMenschen angemessen för<strong>der</strong>n.6.2.1 Hilfe und Unterstützung <strong>in</strong>verschiedenen BeziehungstypenIm Folgenden werden e<strong>in</strong>ige <strong>der</strong> vielfältigen Beziehungstypen<strong>in</strong>nerhalb von Familien behandelt: Partnerschaften(hetero- und homosexuelle Partnerschaften zwischenMännern und Frauen), Beziehungen zwischenEltern und ihren (erwachsenen) K<strong>in</strong><strong>der</strong>n, Beziehungenzwischen Großeltern und ihren Enkeln sowie Beziehungenzwischen Freunden, Bekannten und Nachbarn (private,nicht-familiale Netzwerke). Empfänger von Unterstützungsleistungenälterer Menschen können dabeisowohl junge als auch alte Menschen se<strong>in</strong>. Zunächst werdenim Folgenden die gegenwärtige und zukünftigeStruktur <strong>der</strong> jeweiligen Beziehungsformen skizziert. Daranschließt sich e<strong>in</strong>e Darstellung von Beziehungsqualitätsowie <strong>der</strong> Arten von Unterstützungsleistungen an. Dabeikönnen die <strong>in</strong> Unterstützungsleistungen <strong>zur</strong> Verfügunggestellten Hilfen sehr breit se<strong>in</strong> (z.B. emotionale Unterstützung,<strong>in</strong>strumentelle Hilfen wie Unterstützung imHaushalt, f<strong>in</strong>anzielle Transfers, Betreuung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>no<strong>der</strong> demenziell verän<strong>der</strong>ten alten Menschen sowie Hilfebei Pflegebedürftigkeit). Abschließend werden für diee<strong>in</strong>zelnen Beziehungstypen die – möglicherweise unausgeschöpften– Potenziale sowie die Grenzen von Unterstützungsleistungen<strong>der</strong> fraglichen Beziehungskonstellationendiskutiert.6.2.1.1 Heterosexuelle PartnerschaftenDie Pluralisierung familiärer Lebensformen, zu denenauch die Individualisierung <strong>der</strong> Lebensführung und gewollteK<strong>in</strong><strong>der</strong>losigkeit gehören, bee<strong>in</strong>flussen nicht nurden Aufbau <strong>in</strong>tergenerationeller B<strong>in</strong>dungen, son<strong>der</strong>n auchdie Beziehungen zwischen Partnern. Es gibt e<strong>in</strong>enAnstieg von alle<strong>in</strong> lebenden Männern und Frauen, vonnicht-ehelichen Lebensgeme<strong>in</strong>schaften, von nicht anHaushaltsgeme<strong>in</strong>schaften gebundenen Lebensformen,von Ehen und Familien, die über mehrere Orte h<strong>in</strong>weggeführt werden, von Scheidungen, Trennungen und Fortsetzungsfamilien.Dabei ist zu fragen, ob sich die bislangbeobachtbare Kompensation des Rückgangs an Eheschließungendurch die Zunahme nicht-ehelicher Lebensgeme<strong>in</strong>schaftenweiter fortsetzen wird (Kle<strong>in</strong>, Lengerer& Uzelac 2002). Es kann davon ausgegangen werden,dass es <strong>in</strong> Zukunft zu e<strong>in</strong>er weiteren Diversifizierung vonLebens- und Wohnformen kommen wird, etwa selbst gewählteLebensgeme<strong>in</strong>schaften, geme<strong>in</strong>sam alt und sehralt werdende Ehepaare, Ehepaare ohne K<strong>in</strong><strong>der</strong> sowie alle<strong>in</strong>lebende Männer und Frauen. Ziel dieses Unterabschnittsist es, zunächst die gegenwärtigen und zukünftigenStrukturen von Partnerschaften zwischen Männernund Frauen zu skizzieren und anschließend die Unterstüt-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 175 – Drucksache 16/2190zungspotenziale <strong>in</strong> Partnerschaften älter werden<strong>der</strong> undalter Männer und Frauen zu beschreiben.Struktur: Die Formen <strong>der</strong> Lebenspartnerschaft haben sich<strong>in</strong> den vergangenen Dekaden tief greifend verän<strong>der</strong>t undwerden dies auch <strong>in</strong> Zukunft tun (Mai & Roloff 2004a).Dabei unterscheidet sich die Lebenssituation zwischenMännern und Frauen erheblich, während regionale Unterschiedezwischen Ost- und Westdeutschland – bis auf denhöheren Witweranteil bei den über 75-jährigen ostdeutschenMännern und den vergleichsweise häufiger geschiedenenostdeutschen Frauen – nicht sehr groß s<strong>in</strong>dund sich <strong>in</strong> Zukunft weiter verr<strong>in</strong>gern werden. Tabelle 21zeigt die Familienstandsstrukturen von Männern undFrauen unterschiedlicher Altersgruppen des Jahres 2002.Die Mehrzahl <strong>der</strong> Männer ist gegenwärtig verheiratet,und zwar auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> höchsten Altersgruppe <strong>der</strong> über80-Jährigen (<strong>in</strong> diesem Alter s<strong>in</strong>d etwa zwei Drittel allerMänner verheiratet). Der Anteil von ledigen und geschiedenenMännern ist relativ kle<strong>in</strong>. Die Situation für Frauenstellt sich grundlegend an<strong>der</strong>s dar: Mit dem Alter steigt<strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> verwitweten Frauen erheblich an (bei denüber 80-jährigen Frauen s<strong>in</strong>d fast drei Viertel aller Frauenverwitwet). Der Anteil <strong>der</strong> ledigen und geschiedenenFrauen ist – im Vergleich mit den Männern – etwas höher.Tabelle 22 zeigt e<strong>in</strong>e Hochrechnung <strong>der</strong> Familienstandsstrukturenfür das Jahr 2030, die auf den aktuellen Datendes Jahres 2002 basiert und Heirats-, Scheidungs- sowieSterbewahrsche<strong>in</strong>lichkeiten berücksichtigt. 50 Die Verhältnisse<strong>in</strong> Ost- und Westdeutschland werden sich <strong>in</strong>nerhalb<strong>der</strong> nächsten 25 Jahre weitgehend angleichen (allerd<strong>in</strong>gswird die Zahl <strong>der</strong> Ledigen <strong>in</strong> Ostdeutschland etwas ger<strong>in</strong>gerund die Zahl <strong>der</strong> Geschiedenen etwas höher se<strong>in</strong> als <strong>in</strong>Westdeutschland). Geht man von den Ergebnissen dieserHochrechnung aus, so werden sich <strong>in</strong> den nächsten25 Jahren die Familienstandsstrukturen <strong>der</strong> Geschlechteretwas annähern. Dennoch kann festgehalten werden, dassdie Unterschiede zwischen den Geschlechtern <strong>in</strong> den Partnerschafts-und Lebensformen auch <strong>in</strong> Zukunft Bestand habenwerden. Für Frauen wird das Verwitwungsrisiko weiteransteigen und die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, verheiratet zu se<strong>in</strong>,weiter abnehmen. Der Anteil <strong>der</strong> Frauen <strong>in</strong> nicht-ehelichenLebensgeme<strong>in</strong>schaften (NEL) wird <strong>in</strong> den nächsten Jahrzehntenwenig bedeutsam se<strong>in</strong> und ke<strong>in</strong>e wesentlich größereRolle spielen als gegenwärtig (trotz e<strong>in</strong>er leichten Zunahme<strong>in</strong> den Altersgruppen bis 74 Jahren).50 Hierbei wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ersten Schritt die Familienstandsstruktur e<strong>in</strong>erAltersgruppe des Jahres 2002 als Ausgangswert für das Jahr 2005def<strong>in</strong>iert. Danach wurde e<strong>in</strong>e Hochrechnung für fünf 5-Jahresgruppenbis zum Jahr 2030 weitergeführt. So basiert die Familienstandsstrukturfür die 65- bis 69-Jährigen im Jahre 2010 auf den Daten <strong>der</strong>60- bis 64-Jährigen des Jahres 2005. Die Hochrechnung beg<strong>in</strong>nt somitmit den 40- bis 44-Jährigen (den 65 bis 69 Jahre alten Menschendes Jahres 2030) und endet mit den 55-Jährigen und Älteren des Jahres2005 (den über 80-Jährigen des Jahres 2030).Tabelle 21Familienstandsstrukturen <strong>der</strong> 65 Jahre und älteren Männer und Frauen, 2002von 100 waren:65 J. u. m. 65 - 69 J. 70 - 74 J. 75 - 79 J. 80 J. u. m.Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann Frau Mann FrauDeutschlandLedig 3,8 6,3 5,0 4,7 3,5 6,2 2,7 7,8 2,4 7,0Verheiratet 79,7 43,5 83,4 64,5 82,0 49,9 77,1 35,1 67,1 16,0Verwitwet 13,2 45,2 7,0 25,0 11,4 38,8 17,9 52,5 28,8 72,9Geschieden 3,4 5,0 4,6 5,8 3,2 5,1 2,3 4,6 1,6 4,1WestdeutschlandLedig 4,1 6,3 5,5 4,7 3,8 6,3 2,8 7,7 2,6 7,1Verheiratet 79,0 42,6 82,9 64,4 81,7 50,1 77,6 36,1 65,7 15,0Verwitwet 13,5 46,4 6,8 24,9 11,2 38,6 17,3 52,1 30,1 74,3Geschieden 3,4 4,7 4,8 6,0 3,3 4,9 2,2 4,1 1,6 3,6OstdeutschlandLedig 2,1 5,9 2,9 4,7 1,6 5,6 1,7 8,3 1,5 5,6Verheiratet 80,2 41,2 85,7 63,5 83,6 48.0 74,2 30,2 62,5 12,7Verwitwet 14,8 45,9 7,9 24,9 12,2 39.4 21,6 54,0 34,1 75,0Geschieden 2,9 7.0 3,6 7,0 2,6 7,0 2,6 7,4 1,8 6,7Quelle: Mai & Roloff 2004a: 10, 13. Datenbasis: Mikrozensus 2002.
Drucksache 16/2190 – 176 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 22Familienstandsstrukturen <strong>der</strong> 65 Jahre und Älteren nach Altersgruppen (Deutschland 2002 und 2030)von 100 waren:65 - 69 Jahre 70 - 74 Jahre 75 - 79 Jahre 80 Jahre u.m.2002 2030 2002 2030 2002 2030 2002 2030MännerLedig 4,4 15,6 3,1 11,5 2,3 8,0 2,3 5,7Geschieden 3,5 6,3 2,4 6,6 1,7 6,3 1,4 5,2Verwitwet 6,1 5,8 10,1 9,7 16,3 15,9 29,1 30,7Verheiratet 83,1 64,4 81,9 66,0 77,0 65,1 65,1 54,9NEL * 2,9 7,8 2,6 6,2 2,8 4,7 2,1 3,5FrauenLedig 4,4 8,7 6,0 6,6 7,6 4,9 6,7 4,0Geschieden 5,7 8,4 5,1 8,8 4,6 9,0 4,1 7,0Verwitwet 23,5 23,5 37,5 37,5 51,6 51,6 73,8 76,0Verheiratet 64,1 52,1 49,7 41,8 35,0 30,3 14,6 9,6NEL * 2,3 7,3 1,8 5,3 1,1 4,2 0,7 2,7* NEL = Nicht-eheliche Lebensgeme<strong>in</strong>schaften.Quelle: Mai & Roloff 2004a: 47. Datenbasis: Mikrozensus 2002.Die Familienstandsstrukturen von Männern werden sichnach dieser Hochrechnung erheblich stärker verän<strong>der</strong>n alsdie von Frauen. So wird <strong>der</strong> Anteil verheirateter Männer– je nach Altersgruppe – um bis zu e<strong>in</strong> Viertel abs<strong>in</strong>ken,und <strong>der</strong> Anteil lediger Männer wird stärker zunehmen alsdie Zahl lediger Frauen. Der Anteil <strong>der</strong> geschiedenenMänner und Frauen wird sich <strong>in</strong> allen Altersgruppen verdoppeln.Männer werden anteilig mehr <strong>in</strong> festen, vor allem<strong>in</strong> ehelichen, Partnerschaften leben als Frauen. Sowerden dies im Jahr 2030 von den 65- bis 69-jährigenMännern <strong>in</strong>sgesamt 72,2 Prozent und von den Frauen diesesAlters 59,4 Prozent se<strong>in</strong>. Bei den Hochbetagten wirddieser Unterschied 58,4 zu 12,3 Prozent ausmachen. Umgekehrtwerden von den über 80-jährigen Frauen überdrei Viertel, dagegen von den Männern knapp e<strong>in</strong> Drittelverwitwet se<strong>in</strong>.In Abhängigkeit von <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> künftigen Familienstandsstrukturenund unter <strong>der</strong> Annahme unverän<strong>der</strong>terHaushaltsstrukturen (Basisjahr 2002) ist bis 2030mit e<strong>in</strong>em Anstieg <strong>der</strong> <strong>in</strong> Mehrpersonenhaushalten lebendenüber 65-Jährigen zu rechnen: von 9,3 Millionen auf12,4 Millionen (Mai & Roloff 2004a). Stärker anwachsenwird jedoch die Zahl <strong>der</strong> <strong>in</strong> E<strong>in</strong>personenhaushalten lebendenälteren Menschen, und zwar von <strong>der</strong>zeitig 5,2 Millionenauf 9,2 Millionen. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Westdeutschlandist e<strong>in</strong> Anstieg <strong>der</strong> E<strong>in</strong>personenhaushalte Älterer zu erwarten:Während sich dort <strong>der</strong>en Zahl bis 2030 um81 Prozent erhöhen wird, ist diese Entwicklung <strong>in</strong> Ostdeutschlandmit e<strong>in</strong>er Steigerung um 56 Prozent nichtganz so stark. Sowohl Männer als auch Frauen werden <strong>in</strong>Zukunft vermehrt alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Haushalt führen. Dabeiwird die Zahl <strong>der</strong> alle<strong>in</strong>lebenden Männer gegenüber heuteim letzten Prognosejahr stärker anwachsen als die <strong>der</strong>Frauen: auf fast das Dreifache, die <strong>der</strong> Frauen dagegen„nur“ um 55 Prozent (Mai & Roloff 2004a).Für ältere Migranten und Migrant<strong>in</strong>nen zeigen bisherigeDaten im Vergleich <strong>zur</strong> e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerung e<strong>in</strong>enger<strong>in</strong>geren S<strong>in</strong>gularisierungsgrad und größere Haushalte,<strong>in</strong> denen mehr <strong>Generation</strong>en unmittelbar zusammenleben(Krumme & Hoff 2004; siehe auch den Abschnitt Familienund soziale Netzwerke älterer Migranten im KapitelMigrantion und Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft undGesellschaft). Die Daten des Alterssurveys bestätigendiese Ergebnisse (Tabelle 23). Der Anteil <strong>der</strong> Alle<strong>in</strong>lebendenbei den 40- bis 85-Jährigen ist unter den nichtdeutschenStaatsangehörigen <strong>in</strong>sgesamt etwas ger<strong>in</strong>gerals unter den Deutschen (vgl. letzte Zeile <strong>in</strong> Tabelle 23).Da die im Alterssurvey befragten Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen undAuslän<strong>der</strong> im Durchschnitt jünger s<strong>in</strong>d als die Deutschen,ist es notwendig, das Alter beim Vergleich zu kontrollieren.Betrachtet man e<strong>in</strong>zelne Altersgruppen (40- bis54-Jährige, 55- bis 69-Jährige und 70- bis 85-Jährige), soverr<strong>in</strong>gern sich die Unterschiede zwischen Deutschen undNicht-Deutschen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 177 – Drucksache 16/2190Tabelle 23Anteil <strong>der</strong> Alle<strong>in</strong>lebenden 40- bis 85-jährigen Nicht-Deutschen und Deutschen im Jahr 2002Anteil Alle<strong>in</strong>leben<strong>der</strong> (<strong>in</strong> Prozent)Nicht-DeutscheDeutsche40 – 54 Jahre 10,4 12,755 – 69 Jahre 16,5 16,670 – 85 Jahre 37,3 41,7Weiblich 14,9 25,5Männlich 14,4 14,9Gesamt 14,7 20,5Quelle: Krumme & Hoff 2004: 479. Datenbasis: Alterssurvey 2002.Qualität: Paarbeziehungen und Partnerschaften s<strong>in</strong>d fürviele Menschen die Kernbeziehungen <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Familieund des sozialen Netzwerks. Partnerschaften führen– im Idealfall – <strong>zur</strong> Konstruktion e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Lebenswelt:Wahrnehmung und Interpretation <strong>der</strong> sozialenUmwelt, das Setzen und Verfolgen von Lebensplänen und<strong>der</strong> Austausch über Erfahrungen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> wesentlichesElement von Partnerschaften. Dabei haben sich Partnerschaftenzwischen Frauen und Männern <strong>in</strong> verschiedenerH<strong>in</strong>sicht verän<strong>der</strong>t. Zum e<strong>in</strong>en hat sich die Dauerhaftigkeitvon Ehen verän<strong>der</strong>t. Die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit e<strong>in</strong>erScheidung hat <strong>in</strong> den letzten fünfzig Jahren erheblich zugenommen:Während im Jahr 1950 etwa e<strong>in</strong> Zehntel <strong>der</strong>geschlossenen Ehen geschieden wurden, ist gegenwärtigdamit zu rechnen, dass mehr als e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> geschlossenenEhen durch Scheidung endet (die zusammengefassteScheidungsziffer im Jahr 2000 betrug 37 Prozent(Engstler & Menn<strong>in</strong>g 2003). Gleichzeitig ist die Zahlnicht-ehelicher Lebensgeme<strong>in</strong>schaften <strong>in</strong> den letzten Jahrenerheblich gestiegen. Zudem haben sich die geschlechtsspezifischenVerantwortlichkeiten <strong>in</strong>nerhalb vonPartnerschaften <strong>in</strong> den vergangenen Jahren erheblich verän<strong>der</strong>t:Während noch vor wenigen Jahrzehnten im WestenDeutschlands das „male-bread-w<strong>in</strong>ner“-Modell geschlechtsspezifischeRollenverteilungen für Männer(Erwerbsarbeit) und Frauen (Hausarbeit) vorsah, habensich diese Vorstellungen von Ehe und Partnerschaft zumTeil tiefgreifend verän<strong>der</strong>t. Erwerbsarbeit ist für vieleFrauen selbstverständliches Lebensziel geworden. Hierzeigen sich bedeutsame Unterschiede zwischen den RegionenDeutschlands: Im Osten Deutschlands haben sichFrauen <strong>in</strong> stärkerem Maße und seit längerer Zeit auf dieTeilhabe an <strong>der</strong> Erwerbsarbeit orientiert als <strong>in</strong> Westdeutschland.Diese Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Qualität von Partnerschaftenhaben Bedeutung auch für geme<strong>in</strong>sam alt werdendePaare. Geme<strong>in</strong>sam <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Lebenspartnerschaft alt zuwerden – sei es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ehelichen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er nicht-ehelichenBeziehung –, ist <strong>in</strong> stärkerem Maß als jemals zuvor<strong>der</strong> Ausdruck e<strong>in</strong>er Entscheidung für das geme<strong>in</strong>same Lebenzu zweit. Daten aus dem Alterssurvey zeigen, dassüber 90 Prozent <strong>der</strong> befragten 40- bis 85-jährigen Personenmit Partner ihre Partnerschaft als gut o<strong>der</strong> sehr gute<strong>in</strong>schätzten. Der Anteil <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Partnerschaft zufriedenenPersonen steigt (im Jahr 2002) mit dem Alter sogaran: Bei den 40- bis 54-Jährigen waren dies 91,3 Prozent,bei den 55- bis 69-Jährigen 94,0 und bei den 70- bis85-Jährigen 95,6 Prozent. Langjährige Ehebeziehungenalter Menschen zeichnen sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel durch hoheZufriedenheit mit <strong>der</strong> Partnerschaft aus. Dies zeigt sich– im Vergleich zu Paaren, die im mittleren Erwachsenenalterstehen – auch an e<strong>in</strong>em höheren Maß an Zärtlichkeitim Umgang mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>, durch e<strong>in</strong>e höhere Freude an geme<strong>in</strong>samenAktivitäten sowie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>geren Konflikthäufigkeit(Lang, Neyer & Asendorpf 2005). ÄlterePaare sche<strong>in</strong>en im Lauf <strong>der</strong> Beziehung ihr Kommunikations-und Konfliktverhalten besser auf den Partner abgestimmtzu haben. Insgesamt zeigen diese Befunde, dassdie Partnerschaften älter werden<strong>der</strong> und alter Menschen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel als gut e<strong>in</strong>zuschätzen s<strong>in</strong>d.Potenziale und Risiken: Die gute Beziehungsqualität vonPartnerschaften im mittleren und hohen Erwachsenenalterzeigt sich auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>sam verbrachten Zeit, desWohlbef<strong>in</strong>dens sowie <strong>der</strong> Verantwortungsübernahme fürdie jeweils an<strong>der</strong>e Person. Partnerschaft besteht <strong>in</strong> ersterL<strong>in</strong>ie dar<strong>in</strong>, das Leben mit e<strong>in</strong>em Partner o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Partner<strong>in</strong>zu teilen, Zeit geme<strong>in</strong>sam zu verbr<strong>in</strong>gen und geme<strong>in</strong>sameAktivitäten durchzuführen. Vergleicht man älterwerdende und alte Menschen, die <strong>in</strong> Partnerschaftenleben, mit alle<strong>in</strong> lebenden Personen, so zeigen sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erReihe von Bereichen die positiven Auswirkungen undPotenziale von Partnerschaften. Personen, die <strong>in</strong> Partnerschaftenleben, geben e<strong>in</strong>e bessere subjektive Gesundheit,e<strong>in</strong>e bessere Bewertung des eigenen Lebensstandards sowiee<strong>in</strong>e höhere allgeme<strong>in</strong>e Lebenszufriedenheit an alsPersonen, die alle<strong>in</strong> leben (Mai & Roloff 2004a: 67;Tesch-Römer 2004a). (Ehe-)Partner im geme<strong>in</strong>samenHaushalt wirtschaften zudem <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel geme<strong>in</strong>sam. ImVergleich zeigt sich, dass die materiellen Ressourcen vonMenschen, die im Alter <strong>in</strong> Paarbeziehungen leben, größers<strong>in</strong>d als diejenigen von Personen, die alle<strong>in</strong> leben (Mai &Roloff 2004a: 64). Partner<strong>in</strong>nen und Partner wirtschaftenaber nicht nur geme<strong>in</strong>sam, son<strong>der</strong>n übernehmen auchVerantwortung füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>in</strong> Zeiten von Krankheit undHilfsbedürftigkeit. E<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Rolle spielen Partnerim Fall von ständiger Pflegebedürftigkeit. (Ehe)Partner<strong>in</strong>nenund -partner stellten im Jahr 2002 mit 28 Prozentdie größte Gruppe an Hauptpflegepersonen von pflegebedürftigenMenschen, die <strong>in</strong> Privathaushalten leben (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend2005b: 1). Im Vergleich mit den zuvor durchgeführtenUntersuchungen ist dies allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong> Rückgang gegenüberden Jahren 1991/1992 (damals betrug <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>pflegenden Partner etwa 37 Prozent, 24 Prozent Frauenund 13 Prozent Männer) und 1998 (<strong>in</strong>sgesamt 32 Prozent,davon 20 Prozent Frauen und 12 Prozent Männer)(Schneekloth & Müller 2000: 52). Hier deutet sich möglicherweisean, dass <strong>in</strong> Zukunft die Übernahme von Pflegeverantwortungfür den Partner o<strong>der</strong> die Partner<strong>in</strong> nichtmehr selbstverständlich ist, etwa weil beide Partner an<strong>der</strong> Schwelle zum vierten Lebensalter stehen und e<strong>in</strong>e
Drucksache 16/2190 – 178 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeÜbernahme körperlich belasten<strong>der</strong> Pflegetätigkeiten nichtmehr möglich ist. E<strong>in</strong>e weitere augenfällige Beson<strong>der</strong>heitist, dass im Vergleich <strong>zur</strong> Situation zu Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> 1990er-Jahre <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> männlichen pflegenden Angehörigenvon 17 Prozent auf 27 Prozent angestiegen ist, wobei esvor allem die Söhne s<strong>in</strong>d, die auch als HauptpflegepersonVerantwortung übernehmen (Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend 2005a: 1).Zusammenfassung: Trotz e<strong>in</strong>es Anstiegs <strong>der</strong> Lebenserwartungvon Männern und Frauen und e<strong>in</strong>er Zunahmedes Anteils nicht-ehelicher Lebensgeme<strong>in</strong>schaften werden<strong>in</strong> Zukunft weniger Frauen und Männer <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Paarbeziehungleben als heutzutage. E<strong>in</strong> Leben ohne festePartnerschaft im Alter wird <strong>in</strong> Zukunft für beide Geschlechteransteigen, aber weiterh<strong>in</strong> für Frauen <strong>in</strong> stärkeremMaß zutreffen als für Männer. Für alle<strong>in</strong> lebende älterwerdende und alte Menschen ist das Hilfe- undUnterstützungspotenzial e<strong>in</strong>er Partnerschaft nicht vorhanden.Für jene Menschen, die geme<strong>in</strong>sam mit e<strong>in</strong>em Partnero<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Partner<strong>in</strong> leben, ist das beträchtliche Potenzial<strong>der</strong> Partnerschaft bereits gegenwärtig zu großenTeilen ausgeschöpft. Geme<strong>in</strong>sames Wirtschaften vollziehtsich zum geme<strong>in</strong>samen Vorteil bei<strong>der</strong> Partner, unddie Bereitschaft <strong>zur</strong> Übernahme von Pflege ist groß (undwird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel auch realisiert, wenn <strong>der</strong> Fall e<strong>in</strong>tritt).Schließlich zeigt sich auch bei subjektiver Gesundheitund Lebensqualität e<strong>in</strong> positiver E<strong>in</strong>fluss des Lebens <strong>in</strong>Partnerschaft. Da die Qualität <strong>der</strong> Beziehungen von Menschenauch heute im mittleren Erwachsenenalter hoch ist,kann angenommen werden, dass auch zukünftig diesePartnerschaftspotenziale im Alter realisiert werden. Allerd<strong>in</strong>gsist zu bedenken, dass geme<strong>in</strong>sames Altwerden <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er Partnerschaft auch bedeutet, dass die Voraussetzungenfür Partnerpflege schw<strong>in</strong>den, da <strong>der</strong> Gesundheitszustandund die körperliche Leistungsfähigkeit <strong>der</strong> möglichenPflegeperson ebenfalls e<strong>in</strong>geschränkt se<strong>in</strong> kann (e<strong>in</strong>entsprechen<strong>der</strong> Rückgang <strong>in</strong> den Anteilen von Partnerpflegezeigt sich bereits <strong>in</strong> den vergangenen 10 Jahren).6.2.1.2 Homosexuelle PartnerschaftenPartnerschaften zwischen Menschen gleichen Geschlechts(im Folgenden auch „lesbische und schwulePartnerschaften“ genannt) wurden bis <strong>in</strong> die 1960er- und1970er-Jahre <strong>in</strong> West- und Ostdeutschland durch diestrafrechtliche Verfolgung „homosexueller Handlungen“außerordentlich erschwert. 51 Erst nach Abschaffung des§ 175 im Jahr 1968 <strong>in</strong> <strong>der</strong> DDR und <strong>in</strong> den Jahren 1969bzw. 1973 <strong>in</strong> <strong>der</strong> BRD sowie im Zuge <strong>der</strong> darauf folgendenSchwulen- und Lesben-Bewegung (vor allem <strong>in</strong> <strong>der</strong>51 Im Nationalsozialismus wurden <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e schwule Männer systematischverfolgt („rosa Listen“) und <strong>in</strong> Konzentrations- und Vernichtungslagerdeportiert. Zwischen Ende des 2. Weltkrieges und 1965wurde <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik im Rahmen des § 175 gegen etwa100.000 Männer juristisch ermittelt (Senatsverwaltung für Bildung2003: 11), von denen jährlich ca. 3.000 Personen – zum Teil zu Gefängnisstrafen– verurteilt wurden (Stümke 1998: 59). Diese Verfolgungdürfte mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit Auswirkungen auf die Bildungund den Erhalt von Lebenspartnerschaften dieser Männergeführt haben, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt im dritten und viertenLebensalter stehen.Bundesrepublik) verbesserten sich die Möglichkeiten fürgleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften von Männernund Frauen. Erst seit kurzer Zeit werden die homosexuellenBeziehungen ähnlich gewürdigt wie heterosexuellePartnerschaften. E<strong>in</strong> Beispiel hierfür ist das Institut<strong>der</strong> e<strong>in</strong>getragenen Lebenspartnerschaft, das im Jahr 2001<strong>in</strong> Kraft trat (Dethloff 2001). Paaren gleichen Geschlechtswird damit die Möglichkeit e<strong>in</strong>geräumt, ihrer geme<strong>in</strong>samenVerbundenheit durch die Übernahme rechtlicher VerantwortungAusdruck zu geben, z.B. durch die Wahl e<strong>in</strong>esgeme<strong>in</strong>samen Namens o<strong>der</strong> durch die Verpflichtung zumUnterhalt des Partners. Allerd<strong>in</strong>gs liegt e<strong>in</strong>e rechtlicheGleichstellung <strong>zur</strong> Ehe nicht vor (z.B. gibt es gegenwärtignicht die Möglichkeit <strong>der</strong> Adoption). Zudem s<strong>in</strong>d gleichgeschlechtlichePartnerschaften von Männern und Frauennoch ke<strong>in</strong>eswegs <strong>in</strong> ähnlicher Weise gesellschaftlich akzeptiert,wie dies für gegengeschlechtliche Partnerschaftengilt (Baas & Buba 2001). Bedeutsam ist dabei auchdie unterschiedliche gesellschaftliche Sichtbarkeit vonschwulen und lesbischen Lebensformen. Vor allem <strong>in</strong>großen Städten ist die schwule Szene häufig selbstbewusstsichtbar, auch wenn es nicht selten zu schwulenfe<strong>in</strong>dlichenAnfe<strong>in</strong>dungen und Gewaltakten kommt. LesbischeLebensformen s<strong>in</strong>d gesellschaftlich dagegen <strong>in</strong>weniger starkem Maß sichtbar: „Dabei s<strong>in</strong>d es nicht nuroffene und direkte Diskrim<strong>in</strong>ierungen und Erfahrungenvon Missachtung und Gewalt, die sich auf das Selbstbewusstse<strong>in</strong>von Lesben auswirken; als ebenso folgenreicherweist sich die Nicht-Existenz lesbischer Frauen <strong>in</strong> öffentlichenRäumen und demgegenüber die Allgegenwartvon heterosexueller Identität, heterosexuellen Beziehungen,Lebenskonzepten“ (Hänsch 2002: 193). WelcheAuswirkungen dies für die Situation von geme<strong>in</strong>sam älterwerdenden homosexuellen Paaren hat, ist e<strong>in</strong>e bislangvon <strong>der</strong> alternswissenschaftlichen Forschung noch nichtsystematisch <strong>in</strong> den Blick genommene Frage. Im Folgendensollen zunächst die (wenigen) verfügbaren Daten undErfahrungsberichte zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaftenim mittleren und höheren Lebensalter und anschließenddie Potenziale des Alters <strong>in</strong> gleichgeschlechtlichenLebenspartnerschaften diskutiert werden.Struktur: Im Jahr 2000 gab es <strong>in</strong> Deutschland m<strong>in</strong>destens47.000 zusammenwohnende Paare gleichen Geschlechts(Eggen 2001, Engstler & Menn<strong>in</strong>g 2003), allerd<strong>in</strong>gs ist essehr wahrsche<strong>in</strong>lich, dass die tatsächliche Zahl höherliegt, wenn berücksichtigt wird, dass <strong>der</strong> Prozentsatz vonFrauen und Männern mit homosexuellen Erfahrungen beietwa 5 Prozent liegt 52 (siehe auch Schnei<strong>der</strong>, Rosenkranz& Limmer 1998, die davon ausgehen, dass sich etwa52 In den USA wird <strong>der</strong> Anteil von Homosexualität praktizieren<strong>der</strong> Personenauf 4 Prozent bis 9 Prozent geschätzt. In e<strong>in</strong>er im Jahr 1992durchgeführten Befragung gaben 1,3 Prozent <strong>der</strong> Frauen und 2,7 Prozent<strong>der</strong> Männer an, <strong>in</strong>nerhalb des <strong>zur</strong>ückliegenden Jahres e<strong>in</strong>egleichgeschlechtliche sexuelle Beziehung e<strong>in</strong>gegangen zu se<strong>in</strong>; fürden Zeitraum <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> letzten 18 Jahre erhöhten sich diese Werteauf 4,1 Prozent für Frauen und 4,9 Prozent für Männer (Laumann,Michael & Michaels 1994: 293-296). Repräsentative Studien fürDeutschland liegen nicht vor, allerd<strong>in</strong>gs wird <strong>in</strong> unterschiedlichstenPublikationen <strong>der</strong> Anteil von homosexuellen Personen auf ungefähr5 bis 10 Prozent <strong>der</strong> Bevölkerung geschätzt, ohne dass jedoch e<strong>in</strong>eempirische Basis für diese Schätzung angegeben wird (z.B. Dethloff2001: 2598; Senatsverwaltung für Bildung 2003: 13).
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 179 – Drucksache 16/219053 Anlässlich des Auftretens <strong>der</strong> Immunschwächekrankheit AIDS wurden<strong>in</strong> den 90er-Jahren über 2.900 homosexuelle Männer im Auftrag<strong>der</strong> Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung befragt; allerd<strong>in</strong>gswurden Fragebögen <strong>in</strong> wichtigen Schwulenzeitungen verteilt,was zu e<strong>in</strong>er Verzerrung <strong>der</strong> Stichprobe h<strong>in</strong>sichtlich e<strong>in</strong>er stärkerenBeteiligung aktiver und sozial <strong>in</strong>tegrierter Personen geführt habenkönnte (Bochow 1994). Zudem waren nur 11 Prozent <strong>der</strong> Befragtenälter als 44 Jahre.54 Die Teilnehmer/<strong>in</strong>nen dieser Studie wurden über kommunale E<strong>in</strong>richtungenund Selbsthilfegruppen rekrutiert. Von den Befragten waren92 Prozent lesbisch o<strong>der</strong> schwul und 8 Prozent bisexuell. Lei<strong>der</strong>wurden die Angaben <strong>zur</strong> Partnerschaft nicht nach Geschlecht bzw.sexueller Präferenz differenziert dargestellt.2 Prozent aller Frauen <strong>in</strong> Deutschland als homosexuelldef<strong>in</strong>ieren). Von den im Mikrozensus erfassten Paarengleichen Geschlechts s<strong>in</strong>d 59 Prozent Männer und 41 ProzentFrauen. Der Altersdurchschnitt <strong>in</strong> gleichgeschlechtlichenLebensgeme<strong>in</strong>schaften liegt bei Ende 30 (und ist damitetwas höher als <strong>der</strong> Altersdurchschnitt nicht-ehelicherheterosexueller Lebensgeme<strong>in</strong>schaften, aber deutlichniedriger als <strong>der</strong> Altersdurchschnitt von Ehepaaren). ZusammenlebendePaare gleichen Geschlechts leben häufiger<strong>in</strong> Großstädten als <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Städten und Geme<strong>in</strong>den.In <strong>der</strong> Regel s<strong>in</strong>d Personen <strong>in</strong> gleichgeschlechtlichenPartnerschaften überdurchschnittlich gebildet und eher <strong>in</strong>den oberen E<strong>in</strong>kommensklassen anzutreffen. Allerd<strong>in</strong>gsist hierbei zu bedenken, dass bisherige Untersuchungene<strong>in</strong>en deutlichen Bias aufweisen: Jüngere und höher gebildetePersonen bekennen sich eher zu ihrer Homosexualitätund nehmen auch eher an Untersuchungen teil (e<strong>in</strong>enÜberblick zu homosexuellen Partnerschaften und Lebensformengeben Baas & Buba 2001).In e<strong>in</strong>er Befragung, die von <strong>der</strong> Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung Anfang <strong>der</strong> 1990er-Jahre <strong>in</strong>Auftrag gegeben wurde, gaben über die Hälfte <strong>der</strong> antwortendenschwulen Männer an, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er festen Beziehungzu leben (bei den unter 30-Jährigen waren es 54 Prozent,bei den 30- bis 44-Jährigen 56 Prozent und bei den über44-Jährigen 57 Prozent; Stümke 1998: 228). 53 Möglicherweises<strong>in</strong>d diese Angaben aber zu optimistisch, da dieDurchführung <strong>der</strong> Studie eher aktive und sozial <strong>in</strong>tegriertePersonen ansprach. So gaben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er amerikanischenStudie, an <strong>der</strong> 416 lesbische, schwule und bisexuellePersonen im Alter zwischen 60 und 91 Jahrenteilnahmen, nur 29 Prozent <strong>der</strong> befragten Personen an, <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er Partnerschaft zu leben (Grossman, D'Augelli &Hershberger 2000). 54 Dennoch lässt sich angesichts dieserDaten feststellen, dass das Leben <strong>in</strong> Partnerschaft – undmöglicherweise auch das geme<strong>in</strong>same Altwerden – für e<strong>in</strong>ensubstantiellen Teil älter werden<strong>der</strong> Lesben undSchwule Wirklichkeit ist.Qualität: Lesbische Frauen und schwule Männer stehen<strong>in</strong> Lebenspartnerschaften vor ähnlichen Themen und Problemenwie heterosexuelle Frauen und Männer, aber esbestehen auch Unterschiede zwischen gleich- und gegengeschlechtlichenBeziehungen. Die unterschiedliche gesellschaftlicheAkzeptanz führt dazu, dass ausschließlichPersonen <strong>in</strong> gegengeschlechtlichen Partnerschaften mit<strong>der</strong> Frage konfrontiert werden, ob die eigene sexuelleOrientierung <strong>in</strong>nerhalb des familialen, privaten und beruflichenNetzwerks bekannt werden soll und ob die betroffenePerson e<strong>in</strong> entsprechendes Bekenntnis aktiv vornehmenwill. Gerade ältere Schwule und Lesben, die denNationalsozialismus o<strong>der</strong> die Zeit <strong>der</strong> frühen Bundesrepublikerlebt haben, tragen <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht e<strong>in</strong>e schwereHypothek. Zudem s<strong>in</strong>d nicht wenige ältere Schwule undLesben im Lauf ihres Lebens aus den unterschiedlichstenGründen e<strong>in</strong>e Ehe e<strong>in</strong>gegangen, möglicherweise auch aufGrund <strong>der</strong> befürchteten sozialen Reaktionen auf e<strong>in</strong>e offeneschwule o<strong>der</strong> lesbische Lebensform (Baas & Buba2001).Doch es s<strong>in</strong>d nicht alle<strong>in</strong> negative Merkmale, die gleichvongegengeschlechtlichen Partnerschaften unterscheiden.Im Gegensatz zu gegengeschlechtlichen Paarenüberdauern die Beziehungen von Lesben und Schwulenhäufig e<strong>in</strong>e Trennung: Bei Lesben und Schwulen bestehendauerhafte Beziehungen <strong>in</strong>sofern, „als sie oft – undzwar vermutlich wesentlich häufiger als im heterosexuellenBereich – selbst nach Auflösung <strong>der</strong> Partnerschaft undE<strong>in</strong>gehen neuer B<strong>in</strong>dungen die Beziehung zu den ehemaligenPartnern <strong>in</strong> freundschaftlicher Weise weiter pflegen“(Rauchfleisch 1999: 403f.). Partner<strong>in</strong>nen o<strong>der</strong> Partner<strong>in</strong> gleichgeschlechtlichen Beziehungen s<strong>in</strong>d zudemhäufig gleichberechtigt, da wirtschaftliche Abhängigkeitenseltener s<strong>in</strong>d als bei gegengeschlechtlichen Partnerschaften.Schließlich ist zu betonen, dass gegengeschlechtlichePartnerschaften vor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong>mehr o<strong>der</strong> weniger starken Geme<strong>in</strong>schaft e<strong>in</strong>er lesbischeno<strong>der</strong> schwulen Szene entstehen, wobei allerd<strong>in</strong>gs dieAussage, dass „Homosexuelle <strong>der</strong> Subkultur so wenigentwischen wie <strong>der</strong> Heterosexuelle <strong>der</strong> Ehe. ... Ohne <strong>der</strong>enHalt und Schutz könnten sie kaum überleben“ (Dannecker& Reiche 1974: 74), durch die Liberalisierung <strong>in</strong>den vergangenen Jahrzehnten <strong>in</strong> ihrer Gültigkeit möglicherweiseetwas abgeschwächt wurde.Nicht übersehen werden sollten aber auch Unterschiede<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Unterschiedezwischen lesbischen und schwulen Beziehungenspiegeln allgeme<strong>in</strong>e Geschlechtsunterschiede <strong>in</strong> sozialenBeziehungen wi<strong>der</strong>. In schwulen Partnerschaftenexistiert häufig e<strong>in</strong>e Trennung zwischen Beziehung undSexualität (Buba & Vaskovics 2001). E<strong>in</strong>e längerfristigeschwule Partnerschaft, die Priorität vor allen an<strong>der</strong>en Beziehungenhat, schließt flüchtige sexuelle Kontakte zu an<strong>der</strong>enMännern nicht aus (Rauchfleisch 1999: 402). ImGegensatz dazu sche<strong>in</strong>en lesbische Beziehungen stabilerund exklusiver zu se<strong>in</strong>: „Offensichtlich orientiert sich dieErziehung von Frauen, gleichgültig ob heterosexuell o<strong>der</strong>lesbisch, nach wie vor an dem Leitbild <strong>der</strong> monogam lebenden,lang dauernde Beziehungen pflegenden Frau,während es gleichsam zum sozialen ‚Markenzeichen’ desMannes gehört, e<strong>in</strong>e größere Zahl von sexuellen Beziehungenvorweisen zu können“ (Rauchfleisch 1999: 399).Trotz dieser Differenzierungen sche<strong>in</strong>en jene Faktoren,die stabile, lange dauernde Lebenspartnerschaften för<strong>der</strong>n,bei gleich- und gegengeschlechtlichen Partnerschaftenähnlich zu se<strong>in</strong> (Blando 2001). „Erfolgreiche“ Partnerschaftens<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong> Wechselspiel von Ähnlichkeitund Komplementarität zwischen den Partner<strong>in</strong>nen undPartner, durch Respekt und produktiven Umgang mit
Drucksache 16/2190 – 180 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeKonflikten, durch emotionale Treue, durch sexuelle Fantasieund durch flexiblen Umgang mit geschlechtsrollenspezifischenE<strong>in</strong>stellungen gekennzeichnet. Dies zeigtsich auch an Fallbeispielen, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literatur vorgestelltwerden (Stümke 1998). Zwei schwule Männer, die<strong>zur</strong> Zeit des Interviews im Alter von 68 und 60 Jahren aufe<strong>in</strong>e 33-jährige Beziehung <strong>zur</strong>ückblicken, charakterisierendie geme<strong>in</strong>same Partnerschaft <strong>in</strong> folgen<strong>der</strong> Weise:„Eigentlich waren wir gar nicht e<strong>in</strong>mal unsere Idealtypen...Aberdas Äußere macht es bekanntlich nicht. Damuss erheblich mehr dazu kommen. Zum Beispiel geme<strong>in</strong>sameInteressen, Verständnis füre<strong>in</strong>an<strong>der</strong>, vor allemgegenseitiger Respekt...Ja, Konflikte hat es auch gegeben.Wo gibt es die nicht? Aber wir haben immer viel undausgiebig mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> geredet...Abenteuer und Erlebnissehaben wir uns zugestanden. Aber mehr nicht. Ke<strong>in</strong>e Liebschafth<strong>in</strong>ter dem Rücken des An<strong>der</strong>en...Mit niemandemschlaf’ ich so gern wie mit Gerhard. Der Spaß ist da auchnach 33 Jahren nicht vergangen“ (Stümke 1998: 193-195).Auch wenn dieses Beispiel ke<strong>in</strong>eswegs typisch für allegleichgeschlechtlichen Beziehungen ist, so zeigt sichdoch, dass für stabile, lang dauernde Partnerschaften dieFähigkeiten <strong>der</strong> Beziehungsgestaltung und <strong>der</strong> Verantwortungsübernahmeför<strong>der</strong>lich s<strong>in</strong>d. Vergleicht man älterwerdende Lesben und Schwule, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Partnerschaftleben, mit jenen, die alle<strong>in</strong> leben, so f<strong>in</strong>den sich Ergebnisse,die jenen aus gegengeschlechtlichen Partnerschaftenähneln: Lesben und Schwule <strong>in</strong> Partnerschaften äußernhöheres Wohlbef<strong>in</strong>den, ger<strong>in</strong>gere E<strong>in</strong>samkeit undbessere subjektive Gesundheit als Lesben und Schwule,die alle<strong>in</strong> leben (Grossman et al. 2000).Potenziale und Risiken: Das Älter- und Altwerden f<strong>in</strong>det<strong>in</strong> gleichgeschlechtlichen Partnerschaften vor dem H<strong>in</strong>tergrundausgeprägter Altersbil<strong>der</strong> statt, die sich allerd<strong>in</strong>gs<strong>in</strong> Zukunft än<strong>der</strong>n könnten. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong>Schwulenszene herrschte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit e<strong>in</strong> starkausgeprägter Jugendkult, <strong>der</strong> sich dar<strong>in</strong> äußerte, dass <strong>in</strong>entsprechenden Studien bereits über 35-Jährige (Stümke1998) o<strong>der</strong> über 44-Jährige (Bochow 1994) als „alt“ e<strong>in</strong>gestuftwurden. Szenetypische Lokale bieten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regelnur ger<strong>in</strong>ge Möglichkeiten für „ältere“ Schwule und Lesben,Bekanntschaften zu knüpfen und neue Beziehungene<strong>in</strong>zugehen. Während von e<strong>in</strong>igen Autoren die Auffassungvertreten wird, dass das Merkmal Jugend auch weiterh<strong>in</strong>e<strong>in</strong>e „fast unerlässliche Bed<strong>in</strong>gung für das Begehrenund folglich auch e<strong>in</strong>e wichtige Bed<strong>in</strong>gungbefriedigen<strong>der</strong> Sexualität“ darstellt (Dannecker 2000),s<strong>in</strong>d an<strong>der</strong>e Autoren davon überzeugt, dass auch Ältere <strong>in</strong><strong>der</strong> (schwulen) Subkultur e<strong>in</strong>en beständigen Platz gefundenhaben (Stümke 1998). Doch selbst wenn e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>bettung<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e jugendorientierte Szene den Prozess desÄlterwerdens gleichgeschlechtlicher Partnerschaften charakterisiert,so sche<strong>in</strong>en doch an<strong>der</strong>e Faktoren als Homosexualitätfür e<strong>in</strong> „gutes Altern“ <strong>in</strong>sgesamt verantwortlichzu se<strong>in</strong>. Bei <strong>der</strong> Frage, wie homosexuelle Männer das Altererleben, zeigte sich, dass das Erleben des Alternsprozessesweniger durch Homosexualität bee<strong>in</strong>flusst wird alsdurch Aspekte, die generell für gutes Leben im Alterwichtig s<strong>in</strong>d, zum Beispiel Gesundheit und soziale Integration(Gille 2003). Dabei sche<strong>in</strong>t es von beson<strong>der</strong>er Bedeutungzu se<strong>in</strong>, bereits <strong>in</strong> jüngeren Jahren e<strong>in</strong> Netzwerkaufgebaut zu haben, auf dessen Hilfe und Unterstützungim Alter <strong>zur</strong>ückgegriffen werden kann. Doch gerade dieswar für die heute älteren schwulen Männer, die durch dieVerfolgung durch den Nationalsozialismus und die rechtlicheDiskrim<strong>in</strong>ierung <strong>in</strong> beiden deutschen Staaten häufige<strong>in</strong> gespaltenes Verhältnis zu ihrer Homosexualität haben,e<strong>in</strong> Problem. Infolgedessen verfügen ältere schwule Männernur bed<strong>in</strong>gt über e<strong>in</strong> privates Netzwerk.Als Alternative haben sich <strong>in</strong> den letzten Jahren <strong>in</strong> verschiedenendeutschen Städten Initiativen gebildet, diesich den relevanten Fragen und Problemen <strong>der</strong> Lebenssituation(soziale Integration, Gesundheit, Wohnverhältnisseu.a.m.) älterer lesbischer und schwuler Menschenannehmen. Beschäftigen sich älter werdende Lesben undSchwule mit <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> Betreuung durch ambulantePflegedienste o<strong>der</strong> des Lebens <strong>in</strong> stationären Pflegee<strong>in</strong>richtungen,so wird häufig <strong>der</strong> Wunsch nach „lesbischen“bzw. „schwulen“ E<strong>in</strong>richtungen geäußert, da homophobeE<strong>in</strong>stellungen des pflegerischen Personals befürchtet werden(Calmbach & Rauchfleisch 1999; Gerlach 2002). Ausdiesem Grund haben sich e<strong>in</strong>e Reihe von Projekten gebildet,<strong>der</strong>en Ziel es ist, schwul-lesbische Wohnprojekte fürpflegebedürftige lesbische und schwule Menschen zu entwickeln.55H<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Übernahme von Unterstützung und Verantwortung<strong>in</strong>nerhalb von gleichgeschlechtlichen Partnerschaftenliegen bislang ke<strong>in</strong>e systematischen Befunde ausempirischen Untersuchungen vor. Allerd<strong>in</strong>gs dürfte manangesichts <strong>der</strong> Ähnlichkeiten zwischen lang dauerndenhetero- und homosexuellen Partnerschaften annehmen,dass auch <strong>in</strong> gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Verantwortungbei Hilfe- und Pflegebedarf übernommenwird. Das familiale Netzwerk spielt bei Unterstützungund Hilfe hierbei möglicherweise e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>ere Rolle, dasprivate Netz von Freund<strong>in</strong>nen, Freunden und Bekanntendagegen e<strong>in</strong>e größere Rolle als bei heterosexuellen älterenMenschen. Die Belastbarkeit nicht-familialer Unterstützungsnetzehaben beispielsweise jene Gruppen gezeigt,die an Aids erkrankte homosexuelle Männerpflegen („Buddy-Gruppen“). Potenziale des Alters <strong>in</strong>gleichgeschlechtlichen Beziehungen zwischen älter werdendenund alten Frauen bzw. Männern liegen dabeimöglicherweise nicht alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Phase des Alters selbst,son<strong>der</strong>n bereits im Lebensabschnitt des mittleren Erwachsenenalters.Zusammenfassung: Die Lebensbed<strong>in</strong>gungen von Menschen,die <strong>in</strong> gleichgeschlechtlichen Partnerschaften altwerden, s<strong>in</strong>d bislang nur wenig untersucht. Es kann aberdavon ausgegangen werden, dass es im Rahmen gleichgeschlechtlicherPartnerschaften Potenziale gibt, die bei <strong>der</strong>Unterstützung und Pflege des hilfe- und pflegebedürftigenPartners e<strong>in</strong>gesetzt werden. Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>dgleichgeschlechtliche Partnerschaften, an<strong>der</strong>s als gegengeschlechtlichePartnerschaften, häufig e<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>55 Siehe beispielhaft zu Initiativen und Projekten die folgenden Websites:www.sozialnetz.de/homosexualitaet, www.sappho-stiftung.de, www.village-ev.de,www.altenpflegayheim.de, www.lesbische<strong>in</strong>itiativerut.de,www.schwulenberatungberl<strong>in</strong>.de, www.rubicon-koeln.de, www.schwule-alter-nativen.de
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 181 – Drucksache 16/2190weiteres Unterstützungsnetzwerk <strong>der</strong> lesbischen bzw.schwulen Subkultur. Die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen dafür zuschaffen, dass lesbische Frauen und schwule Männer e<strong>in</strong>egeme<strong>in</strong>same Lebenspartnerschaft aufbauen, die gesellschaftlichakzeptiert und sozialrechtlich ähnlich gestütztwird wie gegengeschlechtliche Partnerschaften, ist sicherlichvon hoher Bedeutung für die Realisierung diesesPotenzials. Darüber h<strong>in</strong>aus ist damit zu rechnen, dass älterwerdende und alte Lesben und Schwule auf Unterstützungim Rahmen <strong>der</strong> Altenhilfe angewiesen s<strong>in</strong>d. Hierzuist es s<strong>in</strong>nvoll, e<strong>in</strong> differenziertes Angebot zu entwickeln,das die Bedürfnisse <strong>der</strong> betroffenen Menschen ernstnimmt (Jäck 2003; Kammerer 2003; Paul 2001).6.2.1.3 Eltern und ihre erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>Die Beziehung zwischen Eltern und ihren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n bestehtüber den gesamten Lebenslauf. Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen<strong>in</strong> K<strong>in</strong>dheit und Jugend s<strong>in</strong>d durch Asymmetrieund Hierarchie geprägt: Eltern verfügen über Ressourcenund kontrollieren im Rahmen <strong>der</strong> Sozialisation das Verhalten<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>. Dies än<strong>der</strong>t sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel mit Adoleszenzund beg<strong>in</strong>nendem Erwachsenenalter, wennK<strong>in</strong><strong>der</strong> eigene Lebensvorstellungen entwickeln, e<strong>in</strong>e beruflicheAusbildung absolvieren, eigene Beziehungene<strong>in</strong>gehen und K<strong>in</strong><strong>der</strong> bekommen. Die Beziehungen zwischenälter werdenden Eltern und erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>nist durch e<strong>in</strong>e höhere Eigenständigkeit und e<strong>in</strong>e „Intimitätauf Distanz“ gekennzeichnet (Rosenmayr & Köckeis1965). Eltern begleiten ihre erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong>Regel mit großem Interesse und hoher Unterstützung.K<strong>in</strong><strong>der</strong> übernehmen häufig Verantwortung für hilfe- undpflegebedürftige Eltern – wobei dies <strong>in</strong> aller Regel eherdie Töchter und Schwiegertöchter als Söhne und Schwiegersöhnes<strong>in</strong>d (Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren,Frauen und ugend: 2005a; Schneekloth & Müller 2000).Gerade bei <strong>der</strong> Betreuung hochaltriger hilfe- und pflegebedürftigerMenschen stehen betreuende K<strong>in</strong><strong>der</strong> nicht seltenselbst an <strong>der</strong> Schwelle des Alters. Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungenim Erwachsenenalter s<strong>in</strong>d nicht alle<strong>in</strong> durchgegenseitige Solidarität gekennzeichnet (Bengtson,Rosenthal & Burton 1996), son<strong>der</strong>n können auch Merkmalevon Konflikt und Ambivalenz be<strong>in</strong>halten (Lettke &Lüscher 2002; Lüscher 1998).Struktur: Die große Mehrzahl <strong>der</strong> im mittleren und höherenErwachsenenalter stehenden Menschen <strong>in</strong> Deutschlandhat K<strong>in</strong><strong>der</strong>: Im Rahmen des Alterssurveys 56 gabenim Jahr 2002 86 Prozent <strong>der</strong> 40- bis 85-jährigen Deutschenan, K<strong>in</strong><strong>der</strong> zu haben. Damit hat sich <strong>der</strong> Anteil vonK<strong>in</strong><strong>der</strong>losen gegenüber <strong>der</strong> Ersterhebung im Jahr 1996,56 Der Alterssurvey ist e<strong>in</strong>e längsschnittliche und kohortenvergleichendeUntersuchung e<strong>in</strong>er repräsentativen Stichprobe <strong>der</strong> 40- bis 85-jährigenBevölkerung <strong>in</strong> Deutschland zu den Themen E<strong>in</strong>kommen undVermögen, Wohnen, <strong>Generation</strong>enbeziehungen und soziale Netzwerke,produktive Tätigkeiten und soziale Integration, subjektive Gesundheitund Wohlbef<strong>in</strong>den (geför<strong>der</strong>t durch das Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Bislang liegen Daten ausden Jahren 1996 (ca. 5.000 Personen) und 2002 (ca. 3.100 Personen)vor (Tesch-Römer 2004b ).als 87 Prozent <strong>der</strong> Befragten angaben, K<strong>in</strong><strong>der</strong> zu haben,nicht wesentlich erhöht (Hoff 2004b). Allerd<strong>in</strong>gs habendie älteren Geburtsjahrgänge durchschnittlich mehr K<strong>in</strong><strong>der</strong>als die jüngeren 57 : Die durchschnittliche K<strong>in</strong><strong>der</strong>zahlbeträgt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 70- bis 85-Jährigen 2,09 K<strong>in</strong><strong>der</strong>,<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 55- bis 69-Jährigen 1,99 K<strong>in</strong><strong>der</strong>und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 40- bis 54-Jährigen 1,64 K<strong>in</strong><strong>der</strong>(Hoff 2004a). Diese Befunde bedeuten zunächst e<strong>in</strong>mal,dass e<strong>in</strong> großer Teil <strong>der</strong> gegenwärtig älteren und altenMenschen <strong>in</strong>nerhalb <strong>in</strong>tergenerationaler Beziehungen geprägterfamilialer Netze lebt. Dies gilt <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maßfür die heute 40-Jährigen. Angesichts <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> amtlichenStatistik bekannten Geburtenentwicklung kanndavon ausgegangen werden, dass Menschen <strong>der</strong> nachfolgendenGeburtsjahrgänge über kle<strong>in</strong>ere familiale Netzwerkeverfügen werden als Menschen, die gegenwärtigim dritten und vierten Lebensalter stehen. Familie wird <strong>in</strong>Zukunft stärker durch die Beziehungen zwischen erwachsenenK<strong>in</strong><strong>der</strong>n und alten Eltern als durch Familien <strong>in</strong> <strong>der</strong>Gründungsphase charakterisiert se<strong>in</strong>. Mit <strong>der</strong> zunehmendenAnzahl von k<strong>in</strong><strong>der</strong>losen Ehepaaren, S<strong>in</strong>gles undneuen Formen des Zusammenlebens haben die Gelegenheiten<strong>zur</strong> <strong>in</strong>tergenerationellen Begegnung und Hilfe abgenommenund werden <strong>in</strong> Zukunft weiter abnehmen. Biszum Jahr 2030 ist eher mit e<strong>in</strong>em Rückgang <strong>der</strong> durchschnittlichenK<strong>in</strong><strong>der</strong>zahl als mit e<strong>in</strong>em Anstieg <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>losigkeitzu rechnen. Allerd<strong>in</strong>gs wird von den 1965geborenen Frauen zwischen e<strong>in</strong>em Viertel und e<strong>in</strong>emDrittel ke<strong>in</strong>e K<strong>in</strong><strong>der</strong> bekommen.Ältere und jüngere Menschen <strong>in</strong> Deutschland leben im <strong>in</strong>tergenerationalenFamilienverbund („multilokale Mehrgenerationenfamilie“).Dies bedeutet, dass die <strong>Generation</strong>en<strong>in</strong>nerhalb von Familien weniger <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushaltzusammen leben, son<strong>der</strong>n dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel e<strong>in</strong>e hoheräumliche Nähe zwischen den Haushalten <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>enbesteht und e<strong>in</strong> reger Austausch zwischen den <strong>Generation</strong>engepflegt wird. Im Vergleich mit an<strong>der</strong>eneuropäischen Län<strong>der</strong>n ist Deutschland das Land mit e<strong>in</strong>em<strong>der</strong> höchsten Anteile von E<strong>in</strong>personenhaushalten beiden über 65-Jährigen und mit e<strong>in</strong>em <strong>der</strong> niedrigstenAnteile von Mehrgenerationenhaushalten (Engstler &Menn<strong>in</strong>g 2003: 58).Obwohl älter werdende Menschen nur selten mit ihrenK<strong>in</strong><strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haushalt zusammenleben,wohnen die <strong>Generation</strong>en <strong>in</strong> räumlicher Nähezu e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>. In <strong>der</strong> Regel wohnt m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> erwachsenesK<strong>in</strong>d nicht weit von dem älter gewordenen Elternteilentfernt (Tabelle 24). Auch die Kontakthäufigkeitzwischen alten Eltern und erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ist hoch(Tabelle 25). Allerd<strong>in</strong>gs deuten die Daten des Alterssurveysaus den Jahren 1996 und 2002 hier Verän<strong>der</strong>ungenan. Während im Jahr 1996 etwa 73 Prozent <strong>der</strong> 55- bis69-jährigen Deutschen angaben, <strong>in</strong> räumlicher Nähe zu57 Die e<strong>in</strong>zige Ausnahme von dieser Regel bilden die Geburtsjahrgänge<strong>der</strong> 1921-26 Geborenen, <strong>der</strong>en Familiengründungspläne durch denZweiten Weltkrieg negativ bee<strong>in</strong>flusst wurden. Angehörige dieserGeburtsjahrgänge haben ebenfalls deutlich weniger K<strong>in</strong><strong>der</strong>.
Drucksache 16/2190 – 182 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 24Wohnentfernung zum nächstwohnenden K<strong>in</strong>d ab 16 Jahren nach Altersgruppen,1996 und 2002, für Deutsche und Nicht-Deutsche (<strong>in</strong> Prozent)1996D40-54 55-69 70-85 40-852002D2002ND * 1996D2002DIm selben Haus 69,9 67,4 69,5 34,3 27,3 40,4 25,9 22,2 22,2 47,0 39,7 54,7In <strong>der</strong> Nachbarschaft6,2 4,8 3,1 14,7 14,3 15,9 17,6 19,0 25,0 11,8 12,2 9,7Im gleichen Ort 8,9 9,4 12,8 24,4 23,8 14,6 23,9 28,8 16,7 18,1 20,1 13,8In max. 2 Std.erreichbar 11,3 13,2 7,1 19,6 26,1 15,2 23,4 22,3 8,3 17,0 20,8 10,2Weiter entfernt 3,7 5,2 7,5 7,1 8,6 13,9 9,1 7,7 27,8 6,1 7,2 11,6Anzahl 1.219 691 226 1.532 903 151 1.137 870 36 3.888 2.464 4132002ND* ND= Nicht-Deutsche, Auslän<strong>der</strong> und Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen.Quelle: Hoff 2004a; Krumme & Hoff 2004. Datenbasis: Alterssurvey 1996 und 2002.1996D2002D2002ND1996D2002D2002NDm<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong> ab 16 Jahren zu wohnen, 58waren dies im Jahr 2002 nur noch etwa 65 Prozent. Demgegenüberstieg dieser Anteil bei <strong>der</strong> ältesten Gruppe <strong>der</strong>70- bis 85-Jährigen leicht an (1996: 67 Prozent, 2002:70 Prozent). Hier zeigt sich e<strong>in</strong> Trend, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>eProblematik <strong>in</strong> den ländlichen Gebieten, vor allem <strong>der</strong>neuen Bundeslän<strong>der</strong> aufwirft: Im Zuge <strong>der</strong> deutschenB<strong>in</strong>nenwan<strong>der</strong>ung ziehen o<strong>der</strong> pendeln K<strong>in</strong><strong>der</strong> zu e<strong>in</strong>emneuen, weit entfernten Arbeitsort, die Eltern bleiben dagegenim Heimatort (Mai & Roloff 2004b; Haupt & Liebscher2005: 76ff.). Dabei muss beachtet werden, dass diegeografische Distanz von <strong>der</strong> sozialen Schicht abhängt: Jehöher die Bildungsschicht, desto größer ist die Entfernungzwischen alten Eltern und erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n.Im Gegensatz zu Deutschen leben ältere Auslän<strong>der</strong> undAuslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen ab 60 Jahren seltener <strong>in</strong> E<strong>in</strong>personenhaushaltenund Zweipersonenhaushalten, dafür häufiger<strong>in</strong> Haushalten mit drei und mehr Personen als die gleichaltrigedeutsche Bevölkerung (Engstler & Menn<strong>in</strong>g 2003:56). Nach Angaben aus dem Alterssurvey ist <strong>der</strong> Anteilvon ausländischen Personen mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ab 16 Jahren,die <strong>in</strong> räumlicher Nähe wohnen, im Jahr 2002 bis zum Altervon 70 Jahren etwas höher als bei Deutschen (85 Prozentbei den 40- bis 54-jährigen und 71 Prozent bei den55- bis 69-jährigen Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Auslän<strong>der</strong>) undbei über 70-Jährigen etwas ger<strong>in</strong>ger als bei Deutschen(64 Prozent bei den 70- bis 85-jährigen Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nenund Auslän<strong>der</strong>n; Tabelle 24). E<strong>in</strong> wichtiger Unterschiedzwischen Deutschen und Auslän<strong>der</strong>n ist <strong>der</strong> bei Auslän<strong>der</strong>nhöhere Anteil an Personen mit erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>nim Ausland (Krumme & Hoff 2004a). Allerd<strong>in</strong>gs muss58 Bei diesen Angaben s<strong>in</strong>d die Kategorien „im selben Haus“, „<strong>in</strong> <strong>der</strong>Nachbarschaft“ und „im gleichen Ort“ zusammengefasst.hierbei bedacht werden, dass <strong>der</strong> Alterssurvey nicht geeignetist, die Pluralität <strong>der</strong> Lebensformen von nicht-deutschenPersonen zu analysieren. Die ger<strong>in</strong>ge Stichprobengrößedes Alterssurveys lässt geson<strong>der</strong>te Auswertungenfür Angehörige unterschiedlicher Nationalitäten nicht zu.Qualität: Intergenerationale Familienbeziehungen spielene<strong>in</strong>e zentrale Rolle im Leben von Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweitenLebenshälfte. Dies zeigt sich bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong>Beziehungsqualität. So gaben mehr als drei Viertel <strong>der</strong>Befragten des Alterssurveys bei <strong>der</strong> Erstbefragung imJahre 1996 an, dass sie ihre Beziehung zu ihrer Familieals gut o<strong>der</strong> sehr gut e<strong>in</strong>schätzen. In den letzten Jahren istdie Wertschätzung <strong>der</strong> Familie im Urteil <strong>der</strong> Teilnehmer<strong>in</strong>nenund Teilnehmer am Alterssurvey gestiegen: ImJahr 2002 schätzten nahezu 80 Prozent <strong>der</strong> 40- bis 69-Jährigenund sogar etwas mehr als 80 Prozent <strong>der</strong> 70- bis 85-Jährigenihre Familienbeziehungen als sehr gut o<strong>der</strong> gut e<strong>in</strong>(Hoff 2004a). Dabei berichten Frauen generell positiverüber Familienbeziehungen; 2002 haben 82 Prozent <strong>der</strong>Frauen angegeben, dass sie sehr gute o<strong>der</strong> gute Beziehungen<strong>zur</strong> Familie haben, gegenüber 78 Prozent <strong>der</strong>Männer. Die Häufigkeit von Konflikten <strong>in</strong>nerhalb von familialen<strong>Generation</strong>en ist dementsprechend relativ ger<strong>in</strong>g:Während etwa 25 Prozent aller Befragten des Alterssurveysangeben, dass es e<strong>in</strong>e Person gebe, mit <strong>der</strong> sie<strong>in</strong> Konflikt stehen, geben nur etwa 10 Prozent an, dass essich dabei um e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tergenerationalen Familienkonflikthandele (Szydlik 2001). Dabei muss berücksichtigt werden,dass die Qualität <strong>der</strong> Beziehungen auch von Belastungenbee<strong>in</strong>flusst wird: F<strong>in</strong>anzielle Probleme undArbeitslosigkeit können die <strong>in</strong>tergenerationalen Beziehungen<strong>in</strong>nerhalb von Familien bee<strong>in</strong>trächtigen (Szydlik2000). Auch ist zu bedenken, dass es zu weitergehendenProblemen kommen kann, wenn <strong>in</strong>nerhalb von konflikt-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 183 – Drucksache 16/2190beladenen Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen belastende Pflegeaufgabenübernommen werden.E<strong>in</strong> weiteres Maß für die Qualität <strong>in</strong>tergenerationaler Beziehungenist die Kontakthäufigkeit zwischen Eltern undK<strong>in</strong><strong>der</strong>n (Hoff 2004a). Im Jahr 2002 hat mehr als dieHälfte <strong>der</strong> deutschen Teilnehmer<strong>in</strong>nen und Teilnehmeram Alterssurvey täglich Kontakt zu m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ihrerK<strong>in</strong><strong>der</strong> ab 16 Jahren und etwa 90 Prozent m<strong>in</strong>destense<strong>in</strong>mal pro Woche (Tabelle 25). Allerd<strong>in</strong>gs zeigt sich zwischen1996 und 2002 e<strong>in</strong> deutlicher Rückgang <strong>der</strong> maximalenKontakthäufigkeit: Der Anteil von deutschen Elternmit m<strong>in</strong>destens täglichen Interaktionen ist von knapp60 Prozent auf etwa 52 Prozent gesunken, zugleich nahm<strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Personen, die e<strong>in</strong>- bis mehrmals <strong>in</strong> <strong>der</strong> WocheKontakt mit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> hatten, <strong>in</strong><strong>der</strong> gleichen Größenordnung zu. Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen undAuslän<strong>der</strong> zeigen e<strong>in</strong>en höheren Anteil von täglichenKontakten. Be<strong>in</strong>ahe zwei Drittel <strong>der</strong> <strong>in</strong> Deutschland lebenden40- bis 85-jährigen Migranten hat täglichen Kontaktzu ihren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ab 16 Jahren. Der Anteil <strong>der</strong> Elternmit wenigen Kontakten (o<strong>der</strong> ohne Kontakte) zu ihrenK<strong>in</strong><strong>der</strong>n entspricht dem Anteil bei Deutschen.Potenziale und Risiken: Das gängige Altersstereotypweist alten Eltern die passive Rolle als Empfänger vonUnterstützung zu. Obwohl gerade im Fall von Pflegebedürftigkeitalte und sehr alte Menschen dabei <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>edie Empfänger von Unterstützungs- und Betreuungsleistungens<strong>in</strong>d, sollte nicht vergessen werden, dass dieunterstützenden K<strong>in</strong><strong>der</strong> nicht selten selbst an <strong>der</strong> Grenzezum höheren Alter stehen. So zeigt sich, dass über60 Prozent <strong>der</strong> Personen, die als HauptpflegepersonenBetreuung <strong>in</strong> häuslichen Pflegearrangements übernehmen,über 55 Jahre s<strong>in</strong>d (Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend 2005b: 10). Private Hilfeleistungenfür hilfe- und pflegebedürftige Menschen werden<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von Menschen erbracht, die selbst imfortgeschrittenen Alter s<strong>in</strong>d. Aber auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Zusammenhängens<strong>in</strong>d ältere Menschen häufig wenigerEmpfänger von Hilfeleistungen, son<strong>der</strong>n leisten sehr umfänglicheHilfe und Unterstützung, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e an dieeigenen K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> (Kohli et al. 2000a).In Tabelle 26 wird für 40- bis 85-Jährige und für die Jahre1996 und 2002 dargestellt, welcher Anteil von ihnenHilfe und Unterstützung an an<strong>der</strong>e geleistet hat. Ergänzendwird <strong>in</strong> Tabelle 27 <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>jenigen gezeigt, dieim gleichen Zeitraum Hilfe und Unterstützung von an<strong>der</strong>enPersonen erhalten haben. Hierbei werden vier Typen vonUnterstützung unterschieden: kognitive Unterstützung(z.B. Rat und Informationen), emotionale Unterstützung(z.B. Trösten), <strong>in</strong>strumentelle Unterstützung (z.B. Hilfenim Haushalt) sowie Geschenke und Unterstützung mitGeld o<strong>der</strong> Sachwerten. Mehr als vier Fünftel <strong>der</strong> 40- bis85-jährigen Menschen berichten sowohl 1996 als auch2002 darüber, <strong>in</strong> den vorangegangenen 12 Monaten kognitiveund emotionale Unterstützung geleistet zu haben.Der Erhalt von solchen Unterstützungen ist den Angabengemäß weniger verbreitet: Etwa drei Viertel <strong>der</strong> Älterenerhalten kognitive Unterstützung, während nur rund zweiDritteln von ihnen emotionale Hilfe empfangen. InstrumentelleUnterstützung haben im Jahr 2002 etwa 30 Prozent<strong>der</strong> Älteren geleistet und etwa 25 Prozent von ihnenhaben diese empfangen. Geld- o<strong>der</strong> Sachtransfers leistete<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Jahres etwa e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> 40- bis 85-Jährigen.Dagegen wurden deutlich weniger als 10 Prozent<strong>der</strong> Befragten f<strong>in</strong>anziell unterstützt o<strong>der</strong> beschenkt. Eszeigt sich, dass Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte beiallen Unterstützungstypen ganz allgeme<strong>in</strong> angeben, mehrUnterstützung an an<strong>der</strong>e zu leisten als sie selbst <strong>in</strong> Anspruchnehmen. Im zeitlichen Vergleich zwischen 1996und 2002 fällt auf, dass es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tendenz e<strong>in</strong>e leichte Ab-Tabelle 25Kontakthäufigkeit zu dem K<strong>in</strong>d ab 16 Jahren mit den meisten Kontakten, nach Altersgruppen, 1996 und 2002,für Deutsche und Nicht-Deutsche (<strong>in</strong> Prozent)1996D40-54 55-69 70-85 40-852002D2002ND * 1996D2002DTäglich 74,3 72,8 75,4 50,6 41,8 53,6 47,7 42,2 52,8 59,5 52,4 65,5M<strong>in</strong>d. wöchentlich19,5 20,2 16,7 37,4 48,3 33,1 40,5 46,0 36,1 30,9 38,2 24,3Weniger häufig 5,4 5,5 7,5 11,2 8,8 13,2 10,8 11,4 11,1 8,8 8,3 9,9Nie 0,7 1,5 0,4 0,8 1,2 -- 1,1 0,4 -- 0,8 1,1 0,2Anzahl 1.215 694 228 1.539 913 151 1.144 873 36 3.898 2.480 4152002ND* ND= Nicht-Deutsche, Auslän<strong>der</strong> und Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen.Quelle: Hoff 2004a; Krumme & Hoff 2004. Datenbasis: Alterssurvey 1996 und 2002.1996D2002D2002ND1996D2002D2002ND
Drucksache 16/2190 – 184 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodenahme <strong>der</strong> Unterstützungen gibt. Diese Verr<strong>in</strong>gerung istbeson<strong>der</strong>s ausgeprägt im Bereich <strong>der</strong> <strong>in</strong>strumentellen Hilfensowie bei <strong>der</strong> geleisteten kognitiven Unterstützung.Betrachtet man geleistete und empfangene Unterstützungsowie ihr Verhältnis zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> getrennt nach Altersgruppen,so zeigt sich, dass <strong>in</strong> fast allen Altersgruppen und füralle Unterstützungstypen gilt, dass mehr Personen angeben,Unterstützung zu leisten als Unterstützung zu erhalten.E<strong>in</strong>e Ausnahme stellt jedoch die Altersgruppe <strong>der</strong>70- bis 85-Jährigen dar: Hier gibt e<strong>in</strong> erheblich größererProzentsatz von Personen an, <strong>in</strong>strumentelle Unterstützungzu erhalten, als zu leisten. Insgesamt kann festgestelltwerden, dass die 40- bis 54-jährigen Personen beiden immateriellen Unterstützungsarten den größten Anteil<strong>der</strong> Hilfeleistungen erbr<strong>in</strong>gen, was offensichtlichauch ihrer Leistungsfähigkeit entspricht. Im Gegensatzdazu leisten die 55- bis 85-Jährigen am häufigsten f<strong>in</strong>anzielleUnterstützung. Aus sozialpolitischer Sicht bedenklichersche<strong>in</strong>t, dass <strong>der</strong> Anteil von Personen, die <strong>in</strong>strumentelleUnterstützung erhalten o<strong>der</strong> leisten, im Zeitraumzwischen 1996 und 2002 zum Teil erheblich gesunken ist.Zusammenfassung: Die Unterstützung zwischen den <strong>Generation</strong>en<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Familien ist hoch und wird auch<strong>in</strong> Zukunft hoch bleiben, sich aber möglicherweise <strong>in</strong> denInhalten verän<strong>der</strong>n. Im „kle<strong>in</strong>en <strong>Generation</strong>envertrag“unterstützen sich die <strong>Generation</strong>en <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Familien.Alte Eltern unterstützen ihre erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>dabei vor allem mit f<strong>in</strong>anziellen Transfers und erwachseneK<strong>in</strong><strong>der</strong> helfen ihren alten Eltern im Haushalt und beiBehördengängen. Durch den öffentlichen <strong>Generation</strong>envertragwird die Familie als Solidargeme<strong>in</strong>schaft durchden Wohlfahrtsstaat nicht geschwächt, son<strong>der</strong>n im Gegenteilzu neuen Leistungen erst befähigt. Die Älterenkönnen e<strong>in</strong>en erheblichen Teil ihrer familialen Transfers(„privater <strong>Generation</strong>envertrag“) nur deshalb erbr<strong>in</strong>gen,weil ihnen <strong>der</strong> öffentliche <strong>Generation</strong>envertrag dazu dieTabelle 26Geleistete <strong>in</strong>formelle Unterstützung <strong>in</strong> den vergangenen 12 Monaten(<strong>in</strong> Prozent)KognitiveUnterstützungDatenbasis: Alterssurvey 1996 und 2002, eigene Berechnungen.EmotionaleUnterstützungInstrumentelleUnterstützungF<strong>in</strong>anzielleUnterstützung1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 200240-54 Jahre 91,5 91,0 87,8 89,3 41,8 37,3 29,3 27,155-69 Jahre 86,8 83,4 82,2 83,4 32,8 29,1 32,6 36,670-85 Jahre 80,2 74,7 79,0 74,2 18,2 15,6 32,3 31,0Gesamt 87,7 84,7 84,2 83,9 34,3 29,6 31,0 31,3Tabelle 27Erhaltene <strong>in</strong>formelle Unterstützung <strong>in</strong> den vergangenen 12 Monaten(<strong>in</strong> Prozent)KognitiveUnterstützungDatenbasis: Alterssurvey 1996 und 2002, eigene Berechnungen.EmotionaleUnterstützungInstrumentelleUnterstützungF<strong>in</strong>anzielleUnterstützung1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 200240-54 Jahre 81,5 80,0 73,3 73,8 29,8 22,7 12,7 11,655-69 Jahre 74,4 74,2 66,4 62,4 26,4 20,7 5,4 5,570-85 Jahre 71,1 71,1 65,6 63,1 41,3 36,3 3,4 2,7Gesamt 77,1 76,0 69,4 67,4 30,6 25,0 8,4 7,5
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 185 – Drucksache 16/2190Mittel gibt. Diese Befunde deuten darauf h<strong>in</strong>, dass Potenzialedes Alters <strong>in</strong> den Beziehungen zwischen älter werdendenEltern und erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n bereits zu e<strong>in</strong>emgroßen Teil realisiert s<strong>in</strong>d. Zu bedenken ist dabei auch,dass <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e f<strong>in</strong>anzielle Transfers, aber auch Erbschaftenzu e<strong>in</strong>er Erhöhung sozialer Ungleichheit <strong>in</strong>nerhalb<strong>der</strong> Gesellschaft führen. Es erben <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e solchePersonen, die ohneh<strong>in</strong> über e<strong>in</strong>e günstige Position<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> gesellschaftlichen Stratifizierung verfügen(Szydlik & Schupp 2004). Weiterh<strong>in</strong> ist zu berücksichtigen,dass die <strong>in</strong>tergenerationellen Beziehungen <strong>in</strong>nerhalbvon Familien künftig durch sich än<strong>der</strong>nde Erwerbsbiografien<strong>in</strong> Zeiten langandauern<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit und e<strong>in</strong>emvermehrten E<strong>in</strong>kommensbedarf bei Hochbetagtenwegen Krankheit, Hilfs- und Pflegebedürftigkeit belastetwerden könnten, da auf Grund <strong>der</strong> seit 2001 beschlossenenReformmaßnahmen die Vorsorgeaufwendungen zunehmenund die Alterse<strong>in</strong>kommen abnehmen werden. Eswird davon ausgegangen, dass – sofern ke<strong>in</strong>e Korrekturenund Ergänzungen vorgenommen werden – die E<strong>in</strong>kommensverteilungim Alter deutlich ungleicher und die Gefahrvon Altersarmut zunehmen werden (siehe auch denAbschnitt „Perspektiven <strong>der</strong> künftigen E<strong>in</strong>kommensentwicklungim Alter angesichts bereits beschlossener Reformmaßnahmen“im Kapitel „E<strong>in</strong>kommenslage im Alterund künftige Entwicklung“).Sollte e<strong>in</strong>e Ausweitung <strong>der</strong> Unterstützung von erwachsenenK<strong>in</strong><strong>der</strong>n durch älter werdende Eltern <strong>in</strong> Betracht gezogenwerden, so s<strong>in</strong>d zudem Wünsche bei<strong>der</strong> Seiten zuberücksichtigen. Zum e<strong>in</strong>en ist zu fragen, ob Eltern e<strong>in</strong>eAusweitung ihrer Unterstützungsleistungen, kognitiver,emotionaler, <strong>in</strong>strumenteller o<strong>der</strong> f<strong>in</strong>anzieller Art, wünschen.Dies ist angesichts <strong>der</strong> hohen Leistungen, die Elternbei <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung und Ausbildung bereits erbrachthaben, allerd<strong>in</strong>gs eher zweifelhaft. Zum an<strong>der</strong>enist zu fragen, ob erwachsene K<strong>in</strong><strong>der</strong> wünschen, stärkervon ihren Eltern unterstützt zu werden, als dies gegenwärtig<strong>der</strong> Fall ist. Gerade angesichts <strong>der</strong> <strong>in</strong> K<strong>in</strong>dheit,Jugend und jungem Erwachsenenalter bestehenden Ungleichgewichte(und <strong>der</strong> persönlichen Vorstellungen vonUnabhängigkeit und Eigenständigkeit) ist es ebenfallswenig wahrsche<strong>in</strong>lich, dass e<strong>in</strong> höheres Engagement älterwerden<strong>der</strong> Eltern von den erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n gewünschtwird. Beziehungen zeigen beson<strong>der</strong>s dann e<strong>in</strong>ehohe Qualität, wenn wechselseitige Unterstützungen reziprokgeleistet werden, wie dies <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wahrnehmung vonMenschen im mittleren und höheren Erwachsenenalter<strong>der</strong> Fall ist. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund ist zu fragen, ob und<strong>in</strong>wiefern es s<strong>in</strong>nvoll ist, <strong>in</strong>tergenerationale Unterstützungvon jungen Familien <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gründungsphase (älter werdendeEltern unterstützen ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> bei dem Versuch,Beruf und Familie zu vere<strong>in</strong>baren) zu stärken.6.2.1.4 Großeltern und ihre Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>In Zukunft wird es zu weiteren Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Familienstrukturenkommen. Dabei s<strong>in</strong>d zwei Szenarien denkbar:Das <strong>der</strong> „Multi-<strong>Generation</strong>enfamilie“ und das <strong>der</strong>„Alterslückenstruktur“. Die Multi-<strong>Generation</strong>enfamilie(o<strong>der</strong> „bean-pole“ bzw. Bohnenstangenfamilie) zeichnetsich dadurch aus, dass e<strong>in</strong>erseits weniger K<strong>in</strong><strong>der</strong> vorhandens<strong>in</strong>d, an<strong>der</strong>erseits aber e<strong>in</strong>e höhere Zahl gleichzeitigleben<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en existiert (Vier- und Fünf-<strong>Generation</strong>en-Familien).Diese Multi-<strong>Generation</strong>enfamilienkönnten auf Grund <strong>der</strong> verlängerten Lebenserwartung <strong>in</strong>Zukunft häufiger se<strong>in</strong> als gegenwärtig. Dies bedeutetauch, dass Familien mehr Lebenszeit damit verbr<strong>in</strong>gen,Familienrollen (Eltern und K<strong>in</strong><strong>der</strong>) zwischen den <strong>Generation</strong>ene<strong>in</strong>zunehmen. Allerd<strong>in</strong>gs könnte es auf Grund dessteigenden Erstgeburtsalters – vor allem durch die zunehmendeZahl von Frauen, die Mitte 30, Anfang 40 daserste K<strong>in</strong>d gebären – <strong>in</strong> Zukunft zu e<strong>in</strong>er „Alterslückenstruktur“kommen. Hierbei entsteht e<strong>in</strong> <strong>Generation</strong>enmustermit relativ großem Abstand zwischen den <strong>Generation</strong>en,e<strong>in</strong> Muster, das für Deutschland möglicherweisetypischer se<strong>in</strong> wird als die Bohnenstangenfamilie. Dennochwerden die Beziehungen zwischen Großeltern undEnkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>n weiterh<strong>in</strong> von Bedeutung bleiben. Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>haben bereits jetzt die Chance, zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> <strong>der</strong>K<strong>in</strong>dheit Beziehungen zu allen vier Großeltern aufzubauen.Empirische Befunde zeigen zudem, dass Großmütterengere Beziehungen zu jenen ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong> aufweisen,die selbst K<strong>in</strong><strong>der</strong> haben, wobei türkische Großmütterstärkere emotionale B<strong>in</strong>dungen angeben als deutscheGroßmütter (Nosaka & Chasiotis 2005).Struktur: Im Gegensatz zu alltäglichen Überzeugungenwaren Beziehungen zwischen drei <strong>Generation</strong>en <strong>in</strong> <strong>der</strong>historischen Vergangenheit außerordentlich selten unddauerten, wenn sie überhaupt möglich waren, nur relativkurz (Hareven 1994, 2001; Hoff & Tesch-Römer imDruck). Aber auch heutzutage s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>tergenerationale Beziehungen,die mehr als drei <strong>Generation</strong>en betreffen, e<strong>in</strong>eAusnahme. Gegenwärtig ist e<strong>in</strong> großer Teil <strong>der</strong> älterenMenschen mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n, die im Erwachsenenalter stehen,bereits Großeltern (o<strong>der</strong> können erwarten, Großeltern zuwerden). Etwa die Hälfte <strong>der</strong> Personen, die im Alterzwischen 55 und 69 Jahren stehen, leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er 3-<strong>Generation</strong>en-Konstellation,und knapp e<strong>in</strong> Viertel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er4-<strong>Generation</strong>en-Konstellation (Tabelle 28). Vonden 70- bis 85-Jährigen leben etwas mehr als die Hälfte<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er 3-<strong>Generation</strong>en-Konstellation und e<strong>in</strong> Viertel <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er 4-<strong>Generation</strong>en-Konstellation. Zwischen 1996 und2002 s<strong>in</strong>d die Verhältnisse recht stabil geblieben. DieseSituation, die auf verbesserte Gesundheit und erhöhte Lebenserwartung<strong>zur</strong>ückzuführen ist, wird sich <strong>in</strong> Zukunftauf Grund <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen Fertilität mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeitverän<strong>der</strong>n: Die nachwachsenden Geburtsjahrgängeälterer Menschen <strong>der</strong> Zukunft werden ger<strong>in</strong>gereChancen haben, die eigene Großelternschaft zu erfahren,da die erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong> seltener eigene K<strong>in</strong><strong>der</strong> habenwerden.Qualität: Großeltern tragen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel nicht die Hauptverantwortungfür die Sozialisation e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des. Diesentlastet die Beziehung von <strong>der</strong> Notwendigkeit für Sanktionenund eröffnet den Freiraum für geme<strong>in</strong>same Aktivitätenmit den Enkeln. Großeltern übernehmen diese Rollegern und assoziieren damit hohes Wohlbef<strong>in</strong>den und Zufriedenheit(Lang 2000b). Mit Blick auf die Entwicklungdes K<strong>in</strong>des stellen Großeltern als Bezugspersonen e<strong>in</strong>ewichtige Brücke <strong>in</strong> die weitere soziale Welt dar und s<strong>in</strong>d
Drucksache 16/2190 – 186 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 28<strong>Generation</strong>enkonstellationen im Familienverbund nach Altersgruppen, 1996 und 2002(<strong>in</strong> Prozent)40-54 55-69 70-85 40-851996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 20021-<strong>Generation</strong>en-Konstellation 2,4 2,7 10,0 6,9 15,5 13,1 7,3 6,42-<strong>Generation</strong>en-Konstellation 17,4 20,8 17,4 19,5 9,1 10,6 16,0 18,13-<strong>Generation</strong>en-Konstellation 62,8 61,1 48,4 49,6 52,2 52,6 55,9 55,24-<strong>Generation</strong>en-Konstellation 17,0 14,4 23,0 23,3 22,7 23,2 20,1 19,45-<strong>Generation</strong>en-Konstellation 0,4 0,9 1,2 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7Anzahl 1.647 1.025 1.561 930 1.137 928 4.345 2.883Datenbasis: Alterssurvey 1996 und 2002, eigene Berechnungen.somit am Fortgang <strong>der</strong> Entwicklung des K<strong>in</strong>des wesentlichbeteiligt. Intergenerationale Beziehungen zwischenGroßeltern und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> bedeutsames sozialesKapital, das <strong>der</strong> kognitiven und sozialen Entwicklungvon K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zugute kommt (Hauser-Schöner 1994). Zugleichlernen auch Großeltern von ihren Enkeln – e<strong>in</strong> Zusammenhangdes Austauschs von Wissen und Erfahrungen,<strong>der</strong> mit dem Begriff des „<strong>Generation</strong>enlernens“bezeichnet worden ist (Lüscher & Liegle 2003).Großeltern modifizieren Regeln und Gebote, aber auchVorstellungen und Überzeugungen <strong>der</strong> Eltern. Dies mil<strong>der</strong>tmöglicherweise konfliktträchtige Beziehungen zwischenEltern und K<strong>in</strong><strong>der</strong>n, kann aber auch zu zusätzlichenSpannungen <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> <strong>in</strong>tergenerationalen Beziehungenführen. Großelternschaft symbolisiert <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regeldie Kont<strong>in</strong>uität des Familienzyklus und ist weith<strong>in</strong> mit <strong>in</strong>tergenerationalerfamiliärer Harmonie assoziiert. Diesepopuläre Annahme bildet die komplexe Wirklichkeit <strong>der</strong>Großelternrolle allerd<strong>in</strong>gs nicht vollständig ab (Sz<strong>in</strong>ovacz1998). Wenn Großeltern beispielsweise regelmäßige Betreuungsaufgabenübernehmen, etwa im Fall von Scheidungeno<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Unterstützung alle<strong>in</strong> erziehen<strong>der</strong> Eltern,so wechseln sie zwangsläufig <strong>in</strong> die Elternrolle.Insgesamt ist festzustellen, dass es e<strong>in</strong>e deutliche Diskrepanz<strong>in</strong> <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> Beziehungsqualität aus <strong>der</strong>Sicht <strong>der</strong> Enkel und <strong>der</strong> Großeltern gibt: Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>schätzen die Qualität <strong>der</strong> Beziehung nicht immer so positive<strong>in</strong> wie es Großeltern tun (Szydlik 2000).Potenziale und Risiken: In den Beziehungen zwischenGroßeltern und ihren Enkeln stehen f<strong>in</strong>anzielle Unterstützungsleistungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel nicht im Mittelpunkt. Vielmehrkommt die großelterliche Aktivität eher auf demGebiet <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Aktivität und <strong>der</strong> Kommunikationzum Ausdruck. Bei den jüngeren Großeltern stehenpraktische Hilfen und das Verhaltensvorbild im Mittelpunkt<strong>der</strong> Beziehung zu den Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>n, bei den älterenGroßeltern dagegen eher emotionale Beziehungsaspekte.K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung durch Großeltern ist für die mittlere <strong>Generation</strong><strong>der</strong> erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong> von großer Bedeutung,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dann, wenn es um die Vere<strong>in</strong>barkeit von Berufund Familie geht und ke<strong>in</strong>e ausreichende Infrastrukturvon K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungsmöglichkeiten <strong>zur</strong> Verfügung steht.Diese Unterstützung ist beson<strong>der</strong>s im Fall von alle<strong>in</strong> erziehendenMüttern von großer Bedeutung (Hoff 2001).Obwohl <strong>in</strong> evolutionstheoretischer Perspektive auf diestammesgeschichtlichen Wurzeln – vor allem auf großmütterlichesInvestment – für die Sorge um die nachwachsenden<strong>Generation</strong>en verwiesen wird (Voland, Chasiotis& Schievenhövel 2005), leisten jedoch ke<strong>in</strong>eswegsalle Großeltern Beiträge <strong>zur</strong> Betreuung von Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>n.Im Mehrgenerationensurvey (Erhebungsjahr 1990)gaben nur 13 Prozent <strong>der</strong> befragten Großeltern an, regelmäßigdie Betreuung <strong>der</strong> Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> zu übernehmen,und 26 Prozent, dies gelegentlich zu tun (Templeton &Bauereiss 1994: 257). Dabei zeigten sich erhebliche Geschlechtsunterschiede:Während fast die Hälfte <strong>der</strong> Großmütterangaben, gelegentlich o<strong>der</strong> regelmäßig K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungzu übernehmen, taten dies nur etwa 15 Prozent<strong>der</strong> Großväter. Aus e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en Perspektive zeigenBefunde <strong>der</strong> Zeitbudgeterhebung 2001/2002 ähnlicheBefunde (Engstler et al. 2004): Von allen befragten über60-Jährigen gaben nur 4 Prozent an, an den betreffendenTagebuchtagen Zeit für K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung aufgewendetzu haben. Auch wenn sich diese Angabe auf alle über60-Jährigen bezieht (unabhängig davon, ob diese selbst
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 187 – Drucksache 16/2190K<strong>in</strong><strong>der</strong> o<strong>der</strong> Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> haben), so zeigt sich doch, dasshier e<strong>in</strong> Potenzial des Alters <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie möglicherweisenicht ausgeschöpft ist.Zusammenfassung: Gegenwärtig ist e<strong>in</strong> großes Potenzial<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Beziehungen von Großeltern und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>nzu beobachten. Aus Sicht älter werden<strong>der</strong> Eltern istes ke<strong>in</strong>eswegs sicher, die Großelternschaft zu erleben, dadie eigenen K<strong>in</strong><strong>der</strong> möglicherweise k<strong>in</strong><strong>der</strong>los bleiben.Der Blick auf Großelternschaft verän<strong>der</strong>t sich, wenn mandie Perspektive <strong>der</strong> Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> e<strong>in</strong>nimmt, die häufig Beziehungenzu vier Großeltern aufbauen können. DiesesPotenzial wird sich <strong>in</strong> Zukunft auf Grund ger<strong>in</strong>ger Fertilitätund e<strong>in</strong>es höheren Alters <strong>zur</strong> Erstelternschaft möglicherweiseverm<strong>in</strong><strong>der</strong>n. Die Großelternrolle wird von älterwerdenden und alten Menschen sehr geschätzt und auchfür Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> birgt diese Beziehung e<strong>in</strong> hohes Potenzialan kognitiven und emotionalen Gew<strong>in</strong>nen. Dietatsächlichen Leistungen von Großeltern bei <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungs<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs nicht so hoch, wie man es angesichts<strong>der</strong> positiven Wertschätzung <strong>der</strong> Großelternrolle erwartenkönnte. Allerd<strong>in</strong>gs ist auch hier fraglich, ob es vonden beteiligten Akteuren im Familienverband – Großeltern,Eltern und K<strong>in</strong><strong>der</strong>/Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong> – gewünscht wird,dass hier e<strong>in</strong> verstärktes Engagement <strong>der</strong> Großeltern erfolgt.Möglicherweise s<strong>in</strong>d die Beziehungen zwischenGroßeltern und Enkeln dann am angenehmsten, wennke<strong>in</strong> Verpflichtungs- und Sozialisationscharakter entsteht.(e) Private Netze: Freunde, Bekannte und NachbarnNachbarn, Freunde und Bekannte s<strong>in</strong>d wichtige sozialeNetzwerkpartner – und ihre Bedeutung wird <strong>in</strong> Zukunftmöglicherweise ansteigen. Die zweite Lebenshälftebr<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e Reihe bedeutsamer Verän<strong>der</strong>ungen des privatenNetzwerks mit sich, und zwar sowohl <strong>in</strong> strukturellerals auch <strong>in</strong> funktioneller H<strong>in</strong>sicht. In verschiedenen Untersuchungenkonnte gezeigt werden, dass die Netzwerkeälter werden<strong>der</strong> Menschen kle<strong>in</strong>er werden. E<strong>in</strong>e durchdeutsche und US-amerikanische Studien belegteSchätzung lautet, dass 35- bis 49-jährige Menschen etwa20-35 Sozialbeziehungen unterhalten, 65- bis 84-Jährigeetwa 9-18 Beziehungen und über 85-Jährige etwa 5-8 Beziehungen(Lang, Neyer & Asendorpf 2005). Trotz <strong>der</strong>Verkle<strong>in</strong>erung <strong>der</strong> Netzwerkgröße mit dem Alter erlebenälter werdende Menschen nicht alle<strong>in</strong> soziale Verluste. Sokonnte empirisch gezeigt werden, dass sich trotz <strong>der</strong> Verkle<strong>in</strong>erungvon Netzwerken das verbliebene Netzwerkdeutlich verän<strong>der</strong>te: Über e<strong>in</strong>en Zeitraum von vier Jahrenwar etwa e<strong>in</strong> Drittel <strong>der</strong> Netzwerkpartner neu <strong>in</strong> das Netzwerkh<strong>in</strong>zugekommen (Lang 2000a). Bemerkenswert dabeiist, dass dies nicht nur <strong>in</strong> <strong>der</strong> Rückbes<strong>in</strong>nung auf Mitglie<strong>der</strong><strong>der</strong> weiteren Familie <strong>zur</strong>ückzuführen ist, da e<strong>in</strong>erheblicher Teil <strong>der</strong> neuen Netzwerkpartner nicht-verwandtePersonen waren (Wenger & Jerome 1999).Die Angehörigen nicht-familialer privater Netzwerkes<strong>in</strong>d diejenigen Menschen, zu denen zum Teil selbst gewählteBeziehungen (Freunde und Bekannte) und zumTeil Alltagskontakte aufrechterhalten und gepflegt werden(Nachbarn). Obwohl Freundschaften grundsätzlichdadurch gekennzeichnet s<strong>in</strong>d, dass sie freiwillig e<strong>in</strong>gegangenwerden und damit auch aufkündbar s<strong>in</strong>d, zeigt essich, dass langjährige und enge Freundschaften zu denstabilsten Beziehungen im Lebenslauf zählen (Armstrong& Goldsteen 1990). Langjährige Freundschaften sche<strong>in</strong>en– ähnlich wie Familienbeziehungen – Verletzungen desReziprozitätspr<strong>in</strong>zips bis zu e<strong>in</strong>em gewissen Grad zu tolerieren(Ikk<strong>in</strong>g & van Tilburg 1998). Dagegen werden kürzerdauernde Freundschaftsbeziehungen, die als unsymmetrischeund nicht reziprok erlebt werden, oftmalsbeendet. Im höheren Erwachsenenalter s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>ejene Freundschaften von Bedeutung, <strong>in</strong> denen Personengeme<strong>in</strong>samen Aktivitäten und Interessen nachgehen(Crohan & Antonucci 1989). Bis <strong>in</strong> das höhere Erwachsenenalterzeigt sich dabei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>fluss früher Erfahrungen<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Herkunftsfamilie (Heyl 2004).Auch flüchtigere Beziehungen wie Bekanntschaften haben<strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte erhebliche Bedeutung,wobei sich diese Bedeutung im Verlauf des Erwachsenenaltersän<strong>der</strong>t. Während Bekanntschaften im frühen o<strong>der</strong>mittleren Erwachsenenalter als mögliche Freundschaftenerlebt werden, stellen Bekannte und Nachbarn für älterwerdende und alte Menschen nicht alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Quelle vonAlltagskontakten dar, son<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d möglicherweise auchbedeutsam für die Er<strong>in</strong>nerung an ihre eigene Vergangenheitund das Erleben persönlicher Kont<strong>in</strong>uität (Lang,Neyer & Asendorpf 2005). Gerade an den Bereich nachbarschaftlicherKontakte knüpfen sich Hoffnungen <strong>zur</strong>verstärkten Nutzung von Potenzialen älter werden<strong>der</strong> undalter Frauen und Männern (Schnell 2002), wobei es unterschiedlicheLösungen <strong>der</strong> Frage gibt, wie mit <strong>der</strong> <strong>in</strong> Bekanntschaftenhäufig bestehenden Reziprozitätsnorm umgegangenwerden kann (z.B. Genossenschaftslösungen)(Mart<strong>in</strong> 2002).6.2.2 Bedeutung sozialer Netze fürpflegebedürftige MenschenFamiliale und weitere private Netze übernehmen <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>emMaß bedeutsame Aufgaben bei <strong>der</strong> Unterstützungund Betreuung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen.Die Rolle von Angehörigen und Nachbarn wirddabei im Sozialrecht beson<strong>der</strong>s betont. So heißt es im § 3SGB XI: „Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungenvorrangig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft<strong>der</strong> Angehörigen und Nachbarn unterstützen“.Weiter heißt es unter Verweis auf die geme<strong>in</strong>same, gesamtgesellschaftlicheVerantwortung <strong>in</strong> § 8(2) SGB XI:„Die Län<strong>der</strong>, die Kommunen, die Pflegee<strong>in</strong>richtungenund die Pflegekassen „...unterstützen und för<strong>der</strong>n ... dieBereitschaft zu e<strong>in</strong>er humanen Pflege und Betreuung ...durch Angehörige, Nachbarn und Selbsthilfegruppen undwirken so auf e<strong>in</strong>e neue Kultur des Helfens und <strong>der</strong> mitmenschlichenZuwendung h<strong>in</strong>“. Im Folgenden werdenzunächst die bereits realisierten Potenziale von älter werdendenMännern und Frauen <strong>in</strong> familialen und weiterenprivaten Netzwerken im Bereich <strong>der</strong> Unterstützung undBetreuung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen dargestellt.Danach werden nicht gedeckte Bedarfe beschriebensowie Entwicklungen des Pflege- und Gesundheitssektorsskizziert, die für den Erhalt familialer Potenziale und die
Drucksache 16/2190 – 188 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeStärkung <strong>der</strong> Unterstützungspotenziale älterer Menschen<strong>in</strong>nerhalb privater Netzwerke relevant s<strong>in</strong>d.6.2.2.1 Leistungen familialer und privaterNetzwerke im Bereich PflegeDie Bedeutung von Familie und weiteren privaten Netzenfür die Unterstützung hilfe- und pflegebedürftiger Menschenist unbestritten. Von den über zwei Millionen pflegebedürftigenMenschen leben 68 Prozent im eigenenHaushalt und werden von Familienangehörigen und an<strong>der</strong>enMitglie<strong>der</strong>n des privaten Netzes vollständig o<strong>der</strong> zumTeil versorgt. Von den im Jahr 2003 im eigenen Haushaltlebenden 1,44 Millionen pflegebedürftigen Menschen erhieltenetwa 987.000 Personen Pflegegeld (wurden alsovon Familie und privatem Netzwerk versorgt) und weitereetwa 450.000 Personen Sachleistungen (wurden alsovon ambulanten Pflegediensten betreut), wobei auch hierdie Unterstützung von familialen und weiteren privatenNetzwerken <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel sehr hoch ist (Statistisches Bundesamt2005). Zusätzlich zu den etwa 1,44 Millionenpflegebedürftigen Menschen, die <strong>in</strong> Privathaushalten lebenund Leistungen nach SGB XI erhalten, bedürfen weitereetwa 3 Millionen Menschen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e hauswirtschaftlicherUnterstützung, ohne selbst Pflegebedarf zuhaben (Schneekloth & Leven 2003: 8). Es s<strong>in</strong>d nach wievor die näheren Angehörigen, die Unterstützung und Betreuungleisten. Etwa 92 Prozent <strong>der</strong> pflegebedürftigenMenschen und etwa 85 Prozent <strong>der</strong> hilfebedürftigen Menschenwerden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel von Familienangehörigen betreut.Von Bedeutung dabei ist, dass über 60 Prozent <strong>der</strong>Personen, die als Hauptpflegepersonen Betreuung <strong>in</strong>häuslichen Pflegearrangements übernehmen, 55 Jahreund älter s<strong>in</strong>d (Schneekloth & Leven 2003). Dies zeigtdas Potenzial des Alters <strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken.Beschreibt man häusliche Hilfe- und Pflegearrangementsnach <strong>der</strong> Art des jeweils gewählten „Pflegemixes“ ausprivater und professioneller Unterstützung, so ergibt sich,dass 55 Prozent aller Pflegebedürftigen ausschließlichprivate Hilfeleistungen aus Familie o<strong>der</strong> Bekanntschafterhalten. H<strong>in</strong>zu kommen weitere 9 Prozent, die neben <strong>der</strong>privat getragenen Hilfe und Pflege zusätzlich selbst f<strong>in</strong>anzierte,jedoch nicht im engeren S<strong>in</strong>ne pflegerische Hilfen<strong>in</strong> Anspruch nehmen. Etwa 28 Prozent <strong>der</strong> Pflegebedürftigenerhalten sowohl private als auch professionelle pflegerischeHilfen und 8 Prozent erhalten ausschließlich professionellePflege. Von den hilfebedürftigen Personenerhalten 75 Prozent ausschließlich private Unterstützung,weitere 9 Prozent private bzw. zusätzlich selbst f<strong>in</strong>anziertehauswirtschaftlicher Hilfe, 1 Prozent private undprofessionelle Pflege und 3 Prozent ausschließlich selbstf<strong>in</strong>anzierte Hilfen ohne private Unterstützung. Insgesamt12 Prozent haben auf ke<strong>in</strong>e mehr o<strong>der</strong> weniger regelmäßigund systematisch verfügbare Hilfe, we<strong>der</strong> privat noch<strong>in</strong> Form von selbst f<strong>in</strong>anzierten Dienstleistungen, <strong>zur</strong>ückgegriffen(Schneekloth & Leven 2003: 28).Angesichts sich verän<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Partnerschaftsbeziehungenund e<strong>in</strong>em höheren Anteil von Menschen ohne K<strong>in</strong><strong>der</strong>wird dem nicht-familialen privaten Netz <strong>in</strong> Zukunft möglicherweisee<strong>in</strong>e stärker werdende Hilfs- und Unterstützungsfunktionzukommen als heutzutage. Dabei ist aberzu bedenken, dass diese Entwicklung e<strong>in</strong>en Zeitraum vonzwei bis drei Dekaden umfassen wird. E<strong>in</strong>e zunehmendeGruppe von Menschen, die ihr Leben nicht <strong>in</strong> familiärenBeziehungen gestaltet, verzichtet freiwillig o<strong>der</strong> unfreiwilligauf die Möglichkeit, im höheren Alter auf familiäreRessourcen <strong>zur</strong>ückgreifen zu können, selbst wenn sie <strong>in</strong>jüngeren Jahren ihre eigenen Eltern unterstützt haben.Das gilt umso mehr, weil bei e<strong>in</strong>er zunehmend ger<strong>in</strong>gerenK<strong>in</strong><strong>der</strong>zahl auch weniger Neffen und Nichten („erweitertes“Familienmodell) <strong>zur</strong> Verfügung stehen. Nachbarn,Freunde und Bekannte leisten bereits jetzt <strong>in</strong> bedeutsamenUmfang Hilfe <strong>in</strong> unterschiedlichen Situationen. Dabeiist jedoch zu bedenken, dass gerade <strong>in</strong> nicht-familialenBeziehungen häufig erwartet wird, dass gegebeneUnterstützung auch <strong>zur</strong>ückgegeben werden kann (Reziprozitätsnorm).Die Hauptverantwortung für Pflege undBetreuung (vor allem demenziell verän<strong>der</strong>ter Menschen)übernehmen Nachbarn, Freunde und Bekannte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regelnicht. Dennoch: Während vor E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> Pflegeversicherungim Jahr 1991 nur etwa 4 Prozent allerHauptpflegepersonen Nachbarn und Freunde waren(Schneekloth & Potthoff 1996), hatte sich diese Zahl biszum Jahr 2002 auf 8 Prozent fast verdoppelt (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend2005a: 1). Neben <strong>der</strong> Übernahme von Hilfe und Betreuungim S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Hauptpflegeperson, ersche<strong>in</strong>en aberweitere ergänzende Betreuungsleistungen s<strong>in</strong>nvoll, dievon Angehörigen des nicht-familialen Netzes ehrenamtlichauf Basis von freiwilligem bürgerschaftlichem Engagementübernommen werden könnten. Beispielhaftkönnten ergänzende, komplementäre Hilfeleistungenwerden, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gewissen Regelmäßigkeit außerhalbvon Familie und Bekanntschaft erbracht werden, ohnedass für den Pflegebedürftigen Kosten anfallen. In <strong>der</strong>Studie „Hilfe- und Pflegebedürftige <strong>in</strong> Deutschland2002“ konnte gezeigt werden, dass etwa 11 Prozent <strong>der</strong>Pflegebedürftigen regelmäßig – mehrheitlich e<strong>in</strong>- bismehrfach pro Woche – ehrenamtliche Betreuungsleistungen<strong>in</strong> Form von Besuchsdiensten, die über e<strong>in</strong>e sozialeE<strong>in</strong>richtung o<strong>der</strong> Ähnlichem vermittelt werden, erhalten(Schneekloth & Leven 2003: 29).6.2.2.2 Ungedeckte Bedarfe und un<strong>zur</strong>eichendeNutzung von AngebotenTrotz <strong>der</strong> hohen Unterstützungsleistungen des familialenund nicht-familialen privaten Netzes gibt es e<strong>in</strong>e Reihevon nicht gedeckten Bedarfen <strong>in</strong> Pflegehaushalten, wobeidie Bereiche pflegerischer Unterstützung und hauswirtschaftlicherHilfe beson<strong>der</strong>s von Bedeutung s<strong>in</strong>d (sieheauch den Abschnitt „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ imKapitel Chancen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Deutschland).Von grundlegen<strong>der</strong> Bedeutung ist dabei die „Vernetzung<strong>der</strong> Netzwerke“, also das angemessene Aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong>abstimmenvon privater und professioneller Unterstützung(Zeman 2005). Etwa 14 Prozent <strong>der</strong> Haushalte von Pflegebedürftigengibt an, dass zusätzliche pflegerische Hilfenotwendig sei, und etwa 12 Prozent <strong>der</strong> Haushalte ist <strong>der</strong>Me<strong>in</strong>ung, dass zusätzliche hauswirtschaftliche Hilfe notwendigsei. Fasst man beide Bereiche zusammen, so ge-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 189 – Drucksache 16/2190ben etwa 18 Prozent <strong>der</strong> Pflegehaushalte an, ke<strong>in</strong>e ausreichendeUnterstützung zu erhalten (Schneekloth & Leven2003: 32). Der Bedarf an zusätzlicher Hilfe und Unterstützungwird <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dann genannt, wenn ke<strong>in</strong>e regelmäßigePflege aus <strong>der</strong> Familie o<strong>der</strong> dem privaten Umfeldgeleistet werden kann. Beson<strong>der</strong>s betroffen s<strong>in</strong>dPflegebedürftige, die über ke<strong>in</strong> ausreichendes familiäresUnterstützungsnetz verfügen bzw. über e<strong>in</strong> Unterstützungsnetz,das durch e<strong>in</strong>e hohe Belastung <strong>der</strong> Hauptpflegepersoncharakterisiert ist (Schneekloth & Leven 2003:33). Von Bedeutung ist dabei auch die Dimension sozialerUngleichheit: Während Angehörige <strong>der</strong> MittelschichtDienstleistungen auf dem Markt kaufen können, s<strong>in</strong>d Angehörige<strong>der</strong> Unterschicht auf die Unterstützungsleistungen(<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e weiblicher) Familienmitglie<strong>der</strong> angewiesen(Theobald 2005). Bei <strong>der</strong> Inanspruchnahme vonLeistungen <strong>der</strong> Pflegeversicherung wird auch deutlich,dass pflegebedürftige Menschen mit e<strong>in</strong>en auf Individualisierungangelegten Lebensentwurf, <strong>der</strong> unter an<strong>der</strong>emdurch hohes Bildungsniveau gekennzeichnet ist, im Vergleichmit Menschen mit traditionellem Lebensentwurfund ger<strong>in</strong>ger Bildung <strong>in</strong> stärkerem Maß ambulanteDienste und weniger stark <strong>in</strong>formelle Hilfen <strong>in</strong> Anspruchnehmen (Bl<strong>in</strong>kert & Klie 1999: 109). Die Bereitschaftvon Familienangehörigen, Verantwortung im BereichPflege zu übernehmen, ist bei Angehörigen <strong>der</strong> Unterschichthöher als bei Angehörigen <strong>der</strong> Mittelschicht(Bl<strong>in</strong>kert 2005).Auch die Zunahme von „Schwarzarbeit“ im häuslichenBereich von Pflege zeugt von ungedeckten Bedarfslagen.So wird im Bereich <strong>der</strong> selbstorganisierten Pflege e<strong>in</strong>eZunahme von illegalen Arbeitskräften <strong>in</strong> Privathaushaltenkonstatiert, die nicht nur hauswirtschaftliche Tätigkeitenund Betreuung, son<strong>der</strong>n zunehmend auch Grund- und Behandlungspflegemit unterschiedlichen Qualitätsstandardsübernehmen (Richter 2004). Durch die EU-Osterweiterungist das Angebot an Pflegekräften stark gewachsen.Die Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus den so genannten„Beitrittsstaaten“ wird <strong>in</strong> Deutschland zwar erst nach e<strong>in</strong>erÜbergangsfrist von maximal sieben Jahren 59 gewährleistet,die Dienstleistungsfreiheit ist jedoch mit dem Beitritt<strong>in</strong> Kraft getreten. Dies bedeutet, dass Selbstständigeihre Dienstleistungen vorübergehend (maximal sechsMonate pro Jahr) anbieten können. Sie benötigen ke<strong>in</strong>eArbeitserlaubnis. Die Pflegekräfte aus den Beitrittsstaatenhaben sich meist <strong>in</strong> ihrem Heimatland selbstständiggemacht, wo sie auch kranken- und rentenversichert s<strong>in</strong>d.Experten schätzen, dass <strong>zur</strong> Zeit ca. 50.000 bis60.000 polnische Pflegehilfen <strong>in</strong> diesem Arrangement leben.Dabei soll es sich mehrheitlich um Fachpersonal59 Die bisherigen EU-Mitgliedslän<strong>der</strong> haben <strong>in</strong> dieser Übergangszeitdie Möglichkeit, die Zuwan<strong>der</strong>ung von Arbeitskräften aus den neuenMitgliedsstaaten durch die Vergabe von Arbeitserlaubnissen zu begrenzen.Deutschland macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Je<strong>der</strong>Bürger <strong>der</strong> neuen EU-Staaten (außer Malta und Zypern), <strong>der</strong> e<strong>in</strong>enArbeitsvertrag mit e<strong>in</strong>em deutschen Arbeitgeber schließen möchte,benötigt grundsätzlich noch m<strong>in</strong>destens zwei Jahre e<strong>in</strong>e Arbeitserlaubnis,die vor Aufnahme <strong>der</strong> Beschäftigung vom Arbeitgeber e<strong>in</strong>zuholenist. Zwei Jahre nach Beitritt sowie nach drei weiteren Jahrenmuss die EU-Kommission darüber <strong>in</strong>formiert werden, ob die Beschränkungenaufrechterhalten bleiben. Danach ist die letztmaligeVerlängerung um zwei weitere Jahre möglich.handeln. Für die illegal arbeitende Pflegehilfe spricht ausSicht des Pflegebedürftigen und se<strong>in</strong>er Angehörigen, dasssie für etwa 500 bis 800 Euro plus Unterbr<strong>in</strong>gung undVerpflegung <strong>zur</strong> Verfügung steht, während e<strong>in</strong> deutscherPflegedienst für e<strong>in</strong>e 24-Stunden-Betreuung durchschnittlich3.000 bis 5.000 Euro pro Monat berechnet. AnerkannteDienste haben auf Grund des tariflich festgelegtenLohns ke<strong>in</strong>e reelle Chance, auch nur annähernd mit denAngeboten auf <strong>in</strong>formellen Märkten zu konkurrieren. DieGefahren des illegalen Pflegemarktes s<strong>in</strong>d aber ebensodeutlich: Verzerrung des Wettbewerbs <strong>der</strong> Pflegeanbieter,Verletzungen <strong>der</strong> Gesetze und evtl. E<strong>in</strong>bußen bei <strong>der</strong>Qualität. Diese dürften jedoch nicht so gravierend ausfallenwie auf den ersten Blick angenommen, da es sich beiden illegal arbeitenden Pflegekräften oft um Fachkräftehandelt. Übersehen werden kann aber auch nach zehnJahren Pflegeversicherungsgesetz nicht, dass <strong>der</strong> regulärePflegemarkt vor allem für e<strong>in</strong>e „Rund-um-die-Uhr-Pflege“ sehr teuer und die Last <strong>der</strong> menschenwürdigenVersorgung pflegebedürftiger Familienmitglie<strong>der</strong> sehrgroß ist.Obwohl private Hilfe und Pflege mit erheblichen Belastungenverbunden s<strong>in</strong>d, greifen nur relativ wenige privatPflegende regelmäßig auf Beratung o<strong>der</strong> sonstige allgeme<strong>in</strong>eUnterstützungsangebote <strong>zur</strong>ück. Nur 7 Prozent <strong>der</strong>privaten Pflegepersonen von Pflegebedürftigen tauschensich regelmäßig mit professionellen Fachkräften aus,14 Prozent tun dies zum<strong>in</strong>dest ab und an. Weitere Angebotewerden ebenfalls recht ger<strong>in</strong>g genutzt. Regelmäßiggenutzt werden telefonische Beratungsmöglichkeiten von4 Prozent <strong>der</strong> Befragten, Angehörigencafes o<strong>der</strong> Sprechstundenvon 6 Prozent, professionell geleitete Angehörigengruppenvon 3 Prozent und private Selbsthilfe<strong>in</strong>itiativenvon 2 Prozent. Insgesamt s<strong>in</strong>d es nicht mehr als16 Prozent <strong>der</strong> Hauptpflegepersonen, die regelmäßig e<strong>in</strong>e<strong>der</strong> genannten Beratungs- und Unterstützungsformen <strong>in</strong>Anspruch nehmen. Etwa 37 Prozent nutzen diese Möglichkeitenzum<strong>in</strong>dest ab und an. Auch Pflegekurse, dievon den Pflegekassen im Rahmen <strong>der</strong> Pflegeversicherungangeboten werden, besuchen nur etwa 16 Prozent <strong>der</strong>Hauptpflegepersonen (Schneekloth & Leven 2003: 24).Während das Angebot an professionellen Pflegesachleistungenim ambulanten Bereich <strong>in</strong> den vergangenen zehnJahren deutlich ausgebaut worden ist, s<strong>in</strong>d zielgenaue undnie<strong>der</strong>schwellige Hilfsangebote im Bereich <strong>der</strong> Beratung,Qualifizierung und Unterstützung von pflegenden Angehörigennoch nicht ausreichend vorhanden. Auch teilstationärePflegeangebote, wie die Tagespflege, werden nur<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gem Umfang <strong>in</strong> Anspruch genommen. Werdenaber Unterstützungsangebote im Bereich von Beratung,Qualifizierung und Entlastung nicht angenommen, sodroht die Überlastung <strong>der</strong> Hauptpflegeperson mit negativenKonsequenzen für die pflegebedürftige Person unddie pflegende Person selbst. Aber auch <strong>zur</strong> Mobilisierungvon ehrenamtlichem Engagement ist es s<strong>in</strong>nvoll, die professionelleInfrastruktur weiter auszubauen (Schneekloth& Leven 2003). Zur Vermeidung vorzeitiger, unnötigerund kosten<strong>in</strong>tensiver stationärer Unterbr<strong>in</strong>gung ist dieMöglichkeit bedarfsgerechter Hilfearrangements für denhäuslichen Bereich <strong>in</strong> jedem E<strong>in</strong>zelfall zu prüfen. Bei denHilfen, die pflegebedürftige Menschen <strong>in</strong> ihrer eigenen
Drucksache 16/2190 – 190 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeHäuslichkeit brauchen, steht häufig nicht nur die unmittelbarepflegerische Unterstützung im Vor<strong>der</strong>grund, son<strong>der</strong>nebenso Hilfen im hauswirtschaftlichen Bereich,kommunikative Angebote, Beratung, Wohnungs- undWohnraumanpassung und weitere niedrigschwelligeHilfeangebote, wie Fahrdienste, Mahlzeitendienste etc.Diese vorpflegerischen o<strong>der</strong> pflegeergänzenden Dienstewerden häufig nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckt,sodass sie entwe<strong>der</strong> privat f<strong>in</strong>anziert o<strong>der</strong> durch dieörtlichen Sozialhilfeträger mitgetragen werden müssen.Mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzeswurden die begrenzten Möglichkeiten im bisherigenrechtlichen Rahmen des SGB XI erweitert. Dadurch bestehtdie Möglichkeit, Pflegedienste für Leistungen <strong>in</strong>Anspruch zu nehmen, die außerhalb des engen Leistungskatalogsvon § 37 Abs. 3 SGB XI stehen. Der Betrag vonbis zu 460 Euro pro Jahr kann für e<strong>in</strong>e Reihe unterschiedlicherBetreuungsleistungen und für die Erstattung vonAufwendungen e<strong>in</strong>gesetzt werden, die vor allem für demenziellverän<strong>der</strong>te pflegebedürftige Menschen mit erheblichemallgeme<strong>in</strong>en Betreuungsbedarf entstehen.Diese weitergehenden Leistungen s<strong>in</strong>d gerade <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blickauf die Versorgung hochaltriger und demenziell erkrankterPersonen bedeutsam. Allerd<strong>in</strong>gs wird im Dritten <strong>Bericht</strong>über die Entwicklung <strong>der</strong> Pflegeversicherung (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Gesundheit und Soziale Sicherung2004) darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass die bisherige Inanspruchnahmedes zusätzlichen Betreuungsbetrages noch h<strong>in</strong>terden Erwartungen <strong>zur</strong>ück bleibt. Während zunächst erwartetwurde, dass etwa 500.000 Personen anspruchsberechtigtse<strong>in</strong> könnten (und Anträge stellen würden), wurdediese Zahl auf 400.000 Personen nach unten korrigiert.Von den etwa 220.000 Versicherten, die im Jahr 2002 mitdem Bewilligungsbescheid über ihren Anspruch auf denzusätzlichen Betreuungsbetrag <strong>in</strong>formiert wurden, nahmenaber nur rund 8.000 Pflegebedürftige die Zusatzleistung<strong>in</strong> Anspruch. Diese Zahl vervierfachte sich zwar imJahr 2003 auf rund 30.000, lag aber damit immer nochweit unterhalb <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> potenziell Anspruchsberechtigten.In dem <strong>Bericht</strong> wird vermutet, dass weniger <strong>der</strong>Auf- und Ausbau <strong>der</strong> zusätzlichen Betreuungsangebotefür die ger<strong>in</strong>ge Inanspruchnahme verantwortlich ist alsvielmehr Hemmschwellen <strong>der</strong> pflegenden Angehörigenund/o<strong>der</strong> des zu betreuenden Pflegebedürftigen, Fremdhilfe<strong>in</strong> Anspruch zu nehmen (Bundesm<strong>in</strong>isterium für Gesundheitund Soziale Sicherung 2004: 44).Möglicherweise fällt es <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Angehörigen vonDemenzkranken schwer, Hilfe von außen anzunehmen.Dabei könnte etwa die Angst, „versagt zu haben“, die Unsicherheitüber die psychologischen Auswirkungen desBetreuungsangebotes auf den <strong>in</strong>dividuellen Zustand desBetreuten, o<strong>der</strong> die Scheu, fremde Personen <strong>in</strong> den privatenBereich e<strong>in</strong>zubeziehen, e<strong>in</strong>e Rolle spielen. DiesesProblem ist nicht zu unterschätzen und ist auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>enFällen zu beobachten. Dies zeigt sich beispielsweisebei dem Vergleich <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Leistungsberechtigten und<strong>der</strong> tatsächlichen Zahl <strong>der</strong> Leistungsbezieher bei <strong>der</strong> Inanspruchnahme<strong>der</strong> Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungspflege gemäß § 39 SGB XI.Von <strong>der</strong> Möglichkeit e<strong>in</strong>er Ersatzpflege für längstens vierWochen je Kalen<strong>der</strong>jahr könnten potenziell jene1,28 Millionen Pflegebedürftigen Gebrauch machen, dieambulant versorgt werden. Tatsächlich wird diese Leistungjedoch nur <strong>in</strong> rund 211.000 Fällen im Jahr <strong>in</strong> Anspruchgenommen, obwohl die gesetzliche Regelung überdie Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungspflege recht flexibel ausgestaltet ist undverschiedenste Möglichkeiten <strong>zur</strong> zeitweiligen Entlastung<strong>der</strong> Hauptpflegeperson eröffnet (Bundesm<strong>in</strong>isterium fürGesundheit und Soziale Sicherung 2004: 44f.).Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass familiale undweitere private Netze e<strong>in</strong>erseits unverzichtbare Leistungenbei <strong>der</strong> Unterstützung und Betreuung hilfe- und pflegebedürftigerMenschen leisten (und dass es zu e<strong>in</strong>emgroßen Teil älter werdende und alte Menschen s<strong>in</strong>d, diediese Leistungen erbr<strong>in</strong>gen), dass es aber an<strong>der</strong>erseitstrotz <strong>der</strong> Angebote <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Pflegeversicherung nochimmer ungedeckte Bedarfe gibt und dass e<strong>in</strong>e Reihe vonHilfs- und Entlastungsangeboten <strong>in</strong> nur ger<strong>in</strong>gem Maßeangenommen werden.6.3 Schlussfolgerungen und ZielsetzungenNachdem im vorangegangen Abschnitt die Potenziale alterMenschen <strong>in</strong> familialen und weiteren privaten Netzwerkenzunächst allgeme<strong>in</strong> und dann mit dem Blick aufden Bereich <strong>der</strong> Unterstützung und Betreuung hilfe- undpflegebedürftiger Menschen dargestellt wurden, sollen <strong>in</strong>diesem Abschnitt Schlussfolgerungen aus <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>analysegezogen sowie Zielsetzungen und Handlungsgrundsätzefür mögliche Maßnahmen und Empfehlungen beschriebenwerden.6.3.1 Schlussfolgerungen aus <strong>der</strong><strong>Lage</strong>analyseDie <strong>Lage</strong>analyse hat gezeigt, dass <strong>in</strong> familialen und nichtfamilialenNetzwerken bereits e<strong>in</strong> hohes Potenzial an Unterstützungs-und Hilfebereitschaft realisiert ist. Innerhalbvon Partnerschaften, von Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen, vonGroßeltern-Enkel-Beziehungen sowie <strong>in</strong> weiteren privatenNetzwerken lassen sich zahlreiche Belege für Unterstützungsleistungenim Bereich <strong>der</strong> <strong>in</strong>strumentellen undemotionalen Unterstützung, <strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellen Transfers sowie<strong>der</strong> Übernahme von Verantwortung bei <strong>der</strong> Unterstützungund Betreuung hilfe- und pflegebedürftiger Menschenf<strong>in</strong>den. Allerd<strong>in</strong>gs ist auch deutlich geworden, dasssich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e familiale Netzwerke <strong>in</strong> Zukunft weiterverän<strong>der</strong>n werden. Die Zahl <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> den nachwachsenden<strong>Generation</strong>en älter werden<strong>der</strong> Menschen wirdger<strong>in</strong>ger se<strong>in</strong> und <strong>der</strong> Abstand zwischen den Haushaltenfamilialer <strong>Generation</strong>en wächst. Dementsprechend stelltsich die Frage, wie – <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Unterstützungpflegebedürftiger Menschen – Pflegehaushalteentlastet und unterstützt werden können. Hier gibt ese<strong>in</strong>en nicht unbeträchtlichen Anteil von Haushalten, <strong>in</strong>denen die pflegebedürftige Person ke<strong>in</strong>e ausreichendepflegerische o<strong>der</strong> hauswirtschaftliche Hilfe erhält und,obgleich die privaten Hauptpflegepersonen die „Hauptlast“<strong>der</strong> Pflege tragen, privat Pflegende nur zu e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong><strong>der</strong>heitregelmäßig auf Beratung o<strong>der</strong> sonstige allgeme<strong>in</strong>eUnterstützungsangebote <strong>zur</strong>ück greifen. Lücken werdendort sichtbar, wo es um zielgenaue und nie<strong>der</strong>schwellige
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 191 – Drucksache 16/2190Hilfsangebote im Bereich <strong>der</strong> Beratung, Qualifizierungund Unterstützung von pflegenden Angehörigen geht.Auffällig ger<strong>in</strong>g ausgeprägt ist darüber h<strong>in</strong>aus die Inanspruchnahmeweitere Entlastungsangebote, etwa durchTagespflege. Dementsprechend s<strong>in</strong>d Ziele und Handlungsgrundsätzezu formulieren, die den aktuellen Standfamilialer und privater Netze sowie zukünftige Entwicklungenaufgreifen.6.3.2 Ziele und HandlungsgrundsätzeMit Blick auf Familien und soziale Netze s<strong>in</strong>d mit demBegriff <strong>der</strong> „Potenziale des Alters“ jene Unterstützungsleistungengeme<strong>in</strong>t, die Mitglie<strong>der</strong> von familialen undprivaten Netzen an<strong>der</strong>en Netzwerkmitglie<strong>der</strong>n gewährenkönnen. E<strong>in</strong> grundlegendes Ziel sieht die Kommissiondar<strong>in</strong>, Möglichkeiten <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungendarzulegen, damit alte Menschen ihr Lebenmöglichst lange selbstbestimmt und selbstständig gestaltenkönnen, und aufzuzeigen, welche Maßnahmen erfor<strong>der</strong>lichs<strong>in</strong>d, damit <strong>der</strong> Vorrang <strong>der</strong> häuslichen Versorgungvor <strong>der</strong> stationären Pflege auch <strong>in</strong> Zukunft weiteraufrechterhalten werden kann. Hierbei sollen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>edie Potenziale alter Menschen <strong>in</strong> Familie undprivaten Netzen berücksichtigt werden. In <strong>der</strong> sozialpolitischenDiskussion wird häufig angenommen, dass Angebotesozialstaatlicher Dienstleistungen das Potenzial vonFamilien zu Unterstützungsleistungen schwächen könne(„Substitutionsthese“). Folgt man dieser These, so dürftensozialpolitische Dienstleistungen nur dort angeboten werden,wo e<strong>in</strong> familiales Netz nicht vorhanden o<strong>der</strong> zuschwach ist, um notwendige Leistungen zu erbr<strong>in</strong>gen. Allerd<strong>in</strong>gsist die Substitutionshypothese ke<strong>in</strong>eswegs unumstritten.Vielmehr zeigen empirische Studien, dass starkesozialstaatliche Infrastruktur das Potenzial von Familienfür bestimmte Unterstützungsleistungen ermöglichenkann („Anregungsthese“) Dienel 2004; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel,Tesch-Römer & Kondratowitz 2005). Folgt man <strong>der</strong> Anregungsthese,so sollten adäquate Angebote sozialerDienstleistungen die Potenziale von Familien <strong>zur</strong> Unterstützungstärken. Angesichts dieser Überlegungen solltedie Senioren- und Familienpolitik zwei grundlegendeZiele verfolgen, nämlich e<strong>in</strong>erseits dazu beitragen, vorhandenePotenziale des Alters <strong>in</strong> Familie und privatenNetzwerken zu erhalten, und an<strong>der</strong>erseits bestrebt se<strong>in</strong>,neue Potenziale <strong>in</strong> diesen Bereichen zu wecken und zustärken.6.3.2.1 Vorhandene Potenziale erhaltenAngesichts des Umfangs an Unterstützungsleistungen,die <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong>nerhalb von Familien, aber auch <strong>in</strong>nerhalbvon privaten Netzwerken <strong>in</strong> Deutschland gegenwärtigbereits geleistet werden, ist zunächst weniger das„Ausschöpfen des Möglichen, noch nicht Realisierten“als vielmehr das „Bewahren des Vorhandenen“ zu for<strong>der</strong>n.Da ältere Menschen bereits jetzt e<strong>in</strong>en erheblichenUnterstützungsbeitrag <strong>in</strong>nerhalb von Familien leisten,vertritt die Kommission die Auffassung, dass es <strong>in</strong> ersterL<strong>in</strong>ie darum geht, diese bereits vorhandenen, realisiertenfamilialen Unterstützungspotenziale durch geeigneteMaßnahmen zu erhalten. Dabei gilt es, die sich wandelndenFormen von Familien- und Haushaltsstrukturen auchmit Blick auf bestehende soziale Ungleichheiten zu berücksichtigen.Die Kommission geht davon aus, dass Senioren-und Familienpolitik <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie darum bemühtse<strong>in</strong> sollten, die vorhandenen Potenziale des Alters <strong>in</strong>nerhalbvon Familien und privaten Netzwerken (Pflege,Enkelbetreuung, f<strong>in</strong>anzielle Transfers) durch geeigneteRahmenbed<strong>in</strong>gungen und Maßnahmen zu erhalten. ImS<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Nachhaltigkeit sozialer Unterstützungsleistungensollte dabei weniger die maximale, als vielmehr dieoptimale Nutzung von Ressourcen diskutiert werden.6.3.2.2 Neue Potenziale stärkenAllerd<strong>in</strong>gs ist angesichts des gesellschaftlichen Wandelszu fragen, ob und <strong>in</strong> welchen Bereichen sich ältere Menschen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie und <strong>in</strong> privaten Netzwerken engagierenkönnten, um neue Potenziale, vor allem für <strong>in</strong>tergenerationaleUnterstützung, zu öffnen. Die Kommission gehtdavon aus, dass Senioren- und Familienpolitik neben <strong>der</strong>Bewahrung des vorhandenen Potenzials neue Perspektivenfür das Engagement älterer Menschen <strong>in</strong> Familie undprivaten Netzen eröffnen sollte.Die Kommission vertrittdie Auffassung, dass die Unterstützungspotenziale ältererMenschen <strong>in</strong>nerhalb privater Netzwerke <strong>in</strong> Zukunft gestärktwerden sollten. Dies bezieht sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e aufBesuchs- und Betreuungsleistungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nachbarschaft,z.B. für demenziell verän<strong>der</strong>te und für alle<strong>in</strong> lebende alteMenschen. Obwohl Familienmitglie<strong>der</strong> im Mittelpunktvon Unterstützung, Hilfe und Pflegeverantwortungstehen, ersche<strong>in</strong>t es s<strong>in</strong>nvoll, dass <strong>der</strong> Blick auf Nachbarschaftund Freundeskreis ausgeweitet wird. Gerade Menschen,die vor kurzem <strong>in</strong> den Ruhestand e<strong>in</strong>getreten s<strong>in</strong>d,haben häufig die Möglichkeit, jene Nachbarn undFreunde zu unterstützen, die ke<strong>in</strong> stabiles familiales Netzwerkhaben. Das Unterstützungspotenzial älter werden<strong>der</strong>Männer und Frauen könnte auch stärker <strong>in</strong> bürgerschaftlichesEngagement e<strong>in</strong>fließen. Allerd<strong>in</strong>gs müssen hierbeiauch die Möglichkeiten und Rahmenbed<strong>in</strong>gungen beachtetwerden, die das Engagement von Menschen mit unterschiedlichemBildungs- und Schichth<strong>in</strong>tergrund bee<strong>in</strong>flussenkönnen.Gerade <strong>in</strong> <strong>der</strong> Betreuung sehr alter, demenziell verän<strong>der</strong>terMenschen ist die Unterstützung pflegen<strong>der</strong> Familieno<strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtungen durch ehrenamtliche Betreuungspersonens<strong>in</strong>nvoll. Die Übernahme von Verantwortlichkeitenim S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es „Alt für Jung“ o<strong>der</strong> „Alt für Alt“ könntezudem e<strong>in</strong>e Stärkung <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>ensolidarität nachsich ziehen.6.4 Maßnahmen zum Erhalt und <strong>zur</strong>Stärkung familialer und privaterNetzwerkeAngesichts <strong>der</strong> vielfältigen Leistungen älterer Menschen<strong>in</strong> Familie und privaten Netzwerken sollen im FolgendenMaßnahmen diskutiert werden, die vorhandene Potenzialestärken und neue Potenziale stimulieren könnten.Dabei wird e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>engung auf den Bereich <strong>der</strong> Unterstützunghilfe- und pflegebedürftiger Menschen vorge-
Drucksache 16/2190 – 192 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodenommen. Im Mittelpunkt stehen zum e<strong>in</strong>en Maßnahmen,die Pflegebereitschaft und Pflegefähigkeit älter werden<strong>der</strong>und alter Angehöriger stützen können, und zum an<strong>der</strong>enVoraussetzungen, die nachbarschaftliches Engagement<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e älter werden<strong>der</strong> und alter Menschenbei <strong>der</strong> Betreuung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschenerhöhen können. Aufgezeigt werden aber auch solcheBed<strong>in</strong>gungen, die vorhandene Bereitschaft <strong>zur</strong> Unterstützunghemmen und vorhandene Potenziale nicht <strong>zur</strong>Umsetzung gelangen lassen.Die Übernahme von Verantwortung für hilfe- und pflegebedürftigeMenschen bedeutet generell e<strong>in</strong>e erheblicheVerän<strong>der</strong>ung des bisherigen Alltags aller Beteiligten. Erschwerendkommt <strong>in</strong> dieser Situation häufig h<strong>in</strong>zu, dassPersonen im privaten Umfeld e<strong>in</strong>es Pflegebedürftigen nurun<strong>zur</strong>eichend über Angebote hauswirtschaftlicher, pflegerischerund sonstiger Dienste <strong>in</strong>formiert s<strong>in</strong>d. Auch dasWissen über Bedarfe e<strong>in</strong>es hilfe- und pflegebedürftigenMenschen, gerade im Fall demenzieller Verän<strong>der</strong>ungen,ist oft nicht ausreichend vorhanden. Die familiale Unterstützungvon Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf f<strong>in</strong>detim Rahmen biografisch gewachsener Beziehungenund vor dem H<strong>in</strong>tergrund unterschiedlicher Motive <strong>zur</strong>Unterstützung statt. Beispielsweise s<strong>in</strong>d die Beziehungenzwischen Eltern und ihren erwachsenen (häufig selbstschon im höheren Lebensalter stehenden) K<strong>in</strong><strong>der</strong>n nichtalle<strong>in</strong> durch Elemente <strong>in</strong>tergenerationaler Solidarität undfilialer Verantwortung gekennzeichnet, son<strong>der</strong>n möglicherweiseauch durch <strong>in</strong>tergenerationale Ambivalenz.Diese Ambivalenzen können lebensgeschichtlich begründetse<strong>in</strong>, und unter beson<strong>der</strong>en Belastungen zu problematischenund konflikthaften Interaktionen führen. Maßnahmenzum Erhalt familialer Pflegepotenziale solltenRahmenbed<strong>in</strong>gungen schaffen, die die Belastung durchPflegetätigkeiten verm<strong>in</strong><strong>der</strong>n. Damit müssen Personen,die Verantwortung <strong>in</strong> Pflege und Betreuung übernehmen,im Erhalt ihrer eigenen Ressourcen gestützt werden unteran<strong>der</strong>em durch: Anerkennung <strong>der</strong> geleisteten Familienarbeit,Ermöglichung <strong>der</strong> Aufrechterhaltung sozialer Bezüge,auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt, Information, Begleitungund Beratung, Bereitstellung flexibler qualitätsgesicherterHilfestrukturen für Helfer und die Betroffenen. ImFolgenden werden solche Formen <strong>der</strong> Unterstützung diskutiert.Aufrechterhaltung sozialer Bezüge: ErwerbstätigkeitDie Aufrechterhaltung <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit spielt e<strong>in</strong>edifferenzierte Rolle bei <strong>der</strong> Bewältigung <strong>der</strong> Pflegesituation.Studien bestätigen sowohl die höhere psychischeund physische Belastung von erwerbstätigen pflegendenAngehörigen als auch die entlastende Funktion <strong>der</strong> außerhäuslichenArbeit als Gegengewicht <strong>zur</strong> Pflegesituation.Der Beruf bedeutet Anerkennung, sozialen Kontakt undSelbstbestätigung (Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend 1997), Ablenkung von den häuslichenSorgen (Reichert 1996), Erhöhung des Selbstwertgefühlsund <strong>der</strong> beruflichen Kompetenz (Naegele 1997). DieTeilhabe älterer Frauen an den Möglichkeiten <strong>der</strong> bezahltenund sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeitist <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten zwargestiegen, aber ausgehend von e<strong>in</strong>em ausgesprochenniedrigen Niveau. Dies liegt unter an<strong>der</strong>em an vielfältigenBarrieren, die sich aus <strong>der</strong> traditionellen <strong>in</strong>nerfamilialenArbeitsteilung über den Erwerbsverlauf dieser Frauenergeben, sowie an konjunkturellen und betrieblichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungenund den geschlechtsspezifisch unterschiedlichenErwerbschancen. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> <strong>der</strong> Frage<strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit von Erwerbsarbeit und Angehörigenpflegekumulieren lebenslange Benachteiligungen, denenFrauen im erwerbsfähigen Alter ausgesetzt s<strong>in</strong>d:– <strong>der</strong> generell schwierigen Herstellung und geschlechtsspezifischungleich verteilten Chancen e<strong>in</strong>er Work-Life-Balance, d.h. <strong>der</strong> gel<strong>in</strong>genden Vere<strong>in</strong>barkeit vonerwerbs- und familienbezogenen Anfor<strong>der</strong>ungen,– dem Mangel an familienfreundlicher Politik (auch <strong>der</strong>Betriebe),– den aus <strong>der</strong> Pflegeübernahme noch stärker ungleichverteilten Erwerbs-, Bildungs-, Teilhabe-, KarriereundE<strong>in</strong>kommenschancen von Männern und Frauen,– <strong>der</strong> ungleich verteilten Verantwortung für Pflegeaufgabenauf Grund <strong>der</strong> geschlechtsspezifischen und <strong>in</strong>nerfamiliärenArbeitsteilung,– verbunden damit, dem ungleich höheren Erwerbslosigkeits-und Verarmungsrisiko <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er Pflegeübernahme,– <strong>der</strong> e<strong>in</strong>geschränkten Lebensqualität von Pflegendenmit Erwerbsverpflichtungen und möglicherweise nochVerpflichtungen gegenüber m<strong>in</strong><strong>der</strong>jährigen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n(Stichwort: Sandwich-<strong>Generation</strong>).Insbeson<strong>der</strong>e unter Gerechtigkeits- und Gleichstellungsaspektenstellt sich somit auch die grundsätzliche Frage,wie es mit <strong>der</strong> freien Entscheidung für o<strong>der</strong> gegen dieÜbernahme von Pflegeverantwortung bestellt ist, die Erwerbsmöglichkeitenbeschränken o<strong>der</strong> verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n. Diesist auch und beson<strong>der</strong>s im H<strong>in</strong>blick auf die Unterstützung<strong>der</strong> Pflegeübernahme generell und <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit vonPflege und Erwerbstätigkeit zu beachten. Ansonstendroht die Festschreibung bestehen<strong>der</strong> Ungleichheiten <strong>der</strong>Geschlechter und e<strong>in</strong>seitiger Zuständigkeitszuweisungenfür Sorgeaufgaben und die damit verbundenen Belastungenvon Frauen. Heute s<strong>in</strong>d bereits weite Teile <strong>der</strong> so genanntenSandwich-<strong>Generation</strong> <strong>in</strong> die Pflege ihrer hochbetagtenAngehörigen <strong>in</strong>volviert. Auf Grund <strong>der</strong> steigendenErwerbsbeteiligung von Frauen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von verheiratetenFrauen, <strong>der</strong> zunehmenden S<strong>in</strong>gularisierung, d.h.Zunahme von Alle<strong>in</strong>lebenden und E<strong>in</strong>personenhaushalten,steht dieses so genannte Pflegepotenzial mittelbislangfristig nicht mehr <strong>in</strong> dem bisherigen Umfang <strong>zur</strong>Verfügung. Die Möglichkeit und Bereitschaft, pflegebed<strong>in</strong>gtdie Erwerbstätigkeit e<strong>in</strong>zuschränken o<strong>der</strong> aufzugebens<strong>in</strong>d – nicht zuletzt auf Grund <strong>der</strong> s<strong>in</strong>kenden LebensundHaushaltse<strong>in</strong>kommen und <strong>der</strong> steigenden Anfor<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> sozialen Absicherung – begrenzt. Durch diezunehmende S<strong>in</strong>gularisierung stehen künftig zunehmendauch Männer vor <strong>der</strong> Notwendigkeit, die Pflege für ältereAngehörige mit <strong>der</strong> eigenen Erwerbsarbeit zu vere<strong>in</strong>baren,da Ehefrauen o<strong>der</strong> Töchter bzw. Schwiegertöchter
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 193 – Drucksache 16/2190fehlen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> traditionellen Arbeitsteilung bei <strong>der</strong>Pflege nicht nachkommen können o<strong>der</strong> wollen (Bäcker2003: 2). Gleichzeitig stehen – demografisch bed<strong>in</strong>gt –<strong>in</strong>sgesamt immer weniger jüngere potenzielle Pflegepersonenimmer mehr potenziellen Pflegebedürftigen gegenüber(Deutscher Bundestag 2002). Die Vere<strong>in</strong>barkeit vonErwerbsarbeit und Angehörigenpflege sche<strong>in</strong>t sich somitzu e<strong>in</strong>em wirtschaftspolitisch bedeutsamen Thema zu entwickeln,das über die Zukunftsfähigkeit <strong>der</strong> sozialen Sicherheitund des Erwerbsystems mit entscheidet.In den Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Europäischen Union gibt es sehrunterschiedliche Strategien für die Herstellung pflegefreundlicherErwerbs- und Unterstützungsstrukturen, wobeiDeutschland im europäischen Vergleich e<strong>in</strong>endeutlichen Nachholbedarf <strong>in</strong> <strong>der</strong> expliziten Berücksichtigung<strong>der</strong> Bedürfnisse und Schwierigkeiten von häuslichPflegenden, die gleichzeitig e<strong>in</strong>er bezahlten Erwerbsarbeitnachgehen wollen o<strong>der</strong> müssen, hat. Es zeigt sich,dass die Möglichkeiten und Risiken, die Vere<strong>in</strong>barkeit <strong>zur</strong>ealisieren, ungleich verteilt s<strong>in</strong>d: nach Geschlecht, Qualifikation,Haushaltszusammensetzung und -e<strong>in</strong>kommen,pflegerischer Infrastruktur vor Ort, betrieblichem Angebotan flexiblen Arbeitszeit- o<strong>der</strong> Unterbrechungsformen,kooperativen Vorgesetzten und Kollegen, unterstützendenFamilienmitglie<strong>der</strong>n. Diese Erkenntnis bedeutet aberauch, dass die wachsende Notwendigkeit <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeitvon Angehörigenpflege und Erwerbsarbeit mit e<strong>in</strong>erKomplexität von Unterstützung und för<strong>der</strong>nden Maßnahmenim gesamtgesellschaftlichen Kontext e<strong>in</strong>hergeht.Strategien <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit umfassen Beratungauf unterschiedlichen Ebenen wie auch Lobbyarbeitund Interessenvertretung, die von <strong>der</strong> Kooperationmit den Arbeitgebern und kommunalen Verwaltungen bish<strong>in</strong> zu f<strong>in</strong>anziellen und zeitlich kompensierenden und flexibilisierendenMaßnahmen reichen (Barkholdt & Lasch2004).Beratung von PflegepersonenDie lebenspraktische Beratung von Betroffenen und Angehörigensowie die Koord<strong>in</strong>ierung von Angebots- undNachfrageprozessen gew<strong>in</strong>nen zunehmend an Bedeutung.Bereits im Vierten <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong>wurde empfohlen, multiprofessionelle Netze im Bereich<strong>der</strong> ambulanten Versorgung unter E<strong>in</strong>beziehungfreiwillig Engagierter zu entwickeln und e<strong>in</strong>e „IntegrierteBeratung“ unter kommunaler Trägerschaft e<strong>in</strong><strong>zur</strong>ichten.Die Vielzahl unterschiedlicher Beratungs- und Betreuungsangebotemacht es für alle Beteiligten schwierig, dasjeweils adäquate Versorgungsangebot zu ermitteln. Ine<strong>in</strong>er „Integrierten Beratung“ könnte allen Beratungsbedürfnissennachgekommen o<strong>der</strong> – <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em zweitenSchritt – die zuständigen Spezialisten e<strong>in</strong>bezogen werden,wenn Ressourcen und Kompetenzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Beratungsstellenicht ausreichend vorhanden s<strong>in</strong>d (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend2002a: 366). Zu den Aufgaben solcher Beratungs- undKoord<strong>in</strong>ationsstellen gehören, ältere und beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Menschenund <strong>der</strong>en Angehörige neutral, verlässlich und qualifiziertim Büro und beim Hausbesuch <strong>zur</strong> selbstständigenLebensführung bei Hilfe- o<strong>der</strong> Pflegebedürftigkeitund bei <strong>der</strong> Wohnraumanpassung, bei <strong>der</strong> Vermittlungvon Kurzzeitpflege o<strong>der</strong> Tagespflege sowie bei <strong>der</strong> Aufnahme<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Pflegeheim zu beraten und zu unterstützen.Weitere Funktionen bestehen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Information überDienstleistungen und Hilfe bei <strong>der</strong>en Vermittlung sowie<strong>in</strong> <strong>der</strong> Begleitung <strong>in</strong> schwierigen Lebenssituationen, <strong>in</strong><strong>der</strong> Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen,<strong>in</strong> <strong>der</strong> Hilfestellung bei <strong>der</strong> Antragstellunggesetzlicher Betreuungsverfahren. Es s<strong>in</strong>d Hilfeplänezu erstellen und die F<strong>in</strong>anzierung zu klären, dasfreiwillige bürgerschaftliche Engagement zu unterstützenund zu koord<strong>in</strong>ieren, Angehörigen- und Selbsthilfegruppenbeim Start zu begleiten und anschließend zu stützen.Um e<strong>in</strong>e höhere Bedarfsgerechtigkeit und Zielgenauigkeit<strong>der</strong> pflegerischen Angebote und <strong>der</strong> pflegeergänzendenHilfen zu erreichen, s<strong>in</strong>d solche Beratungsstrukturenunverzichtbar. Dabei sollten die beson<strong>der</strong>en Bedürfnissevon älteren Menschen, die Verantwortung <strong>in</strong> Pflege undBetreuung übernommen haben, berücksichtigt werden.E<strong>in</strong>e flexible und am Bedarf des E<strong>in</strong>zelnen orientierte Beratungund Hilfeplanung ist am ehesten bei e<strong>in</strong>er trägerunabhängigenTätigkeit gewährleistet. Vorteilhaft wäredeshalb e<strong>in</strong>e kommunale Anb<strong>in</strong>dung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Zusammenschlussmehrerer Träger <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vere<strong>in</strong>. Bei e<strong>in</strong>er nichtträgerneutralen Ansiedlung sollten durch e<strong>in</strong>e vertraglicheVere<strong>in</strong>barung die Ziele, Aufgaben und F<strong>in</strong>anzierungklar def<strong>in</strong>iert und die Anb<strong>in</strong>dung an die Kommune bzw.das Versorgungsgebiet gesichert werden.Qualitätssicherung <strong>in</strong> privaten PflegearrangementsWird die Versorgung e<strong>in</strong>es Pflegebedürftigen von Angehörigendurchgeführt, so gelten auch für diese die Vorgabendes allgeme<strong>in</strong> anerkannten Standes <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischpflegerischenErkenntnisse. Die Beurteilung <strong>der</strong> Pflegequalitätim Rahmen <strong>der</strong> familiären Pflege erfolgt durchprofessionelle Pflegedienste. Dies ersche<strong>in</strong>t durchaus gerechtfertigt.Mehr als drei Viertel <strong>der</strong> pflegenden Angehörigenhaben sich alles selbst beigebracht, etwa 40 Prozent<strong>in</strong>formierten sich über Bücher, jede dritte Pflegepersonhat Tipps von Freunden o<strong>der</strong> Bekannten bekommen undnur ungefähr jede zehnte Hauptpflegeperson hat e<strong>in</strong>enPflegekurs besucht (Runde, Griese & Stierle 2003). Dahers<strong>in</strong>d die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Pflegeberatungse<strong>in</strong>sätzevon Bedeutung, durch die <strong>der</strong> Qualitätsstand<strong>der</strong> familiären Pflege durch professionellePflegefachkräfte kontrolliert wird. Als problematisch erweistsich, dass diese E<strong>in</strong>sätze im Spannungsverhältniszwischen Beratung und Kontrolle stehen. Dabei treffenhäufig lebensweltlich geprägte Wertvorstellungen undQualitätsmaßstäbe auf professionelle Qualitätsstandards<strong>der</strong> Fachpflege (Bl<strong>in</strong>kert & Klie 1999). Ebenso problematischist, dass die Beratungsaktivitäten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Realität häufigauf verwaltungsbezogene Fragen, auf f<strong>in</strong>anzielle Leistungen<strong>der</strong> Pflegekassen und <strong>der</strong>en Hilfsmittelför<strong>der</strong>ungreduziert s<strong>in</strong>d (Becker 1997). E<strong>in</strong>e gezielte Hilfestellungund explizite Pflegeberatung können Überfor<strong>der</strong>ungenund Belastungen auf Seiten <strong>der</strong> pflegenden Angehörigenentgegenwirken und e<strong>in</strong>e mögliche Unterversorgung <strong>der</strong>Pflegebedürftigen abwenden. Die Dauer und ggf. Häufigkeit<strong>der</strong> f<strong>in</strong>anzierten Pflegeberatungse<strong>in</strong>sätze nach § 37,3
Drucksache 16/2190 – 194 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSGB XI sollte erhöht werden, um sie zu e<strong>in</strong>em wirksamerenBeratungs<strong>in</strong>strument zu machen. Ebenso ist über weitereMaßnahmen <strong>zur</strong> Entlastung pflegen<strong>der</strong> Angehörigernachzudenken, wie personelle Unterstützung, psychosozialeBegleitung und zeitliche Entlastung durch ehrenamtlicheHelfer, wie sie gegenwärtig im Modellprogrammnach § 8,3 SGB XI durchgeführt werden.Niedrigschwellige AngeboteDarüber h<strong>in</strong>aus ersche<strong>in</strong>t es im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> gewünschtenStabilisierung des familiären und netzwerkgestütztenPflegepotenziale <strong>in</strong> Zukunft unbed<strong>in</strong>gt geboten, zielgerichtetniedrig-schwellige Beratungs-, QualifizierungsundUnterstützungsangebote für pflegende Angehörige,Nachbarn und Freunde weiter auszubauen. Solche Angebote,wie Entlastungsdienste (stundenweise Betreuungdurch geschulte ehrenamtliche Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiterim häuslichen Umfeld), Tagesbetreuung <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>gruppeno<strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelbetreuung durch anerkannte Helfer<strong>in</strong>neno<strong>der</strong> Helfer, Versorgung mit Mahlzeiten, Fahrdiensteaber auch Freizeit-, Bewegungs- und ganzheitliche Aktivierungsangebote(Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g von lebenspraktischen Tätigkeiten,Gedächtnistra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, geme<strong>in</strong>sames E<strong>in</strong>kaufen undMahlzeitenvorbereitung, Gymnastik, Musik) verbesserndas Allgeme<strong>in</strong>bef<strong>in</strong>den <strong>der</strong> Betroffenen, entlasten Angehörigeund Nachbarn und tragen <strong>zur</strong> Entspannung <strong>der</strong>Pflegesituation bei, wovon auch die Pflegedienste profitierenwürden.Der Bereich <strong>der</strong> haushaltsnahen Dienstleistungen könnte<strong>in</strong> Zukunft mehr dazu beitragen, dass die Potenziale Älterergestützt werden. Ältere Frauen und Männer werdene<strong>in</strong>en stärkeren Bedarf an professionellen Dienstleistungenhaben. Gleichzeitig ist aber auch bekannt, dass es beiÄlteren e<strong>in</strong>e gewisse Zurückhaltung bei <strong>der</strong> Inanspruchnahmesolcher Dienstleistungen gibt. Die Akzeptanzwächst <strong>in</strong> dem Maße, <strong>in</strong> dem Hilfen auf Grund e<strong>in</strong>geschränkterMobilität und s<strong>in</strong>ken<strong>der</strong> körperlicher Leistungsfähigkeiterfor<strong>der</strong>lich werden. Der Zugang zuDienstleistungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er vulnerablen Lebensphase setztbestimmte qualitative Anfor<strong>der</strong>ungen an diese Leistungenvoraus. So wünschen Ältere e<strong>in</strong>e Anlaufstelle für unterschiedlicheBedürfnisse und Bedarfe, bevorzugen häufigden Kontakt, die Beratung o<strong>der</strong> Dienstleistungserbr<strong>in</strong>gungdurch ältere Beschäftigte und schätzen die Kont<strong>in</strong>uitätdes Personale<strong>in</strong>satzes. Auch legen ältere Menschengroßen Wert auf Vertrauen und e<strong>in</strong>e leichte Zugänglichkeitvon Dienstleistungen. E<strong>in</strong> zentraler Ansatzpunkt füre<strong>in</strong> verbessertes und erweitertes Angebot haushaltsnaherDienstleistungen für Ältere besteht zweifellos <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erstärkeren Verknüpfung und Koord<strong>in</strong>ierung von unterschiedlichenDienstleistungen. Verbesserte Angebotebzw. Zugänge zu haushaltsnahen Dienstleistungen lassensich vor diesem H<strong>in</strong>tergrund auf unterschiedlichen Wegenerreichen:– durch Kooperationen verschiedener Dienstleistungsanbieter;– durch e<strong>in</strong>e Diversifizierung des Angebotes bestehen<strong>der</strong>Anbieter;– durch e<strong>in</strong>e verstärkte E<strong>in</strong>richtung von Beratungsstelleno<strong>der</strong> Service-E<strong>in</strong>richtungen, die die Transparenzüber bestehende Angebote erhöhen, den Zugang zuunterschiedlichen Anbietern erleichtern und möglichstauch e<strong>in</strong>e Qualitätssicherungsfunktion übernehmen.Für die angesprochenen Formen gibt es bereits e<strong>in</strong>zelneBeispiele, die aber weiter ausgebaut und verbreitet werdenmüssten:– E<strong>in</strong> Beispiel für Kooperationen unterschiedlicher Anbieters<strong>in</strong>d z.B. Wohnanlagen für ältere Menschen, diee<strong>in</strong> eigenständiges und unabhängiges Leben ermöglichen,aber mit diversen Dienstleistern zusammen arbeiten.Diese könnten beispielsweise die unterschiedlichenBedarfe abdecken, die von <strong>der</strong> Organisationvon Freizeitangeboten (geme<strong>in</strong>same Ausflüge von Bewohner<strong>in</strong>nenund Bewohnern <strong>in</strong> die nähere Umgebung),über E<strong>in</strong>kaufsdienste, Kant<strong>in</strong>en, Hilfe bei <strong>der</strong>Wohnungsre<strong>in</strong>igung, Wäsche und <strong>der</strong> Körperpflege(Hilfe beim Duschen o<strong>der</strong> Baden) bis h<strong>in</strong> zu ärztlichenund pflegerischen Leistungen, die erfor<strong>der</strong>lich se<strong>in</strong>können, wenn sich <strong>der</strong> Gesundheitszustand zeitweiligo<strong>der</strong> ggf. auch dauerhaft verschlechtert, reichen.– Beispiele für die Diversifizierung des Angebotes s<strong>in</strong>dz.B. Pflegedienste, <strong>der</strong>en Schwerpunkt zwar <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erbr<strong>in</strong>gungvon Pflegeleistungen, die aus <strong>der</strong> Pflegeversicherungf<strong>in</strong>anziert werden, besteht, die aber beiBedarf auch re<strong>in</strong> hauswirtschaftliche Hilfen o<strong>der</strong>Transportdienste anbieten, die dann privat f<strong>in</strong>anziertwerden.– E<strong>in</strong> Beispiel für Service-E<strong>in</strong>richtungen, die sich aufdie Information und Beratung über Dienstleistungenspezialisiert haben, s<strong>in</strong>d etwa Pflege-Beratungsstellen,die bei <strong>der</strong> Suche nach e<strong>in</strong>em geeigneten ambulantenPflegedienst o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em freien Platz <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er stationärenE<strong>in</strong>richtung helfen und auch Informationen zu ergänzendenDiensten bereit halten (z.B. <strong>zur</strong> Lieferungvon Mahlzeiten).Begleitung von Pflegepersonen (Case Management)Neben Beratungsangeboten können weitergehende Strukturen,die Pflegepersonen begleitend unterstützen, zumErhalt von Potenzialen älterer Menschen beitragen.Hierzu gehört beispielsweise das Case Management, das<strong>in</strong> <strong>der</strong> gezielten Organisation und Koord<strong>in</strong>ation vonPflege- und Unterstützungsleistungen für pflegebedürftigeund beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te ältere Menschen, für Angehörige undfür Helfer aus privaten Netzwerken durch e<strong>in</strong>e unabhängigeund geschulte Fachkraft besteht. E<strong>in</strong> flächendeckendesAngebot von Case-Management-Strukturen könntee<strong>in</strong>en Beitrag <strong>zur</strong> verbesserten Transparenz, <strong>zur</strong> gesteigertenKonsumentensouveränität, <strong>zur</strong> Optimierung vonPflege und Betreuung und <strong>zur</strong> Entlastung von Betreuendenleisten. Die Aufgaben des Case Managements bestehenauf <strong>der</strong> Grundlage systematischer Bedarfse<strong>in</strong>schätzungen(Assessment) <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Hilfeplanungund Arrangementgestaltung sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> weiteren Infrastrukturentwicklungauf kommunaler Ebene. Dabei ist ess<strong>in</strong>nvoll, nicht alle<strong>in</strong> professionelle Strukturen anzubieten,son<strong>der</strong>n diese auch mit ehren- und nebenamtlichen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 195 – Drucksache 16/2190Strukturen zu verknüpfen, damit das Angebot an pflegerischenund weiteren Hilfen überschaubarer und effektiverwird. Die Kernaufgabe des Case Managements bei <strong>der</strong>Unterstützung von Pflegepersonen wäre es, aus <strong>der</strong> Vielfaltvon Angeboten die für den jeweiligen E<strong>in</strong>zelfall erfor<strong>der</strong>lichenHilfen auszuwählen, Prioritäten festzulegenund Maßnahmen zu koord<strong>in</strong>ieren. Ziel ist dabei, die bestmöglicheLeistung zum richtigen Zeitpunkt durch e<strong>in</strong>enadäquaten Leistungserbr<strong>in</strong>ger zu erreichen. Darüberh<strong>in</strong>aus sollten im Rahmen des Case Managements dieDurchführung <strong>der</strong> Maßnahmen und die Qualität <strong>der</strong> Leistungserbr<strong>in</strong>gungkontrolliert und die Effektivität und Effizienzüberprüft werden. Qualitätsmaßstab sollten dabeisowohl die Bedürfnisse <strong>der</strong> älteren Menschen als auch dieBedürfnisse <strong>der</strong> Angehörigen bzw. <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> privatenNetzwerke se<strong>in</strong>, die Verantwortung <strong>in</strong> Pflege undBetreuung übernehmen.Erprobung neuer Formen <strong>der</strong> UnterstützungNeben verbesserten Formen von Beratung und Begleitungkönnten auch neue Formen <strong>der</strong> Unterstützung dieBereitschaft familialer und weiterer privater Pflegepersonenstärken. Hierbei könnten sich vor allem flexibleFormen <strong>der</strong> Inanspruchnahme von Leistungen för<strong>der</strong>lichauswirken. E<strong>in</strong> Beispiel für erhöhte Flexibilisierung undIndividualisierung von Unterstützungsleistungen s<strong>in</strong>d„Persönliche Pflegebudgets“. Gegenwärtig wird im Rahmenvon § 8 SGB XI <strong>in</strong> sieben Regionen <strong>der</strong> Bundesrepublike<strong>in</strong> Modellprojekt zu „Persönlichen Pflegebudgets“durchgeführt (Klie 2004a). Im Rahmen dieses Modellprojektskönnen Pflegebedürftige mit Mitteln aus <strong>der</strong> PflegeversicherungBetreuungs- und Pflegeleistungen bei Anbieterne<strong>in</strong>kaufen, die ke<strong>in</strong>en Versorgungsvertrag mite<strong>in</strong>er Pflegekasse haben. Dabei s<strong>in</strong>d die Pflegebedürftigen,was den Inhalt <strong>der</strong> Leistungen anbelangt, nicht an die<strong>in</strong>haltlichen Begrenzungen des § 36 SGB XI gebunden(ke<strong>in</strong> „Verrichtungsbezug“ <strong>der</strong> Dienstleistungen) nochs<strong>in</strong>d sie gehalten, Dienstleistungen lediglich bei gem.§ 72 SGB XI zugelassenen Anbietern zu besorgen. Durchdie Lösung vom weith<strong>in</strong> dom<strong>in</strong>anten Sachleistungspr<strong>in</strong>zipkönnen z.B. zugelassene Pflegedienste ihr Leistungsspektrumdiversifizieren und flexiblere Betreuungs- undPflegearrangements anbieten. Vor allem Menschen mitDemenz, die von <strong>der</strong> Pflegeversicherung mit ihrem selektivenPflegebedürftigkeitsbegriff diskrim<strong>in</strong>iert werden,bietet das personenbezogene Budget neue Möglichkeitenfür e<strong>in</strong> angemessenes Pflegearrangement. BetreuendeAngehörige von an Demenz Erkrankten werden durch dasBudget <strong>in</strong> die <strong>Lage</strong> versetzt, diejenigen Dienstleistungene<strong>in</strong>zukaufen, die <strong>in</strong>dividuell und situativ für die entlastendeNetzwerkpflege erfor<strong>der</strong>lich s<strong>in</strong>d. Mit diesem Modellprojektsoll <strong>der</strong> Frage nachgegangen werden, obdurch e<strong>in</strong>e Flexibilisierung <strong>der</strong> Pflegeleistungen e<strong>in</strong>e bedarfsgerechteGestaltung <strong>der</strong> häuslichen Pflege unterstütztwerden kann, und ob durch die Möglichkeit, an<strong>der</strong>eFormen von Dienstleistungen <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen,die Autonomie und Selbstbestimmung des Pflegebedürftigengestärkt wird. Weiterh<strong>in</strong> geht es um die Erprobungvon Assessment-Instrumenten <strong>in</strong> <strong>der</strong> häuslichen Pflegeund die Evaluation <strong>der</strong> systematischen Mite<strong>in</strong>beziehungvon Case Managern als Begleiter <strong>der</strong> Pflegebedürftigen.Positive Erfahrungen (stärkere Orientierung an den Kundenwünschen,Verbesserung <strong>der</strong> Betreuungs- und Pflegequalität,Stärkung <strong>der</strong> Selbstorganisationskräfte <strong>der</strong>Klienten und ihres Umfeldes, größere Zufriedenheit <strong>der</strong>Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten und Pflegebedürftigen, Anstieg <strong>der</strong> subjektivempfundenen Lebensqualität, Kostene<strong>in</strong>sparungen undEntbürokratisierungseffekte, Verbreiterung des Leistungsspektrums)mit personenbezogenen Pflegebudgetsliegen u.a. aus den Nie<strong>der</strong>landen, aus Großbritannien,F<strong>in</strong>nland, Schweden und den USA vor. Neben diesen positivenEffekten lassen Pflegebudgets aber auch e<strong>in</strong>e Reihevon Risiken erwarten, wie pflegefachliche Qualitätse<strong>in</strong>bußen,Missbrauch und die För<strong>der</strong>ung von ungesicherten Arbeitsverhältnissen.Derzeit noch nicht beantwortet werdenkönnen die Fragen, ob das personengebundene Budgetschichtbezogen genutzt wird (und die Mittelschicht bevorzugt),ob es von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten genutztwird und ob es Menschen mit Demenz und ihre Angehörigenerreicht (Klie 2004b). Auch die Herausbildung trägerübergreifen<strong>der</strong>Funktionen, etwa im S<strong>in</strong>ne unabhängigerBeratung, ist <strong>der</strong>zeit noch ungeklärt. Wie dieErfahrungen mit persönlichen Budgets im SGB IX zeigen,werden diese allerd<strong>in</strong>gs nicht ohne weiteres angenommen.Dennoch: Mit dem Instrument <strong>der</strong> persönlichenBudgets ist die Hoffnung auf erhöhte Flexibilität <strong>der</strong>Dienstleistermärkte und verbesserte Angebote <strong>in</strong>dividualisierterLeistungen verknüpft.F<strong>in</strong>anzielle Grundlagen <strong>der</strong> Pflegeversicherungund FamilieDas Bundesverfassungsgericht hat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Urteil vom3. April 2001 festgestellt, dass es mit dem Grundgesetznicht vere<strong>in</strong>bar ist, wenn Personen, die K<strong>in</strong><strong>der</strong> betreuenund erziehen und damit e<strong>in</strong>en generativen Beitrag leisten,den gleichen Beitrag <strong>zur</strong> Pflegeversicherung zahlen wiek<strong>in</strong><strong>der</strong>lose Mitglie<strong>der</strong>. E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitlicher Beitragssatz füralle Versicherten durfte laut Urteil längstens bis 31. Dezember2004 gelten. Das Gesetz <strong>zur</strong> Berücksichtigung<strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung im Beitragsrecht <strong>der</strong> sozialen Pflegeversicherungist zum 1. Januar 2005 <strong>in</strong> Kraft getreten.K<strong>in</strong><strong>der</strong>lose zahlen nun e<strong>in</strong>en zusätzlichen Beitrag von0,25 Prozentpunkten <strong>zur</strong> Pflegeversicherung. 60 Bei e<strong>in</strong>emE<strong>in</strong>kommen an <strong>der</strong> Bemessungsgrenze von 3.525 Eurosteigt die Belastung des Arbeitnehmers um 8,82 Euro auf38,78 Euro pro Monat. Die auf 800 Mio. Euro geschätztenMehre<strong>in</strong>nahmen durch die betroffenen 13 Mio. Beschäftigtensollen <strong>zur</strong> Deckung des seit Jahren wachsendenDefizits <strong>der</strong> Pflegeversicherung verwandt werden.Diese Regelung berücksichtigt zwar die Betreuung undErziehung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n, wie im Urteil verlangt. Der Umfangdieser Aufwendungen, <strong>der</strong> maßgeblich von <strong>der</strong>60 K<strong>in</strong><strong>der</strong>lose Mitglie<strong>der</strong> müssen den höheren Beitragssatz zahlen,wenn sie über 23 Jahre alt s<strong>in</strong>d. Damit zahlen sie statt <strong>der</strong> bisherigen0,85 Prozent künftig e<strong>in</strong>en Beitrag <strong>in</strong> Höhe von 1,1 Prozent ihresBruttoe<strong>in</strong>kommens. Der Arbeitgeberanteil <strong>in</strong> Höhe von 0,85 Prozentbleibt unverän<strong>der</strong>t. Das Gesetz sieht zudem vor, dass Personen, dievor 1940 geboren s<strong>in</strong>d, von dieser Regelung ausgenommen s<strong>in</strong>d.Auch Empfänger des Arbeitslosengeldes II müssen den Zuschlag aufden Beitragssatz nicht zahlen.
Drucksache 16/2190 – 196 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeAnzahl <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> abhängt, f<strong>in</strong>det jedoch ke<strong>in</strong>e Berücksichtigung.Auch die Nichtberücksichtigung aller K<strong>in</strong><strong>der</strong>losen,die vor 1940 geboren s<strong>in</strong>d, ist zu überdenken, dagerade diese Menschen, ohne über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraume<strong>in</strong>gezahlt zu haben, von den Leistungen profitieren.61 Unterschiede bei <strong>der</strong> Inanspruchnahme s<strong>in</strong>d zwischenk<strong>in</strong><strong>der</strong>losen und Versicherten mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n bei <strong>der</strong>stationären Pflege nachweisbar. Die Gesamtausgaben fürüber 60-jährige k<strong>in</strong><strong>der</strong>lose Pflegebedürftige liegen rund10 Prozent höher als die Ausgaben für Pflegebedürftigemit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n (Borchert & Reimann 2004). Während Betroffenemit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n vor allem Pflegegeld <strong>in</strong> Anspruchnehmen und dieses an Familienangehörige, die Pflegeleisten, weitergeben, nutzen K<strong>in</strong><strong>der</strong>lose häufiger die teurerenSachleistungen.E<strong>in</strong>e Würdigung des generativen Beitrags, den Elternleisten, sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>facher, praktikabler und transparenter,wenn er bereichsübergreifend als Teil e<strong>in</strong>es steuerf<strong>in</strong>anziertenFamilienleistungs- und -lastenausgleichs <strong>in</strong> Forme<strong>in</strong>es pro K<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>heitlichen steuerf<strong>in</strong>anzierten Beitragszuschusseserfolgt (Schmähl & Rothgang 2004). Hierbeikann nicht nur die Anzahl <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>, son<strong>der</strong>n auch dief<strong>in</strong>anzielle Belastbarkeit <strong>der</strong> Familie berücksichtigt werden.Das Bundesverfassungsgericht hat <strong>der</strong> Regierungnicht nur die Prüfung <strong>der</strong> Pflegeversicherung, son<strong>der</strong>n allerSozialversicherungszweige auf Berücksichtigung vonErziehungsleistungen aufgetragen. Der Ausgleich überdas Steuersystem ersche<strong>in</strong>t vor diesem H<strong>in</strong>tergrund nichtnur am praktikabelsten, son<strong>der</strong>n würde auch – zumalwenn monetär familienbezogene Transfers <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Institution(„Familienkasse“) gebündelt werden – die Voraussetzungenfür familienpolitisches Handeln erhöhen(Schmähl 2005b).För<strong>der</strong>ung ehrenamtlichen EngagementsÄlter werdende und alte Menschen unterstützen nicht alle<strong>in</strong>Mitglie<strong>der</strong> ihrer Familie, son<strong>der</strong>n auch – jedoch <strong>in</strong>ger<strong>in</strong>gerem Umfang – Mitglie<strong>der</strong> ihres privaten Netzwerks.Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die Möglichkeiten dieser Formvon Unterstützung noch ke<strong>in</strong>eswegs ausgeschöpft. Dahersoll <strong>in</strong> diesem Unterabschnitt diskutiert werden, welcheMaßnahmen geeignet s<strong>in</strong>d, um das Unterstützungspotenzialälter werden<strong>der</strong> und alter Menschen <strong>in</strong> privaten Netzwerkenzu stärken. Hierbei zeigen sich auch deutlicheBerührungspunkte zu För<strong>der</strong>ung von Potenzialen des„bürgerschaftlichen Engagements“.61 Auch wenn nach Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts dasAusgleichserfor<strong>der</strong>nis zwischen K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehenden und K<strong>in</strong><strong>der</strong>losen<strong>der</strong> betroffenen Jahrgänge ke<strong>in</strong>e Rolle spielt. Die Menschen, die vor1940 geboren wurden, haben im ausreichenden Maß K<strong>in</strong><strong>der</strong> geborenund erzogen.Insbeson<strong>der</strong>e <strong>zur</strong> Unterstützung <strong>der</strong> Betreuung von demenziellerkrankten Pflegebedürftigen wäre es s<strong>in</strong>nvoll,die verschiedenen Formen von ehrenamtlich getragenemEngagement noch stärker als bisher zu för<strong>der</strong>n. Nach denErgebnissen <strong>der</strong> Erhebung von Infratest Sozialforschungnehmen nur ca. 11 Prozent <strong>der</strong> Pflegehaushalte freiwilligerbrachte Betreuungsleistungen, z.B. <strong>in</strong> Form von Besuchsdiensten<strong>in</strong> Anspruch (Schneekloth & Leven 2003).Es liegt auf <strong>der</strong> Hand, dass sich dieser Anteil noch deutlichsteigern ließe, wenn entsprechende Angebote vonden Leistungserbr<strong>in</strong>gern <strong>der</strong> Pflege bzw. im Bereich <strong>der</strong>offenen Altenhilfe <strong>in</strong> Zukunft noch stärker als bisher verfügbargemacht würden. Dies bedeutet aber auch, dass <strong>in</strong>nerhalbvon professionellen Leistungserbr<strong>in</strong>gern Raumfür Angebote bürgerschaftlichen Engagements zu schaffens<strong>in</strong>d.Örtliche Koord<strong>in</strong>ationsstellenHäufig ist die Bereitschaft für Engagement vorhanden,aber es fehlt an Informationen, wo e<strong>in</strong> Engagement möglichist. Dieses Aufgabe könnten örtliche Koord<strong>in</strong>ationsstellenerfüllen. Zu den Funktionen dieser örtlichen Koord<strong>in</strong>ationsstellen,die auch Aufgaben <strong>der</strong> Beratung vonhilfe- und pflegebedürftigen Menschen übernehmenkönnten, gehören die Koord<strong>in</strong>ation zwischen unterschiedlichenDiensten und Angeboten, die angemessene Schulungund Fortbildung ehrenamtlicher Betreuungskräftefür das jeweilige Betreuungsangebot und die Organisationund Information über soziale und kulturelle Angebote,die Mitarbeit an <strong>der</strong> Weiterentwicklung <strong>der</strong> Altenarbeit<strong>in</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Kommune und die För<strong>der</strong>ung dieKooperation <strong>der</strong> Dienstleistungsanbieter.6.5 HandlungsempfehlungenDie folgenden Empfehlungen zielen darauf ab, vorhandenePotenziale älter werden<strong>der</strong> Männer und Frauen <strong>in</strong>Familie und privaten Netzwerken zu erhalten und neuePotenziale <strong>in</strong> diesen Bereichen zu wecken und zu stärken.Dabei geht es <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e um die Unterstützung und denSchutz helfen<strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong>, die größere Sensibilisierungfür Bedürfnisse <strong>in</strong> unterschiedlichen Partnerschaftsformensowie gegenüber Konflikten <strong>in</strong> privatenPflegearrangements, um die Qualifizierung professionellerHelferstrukturen für Familien und die Schaffung vonRahmenbed<strong>in</strong>gungen für bürgerschaftliches Engagement.1 Die erweiterten Aufgaben von Familien wahrnehmenund diese neuen Leistungen anerkennen: Insbeson<strong>der</strong>eist die Tatsache zu würdigen, dass e<strong>in</strong> großer Anteil<strong>der</strong> <strong>in</strong>tergenerationalen Hilfen von den Älteren selbstgeleistet wird. Der Erhalt dieser Leistungen älter werden<strong>der</strong>Familien sollte u.a. durch die Erhöhung und vor allemDynamisierung des Pflegegeldes, aber auch durch dendifferenzierten Ausbau ambulanter Strukturen <strong>der</strong> professionellenPflege realisiert werden.2 Fragiler und vielfältiger werdende partnerschaftlicheLebensbezüge stützen: Diesen Verän<strong>der</strong>ungensollte durch angemessene professionelle UnterstützungsangeboteRechnung getragen werden, zugleich könntenneue Formen bürgerschaftlichen Engagements und <strong>der</strong>Selbsthilfe möglicherweise auftretende Unterstützungsdefizitekompensieren.3 Unterschiedliche Partnerschaftsformen anerkennen:Homosexuelle Partnerschaften sollten beim differenziertenAusbau von unterstützenden Systemen für das
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 197 – Drucksache 16/2190Leben im Alter mehr Aufmerksamkeit erhalten als bisher.Das bezieht sich auf die Entwicklung von spezifischenAngeboten auf dem Pflegemarkt, auf die Entwicklungkommunaler Strukturen sowie die Beachtung unterschiedlicherLebensformen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildungprofessioneller Helfer.4 Unterstützung zwischen alt werdenden Eltern un<strong>der</strong>wachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n sichern: Es besteht die Gefahr,dass das gegenwärtig noch feste Netz <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>ensolidaritätbrüchiger wird. Daraus resultierende Defizite<strong>der</strong> Hilfeleistungserbr<strong>in</strong>gung müssen entwe<strong>der</strong> durch bürgerschaftlichesEngagement o<strong>der</strong> durch professionelleambulante Hilfe aufgefangen werden. Nicht zuletzt bedeutetdies aber auch, dass das stationäre System <strong>der</strong>Hilfe und Unterstützung auf diese Entwicklungen reagierenmuss.5 Vere<strong>in</strong>barkeit von Familienarbeit „Pflege“ undErwerbsarbeit unterstützen: In den Betrieben muss e<strong>in</strong>Bewusstse<strong>in</strong> dafür geschaffen werden, dass Pflege undUnterstützung alter Familienmitglie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e neue Aufgabevon Familien ist. Die Ermöglichung dieser Aufgabebei gleichzeitigem Erhalt <strong>der</strong> Berufstätigkeit und e<strong>in</strong>esArbeitsverhältnisses ist zu för<strong>der</strong>n. Weiterh<strong>in</strong> müssen dieKommunen unterschiedliche Formen geme<strong>in</strong>schaftlichenWohnens unterstützen. Um Kapazitäten für die Vielfalt<strong>der</strong> <strong>in</strong>tergenerativen Hilfestellung zu schaffen, müssendie Strukturen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung geför<strong>der</strong>t werden.Nicht zuletzt müssen professionelle Helfer mehr als bislangfür die Zusammenarbeit mit familialen Strukturenausgebildet und geschult werden.6 Beziehung zwischen Großeltern und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>nstärken: Bei <strong>der</strong> Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>generation könnte dieE<strong>in</strong>sicht geför<strong>der</strong>t werden, dass das Wissen und die Erfahrungvon Großeltern auch für das eigene Leben vonBedeutung se<strong>in</strong> kann. E<strong>in</strong>richtung und För<strong>der</strong>ung vonWissensbörsen, Zeitzeugenbörsen und Kontaktstellenzwischen Großeltern- und Enkel-<strong>Generation</strong>, und zwarauch für Personen die nicht mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verwandt s<strong>in</strong>d,könnten den Austausch und den Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>enför<strong>der</strong>n.7 Private Hilfenetzwerke unterstützen und neueWohnformen entwickeln: U.a. sollten Kommunen Modellprojektedes geme<strong>in</strong>schaftlichen Wohnens för<strong>der</strong>no<strong>der</strong> bürgerschaftliches Engagement und die gegenseitigeSelbsthilfe anerkennen. Insbeson<strong>der</strong>e für demenziell erkrankteMenschen sollten Wohnmodelle stärker geför<strong>der</strong>twerden. Dafür muss es e<strong>in</strong>en festen Ansprechpartner <strong>in</strong>den Kommunen geben, und die Vorhaben müssen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Kommunalpolitik verankert werden.8 Professionelle Angebotsstrukturen an <strong>in</strong>dividuellenBedürfnissen von Pflegearrangements ausrichten:Leistungserbr<strong>in</strong>ger sollten ihre Angebote differenziertund zielgruppenspezifisch entwickeln und auf Bedürfnisseunterschiedlicher Nutzergruppen ausrichten. DieLeistungserbr<strong>in</strong>gung von pflegerischer, hauswirtschaftlicherund sonstiger Angebote sollte an den jeweiligen Beson<strong>der</strong>heitenund Bedürfnissen von Pflegearrangementsausgerichtet werden. Dabei sollte beson<strong>der</strong>es Augenmerkauf die Unterstützung von Pflegepersonen gerichtet werden.Mitarbeiter im Bereich <strong>der</strong> häuslichen Pflege, aberauch Angehörige <strong>der</strong> privaten Netzwerke sollten Konflikte,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> privaten Pflegearrangements, erkennenund <strong>der</strong>en Lösung unterstützen.9 Professionelle Angebote vernetzen und Beratungverbessern: Die Versorgung von hilfe- und pflegebedürftigenMenschen, die häufig auch chronisch und mehrfacherkrankts<strong>in</strong>d, sollte durch die Vernetzung von Angeboten<strong>der</strong> Altenhilfe und des Gesundheitswesens verbessertwerden. Dabei sollten stets die Belange und Bedürfnissevon Pflegepersonen aus dem familialen und privatenNetzwerk berücksichtigt werden. E<strong>in</strong> Instrument <strong>zur</strong> besserenVernetzung sollten personengebundene Pflegebudgetsse<strong>in</strong> – allerd<strong>in</strong>gs unter <strong>der</strong> Voraussetzung von Case-Management-Strukturen. Die Beratung pflegebedürftigerund pflegen<strong>der</strong> Menschen kann beispielsweise durch dieVernetzung und Koord<strong>in</strong>ation bereits bestehen<strong>der</strong> Angebote,durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit sowie durchden E<strong>in</strong>satz mo<strong>der</strong>ner Kommunikations- und Informationstechnologienverbessert werden. Dabei ist die Unabhängigkeitvon Beratung sicherzustellen. Die Verantwortungfür die Vernetzung bestehen<strong>der</strong> Beratungsangebotesowie <strong>der</strong>en Qualitätskontrolle liegt bei den Kommunen.10 Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engagementsbei Reformen <strong>der</strong> Versorgungssysteme fürältere und alte Menschen: Die Kooperation von professioneller,ehrenamtlicher und familiärer Hilfe und dieFör<strong>der</strong>ung von gemischten Hilfearrangements muss <strong>in</strong>Zukunft gestärkt werden, die Ermöglichung gemischterHilfearrangements sollte systematisch geför<strong>der</strong>t werden.Die Gew<strong>in</strong>nung und E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von bürgerschaftlich engagiertenHelfer<strong>in</strong>nen und Helfern <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für Betreuungsaufgabensowie <strong>der</strong>en rechtliche, fachliche undorganisatorische Unterstützung sollte verbessert werden.Die Informations- und Kontaktstellen für engagierte undengagementbereite Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger müssen stärkerausgebaut und die bestehenden Institutionen langfristigabgesichert werden. Bestehende Seniorenbüros, Freiwilligenagenturenund Selbsthilfekontaktstellen solltenbesser mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> vernetzt bzw. <strong>in</strong> diesem Bemühen unterstütztwerden.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 199 – Drucksache 16/21907 Engagement und Teilhabe älterer Menschen7.1 E<strong>in</strong>leitung7.1.1 Zeit für e<strong>in</strong>e ZwischenbilanzBereits seit Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> 1980er-Jahre stehen die aktiveTeilhabe und das freiwillige/ehrenamtliche Engagementälterer Menschen auf <strong>der</strong> zivilgesellschaftlichen und politischenAgenda. Dies dokumentiert sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fülle anwissenschaftlicher Begleitliteratur zu entsprechendenPraxis- und Modellprojekten wie auch an spezifischenStudien und Expertisen <strong>zur</strong> Form und Verbreitung ehrenamtlicherund partizipativer Aktivitäten im Alter. In den1990er-Jahren fand mit <strong>der</strong> Tätigkeit <strong>der</strong> Altenberichtskommissionenund <strong>der</strong> beiden Enquete-Kommissionen„Demografischer Wandel“ und „Zukunft des bürgerschaftlichenEngagements“ e<strong>in</strong>e weitere Intensivierung<strong>der</strong> Diskussion statt. Im Kontext dieser Debatten wurdenvom Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauenund Jugend (BMFSFJ) zwei große repräsentative Studien<strong>in</strong> Auftrag gegeben, die vielfältige empirische Daten undErkenntnisse erbrachten und jeweils bereits e<strong>in</strong>mal wie<strong>der</strong>holtwurden: die beiden Alterssurveys von 1996 und2002 sowie die Freiwilligensurveys von 1999 und 2004.Die empirischen Teile dieses Kapitels beruhen im Wesentlichenauf diesen grundlegenden Erhebungen.Die bisher unterstützten und geför<strong>der</strong>ten Modellprojekteund Initiativen erstrecken sich auf viele Bereiche <strong>der</strong>Altenhilfe und -politik und können hier <strong>in</strong> ihrer Reichhaltigkeitnicht wie<strong>der</strong>gegeben werden. Allerd<strong>in</strong>gs stehtdieser Vielfalt an Projekten – von Seniorengenossenschaftenund Seniorenbüros über Nachbarschaftshilfeund ehrenamtlicher Mitarbeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altenhilfe bis h<strong>in</strong><strong>zur</strong> Begegnung <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en und <strong>der</strong> Weitergabevon Erfahrungswissen – e<strong>in</strong>e noch unterentwickelteÜberprüfung ihrer Nachhaltigkeit entgegen. Immer nochmangelt es an e<strong>in</strong>er strukturellen Verankerung und flächendeckendenUmsetzung bewährter Modelle (wie imFalle <strong>der</strong> Seniorenbüros) sowie an e<strong>in</strong>er kont<strong>in</strong>uierlichenBestandsaufnahme und wissenschaftlichen Evaluation<strong>der</strong> vielfältigen Projekte und Initiativen. WenigeÜberblicke gibt es vor allem <strong>zur</strong> quantitativen Verbreitung(aktuell und im zeitlichen Verlauf) und <strong>zur</strong> materiellenund rechtlichen Verankerung <strong>der</strong> Modellprojekte.Exemplarische Beschreibungen e<strong>in</strong>zelner Projekte alsVorzeigemodelle e<strong>in</strong>er „guten Praxis“ s<strong>in</strong>d zwar e<strong>in</strong> ersterwichtiger Schritt, reichen aber nicht aus. E<strong>in</strong>e wichtigeZukunftsaufgabe, die auf Grund des fehlenden Datenmaterialshier noch nicht geleistet werden kann, istdie systematische Evaluation <strong>der</strong> geför<strong>der</strong>ten Projekte,die fundierte Auskünfte über ihre Erfolgschancen undMisserfolgsrisiken geben kann.7.1.2 Potenziale und gesellschaftlicheErwartungenDie öffentliche Debatte um das Engagement und die Teilhabeälterer und alter Menschen hat <strong>in</strong> den letzten Jahrene<strong>in</strong>e deutliche Akzentverschiebung erfahren. Stand langeZeit die Sorge um die mangelnde soziale E<strong>in</strong>bettung vonMenschen im Alter bzw. beson<strong>der</strong>er Risikogruppen <strong>in</strong>nerhalb<strong>der</strong> älteren Bevölkerung im Mittelpunkt des Interesses,so richtet sich die Aufmerksamkeit heute stärkerdarauf, wie die Leistungspotenziale älterer Menschen von<strong>der</strong> Gesellschaft nachgefragt werden können. Diese Akzentverschiebungwird sowohl durch den demografischenWandel als auch den Umbau des Sozialstaats und die damitverbundene Leitidee des aktivierenden Sozialstaats,aber auch durch die Diskussion um bürgerschaftlichesEngagement argumentativ forciert. Gleichwohl bleibt diesoziale Integration älterer Menschen angesichts wie<strong>der</strong>steigen<strong>der</strong> Exklusions- und Armutsrisiken im Lebenslauf(und damit auch im Alter) e<strong>in</strong> wichtiges Zukunftsthema(siehe das Kapitel „E<strong>in</strong>kommenslage im Alter“). Verursachtwerden diese Altersrisiken durch die sich heuteschon abzeichnende mangelhafte soziale Alterssicherunge<strong>in</strong>er großen Anzahl von alle<strong>in</strong> erziehenden Frauen, wie<strong>der</strong>holtbzw. dauerhaft Arbeitslosen und ger<strong>in</strong>gfügigBeschäftigten. Diese Gefährdungslagen werden noch verschärftdurch die aktuellen Arbeitsmarktreformen mit ihrenZwängen zum vorzeitigen Entsparen von Vermögenswerten.Die komplementären Sichtweisen auf dieLebensphase Alter – die klassische Risiko- und Gefährdungsperspektivee<strong>in</strong>erseits, die „neuere“ Potenzial- undRessourcenperspektive an<strong>der</strong>erseits – sollten daher nichtgegene<strong>in</strong>an<strong>der</strong> ausgespielt werden, auch wenn im Folgendenstärker die sozial produktiven Seiten des Alter(n)s beleuchtetwerden.Das gesellschaftliche und politische Interesse am ehrenamtlichenEngagement <strong>der</strong> Älteren kommt nicht von ungefähr.Vielmehr verb<strong>in</strong>den sich mit diesem Thema vielfältigeund zum Teil auch wi<strong>der</strong>sprüchliche Hoffnungenund Erwartungen an e<strong>in</strong>e bessere „Nutzung“ <strong>der</strong> „Alterspotenziale“,nicht nur im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Verbesserung <strong>der</strong>Lebensqualität <strong>der</strong> Älteren selbst. In diesem Kontext istimmer wie<strong>der</strong> vom „sozialen Kapital“ <strong>der</strong> Älteren dieRede, und zwar meist im S<strong>in</strong>ne des Nutzens sozialer Vernetzungfür die Gesellschaft als Ganzes, als Beitrag <strong>zur</strong>Lösung ihrer Probleme (Putnam 1993, 1995). Vorangetriebenwird diese Debatte um mehr Engagement im Ruhestandzunächst von den im historischen Vergleich sehrguten Voraussetzungen, die ältere und alte Menschenheute aufweisen. H<strong>in</strong>gewiesen sei nur auf die gestiegeneund weiter steigende Lebenserwartung, auf höhere Bildungund mehr Möglichkeiten <strong>der</strong> sozialen Vernetzung
Drucksache 16/2190 – 200 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeund E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung, auf bessere gesundheitliche Voraussetzungensowie auf e<strong>in</strong>e verbesserte F<strong>in</strong>anzausstattung imAlter.Unterstützende Beiträge <strong>zur</strong> Bewältigung gesellschaftlicherProbleme und entsprechen<strong>der</strong> Aufgaben durch e<strong>in</strong>eAufwertung und För<strong>der</strong>ung des freiwilligen Engagementsund <strong>der</strong> Teilhabe an bürgerschaftlichem Engagement werden<strong>in</strong> verschiedenen gesellschaftspolitischen Handlungsbereichengesehen. In <strong>der</strong> Debatte um die Reform des Sozialstaatswird gleich <strong>in</strong> mehrerer H<strong>in</strong>sicht auf dasunentgeltliche Engagement – nicht nur <strong>der</strong> Älteren – gesetzt.Die Erwartungen reichen hier von e<strong>in</strong>er f<strong>in</strong>anziellenEntlastung <strong>der</strong> sozialen Sicherungssysteme über die Erhöhung<strong>der</strong> Zielgenauigkeit öffentlicher Leistungserbr<strong>in</strong>gungbis h<strong>in</strong> <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Effektivität und Leistungsqualitätsozialer E<strong>in</strong>richtungen und Dienste durchden systematischen E<strong>in</strong>bezug bürgerschaftlicher Beiträge(z.B. <strong>in</strong> stationären E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Altenhilfe, Krankenhäuserno<strong>der</strong> ambulanten Diensten). Gleichzeitigzeigt die Forschung, dass ältere Menschen schon heute <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em erheblichen Ausmaß geme<strong>in</strong>wohlorientiert engagierts<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>iges deutet aber darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>in</strong> allenAltersgruppen, und damit auch bei den Älteren, noch weiterePotenziale für gesellschaftliches Engagement vorhandens<strong>in</strong>d. Von welcher Qualität und Quantität diesePotenziale s<strong>in</strong>d und wie diese gesellschaftlich geför<strong>der</strong>twerden können, darauf versucht das Kapitel e<strong>in</strong>e Antwortzu geben. Allerd<strong>in</strong>gs sollte beachtet werden, dassengagierte ältere Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger nicht als „Lückenbüßer“für sozialstaatliche Defizite <strong>in</strong>strumentalisiertund ihre Leistungspotenziale nicht als gesellschaftlichfrei verfügbare Ressourcen, die <strong>zur</strong> möglichst vollständigen„Ausschöpfung“ bereitstehen, missbrauchtwerden.7.1.3 Aufbau des KapitelsIn diesem Kapitel wird nach den Möglichkeiten gefragt,wie ältere Menschen sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Gesellschaftfür das Geme<strong>in</strong>wohl engagieren können, welche qualitativenVerän<strong>der</strong>ungen dieses Engagement erfahren wirdo<strong>der</strong> erfahren sollte, welche strukturellen Faktoren undsozialen Unterschiede e<strong>in</strong>e solche aktive Teilhabe för<strong>der</strong>no<strong>der</strong> beh<strong>in</strong><strong>der</strong>n und welche konkreten Maßnahmen undGestaltungsempfehlungen <strong>zur</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung aus<strong>der</strong> Betrachtung abgeleitet werden können. Der Schwerpunktliegt damit auf nachberuflichen Betätigungsfel<strong>der</strong>nim Alter, die „produktiv“, „öffentlich“ und „geme<strong>in</strong>wohlorientiert“s<strong>in</strong>d – im Gegensatz zu „konsumtiven“, „privaten“o<strong>der</strong> „berufsnahen“ Aktivitätsbereichen (Kohli &Künemund 1997). Beson<strong>der</strong>s hervorgehoben werden dieBeziehungen zwischen den <strong>Generation</strong>en, regionale Differenzenzwischen Ost- und Westdeutschland und vorallem die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Zugangzum ehrenamtlichen Engagement – denn Frauenund Männer s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong>, während des gesamten Lebensverlaufsbis <strong>in</strong>s Alter, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er hierarchisch strukturiertenWeise auf unterschiedliche Engagementformenverteilt (Backes 1987; 2000).In Abschnitt 7.2 werden qualitative Entwicklungen imBereich des bürgerschaftlichen bzw. freiwilligen Engagementsälterer Menschen betrachtet. Zunächst werden allgeme<strong>in</strong>eTrends im Feld des bürgerschaftlichen Engagementsdargestellt. Anschließend werden die spezifischenEngagementfel<strong>der</strong>, <strong>in</strong> denen überwiegend ältere Menschenaktiv s<strong>in</strong>d bzw. <strong>der</strong>en Leistungen sich an dieZielgruppe <strong>der</strong> älteren Menschen richten, genauer untersucht.In Abschnitt 7.3 werden aktuelle statistische Daten undempirische Forschungsbefunde zum freiwilligen Engagementälterer Menschen diskutiert und <strong>in</strong>terpretiert. AusgewählteTabellen und Kennziffern sollen e<strong>in</strong>en verdichtetenÜberblick über die Teilhabe an verschiedenenEngagementformen, über die Potenziale des Ehrenamts,über dessen sozial ungleiche Verteilung sowie über ZuundAbgangsmobilität im Ehrenamt geben. Entlang <strong>der</strong>Leitfrage nach <strong>der</strong> „Produktivität im Alter“ wird e<strong>in</strong> weiterführendesFazit gezogen.Abschnitt 7.4 widmet sich <strong>der</strong> altenpolitischen Zielformulierungund <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> qualitativen und quantitativen<strong>Lage</strong>befunde. Zunächst werden die Ziele <strong>der</strong>Kommission für e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>politik des bürgerschaftlichenEngagements im Alter erläutert sowie die Wertvorstellungen,von denen ausgehend die Kommission ihreAnalyse und Empfehlungen entwickelt hat, expliziert.Danach folgt e<strong>in</strong>e kritische Diskussion <strong>der</strong> normativenAmbivalenzen und gesellschaftlichen Wi<strong>der</strong>sprüche, diemit dieser gezielten Engagementför<strong>der</strong>ung verbundens<strong>in</strong>d.In Abschnitt 7.5 werden auf Basis <strong>der</strong> empirischen Analyseund <strong>der</strong> genannten Ziele Anfor<strong>der</strong>ungen formuliert,denen politische Maßnahmen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ungfür ältere Menschen aus Sicht <strong>der</strong> Kommission genügensollten. Nach e<strong>in</strong>er Reflexion über neue Wege <strong>der</strong> Erprobungund Erforschung von beispielhaften Projekten werdenwichtige Maßnahmen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung und Unterstützungdes freiwilligen Engagements älterer Menschengenannt.In Abschnitt 7.6 werden als Schlussfolgerungen aus denvorhergehenden Ausführungen konkrete Handlungsempfehlungenfür die Akteure im Feld <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ungabgeleitet.7.2 Neuere Entwicklungen beim bürgerschaftlichenEngagement ältererMenschenSpätestens seit dem <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Enquete-Kommission„Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ (2002)prägt <strong>der</strong> Begriff des „bürgerschaftlichen Engagements“die e<strong>in</strong>schlägigen Diskussionen. Es lassen sich neben e<strong>in</strong>erengeren Begriffsfassung (bürgerschaftliches Engagementals Beitrag zum politischen Geme<strong>in</strong>wesen) immerstärker auch weitergefasste Bedeutungsversionen erkennen.Begrifflichkeiten wie Ehrenamt, Selbsthilfe, politischePartizipation, aber auch freiwillige soziale Tätigkei-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 201 – Drucksache 16/2190ten werden <strong>in</strong> den Begriff des bürgerschaftlichenEngagements aufgenommen, mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verknüpft und<strong>in</strong>sofern auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en neuen konzeptionellen Zusammenhanggestellt (He<strong>in</strong>ze & Olk 2001). Er fungiert als e<strong>in</strong>eArt von Sammel- und Oberbegriff für e<strong>in</strong> breites Spektrumunterschiedlicher Formen und Spielarten unbezahlter,freiwilliger und geme<strong>in</strong>wohlorientierter Aktivitäten,denen man häufig auch e<strong>in</strong>en Selbsthilfecharakter zum<strong>in</strong>destimplizit zuschreibt. Die eigentümliche „Produktivität“<strong>der</strong> Kategorie des bürgerschaftlichen Engagementsrührt wohl daher, dass sie <strong>in</strong> mehrerer H<strong>in</strong>sicht „Brückenschlägt“. Es werden nicht nur sonst überwiegend getrenntdiskutierte historische und aktuelle Erfahrungen sowieordnungspolitische Leitbil<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en neuen Gesamtzusammenhanggestellt, son<strong>der</strong>n es wird auch auf <strong>der</strong>empirischen Ebene e<strong>in</strong> breites Spektrum von sche<strong>in</strong>bardisparaten Handlungsformen und Tätigkeiten zusammengefasst.Die Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichenEngagements“ hat sich <strong>in</strong> ihrem <strong>Bericht</strong> ausführlich<strong>der</strong> Darlegung e<strong>in</strong>es „qualifizierten“ Begriffs des bürgerschaftlichenEngagements gewidmet. BürgerschaftlichesEngagement charakterisiert sich danach als a) freiwillig,b) nicht auf materiellen Gew<strong>in</strong>n ausgerichtet, c) geme<strong>in</strong>wohlorientiert,d) öffentlich bzw. im öffentlichen Raumstattf<strong>in</strong>dend, und wird e) <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel geme<strong>in</strong>schaftlich/kooperativ ausgeübt. Im Alter spielen darüber h<strong>in</strong>aus solcheEngagementformen e<strong>in</strong>e Rolle, die auf die Aufrechterhaltung<strong>der</strong> gesellschaftlichen Integration älterer und alterMenschen und auf <strong>der</strong>en Autonomie zielen, wie diesz.B. kollektive Selbsthilfeaktivitäten bewirken können.Die Qualifizierung e<strong>in</strong>es Engagements als spezifisch„bürgerschaftliches“ liegt dann vor, wenn die Agierenden<strong>in</strong> ihrer Eigenschaft als Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger handelnund ihre Motivation durch „Mitverantwortung für an<strong>der</strong>eund Sensibilität für Anfor<strong>der</strong>ungen des Geme<strong>in</strong>wesensgekennzeichnet“ ist (Enquete-Kommission „Zukunft desbürgerschaftlichen Engagements“ 2002: 152).Zunächst sollen kurz e<strong>in</strong>ige allgeme<strong>in</strong>e Trends <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklungdes bürgerschaftlichen Engagements skizziertwerden, von denen auch das Engagement von und fürMenschen im Alter betroffen ist. Im Anschluss daranwerden e<strong>in</strong>ige Beson<strong>der</strong>heiten dieses Engagementfeldesbeleuchtet.7.2.1 Allgeme<strong>in</strong>e Trends im Feld „bürgerschaftlichesEngagement“Es ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass <strong>der</strong> schon häufig beschriebeneProzess <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung des bürgerlichenEngagements weiterh<strong>in</strong> voranschreitet (He<strong>in</strong>ze & Olk2001). Er umfasst m<strong>in</strong>destens drei Dynamiken, die aberfür die Gruppe älterer und alter Menschen zum Teilweniger stark ausgeprägt s<strong>in</strong>d, als bisher angenommenwurde:Pluralisierung des bürgerschaftlichen Engagements. E<strong>in</strong>Aspekt des Wandels ist, dass neben den klassischen Formendes Engagements <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>, Partei o<strong>der</strong> Verband an<strong>der</strong>eFormen und Zusammenschlüsse h<strong>in</strong>zugetreten s<strong>in</strong>d.Insbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den Bereichen Ökologie und Kultur,Schule, K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten, Gesundheit, Geschlechterpolitiksowie im sozialen Nahbereich (z.B. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nachbarschaftshilfe)macht <strong>der</strong> <strong>Bericht</strong> neue <strong>in</strong>formelle Formen<strong>der</strong> Organisation des bürgerschaftlichen Engagementsaus. Dies bedeutet jedoch nicht die Verdrängung o<strong>der</strong>Ablösung „alter“ Organisationsformen. Das „klassische“Ehrenamt wird <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den höheren Altersgruppennach wie vor gegenüber den neuen Formen vorgezogen.Individualisierung des bürgerschaftlichen Engagements.Das Engagement wird heute unabhängiger von traditionellenB<strong>in</strong>dungen gestaltet als früher. Soziale und regionaleHerkunft sowie geschlechtsspezifische und familiäreRollen entwickeln e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Bedeutung und B<strong>in</strong>dungskraftfür die Auswahl <strong>der</strong> Organisationsformen undBereiche, <strong>in</strong> denen bürgerschaftliches Engagement realisiertwird. „Ob und wo sich Senior<strong>in</strong>nen und Senioren engagieren,hat weniger mit dem Lebensabschnitt Alter,son<strong>der</strong>n mehr mit <strong>der</strong> Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>em bestimmtensozialen und kulturellen Milieu im Lebensverlauf zutun“ (Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichenEngagements“ 2002: 213).Motivwandel beim bürgerschaftlichen Engagement.Wenn <strong>der</strong> Antrieb <strong>zur</strong> Aufnahme o<strong>der</strong> Weiterführung e<strong>in</strong>esEngagements i.d.R. auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bündel von Motivenliegt, so hat die Forschung <strong>der</strong> vergangenen Jahredoch e<strong>in</strong>ige Trends aufgezeigt. Es existiert e<strong>in</strong> Motivwandelvon altruistischen Motiven h<strong>in</strong> zu eher ereignis-,spaß- und selbstverwirklichungsbezogenen Motiven.Neuere Forschungsarbeiten weisen aber auch auf an<strong>der</strong>e<strong>in</strong>dividuelle Nutzen e<strong>in</strong>es Engagements h<strong>in</strong>, das z.T. alsInvestition <strong>in</strong> die eigene Zukunft durch die Erhöhung von„Reputation“ verstanden werden kann (Erl<strong>in</strong>ghagen2003). Die neuen Motive vertragen sich durchaus mit e<strong>in</strong>erstark geme<strong>in</strong>wohlbezogenen Haltung. „Das Engagementwird dabei zu e<strong>in</strong>em Ort, bei dem Selbstbezug undGeme<strong>in</strong>wohlorientierung e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>gehen, diesowohl für die <strong>in</strong>dividuelle Lebensführung und S<strong>in</strong>nkonstruktionals auch für die gesellschaftliche Entwicklungund den Zusammenhalt von zentraler Bedeutung s<strong>in</strong>d“(Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichenEngagements“ 2002: 122).Auf <strong>der</strong> politischen Ebene hat es <strong>in</strong> den letzten Jahrene<strong>in</strong>e Reihe von Maßnahmen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichenEngagements und des Diskurses darüber gegeben.Das <strong>in</strong>ternationale Jahr <strong>der</strong> Freiwilligen 2001, dieUntersuchung „Freiwilligensurvey“ und beson<strong>der</strong>s dieEnquete-Kommission haben das Wissen über das bürgerschaftlicheEngagement enorm vermehrt. Nicht zuletztwurde dadurch Engagement <strong>in</strong>itiiert und die Vernetzung<strong>der</strong> Akteure geför<strong>der</strong>t. Daraus haben sich neue Akteur<strong>in</strong>nenund Akteure im Feld <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichenEngagements gebildet. Zu nennen s<strong>in</strong>d aufBundesebene <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e das Bundesnetzwerk BürgerschaftlichesEngagement (BBE), das die nachhaltige För<strong>der</strong>ungvon Bürgergesellschaft und bürgerschaftlichem
Drucksache 16/2190 – 202 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeEngagement <strong>in</strong> allen Gesellschafts- und Politikbereichenzum Ziel hat. Das Netzwerk umfasst nach eigenenAngaben national bedeutende Trägerorganisationen, zivilgesellschaftlicheAkteure <strong>der</strong> Freiwilligenarbeit undSelbsthilfe, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgeme<strong>in</strong>schaften,Bund, Län<strong>der</strong> und Kommunen, Wirtschaftsverbändeund Unternehmen sowie Gewerkschaftenund Medien. Auch im Deutschen Bundestag ist dasThema – nachdem die Enquete-Kommission „Zukunftdes bürgerschaftlichen Engagements“ ihre Arbeit beendethat – weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong>stitutionell verankert. Für die Dauer <strong>der</strong>15. Legislaturperiode wurde e<strong>in</strong> Unterausschuss „BürgerschaftlichesEngagement“ e<strong>in</strong>gesetzt, <strong>der</strong> die Umsetzung<strong>der</strong> Beschlüsse <strong>der</strong> Enquete-Kommission „BürgerschaftlichesEngagement“ vorantreiben und an Gesetzesvorhaben,die das bürgerschaftliche Engagement betreffen, mitwirkensoll.Die Enquete-Kommission verweist darauf, dass die För<strong>der</strong>ungdes bürgerschaftlichen Engagements e<strong>in</strong>e politischeQuerschnittsaufgabe darstellt. E<strong>in</strong> wesentlichesElement <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Bürgergesellschaft und desbürgerschaftlichen Engagements liegt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schaffungbeteiligungsfreundlicher Institutionen. Für engagierteMenschen und für die an e<strong>in</strong>em Engagement Interessiertenliegt e<strong>in</strong>e starke Motivation <strong>in</strong> dem Wunsch, ihre Umweltverantwortlich mitzugestalten. Damit s<strong>in</strong>d öffentlicheE<strong>in</strong>richtungen und kommunale Verwaltungengefor<strong>der</strong>t, aber auch Vere<strong>in</strong>e und Verbände aufgerufen,sich gegenüber dem lokalen Umfeld zu öffnen und vonBürger<strong>in</strong>nen und Bürgern angestoßene Verän<strong>der</strong>ungsprozessenicht zu blockieren.Das Thema „Anerkennungskultur“ nimmt e<strong>in</strong>e herausragendeStellung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Diskussion <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung desEngagements e<strong>in</strong>. Die Anerkennung und Wertschätzungdes <strong>in</strong>dividuellen Engagements gehört zu den wichtigstenMöglichkeiten, bürgerschaftliches Engagement zu stimulierenund Menschen <strong>zur</strong> Aufrechterhaltung e<strong>in</strong>es begonnenenEngagements zu bewegen. Dazu kann aufmaterielle wie immaterielle Formen <strong>der</strong> Anerkennung <strong>zur</strong>ückgegriffenwerden. Gerade von älteren und alten Menschenwerden immaterielle Anreize, wie Auszeichnungenund Ehrungen, die Würdigung durch <strong>Bericht</strong>erstattung <strong>in</strong>den Medien, „Dankeschön-Veranstaltungen“ von Kommuneno<strong>der</strong> e<strong>in</strong>fache Danksagungen im Alltag, häufigwichtiger e<strong>in</strong>geschätzt als geldwerte Anerkennungsformen.Die Rolle von Weiterbildungsmaßnahmen als Anerkennungsformkann dabei kaum überschätzt werden. Insbeson<strong>der</strong>efür ältere Frauen stellt die Möglichkeit, sichweiterzubilden und etwas Neues jenseits des bislang Gewohntenund Praktizierten zu lernen, e<strong>in</strong> wichtiges Motivfür ihr Engagement dar, während Männer stärker den E<strong>in</strong>satzund die Weitergabe eigener Kompetenzen aus demBerufsleben <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>grund stellen. Sowohl die Initiativen,Vere<strong>in</strong>e und Verbände als auch Kommunen, Län<strong>der</strong>und <strong>der</strong> Bund können jeweils e<strong>in</strong>en eigenen Beitrag<strong>zur</strong> Anerkennungskultur leisten (vgl. dazu ausführlichden Endbericht <strong>der</strong> Enquete-Kommission „Zukunft desbürgerschaftlichen Engagements“).In den Debatten zum bürgerschaftlichen Engagementwird auch die Rolle <strong>der</strong> Unternehmen zunehmend wichtiger.Mittelständische Unternehmen und Großunternehmenhaben vor allem im Rahmen lokaler und regionalerUnterstützungen und Kooperationen mit zivilgesellschaftlichenGruppen und Organisationen, Initiativen,Vere<strong>in</strong>en (z.B. Sport-, Kultur-, Bildungs- und Heimatvere<strong>in</strong>e),Verbänden (z.B. Umwelt- und Sozialverbände)sowie mit Kommunen und kommunalen Institutionen(K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten, Schulen, Museen, Bibliotheken etc.) Aktivitäten<strong>in</strong> Richtung Bürgerschaft entwickelt. Im Zuge <strong>der</strong>Internationalisierung und Globalisierung <strong>der</strong> Wirtschaftstätigkeitenund <strong>der</strong> Organisations-, Produktions- undDienstleistungsstrukturen sowie <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationalen Besetzungvon Geschäftsführungen, Vorständen und Aufsichtsräten,hat sich <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten e<strong>in</strong> deutlicherTrend <strong>zur</strong> Stärkung bürgerschaftlichen Engagements<strong>in</strong> den Unternehmen vollzogen. Angeregt durch die Praxisvon „Corporate Citizenship“ und „Corporate Volunteer<strong>in</strong>g“<strong>in</strong> den USA und den skand<strong>in</strong>avischen Län<strong>der</strong>n,Großbritannien, den Nie<strong>der</strong>landen und <strong>der</strong> Schweiz unddurch die hier erzielten Erfolge e<strong>in</strong>er besseren Verankerung<strong>der</strong> Unternehmen <strong>in</strong> ihrem lokalen und regionalengesellschaftlichen Umfeld, hat sich nunmehr auch <strong>in</strong>Deutschland die Diskussion über die Rolle von Unternehmen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bürgergesellschaft und die Notwendigkeit e<strong>in</strong>esstärkeren bürgerschaftlichen Engagements verstärkt.Dabei wird mehr als früher <strong>der</strong> Nutzen für das Unternehmenhervorgehoben und auf die möglichen geme<strong>in</strong>samenGew<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Unternehmen, <strong>der</strong> Mitarbeiter und <strong>der</strong> Gesellschaftals Ganzes verwiesen.Auch die Rolle von Stiftungen als Beitrag zum bürgerschaftlichenEngagement <strong>in</strong> Deutschland ist <strong>in</strong> den letztenJahren stärker <strong>in</strong>s Blickfeld <strong>der</strong> Öffentlichkeit gelangt.Derzeit existieren nach Angaben des BundesverbandesDeutscher Stiftungen 12.940 rechtsfähige Stiftungen desbürgerlichen Rechts. „Schätzungen gehen von e<strong>in</strong>em Gesamtkapitalvon 50 – 60 Milliarden Euro aus. Dabei istdie Verteilung sehr ungleich, so vere<strong>in</strong>en etwa die zehngrößten privaten Stiftungen ca. 16 Milliarden Euro aufsich. Das Vermögen <strong>der</strong> meisten Stiftungen liegt jedochunter 500.000 Euro“ (Deutschland aktiv 2004). In diesenStiftungen engagieren sich auch viele ältere Menschen;sie s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> größer werden<strong>der</strong> Kristallisationskern für bürgerschaftlichesEngagement (etwa im Wohnumfeld und<strong>in</strong> kulturellen Projekten).7.2.2 Entwicklungen im Feld des bürgerschaftlichenEngagements vonund für ältere MenschenNeben den oben genannten allgeme<strong>in</strong>en Trends bee<strong>in</strong>flussene<strong>in</strong>ige spezifische Entwicklungen das Feld desEngagements von o<strong>der</strong> für Menschen im Alter. Zunächstist festzustellen, dass im Diskurs über die För<strong>der</strong>ung desfreiwilligen Engagements <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> so genanntenjungen Alten e<strong>in</strong>e herausgehobene Stellung zukommt, dadort große Potenziale <strong>der</strong> Aktivierung von Engagementgesehen werden. E<strong>in</strong>ige <strong>der</strong> oben genannten Programme
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 203 – Drucksache 16/2190nennen trotz e<strong>in</strong>er altersgruppenübergreifenden Ausrichtungältere Menschen explizit als Zielgruppe für aktivierendeMaßnahmen. Es gab und gibt auch politischeMaßnahmen, die e<strong>in</strong>en altersspezifischen Ansatz <strong>der</strong>Engagementför<strong>der</strong>ung verfolgen.Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissenfür Initiativen“ (EFI)Durch das Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissenfür Initiativen“ (EFI) hat das Konzept des Erfahrungswissens<strong>in</strong> <strong>der</strong> Diskussion zum spezifischen bürgerschaftlichenEngagement älterer Menschen an Bedeutung gewonnen.Das EFI-Programm läuft von 2002 bis zum Jahr2006 und wird vom BMFSFJ <strong>in</strong> Kooperation mit zehnBundeslän<strong>der</strong>n durchgeführt. Im Modellprogramm wirddavon ausgegangen, dass ältere Menschen gegenüber an<strong>der</strong>enAltersgruppen über e<strong>in</strong> höheres Maß an spezifischen„Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, Gebrauchswissen,Urteilskraft o<strong>der</strong> Erfahrungen“ verfügen,die sie im Lebenslauf erworben haben. Um dieses Erfahrungswissenaber adressatengerecht weitergeben zu können,sieht das Programm die Schulung und Ausbildung<strong>der</strong> Älteren zu so genannten Seniortra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen und -tra<strong>in</strong>ernvor. Die Ziele des Programms liegen auf mehrerenEbenen. Zum e<strong>in</strong>en soll mit dem Angebot „Seniortra<strong>in</strong>erIn“älteren Menschen neue Formen verantwortungsvollergesellschaftlicher Teilhabe und Mitgestaltung eröffnetbzw. aufgezeigt werden. Diese Zielstellung knüpft an <strong>der</strong>Erkenntnis an, dass trotz <strong>der</strong> starken Verlängerung <strong>der</strong>Lebensphase Alter <strong>in</strong> <strong>der</strong> jüngeren Vergangenheit ke<strong>in</strong>everallgeme<strong>in</strong>erbaren „Verantwortungsrollen“ entstandens<strong>in</strong>d. Das Modellprogramm hat deshalb auch die För<strong>der</strong>unge<strong>in</strong>es positiven Altersbildes <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft alsZiel, da e<strong>in</strong> positives Altersbild als Voraussetzung für dieNachfrage und Nutzung von Leistungspotenzialen ältererMenschen durch die Gesellschaft gesehen wird. Beispielhaftsoll am SeniorTra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen-Engagement die Leistungsfähigkeit<strong>der</strong> Älteren <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit bewusstgemacht werden. Mit <strong>der</strong> Weiterbildungsmöglichkeit zumSeniortra<strong>in</strong>er sollen Ältere für e<strong>in</strong> Engagement motiviertwerden und <strong>in</strong> ihrer Rolle als Expert<strong>in</strong>nen und Expertenwie<strong>der</strong>um Engagement <strong>in</strong>itiieren, an<strong>der</strong>e ältere Menschendazu motivieren und <strong>in</strong> Engagementfragen unterstützen.E<strong>in</strong> wichtiger Teil ist die Entwicklung von Curricula fürdie Tra<strong>in</strong>erschulungen, die darauf zielen, das bei den Seniortra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nenund -tra<strong>in</strong>ern vorhandene Erfahrungswissenbewusst und für die praktische Nutzung reflexivzu machen sowie Methodenwissen für dessen Vermittlungim Kontext von Freiwilligenorganisationen und Initiativenzu lehren. Die Teilnehmer<strong>in</strong>nen und Teilnehmerdes Seniortra<strong>in</strong>erprogramms verfügen über e<strong>in</strong>e überdurchschnittlicheschulische und berufliche Bildung, rund60 Prozent <strong>der</strong> Teilnehmenden haben Abitur o<strong>der</strong>Fachabitur. Damit hebt sich die Teilnehmergruppe deutlichvom Durchschnitt <strong>der</strong> Bevölkerung <strong>in</strong> dieser Altersgruppeab.Der Evaluationsbericht <strong>zur</strong> ersten Projektphase ziehth<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Zufriedenheit <strong>der</strong> Seniortra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen und-tra<strong>in</strong>er mit dem Weiterbildungsprogramm e<strong>in</strong>e positiveBilanz. So zeigen die Erfahrungen mit den ersten E<strong>in</strong>sätzen,dass sowohl die Seniortra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen und -tra<strong>in</strong>er alsauch die Kooperationspartner<strong>in</strong>nen und -partner <strong>in</strong> Initiativenund Organisationen von <strong>der</strong> Zusammenarbeit profitierthaben. Die Tra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen und Tra<strong>in</strong>er konnten ihreKompetenzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em breiten Spektrum von Tätigkeitenwie Organisation von Veranstaltungen, Vernetzung, Beratung,Bürgeraktivierung und Lobbyarbeit e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen. IhrE<strong>in</strong>satz wurde von den Kooperationspartnern als erfolgreichund den Erwartungen entsprechend bewertet. DerZwischenbericht unterstreicht aber, dass für e<strong>in</strong>e nachhaltigeVerstetigung <strong>der</strong> Erfolge des Modellprogramms dienotwendigen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen gegeben se<strong>in</strong> müssen:„Die bessere Ausstattung <strong>der</strong> örtlichen Agenturen fürBürgerengagement muss durch e<strong>in</strong>e stabilere Basis e<strong>in</strong>erengagementför<strong>der</strong>nden Infrastruktur <strong>in</strong> je<strong>der</strong> Kommunegewährleistet werden.“ Es ist e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Begleitung<strong>der</strong> Seniortra<strong>in</strong>er und -tra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen durch dieörtlichen Freiwilligenagenturen o<strong>der</strong> Seniorenbüros notwendig.„Ohne Weiterbildung von Älteren zu SeniorTra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen,<strong>in</strong> <strong>der</strong> sie die Chance erhalten, sich mit <strong>der</strong> Weitergabeihres Erfahrungswissens ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zu setzen,und die ihren Fähigkeiten und Interessen gerecht werdendenRollen zu f<strong>in</strong>den, kann die Multiplikatorenrolle vonSeniorTra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen nicht erfolgreich realisiert werden“(Braun, Burmeister & Engels 2004: 225).Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagementim AlterRegelmäßig wird im seniorenpolitischen Diskurs dieFrage des Verhältnisses von Selbsthilfe und bürgerschaftlichemEngagement aufgeworfen. 62 Selbsthilfe wird als <strong>in</strong><strong>der</strong> Regel auf die Bewältigung e<strong>in</strong>es eigenen Problems(z.B. e<strong>in</strong>er Krankheit, e<strong>in</strong>er Notsituation) ausgerichtetcharakterisiert. Beim bürgerschaftlichen Engagement stehenaltruistische und gesellschaftsbezogene Aspekte imVor<strong>der</strong>grund. Zwischen beiden Fel<strong>der</strong>n besteht <strong>in</strong> allenAltersgruppen e<strong>in</strong> Überschneidungsbereich. DieseSchnittmenge ersche<strong>in</strong>t aber bei e<strong>in</strong>em Teilsegment desEngagements von älteren Menschen beson<strong>der</strong>s groß. Inden sozialen Engagementformen, bei denen die Hilfe vonÄlteren für Ältere im Vor<strong>der</strong>grund steht, und bei <strong>der</strong> altersspezifischenSelbsthilfe s<strong>in</strong>d Selbst- und Fremdhilfeaspekteauf <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Motive und aus Sicht <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellenZugangswege zum Engagement häufig kaum zutrennen. Ältere Menschen, die <strong>zur</strong> Bewältigung eigenerProbleme o<strong>der</strong> von Entwicklungsaufgaben e<strong>in</strong>er Selbsthilfegruppebeitreten, übernehmen neben <strong>der</strong> Funktion,an<strong>der</strong>e Gruppenmitglie<strong>der</strong> durch das Zuhören und Teilenvon Erfahrungen zu unterstützen, auch häufig weitergehendeAufgaben, wie die Organisation o<strong>der</strong> die Leitungvon Treffen. Darüber h<strong>in</strong>aus entwickeln sich aus <strong>der</strong>62 Mit Empowermentstrategien im Übergangsfeld von Selbsthilfe undbürgerschaftlichem Engagement befasst sich <strong>zur</strong> Zeit beispielsweisedas Projekt „Kompetenznetzwerk für das Alter“, dessen Ergebnisseallerd<strong>in</strong>gs erst im Herbst 2005 vorliegen werden.
Drucksache 16/2190 – 204 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSelbsthilfe im Zeitverlauf häufig e<strong>in</strong>deutig nach außengerichtete Aktivitäten, wie die Beratung und Unterstützungan<strong>der</strong>er Betroffener. Nach erlittenen Krankheiten,sozialen Verlusten o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Belastungen entscheidensich viele ältere Menschen, ihre Erfahrungen und Kompetenzenfür an<strong>der</strong>e <strong>in</strong> ähnlichen Situationen e<strong>in</strong>zusetzen,ohne selbst jemals die Unterstützung e<strong>in</strong>er Selbsthilfegruppegesucht zu haben. Ihr bürgerschaftliches Engagementhat dann <strong>in</strong>sofern e<strong>in</strong>e Selbsthilfefunktion, als esdazu beiträgt, eigene Verluste und Verletzungen zu reflektierensowie <strong>der</strong>en weitere Bewältigung zu unterstützen.Bürgerschaftliches Engagement von „jungen Alten“ fürHochaltrige kann e<strong>in</strong>en Aspekt <strong>der</strong> prospektiven Selbsthilfeaufweisen, <strong>in</strong>dem zukünftige mögliche eigene gesundheitliche,funktionelle o<strong>der</strong> soziale E<strong>in</strong>bußen durchdie Helfenden antizipiert und Handlungsstrategien fürdiese Fälle entwickelt werden und <strong>in</strong>dem die psychischeAuse<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit Verlusterfahrungen bereits frühzeitigaufgenommen wird.Engagementför<strong>der</strong>nde Infrastrukture<strong>in</strong>richtungenBürgerschaftliches Engagement profitiert von e<strong>in</strong>er unterstützendenInfrastruktur. Auch wenn <strong>der</strong> Zugang zu e<strong>in</strong>embürgerschaftlichen Engagement überwiegend überprivate Kontakte erfolgt, ist die Schaffung und Unterhaltunge<strong>in</strong>es Netzes aus Mittleragenturen e<strong>in</strong>es <strong>der</strong> zentralenMittel, das die Politik besitzt, um Engagement zuför<strong>der</strong>n. Diese Mittleragenturen übernehmen u.a. die Vermittlungvon Freiwilligen, die Initiierung neuen Engagementsund die Lobbyarbeit für das bürgerschaftlicheEngagement sowie Beiträge <strong>zur</strong> kommunalen Anerkennungskultur.In den vergangen Jahren haben sich verschiedeneTypen von Mittleragenturen entwickelt, wieSeniorenbüros, Freiwilligenagenturen und Selbsthilfekontaktstellen.Im Jahr 2004 gab es nach Auskunft <strong>der</strong>Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaften <strong>der</strong> Seniorenbüros (BAS)und <strong>der</strong> Freiwilligenagenturen (bagfa) sowie <strong>der</strong> NationalenKontakt- und Informationsstelle <strong>zur</strong> Anregung undUnterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) ca.180 Seniorenbüros, 180 Freiwilligenagenturen und340 Selbsthilfekontaktstellen. Diese aus Modellprogrammenhervorgegangenen Formen <strong>der</strong> Mittlerorganisationenfür bürgerschaftliche Aktivitäten s<strong>in</strong>d ausführlich evaluiertund dokumentiert worden (Keupp 2003; Ebert u.a.2002; Braun 1998; Braun u.a. 1996).Engagementbereiche älterer MenschenDie beiden Alterssurveys von 1996 und 2002 (Kohli &Künemund 2001; Künemund 2004) zeigen, dass das faktischeEngagement älterer Menschen <strong>in</strong> den „neuen“ Bereichenehrenamtlichen Engagements gegenüber dem traditionellenEhrenamt eher ger<strong>in</strong>g ist. 63 Mit demNachrücken an<strong>der</strong>s sozialisierter Geburtsjahrgänge mite<strong>in</strong>em besseren Bildungsprofil wird sich dieses Bild abervoraussichtlich verschieben. Trotzdem wird es auf absehbareZeit sowohl e<strong>in</strong>en Bedarf an neuen wie an traditionellenEngagementformen unter den älteren Menschengeben. Die neuen Formen des Engagements haben abere<strong>in</strong>e nicht zu unterschätzende Pionierfunktion für die Etablierung<strong>in</strong>novativer Engagementformen.Die Kommission misst dem Engagement „von Älteren fürÄltere“ und solchen Engagementformen, die explizit denZusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en för<strong>der</strong>n sollen, hohe Bedeutungbei. Diese Aktivitäten können sowohl als traditionellesEngagement als auch unter den so genannten„neuen Engagementformen“ gefunden werden. Mittelfristigist auf Grund des demografischen Wandels absehbar,dass das bürgerschaftliche Engagement von Älterenfür Ältere im Bereich <strong>der</strong> sozialen und pflegerischen Versorgungälterer Menschen an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen wird.Dabei werden <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e neue <strong>in</strong>telligente Mischungenaus familialer, professioneller und ehrenamtlicher Unterstützungbzw. Pflege <strong>zur</strong> langfristigen Stabilisierung vonprivaten Hilfearrangements relevanter werden. Es sprechenaber nicht nur verme<strong>in</strong>tliche Sachzwang- o<strong>der</strong> Kostenargumentefür neue Formen gemischter Hilfearrangements.Durch die bessere E<strong>in</strong>beziehung von freiwilligenHelfern kann die Lebensqualität <strong>der</strong> Hilfebedürftigendurch die Ausweitung <strong>der</strong> persönlichen Netzwerke gesteigertwerden. Die Komb<strong>in</strong>ation <strong>der</strong> unterschiedlichenKompetenzen von Betroffenen, Angehörigen, Professionellenund freiwilligen Helfern von Hilfebedürftigen erhöhtlangfristig die Qualität <strong>der</strong> Versorgung. Das Modellprogramm„Altenhilfestrukturen <strong>der</strong> Zukunft“ hatgezeigt, dass auch die Stärkung des Verbraucherschutzesfür hilfebedürftige Ältere unter angemessenen Rahmenbed<strong>in</strong>gungendurch die bessere E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von freiwilligen– anwaltschaftlich handelnden – Helfern <strong>in</strong> Unterstützungsarrangementsgeför<strong>der</strong>t werden kann (BMFSFJ2004: 84ff., siehe auch den Abschnitt „Verbraucherpolitik“<strong>in</strong> diesem <strong>Bericht</strong>). Damit verlässliche Aussagenüber die erhofften Zugew<strong>in</strong>ne an Lebensqualität und Effektivität<strong>der</strong> Hilfeleistungen getroffen werden können,s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Zukunft vermehrte Anstrengungen zu e<strong>in</strong>er wissenschaftlichenEvaluation dieser Engagementformen nötig.Anhand e<strong>in</strong>iger konkreter Beispiele soll verdeutlicht werden,wo die Kommission Entwicklungsmöglichkeiten fürdie Zukunft sieht.63 Die entsprechenden statistischen Daten <strong>zur</strong> Verteilung <strong>der</strong> älteren Bevölkerungauf die e<strong>in</strong>zelnen Engagementbereiche werden <strong>in</strong> Kapitel7.3 Empirische Befunde zum freiwilligen Engagement ältererMenschen dargestellt.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 205 – Drucksache 16/2190Bürgerschaftliches Engagement <strong>in</strong> <strong>der</strong> HospizbewegungFür die 5. Altenberichtskommission ist das Feld <strong>der</strong> Hospizarbeit aus m<strong>in</strong>destens drei Gründen exemplarisch fürmögliche zukünftige Entwicklungen des Engagements von älteren Menschen für ältere Menschen: a) wegen <strong>der</strong> altersspezifischenMotivation und dem Zugang <strong>der</strong> freiwillig Engagierten, welche mit dem Thema „Tod und Sterben“verbunden s<strong>in</strong>d; b) wegen <strong>der</strong> vorbildlichen Freiwilligenkultur, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Fort- und Weiterbildung,die sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizbewegung entwickelt hat und c) wegen <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ungen, die sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Interaktion vonFreiwilligen mit dem formellen mediz<strong>in</strong>ischen und pflegerischen Versorgungssystemen zeigen.Die Hospizarbeit hat das Ziel, unheilbar kranke und sterbende Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> letzten Phase ihres Lebens zu unterstützenund zu pflegen, damit sie <strong>in</strong> dieser Zeit so bewusst, s<strong>in</strong>nerfüllt und zufrieden und gleichzeitig durch palliativeVersorgung so beschwerdearm wie möglich leben können (Kruse im Druck; Student, Mühlum & Student 2004). Sierichtet ihre Unterstützung außerdem an Angehörige. Sterben wird als e<strong>in</strong> Teil des Lebens betrachtet, <strong>der</strong> nicht ausgegrenztwerden sollte, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> den Alltag <strong>zur</strong>ückgeholt werden muss. Damit ist eng das Ziel <strong>der</strong> Ent-Hospitalisierungund die Ermöglichung des „guten Sterbens“ Zuhause verbunden, das auch durch den Ausbau von Strukturen <strong>der</strong>ambulanten Sterbebegleitung und Palliativversorgung erreicht werden soll. Die rund 25-jährige Geschichte <strong>der</strong> Hospizbewegung<strong>in</strong> Deutschland ist ohne bürgerschaftliches Engagement nicht vorstellbar. In <strong>der</strong> ersten Phase wurde dieHospizidee be<strong>in</strong>ah ausschließlich durch freiwilliges Engagement <strong>in</strong> Institutionen und Geme<strong>in</strong>den getragen und ambulantewie stationäre Hospizdienste gegründet. So basieren fast alle Hospizgründungen auf dem Engagement von Ehrenamtlichen.Laut Angaben <strong>der</strong> Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Hospiz s<strong>in</strong>d heute etwa 80.000 Menschen bürgerschaftlich<strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizbewegung engagiert, dabei handelt es sich zu e<strong>in</strong>em großen Teil um ältere Frauen und Männer.Die Motivation, e<strong>in</strong> Engagement <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizarbeit aufzunehmen, liegt bei älteren Menschen häufig <strong>in</strong> <strong>der</strong> persönlichenBetroffenheit, sei es durch den Verlust des Partners, an<strong>der</strong>er Angehöriger und Freunde o<strong>der</strong> durch Erfahrungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichen Tätigkeit. Dabei wird aus den Hospiz<strong>in</strong>itiativen sowohl von negativen Erfahrungen mit dem Sterben<strong>in</strong> konventionellen E<strong>in</strong>richtungen als auch von positiven Erfahrungen im Kontakt mit ambulanten und stationärenHospizdiensten als Auslöser für e<strong>in</strong>en Engagementwunsch berichtet. E<strong>in</strong> weiteres altersspezifisches Motiv kann <strong>in</strong><strong>der</strong> Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit den existenziellen Themen „Tod und Sterben“ liegen. Für die Freiwilligen bietet das Engagement<strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizarbeit die Möglichkeit, die Entwicklung <strong>der</strong> eigenen Persönlichkeit mit fachlichen Lernprozessenzu verb<strong>in</strong>den. Gleichzeitig steht den freiwillig Engagierten e<strong>in</strong> breites Spektrum von sozialen und organisatorischenTätigkeiten offen, die je nach eigenen Wünschen und Kompetenzen näher o<strong>der</strong> weiter von <strong>der</strong> direktenBegleitung von Sterbenden entfernt angesiedelt se<strong>in</strong> können. Damit s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizarbeit lange Engagementkarrierenbis <strong>in</strong>s sehr hohe Alter mit sich verschiebenden Tätigkeitsschwerpunkten möglich, die auch Gelegenheitzum Austausch mit jüngeren <strong>Generation</strong>en bieten.In <strong>der</strong> Hospizarbeit s<strong>in</strong>d viele Elemente <strong>der</strong> Gew<strong>in</strong>nung und Pflege von Freiwilligen bereits vorbildlich realisiert, dievon <strong>der</strong> Kommission auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Engagementfel<strong>der</strong>n als notwendige Voraussetzung für e<strong>in</strong>e qualitativ gute undnachhaltige Freiwilligenarbeit angesehen werden. Die Schulung von freiwilligen Helfern ist e<strong>in</strong> zentraler Aspekt <strong>der</strong>Hospizarbeit. Dabei geht es nicht nur um die e<strong>in</strong>malige Befähigung für die Aufgaben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizarbeit, son<strong>der</strong>nauch um e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Begleitung <strong>der</strong> Freiwilligen durch Bildungs- und Supervisionsangebote. Es f<strong>in</strong>det i.d.R.e<strong>in</strong>e Verknüpfung von fachlichen und persönlichen Fort- und Weiterbildungszielen statt, u.a. um den Wünschen <strong>der</strong>freiwilligen Helfer nach Selbstentfaltung, Selbstpflege und nach Unterstützung bei <strong>der</strong> Bewältigung eigener Ängstegerecht zu werden.Mit <strong>der</strong> Etablierung <strong>der</strong> Hospizbewegung und <strong>der</strong> erfolgreichen Gründung und Unterhaltung vieler ambulanter undstationärer Hospizdienste hat sich auch die Rolle <strong>der</strong> Ehrenamtlichen verän<strong>der</strong>t. Sie s<strong>in</strong>d heute weniger als vor e<strong>in</strong>igenJahren die treibenden Initiatoren von Hospizdiensten und „Motor e<strong>in</strong>er Bürgerbewegung“; vielmehr verstehen siesich mehr und mehr als Mitglie<strong>der</strong> <strong>in</strong> den multiprofessionellen Teams <strong>der</strong> Hospizdienste. Die notwendige und gewollteKooperation von freiwilligen und professionellen Mitarbeitern ist auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizbewegung mit Spannungenund Konflikten verbunden, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e dort, wo Hospizdienste mit Pflegeheimen kooperieren. Im Gegensatz zuan<strong>der</strong>en Fel<strong>der</strong>n des bürgerschaftlichen Engagements bieten kont<strong>in</strong>uierliche Fortbildungsveranstaltungen und dieE<strong>in</strong>beziehung von Freiwilligen <strong>in</strong> Supervision und Teambesprechungen e<strong>in</strong>en systematischen Ort, wo evtl. auftretendeKonflikte bearbeitet werden können. Für die Freiwilligen ist das Engagement <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizbewegung auf <strong>der</strong>e<strong>in</strong>en Seite e<strong>in</strong>e soziale Tätigkeit mit zum Teil sehr persönlichen <strong>in</strong>timen Kontakten mit Sterbenden, auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>enSeite ist es e<strong>in</strong> politisches Engagement, weil dar<strong>in</strong> nach wie vor die Kritik an den herrschenden Versorgungsstrukturenund bürokratischen Regelungen <strong>der</strong> Pflegeversicherung, die e<strong>in</strong> würdevolles, selbstbestimmtes Leben bis zumEnde teilweise beh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, impliziert ist.
Drucksache 16/2190 – 206 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeBürgerschaftliches Engagement <strong>in</strong> <strong>der</strong> pflegerischen Versorgung älterer MenschenIn <strong>der</strong> Diskussion um die Zukunft <strong>der</strong> pflegerischen Versorgung älterer Menschen gilt die För<strong>der</strong>ung/Ermöglichungvon gemischten Unterstützungsarrangements aus familiären, professionellen und ehrenamtlichen Helfern als Erfolgversprechendes Mittel, um die Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> demografischen Entwicklung <strong>in</strong> diesem sozialpolitischen Feldzu bewältigen. Bereits heute betätigen sich freiwillig Engagierte <strong>in</strong> vielfältiger Form bei <strong>der</strong> Unterstützung von älterenpflegebedürftigen Menschen. E<strong>in</strong>e Studie aus Baden-Württemberg (Klie, Hoch & Pfundste<strong>in</strong> 2004) zeigt beispielsweisefür die stationäre Altenpflege auf, dass dort, wo freiwillige Helfer <strong>in</strong> die Arbeit des Heimes e<strong>in</strong>bezogenwerden, ihr Tätigkeitsspektrum sehr breit ist. An erster Stelle <strong>der</strong> Aktivitäten steht <strong>der</strong> Besuch von Heimbewohner<strong>in</strong>nenund -bewohnern, gefolgt von <strong>der</strong> Mitwirkung bei Gruppenangeboten <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Heime. Auch die Organisationvon Festen o<strong>der</strong> Basaren, <strong>der</strong> Dienst <strong>in</strong> Bewohnercafeterias o<strong>der</strong> das Vorlesen für Bewohner<strong>in</strong>nen und Bewohnerund die Organisation von Gesprächskreisen spielen e<strong>in</strong>e bedeutende Rolle. Deutlich wird <strong>in</strong> dieser Untersuchung aberauch, dass die E<strong>in</strong>richtungen i.d.R. ke<strong>in</strong>e systematischen Konzepte für die E<strong>in</strong>beziehung von Freiwilligen haben, sodasshier noch e<strong>in</strong> großer Entwicklungsbedarf besteht.Die Kommission möchte auf e<strong>in</strong>en Bereich h<strong>in</strong>weisen, <strong>der</strong> bisher quantitativ nicht an <strong>der</strong> Spitze des Engagements <strong>in</strong>diesem Feld rangiert, zukünftig aber e<strong>in</strong>e bedeuten<strong>der</strong>e Rolle spielen könnte: das freiwillige Engagement von jungenAlten für hilfebedürftige Hochaltrige <strong>in</strong> <strong>der</strong> anwaltschaftlichen Interessenvertretung und <strong>der</strong> Sachwalterschaft beimVerbraucherschutz im Bereich sozialer Dienstleistungen und <strong>der</strong> pflegerischen Versorgung.Beispielhaft sei hier e<strong>in</strong> Projekt <strong>der</strong> Bundes<strong>in</strong>teressenvertretung <strong>der</strong> Altenheimbewohner (BIVA) <strong>zur</strong> Qualifizierungvon Heimbeiräten und Heimfürsprechern durch sogen. Multiplikatoren genannt. Die BIVA hat <strong>in</strong> verschiedenen Bundeslän<strong>der</strong>nehrenamtliche Berater<strong>in</strong>nen und Berater ausgebildet, um vor Ort Heimbeiräte zu <strong>in</strong>formieren, zu beratenund sie bei <strong>der</strong> Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte zu unterstützen. Die Heimbeiräte vertreten die Interessen <strong>der</strong>Heimbewohner<strong>in</strong>nen und -bewohner gegenüber dem Heimträger und den Heimmitarbeiter<strong>in</strong>nen und -mitarbeitern,nehmen aber gleichzeitig auch e<strong>in</strong>e Vermittlerrolle zwischen beiden e<strong>in</strong>. Sie s<strong>in</strong>d überwiegend <strong>in</strong> die VeranstaltungsundTagesgestaltung e<strong>in</strong>gebunden, sie haben aber auch Mitspracherechte <strong>in</strong> Fragen <strong>der</strong> Vertragsgestaltung und beiEntgeltverän<strong>der</strong>ungen. Das novellierte Heimgesetz sieht neben <strong>der</strong> Möglichkeit, auch externe Mitglie<strong>der</strong> <strong>in</strong> denHeimbeirat zu wählen, u.a. erweiterte Mitspracherechte des Heimbeirats <strong>in</strong> Fragen <strong>der</strong> Qualitätssicherung und bei denLeistungs-, Qualitäts- und Vergütungsvere<strong>in</strong>barungen mit den Kostenträgern vor. Mehr Mitsprache <strong>in</strong> diesen Fragenund bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> Lebensverhältnisse im Heim sowie <strong>der</strong> Pflege und Betreuung werden auch von den Heimbeirätenselbst gewünscht. Nach den Erfahrungen <strong>der</strong> BIVA ist die gesetzgeberisch angestrebte Aufwertung <strong>der</strong>Heimbeiratsarbeit alle<strong>in</strong> durch e<strong>in</strong>e Ausweitung des Personenkreises und <strong>der</strong> Mitwirkungsbereiche nicht zu erreichen.In <strong>der</strong> Weiterbildung <strong>der</strong> Heimbeiräte liegt e<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung für die effektive För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>Heimbeiratsarbeit. Die freiwillig engagierten Multiplikatoren unterstützen <strong>in</strong> regelmäßigen Gesprächen die Heimbeiräteund Heimfürsprecher bei <strong>der</strong> Durchsetzung ihrer Interessen, <strong>in</strong>dem sie ihr Wissen weitergeben und Kontakte undAustausch mit an<strong>der</strong>en Heimbeiräten organisieren. Das Projekt <strong>der</strong> Multiplikatorenschulung lief <strong>in</strong> vier Bundeslän<strong>der</strong>nund ist <strong>in</strong> Schleswig-Holste<strong>in</strong> durch die Landesregierung dauerhaft etabliert worden.Auch die <strong>in</strong> Deutschland existierenden Pflege-Not-Telefone als Informations- und Beschwerdestellen für Problememit Heimen o<strong>der</strong> ambulanten Diensten arbeiten überwiegend mit freiwillig engagierten älteren Menschen. Die freiwilligenHelfer im Telefondienst beraten und <strong>in</strong>formieren Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei Pflegeproblemenmit professionellen Anbietern und schalten ggf. Heimaufsicht o<strong>der</strong> MDKs e<strong>in</strong> o<strong>der</strong> <strong>in</strong>formieren die Öffentlichkeitüber Missstände <strong>in</strong> <strong>der</strong> pflegerischen Versorgung älterer Menschen. Ihnen kommt e<strong>in</strong>e wichtige Funktion bei <strong>der</strong>basisnahen Verbraucherberatung und Verbraucherorganisierung zu.In beiden genannten Beispielen unterstützen die freiwillig engagierten Senior<strong>in</strong>nen und Senioren ältere Pflegebedürftigebei <strong>der</strong> Durchsetzung ihrer Rechte und leisten damit e<strong>in</strong>en Beitrag <strong>zur</strong> Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse.Die Unterstützung von Älteren durch Ältere wird nichtnur <strong>in</strong> zahlreichen Satzungen von Initiativen, Organisationenund Vere<strong>in</strong>igungen als vorrangiges Ziel hervorgehoben,son<strong>der</strong>n auch durch viele Projekte als beson<strong>der</strong>swichtig unterstrichen. In den Satzungen wird dies hauptsächlichunter dem vorrangigen Ziel <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong>Lebensqualität und <strong>der</strong> Gesundheit für Ältere subsumiert.Darüber h<strong>in</strong>aus werden vor allem Mitspracherechte <strong>in</strong> <strong>der</strong>Gesellschaft, E<strong>in</strong>fluss <strong>in</strong> Politik und Zivilgesellschaft,Verantwortungsübernahme <strong>in</strong> <strong>der</strong> Demokratie sowieSelbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Anerkennung<strong>der</strong> Lebensleistung <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong> und <strong>der</strong>ehrenamtlich Tätigen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft, Chancengleichheitund soziale Sicherheit für die älteren Menschen alsZiele genannt.7.3 Empirische Befunde zum freiwilligenEngagement älterer Menschen7.3.1 Faktisches Engagement von älterenMenschenSeit Mitte <strong>der</strong> 1980er-Jahre zeigt sich <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>Wachstum <strong>der</strong> Engagementbereitschaft und des reali-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 207 – Drucksache 16/2190sierten Engagements <strong>in</strong> allen Dimensionen bei den über60-Jährigen 64 , wobei das freiwillige Engagement ältererMenschen e<strong>in</strong> weites Spektrum abdeckt, das von Unterstützungsleistungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie und <strong>der</strong> Nachbarschaftüber freiwillige Aktivitäten <strong>in</strong> Sportvere<strong>in</strong>en, Kirchengeme<strong>in</strong>denund Politik bis zum traditionellen Ehrenamtreicht. Da die vorliegenden Studien aber zum überwiegendenTeil das Engagement älterer Menschen nicht alsbürgerschaftliches Engagement def<strong>in</strong>ieren, muss hier zunächstauf die empirisch erfassten Engagementkategorien<strong>zur</strong>ückgegriffen werden. Die vorliegenden Studien kommenbei <strong>der</strong> quantitativen Beurteilung des EngagementsÄlterer zu jeweils unterschiedlichen Ergebnissen, die e<strong>in</strong>egroße Streuung bei den angegebenen Beteiligungsquotientenaufweisen. Der Grund liegt <strong>in</strong> unterschiedlichenErhebungsmethoden und Messkonzepten (Künemund2004). Folgende Formulierungen wurden <strong>in</strong> den vorliegendenStudien verwendet:64 Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich im Wesentlichenauf die Expertise von Künemund (2004) „Partizipation und Engagementälterer Menschen“ für den 5. Altenbericht, <strong>der</strong> Auswertungen<strong>der</strong> beiden vorliegenden Befragungen des Alterssurvey1996 und 2002 vorgenommen hat, auf die bis zum Redaktionszeitpunktvorliegenden Ergebnisse <strong>der</strong> beiden Befragungswellen desFreiwilligensurveys 1999 und 2004 (Brendgens, Braun 2001;Gensicke 2004), sowie auf die Expertise von Menn<strong>in</strong>g (2004), dieauf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtesvon 2001/02 die Zeitverwendung älterer Menschen– unter an<strong>der</strong>em auch für bürgerschaftliches Engagement – untersuchthat.a) Sowohl <strong>der</strong> Freiwilligensurvey als auch <strong>der</strong> Alterssurveyweisen e<strong>in</strong>en Anstieg <strong>der</strong> Engagementquoten zwischenihrer ersten und zweiten Befragung aus (Tabelle29). Beim Freiwilligensurvey liegt <strong>der</strong> Anstieg zwischen1999 und 2004 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigenbei 5 Prozentpunkten (auf 40 Prozent), <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe<strong>der</strong> 65- bis 74-Jährigen bei 5 Prozentpunkten (auf32 Prozent) und bei den 75-Jährigen und Älteren bei2 Prozentpunkten (auf 19 Prozent). Der Alterssurvey f<strong>in</strong>detbei den 55- bis 69-Jährigen e<strong>in</strong>en Anstieg um 8 Prozentpunkte(auf 21 Prozent) und bei den 70- bis 85-Jährigenum 2 Prozentpunkte (auf 9 Prozent) im Zeitraum von1996 bis 2002.Das ehrenamtliche Engagement älterer Menschen ist bemerkenswertund nimmt erst <strong>in</strong> <strong>der</strong> höchsten Altersgruppedeutlich ab. Tabelle 29 zeigt, dass die Engagementquoten<strong>der</strong> „jungen Alten“ durch Zuwächse <strong>in</strong> denletzten Jahren heute den Stand <strong>der</strong> Bevölkerung im mittlerenAlter erreichen. Diese letztere Gruppe konnte ke<strong>in</strong>eentsprechenden Zugew<strong>in</strong>ne vorweisen. Im Freiwilligensurveyhat sich <strong>der</strong> Abstand zwischen den 45- bis 54-Jährigenund den 55- bis 64-Jährigen um 5 Prozentpunkteverr<strong>in</strong>gert und <strong>zur</strong> Angleichung auf jeweils 40 Prozentgeführt, während <strong>der</strong> Alterssurvey im Zeitraum von1996-2002 sogar e<strong>in</strong>e Abstandsverr<strong>in</strong>gerung von 9 auf2 Prozentpunkte bei den Altersgruppen <strong>der</strong> 40- bis 54-Jährigen(1996: 22 Prozent, 2002: 23 Prozent) und den 55- bis69-Jährigen (1996: 13 Prozent, 2002: 21 Prozent) aufzeigt(bei viel niedrigeren Ausgangsquoten als im Freiwilligensurvey).Übersicht 2Begriffe: Aktive Beteiligung, freiwilliges Engagement und ehrenamtliche TätigkeitAlterssurvey 1996, 2002 (Künemund 2004, Tabellenanhang)Üben Sie dort e<strong>in</strong>e Funktion aus o<strong>der</strong> haben Sie e<strong>in</strong> Ehrenamt <strong>in</strong>ne? (Frage wurde gestellt, falls e<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> mehrereMitgliedschaften <strong>in</strong> Gruppen o<strong>der</strong> Organisationen genannt wurden)Üben Sie vielleicht noch e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Funktion aus, z.B. als Elternvertreter o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nachbarschaftshilfe?= ehrenamtliche Tätigkeiten <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en und VerbändenFreiwilligensurvey 1999, 2004 (Brendgens, Braun 2001: 221):1. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, außerhalb von Beruf und Familie irgendwo mitzumachen, beispielsweise <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emVere<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>er Initiative, e<strong>in</strong>em Projekt o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Selbsthilfegruppe. Ich nenne Ihnen verschiedene Bereiche, diedafür <strong>in</strong> Frage kommen. S<strong>in</strong>d Sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em o<strong>der</strong> mehreren <strong>der</strong> folgenden Bereiche aktiv beteiligt?= „aktiv“ Beteiligte2. Uns <strong>in</strong>teressiert nun, ob Sie <strong>in</strong> den Bereichen, <strong>in</strong> denen Sie aktiv s<strong>in</strong>d, auch ehrenamtliche Tätigkeiten ausübeno<strong>der</strong> <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en, Initiativen, Projekten o<strong>der</strong> Selbsthilfegruppen engagiert s<strong>in</strong>d. Es geht um freiwillig übernommeneAufgaben und Arbeiten, die man unbezahlt o<strong>der</strong> gegen ger<strong>in</strong>ge Aufwandsentschädigung ausübt.= freiwillig EngagierteZeitbudgeterhebung 2001/02 des Statistischen Bundesamtes (Personenfragebogen, S.7):S<strong>in</strong>d sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em o<strong>der</strong> mehreren <strong>der</strong> nachstehenden Bereiche ehrenamtlich aktiv? Falls ja, geben sie bitte an, ob Siesich über die e<strong>in</strong>fache Mitgliedschaft h<strong>in</strong>aus aktiv beteiligt haben o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Amt übernommen haben und wie hoch <strong>der</strong>durchschnittliche Zeitaufwand <strong>in</strong> Stunden pro Woche hierfür war.= aktive Beteiligung und ehrenamtliches Engagement
Drucksache 16/2190 – 208 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 29Beteiligung am bürgerschaftlichen Engagement <strong>in</strong> verschiedenen StudienFreiwilligensurvey1999Freiwilligensurvey2004Alterssurvey 1996Alterssurvey 2002Zeitbudgeterhebung1991/92Zeitbudgeterhebung2001/02( ): unsicherer Zahlenwert, da Fallzahl sehr ger<strong>in</strong>g.Quelle: Menn<strong>in</strong>g (2004), eigene Ergänzungen.Beteiligungsquoten (%)Insg. Männer Frauen40 %35 %27 %17 %40 %40 %32 %19 %22 %13 %7 %23 %21 %9 %22 %16 %45 %41 %31 %–44 %42 %39 %–25 %18 %9 %22 %23 %15 %25 %(21) %24 %22 %19 %13 %36 %29 %22 %–36 %37 %27 %–18 %9 %6 %23 %18 %5 %20 %(14) %18 %20 %16 %11 %Altersgruppe Bezugsgröße Quelle45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre75 Jahre +45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre75 Jahre +40-54 Jahre55-69 Jahre70-85 Jahre40-54 Jahre55-69 Jahre70-85 Jahre60-69 Jahre70+ Jahre40-59 Jahre60-64 Jahre65-74 Jahre75+ JahrefreiwilligesEngagementfreiwilligesEngagementEhrenamtlicheTätigkeiten <strong>in</strong>Vere<strong>in</strong>en undVerbändenEhrenamtliche Tätigkeiten<strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>enund VerbändenAusübung e<strong>in</strong>esEhrenamtesAusübung e<strong>in</strong>esEhrenamtesGensicke 2004Gensicke 2004Kohli,Künemund 2001Künemund 2004Schwarz 1996Menn<strong>in</strong>g 2004Interessant s<strong>in</strong>d dabei die geschlechtsspezifischen Unterschiede<strong>der</strong> Entwicklung. Bei den Frauen haben sich vorallem <strong>in</strong> <strong>der</strong> mittleren Altersgruppe die Engagementquotenstark erhöht: im Freiwilligensurvey von 29 auf 37 Prozent(Altersgruppe <strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen), im Alterssurveyvon 9 auf 18 Prozent (Altersgruppe <strong>der</strong> 55- bis 69-Jährigen).Dagegen s<strong>in</strong>d, je nach Studie, <strong>in</strong> den beiden benachbartenweiblichen Altersgruppen mittlere bis gar ke<strong>in</strong>e Anstiegezu verzeichnen. Etwas an<strong>der</strong>s liegt die Situation beiden Männern: Hier liegen die höchsten Zuwächse <strong>in</strong> <strong>der</strong>Altersgruppe <strong>der</strong> 65- bis 74-Jährigen mit e<strong>in</strong>em Anstiegvon 31 auf 39 Prozent im Freiwilligensurvey bzw. von9 auf 15 Prozent im Alterssurvey (70 bis 85 Jahre).Fazit: In den letzten Jahren ist die Beteiligung ältererMenschen am ehrenamtlichen Engagement gestiegen. Sieliegt mittlerweile genauso hoch wie bei <strong>der</strong> Bevölkerungim mittleren Alter. Die Zuwächse s<strong>in</strong>d bei den Frauen <strong>in</strong><strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> „jungen Alten“ am stärksten, bei denMännern <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> „älteren Alten“. Das ehrenamtlicheEngagement ist bei den „jungen Alten“ amhöchsten und nimmt bei den „älteren Alten“ wie<strong>der</strong> ab.b) Die Zeitumfänge, die <strong>in</strong> verschiedenen Studien für dasEngagement älterer bürgerschaftlich Aktiver ermitteltwurden, s<strong>in</strong>d beträchtlich: Sie liegen zwischen durchschnittlich15 und 29 Stunden im Monat (Tabelle 30).Menn<strong>in</strong>g (2004) kommt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Expertise auf Basis <strong>der</strong>Zeitbudgeterhebung 2001/02 mit den Daten des Personenfragebogenszu Aktivitätsumfängen, die <strong>in</strong> dieserGrößenordnung liegen. Danach leisten ältere Menschenab dem 60. Lebensjahr im Durchschnitt zwischen knapp19 und 22 Stunden Arbeit im bürgerschaftlichen Engagement.Dabei nimmt die für die aktive Beteiligung aufgewendeteZeit bis <strong>zur</strong> Mitte des 8. Lebensjahrzehnts nochzu und erreicht ihre höchsten Werte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe<strong>der</strong> 65- bis 74-Jährigen. Der Teil <strong>der</strong> älteren Menschen,<strong>der</strong> sich für e<strong>in</strong>e Tätigkeit des bürgerschaftlichen Engagementsentscheidet, ist also offenbar bereit, große Teilese<strong>in</strong>er durch den Ruhestand gewonnenen disponiblen Zeit<strong>in</strong> diese Aktivität zu <strong>in</strong>vestieren. Da gleichzeitig mit denMittelwerten <strong>der</strong> aufgewendeten Zeit auch die Streuungmit zunehmendem Alter bis zum 74. Lebensjahr steigt, istallerd<strong>in</strong>gs anzunehmen, dass sich die Intensität des bürgerschaftlichenEngagements mit steigendem Alter stärkerdifferenziert und die Bandbreite größer wird zwischendenen, die ihrem Engagement beson<strong>der</strong>s viel Zeit widmenund denen, die eher sporadisch und mit ger<strong>in</strong>gemzeitlichen Aufwand bürgerschaftlich aktiv werden.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 209 – Drucksache 16/2190Aufgewendete Zeit für bürgerschaftliches Engagement <strong>in</strong> verschiedenen StudienTabelle 30Zeitbudgeterhebung1991/92Zeitbudgeterhebung2001/02Alterssurvey 1996Alterssurvey 2002( ): unsicherer Zahlenwert, da Fallzahl sehr ger<strong>in</strong>g.Quelle: Menn<strong>in</strong>g (2004), eigene Ergänzungen.Stunden pro MonatInsg. Männer Frauen16202219182621(24)18171519161715202118192824(30)19181519182017202320162319(19)1616(15)1915(11)Altersgruppe Bezugsgröße Quelle40-59 Jahre60-64 Jahre65-74 Jahre75+ Jahre40-59 Jahre60-64 Jahre65-74 Jahre75+ Jahre40-45 Jahre55-69 Jahre70-85 Jahre40-45 Jahre55-69 Jahre70-85 JahrebürgerschaftlichesEngagement:Aktive BeteiligungbürgerschaftlichesEngagement:EhrenamtEhrenamtliche Tätigkeiten<strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>enund VerbändenEhrenamtlicheTätigkeiten <strong>in</strong>Vere<strong>in</strong>en undVerbändenMenn<strong>in</strong>g 2004Menn<strong>in</strong>g 2004Kohli,Künemund 2001Künemund 2004Sowohl <strong>der</strong> Freiwilligensurvey als auch <strong>der</strong> Alterssurveybelegen, dass <strong>in</strong> den höheren Altersgruppen Männer imDurchschnitt mehr Zeit für ihre ehrenamtliche Arbeit aufwendenals Frauen mit e<strong>in</strong>em Ehrenamt. Die Unterschiedes<strong>in</strong>d gravierend. Es kann vermutet werden, dassdies mit <strong>der</strong> Struktur von Ehrenämtern <strong>in</strong> Zusammenhangsteht, dass Männer beispielsweise eher <strong>in</strong> zeit<strong>in</strong>tensivenLeitungsfunktionen von Vere<strong>in</strong>svorständen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>enGremien zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d als Frauen. Dies kann mit denvorliegenden Daten aber nicht belegt werden. E<strong>in</strong> Vergleich<strong>der</strong> Alterssurveys von 1996 und 2002 (Tabelle 30)zeigt weiter, dass nur <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 70- bis 85-jährigenMänner e<strong>in</strong> bedeuten<strong>der</strong> Anstieg des zeitlichen Umfangsim ehrenamtlichen Engagement stattgefunden hat.Dies gilt we<strong>der</strong> für die 55- bis 69-jährigen Männer nochfür die älteren Frauen <strong>in</strong>sgesamt, hier ist <strong>der</strong> Zeitumfangim Wesentlichen konstant geblieben.Fazit: Der Zeitaufwand älterer Menschen für die aktiveBeteiligung im bürgerschaftlichen Engagement ist beträchtlich.Der Zeitumfang für Ehrenämter liegt bei denMännern deutlich höher, bei den Frauen ist e<strong>in</strong> solchergenereller Zusammenhang nicht festzustellen. Im Zeitvergleichf<strong>in</strong>det sich lediglich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 70- bis85-jährigen Männer e<strong>in</strong> wesentlicher Anstieg des Zeitumfangsehrenamtlicher Aktivitäten.c) Nach den Ergebnissen des Alterssurveys ist gut dieHälfte <strong>der</strong> 40- bis 85-Jährigen Mitglied <strong>in</strong> m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>emVere<strong>in</strong> o<strong>der</strong> Verband, und von diesen s<strong>in</strong>d wie<strong>der</strong>umdie Hälfte Mitglied <strong>in</strong> m<strong>in</strong>destens zwei Vere<strong>in</strong>en o<strong>der</strong>Verbänden. Männer s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> allen Altersgruppen häufigerMitglied als Frauen. Und im Osten Deutschlands s<strong>in</strong>d solcheMitgliedschaften bei Männern und Frauen seltener alsim Westen. Beim Vergleich <strong>der</strong> Altersgruppen kann e<strong>in</strong>leichter Rückgang <strong>der</strong> Mitgliedschaftsanteile festgestelltwerden. Was die Häufigkeit <strong>der</strong> Teilnahme an Zusammenkünften,Veranstaltungen und Sitzungen betrifft, lässtsich zwischen 1996 und 2002 e<strong>in</strong>e leichte Zunahme erkennen– die 40- bis 85-Jährigen geben im Jahr 2002 etwashäufiger an, e<strong>in</strong>- o<strong>der</strong> mehrmals wöchentlich <strong>in</strong> diesenVere<strong>in</strong>en o<strong>der</strong> Verbänden e<strong>in</strong>gebunden zu se<strong>in</strong>. DieseIntensivierung zeigt sich <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei den Ruheständlernim Osten Deutschlands, <strong>in</strong> schwächerer Formaber auch im Westen.Neben diesen Mitgliedschaften <strong>in</strong> Gruppen, Vere<strong>in</strong>en undVerbänden hatte <strong>der</strong> Alterssurvey auch <strong>in</strong>formelle Gruppen<strong>in</strong> den Blick genommen: Treffen <strong>in</strong> <strong>in</strong>formellen, aberdennoch festen Gruppen, wie e<strong>in</strong>em Stammtisch, Kaffeeklatsch,Skatabende o<strong>der</strong> auch Gruppen, die regelmäßiggeme<strong>in</strong>sam wan<strong>der</strong>n. Wie bereits 1996 ergibt sich e<strong>in</strong> Anteilvon 40 Prozent bei den 40- bis 85-Jährigen, die sich <strong>in</strong>solchen <strong>in</strong>formellen Gruppen treffen. Die Partizipationsquotenimmt <strong>in</strong>sgesamt über die Altersgruppen h<strong>in</strong>wegbetrachtet leicht ab, und zwar beschleunigt etwa ab dem60. Lebensjahr. Bei den 40- bis 64-Jährigen s<strong>in</strong>d jedenfallsüber 40 Prozent, bei den 70- bis 85-Jährigen h<strong>in</strong>gegennur noch 30 Prozent <strong>in</strong> solche <strong>in</strong>formelle Gruppene<strong>in</strong>gebunden. Im Gegensatz zu 1996 zeigen sich <strong>in</strong> denDaten von 2002 ke<strong>in</strong>e signifikanten Zunahmen <strong>der</strong> Treffenüber die Altersgruppen h<strong>in</strong>weg.
Drucksache 16/2190 – 210 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeFazit: Ungefähr die Hälfte <strong>der</strong> über 40-Jährigen s<strong>in</strong>dMitglied <strong>in</strong> m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em Vere<strong>in</strong> o<strong>der</strong> Verband, Männerhäufiger als Frauen und Westdeutsche häufiger alsOstdeutsche. Fast ebenso hoch liegt die Beteiligung an<strong>in</strong>formellen Freizeit- und Geselligkeitsgruppen. Die aktiveTeilnahme an Vere<strong>in</strong>s- bzw. Verbandsaktivitäten hat<strong>in</strong> den letzten Jahren leicht zugenommen. Sowohl bei formellenals auch bei <strong>in</strong>formellen Gruppen nehmen Mitgliedschaftund aktive Beteiligung mit hohem Alter wie<strong>der</strong>ab.d) Vergleicht man die Engagementbereiche, <strong>in</strong> denen ältereMenschen tätig s<strong>in</strong>d, so zeigen die vorliegenden Studien,übere<strong>in</strong>stimmend, dass die Engagementbereiche„Sport und Bewegung“, „kirchlicher und religiöser Bereich“und „sozialer Bereich“, gefolgt von „Freizeit undGeselligkeit“ und „Kultur und Musik“ an <strong>der</strong> Spitze <strong>der</strong>Aufgabenfel<strong>der</strong> stehen, die von älteren Menschen übernommenwerden. Die Bereiche „Politik“, „Umwelt undNaturschutz“ und an<strong>der</strong>e bürgerschaftliche Aktivitätenfolgen bereits mit größerem Abstand. Rund 25 Prozent<strong>der</strong> sich ehrenamtlich engagierenden Älteren tun dies imBereich Sport und Bewegung, wobei die Anteile bei den50- bis 59-Jährigen noch höher liegen. Dah<strong>in</strong>ter folgenkirchliche bzw. religiöse Gruppen mit 22 Prozent und diewohltätigen Organisationen mit 20 Prozent (Brendgens,Braun 2001).Die relativ hohe Bedeutung sportlicher Aktivitäten wirdauch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er neueren Studie des Instituts für Freizeitwirtschaftbestätigt. Demnach betreiben knapp zwei Drittel<strong>der</strong> 55- bis 69-Jährigen sportliche Aktivitäten und nochüber 35 Prozent <strong>der</strong> 70-Jährigen und Älteren. Allerd<strong>in</strong>gszeigt sich mit zunehmendem Alter e<strong>in</strong>e Bedeutungsverschiebungim Sport: Während jüngere Menschen eher aufLeistung ausgerichtet s<strong>in</strong>d, orientieren sich Ältere eher an<strong>der</strong> Erhaltung und För<strong>der</strong>ung von Gesundheit und Fitness,wobei für Ältere die Umgebung immer größere Bedeutungbekommt. Dies heißt auch, dass sportbegleitendeund auf die konkreten Wünsche <strong>der</strong> Älteren e<strong>in</strong>gehendeAngebote wie Massagen, Gastronomie etc. gefragt s<strong>in</strong>d.Das wachsende Potenzial älterer Sportler<strong>in</strong>nen und Sportlererfor<strong>der</strong>t also auch e<strong>in</strong> Umdenken bei den traditionellenSportanbietern, sei es <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en o<strong>der</strong> <strong>in</strong> Fitnessstudios.Die beiden vorliegenden Wellen des Alterssurveys erlaubene<strong>in</strong>e Differenzierung nach Engagement <strong>in</strong> altersgruppenübergreifendenund altersspezifischen Kontexten(Künemund 2004). Nach den Analysen <strong>der</strong> zweiten Welledes Alterssurveys hat sich das Engagement zwischen1996 und 2002 nur m<strong>in</strong>imal von den altersunspezifischenGruppen h<strong>in</strong> zu den altersspezifischen Gruppen, Vere<strong>in</strong>enund Verbänden verlagert.Im altersspezifischen Segment <strong>der</strong> Vorruhestandsgruppen,Seniorengenossenschaften, Seniorenselbsthilfegruppen,Seniorenakademien sowie <strong>der</strong> Seniorenarbeit <strong>der</strong>Parteien und Gewerkschaften liegt die Quote <strong>der</strong> dort Aktivensehr niedrig. Als Mitglie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Seniorengenossenschafto<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er beliebigen Seniorenselbsthilfegruppebezeichnen sich nur 0,8 Prozent <strong>der</strong> 40- bis 85-Jährigen,1996 waren es ebenfalls 0,8 Prozent. An Seniorenakademienund Weiterbildungsgruppen beteiligen sich nur0,4 Prozent (1996: 0,3 Prozent), im Bereich <strong>der</strong> politischenInteressenvertretung Älterer, also <strong>in</strong> Seniorenbeirätenbzw. -vertretungen o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Seniorenarbeit vonParteien und Gewerkschaften 0,6 Prozent (1996: 0,7 Prozent).Seniorengenossenschaften und Seniorenselbsthilfegruppeno<strong>der</strong> Gruppen für freiwillige Tätigkeiten undHilfen haben ke<strong>in</strong>en Zuwachs zu verzeichnen, bei denParteien und Gewerkschaften s<strong>in</strong>d die Mitgliedschaftsquoten<strong>der</strong> 70- bis 85-Jährigen sogar eher <strong>zur</strong>ückgegangen.E<strong>in</strong>e leichte Zunahme zeigt sich h<strong>in</strong>gegen im „traditionellen“Bereich altersspezifischen Engagements – denSeniorenfreizeitstätten, -treffpunkten sowie Sport- undTanzgruppen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei den 55- bis 69-jährigenFrauen.Bei den altersunspezifischen Gruppen – auch bei den 70- bis85-Jährigen ist e<strong>in</strong>e Mitgliedschaft <strong>in</strong> diesem Bereich mitknapp 38 Prozent deutlich häufiger als solche im altersspezifischenBereich (15 Prozent) – liegen nach wie vordie Sportvere<strong>in</strong>e und geselligen Vere<strong>in</strong>igungen an ersterStelle. Beim altersunspezifischen Engagement gibt es beiden kirchlichen Gruppen e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gfügig höhere Zahlvon Nennungen <strong>der</strong> 55- bis 69-jährigen Frauen. Bei denpolitischen Parteien, wohltätigen Organisationen sowieden Heimat- und Bürgervere<strong>in</strong>en zeigt sich e<strong>in</strong>e leichteZunahme <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 70- bis 85-jährigen Männer.Fazit: Ältere Menschen beteiligen sich immer noch überwiegend<strong>in</strong> „traditionellen“ und „altersunspezifischen“Engagementbereichen wie Sportgruppen, kirchlichen undsozialen Organisationen o<strong>der</strong> Freizeit- und Geselligkeitsgruppen.„Neue“ und „altersspezifische“ Engagementfel<strong>der</strong>z.B. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Seniorenpolitik bleiben trotz hoher öffentlicherAufmerksamkeit weiterh<strong>in</strong> eher randständig.7.3.2 Engagementpotenziale undEngagementmobilitätWenn das freiwillige Engagement älterer Menschen geför<strong>der</strong>tund unterstützt werden soll, dann ist e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung<strong>der</strong> Engagementpotenziale und -reserven <strong>in</strong> <strong>der</strong>älteren Bevölkerung und <strong>der</strong> Mobilität des ehrenamtlichenEngagements wichtig.a) Zunächst setzt e<strong>in</strong> neu aufgenommenes o<strong>der</strong> erweitertesfreiwilliges Engagement e<strong>in</strong>e entsprechende Motivationund Bereitschaft voraus. Es gibt mehrere Wege, dasPotenzial für freiwilliges Engagement im Alter zu schätzen.Allerd<strong>in</strong>gs sollten die folgenden quantitativen Berechnungennicht über<strong>in</strong>terpretiert werden, da die Angabevon Häufigkeiten und prozentualen Verteilungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emhohen Maße abhängig ist von den jeweils zugrunde gelegtenDef<strong>in</strong>itionen und Messverfahren (Künemund2004). Die im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich niedrigen Engagementquotenwerden – trotz <strong>der</strong> schwierigen Vergleichbarkeitauf Grund unterschiedlicher Begriffstraditionen –ebenfalls <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel so <strong>in</strong>terpretiert, dass <strong>in</strong> Deutschlandnoch Engagementreserven bestehen. Auch wennman davor warnen muss, die Ergebnisse von Befragungen<strong>zur</strong> Engagementbereitschaft mit dem tatsächlich <strong>zur</strong>ealisierenden Engagementpotenzial gleichzusetzen, deu-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 211 – Drucksache 16/2190ten die Ergebnisse doch auf Engagementpotenziale h<strong>in</strong>,die nachgefragt werden können.In den beiden Freiwilligensurveys wurde das vorhandene,aber noch nicht verwirklichte Engagementpotenzial <strong>der</strong>älteren Bevölkerung ermittelt, <strong>in</strong>dem die Nicht-Engagiertengefragt wurden, ob sie zum freiwilligen Engagementeventuell o<strong>der</strong> bestimmt bereit wären. Die so ermitteltenBereitschaftsquoten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> folgenden Tabelle 31 abzulesen.Hier zeigt sich zwischen 1999 und 2004 e<strong>in</strong>deutlicher Anstieg <strong>der</strong> Engagementbereitschaft <strong>in</strong> allenAltersgruppen und bei beiden Geschlechtern: In <strong>der</strong>Gruppe <strong>der</strong> 45- bis 54-Jährigen von 25 auf 33 Prozent, beiden 55- bis 64-Jährigen von 22 auf 30 Prozent und beiden 65- bis 74-Jährigen von 12 auf 20 Prozent und beiden 75-Jährigen und Älteren von 7 auf 10 Prozent.Allerd<strong>in</strong>gs fehlen auch bestimmte Informationen h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> Engagementmöglichkeiten älterer Menschen.Zum e<strong>in</strong>en fehlen Daten über qualitative Engagementpotenziale– Ehrenamtliche können oft qualitativmehr als ihnen zugestanden wird und wären daher sicherhäufiger <strong>zur</strong> Übernahme von anspruchsvolleren Aufgabenbereit. Zum an<strong>der</strong>en wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> bisherigen Diskussione<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Nachfrage nach bürgerschaftlichemEngagement <strong>der</strong> älteren Bevölkerung unterstellt, ohnedass dieser Engagementbedarf <strong>in</strong>haltlich spezifiziert undquantitativ bewertet wird. Konkret: In welchen gesellschaftlichenFel<strong>der</strong>n möchten sich ältere Frauen undMänner engagieren und ihre Kompetenzen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>genund wo werden sie mit welchen Qualifikationen benötigt?Nur wenn diese Fragen beantwortet s<strong>in</strong>d, können zielundpassgenaue Maßnahmen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>unggeplant und verwirklicht werden. An<strong>der</strong>nfalls schult manSenior<strong>in</strong>nen und Senioren für Aufgaben und Aktivitäten,die wenig bis gar nicht nachgefragt werden, während <strong>in</strong>an<strong>der</strong>en sozialen Tätigkeitsfel<strong>der</strong>n ehrenamtliche Helfer<strong>in</strong>nenund Helfer benötigt werden, die dann aber we<strong>der</strong>qualitativ noch quantitativ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ausreichenden Maße<strong>zur</strong> Verfügung stehen.Fazit: Die geäußerte Bereitschaft, e<strong>in</strong> freiwilliges bzw.ehrenamtliches Engagement neu aufzunehmen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> bereitsbestehendes Engagement auszuweiten, ist <strong>in</strong> den letztenJahren deutlich angestiegen. Bei den 55- bis 64-Jährigenkann ungefähr e<strong>in</strong> Drittel, bei den 65- bis 74-Jährigenkann e<strong>in</strong> Fünftel <strong>der</strong> Bevölkerung <strong>zur</strong> Gruppe <strong>der</strong> Engagementbereitengezählt werden.b) Kennziffern <strong>zur</strong> Mobilität im Ehrenamt geben H<strong>in</strong>weisedarauf, wie dauerhaft e<strong>in</strong> Engagement ist und welche<strong>in</strong>stitutionellen Unterstützungsformen bei e<strong>in</strong>er eventuellhohen Fluktuation nötig s<strong>in</strong>d. Künemund (2004) hatauf <strong>der</strong> Basis des Alterssurveys berechnet, wie viele <strong>der</strong>1524 Teilnehmer <strong>der</strong> Längsschnittuntersuchung zwischen1996 und 2002 e<strong>in</strong> Ehrenamt neu aufgenommen (Zugang)o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> ausgeübtes Ehrenamt verlassen haben (Abgang),wie viele zu beiden Untersuchungszeitpunkten (Immer)o<strong>der</strong> zu ke<strong>in</strong>em Zeitpunkt (Nie) ehrenamtlich tätig waren.Die folgende Tabelle 32 zeigt diese Verän<strong>der</strong>ungen:Tabelle 31Bereitschaft zum freiwilligen Engagement nach Geschlecht und Alter45-54 Jahre1999200455-64 Jahre1999200465-74 Jahre1999200475 Jahre +19992004freiw.engag.40 %40 %35 %40 %27 %32 %17 %19 %Quelle: Freiwilligensurvey 2004, nachrichtlich TNS-Infratest 2005.Alle Männer FrauenbereitzumEng.25 %33 %22 %30 %12 %20 %7 %10 %nichtbereit35 %27 %43 %30 %61 %48%76 %71 %freiw.engag.45 %44 %41 %42 %31 %39 %bereitzumEng.22 %29 %20 %27 %12 %18 %nichtbereit33 %28 %39 %31 %57 %43 %freiw.engag.36 %36 %29 %37 %22 %2 %bereitzumEng.28 %37 %24 %33 %12 %21 %nichtbereit36 %27 %46 %30 %66 %53 %
Drucksache 16/2190 – 212 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 32Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> ehrenamtlichen Tätigkeiten 1996-2002 (Reihenprozente)Immer Zugang Abgang NieGesamt 9 % 9 % 11 % 71 %Alter46-60 Jahre61-75 Jahre76-91 JahreGeschlechtMännerFrauenRegionOstWestBildungNiedrigMittelHochQuelle: Künemund 2004.13 %7 %5 %11 %8 %6 %10 %4 %7 %14 %10 %11 %3 %10 %8 %6 %10 %6 %9 %11 %14 %10 %4 %13 %9 %8 %11 %4 %11 %12 %64 %73 %88 %67 %75 %80 %69 %87 %72 %64 %Von den Panelteilnehmern waren mehr als zwei Drittel zubeiden Befragungszeitpunkten nicht ehrenamtlich tätig(71 Prozent). Jeweils neun Prozent haben e<strong>in</strong> Engagementaufgenommen o<strong>der</strong> waren zu beiden Zeitpunktenengagiert, und elf Prozent haben ihr Engagement beendet.Tabelle 33 zeigt, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> jüngsten und auch <strong>der</strong> ältesten<strong>der</strong> hier betrachteten Altersgruppen das Engagementzu beiden Zeitpunkten am häufigsten zu f<strong>in</strong>den ist, während<strong>in</strong> <strong>der</strong> mittleren Altersgruppe sowohl die Zu- alsauch die Abgänge am häufigsten s<strong>in</strong>d. Diese höhere Fluktuationverweist möglicherweise auf Zusammenhänge mitdem Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. Männer haben ger<strong>in</strong>gfügighäufiger e<strong>in</strong> Engagement e<strong>in</strong>gestellt als e<strong>in</strong>es neuaufgenommen, bei den Frauen f<strong>in</strong>den wir das nicht. Unterschiedezwischen Ost und West lassen sich – e<strong>in</strong>malvon <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geren Partizipationsquote abgesehen – kaumausmachen. Höhere Bildung – ohneh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> stärkstenBestimmungsgründe des ehrenamtlichen Engagements –geht mit e<strong>in</strong>em etwas häufigeren Aufrechterhalten <strong>der</strong> Tätigkeite<strong>in</strong>her.Die folgende Tabelle 33 zeigt diese Befunde noch deutlicher.Hier wurden aus den von Künemund (2004) angegebenenWerten verschiedene Kennziffern berechnet. Diesegeben anschaulich Auskunft über die Zu- und Abgangsmobilitätenund die daraus ermittelte Fluktuationsrate desehrenamtlichen Engagements zwischen 1996 und 2002.Die höchsten Zugangsmobilitäten (Anteil <strong>der</strong> Zugängeam Endbestand) zeigen sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> mittleren Altersgruppe<strong>der</strong> 61- bis 75-Jährigen (62 Prozent) und <strong>in</strong> den beidenunteren Bildungsgruppen (niedrig: 58 Prozent, mittel:54 Prozent), während die höchsten Abgangsmobilitätenmit jeweils 60 Prozent <strong>in</strong> <strong>der</strong> mittleren Altersgruppe, <strong>der</strong>mittleren Bildungsgruppe und bei den Ostdeutschen zuverzeichnen s<strong>in</strong>d. Diese drei Gruppen weisen mit 61 Prozent(61- bis 75-Jährige), 57 Prozent (mittlere Bildung)und 55 Prozent (Ostdeutsche) auch die jeweils höchstenFluktuationsraten auf (errechnet aus den Mittelwerten <strong>der</strong>Zugangs- und Abgangsmobilitäten).Aus den hohen Mobilitäts- und Fluktuationsraten im ehrenamtlichenEngagement lässt sich folgern, dass sowohldie Betreuungskosten für Neuzugänge (Stichwort „Anlernen“)als auch die Abgangskosten (Stichwort „Erfahrungsverluste“)immens se<strong>in</strong> müssen. Diese dürften vorallem <strong>in</strong> <strong>der</strong> mittleren Altersgruppe <strong>der</strong> 61- bis 75-Jährigen,<strong>der</strong> mittleren Bildungsgruppe und bei den Ostdeutschenam höchsten se<strong>in</strong>. Aus <strong>der</strong> hohen Unbeständigkeitdes ehrenamtlichen Engagements älterer Menschen (wieauch <strong>der</strong> übrigen Altersgruppen) folgt, dass e<strong>in</strong>e dauerhafteund Erfolg versprechende Arbeit mit Ehrenamtlichennur mit e<strong>in</strong>em ausreichenden Bestand an festangestellten und professionellen Mitarbeitern zu bewerkstelligenist. Nur so kann die qualifizierte Aus- und Fortbildungsowie Begleitung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Mitarbeitergewährleistet und ihre geme<strong>in</strong>schaftliche Leistungserbr<strong>in</strong>gungauf e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche und qualitätsgesicherteBasis gestellt werden.Fazit: Das ehrenamtliche Engagement weist e<strong>in</strong>e sehrhohe Zugangs- und Abgangsmobilität auf. Für den relativkurzen Zeitraum von sechs Jahren dokumentiert <strong>der</strong> Alterssurveye<strong>in</strong>e Fluktuationsrate von über fünfzig Prozent.Die mittlere Altersgruppe <strong>der</strong> 61- bis 75-Jährigenund die Ostdeutschen s<strong>in</strong>d von e<strong>in</strong>er beson<strong>der</strong>s hohenFluktuation gekennzeichnet.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 213 – Drucksache 16/2190Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> ehrenamtlichen Tätigkeiten 1996-2002 (Kennziffern)Tabelle 33Zugangsmobilität Abgangsmobilität FluktuationsrateGesamt 50 % 55 % 53 %Alter46-60 Jahre61-75 Jahre76-91 JahreGeschlechtMännerFrauenRegionOstWestBildungNiedrigMittelHoch42 %62 %37 %47 %50 %50 %49 %58 %54 %43 %Engagierte 1996 = Immer + AbgangEngagierte 2002 = Immer + ZugangSaldo = Engagierte 2002 – Engagierte 1996Zugangsmobilität = Zugang / Engagierte 2002 * 100Abgangsmobilität = Abgang / Engagierte 1996 * 100Fluktuationsrate = (Zugangsmobilität + Abgangsmobilität) / 2Quelle: eigene Berechnungen nach Künemund 2004.51 %60 %43 %54 %51 %60 %52 %47 %60 %47 %47 %61 %40 %51 %51 %55 %50 %52 %57 %45 %7.3.3 Soziale Ungleichheiten im freiwilligenEngagementDie Teilnahme an geme<strong>in</strong>schaftlichen Aktivitäten und amfreiwilligen bzw. ehrenamtlichen Engagement verteiltsich nicht gleichmäßig über alle sozialen Gruppen, son<strong>der</strong>nfolgt <strong>in</strong> vielen Bereichen e<strong>in</strong>em Muster <strong>der</strong> sozialenUngleichheit. Dies zeigen Ergebnisse des Freiwilligensurveysvon 2004.a) Aus Tabelle 34 ist abzulesen, wie wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>der</strong>Zugang zum freiwilligen Engagement <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> verschiedenensozialen Gruppen ist.Zunächst verr<strong>in</strong>gern sich die Engagementquoten kont<strong>in</strong>uierlichmit dem Alter, von 40 Prozent <strong>in</strong> <strong>der</strong> jüngsten Altersgruppe(45 bis 54 Jahre) auf 29 Prozent <strong>in</strong> <strong>der</strong> ältestenGruppe (65 bis 74 Jahre), was bei <strong>der</strong> Interpretation <strong>der</strong>nachfolgenden Ergebnisse zu beachten ist. Männer s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>allen Altersgruppen häufiger ehrenamtlich engagiert alsFrauen, wobei die jeweiligen Quoten mit höherem Alterwie<strong>der</strong> abnehmen. Die Haushaltsgröße spielt ebenfalls e<strong>in</strong>egewichtige Rolle: Je größer <strong>der</strong> Haushalt, desto wahrsche<strong>in</strong>licherdas ehrenamtliche Engagement – was möglicherweiseauf die sozialen Unterstützungsleistungen <strong>der</strong> anwesendenHaushaltsmitglie<strong>der</strong> <strong>zur</strong>ückgeführt werden kann.Über die drei Altersgruppen h<strong>in</strong>weg bleibt das Engagement<strong>der</strong> Erwerbstätigen relativ konstant und schwanktzwischen 41 und 42 Prozent, während das Engagement<strong>der</strong> Nicht-Erwerbstätigen <strong>in</strong> allen Altersgruppen niedrigerals das <strong>der</strong> Erwerbstätigen ist. Dies kann e<strong>in</strong>erseits etwasmit <strong>der</strong> Berufsnähe des freiwilligen Engagements zu tunhaben, an<strong>der</strong>erseits kann sich hier aber auch e<strong>in</strong> Effektdes beruflichen Sozialstatus verbergen. Darauf würde diedeutliche Abhängigkeit des freiwilligen Engagementsvom Berufsstatus h<strong>in</strong>deuten: Die Trennl<strong>in</strong>ie verläuft erkennbarzwischen den Arbeitern und den höheren Statusgruppen<strong>der</strong> Angestellten, Beamten und Selbstständigen,zwischen denen kaum Unterschiede bestehen. In <strong>der</strong>Gruppe <strong>der</strong> 45- bis 54-Jährigen s<strong>in</strong>d zwischen 46 und43 Prozent <strong>der</strong> höheren Statusgruppen freiwillig engagiert,jedoch nur 27 Prozent <strong>der</strong> Arbeiter; vergleichbareEngagementverhältnisse f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe<strong>der</strong> 65- bis 74-Jährigen mit jeweils 33 Prozent <strong>der</strong> Selbstständigensowie Angestellten und Beamten, aber nur19 Prozent <strong>der</strong> Arbeiter. E<strong>in</strong>en sehr deutlichen Effekt aufdie Engagementhäufigkeit übt <strong>der</strong> formale Bildungsabschlussaus: Je höher <strong>der</strong> Schulabschluss, desto häufigere<strong>in</strong> freiwilliges Engagement, und zwar über alle Altersgruppenh<strong>in</strong>weg. Schließlich trennen auch die E<strong>in</strong>kommensverhältnissedie Engagierten von den Nicht-Engagierten, denn die Häufigkeit des freiwilligen Engagementssteigt kont<strong>in</strong>uierlich an mit <strong>der</strong> Höhe desHaushaltse<strong>in</strong>kommens.Die Unterschiede im Engagement zwischen Ost- undWestdeutschland sollen <strong>in</strong> <strong>der</strong> folgenden Tabelle 35 noche<strong>in</strong>mal verdeutlicht werden. Sowohl <strong>der</strong> Alterssurvey alsauch <strong>der</strong> Freiwilligensurvey f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> den alten Bundeslän<strong>der</strong>ndeutlich höhere Engagementquoten als <strong>in</strong> denneuen Bundeslän<strong>der</strong>n, und zwar zu beiden Untersuchungszeitpunkten.Zwar haben sich im Zeitverlauf dieEngagementquoten <strong>in</strong> Ost- und West-Deutschland jeweilserhöht, ohne dass sich jedoch <strong>der</strong> Abstand zwischen ihnenverr<strong>in</strong>gert hat.
Drucksache 16/2190 – 214 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 34Soziale Ungleichheit des freiwilligen Engagements: Anteile <strong>in</strong> sozialen GruppenAnteile <strong>der</strong> freiwillig Engagierten nachsoziodemografischen MerkmalenQuelle: Freiwilligensurvey 2004, nachrichtlich TNS-Infratest 2005.45 bis 54JahreAltersgruppe55 bis 64Jahre65 bis 74JahreInsgesamt 40 % 37 % 29 %GeschlechtMänner44 % 41 % 35 %Frauen36 % 33 % 24 %HaushaltsgrößeErwerbsstatusberufliche StellungBildungHaushaltse<strong>in</strong>kommen(ungewichtet)1 Person2 Personenmehr als 2 Personenerwerbstätignicht erwerbstätigArbeiterAngestellte/BeamteSelbstständigeKe<strong>in</strong> AbschlussHauptschulemittlere Reife / FHSAbitur / Hochschulebis 750 €750 – 1.500 €1.500 – 2.500 €2.500 – 4.000 €über 4.000 €33 %32 %45 %42 %34 %27 %43 %46 %36 %34 %40 %47 %21 %30 %41 %46 %52 %31 %37 %41 %41 %34 %24 %40 %43 %33 %29 %39 %49 %20 %30 %39 %45 %54 %24 %31 %31 %42 %29 %19 %33 %33 %24 %21 %37 %38 %14 %26 %33 %41 %41 %Tabelle 35Soziale Ungleichheit des freiwilligen Engagements: Ost-West-UnterschiedeFreiwilligensurvey 1999(freiwilliges Engagement)Freiwilligensurvey 2004(freiwilliges Engagement)Alterssurvey 1996(Ehrenamtliche Tätigkeiten <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>enund Verbänden)Alterssurvey 2002(Ehrenamtliche Tätigkeiten <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>enund Verbänden)Altersgruppe45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre40-54 Jahre55-69 Jahre70-85 Jahre40-54 Jahre55-69 Jahre70-85 JahreQuellen: Gensicke 2004 (Freiwilligensurvey); Künemund 2004 (Alterssurvey).Gesamt40 %35 %27 %40 %40 %32 %22 %13 %7 %23 %21 %9 %Ost-West-UnterschiedeAlteBundeslän<strong>der</strong>43 %37 %27 %42 %41 %34 %23 %14 %7 %25 %22 %10 %NeueBundeslän<strong>der</strong>32 %29 %23 %34 %35 %25 %15 %10 %4 %15 %15 %6 %
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 215 – Drucksache 16/2190Fazit: Die Beteiligung am ehrenamtlichen Engagementist e<strong>in</strong>deutig sozial ungleich verteilt: Je gehobener <strong>der</strong>bildungsbezogene, berufliche und ökonomische Status e<strong>in</strong>erPerson ist, desto eher wird diese ehrenamtlich tätig.Der sozial ungleiche Zugang zum Engagement hat sichlaut Freiwilligensurvey <strong>in</strong> den letzten Jahren sogar verschärft.Weiter s<strong>in</strong>d die „jungen Alten“ häufiger engagiertals die „älteren“ Alten, Männer häufiger als Frauenund Westdeutsche häufiger als Ostdeutsche.b) E<strong>in</strong>e genauere E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Potenziale an ehrenamtlichemEngagement und Teilhabe älterer und alterMenschen setzt auch e<strong>in</strong>e geschlechtsspezifische Differenzierungvoraus (Backes 1987; 2000): Frauen undMänner s<strong>in</strong>d unterschiedlich und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er hierarchischstrukturierten Weise auf Engagementformen verteilt. Diesgilt während des gesamten Lebensverlaufs bis <strong>in</strong>s Alter.Während Männer sich häufiger <strong>in</strong> so genannten politischenEhrenämtern (Vorständen, Beiräten) engagieren,bleiben Frauen eher konzentriert auf das soziale Ehrenamt,auf unmittelbare Arbeit mit und für Hilfebedürftige(Besuchsdienste, Alltagshilfen für Kranke). Je anerkannter,prestigeverbundener, e<strong>in</strong>flussreicher und <strong>in</strong> diesemS<strong>in</strong>ne politischer e<strong>in</strong> Ehrenamt ist, desto eher f<strong>in</strong>den sichdort Männer. Und umgekehrt, je unauffälliger, verborgener,alltäglicher und <strong>in</strong> unmittelbare menschliche Alltagsbeziehungene<strong>in</strong>gebettet das Engagement ist, desto eherwird es von Frauen (auch im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> „typisch weiblichenBeziehungsarbeit“) geleistet. Diese seit langem bekanntenZusammenhänge werden auch von den Daten desFreiwilligensurvey bestätigt (Tabelle 36).Tabelle 36Soziale Ungleichheit des freiwilligen Engagements: GeschlechterproportionenLeistungen/TätigkeitenPersönliche HilfeOrganisation von HilfsprojektenOrganisation und Durchführung von Treffen undVeranstaltungenBeratungPädagogische Betreuung o<strong>der</strong> die Anleitung e<strong>in</strong>erGruppeInteressenvertretung und MitspracheInformations- und ÖffentlichkeitsarbeitVerwaltungstätigkeitenPraktische ArbeitenVernetzungsarbeitMittelbeschaffungQuelle: Freiwilligensurvey 2004.Alter Männer Frauen45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre45-54 Jahre55-64 Jahre65-74 Jahre41 %47 %47 %48 %57 %63 %53 %56 %59 %54 %60 %64 %51 %57 %62 %54 %61 %69 %56 %59 %68 %61 %61 %76 %53 %52 %58 %53 %64 %68 %57 %65 %72 %59 %53 %53 %52 %43 %37 %47 %44 %41 %46 %40 %36 %49 %43 %38 %46 %39 %31 %44 %41 %32 %39 %39 %24 %47 %48 %42 %47 %36 %32 %43 %35 %28 %
Drucksache 16/2190 – 216 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeH<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> erbrachten Leistungen im Ehrenamtübernehmen Männer häufiger die Vertretung von Interessen,die Organisation von Veranstaltungen und Informations-und Öffentlichkeitsarbeiten, während Frauen häufigerpersönliche Hilfen o<strong>der</strong> praktische Arbeiten leisten.Bei <strong>der</strong> Interpretation <strong>der</strong> Tabelle 36 ist es <strong>in</strong>sgesamtwichtig zu beachten, dass sich dar<strong>in</strong> zum Teil auch dieunterschiedlich hohen Engagementquoten von Männernund Frauen spiegeln (Männer 45 bis 54 Jahre: 44 Prozent,55 bis 64 Jahre: 41 Prozent, 65 bis 74 Jahre: 35 Prozent;Frauen 45 bis 54 Jahre: 36 Prozent, 55 bis 64 Jahre:33 Prozent, 65 bis 74 Jahre: 24 Prozent).Zugespitzt formuliert, fühlen sich Männer eher für diesichtbaren Tätigkeiten auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>bühne zuständig,während Frauen eher die weniger sichtbaren Aufgabenauf <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbühne übernehmen. Dies bestätigt die vonBackes (1987) getroffene Unterscheidung zwischen e<strong>in</strong>emmännlich dom<strong>in</strong>ierten „politischen“ und e<strong>in</strong>emweiblich dom<strong>in</strong>ierten „sozialen“ Ehrenamt.Bereits die erste Erhebung des Freiwilligensurveys hatgezeigt, dass auch die Beteiligung an den unterschiedlichenEngagementfel<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e geschlechtsspezifische Verteilungaufweist. Die genannten „politischen“ Tätigkeitenüben Männer vor allem <strong>in</strong> den von ihnen dom<strong>in</strong>ierten Bereichen„Sport und Bewegung“, „Kultur und Musik“ und„Freizeit und Geselligkeit“ aus, während Frauen mit ihren„sozialen“ Tätigkeiten vorherrschend im „kirchlich-religiösenBereich“ und im „sozialen Bereich“ tätig s<strong>in</strong>d(Brendgens & Braun 2001).Auch aus <strong>der</strong> Geschlechterperspektive kommt <strong>der</strong> Frage<strong>der</strong> Bildung als Zugangsbarriere o<strong>der</strong> Zugangsvoraussetzungfür angemessene und gewünschte Engagementformene<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu: Heute ältere und alteFrauen benötigen häufig spezifische Qualifikationsangeboteund Motivationshilfen, um sich die Engagementformenzuzutrauen, die bislang eher von Männern wahrgenommenwerden (politisches Ehrenamt). Und umgekehrt:Um Männer stärker für soziale Ehrenämter zu qualifizierenund zu motivieren, bedarf es ebenfalls gezielter Angebote.Fazit: Ältere Männer verteilen sich stärker auf die prestigeträchtigerenBereiche und Tätigkeiten des „politischen“Ehrenamtes, während ältere Frauen sich weiterh<strong>in</strong>stärker auf die unsche<strong>in</strong>bareren Aktivitäten <strong>in</strong> denBereichen des „sozialen Ehrenamtes“ konzentrieren.7.3.4 Produktivität im Alter: Fazit undAusblickDie Produktivität älterer Menschen ist beträchtlich. Diesbetrifft vor allem die ehrenamtlichen Aktivitäten aberauch Hilfe- und Transferleistungen <strong>in</strong> Familie und sozialenNetzwerken wie Pflegetätigkeiten und K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungsowie die gezielte Weitergabe von Kenntnissen undFertigkeiten (z.B. Projekte im Kontext von „Erfahrungswissen“,Senior-Experten-Service und Wissensbörsen).Diese Tätigkeiten haben – im Gegensatz zu stärker konsumtivgerichteten Tätigkeiten – nicht nur <strong>in</strong>dividuellenWert, z.B. S<strong>in</strong>nerfüllung und soziale Integration, son<strong>der</strong>nzusätzlich e<strong>in</strong>en ökonomischen und gesellschaftlichenWert. Ihre Bedeutung lässt sich erahnen, wenn man berücksichtigt,dass für viele dieser Tätigkeiten – würdensie nicht weitgehend unentgeltlich erbracht – sozialstaatlicheMittel aufgebracht werden müssten. Auch hängt dieFunktionsfähigkeit vieler <strong>in</strong>termediärer Organisationen– z.B. <strong>der</strong> Wohlfahrtsverbände, aber auch <strong>der</strong> Sportvere<strong>in</strong>e– zu e<strong>in</strong>em großen Teil von <strong>der</strong> Bereitschaft zu ehrenamtlichemEngagement ab. Es geht hier nicht nur umden Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en, son<strong>der</strong>n darüber h<strong>in</strong>ausum jenen <strong>der</strong> Gesellschaft <strong>in</strong>sgesamt – um den „sozialenKitt“, <strong>der</strong> aktuell auch <strong>in</strong> den Diskussionen um die„Bürger-“ o<strong>der</strong> „Zivilgesellschaft“ e<strong>in</strong>gefor<strong>der</strong>t wird.Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die bürgerschaftlich und ehrenamtlich aktivenÄlteren <strong>in</strong>sgesamt gesehen trotz ansteigen<strong>der</strong> Engagementquotennoch immer <strong>in</strong> <strong>der</strong> M<strong>in</strong><strong>der</strong>heit (wie <strong>in</strong> an<strong>der</strong>enAltersgruppen auch). Die aktiven älteren Menschenweisen h<strong>in</strong>sichtlich ihrer soziodemografischen Merkmalee<strong>in</strong>ige Beson<strong>der</strong>heiten auf (<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im H<strong>in</strong>blick aufBildung), die darauf schließen lassen, dass sich im Zuge<strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Ressourcen dieserPersonenkreis erweitern könnte. Allerd<strong>in</strong>gs könnte zugleichauch <strong>der</strong> Anteil jener Älteren steigen, die e<strong>in</strong>e solcheProduktivität nicht erbr<strong>in</strong>gen können. Gesellschaftlichs<strong>in</strong>nvolle und „produktive“ Tätigkeiten wie auchfamiliale Unterstützungsleistungen setzen entsprechendeRessourcen voraus, diese wie<strong>der</strong>um e<strong>in</strong>en gut ausgebautenSozialstaat. Diese Voraussetzung steht aber zunehmend<strong>in</strong>frage. L<strong>in</strong>eare Kürzungen etwa bei den Renten– z.B. e<strong>in</strong> Aussetzen <strong>der</strong> Rentenanpassung kann so betrachtetwerden – treffen nicht nur die Älteren selbst, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>edie ohneh<strong>in</strong> schlechter Gestellten, son<strong>der</strong>nüber <strong>der</strong>en Unterstützungsleistungen und Engagementauch die jüngeren Altersgruppen sowie die Gesellschaftund ihren Zusammenhalt <strong>in</strong>sgesamt.Für die nähere Zukunft spricht vieles dafür, dass sich diequantitative Verbreitung des Engagements älterer Menschen<strong>in</strong> Deutschland erhöhen wird. Heute liegen dieSchwerpunkte <strong>in</strong> den meisten Partizipationsfel<strong>der</strong>n nochim traditionellen Bereich von Verbänden und Organisationen,<strong>in</strong> denen die Älteren vielfach als „Stamm-Mitglie<strong>der</strong>“gelten können und zu e<strong>in</strong>em großen Teil eher passiveFormen <strong>der</strong> Beteiligung realisieren. In Zukunft dürftendie Partizipationsansprüche <strong>der</strong> Älteren anspruchsvollerwerden und sich vermehrt auch auf selbstorganisierte undselbstbestimmte Formen richten. Tendenzen <strong>in</strong> dieserRichtung lassen sich seit langem beobachten, s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs<strong>in</strong> den großen Surveys noch nicht nachweisbar. Siewerden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sozialpolitik und <strong>der</strong> sozialen Arbeit mitälteren Menschen stark forciert, aber offensichtlich habensie sich noch nicht breit durchsetzen können.Liest man den sozialpolitischen Handlungsbedarf alle<strong>in</strong>an den Ungleichheiten zwischen den Altersgruppen ab,wie sie z.B. <strong>in</strong> den beiden Wellen des Alterssurvey sichtbarwerden, wären verstärkte För<strong>der</strong>ungen h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> Bildung von Älteren, und hier <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e im Gebrauch<strong>der</strong> neuen Technologien, Computern und Internetangezeigt. Diese müssten zudem so gesteuert werden,dass auch und gerade bildungsungewohnte Schichten e<strong>in</strong>-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 217 – Drucksache 16/2190bezogen werden können, sollen nicht bestehende Bildungsungleichheitenverstärkt werden und die För<strong>der</strong>mittelausschließlich bei denen ankommen, die ohneh<strong>in</strong>schon im Umgang mit Bildung und den neuen Technologiengeübt s<strong>in</strong>d. Darüber h<strong>in</strong>aus könnten die Voraussetzungenfür e<strong>in</strong> aktives Engagement und gesellschaftlichePartizipation Älterer – z.B. rechtliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen,Infrastruktur, Altersbil<strong>der</strong>, aber auch Sicherheit undVerlässlichkeit <strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommen – weiter im Blickbehalten und verbessert werden, um e<strong>in</strong> erfolgreiches Alternsowohl auf <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen, als auch <strong>der</strong> gesellschaftlichenEbene zu ermöglichen.7.4 Ziele und Ambivalenzen <strong>der</strong>Engagementför<strong>der</strong>ung7.4.1 ZieleDie Kommission möchte Möglichkeiten <strong>zur</strong> Verbesserung<strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen aufzeigen, um mehr ältereund alte Menschen zu e<strong>in</strong>em bürgerschaftlichen Engagementzu motivieren. Sie sieht <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stärkung des bürgerschaftlichenEngagements und <strong>der</strong> entsprechenden Teilhabee<strong>in</strong>en Beitrag, Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebensphase Alterdabei zu unterstützen, ihre Potenziale und Kompetenzenfür sich selbst und für die Gesellschaft s<strong>in</strong>nvoll e<strong>in</strong>zusetzen.För<strong>der</strong>ung von Engagement und Partizipation im Alterbedeutet somit immer gezielte Qualifikation, Motivationund Unterstützung im H<strong>in</strong>blick auf Formen desaktiven und ehrenamtlichen Engagements, die den jeweiligensozial differenzierten Gruppen älterer und alterFrauen und Männer am ehesten entsprechen. Dies wie<strong>der</strong>umwird als Beitrag <strong>zur</strong> Stärkung <strong>der</strong> gesellschaftlichenSolidarität angesichts <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ungen desdemografischen Wandels e<strong>in</strong>geschätzt. Gleichzeitig liegtnach E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Kommission <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erhöhung desEngagements das Potenzial, partizipative und direktdemokratischeBeteiligungsformen vermehrt zu etablierenund zu stärken.Neben den Chancen, welche die För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichenEngagements <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e älterer Menschenbietet, sieht die Kommission jedoch auch Risiken, die mit<strong>der</strong> <strong>in</strong>tensiven Diskussion um die Stärkung des Bürgerengagementsund des Umbaus des Sozialstaats verbundens<strong>in</strong>d. Die E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> entsprechenden öffentlichenDiskussion zum Bürgerengagement bleibt <strong>in</strong> <strong>der</strong> 5. Altenberichtskommissionvon Wi<strong>der</strong>sprüchen und Ambivalenzengekennzeichnet. Dieser Altenbericht hat sich jedochzum Ziel gesetzt, ausdrücklich die Chancen herauszuarbeitenund zu betonen, die für Menschen im Alter und dieGesellschaft mit <strong>der</strong> Ausweitung <strong>der</strong> Engagementmöglichkeitenverbunden s<strong>in</strong>d. Die Kommission will zu <strong>der</strong>enEntwicklung und För<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>en Beitrag leisten, wasdie sorgfältige Abwägung von Chancen und Risiken impliziert.Sie hat das Anliegen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit das Bildvon Frauen und Männern im Alter als Träger von Kompetenzenund Potenzialen für die Gesellschaft (auch <strong>in</strong> Formvon Selbsthilfe und eher verdeckten Engagementformen)stärker zu verankern. Zwar geht die Kommission nicht davonaus, dass e<strong>in</strong> generell negatives Altersbild <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaftdom<strong>in</strong>iert. Die Leistungspotenziale ältererMenschen werden allerd<strong>in</strong>gs nicht angemessen wahrgenommen.Damit geht e<strong>in</strong>her, dass die Chancen, diesePotenziale gesellschaftlich stärker nachzufragen, nichth<strong>in</strong>reichend genutzt werden.Die <strong>Lage</strong>analyse zeigt, dass e<strong>in</strong>e hohe Fluktuation <strong>in</strong> <strong>der</strong>Gruppe Engagierter stattf<strong>in</strong>det und <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Engagement-Aussteigernach den Analysen des Alterssurveybeachtlich ist. Dies verweist darauf, dass es nichtselbstverständlich ist, dass ältere Menschen ihr e<strong>in</strong>malbegonnenes Engagement aufrechterhalten. Ziel <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ungmuss es daher se<strong>in</strong>, bereits bestehendesEngagement zu stabilisieren, se<strong>in</strong>en Fortbestand zu för<strong>der</strong>nund auf Grund <strong>der</strong> zunehmenden Orientierung anepisodenhaftem, projektorientiertem Engagement Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>stiegeund Umstiege <strong>in</strong> ehrenamtliches Engagementzu unterstützen und zu organisieren. Hierzu sei aberangemerkt, dass wir zwar die Motive, e<strong>in</strong> Engagementaufzunehmen, benennen können, aber wenig über dieGründe wissen, e<strong>in</strong> bestehendes Engagement weiter fortzusetzen.Das Engagement Älterer ist – wie <strong>in</strong> den an<strong>der</strong>en Altersgruppenauch – sozial hoch selektiv. Sowohl <strong>der</strong> Freiwilligensurveyals auch <strong>der</strong> Alterssurvey haben den starkenZusammenhang zwischen e<strong>in</strong>em hohen formalen Bildungsabschlussund <strong>der</strong> Aktivität im bürgerschaftlichenEngagement bestätigt. Auch bei den älteren Engagiertenf<strong>in</strong>den sich überproportional Personen mit höheren Bildungsabschlüssen.Außerdem f<strong>in</strong>den sich auch bei den älterenund alten Menschen mehr Männer <strong>in</strong> attraktiveren,z.B. auch politisch gestaltenden und mit E<strong>in</strong>fluss ausgestattetenEhrenämtern, mehr Frauen jedoch <strong>in</strong> unmittelbaren,manchmal öffentlich kaum wahrgenommenen, sozialenHilfsdiensten. Daher sollte verstärkt Frauen wieMännern, sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen,Bewohner<strong>in</strong>nen und Bewohnern verschiedener Regionensowie Angehörigen verschiedener Nationalitäten und Migranten<strong>der</strong> Zugang zu Engagementformen gleichermaßenermöglicht werden.Die Kommission geht davon aus, dass e<strong>in</strong> freiwilligeso<strong>der</strong> bürgerschaftliches Engagement Zugang zu sozialenNetzwerken und zu Infrastrukturressourcen erschließenkann und dass die politische Beteiligung und die Vertretungeigener Interessen im politischen Prozess dadurchgeför<strong>der</strong>t wird. Bürgerschaftliches Engagement ist alsonicht nur altruistisches Geben, son<strong>der</strong>n erschließt den Aktivenauch Ressourcen, erweitert <strong>der</strong>en Human- und Sozialkapitalsowie ihre Reputation. Um zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, dassdie Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements mit<strong>der</strong> Gefahr e<strong>in</strong>er Vergrößerung <strong>der</strong> sozialen Ungleichheite<strong>in</strong>hergeht, muss die För<strong>der</strong>ung des Zugangs von bildungsfernenGruppen zu traditionellen und neuen Engagementformenstärker <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>grund gerückt werden.Die Seniorenpolitik war bisher sehr erfolgreich mit engagementför<strong>der</strong>ndenMaßnahmen, von denen überwiegendbildungsgewohnte ältere Menschen profitiert haben.Im Ergebnis lagen häufig <strong>der</strong> ideelle als auch <strong>der</strong> f<strong>in</strong>anzielleSchwerpunkt <strong>der</strong> bisherigen För<strong>der</strong>politik eher aufgesellschaftlich durchsetzungsfähigen Zielgruppen wie
Drucksache 16/2190 – 218 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeden Seniorenstudenten und Seniorenstudent<strong>in</strong>nen sowiequalifizierten Senioren-Experten und Senioren-Expert<strong>in</strong>nen.Das Spektrum <strong>der</strong> Modellprojekte sollte zukünftig soerweitert werden, dass <strong>der</strong> Anschluss zu Ergebnissen desBund-Län<strong>der</strong>-Programms „Stadtteile mit beson<strong>der</strong>emEntwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ explizit gesuchtwird. Hier konnten Erfolge bei <strong>der</strong> Aktivierung von traditionellweniger engagierten Gruppen durch Konzepte <strong>der</strong>Sozialraumorientierung und Geme<strong>in</strong>wesenarbeit sowie<strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Bewohnern <strong>in</strong> benachteiligten Wohnquartierenerzielt werden (Walther 2002).7.4.2 Ambivalenzen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ungBereits <strong>der</strong> flüchtige Blick auf die e<strong>in</strong>schlägigen Debattenzeigt, dass das aktuelle gesellschaftliche und politischeInteresse am bürgerschaftlichen Engagement Älterer alsambivalent zu bewerten ist. Ältere Menschen s<strong>in</strong>d von<strong>der</strong> Debatte um das bürgerschaftliche Engagement <strong>in</strong>zweifacher H<strong>in</strong>sicht betroffen. Zum e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d sie Zielgruppedes traditionellen helfenden Ehrenamtes. Die Verlängerung<strong>der</strong> Lebenserwartung und die zunehmendeZahl Hochaltriger sorgt auf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Seite dafür, dass dieNachfrage nach ehrenamtlicher Hilfeleistung steigt, währenddie Zahl potenziell Helfen<strong>der</strong> im jüngeren Lebensalter<strong>zur</strong>ückgeht. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite wurde durch dasH<strong>in</strong>ausschieben von gesundheitlichen E<strong>in</strong>schränkungenauf immer spätere Lebensjahre und die Entberuflichungim frühen Alter e<strong>in</strong>e Phase des dritten Lebensalters geschaffen,die i.d.R. bei guter Gesundheit und mit ausreichendenzeitlichen und f<strong>in</strong>anziellen Ressourcen verbrachtwird. Die älteren Menschen im dritten Lebensalter werdenmit unterschiedlichen Begründungen als die Gruppegesehen, die ihr bürgerschaftliches Engagement amstärksten ausweiten kann und soll, um die Belastungendes allgeme<strong>in</strong>en, und des dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>gebetteten demografischenStrukturwandels abzufe<strong>der</strong>n.Damit kommt <strong>der</strong> Diskussion um das Engagement <strong>der</strong> sogenannten „jungen Alten“ e<strong>in</strong>e wichtige Stellung im Diskursum die Neupositionierung von sozialstaatlichenLeistungen, marktförmigen Versorgungsformen, familialerUnterstützung und bürgerschaftlichem Engagementzu. Allerd<strong>in</strong>gs droht dem Thema im Kontext <strong>der</strong> Diskussionenum den Umbau des Sozialstaats sowie <strong>der</strong> Gerechtigkeitzwischen den <strong>Generation</strong>en e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>seitig <strong>in</strong>teressengeleiteteInstrumentalisierung. E<strong>in</strong> damit verbundenersozialökonomischer Utilitarismus zeigt sich an entsprechendenFormulierungen – wenn ältere Menschen primärals „Humanressourcen“ angesehen werden, <strong>der</strong>en Potenziale<strong>zur</strong> gesellschaftlichen Nutzung verfügbar gemachtwerden müssen, wor<strong>in</strong> sich auch e<strong>in</strong>e Missachtung desEigens<strong>in</strong>nes und <strong>der</strong> Selbstbestimmung älterer Menschenausdrückt. Zudem haben ältere Menschen schon <strong>in</strong> ihrerVergangenheit viel für die Gesellschaft geleistet und dürfennicht nur an ihren gegenwärtigen Beiträgen gemessenund bewertet werden. Die För<strong>der</strong>ung des Engagementsälterer Menschen sollte daher immer die Freiwilligkeit<strong>der</strong> Beteiligung betonen und ke<strong>in</strong>en sozialen Pflichtenkatalogdef<strong>in</strong>ieren. Umgekehrt dürfen allerd<strong>in</strong>gs auch die<strong>in</strong>dividuellen Chancen, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ungliegen, nicht unterschätzt werden.Positiv an <strong>der</strong> erhöhten Aufmerksamkeit für das bürgerschaftlicheEngagement Älterer ist, dass e<strong>in</strong> lange Zeitverdrängtes und an den Rand abgeschobenes Thema e<strong>in</strong>enzentralen Platz im gesellschaftlichen Diskurs zugewiesenbekommt. Angesichts <strong>der</strong> deutschen Tradition undpolitischen Kultur des (sozialstaatlichen) Etatismus e<strong>in</strong>erseitssowie <strong>der</strong> Markteuphorie und Ökonomisierungstendenzen<strong>der</strong> letzten Jahre an<strong>der</strong>erseits ist es e<strong>in</strong> ermutigendesZeichen, dass die aktiv-bürgerschaftlichen Potenzialeneu ausgelotet werden. Der 5. Altenbericht schließt sich<strong>der</strong> E<strong>in</strong>schätzung <strong>der</strong> Enquete-Kommission „Zukunft desBürgerschaftlichen Engagements“ an: BürgerschaftlichesEngagement ist sowohl Ausdruck <strong>der</strong> Souveränität <strong>der</strong>Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger, als auch e<strong>in</strong> Mittel, e<strong>in</strong>e stärkereZivilgesellschaft zu erreichen und zu stabilisieren.Als Reaktion auf den Vertrauensverlust <strong>in</strong> die traditionellenpolitischen Institutionen hat das bürgerschaftliche Engagemente<strong>in</strong>e öffentliche Kontroll- und Kritikfunktion.Durch das freiwillige und bürgerschaftliche Engagementkönnen Verhaltensformen tra<strong>in</strong>iert werden, die dem demokratischenZusammenleben för<strong>der</strong>lich s<strong>in</strong>d (etwa Fähigkeitenwie Initiative, Kritikfähigkeit, Vertrauen undOrganisationsfähigkeit) und e<strong>in</strong>en wesentlichen Beitrag<strong>zur</strong> demokratischen politischen Kultur leisten. Untersuchungen<strong>der</strong> Forschungsgruppe Wahlen zeigen, dass politischeBeteiligung und freiwilliges Engagement engmite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verknüpft s<strong>in</strong>d. In <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> bürgerschaftlichEngagierten liegt sowohl die Wahlbereitschaftbei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen auf e<strong>in</strong>emüberdurchschnittlichen Niveau, als auch die Bereitschaft,mittels unkonventioneller Instrumente politischen E<strong>in</strong>flusszu nehmen. Dagegen übersteigen die Nichtwähleranteileunter nicht-engagierten Bürger<strong>in</strong>nen und Bürgerndas entsprechende Niveau im Vergleich zu den freiwilligEngagierten um fast das Doppelte (Roth & Kornelius2004).Ältere – und zwar Frauen und Männer <strong>in</strong> spezifischerWeise – haben über ihre Erfahrungen des Sorgens (<strong>der</strong>Selbst- und Fremdsorge) die Befähigung <strong>zur</strong> Verantwortungmeist über e<strong>in</strong>e längere Zeit lernen können. Außerdemdürfte ihr zeitlicher Handlungsspielraum, dieses Erfahrene<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>schaftliche und gesellschaftlicheBezüge e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel größer se<strong>in</strong> als im jüngerenund mittleren Erwachsenenalter. Das E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>generfahrener Sorge um sich und an<strong>der</strong>e (im weitesten S<strong>in</strong>ne)dürfte nicht nur älteren Menschen am ehesten gel<strong>in</strong>gen,wenn Politik und Staatsbürgerschaft als e<strong>in</strong>e Form desHandelns und Bewertens verstanden wird, als e<strong>in</strong> Zusammenkommenim öffentlichen Raum, wo Angelegenheitendes Geme<strong>in</strong>wesens erörtert werden, und zwar mit demZiel zu verän<strong>der</strong>n bzw. Neues zu beg<strong>in</strong>nen.Auch f<strong>in</strong>det durch das Engagement älterer Menschen e<strong>in</strong>enicht zu unterschätzende Wertschöpfung statt: Die produktivenLeistungen, die von älteren Menschen im Kontextdes bürgerschaftlichen Engagements o<strong>der</strong> von Pflege
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 219 – Drucksache 16/2190und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung erbracht werden, tragen zumgesellschaftlichen Wohlstand bei.Die Kommission sieht im bürgerschaftlichen Engagemente<strong>in</strong> potenzielles Begegnungsfeld für die jüngere und ältere<strong>Generation</strong>. Sowohl die SIGMA-Studie aus dem Jahr1999 (Ueltzhöffer 1999) als auch e<strong>in</strong> Überblick über amerikanischeund deutsche Studien (Filipp & Mayer 1999)kommen zu dem Schluss, dass die Lebenswelten verschiedenerAltersgruppen kaum Überlappungen mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>aufweisen. Zwar zeigt die gerontologische Forschungund die Familiensoziologie (Hoff 2004; Nave-Herz 2004), dass die multilokalen generationenübergreifendenFamilienverbünde weitgehend <strong>in</strong>takt s<strong>in</strong>d undvielfältige Unterstützungsleistungen austauschen. Dochbereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt gibt es nur noch wenige Kontaktezwischen älteren und jüngeren Menschen und imAlltagsleben ist <strong>der</strong> Austausch zwischen Alt und Jungnoch stärker e<strong>in</strong>geschränkt. „Mehr als zwei Drittel allerJugendlichen <strong>in</strong> Deutschland haben außerhalb <strong>der</strong> Familiekaum noch mit Angehörigen <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong> zutun“ (Ueltzhöfer 1999). Dem generationenübergreifendenund -verb<strong>in</strong>denden Engagement sollte deshalb hohe Aufmerksamkeitgewidmet werden. Um Enttäuschungen vorzubeugen,dürfen allerd<strong>in</strong>gs auch die strukturellen Grenzenalters<strong>in</strong>tegrativer Bemühungen nicht vergessenwerden (Amrhe<strong>in</strong> 2002).In <strong>der</strong> Altenhilfe und <strong>der</strong> Pflegeversorgung wird seit längeremdie Notwendigkeit diskutiert, Unterstützungsleistungenfür ältere Menschen <strong>in</strong> Zukunft gleichmäßiger aufverschiedene Akteure zu verteilen und gemischte Hilfearrangementsaus familialer, professioneller und ehrenamtlicherHilfe zu för<strong>der</strong>n. Ziel ist es, helfende Angehörigezu entlasten und dadurch Hilfearrangements im häuslichenUmfeld langfristig zu stabilisieren. Die Diskussionum die För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichen Engagementslenkt den Blick auf die bisher unterentwickelte Säule <strong>der</strong>freiwilligen, nicht-familialen Unterstützung <strong>in</strong> Hilfenetzwerkenfür ältere Menschen. Aus <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en bürgerschaftlichenDiskussion lassen sich e<strong>in</strong>e Reihe vonAnregungen h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für gel<strong>in</strong>gendegemischte Hilfearrangements ableiten.Über den gesellschaftlichen Gew<strong>in</strong>n h<strong>in</strong>aus ist auch e<strong>in</strong>hoher <strong>in</strong>dividueller Nutzen für engagierte ältere Menschenzu konstatieren: Zunächst hat bereits die <strong>Lage</strong>analysegezeigt, dass es den Wünschen e<strong>in</strong>es erheblichenTeils <strong>der</strong> älteren Menschen entspricht, sich zu engagieren.Darüber h<strong>in</strong>aus haben viele gerontologische Untersuchungennachgewiesen, dass aktive Menschen durchschnittlichgesün<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d, mehr soziale Kontakte habenund mit ihrem Leben zufriedener s<strong>in</strong>d. Es handelt sich dabeike<strong>in</strong>eswegs nur um e<strong>in</strong>en Selektionseffekt, d.h. dassgesün<strong>der</strong>e Menschen eben aktiver und zufriedener se<strong>in</strong>können als kranke, son<strong>der</strong>n es ist e<strong>in</strong> Wirkungszusammenhangauch <strong>in</strong> die umgekehrte Richtung nachweisbar:Im Durchschnitt werden ältere Menschen durch Erhöhungihres Aktivitätsniveaus, beispielsweise im bürgerschaftlichenEngagement, zufriedener mit ihrem Leben.Die Aufnahme sportlicher Aktivitäten verbessert bis <strong>in</strong>shohe Alter den Gesundheitsstatus, was wie<strong>der</strong>um Auswirkungenauf die Lebenslage <strong>in</strong>sgesamt hat (Engeln2003).Freiwilliges o<strong>der</strong> bürgerschaftliches Engagement undTeilhabe können den aktiven älteren und alten Frauen undMännern den Zugang zu sozialen Netzwerken und zu Infrastrukturressourcenerschließen, die ihnen ohne diesesEngagement verschlossen blieben. Es stößt <strong>in</strong> vielen Fällendie Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit Fragen <strong>der</strong> gesellschaftlichenEntwicklung an o<strong>der</strong> vertieft sie. Dies kann beispielsweisebeim Engagement im Rahmen des Agenda-21-Prozesses <strong>der</strong> Fall se<strong>in</strong>, aber auch beim Umgang mitexistenziellen persönlichen Entwicklungsaufgaben, wiebeim Ehrenamt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Hospizhilfe. Engagement und Teilhabetragen somit <strong>zur</strong> Persönlichkeitsentwicklung undVerbesserung <strong>der</strong> Lebenslage auch im Alter bei. Gleichzeitigmuss gesehen werden, dass bürgerschaftlichesEngagement auch mit hohen zeitlichen, psychischen undf<strong>in</strong>anziellen Belastungen e<strong>in</strong>hergehen kann. Insgesamtkann das freiwillige soziale o<strong>der</strong> bürgerschaftliche Engagementjedoch neben den für die Gesellschaft produktiven,häufig auch sozial- o<strong>der</strong> gesundheitspräventive Folgenhaben, die sich unmittelbar und mittelbar auf dieLebenssituation und das Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>der</strong> älteren und altenMenschen auswirken.Bürgerschaftliches Engagement kann für die Nacherwerbsphasee<strong>in</strong> Tätigkeits- o<strong>der</strong> Rollenmodell anbieten,das durch als s<strong>in</strong>nvoll erlebte und gesellschaftlich auch sobewertete Aktivität und Beschäftigung sowie zeitlicheStrukturierung und soziale Teilhabe und Vernetzung charakterisiertist. Gerade <strong>in</strong> <strong>der</strong> Phase des Übergangs <strong>in</strong> denRuhestand kann bürgerschaftliches Engagement zum Anknüpfungspunktfür die weitere Nutzung bereits im Lebenslauf,z.B. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsarbeit, aber auch <strong>der</strong> Familien-und Hausarbeit, erworbener Kompetenzen werden.Bürgerschaftliches Engagement bietet Frauen und Männernim Alter aber auch die Gelegenheit, neue Fähigkeitenzu entwickeln und bisher ungenutzte persönliche Potenzialezu entfalten. Dies kann ganz beson<strong>der</strong>s beidenjenigen bedeutsam se<strong>in</strong>, die auf Grund ihrer LebensundArbeitsverläufe eher das Gefühl haben, h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> Kompetenzentfaltung etwas versäumt zu haben. Beiälteren und alten Menschen wird dies <strong>der</strong>zeit z.B. eher beiFrauen <strong>der</strong> Fall se<strong>in</strong>, die sich auf Familie und Haushaltkonzentriert haben, eigene qualifikatorische und beruflicheEntwicklungen dabei <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergrund stellten undnun das Bedürfnis haben, sich doch noch außerhalb desbislang Gewohnten weiterzubilden und zu betätigen.Diese Möglichkeit kann auch beson<strong>der</strong>e Bedeutung gew<strong>in</strong>nenvor allem bei Frauen, aber auch bei Männern ausger<strong>in</strong>g qualifizierten Arbeitsbereichen, die Zeit ihres Erwerbslebensihren Interessen an Bildung, Kultur, an <strong>der</strong>Entwicklung von Fähigkeiten <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Fel<strong>der</strong>n aus zeitlichenund materiellen Gründen o<strong>der</strong> wegen <strong>der</strong> Mehrfachbelastungdurch Familie und Beruf nicht nachkommenkonnten.Diese wenigen H<strong>in</strong>weise lassen erkennen, wie differenziertund sensibel vor allem gegenüber geschlechter- und
Drucksache 16/2190 – 220 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodebildungsbezogenen Benachteiligungen e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ungund Qualifizierung im Rahmen des bürgerschaftlichenEngagements se<strong>in</strong> sollte, will sie nicht bereits zeitlebensetablierte Privilegien und gute Bed<strong>in</strong>gungen bei denjenigenweiter stützen und fortführen, die darüber verfügenund bei an<strong>der</strong>en weiter abbauen. Hier<strong>in</strong> liegt e<strong>in</strong> Grundfür die häufig kontroverse Diskussion um die För<strong>der</strong>ungfreiwilligen und ehrenamtlichen Engagements, auch imAlter.Warum bleibt die E<strong>in</strong>schätzung e<strong>in</strong>er verstärkten Engagementför<strong>der</strong>ungdarüber h<strong>in</strong>aus wi<strong>der</strong>sprüchlich und ambivalent?E<strong>in</strong>e ganze Reihe von Argumenten, welche die„dunklen Seiten <strong>der</strong> Zivilgesellschaft“ thematisieren, liefertRoth (2003). „Ohne Zweifel s<strong>in</strong>d auch die Zivilgesellschaftenwestlicher Demokratien von Gruppen undZusammenschlüssen bevölkert, die anti-zivile Werte vertretenund praktizieren“ (Roth 2003: 61). Er weist außerdemu.a. auf Phänomene wie Korruption als e<strong>in</strong>e Formunzivilisiertem sozialen Kapital und auf soziale Schließungstendenzen<strong>in</strong> freiwilligen Organisationen und Vere<strong>in</strong>enh<strong>in</strong>. „Die Folgen sozialer Abgrenzungen und Schließungenfür politische Lernprozesse dürften erheblichse<strong>in</strong>... Je stärker z.B. das Vere<strong>in</strong>swesen alltäglich als Ausdruckvon Exklusivbürgerschaft erfahren wird, desto wenigerkann es <strong>zur</strong> Entfaltung von Bürgertugenden beitragen“(Roth 2003: 64). Der Begriff des bürgerschaftlichenEngagements kann deshalb nur dann se<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>wohlorientiertesDifferenzierungspotenzial <strong>zur</strong> Wirkung br<strong>in</strong>gen,wenn bei se<strong>in</strong>er Verwendung tatsächlich „bürgerschaftliche“von an<strong>der</strong>en, sozial ausgrenzenden o<strong>der</strong> gar anti-demokratischenEngagement- und Beteiligungsformen unterschiedenwerden.In <strong>der</strong> Politik steht Engagement häufig <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gefahr, alskostengünstiger Lückenbüßer für Sparstrategien o<strong>der</strong> alsallfälliger Problemlöser für alle erdenklichen ungelöstengesellschaftlichen Probleme <strong>in</strong>strumentalisiert zu werden.E<strong>in</strong>gebettet ist <strong>der</strong> Engagementdiskurs <strong>in</strong> das sozialpolitischeReformprojekt des aktivierenden Sozialstaats, <strong>der</strong>die Neugestaltung <strong>der</strong> sozialstaatlichen Leistungen mit<strong>der</strong> Reform von Verwaltungsstrukturen und <strong>der</strong> Neugestaltungdes Verhältnisses von Staat und Bürgern verkoppelt.Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Diskussion bef<strong>in</strong>dlichen konkurrierendenModelle e<strong>in</strong>er aktivierenden Sozialpolitik und die damitgekoppelten Formen des Bürgerengagements weisengroße Unterschiede h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Position zum existierendenSozialstaatsmodell <strong>in</strong> Deutschland auf. Dasreicht von liberal <strong>in</strong>dividualistischen Vorstellungen, diee<strong>in</strong>en Rückzug des Staates aus <strong>der</strong> sozialen Sicherung se<strong>in</strong>erBürger proklamieren und die e<strong>in</strong>e Privatisierung undIndividualisierung von Lebensrisiken anstreben. An<strong>der</strong>eproklamieren den Umbau des Sozialstaates h<strong>in</strong> zu mehrKooperation von staatlichen, privaten und <strong>in</strong>termediärenAkteuren o<strong>der</strong> Vorstellungen, die ke<strong>in</strong>en Reformbedarfdes Sozialstaats sehen und bürgerschaftliches Engagementals positive aber randständige Ausschmückung <strong>der</strong>Versorgungslandschaft verstehen. Die Diskussion umChancen und Risiken <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung bei älterenund alten Menschen steht im Kontext dieser Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzungund damit <strong>in</strong> Gefahr, auch für den Abbausozialstaatlicher Leistungen <strong>in</strong>strumentalisiert zu werden.E<strong>in</strong>e Instrumentalisierung des bürgerschaftlichen Engagementsist auch im Rahmen <strong>der</strong> Debatte um <strong>Generation</strong>engerechtigkeitzu verzeichnen. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund<strong>der</strong> Verlängerung <strong>der</strong> Lebensphase Alter, <strong>der</strong> durchschnittlichenVerbesserung des Gesundheitszustands und<strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellen Ressourcenausstattung älterer Menschenwird zunehmend die Frage thematisiert, welche Leistungenman im H<strong>in</strong>blick auf die Erhaltung <strong>der</strong> Solidaritätzwischen den <strong>Generation</strong>en von <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong>erwarten kann o<strong>der</strong> darf. In <strong>der</strong> zum Teil polemisch geführtenDiskussion werden die Probleme <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung<strong>der</strong> sozialen Sicherungssysteme mitunter <strong>in</strong> direktenZusammenhang mit <strong>der</strong> Auffor<strong>der</strong>ung an ältere Menschengebracht, sich „freiwillig“ für die Gesellschaft zuengagieren. Von Seiten <strong>der</strong> Gerontologie ist dazu mehrfachauf die Verzerrung des realen Transfergeschehensh<strong>in</strong>gewiesen worden, wenn die Diskussion um <strong>Generation</strong>engerechtigkeitauf die Bilanzierung von E<strong>in</strong>- und Auszahlungen<strong>der</strong> Sozialversicherung reduziert wird(Schmähl 2002; Kohli 2002; siehe dazu auch ausführlichdas Kapitel „E<strong>in</strong>kommenslage im Alter“).Die Diskussion über ältere Menschen und bürgerschaftlichesEngagement fokussiert <strong>zur</strong> Zeit stark auf soziale Hilfeleistungenund traditionelles Ehrenamt. Auch die Diskussionum die so genannten neuen altersspezifischenFormen des Engagements stellen häufig Selbsthilfeaktivitäten,soziale Unterstützungsdienste o<strong>der</strong> Bildungsaktivitäten<strong>in</strong>s Zentrum <strong>der</strong> Betrachtung. Weniger häufig zielenProjekte auf die Aktivierung <strong>der</strong> politischen Partizipationälterer Menschen. Wenn dies geschieht, beziehen sie sichüberwiegend auf traditionelle Formen <strong>der</strong> Interessenvertretung,wie beispielsweise <strong>in</strong> Seniorenvertretungen. InZukunft könnten ältere Menschen auch <strong>in</strong> unkonventionellenpolitischen Beteiligungsformen e<strong>in</strong>en wichtigenBeitrag <strong>zur</strong> Belebung <strong>der</strong> demokratischen Kultur und desGeme<strong>in</strong>wesens <strong>in</strong> den Kommunen beitragen wie beispielsweiseim Rahmen <strong>der</strong> lokalen Agenda 21 Prozesse.Die Kommission sieht die Aktivierung des bürgerschaftlichenEngagements als e<strong>in</strong> Instrument, um <strong>zur</strong> Lösung <strong>der</strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> gesellschaftlichen Alterung und<strong>der</strong> Schrumpfung <strong>der</strong> Bevölkerung beizutragen. Es kanne<strong>in</strong> Bauste<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em vielfältigen Bündel von Interventionenund Reformen se<strong>in</strong>. Man sollte allerd<strong>in</strong>gs den Anteil,den das bürgerschaftliche Engagement älterer Menschen<strong>zur</strong> Lösung dieser Herausfor<strong>der</strong>ungen beitragenkann, nicht überschätzen. Auch im Alter stellt das bürgerschaftlicheEngagement nur e<strong>in</strong>e Option unter vielen fürdie Freizeitgestaltung und die Strukturierung des Alltagswie die soziale Teilhabe dar (Menn<strong>in</strong>g 2004). WelcheFolgen die angestrebte Angleichung des realen Berufsausstiegsaltersan die gesetzliche Altersgrenze für dieEngagementbereitschaft <strong>der</strong> jungen Alten haben wird, istmomentan kaum abzusehen. Als Resümee <strong>der</strong> Gegenüberstellunge<strong>in</strong>iger Chancen und Risiken des Engagementdiskursesim Bezug auf ältere Menschen lässt sichjedoch feststellen, dass das bürgerschaftliche Engagement
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 221 – Drucksache 16/2190älterer Menschen dazu beitragen kann, nicht nur dieWohlfahrtsproduktion zu erhöhen, son<strong>der</strong>n auch die politischeSphäre <strong>in</strong> Deutschland partizipativer und demokratischerzu gestalten.7.5 Optionen und Maßnahmen <strong>der</strong>Engagementför<strong>der</strong>ung7.5.1 Voraussetzungen und Anfor<strong>der</strong>ungenDamit die erhofften positiven Effekte des bürgerschaftlichenEngagements für die politische Kultur, die Öffnungvon Verwaltungen und die Wohlfahrtsproduktion tatsächliche<strong>in</strong>treten, müssen die För<strong>der</strong>politiken und -maßnahmenbestimmte Voraussetzungen erfüllen. Nicht zuletztmüssen aber auch ältere Frauen und Männer ihre Rolle imEngagement offensiv <strong>in</strong>terpretieren und neben <strong>der</strong> Möglichkeitzum freiwilligen sozialen Engagement auchstärker politische Partizipationsrechte <strong>in</strong> Politik und Verwaltunge<strong>in</strong>for<strong>der</strong>n. Es handelt sich ke<strong>in</strong>eswegs selbstverständlichum e<strong>in</strong>e „W<strong>in</strong>-W<strong>in</strong>“-Situation, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaftwie freiwillig Engagierte und gegebenenfallsbeteiligte Betriebe o<strong>der</strong> Verbände gleichermaßen profitieren,wenn es zu e<strong>in</strong>er Ausweitung des Engagementskommt (auch wenn dies e<strong>in</strong>ige Kampagnenmotti durchausversprechen). Die Versuchung für die Bundesregierungsowie für die Verantwortungsträger <strong>in</strong> Län<strong>der</strong>n undKommunen die Engagementför<strong>der</strong>ung, angesichts <strong>der</strong> aktuellenund wohl auch künftigen Haushaltslage, auf Sonntagsredenund symbolische Pilotvorhaben zu reduzieren,die gleichzeitig von Stellene<strong>in</strong>sparungen im Seniorenbereichbegleitet werden, ist groß.Die dauerhafte För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichen Engagementssteht vor e<strong>in</strong>em erheblichem F<strong>in</strong>anzierungsproblem.Neue Formen e<strong>in</strong>er öffentlich-privaten Partnerschaftslösungfür die F<strong>in</strong>anzierung sollten weiterh<strong>in</strong>erprobt werden, denn ohne e<strong>in</strong>e zusätzliche und verstetigteF<strong>in</strong>anzierung von engagementunterstützendenStrukturen kann das bürgerschaftliche Engagement E<strong>in</strong>bußenerfahren und so zu Kostensteigerungen an an<strong>der</strong>erStelle (z.B. im Gesundheitswesen) beitragen.Die seit längerem angemahnte Öffnung <strong>der</strong> kommunalenVerwaltungen, von Verbänden, Vere<strong>in</strong>en und Institutionenfür das bürgerschaftliche Engagement gehört zu den anspruchsvollstenHerausfor<strong>der</strong>ungen für die Zukunft. Hiergibt es <strong>in</strong>zwischen auf allen Ebenen Beispiele guter Praxis.Damit das bürgerschaftliche Engagement aber e<strong>in</strong>endauerhaften Aufschwung nehmen kann, muss es zu e<strong>in</strong>emflächendeckenden kulturellen Wandel kommen.Projekten <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung, die den Dialog <strong>der</strong><strong>Generation</strong>en för<strong>der</strong>n, sollte beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeitzukommen. So empfiehlt beispielsweise <strong>der</strong> <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong>Initiative für Bürger-Engagement „Deutschland aktiv“(2004): „<strong>Generation</strong>enzusammenführende Projekte solltennicht nur durch die mit sehr ger<strong>in</strong>gen Mitteln ausgestattetenkle<strong>in</strong>en Programme für die För<strong>der</strong>ung von Engagementund Ehrenamt unterstützt werden. Sie solltenBestandteil <strong>der</strong> alltäglichen Politik <strong>in</strong> den jeweiligen Ressortsvon Politik und Verwaltung werden: Das Thema <strong>der</strong>Zusammenarbeit von Alt und Jung gehört z.B. ebenso <strong>in</strong>die K<strong>in</strong><strong>der</strong>- und Jugend- sowie die Schulpolitik wie Aufgabenvon Älteren als Mentoren für jugendliche Berufse<strong>in</strong>steiger<strong>in</strong> den Aufgabenkatalog e<strong>in</strong>er neuen Arbeitsmarktpolitik.“Die Diskussion über bürgerschaftliches Engagement darfnicht <strong>in</strong>strumentell geführt werden. Das Verständnis vonFreiwilligen als Ressource, die es aus Gründen <strong>der</strong> Kosteneffizienzzu aktivieren gelte, geht an den Motiven undvielfach auch <strong>der</strong> Lebenslage <strong>der</strong> Engagierten vorbei.Deshalb sollte auch nicht von Freiwilligengew<strong>in</strong>nung dieRede se<strong>in</strong>, son<strong>der</strong>n die Ermöglichung von Engagementim Zentrum <strong>der</strong> Debatte stehen.Wie bereits zu Beg<strong>in</strong>n angesprochen, wendet sich dieKommission deutlich gegen die E<strong>in</strong>führung von verpflichtendenDiensten für Senioren. Die Hoffnungen,welche <strong>in</strong> das bürgerschaftliche Engagement Älterer fürdie Belebung des Geme<strong>in</strong>wesens und die Stärkung <strong>der</strong>Bürgergesellschaft gesetzt werden, können sich nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emfreiwilligen Rahmen entfalten. Dabei s<strong>in</strong>d <strong>zur</strong> optimalenNutzung des potenziellen Engagements älterer undalter Frauen und Männer <strong>in</strong> ihrem S<strong>in</strong>ne und im gesellschaftlichenS<strong>in</strong>ne folgende Kriterien zu beachten:– Freiwilliges Engagement darf nicht <strong>zur</strong> gesellschaftlichenVerpflichtung im Alter werden. Das bedeutetauch den Verzicht auf e<strong>in</strong>e negative gesellschaftlicheSanktionierung <strong>der</strong>jenigen, die sich daran nicht beteiligen.– Es sollte e<strong>in</strong> sehr breites und gestaltungsoffenes Spektruman Angeboten vorgehalten und weiter entwickeltwerden. Dies muss möglichst transparent h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> Wahrnehmung durch unterschiedliche soziale Milieus,Altersgruppen, beide Geschlechter, Menschen <strong>in</strong>verschiedenen Lebenslagen etc. gestaltet se<strong>in</strong> und direktan den Interessen und (nicht nur formal erkennbaren/messbaren)Qualifikationen wie Erfahrungen undsozialen Netzen <strong>der</strong> (potenziell) sich Engagierendenansetzen.– Engagementför<strong>der</strong>ung ist e<strong>in</strong>e lebenslaufübergreifendeAufgabe. Sie sollte sich nicht alle<strong>in</strong> auf dieGruppe <strong>der</strong> älteren und alten Menschen konzentriereno<strong>der</strong> gar beschränken. Die Erfolg versprechendstenAnsätze <strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Engagementquoten auch imAlter s<strong>in</strong>d diejenigen, die bereits <strong>in</strong> früheren Lebensphasenansetzen und dort positive Engagementerfahrungen<strong>in</strong>itiieren.Die Kommission sieht auf mehreren Ebenen e<strong>in</strong>en hohengesellschaftlichen Nutzen des Engagements älterer Menschenund empfiehlt, die Aktivitäten <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung desfreiwilligen o<strong>der</strong> bürgerschaftlichen Engagements zu verstärken,um die Potenziale <strong>in</strong> allen Altersgruppen für solcheTätigkeiten besser ansprechen zu können. Sie siehtdabei die Notwendigkeit, die För<strong>der</strong>strategien besser mitden politischen Aktivitäten <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en sozialstaatlichenPolitikfel<strong>der</strong>n zu verknüpfen und die Akzentsetzung <strong>der</strong>För<strong>der</strong>angebote im Detail neu zu überdenken, um Hemmnisseund Barrieren für die För<strong>der</strong>ung dieser Potenzialeabzubauen.
Drucksache 16/2190 – 222 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode7.5.2 Neue Wege <strong>der</strong> ErprobungVon <strong>der</strong> Piloterprobung <strong>zur</strong> flächendeckenden LösungPilotprojekte gibt es <strong>in</strong> Deutschland relativ viele, flächendeckendeNutzungen von Ergebnissen <strong>der</strong> Pilotprojektejedoch s<strong>in</strong>d selten. Es ist darauf zu verweisen, dass bei e<strong>in</strong>erZielsetzung „Flächendeckung“ nicht nur zusätzlicheF<strong>in</strong>anzierungsprobleme, son<strong>der</strong>n auch zahlreiche Qualifikations-und Kompetenzherausfor<strong>der</strong>ungen, organisatorischeFragen, Lernanfor<strong>der</strong>ungen etc. zu bewältigen s<strong>in</strong>d.S<strong>in</strong>nvoll ist e<strong>in</strong>e Art beständiges Forum, um das Ziel e<strong>in</strong>erflächendeckenden Unterstützung des bürgerschaftlichenEngagements voranzutreiben. E<strong>in</strong>e alternde Gesellschaftsollte den Anspruch an sich setzen, die Hilfe <strong>zur</strong>Selbsthilfe für alle Senior<strong>in</strong>nen und Senioren zu aktivierenund auf (noch) höhere Niveaustufen zu heben.Bilanzierung und AuditierungEs kommt darauf an, sich auch im Bereich des freiwilligenEngagements von Senioren um Qualitätsstandardsund -verbesserungen systematisch zu bemühen. Hierbeis<strong>in</strong>d <strong>in</strong>dividuelle Autonomie, Selbsthilfe, Eigens<strong>in</strong>nwichtige Aspekte, die zu unterstützen s<strong>in</strong>d. Es gibt aberauch Standards <strong>der</strong> Individualität. Wird dieser Weg nichtbeschritten, ist gerade <strong>in</strong> Deutschland mit se<strong>in</strong>en vielenE<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>itiativen das Risiko groß, dem Ziel e<strong>in</strong>er alternsfreundlichenAlltagskultur entwe<strong>der</strong> nicht o<strong>der</strong> viel zulangsam näher zu kommen.Das Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ wird niefrei von Ambivalenzen se<strong>in</strong>. Insbeson<strong>der</strong>e, was die (berechtigte)Sorge betrifft, dass hierdurch doch vorrangige<strong>in</strong> Stellenabbau ermöglicht werden soll. Umso wichtigers<strong>in</strong>d regelmäßige überschaubare, transparente Informationen.E<strong>in</strong> Bewährungsfeld zu mehr Offenheit und Ehrlichkeitist das Thema „Bürgerschaftliches Engagement“.Bessere Ausschöpfung vorhandener DatenquellenEs reicht nicht, e<strong>in</strong>fach nur die Mittel <strong>zur</strong> Erforschung <strong>der</strong>Möglichkeiten und <strong>der</strong> praktischen Umsetzung des bürgerschaftlichenEngagements zu erhöhen. Es ist auchüber <strong>der</strong>en produktivere Nutzung nachzudenken. Es s<strong>in</strong>d<strong>in</strong> den letzten Jahren mehrere umfangreiche Datensätzezum Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ durch Befragungengeschaffen worden. Die Ausschöpfung dieserDatensätze ist als ger<strong>in</strong>g zu bezeichnen. Es lohnt z.B.,Wettbewerbe für Nachwuchswissenschaftler (auch Studenten)auszuschreiben, um die Nutzungsrate dieser Datensätzezu steigern, abgesehen von an<strong>der</strong>en positiven Effekten.7.5.3 Unterstützende MaßnahmenAltenspezifische Formen des EngagementsunterstützenEngagementför<strong>der</strong>ung ist e<strong>in</strong>e Aufgabe, die sich lebenslauforientiertan alle Altersgruppen richten sollte. AufGrund des demografischen Wandels steigt aber nicht nurdie Zahl <strong>der</strong> potenziell bürgerschaftlich Engagierten an,son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong>jenigen älteren Menschen, die als Empfängervon bürgerschaftlichen Hilfeleistungen profitierenkönnen. Deshalb sieht die Kommission weiterh<strong>in</strong> dieNotwendigkeit altenspezifische Engagementfel<strong>der</strong> durchdie Schaffung und Verbesserung geeigneter Rahmenbed<strong>in</strong>gungenzu för<strong>der</strong>n.Die 5. Altenberichtskommission unterstützt die Initiativedes Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugend <strong>zur</strong> E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es neuen generationsübergreifendenFreiwilligendienstes, wie sie von <strong>der</strong> Kommission„Impulse für die Zivilgesellschaft“ vorgeschlagenworden s<strong>in</strong>d. Diese Dienste stellen e<strong>in</strong>e geregelteForm des bürgerschaftlichen Engagements dar und sollenvon geme<strong>in</strong>nützigen Organisationen und öffentlichenE<strong>in</strong>richtungen angeboten werden. Sie verb<strong>in</strong>den bürgerschaftlicheArbeit mit Bildungs- und Begleitangeboten.Die neuen Elemente gegenüber den existierenden Freiwilligendienstenbestehen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffnung <strong>der</strong> Dienste fürältere Menschen, <strong>der</strong> zeitlichen Flexibilisierung <strong>der</strong>Dienste und <strong>der</strong> Ausweitung <strong>der</strong> traditionellen Aufgabenfel<strong>der</strong>.Um den Bedürfnissen älterer Menschen besser gerechtwerden zu können, sollen sowohl Dauer als auch diewöchentliche Stundenbelastung flexibler gestaltet werden.So sollen unter Berücksichtigung von <strong>in</strong>stitutionellenNotwendigkeiten und Wünschen <strong>der</strong> Freiwilligen e<strong>in</strong>eDauer <strong>der</strong> Dienste ab 3 Monaten bis zu mehr als e<strong>in</strong>emJahr bei Teilzeit o<strong>der</strong> Vollzeittätigkeit ermöglicht werden.Neben den traditionellen Fel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Freiwilligendienstewie Jugendarbeit, Umweltschutz, Kultur, Sport und Friedensarbeitsollen familienunterstützende Institutionen wieMütterzentren aber auch Schulen als neue Orte <strong>der</strong> Freiwilligenarbeiterschlossen werden. Darüber h<strong>in</strong>aus sollenFreiwilligendienste im Bereich Pflege, Migration undSelbsthilfe sowie <strong>in</strong> Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ungangeboten werden.E<strong>in</strong> weiteres, zukünftig bedeutendes Aufgabengebiet fürdas bürgerschaftliche Engagement von Älteren und fürÄltere sieht die Kommission im Bereich <strong>der</strong> Verbraucherpolitikund des Verbraucherschutzes. Engagierte ältereMenschen können im Feld <strong>der</strong> sozialen Dienstleistungenund <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft verstärkt anwaltschaftlicheFunktionen übernehmen. In ambulanten und stationärenPflegearrangements könnte damit die Rolle von freiwilligenHelfern als Koproduzenten von Versorgungsleistungenauf e<strong>in</strong>e begrenzte Interessensvertretungsfunktion fürhilfebedürftige Bewohner o<strong>der</strong> Klienten ausgeweitet werden.In Zukunft wird die politische Beteiligung älterer Menschenvoraussichtlich stärker an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen.Hier erwartet die Kommission, dass neben den traditionellenBeteiligungsformen <strong>in</strong> Parteien, Gewerkschaftenund Seniorenvertretungen zunehmend das Engagementvon älteren Menschen <strong>in</strong> unkonventionellen politischenBeteiligungsformen auf kommunaler Ebene zunehmenwird. Beispiele lassen sich auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> lokalenAgenda-21-Bündnisse f<strong>in</strong>den. Diese Breite des politischenEngagements sollte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Aktivitätenwie <strong>in</strong> den För<strong>der</strong>programmen berücksichtigt werden.Zur Zeit zeigt sich e<strong>in</strong>e Diskrepanz zwischen nom<strong>in</strong>ellenQuoten <strong>der</strong> Beteiligung (gemessen an <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>zahl
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 223 – Drucksache 16/2190o<strong>der</strong> am Wahlverhalten) und faktischen Möglichkeiten<strong>der</strong> Mitwirkung im Alter, sei es <strong>in</strong> Gewerkschaften o<strong>der</strong><strong>in</strong> Fel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Lokal-, Landes- und Bundespolitik (Alber& Schölkopf 1999). So bef<strong>in</strong>den sich Möglichkeiten <strong>zur</strong>Beteiligung an altersrelevanter lokaler Politik, <strong>zur</strong> Mitwirkung<strong>in</strong> Selbstverwaltungsgremien <strong>der</strong> Sozialversicherungsträger,<strong>zur</strong> Eigenvertretung ihrer Interessen als Nutzervon Diensten und E<strong>in</strong>richtungen hierzulande noch <strong>in</strong>Anfängen. Die Ernsthaftigkeit <strong>der</strong> – von gesellschaftlicherSeite wie von Seite Älterer formulierter – For<strong>der</strong>ungennach mehr Beteiligung im Alter wird sich daran messenlassen, wie hoch die Bereitschaft ist, <strong>in</strong>entscheidungsbefugten Gremien und Institutionen, z.B. <strong>in</strong>Parlamenten und Ausschüssen als „normale“ und nichtwegen ihres Status delegierte Vertreter, mitwirken zu lassenund mitzuwirken (Frerichs et al. 1999). Von gesellschaftlicherSeite setzt dies – vermittelt über Institutionenund Organisationen – die Vorhaltung entsprechen<strong>der</strong>struktureller Möglichkeiten und Unterstützung voraus,wobei weniger beteiligungsgeübte und -gewohnte Älteresowie durch ihre Lebensumstände (etwa private/familialeBelastungen) eher daran Geh<strong>in</strong><strong>der</strong>te (v.a. Frauen, Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten, gesundheitlich E<strong>in</strong>geschränkte)beson<strong>der</strong>s zu för<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d.Formelle und <strong>in</strong>formelle Formen des EngagementsanerkennenDer dom<strong>in</strong>ierende Blick auf die gesellschaftlich nützlichenTätigkeiten im Alter ist verengt auf organisierte Formendes Ehrenamts und des bürgerschaftlichen Engagements.Daneben gibt es e<strong>in</strong>e Reihe von außerfamilialen„nützlichen“ Tätigkeiten, die <strong>in</strong> Forschung, Politik undPresse vernachlässigt werden, die aber ebenfalls <strong>zur</strong>Wohlfahrtsproduktion beitragen. Dieses Engagement ältererund alter Menschen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> den wenigerbeachteten Formen <strong>der</strong> Unterstützungsleistungen <strong>in</strong>Nachbarschaft und Bekanntenkreis, ist vor allem Hilfevon Älteren für Ältere. Und es ist vor allem eher unsichtbareHilfe von Frauen <strong>in</strong> alltäglichen Zusammenhängen,die sich mit Begriffen, wie Ehrenamt o<strong>der</strong> bürgerschaftlichemEngagement nicht fassen lässt. Bei den „nützlichen“Tätigkeiten geht es um die Grauzone zwischen <strong>der</strong>re<strong>in</strong> konsumtiven Zeitverwendung und <strong>der</strong> förmlichen Erwerbsarbeit.Unterschiedliche Formen nützlicher Tätigkeiten,die außerhalb <strong>der</strong> Erwerbsarbeit auftreten, s<strong>in</strong>d zudifferenzieren h<strong>in</strong>sichtlich ihrer gesellschaftlichen Potenziale:Haushaltsarbeit im Familienverband, Vere<strong>in</strong>swesenund Selbsthilfegruppen, Do-it-yourself-Leistungen/Hobbys, Ehrenamt, bezahlte „Gelegenheitsarbeit“ imRahmen <strong>der</strong> „Ger<strong>in</strong>gfügigkeit“. Diese Bandbreite des Engagementsist ernst zu nehmen und verbietet vorschnelleVerallgeme<strong>in</strong>erungen h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Potenzialangaben.E<strong>in</strong>e öffentliche Anerkennungskultur darf nicht auf dasformalisierte Engagement beschränkt bleiben.Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den Versorgungssystemenengagementfreundlich gestaltenIn den Kernbereichen <strong>der</strong> sozialstaatlichen Versorgung ältererMenschen öffnet sich e<strong>in</strong>e Schere zwischen den öffentlichenBekenntnissen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung des Engagementsfür Ältere und den Tendenzen <strong>der</strong> Verdrängungsolchen Engagements <strong>in</strong> Randbereiche des Versorgungsgeschehens.So s<strong>in</strong>d beispielsweise die Anreize <strong>in</strong> den F<strong>in</strong>anzierungsmechanismen<strong>der</strong> Pflegeversicherung nichtgeeignet, bürgerschaftliches Engagement zu för<strong>der</strong>n, son<strong>der</strong>nsie beschränken im Gegenteil die Dispositionsspielräumevon Institutionen und Diensten, sich aktiv um dieE<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von ehrenamtlichen Helfer<strong>in</strong>nen und Helfernzu bemühen.Vere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und Engagement erleichternDie betriebliche För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichen Engagementsbzw. das Engagement von Unternehmen selbstist e<strong>in</strong> relativ neues Thema <strong>in</strong> Deutschland, das aber <strong>in</strong>den letzten Jahren durch verschiedene Aktionen stärker <strong>in</strong>die Betriebe und Öffentlichkeit getragen worden ist. Dennochist das betriebliche Engagement o<strong>der</strong> das geför<strong>der</strong>teEngagement ihrer Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter fürdie Bürgergesellschaft (Corporate Volunteer<strong>in</strong>g) noch immerke<strong>in</strong> Massenphänomen, son<strong>der</strong>n beschränkt sich aufe<strong>in</strong>zelne ausgewählte Initiativen, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel von Großbetriebenim städtischen Raum. Insbeson<strong>der</strong>e die betrieblichenengagementför<strong>der</strong>nden Maßnahmen für ältere Mitarbeiter<strong>in</strong>nenund Mitarbeiter und ehemalige Beschäftigtes<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Deutschland im Gegensatz zu den USA und Großbritannienkaum entwickelt. Es mangelt <strong>in</strong> diesem Bereichaber nicht nur an <strong>der</strong> Umsetzung vorhandener Modelle,son<strong>der</strong>n es besteht noch immer e<strong>in</strong> großesWissensdefizit <strong>in</strong> Betrieben und Gesellschaft über dieChancen, die solche Maßnahmen für beide Seiten bieten.7.6 Handlungsempfehlungen1 E<strong>in</strong>e Kultur des bürgerschaftlichen Engagementsför<strong>der</strong>n:– E<strong>in</strong>e Kultur <strong>der</strong> Motivation von Freiwilligen fürbürgerschaftliches Engagement entwickeln: Essollten systematische E<strong>in</strong>führungsgespräche mitpotenziellen Freiwilligen <strong>zur</strong> gegenseitigen Informationüber die Motivation zum Engagement unddas Aufgabenprofil <strong>der</strong> Tätigkeiten erfolgen. Dar<strong>in</strong>sollte e<strong>in</strong>e Aushandlung mit konkreten Absprachenzu e<strong>in</strong>em möglichen Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> freiwilligen Tätigkeit,den zeitlichen Umfang <strong>der</strong> Tätigkeit und demZeitpunkt bzw. den Modalitäten für die Beendigunge<strong>in</strong>er Tätigkeit sowie <strong>in</strong>haltliche Absprachengetroffen werden. Ferner s<strong>in</strong>d Fragen des Auslagenersatzesund eventueller Vergünstigungen sowie<strong>der</strong> Versicherung während <strong>der</strong> Tätigkeitenanzusprechen. Zudem müssen Ansprechpartner benanntund die Möglichkeit von Fortbildung erörtertwerden. E<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Öffentlichkeitsarbeit<strong>zur</strong> Freiwilligenarbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Organisation sowiedie Präsenz auf lokalen Festen und Veranstaltungenkönnen die Gew<strong>in</strong>nung von Freiwilligen zudemmaßgeblich unterstützen.– E<strong>in</strong>e Kultur <strong>der</strong> Pflege und Anerkennung des bürgerschaftlichenEngagements för<strong>der</strong>n: Ob Freiwil-
Drucksache 16/2190 – 224 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodelige e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>mal aufgenommene Tätigkeit auchfortsetzen, hängt von verschiedenen Faktoren ab,die nicht alle von den Organisationen, <strong>in</strong> <strong>der</strong>enmehr o<strong>der</strong> weniger formellen Rahmen sie angesiedelts<strong>in</strong>d, bee<strong>in</strong>flusst werden können. FolgendePunkte können die Verstetigung des Engagementspositiv bee<strong>in</strong>flussen:– E<strong>in</strong>e Kultur des Ausscheidens aus Engagementverhältnissenentwickeln: Organisationen, die mitFreiwilligen arbeiten, sollten dem Ausscheiden ausdem Engagement e<strong>in</strong>en ebenso hohen Stellenwertbeimessen wie dem Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es Engagements,zumal das episodenhafte Engagement als Muster<strong>der</strong> Beteiligung zunimmt. Wenn es sich um e<strong>in</strong>enkurzzeitigen, befristeten E<strong>in</strong>satz gehandelt hat,können Nachweise über geleistete Tätigkeiten fürdie Freiwilligen hilfreich se<strong>in</strong>. Das Thema desAusstiegs von langjährig tätigen älteren Ehrenamtlichenund <strong>der</strong> <strong>in</strong>terne <strong>Generation</strong>enwechsel ist <strong>in</strong>vielen Organisationen e<strong>in</strong> Tabu. Um solche Übergängefür alle Beteiligten möglichst zufrieden stellendzu regeln, sollten solche Fragen möglichstfrühzeitig offen angesprochen werden.2 Das Verhältnis von hauptamtlicher und freiwilligerArbeit aktiv gestalten: Hauptamtliche übernehmenneben <strong>der</strong> Betreuung <strong>der</strong> Freiwilligen häufig die Aufgabe,die F<strong>in</strong>anzierung und Qualifizierung zu sichern, neueProjekte zu <strong>in</strong>itiieren bzw. Mittel zu akquirieren, Qualitätsstandards<strong>der</strong> Freiwilligenarbeit zu sichern, gesellschaftlicheAnerkennung und Wertung durch Lobbyarbeit<strong>in</strong> Politik und Verwaltung zu etablieren und die Kooperationund Vernetzung von Unternehmen, Verbänden undOrganisationen voranzutreiben. In Organisationen, <strong>in</strong> denenhauptamtliche und freiwillige Mitarbeiter<strong>in</strong>nen undMitarbeiter geme<strong>in</strong>sam arbeiten, sollte dieses potenziellkonfliktträchtige Verhältnis durch möglichst klare Absprachengeregelt se<strong>in</strong>. Dazu gehört u.a., dass e<strong>in</strong>e klarumrissene Aufgabenteilung zwischen Hauptamtlichenund Freiwilligen festgelegt wird.3 Pluralität und Wandel von Motiven und Engagementformenberücksichtigen und ermöglichen: Auchwenn ältere Menschen nicht als treibende Kraft im Prozess<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung des Ehrenamtes gelten, so müssensich Organisationen auch bei Freiwilligen <strong>der</strong> höherenAltersgruppen auf e<strong>in</strong>e Verän<strong>der</strong>ung von Motivationund Engagementformen vorbereiten bzw. e<strong>in</strong>stellen.Dazu gehört u.a., dass auch für ältere Menschen verstärktzeitlich flexible Engagementmöglichkeiten und kürzerebefristete Aufgaben für das „H<strong>in</strong>e<strong>in</strong>schnuppern“ <strong>in</strong> Initiativenund Organisationen angeboten werden, dass gezieltgeschlechtsspezifische o<strong>der</strong> schichtenspezifische Motive,Vorerfahrungen und Engagementbedürfnisse zu berücksichtigens<strong>in</strong>d.4 Wissensdefizite <strong>in</strong> den Unternehmen beseitigenund Engagementkultur stärken: In den meisten deutschenBetrieben fehlt es noch immer an e<strong>in</strong>em eigenenKonzept ihres Status als Corporate Citizens. E<strong>in</strong> Verständnisfür die Chancen des Corporate Volunteer<strong>in</strong>g sowieklare Vorstellungen, wie e<strong>in</strong> gezieltes Corporate Volunteer<strong>in</strong>g<strong>in</strong> dem jeweiligen spezifischen betrieblichenKontext <strong>in</strong>stitutionalisiert werden kann, s<strong>in</strong>d bis auf Ausnahmenwenig bis gar nicht ausgeprägt. Insbeson<strong>der</strong>e istdie Erkenntnis, dass engagierte ehemalige Beschäftigteals positive Visitenkarte ihres Unternehmens wahrgenommenwerden könnten, noch zu wenig verankert.Unternehmen können e<strong>in</strong> vorhandenes bürgerschaftlichesEngagement ihrer Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter<strong>in</strong>formell anerkennen und unterstützen, <strong>in</strong>dem sie diesendie Möglichkeit geben, ihre Arbeitszeit so flexibel zu gestalten,dass es nicht zu Konflikten mit den Zeitanfor<strong>der</strong>ungenim bürgerschaftlichen Engagement kommt. Dazugehört die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub für vorübergehend<strong>in</strong>tensive bürgerschaftliche Aktivitäten zu nehmen.Die Beschäftigten können <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em vere<strong>in</strong>bartenUmfang die Infrastruktur des Betriebes wie Internet, Kopierer,Faxgeräte, Fahrzeuge o<strong>der</strong> Räume usw. nutzen.Unternehmen sollten für ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen undArbeitnehmer Sem<strong>in</strong>are anbieten, die e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong>die Möglichkeiten für e<strong>in</strong> nachberufliches Engagementbieten. Dies kann Hand <strong>in</strong> Hand mit e<strong>in</strong>em formalisierten„Bürgerengagementprogramm“ für kurz vor dem Rentene<strong>in</strong>trittstehende und ehemalige Beschäftigte gehen.Engagierte und noch-nicht-engagierte ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer erhalten die Möglichkeit,durch Kurze<strong>in</strong>sätze <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>wohlorganisationen neueEngagementfel<strong>der</strong> kennen zu lernen und können bei Interessedie letzten Wochen auf Kosten <strong>der</strong> Betriebe <strong>in</strong> ihremfavorisierten Engagementfeld arbeiten. Die öffentlichenArbeitgeber sollten hier mit gutem Beispiel vorangehenund modellhaft solche Projekte für ihre vor <strong>der</strong> Pensionierungstehenden Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter anbieten,die Ergebnisse evaluieren lassen und <strong>in</strong> die Öffentlichkeittragen.5 Ausbau und Verstetigung <strong>der</strong> engagementför<strong>der</strong>ndenInfrastruktur: Die Informations- und Kontaktstellenfür engagierte und engagementbereite Bürger<strong>in</strong>nenund Bürger müssen stärker ausgebaut und diebestehenden Institutionen langfristig abgesichert werden.Diese Mittlerorganisationen – seien es Freiwilligenagenturen,Seniorenbüros o<strong>der</strong> Selbsthilfekontaktstellen –übernehmen e<strong>in</strong> breites Spektrum von Funktionen wie dieAnbahnung und Vermittlung von Engagementverhältnissen,Information von <strong>in</strong>teressierten Bürger<strong>in</strong>nen/Bürgernund Organisationen, Lobby<strong>in</strong>g o<strong>der</strong> Weiterbildung vonFreiwilligen usw. Wenn das bürgerschaftliche Engagementernsthaft als Teil e<strong>in</strong>er Reformperspektive für dieBürgergesellschaft verstanden wird, muss e<strong>in</strong>e geeigneteInfrastruktur vorhanden se<strong>in</strong>, welche die Prozesse <strong>der</strong>(Selbst-)Aktivierung <strong>der</strong> Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger begleitenund unterstützen kann.6 Die kommunale Bürgerbeteiligung sollte stärkerausgebaut werden: Die Öffnung <strong>der</strong> Verwaltung für dasEngagement ihrer Bürger sollte auf allen Ebenen vorangetriebenwerden. Es handelt sich dabei aber explizit ume<strong>in</strong>e Aufgabe, die Altersgruppen übergreifend zu verstehenist. Die politische Repräsentation und Partizipation
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 225 – Drucksache 16/2190sowie die Aktivierung des Engagements aller Altersgruppens<strong>in</strong>d Voraussetzung für e<strong>in</strong> funktionierendes Geme<strong>in</strong>wesen.Dabei kann von erfolgreichen Modellen <strong>der</strong> Bürgerbeteiligunggelernt werden. In vielen Geme<strong>in</strong>den zeigtdie Erfahrung, dass erfolgreiche Bürgerbeteiligungsprozessevor allem im Bereich <strong>der</strong> Stadtentwicklung angestoßenwerden konnten.7 Instrumentalisierung des Engagements verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n/SozialeVoraussetzungen schaffen: Sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong>Praxis als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wissenschaft wächst die Befürchtung,dass die seit vielen Jahren beklagte „Lückenbüßerfunktiondes Ehrenamts für den Rückzug des Sozialstaats“von e<strong>in</strong>em rhetorischen Geme<strong>in</strong>platz <strong>der</strong>Ehrenamtsforschung zu e<strong>in</strong>em Problem werden könnte,das die Grundlagen des bürgerschaftlichen Engagementsaushöhlt. Es ist darauf zu achten, dass Ehrenamtlichenicht als billiger Ersatz für abgebautes Personal e<strong>in</strong>spr<strong>in</strong>genund damit <strong>in</strong>direkt <strong>zur</strong> Festigung <strong>der</strong> Massenarbeitslosigkeitbeitragen.Bürgerschaftliches Engagement kann nur dann geleistetwerden, wenn die eigene soziale <strong>Lage</strong> gesichert ist undeigene Ressourcen <strong>in</strong> den Dienst <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft bzw.Gesellschaft gestellt werden können. Für das Engagementund die Teilhabe älterer Menschen erfor<strong>der</strong>t das, dass ihrAlterse<strong>in</strong>kommen, ihre Wohn- und Lebenssituation sowieihr gesundheitlicher Zustand e<strong>in</strong> zufriedenes und abgesichertesLeben ermöglichen – die H<strong>in</strong>wendung zu an<strong>der</strong>ensetzt voraus, dass die <strong>in</strong>dividuelle Sorge nicht nur um daseigene Leben kreisen muss. Damit verbunden ist <strong>der</strong>Kampf gegen soziale Prozesse <strong>der</strong> Ausschließung undDiskrim<strong>in</strong>ierung, sei es auf Grund materieller, gesundheitlicher,ethnischer, regionaler o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er Benachteiligungen.8 Soziale Ungleichheiten des Engagements abbauen:Ehrenamtliches Engagement folgt auch im Altere<strong>in</strong>em klaren Muster <strong>der</strong> sozialen Ungleichverteilungnach Geschlecht, Bildung, E<strong>in</strong>kommen und Berufsstatus.Damit Maßnahmen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung nicht nurwie bisher die „happy few“ <strong>der</strong> sozial Bessergestelltentreffen und damit <strong>zur</strong> Verschärfung sozialer Ungleichheitenbeitragen, sollten vor allem auch bildungsferne undsozial schwächere Bevölkerungsgruppen mit ihren spezifischenPotenzialen und Wünschen angesprochen werden.Gerade diese Personen können durch milieu- undzielgruppengerechte Engagementangebote auch neuebzw. nachholende Bildungs- und Lernerfahrungen machen;aber nur dann, wenn soziale Schwellenängste abgebautwerden und höhergebildete bzw. sozial höher stehendePersonen nicht die jeweiligen Engagementfel<strong>der</strong>dom<strong>in</strong>ieren. Das be<strong>in</strong>haltet auch die gezielte För<strong>der</strong>ungdes Zugangs von Frauen und Männern zu bislang für siejeweils untypischen Engagement- und Beteiligungsformenund damit e<strong>in</strong>e tendenzielle Aufhebung <strong>der</strong> klassischenTrennung zwischen dem niedriger bewerteten sozialenEhrenamt von Frauen und dem angesehenerenpolitischen Ehrenamt von Männern.9 Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engagementsbei Reformen <strong>der</strong> Versorgungssysteme für ältereund alte Menschen: Das bürgerschaftliche Engagementvon Älteren für Ältere wird <strong>in</strong> Zukunft anBedeutung gew<strong>in</strong>nen. Dabei werden <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e neue<strong>in</strong>telligente Mischungen aus familialer, professionellerund ehrenamtlicher Pflege <strong>zur</strong> langfristigen Stabilisierungvon Hilfebeziehungen und Pflegearrangements wichtigerwerden. Die Entwicklungen auf dem Pflegemarkt und<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Wirkung des Pflegeversicherungsgesetzesauf die traditionellen Elemente bürgerschaftlichenEngagements <strong>in</strong> diesem Bereich wurden bereits von <strong>der</strong>Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages kritischbeurteilt. E<strong>in</strong> Zurückdrängen des bürgerschaftlichenEngagements wird zwar weniger dem Pflegeversicherungsgesetzselbst zugeschrieben als eher dessen Umsetzung.Auf die Kompatibilität von professioneller, ehrenamtlicherund familiärer Hilfe und die För<strong>der</strong>ung vongemischten Hilfearrangements muss bei den Reformprojekten,die <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzgeberischen Kompetenz des Bundesliegen, <strong>in</strong> Zukunft stärker Rücksicht genommen bzw.die Ermöglichung gemischter Hilfearrangements solltesystematisch geför<strong>der</strong>t werden.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 227 – Drucksache 16/21908 Migration und Potenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft8.1 Kulturübergreifende und kulturspezifischeDef<strong>in</strong>itionen von PotenzialenAuch wenn sich generelle Erkenntnisse über Potenzialedes Alters <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft und Wirtschaft Deutschlandsweitgehend auf die hier lebenden älteren Migrantenund Migrant<strong>in</strong>nen übertragen lassen, so sollte doch beachtetwerden, dass die jeweiligen Def<strong>in</strong>itionen von Potenzialenstets mit normativen Setzungen verbunden s<strong>in</strong>d.Versteht man Potenziale als Möglichkeiten <strong>zur</strong> Befriedigungvon Bedürfnissen und berücksichtigt man, dass Potenzialeimmer auch soziokulturelle Konstruktionen s<strong>in</strong>d,so bedeutet dies für Migranten und Migrant<strong>in</strong>nen zunächste<strong>in</strong>mal, dass sich ihre Bedürfnisse aus ihrer spezifischenMigrationssituation und aus ihrem soziokulturellenMilieu ergeben. Daraus resultieren dann auch ihrejeweiligen spezifischen Potenziale. Undifferenzierte, klischeehafteDarstellungen von Migranten beh<strong>in</strong><strong>der</strong>n jedochdie Wahrnehmung solcher Potenziale, die <strong>in</strong> <strong>der</strong>Folge e<strong>in</strong>fach schlicht übersehen o<strong>der</strong> unter- bzw. überschätztwerden, d.h. vorhandene Chancen werden nichterkannt, bzw. notwendige Hilfen werden nicht <strong>zur</strong> Verfügunggestellt.E<strong>in</strong> wichtiges Ziel <strong>der</strong> folgenden Analysen ist es daher,immer wie<strong>der</strong> auf die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er differenziertenWahrnehmung von Migration h<strong>in</strong>zuweisen. Die Migrantenbevölkerungist <strong>in</strong> sich sehr heterogen. Dies trifft vorallem auf die <strong>in</strong> den Herkunftslän<strong>der</strong>n sozialisierte ersteMigrantengeneration zu. Die Heterogenität ergibt sichnicht nur durch die jeweilige soziale Schichtzugehörigkeit,son<strong>der</strong>n auch aus vielfältigen, je Migrantengruppemöglichen Komb<strong>in</strong>ationen von Merkmalen. Darunter fallenetwa die nationale, ethnische, religiöse Zugehörigkeit,die Aufenthaltsdauer, aber auch <strong>der</strong> gruppenspezifischeMigrationsstatus: s<strong>in</strong>d es EU-Angehörige, Drittstaatler,aus Anwerbelän<strong>der</strong>n Kommende o<strong>der</strong> Flüchtl<strong>in</strong>ge etc.Von Bedeutung s<strong>in</strong>d auch die Unterschiede des Migrationsprojekts,die e<strong>in</strong>e endgültige Nie<strong>der</strong>lassung o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>etemporäre bzw. zirkuläre Migration zum Ziel haben können.Alter und Altersbil<strong>der</strong> als gesellschaftliche Konstruktionenbeziehen sich auf die jeweiligen sozialen und kulturellenMilieus <strong>der</strong> alten Menschen. Migranten leben häufig <strong>in</strong>– <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> deutschen Gesellschaft entstandenen – eigenenMigrantengesellschaften. Als Angehörige <strong>der</strong>Ausländische Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland nach Staatsangehörigkeiten im Jahr 2003Abbildung 28Türkei26%an<strong>der</strong>e37%Italien8%Russische. För<strong>der</strong>ation2%Bosnisn und Herzegow<strong>in</strong>a2%Portugal2% Kroatien3%Österreich3%Polen4%Serbien / Montenegro8%Griechenland5%Quelle: Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration 2004: 4.
Drucksache 16/2190 – 228 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeersten <strong>Generation</strong> beispielsweise konstruieren sie ihr Altersbildbezogen auf diese Migrantengesellschaften bzw.ihre Herkunftsgesellschaften. Dies umso stärker, je wenigersie kulturell <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Gesellschaft <strong>in</strong>tegrierts<strong>in</strong>d. Insofern entscheidet auch <strong>der</strong> Grad <strong>der</strong> kulturellenIntegration <strong>der</strong> Migranten mit über die Art ihrer altersbezogenenPotenziale.Die kulturelle Integration von Migranten <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong>f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> Wechselwirkung zwischen den Akkulturationsangeboten<strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft e<strong>in</strong>erseits und<strong>der</strong> Integrationsbereitschaft <strong>der</strong> Migranten an<strong>der</strong>erseitsstatt. Man kann davon ausgehen, dass Migranten ländlicherHerkunft größere Hürden überw<strong>in</strong>den müssen, alsdiejenigen städtischer Herkunft, um sich auf e<strong>in</strong>e mo<strong>der</strong>neIndustriegesellschaft e<strong>in</strong>zulassen. Über die Akkulturationsbereitschaftentscheidet auch die Größe <strong>der</strong> jeweiligenethnischen Gruppe. Angehörige zahlenmäßiggroßer Gruppen, beispielsweise türkischer Herkunft, die<strong>in</strong> ihren ethnischen Kolonien im Alltag autark bzw. imethnischen Arbeitsmarkt beschäftigt s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d wenigerdarauf angewiesen, sich zu akkulturieren, als die Angehörigenkle<strong>in</strong>erer Gruppen, die über solche Alternativennicht verfügen.Der Grad kultureller Integration nimmt, neben an<strong>der</strong>enParametern <strong>der</strong> Lebenslage, bei den Migranten E<strong>in</strong>fluss,wenn es um den Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en <strong>in</strong> ihrenFamilien und <strong>der</strong>en Potenziale geht. Darunter kann mandie Unterschiede o<strong>der</strong> Übere<strong>in</strong>stimmungen <strong>in</strong> kulturellenOrientierungen – grob skizziert – etwa Richtung Traditionalismus/Familismuso<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nismus/Individualismuszwischen den <strong>Generation</strong>en verstehen. Bei kulturellerNähe s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>nerfamiliale Hilfepotenziale gegeben, beikultureller Dissonanz o<strong>der</strong> gar Entfremdung zwischenden Migrantengenerationen ist e<strong>in</strong>e Schwächung von <strong>in</strong>nerfamilialenHilfepotenzialen anzunehmen. Man kanndavon ausgehen, dass <strong>in</strong> den meisten Migrantenfamilien<strong>der</strong> Akkulturationsgrad <strong>der</strong> zweiten Migrantengeneration,bei vollständiger Sozialisation <strong>in</strong> Deutschland, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regeldeutlich höher liegt als bei <strong>der</strong> Elterngeneration.„Reethnisierungen“ <strong>der</strong> zweiten Migrantengeneration,wie sie häufig <strong>in</strong> vielen Immigrationslän<strong>der</strong>n beobachtetwerden, basieren weniger auf e<strong>in</strong>er Unkenntnis <strong>der</strong> Kulturdes Aufnahmelandes, son<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d eher auf demonstrativeDistanzierungen o<strong>der</strong> sogar militante Ablehnung<strong>zur</strong>ückzuführen.8.2 Migration: Prognosen und SzenarienIn Deutschland beträgt <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>anteil etwa 8,9 Prozent(Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration,Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration 2005: 574), wobei bereitsE<strong>in</strong>gebürgerte nicht mitgezählt werden. In Zukunft wirddie ausländische Bevölkerung vor allem <strong>der</strong>jenigen Nationalitätenweiter wachsen, <strong>in</strong> denen die jüngeren Altersgruppenstark besetzt s<strong>in</strong>d, wie z.B. bei den Migrantenaus <strong>der</strong> Türkei. Die Bundesrepublik Deutschland gehörtseit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts zu denjenigenLän<strong>der</strong>n Europas mit den stärksten Migrationsbewegungen.Denationalisierung und Globalisierung (Beisheimet al. 1999; Dreher 2003), politische Umbrüche imOsten Europas, die Erweiterung <strong>der</strong> Europäischen Unionund die generelle sozioökonomische Entwicklung <strong>der</strong> bereitse<strong>in</strong>gewan<strong>der</strong>ten und nun bereits <strong>in</strong> dritter <strong>Generation</strong><strong>in</strong> Deutschland lebenden Bevölkerung haben das ThemaMigration <strong>in</strong>s Zentrum <strong>der</strong> sozialpolitischen Diskussiongerückt und zu e<strong>in</strong>em wichtigen Bestimmungsfaktor vondemografischen Zukunftsszenarien werden lassen. Überquantitative und qualitative Merkmale aktueller und zukünftigerMigrationen, wie auch über die hierzu notwendigenSteuerungsmechanismen, gibt es <strong>in</strong> Wissenschaftund Politik, jeweils von unterschiedlichen Prämissen ausgehendund unterschiedlichen gesellschaftlichen Visionenfolgend, grundlegende Kontroversen (Deutscher Bundestag2002).Je nach Bl<strong>in</strong>kw<strong>in</strong>kel und Erkenntnis<strong>in</strong>teresse, ob sozialo<strong>der</strong>kulturpolitisch o<strong>der</strong> demografisch, betriebs- o<strong>der</strong>volkswirtschaftlich fokussiert, werden unterschiedlicheKosten-Nutzen-Bilanzen <strong>der</strong> Migration gezogen (DIW2002; Schmidt 2002; Leber 2004). Somit entstehen auchunterschiedliche Szenarien über den zukünftigen Immigrationsbedarfnach Deutschland, über se<strong>in</strong> Ausmaß, sowieüber Herkunft, Zahl und Qualifikation künftiger Immigranten.Dabei besteht Übere<strong>in</strong>stimmung, dass Migrationper se ke<strong>in</strong>e Lösung des demografischen Problems istund auch nicht ohne weiteres e<strong>in</strong>e Antwort auf Probleme<strong>der</strong> Arbeitsmarktentwicklung darstellt.Die demografischen Prognosen zeigen, dass das Erwerbspersonenpotenzialetwa ab 2020 rapide <strong>zur</strong>ückgehenwird. Mit e<strong>in</strong>er Nettozuwan<strong>der</strong>ung von z.B. 200.000 Personenpro Jahr wird dieser Effekt weiter existieren. Auche<strong>in</strong>e Nettowan<strong>der</strong>ung von 500.000 Personen jährlichwürde zwar das Potenzial zunächst wesentlich erhöhen,den Rückgang aber nur (um ca. 20 Jahre) verschieben(Hönekopp 2004). Hiermit wird nur <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>e Rahmenzukünftiger Entwicklungen gezeigt. Viel schwierigerist es allerd<strong>in</strong>gs, Prognosen über Wirtschaftszweige, Personengruppenund Regionen zu treffen. Exakte Schätzungendes Fachkräftebedarfs etwa s<strong>in</strong>d nicht möglich. Ausden vorliegenden Studien <strong>zur</strong> aktuellen Situation auf demArbeitsmarkt lassen sich aber H<strong>in</strong>weise entnehmen, dasse<strong>in</strong> Mangel <strong>in</strong> verschiedenen Teilbereichen zunehmenwird. Dies ist zunächst vor allem bei Hochschul- undFachhochschulabsolventen <strong>der</strong> Fachrichtungen Informatik,Mathematik, Physik, Chemie <strong>der</strong> Fall. Zeitlich parallellaufen ähnliche Entwicklungen <strong>in</strong> den EU-B<strong>in</strong>nenstaaten,aber auch <strong>in</strong> den weiteren europäischen Län<strong>der</strong>n. Eswird daher zu e<strong>in</strong>em verschärften Wettbewerb um die Anwerbungvon gut qualifizierten Arbeitskräften kommen.Aber auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Bereichen, z.B. <strong>der</strong> personenbezogenenDienstleistungen (Altenpflege etc.), wird es zuEngpässen kommen (Hönekopp 2004). So steigt <strong>in</strong> <strong>der</strong>Landwirtschaft und im Hotel- und Gaststättengewerbe dieNachfrage nach ausländischen Saisonarbeitnehmern <strong>in</strong>den letzten Jahren kont<strong>in</strong>uierlich an. Insgesamt wurden2002 ca. 360.000 Personen aus den mittel- und osteuropäischenLän<strong>der</strong>n als so genannte Programmarbeitnehmer(überwiegend als Saison- und auch als Werkvertragsarbeitnehmer)beschäftigt – mit steigen<strong>der</strong> Tendenz (siehefolgende Tabelle 37). Die Nachfrage nach gut qualifizier-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 229 – Drucksache 16/2190ten Arbeitskräften aus dem Ausland nimmt zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong>e<strong>in</strong>zelnen Segmenten zu. Die Entwicklungen im Zusammenhangmit <strong>der</strong> „Greencard“-Regelung geben hierzuH<strong>in</strong>weise.Zugleich wird es Neuzugänge aus den Reihen <strong>der</strong> heuteunter sechs Jahre alten Auslän<strong>der</strong> geben. Denn wegen <strong>der</strong>hohen Jahrgangsstärken s<strong>in</strong>d auch für die nächsten 10 bis15 Jahre überproportional viele Neuzugänge dieserGruppe auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. So wird z.B.bei den Migranten aus <strong>der</strong> Türkei das Arbeitskräftepotenzial<strong>in</strong> Deutschland kräftig steigen, und es werden wesentlichmehr Personen <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt e<strong>in</strong>treten alsaltersbed<strong>in</strong>gt ausscheiden (Hönekopp 2004). Junge ausländischeArbeitskräfte und solche ausländischer Herkunftkönnen wegen ihrer Mehrsprachigkeit – e<strong>in</strong>e solideberufliche Qualifikation vorausgesetzt – für die exportorientierteWirtschaft Deutschlands e<strong>in</strong> <strong>in</strong>teressantes Arbeitskräftepotenzialdarstellen.Soweit die Entwicklung nationalstaatlich gestaltet werdenkann, steht <strong>in</strong> Deutschland das neue Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetz– verabschiedet nach langen Kontroversen im Jahr 2004 –für den Versuch, E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ung durch e<strong>in</strong> Selektionssysteman die Erfor<strong>der</strong>nisse des Arbeitsmarktes anzupassen.Die Anwerbung von gut qualifizierten Arbeitskräften ausdem Ausland wird sich zukünftig <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weltweitenWettbewerb mit an<strong>der</strong>en Industrienationen vollziehen.Wenn sich qualifizierte Arbeitskräfte aus Entwicklungslän<strong>der</strong>nrekrutieren, muss dies aus entwicklungspolitischerSicht zunehmend problematisiert werden (Dietzel-Papakyriakou 2003). Aus e<strong>in</strong>er Zentrum-Peripherie-Perspektivelässt sich kritisieren, dass gut ausgebildete undfür die Entwicklung ihrer Län<strong>der</strong> dr<strong>in</strong>gend benötigteFachkräfte auf Kosten <strong>der</strong> zumeist ärmeren Län<strong>der</strong> vonden reichen Län<strong>der</strong>n abgeworben werden. Somit wird dieIdee <strong>der</strong> Entwicklungshilfe geradezu auf den Kopf gestellt.Parallel f<strong>in</strong>den weitere neue Entwicklungen statt. Diese,auch unter dem Stichwort e<strong>in</strong>er „Globalisierung von unten“bekannt, s<strong>in</strong>d eng mit <strong>der</strong> heute und <strong>in</strong> Zukunft weiterzunehmenden Erleichterung von Mobilitäts- und Zirkulationsprozessenvon Personen, Waren, Informationen undKapital verknüpft. Temporäre Migrationen und Pendelmigrationenetablieren sich als wichtiger Zukunftsmodus e<strong>in</strong>erweltweiten Migration. Für Migranten aus Drittlän<strong>der</strong>nwird es möglich se<strong>in</strong>, wenn sie sich e<strong>in</strong>bürgern lassen, ihreAngehörigen im Rahmen von Familienzusammenführungenaus den Herkunftslän<strong>der</strong>n nachzuholen. E<strong>in</strong>gebürgerteDrittstaatler genießen dann, wie an<strong>der</strong>e Unionsbürgerauch, im EU-B<strong>in</strong>nenraum Freizügigkeit. In e<strong>in</strong>igenFällen können sie, dank doppelter Staatsangehörigkeit,Mittel- und osteuropäische Programmarbeiter <strong>in</strong> Deutschland, 1991 bis 2002, <strong>in</strong>sgesamtTabelle 37Kr.-pfl.-HaushaltshilfenWerk.-AN 1 Saison-AN 2 Gast-AN 3 Grenz-ANPers. 3 4<strong>in</strong>sgesamt1991 51.771 118.393 2.234 7.000 179.3981992 93.592 195.446 5.057 1.455 12.400 307.9501993 67.270 165.753 5.771 506 11.200 250.5001994 39.069 140.657 5.529 412 8.000 193.6671995 47.565 175.672 5.478 367 8.500 237.5821996 44.020 203.921 4.341 398 7.500 260.1801997 37.021 210.174 3.165 289 5.900 256.5491998 31.772 208.028 3.083 125 5.700 248.7081999 38.620 230.343 3.705 74 4.020 276.7622000 43.575 263.795 5.891 140 3.980 317.3812001 45.379 284.690 5.338 318 4.633 340.3582002 6 43.839 307.167 4.864 358 4.100 1.102 361.4301 Jahresdurchschnittswerte;2 realisierte Vermittlungen, <strong>in</strong>kl. Schausteller;3 Vermittlungen;4 Beschäftigte (Wohnort/Arbeitsortvergleich), angepasst über Arbeitserlaubnisdaten;5 seit Februar 2002;6 Grenz- AN geschätzt.Quelle: Hönekopp 2004: 6. Datenbasis: IAB-Dateien <strong>zur</strong> MOE-Beschäftigung.
Drucksache 16/2190 – 230 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodezudem <strong>in</strong> den Herkunftslän<strong>der</strong>n frei e<strong>in</strong>- und ausreisen.Somit macht e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Migrantenbevölkerung selbstMigrationspolitik, denn jenseits nationalstaatlicher Interventionsmöglichkeitenf<strong>in</strong>den Kettenmigrationen an ersterStelle über Heiratsmigration statt. Grenzüberschreitendentstehen somit neue soziale und ethnischeNetzwerke <strong>der</strong> Migranten: aus klassischen Migrationenwerden Transmigrationen.Diese Phänomene gew<strong>in</strong>nen auch für die e<strong>in</strong>heimischenalten Menschen an Bedeutung. In <strong>der</strong> fachlichen Debattef<strong>in</strong>den sie bisher allerd<strong>in</strong>gs nicht die Aufmerksamkeit, dieihnen zusteht (Dietzel-Papakyriakou, Leotsakou &Raptaki 2004). Da bisher zu wenig Datenmaterial dieseneuen Tendenzen dokumentiert, konzentriert sich die Migrationsforschungweiterh<strong>in</strong> auf die alten Migrationsformen(e<strong>in</strong>malige E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ung, endgültige Rückkehr)und lässt die Beobachtung neuer Formen, wie den Transnationalismusaußer Acht (Faist & Özveren 2004).Diese neuen Entwicklungen verstärken die Heterogenität<strong>der</strong> Migrantenbevölkerung weiter. Sie hat sich – verglichenmit dem Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Anwerbung von ausländischenArbeitskräften <strong>in</strong> den fünfziger Jahren – von vornehmlichniedrig Qualifizierten weitgehend ausdifferenziert. DieseDifferenzierung kann entwe<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e importierte se<strong>in</strong>, d.h.beruflich hoch Qualifizierte immigrieren <strong>in</strong> höhere sozioökonomischePositionen des Aufnahmelandes, o<strong>der</strong> siekann durch die Migration erworben se<strong>in</strong>. Dies würde bedeuten,dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft Deutschlandfür die Migranten e<strong>in</strong> sozialer Aufstieg stattgefunden hat.Letzterer gilt als Indikator von sozialer Mobilität und damitals Gradmesser <strong>der</strong> Opportunitäten <strong>zur</strong> sozialen Integration,die e<strong>in</strong>e Gesellschaft für Migranten bereithält.Ebenso werden demografische, sozioökonomische undkulturelle Angleichungsprozesse an die deutsche Bevölkerungals Integration <strong>in</strong>terpretiert. Der Begriff <strong>der</strong> Integrationwird <strong>in</strong> den jeweiligen politisch-ideologischenKontexten sehr verschiedenartig verwendet. Integration,hier verstanden als soziokulturelle, schichtbezogene Angleichung<strong>zur</strong> e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerung, f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> unterschiedlicherWeise und Intensität von e<strong>in</strong>er Migrantengenerationund Nationalitätengruppe <strong>zur</strong> an<strong>der</strong>en statt.Nimmt man etwa als Kriterium die aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> e<strong>in</strong>heimischenBevölkerung empfundene kulturelle Nähe zuden verschiedenen Migrantenpopulationen, werden z.B.die Migranten aus <strong>der</strong> Türkei mit e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen und dieItaliener mit e<strong>in</strong>er großen kulturellen Nähe wahrgenommen.Wie <strong>in</strong> je<strong>der</strong> Gesellschaft verlaufen diese Prozessesozialer Etikettierungen wechselseitig, f<strong>in</strong>den E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong>das Selbstkonzept und nehmen E<strong>in</strong>fluss auf die Interaktionzwischen Migranten und E<strong>in</strong>heimischen.Die Migranten aus <strong>der</strong> Türkei s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>zige Nationalitätengruppe,die auf Grund ihrer zahlenmäßigen Größe <strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>Lage</strong> ist, quasi-autarke ethnische Kolonien zu bildenund sich zunehmend <strong>in</strong> eigenen Versorgungsstrukturen zusegregieren. Diese, für die verschiedenen Migrantengruppenje nach Migrationssituation unterschiedlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungens<strong>in</strong>d auch für das Alter und se<strong>in</strong>e Potenzialeentscheidend. Hierbei wird deutlich, dass, je nachDef<strong>in</strong>itionskontext und Perspektive, Potenziale unterschiedlichverstanden werden können. So können z.B. <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er ethnisch segregierten Umgebung durchaus Potenzialefür Angehörige dieses soziokulturellen Milieus vorhandense<strong>in</strong>, die aber aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Majoritätsgesellschaftnicht erkannt bzw. anerkannt werden.Dies führt e<strong>in</strong>mal mehr zu <strong>der</strong> E<strong>in</strong>sicht, dass es we<strong>der</strong>„die“ Migranten noch „die alten“ Migranten als e<strong>in</strong>e dist<strong>in</strong>kte,homogene soziale Gruppe gibt. Demzufolge werdensich die nachstehenden Ausführungen vor allem aufdie Migranten aus den Anwerbelän<strong>der</strong>n konzentrieren.Hierzu liegen auch die meisten Daten vor, während esüber die älteren Flüchtl<strong>in</strong>ge so gut wie ke<strong>in</strong>e Daten gibt.Ebenso gibt es auch zu den alten Aussiedlern kaum Daten.Wenn wie<strong>der</strong>um von „Auslän<strong>der</strong>n“ im Allgeme<strong>in</strong>en dieRede ist, dann werden unter dieser Bezeichnung sehrviele unterschiedliche Auslän<strong>der</strong>gruppen subsumiert. SoziologischeAnalysen beziehen sich jedoch auf statistischeDaten, die lediglich das Merkmal <strong>der</strong> Staatsangehörigkeit<strong>in</strong>dizieren. Bereits jetzt hat sich das bisherbestehende Instrumentarium <strong>der</strong> statistischen Dokumentationals untauglich erwiesen, Migration realitätsnah zubeschreiben. E<strong>in</strong> Befund, <strong>der</strong> <strong>in</strong> Zukunft noch deutlicherzu Tage treten wird (Bundesm<strong>in</strong>isterium des Innern2001).Die zunehmende Komplexität <strong>der</strong> Migrantenbevölkerungwird auch durch die Vielfalt <strong>der</strong> Term<strong>in</strong>i deutlich. Angefangenvom antiquiert und euphemistisch kl<strong>in</strong>genden„Gastarbeiter“ bis zum allumfassenden Begriff „Personenmit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund“ werden die Benennungen„Auslän<strong>der</strong>“, „Migrant“, „E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>er“, „Personen ausländischerHerkunft“, „ausländische Mitbürger“, sowie„erste und nachfolgende Migrantengenerationen“ sorglosvermengt, obwohl es sich dabei stets um e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>eGrundgesamtheit handelt. Die e<strong>in</strong>zige Grundgesamtheit,über die statistische Daten vorliegen, ist diejenige <strong>der</strong>Auslän<strong>der</strong>, also Personen ausländischer Staatsangehörigkeit,wohnhaft <strong>in</strong> Deutschland, <strong>der</strong>en Zahl durch das Auslän<strong>der</strong>zentralregisterfortgeschrieben wird. Dabei handeltees sich Anfang <strong>der</strong> siebziger Jahre vor allem umjüngere männliche Migranten im erwerbsfähigen Alter;erst zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt wurde die Familienzusammenführungbedeutsam. Die ältere Migrantenbevölkerungwurde aus <strong>der</strong> Analyse lange Zeit ausgeblendet.Diese setzt sich <strong>in</strong> Deutschland immer mehr und auch <strong>in</strong>den nächsten 20 bis 25 Jahren noch vor allem aus den angeworbenenMigranten <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong> zusammen.Insgesamt kam es <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten zu e<strong>in</strong>er erheblichenVerän<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> den Geschlechterproportionen<strong>der</strong> Migrantenbevölkerung, bed<strong>in</strong>gt durch Familiennachzug,durch Heiratsmigration und durch Geburten. Kamenzu Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Arbeitsmigration vornehmlich junge ausländischeMänner nach Deutschland, so hat <strong>der</strong> Anteilvon Mädchen und Frauen unter <strong>der</strong> Migrantenbevölkerungheute erheblich zugenommen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 231 – Drucksache 16/21908.3 Zur DatenlageDie Ausführungen zu den älteren Migranten basieren vornehmlichauf den folgenden Expertisen, die die 5. Altenberichtskommission<strong>in</strong> Auftrag gegeben hat:– Veysel Özcan, Wolfgang Seifert: Lebenslage ältererMigrant<strong>in</strong>nen und Migranten <strong>in</strong> Deutschland,– Thomas K. Bauer, Hans Dietrich von Loeffelholz,Christoph M. Schmidt: Wirtschaftsfaktor ältere Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten <strong>in</strong> Deutschland – Stand undPerspektiven,– Johannes Korporal, Bärbel Dangel: Die Gesundheitvon Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten als Voraussetzungfür Beschäftigungsfähigkeit im Alter,– sowie auf den Recherchen von Elmar Hönekopp fürden 5. Altenbericht.Datenbasis <strong>der</strong> Expertisen s<strong>in</strong>d das Sozio-oekonomischePanel (SOEP), <strong>der</strong> Mikrozensus, (wobei überwiegend Daten<strong>der</strong> neuesten Welle aus dem Jahr 2002 verwendet werden),das Auslän<strong>der</strong>zentralregister und die amtliche Fortschreibungdes Bevölkerungszustandes. Sowohl bei denDaten des Sozio-oekonomischen Panels als auch im Mikrozensuss<strong>in</strong>d bei ausländischen Alten, vor allem beiFragestellungen, die sowohl Geschlecht als auch Nationalitätenzugehörigkeitberücksichtigen sollen, die Fallzahlgrenzenschnell erreicht. So mussten beim Sozio-oekonomischenPanel von vornehere<strong>in</strong> Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen undAuslän<strong>der</strong> aus den Anwerbestaaten zusammengefasstwerden, da für die Analyse e<strong>in</strong>zelner Gruppen die Fallzahlennicht ausreichten. Dies führt aber EU-Angehörigemit Drittstaatlern zusammen, wodurch bestehende, erheblicheUnterschiede zwischen den Migrantengruppen, dieauf diesen Status <strong>zur</strong>ückgehen, nicht nur <strong>in</strong> <strong>der</strong> Deskription,son<strong>der</strong>n auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Interpretation nivelliert werden.Die Fallzahlen des Mikrozensus <strong>in</strong>des s<strong>in</strong>d von den Fallzahlen<strong>in</strong>sgesamt ausreichend für die Untersuchung Ältereraus <strong>der</strong> Türkei, Italien, Griechenland und dem ehemaligenJugoslawien. Aber auch hier lassen die Fallzahlene<strong>in</strong>e Aufschlüsselung nach Geschlecht nicht zu. Bei denDaten des Auslän<strong>der</strong>zentralregisters ist zwar e<strong>in</strong>e Auswertung<strong>der</strong> Statistiken nach Staatsangehörigkeiten möglich,dies jedoch nur für die größeren Nationalitäten.Ebenso ist auch hier e<strong>in</strong>e Geschlechterdifferenzierungnicht immer möglich.Diese unbefriedigende Datenbasis wird <strong>in</strong> den vorliegendenExpertisen, wie auch <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Migrationsforschungstark bemängelt (6. Familienbericht 2000). Zume<strong>in</strong>en ist sie dem Thema Migration immanent, denn diehohe grenzüberschreitende Mobilität <strong>der</strong> ausländischenBevölkerung lässt sich statistisch nur schwer erfassen.Zum an<strong>der</strong>en wird aber auch kritisiert, dass viele Erhebungskategoriensich aus theoretischen Ansätzen ergeben,wie sie zu Anfang <strong>der</strong> Migration vertreten wurden,und nicht geeignet s<strong>in</strong>d, die heutige Situation adäquat abzubilden(Bundesm<strong>in</strong>isterium des Innern 2001; DeutscherBundestag 2002; Sachverständigenrat für Zuwan<strong>der</strong>ung2004).Auf Grund mangeln<strong>der</strong> Differenzierung <strong>der</strong> Daten s<strong>in</strong>dVergleiche zwischen den Migrantengruppen kaum durchführbar,sodass positive Entwicklungen schwer zu erkennens<strong>in</strong>d. Wie es überhaupt kaum möglich ist, Prozesseund qualitative Verän<strong>der</strong>ungen im Migrationsverlauf aufBasis <strong>der</strong> dürftigen Datenlage zu erfassen. Aber auchQuerschnitte, beispielsweise beson<strong>der</strong>er Merkmale ältererMigrant<strong>in</strong>nen, lassen sich nicht durchführen.Repräsentative Studien über die quantitativ kle<strong>in</strong>eren Nationalitätengibt es kaum, auch <strong>in</strong> den Statistiken werden,wenn überhaupt, alle diese Migrantengruppen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kategorie„Sonstige“ o<strong>der</strong> „an<strong>der</strong>e“ zusammengefasst, obwohlsie zusammengenommen ca 40 Prozent <strong>der</strong> ausländischenBevölkerung ausmachen. So gibt es z.B. <strong>in</strong>Deutschland über die Migranten aus Afrika kaum Kenntnisse,geschweige denn über die Älteren unter ihnen.Ähnliches gilt für die Migranten aus Asien. Je spezifischeralso die Betrachtung, desto unschärfer wird dasBild. H<strong>in</strong>gegen ist es verständlich, dass zu den Migrantenohne Aufenthaltsstatus (so genannte Illegale) ke<strong>in</strong>e Datenvorliegen (Bade 2001; Schönwäl<strong>der</strong> et al. 2004). E<strong>in</strong>enE<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Lebenswelt dieser Gruppe geben lediglichErfahrungsberichte von Kirchen, Wohlfahrtsverbändenund Gewerkschaften (Alt 2003).In <strong>der</strong> folgenden Analyse wird über Migranten gesprochen.Eigentlich stehen, wie oben erwähnt, nur Daten zuAuslän<strong>der</strong>n, also zu e<strong>in</strong>er Untergruppe von Migranten <strong>zur</strong>Verfügung. Denn Migranten, die sich e<strong>in</strong>bürgern lassen,werden nicht mehr als Auslän<strong>der</strong> geführt – auch wenn sieDoppelstaatler s<strong>in</strong>d. Nimmt man hier an, dass sich vor allemjüngere Auslän<strong>der</strong> e<strong>in</strong>bürgern, ist die Verzerrung– was Daten zu den Älteren betrifft –, vergleichsweise ger<strong>in</strong>g.Bekanntlich werden bei den Angaben des Auslän<strong>der</strong>zentralregistersK<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche tendenzielluntererfasst. An<strong>der</strong>erseits kommt es zu e<strong>in</strong>er Übererfassungvon Personen mittleren und höheren Alters. Zu diesemProblem gibt es zwar mittlerweile mehrere H<strong>in</strong>weise,darunter im 6. Familienbericht. Das Bundes<strong>in</strong>nenm<strong>in</strong>isteriumsieht <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>en „Korrekturbedarf <strong>in</strong> erheblichemUmfang“. Nach Auffassung des M<strong>in</strong>isteriums tragen<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Bundeslän<strong>der</strong> (Bayern undNordrhe<strong>in</strong>-Westfalen) die Verantwortung für die falschenZahlen im Auslän<strong>der</strong>zentralregister. Auf Grund nicht erfolgterAktualisierungen wird die Zahl <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> überschätzt.Demzufolge leben <strong>in</strong> Deutschland 700.000 Auslän<strong>der</strong>weniger als angenommen (Handelsblatt 09.03.05).Weitere Verzerrungen ergeben sich bei <strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong>Aufenthaltsdauer. Weil die Rückkehrer mitgezählt bzw. dieUnterbrechungen des Aufenthaltes durch Mehrfachzuwan<strong>der</strong>ungennicht berücksichtigt werden, ist die ermitteltedurchschnittliche Aufenthaltsdauer überhöht.Darüber h<strong>in</strong>aus gibt es e<strong>in</strong>e Reihe von methodischen Problemen,wenn E<strong>in</strong>heimische mit Migranten verglichenwerden. Dies betrifft z.B. die Altersgruppenbildung. Sosollte beim Vergleich mit Parallelgruppen <strong>der</strong> deutschenBevölkerung berücksichtigt werden, dass Alter, weil gesellschaftlichkonstruiert, für die erste Migrantengenerationpsychisch und sozial früher e<strong>in</strong>tritt. Belastende Berufskarrierenund die schwierigen Lebensbed<strong>in</strong>gungen
Drucksache 16/2190 – 232 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodevor <strong>der</strong> Migration im Herkunftsland führen dazu, dassviele Migranten auch physisch früh altern. Um diesesPhänomen zu berücksichtigen, zum Teil aber auch, umden Mangel an Statistiken über ältere Migranten aufzuheben,werden die Altersgrenzen nach unten verschoben. Sowird e<strong>in</strong>e ausreichende Fallzahl erreicht. Dies ist abermeistens nur <strong>der</strong> Fall bei den größeren Nationalitäten(Bundesm<strong>in</strong>isterium für Arbeit und Sozialordnung 2002),und am häufigsten geschieht dies bei <strong>der</strong> Gruppe türkischerStaatsangehöriger, die etwa 30 Prozent <strong>der</strong> ausländischenBevölkerung ausmacht, auf die sich allerd<strong>in</strong>gsüber 90 Prozent <strong>der</strong> wissenschaftlichen Veröffentlichungenbeziehen, während die <strong>Lage</strong> an<strong>der</strong>er Migrantengruppen– vor allem die zahlenmäßig kle<strong>in</strong>eren – bisher weitgehendignoriert wurde.Die Zuwan<strong>der</strong>ungskommission kritisiert e<strong>in</strong>gehend dieun<strong>zur</strong>eichende statistische Dokumentation <strong>der</strong> Migration:„Zur Steuerung von Zuwan<strong>der</strong>ung, E<strong>in</strong>schätzung bestehen<strong>der</strong>Regelungen und Maßnahmen sowie für die Planungund Bereitstellung <strong>der</strong> <strong>zur</strong> Integration notwendigenRessourcen s<strong>in</strong>d verlässliche Daten über das Migrationsgeschehenunabd<strong>in</strong>gbar. Ohne genaues Wissen über Wan<strong>der</strong>ungsbewegungenbleibt je<strong>der</strong> Ansatz für e<strong>in</strong>e Steuerungdes Zuwan<strong>der</strong>ungsgeschehens unvollkommen, daVerän<strong>der</strong>ungen nur un<strong>zur</strong>eichend und nicht schnell genugwahrgenommen werden können. Erst die Kenntnis <strong>der</strong> relevantenDaten eröffnet die Möglichkeit, tatsächliche Migrationsströme<strong>in</strong> ihrer Größenordnung zu erkennen, undschafft die für e<strong>in</strong>e problem- und zielorientierte Politikunentbehrliche Handlungsgrundlage. Die gegenwärtigestatistische Erfassung grenzüberschreiten<strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>ungsbewegungenund <strong>der</strong> e<strong>in</strong>gewan<strong>der</strong>ten Bevölkerung<strong>in</strong> ihrer Gesamtheit wird diesen Anfor<strong>der</strong>ungen nicht gerecht.Sie ist lückenhaft, da bestehende Statistiken jeweilsnur Teilaspekte des Zuwan<strong>der</strong>ungsgeschehens bzw. nurTeile <strong>der</strong> im Ausland geborenen Population erfassen undauch nicht aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> abgestimmt s<strong>in</strong>d.“ (Bundesm<strong>in</strong>isteriumdes Innern 2001: 291).Dennoch verän<strong>der</strong>t sich <strong>der</strong> Blick auf die Migrantenbevölkerungallmählich. Immer mehr wird wahrgenommen,dass die Migrantenbevölkerung e<strong>in</strong> komplexes Mosaikvon Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus,aus vielen nationalen, ethnischen und religiösen Zugehörigkeitenist. Neben <strong>der</strong> neue<strong>in</strong>gereisten und sich durchZuzüge immer wie<strong>der</strong> erneuernden ersten <strong>Generation</strong> leben<strong>in</strong> Deutschland ebenso Migranten <strong>in</strong> <strong>der</strong> dritten <strong>Generation</strong>.Es gibt immer häufiger b<strong>in</strong>ationale Ehen, entwe<strong>der</strong>deutsch-ausländische o<strong>der</strong> unter Auslän<strong>der</strong>n verschiedenerNationalitäten. Allerd<strong>in</strong>gs handelt es sich bei dendeutsch-ausländischen Ehen häufig auch um e<strong>in</strong>gebürgertePersonen, die (noch) nicht e<strong>in</strong>gebürgerte Partner <strong>der</strong>eigenen Herkunftsnationalität heiraten. In vielen solchenEhen werden Ehepartner aus dem Herkunftsland geholt.Hier handelt es sich dann um Ehen zwischen Angehörigenunterschiedlicher Migrantengenerationen. In dieserzunehmend komplexer werdenden Wirklichkeit <strong>der</strong>Migrantenfamilien leben auch die älteren Migranten(Dietzel-Papakyriakou 2000).Aus den theoretischen Diskussionen <strong>der</strong> gerontologischenund <strong>der</strong> Migrationsforschung lässt sich <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mitethnologischen und anthropologischen Ansätzen e<strong>in</strong>eganze Reihe <strong>in</strong>teressanter Hypothesen über das Alter(n)<strong>der</strong> Migranten aufstellen. E<strong>in</strong>ige s<strong>in</strong>d durch empirischeUntersuchungen bestätigt worden. So s<strong>in</strong>d <strong>zur</strong> Lebenssituationälterer Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten empirischeStudien bereits <strong>in</strong> den 1990er-Jahren veröffentlicht worden(u.a. Zentrum für Türkeistudien 1993; Dietzel-Papakyriakou & Olbermann 1996; Kauth-Kokshoorn1999).8.4 Demografische Struktur und Entwicklung<strong>der</strong> MigrantenbevölkerungNach den vorliegenden statistischen Daten leben heuteca. 1,6 Mio. 50-jährige und ältere Personen mit ausländischerStaatsangehörigkeit <strong>in</strong> Deutschland. Im Jahr 2003waren ca. 458.000 Personen, d.h. 6,2 Prozent <strong>der</strong> ausländischenBevölkerung über 65 Jahre alt. Wie oben erwähnt,s<strong>in</strong>d, obwohl nicht als Auslän<strong>der</strong> registriert, auchdie Spätaussiedler<strong>in</strong>nen und Spätaussiedler von Migrationgeprägt und bef<strong>in</strong>den sich somit <strong>in</strong> vielen Bereichen<strong>in</strong> vergleichbarer <strong>Lage</strong>. So waren von den 72.885 Spätaussiedlern,die im Jahr 2003 <strong>in</strong>s Bundesgebiet zugezogens<strong>in</strong>d, 5.199 bzw. 7,1 Prozent im Rentenalter (StatistischesBundesamt 2005b: 166). Altenpopulationen mitMigrationserfahrung s<strong>in</strong>d somit über diese Zahlen h<strong>in</strong>aus<strong>in</strong> Deutschland bereits jetzt vorhanden und werden esbleiben.Nachfolgende Migrantengenerationen (zweite Migrantengeneration)und Neuimmigrierte (erste <strong>Generation</strong>) werden<strong>in</strong> Zukunft als Angehörige unterschiedlicher Migrationskohorten<strong>in</strong> Deutschland altern, wodurch die Heterogenität<strong>der</strong> ausländischen Altenbevölkerung weiter zunehmenwird.Unter den 1,6 Mio. Migranten im Alter von 50 Jahren undälter, die 2004 <strong>in</strong> Deutschland lebten, stammen fast e<strong>in</strong>Drittel aus EU-Mitgliedslän<strong>der</strong>n und knapp zwei Drittelaus Nicht-EU-Staaten. Aus den ehemaligen Anwerbelän<strong>der</strong>nGriechenland, Italien, Türkei und dem ehemaligenJugoslawien kommen ca. 57 Prozent <strong>der</strong> älteren Auslän<strong>der</strong>;ca. 24 Prozent kommen aus <strong>der</strong> Türkei, ca. 17 Prozentaus dem ehemaligen Jugoslawien, ca. 10 Prozent ausItalien und ca. 6 Prozent aus Griechenland (GeroStat -Deutsches Zentrum für Altersfragen 2005). Auf Grund<strong>der</strong> Anwerbung überwiegend junger Männer für die Industriezwischen Mitte <strong>der</strong> 1950er-Jahre bis zum Anwerbestopp1973 s<strong>in</strong>d weibliche Migranten <strong>in</strong> den entsprechendenAltersgruppen unterrepräsentiert. Im Jahr 2003betrug <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> über 55-jährigen Frauen <strong>in</strong> <strong>der</strong> ausländischenBevölkerung 47 Prozent, <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>Frauen <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Bevölkerung h<strong>in</strong>gegen 57 Prozent(GeroStat - Deutsches Zentrum für Altersfragen2005). Insgesamt s<strong>in</strong>d die Altersgruppen <strong>der</strong> über 65-Jährigenund vor allem <strong>der</strong> über 70-Jährigen bei Auslän<strong>der</strong>nweniger stark besetzt. Es handelt sich bei den älterenAuslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Auslän<strong>der</strong>n im Vergleich zu Deutschenimmer noch um e<strong>in</strong>e „jüngere“ Bevölkerungsgruppe.Dies wird sich <strong>in</strong> Zukunft jedoch än<strong>der</strong>n.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 233 – Drucksache 16/2190Altersstruktur ausgewählter Staatsangehörigkeiten 20031 EU vor <strong>der</strong> Erweiterung.Quelle: Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration 2004: 20.Ausländische und deutsche Altersbevölkerung <strong>in</strong> Deutschland, 1991-2003 1 – <strong>in</strong> 1.000 PersonenTabelle 38unter 18 18 bis u. 25 25 bis u. 40 40 bis u. 60 60 bis u. 6565 undälter<strong>in</strong>sgesamtabsolut<strong>in</strong>% absolut <strong>in</strong>% absolut <strong>in</strong>% absolut <strong>in</strong>% absolut <strong>in</strong>% absolut <strong>in</strong>% absolut <strong>in</strong>%EU-Staaten 1 232.648 12,6 154.704 8,4 581.253 31,4 615.271 33,3 105.614 5,7 160.496 8,7 1.849.986 100Türkei 497.950 26,5 220.899 11,8 598.090 31,9 368.246 19,6 97.782 5,2 94.694 5,0 1.877.661 100Serbien undMontenegro 140.716 24,8 59.032 10,4 166.078 29,2 141.359 24,9 26.437 4,7 34.618 6,1 568.240 100Italien 99.644 16,6 58.524 9,7 180.011 29,9 189.852 31,6 29.701 4,9 43.526 7,2 601.258 100Griechenland54.515 15,4 32.701 9,2 110.921 31,3 101.607 28,7 20.885 5,9 34.001 9,6 354.630 100Polen 27.978 8,6 38.458 11,8 126.749 38,8 114.660 35,1 5.821 1,8 13.216 4,0 326.882 100Kroatien 25.220 10,7 23.081 9,8 64.719 27,4 85.718 36,2 19.318 8,2 18.514 7,8 236.570 100Bosnien-Herzegow<strong>in</strong>a32.687 19,6 18.155 10,9 51.328 30,7 49.775 29,8 7.668 4,6 7.468 4,5 167.081 100Portugal 20.607 15,8 11.589 8,9 47.361 36,3 37.697 28,9 7.041 5,4 6.328 4,8 130.623 100Spanien 9.546 7,6 9.868 7,8 44.085 35,0 37.616 29,9 8.257 6,6 16.605 13,2 125.977 100Afrika 54.291 17,5 44.232 14,2 136.797 44,0 62.040 20,0 5.529 1,8 8.054 2,6 310.943 100Asien 184.947 20,3 122.520 13,4 354.873 38,9 211.118 23,1 14.509 1,6 24.028 2,6 911.995 100Insgesamt 1.337.717 18,2 817.946 11,2 2.488.424 33,9 1.932.750 26,4 317.067 4,3 440.861 6,0 7.334.765 100Tabelle 39JahrAltersgruppen 1991 1997 2003 1991 1997 2003 1991 1997 2003Bevölkerung <strong>in</strong>sgesamt deutsche Bevölkerung ausländische BevölkerungInsgesamt 80.274 82.057 82.531 74.207 74.638 75.190 6.067 7.419 7.341darunter:50 - u. 55 J. 6.211 4.569 5.521 5.874 4.156 5.081 337 413 44055 - u. 60 J. 4.919 5.910 4.417 4.697 5.577 4.021 222 333 39660 - u. 65 J. 4.352 4.961 5.476 4.226 4.745 5.175 126 215 30165 - u. 70 J. 3.797 4.001 4.962 3.723 3.881 4.760 74 120 20270 - u. 75 J. 2.756 3.389 3.511 2.717 3.318 3.399 38 71 11375 J. und älter 5.480 5.577 6.386 5.429 5.492 6.243 52 85 14350 J. und älter 27.515 28.406 30.274 26.666 27.170 28.679 849 1.236 1.595<strong>in</strong> % <strong>der</strong>jew. Gesamtbevölkerung34 35 37 36 36 38 14 17 22Quelle: GeroStat - Deutsches Zentrum für Altersfragen, eigene Berechnungen. Datenbasis: Statistisches Bundesamt: Bevölkerungsfortschreibung.1 Die Daten für das Jahr 2004 s<strong>in</strong>d wegen e<strong>in</strong>er Bere<strong>in</strong>igung des Auslän<strong>der</strong>zentralregisters beim Bundesamt für Migration und Flüchtl<strong>in</strong>ge nur bed<strong>in</strong>gtmit den Vorjahren vergleichbar.
Drucksache 16/2190 – 234 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeAbbildung 29Altersstruktur ausgewählter Staatsangehörigkeiten im Jahr 2003Quelle: Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration 2004: 20, eigene Darstellung.Betrachtet man die im Jahr 2003 <strong>in</strong> Deutschland lebendenüber 60 Jahre alten Auslän<strong>der</strong> differenziert nach ihrerHerkunft, so zeigen sich deutliche Unterschiede: Während14,4 Prozent aller EU-Auslän<strong>der</strong>, 10,2 Prozent <strong>der</strong>Türken und 10,8 Prozent <strong>der</strong> Serben und Montenegr<strong>in</strong>erüber 60 Jahre alt waren, hatten nur 4,4 Prozent <strong>der</strong> Afrikanerund 4,2 Prozent <strong>der</strong> Asiaten dieses Alter bereits erreicht.8.5 Ältere Migrantenbevölkerung als Wirtschaftsfaktor:E<strong>in</strong>kommenssituationund E<strong>in</strong>kommensquellenÄltere Migranten bestreiten ihren Lebensunterhalt überwiegendaus Erwerbstätigkeit (42 Prozent) und aus Rentenu.ä. (33 Prozent). Bezogen auf das Jahr 2002 zeigendie Daten des SOEP, dass das verfügbare E<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong>alten Migranten (ohne Personen mit türkischer Nationalität)je Verbrauchere<strong>in</strong>heit mit 15.642 Euro um e<strong>in</strong> Fünftelunter dem <strong>der</strong> Deutschen (19.700 Euro) liegt. DasE<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong> Migranten aus <strong>der</strong> Türkei erreicht11.370 Euro und damit nur 58 Prozent <strong>der</strong> Vergleichsgruppe<strong>der</strong> Deutschen und weniger als drei Viertel desE<strong>in</strong>kommens <strong>der</strong> übrigen älteren Auslän<strong>der</strong>.Was die E<strong>in</strong>kommenssituation betrifft, lässt sich <strong>in</strong>sgesamtaus den Daten des SOEP e<strong>in</strong> positiver Trend ablesen:Ältere Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten werden zunehmendbesser <strong>in</strong>s System <strong>der</strong> Alterssicherung e<strong>in</strong>gebunden. ImJahr 2002 bezogen 95,2 Prozent <strong>der</strong> über 65-jährigenGriech<strong>in</strong>nen und Griechen sowie 93,8 Prozent <strong>der</strong> Italiener<strong>in</strong>nenund Italiener dieser Altersgruppe wie auch79,4 Prozent <strong>der</strong> über 65-jährigen Türken und Türk<strong>in</strong>nenund 86,7 Prozent <strong>der</strong> Personen aus dem ehemaligen Jugoslawiene<strong>in</strong>e öffentliche Rente (Deutsche: 95,9 Prozent).Verglichen mit 1997 lässt sich damit e<strong>in</strong>e Tendenz<strong>zur</strong> Angleichung an die Werte <strong>der</strong> Deutschen erkennen.Die öffentlichen Renten <strong>der</strong> Arbeitsmigranten <strong>der</strong> ersten<strong>Generation</strong> s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs durchschnittlich niedriger,weil sie häufig spät <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e rentenrelevante Erwerbstätigkeit<strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>getreten s<strong>in</strong>d. Somit haben sie kürzereVersicherungs- und Beitragszeiten, die zudem häufigervon Arbeitslosigkeitszeiten unterbrochen wurden. Inden wenig qualifizierten Berufen ließ sich zudem nur e<strong>in</strong>ger<strong>in</strong>geres Erwerbse<strong>in</strong>kommen erzielen. So erreichte imJahr 2002 das E<strong>in</strong>kommen <strong>der</strong> italienischen Haushaltemit e<strong>in</strong>er über 65-jährigen Haushaltsbezugsperson1.482 Euro im Vergleich zu den griechischen mit1.433 Euro, den türkischen mit 1.208 Euro und solchenaus dem ehemaligen Jugoslawien mit 1.190 Euro (Deutsche:1.603 Euro). Zwischen 1997 und 2002 zeigt dieE<strong>in</strong>kommensentwicklung e<strong>in</strong>en Zuwachs von 37,5 Prozentbei den Haushalten von über 65-Jährigen aus Italienund von 24,9 Prozent bei den Haushalten aus dem ehemaligenJugoslawien (Deutsche: + 15,0 Prozent). Auch hierkann von e<strong>in</strong>em Aufholprozess gesprochen werden(Özcan & Seifert 2004: 12).
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 235 – Drucksache 16/2190Wird statt des gesamten Haushaltse<strong>in</strong>kommens das Haushaltse<strong>in</strong>kommenpro Kopf betrachtet, dann machen sichdie unterschiedlichen Haushaltsgrößen bemerkbar. Damitwachsen die E<strong>in</strong>kommensunterschiede. Während e<strong>in</strong>deutscher Haushalt im Jahr 2002 mit Bezugsperson <strong>in</strong> <strong>der</strong>Altersgruppe über 65 Jahren im Durchschnitt 1.101 Euromonatlich je Haushaltsmitglied <strong>zur</strong> Verfügung hatte, s<strong>in</strong>des bei den türkischen Haushalten dieser Gruppe 593 Euro,bei den italienischen 892 Euro und bei den griechischen792 Euro (Özcan & Seifert 2004: 12f.).Was den privaten Konsum <strong>der</strong> Migrantenbevölkerung angeht,gibt es auch hier nur spärliche Erkenntnisse. Davonausgenommen ist die türkische Bevölkerung, <strong>der</strong>en Kaufkraftpotenzialund Konsumverhalten durch e<strong>in</strong>e Reihevon Untersuchungen, vor allem des Zentrums für Türkeistudien<strong>in</strong> Essen, dokumentiert wird. In e<strong>in</strong>er Studie <strong>der</strong>Forschungsgesellschaft für Gerontologie (Gerl<strong>in</strong>g 2005)wird darüber h<strong>in</strong>aus festgestellt, dass <strong>der</strong> private Konsum<strong>der</strong> Migrantenbevölkerung, <strong>der</strong> früher meist ignoriertwurde, nun immer häufiger <strong>in</strong> den Market<strong>in</strong>gkonzeptendeutscher Unternehmer berücksichtigt wird.Mit den Konzepten „Ethno-Market<strong>in</strong>g“ bzw. „InterkulturellesMarket<strong>in</strong>g“ wird angeregt, sich diesen Markt sowohldurch gezielte kulturell-spezifische Ansprache <strong>der</strong>Kunden als auch mit e<strong>in</strong>em entsprechenden Angebot anWaren zu erschließen. Die größte Zielgruppe des „Ethno-Market<strong>in</strong>gs“ ist bisher die aus <strong>der</strong> Türkei stammende Bevölkerung;<strong>in</strong> <strong>der</strong> Zukunft sollen aber auch vermehrt Osteuropäerangesprochen werden. Migranten bilden <strong>in</strong> denÖkonomien ihrer Aufnahmelän<strong>der</strong> ethnische Nischen, wosie ihren eigenen Bedarf an spezifischen Waren undDienstleistungen, wie Lebensmittel, Speditionen, Kleidung,Schmuck, Devotionalien für religiöse Rituale etc.befriedigen können. Migranten besetzen auch Segmentedes allgeme<strong>in</strong>en Marktes und bieten Waren und Dienstleistungenfür die e<strong>in</strong>heimische Bevölkerung, wie Reparaturschnei<strong>der</strong>eien,Restaurants etc. an. In den ethnischenKolonien bilden sich auch zunehmend wirtschaftlich bedeutendeRäume, <strong>in</strong> denen sich parallele Arbeitsmärkteüber die Deckung des ethnischen Bedarfes h<strong>in</strong>aus entwickeln(Deutsches Institut für Urbanistik 2005). LokaleMigrantenökonomien können aber auch mit Blick auf diee<strong>in</strong>heimische Bevölkerung Brückenfunktionen übernehmen(Scha<strong>der</strong> Stiftung 2005).Die Migranten <strong>der</strong> zweiten Migrantengeneration überweisenkaum Geld <strong>in</strong> die Herkunftslän<strong>der</strong>. Ihr Konsumgleicht sich immer mehr dem Konsum E<strong>in</strong>heimischer ausvergleichbaren sozialen Schichten an. Wenn auch dasE<strong>in</strong>kommen unter demjenigen deutscher Haushalte liegt,steigt die Tendenz, <strong>in</strong> Deutschland Immobilieneigentumzu erwerben. Für die Migrantengruppe aus <strong>der</strong> Türkei ist<strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Eigentumsbesitzer mit 16 Prozent um80 Prozent <strong>in</strong> den letzten 5 Jahren gestiegen. Allerd<strong>in</strong>gsverfügen die türkischen Haushalte über mehr Mitglie<strong>der</strong>als die deutschen und die <strong>Generation</strong>en wirtschaften häufigzusammen. Mit <strong>der</strong> europäischen Perspektive <strong>der</strong> Türkeische<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e Geldanlage dort wie<strong>der</strong> attraktiv. Circae<strong>in</strong> Drittel möchte ihre Ersparnisse künftig ausschließlichdort anlegen. Weitere Bereiche, wo türkische Migrantenihre Ersparnisse <strong>in</strong>vestieren, s<strong>in</strong>d Bausparverträge undLebens- und Rentenversicherungen.Generell wird kritisiert, dass die Wirtschaft noch zu wenigauf die Migranten e<strong>in</strong>gegangen ist (Gerl<strong>in</strong>g 2005). ImRahmen von SEEM II „Services for El<strong>der</strong>s from EthnicM<strong>in</strong>orities“ wird <strong>zur</strong> Zeit unter Fe<strong>der</strong>führung des Fachbereichsfür Senioren <strong>der</strong> Stadt Dortmund und unter Beteiligung<strong>der</strong> Forschungsgesellschaft für Gerontologie e<strong>in</strong>eArbeitsgruppe e<strong>in</strong>gerichtet, die u.a. Informationsveranstaltungenfür ältere Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten zu denAngeboten und Diensten <strong>der</strong> Altenhilfe entwickeln unddurchführen sowie <strong>in</strong>teressierte Anbieter für die spezifischenBedürfnisse älterer Migrant<strong>in</strong>nen und Migrantenqualifizieren soll (Gerl<strong>in</strong>g 2005).8.5.1 Erwerbsquote und Erwerbstätigenquoteälterer MigrantenDie Erwerbsbeteiligung bei den Auslän<strong>der</strong>n, also <strong>der</strong> Anteil<strong>der</strong> ausländischen Erwerbspersonen (Erwerbstätigeund Arbeitslose) an den jeweiligen Personen im erwerbsfähigenAlter (15- bis unter 65-Jährige), hat sich <strong>in</strong> denvergangenen 15 Jahren bei Deutschen und Auslän<strong>der</strong>n <strong>in</strong>zwei grundsätzlich verschiedene Richtungen entwickelt:Während sie bei den Deutschen tendenziell steigt, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>ewegen <strong>der</strong> zunehmenden Erwerbsneigung vonFrauen, fällt sie bei Auslän<strong>der</strong>n deutlich <strong>zur</strong>ück. Dabeihatte sie 1982 noch bei allen ausländischen Nationalitätenüber <strong>der</strong> deutschen Quote gelegen. Im Vergleich zu 1982haben von <strong>der</strong> ausländischen erwerbsfähigen Bevölkerungim Jahre 2002 ca. 10 Prozent weniger den Zugangzum deutschen Arbeitsmarkt gefunden.Daten <strong>zur</strong> Erwerbstätigkeit werden zum e<strong>in</strong>en im Rahmendes Mikrozensus erhoben, <strong>der</strong> sich an Haushalte und diedar<strong>in</strong> lebenden Personen richtet, zum an<strong>der</strong>en werden von<strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit Daten zu Arbeitslosen, sozialversicherungspflichtigBeschäftigten und Arbeitsgenehmigungenermittelt.Die Entwicklung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> ausländischen Erwerbstätigenzwischen 1991 bis 2003 zeigte e<strong>in</strong>e Zunahme von2,6 Mio. auf 2,9 Mio. (+ 14,6 Prozent). Der höchste Standwurde 2001 erreicht, im Folgejahr war die Zahl <strong>der</strong> ausländischenErwerbstätigen um 24.000 rückläufig(– 1 Prozent), im Jahr 2003 lag <strong>der</strong> Rückgang bei 83.000(2,7 Prozent). Der Anstieg <strong>der</strong> letzten zehn Jahre ist imKontext <strong>der</strong> Zunahme <strong>der</strong> ausländischen Bevölkerung um24 Prozent zu sehen. Die Zahl <strong>der</strong> deutschen Erwerbstätigenhat sich zwischen 1991 und 2003 um 1,7 Mio. bzw.knapp 5 Prozent verr<strong>in</strong>gert. Dieser Rückgang hängt u.a.mit <strong>der</strong> Konjunkturlage, <strong>der</strong> demografischen Entwicklungund den strukturellen Anpassungen <strong>in</strong> den neuen Bundeslän<strong>der</strong>nzusammen.Die Differenzierung nach Geschlecht zeigt, dass <strong>in</strong> diesemZeitraum die Zunahme <strong>der</strong> Erwerbstätigkeit vonAuslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen (+ 37,3 Prozent) viel stärker war als vonAuslän<strong>der</strong>n (+ 3,5 Prozent). Bei den Deutschen lief dieEntwicklung an<strong>der</strong>s: Während die Zahl <strong>der</strong> erwerbstätigenMänner <strong>zur</strong>ückg<strong>in</strong>g (– 9,6 Prozent), nahm die Zahl<strong>der</strong> erwerbstätigen Frauen leicht zu (+ 2 Prozent). Damit
Drucksache 16/2190 – 236 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeerhöhte sich <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Frauen an den Erwerbstätigenund erreichte 2003 für die Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen 39 Prozent undfür die deutschen Frauen 45 Prozent.Gemäß ihrer Nationalität lassen sich die meisten ausländischenErwerbstätigen 2003 den ehemaligen Anwerbelän<strong>der</strong>nzuordnen: Türkei (25 Prozent), Jugoslawien undNachfolgestaaten (14 Prozent), Italien (12 Prozent) undGriechenland (6 Prozent). Die Entwicklung zwischen1991 und 2003 zeigt für die quantitativ stärkeren Gruppenbedeutende Zuwächse vor allem bei den Län<strong>der</strong>n Polen(+ 82,5 Prozent), Frankreich (+ 23 Prozent), Vere<strong>in</strong>igtesKönigreich (+ 27 Prozent), Portugal (+ 24 Prozent) undItalien (+ 10 Prozent), dagegen Rückgänge für Spanien(– 22 Prozent) und Griechenland (– 8 Prozent).Die Erwerbsquote für die ausländische Bevölkerung lag2003 mit 52 Prozent über <strong>der</strong>jenigen <strong>der</strong> deutschen(43 Prozent). E<strong>in</strong>e Differenzierung <strong>der</strong> Erwerbsquotenach Altersgruppen zeigt, dass sie bei vergleichbarem Altermit Ausnahme <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> über 60-Jährigen fürdie Deutschen höher war als für die Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen undAuslän<strong>der</strong>. Die höhere Quote für die gesamte ausländischeBevölkerung ist entsprechend auf ihren demografischenAufbau <strong>zur</strong>ückzuführen, da <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Personenim Erwerbsalter an <strong>der</strong> ausländischen Bevölkerung höherist (Statistisches Bundesamt 2005b: 28, 123f.).Allerd<strong>in</strong>gs muss dabei berücksichtigt werden, dass dieZahl <strong>der</strong> ausländischen Erwerbspersonen <strong>in</strong> <strong>der</strong> fraglichenZeit durch natürliches Bevölkerungswachstum unddurch Nettozuwan<strong>der</strong>ungen um ca. 1 Million, die <strong>der</strong> erwerbsfähigenausländischen Bevölkerung um ca. 2 Millionenzugenommen hat.Noch deutlicher ist <strong>der</strong> Unterschied zwischen Deutschenund Auslän<strong>der</strong>n beim Zugang <strong>zur</strong> Erwerbstätigkeit. DieErwerbstätigenquote lag für die Deutschen im Jahre 2002immerh<strong>in</strong> um ca. 3 Prozentpunkte über <strong>der</strong>jenigen desJahres 1982. Bei den Auslän<strong>der</strong>n <strong>in</strong>sgesamt und bei denTürken <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e ist sie jedoch um dramatische13 Prozentpunkte <strong>zur</strong>ückgegangen. Nur noch weniger alsdie Hälfte aller Türken im erwerbsfähigen Alter ist <strong>der</strong>zeitabhängig o<strong>der</strong> selbstständig erwerbstätig. Auch hiermuss aber darauf h<strong>in</strong>gewiesen werden, dass die Zahl <strong>der</strong>Erwerbstätigen 2002 noch immer wesentlich über <strong>der</strong> vonvor 20 Jahren lag: bei den Deutschen (mit ca. 26,5 Millionen)um ca. 2 Millionen, bei den Auslän<strong>der</strong>n <strong>in</strong>sgesamt(mit ca. 2,8 Millionen) um ca. 600.000 und bei den Türken(mit ca. 780.000) um ca. 130.000. Die allgeme<strong>in</strong>eWirtschaftsentwicklung und die Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Struktur <strong>der</strong> Arbeitskräftenachfrage haben jedoch nichtzugelassen, dass das Arbeitskräfteangebot absorbiert werdenkonnte (Hönekopp 2004: 13f.).Deutsche sowie Personen aus Griechenland und dem ehemaligenJugoslawien mit jeweils knapp unter 60 Prozenthatten <strong>in</strong> etwa die gleichen Erwerbsquoten, wie auch Italiener<strong>in</strong>nenund Italiener mit 63,3 Prozent. E<strong>in</strong>e niedrigeBeschäftigungsquote und e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Auslastung desArbeitspotenzials Älterer s<strong>in</strong>d somit auch bei den Migrantenfestzustellen. Diese Situation spitzt sich vor allemfür die Migranten türkischer Staatsangehörigkeit zu. In<strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 45- bis 64-jährigen Migranten türki-Abbildung 30Erwerbstätigenquoten für ausgewählte Nationalitäten <strong>in</strong> Deutschland-West, 1982 - 1992 - 2002Quelle: Statistisches Bundesamt und Eurostat; Berechnung und Darstellung Hönekopp 2004:14.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 237 – Drucksache 16/2190scher Staatsangehörigkeit ließ sich durch den Mikrozensus2002 e<strong>in</strong>e Erwerbsbeteiligung von nur 34,5 Prozentfeststellen (Özcan & Seifert 2004: 19). Viele Betriebe habenvor allem bei den ger<strong>in</strong>g qualifizierten ausländischenBeschäftigten die Vorruhestandsregelungen als Instrument<strong>der</strong> Ausglie<strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>gesetzt (Bosch 2004c).Für die über 65-Jährigen spielt die Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong>Deutschland kaum mehr e<strong>in</strong>e Rolle. Bei allen Migrantengruppenliegt sie allerd<strong>in</strong>gs über dem Wert von 2,8 Prozent<strong>der</strong> deutschen Bevölkerung. Der höchste Wert ergibtsich bei Italiener<strong>in</strong>nen und Italienern dieser Altersgruppemit 6,1 Prozent. Noch 1997 lag die Erwerbsquote bei allenMigrantengruppen deutlich höher. So waren 9,1 Prozent<strong>der</strong> Griech<strong>in</strong>nen und Griechen sowie jeweils 8,3 Prozent<strong>der</strong> Italiener<strong>in</strong>nen und Italiener und <strong>der</strong> Personen ausdem ehemaligen Jugoslawien <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong>64-Jährigen noch erwerbstätig (Özcan & Seifert 2004:19). Dies heißt, dass die Migranten im Vergleich zu denDeutschen zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt aus dem Erwerbslebenausscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen,dass ältere Migranten e<strong>in</strong>e Selbstständigenquote von12 Prozent (Selbstständige <strong>in</strong> Prozent <strong>der</strong> Erwerbstätigen)aufweisen. Diese ist höher als bei den ausländischen Erwerbstätigenim Alter von 15 bis 45 Jahren. Insgesamt hatsich die Selbstständigenquote bei Migranten erhöht, währendsich <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> abhängig Beschäftigten an allenErwerbstätigen unter den Auslän<strong>der</strong>n seit Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong>1960er-Jahre von anfänglich 100 Prozent durch den Familiennachzug<strong>der</strong> 1970er-Jahre schon bis zum Beg<strong>in</strong>n<strong>der</strong> 1980er-Jahre auf ca. 80 Prozent verm<strong>in</strong><strong>der</strong>t hat.Für die Bevölkerung im Rentenalter kann Erwerbstätigkeitbedeuten, dass auf Grund fehlen<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er E<strong>in</strong>kommensquellennoch h<strong>in</strong>zuverdient werden muss. E<strong>in</strong>e weitereErklärung könnte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er selektiven Rückkehrliegen. Das heißt erfolgreiche Migranten könnten zu e<strong>in</strong>emfrüheren Zeitpunkt aus dem Erwerbsleben ausscheidenund <strong>in</strong> ihre Heimatlän<strong>der</strong> <strong>zur</strong>ückwan<strong>der</strong>n, währendweniger erfolgreiche Zuwan<strong>der</strong>er länger erwerbstätigbleiben müssen, um e<strong>in</strong>en wirtschaftlich gesicherten Lebensabendzu bestreiten. Solche Hypothesen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> vielenBereichen zulässig, da die amtlichen Daten <strong>in</strong> fast allenBereichen durch die häufig amtlich nicht registrierteRückkehr verzerrt s<strong>in</strong>d.„Zwischen 1991 bis 2003 hat sich die Zahl <strong>der</strong> ausländischenSelbstständigen um 110.000 (+ 63 Prozent) erhöht.Die Zunahme bei den deutschen war zwar mit ca. 600.000absolut höher, relativ gesehen aber kle<strong>in</strong>er (+ 20 Prozent).Der Anteil <strong>der</strong> Selbstständigen an den Erwerbspersonenlag 2003 für die ausländische Bevölkerung mit 7,7 Prozentnur noch leicht unter dem Niveau <strong>der</strong> deutschen(9 Prozent). Italiener<strong>in</strong>nen und Italiener stellen mit46.000 die meisten Selbstständigen, gefolgt von Türk<strong>in</strong>nenund Türken mit 43.000 und Personen mit griechischerStaatsangehörigkeit mit 25.000. Ausländische Erwerbstätigewaren 2003 im Vergleich zu den deutschen <strong>in</strong>den Berufsbereichen des Bergbaus und <strong>der</strong> Fertigungsberufe(vor allem <strong>in</strong> <strong>der</strong> Metall<strong>in</strong>dustrie) stärker vertreten,dagegen <strong>in</strong> den technischen Berufen, <strong>in</strong> den Dienstleistungsberufen,sowie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Land-, Tier- und Forstwirtschaftunterrepräsentiert. E<strong>in</strong>e Ausnahme unter denDienstleistungen bildeten die Hotel- und Gaststättenberufesowie die Re<strong>in</strong>igungs- und Entsorgungsberufe, <strong>in</strong> denenca. 25 Prozent <strong>der</strong> Erwerbstätigen Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nenbzw. Auslän<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d. Diese Verhältnisse trafen vor allemfür Staatsangehörige ehemaliger Anwerbelän<strong>der</strong> aber wenigerfür an<strong>der</strong>e Herkunftslän<strong>der</strong> zu“ (Statistisches Bundesamt2005b: 29).In e<strong>in</strong>er Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung<strong>der</strong> Universität Mannheim ifm (2005) zeigte sich,was die absoluten Zahlen betrifft, dass die Selbstständigentürkischer Herkunft mit 60.000 die größte Gruppebilden. Seit Anfang <strong>der</strong> 1990er-Jahre hat sich <strong>der</strong>en Zahlverdoppelt. E<strong>in</strong> Anstieg <strong>der</strong> Selbstständigenquote ist allerd<strong>in</strong>gsauch e<strong>in</strong> Ergebnis s<strong>in</strong>ken<strong>der</strong> Beschäftigung. Vonallen Gruppen haben die Griechen die stärkste Selbstständigkeitsneigung.Griechen und Türken s<strong>in</strong>d eher <strong>in</strong> Städten,Italiener eher <strong>in</strong> mittelgroßen Geme<strong>in</strong>den aktiv. Deutscheund ausländische Grün<strong>der</strong> unterscheiden sich nichtnur <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gründungsaktivität und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit<strong>der</strong> Unternehmen, son<strong>der</strong>n auch <strong>in</strong> den Gründungsformenund -strategien. So s<strong>in</strong>d die Gründungen von Auslän<strong>der</strong>nstärker auf den Haupterwerb ausgerichtet. E<strong>in</strong>Viertel <strong>der</strong> Existenzgründungen s<strong>in</strong>d Betriebsübernahmen– zumeist von Landsleuten. Was die Migranten-Ökonomiebetrifft, haben Türken e<strong>in</strong>e heterogenere Branchenstruktur,aber weniger „wissens<strong>in</strong>tensive“ Dienste.Unternehmensnahe und freiberufliche Dienstleistungenwerden eher von Migranten mit deutschem Pass ausgeübt.Als Kunden haben Landsleute e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge (aber beiTürken e<strong>in</strong>e etwas höhere) Bedeutung. So führt die gesellschaftlichePartizipation von Migranten türkischerHerkunft <strong>zur</strong> Produktion von <strong>in</strong>termediären Positionenund Diensten. E<strong>in</strong>gebürgerte Unternehmer türkischerHerkunft s<strong>in</strong>d weniger häufig <strong>in</strong> ethnischen Nischen, den„traditionellen“ Sektoren, wie im Gastgewerbe o<strong>der</strong> imHandel, tätig. Während <strong>in</strong> diesen Branchen e<strong>in</strong>e größereAbhängigkeit von e<strong>in</strong>er ethnisch unspezifischen (Lauf-)Kundschaft besteht, ist die Nachfrage <strong>der</strong> Ko-Ethnie imFeld <strong>der</strong> „sonstigen“ Dienstleistungen größer. Hierzuzählt beispielsweise die Nachfrage nach Unternehmens-,Steuer- und Rechtsberatung sowie nach Kreditvermittlungeno<strong>der</strong> Dolmetscherdiensten und ähnlichen nicht rout<strong>in</strong>emäßigerbrachten Leistungen, die Migranten aus <strong>der</strong>Türkei <strong>in</strong> größerem Umfang als die an<strong>der</strong>en Nationalitätenvon ihren Landsleuten erstellen lassen. Bei fast <strong>der</strong>Hälfte aller im Bereich <strong>der</strong> wissens<strong>in</strong>tensiven Dienstleistungentätigen türkischen Unternehmen besteht <strong>der</strong> Kundenstammzu 50 bis 100 Prozent aus Türken (ifm 2005).Im Handwerk s<strong>in</strong>d selbstständige Migranten unterrepräsentiert.Die weitaus meisten Unternehmen beschäftigennur e<strong>in</strong>e bis maximal vier Person(en). Türkische Unternehmenschaffen am meisten Arbeitsplätze, dicht gefolgtvon italienischen. Unternehmen von Migranten <strong>in</strong>sgesamtstellen 3 bis 4 Prozent aller Arbeitsplätze <strong>in</strong> Deutschland.Die Bedeutung von Migrant<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> <strong>der</strong> ethnischen Ökonomiewird <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von zwei Grundl<strong>in</strong>ien bee<strong>in</strong>flusst:Zum e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d nicht nur Migrant<strong>in</strong>nen, son<strong>der</strong>nFrauen generell <strong>in</strong> <strong>der</strong> beruflichen Selbstständigkeit
Drucksache 16/2190 – 238 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 40Übersicht zu den betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotenzialenausländischstämmiger Selbstständigkeit <strong>in</strong> DeutschlandAusgewählte MerkmaleSektoraler Schwerpunkt Gastgewerbe (50%)Handel (24%)Quellen: ifm 2005. Datenbasis: Mikrozensus.Herkunftgriechisch italienisch türkischGastgewerbe (52%)„sonstige“ Dl (23%)Handel (32%)„sonstige“ Dl (29%)DurchschnittlicheUnternehmensgröße 4,0 Beschäftigte 4,8 Beschäftigte 4,3 BeschäftigteBeschäftigungsbeitragArbeitgeberbetriebe 56 % 67 % 49 %Arbeitsplätze <strong>in</strong>sges. 109.000 240.000 260.000AusbildungsbeitragAusbildungsbetriebe 6 % 9 % 15 %Durchschn. Azubizahl 1,8 2,1 1,7Ausbildungsplätze 1.800 6.500 7.500Umsätze <strong>in</strong> € 9,3 Mrd. 15,1 Mrd. 24,7 Mrd.unterrepräsentiert bzw. gründen immer noch weit seltenerals Männer e<strong>in</strong> Unternehmen. Zum an<strong>der</strong>en ist aber auchzu beobachten, dass sich seit etwa zwei Jahrzehnten dieZahl selbstständiger Frauen stärker als die von Männernerhöht hat, was allerd<strong>in</strong>gs auch e<strong>in</strong> Resultat zunehmen<strong>der</strong>Erwerbsbeteiligung ist (Institut für Mittelstandsforschung2005).Diskrepanzen ergeben sich bereits h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Ausgangsbed<strong>in</strong>gungenfür den Zutritt <strong>zur</strong> beruflichen Selbstständigkeit,da <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e unter den italienischen undtürkischen Erwerbstätigen die Frauenanteile weit ger<strong>in</strong>gerals bei deutschen Erwerbstätigen s<strong>in</strong>d. Dies hat <strong>zur</strong> Folge,dass auch die Frauenanteile <strong>in</strong> den jeweiligen Selbstständigengruppennochmals weit ger<strong>in</strong>ger als bei den Deutschenausfallen: Während unter den deutschen Selbstständigenbereits lediglich 29 Prozent weiblichen Geschlechtss<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d dies bei den griechischen Selbstständigen nur24 Prozent und bei den italienischen und türkischenSelbstständigen 20 Prozent bzw. 19 Prozent. Die Selbstständigenquotenvon Frauen betragen bei allen drei Nationalitätenziemlich genau die Hälfte <strong>der</strong>jenigen <strong>der</strong>Männer, wobei die Griech<strong>in</strong>nen noch am besten abschneiden:Immerh<strong>in</strong> ist fast jede zehnte <strong>in</strong> Deutschland erwerbstätigeGriech<strong>in</strong> beruflich selbstständig tätig. Unterden türkischen erwerbstätigen Frauen ist das nur bei je<strong>der</strong>30. <strong>der</strong> Fall (Institut für Mittelstandsforschung 2005: 15).8.5.2 Arbeitslosigkeit älterer MigrantenDie ausländischen Beschäftigten s<strong>in</strong>d vom Strukturwandelsehr viel stärker betroffen als die deutschen. Dies ist<strong>der</strong> Fall vor allem bei <strong>der</strong> ersten Migrantengeneration, diefür den Bedarf im sekundären Sektor, vor allem <strong>in</strong> <strong>der</strong>verarbeitenden Industrie und im Baugewerbe <strong>in</strong> den1960er- und 1970er-Jahren angeworben wurde. Auchheute ist dies <strong>der</strong> Fall z.B. bei den Migranten aus <strong>der</strong> Türkeimit e<strong>in</strong>em Anteil <strong>der</strong> Beschäftigten im sekundärenSektor zum Anfang <strong>der</strong> neunziger Jahre von 69 Prozent,aus Griechenland von 67 Prozent und aus Italien von61 Prozent (Bauer, Loeffelholz & Schmidt 2004: 24).Diese <strong>Generation</strong> <strong>der</strong> damaligen „Gastarbeiter“ wird vonden Folgen des technologischen Umbruchs und des durchdie Globalisierung ausgelösten Strukturwandels erfasst.Gerade <strong>in</strong> den produzierenden Bereichen ist die Beschäftigungstark abgebaut worden. 1974 waren fast 80 Prozentaller Auslän<strong>der</strong> (<strong>in</strong>sgesamt ca. 56 Prozent) im produzierendenBereich beschäftigt, 2000 nur noch ca. 53 Prozent(<strong>in</strong>sgesamt ca. 40 Prozent). Im Ganzen s<strong>in</strong>d dortauch im Jahr 2001 – trotz aller Konvergenz <strong>der</strong> Strukturenund <strong>der</strong> Partizipation auch <strong>der</strong> ausländischen Beschäftigtenam sektoralen Strukturwandel <strong>in</strong> den vergangenendrei Jahrzehnten – immer noch anteilmäßig mehr ausländischeZuwan<strong>der</strong>er beschäftigt als Deutsche. WesentlicherGrund für die Beschäftigungsverluste im Strukturwandelist die ungünstige Qualifikationsstruktur <strong>der</strong>ausländischen Arbeitskräfte. Der Anteil von Personen mitniedrigem Qualifikationsniveau liegt bei Auslän<strong>der</strong>nnoch immer mehr als doppelt so hoch wie bei Deutschen.Dies ist auch <strong>der</strong> Fall für die nachfolgenden <strong>Generation</strong>en.So lag Ende September 2004 <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> ausländischenArbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildungbei 72,9 Prozent aller ausländischen Arbeitslosen,
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 239 – Drucksache 16/2190<strong>der</strong> entsprechende Anteil <strong>der</strong> Deutschen bei 29,5 Prozent(Bundesagentur für Arbeit 2005a). Der Anteil von ausländischen,vor allem türkischen Beschäftigten mit niedrigemQualifikationsniveau ist <strong>in</strong> den vergangenen fastzwanzig Jahren nicht wesentlich <strong>zur</strong>ückgegangen. 2002lag er mit ca. 60 Prozent (bei Türken: über 70 Prozent)immer noch mehr als doppelt so hoch als bei den deutschenBeschäftigten. Entsprechend ist auch <strong>der</strong> Anteilvon ausländischen Beschäftigten mit mittlerem Qualifikationsniveaunicht son<strong>der</strong>lich gestiegen und beträgt gerademal die Hälfte des Wertes für die Deutschen. Für die türkischenBeschäftigten s<strong>in</strong>d die Werte noch ungünstiger(30 Prozent bei Facharbeitern und mittleren Angestellten).Vor dem H<strong>in</strong>tergrund des Strukturwandels ist die Arbeitslosigkeit<strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> <strong>in</strong> den vergangenen Jahren überproportionalgestiegen.Die Arbeitslosigkeit stieg durchschnittlich zwischen 1992und 2003 für Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Auslän<strong>der</strong> <strong>in</strong> den altenLän<strong>der</strong>n ohne Berl<strong>in</strong> von 12 Prozent auf 19 Prozent undfür Deutsche von 6 Prozent auf 8,4 Prozent. Im Bundesdurchschnittfür Deutschland <strong>in</strong>sgesamt lag sie 2003 bei11 Prozent. Beson<strong>der</strong>s kritisch war die <strong>Lage</strong> <strong>in</strong> den neuenBundeslän<strong>der</strong>n, wo fast vier von zehn ausländischen abhängigenErwerbspersonen arbeitslos waren. Der Anteil<strong>der</strong> Männer an den Arbeitslosen war bei <strong>der</strong> ausländischenBevölkerung (61 Prozent) höher als bei <strong>der</strong> deutschen(52 Prozent) (Statistisches Bundesamt 2005b: 29).Dabei zeigen sich erhebliche nationalitätenspezifischeUnterschiede. Bürger aus Spanien und aus dem ehemaligenJugoslawien wiesen 2003 e<strong>in</strong>e relativ niedrige Arbeitslosenquote(13,9 und 16,8 Prozent) auf. Von an<strong>der</strong>enaus den ehemaligen Anwerbelän<strong>der</strong>n Stammenden, dieden Großteil <strong>der</strong> <strong>in</strong> Deutschland lebenden Auslän<strong>der</strong> ausmachen,s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Italiener und Griechen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emrelativ hohen Ausmaß von Arbeitslosigkeit(19,4 Prozent bzw. 18,6 Prozent) betroffen. Die türkischenMigranten s<strong>in</strong>d diejenigen, die am stärksten an dieser Entwicklungteilhaben, denn sie weisen mit ca. 25,2 Prozentdie höchste Arbeitslosenquote auf, gefolgt von Personenmit marokkanischer (21,4 Prozent) Staatsangehörigkeit.Insgesamt war <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Arbeitslosen an den ausländischenArbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmern für EU-Bürger<strong>in</strong>nen und -Bürger niedriger (15,4 Prozent) als fürnicht aus <strong>der</strong> EU stammende Personen, von denen 25,2Prozent arbeitslos waren (Statistisches Bundesamt 2005b:127).Nach Angaben <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit hatten imSeptember 2003 drei von vier ausländischen Arbeitslosenke<strong>in</strong>e abgeschlossene Berufsausbildung und lediglich18 Prozent e<strong>in</strong>e betriebliche Ausbildung. Differenziertnach Staatsangehörigkeiten ergeben sich jedoch erheblicheUnterschiede. So hatten von den französischen undbritischen Arbeitslosen nur ca. 49 Prozent ke<strong>in</strong>e abgeschlosseneBerufsausbildung, dagegen ca. 29 Prozente<strong>in</strong>e betriebliche Ausbildung und mehr als 12 Prozent e<strong>in</strong>enakademischen Abschluss (Statistisches Bundesamt2005b: 30).Die Erwerbslosenquote <strong>der</strong> Migranten war, bezogen aufdie Altersgruppen, zwischen 45 und 65 Jahren mit18,5 Prozent viel höher als die <strong>der</strong> gleichaltrigen Deutschenmit 10,8 Prozent. Im September 2000 war <strong>der</strong> Anteil<strong>der</strong> Langzeitarbeitslosen (über e<strong>in</strong> Jahr arbeitslos) unterden älteren Auslän<strong>der</strong>n mit 53,6 Prozent ger<strong>in</strong>gfügighöher als <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Vergleichsgruppe mit e<strong>in</strong>ementsprechenden Anteil von 53,0 Prozent (Bauer, Loeffelholz& Schmidt 2004: 20). Auch waren ältere Auslän<strong>der</strong>Abbildung 31Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland nach Wirtschaftszweigen1975-2001; <strong>in</strong> Prozent <strong>der</strong> gesamten ausländischen bzw. deutschen BeschäftigtenQuelle: Bauer, Loeffelholz & Schmidt 2004: 25.
Drucksache 16/2190 – 240 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeAbbildung 32Erwerbstätigkeit nach Alter von Deutschen und Auslän<strong>der</strong>n90,0%80,0%70,0%60,0%50,0%DeutscheAuslän<strong>der</strong>40,0%30,0%20,0%10,0%0,0%15 bis 24 J.25 bis 49 J.50 Jahre51 Jahre52 Jahre53 Jahre54 Jahre55 Jahre56 Jahre57 Jahre58 Jahre59 Jahre60 Jahre61 Jahre62 Jahre63 Jahre64 Jahre65 bis 69 J.Quelle: Brussig, Knuth & Weiß 2004: 19. Datenbasis: Mikrozensus 2001.im September 2000 im Schnitt länger arbeitslos alsDeutsche (16 gegenüber 14 Monaten). Allgeme<strong>in</strong> lässtsich festhalten, dass die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, mehr als2 Jahre arbeitslos zu se<strong>in</strong>, bei Auslän<strong>der</strong>n ab dem Altervon 45 Jahren stärker zunimmt als unter Deutschen. Auchlässt sich sagen, dass Migranten früher <strong>in</strong> die „Stille Reserve“abwan<strong>der</strong>n als Deutsche (ebenda).Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien h<strong>in</strong>gegenwaren eher im Gastgewerbe und im Dienstleistungsbereichtätig. Die Arbeitsmarktprobleme <strong>der</strong> ersten Migrantengenerationwurden durch e<strong>in</strong>e fehlende Integrationspolitiknoch weiter verstärkt (ebenda).Analysen <strong>der</strong> Determ<strong>in</strong>anten <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit zeigenweiterh<strong>in</strong>, dass soziodemografische Faktoren wie Alter,Beruf, Geschlecht und Qualifikation zwar e<strong>in</strong>en Erklärungsbeitragzu den beobachteten Unterschieden leistenkönnen, diese aber nicht vollständig erklären. Für e<strong>in</strong>e Integrationspolitik<strong>in</strong> diesem Bereich ist es notwendig, dieUrsachen für die erheblichen Unterschiede <strong>in</strong> den Arbeitsmarktchancenzwischen ausländischen und deutschenErwerbspersonen zu erkunden. Unerlässlich ist esdabei, auch die nationalitätenspezifischen Unterschiedezwischen den Migrantengruppen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Erklärung e<strong>in</strong>zubeziehen.Dazu ist es notwendig, die Praxis <strong>der</strong> Unternehmenmit <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Perspektive zu kontrastierenbzw. unterschiedlich motivierte Übere<strong>in</strong>stimmungen(etwa bei Frühberentung), aus <strong>der</strong> Perspektive des Migrationsprojektesund e<strong>in</strong>er angesteuerten Rückkehr <strong>in</strong>s Herkunftslandzu deuten.8.5.3 Makroökonomische AspekteFolgt man <strong>der</strong> letzten nach Deutschen und Auslän<strong>der</strong>ndifferenzierten Bevölkerungsvorausberechnung <strong>der</strong> amtlichenStatistik, wird die ausländische Bevölkerung beie<strong>in</strong>er Nettozuwan<strong>der</strong>ung von 200.000 Personen bis 2025von 7,3 Mio. auf knapp 10 Mio. steigen. Im gleichenZeitraum wird die deutsche Bevölkerung von 75 auf 70Mio. s<strong>in</strong>ken. Der Anteil <strong>der</strong> über 55-jährigen Migranten
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 241 – Drucksache 16/2190wird sich auf 28 Prozent (2,8 Mio. Personen) verdoppeln;<strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> über 55-jährigen Deutschen h<strong>in</strong>gegen wirdlediglich von 40 auf 55 Prozent steigen. Hochbetagte Migrantenim Alter von über 75 Jahren werden von e<strong>in</strong>emAnteil von 1 bis 2 Prozent auf 7 Prozent zunehmen (Deutsche:von 7 auf 15 Prozent) <strong>in</strong> absoluten Zahlen bedeutetdies: 750.000 hochbetagte Migranten und Migrant<strong>in</strong>nen(Statistisches Bundesamt 2000, mittlere Variante). 2Angesichts dieser Entwicklung ist die Abschätzung <strong>der</strong>längerfristigen Bedeutung älterer Migranten und Migrant<strong>in</strong>nenals Wirtschaftsfaktor e<strong>in</strong> konstitutives Element demografischerund ökonomischer Zukunftsprognosen. Fürdie Entwicklung des ökonomischen Potenzials ältererMigranten s<strong>in</strong>d längerfristige Bevölkerungsvorausberechnungenund -schätzungen als demografische Rahmenbed<strong>in</strong>gungenunerlässlich. Dabei kommt dem Wan<strong>der</strong>ungsgeschehen(Zu- und Abwan<strong>der</strong>ungen) e<strong>in</strong>e wesentlicheRolle zu. Zukunftsszenarien <strong>in</strong> Bezug auf Migration unterliegenallerd<strong>in</strong>gs noch mehr Unsicherheiten als Szenarien<strong>der</strong> deutschen Bevölkerungsentwicklung, denn viele<strong>der</strong> <strong>in</strong> Betracht kommenden Parameter s<strong>in</strong>d auch vonRahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den Herkunftslän<strong>der</strong>n abhängig.Diese lösen Bewegungen zwischen Herkunftsland undDeutschland aus, die sich nur kaum prognostizieren lassen(Bauer, Loeffelholz & Schmidt 2004). E<strong>in</strong>e Verschlechterung<strong>der</strong> Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<strong>in</strong> Deutschland führt aber nur <strong>in</strong>soweit <strong>zur</strong>Rückkehr <strong>in</strong>s Herkunftsland, wenn dort relativ bessereZukunftsaussichten bestehen. Der Vergleich zwischenHerkunftsland und Aufnahmeland fällt je nach wirtschaftlicherund politischer Konjunktur unterschiedlich aus, sodasses zu verschiedenartig starken Rückkehrbewegungenvon Nationalität zu Nationalität kommen kann. Die Mobilitätschancen<strong>der</strong> Migranten und Migrant<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d zudemvon weiteren Faktoren abhängig, so ist z.B. dieBeherrschung <strong>der</strong> Muttersprache e<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzungfür die Rückkehr <strong>in</strong>s Herkunftsland. Viele Angehörige<strong>der</strong> zweiten Migrantengeneration verfügen allerd<strong>in</strong>gsnicht mehr über diese entsprechende Sprachkompetenz.Bei e<strong>in</strong>em Inlandsprodukt von schätzungsweise2.180 Mrd. Euro im Jahr 2004 entfallen auf die ausländischeAlterspopulation (50 bis 65 Jahre) rechnerisch ca.45 Mrd. Euro o<strong>der</strong> 2 Prozent <strong>der</strong> jährlichen Wirtschaftsleistung(pro Kopf gerechnet: 29.000 Euro pro Jahr). Anihrer (direkten) Entstehung und Erstellung s<strong>in</strong>d die älterenerwerbstätigen ausländischen Arbeitnehmer (auch ger<strong>in</strong>gfügigBeschäftigte) und Selbstständige (im Alter zwischen50 und 65 Jahren) beteiligt, während die übrigen<strong>in</strong>direkt <strong>in</strong> ihrer Funktion als Verbraucher und Nutzer vonprivaten bzw. öffentlichen Gütern beitragen.Von <strong>der</strong> Verteilungsseite <strong>der</strong> volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungenher betrachtet s<strong>in</strong>d die älteren Migrantennicht nur Bezieher von Arbeitnehmere<strong>in</strong>kommen. Zume<strong>in</strong>en zeigen sich auch bei dieser Gruppe e<strong>in</strong>e zunehmendeSelbstständigkeit und Vermögensbildung. Zum2 Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Abfassung dieses <strong>Bericht</strong>s lag für die aktuelle10. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtske<strong>in</strong>e Differenzierung nach Deutschen und Auslän<strong>der</strong>n vor.an<strong>der</strong>en ist für die E<strong>in</strong>schätzung ihrer Bedeutung alsWirtschaftsfaktor <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e Abschätzung <strong>der</strong>fiskalischen Kosten dieser Bevölkerungsgruppe von Bedeutung.Hier geht es um den Saldo <strong>der</strong> gezahlten Sozialbeiträgeund (direkten und <strong>in</strong>direkten) Steuern e<strong>in</strong>erseitsund den <strong>in</strong> Anspruch genommenen Leistungen des Staates<strong>in</strong> Form direkter Transfers, Sozialleistungen und Realtransfersan<strong>der</strong>erseits.8.5.4 Bezug öffentlicher TransferleistungenDie größte Bedeutung haben öffentliche Transfers (Arbeitslosengeld/-hilfe,Sozialhilfe, Wohngeld, Pflegegeldund BAföG zusammengefasst) für die Migranten aus <strong>der</strong>Türkei. Bei den über 65-Jährigen dieser Nationalität warenes 23,8 Prozent, ähnlich hoch für über 65-jährige Personenaus dem ehemaligen Jugoslawien mit 23,3 Prozent.E<strong>in</strong>e wesentlich niedrigere öffentliche Transferquotezeigt sich bei über 65-jährigen Italiener<strong>in</strong>nen und Italienernmit 9,4 Prozent, während Griech<strong>in</strong>nen und Griechenmit 4,8 Prozent sogar e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Anteil als Deutschedieser Altersgruppe aufweisen. Somit gibt es, bezogenauf die öffentlichen Transfers, ke<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>heitlichenTrend unter den Nationalitäten (Özcan & Seifert 2004:19).8.5.5 Bezug von SozialhilfeGenerell s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> ausländischen, wie auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschenAltenpopulation die Frauen stärker von <strong>der</strong> Sozialhilfebedürftigkeitbetroffen als die Männer. Bei den Auslän<strong>der</strong>ns<strong>in</strong>d die geschlechtsspezifischen Unterschiedejedoch ger<strong>in</strong>ger ausgeprägt als bei den Deutschen. Letztereskann u.a. durch e<strong>in</strong>e stärkere Unterstützung <strong>der</strong> Älterendurch die jeweiligen Familien erklärt werden. Generellist die Sozialhilfequote <strong>der</strong> Migranten (9 Prozent <strong>der</strong>über 50-Jährigen) weit höher als diejenige <strong>der</strong> Deutschen(1,3 Prozent). Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d bei den Migranten Trendsschwer zu erkennen, da <strong>in</strong> den Statistiken zwischen Arbeitsmigrantenund älteren Flüchtl<strong>in</strong>gen und Asylbewerbernnicht unterschieden wird. Zum Beispiel waren 1997noch 30,4 Prozent <strong>der</strong> Personen aus dem ehemaligen Jugoslawienauf Sozialhilfe als wichtigster E<strong>in</strong>nahmequelleangewiesen und im Jahr 2002 waren es nur noch10,3 Prozent. Dies ist mit <strong>der</strong> Abreise <strong>der</strong> Kriegsflüchtl<strong>in</strong>gezu erklären.Dem 2. Armuts- und Reichtumsbericht folgend (Bundesregierung2005) ist <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong>sgesamt das Armutsrisikovon Personen mit „Migrationsh<strong>in</strong>tergrund“zwischen 1998 und 2003 von 19,6 Prozent auf 24 Prozentgestiegen. Es liegt damit weiterh<strong>in</strong> deutlich über <strong>der</strong> Armutsrisikoquote<strong>der</strong> Gesamtbevölkerung. Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten aus westlichen Herkunftslän<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><strong>der</strong> Regel häufiger <strong>in</strong> höheren E<strong>in</strong>kommensschichtenkonzentriert als Zuwan<strong>der</strong>er aus Drittlän<strong>der</strong>n. Dabei s<strong>in</strong>ddie Zuwan<strong>der</strong>er türkischer Herkunft und aus dem ehemaligenJugoslawien am stärksten von Armut betroffen undhaben die relativ längste Verweildauer <strong>in</strong> Armut.Länger <strong>in</strong> Deutschland ansässige Migranten s<strong>in</strong>d häufiger<strong>in</strong> den höheren E<strong>in</strong>kommensschichten zu f<strong>in</strong>den als Neu-
Drucksache 16/2190 – 242 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 41Inanspruchnahme von Sozialhilfe <strong>der</strong> älteren ausländischen und deutschen Bevölkerung,31.12.2003 nach GeschlechtSozialhilfe-Anteil AnteilAlter von ... bis ZusammenMännlich WeiblichQuote 1 Weiblich Männlichunter ... JahrenAnzahl % Anzahl %Auslän<strong>der</strong>/-<strong>in</strong>nen50 - 60 54.508 6,5 23.119 31.389 57,6 42,460 - 65 27.507 9,1 12.768 14.739 53,6 46,465 - 70 13.350 6,6 8.190 5.160 38,7 61,370 - 75 7.929 7,0 4.124 3.805 48,0 52,075 und älter 8.323 5,8 3.213 5.110 61,4 38,6Insgesamt 616.934 8,4 289.194 327.740 53,1 46,9Durchschnittsalter 30,2 - 29,4 30,9 - -Deutsche50 - 60 171.177 1,9 82.183 88.994 52,0 48,060 - 65 74.032 1,4 35.366 38.666 52,2 47,865 - 70 23.075 0,5 11.615 11.460 49,7 50,370 - 75 16.694 0,5 5.590 11.104 66,5 33,575 und älter 28.445 0,5 4.929 23.516 82,7 17,3Insgesamt 2.194.269 2,9 967.914 1.226.355 55,9 44,1Durchschnittsalter 27,0 - 25,5 28,2 - -1 Anteil <strong>der</strong> Empfänger/-<strong>in</strong>nen laufen<strong>der</strong> Hilfe zum Lebensunterhalt an <strong>der</strong> jeweiligen Bevölkerung.Quelle: Statistisches Bundesamt 2005: 132. Datenbasis: Sozialhilfestatistik.Tabelle 42Armutsrisikoquoten bei <strong>der</strong> Bevölkerung mit und ohne Migrationsh<strong>in</strong>tergrund 1998-2003 <strong>in</strong> ProzentJahrDeutschlandgesamt 1Bevölkerungohne MigrantenFrüheres BundesgebietBevölkerung ohneMigrantenNeue Län<strong>der</strong>MigrantenDeutschlandgesamt1998 12,9 11,0 13,2 19,61999 12,4 10,8 12,7 18,32000 12,4 10,5 14,3 17,72001 13,8 11,0 15,3 22,62002 15,4 11,9 18,4 25,12003 15,4 12,4 18,0 24,01 Auf Grund <strong>der</strong> Datengrundlage – SOEP – weichen die Quoten von Armutsrisikoquoten <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Kapiteln des <strong>Bericht</strong>s ab, die auf Daten <strong>der</strong>EVS basieren.Quelle: Bundesregierung 2005: 166. Datenbasis: SOEP 1998-2003.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 243 – Drucksache 16/2190ankömml<strong>in</strong>ge. Ebenso s<strong>in</strong>d Personen, die <strong>in</strong> b<strong>in</strong>ationalenHaushalten leben, weniger von Armut betroffen als Migrantenhaushalteallgeme<strong>in</strong>. Im Jahr 2003 lebten 34 Prozent<strong>der</strong> <strong>zur</strong> „zweiten <strong>Generation</strong>“ gehörenden Personenunter <strong>der</strong> Armutsrisikogrenze (Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierungfür Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration 2005:91). Dies s<strong>in</strong>d zweimal mehr als bei den Gleichaltrigen <strong>in</strong>den übrigen Haushalten. Auch das Armutsrisiko für alle<strong>in</strong>stehende ältere Migrant<strong>in</strong>nen ist deutlich höher als für an<strong>der</strong>eMigrantengruppen. Das Armutsrisiko wird unterUmständen aufgefangen, wenn mit den Nachkommen geme<strong>in</strong>sameWohn- und Wirtschaftsgeme<strong>in</strong>schaften gebildetwerden.8.6 Sprachkenntnisse und Bildungssituationälterer MigrantenLebenslanges Lernen gilt als Schlüsselaufgabe für Politikund Wissenschaft. Migranten <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong> ausden Anwerbelän<strong>der</strong>n gehören zu den bildungsfernenGruppen. Die ger<strong>in</strong>ge Weiterbildungsbeteiligung ältererMigranten (Barkholdt 2004) lässt den Schluss zu, dassdiese Gruppe ke<strong>in</strong>e vorrangige Zielgruppe von För<strong>der</strong>maßnahmen<strong>in</strong> diesem Bereich gewesen ist. So lag dieTeilnahmequote <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> an beruflicher Weiterbildungim Jahre 2000 bei 12 Prozent gegenüber 30 Prozent<strong>der</strong> Deutschen (Bosch 2004c).Die Auslän<strong>der</strong> sehen für sich e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Weiterbildungsbedarfals die Deutschen. Es ist nicht klar, ob dieGründe hierfür <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er mangelnden Motivation o<strong>der</strong> <strong>in</strong>den objektiven Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, wie traditionelleArbeitsorganisation, un<strong>zur</strong>eichende Angebote o<strong>der</strong> ger<strong>in</strong>geChancen auf Verwertbarkeit, liegen. Es kommt häufigvor, dass berufliche Qualifikationen, die Migrantenaus ihren Herkunftslän<strong>der</strong>n mitbr<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> Deutschlandnicht anerkannt bzw. nicht ausgebaut und <strong>in</strong>folgedessenals Potenziale verloren gehen. Auslän<strong>der</strong> nehmen deutlichweniger als Deutsche an Weiterbildungsmaßnahmenteil, die vom Betrieb veranlasst werden. Sie werden aberauch weniger vom Arbeitgeber unterstützt. Ihre f<strong>in</strong>anzielleBelastung ist damit höher als die <strong>der</strong> Deutschen. ImJahre 2000 wandten Auslän<strong>der</strong> zwischen 20 und 44 Jahre1.031 DM gegenüber 419 DM bei den Deutschen fürWeiterbildung auf (direkte Kosten) (Bosch 2004c). E<strong>in</strong>ewichtige Korrekturfunktion für arbeitslose Zuwan<strong>der</strong>erhatten die Weiterbildungsmaßnahmen <strong>der</strong> Bundesanstaltfür Arbeit. Hier stieg <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>anteil von 5,0 Prozentim Jahre 1991 auf 14,7 Prozent im Jahre 2001 (ebenda).Dieser Prozentsatz lag über demjenigen <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> an<strong>der</strong> Erwerbsbevölkerung, allerd<strong>in</strong>gs unter ihrem Anteil anden Arbeitslosen. Inzwischen ist <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>anteil aberwie<strong>der</strong> deutlich unter 10 Prozent gefallen, was vermutliche<strong>in</strong>e Folge <strong>der</strong> stärkeren Erfolgsorientierung <strong>der</strong> Weiterbildungsmaßnahmenist (Bosch 2004c).Vor allem mangelnde Kenntnisse <strong>der</strong> deutschen Spraches<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> erhebliches H<strong>in</strong><strong>der</strong>nis. Vom neuen Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetzwird erwartet, dass hier vor allem für Neuankömml<strong>in</strong>ge<strong>der</strong> Spracherwerb verbessert wird. Allerd<strong>in</strong>gsgehen die Deutschkenntnisse bei den Auslän<strong>der</strong>n im Alterüber 65 Jahren im Zeitverlauf <strong>zur</strong>ück: 1997 gaben24,9 Prozent an, ihre Deutschkenntnisse seien eherschlecht bzw. sie würden überhaupt ke<strong>in</strong> Deutsch sprechen– vier Jahre später gab fast je<strong>der</strong> Zweite (47,6 Prozent)e<strong>in</strong>e entsprechende Selbste<strong>in</strong>schätzung ab. Es ist dabeisowohl denkbar, dass sich nach <strong>der</strong> Verrentung dieSprachkenntnisse durch weniger häufig stattf<strong>in</strong>dendenKontakt mit Deutschen tatsächlich verschlechtert haben,als auch, dass sich lediglich die Selbste<strong>in</strong>schätzung verän<strong>der</strong>that (Özcan & Seifert 2004: 33). Die kont<strong>in</strong>uierlicheBeobachtung des Weiterbildungsgeschehens <strong>in</strong>Deutschland im Auftrag des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Bildungund Forschung, kurz: das „<strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung“,berücksichtigt seit se<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>führung im Jahr1979 nun zum ersten Mal auch Migranten. In se<strong>in</strong>er Erhebungvon 2003 werden Auslän<strong>der</strong> e<strong>in</strong>bezogen, wobei dieStichprobe von 339 Befragten nicht repräsentativ ist. DieAufnahme <strong>der</strong> Migranten <strong>in</strong> die Studie stellt dennoch e<strong>in</strong>enFortschritt gegenüber <strong>der</strong> bisherigen Praxis dar (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Bildung und Forschung 2004).Nach dem parteiübergreifenden Beschluss des DeutschenBundestages vom Juli 2004 und <strong>der</strong> darauf folgenden Zustimmungdurch den Bundesrat ist das Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetzam 1. Januar 2005 <strong>in</strong> Kraft getreten. Das Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetzstellt die Sprachkenntnisse von Migrantenund Migrant<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> den Mittelpunkt <strong>der</strong> Diskussion überihre Integration. Allerd<strong>in</strong>gs differiert die Bedeutung <strong>der</strong>Sprachbeherrschung je nach Anwendungskontext undZielgruppe. Was die älteren Migranten, die bereits verrentets<strong>in</strong>d, betrifft, wirken sich mangelnde Sprachkenntnissez.B. auch auf die Qualität ihrer Versorgung aus, da hiere<strong>in</strong>e bedürfnisgerechte Nachfrage häufig an ihrer <strong>in</strong>adäquatenFormulierung scheitert. Ger<strong>in</strong>ge Deutschkenntnissebee<strong>in</strong>trächtigen die Interaktion mit den e<strong>in</strong>heimischenSprechern. Defizite <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Sprache s<strong>in</strong>d,wenn es sich nicht um e<strong>in</strong>e transitorische Phase neue<strong>in</strong>gereisterMigranten handelt, häufig auch mit e<strong>in</strong>er schwachenSprachbeherrschung <strong>der</strong> eigenen Herkunftsspracheverbunden. Es handelt sich hier an erster Stelle um e<strong>in</strong>Problem <strong>der</strong> Alphabetisierung und e<strong>in</strong> schichtabhängigesBildungsproblem, als um e<strong>in</strong> re<strong>in</strong>es Sprachproblem.Schulische Bildung als Voraussetzung<strong>der</strong> beruflichen BildungNicht generell bei Migranten, wohl aber bei bestimmtenGruppen, darunter solchen, die <strong>in</strong> erster <strong>Generation</strong> ausden Anwerbelän<strong>der</strong>n kamen, zeigt sich e<strong>in</strong> deutlich niedrigeresBildungsniveau im Vergleich zu Deutschen. Diesist <strong>der</strong> Fall bei den Migranten aus <strong>der</strong> Türkei <strong>in</strong> allen Altersgruppen.Bei den 18- bis 44-Jährigen waren 200219,0 Prozent ohne schulischen Bildungsabschluss, beiden 45- bis 64-Jährigen s<strong>in</strong>d es 42,0 Prozent. Über65-jährige Ältere aus <strong>der</strong> Türkei haben zu 56,9 Prozentke<strong>in</strong>en Bildungsabschluss (Deutsche: jeweils unter 2 Prozent).Ältere <strong>der</strong> selben Altersgruppe aus Italien s<strong>in</strong>d zu25,9 Prozent ohne Bildungsabschluss während 63,0 Prozentüber e<strong>in</strong>en Hauptschulabschluss verfügen. ÄhnlicheWerte zeigen sich bei den Älteren aus Griechenland (jeweilse<strong>in</strong> Viertel und 62,5 Prozent). Auffallend ist, dassim Zeitverlauf ke<strong>in</strong> Aufholen zu erkennen ist. Fürtürkische Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten hat sich <strong>der</strong> Ab-
Drucksache 16/2190 – 244 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodestand <strong>zur</strong> deutschen Bevölkerung weiter vergrößert. Diebei <strong>der</strong> schulischen Bildung ermittelten Unterschiedezwischen Deutschen und Auslän<strong>der</strong>n aus den Anwerbelän<strong>der</strong>nzeigen sich noch deutlicher bei <strong>der</strong> Betrachtung<strong>der</strong> beruflichen Bildungsabschlüsse: 81,8 Prozent <strong>der</strong>45- bis 64-jährigen Migranten und Migrant<strong>in</strong>nen aus <strong>der</strong>Türkei haben ke<strong>in</strong>en beruflichen Ausbildungsabschluss(aus dem ehemaligen Jugoslawien: 49,6 Prozent, aus Italien:65,4 Prozent, aus Griechenland: 70,8 Prozent, Deutsche:14,9 Prozent) (Özcan & Seifert 2004: 9f.). Bei denüber 65-jährigen Älteren aus Italien und Griechenlandsteigen die Anteile <strong>der</strong>er mit e<strong>in</strong>em Lehrabschluss deutlich.Insgesamt liefert auch die Betrachtung <strong>der</strong> beruflichenBildungssituation ke<strong>in</strong>e Anzeichen für e<strong>in</strong> Aufholen imVergleich zu den Deutschen. Bei den hier <strong>in</strong> Betracht gezogenenMigrantengruppen bestehen die deutlichen Unterschiedeweiter. Angesichts ihrer relativ schlechtenDeutschkenntnisse sprechen die älteren Auslän<strong>der</strong> <strong>in</strong> ihremsozialen Umfeld überwiegend ihre Heimatsprache(2001 zu 56,9 Prozent). Auch hier zeigt <strong>der</strong> Vergleich zu1997 e<strong>in</strong>e steigende Tendenz. Im selben Jahr gaben40,3 Prozent <strong>der</strong> 45- bis 65-jährigen und nur 28,6 Prozent<strong>der</strong> über 65-jährigen Auslän<strong>der</strong> an, sehr gut bzw. gutDeutsch zu sprechen (Özcan & Seifert 2004: 34).8.7 Gesundheitliche Situationälterer Auslän<strong>der</strong>Auslän<strong>der</strong> hatten im Jahr 2001 im Durchschnitt e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>gerenGrad <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung als Deutsche <strong>in</strong> <strong>der</strong>selbenAlterskohorte. Auslän<strong>der</strong> im Alter von über 65 Jahrenwaren seltener (16,5 Prozent) <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verrichtung von Tätigkeitendes Alltags (wie sie etwa im Haushalt anfallen)beh<strong>in</strong><strong>der</strong>t als Deutsche (25,5 Prozent). An<strong>der</strong>erseits zeigtsich, dass die ambulanten Arztkontakte für Migrantenund Migrant<strong>in</strong>nen jenseits des fünfzigsten Lebensjahrsüberdurchschnittlich häufig s<strong>in</strong>d. Erwerbstätige Auslän<strong>der</strong>im Alter von 45 bis 65 Jahren waren sowohl 1997 alsauch 2002 wesentlich häufiger über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraumkrankgemeldet als Deutsche vergleichbaren Alters.2002 gaben 13,7 Prozent <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong> dieser Altersgruppean, im jeweiligen Vorjahr mehr als 6 Wochen arbeitsunfähiggewesen zu se<strong>in</strong>, bei Deutschen betrug <strong>der</strong>Anteil mit 6,9 Prozent nur die Hälfte (Özcan & Seifert2004: 23f.). Die Daten des Mikrozensus 2003 belegenden höheren Raucheranteil von ausländischen im Vergleichzu deutschen Männern. In <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> 20- bisunter 60-Jährigen rauchen 46,8 Prozent <strong>der</strong> ausländischengegenüber 39,7 Prozent <strong>der</strong> deutschen Männer. Bei denFrauen s<strong>in</strong>d die Unterschiede <strong>in</strong>sgesamt schwächer ausgeprägt.In <strong>der</strong> Tendenz zeigt sich aber, dass deutscheFrauen etwas häufiger als ausländische Frauen rauchen.Ausländische Frauen s<strong>in</strong>d vergleichsweise häufiger übergewichtigo<strong>der</strong> adipös, wobei die größten Unterschiedeim höheren Lebensalter beobachtet werden können: Vonden 60-jährigen und älteren ausländischen Frauen s<strong>in</strong>d62,7 Prozent übergewichtig o<strong>der</strong> adipös gegenüber54,9 Prozent <strong>der</strong> gleichaltrigen deutschen Frauen (Bundesregierung2005: 164f.).Wichtig, weil verhaltensregulierend, ist neben dem objektivdokumentierten Gesundheitsstatus die subjektive E<strong>in</strong>schätzung<strong>der</strong> eigenen gesundheitlichen Situation. Eszeigt sich, dass 45,4 Prozent <strong>der</strong> 65-jährigen und älterenAuslän<strong>der</strong> im Jahr 1997 ihren Gesundheitszustand als wenigergut bzw. schlecht e<strong>in</strong>stuften. Dieser Wert stieg bis2002 an, als je<strong>der</strong> zweite Auslän<strong>der</strong> dieser Altersgruppee<strong>in</strong>e entsprechende E<strong>in</strong>schätzung über se<strong>in</strong>e gesundheitlicheVerfassung angab (50,7 Prozent). Im Vergleich zu denDeutschen s<strong>in</strong>d somit sowohl die 45- bis 65-jährigen alsauch die über 65-jährigen Auslän<strong>der</strong> mit ihrer gesundheitlichenSituation weniger zufrieden. Häufig werden dieBeschwerden von den Betroffenen mit ihrer beruflichenTätigkeit <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gebracht. Gerade für die Arbeitsmigrantendient <strong>der</strong> Bezug <strong>zur</strong> Arbeit e<strong>in</strong>erseits als subjektiveKrankheits<strong>in</strong>terpretation, an<strong>der</strong>erseits als sozialeLegitimation für die Inanspruchnahme des mediz<strong>in</strong>ischenSystems. Wenn sich auch e<strong>in</strong> kausaler Bezug zwischenArbeitsprozess und Beschwerden nicht immer e<strong>in</strong>deutigdiagnostizieren lässt, gilt dennoch, dass die angeworbenenMigranten überdurchschnittlich oft <strong>in</strong> den am stärkstenbelastenden Arbeitsbereichen e<strong>in</strong>gesetzt wurden. E<strong>in</strong>hoher Anteil <strong>der</strong> Arbeitsmigranten ist im verarbeitendenGewerbe und im Baugewerbe beschäftigt. Über die hohegesundheitliche Belastung am Arbeitsplatz gibt es e<strong>in</strong>eReihe von weiteren Indizien. So zeigt sich aus e<strong>in</strong>er Studie,die alle Fälle mit anerkannter Berufskrankheit beitürkischen Staatsangehörigen <strong>der</strong> Jahre 1995 bis 1997ausgewertet hat, dass das durchschnittlich erreichte Lebensalter<strong>der</strong> als Folge von Berufskrankheit gestorbenentürkischen Arbeitnehmer mit 58,3 Jahren um neun Jahreunter demjenigen <strong>der</strong> deutschen Arbeitnehmer liegt. Überdie Risikoparameter <strong>der</strong> beruflichen Tätigkeit und ihreOrte h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d auch verhaltensbed<strong>in</strong>gte Momente, diepräventive Begleitung und Kontrolle und <strong>der</strong> Prozess vonBehandlung und Rehabilitation von nicht unerheblicherBedeutung. Die letzteren Faktoren s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> ihrem Stellenwertschwer zu objektivieren. Dass aber 37,2 Prozent <strong>der</strong>türkischen und 23,3 Prozent <strong>der</strong> deutschen Arbeitnehmernach Feststellung <strong>der</strong> Berufskrankheiten e<strong>in</strong>e erheblichlange Zeit weiter an ihrem Platz arbeiten, ersche<strong>in</strong>t hochproblematischund allenfalls im S<strong>in</strong>ne ökonomischerSachzwänge o<strong>der</strong> auch mangeln<strong>der</strong> „Aufklärung“ zu <strong>in</strong>terpretierenzu se<strong>in</strong> (Korporal & Dangel 2004: 30).Obwohl die Lebenslage <strong>der</strong> Migrantenbevölkerung sichzunehmend positiv differenziert hat und ihre Situation <strong>in</strong><strong>der</strong> kurativen Versorgung sich <strong>der</strong>jenigen vergleichbarerGruppen <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> deutschen Bevölkerung angenäherthat, bleiben viele Zugangsbarrieren im Bereich <strong>der</strong>Prävention und Rehabilitation bestehen. Nach e<strong>in</strong>er Studiedes Robert Koch-Instituts im Auftrag des Bundesm<strong>in</strong>isteriumsfür Gesundheit und Soziale Sicherung erhaltenfast doppelt so viele deutsche Männer und Frauen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe <strong>der</strong> 50-Jährigen und Älteren e<strong>in</strong>eGrippeschutzimpfung wie Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Auslän<strong>der</strong>(33,2 Prozent gegenüber 18,6 Prozent). Insgesamt ist essehr problematisch, dass Migranten, d.h. <strong>in</strong>zwischen ca.e<strong>in</strong> Zehntel <strong>der</strong> Bevölkerung Deutschlands, <strong>in</strong> den Debattenund Projekten um Primärprävention und Gesundheits-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 245 – Drucksache 16/2190för<strong>der</strong>ung praktisch nicht berücksichtigt werden (Bundesregierung2005).Generell geht man davon aus, dass sich die Morbiditätsratenvon Immigranten jenen <strong>der</strong> nicht immigrierten Bevölkerungzunehmend annähern. Allerd<strong>in</strong>gs lag die Sterblichkeit<strong>in</strong> <strong>der</strong> erwachsenen ausländischen Bevölkerungseit Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> 1980er-Jahre <strong>in</strong> <strong>der</strong> amtlichen Todesursachenstatistik<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik weit unter <strong>der</strong>jenigen<strong>der</strong> deutschen Bevölkerung (Kruse et al. 2004). DieserBefund ist <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n ebenso bekannt(Dietzel-Papakyriakou 1993a). Was Deutschland betrifft,könnten es fehlende Meldungen und Beurkundungen vonSterbefällen, die Aufgabe <strong>der</strong> Staatsangehörigkeit <strong>der</strong> Migranteno<strong>der</strong> ihre selektive Remigration, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e imVerlauf unheilbarer, chronischer o<strong>der</strong> todesbedrohendeKrankheiten se<strong>in</strong>, die dazu beitragen (Korporal & Dangel2004). Die Annahme e<strong>in</strong>er selektiven Rückkehr ist auchals „Healthy-migrant-Effekt“ bekannt und wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>ternationalenLiteratur mit wi<strong>der</strong>sprüchlichen empirischenErgebnissen diskutiert. Möglich ist, dass aus e<strong>in</strong>eraktuell niedrigen Mortalitätsrate erwachsener Zuwan<strong>der</strong>erauf Grund <strong>der</strong> langen Latenzzeit chronischer Erkrankungennicht auf e<strong>in</strong>e auch <strong>in</strong> Zukunft niedrige Mortalitätgeschlossen werden darf (Kruse et al. 2004).Die Problematik <strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit macht sich allmählichauch bei Migranten bemerkbar. Allerd<strong>in</strong>gs wirdsie für die <strong>in</strong> den 1960er-Jahren angeworbene erste <strong>Generation</strong>erst <strong>in</strong> 5 bis 10 Jahren voll zum Tragen kommen,wenn e<strong>in</strong>e größere Anzahl von Migranten und Migrant<strong>in</strong>nendas achtzigste Lebensjahr überschritten haben wird.Bereits heute und beson<strong>der</strong>s um e<strong>in</strong> hohes Hilfe- undPflegebedürftigkeitsrisiko bei dieser Altenpopulation vorzubeugen,ist die Berücksichtigung des fremdkulturell geprägtenKrankheitsverhaltens unerlässlich. Angesichts ihrersprachlichen Schwierigkeiten und ihrer ger<strong>in</strong>genKontaktmöglichkeiten zum deutschen Kontext ist es fürältere Migrant<strong>in</strong>nen von beson<strong>der</strong>er Bedeutung, muttersprachlicheInformationen zu möglichen Hilfen zu bekommen.Ihnen bieten Selbstorganisationen von Migrantene<strong>in</strong>en guten Zugang und Ansatzpunkte für Programme<strong>der</strong> gesundheitlichen Aufklärung und Prävention. In deutscherSprache ist es aber auch möglich, über die zweiteMigrantengeneration Informationen an nicht-deutschsprachigeAngehörige <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong> zu vermitteln.Es ist davon auszugehen, dass bei älteren MigrantenKommunikationsprobleme auch bei <strong>der</strong> Begutachtunge<strong>in</strong>e wichtige Rolle spielen. Wie bei <strong>der</strong> Inanspruchnahmean<strong>der</strong>er Leistungen ist die Beantragung von Leistungen<strong>zur</strong> Pflege bei mangelnden deutschen Sprachkenntnissenerschwert, und man kann davon ausgehen,dass die Sicherheit <strong>der</strong> Begutachtung hierdurch bee<strong>in</strong>trächtigtwird. Interkulturelle Spezifika <strong>der</strong> Pflege undgenerell e<strong>in</strong>e bee<strong>in</strong>trächtigte Kommunikation wegenSprach- und an<strong>der</strong>er Schwierigkeiten, die den Zeitaufwand<strong>der</strong> Pflege erhöhen, bleiben ohne Berücksichtigung,wenn sie nicht im E<strong>in</strong>zelnen den Mediz<strong>in</strong>ischen Dienstengegenüber spezifisch begründet werden. Pflegende Familienangehörige<strong>der</strong> ersten Migrantengeneration stehenhäufig ebenso vor Kommunikationsschwierigkeiten.In <strong>der</strong> Tendenz wird eher für das Pflegegeld optiert. Damitkann den eigenen, auch kulturellen und spirituellenBedürfnissen angemessene Pflege und Versorgung (mit-)geschaffen und sichergestellt und im Rahmen <strong>der</strong> Familieerbracht werden. In <strong>der</strong> Zukunft wird sich zeigen, ob die<strong>in</strong>zwischen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Städten existierenden „ethnischsensiblen“ambulanten Pflegedienste stärker e<strong>in</strong>bezogenwerden. Auch hier beschränkt sich das Angebot imGrunde auf die Migrantengruppe türkischer Staatsangehörigkeit.Die an<strong>der</strong>en Migrantengruppen br<strong>in</strong>gen die nötigeNachfrage nicht zustande. Hier müssen die <strong>in</strong>terkulturellenKompetenzen <strong>der</strong> Regeldienste ausgebautwerden. Generell kann aber gesagt werden, dass e<strong>in</strong>e aufsuchendeVersorgung den Erwartungen <strong>der</strong> älteren Migrantenbevölkerung<strong>in</strong> größerem Umfang entspricht. IhnenRechnung zu tragen, ist e<strong>in</strong>e nicht zu unterschätzendeAnfor<strong>der</strong>ung an die bestehenden Pflegedienste (Korporal& Dangel 2004).8.8 Familien und soziale Netzwerkeälterer MigrantenDa für e<strong>in</strong>e Erstellung ausführlicher Familientypologiendie Fallzahlen lei<strong>der</strong> nicht ausreichend s<strong>in</strong>d, wird hier als„Näherungslösung“ <strong>der</strong> Familienstand betrachtet. Dabeimuss allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e gewisse Unschärfe <strong>in</strong> Kauf genommenwerden, da Verheiratete nicht zwangsläufig auch mitihrem Partner zusammenleben.Bei den 45- bis 64-Jährigen s<strong>in</strong>d Personen aus <strong>der</strong> Türkeimit 90,1 Prozent am häufigsten verheiratet, gefolgt vonGriech<strong>in</strong>nen und Griechen (86,7 Prozent), Italiener<strong>in</strong>nenund Italiener (83,3 Prozent) und Personen aus dem ehemaligenJugoslawien (82,7 Prozent). Von den Deutschendieser Altersgruppe waren h<strong>in</strong>gegen lediglich 77,5 Prozentverheiratet. Ausländische Haushalte s<strong>in</strong>d wie<strong>der</strong>umseltener geschieden als Deutsche – <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e türkischeHaushalte haben mit 4,5 Prozent e<strong>in</strong>en sehr niedrigenAnteil an Geschiedenen, aber auch <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>Verwitweten liegt bei <strong>der</strong> ausländischen Bevölkerungniedriger.Im Vergleich zwischen den Jahren 1997 und 2002 zeigensich ke<strong>in</strong>e drastischen Verän<strong>der</strong>ungen beim Familienstand.Nur bei Personen aus dem ehemaligen Jugoslawiennahm <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Ledigen deutlich zu (Özcan & Seifert2004: 27). Dies dürfte im Zusammenhang mit Bürgerkriegund Zuwan<strong>der</strong>ung von Flüchtl<strong>in</strong>gen stehen.Der hohe Anteil an Verheirateten wirkt auf die materielleAbsicherung <strong>der</strong> Älteren stabilisierend. Verwitwung o<strong>der</strong>Scheidung kann bei Personen mit niedrigem E<strong>in</strong>kommensehr schnell <strong>zur</strong> Abhängigkeit von Sozialhilfe führen.Möglich ist dies <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e bei nichterwerbstätigenEhefrauen o<strong>der</strong> Migrant<strong>in</strong>nen, die nicht-versicherungspflichtigbeschäftigt s<strong>in</strong>d.
Drucksache 16/2190 – 246 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeTabelle 43Familienstand nach Nationalität und Alter, 1997/2002, <strong>in</strong> Prozent18 bis 44 JahreDeutschlandTürkeiQuelle: Özcan & Seifert 2004: 27. Datenbasis: Mikrozensus 2002.Griechenland2002ItalienehemaligesJugoslawienAusland<strong>in</strong>sgesamtledig 47,9 25,4 42,3 42,1 33,3 32,6verheiratet 46,2 71,2 53,7 53,7 61,9 62,8verwitwet 0,4 0,4 0,0 0,3 0,7 0,4geschieden 5,5 3,1 4,0 4,0 4,1 4,145 bis 64 Jahreledig 8,2 1,2 3,8 6,1 4,1 5,1verheiratet 77,1 90,1 86,7 83,3 82,7 83,0verwitwet 5,2 4,3 4,8 3,5 5,4 4,6geschieden 9,5 4,5 4,8 7,1 7,8 7,465 Jahre u. älterledig 5,7 3,1 4,8 9,4 9,7 5,6verheiratet 55,4 78,1 71,4 62,5 54,8 65,1verwitwet 34,4 15,6 19,0 25,0 25,8 23,4geschieden 4,4 3,1 4,8 3,1 9,7 5,918 bis 44 JahreLedig 43,9 25,3 39,0 37,7 32,0 31,3verheiratet 50,6 72,3 58,1 58,0 64,2 65,0verwitwet 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6geschieden 5,0 2,0 2,3 3,7 3,1 3,145 bis 64 JahreLedig 6,8 1,4 3,8 8,1 5,2 5,2verheiratet 79,0 92,1 88,7 81,4 83,4 84,9verwitwet 5,9 3,4 3,8 3,1 4,5 3,8geschieden 8,3 3,2 3,8 7,5 6,9 6,165 Jahre u. älterLedig 6,1 3,2 3,6 8,3 4,3 6,9verheiratet 52,0 80,6 73,6 62,5 56,5 60,6verwitwet 38,0 12,9 20,0 25,0 26,1 27,3geschieden 3,9 3,2 2,7 4,2 13,0 5,21997
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 247 – Drucksache 16/21908.8.1 Potenziale älterer Migranten <strong>in</strong> familialenund weiteren sozialen NetzwerkenDer Familismus <strong>der</strong> Migranten, also das geme<strong>in</strong>schaftlicheWirtschaften und Zusammenhalten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie,macht Migration überhaupt erst möglich. Er bildet auchangesichts e<strong>in</strong>er globalisierten Welt mit <strong>in</strong>zwischengrenzüberschreitenden sozialen Netzwerken e<strong>in</strong>e bedeutsameVoraussetzung, die Migrationssituation zu gestalten.Die Familie dient ebenso als Ort <strong>der</strong> Identitätswahrung,wenn <strong>der</strong> Aufnahmekontext kulturell als zu fremd empfundenwird. Mit <strong>der</strong> Zeit und den nachfolgenden <strong>Generation</strong>enentstehen größere familiale Netzwerke bei den Migranten.Allerd<strong>in</strong>gs kommen diese Potenziale eher <strong>in</strong> den größerenNationalitäten vor. Die kollektiven Ziele <strong>der</strong> Migrantenhaushalte,<strong>in</strong> denen die Älteren ausländischer Herkunftzumeist leben, haben beträchtliche Auswirkungen auf <strong>der</strong>enStatus. In dieser Situation können die Angehörigen <strong>der</strong>ersten Migrantengeneration <strong>in</strong> ihrer Großelternrolle ihrenK<strong>in</strong><strong>der</strong>n Unterstützung und Entlastung anbieten und ihnene<strong>in</strong>en maximalen E<strong>in</strong>satz für das geme<strong>in</strong>same Anliegen<strong>der</strong> Familie ermöglichen. Die Übernahme von neuen nützlichenFunktionen durch die Alten stärkt wie<strong>der</strong>um dieFamilienkohäsion: Ältere Menschen bekommen mehrHilfe, weil ihre Hilfe gebraucht wird. Die Hilfenetzwerke<strong>der</strong> <strong>in</strong>strumentellen und emotionalen Unterstützung ältererMigranten setzen sich ganz überwiegend aus familiärenBezugspersonen zusammen. Hierzu gehören an ersterStelle die eigenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>. Sie helfen vor allem bei Behördenangelegenheiten,bei schweren Hausarbeiten und beimE<strong>in</strong>kaufen. Ältere Mi-granten s<strong>in</strong>d jedoch nicht nur Hilfeempfänger,son<strong>der</strong>n erbr<strong>in</strong>gen ihrerseits auchUnterstützungsleistungenfür an<strong>der</strong>e, wobei wie<strong>der</strong>um die K<strong>in</strong><strong>der</strong>die Hauptadressaten s<strong>in</strong>d. Hierzu zählen vor allem Ratschlägebei persönlichen o<strong>der</strong> praktischen Problemen sowieHilfen im Haushalt <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>, im Familienbetriebo<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung (Olbermann & Dietzel-Papakyriakou1996; Nauck & Kohlmann 1998; Nauck2000). Insgesamt zeigt sich, dass Auslän<strong>der</strong> zu e<strong>in</strong>em größerenTeil auf die Hilfe <strong>der</strong> Familie <strong>zur</strong>ückgreifen als dieDeutschen ähnlicher sozioökonomischer <strong>Lage</strong> (Bauer,Loeffelholz & Schmidt 2004). Dies dürfte auch die Erklärungdafür se<strong>in</strong>, dass die Sozialhilfeabhängigkeit unterden älteren Deutschen überwiegend e<strong>in</strong> Problem <strong>der</strong>Frauen darstellt, während die geschlechtsspezifische Sozialabhängigkeitunter den Auslän<strong>der</strong>n nahezu gleichverteiltist (Bauer, Loeffelholz & Schmidt 2004).E<strong>in</strong>e wichtige Ergänzung <strong>der</strong> bisherigen Daten über ältereMigranten stellt die zweite Welle des Alterssurveys von2002 dar (Krumme & Hoff 2004). Es wurden 586 Nicht-Deutsche im Alter von 40 bis 85 Jahren <strong>in</strong> deutscherSprache befragt. Bei e<strong>in</strong>er nach ausgewählten Staatsangehörigkeitsgruppendifferenzierten Betrachtung <strong>der</strong> Stichprobefallen die Probanden türkischer Herkunft auf: Sieleben häufiger als die deutschen <strong>in</strong> Zweigenerationenhaushaltenmit m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>em K<strong>in</strong>d und <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong>Alle<strong>in</strong>lebenden ist beson<strong>der</strong>s ger<strong>in</strong>g.Während 85 Prozent <strong>der</strong> im Alterssurvey befragten Deutschenangeben, ihre Eltern <strong>in</strong> höchstens zwei Wegstundenerreichen zu können, geben drei Viertel <strong>der</strong> befragtenNicht-Deutschen an, dass ihre Eltern im Ausland leben.Dieser Anteil ist bei den Befragten aus dem ehemaligenJugoslawien mit 96 Prozent am höchsten, gefolgt von denItalienern mit 81 Prozent und denjenigen aus <strong>der</strong> Türkeimit 73 Prozent. Bei den befragten Deutschen beträgt <strong>der</strong>Anteil <strong>der</strong> im Ausland lebenden Eltern lediglich 2 Prozent.Über K<strong>in</strong><strong>der</strong> am selben Ort verfügen 78 Prozent <strong>der</strong>Nicht-Deutschen gegenüber 72 Prozent <strong>der</strong> Deutschen.Insgesamt zeigen die Daten des Alterssurveys, dass dieKernfamilie sowohl für Deutsche wie auch für Nicht-Deutsche zentraler Bezugspunkt ist. Austausch und sozialeUnterstützung <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en f<strong>in</strong>den statt. Wasdie Beziehungen zu den Eltern betrifft, ist dies allerd<strong>in</strong>gsbei den Nicht-Deutschen weniger häufig <strong>der</strong> Fall, weil e<strong>in</strong>Großteil <strong>der</strong> Eltern im Ausland lebt. Dafür f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> dieserRichtung rege f<strong>in</strong>anzielle Transfers statt. Die Nicht-Deutschen bewerten im Vergleich zu den Deutschen dieBeziehungen zu ihren Eltern trotz größerer Entfernung alsenger (Krumme & Hoff 2004).Im Vergleich <strong>der</strong> Nationalitäten zeigte sich bei 18- bis30-Jährigen, dass vor allem die jungen Erwachsenen aus<strong>der</strong> Türkei stark familien- und verwandtschaftsorientierts<strong>in</strong>d und ihre Freundschaften und Cliquen sich <strong>in</strong>nerhalb<strong>der</strong> eigenen ethnischen Geme<strong>in</strong>schaft bewegen (Haug2004). Während <strong>der</strong> Anteil jüngerer Migranten, dieFreundschaften mit Deutschen pflegen, wächst, ist dies <strong>in</strong>viel ger<strong>in</strong>gerem Maße für ältere Migranten <strong>der</strong> Fall. Soerklärte im Jahr 2002 je<strong>der</strong> Zweite <strong>der</strong> 18- bis 44-Jährigen,unter ihren drei wichtigsten Bezugspersonen (Freunden)außerhalb <strong>der</strong> Familie m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e deutsche Personzu haben, bei den 45- bis 65-Jährigen waren es37,3 Prozent, bei 65-jährigen und älteren Auslän<strong>der</strong>n lag<strong>der</strong> Anteil bei 34,2 Prozent. Der niedrigere Anteil bei denÄlteren lässt sich mit ihren ger<strong>in</strong>geren Sprachkenntnissenerklären, denn ausreichende Kenntnisse <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschenSprache s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel Voraussetzung dafür, sozialeNetzwerke bzw. <strong>in</strong>tensivere Kontakte mit Deutschen pflegenzu können.Ältere Migranten s<strong>in</strong>d oftmals auf die Sprachkenntnisseihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong> angewiesen, wenn sie beispielsweise mitdeutschen Behörden <strong>in</strong> Kontakt kommen. Der Anteil vonAuslän<strong>der</strong>n im Alter über 64 Jahren, <strong>der</strong> im Jahr 2001 angab,sehr gut bzw. gut Deutsch zu sprechen, betrug28,6 Prozent. Bemerkenswert ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang,dass sich bei Auslän<strong>der</strong>n im Alter von über 64 Jahrendie Deutschkenntnisse im Zeitverlauf verschlechterthaben: 1997 gaben 24,9 Prozent an, ihre Deutschkenntnisseseien eher schlecht bzw. sie würden überhaupt ke<strong>in</strong>Deutsch sprechen. Vier Jahre später gab fast je<strong>der</strong> Zweite(47,6 Prozent) e<strong>in</strong>e entsprechende Selbste<strong>in</strong>schätzung ab.Hier macht sich u.a. bemerkbar, dass nach <strong>der</strong> Pensionierung<strong>der</strong> E<strong>in</strong>satz <strong>der</strong> deutschen Sprache im Alltag <strong>zur</strong>ückgehtund <strong>der</strong> Kontakt zu den Deutschen, soweit er vor allemdurch die Berufstätigkeit ermöglicht worden ist,abnimmt. Es kann aber auch e<strong>in</strong>e verän<strong>der</strong>te Selbste<strong>in</strong>schätzungh<strong>in</strong>zukommen. Ähnlich verhält es sich mitschriftlichen Deutschkenntnissen. 1997 erklärten 24,1 Prozent<strong>der</strong> 65-jährigen und älteren Auslän<strong>der</strong>, dass ihre
Drucksache 16/2190 – 248 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeschriftlichen Deutschkenntnisse „sehr gut“ bis „gut“seien, 2001 waren es nur noch 18,3 Prozent.Migranten wenden sich also im Alter <strong>der</strong> eigenen Sprachezu. Im Jahr 2001 gaben 97,4 Prozent <strong>der</strong> 65-Jährigen undÄlteren an, dass sie sehr gute Kenntnisse <strong>in</strong> ihrer Herkunftssprachehaben (Özcan & Seifert 2004: 33f.). DieMuttersprache ist also zweifellos diejenige Sprache, <strong>in</strong><strong>der</strong> ältere Migranten am besten kommunizieren können.Für die zweite Migrantengeneration wird dies allerd<strong>in</strong>gs<strong>in</strong> Zukunft nur noch bei den Wenigsten <strong>der</strong> Fall se<strong>in</strong>. Hierkönnte sich e<strong>in</strong>e <strong>zur</strong>zeit vollziehende Wende <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bildungspolitikgegenüber Migrantenk<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> Deutschlandbemerkbar machen. Die Institutionen des Aufnahmelandessehen es immer weniger als ihre Aufgabe an, e<strong>in</strong>efremde Muttersprache zu vermitteln. Hier kommen imGrunde kulturpolitische Erwägungen unter fiskalischenZwängen zum Tragen. Globalisierungsprozesse führen e<strong>in</strong>erseitszu Nivellierungen und Angleichungen und machenan<strong>der</strong>erseits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Begegnung auch die kulturellenDifferenzen deutlich. Das Ideal <strong>der</strong> gesellschaftlichenkulturellen Kohärenz gehört aber zum Konzept des Nationalstaates.E<strong>in</strong>e nahe liegende Strategie, um diese Kohärenzzu sichern, hat die kulturelle Assimilierung <strong>der</strong> Migrantenbevölkerungenzum Ziel. Diese gel<strong>in</strong>gt vor allemüber den Weg <strong>der</strong> sprachlichen Assimilation. Insbeson<strong>der</strong>edie nachfolgenden <strong>Generation</strong>en sollen sich statt mit<strong>der</strong> Herkunftssprache ihrer Eltern mit <strong>der</strong>jenigen des Aufnahmelandesidentifizieren. Diese ist ohneh<strong>in</strong> die Sprachedes Kontextes, <strong>in</strong> dem sie leben, und daher dom<strong>in</strong>ant. Soweitman allerd<strong>in</strong>gs Sprache nicht nur kognitiv-<strong>in</strong>strumentell,son<strong>der</strong>n auch psychosozial als konstitutiv fürVerständnis und Empf<strong>in</strong>den von Welt überhaupt versteht,bedeutet <strong>der</strong> Verlust <strong>der</strong> Muttersprache auch e<strong>in</strong>en qualitativenVerlust für das <strong>in</strong>tergenerationelle Verhältnis.Wenn die Unterstützungsbedürftigkeit <strong>der</strong> Älteren e<strong>in</strong>tritt,bef<strong>in</strong>det sich die zweite <strong>Generation</strong> im Erwachsenenalter.Bis dah<strong>in</strong> haben sich die <strong>in</strong>tergenerationellen Beziehungenmehrmals verän<strong>der</strong>t. Konflikte zwischen Eltern undihren jugendlichen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n können <strong>in</strong> den mittleren Lebensjahrenüberwunden se<strong>in</strong>, zumal die Erwachsenen <strong>der</strong>zweiten <strong>Generation</strong> dann durch ihre eigene Rolle als Elterne<strong>in</strong>en „Perspektivwechsel" vollzogen haben. Esspricht deshalb vieles dafür, dass <strong>in</strong>tergenerative Solidarpotenziale<strong>in</strong> Migrantenfamilien <strong>in</strong> vergleichsweise hohemMaße gegeben s<strong>in</strong>d (Dietzel-Papakyriakou 1993a,1993b).Dies wird von weiteren Studien bestätigt. Ergebnisse <strong>der</strong>Studien von Nauck zeigen, dass bisherige <strong>in</strong>tergenerativeEntfremdung und Konflikte nicht das typische Ergebnisvon E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsprozessen s<strong>in</strong>d (Nauck 2004). Diesewerden vielmehr mit e<strong>in</strong>er hohen „Synchronisierung“durchlebt, d.h. durch die ausgeprägte wechselseitige Orientierung<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en ane<strong>in</strong>an<strong>der</strong> bleibt die Geschw<strong>in</strong>digkeitdes E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsprozesses bei Elternund K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ähnlich, wenngleich bei <strong>der</strong> jüngeren <strong>Generation</strong>auf deutlich höherem Niveau als bei den Eltern.Die <strong>Generation</strong>en vollziehen den sozialen Wandel „imKonvoi“ (BMFSFJ 2000: 109). Den Untersuchungen vonNauck et al. (Nauck & Kohlmann 1998; Nauck 2000) folgendist das Klima <strong>in</strong> den Migrantenfamilien zwischenEhepartnern und <strong>Generation</strong>en eher als kooperativ dennals machtbetont und distanziert zu bezeichnen. Für dieseHypothese spricht auch <strong>der</strong> höhere Grad wechselseitigerEmpathie im Vergleich zu den im Herkunftsland Türkeiuntersuchten Familien (Nauck 2000). Wie im 6. Familienberichtausgeführt, nennen mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Jugendlichenihre Geschwister als enge Bezugspersonen.Die Migrantenfamilie ist <strong>der</strong> wichtigste Ort <strong>der</strong> fraglosenZugehörigkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em fremdkulturellen Kontext. Allerd<strong>in</strong>gsist sie – ebenso vom sozialkulturellen Milieu abhängig– nicht immer <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>, die beson<strong>der</strong>en Belastungen<strong>der</strong> Migrationsituation und des beschleunigtensozialen Wandels aufzufangen. Migrantenfamilien entfaltenihre Solidarpotenziale selbst dann zu außerordentlichgroßer Wirksamkeit, wenn ke<strong>in</strong>e ethnischen Kolonien unterstützendverfügbar s<strong>in</strong>d. Sie unterhalten enge verwandtschaftlicheBeziehungen auch dann, wenn hierzudie Überw<strong>in</strong>dung größerer räumlicher Entfernungen notwendigist (BMFSFJ 2000).Generell bevorzugen Menschen soziale Kontakte zu an<strong>der</strong>en<strong>in</strong> relativer soziokultureller Homogenität. Dort istdie Interaktion „symmetrischer“. So auch die meisten Migranten<strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong>. Sie bevorzugen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regelden Kontakt zu den Landsleuten. Die Pflege geme<strong>in</strong>samerTraditionen, die Herkunftssprache und -geschichteträgt zum Erhalt ihres Selbstwertgefühls und ihres subjektivenWohlbef<strong>in</strong>dens bei. Für die älteren Migranten liegengerade <strong>in</strong> <strong>in</strong>nerethnischen sozialen Räumen die Potenzialefür e<strong>in</strong> Altern <strong>in</strong> Würde gemäß eigener kultureller Bedürfnisseund Altersbil<strong>der</strong>. Diese Tendenz, wovon die<strong>in</strong>ternationale Literatur auch aus den an<strong>der</strong>en Migrationslän<strong>der</strong>nberichtet, wurde <strong>in</strong> Deutschland mit dem Begriff„ethnischer Rückzug“ bezeichnet (Dietzel-Papakyriakou1993a, 1993b). Die Migranten aus <strong>der</strong> Türkei verfügenquasi überall, die an<strong>der</strong>en großen Nationalitätengruppen(Italiener, Griechen, ehemaliges Jugoslawien) nur punktuellüber solche Möglichkeiten (Dietzel-Papakyriakou &Olbermann 1996). Ethnische Kolonien s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gsnicht nur e<strong>in</strong> Ergebnis von sozialen Präferenzen <strong>der</strong>Migranten, son<strong>der</strong>n ergeben sich auch aus direkten und<strong>in</strong>direkten sozialen Exklusionsmechanismen <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft.Hierzu gehören vor allem Diskrim<strong>in</strong>ierungenauf dem Wohnungsmarkt. Erfolgreiche Migrantenverlassen die Auslän<strong>der</strong>quartiere, wenn diese sich <strong>in</strong> benachteiligtenStadtteilen bef<strong>in</strong>den.8.8.2 Potenziale im freiwilligem Engagementälterer MigrantenFreiwilliges Engagement <strong>der</strong> Migranten f<strong>in</strong>det vor allemim Bereich <strong>der</strong> Familie und sozialen Netzwerke statt.Darüber h<strong>in</strong>aus engagieren sich die älteren Migranten vorallem <strong>in</strong> den Auslän<strong>der</strong>vere<strong>in</strong>en. Diese s<strong>in</strong>d typische Zusammenschlüsse<strong>der</strong> ersten Migrantengeneration, <strong>in</strong> denenim weitesten S<strong>in</strong>ne die Herkunftskultur gepflegt wird(Diehl et al. 1998). Weitere Selbstorganisationen widmensich speziellen Bereichen: Sport, Elternvertretungen,Akademikervere<strong>in</strong>e, Selbstständigenvere<strong>in</strong>e, LandsmannschaftlicheVere<strong>in</strong>e etc. Migranten engagieren sich auch<strong>in</strong> Vertretungen <strong>der</strong> politischen Parteien ihres Herkunfts-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 249 – Drucksache 16/2190landes o<strong>der</strong> <strong>in</strong> deutschen Parteien o<strong>der</strong> <strong>in</strong> Auslän<strong>der</strong>beiräten,ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> deutschen Sportvere<strong>in</strong>en. In weiterendeutschen formellen und <strong>in</strong>formellen Bereichen s<strong>in</strong>d Migrantenbisher wenig engagiert. Allerd<strong>in</strong>gs gibt es hierzuz.B. im Freiwilligensurvey von 1999 ke<strong>in</strong>e repräsentativenstatistischen Angaben (Gaitanides 2003). Der ersten<strong>Generation</strong> stehen hier Sprachkenntnisse und vor allemDifferenzen im kulturellen und sozialen Kode im Wege.Traditionelle Freiwilligenorganisationen orientieren sichbeson<strong>der</strong>s an <strong>der</strong> eigenen Subkultur, <strong>der</strong> Pflege ihrer Geschichteund Bräuche, wie auch an Kommunikationsmodi,die sich nur schwer neuen, zumal fremdkulturellgeprägten Menschen öffnen. Dies gilt auch umgekehrt fürdie Selbstorganisationen <strong>der</strong> Migranten, <strong>in</strong> denen Angehörigean<strong>der</strong>er Nationalitäten und auch Deutsche <strong>in</strong> <strong>der</strong>Regel nicht vertreten s<strong>in</strong>d.Von <strong>der</strong> Öffentlichkeit unbemerkt und aus eigener Kraftherrscht <strong>in</strong> Teilbereichen <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> ethnischen Gruppenund <strong>der</strong> ethnischen religiösen E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>e Solidarität,die von den Selbstorganisationen <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>bzw. von den Organisationen <strong>der</strong> aus e<strong>in</strong>er bestimmtenRegion des Herkunftslandes stammenden Migranten getragenwird. Die Überführung von Verstorbenen <strong>in</strong> denHeimatort wird oft durch Spenden aus <strong>der</strong> ethnischenGruppe ermöglicht; kranke und alle<strong>in</strong> stehende alteLandsleute werden besucht, und bei außerordentlichenLebensereignissen wird unterstützt. Weiterh<strong>in</strong> werden <strong>in</strong>den Herkunftsorten geme<strong>in</strong>nützige Projekte gesponsert.Über das freiwillige Engagement <strong>der</strong> Migranten gibt ese<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensive und kontroverse Diskussion, speziell h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> E<strong>in</strong>schätzung, ob <strong>der</strong>en Selbstorganisationendie Integration <strong>in</strong> die deutsche Gesellschaft för<strong>der</strong>n o<strong>der</strong>beh<strong>in</strong><strong>der</strong>n. Seit den 1990er-Jahren wurden diesbezügliche<strong>in</strong>ige Studien durchgeführt. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d sie nicht repräsentativund knüpfen zu wenig an die wissenschaftlicheDiskussion über das freiwillige Engagement <strong>in</strong> <strong>der</strong>Gesellschaft an. Auch hier konzentriert sich die Forschungauf die Migrantengruppe aus <strong>der</strong> Türkei. Für dieAnalyse wird zwischen Herkunftsheterogenen o<strong>der</strong> Herkunftshomogenen(<strong>der</strong>en Mitglie<strong>der</strong> aus e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zigenLand, e<strong>in</strong>er Region o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten religiösen o<strong>der</strong>ethnischen Gruppe stammen) unterschieden. Letztgenanntenwird Selbstsegregation und die Bildung von angeblichen„Parallelgesellschaften“ vorgeworfen. Insgesamtwird die Thematik Selbsthilfeaktivität undSelbstorganisationen von Migranten <strong>in</strong> dieser Ambivalenzgeführt. Die e<strong>in</strong>en verweisen auf die gesellschaftlichenIntegrationsfunktionen von Migrantenselbstorganisationenund führen Schulerfolge, etwa <strong>der</strong> Spanier,Griechen und Italiener auf die Qualität ihre Selbstorganisationen<strong>zur</strong>ück. Dem Vorwurf <strong>der</strong> angeblichen „Parallelgesellschaft“wird mit dem Verweis auf ihre Vermittlerrolleund ihre Dienstleistungsfunktionen begegnet. Sobetrachtet führt die theoretische Diskussion zwangsläufig<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Gegensatz polarisieren<strong>der</strong> Hypothesen. DiesesDilemma stellt sich beim freiwilligen Engagement <strong>der</strong>e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerung kaum, obwohl auch hierSelbstorganisationen <strong>in</strong> subkulturellen Milieus vorkommen.Die herkunftshomogenen Selbstorganisationen s<strong>in</strong>d<strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel Zusammenschlüsse <strong>der</strong> ersten Migrantengeneration.Diese wie<strong>der</strong>um s<strong>in</strong>d häufig Vernetzungen vonerweiterten familialen Netzwerken. Kettenmigrationen– aus e<strong>in</strong>er bestimmten Region des Herkunftslandes zue<strong>in</strong>er bestimmten Region Deutschlands – gibt es viel häufiger,als es dem Außenstehenden bewusst ist. Diese Rekonstruktionenvon Mikrokosmen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Migration s<strong>in</strong>dtypisch und kommen auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Migrationslän<strong>der</strong>nvor. Mit den Migranten werden auch Modi <strong>der</strong> sozialenInteraktion aus den Ursprungskulturen verpflanzt. EthnologischeStudien weisen daraufh<strong>in</strong>, dass hier Patronageund Klientelsysteme aus den Herkunftsregionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igenSelbstorganisationen wie<strong>der</strong>aufleben.In <strong>der</strong> ersten Phase <strong>der</strong> Migration wurde die Betreuung<strong>der</strong> Migrantengruppen je nach religiöser Zugehörigkeit andie Wohlfahrtsverbände übertragen. Diese übernahmendann auch die Advokatenfunktion für die Migranten gegenüber<strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft. Mit <strong>der</strong> Zeit tratendie Selbstorganisationen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Fällen <strong>in</strong> Konkurrenzzu den Wohlfahrtsverbänden, <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Fällen <strong>in</strong> Zusammenarbeitmit ihnen auf, mit dem Anspruch <strong>der</strong> Selbstvertretung.Unter den Angehörigen <strong>der</strong> zweiten Migrantengenerationgibt es <strong>in</strong>zwischen viele, die – mitsozialberuflichen Qualifikationen – ausgestattet, das entsprechendeSegment des sozialarbeiterischen Arbeitsmarktes,mit dem Hauptargument, Insi<strong>der</strong> zu se<strong>in</strong>, fürsich beanspruchen.In den sozialräumlichen Kontexten <strong>der</strong> ethnischen Kolonien,<strong>in</strong> denen viele Migrantenfamilien leben, entwickeltsich auch das Engagement von E<strong>in</strong>zelnen, das über dieGrenzen <strong>der</strong> Familie h<strong>in</strong>ausgeht. E<strong>in</strong>e scharfe Unterscheidungist angesichts weit verzweigter Familiennetzwerkekaum möglich. Ethnische Kolonien entstehen häufig ausKettenmigrationen und diese wie<strong>der</strong>um beruhen auf verwandtschaftlichenBeziehungen. In <strong>der</strong> ersten Zeit <strong>der</strong>Migration, vor <strong>der</strong> Phase <strong>der</strong> Familienzusammenführung<strong>in</strong> den 1970er-Jahren, dienten Selbstorganisationen denMigranten häufig als Familienersatz. Die Weitergabe vonersten Informationen über das Alltagsleben, vom Sich<strong>zur</strong>echtf<strong>in</strong>den<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em fremden Kontext, dem E<strong>in</strong>kaufenbis zum Umgang mit den Behörden geschah dort. Heutewerden sie häufig durch großes Engagement <strong>der</strong> Pioniergenerationaufrechterhalten und stehen vor Problemen,Mitglie<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> zweiten Migrantengeneration zu rekrutieren.Diese teilen nicht den Eifer <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong>,Muttersprache, Traditionen und B<strong>in</strong>dungen zum Herkunftslandzu erhalten. Deutliche bzw. sichtbare Reethnisierungen,symbolisiert zum Beispiel durch typischeKleidung, kommen eher <strong>in</strong> denjenigen Gruppen vor, dievon <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft sehr stark abweichen.Generell ist das religiöse Engagement vor allem aber e<strong>in</strong>Kennzeichen <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong>, die sehr <strong>in</strong>tensiv– auch materiell – <strong>in</strong> Anmietung, Gestaltung und Führungvon Vere<strong>in</strong>shäusern und religiösen Gebäuden <strong>in</strong>vestierthat. Wobei <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Fällen <strong>der</strong> Bau von Moscheen vonmuslimischen Migranten erstritten wurde. Viele Räumlichkeiten<strong>der</strong> Selbstorganisationen werden zunehmendvon Migranten im Rentenalter frequentiert und entwickelnsich zu e<strong>in</strong>er Art Treffpunkte <strong>der</strong> offenen Altenarbeit.Die Selbstorganisationen könnten später auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>
Drucksache 16/2190 – 250 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSystem von Hilfearrangements e<strong>in</strong>gebunden werden,wenn es darum gehen wird, pflegende Familienangehörigezu unterstützen. Hier gilt es, <strong>in</strong>novativ vorzugehenund auf die Selbstorganisationen zuzugehen. Angesichts<strong>der</strong> dramatischen Verknappung ihrer f<strong>in</strong>anziellen Ressourcennutzen die Wohlfahrtsorganisationen ihr Wissenaus ihrer langjährigen Migrantenarbeit über Migrantenmilieusund signifikanten Akteuren und versuchen Migrantenals Freiwillige für sich zu gew<strong>in</strong>nen bzw. sie <strong>in</strong>ihrem Engagement zu unterstützen. So organisieren siepunktuell Fortbildungen für Vere<strong>in</strong>svertreter und Auslän<strong>der</strong>beiräte(Gaitanides 2003).Nach <strong>der</strong> Repräsentativerhebung des Bundesm<strong>in</strong>isteriumsfür Arbeit und Sozialordnung von 1995 waren 22 Prozent<strong>der</strong> Italiener, 26 Prozent <strong>der</strong> Türken und 28 Prozent <strong>der</strong>Griechen Mitglied <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vere<strong>in</strong> <strong>der</strong> eigenen Nationalität,während 22 Prozent <strong>der</strong> Italiener, 17 Prozent <strong>der</strong> Griechensowie 14 Prozent <strong>der</strong> Türken <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em deutschenVere<strong>in</strong> Mitglied waren. Wobei <strong>der</strong> Organisationsgrad <strong>der</strong>Männer höher ist als <strong>der</strong>jenige <strong>der</strong> Frauen (Mehrlän<strong>der</strong>,Ascheberg & Ueltzhöfer 1996). Jüngere Auslän<strong>der</strong> s<strong>in</strong>dhäufiger <strong>in</strong> deutschen, ältere Auslän<strong>der</strong> häufiger <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en<strong>der</strong> eigenen Nationalität organisiert (Bundesm<strong>in</strong>isteriumdes Innern 2001).Die umfangreichste repräsentative Untersuchung überMigrantenselbstorganisationen wurde <strong>in</strong> NRW 1997 imAuftrag des M<strong>in</strong>isteriums für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung,Kultur und Sport NRW durchgeführt(MASSKS 1999). Dort wurde <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>von Migrantenselbstorganisationen an <strong>der</strong> jeweiligen Migrantenbevölkerunghochgerechnet. So entfiel bezüglich<strong>der</strong> Altersstruktur auf die Altersgruppen e<strong>in</strong> Organisationsanteilvon 10 Prozent bis 18 Jahre, von 43 Prozentfür 19 bis 40 Jahre, von 33 Prozent für 41 bis 55 Jahreund von 14 Prozent <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgruppe 56 Jahre und älter.45 Prozent <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> <strong>in</strong> allen Altersgruppen warenFrauen. Insgesamt waren von allen Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong>Migrantenselbstorganisationen 21 Prozent aktive Mitglie<strong>der</strong>.Den höchsten Organisationsgrad wiesen die Migrantenaus Griechenland auf, gefolgt von den Migranten ausItalien und Spanien.Gerade bei älteren Migranten zeigt sich, dass freiwilligesEngagement spezifischen, sich aus <strong>der</strong> Migrationssituationergebenden Bedürfnissen entspricht. Hieraus entstehte<strong>in</strong>es <strong>der</strong> wichtigsten Motive des freiwilligen Engagements,das zugleich Selbsthilfe ist: <strong>der</strong> Erhalt <strong>der</strong> eigenenkulturellen Identität. Das Leben im fremdkulturellenKontext verlangt nach speziellen Arrangements, um dieeigene Sprache sprechen, die religiösen Riten und sozialenRituale erfüllen zu können. Insofern s<strong>in</strong>d viele Selbstorganisationenmultifunktional ausgerichtet, von Beratung,gegenseitiger Unterstützung bei Krankheit o<strong>der</strong>an<strong>der</strong>en kritischen Lebensereignissen bis <strong>zur</strong> Geselligkeit,Pflege <strong>der</strong> Muttersprache und Ausführung religiöserRiten. Sie werden bei bestimmten Nationalitäten allerd<strong>in</strong>gse<strong>in</strong>deutig von den männlichen Mitglie<strong>der</strong>n dom<strong>in</strong>iertund ihren Bedürfnissen entsprechend gestaltet. ÄltereFrauen weichen <strong>in</strong> eigene, meist <strong>in</strong>formelle Bereicheab.Selbstorganisationen <strong>der</strong> Migranten wurden bisher nochnicht ausreichend wahrgenommen und geför<strong>der</strong>t. Amhäufigsten wurden sie im kulturellen Bereich und dorteher folkloristisch e<strong>in</strong>bezogen. Das gerechtfertigte Misstrauengegenüber bestimmten religiös-fundamentalistischenSelbstorganisationen erschwert lei<strong>der</strong> auch die Anerkennung<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en, die auf demokratischer Basisarbeiten. Die demokratischen Selbstorganisationen s<strong>in</strong>djedoch e<strong>in</strong> Schritt <strong>der</strong> Migranten, an <strong>der</strong> Zivilgesellschaft<strong>in</strong> Deutschland zu partizipieren. Sie verdienen und bedürfendaher <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung, wie sonst auch das freiwilligeEngagement aller an<strong>der</strong>en Bürger im Land. Nach <strong>der</strong>NRW-Studie (MASSKS 1999) übernehmen Migrantenselbstorganisationen<strong>in</strong> ihrer überwiegenden Zahl e<strong>in</strong>eBrückenfunktion zwischen Herkunftskultur und <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft.Wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Freiwilligenarbeit <strong>der</strong> Aufnahmegesellschaft,so hängen auch bei den Migranten die Intensität und dieArt des Engagements vom Bildungsstand und <strong>der</strong> sozialenSchichtzugehörigkeit ab. Bürgerschaftliches Engagementist überwiegend e<strong>in</strong> Phänomen gut ausgebildeterMittelschichten. Mit <strong>der</strong> Zunahme von besser gebildetenPersonen <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Migrantenbevölkerung ist auche<strong>in</strong>e Zunahme des freiwilligen Engagements zu erwarten.Damit werden sie voraussichtlich auch stärker <strong>in</strong> den Bereichenaktiv, die bisher fast ausschließlich von Deutschenbesetzt wurden. Dies betrifft nachfolgende Migrantengenerationeno<strong>der</strong> neu e<strong>in</strong>reisende qualifizierteMigranten.Die erste Migrantengeneration <strong>der</strong> heute älteren angeworbenenMigranten engagiert sich <strong>in</strong> den traditionellen Migrantenvere<strong>in</strong>enund weiteren ethnischen Organisationen.Engagierten sie sich früher vor allem <strong>in</strong> ethnischen Sportvere<strong>in</strong>en,Elternvere<strong>in</strong>en, Kulturvere<strong>in</strong>en und religiösenGeme<strong>in</strong>schaften, kommen heute punktuell auch Altenklubsdazu. Beispielhaft ist hier ADENTRO, e<strong>in</strong> Netzwerkfür spanische Senioren und Senior<strong>in</strong>nen, das sich<strong>der</strong> Aufgabe offensiv angenommen hat und Animateurefür die ehrenamtliche Bildungs- und Freizeitarbeit mit älterenMigranten ausbildet (Deutsches Rotes Kreuz 2000).Außerdem wurde e<strong>in</strong>e landesweit operierende Beratungsstelleunter Trägerschaft des Deutschen ParitätischenWohlfahrtsverbandes (DPWV) e<strong>in</strong>gerichtet, die Migrantenselbstorganisationen<strong>in</strong> allen e<strong>in</strong>schlägigen rechtlichenund f<strong>in</strong>anzierungstechnischen Fragen sowie bei <strong>der</strong> Organisationsentwicklungberät und schult (Gaitanides 2003).Auch die Bundeszentrale für politische Bildung will sichverstärkt um die demokratischen Migrantenselbstorganisationenbemühen und sie als Träger <strong>der</strong> politischen Bildunganerkennen (Gaitanides 2003).Das Engagement <strong>der</strong> ersten Migrantengeneration <strong>in</strong> ihrenSelbstorganisationen ist als kollektiv erstellte und kollektivgenutzte Ressource zu sehen, die ihrer Lebenslage entspricht.Ältere Migranten, die nur über rudimentäre o<strong>der</strong>fast ke<strong>in</strong>e Deutschkenntnisse (vielfach bei älteren Frauen)verfügen, werden den Weg <strong>in</strong> deutsche Organisationennicht f<strong>in</strong>den. Nicht nur kulturell-religiöse Barrieren wärenhier zu überw<strong>in</strong>den, son<strong>der</strong>n auch die Unterschiede <strong>in</strong><strong>der</strong> sozialen Schichtzugehörigkeit, die auch bei den e<strong>in</strong>-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 251 – Drucksache 16/2190heimischen Deutschen sehr wirksam s<strong>in</strong>d. Insofern ist <strong>der</strong>ersten Migrantengeneration e<strong>in</strong>e gewisse Insularität <strong>in</strong> ihrentraditionellen Vere<strong>in</strong>en zuzugestehen. Dennoch istauch diesen Organisationen gegenüber e<strong>in</strong>e öffentlicheAnerkennungskultur notwendig. Gerade diese verfügennicht über das notwendige Know-how und die kommunalpolitischeLobby, um sich f<strong>in</strong>anzielle Mittel zu erschließen.8.9 Mobilitätspotenziale und Wan<strong>der</strong>ungsverhaltenälterer MigrantenIm Zeitraum von 1990 bis 2002 s<strong>in</strong>d ca. 4,6 MillionenPersonen netto nach Deutschland e<strong>in</strong>gewan<strong>der</strong>t. DiesesMigrationssaldo ergibt sich aus Millionen Zuzügen undFortzügen von Personen aus den verschiedenen E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ergruppen:Auslän<strong>der</strong> und Deutsche, Asylbewerber,Flüchtl<strong>in</strong>ge, Aussiedler und Familienangehörige, Bildungs-o<strong>der</strong> Arbeitsmigranten. „Migration ist nichts abgeschlossenes,son<strong>der</strong>n bedeutet laufende Anpassungsprozesse,<strong>in</strong>ter- und <strong>in</strong>tranational, <strong>in</strong>ter- und <strong>in</strong>traregional,<strong>in</strong>ter- und <strong>in</strong>tragenerativ“ (Hönekopp 2004: 4). Seit 1990hat sich z.B. verstärkt e<strong>in</strong>e neue <strong>in</strong>ternationale Arbeitskräftemobilitätentwickelt. Die befristete Beschäftigungvon Personen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e aus den mittel- und osteuropäischenTransformations- bzw. (heutigen) Beitrittslän<strong>der</strong>nals Werkvertrags-, Saison-, Grenz- o<strong>der</strong> „neue“Gastarbeitnehmer.Immigrationen werden immer von Remigrationen <strong>in</strong>sHerkunftsland begleitet. Temporäre Migrationen, Remigrationeno<strong>der</strong> Pendelbewegungen zwischen HerkunftsundAufnahmeland hat es immer gegeben. Zwischen1974 und 1994 s<strong>in</strong>d 12,3 Millionen Personen nachDeutschland zugezogen und 9,8 Millionen fortgezogen,was e<strong>in</strong> Migrationsaldo von 3,5 Millionen ergibt. Zwischen1955 und 1996 s<strong>in</strong>d ca. 23 Mio. Auslän<strong>der</strong> offiziell<strong>in</strong> die Bundesrepublik gekommen. Ca. 17 Mio. haben dasLand wie<strong>der</strong> verlassen. Insgesamt gesehen, ist die Gruppe<strong>der</strong>jenigen, die <strong>zur</strong>ückkehren, größer als die Gruppe <strong>der</strong>er,die für immer hier bleiben. In den letzten Jahrenwächst die Zahl <strong>der</strong> Fortzügler und übertrifft sogar die <strong>der</strong>Zuzügler. Wenn man die Zuzüge zu den Fortzügen <strong>in</strong> Relationsetzt, hat Deutschland die größte Fluktuationsrate<strong>in</strong> Europa. Die Fluktuationsrate bezeichnet den Anteil <strong>der</strong>Zu- und Fortzüge an <strong>der</strong> gesamten ausländischen Bevölkerung(Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend 2000).Insgesamt hat die Migrationsbereitschaft älterer Menschen<strong>in</strong> den <strong>zur</strong>ückliegenden Jahren zugenommen; dieVerlegung des Wohnsitzes nach <strong>der</strong> Pensionierung ist e<strong>in</strong>sich weltweit verbreitendes Phänomen. Zwar s<strong>in</strong>d diesmeist Nahwan<strong>der</strong>ungen, doch ist zu erwarten, dass auchFernwan<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> Zukunft erheblich an Bedeutung gew<strong>in</strong>nenwerden (Dietzel-Papakyriakou 1999). Hierzuwerden die durch häufige Reisen erworbenen Kompetenzensowie die Zunahme <strong>der</strong> materiellen Ausstattung alterMenschen beitragen. Günstige <strong>in</strong>stitutionelle Rahmenbed<strong>in</strong>gungen,wie die freie Wahl des Wohnortes für Rentner<strong>der</strong> Mitgliedstaaten <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> EU, die fortschreitendeHarmonisierung <strong>der</strong> rechtlichen Bestimmungen und dieErmöglichung des Transfers sozialer Leistungen, z.B. <strong>der</strong>Pflegeversicherung, werden diese Tendenz verstärken.Zudem können strukturelle Probleme, u.a. hohe Arbeitslosigkeit,hohe Wohndichte und schlechte Wohnumfeldbed<strong>in</strong>gungen,hohe Lebenshaltungskosten und ger<strong>in</strong>geErholungsmöglichkeiten, <strong>zur</strong> Abwan<strong>der</strong>ung alter Menschenführen.S<strong>in</strong>d die meisten Wan<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> e<strong>in</strong>heimischen älterenMenschen Nah- bzw. B<strong>in</strong>nenwan<strong>der</strong>ungen, so ist dies beiden älteren Arbeitsmigranten umgekehrt. Bei ihnen handeltes sich häufiger um Fernwan<strong>der</strong>ungen über nationaleGrenzen h<strong>in</strong>weg, <strong>in</strong> den allermeisten Fällen <strong>in</strong> die Herkunftsgesellschaft.Solche Fernwan<strong>der</strong>ungen kommen bei<strong>der</strong> e<strong>in</strong>heimischen Arbeiterbevölkerung vergleichbarersozialer <strong>Lage</strong> kaum, son<strong>der</strong>n – wenn überhaupt – <strong>in</strong> dene<strong>in</strong>heimischen Ober- bzw. Mittelschichten vor.Obwohl die Bedeutung <strong>der</strong> grenzüberschreitenden Mobilitätfür die älteren Migranten <strong>in</strong>zwischen erkannt und damitbegonnen wurde, auslän<strong>der</strong>rechtliche H<strong>in</strong><strong>der</strong>nisseaus<strong>zur</strong>äumen, nehmen ältere Migranten bei ihrer Rückwan<strong>der</strong>ungteilweise erhebliche Nachteile vor allem imBereich <strong>der</strong> sozialen Absicherung und gesundheitlichenVersorgung <strong>in</strong> Kauf. Dies gilt allerd<strong>in</strong>gs am wenigsten fürdie Bürger <strong>der</strong> Europäischen Union. Sie genießen seitAnfang <strong>der</strong> 1990er-Jahre bei Erfüllung bestimmter VoraussetzungenFreizügigkeit.8.9.1 Rückkehr <strong>in</strong>s HerkunftslandWie viele Migranten mit Erreichen des Rentenalters <strong>in</strong>ihre Heimatlän<strong>der</strong> <strong>zur</strong>ückkehren, ist aus den Statistikennicht zu ersehen. In e<strong>in</strong>er Familie können unterschiedlicheOrientierungen vorkommen, zwischen den Ehepartnernund auch den nachfolgenden <strong>Generation</strong>en. Letztgenanntes<strong>in</strong>d tendenziell meist verbleiborientiert, vor allemdann, wenn sie ke<strong>in</strong>e Kompetenzen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Herkunftssprachemehr haben. Nicht immer ist die E<strong>in</strong>bürgerung e<strong>in</strong>Nachweis e<strong>in</strong>er Verbleibabsicht. Bei den Drittstaatlern erlaubterst die E<strong>in</strong>bürgerung e<strong>in</strong>e ungeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Mobilitätzwischen Herkunfts- und Aufnahmeland. Die vorliegendenDaten weisen eher darauf h<strong>in</strong>, dass die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<strong>der</strong> Rückkehr mit zunehmendem Alter <strong>der</strong> Migrantenabnimmt. So waren nahezu 73 Prozent allerFortgezogenen im Jahr 2002 unter 40 Jahre alt. Unter den40- bis 65-Jährigen zogen im Jahr 7 Prozent aus <strong>der</strong> Bundesrepublikfort, unter den über 65-Jährigen nur ca. 2 Prozent(Bauer, Loeffelholz & Schmidt 2004: 15). Allerd<strong>in</strong>gsist <strong>der</strong> Anteil an den Fortgezogenen auf Grund <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>genabsoluten Zahl <strong>der</strong> Älteren nicht ausreichend aussagefähig.Insgesamt s<strong>in</strong>d die Statistiken über ältere Migranten mitvielen Fehlern behaftet und bedürfen e<strong>in</strong>er <strong>zur</strong>ückhaltendenInterpretation. So kehren die meisten Migranten, <strong>in</strong>sofernsie nicht pendeln, <strong>in</strong> ihre Herkunftslän<strong>der</strong> <strong>zur</strong>ück,ohne sich beim Auslän<strong>der</strong>amt abzumelden. Im Gegenteilversuchen die meisten weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> Deutschland gemeldetzu bleiben, um ihre Aufenthaltsrechte nicht zu verlieren.Wenn auch dieser Aspekt für Drittstaatler viel wichtigerist als für EU-Angehörige, so wird auch <strong>der</strong> WohnortDeutschland von EU-angehörigen Migranten möglichst
Drucksache 16/2190 – 252 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodenicht aufgegeben, damit <strong>der</strong> Zugang <strong>zur</strong> deutschen gesundheitlichenVersorgung, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel höhere Standardsals diejenige im Herkunftsland hat, nicht verlorengeht. Ebenso lassen sie auch ihre Rentenbezüge aufBankkonten <strong>in</strong> Deutschland überweisen. Es lassen sichalso vielfältige Indizien dafür f<strong>in</strong>den, dass die Rückkehr<strong>in</strong>s Herkunftsland untererfasst ist: die <strong>in</strong> ihre Herkunftslän<strong>der</strong><strong>zur</strong>ückgekehrten Migranten verbleiben <strong>in</strong> den Mel<strong>der</strong>egistern<strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>ämter und damit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Statistikdes Auslän<strong>der</strong>zentralregisters. Den wichtigsten H<strong>in</strong>weisliefert hierfür jedoch die Mortalitätsrate <strong>der</strong> Migranten.Sie ist um fast die Hälfte niedriger als die entsprechendenhöheren Altersgruppen <strong>der</strong> e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerung.Grob gerechnet würde dies darauf h<strong>in</strong>weisen, dass fastum 50 Prozent weniger ältere Migranten <strong>in</strong> Deutschlandleben als <strong>in</strong> <strong>der</strong> Statistik angegeben (Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2000). Das Problem<strong>der</strong> Untererfassung <strong>der</strong> im Ausland lebenden Älterenwird auch <strong>in</strong> Bezug auf die im Ausland lebendenDeutschen erwähnt. Auch für sie gilt, dass das Phänomen<strong>der</strong> Ruhestands-Migration nicht durch die offiziellenRentenversicherungsdaten erfasst wird (Cirkel et al.2004). Auch bei Deutschen ist die Motivation, den permanentenRuhesitz im Ausland offiziell anzumelden,nicht beson<strong>der</strong>s groß, „…was dazu führt, dass die Zahl<strong>der</strong> amtlich gemeldeten Residenten erheblich von <strong>der</strong> tatsächlichenabweicht. Im Jahr 2002 waren z.B. 66.000Deutsche offiziell <strong>in</strong> Spanien gemeldet, Schätzungen desGeneralkonsuls aus Malaga zufolge dürften es aber bis zue<strong>in</strong>er halben Million Deutsche mit e<strong>in</strong>em Altersdurchschnittüber 60 Jahren se<strong>in</strong>, die sich permanent o<strong>der</strong> denüberwiegenden Teil des Jahres <strong>in</strong> Spanien aufhalten“(Cirkel et al. 2004: 79).Das Thema „Deutsche Rentner im Ausland“ hat an Bedeutungund <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> „Ruhestands-Migration“ imLaufe <strong>der</strong> 1980er-Jahre beachtenswert zugenommen. DieNord-Süd-Wan<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Älteren <strong>in</strong> Europa ähnelndem längst bekannten Pendant <strong>in</strong> den USA, etwa <strong>in</strong> das„Rentnerparadies“ von Florida. Was die Migrationen <strong>der</strong>älteren Deutschen betrifft, s<strong>in</strong>d nur wenige Erkenntnissegesichert. Das Spektrum <strong>der</strong> Ziellän<strong>der</strong> weitet sich überdie bereits vielen bekannten Zielgebiete <strong>in</strong> Spanien aus.Alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> Südafrika verbr<strong>in</strong>gen schätzungsweise 100.000deutsche Rentner den W<strong>in</strong>ter (Cirkel et al. 2004: 76). Insgesamtliegen jedoch ke<strong>in</strong>e zuverlässigen Zahlen über dasAusmaß und die Effekte vor.E<strong>in</strong> endgültiger Verbleib <strong>in</strong> Deutschland wird für ältereMigranten dann wahrsche<strong>in</strong>licher, wenn ihre Mobilitätaus gesundheitlichen o<strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellen Gründen abnimmt.Bis dah<strong>in</strong> pendeln sie. Über dieses Verhaltensmuster wirdauch aus an<strong>der</strong>en Migrationslän<strong>der</strong>n berichtet. Zum e<strong>in</strong>enwird damit aus Sicht <strong>der</strong> Migrierenden die Frage von Verbleibo<strong>der</strong> Rückkehr <strong>in</strong>s Heimatland offen gelassen, zuman<strong>der</strong>en wird mit dem Pendeln pragmatisch auf die Ressourcendes Herkunfts- bzw. Gastlandes <strong>zur</strong>ückgegriffen.Nicht selten verfügen ältere Migranten im Herkunftslandüber bessere Wohnbed<strong>in</strong>gungen als <strong>in</strong> Deutschland unddie relativ niedrigen Renten vieler älterer Arbeitsmigrantenstellen beim Transfer <strong>in</strong>s Herkunftsland e<strong>in</strong> weit ansehnlicheresE<strong>in</strong>kommen dar als <strong>in</strong> Deutschland, zumaldie meisten Migranten <strong>in</strong> deutschen Ballungsräumen leben,<strong>in</strong> denen die Lebenshaltungskosten überdurchschnittlichhoch s<strong>in</strong>d.Für die deutschen Rentner gehört <strong>zur</strong> Hauptmotivationfür e<strong>in</strong>en Aufenthalt im Süden das Klima, die Landschaft,die Lebensart. Dies s<strong>in</strong>d auch bei nicht-deutschen Migrantendie am häufigsten genannten Gründe, wobei beiihnen darüber h<strong>in</strong>aus sozio-emotionale, vor allem kulturelleund familiäre B<strong>in</strong>dungen e<strong>in</strong>e sehr große Rolle spielen.Die meisten von ihnen haben Familienangehörige <strong>in</strong>den Herkunftslän<strong>der</strong>n. Noch am Anfang <strong>der</strong> 1990er-Jahregab etwa die Hälfte <strong>der</strong> älteren Arbeitsmigranten an, K<strong>in</strong><strong>der</strong>im Herkunftsland zu haben (Zentrum für Türkeistudien1993).8.9.2 Beziehungen zum HerkunftslandAus den Daten des SOEP können H<strong>in</strong>weise über die Verbundenheit<strong>der</strong> älteren Migranten zu ihren Herkunftslän<strong>der</strong>nwie auch über ihr Pendelverhalten gewonnen werden:So weisen die ersten aber auch die weiteren<strong>Generation</strong>en e<strong>in</strong>e enge B<strong>in</strong>dung zu ihrem Herkunftsland(bzw. dem Herkunftsland ihrer Familie) auf. Bei den 65-Jährigen und Älteren gaben 1999 74,4 Prozent an, dasssie e<strong>in</strong>e starke bzw. sehr starke Verbundenheit zu demLand besitzen, wo sie geboren wurden und ihre Jugendverbracht haben. Der Wert für die 18- bis 44-Jährigen wardeutlich ger<strong>in</strong>ger. Allerd<strong>in</strong>gs geben auch hier immerh<strong>in</strong>mehr als die Hälfte (54,2 Prozent) an, stark bis sehr starkmit ihrem Heimatland bzw. dem ihrer Eltern verbundenzu se<strong>in</strong>.Allerd<strong>in</strong>gs hat sich das Herkunftsland, sowohl h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> sozialen Beziehungen als auch <strong>der</strong> materiellenUmwelt während e<strong>in</strong>er <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel langen Zeit <strong>der</strong> Abwesenheitverän<strong>der</strong>t. So stellen Migranten fest, immermehr Zeit zu benötigen, sich dort wie<strong>der</strong> heimisch zu fühlen.Ihr Anteil wächst mit <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> Abwesenheit folglichan, was <strong>in</strong> den Befragungen zum Ausdruck kommt:So gaben 1998 noch 76,2 Prozent <strong>der</strong> befragten 65-jährigenund älteren Migranten an, sich bei Besuchen im Heimatlandsofort o<strong>der</strong> ziemlich schnell heimisch zu fühlen.2002 lag dieser Wert nur noch bei 55,1 Prozent (Özcan &Seifert 2004: 37).8.9.3 Pendelmigration/TransmigrationDieser durch Migration entstandene doppelte Bezug zumHerkunfts- und Aufnahmeland, auf den die meisten nichtmehr verzichten können, gehört zum Faktorenbündel, <strong>der</strong>Pendelmigration motiviert. Viele Migranten verschiebendie Lösung des Dilemmas: „Rückkehr o<strong>der</strong> Verbleib“ aufspäter und richten sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em provisorischen Zustanddes „sowohl als auch“ durch das Pendeln zwischen denbeiden Län<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> (Dietzel-Papakyriakou & Olbermann1996; Dietzel-Papakyriakou, Leotsakou & Raptaki2004). Dieses Arrangement wird auch aus den an<strong>der</strong>enImmigrationslän<strong>der</strong>n, z.B. aus Frankreich o<strong>der</strong> den Nie<strong>der</strong>landenbei den maghreb<strong>in</strong>ischen Migranten, berichtet.Pendeln ist e<strong>in</strong> Migrationsmodus vor allem <strong>der</strong> jungenAlten. Solches Verhalten verweist auf das neu <strong>in</strong> <strong>der</strong>
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 253 – Drucksache 16/2190Gesamtbesuchsdauer <strong>in</strong> den letzten zwei Jahren nach Alter, 1996/2002, <strong>in</strong> ProzentTabelle 4418 bis 44 Jahre 45 bis 65 Jahre 65 Jahre und älter2002Nie 10,3 6,6 2,6Bis 3 Wochen 30,5 21,2 15,01-3 Monate 56,8 55,0 34,74-6 Monate 1,3 9,9 19,0Länger 1,0 7,2 28,71996Nie 13,1 12,2 14,3Bis 3 Wochen 16,8 15,6 17,01-3 Monate 61,2 56,0 53,54-6 Monate 6,0 10,3 9,3Länger 2,9 5,9 5,9Quelle: Özcan & Seifert 2004: 36. Datenbasis: SOEP, Querschnitte 1996/2002.Migrationsforschung diskutierte Phänomen <strong>der</strong> Transmigration(Basch et al. 1994; Pries 1998; Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2000). ImGrunde zeigen Arbeitsmigranten hier Verhaltensweisen,die den Möglichkeiten e<strong>in</strong>er globalisierten Welt entsprechen.Ihre Mobilitätspotenziale tragen zu e<strong>in</strong>er aktivenGestaltung des Alters bei. Während <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong>deutschen Älteren solche Aktivitäts- bzw. Mobilitätsmustersich vornehmlich als Mittelschichtphänomen f<strong>in</strong>denlassen, pendeln <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Arbeitsmigrantenvornehmlich berentete Arbeiter mit häufig bescheidenenRentenbezügen. Das Pendeln verlangt hier erhebliche organisatorischeKompetenzen und wird häufig nur Dank<strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> realisiert und ist also <strong>in</strong>vielen Fällen als <strong>in</strong>tergenerationeller Austausch zu verstehen(Dietzel-Papakyriakou, Leotsakou & Raptaki2004).Insgesamt gesehen hat nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Anteil von ihnenseit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ung nach Deutschland das Herkunftslandnicht m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>mal besucht. Die Unterschiedezwischen den verschiedenen Altersgruppen s<strong>in</strong>d dabei ger<strong>in</strong>gfügig.Bezüglich <strong>der</strong> Gesamtbesuchsdauer während<strong>der</strong> vergangenen beiden Jahre seit dem Befragungszeitpunktzeigen sich jedoch erhebliche Differenzen.Ältere Auslän<strong>der</strong> ab 65 Jahren zeigen mit Abstand denhöchsten Anteil mit e<strong>in</strong>er Gesamtbesuchsdauer ab 4 Monatenund länger, wobei dieser Wert zwischen 1996 und2002 erheblich gestiegen ist. 2002 gaben <strong>in</strong> dieser Altersgruppe19 Prozent an, <strong>in</strong> den vergangenen beiden Jahrenzwischen vier bis sechs Monaten im Herkunftsland verbrachtzu haben, bei weiteren 28,7 Prozent betrug dieAufenthaltsdauer e<strong>in</strong>en noch längeren Zeitraum. DieseGruppen pendeln also, meist auch „<strong>zur</strong> Nutzung lokal gebundenerRessourcen“ (Krumme 2003). Solche lokalgebundenen Ressourcen, wie z.B. Immobilien wurdenhäufig während des Erwerbslebens <strong>in</strong> Deutschland als Ersparnisseund Altersvorsorge im Herkunftsland geschaffen.Migranten haben aber auch durch ihre Herkunftsfamilienhäufig materiellen Besitz über Erbschaften usw.und auch lokal gebundene soziale und emotionale Beziehungenzum Herkunftsort. So liegen im HerkunftskontextPotenziale, die durch Mobilität erschlossen werden können.Durch Pendelmigration verr<strong>in</strong>gert sich die Inanspruchnahmevon Versicherungsleistungen durch ältere Migranten,vor allem, wenn das Pendeln <strong>zur</strong> Lebenszufriedenheitund guter gesundheitlicher Verfassung beiträgt. An<strong>der</strong>erseitsgeht im Inland dadurch Kaufkraft verloren. Es fehlenallerd<strong>in</strong>gs Daten, die diese Frage volkswirtschaftlichbeantworten können. Bisher s<strong>in</strong>d auch kaum Schätzungenüber die <strong>in</strong> Zukunft anfallenden Betreuungskosten fürhilfebedürftige ältere und hochbetagte Migranten vorhanden.Dieser Bedarf wird, wenn man die Besetzung <strong>der</strong> Altersgruppenbetrachtet, erst <strong>in</strong> 10 bis 15 Jahren und vor allem<strong>in</strong> den urbanen Zentren entstehen.8.10 HandlungsgrundsätzeBei Migranten handelt es sich um e<strong>in</strong>e extrem heterogenePopulation. Sie wird für die Erfor<strong>der</strong>nisse <strong>der</strong> Analyseunter gewissen Merkmalen, die allen Gruppen geme<strong>in</strong>samo<strong>der</strong> analog s<strong>in</strong>d, subsumiert. Dieses Vorgehen istmit e<strong>in</strong>er Komplexitätsreduktion und Fragmentierung von
Drucksache 16/2190 – 254 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeZusammenhängen verbunden, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Realität vielschichtigerund umfassen<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d. Um Unterschiede deutlichzu machen wird polarisiert zwischen „deutscher“ und„Migranten-Bevölkerung“. Dies soll nicht darüber h<strong>in</strong>wegtäuschen, dass Migranten häufig mehr Geme<strong>in</strong>samkeitenmit Deutschen ähnlicher sozialer <strong>Lage</strong> haben, alsmit Angehörigen <strong>der</strong> eigenen Nationalität, die aber e<strong>in</strong>eran<strong>der</strong>en sozialen Schicht angehören. Dies verweist aufdie alte Frage <strong>in</strong> <strong>der</strong> Migrationsforschung, ob Kultur o<strong>der</strong>Schicht das Entscheidende sei. Fest zu halten bleibt, dassviele ältere Migranten sich soziostrukturell und auch kulturell<strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong>tegriert haben. Obschon ke<strong>in</strong>e gesichertenDaten über sie existieren, lassen sich <strong>in</strong>direktmittels verschiedener Indikatoren, wie Kenntnisse <strong>der</strong>deutschen Sprache, E<strong>in</strong>kommen und Immobilienbesitz,Verbleibabsichten etc. Schlüsse ziehen. Für sie treffenAnalysen und Schlussfolgerungen, die <strong>in</strong> den vorherigenKapiteln die „e<strong>in</strong>heimischen“ Älteren betreffen, auchweitgehend zu.Unabhängig von ihrer nationalen Herkunft und soziokulturellenZugehörigkeit ist jedoch allen Migranten die Migrationserfahrunggeme<strong>in</strong>sam. Es geht also darum, dieSpezifik, die sich aus <strong>der</strong> Migrantensituation ergibt, herauszuarbeiten.Diese Spezifik resultiert z.B. aus <strong>der</strong> Differenzzwischen Herkunfts- und Aufnahmekontext, dieals Mo<strong>der</strong>nisierungsdifferenz, o<strong>der</strong> als kulturelle Differenzverstanden werden kann. Auch hier wird e<strong>in</strong>e grundsätzlicheDebatte <strong>der</strong> Migrationsforschung berührt, etwadie zwischen universalistischen und kulturrelativistischenPositionen. Die Kommission ist <strong>der</strong> Me<strong>in</strong>ung, dass dieseDebatte an dieser Stelle nicht geführt werden kann. Insofernwurde <strong>in</strong> <strong>der</strong> vorherigen Analyse ke<strong>in</strong> detaillierterBezug auf die vielen konkreten Kulturen, aus denen dieMigranten kommen, genommen.Diese dem Thema Migration immanente Problematikwird auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Architektur des <strong>Bericht</strong>s deutlich. DennMigration wird sowohl <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigenen Kapitel bearbeitet,als auch als Querschnittsthema im Kontext <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnenthematischen Kapitel behandelt. So folgen hier lediglichdie Empfehlungen, die sich explizit auf die Spezifik<strong>der</strong> Migrantensituation beziehen. Die weiteren Empfehlungen,quasi universalistischen Charakters, die alle altenMenschen, ganz gleich ob e<strong>in</strong>heimische o<strong>der</strong> zugewan<strong>der</strong>te,<strong>in</strong> Deutschland betreffen, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den entsprechendenKapiteln des <strong>Bericht</strong>s zu f<strong>in</strong>den.8.11 Handlungsempfehlungen1 Die Datenlage verbessern. Die Kommission empfiehlt,das statistische Dokumentationsdefizit vor allembei den kle<strong>in</strong>eren Nationalitätengruppen und bei denFrauen zu beheben. Die Migrantenbevölkerung muss <strong>in</strong>die Sozialberichterstattung e<strong>in</strong>bezogen werden. Die Fokussierungauf e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige Nationalität (aus <strong>der</strong> Türkei)o<strong>der</strong> die Subsumierung aller Migranten unter das MerkmalAuslän<strong>der</strong> muss überwunden werden, denn sie verzerrtdie Wahrnehmung <strong>in</strong> wissenschaftlich unzulässigerWeise. Es s<strong>in</strong>d längsschnittbezogene Untersuchungennotwendig, die e<strong>in</strong>e verlaufsorientierte Betrachtungsweiseermöglichen.2 Potenziale älterer Migranten <strong>in</strong> Arbeitswelt undWirtschaft för<strong>der</strong>n:– Migranten stärker <strong>in</strong> Weiterbildungsmaßnahmen e<strong>in</strong>beziehen.Migranten wurden bisher überdurchschnittlichhäufig mit Hilfe des Frühverrentungs<strong>in</strong>strumentariumsaus dem Arbeitsprozess ausgeglie<strong>der</strong>t. Es gilt,ihre Motivation für e<strong>in</strong>en Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> das Arbeitslebenzu för<strong>der</strong>n. Daher sollten Migranten stärker<strong>in</strong> Weiterbildungsmaßnahmen e<strong>in</strong>bezogen werden,wobei diese dr<strong>in</strong>gend notwendig mit <strong>der</strong> Sprachför<strong>der</strong>ungkomb<strong>in</strong>iert werden sollten.– Nachfolgende Migrantengenerationen qualifizieren:Als beste Prävention vor Frühausglie<strong>der</strong>ung und Arbeitslosigkeitgilt die Qualifikation <strong>der</strong> nachfolgendenMigrantengenerationen. Auch hier gilt, dass die Basisfür e<strong>in</strong>e gute berufliche Qualifikation durch die Schulbildunggelegt wird.3 Potenziale <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bildung entwickeln:– Die Kommission betont, dass die Beherrschung <strong>der</strong>deutschen Sprache für alle Migranten <strong>in</strong> allen Altersgruppene<strong>in</strong> Schlüssel <strong>zur</strong> Integration <strong>in</strong> die deutscheGesellschaft ist. Sie ist die wichtigste Voraussetzungfür Bildung bzw. Weiterbildung und e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> wichtigstenBed<strong>in</strong>gungen für den beruflichen Erfolg <strong>der</strong> nachfolgendenMigrantengenerationen.– Bei älteren Migranten Deutschkenntnisse nach <strong>der</strong>Pensionierung erhalten: Bei den älteren Migranten, diebereits Deutsch sprechen, hat die Erhaltung ihrerSprachkenntnisse Priorität. Ihnen sollten adäquateSprachangebote gemacht werden. Bei alte<strong>in</strong>gesessenenalten Migranten, die im eigenethnischen Milieuleben, ist die Funktionalität <strong>der</strong> deutschen Sprache ger<strong>in</strong>g.Bil<strong>in</strong>gualismus <strong>der</strong> Migranten ist als e<strong>in</strong> kulturellesKapital für Deutschland zu för<strong>der</strong>n. Weil die Sprache<strong>der</strong> ersten Migrantengeneration meist nichtDeutsch, son<strong>der</strong>n ausschließlich die Sprache des Herkunftslandesist, ist diese auch die e<strong>in</strong>zige Sprache <strong>in</strong><strong>der</strong> die Kommunikation zwischen den <strong>Generation</strong>enstattf<strong>in</strong>den kann. Angesichts <strong>der</strong> Globalisierungsprozesseist die Zweisprachigkeit <strong>in</strong> den Migrantenfamiliene<strong>in</strong> kulturelles Kapital für das ganze Land.– Bildung und Ausbildung <strong>der</strong> zweiten und nachfolgendenMigrantengenerationen sollten zu den Prioritäten<strong>der</strong> Bildungspolitik gehören: Bei <strong>der</strong> vielseitigenSuche nach Gründen und Konzepten des Bildungserfolgessollten die Unterschiede zwischen den <strong>in</strong>Deutschland lebenden Nationalitätengruppen, von denene<strong>in</strong>ige äußerst erfolgreich s<strong>in</strong>d, berücksichtigtwerden. Analysen, die sämtliche Migrantengruppenunter dem Begriff „Auslän<strong>der</strong>“ e<strong>in</strong>erseits zusammenfassenund an<strong>der</strong>erseits Migrantenk<strong>in</strong><strong>der</strong> und Bildungsmisserfolgquasi als Synonyme benutzen, verstellenden Blick.4 Potenziale im Gesundheitsbereich bei älteren Migrantennutzen:– Spätere Beschäftigungsfähigkeit <strong>der</strong> Migranten för<strong>der</strong>n:Die Unterrepräsentanz von Migranten bei den
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 255 – Drucksache 16/2190Rehabilitationsverfahren muss überwunden werden,um die Chancen <strong>der</strong> späteren Beschäftigungsfähigkeitund des Erhalts von Arbeitsfähigkeit auch bei älterenMigranten zu nutzen.– Bei Pflegebedürftigkeit Hilfepotenziale <strong>in</strong> den Familienerhalten: Vor dem E<strong>in</strong>tritt <strong>der</strong> ersten Migrantengeneration<strong>in</strong> das hohe Alter ist es wichtig, Strategien fürdie Erhaltung von Hilfepotenzialen <strong>in</strong> den Familien zuentwickeln. Es ist dr<strong>in</strong>gend notwendig, die Wohnsituationaltengerecht für die häusliche Versorgung Pflegebedürftigeranzupassen.– Fehlversorgung vermeiden: Altenhilfe und Migrantenarbeitvernetzen: Bei <strong>der</strong> Implementation von Hilfsmaßnahmenmuss bei den Pflegenden <strong>der</strong> erstenMigrantengeneration auf die e<strong>in</strong>geschränkte Kommunikationsfähigkeit<strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Sprache, wie auchauf kulturelle Unterschiede <strong>in</strong> Gesundheits- undKrankheitsverhalten Rücksicht genommen werden.Um Fehlversorgung und Kosten für die Betroffenenund die Versorgungssysteme zu vermeiden, ist es notwendig,über die Vernetzungen zwischen den Institutionen<strong>der</strong> gesundheitlichen Versorgung und <strong>der</strong>Altenhilfe h<strong>in</strong>aus auch die Migrationsberatung und-sozialarbeit e<strong>in</strong>zubeziehen.– Initiativen für e<strong>in</strong>e „Kultursensible Altenhilfe“ nutzen:Inzwischen bilden <strong>in</strong> nicht ger<strong>in</strong>ger Zahl E<strong>in</strong>richtungen<strong>der</strong> Versorgung o<strong>der</strong> Träger von Fort- und WeiterbildungFachkräfte im Bereich <strong>der</strong> <strong>in</strong>terkulturellenPflege im H<strong>in</strong>blick auf „Zusatzkompetenzen“ für dieeigen<strong>in</strong>stitutionelle Versorgung fort. Initiativen, wiedas "Memorandum für e<strong>in</strong>e kultursensible Altenhilfe"und die Initiative "Charta für e<strong>in</strong>e kultursensible Altenpflege"müssen fortgeführt werden.– Ehrenamtliches Engagement <strong>der</strong> Migranten anerkennenund qualifizieren: Bei den alte<strong>in</strong>gesessenen Migrantengruppen,vor allem bei den aus <strong>der</strong> TürkeiStammenden, bilden sich immer mehr eigene Versorgungsstrukturenheraus, weil die Nachfragegröße dieserGruppe es ermöglicht. Insofern müssen die Chancen<strong>der</strong> Eigenorganisation gesundheitlich-sozialerBelange bei dieser Migrantengruppe, zu denen vor allemdie Pflege zählt, erkannt werden. Allerd<strong>in</strong>gs mussdie professionelle Pflege diese „ethnische Basisversorgung“<strong>in</strong>tegrieren und vernetzen. Alle an<strong>der</strong>en kle<strong>in</strong>erenNationalitätengruppen können, schlicht mangelsausreichen<strong>der</strong> Masse, ke<strong>in</strong>e eigene Infrastrukturen bilden,sodass sie auf die Regelversorgung angewiesens<strong>in</strong>d. Hier können Erfahrungen vorliegen<strong>der</strong> erfolgreicherdezentraler Modelle aufgegriffen werden, umVersorgungsbedürfnissen und -bedarfen kulturspezifischzu entsprechen. Dabei können, wo immer vorhanden,die ehrenamtlichen Potenziale <strong>der</strong> Migrantene<strong>in</strong>gewiesen und fortgebildet werden.5 Potenziale <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie erhalten:– Mit wohnökologischen und familienorientierten Maßnahmendie Solidarität <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Migrantenfamilienerhalten: Familien ausländischer Herkunft brauchenspezifische Formen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung und Beratung,auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Muttersprache. Aber auch dieRegeldienste <strong>der</strong> Wohlfahrtsorganisationen und <strong>der</strong>Kommunen müssen sich den Migrantenfamilien öffnen.Hierzu trägt bei, dass die Institutionen <strong>der</strong> Migrantenbetreuungund <strong>der</strong> öffentliche Dienst immerhäufiger qualifizierte Fachkräfte <strong>der</strong> zweiten Migrantengeneratione<strong>in</strong>stellen.– Die nachfolgenden Migrantengenerationen zu e<strong>in</strong>ergerechteren Verteilung <strong>der</strong> Pflegearbeit zwischen denGeschlechtern sozialisieren: Es ist notwendig, dienachfolgenden Migrantengenerationen dabei zu unterstützen,Synthesen vermittelnde Arrangements zwischenden gesellschaftlichen, familien- und kulturspezifischenAnfor<strong>der</strong>ungen zu f<strong>in</strong>den. Zunehmend wirddie Betreuung und Pflege <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong> an Bedeutunggew<strong>in</strong>nen. In den allermeisten Fällen übernehmendie Frauen diese Aufgaben. Hier sollte dasPr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>er gerechten Verteilung <strong>der</strong> Pflegearbeitzwischen den Geschlechtern vor allem durch die <strong>in</strong>stitutionelle,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e schulische Sozialisation <strong>der</strong>zweiten Migrantengeneration vermittelt werden. Wiebei den deutschen Familien geht es auch hier darum,die bisher ungenützten Potenziale <strong>der</strong> Männer, ob Ehemännero<strong>der</strong> Söhne o<strong>der</strong> Väter <strong>in</strong> die Pflegearbeit zu<strong>in</strong>tegrieren.6 Migrationsspezifische Potenziale erkennen undanerkennen:– Räumliche Mobilität älterer Migranten erhalten: ÄltereMigranten pendeln zwischen Herkunftsland undAufnahmeland. Dieses Arrangement räumlicher Mobilitätist <strong>in</strong> Deutschland noch zu wenig erkannt undanerkannt. Weitere Maßnahmen müssen getroffenwerden, damit den Rentnern ke<strong>in</strong>e sozialrechtlichenBenachteiligungen durch ihr Pendeln entstehen. Indiesem Zusammenhang ließe sich z.B. an die zukünftigeGewährung e<strong>in</strong>es umfassenden Krankenversicherungsschutzeso<strong>der</strong> Sicherung des Aufenthaltsstatusüber e<strong>in</strong>en sechsmonatigen Auslandsaufenthalt h<strong>in</strong>ausdenken.– Freiwilliges Engagement, soziale und politische Partizipationälterer Migranten för<strong>der</strong>n: Die sozialen Vernetzungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> ethnischen Kolonie können vieleFunktionen haben, z.B. im Bereich <strong>der</strong> laienmediz<strong>in</strong>ischenSysteme und <strong>der</strong> gegenseitigen Unterstützung<strong>der</strong> Frauen, was für die Altenpflege <strong>in</strong> den Familienvon Bedeutung ist. Diese Hilfepotenziale gilt es zuför<strong>der</strong>n und etwa die Beratung für pflegende Angehörigeo<strong>der</strong> den Aufbau von präventiven Beratungsnetzwerken<strong>in</strong> den Orten, die von den Migranten besuchtwerden, professionell zu organisieren. Generell könnenhier bessere Vernetzungen familialer und an<strong>der</strong>er<strong>in</strong>formeller Kreise mit den <strong>in</strong>stitutionellen Potenzialenerreicht und Kompetenzen erhöht werden. WichtigsteZielgruppe s<strong>in</strong>d hierbei die Frauen <strong>in</strong> allen Migrantengruppen.– Migrantenselbstorganisationen zivilgesellschaftlichweiterentwickeln: Die Kommission ist <strong>der</strong> Me<strong>in</strong>ung,
Drucksache 16/2190 – 256 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodedass die ethnischen Selbstorganisationen vor allem auf<strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Kommunen zivilgesellschaftlich entwickeltund durch geme<strong>in</strong>wesenorientierte Ansätze füre<strong>in</strong>e Verbesserung <strong>der</strong> lokalen Lebensverhältnisse <strong>in</strong>den Migrantenquartieren erschlossen werden müssen.Ältere Migranten, die sich im Rahmen dieser Selbstorganisationenengagieren, sollten öffentlich anerkanntwerden. Auch ihnen sollten Gratifikationen, wie sie imZusammenhang mit <strong>der</strong> deutschen Bevölkerung diskutiertwerden, bei <strong>der</strong> Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln,Besuch von Schwimmbä<strong>der</strong>n etc. erteiltwerden. Die Kommission empfiehlt ältereMigranten angemessen <strong>in</strong> den Seniorenvertretungenund Beiräten auf allen Ebenen zu <strong>in</strong>tegrieren.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 257 – Drucksache 16/21909 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen9.1 Zusammenfassung9.1.1 Auftrag <strong>der</strong> 5. AltenberichtskommissionDer Auftrag <strong>der</strong> Bundesregierung an die Altenberichtskommissionlautete, den 5. Altenbericht zum Thema „Potenzialedes Alters <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft – DerBeitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en“zu verfassen. Es wurden <strong>der</strong> Kommission u.a.folgende Fragen mit auf den Weg gegeben: „Welche Stärkenhaben ältere Menschen und wie s<strong>in</strong>d diese Stärken fürneue soziale Rollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er sich wandelnden Gesellschaftnutzbar zu machen? Welche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>dnötig, um die Bereitschaft <strong>der</strong> verschiedenen gesellschaftlichenAkteure <strong>zur</strong> Nutzung <strong>der</strong> Potenziale des Alters zuför<strong>der</strong>n? Welche neuen Anfor<strong>der</strong>ungen ergeben sich speziellim H<strong>in</strong>blick auf die Erhaltung <strong>der</strong> Solidarität zwischenden <strong>Generation</strong>en?“– Der <strong>Bericht</strong> ist diesen Fragen <strong>in</strong> neun Kapiteln nachgegangen,die sich mit folgenden Themen beschäftigen:– An welchen normativen Leitbil<strong>der</strong>n hat sich die Kommission<strong>in</strong> ihrer Arbeit orientiert?– Wie kann die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmerund Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen erhöht werden?– Welche Rolle können Betriebe und Organisationen alsInnovationsakteure <strong>zur</strong> Bewältigung des demografischenWandels übernehmen?– Wie kann Bildung zum Aufbau und Erhalt von Potenzialenälterer Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmersowie von Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Nacherwerbsphase beitragen?– Wie sieht <strong>der</strong> heutige und zukünftig erwartbare E<strong>in</strong>kommensspielraumälterer Menschen als Voraussetzungfür die Entfaltung von Potenzialen aus? Wiekann er bee<strong>in</strong>flusst werden?– Welche Chancen bietet die stärker zu entwickelnde„Seniorenwirtschaft“, die sich mit <strong>der</strong> Produktion vonGütern und Dienstleistungen für ältere Menschen befasst,um negative wirtschaftliche Konsequenzen desdemografischen Wandels zu kompensieren?– Wie kann bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen<strong>zur</strong> <strong>Generation</strong>ensolidarität und gesellschaftlichenMo<strong>der</strong>nisierung beitragen?– Welche Leistungen erbr<strong>in</strong>gen ältere Menschen <strong>in</strong> Familienund privaten Netzwerken und wie können diesedauerhaft erhalten werden?– Wie sehen die Potenziale älterer Migrant<strong>in</strong>nen undMigranten aus, wie können sie geför<strong>der</strong>t und besserfür die Selbsthilfe und gesellschaftliches Engagementgenutzt werden?Zwei Punkte ziehen sich als roter Faden durch den <strong>Bericht</strong>:Zum e<strong>in</strong>en macht <strong>der</strong> <strong>Bericht</strong> noch e<strong>in</strong>mal sehr deutlich,dass die Lebensphase Alter nicht mit Krankheit und Unproduktivitätgleichgesetzt werden kann, son<strong>der</strong>n Älterebereits heute e<strong>in</strong>en großen Beitrag zum gesellschaftlichenWohlstand erbr<strong>in</strong>gen. Gleichzeitig zeigt <strong>der</strong> <strong>Bericht</strong>, dassdie Potenziale älterer Menschen sozial sehr ungleich verteilts<strong>in</strong>d und dass es nicht das Alter und den alten Menschengibt.Es wird <strong>in</strong> den vorangehenden Kapiteln aber auch sichtbar,dass ältere Menschen unter verbesserten Rahmenbed<strong>in</strong>gungenihre Potenziale im größeren Umfang für dieGesellschaft e<strong>in</strong>setzen könnten. Diese müssen jedoch <strong>in</strong>e<strong>in</strong>en gesellschaftlichen Kulturwandel e<strong>in</strong>gebettet werden,<strong>der</strong> auch die Bereitschaft von Unternehmen, Organisationenund Verwaltungen umfasst, die vorhandenen PotenzialeÄlterer <strong>in</strong> stärkerem Maß ab<strong>zur</strong>ufen und zunutzen. Entsprechend des im Anfangskapitel entwickeltenLeitbildes des „mitverantwortlichen Alter(n)s“ und<strong>der</strong> „<strong>Generation</strong>ensolidarität“ ist dies e<strong>in</strong>es <strong>der</strong> vordr<strong>in</strong>glichstenZiele.Der zweite zentrale Gedanke, <strong>der</strong> die voranstehenden Kapitelleitet, bezieht sich auf die Herausfor<strong>der</strong>ungen, dieaus <strong>der</strong> Alterung und <strong>der</strong> Schrumpfung <strong>der</strong> deutschen wie<strong>der</strong> europäischen Bevölkerung für die Sicherung <strong>der</strong> Produktivitätund Innovationsfähigkeit <strong>der</strong> Gesellschaft erwachsen.Die gesellschaftliche Alterung und dieSchrumpfung <strong>der</strong> Bevölkerungszahl s<strong>in</strong>d voraussichtlichmit e<strong>in</strong>er Reihe von wirtschaftlichen Belastungen verbunden,<strong>der</strong>en Ausmaß und Struktur aber unter Ökonomenstrittig ist. Die Kommission hat <strong>in</strong> den vorgelegten Kapitelnihr Augenmerk darauf gerichtet, Maßnahmen zumErhalt <strong>der</strong> gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Innovationsfähigkeitund Produktivität zu entwickeln und diewichtigsten Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Ausgestaltungzu beschreiben.In <strong>der</strong> öffentlichen Diskussion wird die Alterung <strong>der</strong>Gesellschaft be<strong>in</strong>ahe ausschließlich mit f<strong>in</strong>anziellen Belastungen<strong>in</strong> Zusammenhang gebracht, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e imH<strong>in</strong>blick auf die Alterssicherungssysteme, das Gesundheitswesenund die Pflegeversicherung. Diese Elementes<strong>in</strong>d aber nur Teil e<strong>in</strong>es umfassenden Austauschsystemszwischen den <strong>Generation</strong>en, das als Ganzes <strong>in</strong> den Blickgenommen werden muss, wenn die Frage <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>ensolidaritätund des Beitrags älterer Menschen zum Zusammenhalt<strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en diskutiert wird.
Drucksache 16/2190 – 258 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeIm Folgenden werden zunächst anhand <strong>der</strong> Frage „Wasleisten ältere Menschen für die Gesellschaft?“ die <strong>in</strong> denvorangehenden Kapiteln identifizierten Potenziale ältererMenschen aufgezeigt, die sie bereits heute <strong>in</strong> hohemMaße für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschafte<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen (siehe Abschnitt 9.1.2). Anschließendwird herausgearbeitet, wo ungenutzte Potenziale ältererMenschen liegen, welche Barrieren ihre Nutzung blockierenund welche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für ihre Entwicklungför<strong>der</strong>lich se<strong>in</strong> können (siehe Abschnitt 9.1.3). Dieunter Abschnitt 9.1.4 zusammengestellte Diskussionmacht deutlich, warum die stärkere Nutzung <strong>der</strong> Potenzialealter Menschen unter den Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>er alterndenund schrumpfenden Gesellschaft dr<strong>in</strong>gend notwendig ist,um die Produktivität und die gesellschaftliche und wirtschaftlicheInnovationsfähigkeit <strong>in</strong> Deutschland zu erhalten.Die Kommission macht darauf aufmerksam, dass dabei<strong>der</strong> Fokus nicht nur auf <strong>der</strong> Lebensphase Alter liegendarf, son<strong>der</strong>n im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Lebenslaufperspektive alleLebensphasen <strong>in</strong> den Blick genommen werden müssen,wenn es darum geht, e<strong>in</strong>e gerechtere Verteilung <strong>der</strong> Lastendes demografischen Wandels auf die <strong>Generation</strong>en zuorganisieren. In diesem Zusammenhang wird abschließend(siehe Abschnitt 9.1.5) auf e<strong>in</strong>e Reihe von bedeutsamenDimensionen sozialer Ungleichheit e<strong>in</strong>gegangen, diesich über den Lebenslauf h<strong>in</strong>weg kumulierend auf dieAusbildung und Verwirklichung von Potenzialen im Alterund für das Alter auswirken. Am Ende des Kapitels (sieheAbschnitt 1.1) bef<strong>in</strong>det sich noch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>e Zusammenstellungaller von <strong>der</strong> Kommission erarbeiteten Handlungsempfehlungen.9.1.2 Was leisten ältere Menschenfür die Gesellschaft?ErwerbsarbeitÄltere Menschen verfügen auch im Erwerbsleben über e<strong>in</strong>enerheblichen Wissens- und Erfahrungsschatz und damitRessourcen, auf die e<strong>in</strong>e Gesellschaft des langen Lebensnicht länger verzichten kann. E<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong>Beschäftigungsquote <strong>der</strong> Älteren am Ende <strong>der</strong> Erwerbsphase(55 bis 64 Jahre) ist e<strong>in</strong> zentrales Ziel <strong>der</strong> 5. Altenberichtskommission.Ältere Menschen haben Fachwissen, sie br<strong>in</strong>gen beruflicheErfahrung mit und sie haben dank ihres Alters auchmehr Lebenserfahrung als die Jüngeren. Obwohl festgestelltwurde, dass diese Potenziale am besten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Verknüpfung<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Fähigkeiten von Jüngeren undÄlteren genutzt werden können, stellen altersgemischteTeams noch immer e<strong>in</strong>e Ausnahme dar. Als wichtigstesErgebnis e<strong>in</strong>er großen Studie mit Personalverantwortlichenkonnte festgehalten werden, dass sich das globaleUrteil „Ältere s<strong>in</strong>d nicht weniger, son<strong>der</strong>n an<strong>der</strong>s leistungsfähigals Jüngere!“ deutlich wi<strong>der</strong>spiegelt: Erfahrungswissen,Arbeitsmoral/-diszipl<strong>in</strong>, Qualitätsbewusstse<strong>in</strong>und Loyalität gelten hier eher als Stärken Älterer,während körperliche Belastbarkeit eher bei Jüngeren gesehenwird.Dennoch zeigen die Ergebnisse des 5. Altenberichts, dasssich die Vorstellungen von e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>geschränkten E<strong>in</strong>satzfähigkeitÄlterer im Erwerbsleben und Bil<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er nachlassendenTatkraft, Innovationsfähigkeit und KreativitätÄlterer im öffentlichen Bewusstse<strong>in</strong> entgegen wissenschaftlichenErkenntnissen hartnäckig halten konnten.BildungZu den positiven Entwicklungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersphase, diegleichsam die Basis für die <strong>in</strong>dividuellen wie gesellschaftlichen„Potenziale des Alters“ bilden, zählen das imVergleich mit früheren Altengenerationen durchschnittlichhöhere Bildungs- und Qualifikationsniveau, e<strong>in</strong> breiteresSpektrum von Interessen und Kompetenzen sowiee<strong>in</strong> umfangreiches Erfahrungswissen. E<strong>in</strong>e Abnahme <strong>der</strong>Lernkapazität kann häufig kompensiert werden, da imLebenslauf entwickelte Wissenssysteme sowie Handlungs-und Organisationsstrategien vielfach E<strong>in</strong>bußen <strong>in</strong>Funktionen u.a. <strong>der</strong> Verarbeitungsgeschw<strong>in</strong>digkeit, <strong>der</strong>Umstellungsfähigkeit, <strong>der</strong> Psychomotorik und des Arbeitsgedächtnissesausgleichen und wissens- undhandlungsbasierte Erfahrungen vor allem bei komplexenTätigkeiten zu e<strong>in</strong>em Leistungszuwachs führen können.In <strong>der</strong> Teilnahme an Bildungsangeboten spiegeln sichauch die <strong>in</strong> früheren Lebensphasen erworbenen Bildungsgewohnheitenwi<strong>der</strong>. Die Grundlagen lebenslangen Lernenswerden bereits <strong>in</strong> den frühen Bildungsphasen geschaffen.Die Befunde des 5. Altenberichts verweisendarauf, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Bildung und beruflichenWeiterbildung erhebliche soziale Ungleichheiten <strong>in</strong> Bezugauf die Teilnahme existieren, die vor allem nach Bildungsgrad,Qualifikation, Erwerbstätigkeit, beruflichemStatus, Geschlecht, Nationalität und Alter differieren.Wird bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> betrieblichen Weiterbildunge<strong>in</strong> sehr breiter Bildungsbegriff zugrunde gelegt, <strong>der</strong> formalesund nicht-formales Lernen <strong>in</strong>tegriert, so zeigt sich,dass dem Alter ke<strong>in</strong> eigenständiger Erklärungswert bei<strong>der</strong> Erklärung <strong>der</strong> Bildungsteilnahme zukommt. BestimmteBeschäftigtengruppen, z.B. hoch qualifizierteBeschäftigte, zeigen am Ende des Erwerbslebens sogarsteigende Teilnahmequoten.E<strong>in</strong>kommenslage im Alter und künftige Entwicklungsowie Chancen <strong>der</strong> SeniorenwirtschaftDie ökonomischen Potenziale des Alters und e<strong>in</strong>er alterndenGesellschaft werden <strong>in</strong> zwei aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong> bezogenenKapiteln des 5. Altenberichts thematisiert. Das Kapitel<strong>zur</strong> E<strong>in</strong>kommenslage im Alter analysiert die Verteilung<strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellen Mittel, die älteren Menschen <strong>zur</strong> Verfügungstehen, und die voraussichtliche zukünftige Entwicklung<strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Alterse<strong>in</strong>kommen sowie <strong>der</strong>enVerteilung <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Gruppe älterer Menschen.Im Kapitel „Chancen <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft“ wird, ausgehendvon <strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Analyse <strong>der</strong> WirtschaftskraftÄlterer, das Marktsegment <strong>der</strong> so genannten „Seniorenwirtschaft“untersucht. In diesem Marktsegment, dasauf die spezifischen Bedürfnisse älterer Menschen an Warenund Dienstleistungen zielt, liegen Potenziale, die beigezielter Entwicklung mögliche negative wirtschaftlicheKonsequenzen <strong>der</strong> Alterung und Schrumpfung <strong>der</strong> Bevölkerungzum<strong>in</strong>dest teilweise kompensieren könnten.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 259 – Drucksache 16/2190Die durchschnittliche E<strong>in</strong>kommenssituation älterer Menschenist gut und ihre Vermögenssituation entspricht imDurchschnitt <strong>der</strong>jenigen <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung. Die Armutsquoten<strong>der</strong> älteren Menschen liegen unter denen <strong>der</strong>Gesamtbevölkerung. Dar<strong>in</strong> spiegelt sich u.a. die Erfolgsgeschichte<strong>der</strong> deutschen Alterssicherungspolitik seit <strong>der</strong>E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> „dynamischen Rente“ im Jahr 1957 wi<strong>der</strong>.Die Kommission wendet sich <strong>in</strong> diesem Zusammenhangdeutlich dagegen, dass diese günstigen Durchschnittswerte<strong>in</strong> <strong>der</strong> öffentlichen Diskussion als Argument e<strong>in</strong>gesetztwerden, um E<strong>in</strong>schnitte bei den Alterse<strong>in</strong>kommenzu rechtfertigen. Die empirischen Erhebungen belegen allerd<strong>in</strong>gse<strong>in</strong>e große Spreizung bei <strong>der</strong> Verteilung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen<strong>in</strong> <strong>der</strong> älteren Bevölkerung und e<strong>in</strong>e noch größereSpreizung <strong>der</strong> Vermögensverteilung. Ferner istabzusehen, dass sich <strong>in</strong>folge <strong>der</strong> Sozialreformen nach <strong>der</strong>deutschen E<strong>in</strong>heit die E<strong>in</strong>kommensverteilung im Altervermutlich deutlich ungleicher als bisher gestalten wirdund die heute mittleren Altersgruppen zukünftig stärkerauf bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen <strong>zur</strong>ückgreifen müssen,um Altersarmut zu vermeiden.Der Abschnitt „Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung und die gesamtwirtschaftlicheProduktivitäts- und E<strong>in</strong>kommensentwicklung“im Kapitel „E<strong>in</strong>kommenslage im Alter undkünftige Entwicklung“ setzt sich kritisch mit Argumentenause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>, die große wirtschaftliche Folgeprobleme <strong>der</strong>Alterung und <strong>der</strong> Schrumpfung <strong>der</strong> Bevölkerungszahl unterstellen.Auch die 5. Altenberichtskommission sieht damitverbundene Probleme. In den üblichen Szenarien <strong>zur</strong>Quantifizierung <strong>der</strong> ökonomischen Belastungen werdenaber häufig entlastende Aspekte außer Acht gelassen. Diedurchschnittlich gute materielle Situation älterer Menschenweist auch darauf h<strong>in</strong>, dass Senioren bereits heutedurch ihren Konsum <strong>in</strong> beträchtlichem Umfang <strong>zur</strong> wirtschaftlichenEntwicklung beitragen und auf Grund <strong>der</strong>Entwicklung ihrer Kaufkraft <strong>in</strong> Zukunft wahrsche<strong>in</strong>lichnoch mehr für lebensqualitätssteigernde altersspezifischeWaren und Dienstleistungen ausgeben werden. Die Kommissionbegreift die „Seniorenwirtschaft“ nicht nur alsElement <strong>zur</strong> Steigerung <strong>der</strong> Lebensqualität älterer Menschendurch för<strong>der</strong>nde und stützende Dienste und Angeboteauf privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsmärkten,son<strong>der</strong>n auch als e<strong>in</strong>en neuen Impulsgeber fürwirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung. Umdiese Aufgabe erfüllen zu können, bedarf die Seniorenwirtschaftzum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> <strong>der</strong> Anfangsphase noch öffentlicherUnterstützung.Familie und private NetzwerkeInnerhalb von Partnerschaften, von Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen,von Großeltern-Enkel-Beziehungen sowie <strong>in</strong>weiteren privaten Netzwerken werden vielfältige Potenzialeälterer Menschen wirksam. Das betrifft beispielsweisedie Hilfeleistungen im Bereich <strong>der</strong> <strong>in</strong>strumentellenund emotionalen Unterstützung, <strong>der</strong> f<strong>in</strong>anziellen Transferssowie <strong>der</strong> Übernahme von Verantwortung bei <strong>der</strong> Betreuunghilfe- und pflegebedürftiger Menschen. Der <strong>Bericht</strong>hat darüber h<strong>in</strong>aus deutlich gemacht, dass Potenzialedes Alters <strong>in</strong> Partnerschaften und <strong>in</strong> den Beziehungenzwischen älter werdenden Eltern und erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>nbereits zu e<strong>in</strong>em großen Teil ausgeschöpft s<strong>in</strong>d.Die Verantwortungsübernahme für die Betreuung hilfeundpflegebedürftiger Eltern kann aber auch zu hohen Belastungenund Konflikten führen, beispielsweise wennErwerbstätigkeit und Pflege zu vere<strong>in</strong>baren s<strong>in</strong>d o<strong>der</strong> dieunterstützenden K<strong>in</strong><strong>der</strong> selbst schon an <strong>der</strong> Grenze zumhöheren Alter stehen.Engagement und Partizipation älterer MenschenDas Engagement und die politische Partizipation ihrerBürger ist für den Zusammenhalt <strong>der</strong> Gesellschaft unverzichtbar.Es geht dabei nicht nur um die Wertschöpfung,die im Rahmen von unbezahlten Tätigkeiten erfolgt,son<strong>der</strong>n auch um das Engagement <strong>der</strong> Bürger aller Altersstufenfür die Belebung <strong>der</strong> Demokratie und die Mo<strong>der</strong>nisierung<strong>der</strong> Gesellschaft. Die im 5. Altenbericht ausgewertetenUntersuchungen zeigen deutlich, dass ältereMenschen <strong>in</strong> erheblichem Umfang unentgeltlich freiwillige,geme<strong>in</strong>wohlorientierte Tätigkeiten übernehmen. Beiden so genannten „jungen Alten“ (50 bis 65-Jährige) war<strong>der</strong> Anstieg des Engagements <strong>in</strong> den letzten Jahren imVergleich aller Altersgruppen am höchsten. Die Engagementquoten<strong>der</strong> älteren Menschen – ausgenommen <strong>der</strong>Hochaltrigen – nähern sich <strong>in</strong>zwischen denen <strong>der</strong> jüngerenAltersgruppen weitgehend an und auch <strong>der</strong> von älterenMenschen für ihr Engagement erbrachte Zeitaufwandist beträchtlich. Ältere Menschen engagieren sich gegenwärtigvor allem <strong>in</strong> den traditionellen Ehrenamtsfel<strong>der</strong>nSport, Kirche und soziale Organisationen. Es gibt danebenaber auch e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Gruppe von „Pionieren“, diesich mit zentralen Zukunftsthemen wie „Wohnen im Alter“,„<strong>in</strong>tergenerationelles Engagement“, „Umwelt- undDenkmalschutz“ o<strong>der</strong> „Ältere als Akteure des Verbraucherschutzesfür ältere Menschen“ neue zukunftsweisendeEngagementformen erproben und entwickeln, die<strong>in</strong>novative Antworten auf die Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Zeitund <strong>der</strong> demografischen Alterung geben.Migration und Potenziale des Alters<strong>in</strong> Wirtschaft und GesellschaftSelbsthilfepotenziale und soziales Engagement von Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten wurden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeitlange Zeit nicht wahrgenommen. Ihr Engagement konzentriertsich auf Familien- und Nachbarschaftshilfe sowieauf meist eigenethnische Vere<strong>in</strong>saktivitäten. Die hohenSolidaritätspotenziale von Familien ausländischerHerkunft und das bürgerschaftliche Engagement <strong>in</strong> demokratischenSelbstorganisationen stellen wichtige sozialeRessourcen für die Integration dar. Der 5. Altenberichthat aber auch gezeigt, dass <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die un<strong>zur</strong>eichendenKenntnisse <strong>der</strong> deutschen Sprache, die Zugehörigkeitzu bildungsfernen Schichten und gesundheitliche E<strong>in</strong>schränkungendie Partzipation vieler älterer Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten an <strong>der</strong> Zivilgesellschaft e<strong>in</strong>schränken.
Drucksache 16/2190 – 260 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode9.1.3 Was könnten ältere Menschenfür die Gesellschaft leisten?Die Analysen zu den e<strong>in</strong>zelnen Themenbereichen dieses<strong>Bericht</strong>s haben gezeigt, dass über die bereits genutztenPotenziale des Alters h<strong>in</strong>aus noch weitere Potenziale vorhandens<strong>in</strong>d, die <strong>der</strong>zeit nicht abgerufen werden bzw.,dass teilweise erhebliche Barrieren für <strong>der</strong>en Nutzung bestehen.Häufig könnten auf Seiten <strong>der</strong> älteren Menschenauch weitere Potenziale entwickelt werden, wenn geeigneteför<strong>der</strong>nde Rahmenbed<strong>in</strong>gungen geschaffen würden.E<strong>in</strong>ige Schlaglichter auf Entwicklungsfel<strong>der</strong>, die im <strong>Bericht</strong>ausgeführt wurden, sollen hier genannt werden.ErwerbsarbeitDeutschland hat zusammen mit e<strong>in</strong>igen an<strong>der</strong>en kont<strong>in</strong>entaleuropäischenLän<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> niedrigsten Beschäftigungsquoten<strong>der</strong> 55- bis 64-Jährigen, was u.a.Folge <strong>der</strong> bisher konsensual getragenen Vorruhestandspraxis,e<strong>in</strong>er stark ausgeprägten Frühverrentungsbereitschaft,<strong>der</strong> nach wie vor hohen Zahl gesundheitsbed<strong>in</strong>gterFrühverrentungen wie auch e<strong>in</strong>er un<strong>zur</strong>eichenden Gleichstellungvon Frauen, e<strong>in</strong>er ungenügenden Weiterqualifizierungund nicht zuletzt e<strong>in</strong>er gravierenden betrieblichenAltersdiskrim<strong>in</strong>ierung ist. E<strong>in</strong>e solch ger<strong>in</strong>ge Nutzungdes Erwerbspersonenpotenzials Älterer ist jedoch angesichts<strong>der</strong> demografischen Entwicklung auf Dauer nichtvertretbar. Nur durch e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> ErwerbsbeteiligungÄlterer können künftig die demografisch bed<strong>in</strong>gtenLücken auf dem Arbeitsmarkt geschlossen und wirtschaftlicheProsperität, Beschäftigung und gesellschaftlicheEntwicklung geför<strong>der</strong>t sowie gleichzeitig die F<strong>in</strong>anzierung<strong>der</strong> sozialen Sicherungssysteme sichergestelltwerden.Um dieses Potenzial Älterer zu nutzen, bedarf es auf alleBeteiligten ausgerichteter <strong>in</strong>tegrierter Strategien von Betriebenund Tarifparteien sowie e<strong>in</strong>er staatlichen För<strong>der</strong>ungzukunftsorientierter Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesundheits-,Bildungs-, Familien- und Arbeitsmarktpolitiksowie an<strong>der</strong>er Bereiche <strong>der</strong> sozialen Sicherung, um e<strong>in</strong>eVerlängerung <strong>der</strong> Lebensarbeitszeit zu ermöglichen – immerunter E<strong>in</strong>bezug <strong>der</strong> Betroffenen selbst als „Experten<strong>in</strong> eigener Sache“.Nachdem die verschiedenen Anreize <strong>zur</strong> Frühverrentungweitestgehend abgebaut s<strong>in</strong>d, geht es nun darum, die Beschäftigungsfähigkeitim Alter und die Motivation, längerzu arbeiten, zu erhöhen. Zentrale Akteure, um die Beschäftigungsfähigkeitim Alter zu erhalten und zu för<strong>der</strong>n,s<strong>in</strong>d aus Sicht <strong>der</strong> Kommission die Betriebe. Zu denBestandteilen e<strong>in</strong>er „demografiesensiblen“ Beschäftigungspolitikgehören u.a. e<strong>in</strong>e präventive Gesundheitsför<strong>der</strong>ungspolitikund lebenslange berufliche Weiterqualifizierung<strong>in</strong> lernför<strong>der</strong>lichen Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen.Arbeitsplätze, Arbeitsorganisation und Arbeitszeit müssenzukünftig auf das verän<strong>der</strong>te, stärker durch LebensundBerufserfahrung geprägte Leistungsvermögen älterwerden<strong>der</strong> Belegschaften flexibel ausgerichtet werden.Gleichzeitig for<strong>der</strong>t die 5. Altenberichtskommission dazuauf, viel stärker als bisher auch die bislang noch unausgeschöpftenPotenziale, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von Frauen, Migrantenund auch beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Menschen, auf dem Arbeitsmarktzu mobilisieren und zu nutzen. Betriebe undVerwaltungen müssen sich zukünftig sowohl auf die beson<strong>der</strong>enBeschäftigungsvoraussetzungen und -bedürfnisseh<strong>in</strong>sichtlich des Alters als auch des Geschlechts und<strong>der</strong> kultureller Herkunft und damit auf <strong>in</strong>sgesamt zunehmendheterogene Belegschaften e<strong>in</strong>stellen. Die 5. Altenberichtskommissionweist hier mit Nachdruck darauf h<strong>in</strong>,dass sich h<strong>in</strong>ter e<strong>in</strong>er durchschnittlichen Beschäftigungsquoteviele unterschiedliche Lebens- und Erwerbsverläufeverbergen: Zu den „alten“ sozialen Ungleichheitenauf Grund des Geschlechts, körperlicher Arbeitsbelastungenund restriktiven Anfor<strong>der</strong>ungen, s<strong>in</strong>d neue Dimensionensozialer Ungleichheiten h<strong>in</strong>zugetreten, nämlich dienach Qualifikationsniveau, psychischen Belastungen undNationalität. Wer besser qualifiziert und gesund ist, hatnicht nur größere Chancen e<strong>in</strong>e Stelle zu f<strong>in</strong>den, son<strong>der</strong>ndann auch nach dem 55. Lebensjahr beschäftigt zu bleiben.Gefor<strong>der</strong>t s<strong>in</strong>d deshalb differenzierte Lösungen, umPotenziale aller Alters- und Erwerbstätigengruppen zunutzen.Notwendig ist es zudem, neben <strong>der</strong> Beschäftigungsbereitschaft<strong>der</strong> Betriebe auch die <strong>der</strong> Betroffenen selbst zu erhöhenund ihre Eigenverantwortung (z.B. für gesundheitsför<strong>der</strong>lichesVerhalten o<strong>der</strong> lebenslanges Lernen) zuför<strong>der</strong>n. Schließlich kann e<strong>in</strong>e längere Erwerbsphaseauch e<strong>in</strong> wichtiges Element e<strong>in</strong>er erfüllten Lebensgestaltungfür die Betroffenen selbst se<strong>in</strong>.BildungDie Bedeutung <strong>der</strong> Bildung für die Entwicklung des Individuumsbeschränkt sich nicht nur auf die Zeit <strong>der</strong>Berufstätigkeit und den beruflichen Bereich. Neben berufsbezogenenZielsetzungen wie Sicherung von wirtschaftlicherEntwicklung und Innovationsfähigkeit o<strong>der</strong>Erhaltung und För<strong>der</strong>ung von Beschäftigungsfähigkeits<strong>in</strong>d unter an<strong>der</strong>em Selbstständigkeit, Selbstbestimmungund soziale Teilhabe als bedeutende Zielsetzungen vonErwachsenen- und Altenbildung zu nennen. Darüber h<strong>in</strong>ausist die Unterstützung des Individuums bei <strong>der</strong> Verwirklichungo<strong>der</strong> Vervollkommnung unterschiedlichsterFreizeitaktivitäten und Freizeit<strong>in</strong>teressen von beson<strong>der</strong>erBedeutung. Bildung und lebenslanges Lernen wirken lebenslangprotektiv für die Gesundheit und Leistungsfähigkeitim Alter, wenn sie <strong>zur</strong> Ausbildung e<strong>in</strong>es gesundenLebensstils beitragen. Entsprechend können Bildungsangebote,<strong>in</strong> denen jüngere Altersgruppen für die Abhängigkeitdes Gesundheitszustandes im Alter von gesundheitsbezogenenGewohnheiten und Verhaltensweisen <strong>in</strong>früheren Lebensabschnitten – und damit für die Gestaltbarkeitvon Alternsprozessen – sensibilisiert werden, alse<strong>in</strong> wichtiger Beitrag <strong>zur</strong> Prävention für das Alter gewertetwerden. Neben e<strong>in</strong>er Prävention für das Alter hat aberauch e<strong>in</strong>e Prävention im Alter noch erhebliche Auswirkungenauf die Entwicklung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit.Aus diesem Grunde sollten auch Bildungsangebote,die sich primär an ältere Menschen wenden, alszentraler Bestandteil e<strong>in</strong>er Strategie lebenslangen Ler-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 261 – Drucksache 16/2190nens <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lebensqualität angesehen werden.E<strong>in</strong>e effektive Nutzung von Potenzialen älterer Menschen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs- und Nacherwerbsphase ist ohne e<strong>in</strong> effizientesBildungssystem nicht möglich. Die <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>eunter An- und Ungelernten ger<strong>in</strong>ge Weiterbildungsbeteiligungund das damit e<strong>in</strong>hergehende Risiko reduzierterBeschäftigungsfähigkeit verweisen auf die Notwendigkeitmöglichst frühzeitig e<strong>in</strong>setzen<strong>der</strong>, präventiver Bildungsmaßnahmen.Die vorliegenden Befunde <strong>zur</strong> Nutzungvon Bildungsangeboten machen deutlich, dassPersonen mit höherer Schul- und Berufsausbildung überproportionalan Bildungsangeboten partizipieren, sodassBildungsungleichheiten im Alter noch verstärkt werden.Im Vergleich zu an<strong>der</strong>en europäischen Staaten, die dasvorhandene Erwerbspersonenpotenzial deutlich besserausschöpfen, <strong>in</strong>vestiert Deutschland eher wenig <strong>in</strong> Weiter-und Erwachsenenbildung. Daher empfiehlt die Kommissionnachdrücklich, lebenslanges Lernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbs-und Nacherwerbsphase <strong>in</strong> stärkerem Maße alsbisher zu för<strong>der</strong>n.E<strong>in</strong>kommenslage im Alter und künftige Entwicklungund Chancen <strong>der</strong> SeniorenwirtschaftAuch <strong>in</strong> Zukunft sollte gesichert werden, dass ältere Menschennicht zu den wirtschaftlichen Problemgruppen zählen.Daher vertritt die Kommission die Me<strong>in</strong>ung, dassdurch die weitere Entwicklung <strong>der</strong> Alterssicherung e<strong>in</strong>estärkere Spreizung <strong>der</strong> Alterse<strong>in</strong>kommen und e<strong>in</strong> langfristigfür die nachwachsenden Altengenerationen drohen<strong>der</strong>Wie<strong>der</strong>anstieg <strong>der</strong> Altersarmut verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t werdenmuss. Dazu wird im Kapitel „E<strong>in</strong>kommenslage im Alter“vorgeschlagen, dass– die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) bei längererVersicherungsdauer weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Leistungsniveaubeibehalten soll, das deutlich über die steuerf<strong>in</strong>anziertebedarfs- o<strong>der</strong> bedürftigkeitsgeprüfte, armutsvermeidendeM<strong>in</strong>destsicherung h<strong>in</strong>ausreicht;– für die GRV e<strong>in</strong>e enge Beitrags-Leistungs-Beziehungerhalten bleiben sollte, wobei bestimmte Leistungen,z.B. die H<strong>in</strong>terbliebenenversorgung, organisatorischauszuglie<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d;– sich e<strong>in</strong>e verantwortungsvolle Alterssicherungspolitikaber nicht alle<strong>in</strong> auf die Alterssicherungssysteme (<strong>der</strong>enF<strong>in</strong>anzierung, Leistungen und Besteuerung) beschränkendarf, son<strong>der</strong>n auch weitere für die (reale)E<strong>in</strong>kommenslage im Alter wichtige – und politischgestaltbare – Entwicklungen zu berücksichtigen hat.Weitere Faktoren, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Höhe und Strukturvon Sozialversicherungsleistungen bzw. Selbst- undZuzahlungsregelungen im Falle von Krankheit undPflegebedürftigkeit, die aus den laufenden Alterse<strong>in</strong>kommenzu f<strong>in</strong>anzieren s<strong>in</strong>d, müssen bei e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schätzung<strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensentwicklung im Alter berücksichtigtwerden.Um die Potenziale <strong>der</strong> Seniorenwirtschaft für die Abfe<strong>der</strong>ung<strong>der</strong> wirtschaftlichen Folgen des demografischenWandels, für die Schaffung von Arbeitsplätzen, aber auchfür die Erhöhung <strong>der</strong> Lebensqualität älterer Menschenvoll zu entfalten, s<strong>in</strong>d unterstützende Rahmenbed<strong>in</strong>gungenund Maßnahmen <strong>zur</strong> Stärkung dieses Wirtschaftssegmentesnotwendig. Dazu gehören u.a. e<strong>in</strong>e Sensibilisierungaller Marktakteure für die Chancen e<strong>in</strong>er auf diespezifischen Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtetenWirtschaft und die Nutzung <strong>der</strong> Kompetenzen Älterer bei<strong>der</strong> Entwicklung und Vermarktung <strong>der</strong> an Senioren gerichtetenProdukte und Dienstleistungen. Hierzu gehörenaber auch die Berücksichtigung <strong>der</strong> Konsumbedürfnissesozial schwacher älterer Menschen und die Entwicklungneuer Formen des Verbraucherschutzes für ältere Menschensowie <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für die beson<strong>der</strong>s vulnerablenGruppen unter ihnen, wie etwa pflegebedürftige Menschen.Familie und private NetzwerkeAngesichts des Umfangs an Unterstützungsleistungen,die gegenwärtig bereits geleistet werden, geht es kurzfristigvor allem um das „Bewahren des Vorhandenen“.Demzufolge sollten die Potenziale des Alters <strong>in</strong>nerhalbvon Familien und privaten Netzwerken durch geeigneteRahmenbed<strong>in</strong>gungen und Maßnahmen erhalten und stabilisiertwerden. E<strong>in</strong>en Beitrag dazu könnte beispielsweise<strong>der</strong> Ausbau von Beratungs-, Qualifizierungs- und Unterstützungsangebotenfür pflegende Angehörige, Nachbarnund an<strong>der</strong>e <strong>in</strong>formelle Helfer leisten.Im H<strong>in</strong>blick auf den demografischen und gesellschaftlichenWandel s<strong>in</strong>d neue Potenziale durch das „Ausschöpfendes Möglichen, noch nicht Realisierten“ zu erschließen.Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> zu erwartendensteigenden Zahl <strong>der</strong> Hochaltrigen und e<strong>in</strong>er ansteigendenErwerbsbeteiligung von Frauen, bedeutet dies, dass künftigzunehmend mehr Männer vor <strong>der</strong> Notwendigkeit stehen,die Pflege für ältere Angehörige mit <strong>der</strong> eigenen Erwerbsarbeitzu vere<strong>in</strong>baren.Auch die sich wandelnden Familien- und Haushaltsstrukturen– <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die weitere Zunahme von E<strong>in</strong>personen-Haushalten– erfor<strong>der</strong>n die künftige Ausweitung <strong>der</strong>Unterstützungspotenziale älterer Menschen <strong>in</strong>nerhalb privaterNetzwerke und Freundeskreise. Dies bezieht sich<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auf Besuchs- und Betreuungsleistungen <strong>in</strong><strong>der</strong> Nachbarschaft, z.B. für alle<strong>in</strong> lebende alte Menschen.Auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Betreuung sehr alter, demenziell verän<strong>der</strong>terMenschen ist die Unterstützung pflegen<strong>der</strong> Familien o<strong>der</strong>E<strong>in</strong>richtungen durch ehrenamtliche Betreuungspersonens<strong>in</strong>nvoll. Gerade jene Menschen, die vor kurzem <strong>in</strong> denRuhestand e<strong>in</strong>getreten s<strong>in</strong>d, haben häufig die Möglichkeit,Nachbarn, Freunde und Bekannte zu unterstützen,die ke<strong>in</strong> stabiles familiales Netzwerk haben.Engagement und Partizipation älterer Menschen:Die Frage nach <strong>der</strong> besseren Nutzung <strong>der</strong> noch zu aktivierendenEngagementpotenziale ist ke<strong>in</strong> altersspezifischesProblem. Ältere Menschen s<strong>in</strong>d bereits heute <strong>in</strong> ähnlichemUmfang wie die jüngeren Altersgruppen bürgerschaftlichaktiv. Um das unausgeschöpfte Potenzial für
Drucksache 16/2190 – 262 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodebürgerschaftliches Engagement zu aktivieren, müssen– lebenslauforientiert – schon <strong>in</strong> den frühen Phasen desLebens Angebote für Engagement gemacht werden. Vorallem muss von seiten <strong>der</strong> Organisationen, Verwaltungen,Unternehmen und <strong>der</strong> Politik die Bereitschaft geför<strong>der</strong>twerden, die Kompetenzen <strong>der</strong> Bürger auch ab<strong>zur</strong>ufen undzu nutzen. Freiwillig Engagierte – vor allem Ältere – könneni.d.R. mehr als ihnen abverlangt wird.Der <strong>Bericht</strong> hat darüber h<strong>in</strong>aus deutlich gemacht, dass beiden bisher unterdurchschnittlich engagierten bildungsfernenGruppen e<strong>in</strong> Potenzial für bürgerschaftliches Engagementliegt, das durch zielgerichtete Maßnahmen aktiviertwerden kann. Hier geht es nicht nur um die Nutzung vonRessourcen für die Gesellschaft, son<strong>der</strong>n auch um e<strong>in</strong>eErhöhung <strong>der</strong> Selbsthilfepotenziale und <strong>der</strong> Erschließungvon Zugängen zu politischen Entscheidungsprozessenund Ressourcen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Befähigung <strong>zur</strong> Selbsthilfe.Migration und Potenziale des Alters<strong>in</strong> Wirtschaft und GesellschaftDie Integration <strong>der</strong> ausländischen Mitbürger ist e<strong>in</strong>e <strong>der</strong>wichtigsten Zukunftsfragen <strong>in</strong> Deutschland. Die Beherrschung<strong>der</strong> deutschen Sprache ist <strong>der</strong> Hauptschlüssel fürden Zugang zu Bildung und Qualifikation und e<strong>in</strong>e Voraussetzungfür beruflichen Erfolg, für die gleichberechtigteMöglichkeit <strong>der</strong> Teilhabe am gesellschaftlichen,ökonomischen, politischen und kulturellen Leben. DieErhöhung <strong>der</strong> Selbsthilfepotenziale, die Erschließung vonZugängen zu politischen Entscheidungsprozessen undRessourcen hängen, wie die Integration <strong>in</strong>sgesamt, nichtnur von <strong>der</strong> „E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungsbereitschaft“ <strong>der</strong> Zugewan<strong>der</strong>tenab. Auch die gesellschaftlichen Institutionen müssenhier entsprechende Angebote und Möglichkeiten eröffnen.Migranten wurden bisher überdurchschnittlichhäufig mit Hilfe des Vorruhestands aus dem Arbeitsprozessausgeglie<strong>der</strong>t. Es gilt, ihre Motivation für e<strong>in</strong>e längereLebensarbeitszeit zu erhöhen. Dazu müssen Migrantenstärker <strong>in</strong> Weiterbildungsmaßnahmen e<strong>in</strong>bezogenwerden, wobei diese unbed<strong>in</strong>gt mit <strong>der</strong> Sprachför<strong>der</strong>ungkomb<strong>in</strong>iert werden sollen. Bildung und Ausbildung <strong>der</strong>zweiten und nachfolgenden Migrantengenerationen solltenzu den Prioritäten <strong>der</strong> Bildungspolitik gehören, dasich ansonsten die Benachteiligung über mehrere <strong>Generation</strong>envon Migranten weitervererbt.9.1.4 Alternde Gesellschaft und die Neugestaltungdes LebenslaufsNeben <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung, e<strong>in</strong>e solidarische und gerechteVerteilung <strong>der</strong> Lasten des demografischen Wandelsauf die <strong>Generation</strong>en zu organisieren, stellt sich <strong>in</strong> Zukunftverstärkt die Frage, wie die Produktivität und diegesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationsfähigkeit<strong>in</strong> Deutschland unter den Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>er alterndenund schrumpfenden Gesellschaft sichergestellt werdenkann. Zu Recht wird <strong>in</strong>zwischen häufiger daraufh<strong>in</strong>gewiesen, dass die Alterung <strong>der</strong> Bevölkerung voraussichtliche<strong>in</strong> gesellschaftlich und ökonomisch zu bewältigendesProblem darstellt – zumal es sich bei <strong>der</strong> Verlängerung<strong>der</strong> <strong>in</strong>dividuellen Lebensspannen um e<strong>in</strong> gewolltesund wünschenswertes Phänomen handelt. Schwerwiegen<strong>der</strong>ersche<strong>in</strong>t das Problem und die Folgen <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>genGeburtenrate. Damit ist langfristig bei den als realistische<strong>in</strong>geschätzten Zuwan<strong>der</strong>ungszahlen e<strong>in</strong>e Schrumpfung<strong>der</strong> Bevölkerungszahl verbunden (siehe dazu auch dasE<strong>in</strong>leitungskapitel).Zwei Ansatzpunkte, die <strong>zur</strong> Bewältigung <strong>der</strong> erwartetengesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen (siehe KapitelE<strong>in</strong>kommenslage im Alter) des demografischenWandels beitragen können, sollen hier hervorgehobenwerden. Zum e<strong>in</strong>en ist für die Erhaltung <strong>der</strong> Innovationsfähigkeitund Produktivität unserer Gesellschaft die Erhöhung<strong>der</strong> Geburtenzahlen höchst wünschenswert. Es iste<strong>in</strong> Bewusstse<strong>in</strong> dafür zu schaffen, dass unsere Gesellschaftohne K<strong>in</strong><strong>der</strong> nicht überlebensfähig ist. Dazu ist dieVerbesserung <strong>der</strong> Lebenssituation von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n, Familienund Alle<strong>in</strong>erziehenden e<strong>in</strong>e dr<strong>in</strong>gende Notwendigkeit.Zentral ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang, dass die Vere<strong>in</strong>barkeitvon Bildung, Beruf und K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung, aber auchvon Beruf und <strong>der</strong> Sorge um ältere Familienmitglie<strong>der</strong>,weiter verbessert wird. Es s<strong>in</strong>d außerdem e<strong>in</strong>e verlässlicheE<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ungspolitik sowie Integrationsanstrengungenfür die hier lebenden E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>er notwendig, dieDeutschland für qualifizierte Zuwan<strong>der</strong>ungswillige alsoffenes und aufnahmebereites Land präsentiert. Denn angesichtsdes <strong>in</strong> allen OECD-Staaten gleichen Trends zumBevölkerungsrückgang wird <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>e verschärfteKonkurrenzsituation um gut qualifizierte Zuwan<strong>der</strong>ere<strong>in</strong>treten. Aber auch e<strong>in</strong>e erfolgreiche E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>ungspolitiklöst das Gesamtproblem nicht.Der Schwerpunkt des <strong>Bericht</strong>s liegt aber auf e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>enAspekt. Es ist dr<strong>in</strong>gend erfor<strong>der</strong>lich, die Potenziale ältererArbeitnehmer<strong>in</strong>nen und Arbeitnehmer und ältererMenschen jenseits des Erwerbslebens besser als bisher zunutzen. Dies gilt <strong>in</strong> quantitativer H<strong>in</strong>sicht, <strong>in</strong>dem beispielsweisedie vorhandenen Kompetenzen älterer Menschenaußerhalb <strong>der</strong> Erwerbsarbeit im bürgerschaftlichenEngagement stärker wahrgenommen und abgerufen werdeno<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Erwerbsarbeit, <strong>in</strong>dem die Beschäftigungsquotenälterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen erhöhtwerden.Darüber h<strong>in</strong>aus muss aber auch e<strong>in</strong>e qualitativ verän<strong>der</strong>teNutzung <strong>der</strong> Potenziale älterer Menschen e<strong>in</strong>geleitet werden.Bisher gelten jüngere Menschen und Neue<strong>in</strong>steiger<strong>in</strong> den Arbeitsmarkt als diejenigen, die Innovationen <strong>in</strong>Betriebe br<strong>in</strong>gen. In e<strong>in</strong>er Gesellschaft, <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igenJahren die Zahl <strong>der</strong> älteren Menschen die <strong>der</strong> jüngerenMenschen übersteigen wird und <strong>in</strong> <strong>der</strong> zudem die Belegschaften<strong>der</strong> Betriebe <strong>in</strong> den nächsten zwanzig Jahren rapidealtern werden, steigt die Notwendigkeit, die <strong>in</strong>novativenund kreativen Fähigkeiten älterer Beschäftigter undälterer Selbstständiger besser zu erkennen, zu nutzen undzu för<strong>der</strong>n.Es handelt sich dabei – im Zusammenwirken mit <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung<strong>zur</strong> Schaffung e<strong>in</strong>er k<strong>in</strong><strong>der</strong>- und elternfreundlichenGesellschaft – ke<strong>in</strong>esfalls um alternative, son<strong>der</strong>num komplementäre Strategien. Auf Grund <strong>der</strong> Trägheitdemografischer Entwicklungen und <strong>der</strong> langen Zeit-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 263 – Drucksache 16/2190räume, die notwendig s<strong>in</strong>d, damit sich Än<strong>der</strong>ungen imGeburtenverhalten auf die Bevölkerungsstruktur auswirken,gibt es ke<strong>in</strong>e Alternative zu e<strong>in</strong>er verstärkten Nutzung<strong>der</strong> Potenziale älterer Menschen. Alter muss e<strong>in</strong> gesellschaftlicherInnovationsmotor werden. Entsprechends<strong>in</strong>d von betrieblicher und gesellschaftlicher Seite die Voraussetzungenfür den Erhalt und die Entwicklung vonKreativität für das Alter und im Alter zu schaffen. Es s<strong>in</strong>ddamit aber auch erhöhte Anfor<strong>der</strong>ungen an die Menschenselbst verbunden: Die Bereitschaft, e<strong>in</strong>en Teil <strong>der</strong> durchdie Verlängerung <strong>der</strong> Lebenserwartung h<strong>in</strong>zugewonnenenJahre <strong>in</strong> Erwerbsarbeit und sonstige Formen gesellschaftlichenEngagements zu <strong>in</strong>vestieren, muss erhöht werden.Und die Bereitschaft, sich lebenslang weiterzubilden undLernen nicht als Zumutung zu begreifen, muss steigenund geför<strong>der</strong>t werden. Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ungspielen e<strong>in</strong>e zentrale Rolle für den Aufbau und denErhalt von Potenzialen im und für das Alter. Sie s<strong>in</strong>dwichtige Voraussetzungen für den Erhalt von Selbstständigkeit,Aktivität, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Wohlbef<strong>in</strong>denund Lebenszufriedenheit im Alter.Mit <strong>der</strong> Frage nach den Potenzialen des Alters <strong>in</strong> und fürWirtschaft und Gesellschaft stellt sich die Frage nach <strong>der</strong>Gestaltung des Lebenslaufs und <strong>der</strong> Verteilung gesellschaftlichund <strong>in</strong>dividuell relevanter Aufgaben, Rechteund Pflichten <strong>in</strong> den unterschiedlichen Lebensphasen.Wenn unter den Bed<strong>in</strong>gungen des demografischen Wandelsdie Potenziale aller Altersgruppen <strong>zur</strong> gesellschaftlichenEntwicklung sowie zum Erhalt von Lebenschancengenutzt werden sollen, können die etablierten Formen <strong>der</strong>Arbeitsteilung und Aufgabenzuweisung <strong>in</strong>nerhalb des Lebenslaufs– zwischen den <strong>Generation</strong>en und zwischen denGeschlechtern – nicht e<strong>in</strong>fach fortgesetzt werden. Auchungenutzte, verdeckte o<strong>der</strong> unentdeckte Potenziale <strong>in</strong> verschiedenensozialen <strong>Lage</strong>n und sozialen Gruppierungens<strong>in</strong>d aufzuspüren und im H<strong>in</strong>blick auf ihre gesellschaftlicheRelevanz zu bewerten und zu nutzen.Wir müssen nicht nur die Lebensphase Alter neu beschreibenund diesbezügliche Zuschreibungen und Funktionszuweisungenverän<strong>der</strong>n. Potenziale des Alters neuzu bestimmen, ist ohne Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lebensläufenicht möglich. Die e<strong>in</strong>e wichtige Verän<strong>der</strong>ung betrifft dieVerb<strong>in</strong>dung von Arbeiten und Lernen. In e<strong>in</strong>er Wissensgesellschaftkann die Beschäftigungsfähigkeit bis zumRentenalter nur durch Weiterbildung gesichert werden. Jenach <strong>in</strong>dividuellem Bedarf wird die Erwerbstätigkeitdurch kle<strong>in</strong>ere o<strong>der</strong> auch größere Weiterbildungsphasenunterbrochen. Die zweite wichtige Verän<strong>der</strong>ung betrifftdie Komb<strong>in</strong>ation von Familie und Erwerbstätigkeit. DaFrauen, die bislang unbezahlte Famlienarbeit leisteten,zunehmend erwerbstätig s<strong>in</strong>d, müssen die notwendigenPotenziale für K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung und Pflege durch e<strong>in</strong>e flexibleArbeitszeitgestaltung, die von bezahltem Erziehungsurlaubbis h<strong>in</strong> zu Ansprüchen auf unbezahlte Verr<strong>in</strong>gerung<strong>der</strong> Arbeitszeit für beide Geschlechter reicht,gesichert werden. Die Folge bei<strong>der</strong> Entwicklungen s<strong>in</strong>dflexiblere Erwerbsverläufe.Die Herausfor<strong>der</strong>ungen s<strong>in</strong>d umso größer, da es nichtmehr alle<strong>in</strong> um e<strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> kollektivesAltern geht. Damit verschieben sich die quantitativen Relationenzwischen den <strong>Generation</strong>en. Dies ist mit weitreichendenFolgen für <strong>in</strong>dividuelle Gewohnheiten und Verhaltensweisensowie gesellschaftliche Prozesse undInstitutionen verbunden, die heute nicht vollständig absehbars<strong>in</strong>d.9.1.5 Sozial differenzierte Maßnahmen<strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung von PotenzialenDie Ausbildung und Nutzung von Potenzialen ist imKontext e<strong>in</strong>er lebenslangen Entwicklung zu betrachten.Die im Alter bestehenden Möglichkeiten, e<strong>in</strong> an eigenenLebensentwürfen, Ziel- und Wertvorstellungen orientiertesLeben zu führen, hängen ebenso wie die Fähigkeit undBereitschaft, vorhandene Potenziale für sich selbst undan<strong>der</strong>e zu nutzen, von den <strong>in</strong> früheren Lebensabschnittenvorgefundenen Entwicklungsbed<strong>in</strong>gungen und den gewonnenenErfahrungen ab.Im Vergleich zu früheren Lebensphasen ist das Alter eherdurch e<strong>in</strong>e höhere Heterogenität als durch e<strong>in</strong>e zunehmendeHomogenität gekennzeichnet. Soziale Ungleichheitenreduzieren sich im Allgeme<strong>in</strong>en nicht mit dem Alter– schon gar nicht von selbst. Vielmehr lassen sich dieim Alter verfügbaren materiellen und sozialen Ressourcenvielfach als Ergebnis e<strong>in</strong>er Kumulation von Vor- o<strong>der</strong>Nachteilen beschreiben. E<strong>in</strong>e gezielte Erweiterung undNutzung <strong>der</strong> Potenziale des Alters muss entsprechendmöglichst früh ansetzen, damit e<strong>in</strong>e unerwünschte Benachteiligunggar nicht erst entsteht o<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> ihrenlangfristigen Auswirkungen deutlich reduziert wird.Dagegen erweisen sich soziale Ungleichheiten im Alterhäufig als nicht mehr korrigierbar.Im Folgenden soll auf e<strong>in</strong>ige für die Diskussion von Potenzialenim Alter bedeutsame Dimensionen sozialer Ungleichheite<strong>in</strong>gegangen werden. Es wird zunächst aufgezeigt,dass es für Angehörige bildungsferner Schichten,Migranten, Frauen, alle<strong>in</strong>stehende Menschen ohne K<strong>in</strong><strong>der</strong>sowie unter gesundheitlichen Bee<strong>in</strong>trächtigungen leidendeMenschen zum Teil erheblich schwieriger ist, Potenzialee<strong>in</strong>er aktiven Teilhabe am gesellschaftlichenLeben auszubilden und zu verwirklichen. Des Weiterenwerden präventive Strategien genannt, <strong>der</strong>en Umsetzungdazu beitragen könnte, dass die Folgen <strong>der</strong> beschriebenenUngleichheitsdimensionen zum<strong>in</strong>dest deutlich verm<strong>in</strong><strong>der</strong>twerden. Im letzten Teil dieses Abschnitts wird die Fragegestellt, <strong>in</strong>wieweit das Alter als solches e<strong>in</strong>e bedeutsameDimension sozialer Ungleichheit konstituiert.Soziale HerkunftIn ke<strong>in</strong>em vergleichbaren Land ist <strong>der</strong> Zusammenhangzwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg so ausgeprägtwie <strong>in</strong> Deutschland. Die PISA-Studien belegen,dass das deutsche Bildungssystem im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Leistungsfähigkeit nur mittelmäßig istund fachspezifische sowie allgeme<strong>in</strong>e Kompetenzen wenigererfolgreich vermittelt werden als etwa <strong>in</strong> den nordeuropäischenStaaten. Im Vergleich mit an<strong>der</strong>en europäischenStaaten machen <strong>in</strong> Deutschland weniger Schüler
Drucksache 16/2190 – 264 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeAbitur, wobei unter diesen <strong>der</strong> Anteil an K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ausAkademikerfamilien größer ist als <strong>in</strong> jedem an<strong>der</strong>en europäischenLand. Die langfristigen Auswirkungen e<strong>in</strong>esSchulsystems, das gegenwärtig offensichtlich eher zu e<strong>in</strong>erVerstetigung denn zu e<strong>in</strong>er Nivellierung vonschichtspezifischen Ungleichheiten beiträgt, werdendeutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass frühe Bildungserfahrungendie weitere Bildungsbiografie prägen,<strong>der</strong> Schulabschluss entscheidend für die Arbeitsmarktchancenund das <strong>in</strong>dividuelle Arbeitsmarktrisikoist, gerade unter ger<strong>in</strong>g Qualifizierten e<strong>in</strong>e niedrige Weiterbildungsbeteiligungbesteht und schließlich die Beschäftigungsfähigkeitbei ger<strong>in</strong>g Qualifizierten mit demAlter deutlich <strong>zur</strong>ückgeht.Im Kontext <strong>der</strong> Erweiterung und Nutzung von Potenzialendes Alters misst die Kommission e<strong>in</strong>er Verbesserung<strong>der</strong> Bildungschancen von Angehörigen unterprivilegiertersozialer Schichten große Bedeutung bei. EntsprechendeBemühungen sollten bereits auf <strong>der</strong> Ebene des Schulsystemsansetzen, <strong>in</strong>dem durch die gezielte Ausschöpfungvon För<strong>der</strong>möglichkeiten die Grundlage für Bildungsmotivation,positive Bildungserfahrungen und spätere Qualifikationengelegt wird. Der staatliche Auftrag, allen Bürgerne<strong>in</strong>e breite Grundausbildung zu f<strong>in</strong>anzieren,erstreckt sich angesichts e<strong>in</strong>er hohen Anzahl von Bildungsabbrechernund Zuwan<strong>der</strong>ern mit an<strong>der</strong>en Bildungsbiografienzunehmend auch auf die Erwachsenphase.Wie im Bildungskapitel ausführlich dargelegtsollte daher e<strong>in</strong> Nachholen von Bildungsabschlüssen auchnach dem 30. Lebensjahr geför<strong>der</strong>t und Anreizsysteme<strong>zur</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Beteiligung an beruflicher Weiterbildunggeschaffen werden. Die Teilnahme an außer- undnachberuflichen Bildungsangeboten sollte grundsätzlich<strong>in</strong> dem Maße geför<strong>der</strong>t werden, wie sie auch <strong>in</strong> gesellschaftlichemInteresse ist – etwa <strong>in</strong>dem sie <strong>zur</strong> Erhaltungkörperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit o<strong>der</strong> <strong>zur</strong>Vermeidung von Unterstützungsbedarf beiträgt. Darüberh<strong>in</strong>aus sollte <strong>der</strong> freie Zugang zu allgeme<strong>in</strong>er, politischerund kultureller Bildung gesichert se<strong>in</strong>.MigrantenstatusDie <strong>in</strong> Deutschland lebenden älteren Migrant<strong>in</strong>nen undMigranten gehören gegenwärtig zum überwiegenden Teilbildungsfernen Schichten an, soweit sie aus den ehemaligenAnwerbelän<strong>der</strong>n stammen. Im Allgeme<strong>in</strong>en spiegelnsich ger<strong>in</strong>ge berufliche Qualifikationen im Vergleich <strong>zur</strong>Gesamtbevölkerung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em deutlich erhöhten Arbeitslosigkeitsrisikowi<strong>der</strong>. Des Weiteren arbeiten Migrantenund Migrant<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> aller Regel unter körperlich vergleichsweisestark beanspruchenden Bed<strong>in</strong>gungen, wase<strong>in</strong>e höhere Anfälligkeit für Verschleißerkrankungen <strong>zur</strong>Folge hat. Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbslebenverr<strong>in</strong>gert sich für e<strong>in</strong>en großen Teil dieser Menschen diesoziale Integration, da sich Kontakte <strong>zur</strong> e<strong>in</strong>heimischenBevölkerung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel auf Arbeitskollegen reduzieren.Diese Annahme wird auch durch Befunde belegt, dass imAlter die Orientierung am Herkunftsland wie<strong>der</strong> zunimmt.Die räumliche Mobilität älterer Migranten und dieBereitschaft zum freiwilligen Engagement <strong>in</strong> ethnischenOrganisationen lassen sich als zwei für Migranten typischePotenziale beschreiben.Gerade die Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong>aus den ehemaligen Anwerbelän<strong>der</strong>n verfügenhäufig nur über un<strong>zur</strong>eichende Sprachkenntnisse. Die Beherrschung<strong>der</strong> deutschen Sprache ist nicht nur e<strong>in</strong>e entscheidendeVoraussetzung für berufliche (Weiter-)Qualifizierungund Beschäftigungsfähigkeit, son<strong>der</strong>n darüberh<strong>in</strong>aus – unabhängig vom Lebensalter – <strong>der</strong> Schlüssel <strong>zur</strong>Integration <strong>in</strong> die deutsche Gesellschaft. Aus diesemGrunde empfiehlt die Kommission, Sprachkurse fürMigranten stärker zu för<strong>der</strong>n als bisher. Auch wenn mitdem Älterwerden <strong>der</strong> zweiten MigrantengenerationSprachbarrieren <strong>zur</strong>ückgehen werden, sieht die Kommissionnicht nur gegenwärtig, son<strong>der</strong>n auch langfristig dieNotwendigkeit, Migrationsberatung und Migrationssozialarbeitbei <strong>der</strong> Vernetzung von Institutionen <strong>der</strong>gesundheitlichen Versorgung und Altenhilfe stärker zuberücksichtigen. Die im Allgeme<strong>in</strong>en starke Familienorientierungvon Migranten wird häufig unzulässigerweiseim S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Mo<strong>der</strong>nisierungsdefizits gedeutet.Im Unterschied dazu sieht die Kommission <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familienorientierunge<strong>in</strong> bedeutsames Unterstützungspotenzial.Mit <strong>der</strong> steigenden Anzahl älterer Migranten wirddie am stärksten repräsentierte Migrantengruppe aus <strong>der</strong>Türkei zum Teil relativ eigenständige Versorgungsstrukturenentwickeln. Die Kommission empfiehlt, <strong>der</strong>artigeFormen von Selbsthilfe zu för<strong>der</strong>n und entsprechend zuvernetzen.Grundsätzlich ist nach Auffassung <strong>der</strong> Kommission e<strong>in</strong>allgeme<strong>in</strong>es Defizit an soziokultureller Integration vonMigrant<strong>in</strong>nen und Migranten zu beklagen. Die Erkenntnis,dass unsere Gesellschaft sowohl <strong>in</strong> wirtschaftlicherals auch <strong>in</strong> kultureller H<strong>in</strong>sicht erheblich von <strong>der</strong> Migrationprofitiert, hat sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bevölkerung noch nicht <strong>in</strong>ausreichendem Maße durchgesetzt. Hier hat die Politikdie Aufgabe, durch e<strong>in</strong>en verantwortlichen Umgang mitdem Thema Migration zu e<strong>in</strong>em verän<strong>der</strong>ten gesellschaftlichenBewusstse<strong>in</strong> beizutragen. Hierzu gehört, dass Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten nicht e<strong>in</strong>seitig als defizitäreWesen und Opfer gesehen werden. Des Weiteren gilt auchfür die Integration, dass Migranten möglichst frühzeitigangemessen geför<strong>der</strong>t und gefor<strong>der</strong>t werden. Die Sprachkompetenz<strong>der</strong> Migrantenbevölkerung muss bereits imK<strong>in</strong><strong>der</strong>garten- und Schulalter systematisch entwickeltwerden. Die Ergebnisse <strong>der</strong> PISA-Studien belegen, dassdie gegenwärtig im Schulbereich gültigen Voraussetzungen– unabhängig vom jeweils betrachteten Bundesland –un<strong>zur</strong>eichend s<strong>in</strong>d. Ke<strong>in</strong>er europäischen Gesellschaft gel<strong>in</strong>gtes schlechter, K<strong>in</strong><strong>der</strong> aus Migrantenfamilien <strong>in</strong> dasSchulsystem zu <strong>in</strong>tegrieren.GeschlechtIn Bezug auf die Entwicklung und Nutzung von Potenzialendes Alters können Frauen <strong>in</strong> mehrerer H<strong>in</strong>sicht als benachteiligtgelten. Armut im Alter ist heute vor allem e<strong>in</strong>weibliches Problem, das sich als Konsequenz aus e<strong>in</strong>erBenachteiligung <strong>in</strong> früheren Abschnitten des Lebenslaufsergibt. Dies wird auf dem Arbeitsmarkt deutlich, wo
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 265 – Drucksache 16/2190Frauen im Vergleich zu Männern häufig ger<strong>in</strong>gere Verdienst-und Karrieremöglichkeiten vorf<strong>in</strong>den. Das zeigtsich zudem <strong>in</strong> den <strong>in</strong> unserer Gesellschaft nach wie vorverbreiteten Geschlechtsrollenvorstellungen, die Frauenveranlassen, zu Gunsten von K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung o<strong>der</strong> Pflegetätigkeitauf e<strong>in</strong>e ihren Fähigkeiten entsprechende beruflicheEntwicklung und den Aufbau e<strong>in</strong>er eigenständigenAlterssicherung zu verzichten. Die steigendeErwerbsbeteiligung von Frauen hat nicht selten e<strong>in</strong>edurch K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung o<strong>der</strong> Pflegetätigkeit bed<strong>in</strong>gteDoppelbelastung <strong>zur</strong> Folge. Diese durch die un<strong>zur</strong>eichendeVere<strong>in</strong>barkeit beruflicher und familiärer Aufgabenbed<strong>in</strong>gte Überfor<strong>der</strong>ung kann langfristig gesundheitlicheE<strong>in</strong>schränkungen nach sich ziehen und dieEntfaltung vorhandener sowie die Ausbildung neuer Potenzialenachhaltig beh<strong>in</strong><strong>der</strong>n.Mit dem demografischen Wandel wird e<strong>in</strong>e weitere Erwerbsbeteiligungvon Frauen ebenso unverzichtbar wieauch die Notwendigkeit, Erwerbstätigkeit und Familieverb<strong>in</strong>den zu müssen, um e<strong>in</strong>e Ausschöpfung <strong>der</strong> Potenzialevon Frauen und Männern für K<strong>in</strong><strong>der</strong>erziehung undPflege zu erhöhen. Um unerwünschte Folgen e<strong>in</strong>er Doppelbelastungzu vermeiden, s<strong>in</strong>d Maßnahmen <strong>zur</strong> Verbesserung<strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie und Beruf ebensovonnöten, wie e<strong>in</strong>e stärkere Flexibilisierung <strong>der</strong> Jahresund<strong>der</strong> Lebensarbeitszeit und e<strong>in</strong>e stärkere gesellschaftlicheAchtung von Erziehungs- und Pflegeaufgaben. Umdie Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie und Beruf zu verbessern,sieht die Kommission die Notwendigkeit, e<strong>in</strong> flächendeckendesAngebot von K<strong>in</strong><strong>der</strong>krippen, K<strong>in</strong><strong>der</strong>tagesstättenund Ganztagsschulen zu schaffen sowie Angebote ambulanterund teilstationärer Versorgung auszubauen. Unternehmenmüssen verstärkt e<strong>in</strong> Bewusstse<strong>in</strong> für Pflegetätigkeitenals neues Vere<strong>in</strong>barkeitsproblem neben <strong>der</strong>Erziehung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> entwickeln.Familiäre UnterstützungspotenzialeAus <strong>der</strong> sich verän<strong>der</strong>nden Altersstruktur unserer Gesellschaftergibt sich e<strong>in</strong>e Zunahme <strong>der</strong> auf Hilfe- und Pflegeleistungenangewiesenen Personen bei gleichzeitig abnehmendenfamiliären Unterstützungspotenzialen. Fürzukünftige Kohorten älterer Menschen werden wenigerK<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>zur</strong> Verfügung stehen, die anfallende Pflegeaufgabenübernehmen können. H<strong>in</strong>zu kommt, dass die heutehöheren Scheidungsraten, die niedrigeren Heirats- undWie<strong>der</strong>verheiratungszahlen, e<strong>in</strong>e zusätzliche Verkle<strong>in</strong>erungsozialer Unterstützungsnetzwerke für Viele <strong>zur</strong>Folge haben. Die Unterschiede <strong>in</strong> den familiären Unterstützungspotenzialenkönnen als e<strong>in</strong>e weitere Dimensionvon sozialer Ungleichheit im Alter bezeichnet werden.Damit stellt sich zunächst die Aufgabe e<strong>in</strong>er gezieltenFör<strong>der</strong>ung junger Familien. Die Tatsache, dass die Geburtvon K<strong>in</strong><strong>der</strong>n heute mit e<strong>in</strong>em nicht zu unterschätzendenArmutsrisiko e<strong>in</strong>hergeht, ist nicht akzeptabel. Hier hat diePolitik die Aufgabe, geeignete Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zuschaffen, damit sich wie<strong>der</strong> mehr Familien für K<strong>in</strong><strong>der</strong>entscheiden. Unabhängig davon, ob sich die Geburtenrate<strong>in</strong> Zukunft wie<strong>der</strong> nach oben entwickeln wird, besteht dieNotwendigkeit, <strong>zur</strong>ückgehende familiäre Unterstützungspotenzialezu kompensieren. In diesem Zusammenhangs<strong>in</strong>d ehrenamtliche Initiativen ebenso zu för<strong>der</strong>n wie e<strong>in</strong>allgeme<strong>in</strong> verstärktes Problembewusstse<strong>in</strong>, das sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erhöheren Eigenverantwortung nie<strong>der</strong>schlagen sollte.Durch e<strong>in</strong>e Stärkung von Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<strong>in</strong> unserem nach wie vor zu sehr kurativ ausgerichtetenGesundheitssystem kann dazu beigetragen werden,dass <strong>der</strong> Bedarf an Hilfe- und Pflegeleistungen unddamit auch <strong>der</strong> <strong>in</strong>nerfamiliäre Unterstützungsbedarf wenigerstark ansteigt als auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> Altersstruktur zu erwarten wäre.Gesundheitliche Bee<strong>in</strong>trächtigungenGerade im hohen Alter können gesundheitliche Bee<strong>in</strong>trächtigungendie Verwirklichung von persönlich bedeutsamenLebensentwürfen, Ziel- und Wertvorstellungen erheblicherschweren. In <strong>der</strong> Alternsforschung wird diesemUmstand durch die Differenzierung zwischen e<strong>in</strong>em drittenund vierten Lebensalter Rechnung getragen. Währenddas dritte Lebensalter vor allem durch e<strong>in</strong>en Gew<strong>in</strong>n anaktiven Jahren gekennzeichnet ist, nehmen im vierten Lebensaltergesundheitliche o<strong>der</strong> konstitutionsbed<strong>in</strong>gte Risikenzu. Die Wi<strong>der</strong>stands- und Kompensationsfähigkeitverr<strong>in</strong>gert sich und die Verletzlichkeit des Menschennimmt zu. Die Kommission betont, dass <strong>der</strong> für das vierteLebensalter nicht zu leugnende Verlust an körperlichenund geistigen Funktionen nicht bedeutet, dass Menschenüber ke<strong>in</strong>e Potenziale mehr verfügen, die sie für sichselbst und an<strong>der</strong>e nutzen könnten. Auch im sehr hohenAlter unterscheiden sich Menschen <strong>in</strong> starkem Maße <strong>in</strong>ihren körperlichen und geistigen Fähigkeiten.Gesundheitliche Bee<strong>in</strong>trächtigungen und die Möglichkeiten,trotz dieser Nachteile e<strong>in</strong> an eigenen Lebensentwürfen,Ziel- und Wertvorstellungen orientiertes Leben zuführen, s<strong>in</strong>d zu e<strong>in</strong>em guten Teil das Resultat e<strong>in</strong>er lebenslangenEntwicklung. Diese können sowohl die Folgee<strong>in</strong>er Kumulation von Vorteilen als auch von Nachteilense<strong>in</strong>. Der durch zahlreiche empirische Studien gestützteBefund, dass Angehörige unterprivilegierter Schichten imAlter <strong>in</strong> höherem Maße von gesundheitlichen E<strong>in</strong>schränkungenbetroffen s<strong>in</strong>d als Angehörige höherer sozialerSchichten, verweist sowohl auf schichtspezifische Unterschiedeim Gesundheitsverhalten als auch auf schichtspezifischeUnterschiede <strong>in</strong> gesundheitlichen Belastungenund Verschleißprozessen. Bei Angehörigen unterprivilegiertersozialer Schichten s<strong>in</strong>d Risikofaktoren wie Rauchen,Alkoholmissbrauch und ungesunde Ernährung stärkerausgeprägt. Hier wirkt sich zum e<strong>in</strong>en aus, dass dieserPersonenkreis durch Maßnahmen <strong>der</strong> Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>unghäufig nicht o<strong>der</strong> nur un<strong>zur</strong>eichen<strong>der</strong>reicht wird. Des Weiteren ist zu bedenken, dass gesundheitsför<strong>der</strong>lichesVerhalten zum Teil auch f<strong>in</strong>anzielle Ressourcenvoraussetzt, die von diesen Menschen nicht e<strong>in</strong>gesetztwerden können. Körperlich stark beanspruchendeArbeitsbed<strong>in</strong>gungen haben nicht selten Verschleißersche<strong>in</strong>ungen<strong>zur</strong> Folge, die geme<strong>in</strong>sam mit e<strong>in</strong>em höherenRisiko für Arbeitsunfälle dazu beitragen, dass dasAusscheiden aus dem Erwerbsleben nicht mit dem Erreichen<strong>der</strong> gesetzlichen Altersgrenze, son<strong>der</strong>n über e<strong>in</strong>e Erwerbsungfähigkeitsrenteerfolgt. Vor dem skizziertenH<strong>in</strong>tergrund empfiehlt die Kommission, Angebote <strong>der</strong>
Drucksache 16/2190 – 266 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodePrävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung verstärkt <strong>in</strong> betrieblicheWeiterbildungsmaßnahmen zu <strong>in</strong>tegrieren. DesWeiteren ersche<strong>in</strong>t unter <strong>der</strong> Zielsetzung e<strong>in</strong>er Erhaltung<strong>der</strong> Beschäftigungsfähigkeit e<strong>in</strong>e Anpassung von Arbeitsbed<strong>in</strong>gungenund Arbeitsanfor<strong>der</strong>ungen unumgänglich.Inwieweit es Menschen gel<strong>in</strong>gt, im Alter trotz gesundheitlicherE<strong>in</strong>schränkungen e<strong>in</strong> selbst- und mitverantwortlichesLeben zu führen, hängt <strong>in</strong> starkem Maße von<strong>der</strong> sozialen Teilhabe <strong>in</strong> früheren Lebensabschnitten ab.Wer sich etwa im Alter ehrenamtlich engagiert, hat dies<strong>in</strong> aller Regel auch schon <strong>in</strong> früheren Lebensabschnittengetan. Auch s<strong>in</strong>d Menschen, die <strong>in</strong> früheren Lebensabschnittene<strong>in</strong> breites Interessen- und Tätigkeitsspektrumausgebildet haben, besser <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>, nach dem Ausscheidenaus dem Erwerbsleben e<strong>in</strong>e persönlich zufriedenstellendeZukunftsperspektive zu entwickeln. Aus<strong>der</strong>artigen Befunden leitet sich die For<strong>der</strong>ung ab, dass dieTeilhabe an allgeme<strong>in</strong>er, politischer und kultureller Bildungmöglichst frühzeitig geför<strong>der</strong>t werden muss; spezielleBildungsangebote, die ältere Menschen motivierensollen, sich trotz bestehen<strong>der</strong> E<strong>in</strong>schränkungen für sichselbst und an<strong>der</strong>e zu engagieren, ersche<strong>in</strong>en dagegen wenigerzweckmäßig.AlterInwieweit Menschen im Alter e<strong>in</strong> an persönlichen Lebensentwürfen,Ziel- und Wertvorstellungen orientiertes Lebenverwirklichen können, ist nicht nur von <strong>in</strong>dividuellenKompetenzen und Ressourcen abhängig, son<strong>der</strong>n auchvon <strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesellschaft bestehenden Bereitschaft,die Ausbildung und Nutzung von Potenzialen zu akzeptierenund gegebenenfalls zu unterstützen. Obwohl die populäreAussage, unsere Gesellschaft sei durch e<strong>in</strong>e Ablehnungdes Alters charakterisiert, <strong>in</strong> dieser allgeme<strong>in</strong>enForm nicht haltbar ist, kann doch von e<strong>in</strong>er tief greifendenReserviertheit gegenüber dem Alter ausgegangen werden.Diese spiegelt sich im Bereich <strong>der</strong> Arbeitswelt, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<strong>in</strong> <strong>der</strong> lange Zeit dom<strong>in</strong>ierenden Frühverrentungspraxis,<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er vergleichsweise ger<strong>in</strong>gen Ausschöpfung desBeschäftigungspotenzials älterer Menschen, e<strong>in</strong>em fürÄltere erhöhten Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit sowiee<strong>in</strong>er im Alter ger<strong>in</strong>geren Weiterbildungsbeteiligung wi<strong>der</strong>.Darüber h<strong>in</strong>aus wird die angesprochene Reserviertheitgegenüber dem Alter <strong>in</strong> <strong>der</strong> aktuellen Diskussion übernotwendige Reformen des sozialen Sicherungssystemsdeutlich, die Risiken des Alters und aus diesen resultierendef<strong>in</strong>anzielle Belastungen e<strong>in</strong>seitig fokussiert.Für den Bereich des ehrenamtlichen Engagements kannfestgestellt werden, dass die Leistungen älterer Menschenim Allgeme<strong>in</strong>en eher nicht angemessen gewürdigt und ältereMenschen nach wie vor zu selten als mitverantwortlicheBürger angesprochen werden.Die <strong>in</strong> unserer Gesellschaft dom<strong>in</strong>anten Altersbil<strong>der</strong> orientierensich häufig noch zu stark an E<strong>in</strong>schränkungenund Verlusten, die für frühere Geburtsjahrgänge ältererMenschen weit charakteristischer waren, als sie es für dieheute Älteren s<strong>in</strong>d. Die Kommission geht davon aus, dasssich zum e<strong>in</strong>en <strong>der</strong> Trend zu materiell besser ausgestatteten,gesün<strong>der</strong>en, aktiveren und produktiveren <strong>Generation</strong>enälterer Menschen weiter fortsetzen wird, zum an<strong>der</strong>endie Potenziale des Alters mit fortschreitendemdemografischen Wandel verstärkt wahrgenommen undgenutzt werden. Im Zuge dieser Entwicklung werden sichauch die gesellschaftlich dom<strong>in</strong>anten Altersbil<strong>der</strong> verän<strong>der</strong>n.Gleichwohl ist es dr<strong>in</strong>gend erfor<strong>der</strong>lich, durch e<strong>in</strong>endifferenzierteren Umgang mit dem Thema Alter verstärktdie möglichen Chancen des demografischen Wandels <strong>in</strong>den öffentlichen Diskurs e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen und politischeKonzepte zu entwickeln, die explizit auf Potenziale desAlters <strong>zur</strong>ückgreifen. In diesem Kontext sei noch e<strong>in</strong>maldarauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass e<strong>in</strong>e an <strong>der</strong> Entfaltung und Nutzungvon Potenzialen des Alters <strong>in</strong>teressierte Politik eserfor<strong>der</strong>lich macht, <strong>in</strong> höherem Maße als bisher flexibleRegelungen für den Übergang von <strong>der</strong> Erwerbsphase <strong>in</strong>die Nacherwerbsphase zu schaffen.9.2 HandlungsempfehlungenHandlungsempfehlungen zum Kapitel ErwerbsarbeitDie Kommission spricht sich für e<strong>in</strong>en Paradigmenwechsel<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> Lebensarbeitszeit aus. Dazu bedarfes <strong>in</strong>tegrierter Anstrengungen auf unterschiedlichenFel<strong>der</strong>n und Politikebenen. Angesprochen ist neben denälteren Erwerbstätigen, den betrieblichen Akteuren undden Tarifparteien auch <strong>der</strong> Staat. Dieser muss – <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesundheitspolitik, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bildungspolitik, <strong>in</strong><strong>der</strong> Familienpolitik und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitik – Rahmenbed<strong>in</strong>gungenschaffen, durch die e<strong>in</strong>e Verlängerung<strong>der</strong> Lebensarbeitszeit weiter geför<strong>der</strong>t wird.1 Schaffung e<strong>in</strong>er „demografiesensiblen“ Unternehmenskulturund Entwicklung von „Leitl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>erguten Praxis“: Damit ist geme<strong>in</strong>t, dass Betriebe e<strong>in</strong>ePersonal- und Beschäftigungspolitik mit dem Ziel <strong>der</strong>gleichberechtigten Behandlung aller Altersgruppen imBetrieb praktizieren. Insbeson<strong>der</strong>e geht es darum, dieVorteile altersgemischter Arbeits- und Lernteams und e<strong>in</strong>erausgewogenen Personalstruktur im Unternehmen mite<strong>in</strong>er h<strong>in</strong>reichenden Vertretung auch des ErfahrungswissensÄlterer deutlich zu machen. Hilfreich können auch„Leitl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>er Guten Praxis“ se<strong>in</strong>, wie sie bereits aufEU-Ebene e<strong>in</strong>geführt, <strong>in</strong> Deutschland aber bislang kaumim E<strong>in</strong>satz s<strong>in</strong>d. Darüber h<strong>in</strong>aus hält die Kommission dieVerbreitung von Beispielen hervorragen<strong>der</strong> betrieblicherPraxis für geeignet.2 Anreizstrukturen für Gesundheitsschutz, Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund Prävention: Die Kommission hältes für notwendig, jene Betriebe zu belohnen, die Maßnahmendes Gesundheitsschutzes, <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund <strong>der</strong> Prävention umsetzen. Die Kommission sieht dabeiPrüfungsbedarf h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Wirkung von entsprechendenAnreizen (zum Beispiel Bonus- und Malussysteme).3 Demografiegerechte Tarifverträge abschließen:Die Kommission empfiehlt den Tarifpartnern, passiveSchutzregelungen für Ältere, wie etwa Entgeltsicherung,Aufstockung von Altersteilzeitphasen o<strong>der</strong> spezifischeKündigungsschutzbestimmungen, durch Vere<strong>in</strong>barungen
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 267 – Drucksache 16/2190zu e<strong>in</strong>er präventiven För<strong>der</strong>ung zu ergänzen. Insbeson<strong>der</strong>es<strong>in</strong>d Tarifvere<strong>in</strong>barungen zu den Themen Qualifizierungund Weiterbildung, Gesundheitsschutz und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,Arbeitsorganisation sowie flexible Lebensarbeitszeitenauszuhandeln. Die Kommission begrüßt,dass im neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes dieZahl <strong>der</strong> Altersstufen bereits von 12 auf 6 reduziertwurde. Sie plädiert dafür, <strong>in</strong> den nächsten Jahren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erzweiten Reformstufe die Altersstufen beim Entgelt im öffentlichenDienst, und soweit notwendig, auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>enBranchen weiter zu reduzieren.4 „Echte“ Altersteilzeit als Bestandteil flexibler Lebensarbeitszeiten:Die Altersteilzeit sollte als Blockvariantenicht mehr geför<strong>der</strong>t werden. Die Kommissionschlägt vor, im Teilzeitgesetz, das zu e<strong>in</strong>em Gesetz fürWahlarbeitszeiten weiterentwickelt werden könnte, e<strong>in</strong>espezielle Variante <strong>der</strong> Arbeitszeitflexibilisierung für über50-Jährige e<strong>in</strong>zuführen. Da das Haupth<strong>in</strong><strong>der</strong>nis für e<strong>in</strong>eVerkürzung <strong>der</strong> Arbeitszeit für Ältere spätere E<strong>in</strong>schnittebei <strong>der</strong> Rente s<strong>in</strong>d, sollten zwischen dem 50. und 65. Lebensjahrfür e<strong>in</strong>e maximale Periode von 5 Jahren die Rentenbeiträgefür die verkürzte Arbeitszeit (auf maximal50 Prozent) durch die öffentliche Hand übernommen werden.Die bisherige Aufstockung <strong>der</strong> Entgelte sollte entfallen;dies könnten die Tarifpartner regeln.5 Ke<strong>in</strong>e Lockerung des Kündigungsschutzes für ältereBeschäftigte, aber Abbau <strong>der</strong> Barrieren bei <strong>der</strong>E<strong>in</strong>stellung Älterer: Die Kommission spricht sich gegendie Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere Beschäftigteaus. Denn e<strong>in</strong>e Lockerung des Kündigungsschutzeswürde zu mehr Entlassungen Älterer und ihrenErsatz durch Jüngere führen. Gleichzeitig ist nicht zuübersehen, dass die Sorge vor hohen Entlassungskosteno<strong>der</strong> <strong>der</strong> Unkündbarkeit Älterer e<strong>in</strong> zentrales E<strong>in</strong>stellungshemmnisist. Der Gesetzgeber hat darauf reagiertund die Befristung Älterer ab dem 52. Lebensjahr bis zumRentenbezug ohne sachlichen Grund ermöglicht. Esspricht vieles dafür, dass diese Regelung juristisch ke<strong>in</strong>enBestand haben wird, nachdem <strong>der</strong> EuGH beson<strong>der</strong>e Befristungsmöglichkeitenfür Ältere als altersdiskrim<strong>in</strong>ierendbezeichnet hat. Die Kommission schlägt deshalbvor, im Kündigungsschutz das Lebensalter als Kriteriumbei <strong>der</strong> Sozialwahl zu streichen. Langjährig Beschäftigtewürden damit über das Kriterium „Betriebszugehörigkeit“geschützt; E<strong>in</strong>stellungsbarrieren für Ältere würdenverm<strong>in</strong><strong>der</strong>t.6 Ke<strong>in</strong>e starren Regelungen des Ausscheidens mit65 Jahren: Die <strong>in</strong> Tarifverträgen und im Beamtenrechtoft starren Regelungen e<strong>in</strong>es Ausscheidens mit dem65. Lebensjahr sollten gelockert werden. Allerd<strong>in</strong>gs müssendabei betriebliche Interessen an e<strong>in</strong>er ausgeglichenenPersonalstruktur und e<strong>in</strong>er regelmäßigen Neubesetzungvon Führungspositionen berücksichtigt werden. Dieswäre etwa durch die Begrenzung des Kündigungsschutzesbis zum 65. Lebensjahr zu ermöglichen.7 Arbeitsmarktpolitische Instrumente vere<strong>in</strong>fachen:In den letzten Jahren s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Reihe von neuen Instrumenten<strong>der</strong> Arbeitsmarktpolitik <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung Älterere<strong>in</strong>geführt worden. E<strong>in</strong>ige dieser Maßnahmen, wie etwa<strong>der</strong> Beitragsbonus für Arbeitgeber bei <strong>der</strong> E<strong>in</strong>stellung Älterer,werden kaum genutzt, da die Arbeitsvermittler nure<strong>in</strong>e begrenzte Anzahl von Instrumenten vermarkten könnenund die Nutzer angesichts <strong>der</strong> komplexen För<strong>der</strong>landschaftebenfalls nur wenige Instrumente kennen. DieKommission empfiehlt daher die Bündelung zu wenigenschlagkräftigen Instrumenten mit hohem Wie<strong>der</strong>erkennungswert.So könnte man alle f<strong>in</strong>anziellen Zuwendungenan die Arbeitgeber und die Beschäftigten bei den E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungszuschüssenbündeln, die ohneh<strong>in</strong> sehr flexibelgehandhabt werden. Dies wäre mit e<strong>in</strong>em erheblichenBürokratieabbau verbunden.8 Für mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben<strong>in</strong> die Nacherwerbsphase: Die Kommissionist <strong>der</strong> Auffassung, dass <strong>in</strong> höherem Maße als bisher e<strong>in</strong>eFlexibilisierung beim Übergang vom Erwerbsleben <strong>in</strong> dieNacherwerbsphase erfor<strong>der</strong>lich ist. Dazu schlägt dieKommission vor:– Die Regelungen für die Inanspruchnahme <strong>der</strong> Teilrente(bei Alters- und Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ungsrenten) aus<strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung sollten vere<strong>in</strong>fachtwerden. Dies betrifft vor allem die Regelungenfür den möglichen H<strong>in</strong>zuverdienst.– E<strong>in</strong>e weitere Maßnahme <strong>zur</strong> Erhöhung des Flexibilisierungsgradesfür den Übergang von <strong>der</strong> Erwerbs- <strong>in</strong>die Ruhestandsphase wird von <strong>der</strong> Kommission <strong>in</strong> <strong>der</strong>Möglichkeit gesehen, den Zeitpunkt zwischen demvollständigen o<strong>der</strong> teilweisen Ausscheiden aus demErwerbsleben und dem Zeitpunkt <strong>der</strong> Inanspruchnahmee<strong>in</strong>er Altersrente durch private und betrieblicheVorsorge zu überbrücken. Dafür sollten auch die Mittel<strong>der</strong> geför<strong>der</strong>ten Privatvorsorge e<strong>in</strong>gesetzt werdenkönnen, was bislang nur <strong>in</strong> begrenztem Umfang <strong>der</strong>Fall ist.– Die Zuschläge für e<strong>in</strong> H<strong>in</strong>ausschieben <strong>der</strong> Inanspruchnahme<strong>der</strong> Altersrente über den Zeitpunkt <strong>der</strong> Regelbzw.Referenzaltersgrenze (ab <strong>der</strong> die Rente abschlagfrei<strong>in</strong> Anspruch genommen werden kann) sollten erhöhtwerden, um e<strong>in</strong>en tatsächlichen f<strong>in</strong>anziellen Anreiz<strong>zur</strong> Weiterarbeit zu bieten.– Wird nach Inanspruchnahme <strong>der</strong> Altersrente ab <strong>der</strong>Regel-(Referenz)Altersgrenze e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeitausgeübt, so ist <strong>der</strong>zeit – um Wettbewerbsverzerrungzu vermeiden – vom Arbeitgeber <strong>der</strong> halbe Rentenversicherungsbeitragzu entrichten. Allerd<strong>in</strong>gs führt dieseBeitragszahlung zu ke<strong>in</strong>em erhöhten Rentenanspruch.Dies ist mit dem Konzept <strong>der</strong> Rentenversicherung,nach dem Beitragszahlungen zu Rentenansprüchenführen sollen, nicht vere<strong>in</strong>bar. Deshalb sollte nach Beendigung<strong>der</strong> Erwerbstätigkeit des Rentners e<strong>in</strong>e entsprechendeNeuberechnung <strong>der</strong> Rente (also e<strong>in</strong>e Rentenanhebung)erfolgen.9 Zur Höhe des abschlagfreien Rentenalters gab es<strong>in</strong> <strong>der</strong> Kommission drei Me<strong>in</strong>ungen:(a) E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Kommission spricht sich dafür aus, dasske<strong>in</strong>e Erhöhung des abschlagfreien Rentenalters
Drucksache 16/2190 – 268 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodeerfolgen darf, um weitere soziale Ungleichheiten zuvermeiden. Zum Ersten ist die Arbeitsmarktlage bism<strong>in</strong>destens 2015 angespannt, was bei Heraufsetzungdes abschlagfreien Rentenalters zu e<strong>in</strong>er Zunahme<strong>der</strong> Langzeitarbeitslosigkeit Älterer, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong>ger<strong>in</strong>ger Qualifizierten und <strong>der</strong> Älteren mit gesundheitlichenBee<strong>in</strong>trächtigungen, führen würde. ZumZweiten geht e<strong>in</strong>e Erhöhung des abschlagfreien Rentenalterszu Lasten <strong>der</strong> Beschäftigten auf Arbeitsplätzenmit begrenzter Tätigkeitsdauer, <strong>der</strong>en quantitativeBedeutung ke<strong>in</strong>esfalls rückläufig ist. Aufsolchen Arbeitsplätzen ist e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeitschon bis zum heutigen Rentenalter nicht möglich.Zum Dritten s<strong>in</strong>d die Lebenserwartung und damit dasRentenbezugsalter <strong>der</strong> Beschäftigten mit kumulativenBelastungen deutlich ger<strong>in</strong>ger als die <strong>der</strong> Beschäftigten,die das künftig erhöhte Rentenalter erreichenkönnen. E<strong>in</strong>e Erhöhung des abschlagfreienRentenalters würde die sozialen Ungleichheiten h<strong>in</strong>sichtlich<strong>der</strong> möglichen Rentenbezugsdauer verschärfen.(b) E<strong>in</strong> an<strong>der</strong>er Teil <strong>der</strong> Kommission vertritt demgegenüberfolgende Position: Im Interesse e<strong>in</strong>er Verlängerung<strong>der</strong> Erwerbsphase stellt die Anhebung <strong>der</strong> Altersgrenzefür den abschlagfreien Bezug e<strong>in</strong>erAltersrente <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherungim Zuge <strong>der</strong> weiter steigenden Lebenserwartung e<strong>in</strong>e<strong>der</strong> Maßnahmen dar, um e<strong>in</strong>e Erhöhung <strong>der</strong> ErwerbsbeteiligungÄlterer zu beför<strong>der</strong>n. Das Wirksamwerdensetzt allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e verän<strong>der</strong>te Arbeitsmarktlage(wie auch weitere flankierende Maßnahmen, so z.B.<strong>zur</strong> erhöhten Weiterbildung u.a. <strong>der</strong> älteren Erwerbstätigen)voraus, die es den älteren Versicherten ermöglicht,länger im Erwerbsleben verbleiben zu können.Die Ankündigung dieser Maßnahme jetzt, aberdas Wirksamwerden unter <strong>der</strong> oben erwähnten Bed<strong>in</strong>gung,ermöglicht Versicherten wie Arbeitgeberne<strong>in</strong>e frühzeitige Orientierung und ggf. Anpassung andie sich <strong>in</strong> Zukunft än<strong>der</strong>nden sozialrechtlichen Bed<strong>in</strong>gungen.Dieser Teil <strong>der</strong> Kommission hält e<strong>in</strong>e solcheMaßnahme unter verteilungs- und sozialpolitischenGesichtspunkten dann für vertretbar, wenn– wofür sie plädiert – das Leistungsniveau <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzlichenRentenversicherung nicht <strong>in</strong> dem Maße reduziertwird, wie dies durch die bislang beschlossenenMaßnahmen erfolgen würde (siehe KapitelE<strong>in</strong>kommenslage im Alter). E<strong>in</strong>e (im Durchschnitt)steigende Lebenserwartung bei unverän<strong>der</strong>tem Alterdes abschlagfreien Rentenbezugs stellt e<strong>in</strong>e Leistungsverbesserungdar. Durch die vorgeschlageneMaßnahme erfolgt bei späterem Rentenbeg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>eAufteilung <strong>der</strong> zusätzlichen Lebenszeit zwischen Erwerbs-und Rentnerphase und damit e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<strong>der</strong> sonst e<strong>in</strong>tretenden zusätzlichen F<strong>in</strong>anzbelastung.(c) E<strong>in</strong> Kommissionsmitglied (Prof. Dr. Kreibich) vertrittdie Position, dass es ke<strong>in</strong>e auf e<strong>in</strong> bestimmtesLebensalter festgelegte allgeme<strong>in</strong>e Rentene<strong>in</strong>trittsgrenzegeben sollte. Die Folgen e<strong>in</strong>es für alle Arbeitnehmergleichermaßen geltendes Rentene<strong>in</strong>trittsalterhaben gezeigt, dass alle Modelle mit starren Altersgrenzengescheitert s<strong>in</strong>d. Sie müssen scheitern, weilsich e<strong>in</strong>erseits die das Rentene<strong>in</strong>trittsalter bestimmendenParamenter ständig verän<strong>der</strong>n (demografischerWandel, ansteigende Lebenszeiten, rasante Verän<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en und beruflichenQualifikationsanfor<strong>der</strong>ungen, anhalten<strong>der</strong> Trend zu<strong>in</strong>dividualistischen Lebens- und Arbeitsformen etc.)und an<strong>der</strong>erseits die persönlichen Voraussetzungenfür Leistungsmöglichkeit und Motivation im Arbeitslebenfür jeden Arbeitnehmer völlig unterschiedlichs<strong>in</strong>d (physische, psychische und geistige Leistungsfähigkeit,Gesundheit, Qualifikationserwerb und Qualifikationsbereitschaft,<strong>in</strong>dividuelle und familiäre Lebensverhältnisseund Lebensplanungen etc.). Hierausergibt sich, dass e<strong>in</strong> fixes Rentene<strong>in</strong>trittsalter für alleArbeitnehmer e<strong>in</strong> Anachronismus ist und zudem mit<strong>der</strong> irreversiblen Zunahme von Informations- undWissensarbeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Wissensgesellschaftnicht vere<strong>in</strong>bar se<strong>in</strong> kann. Deshalb wird für die Festlegunge<strong>in</strong>es Grundarbeitsvolumens (auf <strong>der</strong> Grundlagevon Arbeitszeitkonten) plädiert, dass e<strong>in</strong>e abschlagfreieGrundrente und durch sie e<strong>in</strong>e sichereAltersversorgung garantiert. Für jeden Arbeitnehmer,<strong>der</strong> auf Grund von Arbeitsunfähigkeit nach strengenPrüfungsmaßstäben das Grundarbeitsvolumen nichterbr<strong>in</strong>gen kann, werden Fehlzeiten von <strong>der</strong> Solidargeme<strong>in</strong>schaftausgeglichen.Alle Arbeitnehmer können ansonsten je nach Motivation,Arbeitsbereitschaft und Interesse ihrer Fähigkeitenund Kenntnisse so lange und mit je flexiblen Arbeitsvolum<strong>in</strong>ae<strong>in</strong>setzen wie sie das wünschen. Siekönnen somit flexibler auf Anfor<strong>der</strong>ungen des Arbeitsmarktesreagieren. Gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischergibt sich mittel- und langfristig e<strong>in</strong>an Arbeitsleistung und Produktivität besser angepasstesf<strong>in</strong>anzierbares Rentenniveau. Die Vorteile <strong>der</strong> Erhaltungvon leistungsfähigen, zuverlässigen, erfahrenenund <strong>in</strong>novativen älteren Arbeitskräften imArbeitsprozess s<strong>in</strong>d für die Gesellschaft und dieVolkswirtschaft unschätzbar und empirisch gut nachgewiesen.10 Erwerbsunfähigkeitsrenten möglichst streng anmediz<strong>in</strong>ische Kriterien koppeln: Die Inanspruchnahmevon Erwerbsunfähigkeitsrenten sollte möglichst streng anmediz<strong>in</strong>ische Kriterien gekoppelt und das Vorliegen <strong>der</strong>mediz<strong>in</strong>ischen Voraussetzungen wirksam überprüft werden.Damit brauchen die Abschläge für Altersrente beivorzeitiger Inanspruchnahme nicht mehr <strong>in</strong> gleichemMaße auf die Erwerbsunfähigkeitsrenten übertragen zuwerden, um Anreize für e<strong>in</strong> Ausweichen <strong>in</strong> diese Rentenartzu vermeiden.Handlungsempfehlungen zum Kapitel BildungDie 5. Altenberichtskommission schließt sich den Überlegungen<strong>der</strong> unabhängigen Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierungLebenslangen Lernens“ für Personen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Erwerbsphase weitgehend an und ergänzt sie durch Vorschläge<strong>zur</strong> Nacherwerbsphase. Die Empfehlungen orientierensich auch an den positiven Erfahrungen mit Er-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 269 – Drucksache 16/2190wachsenenstipendien <strong>in</strong> Schweden beim Nachholen vonSchul- und Studienabschlüssen, an den französischenErfahrungen <strong>der</strong> Umlagef<strong>in</strong>anzierung <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e fürbefristete Beschäftigte und Leiharbeiter sowie am neuenfranzösischen Weiterbildungsgesetz, das jedem Beschäftigtenjährlich e<strong>in</strong>en Weiterbildungsanspruch von20 Stunden e<strong>in</strong>räumt.1 Erwachsenenbildungsför<strong>der</strong>ung: Ger<strong>in</strong>ger qualifizierteBeschäftigte müssen frühzeitig durch e<strong>in</strong> Nachholenvon schulischen, beruflichen und Hochschulabschlüssen<strong>in</strong> die <strong>Lage</strong> versetzt werden, ihre Beschäftigungsfähigkeitso zu verbessern, dass sie möglichst bis zum normalenRentenalter erwerbstätig se<strong>in</strong> können. Zu den ger<strong>in</strong>gerqualifizierten Beschäftigten gehören viele Migranten ausden ehemaligen Anwerbelän<strong>der</strong>n. Grundvoraussetzungfür die Verbesserung <strong>der</strong>er Beschäftigungsfähigkeit ist dieFör<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> deutschen Sprachkenntnisse. Die hierzuvorgesehenen Integrationskurse sollen auch die dauerhaft<strong>in</strong> Deutschland lebenden Migranten e<strong>in</strong>beziehen.2 Grundversorgung mit allgeme<strong>in</strong>er Bildung: DieBundeslän<strong>der</strong> und Kommunen sollen wie bislang e<strong>in</strong>e flächendeckendeGrundversorgung mit Angeboten allgeme<strong>in</strong>er,politischer und kultureller Weiterbildung gewährleisten.Dazu zählt auch die Infrastruktur für dasNachholen von Schulabschlüssen, für die Sprach- und Integrationsför<strong>der</strong>ungvon Zuwan<strong>der</strong>ern und für die För<strong>der</strong>ungdes Erwerbs von <strong>in</strong>ternationaler Kompetenz (z.B.Sprache und kulturelle Kompetenz). Län<strong>der</strong> und Kommunensollen sich auf e<strong>in</strong>en bestimmten Prozentsatz ihresHaushalts verständigen, <strong>der</strong> jährlich für die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>allgeme<strong>in</strong>en, politischen und kulturellen Weiterbildung<strong>zur</strong> Verfügung gestellt wird.3 Bildungssparen: Die staatliche För<strong>der</strong>ung nach dem5. Vermögensbildungsgesetz (VermBG) soll um die Möglichkeiterweitert werden, auch Bildungssparen staatlichzu för<strong>der</strong>n. Damit sollen auch für bisher bildungsfernePersonengruppen mit niedrigem E<strong>in</strong>kommen und ger<strong>in</strong>gemeigenen Vermögen Anreize geschaffen werden, e<strong>in</strong>enTeil ihres E<strong>in</strong>kommens <strong>in</strong> lebenslanges Lernen zu <strong>in</strong>vestieren.Erwachsene Lernende sollen auch e<strong>in</strong>kostengünstiges Darlehen für Bildungszwecke aufnehmenkönnen. In das Bildungskonto können auch vermögenswirksameLeistungen des Arbeitgebers e<strong>in</strong>gebrachtwerden. Um Anreize zum Sparen zu erhalten, müssen dieKonten vor staatlichen Zugriffen, z.B. auf das VermögenArbeitsloser, geschützt werden.4 Ausbau betrieblicher Weiterbildung: Die F<strong>in</strong>anzierungbetrieblicher Weiterbildung ist orig<strong>in</strong>äre Aufgabe<strong>der</strong> Betriebe. Der Staat kann allerd<strong>in</strong>gs die Rahmenbed<strong>in</strong>gungenfür betriebliche Weiterbildung verbessern. Vere<strong>in</strong>barungenzu betrieblichen Lernzeitkonten zwischenden Sozialpartnern sollen durch gesetzliche Regelungen<strong>zur</strong> Insolvenzsicherung <strong>der</strong> Guthaben, durch e<strong>in</strong>e nachgelagerteBesteuerung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zahlungen sowie durch dieAllgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeitserklärung von freiwilligen Vere<strong>in</strong>barungen<strong>zur</strong> Umlagef<strong>in</strong>anzierung, wie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bauwirtschaft,verbessert werden. Ähnlich wie <strong>in</strong> Dänemark,Schweden o<strong>der</strong> Frankreich sollen Beschäftigte für Bildungsmaßnahmenmit e<strong>in</strong>em Rückkehrrecht freigestelltwerden. Angesichts <strong>der</strong> hohen Arbeitsmarktrisiken vonLeiharbeitnehmern soll e<strong>in</strong>e Umlage von e<strong>in</strong>em Prozent<strong>der</strong> Lohnsumme für Qualifizierung erhoben werden. DieUmlagemittel sollen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en von den Sozialpartnern verwaltetenFonds fließen und <strong>in</strong> verleihfreien Zeiten für dieWeiterbildung genutzt werden.5 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: Die Bundesagenturfür Arbeit soll nach Vorstellung <strong>der</strong> Kommissionkünftig stärker als bisher präventiv die Weiterbildung<strong>der</strong> auf dem Arbeitsmarkt am stärksten gefährdetenGruppe <strong>der</strong> An- und Ungelernten im Betrieb för<strong>der</strong>n. Dabeisollen nicht nur wie bisher Maßnahmen geför<strong>der</strong>twerden, die mit e<strong>in</strong>em Berufsabschluss enden, son<strong>der</strong>nauch anerkannte Module, die zu solchen Abschlüssenh<strong>in</strong>führen können. Weiterh<strong>in</strong> sollen die Bildungsbemühungenvon Arbeitslosen durch Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchsbei eigen<strong>in</strong>itiierter Weiterbildung gestärktwerden.Zur Vermeidung von negativen Selektionseffekten zumNachteil ger<strong>in</strong>g Qualifizierter sollen die prognostiziertenVerbleibsquoten bei Weiterbildungsmaßnahmen flexiblergehandhabt werden. Je<strong>der</strong> potenziell von Arbeitslosigkeitbedrohte über 40-Jährige sollte Anrecht auf e<strong>in</strong> Bildungsprofil<strong>in</strong>ghaben, das den <strong>in</strong>dividuellen Bildungsbedarffeststellt.6 Verbesserung <strong>der</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für lebenslangesLernen: Die Kommission empfiehlt– die Möglichkeiten <strong>zur</strong> Stärkung eigenverantwortlichenPatientenhandelns durch verän<strong>der</strong>te Informations- undBeratungsstrukturen zu för<strong>der</strong>n,– die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt durch die Bündelungvon Qualifikationen <strong>in</strong> anerkannten Berufeno<strong>der</strong> Fortbildungsgängen zu erhöhen,– zukünftig die Zertifizierung von im Berufsleben o<strong>der</strong>im außerberuflichen Alltag erworbenen Kenntnissenund Fähigkeiten verstärkt zu stimulieren und zu unterstützen,– die Weiterbildungsangebote zeitlich zu flexibilisieren,damit Erwachsene Beruf und Lernen besser mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong>komb<strong>in</strong>ieren können,– lernför<strong>der</strong>liche (dezentrale) Formen <strong>der</strong> Arbeitsorganisationmit größeren <strong>in</strong>dividuellen Handlungsspielräumenzu entwickeln, <strong>in</strong> denen <strong>in</strong>formelles und nonformales Lernen direkt angeregt und gesichert wird,– durch Rahmensetzungen <strong>in</strong> Arbeits- und Produktmärktenvielfältige Anreize für die betriebliche Weiterbildungund lebenslanges Lernen zu erzeugen.7 För<strong>der</strong>ung von Eigenverantwortung im Gesundheitssystem:Aus gesundheitspolitischer Perspektive s<strong>in</strong>dBildungsangebote wegen ihrer Bedeutung für Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund Prävention unverzichtbar. Angesichts<strong>der</strong> nachgewiesenen Erfolge <strong>der</strong>artiger Programme liegtes nahe, gezielte Anreizsysteme zu schaffen. Gleiches gilt
Drucksache 16/2190 – 270 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodefür Schulungen mit dem Ziel e<strong>in</strong>es besseren Krankheitsmanagementsund e<strong>in</strong>er effektiveren Nutzung von Möglichkeitendes Versorgungssystems.8 Entwicklung von Qualitätsstandards als Grundlagegezielter För<strong>der</strong>ung von Bildungsbeteiligungnach <strong>der</strong> Erwerbsphase: Im Bereich von Gesundheit,Leistungsfähigkeit und Krankheitsmanagement soll dieEntwicklung von Qualitätsstandards, anhand <strong>der</strong>er sichdie Effektivität von Bildungsmaßnahmen abbilden lässt,gezielt vorangetrieben werden.Handlungsempfehlungen zum Kapitel E<strong>in</strong>kommenslageim Alter und künftige EntwicklungDie Gefahr ist nicht von <strong>der</strong> Hand zu weisen, dass die gesetzlicheRentenversicherung (GRV) mit ihrer engenLeistungs-Gegenleistungs-Beziehung angesichts des Niveauabbausihre Legitimation zunehmend verlieren unddie Transformation <strong>in</strong> e<strong>in</strong> eher allgeme<strong>in</strong>es Umverteilungssystem(ggf. sogar verknüpft mit Bedürftigkeitsüberprüfung)e<strong>in</strong>treten könnte. Zudem lässt die Beitragsorientierung<strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV vermuten, dass es immer dannzu weiteren E<strong>in</strong>schnitten im Leistungsrecht kommenkönnte, wenn das Beitragsziel verletzt zu werden droht.Des Weiteren ist ebenfalls nicht von <strong>der</strong> Hand zu weisen,dass es angesichts des drastisch verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Leistungsniveaus<strong>der</strong> GRV für die Bürger zu verpflichtenden Formen<strong>der</strong> kapitalfundierten <strong>in</strong>dividuellen o<strong>der</strong> über Betriebeabgewickelten Alterssicherung kommen wird, alsofaktisch zu e<strong>in</strong>em zweiten obligatorischen System neben<strong>der</strong> GRV. Allerd<strong>in</strong>gs ließen sich damit zum<strong>in</strong>dest Ungleichheiten<strong>in</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommensverteilung auf Grund vonselektiver Nutzung <strong>der</strong> privaten Altersvorsorgemöglichkeitenvermeiden.Die Kommission spricht sich demgegenüber für folgendeStrategie im H<strong>in</strong>blick auf die künftige Entwicklung <strong>der</strong>Alterse<strong>in</strong>kommen aus, <strong>der</strong>en zentrale Elemente s<strong>in</strong>d:1 Leistungsniveau <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV: Die gesetzliche Rentenversicherung(GRV) soll bei längerer Versicherungsdauerweiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Leistungsniveau beibehalten, das aberdeutlich über <strong>der</strong> steuerf<strong>in</strong>anzierten bedarfs- o<strong>der</strong> bedürftigkeitsgeprüftenarmutsvermeidenden M<strong>in</strong>destsicherungliegt.2 Enge Beitrags-Leistungs-Beziehung <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRVherstellen: Für die GRV soll e<strong>in</strong>e enge Beitrags-Leistungs-Beziehungerhalten bleiben. Dies soll auch durchdie sachgerechte F<strong>in</strong>anzierung von Umverteilungsaufgaben<strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> GRV verdeutlicht werden. Das betrifft<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>em Maße die F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbliebenenversorgung.Der Zahlbetrag <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbliebenenrentenist abhängig von e<strong>in</strong>er im Pr<strong>in</strong>zip alle an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>künfteberücksichtigenden Bedarfsprüfung. DieF<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er solchen bedarfsgerechten Transferzahlungerfor<strong>der</strong>t allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsmittel und nichtdie Deckung durch am Arbeitsverhältnis anknüpfendeSozialversicherungsbeiträge. Durch e<strong>in</strong>e sachadäquateF<strong>in</strong>anzierung würde die Beitragsbelastung (auch <strong>der</strong> Arbeitgeber)reduziert.3 Erhöhung <strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung Älterer: Für e<strong>in</strong>enTeil <strong>der</strong> Kommission ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhange<strong>in</strong>e Anpassung <strong>der</strong> Regelungen für den Bezug e<strong>in</strong>er abschlagfreienAltersrente im Zuge <strong>der</strong> sich hoffentlich weitererhöhenden Lebenserwartung e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> Möglichkeiten.Sie wäre nach dieser Sicht auch sozial- und verteilungspolitischvertretbar, wenn das Leistungsniveau <strong>der</strong> GRVauf e<strong>in</strong>em von <strong>der</strong> Kommission für erfor<strong>der</strong>lich gehaltenenNiveau verbleibt. An<strong>der</strong>enfalls bestünde die Gefahr,dass primär <strong>zur</strong> Vermeidung von E<strong>in</strong>kommensarmut imAlter e<strong>in</strong>er Erwerbstätigkeit weiter nachgegangen werdenmuss. Das Wirksamwerden e<strong>in</strong>er solchen jetzt anzukündigendenVerän<strong>der</strong>ung setzt allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e verän<strong>der</strong>te Arbeitsmarktlagevoraus und erfor<strong>der</strong>t flankierende Maßnahmen.Für e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Teil <strong>der</strong> Kommission bildetdie Anpassung <strong>der</strong> Altersgrenze für den abschlagfreienBezug e<strong>in</strong>er Altersrente <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV unter den gegenwärtigenArbeitsmarktbed<strong>in</strong>gungen und wegen <strong>der</strong> aktuellenbetrieblichen Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen Älterer ke<strong>in</strong>edafür geeignete Maßnahme, da ansonsten weitere sozialeUngleichheiten drohen (siehe hierzu auch die Empfehlungenzum Kapitel Erwerbsarbeit).4 Statt Subventionierung von F<strong>in</strong>anzkapital För<strong>der</strong>ungvon „Humankapital“: Wenn für die wirtschaftlicheEntwicklung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em rohstoffarmen Land wieDeutschland das „Humankapital“ von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutungist, dann liegt es nahe, bei knappen öffentlichenMitteln statt <strong>der</strong> Subventionierung von F<strong>in</strong>anzkapital fürdie Privatvorsorge (verbunden mit erheblichen Mitnahmeeffekten)vermehrt öffentliche Mittel für die Weiterqualifizierunge<strong>in</strong>zusetzen. Weiterqualifizierung ist e<strong>in</strong>wichtiger Faktor für die künftige Entwicklung von Produktivitätund E<strong>in</strong>kommen und damit zugleich für dieMöglichkeit, steigende Vorsorgeaufwendungen zu akzeptierenund zu tragen, bei gleichzeitig noch steigenden laufendenNettoe<strong>in</strong>kommen (siehe Empfehlung zum KapitelBildung).5 Private und betriebliche Alterssicherung als Ergänzungbei <strong>in</strong>sgesamt reduzierter Gesamtbelastung:Insgesamt würde durch diese Maßnahmen kaum e<strong>in</strong> höhererBeitragssatz <strong>in</strong> <strong>der</strong> GRV als jetzt politisch angestrebterfor<strong>der</strong>lich. Um das bisherige Absicherungsniveauim Alter aufrecht zu erhalten, verr<strong>in</strong>gert sich die Notwendigkeitfür private Vorsorge. Private und betriebliche Vorsorgewürden ihre Ergänzungsfunktion behalten und nichtzum (partiellen) Ersatz für die GRV werden. Tendenziellkönnte damit sogar die Gesamtbelastung für die privatenHaushalte bei vergleichbarem Sicherungsniveau niedrigerse<strong>in</strong> als bei <strong>der</strong> jetzt e<strong>in</strong>geschlagenen politischen Strategie,da die Übergangskosten von Umlage- zu Kapitaldeckungger<strong>in</strong>ger würden.6 E<strong>in</strong>bezug aller bislang nicht obligatorisch abgesichertenSelbstständigen <strong>in</strong> die GRV: Ergänzend läge esnahe, alle Selbstständigen, die bislang ke<strong>in</strong>em obligatorischenAlterssicherungssystem angehören, <strong>in</strong> die GRVe<strong>in</strong>zubeziehen. Der Hauptgrund dafür ist nicht <strong>der</strong> (ggf.nur vorübergehende) E<strong>in</strong>fluss auf die F<strong>in</strong>anzlage <strong>der</strong>GRV, son<strong>der</strong>n vielmehr die Vermeidung von E<strong>in</strong>kom-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 271 – Drucksache 16/2190mensarmut bei dieser Personengruppe, die bisher schonsehr heterogen war und durch neue Formen von Selbstständigkeitnoch heterogener wird.7 Für e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tegrierten Ansatz <strong>in</strong> <strong>der</strong> Alterssicherungspolitik:E<strong>in</strong>e nachhaltige Alterssicherungspolitikdarf sich aber nicht alle<strong>in</strong> auf die Alterssicherungssysteme(<strong>der</strong>en F<strong>in</strong>anzierung, Leistungen und Besteuerung) beschränken,son<strong>der</strong>n hat auch weitere für die (reale) E<strong>in</strong>kommenslageim Alter wichtige – und politisch gestaltbare –Entwicklungen zu berücksichtigen, wie <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e Höheund Struktur von Sozialversicherungsleistungen im Fallevon Krankheit und Pflegebedürftigkeit, was aus den laufendenAlterse<strong>in</strong>kommen (wegen Zuzahlung, Begrenzungendes Leistungskatalogs u.a.m.) zu f<strong>in</strong>anzieren ist. E<strong>in</strong>e<strong>der</strong>artige <strong>in</strong>tegrierte Sicht und Entscheidungsvorbereitungwird von <strong>der</strong> Kommission für dr<strong>in</strong>gend erfor<strong>der</strong>lich gehalten.Handlungsempfehlungen zum Kapitel Chancen <strong>der</strong>Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> DeutschlandDie Kommission begreift die „Seniorenwirtschaft“ e<strong>in</strong>erseitsals Element <strong>zur</strong> Steigerung <strong>der</strong> Lebensqualität ältererMenschen durch Dienste und Angebote auf privatenKonsumgüter- und Dienstleistungsmärkten. An<strong>der</strong>erseitsbegreift sie die „Seniorenwirtschaft“ auch als e<strong>in</strong>en neuenImpulsgeber für wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung.Allerd<strong>in</strong>gs ist dies e<strong>in</strong>e ambitionierte Aufgabe,die zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> <strong>der</strong> Anfangsphase noch öffentlicherFör<strong>der</strong>ung und Unterstützung bedarf.1 Differenzierte Markterschließung und Sensibilisierung<strong>der</strong> Akteure: E<strong>in</strong>e <strong>der</strong> wichtigsten zukünftigenAufgaben <strong>der</strong> Wissenschaft und <strong>der</strong> Marktforschung bestehtnach Auffassung <strong>der</strong> Kommission dar<strong>in</strong>, die differenziertenBedürfnisse und Interessen <strong>der</strong> älteren Menschennoch systematischer <strong>in</strong> den Blick zu nehmen,transparent zu machen und dieses Wissen auch zu verbreiten.Die Kommission ist <strong>der</strong> Ansicht, dass hierfür aufBundesebene e<strong>in</strong> „Masterplan Seniorenwirtschaft“ erarbeitetwerden sollte, <strong>der</strong> sowohl die Nachfrageseite mitihren speziellen Bedürfnissen als auch die Angebotsseiteberücksichtigt und die Potenziale auch auf die Ebene <strong>der</strong>Akteure „herunterbricht“. Durch Kooperation und Wissenstransferunter den beteiligten Akteuren können verstreuteE<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>itiativen sichtbar gemacht sowie neue Impulsefür die Weiterentwicklung des „silver market“gegeben werden.2 Berücksichtigung auch <strong>der</strong> Konsumbedürfnissesozial schwacher älterer Menschen: SeniorenwirtschaftlicheProdukte und Dienste müssen für das gesamteSpektrum <strong>der</strong> älteren Bevölkerung zugänglich se<strong>in</strong>, dasheißt u.a. auch für sozial und E<strong>in</strong>kommensschwache sowiefür ältere Personen <strong>in</strong> strukturschwachen Regionenbezahlbar und verfügbar se<strong>in</strong>. Dies wie<strong>der</strong>um erfor<strong>der</strong>tvielfach auch den f<strong>in</strong>anziellen E<strong>in</strong>satz <strong>der</strong> kommunalenEbene. Berührt s<strong>in</strong>d dabei nicht nur freiwillige Leistungen,son<strong>der</strong>n auch Soll- und Mussleistungen (z.B. gemäßden Bestimmungen im Sozialhilferecht). Auch das SGB IXist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang anzusprechen, denn vieleältere, vor allem pflegebedürftige Menschen s<strong>in</strong>d zugleichbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>t und von daher potenziell leistungsberechtigtfür Hilfen <strong>zur</strong> Teilhabe <strong>in</strong> <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft.3 Befähigung <strong>zur</strong> Selbstorganisation und stärkerekonsumrelevante Interessenvertretung <strong>der</strong> älteren<strong>Generation</strong>: Auch für die älteren Menschen selbst bestehtdie Aufgabe, sich ihren Bedürfnissen und Ansprüchennoch stärker als bisher bewusst zu werden und Erwartungenzu formulieren. Als Mediator dieser Interessensollten beispielsweise die Seniorenorganisationen auftreten,zumal sich bereits die Dachorganisationen <strong>der</strong> Seniorenverbände(BAGSO) sowie <strong>der</strong> Verbraucherzentralenund Verbraucherverbände seit kurzem den Konsum<strong>in</strong>teressenälterer Menschen angenommen haben. Gerade auförtlicher Ebene bietet sich für die lokalen Seniorenvertretungenhier e<strong>in</strong> neues Aktionsfeld an.4 Dialogische Produkt- und Dienstleistungsentwicklung:Die Kommission ist <strong>der</strong> Auffassung, dass das spezifischeVerbraucherwissen <strong>der</strong> älteren Menschen selbstbislang bei <strong>der</strong> Markt- und Produktentwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Seniorenwirtschaftviel zu kurz gekommen ist. Sie for<strong>der</strong>t<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong>novative Unternehmen auf, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en konkretenDialog mit den potenziellen Abnehmern und Nutzernseniorenwirtschaftlicher Produkte und Dienste zutreten. Solche Formen „dialogischer Produkt- und Dienstleistungsentwicklung“und e<strong>in</strong> darauf bezogenes Benchmark<strong>in</strong>g-Konzepthätten nach Auffassung <strong>der</strong> Kommissiongute Chancen mitzuhelfen, die immer nochdom<strong>in</strong>ierende Distanz zwischen Privatwirtschaft undKunden aus <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> älteren Menschen zu überbrücken.5 Verbesserung und Erweiterung <strong>der</strong> vorhandenenProdukte und Dienstleistungen: Vor diesem H<strong>in</strong>tergrundmüssen die bereits vorhandenen Angebote verbessert un<strong>der</strong>weitert werden. Notwendig dafür ist das systematischeE<strong>in</strong>holen von Kundenerfahrungen und -me<strong>in</strong>ungen. Notwendigist weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e diversifizierte Produktstrategie,die sich an den <strong>in</strong>dividuellen Bedürfnissen <strong>der</strong> älterenAbnehmer ausrichtet. Bei <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>en Produktgestaltunggilt es zukünftig verstärkt darauf zu achten, dass dieProdukte nutzer- und bedienungsfreundlich und dementsprechende<strong>in</strong>fach auch von älteren Menschen zu handhabens<strong>in</strong>d. Gleichzeitig ist bei dem Design von speziellenProdukten für Senior<strong>in</strong>nen und Senioren darauf zu achten,dass man dieses den Produkten nicht ansieht („Designfor all Ages“).6 Senioren-Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung – dabei stärkereBerücksichtigung kle<strong>in</strong>er Unternehmen: Die bislang <strong>in</strong>e<strong>in</strong>igen Bundeslän<strong>der</strong>n gesammelten Erfahrungen habengezeigt, dass durch Vorgabe gezielter wirtschaftlicher undpolitischer Impulse das ökonomische QuerschnittsfeldSeniorenwirtschaft <strong>in</strong>itiiert, geför<strong>der</strong>t und gestärkt werdenkann. Von diesen Erfahrungen könnte auch die lokaleWirtschaftsför<strong>der</strong>ung an<strong>der</strong>norts profitieren. Zur gesamtwirtschaftlichenUnterstützung seniorenwirtschaftlicherInitiativen ist nach Auffassung <strong>der</strong> Kommission e<strong>in</strong>e För-
Drucksache 16/2190 – 272 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode<strong>der</strong>politik zu entwickeln, die sich auch an den Bedürfnissenkle<strong>in</strong>er, gerade erst gegründeter Unternehmen orientiert.7 E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Verbraucherschutzes für ältereMenschen: E<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>s wichtige Aufgabe besteht <strong>in</strong><strong>der</strong> E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es funktionierenden und öffentlichkeitswirksamenVerbraucherschutzes. Die Kommissionist <strong>der</strong> Auffassung, dass die „Seniorenwirtschaft“ bislangvon den etablierten Anbietern Verbraucher<strong>in</strong>formationund -beratung nur un<strong>zur</strong>eichend ernst genommen wordenist. Sie begrüßt aus diesem Grunde die jüngsten Initiativendes organisierten Verbraucherschutzes zu Gunsten ältererMenschen. An<strong>der</strong>erseits s<strong>in</strong>d viele ältere Konsumentenauf Grund e<strong>in</strong>geschränkter Lebensverhältnissegerade nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Lage</strong>, e<strong>in</strong>e aktive Rolle als „kritischeVerbraucher“ auszuüben und s<strong>in</strong>d dabei auf externe Unterstützungangewiesen. Dabei geht es <strong>der</strong> Kommissionnicht nur um geeignete Prüf<strong>in</strong>stitutionen und e<strong>in</strong>e zielgenauere„Vermarktungsstrategie“, son<strong>der</strong>n auch um dieEntwicklung entsprechen<strong>der</strong> Instrumente und Verfahren.Exemplarisch verweist die Kommission hier auf das Prüfsiegel„Komfort und Qualität“.Handlungsempfehlungen zum Kapitel Potenziale desAlters <strong>in</strong> Familie und privaten NetzwerkenDie folgenden Empfehlungen zielen darauf ab, vorhandenePotenziale älter werden<strong>der</strong> Männer und Frauen <strong>in</strong>Familie und privaten Netzwerken zu erhalten und neuePotenziale <strong>in</strong> diesen Bereichen zu wecken und zu stärken.Dabei geht es <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e um die Unterstützung und denSchutz helfen<strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong>, die größere Sensibilisierungfür Bedürfnisse <strong>in</strong> unterschiedlichen Partnerschaftsformensowie gegenüber Konflikten <strong>in</strong> privatenPflegearrangements, um die Qualifizierung professionellerHelferstrukturen für Familien und die Schaffung vonRahmenbed<strong>in</strong>gungen für bürgerschaftliches Engagement.1 Die erweiterten Aufgaben von Familien wahrnehmenund diese neuen Leistungen anerkennen: Insbeson<strong>der</strong>eist die Tatsache zu würdigen, dass e<strong>in</strong> großer Anteil<strong>der</strong> <strong>in</strong>tergenerationalen Hilfen von den Älteren selbstgeleistet wird. Der Erhalt dieser Leistungen älter werden<strong>der</strong>Familien sollte u.a. durch die Erhöhung und vor allemDynamisierung des Pflegegeldes, aber auch durch dendifferenzierten Ausbau ambulanter Strukturen <strong>der</strong> professionellenPflege realisiert werden.2 Fragiler und vielfältiger werdende partnerschaftlicheLebensbezüge stützen: Diesen Verän<strong>der</strong>ungensollte durch angemessene professionelle UnterstützungsangeboteRechnung getragen werden, zugleich könntenneue Formen bürgerschaftlichen Engagements und <strong>der</strong>Selbsthilfe möglicherweise auftretende Unterstützungsdefizitekompensieren.3 Unterschiedliche Partnerschaftsformen anerkennen:Homosexuelle Partnerschaften sollten beim differenziertenAusbau von unterstützenden Systemen für dasLeben im Alter mehr Aufmerksamkeit erhalten als bisher.Das bezieht sich auf die Entwicklung von spezifischenAngeboten auf dem Pflegemarkt, auf die Entwicklungkommunaler Strukturen sowie die Beachtung unterschiedlicherLebensformen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildungprofessioneller Helfer.4 Unterstützung zwischen alt werdenden Eltern un<strong>der</strong>wachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n sichern: Es besteht die Gefahr,dass das gegenwärtig noch feste Netz <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>ensolidaritätbrüchiger wird. Daraus resultierende Defizite<strong>der</strong> Hilfeleistungserbr<strong>in</strong>gung müssen entwe<strong>der</strong> durch bürgerschaftlichesEngagement o<strong>der</strong> durch professionelleambulante Hilfe aufgefangen werden. Nicht zuletzt bedeutetdies aber auch, dass das stationäre System <strong>der</strong>Hilfe und Unterstützung auf diese Entwicklungen reagierenmuss.5 Vere<strong>in</strong>barkeit von Familienarbeit „Pflege“ undErwerbsarbeit unterstützen: In den Betrieben muss e<strong>in</strong>Bewusstse<strong>in</strong> dafür geschaffen werden, dass Pflege undUnterstützung alter Familienmitglie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e neue Aufgabevon Familien ist. Die Ermöglichung dieser Aufgabebei gleichzeitigem Erhalt <strong>der</strong> Berufstätigkeit und e<strong>in</strong>esArbeitsverhältnisses ist zu för<strong>der</strong>n. Weiterh<strong>in</strong> müssen dieKommunen unterschiedliche Formen geme<strong>in</strong>schaftlichenWohnens unterstützen. Um Kapazitäten für die Vielfalt<strong>der</strong> <strong>in</strong>tergenerativen Hilfestellung zu schaffen, müssendie Strukturen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung geför<strong>der</strong>t werden.Nicht zuletzt müssen professionelle Helfer mehr als bislangfür die Zusammenarbeit mit familialen Strukturenausgebildet und geschult werden.6 Beziehung zwischen Großeltern und Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>nstärken: Bei <strong>der</strong> Enkelk<strong>in</strong><strong>der</strong>generation könnte dieE<strong>in</strong>sicht geför<strong>der</strong>t werden, dass das Wissen und die Erfahrungvon Großeltern auch für das eigene Leben vonBedeutung se<strong>in</strong> kann. E<strong>in</strong>richtung und För<strong>der</strong>ung vonWissensbörsen, Zeitzeugenbörsen und Kontaktstellenzwischen Großeltern- und Enkel-<strong>Generation</strong>, und zwarauch für Personen die nicht mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> verwandt s<strong>in</strong>d,könnten den Austausch und den Zusammenhalt <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>enför<strong>der</strong>n.7 Private Hilfenetzwerke unterstützen und neueWohnformen entwickeln: U.a. sollten Kommunen Modellprojektedes geme<strong>in</strong>schaftlichen Wohnens för<strong>der</strong>no<strong>der</strong> bürgerschaftliches Engagement und die gegenseitigeSelbsthilfe anerkennen. Insbeson<strong>der</strong>e für demenziell erkrankteMenschen sollten Wohnmodelle stärker geför<strong>der</strong>twerden. Dafür muss es e<strong>in</strong>en festen Ansprechpartner <strong>in</strong>den Kommunen geben, und die Vorhaben müssen <strong>in</strong> <strong>der</strong>Kommunalpolitik verankert werden.8 Professionelle Angebotsstrukturen an <strong>in</strong>dividuellenBedürfnissen von Pflegearrangements ausrichten:Leistungserbr<strong>in</strong>ger sollten ihre Angebote differenziertund zielgruppenspezifisch entwickeln und auf Bedürfnisseunterschiedlicher Nutzergruppen ausrichten. DieLeistungserbr<strong>in</strong>gung von pflegerischer, hauswirtschaftlicherund sonstiger Angebote sollte an den jeweiligen Beson<strong>der</strong>heitenund Bedürfnissen von Pflegearrangementsausgerichtet werden. Dabei sollte beson<strong>der</strong>es Augenmerk
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 273 – Drucksache 16/2190auf die Unterstützung von Pflegepersonen gerichtet werden.Mitarbeiter im Bereich <strong>der</strong> häuslichen Pflege, aberauch Angehörige <strong>der</strong> privaten Netzwerke sollten Konflikte,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> privaten Pflegearrangements, erkennenund <strong>der</strong>en Lösung unterstützen.9 Professionelle Angebote vernetzen und Beratungverbessern: Die Versorgung von hilfe- und pflegebedürftigenMenschen, die häufig auch chronisch und mehrfacherkrankts<strong>in</strong>d, sollte durch die Vernetzung von Angeboten<strong>der</strong> Altenhilfe und des Gesundheitswesens verbessertwerden. Dabei sollten stets die Belange und Bedürfnissevon Pflegepersonen aus dem familialen und privatenNetzwerk berücksichtigt werden. E<strong>in</strong> Instrument <strong>zur</strong> besserenVernetzung sollten personengebundene Pflegebudgetsse<strong>in</strong> – allerd<strong>in</strong>gs unter <strong>der</strong> Voraussetzung von Case-Management-Strukturen. Die Beratung pflegebedürftigerund pflegen<strong>der</strong> Menschen kann beispielsweise durch dieVernetzung und Koord<strong>in</strong>ation bereits bestehen<strong>der</strong> Angebote,durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit sowie durchden E<strong>in</strong>satz mo<strong>der</strong>ner Kommunikations- und Informationstechnologienverbessert werden. Dabei ist die Unabhängigkeitvon Beratung sicherzustellen. Die Verantwortungfür die Vernetzung bestehen<strong>der</strong> Beratungsangebotesowie <strong>der</strong>en Qualitätskontrolle liegt bei den Kommunen.10 Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engagementsbei Reformen <strong>der</strong> Versorgungssysteme für ältereund alte Menschen: Die Kooperation von professioneller,ehrenamtlicher und familiärer Hilfe und dieFör<strong>der</strong>ung von gemischten Hilfearrangements muss <strong>in</strong>Zukunft gestärkt werden, die Ermöglichung gemischterHilfearrangements sollte systematisch geför<strong>der</strong>t werden.Die Gew<strong>in</strong>nung und E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von bürgerschaftlich engagiertenHelfer<strong>in</strong>nen und Helfern <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e für Betreuungsaufgabensowie <strong>der</strong>en rechtliche, fachliche undorganisatorische Unterstützung sollte verbessert werden.Die Informations- und Kontaktstellen für engagierte undengagementbereite Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger müssen stärkerausgebaut und die bestehenden Institutionen langfristigabgesichert werden. Bestehende Seniorenbüros, Freiwilligenagenturenund Selbsthilfekontaktstellen solltenbesser mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> vernetzt bzw. <strong>in</strong> diesem Bemühen unterstütztwerden.Handlungsempfehlungen zum Kapitel Engagementund Teilhabe älterer Menschen1 E<strong>in</strong>e Kultur des bürgerschaftlichen Engagementsför<strong>der</strong>n:– E<strong>in</strong>e Kultur <strong>der</strong> Motivation von Freiwilligen für bürgerschaftlichesEngagement entwickeln: Es solltensystematische E<strong>in</strong>führungsgespräche mit potenziellenFreiwilligen <strong>zur</strong> gegenseitigen Information über dieMotivation zum Engagement und das Aufgabenprofil<strong>der</strong> Tätigkeiten erfolgen. Dar<strong>in</strong> sollte e<strong>in</strong>e Aushandlungmit konkreten Absprachen zu e<strong>in</strong>em möglichenBeg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> freiwilligen Tätigkeit, den zeitlichen Umfang<strong>der</strong> Tätigkeit und dem Zeitpunkt bzw. den Modalitätenfür die Beendigung e<strong>in</strong>er Tätigkeit sowie <strong>in</strong>haltlicheAbsprachen getroffen werden. Ferner s<strong>in</strong>dFragen des Auslagenersatzes und eventueller Vergünstigungensowie <strong>der</strong> Versicherung während <strong>der</strong> Tätigkeitenanzusprechen. Zudem müssen Ansprechpartnerbenannt und die Möglichkeit von Fortbildung erörtertwerden. E<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Öffentlichkeitsarbeit <strong>zur</strong>Freiwilligenarbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Organisation sowie die Präsenzauf lokalen Festen und Veranstaltungen könnendie Gew<strong>in</strong>nung von Freiwilligen zudem maßgeblichunterstützen.– E<strong>in</strong>e Kultur <strong>der</strong> Pflege und Anerkennung des bürgerschaftlichenEngagements för<strong>der</strong>n: Ob Freiwilligee<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>mal aufgenommene Tätigkeit auch fortsetzen,hängt von verschiedenen Faktoren ab, die nicht allevon den Organisationen, <strong>in</strong> <strong>der</strong>en mehr o<strong>der</strong> wenigerformellen Rahmen sie angesiedelt s<strong>in</strong>d, bee<strong>in</strong>flusstwerden können. Folgende Punkte können die Verstetigungdes Engagements positiv bee<strong>in</strong>flussen:– E<strong>in</strong>e Kultur des Ausscheidens aus Engagementverhältnissenentwickeln: Organisationen, die mit Freiwilligenarbeiten, sollten dem Ausscheiden aus demEngagement e<strong>in</strong>en ebenso hohen Stellenwert beimessenwie dem Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es Engagements, zumal dasepisodenhafte Engagement als Muster <strong>der</strong> Beteiligungzunimmt. Wenn es sich um e<strong>in</strong>en kurzzeitigen, befristetenE<strong>in</strong>satz gehandelt hat, können Nachweise übergeleistete Tätigkeiten für die Freiwilligen hilfreichse<strong>in</strong>. Das Thema des Ausstiegs von langjährig tätigenälteren Ehrenamtlichen und <strong>der</strong> <strong>in</strong>terne <strong>Generation</strong>enwechselist <strong>in</strong> vielen Organisationen e<strong>in</strong> Tabu. Um solcheÜbergänge für alle Beteiligten möglichst zufriedenstellend zu regeln, sollten solche Fragen möglichstfrühzeitig offen angesprochen werden.2 Das Verhältnis von hauptamtlicher und freiwilligerArbeit aktiv gestalten: Hauptamtliche übernehmenneben <strong>der</strong> Betreuung <strong>der</strong> Freiwilligen häufig die Aufgabe,die F<strong>in</strong>anzierung und Qualifizierung zu sichern, neueProjekte zu <strong>in</strong>itiieren bzw. Mittel zu akquirieren, Qualitätsstandards<strong>der</strong> Freiwilligenarbeit zu sichern, gesellschaftlicheAnerkennung und Wertung durch Lobbyarbeit<strong>in</strong> Politik und Verwaltung zu etablieren und die Kooperationund Vernetzung von Unternehmen, Verbänden undOrganisationen voranzutreiben. In Organisationen, <strong>in</strong> denenhauptamtliche und freiwillige Mitarbeiter<strong>in</strong>nen undMitarbeiter geme<strong>in</strong>sam arbeiten, sollte dieses potenziellkonfliktträchtige Verhältnis durch möglichst klare Absprachengeregelt se<strong>in</strong>. Dazu gehört u.a., dass e<strong>in</strong>e klarumrissene Aufgabenteilung zwischen Hauptamtlichenund Freiwilligen festgelegt wird.3 Pluralität und Wandel von Motiven und Engagementformenberücksichtigen und ermöglichen: Auchwenn ältere Menschen nicht als treibende Kraft im Prozess<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung des Ehrenamtes gelten, so müssensich Organisationen auch bei Freiwilligen <strong>der</strong> höherenAltersgruppen auf e<strong>in</strong>e Verän<strong>der</strong>ung von Motivationund Engagementformen vorbereiten bzw. e<strong>in</strong>stellen.Dazu gehört u.a., dass auch für ältere Menschen verstärktzeitlich flexible Engagementmöglichkeiten und kürzere
Drucksache 16/2190 – 274 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiodebefristete Aufgaben für das „H<strong>in</strong>e<strong>in</strong>schnuppern“ <strong>in</strong> Initiativenund Organisationen angeboten werden, dass gezieltgeschlechtsspezifische o<strong>der</strong> schichtenspezifische Motive,Vorerfahrungen und Engagementbedürfnisse zu berücksichtigens<strong>in</strong>d.4 Wissensdefizite <strong>in</strong> den Unternehmen beseitigenund Engagementkultur stärken: In den meisten deutschenBetrieben fehlt es noch immer an e<strong>in</strong>em eigenenKonzept ihres Status als Corporate Citizens. E<strong>in</strong> Verständnisfür die Chancen des Corporate Volunteer<strong>in</strong>g sowieklare Vorstellungen, wie e<strong>in</strong> gezieltes Corporate Volunteer<strong>in</strong>g<strong>in</strong> dem jeweiligen spezifischen betrieblichenKontext <strong>in</strong>stitutionalisiert werden kann, s<strong>in</strong>d bis auf Ausnahmenwenig bis gar nicht ausgeprägt. Insbeson<strong>der</strong>e istdie Erkenntnis, dass engagierte ehemalige Beschäftigteals positive Visitenkarte ihres Unternehmens wahrgenommenwerden könnten, noch zu wenig verankert.Unternehmen können e<strong>in</strong> vorhandenes bürgerschaftlichesEngagement ihrer Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter<strong>in</strong>formell anerkennen und unterstützen, <strong>in</strong>dem sie diesendie Möglichkeit geben, ihre Arbeitszeit so flexibel zu gestalten,dass es nicht zu Konflikten mit den Zeitanfor<strong>der</strong>ungenim bürgerschaftlichen Engagement kommt. Dazugehört die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub für vorübergehend<strong>in</strong>tensive bürgerschaftliche Aktivitäten zu nehmen.Die Beschäftigten können <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em vere<strong>in</strong>bartenUmfang die Infrastruktur des Betriebes wie Internet, Kopierer,Faxgeräte, Fahrzeuge o<strong>der</strong> Räume usw. nutzen.Unternehmen sollten für ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen undArbeitnehmer Sem<strong>in</strong>are anbieten, die e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong>die Möglichkeiten für e<strong>in</strong> nachberufliches Engagementbieten. Dies kann Hand <strong>in</strong> Hand mit e<strong>in</strong>em formalisierten„Bürgerengagementprogramm“ für kurz vor dem Rentene<strong>in</strong>trittstehende und ehemalige Beschäftigte gehen. Engagierteund noch-nicht-engagierte ältere Arbeitnehmer<strong>in</strong>nenund Arbeitnehmer erhalten die Möglichkeit, durchKurze<strong>in</strong>sätze <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>wohlorganisationen neue Engagementfel<strong>der</strong>kennen zu lernen und können bei Interessedie letzten Wochen auf Kosten <strong>der</strong> Betriebe <strong>in</strong> ihrem favorisiertenEngagementfeld arbeiten. Die öffentlichen Arbeitgebersollten hier mit gutem Beispiel vorangehen undmodellhaft solche Projekte für ihre vor <strong>der</strong> Pensionierungstehenden Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter anbieten, dieErgebnisse evaluieren lassen und <strong>in</strong> die Öffentlichkeit tragen.5 Ausbau und Verstetigung <strong>der</strong> engagementför<strong>der</strong>ndenInfrastruktur: Die Informations- und Kontaktstellenfür engagierte und engagementbereite Bürger<strong>in</strong>nenund Bürger müssen stärker ausgebaut und diebestehenden Institutionen langfristig abgesichert werden.Diese Mittlerorganisationen – seien es Freiwilligenagenturen,Seniorenbüros o<strong>der</strong> Selbsthilfekontaktstellen –übernehmen e<strong>in</strong> breites Spektrum von Funktionen wie dieAnbahnung und Vermittlung von Engagementverhältnissen,Information von <strong>in</strong>teressierten Bürger<strong>in</strong>nen/Bürgernund Organisationen, Lobby<strong>in</strong>g o<strong>der</strong> Weiterbildung vonFreiwilligen usw. Wenn das bürgerschaftliche Engagementernsthaft als Teil e<strong>in</strong>er Reformperspektive für dieBürgergesellschaft verstanden wird, muss e<strong>in</strong>e geeigneteInfrastruktur vorhanden se<strong>in</strong>, welche die Prozesse <strong>der</strong>(Selbst-)Aktivierung <strong>der</strong> Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger begleitenund unterstützen kann.6 Die kommunale Bürgerbeteiligung sollte stärkerausgebaut werden: Die Öffnung <strong>der</strong> Verwaltung für dasEngagement ihrer Bürger sollte auf allen Ebenen vorangetriebenwerden. Es handelt sich dabei aber explizit ume<strong>in</strong>e Aufgabe, die Altersgruppen übergreifend zu verstehenist. Die politische Repräsentation und Partizipationsowie die Aktivierung des Engagements aller Altersgruppens<strong>in</strong>d Voraussetzung für e<strong>in</strong> funktionierendes Geme<strong>in</strong>wesen.Dabei kann von erfolgreichen Modellen <strong>der</strong> Bürgerbeteiligunggelernt werden. In vielen Geme<strong>in</strong>den zeigtdie Erfahrung, dass erfolgreiche Bürgerbeteiligungsprozessevor allem im Bereich <strong>der</strong> Stadtentwicklung angestoßenwerden konnten.7 Instrumentalisierung des Engagements verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n/SozialeVoraussetzungen schaffen: Sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong>Praxis als auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> Wissenschaft wächst die Befürchtung,dass die seit vielen Jahren beklagte „Lückenbüßerfunktiondes Ehrenamts für den Rückzug des Sozialstaats“von e<strong>in</strong>em rhetorischen Geme<strong>in</strong>platz <strong>der</strong>Ehrenamtsforschung zu e<strong>in</strong>em Problem werden könnte,das die Grundlagen des bürgerschaftlichen Engagementsaushöhlt. Es ist darauf zu achten, dass Ehrenamtlichenicht als billiger Ersatz für abgebautes Personal e<strong>in</strong>spr<strong>in</strong>genund damit <strong>in</strong>direkt <strong>zur</strong> Festigung <strong>der</strong> Massenarbeitslosigkeitbeitragen.Bürgerschaftliches Engagement kann nur dann geleistetwerden, wenn die eigene soziale <strong>Lage</strong> gesichert ist undeigene Ressourcen <strong>in</strong> den Dienst <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>schaft bzw.Gesellschaft gestellt werden können. Für das Engagementund die Teilhabe älterer Menschen erfor<strong>der</strong>t das, dass ihrAlterse<strong>in</strong>kommen, ihre Wohn- und Lebenssituation sowieihr gesundheitlicher Zustand e<strong>in</strong> zufriedenes und abgesichertesLeben ermöglichen – die H<strong>in</strong>wendung zu an<strong>der</strong>ensetzt voraus, dass die <strong>in</strong>dividuelle Sorge nicht nur um daseigene Leben kreisen muss. Damit verbunden ist <strong>der</strong>Kampf gegen soziale Prozesse <strong>der</strong> Ausschließung undDiskrim<strong>in</strong>ierung, sei es auf Grund materieller, gesundheitlicher,ethnischer, regionaler o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er Benachteiligungen.8 Soziale Ungleichheiten des Engagements abbauen:Ehrenamtliches Engagement folgt auch im Altere<strong>in</strong>em klaren Muster <strong>der</strong> sozialen Ungleichverteilungnach Geschlecht, Bildung, E<strong>in</strong>kommen und Berufsstatus.Damit Maßnahmen <strong>der</strong> Engagementför<strong>der</strong>ung nicht nurwie bisher die „happy few“ <strong>der</strong> sozial Bessergestelltentreffen und damit <strong>zur</strong> Verschärfung sozialer Ungleichheitenbeitragen, sollten vor allem auch bildungsferne undsozial schwächere Bevölkerungsgruppen mit ihren spezifischenPotenzialen und Wünschen angesprochen werden.Gerade diese Personen können durch milieu- undzielgruppengerechte Engagementangebote auch neuebzw. nachholende Bildungs- und Lernerfahrungen machen;aber nur dann, wenn soziale Schwellenängste abgebautwerden und höhergebildete bzw. sozial höher ste-
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 275 – Drucksache 16/2190hende Personen nicht die jeweiligen Engagementfel<strong>der</strong>dom<strong>in</strong>ieren. Das be<strong>in</strong>haltet auch die gezielte För<strong>der</strong>ungdes Zugangs von Frauen und Männern zu bislang für siejeweils untypischen Engagement- und Beteiligungsformenund damit e<strong>in</strong>e tendenzielle Aufhebung <strong>der</strong> klassischenTrennung zwischen dem niedriger bewerteten sozialenEhrenamt von Frauen und dem angesehenerenpolitischen Ehrenamt von Männern.9 Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engagementsbei Reformen <strong>der</strong> Versorgungssysteme für ältereund alte Menschen: Das bürgerschaftliche Engagementvon Älteren für Ältere wird <strong>in</strong> Zukunft anBedeutung gew<strong>in</strong>nen. Dabei werden <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e neue<strong>in</strong>telligente Mischungen aus familialer, professionellerund ehrenamtlicher Pflege <strong>zur</strong> langfristigen Stabilisierungvon Hilfebeziehungen und Pflegearrangements wichtigerwerden. Die Entwicklungen auf dem Pflegemarkt und<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Wirkung des Pflegeversicherungsgesetzesauf die traditionellen Elemente bürgerschaftlichenEngagements <strong>in</strong> diesem Bereich wurden bereits von <strong>der</strong>Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages kritischbeurteilt. E<strong>in</strong> Zurückdrängen des bürgerschaftlichenEngagements wird zwar weniger dem Pflegeversicherungsgesetzselbst zugeschrieben als eher dessen Umsetzung.Auf die Kompatibilität von professioneller, ehrenamtlicherund familiärer Hilfe und die För<strong>der</strong>ung vongemischten Hilfearrangements muss bei den Reformprojekten,die <strong>in</strong> <strong>der</strong> gesetzgeberischen Kompetenz des Bundesliegen, <strong>in</strong> Zukunft stärker Rücksicht genommen bzw.die Ermöglichung gemischter Hilfearrangements solltesystematisch geför<strong>der</strong>t werden.Handlungsempfehlungen zum Kapitel Migration undPotenziale des Alters <strong>in</strong> Wirtschaft und Gesellschaft1 Die Datenlage verbessern. Die Kommission empfiehlt,das statistische Dokumentationsdefizit vor allembei den kle<strong>in</strong>eren Nationalitätengruppen und bei denFrauen zu beheben. Die Migrantenbevölkerung muss <strong>in</strong>die Sozialberichterstattung e<strong>in</strong>bezogen werden. Die Fokussierungauf e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige Nationalität (aus <strong>der</strong> Türkei)o<strong>der</strong> die Subsumierung aller Migranten unter das MerkmalAuslän<strong>der</strong> muss überwunden werden, denn sie verzerrtdie Wahrnehmung <strong>in</strong> wissenschaftlich unzulässigerWeise. Es s<strong>in</strong>d längsschnittbezogene Untersuchungennotwendig, die e<strong>in</strong>e verlaufsorientierte Betrachtungsweiseermöglichen.2 Potenziale älterer Migranten <strong>in</strong> Arbeitswelt undWirtschaft för<strong>der</strong>n:– Migranten stärker <strong>in</strong> Weiterbildungsmaßnahmen e<strong>in</strong>beziehen.Migranten wurden bisher überdurchschnittlichhäufig mit Hilfe des Frühverrentungs<strong>in</strong>strumentariumsaus dem Arbeitsprozess ausgeglie<strong>der</strong>t. Es gilt,ihre Motivation für e<strong>in</strong>en Wie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> das Arbeitslebenzu för<strong>der</strong>n. Daher sollten Migranten stärker<strong>in</strong> Weiterbildungsmaßnahmen e<strong>in</strong>bezogen werden,wobei diese dr<strong>in</strong>gend notwendig mit <strong>der</strong> Sprachför<strong>der</strong>ungkomb<strong>in</strong>iert werden sollten.– Nachfolgende Migrantengenerationen qualifizieren:Als beste Prävention vor Frühausglie<strong>der</strong>ung und Arbeitslosigkeitgilt die Qualifikation <strong>der</strong> nachfolgendenMigrantengenerationen. Auch hier gilt, dass die Basisfür e<strong>in</strong>e gute berufliche Qualifikation durch die Schulbildunggelegt wird.3 Potenziale <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bildung entwickeln:– Die Kommission betont, dass die Beherrschung <strong>der</strong>deutschen Sprache für alle Migranten <strong>in</strong> allen Altersgruppene<strong>in</strong> Schlüssel <strong>zur</strong> Integration <strong>in</strong> die deutscheGesellschaft ist. Sie ist die wichtigste Voraussetzungfür Bildung bzw. Weiterbildung und e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> wichtigstenBed<strong>in</strong>gungen für den beruflichen Erfolg <strong>der</strong> nachfolgendenMigrantengenerationen.– Bei älteren Migranten Deutschkenntnisse nach <strong>der</strong>Pensionierung erhalten: Bei den älteren Migranten, diebereits Deutsch sprechen, hat die Erhaltung ihrerSprachkenntnisse Priorität. Ihnen sollten adäquateSprachangebote gemacht werden. Bei alte<strong>in</strong>gesessenenalten Migranten, die im eigenethnischen Milieuleben, ist die Funktionalität <strong>der</strong> deutschen Sprache ger<strong>in</strong>g.Bil<strong>in</strong>gualismus <strong>der</strong> Migranten ist als e<strong>in</strong> kulturellesKapital für Deutschland zu för<strong>der</strong>n. Weil die Sprache<strong>der</strong> ersten Migrantengeneration meist nichtDeutsch, son<strong>der</strong>n ausschließlich die Sprache des Herkunftslandesist, ist diese auch die e<strong>in</strong>zige Sprache <strong>in</strong><strong>der</strong> die Kommunikation zwischen den <strong>Generation</strong>enstattf<strong>in</strong>den kann. Angesichts <strong>der</strong> Globalisierungsprozesseist die Zweisprachigkeit <strong>in</strong> den Migrantenfamiliene<strong>in</strong> kulturelles Kapital für das ganze Land.– Bildung und Ausbildung <strong>der</strong> zweiten und nachfolgendenMigrantengenerationen sollten zu den Prioritäten<strong>der</strong> Bildungspolitik gehören: Bei <strong>der</strong> vielseitigen Suchenach Gründen und Konzepten des Bildungserfolgessollten die Unterschiede zwischen den <strong>in</strong> Deutschlandlebenden Nationalitätengruppen, von denene<strong>in</strong>ige äußerst erfolgreich s<strong>in</strong>d, berücksichtigt werden.Analysen, die sämtliche Migrantengruppen unter demBegriff „Auslän<strong>der</strong>“ e<strong>in</strong>erseits zusammenfassen undan<strong>der</strong>erseits Migrantenk<strong>in</strong><strong>der</strong> und Bildungsmisserfolgquasi als Synonyme benutzen, verstellen den Blick.4 Potenziale im Gesundheitsbereich bei älteren Migrantennutzen:– Spätere Beschäftigungsfähigkeit <strong>der</strong> Migranten för<strong>der</strong>n:Die Unterrepräsentanz von Migranten bei denRehabilitationsverfahren muss überwunden werden,um die Chancen <strong>der</strong> späteren Beschäftigungsfähigkeitund des Erhalts von Arbeitsfähigkeit auch bei älterenMigranten zu nutzen.– Bei Pflegebedürftigkeit Hilfepotenziale <strong>in</strong> den Familienerhalten: Vor dem E<strong>in</strong>tritt <strong>der</strong> ersten Migrantengeneration<strong>in</strong> das hohe Alter ist es wichtig, Strategien fürdie Erhaltung von Hilfepotenzialen <strong>in</strong> den Familien zuentwickeln. Es ist dr<strong>in</strong>gend notwendig, die Wohnsituationaltengerecht für die häusliche Versorgung Pflegebedürftigeranzupassen.
Drucksache 16/2190 – 276 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode– Fehlversorgung vermeiden: Altenhilfe und Migrantenarbeitvernetzen: Bei <strong>der</strong> Implementation von Hilfsmaßnahmenmuss bei den Pflegenden <strong>der</strong> erstenMigrantengeneration auf die e<strong>in</strong>geschränkte Kommunikationsfähigkeit<strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Sprache, wie auchauf kulturelle Unterschiede <strong>in</strong> Gesundheits- undKrankheitsverhalten Rücksicht genommen werden.Um Fehlversorgung und Kosten für die Betroffenenund die Versorgungssysteme zu vermeiden, ist es notwendig,über die Vernetzungen zwischen den Institutionen<strong>der</strong> gesundheitlichen Versorgung und <strong>der</strong>Altenhilfe h<strong>in</strong>aus auch die Migrationsberatung und-sozialarbeit e<strong>in</strong>zubeziehen.– Initiativen für e<strong>in</strong>e „Kultursensible Altenhilfe“ nutzen:Inzwischen bilden <strong>in</strong> nicht ger<strong>in</strong>ger Zahl E<strong>in</strong>richtungen<strong>der</strong> Versorgung o<strong>der</strong> Träger von Fort- und WeiterbildungFachkräfte im Bereich <strong>der</strong> <strong>in</strong>terkulturellenPflege im H<strong>in</strong>blick auf „Zusatzkompetenzen“ für dieeigen<strong>in</strong>stitutionelle Versorgung fort. Initiativen, wiedas "Memorandum für e<strong>in</strong>e kultursensible Altenhilfe"und die Initiative "Charta für e<strong>in</strong>e kultursensible Altenpflege"müssen fortgeführt werden.– Ehrenamtliches Engagement <strong>der</strong> Migranten anerkennenund qualifizieren: Bei den alte<strong>in</strong>gesessenen Migrantengruppen,vor allem bei den aus <strong>der</strong> TürkeiStammenden, bilden sich immer mehr eigene Versorgungsstrukturenheraus, weil die Nachfragegröße dieserGruppe es ermöglicht. Insofern müssen die Chancen<strong>der</strong> Eigenorganisation gesundheitlich-sozialerBelange bei dieser Migrantengruppe, zu denen vor allemdie Pflege zählt, erkannt werden. Allerd<strong>in</strong>gs mussdie professionelle Pflege diese „ethnische Basisversorgung“<strong>in</strong>tegrieren und vernetzen. Alle an<strong>der</strong>en kle<strong>in</strong>erenNationalitätengruppen können, schlicht mangelsausreichen<strong>der</strong> Masse, ke<strong>in</strong>e eigene Infrastrukturen bilden,sodass sie auf die Regelversorgung angewiesens<strong>in</strong>d. Hier können Erfahrungen vorliegen<strong>der</strong> erfolgreicherdezentraler Modelle aufgegriffen werden, umVersorgungsbedürfnissen und -bedarfen kulturspezifischzu entsprechen. Dabei können, wo immer vorhanden,die ehrenamtlichen Potenziale <strong>der</strong> Migrantene<strong>in</strong>gewiesen und fortgebildet werden.5 Potenziale <strong>in</strong> <strong>der</strong> Familie erhalten:– Mit wohnökologischen und familienorientierten Maßnahmendie Solidarität <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Migrantenfamilienerhalten: Familien ausländischer Herkunft brauchenspezifische Formen <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung und Beratung,auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> jeweiligen Muttersprache. Aber auch dieRegeldienste <strong>der</strong> Wohlfahrtsorganisationen und <strong>der</strong>Kommunen müssen sich den Migrantenfamilien öffnen.Hierzu trägt bei, dass die Institutionen <strong>der</strong> Migrantenbetreuungund <strong>der</strong> öffentliche Dienst immerhäufiger qualifizierte Fachkräfte <strong>der</strong> zweiten Migrantengeneratione<strong>in</strong>stellen.– Die nachfolgenden Migrantengenerationen zu e<strong>in</strong>ergerechteren Verteilung <strong>der</strong> Pflegearbeit zwischen denGeschlechtern sozialisieren: Es ist notwendig, dienachfolgenden Migrantengenerationen dabei zu unterstützen,Synthesen vermittelnde Arrangements zwischenden gesellschaftlichen, familien- und kulturspezifischenAnfor<strong>der</strong>ungen zu f<strong>in</strong>den. Zunehmend wirddie Betreuung und Pflege <strong>der</strong> ersten <strong>Generation</strong> an Bedeutunggew<strong>in</strong>nen. In den allermeisten Fällen übernehmendie Frauen diese Aufgaben. Hier sollte dasPr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>er gerechten Verteilung <strong>der</strong> Pflegearbeitzwischen den Geschlechtern vor allem durch die <strong>in</strong>stitutionelle,<strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e schulische Sozialisation <strong>der</strong>zweiten Migrantengeneration vermittelt werden. Wiebei den deutschen Familien geht es auch hier darum,die bisher ungenützten Potenziale <strong>der</strong> Männer, ob Ehemännero<strong>der</strong> Söhne o<strong>der</strong> Väter <strong>in</strong> die Pflegearbeit zu<strong>in</strong>tegrieren.6 Migrationsspezifische Potenziale erkennen undanerkennen:– Räumliche Mobilität älterer Migranten erhalten: ÄltereMigranten pendeln zwischen Herkunftsland undAufnahmeland. Dieses Arrangement räumlicher Mobilitätist <strong>in</strong> Deutschland noch zu wenig erkannt undanerkannt. Weitere Maßnahmen müssen getroffenwerden, damit den Rentnern ke<strong>in</strong>e sozialrechtlichenBenachteiligungen durch ihr Pendeln entstehen. Indiesem Zusammenhang ließe sich z.B. an die zukünftigeGewährung e<strong>in</strong>es umfassenden Krankenversicherungsschutzeso<strong>der</strong> Sicherung des Aufenthaltsstatusüber e<strong>in</strong>en sechsmonatigen Auslandsaufenthalt h<strong>in</strong>ausdenken.– Freiwilliges Engagement, soziale und politische Partizipationälterer Migranten för<strong>der</strong>n: Die sozialen Vernetzungen<strong>in</strong> <strong>der</strong> ethnischen Kolonie können vieleFunktionen haben, z.B. im Bereich <strong>der</strong> laienmediz<strong>in</strong>ischenSysteme und <strong>der</strong> gegenseitigen Unterstützung<strong>der</strong> Frauen, was für die Altenpflege <strong>in</strong> den Familienvon Bedeutung ist. Diese Hilfepotenziale gilt es zuför<strong>der</strong>n und etwa die Beratung für pflegende Angehörigeo<strong>der</strong> den Aufbau von präventiven Beratungsnetzwerken<strong>in</strong> den Orten, die von den Migranten besuchtwerden, professionell zu organisieren. Generell könnenhier bessere Vernetzungen familialer und an<strong>der</strong>er<strong>in</strong>formeller Kreise mit den <strong>in</strong>stitutionellen Potenzialenerreicht und Kompetenzen erhöht werden. WichtigsteZielgruppe s<strong>in</strong>d hierbei die Frauen <strong>in</strong> allen Migrantengruppen.– Migrantenselbstorganisationen zivilgesellschaftlichweiterentwickeln: Die Kommission ist <strong>der</strong> Me<strong>in</strong>ung,dass die ethnischen Selbstorganisationen vor allem auf<strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Kommunen zivilgesellschaftlich entwickeltund durch geme<strong>in</strong>wesenorientierte Ansätze füre<strong>in</strong>e Verbesserung <strong>der</strong> lokalen Lebensverhältnisse <strong>in</strong>den Migrantenquartieren erschlossen werden müssen.Ältere Migranten, die sich im Rahmen dieser Selbstorganisationenengagieren, sollten öffentlich anerkanntwerden. Auch ihnen sollten Gratifikationen, wie sie imZusammenhang mit <strong>der</strong> deutschen Bevölkerung diskutiertwerden, bei <strong>der</strong> Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln,Besuch von Schwimmbä<strong>der</strong>n etc. erteiltwerden. Die Kommission empfiehlt ältereMigranten angemessen <strong>in</strong> den Seniorenvertretungenund Beiräten auf allen Ebenen zu <strong>in</strong>tegrieren.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 277 – Drucksache 16/2190LiteraturverzeichnisAdamy, W. (2003): Herausfor<strong>der</strong>ungen e<strong>in</strong>er älter werdendenErwerbsbevölkerung, o<strong>der</strong>: wem nutzt e<strong>in</strong>e alternsgerechteGestaltung <strong>der</strong> Arbeitswelt? In: U. Engelen-Kefer& K. Wiesehügel (Hrsg.): Sozialstaat - solidarisch, effizient,zukunftssicher. Alternativen zu den Vorschlägen <strong>der</strong>Rürup-Kommission. Hamburg: VSA-Verlag, S. 86-103.Aktionsbündnis für Qualifizierung und Bildung (2004):Zur Situation und Zukunft <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung.Hamburg: AQUA Aktionsbündnis für Qualifizierung undBildung.Alber, J. & Schölkopf, M. (1999): Seniorenpolitik. Diesoziale <strong>Lage</strong> älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland undEuropa. Amsterdam: Fakultas.Alt, J. (2003): Leben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schattenwelt - Problemkomplexillegale Migration. Neue Erkenntnisse <strong>zur</strong> Lebenssituationillegaler Migranten <strong>in</strong> München, Leipzig undan<strong>der</strong>en Städten. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.Amann, A. (2004): Unentdeckte und ungenützte Ressourcenund Potenziale des Alter(n)s. Expertise im Auftrag<strong>der</strong> Sachverständigenkommission „5. Altenbericht <strong>der</strong>Bundesregierung“. Wien.Ammermüller, A.; Weber, A. M. & Westerheide, P.(2005): Die Entwicklung und Verteilung des Vermögensprivater Haushalte unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung desProduktivvermögens. Mannheim.Amrhe<strong>in</strong>, L. (2002): Dialog <strong>der</strong> <strong>Generation</strong>en durchalters<strong>in</strong>tegrative Strukturen? Anmerkungen zu e<strong>in</strong>er gerontologischenUtopie. In: Zeitschrift für Gerontologieund Geriatrie 35(4), S. 315-327.Antonucci, T. C. (2001): Social relations: an exam<strong>in</strong>ationof social networks, social support, and sense of control.In: J.E. Birren & K.W. Schaie (Hrsg.): Handbook of thpsychology of ag<strong>in</strong>g. 5 ed. San Diego: Academic Press,S. 427-453.Arens, T. & Qu<strong>in</strong>ke, H. (2003): Bildungsbed<strong>in</strong>gte öffentlicheTransfers und Investitionspotenziale privater Haushalte<strong>in</strong> Deutschland. Gutachten für die Expertenkommission„F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“.Schriftenreihe <strong>der</strong> Expertenkommission F<strong>in</strong>anzierung LebenslangenLernens Bd. 3. Bielefeld: Bertelsmann.Armstrong, M. J. & Goldsteen, K. S. (1990): Friendshipsupport patterns ol<strong>der</strong> American women. In: Journal ofAg<strong>in</strong>g Studies (4), S. 391-404.Arnkil, R.; Hietikko, M.; Mattila, K. Niem<strong>in</strong>en, J. Rissanen,P. & Spangar, T. (2002): The national programme onage<strong>in</strong>g workers – evaluation. Reports of the M<strong>in</strong>istry ofSocial Affairs and Health, Hels<strong>in</strong>ki, F<strong>in</strong>land 2002: 5.(http://pre20031103.stm.fi/english/current/ageprog/)Attias-Donfut, C. (2000): Familialer Austausch und sozialeSicherung. In: M. Kohli & M. Szydlik (Hrsg.): <strong>Generation</strong>en<strong>in</strong> Familie und Gesellschaft. Opladen: Leskeu. Budrich, S. 222-237.Aust, F. & Schrö<strong>der</strong>, H. (2004): Weiterbildungsbeteiligungälterer Erwerbspersonen. Expertise im Auftrag <strong>der</strong>Sachverständigenkommission „5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Bonn.Baas, S. & Buba, H. P. (2001): Zum Stand <strong>der</strong> Forschung.In: H.P. Buba & L.A. Vaskovics (Hrsg.): Benachteiligunggleichgeschlechtlich orientierter Personen und Paare.Köln: Bundesanzeiger, S. 329-351.Bäcker, G. (1999): Leistung und Erfahrung, Altern <strong>in</strong> <strong>der</strong>Arbeitsgesellschaft. In: A. Nie<strong>der</strong>franke, G. Naegele & E.Frahm (Hrsg.): Funkkolleg Altern 2. Opladen: WestdeutscherVerlag, S. 53-96.Bäcker, G. (2003): Berufstätigkeit und Verpflichtungen <strong>in</strong><strong>der</strong> familiären Pflege - Anfor<strong>der</strong>ungen an die Gestaltung<strong>der</strong> Arbeitswelt. In: B. Badura, H. Schellschmidt & C.Vetter (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2003. Heidelberg:Spr<strong>in</strong>ger, S. 132-145.Backes, G. M. (1987): Frauen und soziales Ehrenamt. ZurVergesellschaftung weiblicher Selbsthilfe. Beiträge <strong>zur</strong>Sozialpolitik-Forschung; 1. Augsburg.: Maro Verlag.Backes, G. M. (1997): Alter(n) als „GesellschaftlichesProblem“? Zur Vergesellschaftung des Alter(n)s im Kontext<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung. Opladen: Westdeutscher Verlag.Backes, G. M. (2000): Geschlechtsspezifische Lebenslagen<strong>in</strong> West und Ost. Altern <strong>in</strong> den alten und neuen Bundeslän<strong>der</strong>n.In: G. M. Backes & W. Clemens (Hrsg.): Lebenslagenim Alter. Opladen, S. 93-113.Backes, G. M. & Clemens, W. (2003): Lebensphase Alter.E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die sozialwissenschaftliche Alternsforschung.Grundlagentexte Soziologie. We<strong>in</strong>heim, München:Juventa.Bade, K. J. (2001): Integration und Illegalität <strong>in</strong> Deutschland(Rat für Migration). Osnabrück: Institut für Migrationsforschungund Interkulturelle Studien (IMIS).Badura, B. (2003): Gesund älter werden - BetrieblichePeronal und Gesundheitspolitik <strong>in</strong> Zeiten demographischenWandels. In: B. Badura, H. Schellschmidt & C.Vetter (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2002. Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger,S. 33-42.BAGSO – Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>der</strong> Senioren-Organisationen (2004a): Solidarität von Familien: GegenseitigeUnterstützung und Grenzen <strong>der</strong> Belastbarkeit.Empfehlungen <strong>der</strong> BAGSO zum 7. Familienbericht 2005 -
Drucksache 16/2190 – 278 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeZukunft Familie . Ergebnis des Workshops vom 28. und29. September 2004 <strong>in</strong> Bonn. Bonn: BAGSO.BAGSO – Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>der</strong> Senioren-Organisationen (2004b): Nutzergerechte Produkte &Dienstleistungsservice für Ältere? Dokumentation vonzwei Workshops. Bonn.Bahlo, E. & Kern, M. (1999): Was muss geschehen? For<strong>der</strong>ungenund Maßnahmen zu mehr Patientenorientierung.In: Perspective on Managed Care 2(1), S. 20-30.Barkholdt, C. (1998): Destandardisierung <strong>der</strong> Lebensarbeitszeit- E<strong>in</strong>e Chance für die alternde Erwerbsarbeitsgesellschaft?Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.Barkholdt, C. (2004): Umgestaltung <strong>der</strong> Altersteilzeit:von e<strong>in</strong>em Ausglie<strong>der</strong>ungs- zu e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ungs<strong>in</strong>strument.Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Dortmund.Barkholdt, C. & Lasch, V. (2004): Wirtschaftskraft ältererArbeitnehmer<strong>in</strong>nen. Vere<strong>in</strong>barkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit.Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Dortmund, Kassel.Barmby, T. A.; Ercolani, M. G. & Treble, J. G. (2002):Sickness absence: An <strong>in</strong>ternational comparison. In: TheEconomic Journal (112), S. 315-331.Barmer Ersatzkasse (2004): Gesundheitsreport 2004. Gesundheit,Fitness und Produktivität - Betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ungbewegt was. Wuppertal: Barmer Ersatzkasse.Basch, L.; Glick Schiller, N. & Szanton, B. (1994):Nations unbound: Transnational projects, postcolonialpredicaments and deterritorialized nation-states. Amsterdam:Gordon and Breach Publishers.Bauer, F.; Groß, H.; Lehmann, K. & Munz, E. (2004):Arbeitszeit 2003. Arbeitszeitgestaltung, Arbeitszeitorganisationund Tätigkeitsprofile. Köln: ISO (<strong>Bericht</strong> desISO 70).Bauer, T. K.; von Loeffelholz, H. D. & Schmidt, C. M.(2004): Wirtschaftsfaktor ältere Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten<strong>in</strong> Deutschland. Stand und Perspektiven. Expertiseim Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission „5. Altenbericht<strong>der</strong> Bundesregierung“. Essen.Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>geund Integration (2002): <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Beauftragten <strong>der</strong>Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration.Berl<strong>in</strong>, Bonn.Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>geund Integration (2003): Migranten s<strong>in</strong>d aktiv. Zumgesellschaftlichen Engagement von Migrant<strong>in</strong>nen undMigranten. Fachtagung <strong>der</strong> Beauftragten <strong>der</strong> Bundesregierungfür Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integration. Berl<strong>in</strong>,Bonn.Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>geund Integration (2004): Daten - Fakten - Trends.Strukturdaten <strong>der</strong> ausländischen Bevölkerung. Stand2004. Berl<strong>in</strong>.Beauftragte <strong>der</strong> Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>geund Integration (2005): <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Beauftragten <strong>der</strong>Bundesregierung für Migration, Flüchtl<strong>in</strong>ge und Integrationüber die <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Auslän<strong>der</strong> <strong>in</strong>Deutschland. Berl<strong>in</strong>.Becker, G. (1993): Human capital. A theoretical andempirical analysis with special reference to education.Chicago: National Bureau of Economic Research.Becker, I. & Hauser, R. (2004): Verteilung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen1999 - 2003. <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> Studie im Auftrag des Bundesm<strong>in</strong>isteriumsfür Gesundheit und Soziale Sicherung.Frankfurt a. M.: Universität.Becker, R. (1997): Häusliche Pflege von Angehörigen:Beratungskonzeptionen für Frauen. Frankfurt a. M.Behrens, J. (1999): Länger erwerbstätig durch ArbeitsundLaufbahngestaltung: Personal- und Organisationsentwicklungzwischen begrenzter Tätigkeitsdauer und langfristigerErwerbstätigkeit. In: M. Gussone, A. Huber,M. Morschhäuser & J. Petrenz (Hrsg.): Ältere Arbeitnehmer.Altern und Erwerbsarbeit <strong>in</strong> rechtlicher, arbeits- undsozialwissenschaftlicher Sicht. Frankfurt a. M.: Bund-Verlag, S. 101–186.Behrens, J. (2003): Fehlzeit, Frühberentung: Längererwerbstätig durch Personal- und Organisationsentwicklung.In: B. Badura, H. Schellschmidt & C.Vetter (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2002. Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger,S. 115-136.Beisheim, M.; Dreher, S.; Walter, G. & Zangl, B. (1999):Im Zeitalter <strong>der</strong> Globalisierung? Thesen und Daten <strong>zur</strong>gesellschaftlichen und politischen Denationalisierung.Baden-Baden: Nomos.Bellmann, L. & Leber, U. (2004): Ältere Arbeitnehmerund betriebliche Weiterbildung. In: G. Schmid, M. Gangl& P. Kupka (Hrsg.): Arbeitsmarktpolitik und Strukturwandel:Empirische Analysen. Beiträge <strong>zur</strong> Arbeitsmarkt-und Berufsforschung. BeitrAB 286. Nürnberg: Institutfür Arbeitsmarkt- und Berufsforschung <strong>der</strong>Bundesagentur für Arbeit, S. 19-36.Bengtson, V. L.; Rosenthal, C. & Burton, L. (1996):Paradoxes of family and ag<strong>in</strong>g. In: R. H. B<strong>in</strong>stock &L. K. George (Hrsg.): Handbook of ag<strong>in</strong>g and the socialsciences. San Diego: Academic Press, S. 253-282.Bertelsmann Stiftung (1997): Mit 60 auf das Abstellgleis?Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.Bertelsmann Stiftung; Bundesvere<strong>in</strong>igung <strong>der</strong> DeutschenArbeitgeberverbände; Funk, L. & Klös, H.-P. (2003):Beschäftigungschancen für ältere Arbeitnehmer. InternationalerVergleich und Handlungsempfehlungen. Gütersloh:Verlag Bertelsmann Stiftung.Bertelsmann Stiftung & Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.)(2004): Zukunftsfähige betriebliche Gesundheitspolitik.Vorschläge <strong>der</strong> Expertenkommission. Gütersloh: VerlagBertelsmann Stiftung.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 279 – Drucksache 16/2190Bexfield, H. (1995): Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und Patientenpartizipation.In: W. Damkowski, S. Görres & K.Luckey (Hrsg.): Patienten im Gesundheitssystem - Patientenunterstützungund -beratung. Augsburg: Maro Verlag,S. 217-226.Bielenski, H.; Bosch, G. & Wagner, A. (2002): Wie dieEuropäer arbeiten wollen: Erwerbs- und Arbeitszeitwünsche<strong>in</strong> 16 Län<strong>der</strong>n. Frankfurt a. M.: Campus.Birg, H. (2001): Die demographische Zeitenwende. DerBevölkerungsrückgang <strong>in</strong> Deutschland und Europa. München:Beck.Bisp<strong>in</strong>ck, R. & WSI-Tarifarchiv (2005): Senioritätsregeln<strong>in</strong> Tarifverträgen. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Düsseldorf: Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichesInstitut.BKK Bundesverband <strong>der</strong> Betriebskrankenkassen (2004):BKK-Gesundheitsreport 2004. Gesundheit und sozialerWandel. Essen: BKK-Bundesverband.Blando, J. A. (2001): Twice hidden: Ol<strong>der</strong> gay andlesbian couples, friends, and <strong>in</strong>timacy. In: <strong>Generation</strong>s25(2), S. 87-89.Bl<strong>in</strong>kert, B. (2005): Pflege und soziale Ungleichheit -Pflege und „soziale Milieus“. In: K. R. Schroeter &T. Rosenthal (Hrsg.): Soziologie <strong>der</strong> Pflege. We<strong>in</strong>heim:Juventa, S. 141-156.Bl<strong>in</strong>kert, B. & Klie, T. (1999): Pflege im sozialen Wandel.Studie <strong>zur</strong> Situation häuslich versorgter Pflegebedürftiger.Hannover: V<strong>in</strong>centz.Bl<strong>in</strong>kert, B. & Klie, T. (2004): Solidarität <strong>in</strong> Gefahr? Pflegebereitschaftund Pflegebedarfentwicklung im demografischenund sozialen Wandel. Hannover: V<strong>in</strong>centz.Blöndal, S.; Filed, S. & Girouard, N. (2002): Investment<strong>in</strong> human capital through upper-secondary and tertiaryeducation. In: OECD Economic Studies Nr. 34. Paris:OECD, S. 41-89.Bochow, M. (1994): Schwuler Sex und die Bedrohungdurch AIDS - Reaktionen homosexueller Männer <strong>in</strong> OstundWestdeutschland. Ergebnisbericht zu e<strong>in</strong>er Befragungim Auftrag <strong>der</strong> Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung. Berl<strong>in</strong>: Deutsche AIDS Hilfe.Borchert, J. & Reimann, A. (2004): Die Umsetzung desPflegeurteils. Arbeitspapier/Dokumentation Nr. 133.Sankt August<strong>in</strong>: Konrad-Adenauer-Stiftung.Börsch-Supan, A. (2004): Das Ende <strong>der</strong> Illusionen. In:Frankfurter Allgeme<strong>in</strong>e Zeitung. Beilage Altersvorsorge,S. B3.Börsch-Supan, A.; Düzgün, I. & Weiss, M. (2005): Alternund Produktivität: Zum Stand <strong>der</strong> Forschung. MEA-Arbeitspapier 73. Mannheim: Research Institute for theEconomics of Ag<strong>in</strong>g.Börsch-Supan, A. & Sommer, M. (2003): Demographieund Kapitalmärkte. Die Auswirkungen <strong>der</strong> Bevölkerungsalterungauf Aktien-, Renten- und Immobilienvermögen.Köln: Deutsches Institut für Altersvorsorge.Bosch, G. (1998): Zukunft <strong>der</strong> Erwerbsarbeit: Strategienfür Arbeit und Umwelt. Frankfurt a. M.: Campus.Bosch, G. (2000): Neue Lernkulturen und Arbeitnehmer<strong>in</strong>teressen.In: Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Qualifikations-Entwicklungs-Management(Hrsg.): Kompetenzentwicklung2000: Lernen im Wandel - Wandel durch Lernen. Münster:Waxmann, S. 227-270.Bosch, G. (2003a): Ältere Arbeitnehmer. <strong>Bericht</strong>Deutschland. In: Europäische Kommission (Hrsg.): Beschäftigungsobservatorium.Luxemburg, S. 88-100.Bosch, G. (2003b): Betriebliche Reorganisation und neueLernkulturen. In: F. Bsirske, H. Endl, L. Schrö<strong>der</strong> & M.Schwemmle (Hrsg.): Wissen ist was wert. Hamburg:VSA-Verlag, S. 118-129.Bosch, G. (2004a): F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens.Der Weg <strong>in</strong> die Zukunft. In: Berufsbildung <strong>in</strong> Wissenschaftund Praxis 33(6), S. 5-10.Bosch, G. (2004b): F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens.Der Weg <strong>in</strong> die Zukunft. Die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong>Expertenkommission F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens.In: Deutsche Evangelische Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft fürErwachsenenbildung (Hrsg.): Forum Erwachsenenbildung- Beiträge und <strong>Bericht</strong>e. Bd. 4. Frankfurt a. M.,S. 26-32.Bosch, G. (2004c): Thematische <strong>Bericht</strong>e <strong>zur</strong> Beschäftigungvon Immigranten: Deutschland. In: EuropäischesBeschäftigungsobservatorium (Hrsg.): <strong>Bericht</strong> vomHerbst 2003. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen<strong>der</strong> Euopäischen Geme<strong>in</strong>schaften, S. 52-59.Bosch, G. (2005a): Den Kuchen zwischen Jung und Altaufteilen. In: Die Zeitschrift für Erwachsenenbildung.<strong>Generation</strong>enwechsel 12(2), S. 42-45.Bosch, G. (2005b): Wissensmanagement - Neue Modelleberuflicher Weiterbildung. In: H. Meffert & P. Ste<strong>in</strong>brück(Hrsg.): Trendbuch NRW. Perspektiven e<strong>in</strong>er Metropolregion.Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, S. 169-186.Bosch, G.; Hennicke, P.; Hilbert, J. & Kristof, K. (Hrsg.)(2002): Die Zukunft <strong>der</strong> Dienstleistungen und ihre Auswirkungenauf Arbeit, Umwelt und Lebensqualität.Frankfurt a. M., New York: Campus.Bosch, G. & Knuth, M. (2003): Recent developments <strong>in</strong>the labour market. In: W. Müller-Jentsch & H. J.Weitbrecht (Hrsg.): The chang<strong>in</strong>g contours of German<strong>in</strong>dustrial relations. München: Hampp, S. 137-156.Bosch, G. & Schief, S. (2005a): Politik für ältere Beschäftigteo<strong>der</strong> Politik für alle. Zur Teilnahme älterer Erwerbspersonenam Erwerbsleben <strong>in</strong> Europa. IAT-Report 2005-4. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik.Bosch, G. & Schief, S. (2005b): Ältere Beschäftigte <strong>in</strong>Europa: Neue Formen sozialer Ungleichheit. In: WSI -Mitteilungen (1), S. 32-39.
Drucksache 16/2190 – 280 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeBraun, J.; Burmeister, J. & Engels, D. (Hrsg.) (2004):SeniorTra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>: Neue Verantwortungsrolle und Engagement<strong>in</strong> Kommunen. Bundesmodellprogramm „Erfahrungswissenfür Initiativen“. <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> ersten Programmphase.ISAB-<strong>Bericht</strong>e aus Forschung und Praxis,Nr. 84. Leipzig: ISAB-Verlag.Braun, J. & Deutsche Gesellschaft für Gerontologie undGeriatrie, Fachbereich IV (1998): Seniorenbüros, e<strong>in</strong>neuer E<strong>in</strong>richtungstyp <strong>der</strong> offenen Altenarbeit. Ergebnisse<strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung des ModellprogrammsSeniorenbüro. In: R. Schmidt, H. Braun, K. I.Giercke, T. Klie & Deutsches Zentrum für Altersfragen(Hrsg.): Neue Steuerungen <strong>in</strong> Pflege und Sozialer Altenarbeit.Regensburg: Transfer-Verlag, S. 237-243.Braun, J.; Kettler, U.; Becker, I. & Institut für SozialwissenschaftlicheAnalysen und Beratung (1996): Selbsthilfeund Selbsthilfeunterstützung <strong>in</strong> <strong>der</strong> BundesrepublikDeutschland. Aufgaben und Leistungen <strong>der</strong> Selbsthilfekontaktstellen<strong>in</strong> den neuen und alten Bundeslän<strong>der</strong>n. Abschlussbericht.ISAB-<strong>Bericht</strong>e aus Forschung und PraxisNr. 50. Leipzig: ISAB-Verlag.Braun, J. & Wahlen, G. (2001): Die Freiwilligen: dasSozialkapital des neuen Jahrtausends. För<strong>der</strong>politischeKonsequenzen aus dem Freiwilligensurvey 1999: Fachtagungdes BMFSFJ am 29./30. März 2001 <strong>in</strong> Bonn. ISAB-<strong>Bericht</strong>e aus Forschung und Praxis. Bd. 71. Leipzig:ISAB-Verlag.Braun, M. (2003): Gesundheitspräventive Arbeitsgestaltungund Unternehmensentwicklung. In: Das Gesundheitswesen65(12), S. 698-703.Braun, S. (2002): Soziales Kapital, sozialer Zusammenhaltund soziale Ungleichheit. Integrationsdiskurse zwischenHyper<strong>in</strong>dividualismus und <strong>der</strong> Abdankung desStaates. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage <strong>zur</strong>Wochenzeitung Das Parlament (B29/30), S. 6-12.Brendgens, U. & Braun, J. (2001): Freiwilliges Engagement<strong>der</strong> Senior<strong>in</strong>nen und Senioren. In: S. Picot (Hrsg.): FreiwilligesEngagement <strong>in</strong> Deutschland - Freiwilligensurvey1999. Stuttgart: Kohlhammer, S. 209-301.Breyer, F. (2000): Kapitaldeckungs- versus Umlageverfahren.In: Perspektiven <strong>der</strong> Wirtschaftspolitik (1),S. 383-405.Brussig, M. (2005): Die „Nachfrageseite des Arbeitsmarktes“:Betriebe und die Beschäftigung Älterer imLichte des IAB-Betriebspanels 2002. Altersübergangs-Report 2005-02. Düsseldorf, Gelsenkirchen: Hans-Böckler-Stiftung; Institut Arbeit und Technik.Brussig, M.; Knuth, M. & Weiß, W. (2004): Arbeiten ab50 <strong>in</strong> Deutschland. E<strong>in</strong>e Landkarte <strong>der</strong> Erwerbstätigkeitauf <strong>der</strong> Grundlage des Mikrozensus 1996 bis 2001. Expertiseim Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Gelsenkirchen.Buba, H.-P. & Vaskovics, L. A. (2001): Benachteiligunggleichgeschlechtlich orientierter Personen und Paare.Köln.Büchel, F. & Pannenberg, M. (2004): Berufliche Weiterbildung<strong>in</strong> West- und Ostdeutschland. In: Zeitschrift fürArbeitsmarktforschung 37(2), S. 73-126.Bühlmann, M. & Freitag, M. (2004): Individuelle undkontextuelle Determ<strong>in</strong>anten <strong>der</strong> Teilhabe an Sozialkapital.In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie56(2), S. 327-349.Bundesagentur für Arbeit (2002): Arbeitsmarkt 2001.Amtliche Nachrichten <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit.Nürnberg: Bundesagentur für Arbeit.Bundesagentur für Arbeit (2004): Arbeitsmarkt 2003.Amtliche Nachrichten <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit.52. Jahrgang (Son<strong>der</strong>nummer), Juli 2004. Nürnberg:Bundesagentur für Arbeit.Bundesagentur für Arbeit (2005a): Arbeitsmarkt 2004.Amtliche Nachrichten <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit.53. Jahrgang, August 2005. Nürnberg: Bundesagentur fürArbeit.Bundesagentur für Arbeit (2005b): Statistik. DetaillierteInformationen „För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> beruflichen Weiterbildung(fbW)“. Zeitreihe für E<strong>in</strong>tritte.Bundesagentur für Arbeit (2005c): Der Arbeitsmarkt <strong>in</strong>Deutschland, Monatsbericht Juni 2005. Nürnberg: Bundesagenturfür Arbeit.Bundesagentur für Arbeit (2005d): Arbeitsmarkt <strong>in</strong> Zahlen- Aktuelle Daten. Dezember 2004. Nürnberg: Bundesagenturfür Arbeit.Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmediz<strong>in</strong>(2003): Sicher, gesund und wettbewerbsfähig. Bremerhaven:Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft.Bundes<strong>in</strong>stitut für Berufsbildung (2004): BIBB-Studiebelegt: Privatpersonen <strong>in</strong>vestieren Milliarden <strong>in</strong> ihre beruflicheWeiterbildung. Pressemitteilung vom 22.04.04.Nr. 14/2004. Bonn: BIBB.Bundes<strong>in</strong>stitut für Bevölkerungsforschung (2004): Bevölkerung.Fakten - Trends - Ursachen - Erwartungen. Diewichtigsten Fragen. Wiesbaden: Bundes<strong>in</strong>stitut für Bevölkerungsforschung.Bundesm<strong>in</strong>isterium des Innern (2001): <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> UnabhängigenKommission „Zuwan<strong>der</strong>ung“. Zuwan<strong>der</strong>unggestalten, Integration för<strong>der</strong>n. Berl<strong>in</strong>: Bundesm<strong>in</strong>isteriumdes Innern.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Arbeit und Sozialordnung (2001):Alterssicherung <strong>in</strong> Deutschland 1999 (ASID '99). Tabellenband.Forschungsbericht 289/T. Bonn: Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Arbeit und Sozialordnung.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Arbeit und Sozialordnung (2002):Situation <strong>der</strong> ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland.Repräsentativuntersuchung 2001. Bonn: BMA.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung (2003):<strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung VIII. Integrierter Gesamtbericht<strong>zur</strong> Weiterbildungssituation <strong>in</strong> Deutschland.Bonn: BMBF.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 281 – Drucksache 16/2190Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung (2004):Ergebnisse <strong>der</strong> Repräsentativbefragung <strong>zur</strong> Weiterbildung<strong>in</strong> Deutschland. Berl<strong>in</strong>: BMBF.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Bildung und Forschung (2005):<strong>Bericht</strong>ssystem Weiterbildung IX. Ergebnisse <strong>der</strong> Repräsentativbefragung<strong>zur</strong> Weiterbildungssituation <strong>in</strong>Deutschland. Bonn, Berl<strong>in</strong>: BMBF.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie und Senioren (1993): ErsterAltenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung. Die Lebenssituationälterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland. Bonn: BMFS.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(1997): Vere<strong>in</strong>barkeit von Erwerbstätigkeit undPflege. Bearbeitet von Brigitte Beck, Gerhard Naegele(Projektleitung) und Monika Reichert. SchriftenreiheBand 106/1: Stuttgart, Berl<strong>in</strong>, Köln.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(1998): Zweiter Altenbericht. Wohnen im Alter.Bonn: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2000): Sechster Familienbericht zum Thema Familienausländischer Herkunft <strong>in</strong> Deutschland. Leistungen,Belastungen, Herausfor<strong>der</strong>ungen. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2001): Dritter Altenbericht. Alter und Gesellschaft- Zur <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong>. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2002a): Vierter <strong>Bericht</strong> <strong>zur</strong> <strong>Lage</strong> <strong>der</strong> älteren <strong>Generation</strong><strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland: Risiken,Lebensqualität und Versorgung Hochaltriger - unter beson<strong>der</strong>erBerücksichtigung demenzieller Erkrankungen.Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2002b): Freiwilligen Agenturen, Börsen, Zentren.Schlüssel <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung des bürgerschaftlichen Engagements.Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2002c): Unternehmen und Gesellschaft. Praxisbeispielevom unternehmerischen Bürgerengagement mittelsPersonale<strong>in</strong>satz bis h<strong>in</strong> zu Projekte<strong>in</strong>sätzen <strong>in</strong> sozialenAufgabenfel<strong>der</strong>n als Teil <strong>der</strong> Personalentwicklung. Dokumentation.Berl<strong>in</strong>, Bonn: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2004): Altenhilfestrukturen <strong>der</strong> Zukunft. Abschlussbericht<strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitforschungzum Bundesmodellprogramm. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2005a): Möglichkeiten und Grenzen selbstständigerLebensführung <strong>in</strong> Privathaushalten. Ergebnisse <strong>der</strong>Studie MuG III. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(2005b): Möglichkeiten und Grenzen selbstständigerLebensführung (MuG III). Ausgewählte Repräsentativergebnisse.Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Gesundheit und Soziale Sicherung(2003a): Nachhaltigkeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong>Sozialen Sicherungssysteme - <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Kommission.Berl<strong>in</strong>: BMGS.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Gesundheit und Soziale Sicherung(2003b): <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> Bundesregierung nach § 160des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) über dieBeschäftigungssituation schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen.Drucksache 15/1295. Berl<strong>in</strong>: Bundestag.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Gesundheit und Soziale Sicherung(2004): Dritter <strong>Bericht</strong> über die Entwicklung <strong>der</strong>Pflegeversicherung. Bonn: BMGS.Bundesm<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft und Arbeit (2005): Alterungund Familienpolitik. Gutachten des WissenschaftlichenBeirats. (http://www.bmwa.bund.de/Navigation/M<strong>in</strong>isterium/beiraete,did=6458.html).Bundesregierung (2004a): Positive Zwischenbilanz <strong>zur</strong>Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Berl<strong>in</strong>: Bundesregierung.Bundesregierung (2004b): Verbraucherpolitischer <strong>Bericht</strong>2004 <strong>der</strong> Bundesregierung. Berl<strong>in</strong>: BMVEL.Bundesregierung (2005): Lebenslagen <strong>in</strong> Deutschland.Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht <strong>der</strong> Bundesregierung.Berl<strong>in</strong>: Bundesregierung.Bundesvere<strong>in</strong>igung <strong>der</strong> Deutschen Arbeitgeberverbände(2002): Ältere Mitarbeiter im Betrieb - E<strong>in</strong> Leitfaden fürUnternehmer. Berl<strong>in</strong>: Bundesvere<strong>in</strong>igung <strong>der</strong> DeutschenArbeitgeberverbände.Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför<strong>der</strong>ung(2004): Strategie für LebenslangesLernen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland. Materialien<strong>zur</strong> Bildungsplanung und <strong>zur</strong> Forschungsför<strong>der</strong>ung.Heft 115. Bonn: Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Bildunsplanungund Forschungsför<strong>der</strong>ung.Büttner, R. & Knuth, M. (2004): Spätere Zugänge <strong>in</strong>Frührenten - Regelaltersrente auf dem Vormarsch. Altersübergangs-Report2004-01. Düsseldorf, Gelsenkirchen:Hans-Böckler-Stiftung; Institut Arbeit und Technik.Calmbach, B. & Rauchfleisch, U. (1999): Lesbenfe<strong>in</strong>dlicheE<strong>in</strong>stellungen <strong>in</strong> sozialen Berufen. In: Wege zumMenschen. Monatszeitschrift für Seelsorge und Beratung,heilendes und soziales Handeln 51, S. 39-45.Cirkel, M.; Frerichs, F. & Gerl<strong>in</strong>g, V. (2000): Seniorenwirtschaft.In: Impulse - Zeitschrift <strong>der</strong> ForschungsgesellschaftGerontologie (FfG) und des Instituts für Gerontologiean <strong>der</strong> Universität Dortmund. Son<strong>der</strong>ausgabe Mai2000, S. 1-4.Cirkel, M.; Hilbert, J. & Schalk, C. (2004): Produkte undDienstleistungen für mehr Lebensqualität im Alter. Expertiseim Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Gelsenkirchen.Clemens, W. (2001): Ältere Arbeitnehmer im sozialenWandel. Von <strong>der</strong> verschmähten <strong>zur</strong> gefragten Humanressource?Opladen: Leske u. Budrich.
Drucksache 16/2190 – 282 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeClemens, W. (2003): Modelle und Maßnahmen betrieblicherAnpassung älterer Arbeitnehmer. In: M. Herfurth,M. Kohli & K.F. Zimmermann (Hrsg.): Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alterndenGesellschaft. Problembereiche und Entwicklungstendenzen<strong>der</strong> Erwerbsbeteiligung Älterer. Opladen:Leske u. Budrich, S. 93-129.Cohen, A. (2002): Leistungsanfor<strong>der</strong>ungen und Leistungsmöglichkeiten.In: B. Schlag, K. Megel & BMFSFJ(Hrsg.): Mobilität und gesellschaftliche Partizipation imAlter. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ, S. 292-310.Conrad, H. (2002): Die Pflegeversicherung <strong>in</strong> Japan: E<strong>in</strong>Überblick. In: Impulse - Zeitschrift <strong>der</strong> ForschungsgesellschaftGerontologie (FfG) und des Instituts für Gerontologiean <strong>der</strong> Universität Dortmund, S. 2-4.Conrad, H.; Gerl<strong>in</strong>g, V. & Naegele, G. (2005): HaushaltsbezogeneDienstleistungen <strong>in</strong> Japan: Neue Geschäftsfel<strong>der</strong>im silver market. Unveröffentlichte Expertise im Auftragdes Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend. Dortmund, Tokio.Crohan, S. E. & Antonucci, T. C. (1989): Friends as asource of social support <strong>in</strong> old age. In: R. G. Adams & R.Blieszner (Hrsg.): Ol<strong>der</strong> adult friendship: Structure andprocess. Newbury Park: Sage, S. 129-146.Daatland, S. O. & Herlofson, K. (2003): „Lost solidarity“or „change solidarity“: a comparative European view ofnormative solidarity. In: Age<strong>in</strong>g & Society 23(5), S. 537-560.Dannecker, M. (2000): Über schwule Erwachsene, zumFetisch Jugend und <strong>zur</strong> Midlife-Crisis bei schwulen Männern.„Jung zu se<strong>in</strong>, das ist nicht schwer, erwachsen se<strong>in</strong>dagegen sehr?“ Erste schwule Erwachsenenfachtagungfür die <strong>Generation</strong> zwischen Jugend und Alter (30-60 Jahre).Dokumentation <strong>der</strong> Kölner Fachtagung am 2.10.1999.Köln: Schwules Netzwerk NRW.Dannecker, M. & Reiche, R. (1974): Der gewöhnlicheHomosexuelle. E<strong>in</strong>e soziologische Untersuchung übermännliche Homosexuelle <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik. Frankfurta. M.: Campus.Dethloff, N. (2001): Die e<strong>in</strong>getragene Lebenspartnerschaft- e<strong>in</strong> neues familienrechtliches Institut. In: NeueJuristische Wochenzeitschrift 36, S. 2598-2604.Deutsche Angestelltenkrankenkasse (DAK) (2004):DAK-Gesundheitsreport 2004. Hamburg: Deutsche Angestelltenkrankenkasse.Deutsche Bank Research (2002): Die demographischeHerausfor<strong>der</strong>ung. Frankfurt a. M.Deutscher Bundestag (1998): Zweiter Zwischenbericht<strong>der</strong> Enquete-Kommission „Demographischer Wandel“ -Herausfor<strong>der</strong>ungen unserer älter werdenden Gesellschaftan den E<strong>in</strong>zelnen und die Politik. Zur Sache 8/1998. Berl<strong>in</strong>.Deutscher Bundestag (2001): Gutachten 2000/2001 desSachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen.Bedarfsgerechtigkeit und WirtschaftlichkeitBand I: Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierungund Partizipation. Band II: Qualitätsentwicklung <strong>in</strong> Mediz<strong>in</strong>und Pflege. BT-Drs. 14/5660. Bonn.Deutscher Bundestag (2002): Enquete-Kommission „DemographischerWandel“ - Herausfor<strong>der</strong>ungen unserer älterwerdenden Gesellschaft an den E<strong>in</strong>zelnen und diePolitik. Abschlussbericht. Zur Sache 3/2002. Berl<strong>in</strong>.Deutsches Institut für Urbanistik; Floet<strong>in</strong>g, H.; Reimann, B.& Schuleri-Hartje, U.-K. (2005): Entwicklung <strong>der</strong>Migrantenökonomie <strong>in</strong> den Stadtquartieren deutscherGroßstädte. Berl<strong>in</strong>.Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (2001):Schulbesuch und Berufsausbildung von jungen Auslän<strong>der</strong>n- kaum noch Fortschritte. DIW Wochenbericht 10/01. Berl<strong>in</strong>.Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (2002): Migrationund Sozialstaat. Empirische Evidenz und wirtschaftspolitischeImplikationen für Deutschland. Berl<strong>in</strong>:Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Vierteljahreshefte<strong>zur</strong> Wirtschaftsforschung Heft 2).Deutsches Rotes Kreuz (2000): ADENTRO. Maßnahmen<strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> gesellschaftlichen Teilhabe von spanischsprechenden Senior<strong>in</strong>nen und Senioren <strong>in</strong> Deutschland.Abschlussbericht e<strong>in</strong>es Modellprojekts. Bonn: Universitätsbuchdruckerei.Deutschland aktiv (2004): Deutschland aktiv. Der <strong>Bericht</strong><strong>der</strong> Initiative für Bürger-Engagement „für mich, für uns,für alle“. (http://www.buerger-engagement.de/3_expedition/<strong>in</strong>itiativenbericht_2004/Initiativenbericht_04.pdf).Diehl, C.; Urban, J. & Esser, H. (1998): Die soziale undpolitische Partizipation von Zuwan<strong>der</strong>ern <strong>in</strong> <strong>der</strong> BundesrepublikDeutschland. Bonn: Forschungs<strong>in</strong>stitut <strong>der</strong>Friedrich-Ebert-Stiftung.Dienel, C. (2004): Familien als Dienstleister des Sozialstaates:Die Pflege älterer Familienmitglie<strong>der</strong> im europäischenVergleich. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„7. Familienbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Magdeburg.Dietzel-Papakyriakou, M. (1993a): Ältere ausländischeMenschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik. In: Deutsches Zentrumfür Altersfragen (Hrsg.): Expertisen zum Ersten Altenbericht<strong>der</strong> Bundesregierung. Band III. Berl<strong>in</strong>: DeutschesZentrum für Altersfragen, S. 1-154.Dietzel-Papakyriakou, M. (1993b): Altern <strong>in</strong> <strong>der</strong> Migration.Die Arbeitsmigranten vor dem Dilemma: <strong>zur</strong>ückkehreno<strong>der</strong> bleiben? Stuttgart: Enke.Dietzel-Papakyriakou, M. (1999): Wan<strong>der</strong>ungen alterMenschen. Das Beispiel <strong>der</strong> Rückwan<strong>der</strong>ung älterer Arbeitsmigranten.In: G. Naegele & R. M. Schütz (Hrsg.):Soziale Gerontologie. Lebenslagen im Alter und Sozialpolitikfür ältere Menschen. Wiesbaden: WestdeutscherVerlag, S. 141-156.Dietzel-Papakyriakou, M. (2000): El<strong>der</strong>ly foreigners,el<strong>der</strong>s of foreign heritage <strong>in</strong> Germany. In: Revue Européennedes Migrations Internationales 16(3).
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 283 – Drucksache 16/2190Dietzel-Papakyriakou, M. (2003): Zentrale Befunde undPerspektiven des <strong>Bericht</strong>s <strong>der</strong> Enquete-Kommission„Demographischer Wandel“ - Herausfor<strong>der</strong>ungen unsererälter werdenden Gesellschaft an den E<strong>in</strong>zelnen und diePolitik. In: Sozialer Fortschritt 52(5-6), S. 130-135.Dietzel-Papakyriakou, M.; Leotsakou, A. & Raptaki, M.(2004): Mobilität von Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten imAlter. Wissenschaftliches Forschungsprojekt im Auftragdes Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugend. Berl<strong>in</strong>: BMFSFJ.Dietzel-Papakyriakou, M. & Olbermann, E. (1996): SozialeNetzwerke älterer Migranten. Zur Relevanz familiärerund <strong>in</strong>nerethnischer Unterstützung. In: Zeitschrift fürGerontologie und Geriatrie 29(1), S. 34-41.D<strong>in</strong>geldey, I. (2005): Zehn Jahre aktivierende Arbeitsmarktpolitik<strong>in</strong> Dänemark. In: WSI-Mitteilungen 1,S. 18-24.Dohmen, G. (2001): Das <strong>in</strong>formelle Lernen. Die Erschließunge<strong>in</strong>er bisher vernachlässigten Grundform menschlichenLernens für das Lebenslange Lernen. Bonn: Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Bildung und Forschung.Donges, J. B. (2005): Das Wachstum nimmt ab. In: Handelsblatt,S. 39.Dreher, S. (2003): Vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat?Die Bedeutung <strong>der</strong> Migration <strong>in</strong> <strong>der</strong> Globalisierungsdebatte.In: U. Hunger & B. Santel (Hrsg.): Migrationim Wettbewerbsstaat. Opladen: Leske u. Budrich.Ebb<strong>in</strong>ghaus, B. (2003): Exit from labor. Reform<strong>in</strong>g earlyretirement and social partnership <strong>in</strong> Europe, Japan, andthe USA. Habilitationsschrift. Köln: Wirtschafts- und sozialwissenschaftlicheFakultät <strong>der</strong> Universität.Eberl<strong>in</strong>g, M.; Hielscher, V.; Hildebrand, E. & Jürgens, K.(2004): Prekäre Balancen. Flexible Arbeitszeiten zwischenbetrieblicher Regulierung und <strong>in</strong>dividuellen Ansprüchen.Berl<strong>in</strong>: edition sigma.Ebert, O.; Hartnuß, B.; Rahn, E.; Schaaf-Derichs, C.;Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren Frauen und Jugend& Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>der</strong> Freiwilligenagenturen(2002): Freiwilligenagenturen <strong>in</strong> Deutschland. Ergebnissee<strong>in</strong>er Erhebung <strong>der</strong> Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<strong>der</strong> Freiwilligenagenturen (bagfa). Schriftenreihe desBundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauen undJugend, Bd. 227. Stuttgart: Kohlhammer.Eggen, B. (2001): Gleichgeschlechtliche Lebensgeme<strong>in</strong>schaften.Teil 2: Familiale und ökonomische Strukturengleichgeschlechtlicher Lebensgeme<strong>in</strong>schaften mit undohne K<strong>in</strong><strong>der</strong>n. In: Baden-Württemberg <strong>in</strong> Wort und Zahl(12), S. 579-583.Eisen, R. (2004): Kapitaldeckungs- versus Umlageverfahren<strong>in</strong> <strong>der</strong> Sozialen Sicherung - Fünf Mythen über dieVorteile des Kapitaldeckungsverfahrens. In: H. Rische &W. Schmähl (Hrsg.): Gesundheits- und Alterssicherung -gleiche Herausfor<strong>der</strong>ungen, gleiche Lösungen? Münster:LIT Verlag, S. 91-100.Engeln, A. (2003): Zur Bedeutung von Aktivität und Mobilitätfür die Entwicklung im Alter. In: Zeitschrift fürGerontopsychologie & -psychiatrie 16(3), S. 117-129.Engeln, A.; Schlag, B. & Deubel, K. (2002): Verbesserung<strong>der</strong> Attraktivität öffentlicher Verkehrsangebote fürältere Autofahrer<strong>in</strong>nen und Autofahrer. Probleme undpraktikable Lösungen. Berl<strong>in</strong>: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend.Engstler, H. (2004): Erwerbsbeteiligung <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweitenLebenshälfte und <strong>der</strong> Übergang <strong>in</strong> den Ruhestand. In:C. Tesch-Römer (Hrsg.): Sozialer Wandel und <strong>in</strong>dividuelleEntwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte. Ergebnisse<strong>der</strong> zweiten Welle des Alterssurveys. Berl<strong>in</strong>: DeutschesZentrum für Altersfragen, S. 113- 121.Engstler, H. & Menn<strong>in</strong>g, S. (2003): Die Familie im Spiegel<strong>der</strong> amtlichen Statistik. Berl<strong>in</strong>: Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren Frauen und Jugend.Engstler, H.; Menn<strong>in</strong>g, S.; Hoffmann, E. & Tesch-Römer,C. (2004): Die Zeitverwendung älterer Menschen. In:Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Alltag <strong>in</strong> Deutschland -Analysen <strong>zur</strong> Zeitverwendung. Band 43 <strong>der</strong> SchriftenreiheForum <strong>der</strong> Bundesstatistik. Stuttgart: Metzler-Poeschel, S. 216-246.Enquete-Kommission „Zukunft des BürgerschaftlichenEngagements“ (2002): Bürgerschaftliches Engagement -auf dem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e zukunftsfähige Bürgergesellschaft.Endbericht. Schriftenreihe: Enquete-Kommission „Zukunftdes Bürgerschaftlichen Engagements“ des DeutschenBundestages. Bd. 4. Opladen: Leske u. Budrich.Ericsson, K. A.; Krampe, R. T. & Tesch-Römer, C.(1993): The role of deliberate practice <strong>in</strong> the acquisitionof expert performance. In: Psychological Review (100),S. 363-406.Erl<strong>in</strong>ghagen, M. (2003): Die <strong>in</strong>dividuellen Erträge ehrenamtlicherArbeit. Zur sozioökonomischen Theorie unentgeltlicher,haushaltsextern organisierter Produktion. In:Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie55(4), S. 737-757.Ernst, J. (1995): Frühverrentung <strong>in</strong> Ostdeutschland. Ergebnissee<strong>in</strong>er empirischen Erhebung zu den Bed<strong>in</strong>gungenund sozialen Folgen des vorzeitigen Ruhestandes.Frankfurt a. M., Berl<strong>in</strong>, Bern: Lang.Europäische Kommission (2003): Beschäftigung <strong>in</strong>Europa 2003. Luxemburg: Europäische Kommission.Europäische Kommission (2004): Mehr und bessere Arbeitsplätzefür alle. Die Europäische Beschäftigungsstrategie.Luxemburg: Europäische Kommission.Europäische Zentralbank (EZB) (2004): Jahresbericht2004.Evers, A. (1999): För<strong>der</strong>ung bürgerschaftlichen Engagements- Zur Bedeutung von kooperativen Netzwerkenund <strong>der</strong> Nutzung sozialen Kapitals. In: J. Bogumil & H. J.Vogel (Hrsg.): Netzwerk: Kommunen <strong>der</strong> Zukunft: E<strong>in</strong>e
Drucksache 16/2190 – 284 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeGeme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative <strong>der</strong> Bertelsmann-Stiftung, <strong>der</strong>Hans-Böckler-Stiftung und <strong>der</strong> KGSt. BürgerschaftlichesEngagement <strong>in</strong> <strong>der</strong> kommunalen Praxis. Initiatoren, Erfolgsfaktorenund Instrumente, S. 127-133.Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“(2002): Auf dem Weg <strong>zur</strong> F<strong>in</strong>anzierung lebenslangenLernens. Zwischenbericht. Bielefeld.Expertenkommission „F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“(2004): Schlussbericht <strong>der</strong> unabhängigen Expertenkommission„F<strong>in</strong>anzierung Lebenslangen Lernens“: DerWeg <strong>in</strong> die Zukunft. BT-Drs. 15/3636. Berl<strong>in</strong>: DeutscherBundestag.Fach<strong>in</strong>ger, U. (2004): E<strong>in</strong>kommensverwendung im Alter.Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Bremen.Fach<strong>in</strong>ger, U.; Oelschläger, A. & Schmähl, W. (2004):Alterssicherung von Selbstständigen. Münster: LIT Verlag.Faist, T. & Özverenz, E. (Hrsg.) (2004): Transnationalsocial spaces. Agents, networks and <strong>in</strong>stitutions. Adelshot:Avebury.Faure, E. (1972): Learn<strong>in</strong>g to be. The world of educationtoday and tomorrow. Paris: UNESCO.Filipp, S. H. & Mayer, A. K. (1999): Bil<strong>der</strong> des Alters.Altersstereotype und die Beziehungen zwischen den <strong>Generation</strong>en.Stuttgart: Kohlhammer.Fischer, B. (2003): Seniorenwirtschaft <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. E<strong>in</strong> Instrument <strong>zur</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Lebenssituationälterer Menschen. <strong>Bericht</strong> <strong>der</strong> M<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> fürGesundheit, Soziales, Frauen und Familie des LandesNordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Düsseldorf: Eigenverlag.Förster, M. (1991): E<strong>in</strong>e Anmerkung <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>der</strong>Erwerbsquoten <strong>in</strong> <strong>der</strong> DDR zwischen 1981 und 1989. In:Projektgruppe „Das Sozio-ökonomische Panel“ (Hrsg.):Lebenslagen im Wandel: Basisdaten und -analysen <strong>zur</strong>Entwicklung <strong>in</strong> den Neuen Bundeslän<strong>der</strong>n. Frankfurta. M., New York: Campus, S. 139-147.Frankfurter Allgeme<strong>in</strong>e Zeitung (FAZ) vom 25.06.2004(2004): Die Insolvenzwelle ebbt kaum ab. In: FrankfurterAllgeme<strong>in</strong>e Zeitung.Frerichs, F. (1998): Älter werden im Betrieb. Beschäftigungschancenund -risiken im demographischen Wandel.Opladen: Westdeutscher Verlag.Gaitanides, S. (2003): Freiwilliges Engagement undSelbsthilfepotential von Familien ausländischer Herkunftund Migrantenselbstorganisationen - Anfor<strong>der</strong>ungen andie Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik. Berl<strong>in</strong>,Bonn: Bonner Universitäts- Buchdruckerei.Gensicke, T. (2004): Freiwilliges Engagement <strong>in</strong>Deutschland 1999-2004. Ergebnisse <strong>der</strong> repräsentativenTren<strong>der</strong>hebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichemEngegement (unveröff. Manuskript).München: TNS Infratest Sozialforschung.Gerlach, H. (2002): Wie erleben homosexuelle Männerpflegerische Situationen? In: Pflegezeitschrift (9), S. 2-6.Gerl<strong>in</strong>g, V. (2005): Migranten/<strong>in</strong>nen als neue Zielgruppen<strong>der</strong> Wirtschaft unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung desRuhrgebiets. Forschungsbericht. Dortmund: Forschungsgesellschaftfür Gerontologie.Gerl<strong>in</strong>g, V. & Conrad, H. (2002): Wirtschaftskraft Alter<strong>in</strong> Japan: Handlungsfel<strong>der</strong> und Strategien. UnveröffentlichteExpertise im Auftrag des BMFSFJ. Dortmund,Tokio.Gerl<strong>in</strong>g, V.; Naegele, G. & Scharfenorth, K. (2004): Derprivate Konsum älterer Menschen - „WirtschaftskraftAlter“ als e<strong>in</strong> neues Feld für Konzeptualisierung undWeiterentwicklung <strong>der</strong> These von <strong>der</strong> „Altersproduktivität“.In: Sozialer Fortschritt 53(11-12), S. 293-301.GeroStat (2005): Statistisches Informationssystem. DeutschesZentrum für Altersfragen (DZA). (www.gerostat.de).Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) (2002): 50plus2002 - Der <strong>Bericht</strong>-Band 1. Nürnberg.Gille, C. (2003): Homosexuelle Männer im Alter. ÜberAspekte von gutem Leben im Alter und die Unterstützungsmöglichkeiten,die durch die schwule Geme<strong>in</strong>schaftund durch professionelle Altenhilfe geschaffen werdenkönnen. Berl<strong>in</strong>: Evangelische Fachhochschule Berl<strong>in</strong>.Göbel, D. (1983): Lebense<strong>in</strong>kommen und Erwerbsbiographie.Frankfurt a. M., New York: Campus.Goebel, J.; Habich, R. & Krause, P. (2004): E<strong>in</strong>kommen -Verteilung, Armut und Dynamik. In: Statistisches Bundesamt(Hrsg.): Datenreport 2004. Bonn, S. 623-638.Gräf, B. (2003): Deutsches Wachstumspotenzial: Vor demografischerHerausfor<strong>der</strong>ung. Deutsche Bank Research,Aktuelle Themen Nr. 277.Grossmann, A. H.; D'Augelli, A. R. & Hershberger, S. L.(2000): Social support networks of lesbian, gay, andbisexual adults 60 years of age and ol<strong>der</strong>. In: Journal ofGerontology 55B(3), S. 171-179.Grünewald, U. & Moraal, D. (2002): Betriebliche Weiterbildung<strong>in</strong> Deutschland - fit für Europa? Ergebnisse <strong>der</strong>zweiten europäischen Weiterbildungserhebung. In: Berufsbildung<strong>in</strong> Wissenschaft und Praxis (3), S. 18-23.Grünewald, U.; Moraal, D. & Schönefeld, G. (2003): BetrieblicheWeiterbildung <strong>in</strong> Deutschland und Europa. Bielefeld:Bertelsmann.Hänsch, U. (2002): Lebenswege lesbischer Frauen. Zehnbiografische Portraits. Düsseldorf: M<strong>in</strong>isterium fürFrauen, Jugend, Familie und Gesundheit des LandesNordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.Hareven, T. K. (1994): Ag<strong>in</strong>g and generational relations:A historical and life course perspective. In: AnnualReview of Sociology 20, S. 437-461.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 285 – Drucksache 16/2190Hareven, T. K. (2001): Historical perspectives on ag<strong>in</strong>gand family relations. 5.ed. In: R. H. B<strong>in</strong>stock & L. K.George (Hrsg.): Handbook of ag<strong>in</strong>g and the socialsciences. San Diego: Academic Press, S. 141-159.Haug, S. (2004): Soziale Integration durch soziale E<strong>in</strong>bettung<strong>in</strong> Familie, Verwandschafts- und Freundesnetzwerke.In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 29,S. 163-192.Haupt, H. & Liebscher, R. (2005): Sozialreport 50+ 2005.Daten und Fakten <strong>zur</strong> sozialen <strong>Lage</strong> 50- bis unter 65-Jähriger<strong>in</strong> den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n. Berl<strong>in</strong>: trafo verlag.Haus, M. (2005): Zivilgesellschaft und soziales Kapitalim städtischen Raum. In: Aus Politik und Zeitgeschichte(3), S. 25-31.Hauser-Schöner, I. (1994): K<strong>in</strong><strong>der</strong> brauchen ihre Großeltern.München: Kösel.He<strong>in</strong>ze, R.G. & Olk, T. (Hrsg.) (2001): Bürgerengagement<strong>in</strong> Deutschland. Bestandsaufnahme und Perspektiven.Opladen: Leske & Budrich.Helmstädter, E. (1996): Perspektiven <strong>der</strong> Sozialen Marktwirtschaft.Ordnung und Dynamik des Wettbewerbs.Worte - Werke - Utopien. Bd. 2. Münster: Lit-Verlag.Henke, C. (2000): Das Ruhestandsverhalten <strong>der</strong> älterenArbeitnehmer <strong>in</strong> Ost- und Westdeutschland. E<strong>in</strong>e empirischeUntersuchung auf <strong>der</strong> Basis des SozioökonomischenPanels. In: Sozialer Fortschritt 49(8/9), S. 196-213.Heyl, V. (2004): Freundschaften im mittleren und höherenErwachsenenalter: Der lange Arm frühk<strong>in</strong>dlicher Erfahrungen.In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie37(5), S. 357-359.Hill, P. B. & Kopp, J. (2002): Familiensoziologie. 2. Aufl.Opladen: Westdeutscher Verlag.Himmelreicher, R. K. & Viebrok, H. (2003): „Riester-Rente“ und Rentabilität <strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersvorsorge. In: DeutscheRentenversicherung (6-7), S. 332-350.Hoff, A. (2001): Informal vs. formal support mobilizationby lone mothers <strong>in</strong> Germany and the United K<strong>in</strong>gdom.The London School of Economics and Political Science(Unpublished PhD thesis).Hoff, A. (2004a): Intergenerationale Familienbeziehungenim Wandel. In: C. Tesch-Römer (Hrsg.): SozialerWandel und <strong>in</strong>dividuelle Entwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte.Ergebnisse <strong>der</strong> zweiten Welle des Alterssurveys.Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen,S. 209-266.Hoff, A. (2004b): Intergenerationale und <strong>in</strong>tragenerationaleBeziehungen und Transfers <strong>in</strong> Familien. EmpirischeDatenanalyse auf Basis des Alterssurveys. Expertise imAuftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission „5. Altenbericht<strong>der</strong> Bundesregierung“. Berl<strong>in</strong>.Hoff, A. & Tesch-Römer, C. (im Druck): Family relationsand ag<strong>in</strong>g - Substantial changes s<strong>in</strong>ce the middle of thelast century? In: H.-W. Wahl & C. Tesch-Römer (Hrsg.):New dynamics <strong>in</strong> old age: Individual, environmental andsocietal perspectives. Amityville New York: Baywood.Holzmann, R. & H<strong>in</strong>z, R. (2005): Old-age <strong>in</strong>come support<strong>in</strong> the twenty-first century: An <strong>in</strong>ternational perspectiveon pension systems and reform (Web Version, February18, 2005).Hönekopp, E. (2004): Arbeitsmarktpotenziale ältererAuslän<strong>der</strong> bzw. E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>er. Recherche im Auftrag <strong>der</strong>Sachverständigenkommission „5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Nürnberg.Höpfl<strong>in</strong>ger, F. (1999): <strong>Generation</strong>enfrage. Lausanne:Réalités sociales.Hübner, W. & Wahse, J. (2002): Ältere Arbeitnehmer -e<strong>in</strong> personalpolitisches Problem? In: E. Kistler & H. G.Mendius (Hrsg.): Demographischer Strukturbruch undArbeitsmarktentwicklung. Probleme, Fragen, erste Antworten- SAMF-Jahrestagung 2001. Broschürenreihe:Demographie und Erwerbsarbeit. Stuttgart: FraunhoferIAO, S. 68-86.Ikk<strong>in</strong>k, K. K. & Van Tilburg, T. (1998): Do ol<strong>der</strong> adults'network members cont<strong>in</strong>ue to provide <strong>in</strong>strumental support<strong>in</strong> unbalanced relationship? In: Journal of Social andPersonal Relationships 15, S. 59-75.Ilmar<strong>in</strong>en, J. (2002): Physical requirements associatedwith the work of ag<strong>in</strong>g workers <strong>in</strong> the European Union.In: Experimental Ag<strong>in</strong>g Research 28, S. 7-23.Ilmar<strong>in</strong>en, J. E. (1999): Age<strong>in</strong>g workers <strong>in</strong> the EuropeanUnion - status and promotion of work ability, employabilityand employment. Hels<strong>in</strong>ki: F<strong>in</strong>ish Institute ofOccupational Health, M<strong>in</strong>istry of Social Affairs andHealth, M<strong>in</strong>istry of Labour.<strong>in</strong>fas (2001): Bildung im Alter. Bildungsbeteiligung undBildungs<strong>in</strong>teressen älterer Menschen. Bonn-Bad Godesberg:<strong>in</strong>fas.Ingersoll-Dayton, B. & Antonucci, T. C. (1988): Reciprocaland nonreciprocal social support: contrast<strong>in</strong>g sides of<strong>in</strong>timate relationships. In: Journal of Gerontology 43(3),S. S65-73.Institut für Freizeitwirtschaft München (2003a):Marktchancen im Gesundheitstourismus. Health-Care,Anti-Ag<strong>in</strong>g-, Wellness- und Beauty-Urlaub bis 2010.München: Institut für Freizeitwirtschaft.Institut für Freizeitwirtschaft München (2003b): Zielgruppenund Marktchancen im Freizeitsport 2002 bis2010. München.Institut für Mittelstandsforschung; Leicht, R.; Humpert,A. & Leiss, M. (2005): Ethnische Ökonomie. Mannheim:Universität.Jäck, S. (2003): Wo Schwule und Lesben geme<strong>in</strong>sam altwerden können. In: Pflegezeitschrift 56(3), S. 181-183.Jansen, R. & Müller, R. (2000): Arbeitsbelastungen undGesundheit älterer Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich.In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 33(4),S. 256-261.
Drucksache 16/2190 – 286 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeJETRO (2000): Japanese Market Report No. 50 - SeniorCitizen- related Bus<strong>in</strong>esses. JETRO.Kaldybajewa, K. (2005): Rentenzugang <strong>der</strong> BfA 2004:Arbeitslosigkeit als wesentlicher Grund für den Rentenzugangbei Frauen und Männern. In: Die Angestelltenversicherung52, S. 213-221.Kal<strong>in</strong>a, T. & Knuth, M. (2002): Arbeitslosigkeit als Übergangzwischen Beschäftigung und Rente <strong>in</strong> Westdeutschland.Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik.Kammerer, D. (2003): AltenpflegGayheim - Toleranz istgefragt. In: Heim + Pflege 34, S. 6-8.Karazman, R.; Geißler, H.; Kloimüller, I. & W<strong>in</strong>kler, N.(Hrsg.) (1995): Betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung für älterwerdendeArbeitnehmer. Schriftenreihe des Institutsfür betriebliche Gesundheitsför<strong>der</strong>ung (IBG-Austria).Gamburg: Verlag für Gesundheitsför<strong>der</strong>ung.Kaufmann, F.-X. (1995): Zukunft <strong>der</strong> Familie im vere<strong>in</strong>igtenDeutschland. München: Beck.Kaufmann, F.-X. (2005): Schrumpfende Gesellschaft.Vom Bevölkerungsrückgang und se<strong>in</strong>en Folgen. Frankfurta. M.: Suhrkamp.Kauth-Kokshorn, E.-M. (1999): Wohn- und Lebenssituationälterer ausländischer Hamburger<strong>in</strong>nen und Hamburger.In: Das Gesundheitswesen 61, S. 522-527.Keupp, H. (2003): Lokale E<strong>in</strong>richtungen <strong>zur</strong> För<strong>der</strong>ungdes bürgerschaftlichen Engagements: Freiwilligenagenturen,Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros u.ä. - Chancenund Restriktionen. In: Enquete-Kommission „Zukunftdes Bürgerschaftlichen Engagements“ (Hrsg.):Bürgerschaftliches Engagement <strong>in</strong> den Kommunen.Schriftenreihe: Enquete-Kommission „Zukunft des BürgerschaftlichenEngagements“ des Deutschen Bundestages.Bd. 8. Opladen: Leske u. Budrich, S. 13-51.Kiewel, A. (2000): Handlungsfel<strong>der</strong> für Patientenschutzund -beteiligung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arzneimittelversorgung. In: DieKrankenversicherung 52(12), S. 354.Kistler, E. & Huber, A. (2002): Entlastet die demographischeEntwicklung den Arbeitsmarkt nachhaltig? Ke<strong>in</strong>Licht am Ende des Tunnels. In: E. Kistler & H. G. Mendius(Hrsg.): Demographischer Strukturbruch und Arbeitsmarktentwicklung.Probleme, Fragen, erste Antworten- SAMF-Jahrestagung 2001. Broschürenreihe:Demographie und Erwerbsarbeit. Stuttgart: FraunhoferIAO, S. 48-67.Kle<strong>in</strong>, T. (1996): Mortalität <strong>in</strong> Deutschland: Aktuelle Entwicklungenund soziale Unterschiede. In: W. Zapf, J.Schupp & R. Habich (Hrsg.): Lebenslagen im Wandel.Sozialberichterstattung im Längsschnitt. Frankfurt a. M.,New York: Campus, S. 366-377.Kle<strong>in</strong>, T. (2004): Lebenserwartung - gesellschaftliche undgerontologische Bedeutung e<strong>in</strong>es demografischen Konzepts.In: A. Kruse & M. Mart<strong>in</strong> (Hrsg.): Enzyklopädie<strong>der</strong> Gerontologie. Bern: Huber, S. 66-81.Kle<strong>in</strong>, T.; Lengerer, A. & Uzelac, M. (2002): PartnerschaftlicheLebensformen im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich.In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 27(3),S. 359-379.Klemp, G. O. & McClelland, D. C. (1986): What characterizes<strong>in</strong>telligent function<strong>in</strong>g among senior managers?In: R. J. Sternberg & R. K. Wagner (Hrsg.): Practical<strong>in</strong>telligence <strong>in</strong> an everyday world. New York: CambridgeUniversity Press, S. 31-50.Klie, T. (2004a): Wie es Euch gefällt: personenbezogenePflegebudgets proben den Auftritt. Selbstbestimmte Pflegearrangementswerden den häuslichen Pflegemarkt revolutionieren.In: Forum Sozialstation 126(2), S. 12-17.Klie, T. (2004b): Das personengebundene Pflegebudget.Erfahrungen aus den Nie<strong>der</strong>landen. In: Dr. med. Mabuse151(9/10), S. 45-47.Klie, T.; Hoch, H. & Pfundste<strong>in</strong>, T. (2005): Zwischenberichtdes Teilprojekts „Heim- und Engagiertenbefragung“15. Juli 2004 (unveröff. Manuskript). Baden-Württemberg:Sozialm<strong>in</strong>isterium.Kliegel, M. (2004): Gesundheitsverhalten bei chronischenKrankheiten im höheren Erwachsenenalter. In:A. Kruse & J. Mart<strong>in</strong> (Hrsg.): Enzyklopädie <strong>der</strong> Gerontologie.Bern: Huber, S. 314-327.Kliegl, R. & Mayr, U. (1997): Kognitive Leistungen undLernpotential im höheren Erwachsenenalter. In:F.E. We<strong>in</strong>ert & H. Mandl (Hrsg.): Enzyklopädie <strong>der</strong> Psychologie- Pädagogische Psychologie. Psychologie <strong>der</strong> Erwachsenenbildung.Bd. IV. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe, S. 86-114.Köchl<strong>in</strong>g, A. & Deimel, M. (2004): Ältere Beschäftigteund altersausgewogene Personalpolitik. Workshopauswertung.Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Dortmund.Kohli, M. (2002): <strong>Generation</strong>engerechtigkeit ist mehr alsRentenf<strong>in</strong>anzierung. In: Zeitschrift für Gerontologie undGeriatrie 35(2), S. 129-138.Kohli, M. & Künemund, H. (1997): Nachberufliche Tätigkeitsfel<strong>der</strong>Konzepte, Forschungslage, Empirie. Schriftenreihedes Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend, Bd. 130.1. Stuttgart, Berl<strong>in</strong>, Köln:Kohlhammer.Kohli, M. & Künemund, H. (2001): Partizipation und Engagementälterer Menschen. Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven.In: Deutsches Zentrum für Altersfragen(Hrsg.): Lebenslagen, soziale Ressourcen undgesellschaftliche Integration im Alter. Opladen: Leske u.Budrich, S. 117-234.Kohli, M.; Künemund, H.; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. & Szydlik,M. (2000a): <strong>Generation</strong>enbeziehungen. In: M. Kohli & H.Künemund (Hrsg.): Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche<strong>Lage</strong> und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey. Opladen: Leske u. Budrich, S. 176-211.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 287 – Drucksache 16/2190Kohli, M.; Künemund, H.; Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A. &Szydlik, M. (2000b): Grunddaten <strong>zur</strong> Lebenssituation <strong>der</strong>40-85jährigen deutschen Bevölkerung. Berl<strong>in</strong>: Weißensee.Koller, B.; Bach, H.-U. & Brixy, U. (2003): Ältere ab55 Jahren - Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Leistungen<strong>der</strong> Bundesanstalt für Arbeit. IAB Werkstattbericht5. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung<strong>der</strong> Bundesanstalt für Arbeit.Kommission <strong>der</strong> Europäischen Geme<strong>in</strong>schaften (2004):Mitteilung <strong>der</strong> Kommission an den Rat, das europäischeParlament, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschussund den Ausschuss <strong>der</strong> Regionen: Anhebung <strong>der</strong>Beschäftigungsquote älterer Arbeitskräfte und des Erwerbsaustrittsalters.KOM (2004) 146 endgültig. Brüssel:Kommission <strong>der</strong> Europäischen Geme<strong>in</strong>schaften.Kommission <strong>der</strong> Europäischen Geme<strong>in</strong>schaften (2005):Grünbuch „Angesichts des demografischen Wandels -e<strong>in</strong>e neue Solidarität zwischen den <strong>Generation</strong>en“. KOM(2005) 94 endgültig. Brüssel: Kommission <strong>der</strong> EuropäischenGeme<strong>in</strong>schaften.Korczak, D. (2004): Überschuldungssituation <strong>in</strong> Deutschlandim Jahr 2002. Expertise für den 2. Armuts- undReichtumsbericht <strong>der</strong> Bundesregierung. München.Korporal, J. & Dangel, B. (2004): Die Gesundheit vonMigrant<strong>in</strong>nen und Migranten als Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeitim Alter. Expertise im Auftrag <strong>der</strong>Sachverständigenkommission „5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Berl<strong>in</strong>.Kotsusho, K. (2001): Horitso no kaisei nado (Gesetzesrevisionenund an<strong>der</strong>es).Krumme, H. (2003): „Halbe hier, halbe da“ - Pendelmigrationtürkischer Arbeitsmigranten im Ruhestand. In:Informationsdienst Altersfragen 30(1), S. 6-8.Krumme, H. & Hoff, A. (2004): Die Lebenssituation ältererAuslän<strong>der</strong><strong>in</strong>nen und Auslän<strong>der</strong> <strong>in</strong> Deutschland. In:C. Tesch-Römer (Hrsg.): Sozialer Wandel und <strong>in</strong>dividuelleEntwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte. Ergebnisse<strong>der</strong> zweiten Welle des Alterssurveys. Berl<strong>in</strong>: DeutschesZentrum für Altersfragen, S. 455-500.Kruse, A. (1997): Bildung und Bildungsmotivation imErwachsenenalter. In: F. E. We<strong>in</strong>ert & H. Mandl (Hrsg.):Enzyklopädie <strong>der</strong> Psychologie. Psychologie <strong>der</strong> Erwachsenenbildung.Bd. 4. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe, S. 117-179.Kruse, A. (2002a): Gesund altern. Stand <strong>der</strong> Präventionund Entwicklung ergänzen<strong>der</strong> Präventionsstrategien.Schriftenreihe des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Gesundheit.Bd. 146. Baden-Baden: Nomos.Kruse, A. (2002b): Produktives Leben im Alter: Der Umgangmit Verlusten und <strong>der</strong> Endlichkeit des Lebens. In:R. Oerter & L. Montada (Hrsg.): Entwicklungspsychologie.We<strong>in</strong>heim: Psychologie Verlags Union, S. 983-996.Kruse, A. (2004): Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ungim Alter. In: K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.):Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung. Bern: Huber,S. 41-54.Kruse, A. (2005a): Biographische Aspekte des Alter(n)s:Lebensgeschichte und Diachronizität. In: U. M. Staud<strong>in</strong>ger& S. H. Filipp (Hrsg.): Enzyklopädie <strong>der</strong> Psychologie –Entwicklungspsychologie: Entwicklung im mittleren undhöheren Erwachsenenalter. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe, S. 1-38.Kruse, A. (2005b): Selbstständigkeit, Selbstverantwortung,bewusst angenommene Abhängigkeit und Mitverantwortungals Kategorien e<strong>in</strong>er Ethik des Alters. In:Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 38, S. 273-286.Kruse, A. (2005c): Das letzte Lebensjahr. Zur körperlichen,psychischen und sozialen Situation des alten Menschenam Ende se<strong>in</strong>es Lebens. Urban TaschenbücherBd. 771. Stuttgart: Kohlhammer.Kruse, A.; Gaber, E.; Heuft, G. & Oster, P. (2002): Gesundheitim Alter. Gesundheitsbericht für die BundesrepublikDeutschland. Berl<strong>in</strong>: Robert Koch Institut.Kruse, A.; Lehr, U. & Schmitt, E. (2004): Ressourcen desAlters erkennen und nutzen - <strong>zur</strong> Produktivität ältererMenschen. In: G. Jüttemann (Hrsg.): Psychologie als Humanwissenschaft.Gött<strong>in</strong>gen: Vandenhoeck u. Ruprecht,S. 345-360.Kruse, A. & Packebusch, L. (im Druck): AlternsgerechteArbeitsgestaltung. In: B. Zimolong & U. Konradt (Hrsg.):Ingenieurpsychologie. Enzyklopädie <strong>der</strong> Psychologie.Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Kruse, A. & Rud<strong>in</strong>ger, G. (1997): Lernen und Leistung imErwachsenenalter. In: F. E. We<strong>in</strong>ert & H. Mandl (Hrsg.):Enzyklopädie <strong>der</strong> Psychologie - Pädagogische Psychologie.Bd. IV: Psychologie <strong>der</strong> Erwachsenenbildung. Gött<strong>in</strong>gen:Hogrefe, S. 45-85.Kruse, A. & Schmitt, E. (2001a): Psychology of education<strong>in</strong> old age. In: N. J. Smelser & P. B. Baltes (Hrsg.):International Encyclopedia of the Social and BehavioralSciences. Oxford: Pergamon, S. 4223-4227.Kruse, A. & Schmitt, E. (2001b): Adult education andtra<strong>in</strong><strong>in</strong>g: Cognitive aspects. In: N. J. Smelser & P. B.Baltes (Hrsg.): International Encyclopedia of the Socialand Behavioral Sciences. Oxford: Pergamon, S. 139-142.Kruse, A. & Schmitt, E. (2004): Differentielle Psychologiedes Alterns. In: K. Pawlik (Hrsg.): Enzyklopädie <strong>der</strong>Psychologie: Theorien und Anwendungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> DifferentiellenPsychologie. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe, S. 533-571.Kruse, A.; Schmitt, E.; Dietzel-Papakyriakou, M. &Kampanaros, D. (2004): Migration. In: A. Kruse &M. Mart<strong>in</strong> (Hrsg.): Enzyklopädie <strong>der</strong> Gerontologie. Bern:Verlag Hans Huber, S. 576-592.Künemund, H. (2004): Partizipation und Engagement ältererMenschen. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Berl<strong>in</strong>.Kütt<strong>in</strong>g, H. J. & Krüger, K. (2002): Zukünftige Automobilitätälterer Menschern. In: B. Schlag & K. Megel(Hrsg.): Mobilität und gesellschaftliche Partizipation imAlter. Stuttgart: Kohlhammer, S. 161-172.
Drucksache 16/2190 – 288 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeLandesregierung Schleswig-Holste<strong>in</strong> (2004): ZukunftsfähigesSchleswig-Holste<strong>in</strong> - Konsequenzen des demographischenWandels. Kiel.Lang, F. R. (2000a): End<strong>in</strong>gs and cont<strong>in</strong>uity of socialrelationships: Maximiz<strong>in</strong>g <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sic benefits with<strong>in</strong> personalnetworks when feel<strong>in</strong>g near to death? In: Journal ofSocial and Personal Relationships 17, S. 157-184.Lang, F. R. (2000b): Soziale Beziehungen im Alter: Ergebnisse<strong>der</strong> empirischen Forschung. In: H.-W. Wahl &C. Tesch-Römer (Hrsg.): Angewandte Gerontologie <strong>in</strong>Schlüsselbegriffen. Stuttgart: Kohlhammer, S. 142-147.Lang, F. R.; Neyer, F. J. & Asendorpf, J. B. (2005): Entwicklungund Gestaltung sozialer Beziehungen. In: S. H.Filipp & U. M. Staud<strong>in</strong>ger (Hrsg.): Entwicklungspsychologiedes mittleren und höheren Erwachsenenalters. Enzyklopädie<strong>der</strong> Psychologie, Serie Entwicklungspsychologie,Band C/V/6. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe, S. 377-416.Laumann, E. O.; Michael, R. T. & Michaels, S. (1994):The social organization of sexuality <strong>in</strong> the United States.Chicago: University of Chicago Press.Leber, U. (2002): Betriebliche Weiterbildung von Männernund Frauen. In: G. Engelbrech (Hrsg.): Arbeitsmarktchancenfür Frauen. Beiträge <strong>zur</strong> Arbeits- und Berufsforschung.Nürnberg, S. 175-191.Leber, U. (2004): Wechselseitige Beziehungen zwischenZuwan<strong>der</strong>ung und Sozialversicherung. Beiträge <strong>zur</strong> Arbeitsmarkt-und Berufsforschung BeitrAB 281. Nürnberg:Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung <strong>der</strong> Bundesagenturfür Arbeit.Leiser<strong>in</strong>g, L. (2002): Entgrenzung und Remoralisierung -Alterssicherung und <strong>Generation</strong>enbeziehungen im globalisiertenWohlfahrtskapitalismus. In: Zeitschrift für Gerontologieund Geriatrie 35(4), S. 343-345.Lepp<strong>in</strong>, A. (2004): Konzepte und Strategien <strong>der</strong> Krankheitsprävention.In: K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch(Hrsg.): Lehrbuch Prävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung.Bern: Huber, S. 41-54.Lettke, F. & Lüscher, K. (2002): <strong>Generation</strong>enambivalenz- E<strong>in</strong> Beitrag zum Verständnis von Familien heute. In:Soziale Welt 54(4), S. 437-466.L<strong>in</strong>denberger, U. (2000): Intellektuelle Entwicklung überdie Lebensspanne: Überblick über ausgewählte Forschungsbrennpunkte.In: Psychologische Rundschau 51,S. 135-145.L<strong>in</strong>denberger, U.; Kliegl, R. & Baltes, P. B. (1992): Professionalexpertise does not elim<strong>in</strong>ate negative agedifferences <strong>in</strong> imagery-based memory performancedur<strong>in</strong>g adulthood. In: Psychology and Ag<strong>in</strong>g, S. 585-593.Lüscher, K. (1998): A heuristic model for the Study ofIntergenerational Ambivalence. Konstanz: SozialwissenschaftlicheFakultät <strong>der</strong> Universität Konstanz, Forschungsschwerpunkt„Gesellschaft und Familie“ (ArbeitspapierNr. 29).Lüscher, K. & Liegle, L. (2003): <strong>Generation</strong>enbeziehungen<strong>in</strong> Familie und Gesellschaft. Bd. 11. Konstanz: UVKVerlagsgesellschaft.Mai, R. (2003): Die Alten <strong>der</strong> Zukunft. E<strong>in</strong>e bevölkerungsstatistischeAnalyse. Schriftenreihe des Bundes<strong>in</strong>stitutsfür Bevölkerungsforschung. Bd. 32. Opladen:Leske u. Budrich.Mai, R. & Roloff, J. (2004a): Zukunft von Potenzialen <strong>in</strong>Paarbeziehungen älterer Menschen. Perspektiven vonFrauen und Männern. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Wiesbaden.Mai, R. & Roloff, J. (2004b): Entwicklung und Struktur<strong>der</strong> deutsch-deutschen Wan<strong>der</strong>ungen. Expertise im Auftrag<strong>der</strong> Sachverständigenkommission „5. Altenbericht<strong>der</strong> Bundesregierung“. Wiesbaden.Manow, P. (2000): Kapitaldeckung o<strong>der</strong> Umlage: ZurGeschichte e<strong>in</strong>er anhaltenden Debatte. In: S. Fisch & U.Haerendel (Hrsg.): Geschichte und Gegenwart <strong>der</strong> Rentenversicherung<strong>in</strong> Deutschland. Beiträge <strong>zur</strong> Entstehung,Entwicklung und vergleichenden E<strong>in</strong>ordnung <strong>der</strong> Alterssicherungim Sozialstaat. Bd. 141 Schriftenreihe <strong>der</strong>Hochschule Speyer. Berl<strong>in</strong>, S. 145-168.Mart<strong>in</strong>, J. (2002): Als engagierte Bürger Sozialplanunganstoßen - Netzwerke helfen Menschen und Organisationen.In: Blätter <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege 149, S. 217-218.Mart<strong>in</strong>s, J. O.; Gionand, F.; Antol<strong>in</strong>, P.; de la Maisoneuve,C. & Yoo, K.-Y. (2005): The impact of age<strong>in</strong>g on demand,factor markets and growth. Paris: Organisation forEconomic Co-Operation and Development.Matthäi, I. (2004): Ältere alle<strong>in</strong> stehende Migrant<strong>in</strong>nen.Berl<strong>in</strong>: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauenund Jugend.Mehrlän<strong>der</strong>, U.; Ascheberger, C. & Ueltzhöffer, J. (1996):Situation <strong>der</strong> ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland.Berl<strong>in</strong>: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Arbeit und Sozialordnung.Meier-Baumgartner, H. P.; Dapp, U. & An<strong>der</strong>s, J. (2004):Aktive Gesundheitsför<strong>der</strong>ung im Alter. E<strong>in</strong> neuartigesPräventionsprogramm für Senioren. Stuttgart: Kohlhammer.Me<strong>in</strong>hard, V. & Zwiener, R. (2005): GesamtwirtschaftlicheWirkungen e<strong>in</strong>er Steuerf<strong>in</strong>anzierung versicherungsfrem<strong>der</strong>Leistungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Sozialversicherung. Berl<strong>in</strong>.Menn<strong>in</strong>g, S. (2004): Die Zeitverwendung älterer Menschenund die Nutzung von Zeitpotenzialen für <strong>in</strong>formelleHilfeleistungen und bürgerschaftliches Engagement. Expertiseim Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Berl<strong>in</strong>.Micklitz, H.-W. & Reisch, L. A. (2004): Verbraucherpolitikund Verbraucherschutz für das Alter. Expertise imAuftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission „5. Altenbericht<strong>der</strong> Bundesregierung“. Bamberg.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 289 – Drucksache 16/2190M<strong>in</strong>isterium für Arbeit, Soziales, Stadtentwicklung, Kulturund Sport NRW (1999): Selbstorganisation von Migrant<strong>in</strong>nenund Migranten <strong>in</strong> NRW. Düsseldorf, Essen,Münster: Zentrum für Türkeistudien, Institut für Politikwissenschaft<strong>der</strong> Universität Münster.Mol<strong>in</strong>ie, A. (2003): Age and work<strong>in</strong>g conditions <strong>in</strong> theEuropean Union. Luxemburg: European Foundation forthe Improvement of Liv<strong>in</strong>g and Work<strong>in</strong>g Conditions.Moll, T. & Stichnoth, U. (2003): Die quantitative Entwicklung<strong>der</strong> Renten wegen verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Erwerbsfähigkeit.E<strong>in</strong>e vergleichende Betrachtung 2000 bis 2002. In:Die Angestelltenversicherung 50(8/9), S. 419-426.Montada, L. (1996): Machen Gebrechlichkeit und chronischeKrankheit produktives Altern unmöglich? In: M.Baltes & L. Montada (Hrsg.): Produktives Leben im Alter.Frankfurt a. M., S. 382-392.Morschhäuser, M. (1999): Alternsgerechte Arbeit: Gestaltungsaufgabefür die Zukunft o<strong>der</strong> Kampf gegenW<strong>in</strong>dmühlen? In: J. Behrens, M. Morschhäuser, H.Viebrok & E. Zimmermann (Hrsg.): Länger erwerbstätig -aber wie? Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 19-70.Morschhäuser, M. (Hrsg.) (2002): Gesund bis <strong>zur</strong> Rente.Konzepte gesundheits- und alternsgerechter Arbeits- undPersonalpolitik. Broschürenreihe: Demographie und Erwerbsarbeit.Stuttgart: Fraunhofer IAO.Motel-Kl<strong>in</strong>gebiel, A.; Tesch-Römer, C. & vonKondratowitz, H.-J. (2005): Welfare states do not crowdout the family: evidence for functional differentiationfrom comparative analyses. In: Age<strong>in</strong>g and Society 25.Münnich, M. (2001): Zur wirtschaftlichen <strong>Lage</strong> vonRentner- und Pensionärshaushalten. In: Wirtschaft undStatistik (7), S. 546-571.Myles, J. (2002): A new social contract for the el<strong>der</strong>ly. In:G. Esp<strong>in</strong>g-An<strong>der</strong>sen (Hrsg.): Why we need a new welfarestate. Oxford: University, S. 130-172.Naegele, G. (1977): Konsumverhalten sozial schwacheralter Menschen. Möglichkeiten und Grenzen e<strong>in</strong>er alternspezifischenVerbraucherpolitik. Bonn: Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<strong>der</strong> Verbraucher e.V.Naegele, G. (1992, 2004: 2. Auflage): Zwischen Arbeitund Rente - Gesellschaftliche Chancen und Risiken ältererArbeitnehmer. Augsburg: Maro-Verlag.Naegele, G. (1996): Demographische und strukturelleVerän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt - Neue Herausfor<strong>der</strong>ungenan berufliche Fort- und Weiterbildung. In:L. Veelken, E. Gösken & M. Pfaff (Hrsg.): GerontologischeBildungsarbeit. Neue Ansätze und Modelle. Dortmun<strong>der</strong>Beiträge <strong>zur</strong> angewandten Gerontologie. Bd. 2.Hannover: V<strong>in</strong>centz, S. 131-150.Naegele, G. (1997): Zusammenfassung wichtiger Ergebnisseund erste sozialpolitische Schlußfolgerungen. In:B. Beck, G. Naegele, M. Reichert & Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren Frauen und Jugend (Hrsg.): Vere<strong>in</strong>barkeitvon Erwerbstätigkeit und Pflege. Stuttgart, Berl<strong>in</strong>,Köln: Kohlhammer, S. 5-21.Naegele, G. (2001): Demographischer Wandel und Erwerbsarbeit.In: Aus Politik und Zeitgeschichte (B3-4),S. 3-4.Naegele, G. (2002a): Active strategies for ol<strong>der</strong> workers<strong>in</strong> Germany. In: M. Jepsen, D. Foden & M. Hutsebaut(Hrsg.): Active strategies for ol<strong>der</strong> workers. Brüssel:European Trade Union Institut (ETUI), S. 207-244.Naegele, G. (2002b): Change <strong>in</strong> paradigm for ol<strong>der</strong> workersand retirement policies - the German case. In:S. Pohlmann (Hrsg.): Fac<strong>in</strong>g an age<strong>in</strong>g world - recommendationsand perspectives. Regensburg: Transfer Verlag,S. 13-16.Naegele, G. (2004a): Lebensarbeitszeit und ältere Arbeitnehmer- Thesen <strong>zur</strong> Revitalisierung sozialpolitischer Argumente<strong>in</strong> <strong>der</strong> Altersgrenzendiskussion und -politik und<strong>zur</strong> Begründung und sozialpolitischen Flankierung e<strong>in</strong>erneuen Organisation von Arbeitszeit im Lebenslauf. GesprächskreisArbeit und Soziales: Fachtagung zumThema „Sozialpolitische Flankierung e<strong>in</strong>er verlängertenErwerbstätigenphase“. Berl<strong>in</strong>: Friedrich-Ebert-Stiftung.Naegele, G. (2004b): Verrentungspolitik und Herausfor<strong>der</strong>ungendes demographischen Wandels <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt.In: M. v. Cranach, H.-D. Schnei<strong>der</strong> & E. Ulich(Hrsg.): Ältere Menschen im Unternehmen. Chancen, Risiken,Modelle. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt, S. 189-219.Naegele, G. (2004c): Soziale Dienste für ältere Menschen.In: A. Kruse & M. Mart<strong>in</strong> (Hrsg.): Enzyklopädie<strong>der</strong> Gerontologie. Bern: Huber, S. 449-461.Naegele, G. (2005): Nachhaltige Arbeits- und Erwerbsfähigkeitfür ältere Arbeitnehmer. In: WSI-Mitteilungen58(4), S. 214-219.Naegele, G.; Barkholdt, C.; De Vroom, B. & EuropeanFoundation for the Improvement of Liv<strong>in</strong>g and Work<strong>in</strong>gConditions (2003): A new organisation of time overwork<strong>in</strong>g life. Dubl<strong>in</strong>: European Foundation for theImprovement of Liv<strong>in</strong>g and Work<strong>in</strong>g Conditions.Naegele, G. & Walker, A. (2003): Altern <strong>in</strong> <strong>der</strong> Arbeitswelt- Europäische „Leitl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>er Guten Praxis (goodpractice)“ für die Gleichbehandlung älterer Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen<strong>in</strong> <strong>der</strong> betrieblichen Personalpolitik. In: B.Badura, H. Schellschmidt & C. Vetter (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2002. Demographischer Wandel. Herausfor<strong>der</strong>ungenfür die betriebliche Personal- und Gesundheitspolitik.Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger, S. 225-234.Nauck, B. (2000): Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen <strong>in</strong> Migrantenfamilien- e<strong>in</strong> Vergleich zwischen griechischen, italienischen,türkischen und vietnamesischen Familien <strong>in</strong>Deutschland. In: Sachverständigenkommission 6. Familienbericht(Hrsg.): Familien ausländischer Herkunft <strong>in</strong>Deutschland: Empirische Beiträge <strong>zur</strong> Familienentwicklungund Akkulturation. Materialienband I. Opladen:Leske u. Budrich, S. 347-392.Nauck, B. (2004): Interkultureller Kontakt und <strong>in</strong>tergenerationaleTransmission <strong>in</strong> Migrantenfamilien. In: Y.Karakasoglu & J. Lüddecke (Hrsg.): Mirationsforschungund <strong>in</strong>terkulturelle Pädagogik. Aktuelle Enwicklung <strong>in</strong>Theorie, Empirie und Praxis. Münster, S. 229-248.
Drucksache 16/2190 – 290 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeNauck, B. & Kohlmann, A. (1998): Verwandtschaft alssoziales Kapital - Netzwerkbeziehungen <strong>in</strong> türkischenMigrantenfamilien. In: M. Wagner (Hrsg.): Verwandtschaft.Sozialwissenschaftliche Beiträge zu e<strong>in</strong>em vernachlässigtenThema. Stuttgart: Enke, S. 203-235.Nave-Herz, R. (2004): Materielle und immaterielleTransferleistungen zwischen den familialen <strong>Generation</strong>en.In: R. Nave-Herz (Hrsg.): Ehe- und Familiensoziologie.E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> Geschichte, theoretische Ansätzeund empirische Befunde. We<strong>in</strong>heim, München: Juventa,S. 212-222.Nell-Breun<strong>in</strong>g, O. v. (1977): Soziallehre <strong>der</strong> Kirche. Erläuterungen<strong>der</strong> lehramtlichen Dokumente. Wien:Europa-Verlag.Nenk<strong>in</strong> Shik<strong>in</strong> Un`yo Kik<strong>in</strong> (2001): Nenk<strong>in</strong> jutaku yush<strong>in</strong>(Bauf<strong>in</strong>anzierung des Government Pension InvestmentFonds). (http://www.nenpuku.go.jp/yuusi/k<strong>in</strong>ri.htlm#k<strong>in</strong>ri1).Neumann, M. J. M. (1998): E<strong>in</strong> Reformvorschlag <strong>zur</strong> gesetzlichenRentenversicherung. E<strong>in</strong> E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Kapitaldeckung<strong>der</strong> gesetzlichen Renten ist das Gebot <strong>der</strong>Stunde. In: Wirtschaftsdienst, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik78(5), S. 259-267.Noll, H.-H. & Weick, S. (2005): Relative Armut undKonzentration <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommen deutlich gestiegen. In:Informationsdienst Soziale Indikatoren (ZUMA) (33),S. 1-6.Nosaka, A. & Chasiotis, A. (2005): Explor<strong>in</strong>g the variation<strong>in</strong> <strong>in</strong>tergenerational relationships among Germans andTurkish immigrants: An evolutionary perspective ofbehavior <strong>in</strong> a mo<strong>der</strong>n social sett<strong>in</strong>g. In: E. Voland,A. Chasiotis & W. Schievenhövel (Hrsg.): Grandmotherhood- The evolutionary significance of the second half offemale life. New Jersey: Rutgers University Press.OECD: OECD Labour Market Statistics. OECD.OECD (2001): Bildungspolitische Analysen, Bildung undberufliche Qualifikation. Paris: OECD.OECD (2003a): Bildung auf e<strong>in</strong>en Blick. OECD-Indikatoren2003. Paris: OECD.OECD (2003b): The Policy Agenda for Growth. Anoverview of the sources of economic growth <strong>in</strong> OECDCountries. Paris: OECD.OECD (2004a): Employment Outlook 2004. Paris:OECD.OECD (2004b): Education at a glance. Paris: OECD.OECD (2005, forthcom<strong>in</strong>g <strong>in</strong> autumn): Age<strong>in</strong>g andemployment policies: Germany. Paris: OECD.OECD-EAG (2002): Education at a glance. Paris: OECD.Offe, C. & Fuchs, S. (2001): Schwund des Sozialkapitals?Der Fall Deutschland. In: R. D. Putnam (Hrsg.): Gesellschaftund Geme<strong>in</strong>s<strong>in</strong>n. Sozialkapital im <strong>in</strong>ternationalenVergleich. Gütersloh, S. 417-514.Olbermann, E. & Dietzel-Papakyriakou, M. (1996): Entwicklungvon Konzepten und Handlungsstrategien für dieVersorgung älter werden<strong>der</strong> und älterer Auslän<strong>der</strong>. Bonn:Bundesm<strong>in</strong>isterium für Arbeit und Sozialordnung.Orzag, P. R. & Stiglitz, J. E. (2001): Reth<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g pensionreform: Ten myths about social security systems. In:R. Holzmann & J. Stiglitz (Hrsg.): New ideas about oldage security. Toward susta<strong>in</strong>able pensions systems <strong>in</strong> the21st century. Wash<strong>in</strong>gton D.C.: World Bank, S. 17-62.Oswald, W. D.; Hagen, B. & Rupprecht, R. (2001): NichtmedikamentöseTherapie und Prävention <strong>der</strong> AlzheimerKrankheit. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie34(2), S. 116-121.Özcan, V. & Seifert, W. (2004): Lebenslage älterer Immigrant<strong>in</strong>nenund Immigranten <strong>in</strong> Deutschland. Expertiseim Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission „5. Altenbericht<strong>der</strong> Bundesregierung“. Berl<strong>in</strong>.Paul, W. (2001): Rosa Pflege. In: Altenpflege 2, S. 35-37.Pötschke-Langer, M. (1998): Krebsprävention und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung:Was Hänschen nicht lernt… In:Deutsches Ärzteblatt 95(22).Pries, L. (1998): Transnationale Soziale Räume. In:U. Beck (Hrsg.): Perspektiven <strong>der</strong> Weltgesellschaft.Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 55-86.PROGNOS AG (2002): Prognos Deutschland Report2002- 2020. Basel: Prognos-Eigenverlag.Putnam, R. D. (1993): Mak<strong>in</strong>g democracy work. Civictraditions <strong>in</strong> mo<strong>der</strong>n Italy. Pricetown, New Jersey.Putnam, R. D. (1995): Bowl<strong>in</strong>g alone. America'sdecl<strong>in</strong><strong>in</strong>g social capital. In: Journal of Democracy 6,S. 65-78.Rauch, A. & Brehm, H. (2003): Licht am Ende des Tunnels?E<strong>in</strong>e aktuelle Analyse <strong>der</strong> Situation schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>terMenschen am Arbeitsmarkt. IAB WerkstattberichtNr. 6 vom 17.4.2003. Nürnberg: Bundesanstalt für Arbeit.Rauchfleisch, U. (1999): Dauerhafte Partnerschaften beigleichgeschlechtlichen Paaren - Wunsch o<strong>der</strong> Realität?In: Familiendynamik. Interdiszipl<strong>in</strong>äre Zeitschrift für systemorientiertePraxis und Forschung 24, S. 395-408.Reichert, M. (1996): Vere<strong>in</strong>barkeit von Erwerbstätigkeitund Hilfe/Pflege für ältere Angehörige. ArbeitsplatzbezogeneBelastungen und Bewältigungsstrategien. In: H. P.Tews, T. Klie & R. M. Schütz (Hrsg.): Altern und Politik.Melsungen: Bibliomed, S. 237-251.Reifner, U. (2005): Altengerechte F<strong>in</strong>anzdienstleistungen.Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> gesellschaftlichen Alterungfür die Entwicklung neuer F<strong>in</strong>anzdienstleistungen undden Verbraucherschutz. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Hamburg.Richter, E. (2004): Illegale Pflegekräfte. Schwarzarbeit<strong>in</strong> <strong>der</strong> Pflege: Nachfrage offenbart dramatischen Mangelan 24-Stunden-Pflege. In: Forum Sozialstation (128),S. 14-17.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 291 – Drucksache 16/2190Rosenmayr, L. & Köckeis, E. (1965): Umwelt und Familiealter Menschen. Neuwied: Luchterhand.Roth, D. & Kornelius, B. (2004): Politische Partizipation<strong>in</strong> Deutschland. Empirische Bestandsaufnahme <strong>der</strong> ForschungsgruppeWahlen e.V. im Auftrag <strong>der</strong> BertelsmannStiftung. (http://www.bertelsmann stiftung.de/medien/pdf/StudiePolitischePartizipationZusammenfassungundAusblick.pdf).Roth, R. (2003): Die dunklen Seiten <strong>der</strong> Zivilgesellschaft.Grenzen e<strong>in</strong>er zivilgesellschaftlichen Fundierung von Demokratie.In: Forschungsjournal NSB 16(2), S. 59-73.Rowe, J. W. & Kahn, R. L. (1998): Successful ag<strong>in</strong>g.New York: Pantheon Books.Ruland, F. (2004): Aktuelle Ergebnisse zu den Wirkungen<strong>der</strong> bisherigen Rentenreformen auf den Übergang von <strong>der</strong>Erwerbs- <strong>in</strong> die Ruhestandsphase. Aktuelles Pressesem<strong>in</strong>ardes VDR vom 22. und 23.11.2004 <strong>in</strong> Würzburg.Würzburg: VDR-Vervielfältigung.Ruland, F. (2005): Die „E<strong>in</strong>schnitte bei den Renten“ - <strong>zur</strong>Methode und zu ihrer verfassungsrechtlichen Zulässigkeit.In: Deutsche Rentenversicherung (4-5), S. 217-228.Runde, P.; Giese, R. & Stierle, C. (2003): E<strong>in</strong>stellungenund Verhalten <strong>zur</strong> häuslichen Pflege und <strong>zur</strong> Pflegeversicherungunter den Bed<strong>in</strong>gungen des gesellschaftlichenWandels. Analysen und Empfehlungen auf Basis von repräsentativenBefragungen bei AOK-Leistungsempfängern<strong>der</strong> Pflegeversicherung. Hamburg.Rürup, B. (2004): Alterung: Mehr als e<strong>in</strong> Problem <strong>der</strong>Sozialversicherung. Kongress: Zukunftsfähiges Schleswig-Holste<strong>in</strong>am 16.4.2004 (hektografiertes Manuskript).Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen(2001): Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit.Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierungund Partizipation. Gutachten 2000/2001. Bd. I.Sachverständigenrat für Zuwan<strong>der</strong>ung (2004): Migrationsbericht.<strong>Bericht</strong> des Sachverständigenrates für Zuwan<strong>der</strong>ungund Integration im Auftrag <strong>der</strong> Bundesregierung<strong>in</strong> Zusammenarbeit mit dem europäischen Forum fürMigrationsstudien (emfs) an <strong>der</strong> Universität Bamberg.Bundesamt für Migration und Flüchtl<strong>in</strong>ge.Sachverständigenrat <strong>zur</strong> Begutachtung <strong>der</strong> gesamtwirtschaftlichenEntwicklung (2003): Jahresgutachten 2003/2004. Wiesbaden.Sangyosho, K. (2002): 2000-nendo ni okeru fukushi yogushijo kibo suikei ni tsuite (Zur Schätzung <strong>der</strong> Größe desMarktes für Pflegeprodukte im Fiskaljahr 2000). Tokio.Scha<strong>der</strong>-Stiftung (2005): Zuwan<strong>der</strong>er <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt. Empfehlungen<strong>zur</strong> stadträumlichen Integrationspolitik. Darmstadt:Scha<strong>der</strong>-Stiftung.Schief, S. (2005): Beschäftigungsquoten, Arbeitszeitenund Arbeitsvolum<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>der</strong> Europäischen Union, <strong>der</strong>Schweiz und Norwegen. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Gelsenkirchen.Schmähl, W. (1977): Alterssicherung und E<strong>in</strong>kommensverteilung.Tüb<strong>in</strong>gen: JCB Mohr Verlag.Schmähl, W. (1980): Vermögensansammlung für dasAlter im Interesse wirtschafts- und sozialpolitischerZiele - Begründungen und Realisierungsmöglichkeitenvor dem H<strong>in</strong>tergrund <strong>der</strong> künftigen Bevölkerungsentwicklung.In: K. Schenke & W. Schmähl (Hrsg.): Alterssicherungals Aufgabe für Wissenschaft und Politik - HelmutMe<strong>in</strong>hold zum 65. Geburtstag. Stuttgart: Kohlhammer,S. 379-406.Schmähl, W. (1981): Lebense<strong>in</strong>kommens- und Längsschnittanalysen.In: P. Her<strong>der</strong>-Dorneich (Hrsg.): DynamischenTheorie <strong>der</strong> Sozialpolitik. Berl<strong>in</strong>: Vere<strong>in</strong> für Socialpolitik,S. 225-330.Schmähl, W. (1985): Neuregelung <strong>der</strong> H<strong>in</strong>terbliebenversorgung<strong>in</strong> längerfristiger Perspektive. In: Deutsche Rentenversicherung,S. 288-296.Schmähl, W. (1986): Lohnentwicklung im Lebensverlauf- Zur Gestaltung <strong>der</strong> Alterslohnprofile von Arbeitern<strong>in</strong> Deutschland. In: Allgeme<strong>in</strong>es Statistisches Archiv(70), S. 180-203.Schmähl, W. (1991): Alterssicherung <strong>in</strong> <strong>der</strong> DDR undihre Umgestaltung im Zuge des deutschen E<strong>in</strong>igungsprozesses- E<strong>in</strong>ige verteilungspolitische Aspekte. In: G.Kle<strong>in</strong>henz (Hrsg.): Sozialpolitik im vere<strong>in</strong>ten DeutschlandI. Bd. 208/I, Schriften des Vere<strong>in</strong>s für Socialpolitik,Neue Folge. Berl<strong>in</strong>: Duncker & Humblot, S. 49-95.Schmähl, W. (1995): Funktionsgerechte F<strong>in</strong>anzierung <strong>der</strong>Sozialversicherung. In: Deutsche Rentenversicherung(10-11), S. 601-618.Schmähl, W. (1998): Perspektiven <strong>der</strong> Sozialpolitik nachdem Regierungswechsel. In: Wirtschaftsdienst. Zeitschriftfür Wirtschaftspolitik (78), S. 713-722.Schmähl, W. (2000): Perspektiven <strong>der</strong> Alterssicherungspolitik<strong>in</strong> Deutschland - Über Konzeptionen, Vorschlägeund e<strong>in</strong>en angestrebten Paradigmenwechsel. In: Perspektiven<strong>der</strong> Wirtschaftspolitik (1), S. 407-430.Schmähl, W. (2001): Umlagef<strong>in</strong>anzierte Rentenversicherung<strong>in</strong> Deutschland. Optionen und Konzepte sowie politischeEntscheidungen als E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en grundlegendenTransformationsprozess. In: W. Schmähl & V. Ulrich(Hrsg.): Soziale Sicherungssysteme und demographischeHerausfor<strong>der</strong>ungen. Tüb<strong>in</strong>gen: Mohr, S. 123-204.Schmähl, W. (2002a): Leben die „Alten“ auf Kosten <strong>der</strong>„Jungen“? Anmerkungen <strong>zur</strong> Belastungsverteilung zwischen„<strong>Generation</strong>en“ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alternden Bevölkerung ausökonomischer Perspektive. In: Zeitschrift für Gerontologieund Geriatrie 35(4), S. 304-314.Schmähl, W. (2002b): Aufgabenadäquate F<strong>in</strong>anzierung<strong>der</strong> Sozialversicherungen und <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> „Fehlf<strong>in</strong>anzierung“<strong>in</strong> Deutschland. In: W. Boecken, F. Ruland& H.-D. Ste<strong>in</strong>meyer (Hrsg.): Sozialrecht und Sozialpolitik<strong>in</strong> Deutschland und Europa. Neuwied: Luchterhand,S. 605-620.
Drucksache 16/2190 – 292 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSchmähl, W. (2002c): Begrenzung und Verstärkung desAnstiegs von Sozialbeiträgen. In: Wirtschaftsdienst. Zeitschriftfür Wirtschaftspolitik (82), S. 661-666.Schmähl, W. (2003a): Wem nutzt die Rentenreform? Offeneund versteckte Verteilungseffekte des Umstiegs zumehr privater Altersvorsorge. In: Die Angestelltenversicherung50(7), S. 349-363.Schmähl, W. (2003b): Age<strong>in</strong>g workforce: firm strategiesand public policy <strong>in</strong> Germany. In: The Geneva Papers onRisk and Insurance 28(4), S. 575-595.Schmähl, W. (2004a): E<strong>in</strong> „Nachhaltigkeitsgesetz“ für dieRentenversicherung - Anspruch und Wirklichkeit. In:Wirtschaftsdienst. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 84(4),S. 1-8.Schmähl, W. (2004b): E<strong>in</strong>kommen und soziale AbsicherungÄlterer - Perspektiven, Fragen, Aufgaben. In:e.s. rück (Hrsg.): Zukunftsmarkt Senioren. Hannover,S. 13-27.Schmähl, W. (2004c): Vom „geheimräthlichen Wechselbalg“<strong>zur</strong> „Riester-Rente“: Alterssicherungspolitik <strong>in</strong>Deutschland. Anmerkungen zu sich wandelnden Zielenund Konzepten. In: B. Schefold (Hrsg.): Wirtschafts- undSozialwissenschaftler <strong>in</strong> Frankfurt a. M.. Marburg:metropolis service dialog, S. 379-401.Schmähl, W. (2005a): E<strong>in</strong>kommenslage und E<strong>in</strong>kommensverwendungspotentialÄlterer <strong>in</strong> Deutschland. In:Wirtschaftsdienst. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik (85),S. 156-165.Schmähl, W. (2005b): Zielgenaue und transparente Familienpolitikmit Hilfe e<strong>in</strong>er steuerf<strong>in</strong>anzierten Familienkasse.In: J. Althammer (Hrsg.): Familienpolitik und sozialeSicherung. Berl<strong>in</strong>, Heidelberg: Spr<strong>in</strong>ger, S. 205-224.Schmähl, W. (2005c): „<strong>Generation</strong>engerechtigkeit“ alsBegründung für e<strong>in</strong>e Strategie „nachhaltiger“ Alterssicherung<strong>in</strong> Deutschland. In: G. Huber, H. Krämer & H. D.Kurz (Hrsg.): E<strong>in</strong>kommensverteilung, technischer Fortschrittund struktureller Wandel. Marburg: Metropolis-Verlag, S. 441-459.Schmähl, W. & Göbel, D. (1983): Lebense<strong>in</strong>kommensverläufeaus Längsschnittdaten <strong>der</strong> Rentenversicherungsträger.In: W. Schmähl (Hrsg.): Ansätze <strong>der</strong> Lebense<strong>in</strong>kommensanalyse.Tüb<strong>in</strong>gen: Mohr, S. 126-172.Schmähl, W. & Rothgang, H. (2004): Familie und Pflegeversicherung:Verfassungsrechtlicher Handlungsbedarf,Handlungsmöglichkeiten und e<strong>in</strong> Gestaltungsvorschlag.In: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 53(2), S. 181-191.Schmidt, C. M. (2002): Sozialstaat und Migration - EmpirischeEvidenz und wirtschaftspolitische Implikationenfür Deutschland. In: Vierteljahreshefte <strong>zur</strong> Wirtschaftsforschung(DIW) 71(2), S. 173- 186.Schmitt, E. (2004): Altersbild - Begriff, Befunde undpolitische Implikationen. In: A. Kruse & M. Mart<strong>in</strong>(Hrsg.): Enzyklopädie <strong>der</strong> Gerontologie. Bern, Gött<strong>in</strong>gen,Toronto, Seattle: Huber, S. 135-148.Schmitt-Beck, R. & Rohrschnei<strong>der</strong>, R. (2004): SozialesKapital und Vertrauen <strong>in</strong> die Institutionen <strong>der</strong> Demokratie.In: R. Schmitt-Beck, M. Wasmer & A. Koch (Hrsg.):Sozialer und politischer Wandel <strong>in</strong> Deutschland. Analysenmit ALLBUS-Daten aus zwei Jahrzehnten. BlickpunktGesellschaft. Bd. 7. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften,S. 235-260.Schneekloth, U. & Leven, I. (2003): Hilfe- und Pflegebedürftige<strong>in</strong> Privathaushalten <strong>in</strong> Deutschland. München:Infratest Sozialforschung.Schneekloth, U. & Müller, U. (2000): Wirkungen <strong>der</strong>Pflegeversicherung. Schriftenreihe des Bundesm<strong>in</strong>isteriumsfür Gesundheit. Bd. 127. Baden-Baden: Nomos.Schneekloth, U. & Potthoff, P. (1996): Hilfe- und Pflegebedürftige<strong>in</strong> privaten Haushalten. Endbericht <strong>zur</strong> Repräsentativerhebung1991.( 2. akt. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.Schnei<strong>der</strong>, N. F.; Rosenkranz, D. & Limmer, R. (1998):Nichtkonventionelle Lebensformen. Entstehung, Entwicklung,Konsequenzen. Opladen: Leske u. Budrich.Schnell, U. (2002): Betreutes Wohnen: Nachbarschaftshilfe.In: H. Stolarz & U. Kremer-Preiß: Demenzbewältigung<strong>in</strong> den eigenen vier Wänden. Köln: KuratoriumDeutsche Altershilfe, S. 147-150.Schönwäl<strong>der</strong>, K.; Vogel, D. & Sciort<strong>in</strong>o, G. (2004): Migrationund Illegalität <strong>in</strong> Deutschland. Berl<strong>in</strong>: Wissenschaftszentrumfür Sozialforschung.Schrö<strong>der</strong>, H. & Gilberg, R. (2005): Weiterbildung Ältererim demographischen Wandel. Empirische Bestandsaufnahmeund Prognose. Bielefeld: <strong>in</strong>fas.Schuldt, K. & Troost, A. (2004): För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> beruflichenWeiterbildung - quo vadis? - Evaluierungsergebnisse,Entwicklungstendenzen und Perspektiven. Bremen,Teltow: Progress-Institut für WirtschaftsforschungGmbH.Schwartz, F.-W. (1999a): Patienten- und Konsumentensouveränität:E<strong>in</strong> neues Leitbild?! Vortrag auf <strong>der</strong> Tagung„Patientenschutz <strong>in</strong> Deutschland“ <strong>der</strong> Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<strong>der</strong> Verbraucherverbände. Berl<strong>in</strong>.Schwartz, F.-W. (1999b): Der „kundige Kunde“ - se<strong>in</strong> Informationsbedarf,se<strong>in</strong>e Informationsdefizite. In: DieBKK (7), S. 334-338.Schwarz, N. (1996): Ehrenamtliche Tätigkeiten und sozialeHilfeleistungen. In: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Zeit im Blickfeld.Ergebnisse e<strong>in</strong>er repräsentativen Zeitbudgeterhebung.Schriftenreihe Band 121. Stuttgart, Berl<strong>in</strong>, Köln:BMFSFJ, S. 169-178.Schwarze, J.; Wagner, G. G. & Wun<strong>der</strong>, C. (2004): Alterssicherung:Gesunkene Zufriedenheit und Skepsisgegenüber privater Vorsorge. In: Wochenbericht 71(22),S. 316-322.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 293 – Drucksache 16/2190Schwitzer, K.-P. (1999): Alltagserfahrungen alter, nichtmehr im Erwerbsleben stehen<strong>der</strong> Menschen vor und nach1990. In: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Materialien <strong>der</strong>Enquete-Kommission „Überw<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> Folgen <strong>der</strong>SED-Diktatur im Prozess <strong>der</strong> deutschen E<strong>in</strong>heit“. BandV: Alltagsleben <strong>in</strong> <strong>der</strong> DDR und <strong>in</strong> den neuen Län<strong>der</strong>n.Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 838-929.Seidel, S. & Kuwan, H. (2001): Lernformen und Lernstrategienbei Erwachsenen. Pilotstudie zum selbstgesteuertenLernen und den Möglichkeiten se<strong>in</strong>er statistischenErfassung. ies <strong>Bericht</strong> 102/01. München, Hannover: Institutfür Entwicklungsplanung und Strukturforschung.Sekretariat <strong>der</strong> ständigen Konferenz <strong>der</strong> Kultusm<strong>in</strong>ister<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland (2003):Synoptische Darstellung <strong>der</strong> <strong>in</strong> den Län<strong>der</strong>n bestehendenMöglichkeiten des Hochschulzugangs für beruflich qualifizierteBewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigungauf <strong>der</strong> Grundlage hochschulrechtlicher Regelungen.(http://www.kmk.org/hschule/Synopse2003.pdf).Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport (2003):An<strong>der</strong>s se<strong>in</strong> und älter werden - Lesben und Schwule imAlter. Dokumentation e<strong>in</strong>er Fachtagung vom 22./23. November2002. Dokumente lesbisch-schwuler Emanzipationdes Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen.Nr. 20. Berl<strong>in</strong>: Senatsverwaltung für Bildung,Jugend und Sport.Seniorwatch (2002): European Seniorwatch observatoryand <strong>in</strong>ventory. www.seniorwatch.de.Siebert, H. (Hrsg.) (1998): Redesign<strong>in</strong>g Social Security.Tüb<strong>in</strong>gen: JCB Mohr.Siebert, H. (2003): Der Kobra-Effekt. München: VerlagPiper.Siebert, H. (2004): Die wirtschaftlichen Folgen: Ende vonWachstum und Prosperität? In: Bundesverband DeutscherBanken (Hrsg.): Deutschland altert - die demographischenHerausfor<strong>der</strong>ungen annehmen. Berl<strong>in</strong>, S. 25-34.Sommer, C.; Künemund, H. & Forschungsgruppe Alternund Lebenslauf (Fall) (1999): Bildung im Alter. E<strong>in</strong>e Literaturanalyse.Berl<strong>in</strong>: Freie Universität (Forschungsbericht66).Sommer, C.; Künemund, H. & Kohli, M. (2001): Bildungim Alter - Bildung für das Alter. E<strong>in</strong>e Repräsentativuntersuchungüber die Praxis <strong>der</strong> Altersbildung <strong>in</strong> Deutschland.Berl<strong>in</strong>: Freie Universität.Sommer, C.; Künemund, H. & Kohli, M. (2004): ZwischenSelbstorganisation und Seniorenakademie. DieVielfalt <strong>der</strong> Altersbildung <strong>in</strong> Deutschland. Beiträge <strong>zur</strong>Alterns- und Lebenlaufforschung. Berl<strong>in</strong>: Weißensee Verlag.Statistisches Bundesamt (1996): BevölkerungsstatistischeÜbersichten 1946 bis 1989 (Teil II). Heft 28 <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>reihemit Beiträgen für das Gebiet <strong>der</strong> ehemaligen DDR.Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Statistisches Bundesamt (2000): BevölkerungentwicklungDeutschlands bis zum Jahr 2050. Ergebnisse <strong>der</strong>9. koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden:Statistisches Bundesamt.Statistisches Bundesamt (2002): Zweite europäische Erhebung<strong>zur</strong> beruflichen Weiterbildung (CVTS2). Ergebnisse<strong>der</strong> schriftlichen Erhebung bei ca. 3200 Unternehmenmit 10 und mehr Beschäftigten <strong>in</strong> Deutschland.Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Statistisches Bundesamt (2003a): Im Blickpunkt: Bildung<strong>in</strong> Deutschland. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Statistisches Bundesamt (2003b): Bevölkerung Deutschlandsbis 2050. Ergebnisse <strong>der</strong> 10. koord<strong>in</strong>ierten Bevölkerungsvorausberechnung.Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Statistisches Bundesamt (2004): Strukturdaten und Integrations<strong>in</strong>dikatorenfür die ausländische Bevölkerung <strong>in</strong>Deutschland 2002. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Statistisches Bundesamt (2005a): <strong>Bericht</strong>: Pflegestatistik2003 - Pflege im Rahmen <strong>der</strong> Pflegeversicherung -Deutschlan<strong>der</strong>gebnisse. Bonn: Statistisches Bundesamt,Zweigstelle Bonn.Statistisches Bundesamt (2005b): Strukturdaten und Integrations<strong>in</strong>dikatorenfür die ausländische Bevölkerung <strong>in</strong>Deutschland 2003. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.Staud<strong>in</strong>ger, U. M. (1996): Psychologische Produktivitätund Selbstentfaltung im Alter. In: M. M. Baltes &L. Montada (Hrsg.): Produktives Leben im Alter. SchriftenreiheADIA-Stiftung <strong>zur</strong> Erforschung neuer Wege fürArbeit und soziales Leben. Bd. 3. Frankfurt, New York:Campus, S. 344-373.Staud<strong>in</strong>ger, U. M. (2003): Die Zukunft des Alterns unddas Bildungssystem. In: S. Pohlmann (Hrsg.): Der demografischeImperativ. Hannover: V<strong>in</strong>centz, S. 65-81.Staud<strong>in</strong>ger, U. M. & Sch<strong>in</strong>dler, I. (2002): Produktives Lebenim Alter: Aufgaben, Funktionen und Kompetenzen.In: R. Oerter & L. Montada (Hrsg.): Entwicklungspsychologie.We<strong>in</strong>heim: Psychologie Verlags Union,S. 955-982.Stichnoth, U. & Wichmann, T. (2001): Reform <strong>der</strong> Rentewegen verm<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Erwerbsfähigkeit. In: Die AngestelltenVersicherung 48(3), S. 53-65.Stiglitz, J. (2005): Secur<strong>in</strong>g social security for the future.In: The Economists' Voice 2(1), S. 6.Stümke, H.-G. (1998): Älter werden wir umsonst. SchwulesLeben jenseits <strong>der</strong> Dreißig. Erfahrungen, Interviews,<strong>Bericht</strong>e. Berl<strong>in</strong>: Verlag rosa W<strong>in</strong>kel.Sz<strong>in</strong>ovacz, M. E. (1998): Research on grandparent<strong>in</strong>g:Needed ref<strong>in</strong>ements <strong>in</strong> concepts, theories, and methods.In: M. E. Sz<strong>in</strong>ovacz (Hrsg.): Handbook of grandparenthood.Westport: Greenwood, S. 257-288.Szydlik, M. (2000): Lebenslange Solidarität? <strong>Generation</strong>enbeziehungenzwischen erwachsenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Eltern.Opladen: Leske u. Budrich.
Drucksache 16/2190 – 294 – Deutscher Bundestag – 16. WahlperiodeSzydlik, M. (2001): <strong>Generation</strong>ensolidarität, <strong>Generation</strong>enkonflikt.In: J. Allmend<strong>in</strong>ger (Hrsg.): Gute Gesellschaft?Verhandlungen des 30. Kongresses <strong>der</strong> DeutschenGesellschaft für Soziologie <strong>in</strong> Köln 2000. Opladen: Leskeu. Budrich, S. 573-596.Szydlik, M. & Schupp, J. (2004): Wer erbt mehr? Erbschaften,Sozialstruktur und Alterssicherung. In: KölnerZeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 56,S. 609-629.Templeton, R. & Bauereiss, R. (1994): K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuungzwischen den <strong>Generation</strong>en. In: W. Bien (Hrsg.): Eigen<strong>in</strong>teresseo<strong>der</strong> Solidarität. Opladen: Leske u. Budrich,S. 250-266.Tesch-Römer, C. (2004a): Verän<strong>der</strong>ung von subjektivemWohlbef<strong>in</strong>den und Lebensqualität <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte.In: C. Tesch-Römer (Hrsg.): Sozialer Wandel und<strong>in</strong>dividuelle Entwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte.Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen, S. 395-454.Tesch-Römer, C. (2004b): Sozialer Wandel und <strong>in</strong>dividuelleEntwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Lebenshälfte. Ergebnisse<strong>der</strong> zweiten Welle des Alterssurveys. Abschlussbericht.Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.Theobald, H. (2005): Social exclusion and care for theel<strong>der</strong>ly. Theoretical concepts and chang<strong>in</strong>g realities <strong>in</strong>European welfare states. Berl<strong>in</strong>: WissenschaftszentrumBerl<strong>in</strong> für Sozialforschung (WZB), ForschungsgruppePublic Health.Thompson, L. (1998): Ol<strong>der</strong> & wiser - The economics ofpublic pensions. Wash<strong>in</strong>gton D.C.: University Press ofAmerica.Tippelt, R. & Barz, H. (2004): Soziale und regionale Differenzierungvon Weiterbildungsverhalten und Weiterbildungs<strong>in</strong>teressen.Kurz-Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse.München, Düsseldorf: Ludwig-Maximilian-Universität.Tödter, N. (2004): Verän<strong>der</strong>ungen des Reisemarktes <strong>in</strong>Deutschland bis 2020 auf Grund <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Alterspyramiden<strong>in</strong> hoch entwickelten Gesellschaften.Frankfurt a. M.: Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.Ueltzhöfer, J. (1999): <strong>Generation</strong>enkonflikt und <strong>Generation</strong>enbündnis<strong>in</strong> <strong>der</strong> Bürgergesellschaft. Stuttgart: Sozialm<strong>in</strong>isteriumBaden-Württemberg.Unabhängige Kommission „Zuwan<strong>der</strong>ung“ (2001): Zuwan<strong>der</strong>unggestalten - Integration för<strong>der</strong>n. <strong>Bericht</strong> vom04. Juli 2001. Berl<strong>in</strong>: Vervielfältigung.Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (2003):Rentenversicherung <strong>in</strong> Zeitreihen, Juli 2003. Frankfurt a.M.: VDR-Eigenverlag.Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (2004):Rentenversicherung <strong>in</strong> Zeitreihen, Juli 2004. Frankfurt a.M.: VDR-Eigenverlag.Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (2005):VDR Statistik Rentenzugang des Jahres 2004 e<strong>in</strong>schließlichRentenwegfall, Rentenän<strong>der</strong>ung/Än<strong>der</strong>ung des Teilrentenanteils.Frankfurt a. M.: VDR-Eigenverlag.Verbraucherzentrale NRW; Verbraucherzentrale Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz; Verbraucherzentrale Brandenburg & Bundesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<strong>der</strong> Senioren-Organisationen (BAGSO)(2005): Zielgruppenorientierte Verbraucherarbeit für undmit Senioren. Ergebnisse und Handlungsempfehlungen.Düsseldorf: Bundesm<strong>in</strong>isterium für Verbraucherschutz,Ernährung und Landwirtschaft.Vetter, C. (2003): E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> Altersstruktur auf diekrankheitsbed<strong>in</strong>gten Fehlzeiten. In: B. Badura, H. Schellschmidt& C. Vetter (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2002. DemographischerWandel; Herausfor<strong>der</strong>ungen für die betrieblichePersonal- und Gesundheitspolitik. Berl<strong>in</strong>:Spr<strong>in</strong>ger, S. 249-264.Viebrok, H. (2004a): Absicherung bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung.Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Bremen.Viebrok, H. (2004b): Künftige E<strong>in</strong>kommenslage im Alter.Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Bremen.Viebrok, H.; Himmelreicher, R. K. & Schmähl, W.(2004): Private Altersvorsorge statt Rente: Wer gew<strong>in</strong>nt,wer verliert? Beiträge <strong>zur</strong> Sozial- und Verteilungspolitik.Bd. 3. Münster: Lit-Verlag.Voland, E.; Chasiotis, A. & Schievenhövel, W. (2005):Grandmotherhood - a short overview of three fields ofresearch on the evolutionary significance of postgenerativefemale life. In: E. Voland, A. Chasiotis & W. Schievenhövel(Hrsg.): Grandmotherhood - The evolutionary significanceof the second half of female life. New Jersey: RutgersUniversity Press.Volkholz, V. (2004): E<strong>in</strong>ige Schlussfolgerungen für den5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung. 3. Entwurf. Dortmund:Gesellschaft für Arbeitsschutz- und Humanisierungsforschung.Volkholz, V. (2004): Die Arbeitskräfte-E<strong>in</strong>satz-Bilanz(AKE-Bilanz) für verschiedene Altersgruppen und Tätigkeitsdauer-Gruppenbeim jetzigen Arbeitgeber. Dortmund:Gesellschaft für Arbeitsschutz- und Humanisierungsforschung(GfAH).Volkholz, V.; Kiel, U. & W<strong>in</strong>gen, S. (2002): Strukturwandeldes Arbeitskräfteangebots. In: P. Brödner & M. Knuth(Hrsg.): Nachhaltige Arbeitsgestaltung: Trendreports <strong>zur</strong>Entwicklung und Nutzung von Humanressourcen. München:Hampp, S. 241-302.Wachtler, G. (2004): Die Älteren als Humankapital <strong>der</strong>Wirtschaft: Produktion und Innovation werden nur durchdie Qualifizierung <strong>der</strong> Älteren garantiert. In: SozialverbandVdK Bayern (Hrsg.): Mediz<strong>in</strong>studium mit 60? Antwortenauf Alterung und Rückgang <strong>in</strong> den Gesundheitsberufen.München: Sozialverband VdK Bayern, S. 38-48.Wagner, A. & Muth, J. (1998): Arbeitslose, Langzeitarbeitsloseund ihre Familie. Landessozialbericht Nr. 8.Düsseldorf: M<strong>in</strong>isterium für Arbeit, Gesundheit, und Sozialesdes Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 295 – Drucksache 16/2190Weber, T. (2005): Erste Ergebnisse <strong>der</strong> Statistiken überdie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung.In: Statistisches Bundesamt (4), S. 382-387.We<strong>in</strong>kopf, C. (2004): Haushaltsnahe Dienstleistungen fürÄltere. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Sachverständigenkommission„5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“. Gelsenkirchen.Weißhuhn, G. & Rövekamp Große, J. (2004): Bildungund Lebenslagen <strong>in</strong> Deutschland. Modul „Bildung“ <strong>zur</strong>E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> den zweiten Armuts- und Reichtumsbericht<strong>der</strong> Bundesregierung.Wenger, G. C. & Jerome, D. (1999): Change and stability<strong>in</strong> confidant relationships. F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs from the BangorLongitud<strong>in</strong>al Study of Age<strong>in</strong>g. In: Journal of Ag<strong>in</strong>gStudies 13(3), S. 269-294.Werner, D.; Flüter-Hoffmann, C. & Zedler, R. (2003):Berufsbildung: Bedarfsorientierung und Mo<strong>der</strong>nisierung.In: H.-P. Klös & R. Weiß (Hrsg.): Bildungs-Benchmark<strong>in</strong>gDeutschland. Köln: Deutscher Instituts-Verlag,S. 287-381.W<strong>in</strong>gen, M. (1997): Familienpolitik. Stuttgart: Lucius &Lucius (UTB).Wirth, H. & Dümmler, K. (2004): Zunehmende Tendenzzu späteren Geburten und K<strong>in</strong><strong>der</strong>losigkeit bei Akademiker<strong>in</strong>nen.E<strong>in</strong>e Kohortenanalyse auf <strong>der</strong> Basis von Mikrozensusdaten.In: Informationsdienst Soziale Indikatoren(32), S. 1-6.Wirtschaftsm<strong>in</strong>isterium Mecklenburg-Vorpommern (2003):Zukunftsbranche Gesundheitswirtschaft. Zur wirtschaftlichenund beschäftigungspolitischen Entwicklung <strong>in</strong> denBereichen <strong>der</strong> Gesundheitswirtschaft, des Tourismus/Gesundheitstourismus sowie <strong>der</strong> Ernährungswirtschaftdes Landes Mecklenburg-Vorpommern.Wissenschaftlicher Beirat „Verbraucher- und Ernährungspolitik“beim Bundesm<strong>in</strong>isterium für Verbraucherschutz,Ernährung und Landwirtschaft (2003a): Verbraucher<strong>in</strong>formationals Instrument <strong>der</strong> Verbraucherpolitik. Hannover,Berl<strong>in</strong>: BMVEL.Wissenschaftlicher Beirat „Verbraucher- und Ernährungspolitik“beim Bundesm<strong>in</strong>isterium für Verbraucherschutz,Ernährung und Landwirtschaft (2003b): StrategischeGrundsätze und Leitbil<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er neuen Verbraucherpolitik.Stuttgart- Hohenheim, Berl<strong>in</strong>: BMVEL.Wohlfahrt, N. (2003): Bürgerschaftliches Engagement,Freie Wohlfahrtspflege und aktivieren<strong>der</strong> Sozialstaat. InszenierterSozialstaatsumbau o<strong>der</strong> Stärkung des sozialenKapitals? In: Soziale Arbeit (10), S. 362-369.Wolff, H.; Spieß, K. & Mohr, H. (2001): Arbeit - Altern -Innovation. Zukunft <strong>der</strong> Arbeit. Arbeit <strong>der</strong> Zukunft. Basel:PROGNOS.World Health Organisation (2001): The <strong>in</strong>ternationalclassification of function<strong>in</strong>g, disability and health - ICF.Genf: World Health Organisation (WHO).Wurm, S. (2004): Gesundheitliche Potenziale und Grenzenälterer Erwerbspersonen. Expertise im Auftrag <strong>der</strong>Sachverständigenkommission „5. Altenbericht <strong>der</strong> Bundesregierung“.Berl<strong>in</strong>.Yoshikazu, G. (2002): Ag<strong>in</strong>g populations, new bus<strong>in</strong>essopportunities and new bus<strong>in</strong>ess models developed <strong>in</strong>Japan. In: Journal of Japanese Trade & Industry (3),S. 24-27.Zeman, P. (2002): Ältere Migrant<strong>in</strong>nen und Migranten <strong>in</strong>Berl<strong>in</strong>. Expertise im Auftrag <strong>der</strong> Senatsverwaltung fürGesundheit, Soziales und Verbraucherschutz. Berl<strong>in</strong>:Deutsches Zentrum für Altersfragen.Zeman, P. (2005): Altenpflegearrangements: Vernetzung<strong>der</strong> Netzwerke. In: P. Bauer & U. Otto (Hrsg.): Mit Netzwerkenprofessionell zusammenarbeiten. Tüb<strong>in</strong>gen: dgtv-Verlag, S. 315-333.ZfT-Zentrum für Türkeistudien (1993): Zur Lebenssituationund spezifischen Problemlage älterer ausländischerE<strong>in</strong>wohner <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland. Forschungsberichtim Auftrag des Bundesm<strong>in</strong>isters für Arbeitund Sozialordnung. Bonn: Bundesm<strong>in</strong>isterium fürArbeit und Sozialordnung.Ziefle, A. (2004): Die <strong>in</strong>dividuellen Kosten des Erziehungsurlaubs:E<strong>in</strong>e empirische Analyse <strong>der</strong> kurz- undlängerfristigen Folgen für den Karriereverlauf vonFrauen. Berl<strong>in</strong>: Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung.Discussion papers 2004-102.Zimber, A. & Weyerer, S. (1999): Arbeitsbelastungen <strong>in</strong><strong>der</strong> Altenpflege. Gött<strong>in</strong>gen: Hogrefe.Zimprich, D. (2004): Kognitive Leistungsfähigkeit im Alter.In: A. Kruse & J. Mart<strong>in</strong> (Hrsg.): Enzyklopädie <strong>der</strong>Gerontologie. Bern: Huber, S. 289-303.Zollmann, P. & Schliehe, F. (2003): Rehabilitation undWie<strong>der</strong>e<strong>in</strong>glie<strong>der</strong>ung im demographischen Wandel. In:B. Badura, H. Schellschmidt & C. Vetter (Hrsg.): Fehlzeiten-Report2002: Demographischer Wandel; Herausfor<strong>der</strong>ungenfür die betriebliche Personal- und Gesundheitspolitik.Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger, S. 185-199.
Diese Broschüre ist Teil <strong>der</strong> Öffentlichkeitsarbeit <strong>der</strong> Bundesregierung;sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.Herausgeber:Bundesm<strong>in</strong>isteriumfür Familie, Senioren, Frauenund Jugend11018 Berl<strong>in</strong>www.bmfsfj.deBezugsstelle:Publikationsversand <strong>der</strong> BundesregierungPostfach 48 10 0918132 RostockTel.: 0 18 05/77 80 90*Fax: 0 18 05/77 80 94*E-Mail: publikationen@bundesregierung.deInternet: www.bmfsfj.deStand:August 2006Gestaltung:KIWI GmbH, OsnabrückDruck:DruckVogt GmbH, Berl<strong>in</strong>Für weitere Fragen nutzen Sie unserServicetelefon: 0 18 01/90 70 50**Fax: 0 18 88/5 55 44 00Montag–Donnerstag 7–19 Uhr* je<strong>der</strong> Anruf kostet 12 Cent pro M<strong>in</strong>ute** nur Anrufe aus dem Festnetz, 9–18 Uhr 4,6 Cent,sonst 2,5 Cent pro angefangene M<strong>in</strong>ute