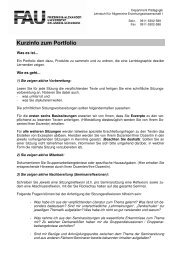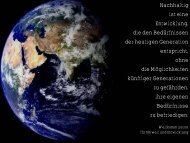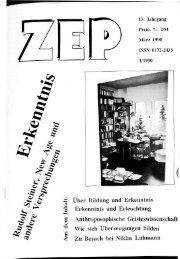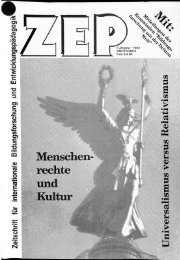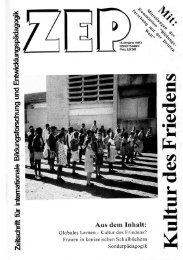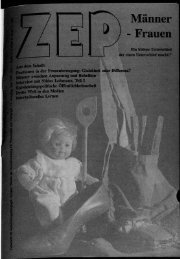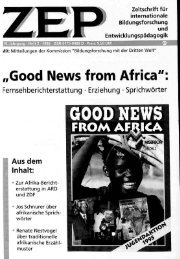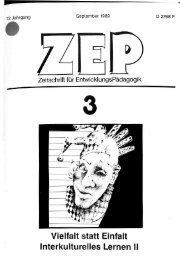ZEP - Lehrstuhl für Allgemeine Erziehungswissenschaft I
ZEP - Lehrstuhl für Allgemeine Erziehungswissenschaft I
ZEP - Lehrstuhl für Allgemeine Erziehungswissenschaft I
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ZEP</strong>30. Jg. Heft 1 März 2007 Seite 39Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezension Kurzrezensionder Zeit um mehr als ein Drittel zugenommen hat, relativiertsich der Erfolg.Um das Ziel einer erfolgreichen Grundschulbildung zuerreichen, wird eine frühkindliche Erziehung (Alter drei bissechs) mit einem umfassenden Programm für Ernährung undGesundheit als notwendig angesehen. Ohne eine grundlegendeVersorgung und Vorsorge für Kinder dieser Altersgruppe kannnach Meinung der UNESCO eine Benachteiligung der armenKinder nicht aufgehoben werden. Dafür ist eine breite nationaleZustimmung der Länder – eine nationale Bildungspolitikmit der nötigen finanziellen Ausstattung – die Voraussetzung.Die Erfolge im Bereich der ECCE (Early childhood care andeducation) sind sehr ungleich verteilt.Während die Seychellen und Mauritius ein ECCE-Programmflächendeckend (100 %) eingeführt haben, gibt es soein Programm zu weniger als 10% in der Hälfte aller Länderin Afrika südlich der Sahara. Ähnlich sieht das Ergebnis inOstasien, im Pazifik, in Kambodscha und Laos aus. In China,Vietnam und auf den Philippinen liegt die GER zwischen36 % und 47 %. Im siebten und achten Kapitel zeigt derBericht, wie effektive Programme erstellt und umgesetztwerden können.Von der Kindheit zur Jugend ist es nicht weit. Deshalbkommen wir zur Shell-Studie. Wenn man mit Schüler/innenoder Studierenden zu tun hat, ist die Shell-Studie genausounentbehrlich wie der Fischer Weltalmanach oder der UNDP-Jahresbericht.Die Shell-Studie ist mittlerweile eine Institution. Sie erscheintseit 53 Jahren in unregelmäßigen Zeitabständen. Dievorletzte (14. Studie) erschien im Jahre 2002, die letzte (15.Studie) im Jahre 2006. Allein an der Auswahl der Schwerpunktekann man die Zeitströmung ablesen. Während 2002die zwei Schwerpunkte Politikverständnis und geschlechtsspezifischePhänomene waren, geht es in der neuen Ausgabeum generationsspezifische (‚Alt und Jung’) Unterschiede undReligiosität.Es gibt dabei einige interessante Entwicklungen: Der Prozentsatzder Jugendlichen, die sich als politisch interessiertbezeichnen, hat leicht zugenommen – von 34% (2002) auf39% (2006). Andererseits wünschen sich mehr Jugendlicheweniger Zuwanderung (58% gegenüber 48% in 2002). Ebensohat sich die Zahl derer, die Vorbehalte gegenüber bestimmtengesellschaftlichen Gruppen haben, von 49% (2002) auf 54%(2006) erhöht. Die neue Shell-Studie ist wie immer eineFundgrube.Die Jugend ist auch das Thema des Weltentwicklungsberichts2007 der Weltbank. Genau genommen lautet dasThema ‚Entwicklung und die nächste Generation’. Auch hierist die Zielgruppe die Jugend zwischen 12 und 24 Jahren. DerBericht geht folgenden Fragen nach: Wie lernen Jugendlicheerwachsen zu werden? Wie lernen sie riskante Herausforderungenzu meistern? Werden sie in den Schulen gut genugauf den künftigen Arbeitsmarkt vorbereitet? Können sie sichschnellen Veränderungen in der Wirtschaft anpassen? Könnensie dorthin wandern, wo für sie Jobs zu finden sind?Im Bildungsbereich sind die Publikationen der OECDin Kooperation mit der UNESCO eine Klasse für sich. ZurErinnerung: Die WEI (World Education Indicators) sindjene Indikatoren, die nach langjähriger mühsamer Arbeit derOECD und UNESCO Messungen von Schülerleistungen inPISA erst ermöglichten. Nach diesen Indikatoren werdenaber nicht nur 15-Jährige gemessen, sondern auch Menschenaller Altersgruppen. Die erste WEI-Studie erschien 1995, inder der Bildungsstand der Erwachsenen in verschiedenenLändern gemessen wurde. Die Länder, die für den Vergleichherangezogen wurden, sind nicht identisch mit den OECD-Mitgliedstaaten. Es sind hauptsächlich Entwicklungsländer,angefangen von Argentinien, Brasilien über China, Indien bisSimbabwe, Tunesien und Uruguay (insgesamt 19 Länder).In der neuen Studie werden Menschen aller Altersgruppenberücksichtigt. Wenn man wissen möchte, in welchem Landwie viel Prozent der Schüler/innen eine Privatschule besuchenund pikanterweise wieviel staatliche Subventionen diese Privatschulenerhalten (in Chile z.B. 65% im tertiären Sektor),dann ist die WEI-Studie die richtige Adresse.Da wir uns zur Zeit auch noch in der internationalen Dekadeder Alphabetisierung (2003 – 2012) befinden, lohnt essich, beim Thema Bildung zu verweilen. Die OECD hat eineSekundäranalyse von PISA 2003 veröffentlicht. In dieserStudie geht es um den Erfolg der Schüler/innen mit Migrationshintergrund.Es lohnt sich, die Studie genau anzusehen.Denn es gibt drei Kategorien von OECD-Ländern: Zur erstenKategorie gehören Länder, in denen Schüler/innen ausMigrantenfamilien besser als Einheimische abschneiden, inder zweiten Kategorie, in denen sie etwa gleiche Ergebnissevorweisen und in der dritten, wo sie schlechtere Leistungenals Einheimische erbringen. Zur ersten Kategorie gehörendie klassischen Zuwanderungsländer wie Australien, Kanada,Neuseeland, Macao-China. Es gibt mehrere Gründe für dasbessere Abschneiden der Migrantenkinder in diesen Ländern:a) diese Länder nehmen Zuwanderer selektiv auf, sie lassennur solche Menschen ins Land, die sie brauchen, folglich, b)sind die Zuwanderer gut bis hoch qualifiziert, also die Kinderkommen nicht aus bildungsfernen Familien und c) die Kinderbeherrschen die Sprache des Aufnahmelandes zumindest alsZweitsprache.Die Studie geht sehr differenziert vor: Unterscheidung vonacht verschiedenen Typen von Migranten, bei Kindern dieHerkunft der Eltern (beide oder nur einer aus dem Ausland),erste, zweite, dritte Generation der Migranten usw. Es istein merkwürdiges Ergebnis, dass in Deutschland die zweiteGeneration von Migrantenkindern schlechter als die ersteGeneration abschneidet.Bevor wir uns zum Schluss dem großen Thema Armutsbekämpfungwidmen, noch zwei kurze Hinweise zu zweiBerichten: Globale Trends 2007 und Development CooperationReport 2005 der OECD. Beide haben zwar auchmit der Armutsbekämpfung zu tun, aber das ist nicht dasHauptthema. Globale Trends erscheint alle zwei Jahre, nimmtsowohl aktuelle, als auch strukturelle Entwicklungen auf,deutet die Tendenzen und interpretiert sie. Der Bericht ist infünf Bereiche mit Unterthemen eingeteilt: Weltordnung undFrieden, Weltgesellschaft und Entwicklung (hierzu gehörtauch ein Kapitel über Armutsbekämpfung), Weltwirtschaft