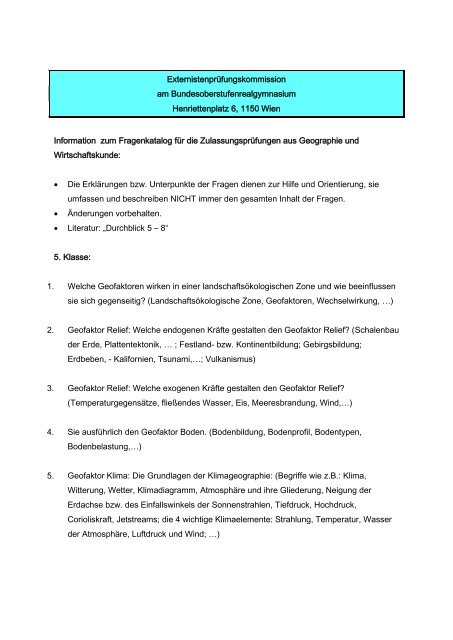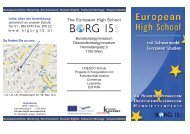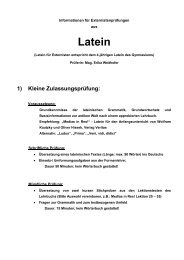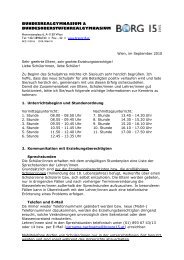Fragenkatalog - Henriettenplatz
Fragenkatalog - Henriettenplatz
Fragenkatalog - Henriettenplatz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Externistenprüfungskommission<br />
am Bundesoberstufenrealgymnasium<br />
<strong>Henriettenplatz</strong> 6, 1150 Wien<br />
Information zum <strong>Fragenkatalog</strong> für die Zulassungsprüfungen aus Geographie und<br />
Wirtschaftskunde:<br />
� Die Erklärungen bzw. Unterpunkte der Fragen dienen zur Hilfe und Orientierung, sie<br />
umfassen und beschreiben NICHT immer den gesamten Inhalt der Fragen.<br />
� Änderungen vorbehalten.<br />
� Literatur: „Durchblick 5 – 8“<br />
5. Klasse:<br />
1. Welche Geofaktoren wirken in einer landschaftsökologischen Zone und wie beeinflussen<br />
sie sich gegenseitig? (Landschaftsökologische Zone, Geofaktoren, Wechselwirkung, …)<br />
2. Geofaktor Relief: Welche endogenen Kräfte gestalten den Geofaktor Relief? (Schalenbau<br />
der Erde, Plattentektonik, … ; Festland- bzw. Kontinentbildung; Gebirgsbildung;<br />
Erdbeben, - Kalifornien, Tsunami,…; Vulkanismus)<br />
3. Geofaktor Relief: Welche exogenen Kräfte gestalten den Geofaktor Relief?<br />
(Temperaturgegensätze, fließendes Wasser, Eis, Meeresbrandung, Wind,…)<br />
4. Sie ausführlich den Geofaktor Boden. (Bodenbildung, Bodenprofil, Bodentypen,<br />
Bodenbelastung,…)<br />
5. Geofaktor Klima: Die Grundlagen der Klimageographie: (Begriffe wie z.B.: Klima,<br />
Witterung, Wetter, Klimadiagramm, Atmosphäre und ihre Gliederung, Neigung der<br />
Erdachse bzw. des Einfallswinkels der Sonnenstrahlen, Tiefdruck, Hochdruck,<br />
Corioliskraft, Jetstreams; die 4 wichtige Klimaelemente: Strahlung, Temperatur, Wasser<br />
der Atmosphäre, Luftdruck und Wind; …)
6. Wetterkatastrophen und die Arten von Niederschlag: (Konvektionsniederschlag,<br />
Stauniederschlag, Fronten; Monsun; Wirbelstürme;…)<br />
7. Die landschaftsökologischen Zonen der Erde:<br />
Beschreiben Sie das Klima, die landschaftsökologische Zone sowie im Überblick die<br />
anthropogene Nutzung in der polaren und subpolaren Klimazone. (Polare Kältewüste,<br />
Tundra, Barren Ground, Permafrost, Rentierzucht, Fischfang,…)<br />
8. Die landschaftsökologischen Zonen der Erde:<br />
Beschreiben Sie das Klima, die landschaftsökologische Zone sowie im Überblick die<br />
anthropogene Nutzung in der borealen Klimazone: (Permafrost, borealer Nadelwald,<br />
Taiga, …)<br />
9. Die landschaftsökologischen Zonen der Erde:<br />
Beschreiben Sie das Klima, die landschaftsökologische Zone sowie im Überblick die<br />
anthropogene Nutzung in der gemäßigten Klimazone. ( Unterschied ozeanisch –<br />
kontinental, Jahreszeiten, sommergrüne Laubwälder, Steppen, Halbwüsten, Wüsten,<br />
Prärie, Pampa, Golfstrom, Föhn, Inversion,…)<br />
10. Die landschaftsökologischen Zonen der Erde:<br />
Beschreiben Sie das Klima, die landschaftsökologische Zone sowie im Überblick die<br />
anthropogene Nutzung in der subtropischen Klimazone. ( 3-Teilung in sommertrockenes<br />
Mittelmeerklima, sommerfeuchtes Ostseitenklima und Wüsten; Hartlaubwälder,<br />
Lorbeerwälder, Oasen; mediterrane Kulturpflanzen; Reisanbau; …)<br />
11. Die landschaftsökologischen Zonen der Erde:<br />
Beschreiben Sie das Klima, die landschaftsökologische Zone sowie im Überblick die<br />
anthropogene Nutzung in der tropischen Klimazone. (2-Teilung in immerfeuchte Tropen<br />
und wechselfeuchte Tropen; tropischer Regenwald, Stockwerkbau, Savannen, Nutzung<br />
und Gefährdung des tropischen Regenwaldes, Nutzung der Savannen…)<br />
12. Bevölkerungsgeographie:<br />
Grundlagen der Bevölkerungsgeographie: Geburtenrate, Sterberate, der<br />
„demographische Übergang“; Verdoppelungszeit, Fruchtbarkeitsrate, Volkszählung,<br />
Altersaufbau der Bevölkerung eines Staates, Familienplanung, Bevölkerungspolitik<br />
(Beispiel China, Beispiel Indien), Historische Entwicklung der Weltbevölkerung,
Bevölkerungsverteilung auf der Erde,…)<br />
13. Bevölkerungsgeographie:<br />
Weltweite Migration: Push- und Pullfaktoren, Flüchtlinge, Legale und illegale<br />
Zuwanderung – Beispiel USA; Zusammenleben von Mehrheiten und Minderheiten,<br />
(Bsp. Kanada, Bsp. China,…). Ethnische Konflikte. Räumliche und soziale Mobilität.<br />
14. Die Nutzung verschiedener landschaftsökologischer Zonen durch den Menschen – die<br />
Verwandlung der Naturlandschaft in eine Kulturlandschaft<br />
Die Nutzung der tropischen Regenwälder der Erde (Beispiel Brasilien: Ursprüngliche<br />
Nutzung und heutige Nutzung; kommerzielle Holznutzung, Brandrodung, Agrobusiness,<br />
Brennholznutzung, Energiegewinnung, Rohstoffgewinnung, Plantagen, Cashcrops,<br />
Straßenbau;…) Chancen für den Regenwald.<br />
15. Die Nutzung verschiedener landschaftsökologischer Zonen durch den Menschen:<br />
Die Sahelzone – ein Beispiel für nicht angepasste Nutzung. (Naturraum,<br />
Niederschlagsvariabilität, Gründe für die Desertifikation in der Sahelzone,<br />
„neue“ Landwirtschaft für die Sahelzone)…<br />
16. Intensive Landwirtschaft – Beispiel USA:<br />
Das ursprüngliche System der „belts“ und sein Wandel; die räumlichen und<br />
Schwerpunkte der US-Landwirtschaft, Agrobusiness in den USA heute, Gentechnik,<br />
Hybridsorten, Wachstumshormone; Bewässerungswirtschaft in Kalifornien; Maßnahmen<br />
gegen die Bodenerosion durch Wind und Wasser; …<br />
17. Die Nutzung der borealen Nadelwälder:<br />
Beispiel Kanada, Beispiel Russland. (Lage des borealen Nadelwaldes, Nutzung einst und<br />
heute; Kahlschlag, …)<br />
18. Die intensive Nutzung der Meere: Sind unsere Meere bald leer gefischt?<br />
(Fischereigrenzen; Ursachen der Überfischung der Meere, Walfang, Fabrikschiffe, …)<br />
19. Wichtige Grundlagen der Wirtschaft – Wie funktioniert die Marktwirtschaft?<br />
Bedürfnisse, Bedarf; Bedürfnispyramide nach Maslow; Wirtschaften, Grenznutzen,<br />
Grenzkosten, Einkommenselastizität, Märkte die Orte des Wirtschaftens; Angebot und
Nachfrage; Inflation; die Produktionsfaktoren Grund und Boden, Kapital, Arbeit, Know<br />
how,…)<br />
6. klasse:<br />
20. Der physiogeographische Raumbegriff Europa:<br />
Abgrenzen des Kontinentes Europa gegenüber Asien; Gliederung Europas nach<br />
naturräumlichen Kriterien (Tertiäre Faltengebirge, Mittelgebirge, Tiefländer, Küsten,<br />
Küstenformen;…), das Klima Europas. Weitere Gliederungsmöglichkeiten.<br />
21. Die Etappen des europäischen Integrationsprozesses:<br />
Europa nach dem Zweiten Weltkrieg; Der Marshallplan; EGKS, EURATOM, EWG;<br />
Meilensteine der europäischen Einigung und der Erweiterung der EG bzw. EU;<br />
„EU der 27“; Verträge von Maastricht, Amsterdam, Nizza, Kopenhagen und Lissabon;<br />
weitere EU-Beitrittskandidaten<br />
22. Die juristischen Organe der EU<br />
Die 5 wichtigsten Organe der EU, ihre Aufgaben, ihr Sitz, österreichische Kommissare<br />
seit 1995, …<br />
23. Der €URO, die Einheitswährung der EU; die Einführung des €URO, die Vorteile der<br />
gemeinsamen Währung, die Konvergenzkriterien von Maastricht, der Stabilitätspakt;<br />
„Tricks“ bei Beitritt zum €URO; die Krise des €URO (Griechenland, Irland, Portugal,<br />
Spanien, Italien);<br />
24. Die Vielfalt der landwirtschaftlichen Nutzung Europas (Wälder, Grünland im Nordwesten<br />
Europas und im Gebirge, Ackerbau, … , traditionelle mediterrane Kulturen;<br />
Entwicklungstendenzen der europäischen Landwirtschaft – Strukturwandel, Gentechnik,<br />
biologischen und nachhaltige Landwirtschaft.<br />
25. Ein Beispiel für die Inwertsetzung eines Trockenraumes:<br />
Exportorientierter Gemüse- und Obstanbau in Südspanien. (Landwirtschaft im Raum<br />
Almeria, Valencia, Murcia; Huertas; künstliche Bewässerung; …
26. Tourismus in Europa.<br />
Berggebiete im Wandel – Von der Bergbauernwirtschaft zu Tourismuszentren,<br />
Rahmenbedingungen für den Tourismus; Ansprüche an die Landschaft; Belastbarkeit der<br />
Landschaft. Trends im Tourismus; Beispiele für die touristische Erschließung Europas.<br />
27. Die Bevölkerung Europas.<br />
Die demographische Entwicklung Europas, „Mangelware Kind“ – Fruchtbarkeitsraten in<br />
Europa. Bevölkerungspolitik in Europa, Familienförderung. Europa als Einwanderungsziel;<br />
der Umgang Europas mit Asylwerbern und Migranten, die wichtigsten Schlepperrouten in<br />
die EU; das Schengener Abkommen und die (illegale sowie legale) Einwanderung nach<br />
Europa; ethnische Minderheiten in Europa, unterschiedliche Völker und Nationalitäten in<br />
einem Staat.<br />
28. Die wichtigsten politischen Entscheidungsfelder Europas:<br />
Die Wirtschafts-, Finanz- und Agrarpolitik Europas; der Binnenmarkt; Wettbewerbspolitik,<br />
Regionalpolitik, Verkehrspolitik,…<br />
29. Regionale Disparitäten in Europa.<br />
Die Ursachen regionaler Disparitäten; periphere Regionen, alte Industriegebiete; der<br />
„Rostgürtel“ Europas, Stahl- und Kohlekrise + regionale Beispiele; Strukturwandel;<br />
zentrale und erfolgreiche Regionen, Wachstumsregionen in Europa; die Machtzentren<br />
und Finanzplätze Europas;
7. Klasse:<br />
30. Die naturräumliche Gliederung, das Klima und die natürliche Vegetation Österreichs.<br />
Österreichs naturräumliche Lage in Europa, die Großlandschaften Österreichs; Karst;<br />
Gletscher; das Klimatypen in Österreich; Vegetationsgrenzen in den Alpen.<br />
31. Nationalparks in Österreich.<br />
Nationalparkkriterien, die Nationalparkidee; 6 Nationalparks in Österreich;<br />
Interessenskonflikte in den Nationalparks<br />
32. Der sorgsame Umgang mit knappen Ressourcen: Wasser (Boden und Luft); die<br />
Wasserversorgung Wiens; Abwasserentsorgung, Kläranlagen; Grundwassergefährdung;<br />
Bodenversiegelung; Ozon; Treibhauseffekt; sauerer Regen; Smog<br />
33. Bevölkerungsgeographie Österreichs:<br />
Die statistische Erfassung der Bevölkerung Österreichs (Volkszählung)<br />
Maßzahlen, - Geburtenrate, Sterberate, Fruchtbarkeitsrate, Entwicklung der Geburten-<br />
und Sterberate, der demographische Übergang; der Altersaufbau der österreichischen<br />
Bevölkerung und seine Folgen; die sozioökonomische Gliederung der österreichischen<br />
Bevölkerung;<br />
34. Binnen- und Zuwanderung in bzw. nach Österreich.<br />
Migration und ihre Folgen; Gewinner und Verlierer der regionalen Bevölkerungs-<br />
entwicklung in Österreich; Volksgruppen, Minderheiten in Österreich und ihre Probleme.<br />
35. Das magische Polygon (Vieleck) der Wirtschaftspolitik.<br />
Ziele und Träger der Wirtschaftspolitik; Zielkonflikte und Zielharmonie in der<br />
Wirtschaftspolitik – „der magische Moment“.<br />
36. Das soziale Netz und die Sozialpolitik in Österreich.<br />
Sozialversicherung; das System der Sozialpolitik in Österreich; Pensions-, Kranken-,<br />
Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Wer finanziert das soziale Netz? Armut in einem
eichen Staat!? Grundeinkommen. Die Sozialpartnerschaft in Österreich.<br />
37. Keynesianismus gegen Neoliberalismus: Keynes gegen Friedmann;<br />
Inhalte, Stärken und Schwächen beider Systeme<br />
38. Budget und Steuern in Österreich.<br />
Budgetpolitik; Welche Gebietskörperschaften erstellen ein Budget in Österreich?<br />
Nulldefizit pro und contra; Steuerpolitik; Abgabenquote; der Finanzausgleich; Arten<br />
Steuern; Steuerprogression;<br />
39. Die drei wichtigsten volkswirtschaftlichen Indikatoren: Wirtschaftswachstum;<br />
Arbeitslosigkeit, Inflation; (BIP, Konjunktur, Arten der Arbeitslosigkeit, Arten der Inflation,<br />
Messung der Inflation,…)<br />
40. Die österreichischen Land- und Forstwirtschaft.<br />
Struktur- und Strukturwandel der österreichischen Landwirtschaft; die<br />
landwirtschaftlichen Produktionsgebiete Österreichs; das Marchfeld und alpine<br />
Produktionsregionen als Beispiele;<br />
41. Die Industrie Österreichs.<br />
Die österreichischen Industrieregionen, „alte“ Industriegebiete im Wandel,<br />
Wirtschaftsstandorte an der Peripherie Österreichs; dynamische Wirtschaftsstandorte<br />
42. Tourismus in Österreich.<br />
Der Stellenwert des Tourismus für die österreichische Volkswirtschaft, regionale<br />
Verteilung des Fremdenverkehrs in Österreichs, Arten des Tourismus; sanfter Tourismus,<br />
harter Tourismus,…<br />
43. Verkehrsgeographie Österreichs.<br />
Hauptverkehrswege Österreichs (Straße, „Schiene“, Wasserstraße Donau, Flughäfen),<br />
Transitverkehr, Maut, Road Pricing; Pendlerverkehr, Park and Ride; …)<br />
44. Zentrum und Peripherie in Österreich.<br />
Wirtschaften und leben an der Peripherie – Beispiele: Burgenland, Mühl- und Waldviertel.<br />
Der ländliche Lebensraum Österreichs: Kulturlandschaft im ländlichen Raum, Haus-,<br />
Siedlungs- und Flurformen Österreichs (Achtung: Nicht in „Durchblick 7“ enthalten)
45. Wirtschaften und leben im Zentrum.<br />
8. Klasse:<br />
Metropole Wien; Abgrenzung Stadt/Land; die historische Entwicklung bzw. die<br />
Stadtentwicklung Wiens; „Von der Romanik bis zur Wienerberg – und Donau – City“, -<br />
„Vorgründerzeit“, „Gründerzeit“, „Zwischenkriegszeit“, „Nachkriegszeit“; aktuelle<br />
Großbauprojekte in Wien (Großteils nicht in „Durchblick 7“ enthalten)<br />
46. Die Entwicklung, heutigen Rahmenbedingungen und Institutionen der Globalisierung:<br />
z.B.: Informationsrevolution, Liberalisierung der Weltwirtschaft, der Sieg der<br />
Marktwirtschaft, neue Transporttechnologien, globale Transportwege, Änderungen im<br />
Arbeitsprozess ( Automationstechnologie,…) ; WTO; IWF; Weltbank.<br />
47. Die Entwicklungsländer und ihre sozioökonomischen und politischen Merkmale.<br />
Die Entwicklungsländer sind nicht alle gleich (arm):<br />
2 Methoden und Modelle zur Gliederung der 3.-Welt-Staaten:<br />
a) „Von den „LLDC’s“ … bis zu den „NIC’s“<br />
b) Aktuelle Gliederung (der UNO) nach dem HDI ( „Human Development Index“.<br />
48. Die Ursachen der Unterentwicklung<br />
a) Natürliche Gegebenheiten<br />
b) Exogene Ursachen<br />
c) Endogene Ursachen<br />
49. Die Überwindung der Unterentwicklung der 3.-Welt-Staaten –<br />
Entwicklungspolitik, Entwicklungshilfe und Globalisierungskritik<br />
Verschiedene Lösungsversuche: z.B.: Änderung des Weltwirtschaftssystems,<br />
Umschuldung, Entwicklung der Landwirtschaft, Entwicklung der Industrie, Abkoppelung<br />
von der Weltwirtschaft – Protektionismus, … ; ein globaler Marshallplan (GMP) …<br />
50. Globaler Klimawandel – das Weltökosystem in Gefahr<br />
Weltweiter Klimaschutz und Klimapolitik; Club of Rome; der ökologische Fußabdruck;<br />
der globale Klimawandel und seine Auswirkungen; Kyoto-Protokoll; nachhaltiges Leben<br />
und Wirtschaften – eine Strategie für die Zukunft<br />
51. Politische und ökonomische Systeme im Vergleich:<br />
Die „Neoliberale Marktwirtschaft“ – die USA:<br />
Grundwerte der amerikanischen Gesellschaft; der sozioökonomische Strukturwandel der
Industrie der USA; die Industriegebiete der USA;<br />
52. Politische und ökonomische Systeme im Vergleich:<br />
Lateinamerika: „Neoliberale Ansätze und ihre Gegenmodelle (Brasilien, Mexiko, Kuba)<br />
53. Politische und ökonomische Systeme im Vergleich:<br />
Die „Soziale Marktwirtschaft“ – EUROPA; die Ziele der sozialen Marktwirtschaft;<br />
die Vielfältigkeit europäischer Sozialmodelle.<br />
54. Politische und ökonomische Systeme im Vergleich:<br />
Der „Neomerkantilismus“: Asiatische Modelle; das japanische Wirtschaftssystem;<br />
die „Tigerstaaten“ Südostasiens;<br />
55. Politische und ökonomische Systeme im Vergleich:<br />
Die „Sozialistische Marktwirtschaft“: Der Sonderfall China; „von Mao zum Markt“; Deng<br />
Xiao Ping und sein Reformprozess; Sonderwirtschaftszonen; „Zentrum und Peripherie“ in<br />
China heute – Küstenregionen (( Landesinnere;<br />
weitere aktuelle Fragen: Staatsbetriebe, Wanderarbeiter, Ökologie, aktuelle politische<br />
Fragen;<br />
56. Politische und ökonomische Systeme im Vergleich:<br />
Das „duale Wirtschaftssystem der Entwicklungsländer“: Subsistenzwirtschaft und<br />
Rohstoffökonomien; Fallbeispiele aus Afrika,; „Failed States“;<br />
57. Städte als Lebensräume und ökonomische Zentren:<br />
Globale Stadtmodelle: Die „europäische Stadt“; die „angloamerikanische Stadt“, die<br />
„lateinamerikanische Stadt“, die „orientalische Stadt“, - ein Vergleich.<br />
Achtung: Nicht in „Durchlick 8“ enthalten.<br />
58. Städte als Lebensräume und ökonomische Zentren:<br />
Global Cities, Metropolen, Megacities + weltweite Beispiele: Manila, Jakarta, Bangkok,<br />
Mexiko-City, Mumbai, Lagos, Sao Paulo, …<br />
59. Städte als Lebensräume und ökonomische Zentren:<br />
Städte als Spiegelbilder ihres Zeitalters: Grundrisse, Merkmale und historische<br />
Gliederung einer Stadt; funktionale und sozialräumliche Gliederung von Städten; private<br />
Stadtviertel – „Gatet Communities“; Suburbanisierung; Stadtentwicklung – „Wie Stadtteile
ihr Image ändern“; Gentrifizierung; Stadtentwicklung zwischen „Explosion“ und<br />
Stagnation, „Shrinking Cities“;<br />
60. Politische Gestaltung von Räumen:<br />
Raumordnung und Raumplanung in Österreich; der Flächenwidmungsplan, der<br />
Bebauungsplan, Bauen in gefährdeten Gebieten – der Gefahrenzonenplan<br />
Der Umgang mit Naturgefahren in Österreich – Hochwasser, Lawinen – das<br />
Lawinenunglück von Galtür.