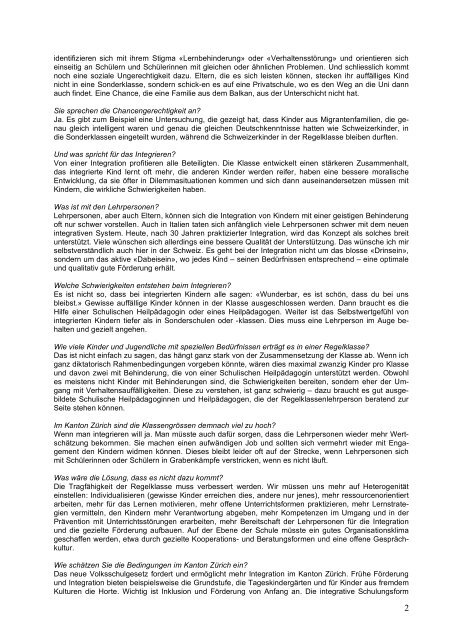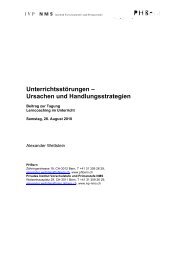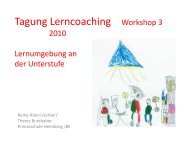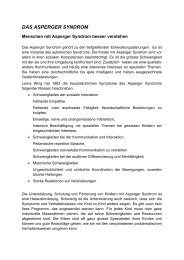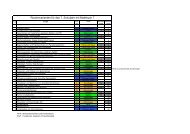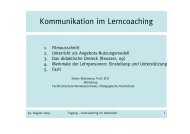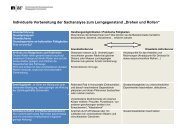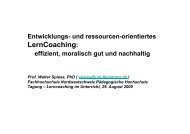«Alle Kinder können integriert werden» - Projekt Schul-In
«Alle Kinder können integriert werden» - Projekt Schul-In
«Alle Kinder können integriert werden» - Projekt Schul-In
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
identifizieren sich mit ihrem Stigma «Lernbehinderung» oder «Verhaltensstörung» und orientieren sicheinseitig an Schülern und Schülerinnen mit gleichen oder ähnlichen Problemen. Und schliesslich kommtnoch eine soziale Ungerechtigkeit dazu. Eltern, die es sich leisten <strong>können</strong>, stecken ihr auffälliges Kindnicht in eine Sonderklasse, sondern schick-en es auf eine Privatschule, wo es den Weg an die Uni dannauch findet. Eine Chance, die eine Familie aus dem Balkan, aus der Unterschicht nicht hat.Sie sprechen die Chancengerechtigkeit an?Ja. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass <strong>Kinder</strong> aus Migrantenfamilien, die genaugleich intelligent waren und genau die gleichen Deutschkenntnisse hatten wie Schweizerkinder, indie Sonderklassen eingeteilt wurden, während die Schweizerkinder in der Regelklasse bleiben durften.Und was spricht für das <strong>In</strong>tegrieren?Von einer <strong>In</strong>tegration profitieren alle Beteiligten. Die Klasse entwickelt einen stärkeren Zusammenhalt,das <strong>integriert</strong>e Kind lernt oft mehr, die anderen <strong>Kinder</strong> werden reifer, haben eine bessere moralischeEntwicklung, da sie öfter in Dilemmasituationen kommen und sich dann auseinandersetzen müssen mit<strong>Kinder</strong>n, die wirkliche Schwierigkeiten haben.Was ist mit den Lehrpersonen?Lehrpersonen, aber auch Eltern, <strong>können</strong> sich die <strong>In</strong>tegration von <strong>Kinder</strong>n mit einer geistigen Behinderungoft nur schwer vorstellen. Auch in Italien taten sich anfänglich viele Lehrpersonen schwer mit dem neuenintegrativen System. Heute, nach 30 Jahren praktizierter <strong>In</strong>tegration, wird das Konzept als solches breitunterstützt. Viele wünschen sich allerdings eine bessere Qualität der Unterstützung. Das wünsche ich mirselbstverständlich auch hier in der Schweiz. Es geht bei der <strong>In</strong>tegration nicht um das blosse «Drinsein»,sondern um das aktive «Dabeisein», wo jedes Kind – seinen Bedürfnissen entsprechend – eine optimaleund qualitativ gute Förderung erhält.Welche Schwierigkeiten entstehen beim <strong>In</strong>tegrieren?Es ist nicht so, dass bei <strong>integriert</strong>en <strong>Kinder</strong>n alle sagen: «Wunderbar, es ist schön, dass du bei unsbleibst.» Gewisse auffällige <strong>Kinder</strong> <strong>können</strong> in der Klasse ausgeschlossen werden. Dann braucht es dieHilfe einer <strong>Schul</strong>ischen Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen. Weiter ist das Selbstwertgefühl von<strong>integriert</strong>en <strong>Kinder</strong>n tiefer als in Sonderschulen oder -klassen. Dies muss eine Lehrperson im Auge behaltenund gezielt angehen.Wie viele <strong>Kinder</strong> und Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen erträgt es in einer Regelklasse?Das ist nicht einfach zu sagen, das hängt ganz stark von der Zusammensetzung der Klasse ab. Wenn ichganz diktatorisch Rahmenbedingungen vorgeben könnte, wären dies maximal zwanzig <strong>Kinder</strong> pro Klasseund davon zwei mit Behinderung, die von einer <strong>Schul</strong>ischen Heilpädagogin unterstützt werden. Obwohles meistens nicht <strong>Kinder</strong> mit Behinderungen sind, die Schwierigkeiten bereiten, sondern eher der Umgangmit Verhaltensauffälligkeiten. Diese zu verstehen, ist ganz schwierig – dazu braucht es gut ausgebildete<strong>Schul</strong>ische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die der Regelklassenlehrperson beratend zurSeite stehen <strong>können</strong>.Im Kanton Zürich sind die Klassengrössen demnach viel zu hoch?Wenn man integrieren will ja. Man müsste auch dafür sorgen, dass die Lehrpersonen wieder mehr Wertschätzungbekommen. Sie machen einen aufwändigen Job und sollten sich vermehrt wieder mit Engagementden <strong>Kinder</strong>n widmen <strong>können</strong>. Dieses bleibt leider oft auf der Strecke, wenn Lehrpersonen sichmit Schülerinnen oder Schülern in Grabenkämpfe verstricken, wenn es nicht läuft.Was wäre die Lösung, dass es nicht dazu kommt?Die Tragfähigkeit der Regelklasse muss verbessert werden. Wir müssen uns mehr auf Heterogenitäteinstellen: <strong>In</strong>dividualisieren (gewisse <strong>Kinder</strong> erreichen dies, andere nur jenes), mehr ressourcenorientiertarbeiten, mehr für das Lernen motivieren, mehr offene Unterrichtsformen praktizieren, mehr Lernstrategienvermitteln, den <strong>Kinder</strong>n mehr Verantwortung abgeben, mehr Kompetenzen im Umgang und in derPrävention mit Unterrichtsstörungen erarbeiten, mehr Bereitschaft der Lehrpersonen für die <strong>In</strong>tegrationund die gezielte Förderung aufbauen. Auf der Ebene der <strong>Schul</strong>e müsste ein gutes Organisationsklimageschaffen werden, etwa durch gezielte Kooperations- und Beratungsformen und eine offene Gesprächkultur.Wie schätzen Sie die Bedingungen im Kanton Zürich ein?Das neue Volksschulgesetz fordert und ermöglicht mehr <strong>In</strong>tegration im Kanton Zürich. Frühe Förderungund <strong>In</strong>tegration bieten beispielsweise die Grundstufe, die Tageskindergärten und für <strong>Kinder</strong> aus fremdemKulturen die Horte. Wichtig ist <strong>In</strong>klusion und Förderung von Anfang an. Die integrative <strong>Schul</strong>ungsform2