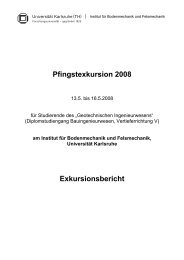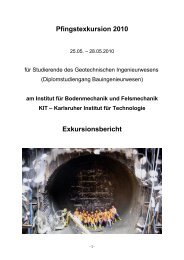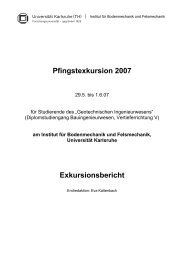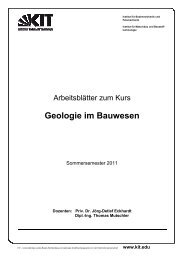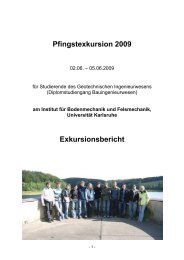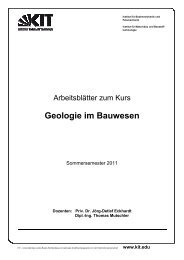Hydrogeologische Grundlagen - IBF
Hydrogeologische Grundlagen - IBF
Hydrogeologische Grundlagen - IBF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Arbeitsblätter zum Kurs "GEOLOGIE IM BAUWESEN" Seite 12.10<br />
Ergänzende Stichworte zu Kapitel 12<br />
Abfluss: Alle Transportvorgänge, die die meteorischen Niederschläge (Regen, Schnee,<br />
Eis, Tau) über die Flüsse und Seen in die Meere zurückführen. Gegenteil: Versickerung.<br />
Artesisches Wasser: Gespanntes Grundwasser, das zwischen muldenförmig nach unten<br />
gebogenen, wasserundurchlässigen Bodenschichten liegt und an einer höher gelegenen<br />
Stelle einen Zufluss erhält. Durchörtert man die darüberliegende Stauschicht so entsteht<br />
durch den dort herrschenden Überdruck ein natürlicher Springbrunnen (artesischer Brunnen),<br />
wenn der Entnahmepunkt tiefer liegt als der freie Grundwasserspiegel im Speichergestein.<br />
Bergwasser: Alles im Fels auftretende Wasser wie Porenwasser im Gestein und in den<br />
Kluftzwischenmitteln oder freies Kluftwasser.<br />
Grundwasserbeschaffenheit: Qualitative und quantitative Zusammensetzung des GW<br />
nach Art und Menge der darin enthaltenen und transportierten Stoffe; Maß für die Filterwirkung<br />
des Bodens<br />
Grundwasserleiter (Aquifer): Wasserdurchlässige Gesteinsformation, die mit GW teilweise<br />
oder ganz gefüllt sein kann<br />
Grundwasserstauer: gering durchlässige Gesteinsformation, die einen GW-Leiter nach<br />
oben oder unten abgrenzt<br />
Hydrogeologie: Lehre vom Wasserhaushalt des Untergrundes (Vorräte, Dynamik, Zusammensetzung<br />
des Grundwassers)<br />
Kapillarität: Grundwasseranstieg in den Kapillaren des Bodens durch die Oberflächenspannung<br />
an der Grenzfläche von Wasser und Luft<br />
Thermen (=Thermalquellen): Quellen von aus größeren Tiefen - meist an geologischen<br />
Verwerfungen - aufsteigenden warmen oder heißen, mineralhaltigen Wässern (z.B. Thermen<br />
von Baden-Baden); eruptive Quellen von Wasserdampf und heißem Wasser in vulkanischen<br />
Gebieten nennt man dagegen Geysire (z.B. in Island).<br />
Tropfsteine: In Karsthöhlen tropft aus Spalten und Poren gewöhnlich kalkhaltiges Wasser.<br />
An der Aufschlagstelle scheidet sich Kalkspat aus (Tropfsteine) und bildet zapfenähnliche<br />
Gebilde, die in die Höhe wachsen (Stalagmiten). Die von den Decken herabwachsenden,<br />
hängenden Zapfen heißen Stalaktiten. Verwachsen Stalagmiten mit Stalaktiten<br />
entstehen Tropfsteinsäulen oder Stalagnaten.<br />
Wasserhärte: Maß für gelöste Ca- und Mg-Verbindungen im Wasser: ein deutscher Härtegrad<br />
(1° d. H.) entspricht 10 mg CaO oder 18 mg CaCO3 pro Liter Wasser.<br />
Wasserwegigkeit: Eigenschaft klüftigen Gebirges, dem Wasser entlang der Klüfte bevorzugte<br />
Sickerwege zu bieten; die Wasserwegigkeit kann in verschiedenen Richtungen sehr<br />
unterschiedlich sein.