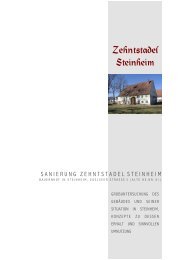Leitfaden zur Erarbeitung von Integrierten Handlungskonzepten
Leitfaden zur Erarbeitung von Integrierten Handlungskonzepten
Leitfaden zur Erarbeitung von Integrierten Handlungskonzepten
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hessisches Ministerium fürWirtschaft, Verkehr und LandesentwicklungInstrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereiche<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong><strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong>Prof. Thomas Dilger / Dipl.-Ing. Felix LüterNH ProjektStadt / Nassauische HeimstätteWohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheInhalt1 Einführung – was und warum 21.1 Definition 21.2. Historie 21.3. Kurzüberblick – Bestandteile, Prinzipien, Ziele 3Prozesshaftes Verfahren und konsensuale <strong>Erarbeitung</strong> 3Einbezug aller relevanten Akteure 4Integrierte Gesamtbetrachtung des Gebietes im Kontext seines Umfeldes 4sektoraler Einbezug aller relevanten Themen 5Konkreter Gebietsbezug – Gebietsabgrenzung 5Räumliche Staffelung und integrativer Ansatz 5Leitbildformulierung, Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldern und Maßnahmen 5fokussierter Mitteleinsatz 6Bearbeitungsteam 62 Hauptteil – <strong>Erarbeitung</strong>s-<strong>Leitfaden</strong> Integrierte Handlungskonzepte 6Meilensteine – verbindliche Zwischenschritte 62.1. Prozessstrukturierung 7Erste Problem- und Zielermittlung 7Programmbewerbung 7Erstellung eines Projekt-Zeitplans 8Dauer des <strong>Erarbeitung</strong>sprozesses 8Erststrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit 8Prüfung der Beauftragung 8Lenkungsgruppe 92.2. Analysephase 9Grundlagenermittlung und Auswertung 9Szenarienentwicklung und Prognosen 11Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken –Bewertung (SWOT-Analyse) 11Akteursbeteiligung 112.3. Konzeptphase 12Leitbildentwicklung 13Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldern 13Maßnahmenformulierung 13Maßnahmenpriorisierung und Initialprojekte 13Zeit-Maßnahmen-Planung und Kosten-Finanzierungsplan 14Gebietsabgrenzung 14Aufbau und Förderung <strong>von</strong> Beteiligungsstrukturen 14Abstimmung und Beteiligung 14Abstimmung mit dem Fördermittelgeber (im Falle einer Programmteilnahme) 15Überarbeitung und Gremienbeteiligung 152.4. Fertigstellung und Umsetzung 16Beschluss 16Vorbereitung, Strukturierung und Beginn der Umsetzungsphase 16Evaluation und Abrechnung 16Förderung (im Falle einer Programmteilnahme) 172.5. Ausblick 173 bestpractice-Beispiele 18Teilräumliche Projektbeispiele - Soziale Stadt 18Gesamtstädtische und Interkommunale Handlungskonzepte im Rahmen des Programms„Stadtumbau in Hessen“ 19Integrierte Handlungskonzepte außerhalb <strong>von</strong> Förderprogrammen 214 Links und Literatur 22<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 2
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereiche1 Einführung – was und warum1.1 DefinitionEin Integriertes Handlungskonzept ist ein umsetzungsorientiertes, gebietsbezogenesPlanungs- und Steuerungsinstrument mit einem ganzheitlichen Betrachtungsansatz.Es handelt sich um einen prozessorientierten Ansatz, dass heißt, ein IntegriertesHandlungskonzept ist auf eine kontinuierliche Fortentwicklung angelegt, um auch inzeitlicher Hinsicht integriert zu handeln, also auf neue Entwicklungen reagieren zukönnen.Bei der <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes sind alle relevanten Belangemiteinzubeziehen. In Bezug auf die Beteiligung bedeutet dies, dass die gebietsbezogenenAkteure aller Sektoren in den Planungs- und Umsetzungsprozess miteinzubinden sind. Hierdurch soll nicht nur eine Interessenwahrung gewährleistet werden,sondern auch eine Aktivierung <strong>zur</strong> Mitgestaltung des Stadtentwicklungsprozesseserwirkt werden.In Bezug auf die räumliche Dimension sollten die Planungen integriert abgestimmt mitder jeweils höheren räumlichen Ebene entwickelt werden. Integrierte Handlungskonzeptesind sowohl für teilräumliche, gesamtstädtische als auch für interkommunaleGebietseinheiten geeignet.Durch die <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes wird für alle beteiligtenAkteure und Prozesse ein integrierter Rahmen geschaffen, der eine nachhaltige Interessenabstimmungund eine Planungssicherheit bietet.1.2 HistorieDer Leitbegriff nachhaltige und integrierte Stadtentwicklung beschreibt die thematischeVerknüpfung sozialer, kultureller, ökonomischer und ökologischer Handlungsfelderim Planungsprozess, mit dem Ziel der Verbesserung der Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen.Ziel ist es, die bestehende Stadtstruktur in ihrer Gesamtheit zeitgemäßfortzuentwickeln und zu ertüchtigen.Zentraler Ansatz einer solchen Planungspolitik ist der systematische Einbezug allerAkteure eines Projektgebietes – integrierte Stadtentwicklung versteht sich als Gemeinschaftsaufgabe.Seit den 1990er Jahren hat das Thema Nachhaltige Entwicklung in allen Bereicheneinen starken Bedeutungszuwachs erhalten. Im Bereich des Städtebaus ist in diesemZusammenhang der Begriff der <strong>Integrierten</strong> Stadtentwicklung geprägt worden undwurde in der Folge <strong>von</strong> internationalen Meilensteinen, wie dem EU-Programm UR-BAN I + II (seit 1994) oder der UN-Konferenz Habitat II (1996) mit Leben gefüllt.<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 3
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheAus dieser Entwicklung heraus und aufgrund des Handlungsbedarfs in den Städtenund Regionen sind in Deutschland die Städtebau-Förderprogramme Soziale Stadt(seit 1999 Umsetzung in allen Bundesländern) und Stadtumbau (in Hessen seit 2005)mit ihren jeweiligen Landesprogrammen entstanden. Mit der Verabschiedung derLeipzig Charta <strong>zur</strong> nachhaltigen europäischen Stadt im Jahr 2007 durch die Stadtentwicklungsministerder EU erhält das Thema auf europäischer Ebene zusätzlichesGewicht. (Informationen und Hintergründe <strong>zur</strong> Leipzig Charta, siehehttp://www.bmvbs.de - Rubrik EU Ratspräsidentschaft, Kapitel Arbeitsprogramm,Thema Bau und Stadtentwicklung und hier Übersichtsseite Leipzig Charta.)Auf der Ebene der bundesdeutschen Gesetzgebung hat mit der Europarechtsanpassungdes Baugesetzbuches in den Jahren 2004 und 2007 die nachhaltige, integrierteStadtentwicklung mit ihren Programmen eine deutliche Stärkung erfahren.Die aktuelle programmatische Weiterentwicklung findet in Hessen ihren derzeitigenAbschluss mit der geplanten Einführung der „Richtlinien des Landes Hessen <strong>zur</strong> Förderungder nachhaltigen Stadtentwicklung“ (RiLiSE), die die „Verwaltungsvorschriftenüber den Einsatz <strong>von</strong> Sanierungs- und Entwicklungsförderungsmitteln (VV-StBauF)ablösen sollen. RiLiSE wird erstmals allen Programmen des besonderen Städtebaurechtsin Hessen einen einheitlichen Rahmen geben, in dem wesentlich deutlicher einenachhaltige, also integrierte Entwicklung als Grundsatz für alle Maßnahmen definiertwird. Dementsprechend sollen zukünftig in allen Programmen der StädtebauförderungIntegrierte Handlungskonzepte verpflichtende Grundlage sein.Das Programm „Stärkung zentraler Kernbereiche“ bildet den neuesten Baustein einerintegrierten und nachhaltigen Entwicklung im Rahmen der Städtebauförderung inHessen. Bei der Realisierung des Programms kann auf die mittlerweile umfassendeErfahrung mit Maßnahmen, Instrumenten und Strategien der <strong>Integrierten</strong> Stadtentwicklungin Hessen <strong>zur</strong>ückgegriffen werden. Der vorliegende <strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> ErstellungIntegrierter Handlungskonzepte bildet einen Baustein <strong>zur</strong> Vermittlung dieser Kompetenzen.Denn die <strong>Erarbeitung</strong> Integrierter Handlungskonzepte wird auch im Programm„Stärkung zentraler Kernbereiche“ den fundierten Beginn <strong>von</strong> Entwicklungsprozessenbilden.Einleitend sei betont, dass analog der oben skizzierten Entwicklung die <strong>Erarbeitung</strong>eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes generell für alle Vorhaben der Stadtentwicklungzu empfehlen ist. Es ist also auch außerhalb <strong>von</strong> Förderprogrammen eine unbedingtempfehlenswerte Handlungsgrundlage. Denn die <strong>Erarbeitung</strong> Integrierter Handlungskonzeptehat sich als Arbeits-Grundlage für die nachhaltige Entwicklung <strong>von</strong>Städten und Quartieren bewährt. Die Vorteile liegen in der systematischen und ganzheitlichenErfassung der Situation und in der <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> mit allen Akteuren abgestimmtenlokal angepassten Lösungsansätzen, die immer auch das größere Bildeiner gesamtstädtischen oder sogar regionalen Betrachtung berücksichtigen.<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 4
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheKurzüberblick – Bestandteile, Prinzipien, ZieleWesentliche Charakteristika der <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong>Handlungskonzeptes• Prozesshaftes Verfahren – auf Fortschreibung angelegt• Konsensuale <strong>Erarbeitung</strong> – Einbezug aller relevanten Akteure• Integrierte Gesamtbetrachtung des Gebietes im Kontext seines Umfeldes• Ganzheitlicher, integrierter Planungsansatz – sektoraler Einbezug aller relevantenThemen und interdisziplinäre Arbeitsweise• Konkreter Gebietsbezug – Gebietsabgrenzung• Räumliche Staffelung – teilräumlich, gesamstädtisch, interkommunal• Integrieter Ansatz – Einbezug aller Planungen und Maßnahmen• Leitbildformulierung• Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldern und Maßnahmen• fokussierter MitteleinsatzProzesshaftes Verfahren und konsensuale <strong>Erarbeitung</strong>Am Beginn des Prozesses stehen die Feststellung eines Handlungsbedarfes und derBeschluss <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes.Sowohl bei der Erstellung, als auch bei der Umsetzung und Fortschreibung des <strong>Integrierten</strong>Handlungskonzeptes handelt es sich um einen prozesshaften Arbeitsansatz.Die frühzeitige Einbeziehung aller Beteiligten in der Konzeptphase bildet oftmals denGrundstein <strong>zur</strong> Stärkung oder zum Aufbau <strong>von</strong> Strukturen intensiver Zusammenarbeit.Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein der nachhaltigen Stadtentwicklung. Dennnur gemeinsam können zukünftige Herausforderungen effizient, Ressourcen schonendund im Sinne aller Beteiligten gemeistert werden.Neben der Formulierung <strong>von</strong> Leitbildern, Zielen und Handlungsfeldern, werden imRahmen des Prozesses gemeinsam mit den beteiligten Akteuren zweckdienlicheMaßnahmen entwickelt. Den Abschluss des Prozesses bildet die Verabschiedungdes Konzeptes durch die Stadtverordneten- oder Gemeindeversammlung. Hiermitund mit der vorangegangenen Einbeziehung aller relevanten Akteure ist die gemeinsameBindung an das Konzept und das Prinzip der kommunalen Planungshoheit gewährleistet.Eine wichtige Vorraussetzung für die Initiierung langfristiger und somitnachhaltiger Prozesse.Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein Integriertes Handlungskonzept nichts mit einemin Stein gemeißelten Masterplan für die Ewigkeit gemein hat. Im Gegenteil, die kontinuierlicheinhaltliche Weiterentwicklung im Prozess der Umsetzung – offen für denEinbezug neuer Entwicklungen - bildet einen weiteren wesentlichen Grundsatz dernachhaltigen Planungspraxis.<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 5
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheEinbezug aller relevanten AkteureNeben einer angemessenen Beteiligung und Information der Bürger und dem kommunalenund gegebenenfalls interkommunalen Austausch in Politik und Verwaltungsind alle Akteure des Projektgebietes im Rahmen der Entwicklung in die Planung einzubeziehen.Im Falle <strong>von</strong> Kernbereichen sind dies beispielsweise insbesondere Einzelhändler,Wohnungsbaugesellschaften, Gastronomen, Kulturschaffende, Hauseigentümer,Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, Träger im Gebiet arbeitender Sozialeinrichtungensowie Interessengruppen und Vereinigungen lokaler Bürger undGruppierungen, wie Bürgerinitiativen, Nachbarschaftsorganisationen oder ausländischeKulturvereine. Die Liste ist selbstverständlich je nach Sachlage und Projektgebietim Einzelfall entsprechend anzupassen. Eine besondere Berücksichtigung beider Konzepterarbeitung sollten die Bedürfnisse spezieller Akteure, wie Senioren, Jugendlicheoder Personen mit Migrationshintergrund erfahren.Einbezug aller Akteure – Lebendiges Zusammenleben gewährleistenQuelle: Nassauische Heimstätte Wohnungs- und EntwicklungsgesellschaftIntegrierte Gesamtbetrachtung des Gebietes im Kontext seines UmfeldesWichtig ist, dass die Entwicklungskonzeption integriert, das heißt im Einklang mit derGesamtschau der kommunalen oder sogar interkommunalen Entwicklung, erarbeitetwird, so dass beispielsweise durch eine unabgestimmte Ausweisung großflächigerGewerbegebiete drohende Funktionsverluste in der Innenstadt verhindert werden undstatt dessen eine gesamtstädtisch-integrierte Einzelhandelsentwicklung angestrebtwerden kann.Auch kann eine räumlich übergeordnete Betrachtung eventuell neue Entwicklungspotentialefür Kernbereiche aus der gesamtstädtischen Perspektive heraus erbringen.Städtische Entwicklungsprozesse sind gekennzeichnet durch eine komplexe Verschränkungverschiedenster Einflüsse. So gilt es beispielsweise im Falle <strong>von</strong> Kernbereichen,die positiven Aspekte, wie ihre zumeist hohe bauliche Dichte aber auch diekomplexe Verschränkung einer Vielzahl <strong>von</strong> Nutzungen und Nutzergruppen, ein erlebbaresNebeneinander <strong>von</strong> Einzelhandel, Wohnen, Kultur, Gastronomie, Dienstleistungenund Begegnungsorten im öffentlichen Raum zu bewahren, zu stärken und zu-<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 6
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereichekunftsgewandt weiterzuentwickeln. Chancen, die aus gesellschaftlichen, demographischenoder wirtschaftlichen Veränderungsprozessen erwachsen, wie beispielsweiseder in einer <strong>zur</strong> Dienstleistungsgesellschaft gewandelten Gesellschaft wachsendeBedarf an Flächen auch für Gesundheitswirtschaft, Freizeit und Kultur, gilt es zu identifizierenund mit Hilfe des <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes für die lokale Entwicklungdienstbar zu machen.Ziel ist es, mit den im <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzept formulierten Maßnahmen punktuelleInitialwirkungen zu erzeugen, die möglichst breit gefächerte Aktivitäten im Sinneder Zielrichtung des Konzeptes nach sich ziehen.Sektoraler Einbezug aller relevanten ThemenIm Rahmen des <strong>Erarbeitung</strong>sprozesses werden sektoral, also über alle Themenfelderhinweg alle für die Maßnahme relevanten Informationen zusammengetragen, bewertetund dienen als Grundlage <strong>zur</strong> Konzeptentwicklung. Die thematische Gesamtschauund der Einbezug aller relevanten Akteure sollen der Nachhaltigkeit der Maßnahmenim Sinne einer größtmöglichen Synergie und der Beförderung der dringlichsten undwichtigsten Entwicklungen dienen.Konkreter Gebietsbezug - GebietsabgrenzungEine Gebietsabgrenzung ist bei der <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> im Rahmen<strong>von</strong> Förderprogrammen der <strong>Integrierten</strong> Stadtentwicklung immer zwingend erforderlich.Hiermit wird der gebündelte und auf die wichtigsten Schwerpunktgebieteund –Themen fokussierte Einsatz der Mittel gewährleistet.Aus eben diesem Grund empfiehlt sich auch für die <strong>Erarbeitung</strong> Integrierter Handlungskonzepteaußerhalb <strong>von</strong> Förderprogrammen die klare Abgrenzung des Schwerpunktgebietesvom Umfeld.Räumliche Staffelung und integrierter AnsatzIntegrierte Handlungskonzepte sind in der bisherigen Praxis sowohl teilräumlich, gesamtstädtischals auch interkommunal als Planungsinstrument eingesetzt. Sie dienenals zusammenbindendes Instrument, das übergreifend alle bestehenden oder zukünftigenthematischen Teilkonzepte, wie beispielsweise Wohnraumversorgungs-, Bildungs-,Einzelhandels- und Verkehrsentwicklungskonzeptionen, und aktivierendeMaßnahmen und Programme, wie die Teilnahme an „Ab in die Mitte!“ oder Schaffungeines Business Improvement Districts (BID) zusammenbinden und in den gemeinsamenKontext einer integrierten Gesamtentwicklung stellen kann.Leitbildformulierung, Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldern und MaßnahmenDer Formulierung <strong>von</strong> Entwicklungsleitbildern kommt eine wichtige Funktion bei der<strong>Erarbeitung</strong> und Kommunikation der mit dem <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzept verfolgtenPlanungsziele zu. In einem sinnbildlichen Motto zusammengefasst kann ein Leit-<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 7
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereichebild die wesentlichen Ziele der Entwicklung für die nachfolgende Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldernund der darauf folgenden Zuordnung <strong>von</strong> Maßnahmen vorgeben.Fokussierter MitteleinsatzEin Grundprinzip der modernen, nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung istes, mit Hilfe <strong>von</strong> punktuellen Pilotprojekten eine möglichst breite Aktivierung <strong>von</strong> Akteurenund Finanzmitteln (privat, öffentlich, Förderprogramme) anzustoßen. Denn eingewecktes Engagement für das eigene Umfeld, den Stadtteil, die Gesamtstadt oderdie Region befördert auch eine dauerhafte Verstärkung der Identifikation mit demGebiet.BearbeitungsteamDie <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes stellt einen komplexen Arbeitsprozessmit einer Vielzahl <strong>von</strong> Abstimmungs- und Koordinierungsmaßnahmenund einem hohen Zeitbedarf für die inhaltliche Bearbeitung dar. Zudem handelt essich um Arbeitsprozesse, bei denen ein hohes Maß an Erfahrung im Umgang mit akteursbasiertenStadtentwicklungsprozessen ein Garant für eine erfolgreiche Konzeptionsein kann. Spezielle Kenntnisse in der Moderation und eine überdurchschnittlichgeschulte Sozialkompetenz sind weitere wichtige Vorraussetzungen. Auf diese Aufgabenspezialisierte externe Dienstleister haben den Vorteil, solche Prozesse nichtnur einmalig oder erstmalig durchzuführen, sondern auf einen über zahlreiche Projektegewachsenen Erfahrungsschatz <strong>zur</strong>ückgreifen zu können.Aufgrund der personellen Auslastung in den kommunalen Verwaltungen ist zu empfehlen,die Beauftragung eines externen Dienstleisters zu prüfen.Ein weiterer Vorteil liegt in der formalen Neutralität eines externen Dienstleisters, derbei schwierigen Vermittlungsprozessen die Rolle eines neutralen Moderators übernehmenkann.Auf jeden Fall ist zu empfehlen, entsprechend der großen thematischen Bandbreite,ein interdisziplinäres Team zu bilden oder zu beauftragen.Anforderungen an das Bearbeitungsteam• Interdisziplinäre Besetzung• Möglichst spezielle Schulung und Kenntnisse in der Moderation und Mediation• Erfahrung im Umgang mit komplexen, akteursbasierten Planungsprozessen• Hohe Anforderungen an zeitliche Ressourcen<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 8
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereiche2 Hauptteil – <strong>Erarbeitung</strong>s-<strong>Leitfaden</strong> Integrierte HandlungskonzepteDie Erstellung eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes gliedert sich in verschiedeneBearbeitungsphasen.Bearbeitungsphasen• Prozessstrukturierung• Analyse• Konzept• Beschluss• UmsetzungDiese sollen im Folgenden detailliert dargestellt werden.Meilensteine – verbindliche ZwischenschritteDas komplexe Zusammenspiel verschiedenster Akteure und Interessenlagen kanndie <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes in sensiblen Phasen der Erstellunggegebenenfalls schwierig gestalten und einen zügigen Prozessfortschritthemmen. Deshalb ist es zu empfehlen, den Abschluss der einzelnen <strong>Erarbeitung</strong>sphasenklar und deutlich zu kennzeichnen und zu kommunizieren. Beispielsweisekann eine Präsentation der Zwischenergebnisse in einer Lenkungsgruppe einen solchenMeilenstein darstellen. Hiermit kann eine Beschlussfähigkeit, auch <strong>von</strong> Teileneines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes ermöglicht werden.2.1 ProzessstrukturierungProzesstrukturierung - Arbeitsbausteine• Erste Problem- und Zielermittlung• Klärung der Eignung für eine Programmbewerbung• Erstellung eines Projekt-Zeitplans – Abschätzung der Dauer des <strong>Erarbeitung</strong>sprozesses• Prüfung der Beauftragung• Erststrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit• Einrichtung einer LenkungsgruppeDa es sich bei der <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes um einenkomplexen Planungsprozess mit einer Vielzahl <strong>von</strong> Beteiligten handelt, ist eine koordinierteStrukturierung bereits vor Planungsstart eine wichtige Basis.Erste Problem- und ZielermittlungVor einem Beschluss <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes stehtzumeist eine Problemverdichtung oder das Erkennen einer drohenden Abwärtsspirale.Probleme und Handlungsanlässe gehen dabei über baulich-räumliche Aufgabenweit hinaus. Dies erklärt auch die Querschnittsorientierung, die einem <strong>Integrierten</strong>Handlungskonzept zu Eigen ist. Hoch- und städtebauliche, soziale, demographische,gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturpolitische, interkulturelle, religiöse, touristi-<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 9
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereichesche, umwelt-, beschäftigungs- und bildungspolitische Themen, Fragen der Verkehrs-, Einzelhandels- und Gewerbeentwicklung, usw. – kurz alle, für das Untersuchungsgebietrelevante Themen müssen übergreifend analysiert, in der weiteren Entwicklungprognostiziert und in Bezug auf die zu lösenden Problemstellungen, soweit erforderlichkonzeptionell modifiziert werden.Eine anfängliche Erstbeschreibung des Anlasses, bzw. der Problemlage kann als Beschlussgrundlagedienen, je nach Umfang der zu untersuchenden Problemstellungenkann auch eine Voruntersuchung in Erwägung gezogen werden.ProgrammbewerbungIn der Anfangsphase ist zu prüfen, inwieweit sich die Problemstellung für die Bewerbungin einem Programm der Städtebauförderung eignet. Sollte das Integrierte Handlungskonzeptim Kontext eines Städtebauförderprogrammes erstellt werden, so fällt indiese erste Phase auch die Programmbewerbung. Die hierfür notwendige Antragsstellungbietet zumeist den ersten Anlass zu einer komprimierten Gesamtschau derSach- und Datenlage. Auch eine erste, vorläufige Gebietsabgrenzung ist Bestandteilder Programmbewerbung.Gleiches gilt für eine erste Definition inhaltlicher Ziele, auf Grundlage der dringlichstenProbleme. Alle diese Erstannahmen gilt es, im folgenden <strong>Erarbeitung</strong>sprozess zuverifizieren und gegebenenfalls zu korrigieren oder zu ergänzen.Die Projektbeantragung erfolgt durch die Kommune, dem Entschluss zu einem solchenSchritt kann aber idealerweise bereits eine Abstimmung mit lokalen Akteuren,wie Wohnungsbaugesellschaften, Einzelhandelsverbänden, lokalen Wirtschaftsunternehmenoder Initiativen vorausgehen.Wichtig ist auch, rechtzeitig bereits zu Projektbeginn die Förder- und Vergaberichtliniendes jeweiligen Programmes zu berücksichtigen.Programmbewerbung (im Falle der Teilnahme an einem städtebaulichen Förderprogramm)• Problembeschreibung• Komprimierte Sachstands- und Datenermittlung• Erste Ziel- und Maßnahmendefinitionen• Vorläufige Gebietsabgrenzung• Erste KostenschätzungenErstellung eines Projekt-ZeitplansUm eine Verbindlichkeit und einen Rahmen für den <strong>Erarbeitung</strong>sprozess zu definieren,ist die Erstellung eines <strong>Erarbeitung</strong>szeitplans vor Projektbeginn sinnvoll. EineAbstimmung eines verbindlichen Zeitplans zu Projektbeginn zwischen dem Bearbeitungsteamund der Kommune, ganz gleich, ob es sich um einen externenDienstleister oder ein Team der kommunalen Verwaltung handelt, schafft Planungssi-<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 10
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereichecherheit auf beiden Seiten. Zudem ist so die frühzeitige Koordination der Beteiligungauf den unterschiedlichen Ebenen möglich.Deshalb ist die Erstellung eines solchen Projekt-Zeitplans auch bei Projekten außerhalb<strong>von</strong> Förderprogrammen zu empfehlen. Aus dem Erfahrungsschatz der bestehendenFörderprogramme der <strong>Integrierten</strong> Stadtentwicklung ist bei geförderten Projektenmittlerweile die bindende Verpflichtung erwachsen, Integrierte Handlungskonzepteinnerhalb des ersten Jahres nach Programmaufnahme zu erstellen. Dies dientletztendlich dem zügigen Start des Bearbeitungsprozesses und dementsprechenddem Einsetzen baldiger positiver Entwicklungen innerhalb des Programmgebietes.Dauer des <strong>Erarbeitung</strong>sprozessesJe nach Größe des Projektgebietes und inhaltlichen Umfang des Planungsanlassessollte für die <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes mindestens ein halbesJahr bei kleinen, teilräumlichen Projekten, durchschnittlich aber eher ein einjährigerProzess eingeplant werden.Die <strong>Erarbeitung</strong> sollte effizient und zügig erfolgen. Für einen gründlichen Prozess mitumfangreicher Beteiligung und Datenauswertung hat sich dieser Zeitraum in der Praxisals realistisch erwiesen.Erststrukturierung der ÖffentlichkeitsarbeitDer <strong>Erarbeitung</strong>sprozess sollte mit einer parallelen Öffentlichkeitsarbeit flankiert werden.So können Ziele und Inhalte frühzeitig kommuniziert und die Öffentlichkeit <strong>zur</strong>Beteiligung animiert werden. Geeignete Maßnahmen müssen auf das lokale Projektangepasst werden. Regelmäßige Pressemitteilungen zu Meilensteinen der <strong>Erarbeitung</strong>,die Einrichtung einer Website und gegebenenfalls besondere Öffentlichkeitsmaßnahmen,wie Aktionen oder Veranstaltungen können diesem Zweck dienen. ÜberMöglichkeiten <strong>zur</strong> Schaffung einer unverkennbaren Gebietsidentität, wie der Förderungeiner einheitlichen Gestaltung, beispielsweise in Kernbereichen oder Ladenstraßensowie der Entwicklung gemeinsamer Kommunikationsinstrumente, wie beispielsweiseLogos, ist an dieser Stelle nachzudenken.Prüfung der BeauftragungVor der <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes ist in jedem Fall zu prüfen,ob eine interne Bearbeitung <strong>von</strong> den personellen Kapazitäten gewährleistet werdenkann, oder ob die Beauftragung eines externen Dienstleisters (siehe Kapitel 1.3. -Bearbeitungsteam), <strong>zur</strong> Entlastung der kommunalen Verwaltungsmitarbeiter und <strong>zur</strong>Gewährleistung eines zügigen und interessenneutralen <strong>Erarbeitung</strong>sprozesses Vorteilebietet. Eine solche Prüfung sollte ergebnisoffen und im Rahmen eines fairen Dialogsmit den zuständigen Stellen erfolgen.Lenkungsgruppe<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 11
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheEin wichtiger Schritt, der bereits zu Beginn des <strong>Erarbeitung</strong>sprozesses koordiniertwerden sollte, ist die Einrichtung einer fachübergreifenden Lenkungsgruppe. In denProgrammen Stadtumbau und Soziale Stadt wird eine Zusammensetzung empfohlen,die möglichst einen repräsentativen Querschnitt der zu beteiligenden Interessengruppen,Fachdisziplinen und Themenfelder bildet. Im Sinne einer integrierten Stadtentwicklungsind deshalb neben Vertretern aus Politik und den relevanten Fachämternauch Vertreter aus Handel, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der Lenkungsgruppe zubeteiligen.Die Lenkungsgruppe dient der inhaltlichen Ergänzung und Abstimmung des Planungsprozesses,sowie der Gewährleistung <strong>von</strong> Informationsaustausch und Informationsflusszwischen den Prozessbeteiligten.Es ist im Einzelfall abzuwägen, wie diversifiziert eine Lenkungsgruppe zu besetzenist. An dieser Stelle ist lediglich anzumerken, dass eine große Gruppe, die eine kontinuierlicheumfassende Beteiligung relevanter Vertreter aller Sektoren sicherstellt, einengroßen Vorteil bedeuten kann, da hierdurch eine breite Zustimmung zum <strong>Integrierten</strong>Handlungskonzept kontinuierlich und frühzeitig erwirkt werden kann. Andererseitsstößt man bei einer umfassenden Besetzung schnell auf Teilnehmerzahlen, dieeine effiziente Diskussion und Abstimmung, bzw. eine gemeinsame Terminfindungkaum noch steuerbar machen. Zudem muss individuell entschieden werden, welchesMaß an Beteiligung in dieser Form zweckdienlich und gewünscht und welches eherals aus der lokalen Erfahrung heraus als hinderlich eingeschätzt wird.LenkungsgruppeZusammensetzung• Interdisziplinäre und an Schwerpunktthemen orientierte Zusammensetzung• Vertreter aus allen 3 Sektoren – Politik, Verwaltung, Wirtschaft und ZivilgesellschaftAufgaben• inhaltliche Ergänzung und Abstimmung des Planungsprozesses• Gewährleistung <strong>von</strong> Informationsaustausch und Informationsfluss zwischen denProzessbeteiligten2.2 AnalysephaseAnalysephase - Arbeitsbausteine• Sektorale Grundlagenermittlung und Auswertung• Integrierte Datenkorrelation in Rückkopplung zwischen Projektgebiet und Umfeld• Szenarienentwicklung und Prognosen• Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken –Bewertung (SWOT-Analyse)• AkteursbeteiligungGrundlagenermittlung und Auswertung<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 12
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheDie Ermittlung und Auswertung relevanter Daten bildet den Arbeitsinhalt der Analysephase(siehe Infobox Analysephase – Themenfelder und Datenquellen). Zurückgegriffenwird hierbei auf Datenbestände aus der kommunalen Verwaltung, <strong>von</strong> relevantenEinrichtungen und Wirtschaftseinheiten und Vertretern der Zivilgesellschaft, wiez.B. Vereine oder Verbände. Ebenfalls einbezogen werden relevante Daten <strong>von</strong>räumlich übergeordneten Stellen (Kreis, Land, Bund). Ausgewertet werden sowohlstatistische Daten, als auch bestehende Konzeptionen, Planungen und Untersuchungen.Auch übergeordnete Studien, wie z.B. bundesweite Untersuchungen <strong>zur</strong> demographischenEntwicklung müssen themenspezifisch Berücksichtigung finden, umauch unabhängig <strong>von</strong> der lokalen Ebene wichtige Entwicklungen im globalen Kontext,die Auswirkungen auf das lokale Handeln haben, mit einzubeziehen.Bei komplexen Sachverhalten und / oder mangelnder Datenlage zu essentiellenThemenfeldern muss gegebenenfalls der Bedarf einer Primärerhebung geklärt werdenund eine solche zusätzlich beauftragt werden.Die sektorale Betrachtung steht dabei immer unter dem Tenor der integrierten Gesamtschaudes Projektgebietes und seines Umfeldes. In dieser Arbeitsphase geht esum die Konkretisierung, Belegung, bzw. Korrektur und Anpassung der ursprünglichenAnnahmen, die Anlass <strong>zur</strong> Erstellung des Konzeptes sind. Zudem ermöglicht eine detaillierteund umfassende Gesamtbetrachtung die Identifikation neuer, bislang unbekannterChancen aber auch <strong>von</strong> möglichen Problemfeldern und bewirkt ein vertieftesVerständnis der Zusammenhänge und Hintergründe für die auftretenden Probleme.Eine zielorientierte Auswertung in Bezug auf die spezifische Sachlage vor Ort sollteHandlungsgrundsatz sein. Die reine Anhäufung <strong>von</strong> Daten alleine ist nicht zielführend.Analysephase – Themenfelder und DatenquellenGrundlagenermittlung sektoral - Themenfelder• Bevölkerung, demographische Besonderheiten, spezielle Zielgruppen• Wirtschaftsstruktur, Einzelhandel, Dienstleistung, Kaufkraft• Wohnen• Freizeit, Kultur, Sport, Tourismus• Soziale und stadttechnische Infrastruktur• Genius Loci - Stadträumliche Qualität, baukulturelle Identität, historischeOrtsprägung• Freiraum und Aufenthaltsqualität• Immobilienmarkt• Verkehr und Erreichbarkeit• Sozialstruktur, Integration• Umwelt• Übergeordnete Planungen und Programme• Gegebenenfalls weitere lokale Themenfelder<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 13
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheDatenquellen (Auswahl muss lokal angepasst werden)• kommunale Datenbestände• relevante Einrichtungen des Sektors Wirtschaft wie beispielsweise IHK• relevante Einrichtungen der Zivilgesellschaft, wie Sozialverbände, etc.• relevante Daten <strong>von</strong> räumlich übergeordneten Stellen (Kreis, Land, Bund)• relevante übergeordnete Untersuchungen wie Demographieberichte, FamilienundZielgruppenstudien, etc.• statistische Daten• Konzeptionen, Planungen und UntersuchungenSzenarienentwicklung und PrognosenEbenfalls <strong>zur</strong> Analysephase gehört die perspektivische Prognose der analysiertenFakten, sowie die Vernetzung mit zukünftig anstehenden Entwicklungen oder bekannten,zu erwartenden Einflüssen <strong>von</strong> außen. Dies können beispielsweise zu erwartendepositive und negative Auswirkungen einer großen, übergeordnet geplantenInfrastrukturmaßnahme oder das Wissen um die perspektivische Verlagerung oderAufgabe <strong>von</strong> wichtigen Produktions- oder Einzelhandelsstandorten sowie gesamtgesellschaftlicheoder demographische Entwicklungen sein.Eventuell ist die Entwicklung <strong>von</strong> Szenarien notwendig, um mögliche Entwicklungslinienfür das Untersuchungsgebiet abzubilden und in einer Diskussion gegeneinanderabzuwägen.Hierbei werden Grundannahmen für eine mögliche Entwicklung gesetzt und die Effekteauf die weitere Gebietsentwicklung in Form eines Szenarios skizziert. Gebräuchlicherweisewerden mindestens drei verschiedene Szenarien entwickelt:• Eine <strong>von</strong> der bisherigen Entwicklung abweichende Positiventwicklung (Boomszenario).• Eine Entwicklung ohne große Veränderungen in Form einer linearen Fortschreibungder analysierten Entwicklungen (Trendszenario).• Eine Entwicklung, die Möglichkeiten einer anhaltenden Negativentwicklung untersucht(Negativszenario).Im Bedarfsfall können insbesondere <strong>zur</strong> Einschätzung <strong>von</strong> Problemlagen auch mehrereNegativszenarien in unterschiedlichen Abstufungen untersucht werden.Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken –Bewertung (SWOT-Analyse)Ziel der Analyse ist die Abwägung <strong>von</strong> Stärken und Schwächen, Chancen und Risikenfür die Entwicklung eines Untersuchungsgebietes. Diese ursprünglich aus derBetriebswirtschaft stammende Betrachtungsweise kann auf Grundlage der analysiertenDaten, ergänzenden Informationen der lokalen Akteure sowie möglicher Prognosenerstellt werden. Sie bildet zusammenfassend die Bewertung der analysiertenFakten ab.<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 14
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheStärken-Schwächen-Analyse als objektivierte Grundlage <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>von</strong> StandortenQuelle: Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbHAkteursbeteiligungNeben der Auswertung <strong>von</strong> Informationen in Text und Bild ist der Einbezug lokalerAkteure in der Analysephase essentiell, um ein umfassendes und vor allem vollständigesBild erhalten zu können. Die Vertreter <strong>von</strong> Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaftsind hier als die lokalen Experten zu sehen, die in der Summe ihres jeweilsspezifischen Detailwissens einen unschätzbaren Wert als Informationsquelle darstellen,das oftmals auch die besten Statistiken oder theoretischen Studien nicht adäquatabbilden können.Art und Maß der Beteiligung ist wiederum <strong>von</strong> der spezifischen Aufgabenstellung abhängig.Die Beteiligung ist auch deshalb <strong>von</strong> grundlegender Bedeutung, weil einePlanung ohne die Kenntnis der Interessenlage der „Beplanten“ zu keiner Akzeptanzführen kann. Die mit einem <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzept verfolgten Ziele könnennur erreicht werden, wenn sie <strong>von</strong> der breiten Mehrheit, der das Projektgebiet als Lebens-,Arbeits-, oder Erlebnisraum nutzenden Personen mitgetragen werden. Es istdeshalb <strong>von</strong> Anbeginn zu planen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form die gesamteÖffentlichkeit in die Information und Beteiligung einbezogen werden soll.Durch die Beteiligung in der Analysephase soll also letztendlich ein Abgleich und eineErgänzung des Analyseergebnisses erreicht werden. Dementsprechend empfiehltsich zeitlich die Einbindung eines größeren Beteiligungsbausteins in den <strong>Erarbeitung</strong>sprozess,nachdem die theoretische Datenermittlung bereits fortgeschritten ist.Nach der Einarbeitung der Ergebnisse der Beteiligung erfolgt die vorläufige Fertigstellungdes Analyseteils. Eine regelmäßige Rückkopplung der Arbeitszwischenständemit der in Kapitel 2.1. beschriebenen Lenkungsgruppe sollte zu diesem Zeitpunkt bereitsetabliert sein. Die Präsentation eines vorläufigen Analyseergebnisses in derLenkungsrunde kann als Meilenstein für das Ende der Analysephase stehen.<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 15
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheMögliche Formen der Beteiligung (Auswahl)• Kontinuierliche Beteiligung ausgewählter Vertreter in einer Lenkungsgruppe oderin einem Arbeitsausschuss• Beteiligung <strong>von</strong> lokalen Experten (als Orientierung kann eine Auswahl aus derListe der Träger öffentlicher Belange dienen) in Form eines oder mehrererWorkshops• Einbezug der gesamten Öffentlichkeit im Rahmen eines oder mehrererWorkshops• Einbezug der Öffentlichkeit im Rahmen einer Informations- und Diskussionsveranstaltung• Befragung bestimmter Zielgruppen (Bewohner, Einzelhändler, etc.) mittels einesindividuellen Fragebogens• Durchführung <strong>von</strong> Experteninterviews2.3 KonzeptphaseKonzeptphase - Arbeitsbausteine• Leitbildentwicklung• Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldern• Maßnahmenformulierung• Maßnahmenpriorisierung und Initialprojekte• Zeit-Maßnahmen und Finanzierungsplanung• Endgültige Gebietsabgrenzung• Aufbau und Förderung <strong>von</strong> Beteiligungsstrukturen• Akteursbeteiligung• (gegebenenfalls Abstimmung mit dem Programmträger)• Überarbeitung und Gremienbeteiligung• Einbindung der Öffentlichkeit• Bindender Beschluss des Konzeptes durch die kommunale PolitikLeitbildentwicklungFür das gesamte Untersuchungsgebiet ist die Definition eines übergeordneten Leitbildesein wichtiger Schritt. Einerseits wird hiermit die übergeordnete Zielrichtung determiniert,andererseits ist ein Leitbild ein wichtiger Baustein <strong>zur</strong> Visualisierung und Kommunikationder Planungsziele in der Öffentlichkeit und bei den Planungsbeteiligten.Handlungsfelder und Leitbild sind unbedingt in der Lenkungsgruppe und mit den lokalenAkteuren abzustimmen.Definition <strong>von</strong> HandlungsfeldernAuf Grundlage der Analyse bildet die Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldern zusammen mitder vorstehenden Leitbildentwicklung die Überleitung <strong>zur</strong> Konzeptphase. Hier solltensich die ermittelten wesentlichen Handlungserfordernisse widerspiegeln – thematischsinnvoll gebündelt. Die Definition <strong>von</strong> Handlungsfeldern geht einher mit der Formulierung<strong>von</strong> übergeordneten Zielen für das Untersuchungsgebiet. (Eine Orientierung bezüglichrelevanter Handlungsfelder kann die Liste der Themenbereiche in der InfoboxAnalysephase – Themenfelder und Datenquellen geben.)<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 16
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheMaßnahmenformulierungNach der Rückkopplung der identifizierten Handlungsfelder und des Leitbildes in derLenkungsgruppe werden in einem nächsten Schritt zielführende Maßnahmen zu denHandlungsfeldern erarbeitet. Neben im Rahmen der Konzepterarbeitung entstandenenMaßnahmenvorschlägen, können auch bereits angedachte oder geplante Maßnahmen,die <strong>zur</strong> Erreichung der im Handlungskonzept formulierten Ziele zweckdienlichsind in das Konzept integriert werden. Was im Falle einer ProgrammteilnahmeVorraussetzung für die Förderfähigkeit ist, sollte auch bei außerhalb <strong>von</strong> Städtebauförderungsprogrammenentwickelten <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> beachtet werden:Bei der Auswahl der Maßnahmen sollte berücksichtigt werden, dass es sich umProjekte handelt, die noch nicht begonnen sind, um eine Übereinstimmung mit denGrundsätzen und den Zielen des Handlungskonzeptes zu gewährleisten. Als Leitsatzkann darüber hinaus das Prinzip gelten, dass die Maßnahmen dem Allgemeinwohlund der Gebietsentwicklung dienen müssen. Im Falle einer Förderung zudem, dasses sich um unrentierliche Maßnahmen handelt, d.h., dass kein direkter privatwirtschaftlicherGewinn aus einer mit öffentlichen Geldern finanzierten Maßnahme erwächst.Maßnahmenpriorisierung und InitialprojekteBei der Auswahl der Maßnahmen gilt das Prinzip der Priorisierung. Bei der Einschätzungder Bedeutung einer geplanten Maßnahme ist sowohl ein größtmöglicher Effektfür das zu überplanende Gebiet, als auch das Verhältnis <strong>von</strong> Aufwand und Nutzenentscheidend – sowohl den fiskalischen Aufwand betreffend, als auch den Zeitbedarfund die Komplexität des Abstimmungsaufwandes. Wichtig ist, dass zeitnah nach Fertigstellungdes <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes eine öffentlichkeitswirksame Initialmaßnahmerealisiert werden kann, um den Entwicklungsprozess mit seinen Zielenund Handlungsfeldern im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Einerseits als einsichtbares Zeichen <strong>von</strong> Veränderung und darüber hinaus, um Unterstützung und Akzeptanzfür das Projekt zu fördern.Strukturwandel bewältigen – Versorgungsfunktion stärkenQuelle: Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 17
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheZeit-Maßnahmen-Planung und Kosten-FinanzierungsplanFür die integrierte Abstimmung der Einzelmaßnahmen untereinander und mit den Zielendes Handlungskonzeptes ist die Erstellung eines Zeit-Maßnahmen-Planes für dieUmsetzungsphase erforderlich. Hier werden die Priorität der sektoralen Projekte unddie zeitliche Abfolge sowie das Ineinandergreifen <strong>von</strong> Maßnahmen veranschaulichtund erarbeitet.Analog <strong>zur</strong> zeitlichen Abstimmung der Einzelmaßnahmen im Gesamtkontext ist die<strong>Erarbeitung</strong> eines Kosten-Finanzierungsplans für die Umsetzung notwendig.Es bietet sich an, eine Übersichtsplanung für die ersten fünf Jahre der Umsetzungdes Handlungskonzeptes und eine detaillierte Planung für das erste Realisierungsjahrzu erstellen.GebietsabgrenzungDie bereits in Kapitel 2.1. erwähnte vorläufige Gebietsabgrenzung kann während des<strong>Erarbeitung</strong>sprozesses angeglichen werden. D.h. es kann neuen identifizierten räumlichen,bzw. Nutzungszusammenhängen Rechnung getragen werden, es kann sichaber auch die Wiederausgliederung eines Teilgebietes als sinnvoll erweisen. Eventuell,weil sich der Einbezug als nicht notwendig oder zweckdienlich erwiesen hat oderauch, weil eine Eignung des entsprechenden Teilbereiches für eine spezielle Fördermaßnahmeder Städtebauförderung erkannt wurde.Aufbau und Förderung <strong>von</strong> BeteiligungsstrukturenHandelt es sich um ein Gebiet, in dem bislang nur wenige formelle und informelleStrukturen <strong>zur</strong> gemeinsamen Zusammenarbeit existieren, empfiehlt es sich, bei derPriorisierung <strong>von</strong> Maßnahmen weniger komplexe Teilprojekte für den Beginn derUmsetzung zu wählen. Eine zügige, zielführende und erfolgreiche Zusammenarbeitist motivierend und kann einen wichtigen Prozess darstellen, um zwischen den BeteiligtenVertrauen zu stärken und eventuelle Vorbehalte abzubauen.Abstimmung und BeteiligungGenau wie in der Analysephase ist der kontinuierliche Abgleich und die Rückkopplungdes Bearbeitungsstandes der Konzeptentwicklung wichtig. Im Projektzeitplansollten für die Konzeptphase mindestens zwei Lenkungsgruppensitzungen eingeplantwerden. Üblicherweise beinhaltet ein Termin die Abstimmung <strong>von</strong> Leitbild, Handlungsfeldernund ersten Maßnahmenkonzeptionen. In einem zweiten Termin solltendann die konkreten Maßnahmenvorschläge, das Zeit-Maßnahmen-Raster und die Finanzierungsplanungabgestimmt werden. Besonders bei der Auswahl und Priorisierung<strong>von</strong> Maßnahmen ist die aktive Mitarbeit der Lenkungsgruppe als Expertengremiumgefragt.Auch die Durchführung eines Konzeptworkshops mit sektoralen Themenexpertensollte Bestandteil der Konzeptphase sein. Bei dem gemeinsamen Planungstreffen mit<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 18
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheVertretern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung sollte ein Abgleich und eineErgänzung der Konzeptinhalte erfolgen. Es empfiehlt sich, hierfür einen Zeitpunktim hinteren Teil der Konzeptphase zu wählen, um anhand <strong>von</strong> möglichst konkretenInhalten und Maßnahmen diskutieren zu können.Abstimmung mit dem Fördermittelgeber (im Falle einer Programmteilnahme)Spätestens in der Phase der Umsetzung des <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes wirdes projekt- und verfahrensbezogen Abstimmungsbedarf mit dem Programmträger, alsodem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung geben.Grundsätzlich steht <strong>zur</strong> Beratung in Detailfragen das Kompetenzzentrum derHessen Agentur <strong>zur</strong> Verfügung.Die Erfahrungen in den Programmen Soziale Stadt und Stadtumbau haben gezeigt,dass eine frühzeitige inhaltliche Abstimmung in der Konzeptphase, insbesonderebeim Thema der Fördergebietsabgrenzung und der Wahl <strong>von</strong> Initialprojekten sinnvollist und <strong>von</strong> Seiten des Ministeriums begrüßt wird. Auch die vorläufige Endfassungdes Konzeptes sollte vor der Abstimmung auf der lokalen politischen Ebene dem Programmträgervorgestellt werden.Ist eine Programmaufnahme bereits vor der <strong>Erarbeitung</strong> des <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzepteserfolgt, liegt die erste reguläre Beantragung <strong>von</strong> Fördermitteln für das Projektaufgrund der üblichen Terminfolge vermutlich in der Bearbeitungsphase.In diesem Fall ist eine Abstimmung der hierfür ausgewählten Teilprojekte und Maßnahmenmit dem Fördermittelgeber zu empfehlen. Vorraussetzung für den Mittelantragist eine mit dem Programmträger abgestimmte vorläufige Gebietsabgrenzung.Grundsätzlich ist eine offene Diskussion mit den Zuständigen des Ministeriums undder Hessen Agentur bei Sachverhalten, zu denen in den einschlägigen Richtlinienkeine eindeutige Regelung getroffen werden kann oder bei komplexen, bzw. brisantenVerfahren und Maßnahmen im Zweifelsfall immer zu empfehlen, um ReibungsundEffizienzverluste zu vermeiden.Überarbeitung und GremienbeteiligungNach den Beteiligungs- und Abstimmungsprozessen erfolgt eine Einarbeitung der Anregungenund Ergänzungen in das Konzept. Eine zweite inhaltliche Überarbeitungdes dann vollständigen Konzeptes in Rohfassung empfiehlt sich nach einer Präsentationdes fertigen Konzeptes in den Gremien, das heißt in den Fraktionen und demMagistrat, gegebenenfalls in Fachausschüssen. Je nach Sensibilität und Brisanz derbearbeiteten Themen ist festzulegen, inwieweit eine Vormoderation auch auf fraktionellerEbene oder in der Stadtverordnetenversammlung erforderlich ist. Normalerweiseerfolgt die Präsentation in Form einer Druckfassung, die <strong>von</strong> den Gremien geprüftund mit Anregungen versehen wird. Eine Vortrags-Präsentation im Magistrat ist hingegenobligatorisch. Vor der Rückkopplung auf der politischen Gremienebene ist die<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 19
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereichevorläufige Endfassung unbedingt mit der Lenkungsrunde abzustimmen. Inwieweit einefrühzeitige und wiederkehrende Information der politischen Gremien oder einzelnerSchlüsselpersonen lokal sinnvoll ist, ist abzuwägen. Wie bereits erwähnt kanndies der frühzeitigen politischen Sicherung der Maßnahme dienen, bedeutet aber einenwesentlich höheren Abstimmungs-, Koordinierungs- und Zeitaufwand. Eventuellkann eine zu frühe Information aber auch zu einer Auffaserung des Konzeptes führen,bevor dies in einer integrierten Vollständigkeit seine überzeugende Wirkung entfaltenkann.Ebenen der Abstimmung und Akteursbeteiligung• (Der Fördermittelgeber und Programmträger – im Falle einer Programmbeteiligung)• Politische Entscheidungsträger• Vertreter der relevanten Fachämter• Alle relevanten Vertreter der drei Sektoren im Planungsgebiet• Vertreter lokaler Verbände und Institutionen• Formelle und informelle lokale Gruppierungen, wie Interessengruppen und Initiativen• Die (gebietsbezogene) Öffentlichkeit2.4 Fertigstellung und UmsetzungVorbereitung der Umsetzung• Verstetigung der Lenkungsgruppe als Arbeitsrunde• Einrichtung eines extern beauftragten oder internen Projektmanagements• Vorbereitung und Durchführung eines Initialprojektes• Gegebenenfalls Einrichtung eines lokalen ProjektbürosBeschlussNach der Abstimmung auf politischer Ebene erfolgt eine letzte Überarbeitung durchIntegration der Rückmeldungen in das Konzept. Verabschiedet wird das IntegrierteHandlungskonzept durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, bzw.des Gemeinderates. Hiermit erhält es seine bindende Wirkung.Vorbereitung, Strukturierung und Beginn der UmsetzungsphaseZu empfehlen ist eine Verstetigung der Lenkungsgruppe als permanente Arbeitsgruppefür die Umsetzungsphase, gegebenenfalls mit einer modifizierten Besetzung.Vor der Einsetzung eines Managements <strong>zur</strong> Steuerung der Umsetzung ist zu prüfen,ob die Funktion eines permanenten Managements verwaltungsintern erfolgen kannoder ob die Beauftragung eines Dienstleisters mit Erfahrung in der Umsetzung sinnvollerist.Wichtig ist, dass sich möglichst schon in der Phase der Konzepterarbeitung ein Steuerungsteametabliert, das sich als lokaler Ansprechpartner frühzeitig etabliert - Personalisierungschafft Vertrauen. Zu diesem Zweck hat sich in anderen Programmen<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 20
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereicheder <strong>Integrierten</strong> Stadtentwicklung die Einrichtung eines lokalen Projektbüros im Fördergebietbewährt. Je nach Bedarf sollten dort regelmäßige Projektsprechzeiten angebotenwerden. Ein Projektbüro dient als räumliche Verortung der Gesamtmaßnahmeund sollte als Tagungsort für alle Arten <strong>von</strong> Arbeitsgruppen und Besprechungenin der Umsetzung genutzt werden.Auf die Durchführung eines Initialprojektes zum Start der Umsetzungsphase als öffentlichkeitswirksameMaßnahme und Signal des Aufbruchs wurde bereits im Kapitel„Konzeptphase“ eingegangen.Evaluation und AbrechnungEine Evaluation der Gesamtmaßnahme ist für alle Arten <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong>,gleich ob innerhalb oder außerhalb <strong>von</strong> Förderprogrammen zu empfehlen.Sie dient der selbstkritischen Bewertung und Einschätzung der Erfolge der Maßnahmen.Somit kann die Gesamtmaßnahme den Erfahrungen entsprechend im Laufe derDurchführung angepasst und verbessert werden.Im Falle einer Förderung dient die Evaluation gleichsam auch der Dokumentation gegenüberdem Fördermittelgeber. In diesem Fall muss auch der zweckgebundene undrichtliniengetreue Einsatz <strong>von</strong> Fördermitteln nachgewiesen werden. Die Abrechnungsollte zeitnah im Jahresturnus erfolgen.Eine treuhänderische Fördermittelverwaltung inklusive Abrechnung der Maßnahmelässt sich auch durch die Beauftragung eines entsprechenden Dienstleisters aus demverwaltungsinternen Tagesgeschäft auslagern.Förderung (im Falle einer Programmteilnahme)Da es sich bei den Programmen der modernen Städtebauförderung um Impulsförderprogrammehandelt, kann die frühzeitige Identifizierung <strong>von</strong> strategischen Partnerschaften<strong>zur</strong> Finanzierung und Durchführung <strong>von</strong> Maßnahmen mit lokalen Akteurenaus der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft sowie die Identifizierung <strong>von</strong> geeignetenKomplementär-Förderprogrammen bereits ein Baustein im Rahmen der <strong>Erarbeitung</strong>eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes bilden. Zumindest bildet das IntegrierteHandlungskonzept eine wichtige Basis, um in der Umsetzungsphase dieser Aufgabenachzukommen.Mögliche Arbeitsbausteine der Umsetzung• Prozesssteuerung, Moderation, ggf. Finanz- und Fördermittelmanagement• Akquisition zusätzlicher Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten• Öffentlichkeitsarbeit• Ordnungsmaßnahmen• Initiierung und Steuerung <strong>von</strong> Initiativen und Projekten wie BID und „Ab in die Mitte!“• Modernisierungs- und Baumaßnahmen• Evaluierung und Erfolgskontrolle<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 21
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereiche2.5 AusblickIm Bearbeitungs- und Umsetzungsprozess sollten aktuelle Entwicklungen Berücksichtigungfinden. Beispielsweise findet aktuell das Thema Energieeffizienz undnachhaltige Strategien in Hoch- und Städtebau allerorten Eingang in die Diskussion,die Planung und die Maßnahmensteuerung.Auch eine attraktive, aktivierende und identifikationsfördernde Prozessgestaltung solltegewährleistet werden. Beispielsweise gibt es aktuell erste Pilotprojekte virtuellerBeteiligungsmodelle in Planungsprozessen (vgl. Hessische GemeinschaftsinitiativeSoziale Stadt – Projektgebiet Neu-Isenburg Stadtquartier West).Eine kontinuierliche Integration neuester Entwicklungen und Methoden in den Planungs-und Umsetzungsprozess kann erfolgsfördernd auf das Projekt wirken und zueinem zukunftsgewandten Image beitragen. Die Gewährleistung einer Arbeitsweiseauf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik ist eventuell durch einen externenDienstleister, der sich kontinuierlich mit der Entwicklung und Anwendung neuerMethoden beschäftigt einfacher zu erbringen.<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 22
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereiche3 bestpractice-BeispieleTeilräumliche Projektbeispiele - Soziale StadtRüsselsheim Dicker BuschKategorie:Auftraggeber:Bearbeitung:teilräumliches Integriertes HandlungskonzeptStadt Rüsselsheim<strong>Erarbeitung</strong> des <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptesdurch Fr. Scheiblauer, FH-Frankfurt, FB Architektur (städtebaulicherTeil), Hr. Prof. Dr. Dilcher (Gemeinwesenarbeit)Quartiersmanagement – Koordination und Leitung, 1999 –2007 Hr. Schiermer, Architekt + Stadtplaner, ab 2007 NeueWohnraumhilfe Darmstadt, Gemeinwesenarbeit und Büroorganisationseit 1999 durch den Kinderschutzbund e.V.Ziel des Programms ist die Stabilisierung und städtebauliche Weiterentwicklung desStadtteils aus den 1960er Jahren. Eine Reihe <strong>von</strong> Konflikten im Stadtteil und ein sehrschlechtes Image als Wohnstandort waren Anlass <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> und Umsetzungeines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes. Es handelt sich um eines der ersten Projekteder Sozialen Stadt in Hessen. Die Schwerpunkte im Bereich der städtebaulichenEntwicklung liegen in der Verbesserung des Wohnumfeldes und der Erhöhung derAufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, insbesondere für Kinder- und Jugendliche.Hierzu zählen Maßnahmen, wie die Aufwertung der Hauseingangsbereiche und dieUmgestaltung <strong>von</strong> Spielplätzen und Treffpunkten. Die Aufenthaltsorte wurden in Form<strong>von</strong> Beteiligungsprojekten umgestaltet. Das Stadtteilzentrum wurde in Zusammenarbeitmit Einzelhändlern umgestaltet. Beispiele für die integrierte Kombination <strong>von</strong> investivenund nicht-investiven Maßnahmen stellt das so genannte Taschengeldprojektdar - Jugendliche sorgen für die Sauberkeit im neuen Einkaufszentrum, sowie Patenschaftenfür die umgestalteten Spielplätze. Als eines der letzten und wichtigsten Projekteim Rahmen der Förderung befindet sich <strong>zur</strong>zeit ein Stadtteiltreff in Zusammenarbeitmit der Caritas im Aufbau. Dieses Projekt ist <strong>von</strong> zentraler Bedeutung für dieVerstetigung der Maßnahmen nach Ablauf der Förderzeit – 2008 ist das letzte Projektjahr.Zur Verstetigung wurde auch ein Verein <strong>zur</strong> Fortsetzung der Quartiersmanagementaktivitätengegründet. Die Grundfinanzierung erfolgt über den Erlös <strong>von</strong> Solarstromeiner PV-Anlage auf dem Dach des Vereinssitzes. Ein wichtiges Projekt imBereich sozialer Sicherheit bildet ein Conciergemodell, das ebenfalls über die Projektlaufzeithinaus fortgeführt werden soll. Einen großen Schwerpunkt im nichtinvestivenBereich bildet eine integriert-abgestimmtes Bündel vieler kleiner einzelnen und aktivierendenLOS-Projekte, die einem Gesamtkonzept folgen. Alle Projekte zielen daraufab, die Identifikation der Bürger mit ihrem Stadtteil zu stärken. Die wichtigstenjüngsten Projekte hierbei sind unter anderem ein Aktivierungs-Projekt für die wachsendeZahl <strong>von</strong> Migranten-Senioren, der Aufbau eines Gesundheitsnetzwerkes –speziell für bildungsferne Schichten <strong>zur</strong> Förderung eines Ernährungs- und Sportbewusstseins.Ansprechpartner: Herr Schuh, Bereich Umwelt und Planung, Stadt Rüsselsheim<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 23
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheÖstliche Innenstadt OffenbachKategorie:Auftraggeber:Bearbeitung:Integriertes Handlungskonzept für ein teilräumliches,innerstädtisches KerngebietStadt Offenbach2001/2002 <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptesdurch die NH | ProjektStadt / Nassauische Heimstätte Wohnungs-und Entwicklungsgesellschaft mbHProjektmanagement durch die NH | ProjektStadtTypisches Beispiel für ein innerstädtisches Quartier mit heterogenen, komplexenProblemlagen. Ziele und Erfolge sind die Verringerung der Mieterfluktuation, Verbesserungder Mieterstruktur im Quartier, Identifikation der Bewohner mit dem Quartier,Qualifizierungs- und Integrationsprojekte für Einwohner mit Migrationshintergrund,Verbesserung der Qualität im Öffentlichen Raum, Imageverbesserung, Beschäftigungs-und Qualifizierungsprojekte, Erhöhung der Sicherheit und Sauberkeit imStadtteil, Konfliktmanagement im Quartier, ein als Anlaufstelle etabliertes Quartiersbüro.Es werden zahlreiche Beteiligungs- und Aktivierungsprojekte durchgeführt: mitBewohnern, Vermietern, Hartz IV-Beziehern, Trägern öffentlicher Belange, Polizeiund Ordnungsamt, Ämtern, Interdisziplinäre Arbeitsgruppen, Vernetzung mit bestehendenund Förderung <strong>von</strong> Initiativen im Stadtteil.Ansprechpartner: Herr Dr. Schulze-Böing, Leiter des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik,Europaangelegenheiten, Stadt Offenbach am Main; Vorsitzender des bundesweitenVereins „Beschäftigungspolitik: kommunal“ (bp:k) und des Ausschusses fürBeschäftigungs- und Sozialpolitik im Rat der Gemeinden und Regionen Europas(Brüssel); Geschäftsführer MainArbeit GmbHGesamtstädtische und Interkommunale Handlungskonzepte im Rahmendes Programms „Stadtumbau in Hessen“Modellstandort Bensheim, im Landesprogramm „Stadtumbau in Hessen“Kategorie:Auftraggeber:gesamtstädtisches Integriertes Entwicklungskonzept mit teilräumlichen<strong>Handlungskonzepten</strong>, InnenstadtbezugStadt BensheimBearbeitung: <strong>Erarbeitung</strong> des <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes Mitte 2005bis Mitte 2006 durch die NH | ProjektStadt / NassauischeHeimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbHStadtumbaumanagement seit Herbst 2007 – RittmannspergerArchitektenAus der gesamtstädtischen Untersuchung heraus wurden unterschiedliche Schwerpunktedefiniert: Neben einem zentralen Stadtumbaufördergebiet mit investivem undnicht-investivem Tätigkeitsschwerpunkt und höchster Handlungspriorität, zwei Gebietenmit nachrangiger Priorität und vorerst ausschließlich nicht-investiven Maßnah-<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 24
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereichemen, werden mehrere Beobachtungsgebiete bestimmt, deren zukünftige Entwicklungim Fokus der weiteren Bearbeitung bleiben wird. Ziele sind die Wiedernutzung <strong>von</strong>Brachen und Leerständen, Abbau der bestehenden Nutzungskonflikte, Umkehr sozialerund ethnischer Segregationstendenzen, Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes,sowie Schaffung einer Quartiersidentität. Im Rahmen des <strong>Erarbeitung</strong>sprozesseswurden durch Steuerung der Lenkungsgruppe auf Verwaltungsebeneund der Integration <strong>von</strong> Multiplikatoren in den Handlungsfeldern Wirtschaft und Tourismus,Wohnen und Stadtbild, Soziales, Umwelt und Verkehr auf lokaler Ebene Impulsprojekteentwickelt.Bei der Entwicklung <strong>von</strong> Folgenutzungen für das Fördergebiet bildet die <strong>Erarbeitung</strong>einer gesamtstädtisch-integrierten Einzelhandelsstrategie eine wichtige Rolle, um dieInnenstadt nicht weiter zu destabilisieren.Ansprechpartner: Herr Sachwitz, Fachdienstleiter StadtplanungStadtumbau ObertshausenKategorie:Auftraggeber:Bearbeitung:gesamtstädtisches Integriertes Entwicklungskonzept mit teilräumlichenSchwerpunktgebieten in den KernbereichenStadt Obertshausen<strong>Erarbeitung</strong> des <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes 2006 bis2007 durch die NH | ProjektStadt gemeinsam mit der PlanungsgruppeDarmstadtDie zukünftige Stadtentwicklung der Stadt Obertshausen wird sich auf eine Innenentwicklungkonzentrieren. Nach- und Umnutzungskonzepte für Brachen, Konversionsflächenund mindergenutzte Areale, sowie Strategien <strong>zur</strong> Anpassung der Siedlungsstrukturan die Erfordernisse der Entwicklung <strong>von</strong> Bevölkerung und Wirtschaft erfolgenim Rahmen des <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes in einem gesamtstädtischintegriertenBetrachtungsrahmen.Schwerpunkte sind die Schaffung eines neuen zentralen Verwaltungsstandorts für diebeiden Stadtteile Hausen und Obertshausen, die Revitalisierung und Stärkung der altenOrtskerne durch die Nachnutzung der frei werdenden Grundstücke der Stadtteilverwaltungen,die Widernutzung der Brachen altes Hallenbad und eines kontaminiertenIndustriegeländes sowie die Stärkung der innerstädtischen Quartiere, insbesonderedurch Stärkung des Einzelhandels, durch Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität,Erhaltung innerstädtischer Altbaubestände und Aufwertung der Umwelt.Ansprechpartner: Frau Holler, Fachbereichs-Leiterin Bauen, Planen, Umwelt und Verkehr<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 25
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheStadtumbau Hinterland + Bad Laasphe,Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)Kategorie:Auftraggeber:Bearbeitung:interkommunales HandlungskonzeptZweckverband Hinterland + Stadt Bad Laaspheseit Januar 2007 <strong>Erarbeitung</strong> eines InterkommunalenStadtentwicklungskonzeptes durch die NH | ProjektStadt /WOHNSTADT GmbHDas ISEK ist ein handlungsfeldorientiertes Stadtumbaukonzept für eine interkommunaleKooperation <strong>von</strong> neun Kommunen. Es formuliert sowohl strategischkonzeptionelleAnsätze für die Region als auch städtebauliche Schwerpunktgebiete,für die eine intensive Förderung vornehmlich im Rahmen der Städtebauförderung angestrebtwird. Zudem handelt es sich um einen Landesgrenzen überschreitenden integriertenAnsatz – Bad Laasphe liegt im Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen.Ansprechpartner: Herr Völker, kaufmännischer Geschäftsführer des ZweckverbandesHinterlandIntegrierte Handlungskonzepte außerhalb <strong>von</strong> FörderprogrammenWohnungsübergreifendes Concierge- und FreiflächenkonzeptSiedlung Hermann-Brill-Straße, Wiesbaden- KlarenthalKategorie:Auftraggeber:Bearbeitung:teilräumliches eigentümerübergreifendes KonzeptWohnungsbaugesellschaften GENO 50, GWW, NassauischeHeimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbHDurchführung des Conciergesystems - Volksbildungswerk KlarenthalEs handelt sich um ein landesweit einzigartiges Modellprojekt für wohnungsgesellschafts-übergreifendeFreiflächen- und Conciergekonzeptionen in Großsiedlungenaußerhalb <strong>von</strong> Förderprogrammen. Basis für den gemeinsamen umfassenden Neugestaltungsprozesswar eine Machbarkeitsstudie.Das integrierte Conciergesystem schafft Sicherheit und ermöglicht vor allem auchden kontinuierlichen Informationsfluss zwischen Bewohnern und Hausverwaltung.Gleichzeitig schafft das Projekt Arbeitsplätze. Ergänzt wurde das Sicherheitskonzeptdurch die Installation eines Videosicherheitssystems und bauliche Veränderungen.Anonyme Eingangsbereiche wurden zu Treffpunkten und Kommunikationsräumenumgestaltet, verwahrloste Müllsammelstellen eingehaust und begrünt, unattraktiveFreiflächen in Terrassen- und Themengärten umgewandelt. Die neue, wohnungsgesellschaftsübergreifendeFreiflächenzonierung ermöglicht die Errichtung zahlreichernaturnaher Aufenthaltsbereiche.Ansprechpartner: Herr Knab, Geschäftsführer Volksbildungswerk Klarenthal<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 26
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheGinsheim-Gustavsburg, Wohnquartier „An der Schleuse“,Integrierte SiedlungsentwicklungskonzeptionKategorie:Auftraggeber:teilräumliches integriertes HandlungskonzeptGemeinde Ginsheim-Gustavsburg, in Abstimmung mit den vorOrt vertretenen WohnungsbaugesellschaftenBearbeitung: <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes - Modul 1 -Analyse, Ziele und Handlungsfelder 2007 durch die NH | ProjektStadt/ Nassauische Heimstätte Wohnungs- und EntwicklungsgesellschaftmbHIntegrierte Maßnahmenkonzeption <strong>zur</strong> nachhaltigen Entwicklung der Siedlung. Besonderheit:Es handelt sich um einen niedrigschwelligen Ansatz <strong>zur</strong> Untersuchungund Optimierung <strong>von</strong> Gebieten unterhalb der Schwelle <strong>von</strong> Förderprogrammen.Bei dem Quartier handelt es sich um ein typisches Wohnquartier aus den1960er/1970er Jahren in östlicher Randlage des Ortsteils Gustavsburg. Das hier erarbeiteHandlungskonzept hat Pilotcharakter für andere Wohnquartiere.Schwerpunkte des Konzeptes liegen auf einer integrierten, nachhaltigen und energieeffizientenModernisierung des Baubestandes in Kombination mit Maßnahmen <strong>zur</strong>Freiraumaufwertung und Kommunikationsinstrumenten im Sinne eines „Neighbourhood-Branding“.Ansprechpartner: Herr Hummel, Fachbereichsleitung Raum – Bau - Umwelt<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 27
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler Kernbereiche4 Links und LiteraturLiteraturIntegrierte Handlungskonzepte im Rahmen des Programmes Soziale Stadt<strong>Leitfaden</strong> Förderprogramm Soziale Stadt, Frankfurt am Main, Servicestelle Hegiss,2003, HEGISS Materialien, Arbeitshilfe 2Beziehbar unter http://edoc.difu.de/edoc.php?id=UGCRK56Q<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“der ARGEBAU (Konferenz der Bauminister der Länder), Fassung vom 29. August2005Beziehbar unter http://hegiss.de/ im Bereich Dokumentation, Stichwort GrundlagenStrategien für die Soziale Stadt, Endbericht der Programmbegleitung, Difu 2003Beziehbar unter http://www.sozialestadt.de/veroeffentlichungen/endbericht/Integrierte Handlungskonzepte im Rahmen des Programmes Stadtumbau inHessenAlle beziehbar unter http://www.stadtumbau-hessen.de/Gemeinschaftsinitiative Stadtumbau in Hessen, <strong>Leitfaden</strong> Interkommunale Kooperation,HMWVL, 2006Erster Info-Brief Stadtumbau in HessenAnlage 1 - <strong>Leitfaden</strong> StadtumbauAnlage 2 - Organisation Interkommunaler GruppenZweiter Info-Brief zum Stadtumbau in HessenAnlage 1 - Kurzfassung Schwalm-Eder-WestAnlage 2 – Integriertes Handlungskonzept hessischer Stadtumbau-Pilotstandort BensheimIntegrierte Handlungskonzepte im Rahmen des Programmes Stadtumbau WestDie folgende und weitere Informationen beziehbar unter www.stadtumbauwest.deBroschüre „16 Pilotstädte gestalten den Stadtumbau - Zwischenstand im ExWoSt-Forschungsfeld“<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 28
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheLinkshttp://www.bbr.bund.de/http://www.hegiss.de/http://www.sozialestadt.dehttp://www.stadtumbau-hessen.de/http://www.wirtschaft.hessen.de/http://www.stadtumbauwest.de/http://www.soziale-stadt-offenbach.de/<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 29
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheProf. Thomas DilgerNassauische HeimstätteWohnungs- und EntwicklungsgesellschaftGeschäftsführergeboren in Stade/Elbe1971 Abitur in OsnabrückDiplom an der Architekturabteilung der TU HannoverPlaner im Architekturbüro Johannsen in Osnabrück1978 – 1979 Referendariat in Münster – Bauassessor1980 – 1984 Planungsamtsleiter und Stadtbaurat in Lennestadt1985 – 1989 technischer Beigeordneter der Stadt Wesel1990 – 1997 Stadtentwicklungsdezernent der Landeshauptstadt Wiesbaden1998 – 2001 Geschäftsführender Gesellschafter im Büro DKS – Städtebau(Dilger, Kramm & Strigl) Darmstadt/Wiesbadenab 2002 Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte in Frankfurtam Main undseit 2005 zusätzlich Geschäftsführer der Wohnstadt HessenSept. 2006 HonorarprofessorMitglied der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen.1991 Berufung in die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung.Vorsitzender des Fördervereins der Landesentwicklungsgesellschaften e.V.Lehrbeauftragter der TU Darmstadt 1996/97 und seit 2003 Fachgebiet Entwerfen,Städtebau und Siedlungswesen im Fachbereich Architektur (städtebauliche Projektentwicklung).Präsident BV-LEG. Vorsitzender des Ausschusses Stadtentwicklung des ZIA.<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 30
Instrumente <strong>zur</strong> Stärkung zentraler KernbereicheFelix Lüter, Dipl.- Ing., Architektur und StadtplanungNassauische HeimstätteWohnungs- und EntwicklungsgesellschaftProjektbeauftragterHochschulabschlüsse und Fortbildungen2007 Dipl. Ing. TU, Fachrichtung Architektur und Stadtplanung, Technische Universität DarmstadtTätigkeiten außerhalb der Nassauischen Heimstätte (Auswahl)1998 Mitarbeit im Architekturbüro Tuchen, Frankfurt2002-2005seit 2004Mitarbeit bei der Energie Consult, KelkheimKundenbetreuung, Organisation und ProjektevaluationStudien- und Arbeitsschwerpunkt im Themenfeld Stadtumbau, diverse freie Arbeiten, u.a. Diplomarbeitzum Thema nachhaltiger Stadtumbau schrumpfender Städte zu energieautarken Siedlungsformen2005 Wettbewerbsgewinn beim bundesweiten Studentenwettbewerb „Schrumpfen als Chance“2007 Forschungsvorbereitung an der TU Darmstadt für ein Projekt des Bundesprogrammes EnEffStadt2007 Präsentation der Diplomarbeit auf dem Weltkongress für nachhaltiges Bauen in LissabonArbeitsschwerpunkt bei der Nassauischen Heimstätteseit 2005Referenzprojekte2005-2006Projektbeauftragter im Fachbereich Integrierte Stadt- und Gewerbeflächenentwicklung, Schwerpunkte„Stadtumbau in Hessen“ und „Soziale Stadt“Modellstandort „Stadtumbau in Hessen“, Bensheim, Mitarbeit bei der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptesund des teilräumlichen <strong>Integrierten</strong> Handlungskonzeptes2007 <strong>Erarbeitung</strong> eines <strong>Integrierten</strong> Nachhaltigen Siedlungsentwicklungs-konzeptes für das Wohnquartier„An der Schleuse“ in Ginsheim-GustavsburgSeit 2007Seit 2007Seit 2007Interkommunaler Verbund Stadtumbau Bergstraße, Projektmitarbeit im StadtumbaumanagementInterkommunaler Verbund Stadtumbau Raunheim, Rüsselsheim, Kelsterbach, <strong>Erarbeitung</strong> eines<strong>Integrierten</strong> Interkommunalen und <strong>von</strong> Kommunalen <strong>Handlungskonzepten</strong>, Projektmitarbeit imStadtumbau-managementSoziale Stadt Neu-Isenburg – Stadtquartier West, Projektmitarbeit im Quartiersmanagement, u.a.Management eines energieeffizienten Umbaus einer Kita in ein Familienzentrum<strong>Leitfaden</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Integrierten</strong> <strong>Handlungskonzepten</strong> 31