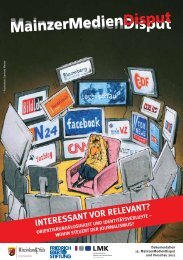Die Publikation im PDF-Format
Die Publikation im PDF-Format
Die Publikation im PDF-Format
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AUF DEM BOULEVARD DER ÖFFENTLICHKEIT –WAS KOSTET UNS DIE MEINUNGSFREIHEITDokumentationOktober 2004
INHALT4Dr. Thomas Leif – Vorwort – Information. Analyse. Aufklärung.VERSCHWIEGEN, VERSCHWUNDEN, VERDRÄNGT –WAS (NICHT) ÖFFENTLICH WIRD8141732Markus Schächter – Eröffnungsrede: Auf dem Boulevard der ÖffentlichkeitManfred Helmes – Grußwort anlässlich des 8. MainzerMedienDisputWolfgang Thierse – Eröffnungsrede: Der Zwang zur Unterhaltung und Ernst der PolitikHans Leyendecker – Kampagnenführer Bild – ein Rededuell3945626671Hans Leyendecker, Frank Bsirske, Heribert Prantl – Panel 1 –„<strong>Die</strong> Macht der Kampagnen und die Schwäche des Parlaments”Petra Kaminsky, Wolfgang Kenntemich, Klaudia Brunst, Ulrich Felix Schneider– Panel 2 – „Boulevard-Journalismus – die neue Leitwährung in den Medien”Martin Lohmann, Dr. Michael Maier, Horst Röper – Panel 3 –„Pflegefall Qualitätszeitung – muss die Pressefreiheit subventioniert werden?”Kurt Beck – Zwischen Wettbewerb und Pluralismus – „Entwurf eines siebtenGesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung”Siegfried Weischenberg – Dinner-Speach – Boulevard, Talk Retro und Ostalgie –wann folgt die Renaissance des Journalismus?81Jürgen Dahlkamp – Rede „Leuchtturm”BOULEVARDISIERUNG und QUALITÄT IM JOURNALISMUS88Prof. Dr. Georg Ruhrmann – Info mit –tainment – Nachrichten <strong>im</strong> Langzeitvergleich97Dr. Norbert Schneider – Jenseits der Superstars –Programmentwicklung bei den Privaten105Ernst Elitz – Zwischen KEF und Quote: Der Qualität gehört die Zukunft?113 Bodo Hombach – Qualität in der Krise: Was Zeitungen sich leisten können2
121Dr. Joach<strong>im</strong> Huber – <strong>Die</strong> Relevanz der Magazine136Dr. Ulrich F. Schneider – Medienprominenz als gesellschaftlicher Spiegel?Ein kulturkritischer Diskussionsbeitrag zur Boulevardisierung der MassenmedienETHIK IM JOURNALISMUS152167177Prof. Dr. Günther Rager – Ohne Furcht und Adel? – Ethische Konfliktfelder <strong>im</strong> JournalismusProf. Dr. Babara Thomaß – Maßstäbe gegen MaßlosigkeitTop Ten der vernachläßigte Themen 2003RECHERCHE IM JOURNALISMUS180Bundespräsident a. d. Johannes Rau – Medien zwischen Anspruch und Realität194Christoph Arnowski – „Verschlossenen Auster” an Albrecht SchmidtVerleihung von Netzwerk Recherche198Sven Preger – Der strukturelle Zwang – Warum es Recherche so schwer hatDIE NEUEN SPIN DOCTOREN210219233Stefan Marx – Boulevard Schröder, Boulevard BlairWarum Spin Doctors nicht totzukriegen sindDr. Rudolf Speth, Dörte Schulte-Derne – INSM und BürgerkonventSegensreiche Neuerung oder „Protest in Lackschuhen”?Manfred Redelfs – Informationsgesellschaft ohne Informationszugang?Das Ringen um ein Akteneinsichtsrecht für jedermann245Programm – 9. MainzerMedienDisput am 4. November 2004252 Impressum3
Parlamentarier. Der frühere CDU-Schatzmeister Leissler-Kiep „verkaufte”seine Informationen in der CDU-Spenden-Affaire ganz gezielt, um <strong>im</strong> Gegenzugseine Schwarzgeld-Rolle etwas aufzuhellen. <strong>Die</strong> Kette dieser interessen-geleitetenPseudo-Enthüllungen liesse sich noch fortsetzen: Siefunktioniert <strong>im</strong> Geflecht der Lokalpolitik genauso wie <strong>im</strong> Kanzleramt, inMinisterien oder Behörden. Im Kampf um Machterwerb oder Machterhaltist die Steuerung von kritischer Öffentlichkeit e i n e zentrale Ressource.Quellenpflege und die Erschliessung neuer Quellen ist folglich eine derwichtigsten Beschäftigungen von Journalisten, die mehr sein wollen, alsdie Textmanager von Agentur- oder PR-Material.Mit jedem veröffentlichten Skandal wird die Luft aber dünner. Für Behörden-Chefsist jedes (noch so kleine) Informations-Schlupfloch ein Risiko.Nachdem die WELT über interne Vermerke der hessichen Landesregierungzum Thema „NPD-Verbot” berichtete, wurde sogar das BKA eingeschaltet,um die Quelle künftig stillzulegen. Auch in den Staatsanwaltschaften werdenhäufig „interne Ermittlungen” aufgenommen, wenn wichtige Schriftstückeden internen Postweg verlassen. <strong>Die</strong> EU-Anti-KorruptionsbehördeOLAF schaltete die belgische Justiz ein und beschlagnahmte die komplettenAkten des Brüsseler Stern-Korrespondenten. <strong>Die</strong> Botschaft dieserAktionen richtet sich nicht in erster Linie an die kritisch berichtenden Journalisten;die Warnung geht an die Informanten. Zu der politischen Einschüchterungkommt oft noch die juristische Verfolgung v o r undn a c h unliebsamen Veröffentlichungen.Klaus Bednarz, der frühere Monitor-Chef hat diesen Trend schon früherkannt und gemahnt, dass der Anteil investigativer Eigenleistungen sinke.Chefredakteure und Verlagschefs bremsten kritische Recherchen, „da siekostspielige Klagen oder unliebsame politische, sprich unternehmenspolitischeFolgen fürchten.” Der Autor Marc Pitzke spitzt noch zu: „InvestigativerJournalismus ist bei uns eine verlernte Kunst. Intensive Recherche istnicht gefragt.” Mustert man die Veränderung der Medienlandschaft, kannman dieser Einschätzung nicht widersprechen.Sicherlich schrumpft der Markt für soliden Hintergrund-Journalismus und fürmeist finanziell aufwendige Recherchen. <strong>Die</strong>s liegt jedoch nicht nur an den„äusseren” Bedingungen, sondern auch an der „inneren” Haltung vielerJournalisten. Das Berufsbild hat sich <strong>im</strong> Laufe der Jahre <strong>im</strong> Windschattendes volljährigen Privatfunks verändert. Viele Journalisten sehen sich als<strong>Die</strong>nstleister für Service-Informationen, nicht als Aufklärer von Missständenoder Mahner gegen Korruption, Machtmissbrauch und Ämterpatronage.5
Der Broadway-Kolunmnist Walter Winchell hat diese Haltung zynisch sobeschrieben: „Zu viel Recherche macht die schönste Geschichte kaputt.”All diese Faktoren beeinflussen, beeinträchtigen und behindern den sogenannten„investigativen Journalismus”, der in Deutschland <strong>im</strong>mer nocheine Ausnahme-Gattung ist. Es gibt aber keinen Grund, sich von diesernüchternen Bilanz entmutigen zu lassen. Vielmehr sollte man den Blick aufsoliden und seriösen Recherche-Journalismus richten. Wenn es gelänge,bei allen journalistischen Produkten die Quellenvielfalt zu erhöhen, wennes gelänge gesteuerte PR-informationen zu filtern und zu hinterfragen undwenn es gelänge, die richtigen Fragen an die richtigen Leute zu richten –dann würden wir die Fundamente eines verantwortlichen Journalismuserneuern.Und dies wäre dann vielleicht das solide und stabile Fundament, auf demsich dann m e h r „investigativer Journalismus” entwickeln könnte. Eininvestigativer Journalismus, der diesen anspruchsvollen Namen auch wirklichverdient. Über die hier skizzierten Fragen und Verwerfungen eines anspruchsvollen,einer vitalen Demokratie verpflichtetem Journalismus diskutiertseit fast einem Jahrzehnt der MainzerMedienDisput jedes Jahr <strong>im</strong> November.Mit der vorliegenden Dokumentation wird wieder ein „Gedächnisfür eine kritische Öffentlichkeit” präsentiert.Ganz unterschiedliche Autoren untersuchen den oft Intransparenten Medienmarkt,beleuchten die jorunalistische Praxis und beschäftigen sich mitMedienwelten, die ihnen bisher verborgen blieben. <strong>Die</strong> fulminanten Gedankenund Analysen bilden das Fundament für den diesjährigen Mainzer-MedienDisput.Noch wichtiger aber ist die Empfehlung von Lisa Spitz für die Gestaltungvon Podiumsdiskussionen. In der Süddeutschen Zeitung (7./9. August2004) liest sie den Agenten der Begegnungs-Industrie die Leviten. IhreSpitzen zur „deutschen Podiums-Diskussion” sitzen und sind deshalb solesens- und bedenkenswert:„Im 19. Jahrhundert gab es ein Konversationslexikon, damit hat man sichpräpariert, bevor man einer Einladung folgte. <strong>Die</strong> Gespräche waren sicherhohl, aber wenigstens nicht peinlich. Warum lernt heute niemand zudiskutieren, bevor er sich auf ein Podium zerren lässt? Zuhören, seineArgumente ordnen, knappe Gegenfragen stellen, Einsichten annehmen,Unwissen eingestehen, mit Selbstironie gewappnet sein, schlagfertig kontern...Herrgott, was könnte das ein Theater sein!”Eine Mahnung an alle, die die Podien der Republik bevölkern, also auchan den MedienDisput <strong>im</strong> November.Thomas Leif6
VERSCHWIEGEN,VERSCHWUNDEN,VERDRÄNGT –WAS (NICHT)ÖFFENTLICHTWIRD
sondern bei Adam und Eva. In diese Falle sollten wir aber nicht tappen,sondern wir sollten festhalten:<strong>Die</strong> Zuschauer <strong>im</strong> Jahr 2003 wissen sehr wohl, dass es sich lohnt, nachInhalten zu suchen und Inhalte zu finden, und sie wissen auch sehr wohl,welche konkreten Inhalte sie <strong>im</strong> deutschen dualen Fernsehsystem findenkönnen. Im ZDF stellen wir fest – in diesem Jahr ganz besonders –, dass<strong>im</strong>mer mehr Zuschauer klassische Qualitätssendungen mit Informationsgehaltnachfragen: Das „heute-journal”, das Kulturmagazin „aspekte”, dieHintergrund-Dokumentationen sind die Gewinner dieses Jahres. Sie gewinnenbis zu 20 Prozent der Zuschauer, und sie gewinnen auch jüngereZuschauer, und sie gewinnen – was uns besonders wichtig ist – Zuschaueraus den neuen Bundesländern.Mehr als jeder andere Sender <strong>im</strong> Kontinental-Europa bringt das ZDFInformationssendungen. Fast 50 Prozent, fast jede zweite Sendung seinesAngebots ist eine Informationssendung. Und es ist, wenn man einen Tagwie heute n<strong>im</strong>mt, buchstabierbar, wie sich ein Sender, der vor 15 bis 20Jahren noch ein „Unterhaltungsdampfer” war, sich entwickelt hat hin zueinem Informationssender mit ansprechender Unterhaltung. Wenn manalso einen Tag wie heute betrachtet, den Informationsdienstag des ZDF,dann sind von 19.00 Uhr bis 22.45 Uhr fast drei Stunden reine Information– ein Informations-Themenabend, wie er auch auf ARTE nichtstattfindet, wie er heute <strong>im</strong> ZDF stattfindet, wie er – das können wir schonprognostizieren – mit vielen Zuschauern stattfindet. In diesen drei Stunden,an manchen <strong>Die</strong>nstagen kommt noch Elke Heidenreich mit „lesen!” dazu –in diesen dann dreieinhalb Stunden bringen wir an einem Tag mehrInformation als der Marktführer der Privaten, als RTL in einer ganzenWoche. Mit unseren 450 Dokumentationen, der Königsdisziplin desöffentlich-rechtlichen Fernsehens, bringen wir etwa zehnmal so vieleDokumentationen <strong>im</strong> Jahr wie SAT.1. In der öffentlichen Diskussion der letztenTage ist dies nicht besonders zur Kenntnis gebracht worden. Manhat auf andere, auf ökonomische Akzente gesetzt.Deshalb erlauben Sie mir, dass ich mich heute nicht bloß auf eineBegrüßung beschränke, sondern mit einigen Gedanken zur Versachlichungder Debatte beitragen möchte. Meine Gedanken bleiben freilichbe<strong>im</strong> Thema:Das ZDF hat heute vor einer Woche in seiner Reihe „37°” unter dem Titel„Der Fall der Sieger” eine Reportage über die Boulevard-Karrieren der9
ehemaligen „Big Brother”-Helden ausgestrahlt. Für diese Hintergründeund Spätfolgen des einstigen großen TV-Spektakels interessieren sichnur ganz wenige. Wir wollen aus unserer informationsbest<strong>im</strong>mten Sichtder Dinge aber Fragen stellen, beispielsweise danach, wie sich dasLeben nach einem „Öffentlichkeitsschock” darstellt. Man konnte sehen –und <strong>im</strong> Prinzip wussten wir das schon vorher –, dass kein Mensch den„Boulevard der Öffentlichkeit” dauerhaft ertragen kann, dass derMensch <strong>im</strong>mer auch ein Stück Privatheit und Int<strong>im</strong>ität braucht.Was will ich damit sagen? Da man den Konvergenz-Propheten zufolgeangeblich keine Unterschiede mehr erkennt zwischen kommerziellem undöffentlich-rechtlichem Fernsehen, verweise ich auf einen der entscheidenden:Das „Privat”-Fernsehen hat – nomen est omen – insbesondere inseinen Talk- und Reality-<strong>Format</strong>en das Private öffentlich gemacht und einTabu nach dem anderen gebrochen. Öffentlich-rechtliches Fernsehendagegen darf nicht Schlüsselloch ins nachbarliche Schlafz<strong>im</strong>mer werden,sondern muss Fenster zur Welt sein. Es ist nicht nur Boulevard, sondernein ganzes Straßennetz. Es ist nicht nur Markt zum Austausch von Einheitswaren,sondern ist Forum und Marktplatz zum Austausch kontroverserMeinungen.<strong>Die</strong>s schließt nicht aus, dass es auch <strong>im</strong> öffentlich-rechtlichen Fernsehenden Boulevard gibt: Es gab bei der ARD den erfolgreichen „BoulevardBio”, und es gibt <strong>im</strong> ZDF „leute heute”, den späten Talk mit „Kerner”und die Sonntagsfilme. Aber der Boulevard ist keine Hauptstraße, sonderneine Straße unter vielen. Und auf dieser Straße liegen bei uns dieThemen. Damit meine ich nicht die Verkehrsunfälle, mit denen dasPrivatfernsehen tagtäglich seine Nachrichten aufreißt. Damit meine ichschon eher die Straßendemonstrationen engagierter Bürger gegen dasSchließen von Betrieben, gegen das Zerstören der Umwelt, gegen dasEntsenden von Soldaten in den Krieg. Und ich meine natürlich auch dieganze Palette der sozialen Themen, die jetzt in der öffentlichen Diskussionstehen, zu Recht in der öffentlichen Diskussion stehen: Themen wieSteuern, Arbeitslosigkeit, Rente.Das ZDF hat am vergangenen Montag einen ganzen Service-Tag zurZukunft der Altersvorsorge – der vielleicht schwierigsten Frage – angeboten,beginnend mit dem „morgenmagazin”, über „drehscheibe”, „Mittagsmagazin”und „heute in Europa”, bis hin zu einem abendlichen „WISOspezial” als Schwerpunkt zur besten Sendezeit. Insgesamt 135 Minuten10
Spezialservice. <strong>Die</strong>s gibt es nur <strong>im</strong> öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Differenzierte,professionell aufbereitete, Mehrwert produzierende Service-Sendungen dieser Art bleiben – und müssen es bleiben – eine der besonderenLeistungen des public service.Ein Sender wie das öffentlich-rechtliche ZDF hat als Ziel, das Leben vonmöglichst vielen Zuschauern mit möglichst interessanten Programmenund professionellen Service-Leistungen zu versorgen und zu bereichern.<strong>Die</strong>se Zielvorstellung einer programmlichen Exzellenz schließt Irrwegenicht aus: Sackgassen, Niederlagen, Fehlleistungen – gerade <strong>im</strong> umstrittenenUnterhaltungsbereich. Dazu kommen Grenzwanderungen mitriskanten Absturzgefahren. Ich will ein Beispiel nennen, wie wir künftigsensibler und strenger sein werden und sein müssen, als es unsererechtlichen Richtlinien erlauben. Ich meine die Kooperationsmodelle <strong>im</strong>Programmbereich. Um konkreter zu werden: Ich habe mit dem ProgrammdirektorDr. Bellut vereinbart, dass wir ab Anfang 2004 keinemedizinisch-pharmazeutischen Großkooperation mehr eingehen werden.<strong>Die</strong> bereits heute spürbare Entwicklung in diesem Markt, vor demHintergrund der jetzt einsetzenden Gesundheitsreform, und der Druck,der sich dort neu formierenden Kräfte lassen es uns als sinnvoll undrichtig erscheinen, auf diese Kooperationen grundsätzlich zu verzichten.Wir werden dem Fernsehrat – Frau Fuchs, <strong>im</strong> Dezember – einen Berichtüber unsere Kooperationen vorlegen und eine neue Diskussion überdieses breite Feld beginnen.Indem wir deutlich machen, dass wir in diesen und ähnlichen Feldernuns mit einer neuen Sensibilität und auch Rigidität neuen Fragen stellen,dürfen wir aber gleichzeitig nicht in eine andere Falle hineingehen: Auchöffentlich-rechtliches Fernsehen braucht Wettbewerbsfähigkeit. Geradeder public service ist ein Massenmedium, wenn er erfolgreich sein will.Als solches muss er sich um die Akzeptanz des großen Publikums bemühen.Ein Programm, das darauf verzichtet, mit Sport, Unterhaltung,auch Boulevard das Publikum anzusprechen, vergibt insgesamt seineChance, ein breites und gehörtes Forum für gesellschaftliche Debattenzu sein und die politische, soziale, ökonomische Entwicklung für alleerfolgreich zu begleiten. Wir müssen die Menschen gerade dort abholen,wo sie sich befinden, und man kann sie auch wieder dorthin zurückbringen.Wir dürfen sie zum Beispiel ins Kino oder ins Theater führen –quasi zum halben Preis: <strong>Die</strong> derzeit diskutierte, heftig umstrittene Rundfunkgebührbringt für das ZDF zur Zeit vier Euro pro Monat von jedem11
Gebührenzahler – das ist weniger als die Hälfte einer einzigen Kinokarteund hält, quasi als Dauerkarte, einen ganzen Monat. Vier Euro <strong>im</strong> Monatsind 13 Cent am Tag.Ich sage dies, um einmal die Relation bewusst zu machen, worüber wirgegenwärtig diskutieren. Und ich will dabei gar nicht breit ins Feldführen, dass das ZDF neben seinem 24-stündigen Hauptprogramm mitden Informationsleistungen, die ich eben dargestellt habe, außerdem inseinem Digitalbouquet neben dem Theaterkanal eine Reihe weitererInformationssendungen anbietet, dass es maßgeblich an den Kulturprogrammen3Sat und Arte beteiligt ist, am Ereignis- und DokumentationskanalPhoenix und schließlich am Kinderkanal als gewalt- und werbefreiemAngebot für die nachwachsende Generation, die unsere Zukunftgestaltet.<strong>Die</strong>se profilbildenden öffentlich-rechtlichen Angebote werden als vermeintlichunrechtmäßige Expansion kritisiert, solange es sie gibt; siewürden aber in ihrer inhaltlichen Funktion gefordert, sobald es sie nichtgäbe. Wer uns hier eine zu große Verzweigung unserer Angebotsstrukturvorwirft, kann uns nicht gleichzeitig eine zu große Boulevardisierungvorwerfen. Was „Expansion” genannt wird, ist in Wirklichkeit vielfacherAusdruck einer qualitativen Vielfalt.Wir sind ein wirkliches Voll- und Vielfaltsprogramm, kein Zielgruppenfernsehenwie das Privatfernsehen für die 14- bis 49jährigen. Deshalbbrauchen wir auch ein paar Mitarbeiter mehr und sind trotzdem mit einemPersonalaufwand von 13,7 Prozent europaweit führend in Sachen Sparsamkeit.<strong>Die</strong>ser wirtschaftliche Erfolg wäre allerdings nichts wert, wenner nicht auch ein programmlicher Erfolg, sprich: ein qualitativer Erfolg,wäre. So ist das ZDF gerade vor wenigen Wochen mit dem internationalenBanff Award als „Channel of the Year 2003” ausgezeichnet worden –eine Auszeichnung, die darauf rekurrierte, dass es in Deutschland eineweltweit führende, eine beispielhafte Fernsehkultur aufgrund der starkenund wiedererstarkten öffentlich-rechtlichen Veranstalter gibt. <strong>Die</strong>se Auszeichnunggalt besonders unseren öffentlich-rechtlichen Qualitäten <strong>im</strong>ZDF in den Bereichen Kultur, Politik und Hintergrundinformation. Vorallem die führende Funktion des ZDF <strong>im</strong> Königsgenre des öffentlichrechtlichenFernsehens, in der Dokumentation, wurde als – ich zitiere –„Bollwerk des public service in Deutschland” dargestellt. Da haben wirwieder das Wort vom „Bollwerk” – in einer ganz anderen Funktion.12
Ich breche hier – aus Zeitgründen und wissend, dass ich mein Grußwort-Kontingent weit überschritten habe – mein Plädoyer für das ZDF <strong>im</strong> speziellenund für das öffentlich-rechtliche Fernsehen <strong>im</strong> allgemeinen ab. Ichhoffe, gezeigt zu haben, dass wir eine breite öffentliche Diskussion nichtscheuen, vor allem dann nicht, wenn sie nicht überhitzt, sondern mitquasi 37 Grad geführt wird, also: sachlich und nicht polemisch.Allerdings: Man darf die Sach- und Qualitätsdiskussion nicht nur fordern,sondern muss sie auch führen mit den Daten, mit den Fakten, mit denEinzelheiten. Heute, be<strong>im</strong> MainzerMedienDisput <strong>im</strong> ZDF ist hierzu diepassende Gelegenheit und auch der passende Ort. – Ich heiße Sie nocheinmal herzlich willkommen.13
14GRUSSWORT ANLÄSSLICHDES 8. MAINZER MEDIEN DISPUTManfred Helmes, LPR-DirektorHerr Bundestagspräsident,Herr Intendant,verehrte Frau Fuchs,sehr geehrte Damen und Herren,als dritter <strong>im</strong> Bunde der Veranstalter,der die zweite Säule desdualen Systems vertritt, entbieteich Ihnen ein herzliches Willkommenzum 8. MainzerMedienDisput.<strong>Die</strong>se Veranstaltung hat sich nie mit den Medientagen München, denMedientagen NRW oder den Mitteldeutschen Medientagen messen wollen.Nicht der Glamour der Get Together sollte den Anreiz zur Teilnahmebieten, sondern die Brisanz der Themen, die die Rolle des Rundfunks ineiner demokratischen Gesellschaft hinterfragen. Das kritische Gewissen<strong>im</strong> täglichen Stellungskampf zwischen Qualität und Quote <strong>im</strong> dualenSystem ist das Markenzeichen des Mediendisputs. Dafür möchte ichdenen danken, die inhaltlich dafür verantwortlich zeichnen und sichnicht beirren lassen, diesen Weg konsequent weiterzugehen.Meine sehr geehrten Damen und Herren, <strong>im</strong> Jahr 2004 jährt sich derUrknall des dualen Systems zum 20. Mal. Was <strong>im</strong> KabelpilotprojektLudwigshafen seinen Anfang nahm, wird am 16. und 17. Juni 2004 in Mainzauf einer gemeinsamen Veranstaltung von VPRT, Arbeitsgemeinschaftder Landesmedienanstalten und der Landeszentrale für private RundfunkveranstalterRheinland-Pfalz gebührend gefeiert werden. Dazu ladeich Sie heute schon herzlich ein.Wir werden uns dabei nicht darauf beschränken, in Wehmut vermeintlichbesserer Zeiten zu gedenken, sondern uns in Gesprächsrunden zu Themenblöckenwie Finanzierung/Werbewirtschaft, Technik/Digitalisierung, europäischeEntwicklungen und Programm mit den Fragen beschäftigen, dieaufgrund technischer Entwicklungen und der Verlagerung von Zuständig-
keiten auf die europäische Ebene einer Lösung harren. Eine Feststellungsollte aber – womöglich nicht widerspruchsfrei – erlaubt sein: <strong>Die</strong> Einführungdes kommerziellen Rundfunks hat den monolithischen Blocköffentlich-rechtlichen Rundfunk in Bewegung versetzt. Sie hat ihn vonSchwerfälligkeit und Sendungsbewusstsein befreit und in einem langenund beinharten Konkurrenzkampf zu Geschmeidigkeit verholfen. <strong>Die</strong>aktuelle heftige Diskussion um das programmliche und werblicheNebeneinanderdes öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks ist ein Signaldafür, dass partiell Rückfälligkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunksspürbar sind.Und – davon bin ich fest überzeugt – diese Diskussion hat ihren Höhepunktnoch lange nicht erreicht. Ich warne zudem vor der Selbstsicherheitzu glauben, das Bundesverfassungsgericht werde es am Endezugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schon richten. Um einemmöglichen Missverständnis vorzubeugen: Kommerzieller Rundfunk setztein funktionierendes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem voraus. <strong>Die</strong>sist eine der Kernaussagen des Bundesverfassungsgerichts, und sie wirdauch weiterhin Leitlinie der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtsbleiben, aber eben in einem austarierten Verhältnis programmlicherund finanzieller Konkurrenz.Und eine zweite Feststellung muss erlaubt sein. Eine Reihe von programmlichenEntwicklungen der vergangenen 20 Jahre sind von kommerziellenKonkurrenten angestoßen worden. Natürlich gab es da auchWegsehenswertes. Mein Kollege Dr. Norbert Schneider hat dies auf eineranderen Veranstaltung kürzlich so formuliert: „Zeugen der ersten Stundeist manches Unsendbare, was gleichwohl gesendet wurde, in lebhafter,gelegentlich grauenhafter Erinnerung”. Aber da gab es auch die Newsshowsnach Mitternacht, das Umsteuern auf die deutsche Serie, dieSpaßshow am Wochenende, Stern-TV und Spiegel-TV. Und am deutlichstenwurde die Angebotsentwicklung <strong>im</strong> Segment Sportsendungen. Ichwill damit nicht von Fehlentwicklungen ablenken wie der Boulevardisierungder Information und dem Durchgriff ins Private und ins Int<strong>im</strong>e.Ich will nur ohne ideologische Scheuklappen eine Entwicklung aufzeigen,die durchaus in der Zweckbest<strong>im</strong>mung liegt, die das Bundesverfassungsgerichtbeiden Systemen zugewiesen hat.Und erlauben Sie mir eine dritte Feststellung. Eine Verhinderung weitererFehlentwicklungen <strong>im</strong> programmlichen wie <strong>im</strong> ökonomischen Bereich15
eider Systeme wird nur möglich sein, wenn wir uns bei der gesellschaftlichenKontrolle auf einheitliche Bewertungskriterien nicht nur verständigen,sondern sie auch praktizieren. <strong>Die</strong>s gilt für den Jugendschutzgenauso wie für Werbung und Sponsoring. Wenn wir auf SAT.1 als LPReinen Kr<strong>im</strong>i beanstanden, weil er die Entwicklung Jugendlicher beeinträchtigt,dieser aber mit vergleichbarem Inhalt als „Tatort” unbeanstandetgesendet wird, schaden wir beiden Systemen. Wer NeunLive wegen seinerRefinanzierung über Telefongebühren an den Pranger stellt, das gleicheSystem aber bei Gewinnspielen und Sportsendungen praktiziert, wirdangreifbar. Wenn wir als LPR die Einführungssendung des 5er BMW alsSchleichwerbung beanstanden bei SAT.1, „Wetten dass” aber noch nichteinmal als Sponsorsendung gekennzeichnet wird, fördern wir die Beschleunigungder Auflösung der Trennung von Werbung und Programm.Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir der holzschnittartigkeitmeiner Feststellungen durchaus bewusst, wollte aber nicht daraufverzichten, sie aus der Sicht des kommerziellen Standbeins desdualen Systems damit zu konfrontieren.Ich wünsche uns einen interessanten Tag.16
DER ZWANG ZUR UNTERHALTUNGUND DER ERNST DER POLITIKRede des Präsidenten des Deutschen Bundestages,Wolfgang Thierse, aus Anlass desMAINZER MEDIEN DISPUTS am 4. November 20031. Über absoluten Unterhaltungszwang und langsame Politik„Was ich Ihnen vortragen will, ist eine Polemik,also eine Zuspitzung. Ich will reden vom problematischenVerhältnis zwischen dem <strong>im</strong>mer absoluter/„totalitärer”werdenden Unterhaltungszwang inden Medien und der einigermaßen ernsthaften,also langsamen und langweiligen Politik! Unterhaltung,das will ich ausdrücklich voranstellen, alsBeschäftigung, die keine unmittelbaren Ziele verfolgt,nicht auf Durchsetzung, auf Erfolg, sondernallenfalls auf angenehmen Zeitvertreib ausgerichtetist, gehört zu unseren menschlichen Grundbedürfnissen.Sie gehört nicht zuletzt zum Auftragder öffentlich-rechtlichen Medien, allerdings nebenBildung und Information, nicht stattderer.Es gibt noch Bildung und Information <strong>im</strong> öffentlich-rechtlichen Rundfunkund Fernsehen und es gibt einordnenden, dabei durchaus meinungsfreudigenQualitätsjournalismus in Tageszeitungen und in Wochenzeitungen.Kann man deshalb – ein wenig intellektuell hochmütig, ein wenigresigniert – den Abstieg von Unterhaltungskultur zum Boulevard, vonzweckfreier Kommunikation zu sinnloser Unterhaltung als bloßenNiveauverlust beklagen und zur Tagesordnung übergehen? Was gingedas mich an. Das beträfe nur meinen persönlichen Geschmack, beträfemich als Politiker nur dann, wenn es st<strong>im</strong>mt, dass die Sorgfalt und derErnst politischer Debatten vom Einfluss der „Regenbogenpresse” abhängt,wenn es st<strong>im</strong>mt, dass nahezu alles in den <strong>Die</strong>nst von Unterhaltunggenommen wird. Dann stellte sich die Sorge ein, dass dieFunktionen der Pressefreiheit für die Demokratie nicht mehr gewährleistetsein könnten.17
2. Qualitätsjournalismus wird durch Arbeitsbedingungen abgeschafftWir müssen feststellen, dass <strong>im</strong> Fernsehen die Grenzen zwischen ernsthafterInformation und spaßhafter Unterhaltung <strong>im</strong>mer häufiger verschw<strong>im</strong>men;dass „Bild” angesichts einer Reichweite, die von kaumeinem Fernsehsender übertroffen wird, die Rolle eines Leitmediums erhält;dass die hochgelobten Regionalzeitungen dabei sind, Qualitätsjournalismusauf dem Umweg über die Arbeitsbedingungen abzuschaffen.Ausgegliederte Lokalredaktionen ersetzen Berufsjournalisten, die übergenaue Kenntnisse in der Region verfügen und politische Zusammenhängeerkennen können, durch billige Jung- oder Nebenerwerbsjournalisten,die bestenfalls ereignisorientierten „Häppchenjournalismus” bietenkönnen. Hauptsache: die Lohnkosten sinken. <strong>Die</strong> ohnehin <strong>im</strong>mer prekäreinnere Pressefreiheit gerät unter ökonomischem Wettbewerbsdruck undfolglich auf den Rückzug. Selbst in sogenannten Qualitätszeitungen fehlt<strong>im</strong>mer öfter die Zeit zu einer sorgfältigen Recherche. Schnelligkeit hatVorrang: übrigens auch auf Kosten von Rechtschreibung und begrifflicherGenauigkeit. Spartenprogramme <strong>im</strong> Radio und zunehmend auch<strong>im</strong> Fernsehen segmentieren das Publikum. „Phoenix” oder „n-tv” halteneine Sehbeteiligung um die 0,7 Prozent für einen Erfolg.In einer Berliner Obdachlosenzeitung las ich Folgendes: „Im Grundegenommen brauchen die Medien keine Wirklichkeit mehr. Sie sind durchausin der Lage, ein System der Wirklichkeit zu inszenieren, auf das siesich fortan beziehen.” Tatsächlich haben wir natürlich noch eine pluralistischeMedienlandschaft. Aber <strong>im</strong>mer öfter gewinnt man den Eindruck,dass Meldungen „die Runde machen”. Ein Medium fängt an, alle anderenfolgen, fühlen sich verpflichtet, eine Sache zu behandeln, nicht weilsie als wichtig gilt, sondern weil andere sie wichtig gemacht haben.<strong>Die</strong>ses Leitmedium ist meist „Bild”. Ein anderes das Fernsehen. Talk-Shows „machen” Nachrichten, wie oft ihnen das gelingt, wird in den Redaktionenals Erfolg gezählt.3. <strong>Die</strong> Grundversorgung mit Empörung ist gewährleistet<strong>Die</strong> Fernsehkritikerin Klaudia Brunst schreibt über politische Talk-Shows(es gibt dafür kein deutsches Wort), sie seien „redundant, s<strong>im</strong>plifizirend,flüchtig und damit entpolitisierend”. Ich fürchte, sie hat Recht. Man kannvon diesen meist gesehenen politischen Sendungen <strong>im</strong> deutschenFernsehen Zeitvertreib erwarten, aber tatsächlich auch Information? Dasist keine totale Ablehnung solcher Talkshows, schließlich nehme ich gele-18
Standpunkten zu tun bekommen, die mir helfen, eine verabscheuungswürdigerechtsextreme Meinung von einer freiheitlichen konservativenzu unterscheiden und nicht beiden den gleichen Wert zuzumessen. <strong>Die</strong>Gleichsetzung der Zuschauerquote mit dem demokratischen Prozess istgleichbedeutend mit seiner Auslieferung an die Medienlogik oder anschieren Populismus. Wenn Politik auf der Bühne der Medien allein aufden Menschen als Marktteilnehmer als Konsumenten schielt, dann ignoriertsie den Teilnehmer an der Beteiligungsdemokratie, also den Bürger.Sie liefert sich schutzlos launischen St<strong>im</strong>mungstrends aus. „Florida-Rolf”ist ein Vorgeschmack; die plebiszitäre Gouverneursabberufung in Kalifornienbereits die Realität dieses konsumistischen Politikverständnisses.Der Leiter der Landesmedienanstalt NRW, Norbert Schneider, kritisiertdie Quotenhörigkeit so: wenn die Quote das flächendeckende Kriteriumist, wird der Zuschauer indirekt für die Qualität der Medieninhalte verantwortlichgemacht. „Er bekommt, was er will (...) <strong>Die</strong>se Instrumentalisierungdes Publikums nivelliert nicht nur Menschen und Sachen (...) Indieser Abgabe von Senderkompetenz an die Empfängerkompetenz vollziehtsich (...) ein partieller Verzicht auf Berufsausübung.” Man sollte dasdem Herrn Intendanten in Frankfurt einmal mitteilen.5. Wie wirkt die Quote als einziges Erfolgskriterium auf Politik?Sie bewirkt Reduktion. Quotenhörigen geht es – wie dem Boulevard –um Streit, um Rücktritte, um scheinbare oder tatsächliche Widersprüche,um Katastrophen und andere Sensationen. Während die Wirklichkeitkomplizierter wird, interessiert er sich vorwiegend für Vereinfachungenoder lenkt gleich ganz von ihr ab.Das Fernsehen fühlt sich auch bei höchster Seriosität angehalten, Politikerund andere Teilnehmer an der öffentlichen Kommunikation nachgeradezu nötigen, um so einfacher und kürzer Stellung zu nehmen,desto komplizierter die Sachverhalte sind. Zwischen der Wirklichkeit undihrer medial vermittelten Wahrnehmung entsteht eine Kluft und wenndieser Trend zur Vereinfachung anhält, wird die Wirklichkeit tatsächlichin den Medien nicht mehr stattfinden.Ganz <strong>im</strong> Sinne des Bundesverfassungsgerichts, das 1984 das Nötige zumDualen System geurteilt hat, geht es mir nicht darum, Klatsch undTratsch gegen seriösen politischen Journalismus einfach nur auszuspielenund hochnäsig die mediale Befriedigung der Unterhaltungsbedürfnissezu denunzieren. <strong>Die</strong> Sorge ist vielmehr, dass vor lauter UnterhaltungsanspruchMedien nicht mehr sorgfältig berichten, die Wirklichkeit20
nicht mehr abbilden, den Ernst verlieren, Interessen und Interessentennicht mehr kenntlich machen und so letztlich die Demokratie gefährden.Ich sehe eine solche Gefahr, wenn st<strong>im</strong>mt, dass „die Demokratie die einzigeHerrschaftsform (ist), die in ständig neuer Kraftanstrengung gelerntwerden muss.” (O. Negt)Wie und wo soll dieses Lernen stattfinden, wenn alles dem Diktat derUnterhaltung unterworfen ist und über die Politik, die sich dem Unterhaltungsschemanicht unterwerfen lässt, schließlich gar nicht mehrdifferenziert informiert wird?Demokratie lebt von Öffentlichkeit. Sie erst schafft politische Legit<strong>im</strong>ation.Das setzt aber nicht nur voraus, dass der politische Akteuröffentlich handelt, sondern auch, dass die Massenmedien ihre Funktionin diesem Zusammenhang erfüllen. <strong>Die</strong> Zukunft der Demokratie, schreibtder hier in der Nähe von Mainz lehrende Politologe Sarcinelli, hängenicht zuletzt davon ab, „ob sich die Interaktionseffekte zwischen Politikund Medien als hilfreich bei der Lösung politischer Probleme erweisenoder als problemverstärkend. “Natürlich kümmert es ihn nicht, ob Mediender Regierung oder der Opposition „helfen”, sondern dass sie sich überhauptangemessen mit Politik befassen. Er hätte auch daran erinnernkönnen, dass die Pressefreiheit eine dienende Freiheit <strong>im</strong> Sinne derDemokratie ist; sie hat die Aufgabe der Rückkopplung von verliehenerpolitischer Macht an den Souverän. So gesehen umfasst Art. 5 GG nichtdie Freiheit, auf ernste politische Information und Meinungsbildung zuverzichten. Dahin wird aber die Entwicklung getrieben. Sarcinellischreibt: „<strong>Die</strong> Medien entfernen sich weiter von der Politik und folgenstärker ihrer eigenen Logik.” <strong>Die</strong> sei best<strong>im</strong>mt durch die Nachfrage desMarktes, auf dem „die Erhöhung der Informationsqualität nicht unbedingtzur Steigerung der Verkaufszahlen und Einschaltquoten” beitrage.6. Diktat der Unterhaltung kehrt Zweck-Mittel-Verhältnis um<strong>Die</strong> Vermischung von „Ernst” und Unterhaltung ist zunächst recht harmlos.Wenn in der Schule oder in einem Technikmuseum Momente desSpiels und der Spannung genutzt werden, um Interesse an Mathematik,an Physik oder an Politik also auf den ersten Blick sperrige Materien zuwecken, wird sich niemand beschweren. Es handelt sich jedenfalls umPolitik, Physik oder Mathematik, die Gegenstand der Kommunikationsind und die unterhaltenden Elemente dienen als Transportmittel. ZumDiktat der Unterhaltung kommt es erst, wenn diese Zweck-Mittel Relationumgekehrt wird. Dann geht es in Wahrheit nicht mehr um Politik,21
die mit unterhaltendem Mittel ver„mittelt” wird, sondern der Zweck istUnterhaltung, die sich des Gegenstands der Politik bloß noch als Mittelbedient. <strong>Die</strong>se Tendenz n<strong>im</strong>mt zu. Ohne Gegensteuern wäre schließlicheine Unterscheidung zwischen den <strong>im</strong> Sinne der Legit<strong>im</strong>ation von Politikwichtigen und ernsten Angelegenheiten einerseits und dem für wichtignur Erklärten (wegen des Unterhaltungswerts oder der Nützlichkeit fürdie Verwertungsketten) kaum noch möglich. <strong>Die</strong>se Unterscheidung istaber das Metier der politischen Berichterstattung.Es hat sich nämlich nichts daran geändert, dass es in der Politik umernste, <strong>im</strong>mer öfter <strong>im</strong>mer schwierigere, fast <strong>im</strong>mer folgenreiche Güterabwägungenund Entscheidungen geht. Parlamentarier und Regierungenwollen das Richtige tun. Der Streit darüber, was das Richtige ist, kanngelegentlich unterhaltsam, kurzweilig, leidenschaftlich sein. In der Regelist er mühsam, von Zielkonflikten und vielen Teufeln <strong>im</strong> Detail belastet,zeitraubend und ernst. Natürlich ist es spannend, ob es dem Bundeskanzlerund seiner Koalition gelingt, die „Agenda 2010” durchzusetzen,oder ob es Frau Merkel gelingt, die Verbundenheit der CDU mit derkatholischen Soziallehre auf zu lösen. Aber neben dem „event” einesSieges oder einer Niederlage dürfte es für die Öffentlichkeit wichtigersein, welche Art von Gesellschaft, welche Regeln mit welchen Folgengerade gestaltet werden. Nur dann kann öffentlich entschieden werden,ob der Entwurf akzeptiert, aktiv befördert, abgelehnt oder durch realistischeAlternativen ersetzt werden soll.Ich erinnere an die längst vergessenen Fernseh-„Duelle” der Spitzenkandidatenbei der Bundestagswahl vor erst einem Jahr: es wurde mehr darübergesendet und geschrieben, wie sie gewirkt, wie sie gesprochen,wie sich gehalten haben und ob die Farbe ihrer Krawatten angemessenwar, als darüber, was sie gesagt und wie sie es begründet haben. Nicht,dass es illegit<strong>im</strong> oder intellektuell niveaulos wäre, die Art und Weise desAuftretens von Politikern zu diskutieren. Spätestens seit dem „Duell”zwischen Nixon und Kennedy wissen wir, welche Bedeutung dem Bild <strong>im</strong>Vergleich zum Wort zukommt. Aber wenn es nur noch um Äußerlichkeitenund um unterhaltende Aspekte geht, wenn der Anspruch an Politik erhobenwird, in diesem Sinne „mediengerechter” zu werden, dann st<strong>im</strong>mtetwas nicht mehr.7. Mediengerechtheit stand auch bei Fernsehduellen <strong>im</strong> VordergrundAls es <strong>im</strong> Bundestag um das sogenannte Arbeitslosengeld II ging, erlebteinsbesondere die SPD eine durchaus sachlich begründete Kontroverse.22
Sie handelte u.a. davon, ob ältere Arbeitslose ihre Ersparnisse, ihre Altersvorsorge,die sie als Rentner zu verbrauchen planten, schon als nocharbeitswillige Erwerbsfähige verbrauchen sollten, ehe sie Unterstützungdurch das Arbeitslosengeld II bekommen können. Man konnte das durchausin den Medien erfahren – <strong>im</strong> Vordergrund stand die Sachfrage allerdingsnicht. Im Vordergrund standen Sieg oder Niederlage des Bundeskanzlers,standen sogenannte Abweichler, stand die Geschlossenheit derKoalition. Natürlich ging es darum auch. Aber die Gewichtung war falsch:es ist normal, dass das Parlament – auch die Regierungsmehrheit – Gesetzenicht nur verabschiedet, sondern sie zuvor diskutiert, prüft und verändert.Es handelt sich <strong>im</strong>mer um einen Entscheidungsprozess und nichtum ein „event”, bei dem Vorlagen „abgenickt” werden oder eben nicht.Außergewöhnlich war, dass das Ringen um die richtige Lösung, um denakzeptablen Kompromiss unter Zeitdruck eine Dramatik erreichte, dienicht alltäglich ist. Wir waren in dieser Zeit sehr unterhaltsam, wenn Sie sowollen: mediengerecht. Aber ob das dem Ansehen der Politik, des Parlaments,der SPD genutzt hat, ist zweifelhaft. Es hat übrigens niemand gelobt,dass diese Dramatik mediengerecht war. Vielmehr wurde getadelt,dass es zu dieser Dramatik überhaupt gekommen war. Es besteht alsonoch Hoffnung.8. Politik als Prozess ist Opfer der BoulevardisierungIch habe den Eindruck, dass stinknormale Arbeit an Gesetzen gar nichtmehr möglich ist angesichts einer <strong>im</strong>mer hysterischer werdenden politischenKommunikation. Lassen Sie mich das etwas schematisch erläutern.Alle Entscheidungen haben eine Vorgeschichte, haben dem gesellschaftlichenWandel unterliegende Voraussetzungen, stehen <strong>im</strong> Streit konkurrierenderInteressen. Einem Referentenentwurf aus einem Ministerium magman das schon ansehen. Wichtig ist er nicht. Wenn er an das Licht derÖffentlichkeit gebracht wird, kennt ihn der zuständige Minister nicht einmalunbedingt. Es ist noch ein weiter Weg bis zur Kabinettvorlage, dievöllig anders aussehen kann. Das hält Medien nicht davon ab, den Inhaltdes Referentenentwurfs als Entscheidung oder politisch bereits abgest<strong>im</strong>mtePlanung zu präsentieren und Empörung darüber zu entfachen.<strong>Die</strong> Regierung hat in so einem Fall nicht mehr die Möglichkeit, sich einenErkenntnisstand aufschreiben zu lassen, ihn zu beraten und schließlicheine politische Richtung vorzugeben. Kommt es trotz voreiliger Empörungzu einem Kabinettsbeschluss, entsteht der Eindruck, die Angelegenheit seientschieden. Das st<strong>im</strong>mt aber nicht. Nur wenige Gesetzentwürfe verlassen23
den Bundestag so, wie sie eingebracht worden sind. In der letzten Legislaturperiodeblieben von 405 Gesetzentwürfen (ohne völkerrechtliche Verträge)nur 79 unverändert. Mit dem Beschluss der Regierung fängt dieeigentliche Entscheidungsprozess also überhaupt erst an. Aber natürlichhatten schon zuvor zahlreiche Abgeordnete der Versuchung nicht widerstehenkönnen, eine verfrühte 20-Zeilen-Meldung über einen 40-seitigenReferentenentwurf zu kommentieren. Auch dadurch wird „vergessen”,dass das Parlament entscheidet.Kommt – mit einem Votum des Bundesrats versehen – der Regierungsentwurfschließlich <strong>im</strong> Parlament an, machen sich die Parlamentarier <strong>im</strong>Plenum und in den Ausschüssen darüber her – <strong>im</strong> Plenum und bei denAnhörungen der Experten und Interessenten öffentlich. Erst in der drittenLesung kann es zu einem Beschluss kommen. Sie wissen das natürlich,wie Sie auch wissen, dass das Verfahren in Grenzen variabel ist. Grundsätzlichwill ich aber unterstreichen, wie langsam der parlamentarischeEntscheidungsprozess in aller Regel ist. Er MUSS relativ langsam sein,weil er nicht nur in der Sache sorgfältig und fair bei der Balance zwischenkonkurrierenden Interessen und Ansichten sein muss, sondern vorallem auch transparent. <strong>Die</strong> Einhaltung der festgelegten Verfahren dientder Transparenz. Das ist die Einladung an alle Bürger, mitzudenken, sicheinzumischen, sich Urteile zu bilden. Weil dieser zutiefst demokratischeProzess sich den Darstellungsformen von Medien nicht oder nicht gänzlichunterwerfen lässt, wird er heute in einzelne, eher unterhaltende„events” zerlegt. Denn der marktgängigen Zerstreuung durch <strong>im</strong>mer neueReize ist diese Langsamkeit und Ernsthaftigkeit hinderlich. Es gibt nochJournalisten, die diese Prozesse genau und langfristig beobachten unddarüber berichten, über das Sachlich-Politische ebenso, wie über dasPersönlich-Politische an diesem Lern- und Entscheidungsprozess. Aberwas liest und hört der größte Teil des Publikums? „Regierung plant...”;„Regierung ändert Kurs”, „Koalition streitet”, „Mehrheit der Koalitionsicher?”, „Kanzler erleidet Schlappe”, „Minister macht in Ausschau Rückzieher”,„Merz knickt ein”, „Regierung bessert nach”, „Opposition verlangtSondersitzung”, „Opposition rügt Bundestagspräsident”; „Ströbelest<strong>im</strong>mt nun doch zu”, „Regierung gerettet”.9. Der Streit ist das Wesen der Demokratie und kein SkandalAuf diese Weise kann man jeden Gesetzgebungsprozess medial begleiten,ohne auch nur ein einziges Mal in den Text geschaut oder sichsonstwie mit dem Gegenstand des politischen Streits befasst zu haben.24
Der Streit ist das Wesen der Demokratie, er ist kein Skandal, keineNeuigkeit, sondern eine alltägliche und unausweichliche demokratischeNormalität. Neu sind jeweils die Gegenstände des Streits, variabel ist dasAusmaß der Gegensätze und Unterschiede, die streitig sind. Unterhaltenderscheint aber zu sein, diese Normalität zur Sensation umzudeuten– und so ganz nebenbei die Aversion des Publikums gegen Streitereientendenziell auf die Demokratie zu übertragen.<strong>Die</strong> Zerlegung eines Entscheidungsprozesses in einzelne „events” vonSiegen und Niederlagen ist problematisch, da sie zur Verdunkelung derHintergründe, der wirksamen Interessen führt, absichtslos oder absichtsvoll.Gefährlich wird sie nicht allein durch das Schüren antidemokratischerRessent<strong>im</strong>ents, sondern auch, wenn die politischen „events” mit anderenkonkurrieren: „Ehekrach bei (hier kann der Name eines beliebigen Prominenteneingefügt werden)”; „Frau x doch geliftet”; „Y steht zu seinenSchönheitsoperationen”; „feige Flucht des Fußballtrainers Z”; „Bild rettetWeihnachtsgans” – solche für die Allgemeinheit folgenlosen Neuigkeitenerscheinen gleichgewichtig, <strong>im</strong> Boulevard sogar wichtiger als die Bemühungenum die öffentlichen Angelegenheiten. <strong>Die</strong> Suggestion ist, dass dieneue Freundin von Boris Becker oder Oliver Kahn genauso wichtig ist,wie eine vorgezogene Steuersenkung oder der Angriff von Rechtsextremistengegen einen ihnen fremd erscheinenden Passanten.Dass es um die Unterscheidung zwischen wichtig und unwichtig <strong>im</strong>merseltener geht, erkennt man auch daran, dass in den Redaktionen nichtmehr so häufig wie früher gestritten wird, was in welcher Länge anwelcher Stelle der Zeitung stehen soll oder gesendet wird. Man sagt mir:Unter Verkaufsgesichtspunkten stehe bereits fest, was, weil es personalisierbar,skandalisierbar, Empörung generierend und Vorurteile bestätigendist, auf die ersten Seiten komme. Nun, Sie müssen besser wissen,ob ich das richtig gehört habe. Es wäre jedenfalls ein Alarmsignal, ja einSargnagel für den politischen – auch den wissenschaftlichen und kulturellenQualitätsjournalismus, wenn wichtig nur noch ist, was Quote bringt.<strong>Die</strong> alltägliche parlamentarische Güter- und Interessenabwägung wirddem Vorurteil geopfert, den Politikern gehe es nur um sich selbst, allenfallsum den Erhalt der Macht der je eigenen Partei.10. Bisher haben Medien die zur Meinungsbildung nötigeDifferenzierung gebotenIch will mich nicht beklagen, aber nüchtern einige Veränderungen nennen,die zu dieser Verzerrung der Wirklichkeit beitragen:25
Anders ist bisher gewesen, dass Unterhaltung einschließlich Klatsch undTratsch ihren eigenen Platz hatte: best<strong>im</strong>mte Zeitschriften waren daraufspezialisiert und sind es noch heute; in den Zeitungen gab und gibt esdafür best<strong>im</strong>mte Seiten, Spalten, bei denen der Leser sofort merkte: hierwird gemenschelt, nicht mehr nur hart gearbeitet. Jetzt wird beides miteinandervermischt. Es gibt in den tagesthemen oder noch deutlicher <strong>im</strong>„heute-journal” gelegentlich Beiträge, nach denen man Nina Ruge alsModeratorin erwartet, aber nicht Klaus Kleber.Anders ist bisher gewesen, dass über einen Referentenentwurf berichtetworden ist, jetzt empört man sich darüber, inszeniert man Empörung.Anders ist bisher gewesen, dass man mit etwas Mühe durch täglicheZeitungslektüre die politischen Prozesse verfolgen und einordnen konnte.<strong>Die</strong>se Mühe wurde dem Publikum bedenkenlos zugemutet! Jetzt schlägtdie Quote durch auf Nachrichtenauswahl und -aufbereitung.Anders ist bisher gewesen, dass Medien die zur Meinungsbildung nötigeDifferenzierung angeboten haben. Jetzt ist dafür keine Zeit, <strong>im</strong> Fernsehenschon gar nicht.Anders ist bisher gewesen, Politik zu kommentieren als sozial oderunsozial, machbar oder unrealistisch. Jetzt ist sie wahr oder unwahr, gutoder böse. So wird sie der Meinungsbildung enthoben und erhält religiöseZüge. <strong>Die</strong> Gegenaufklärung siegt posthum, obwohl es gar keineabsichtsvollen Gegenaufklärer mehr gibt.Anders ist bisher gewesen, dass eine Nachricht von gestern auch heutenoch einer Betrachtung wert gewesen ist. Jetzt glaubt man, man müsseständig etwas Neues bieten, auch wenn es gar nichts Neues gibt. <strong>Die</strong> Jagdnach Neuigkeiten rechtfertigt sogar, aus Gerüchten Nachrichten zu machen.Anders ist bisher gewesen, dass Medien auch über Sachfragen geschriebenhaben. Jetzt werden Sachverhalte, die nicht bebildert werden können, entwederüber Personen transportiert oder fallen, wo auch das schwierig ist,ganz unter den Tisch.Anders ist bisher gewesen, dass Ursachen von Fehlentwicklungen analysiertwurden. Jetzt wird, weil dafür keine Zeit sei oder das Diktat derUnterhaltung es verbietet, nach Schuld gefragt. Als ob sich ein Problemdadurch lösen ließe, dass man einen Sündenbock an den Pranger stellt.11. Skandalisierung führt zu Respektverlust<strong>Die</strong>se Veränderungen sind scheinbar graduell. Ihre Wirkung aber kannerheblich sein.So, wie sich schleichend Unterhaltung vom Mittel zum Zweck wandelt,26
haben sich charakteristische Rahmenbedingungen des Journalismus zudominanten Zwängen gewandelt. Wirtschaftlichkeit war schon <strong>im</strong>mernotwendig. Sie plagte Verleger und Veranstalter und sei es durch denAnspruch, mit den Rundfunkgebühren auskommen zu müssen. Personalisierungwar durchaus schon <strong>im</strong>mer ein Transportmittel auch fürpolitische Inhalte gewesen. Knapper Platz und wenig Zeit sind keineneuen, sondern charakteristische Herausforderungen des Journalistenberufs.<strong>Die</strong> Versuchung war auch in diesem Metier schon <strong>im</strong>mer groß,ein Ergebnis mit möglichst geringem Aufwand zu erzielen. Autoren, diestatt etwas zu wissen und darüber zu berichten, bloß etwas meinen unddas aufschreiben oder senden, sind kein neues Phänomen. <strong>Die</strong> Herausforderungan den Journalisten, so zu berichten, dass das Publikum denBericht versteht, ist so alt wie der Beruf selbst. <strong>Die</strong> Schlagzeile hatteschon <strong>im</strong>mer die Aufgabe, Interesse und Kauflust des Publikums zuwecken. Übrigens Politiker haben sich auch schon <strong>im</strong>mer über das eineoder andere Ergebnis journalistischen Schaffens geärgert, weil sie ganzallgemein ihr Eingebunden-Sein in Umstände nur unvollständig wiedergegebenfinden. Jetzt wird von den komplizierten Umständen oft völligabgesehen, weil sie als zu schwierig gelten – oder weil Redakteure dieseUmstände gar nicht mehr kennen.<strong>Die</strong> Veränderungen haben Folgen, nicht nur für den Journalismus, sondernvor allem für Politik und Demokratie. Das beginnt mit dem Ansehensverlustder demokratischen Institutionen, der längst das Niveau fasttotaler Respektverweigerung erreicht hat und endet nicht mit dem Erfolgpopulistischer Gruppierungen oder Personen in verschiedenen europäischenLändern einschließlich des Bundeslandes Hamburg oder etwadem Ergebnis der Gouverneursabwahl in Kalifornien. Damit sage ichnicht, dass in erster Linie oder gar ausschließlich die Medien/die Journalistendaran „schuld” seien. Nein, wahrlich und vor allem Politiker.12. Politiker, die in den Medien nicht stattfinden, existieren nichtDenn die Art und Weise, wie Politiker versuchen, mit dieser neuartigenMedienwelt umzugehen, scheint mir eher geeignet, die beschriebenenEffekte zu verstärken als sie zu korrigieren. Eine Redaktion muss dochdem Größenwahn verfallen, wenn sie um der die Auflage steigerndenEmpörung willen mit einen Fall von Missbrauch sozialstaatlicher Leistungenaufmacht und die Politik in allerkürzester Zeit über dieses Stöckchenspringt. Alltäglicher ist, dass auch Politiker <strong>im</strong>mer wieder glauben,Neuigkeiten produzieren zu müssen, weil sie nur so in den Medien27
vorkommen. Es hat mir schon eine Menge Häme eingebracht, was ichjetzt hier ungerührt zu wiederholen mich traue: Politiker sind eherGetriebene, die den Marktgesetzen der Medien Unterworfenen als diegestaltenden Inszenierer ihrer Medienauftritte. Alle angeblichenGegenbeispiele, die Journalisten mir auf diese These anbieten, übersehenden entscheidenden Ausgangspunkt: Politiker, die in den Mediennicht stattfinden, existieren nicht. Sie sind auf die Medien angewiesen,wenn sie nicht den Makel der Untätigkeit riskieren wollen. Sind aberumgekehrt die Medien ebenso auf die Politiker angewiesen? Das giltallenfalls teilweise. Natürlich würde die Talk-Show nicht funktionieren,wenn kein Politiker teilnähme. Zum Glück für Sabine Christiansen sorgtaber die Zusage aus der einen Partei dafür, dass auch die anderen sichnicht verweigern. Und ebenso klar ist, dass diejenigen, deren Metier esist, aus dem Parlament zu berichten, auch auf Parlamentarier angewiesensind. Deswegen erscheint aber längst nicht jeder Parlamentarier inder Zeitung oder <strong>im</strong> Fernsehen. Dafür muss er etwas besonderes machen– beispielsweise seiner eigenen Fraktion gewaltigen Ärger, oder seinschwer vermittelbares Tun durch symbolhafte Bilder oder Aktionen inszenieren.Ich kritisiere das nicht, wenn die Inszenierung der Darstellungdes persönlichen und politischen Profils dient. Darauf hat die ÖffentlichkeitAnspruch. Aber wenn die Regeln des Infotainment zum Selbstzweckwerden, ist die Grenze des Zuträglichen überschritten. Leichter hates, wer prominent ist. Prominenz aber ist kein Privileg von Politikern. Prominentegibt es zu hauf. Manche Medien schaffen sich ihre Prominenteninzwischen selbst, mit denen sie dann Seiten und Sendezeit füllen.Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie hat aus Anlass der Schwarzeneggerwahlseine These wiederholt: Wirtschaft, Unterhaltung und Politikseien zu einer virtuellen Unterhaltungsökonomie zusammengewachsen,deren oberste Positionen durch Medien-Prominenz besetzt werden.„(...) wehe dem”, schreibt er, „der sich der Mediengewalt – wie der abgewählteGouverneur Davis – verweigert.”13. Prominenz wird zum eigentlichen Kriterium,das Parlament zum „Show-Room”Nach dem unrühmlichen Abgang von Roland Schill oder der Selbstzerfleischungder niederländischen Partei des ermordeten P<strong>im</strong> Forteynhatte ich auf einen Lerneffekt gehofft. Dass Wähler ebenso wiekoalitionsbedürftige Politiker der Personalauslese wirklich politischerParteien wieder mehr zutrauen. Sie erhöht jedenfalls die Chance,28
einigermaßen professionelle Parlamentarier oder Koalitionspartner zuwählen, die sich auch für Stabilität in der Demokratie verantwortlichfühlen. Nicht nur Kalifornien weckt neue Zweifel: Prominenz wird zumeigentlichen Kriterium – nach Macht, Unterstützerkreisen und Interessen,nach Kompetenz und Professionalität muss nicht mehr gefragt werden.Das einzige politische Programm ist die schon bestehende Prominenzdes Kandidaten. Der Boulevard hat uns schon vergessen lassen, dassProminenz lediglich Bekanntheit bedeutet und längst noch nicht Kompetenz.Bei Herrn Schwarzenegger fiel auf, dass ihm in Kalifornien wieauch in „Bild” der Einfachheit halber die Eigenschaften seiner Filmrollenzugeschrieben wurden.Angesichts dieser Entwicklung beharre ich geradezu störrisch darauf,dass Politik nicht in erster Linie Spaß machen kann, es nicht einmaldarf. Das Parlament ist die Bühne zur Präsentation politischer Meinungenund Vorschläge, aber es darf nicht zum „Show-Room” verkommen.Im Parlament wird es Ernst. Hier werden die öffentlichen Angelegenheitenbehandelt, die alle Bürger etwas angehen, sie <strong>im</strong> Zweifel allebetreffen. Eine Parlamentsentscheidung ist kein pop-kulturelles „event”,sondern ein ernsthafter Vorgang mit Folgen.14. <strong>Die</strong> Bundesregierung legt Focus auf„Arbeits- und Durchsetzungskommunikation”Nun werde ich nicht leugnen, dass es Politiker gibt, die es auf schongeniale Weise verstanden haben, die Medien für ihren Weg ins Kanzleramtoder in die Downing Street 10 zu nutzen. Man nennt das „Darstellungskommunikation”.<strong>Die</strong> Bundesregierung hat inzwischen längstden Schwerpunkt ihres Kommunikationsverhaltens auf die „Arbeits- undDurchsetzungskommunikation” verlagert. Der Kanzler riskiert heute seinAmt, um Entscheidungen durchzusetzen, von deren Notwendigkeit erüberzeugt ist und scheut nicht den langen Atem, auch die Wählerinnenund Wähler schließlich zu überzeugen. <strong>Die</strong> jetzt eingeleiteten Veränderungensind nach Quantität und Qualität in vergleichbarem Umfang nochvon keiner Regierung gewagt worden. „Bild” hindert das nicht, das ältesteantiparlamentarische Vorurteil hervorzukramen, „Blablabla”, Politikerredeten nur und würden nichts tun. „Tut endlich was!” hieß es <strong>im</strong> klarenWiderspruch zur politischen Wirklichkeit. Wenn wir wieder so weit sind,das Parlament als „Schwatzbude” abzutun, obwohl es keine ist, befindenwir uns erneut auf einem Weg, auf dem schon 1848 und 1933 alle demokratischenHoffnungen und individuellen Freiheiten geopfert worden waren.29
15. Mut zur partiellen „Entschleunigung”Lassen Sie mich zum Schluss ein paar Wünsche aussprechen, in derHoffnung, dass die beschriebene Veränderung, die Diktatur der Unterhaltungnicht unumkehrbar geworden ist. Kommerzialisierung, damiteinhergehend Skandalisierung, Personalisierung, Reduzierung, unangemesseneMoralisierung, der Fetisch der <strong>im</strong>mer neuen Neuigkeiten, dieVerdrängung sachlicher, realitätsverbundener Beurteilungen gelingen,weil ihnen die Widerlager fehlen: die aufklärerische Ethik, der Versucheiner Selbstbeschränkung auf die Vermittlung der Lebenswirklichkeit,statt des hybriden Versuchs, die Wirklichkeit zu erschaffen, der Mut zurwenigstens gelegentlichen oder partiellen Entschleunigung, damit Zeitgewonnen wird für Differenzierungen, für den Erwerb von Sachkundeauch auf Seiten des Redakteurs, der Mut, dem Publikum auch etwaszuzumuten und sich dessen Kritik auszusetzen, das Selbstbewusstsein,für die Unterscheidung von wichtig und unwichtig auch zukünftiggebraucht zu werden; eine Binnenpluralität, wie sie bei öffentlich-rechtlichenMedien <strong>im</strong>merhin noch gelegentlich möglich ist, das wären einigedieser Widerlager, auf die es ankommt.Gerade wenn ökonomischer Druck zu mehr Zusammenarbeit und zumehr Konzentration in der Branche führt, brauchen wir klarere und verlässlicheGarantien für innere Pressefreiheit. Das ist ein komplexesThema, es zu regeln, ist vor fast 30 Jahren gescheitert und seither nichtmehr öffentlich diskutiert worden. Jetzt gehört es wieder auf die Tagesordnung.Journalistische Qualität muss sich gegen die Zwänge kommerziellerLogik und gegen das Diktat der Unterhaltung durchsetzen können. Dasist nicht nur eine Frage journalistischer, sondern auch eine Frage verlegerischerVerantwortung. Handelt es sich bei letzterer doch nicht nur umeine Verantwortung für die Profitabilität der Verlage, sondern auch umeine Verantwortung für die Demokratie. Dem Leser nach dem Munde zuschreiben, ihn zu unterfordern, ist wie eine Kapitulation; es ist diescheinheilige Verlagerung von Verantwortung an das Publikum.Verleger, Intendanten, Redakteure müssen diese Verantwortung schonselbst wahrnehmen, indem sie beispielsweise wieder den Mut entwickelndem Publikum auch schwierigere Kost zuzumuten. Sonst werdensie überflüssig: ungeprüfte und nicht gewichtete Information gibt esschließlich schon <strong>im</strong> Internet.Wenn politische Information unter dem Diktat der Unterhaltung schnell,flott, spannend, spaßig, hämisch, persönlich zu sein hat, werden sich30
die Produkte und die Informationen <strong>im</strong>mer mehr angleichen. Pluralitätder Medien wird zu bloßer Vielfalt der Stile. Schon jetzt gibt es zu vieleNachrichten, die nicht erscheinen. Das reicht von den schwierigen Materiender Forschungs- und der Infrastrukturpolitik bis zu „vergessenenKriegen” oder der Bioethik. Medienkritik, die auch das Handeln derVerleger einbezieht, ist hier ebenfalls zu erwähnen. Sie ist mindestensso notwendig, wie sie derzeit selten ist. Einförmigkeit und „Sparjournalismus”gefährden am Ende die Vielfalt der Medien und auf diese Weisedie Demokratie selbst.Es ist umgekehrt unvorstellbar, dass sich die parlamentarischen Verfahrenan die Verwertungsinteressen der Medien anpassen könnten.Wenn, dann nur um den Preis demokratischen Substanzverlustes.Übrigens nicht nur wegen des Verlustes an Transparenz und Sorgfalt.Der Ertrag größerer Aufmerksamkeit bliebe wahrscheinlich trotzdem aus,weil Unterhaltungskünstler einfach die besseren Unterhalter sind. <strong>Die</strong>senWettbewerb würde die Politik also auch nach einer solchen Anpassungverlieren. Besser also, sie bleibt bei ihren Leisten. Ich werbe also beiIhnen: Seien Sie Verbündete, die den Ernst von Politik respektieren,Demokratie verständlich machen – ohne langweilig sein zu müssen!Ich wurde einmal gefragt, was ich davon halte, dass in einer der vielenüberflüssigen Umfragen – die Frage war, welche Politiker auch alsFernsehunterhalter vorstellbar wären – niemand auf meinen Namengekommen sei. Ich war erleichtert und fühlte mich verstanden.31
KAMPAGNENFÜHRER BILD – EIN REDEDUELLHans Leyendecker, Süddeutsche ZeitungDuelle müssen sein, zumal die Medien ihrenKunden Unterhaltung schulden. Wenn zweisich streiten, freuen sich Hunderte.Polemiken zwischen Journalisten aber sindbesonders erquickend, weil sie mit speziellerBosheit geführt werden. Denn es geht bekanntermaßennicht um den Sieg, sondernum den Kampf.Der Sieg wird ohnehin nachher von beidenParteien für sich in Anspruch genommen. Ichbefinde mich heute bei diesem Streitgesprächin einer möglicherweise schwierigen, vielleichtaber auch kommenden Lage. <strong>Die</strong>Meinungsoffiziere von Bild sind trotz allerBitten der Veranstalter nicht gekommen.Gestern Nachmittag rief mich eine Sekretärin des Hauptstadtbüros vonBild an. Herr <strong>Die</strong>kmann sei bekanntermaßen verhindert. Herr Kleine,Leiter des Hauptstadtbüros, wisse nicht genau, ob er abgesagt habe,aber er sage jetzt ab. Schade und Dankeschön. Wie soll da ein anständigesDuell zustande kommen? Und wie bekommen wir Polemik in derKürze?Das erinnert ein wenig an die alte Komödie „Fink und Fliederbusch” vonArthur Schnitzler, die 1917 erstmals aufgeführt wurde. <strong>Die</strong> Hauptakteurein Schnitzlers Stück sind Journalisten, also Lohnschreiber, die ihre Buchstabennach den Meinungen und Interessen derer setzen, die ihnen dasGehalt zahlen. Ziemlich aktuell also.Der Plot der Geschichte ist lebensnah. Ein junger Journalisten-Aufsteigerschreibt als Fink für die Wochenzeitung „<strong>Die</strong> elegante Welt”, in der ersich als sehr staatserhaltend erweist und der Aristokratie huldigt und alsFliederbusch schreibt er inkognito für die aufklärerisch-liberale Tageszeitung„<strong>Die</strong> Gegenwart”. Fliederbusch attackiert heftig Fink und am Endebleibt beiden nur das Duell in den Praterauen. Pistolen. 30 Schritte. Zunächst.Bei Fehlversuchen weniger Schritte. „Ich möchte wissen, wer ich bin?”sagt Fink/Fliederbusch. Keine schlechte Frage. „Ich kann schreiben nach32
jeder Richtung” hat Gustav Freytags Schmock gesagt. Das galt für Vertreterdieser Branche zu allen Zeiten.Also, noch einmal zu den Regeln: Ich stelle heute die Fragen und gebemir die passenden Antworten – der Traum vieler Feuilletonisten und derAlltag des Leitartiklers. <strong>Die</strong> Zitate sind – bis auf ein paar Übergänge –authentisch, aber nicht für diesen Zweck autorisiert. Am meisten habeich mich bei Bild-Chefredakteur Kai <strong>Die</strong>kmann bedient, aber auch einigeseiner Kollegen, wie bspw. Politikchef Jörg Quoos, kommen zu Wort. Ichdanke den Herren, es handelt sich ausschließlich um Herren, schon malvorab für das Gesagte.Frage: Ich möchte mit Ihnen heute über den Kampagnenführer Bild reden.Wie viel Macht haben Sie?Bild: Mir sind Chefredakteure, die stolz auf ihre angebliche Macht sind,ein Gräuel. Ich verstehe mich nicht als mächtiger oder gar mächtigsterZeitungsmann, sondern als politischer Journalist. Ich war <strong>im</strong>mer leidenschaftlichan Politik interessiert, war lange Parlamentskorrespondent,habe politische Bücher geschrieben.Frage: Sie waren, nur zur Erinnerung, für Bild und für Bild am Sonntag inBonn. Sie sind Co-Autor von Standardwerken wie Helmut Kohls Hagiographie„Ich wollte Deutschlands Einheit”.Bild: Viel Feind viel Ehr, offenbar sind Ihnen Neidgefühle nicht fremd.Aber ich weiß: Wer den Arsch aus dem Fenster hält, muss auch damitrechnen, dass es regnet. Im Übrigen halte ich es mit Harry S. Truman:„Wer die Hitze nicht verträgt, gehört nicht in die Küche.”Frage: Seit ihrem Amtsantritt <strong>im</strong> Januar 2001 fahren Sie Kampagne nachKampagne.Bild: Ihre Behauptung ist Unfug. Bild ist die größte und wichtigsteZeitung Deutschlands, selbstverständlich auch politisch. Wir stoßengroße Debatten an, die von anderen Medien gern aufgegriffen werden.Journalisten sollen Politik kritisch und fair begleiten.Bild setzt auf die Themen, die Millionen Menschen bewegen. Ich bin keinKampagnero.Frage: In einem Interview mit der Zeitung Horizont <strong>im</strong> Mai 2002 haben sieselbst mal eingeräumt, Kampagnen-Journalismus zu machen.Bild: Das war doch etwas völlig anderes. Ich habe in diesem Interview33
nur gesagt, dass wir Kampagnen für die Leser machen. Zum Beispiel,wenn sich die Menschen bei der Euro-Rechnung über den Tisch gezogenfühlen und die Politik einfach nicht reagiert. Bild versteht sich <strong>im</strong> bestenSinn als Anwalt des kleinen Mannes. Dabei ist Bild <strong>im</strong>mer überparteilich.Wir können nur einen Trend abschwächen oder verstärken.Frage: Sie haben Anfang 2001, kurz nach Ihrem Amtseintritt bei Bild, einFoto des grünen Umweltministers Jürgen Trittin veröffentlicht. Es zeigt ihnbei einer Demonstration in Göttingen <strong>im</strong> Kreis anderer Demonstranten. Inder Bildunterschrift behauptet Bild fälschlich, Trittin habe einen Bolzenschneiderin der Hand und ein anderer Demonstrant trage einen Schlagstock.Beides st<strong>im</strong>mte nicht. Eine Fälschung also.Bild: Das Foto, das uns vorlag, ist weder verfälscht noch manipuliertworden. Es zeigt Jürgen Trittin an der Seite von vermummten Chaoten.Bei der Beschriftung ist uns allerdings ein Fehler unterlaufen.Frage: Da wurde Trittin fälschlicherweise ein Bolzenschneider zugeordnetund ein Seil wurde zum Schlagstock. Einen Fehler nennen Sie das?Bild: Wo gearbeitet wird, werden Fehler gemacht. Es darf nicht passieren,aber es ist passiert. Wenn es in den vergangenen Jahren überhaupt eineKampagne gegeben hat, dann war es eine Kampagne gegen den Axel-Springer-Verlag. Da wurde von außen der Versuch gemacht, unabhängigeJournalisten einzuschüchtern.Frage: Es fällt auf, das sie <strong>im</strong>mer wieder die derzeitige Regierung und davor allem die Bündnisgrünen unter Feuer nehmen. In der Affäre um dieBonusmeilen vor der Bundestagswahl 2002 attackierten sie besondersheftig grüne Politiker.Bild: Uns ging es darum, unsere Leser über das Verhalten ihrer politischenVertreter zu informieren. Das Abfliegen dienstlicher Bonusmeilenist sicherlich kein Weltuntergang, aber die Frage ist, ob unseren Politikernklare Regelungen, deren Verletzung bei jedem Arbeitnehmer zufristlosen Kündigungen führen würde, eigentlich völlig egal sind.Frage: <strong>Die</strong> Frage ist auch: Warum es fast nur Grüne getroffen hat. Warumerfuhren wir beispielsweise nichts über FDP-Politiker?Bild: <strong>Die</strong> angesprochenen FDP-Politiker, Wolfgang Gerhardt und andere,konnten schriftlich nachweisen, dass sie die gesammelten Meilen dienstlichverwendet haben. Im Übrigen bewegte das Thema die Menschen,sonst hätte es nicht diesen Raum in allen Zeitungen und Nachrichtensendungenbekommen.34
Frage: In Berichten über die wilde Jugend von Joschka Fischer zeigte Bilddekorativ den RAF-Stern. Was hatte das mit Journalismus zu tun?Bild: Wir haben sachlich berichtet und sind <strong>im</strong>merhin mit einem Kommentaraufgefallen, der die Person Joschka Fischer sehr differenziert beurteilthat. Peter Boenisch schrieb über Fischers Vergangenheit: „Heuteentscheiden allein seine diplomatischen Ergebnisse und nicht die Bilderaus einer beiderseits gewalttätigen und hasserfüllten Vergangenheit.”Frage: Sie lassen jagen und salben die Wunden, wenn es Ihnen gefällt. Wieist eigentlich das Verhältnis von Bild zum Kanzler? Gerhard Schröder wird jader Satz zugeschrieben, dass er Bild, BamS und die Glotze brauche. Im Kabinettklagte Schröder dann <strong>im</strong>mer wieder über die Kampagnen von Bild.Bild: Zur Zeit von Helmut Kohl waren Spiegel und Stern die bösen Buben.Jetzt soll es Bild sein. <strong>Die</strong> gleichen Medien, die uns vorgeworfen habeneine Kampagne gegen die Regierung zu fahren, haben uns später genaudas Gegenteil angekreidet. Wenn Kanzler Schröder den Satz über Bild,BamS und Glotze je gesagt haben sollte, dann war das nichts weiter alsein flotter Spruch. Das ist nicht durch Tatsachen gedeckt, auch nichtdurch die vermeintlichen Planspiele eines medienerfahrenen Kanzlers.Frage: Kann es nicht sein, dass Sie die Realität durch einen Sehschlitzbetrachten? Im Wahlkampf hatte Bild, anders als alle anderen, denKandidaten Edmund Stoiber bei Ted-Umfragen vorn. Dagegen war dieSPD meist ratlos. Wenn Bild die St<strong>im</strong>mung richtig wiedergegeben hätte,wäre Stoiber der klare Wahlsieger gewesen.Bild: Es gibt für Bild keinen anderen Platz als die politische Mitte. Ichordne mich dort ein, wo die politischen Themen liegen, die unsere zwölfMillionen Leser betreffen und interessieren.Frage: Sie betreiben <strong>im</strong>mer wieder übelsten Populismus, rücken denBundestag in die Nähe einer Schwatzbude. Politiker werden als Abzockerdiffamiert und als Versager: „Hört auf zu reden, macht was” standda neulich und dann kam der Ruf nach dem starken Mann: „Deutschlandbraucht viele Schwarzeneggers. Statt Blabla spricht er Klartext.”Bild: Wir rufen nicht nach dem starken Mann. Das gab der Text so nicht her.Es war die Debatte in Deutschland unter dem Eindruck dieses riesigen Wahlsieges.Ist das nicht auch für die deutsche Politik von Vorteil, dass sich jemand,der die Massen hinter sich bringt, außerhalb der Politik in die Politikbewegt und versucht etwas daran zu verbessern, innerhalb der demokratischenSpielregeln? Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen dazu.35
Frage: Sie verbreiten Antiparlamentarismus. Deutschland ist für Sie einGaga-Staat, das Parlament ein Hühnerstall. Jüngst haben Sie in einerKampagne behauptet, die EU-Abgeordneten wollten sich die Steuernhalbieren. Richtig ist, dass es praktisch ein Nullsummenspiel war. DerUnterschied zwischen dem alten und dem neuen System machte praktisch23 Euro <strong>im</strong> Monat aus.Bild: <strong>Die</strong>se neunzig Politiker wollten für sich selbst die Steuer halbieren.Und das war der Fakt.Frage: Das ist ein direkter Angriff auf die Parlamentarier.Bild: Das ist ein direkter Angriff auf die Parlamentarier.Frage: In der Steuerdebatte trommeln Sie populistisch seit fast einem Jahr.Bild: Also Kampagne will ich das nicht nennen, das ist eine sehrpointierte Berichterstattung, die <strong>im</strong> Grunde genommen auf sehr vielBeifall gestoßen ist. Viele Politiker haben sich in Bild dazu geäußert undhaben uns unterstützt in dieser Kampagne. Wochen nachdem wir dieseKampagne gestartet haben, hat auch der Bundeskanzler öffentlich versprochen:„Jawohl, wir ziehen die Steuerreform vor, obwohl es nochFinanzierungsschwierigkeiten gibt.”Frage: Sie haben dann gemeldet: „Endlich – auch der Kanzler gibt nach”. Daswar doch nur die Botschaft, dass Bild die Politik best<strong>im</strong>mt. Sie erfanden zehnneue Gebote: Verhaltensregeln für Politiker. Sind Sie <strong>im</strong> Rausch der Macht?Bild: Eine Zeitung wie Bild muss die Werte, die unsere Gemeinschaftzusammenhalten, pflegen: Familie, Solidarität, Treue, Respekt. Auch wenndas merkwürdig klingen mag: Letztlich ist es der Kanon der zehn Gebote,dem wir uns verpflichtet fühlen. Gerade eine Zeitung mit großenBuchstaben ist der Wahrheit doppelt und dreifach verpflichtet.Frage: Der Bild-Leser erfährt vor allem Geschichten aus der Gosse. In diesemJahr hat Bild fast 300 Geschichten über <strong>Die</strong>ter Bohlen gebracht.Bild: Ich bin überzeugt, dass sich Menschen für nichts mehr interessierenals für andere Menschen. Dabei geht es um Authentizität. <strong>Die</strong>terBohlen ist zum Beispiel eine Figur, die seit Jahren erfolgreich ist undpolarisiert. Natürlich hat auch der Bild-Vorabdruck dem Buch Flügelgemacht und für eine Punktlandung auf Platz eins der Bestsellertitelgesorgt, so wie das bei allen Buchtiteln ist, die wir vorab bringen. Aberein Bild-Chef wäre auch bescheuert und falsch am Platz, wenn er aufeinen satten, prallen Boulevardstoff verzichtete.36
Frage: Katja Kessler, die Frau des Bild-Chefredakteurs <strong>Die</strong>kmann, hat dieBücher von Bohlen geschrieben, die dann von Bild <strong>im</strong> Vorabdruck veröffentlichtwurden. Halten Sie das nicht für anrüchig?Bild: Nein. Ich habe darauf bestanden, dass Katja Kessler nicht am Umsatzbeteiligt wird. Damit keiner auf die Idee kommt, die Familienkassewäre via Bild aufgebessert worden.Frage: Bohlen-Gegner und dazu gehören auch diejenigen, die einstweiligeVerfügungen gegen das Buch durchgesetzt haben, werden von Bild heftigkritisiert, manchmal auch niedergegrätscht. Gehören solche Kritiken zurWertkette Bild-Bohlen?Bild: Wir berichten. Wir klären auf. Wir sind unabhängig. Ich muss nochmal was über Bohlens Bucherfolge sagen. Erstens ist er authentisch.Zweitens: Wir leben in einer atomisierten Gesellschaft, in der Menschennur sehr wenig verbindet. Ein <strong>Format</strong>, ein Typ wie <strong>Die</strong>ter funktioniert alssozialer Schmierstoff. Über ihn können Menschen reden und zwar unabhängigdavon, ob sie ihn bejubeln oder doof finden.Frage: Im Vorjahr haben Sie das Spektakel um die Familie Wussow vermarktet.Klaus-Jürgen Wussow, der alternde Serienschauspieler, der mitFrau Scholz, der Witwe von Gustav Scholz zusammenlebt und YvonneWussow, die erfolglose Journalistin. Ich lesen Ihnen mal ein paar E-Mailsvor, die ein Bild-Reporter Frau Wussow geschrieben hat:Liebe Frau Wussow, morgen gibt es in Bild übrigens eine dicke Überraschung.Es ist doch etwas langweilig, wenn <strong>im</strong>mer nur Klaus<strong>im</strong>ausi oderBienchen reden, oder nicht? Honorar wie üblich.Oder: „Na, na, na Frau Wussow. Warum so sensibel auf einmal? Haben Sienicht Lust auf ein Interview über das neue Ehepaar? Über ein Honorarkönnen wir gerne reden.”Oder: „Ich hoffe, Sie werten es als Zeichen der Fairness, das wir dieGeschichte bisher nicht gemacht haben. Sie sollten sich mal ernsthaftüberlegen, was Sie mit Ihrer Verweigerungshaltung hier bewirken.”Bild: Exklusivgeschichten fallen ja nicht vom H<strong>im</strong>mel. Da müssen dieKollegen hart und erfolgreich arbeiten. Ich glaube an guten Boulevard-Journalismus. Wir müssen um gute Stoffe, gute Fotos, gute Schlagzeilenkämpfen.Frage: Wen bewundern Sie eigentlich?Bild: Ich bewundere den Papst: Für seinen Mut auch schwierige Themenanzufassen, für sein Bekenntnis zur Unterscheidung von Gut und Böse,37
für sein Bekenntnis zum Leben und zur persönlichen Verantwortung, fürseinen Antikommunismus, für seinen Antikapitalismus, für die Kraft mit derer die katholische Kirche wieder zur höchsten moralischen Instanz derwestlichen Welt gemacht hat. Für seine überragende politische Rolle.Frage: Danke, das reicht.Ein paar Fragen, ein paar Antworten aus dem Off, die so glatt und abgeschliffensind, dass man sie eigentlich nicht <strong>im</strong> Original hören muss. Bildist eine Macht, weil viele vor Bild kuschen. Da ist das Publikum, das dieDummacher-Droge Bohlen/Naddel/Effenberg braucht wie der Junkie dieNadel. Da sind die Journalisten, die sich von dem Boulevardblatt Themenvorgeben lassen und manchmal – wie <strong>im</strong> Fall Sebnitz – erbärmlich reinfallen.<strong>Die</strong> Kampagne um Florida-Rolf, der in Miami deutsche Sozialhilfebezieht und darob von Bild als Abzocker angeprangert wurde, war daseine: Das andere war die Reaktion der Politik. Ein Florida-Rolf-Gesetzwurde geschustert, damit Bild Ruhe gab. <strong>Die</strong> Politik macht sich nochkleiner als sie ist und manche Parlamentarier entblöden sich nicht, diezehn Bild-Gebote in ihrem Büro aufzuhängen und sich dabei fotografierenzu lassen. Da ist das Feuilleton, das sich von Bild mit Stoffen fütternlässt, als müsste es sofort verhungern.Da ist ein Schriftsteller wie Martin Walser, der neulich vom SZ-Magazingefragt wurde, ob er sich in die, ich zitiere, „durchaus ehrenvolle Traditionvon Goethe, Thomas Mann und <strong>Die</strong>ter Bohlen als Skandalautor” seheund Walser hat geantwortet: „Wenn Sie Thomas Mann weglassen, ja”.Inszenierungen werden als Realität ausgegeben. Lüge und Wahrheitkommen <strong>im</strong> Plural vor. Am Ende enden wir mit Schnitzler und Fink/Fliederbusch: Alles wird austauschbar.Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.38
PANEL 1: „DIE MACHT DER KAMPAGNEN UNDDIE SCHWÄCHE DES PARLAMENTS”Hans Leyendecker, Frank Bsirske, Heribert PrantlIm Folgenden sind die Aussagen der verschiedenen Teilnehmer des Panelszu den einzelnen Fragen dokumentiert und hintereinander montiert. <strong>Die</strong>Reihenfolge der Darstellung ist also konstruiert.1. Ist das Thema „Kampagnen” und „Kampagnen-Journalismus”eine neue Erscheinung? Haben sie eine neue Qualität?Hans Leyendecker, (Süddeutsche Zeitung):Das Thema ist nicht neu: Über Kampagnen und Kampagnen-Journalismushat Karl Kraus Bücher geschrieben. Er leuchtete in den Sumpf der Kameraderieund Verfilzungen der Wiener Cliquen hinein, die sich auf Gegenseitigkeitlobten und gemeinsam Kampagnen starteten. Kraus wies nach,dass nur dann redaktionelle Angriffe aufhörten, wenn Inserate der angegriffenenInstitutionen erschienen.Frank Bsirske, (Vorsitzender der Vereinten <strong>Die</strong>nstleistungsgewerkschaft - ver.di):Kampagnen sind nicht neu, und Kampagnen sind legit<strong>im</strong>, wenn sie demokratischlegit<strong>im</strong>iert und transparent sind. Auch Gewerkschaften haben seitjeher inhaltliche Schwerpunkte gesetzt und in Form von Kampagnen bearbeitet.Springers Aktion „Macht das Tor auf” in Zeiten des kalten Kriegesoder Löwenthals „Konservative Aktion” waren typische Kampagnen ausdem rechten Lager heraus. Sie waren aber bescheidener und offener angelegtals heutige wie „BürgerKonvent” oder „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.”Kaum je aber waren Kampagnen so gut finanziell dotiert undzugleich so undurchsichtig, so breit und professionell aufgebaut wie heute.2. Was ist die Ursache für die Entstehungeiner Vielzahl neuer Kampagnen?Hans Leyendecker:Heutzutage sind Kampagnen häufig der Versuch, auf das eigene Produktaufmerksam zu machen – ich skandaliere, also bin ich. Hinter schlecht gemachtenKampagnen versteckt sich auch die Illusion von Journalisten,am Leben teilzuhaben.39
Frank Bsirske:Politikverdrossenheit ist eine der Quellen; die für das bürgerlich-konservativeLager 1998 verlorene Regierungsgewalt stellt eine weitere dar.Über fragwürdige Kampagnen, hochprofessionell gemanagt, wird Druckauf die Politik aufgebaut und Raum für demokratisch nicht legit<strong>im</strong>ierteInteressen geschaffen.Heribert Prantl, (Süddeutsche Zeitung):Wir erleben, sagt Angela Merkel, „die zweiten Gründerjahre der Republik”.<strong>Die</strong> Interessenverbände, zumal die der Wirtschaft, verhalten sichentsprechend. In „Gründerjahren” geht viel, was früher nicht gegangenist und später nicht mehr geht. Das bisher Sichere ist nicht mehr sicher –auch Kernelemente, z.B. des Sozialstaats, können jetzt in Frage gestelltwerden.„Politik”, so hat Kurt Tucholsky vor 85 Jahren geschrieben, „Politik kannman in diesem Land definieren als die Durchsetzung wirtschaftlicherZwecke mit Hilfe der Gesetzgebung”. Schon lange war die Durchsetzungdieser Interessen auf breiter Front nicht mehr so einfach wie derzeit.<strong>Die</strong>se Chance wird von den diversen wirtschaftsnahen Kampagnengenutzt.3. Wer kann sich Kampagnen leisten oder kann unddarf man St<strong>im</strong>mung kaufen?Hans Leyendecker:Kampagnen können aber auch aufklären und ein Stück Aufklärungsein. Allerdings haben Journalisten, die über Missstände informierenwollen, einen schweren Stand. Wenn der Reiz der Neuheit verschwundenist, schlägt die St<strong>im</strong>mung des Publikums leicht um. Es verliert dieGeduld.Frank Bsirske:Leisten kann sich Kampagnen, wer Geld hat. <strong>Die</strong> Gewerkschaften betreibenKampagnen <strong>im</strong> Auftrag, legit<strong>im</strong>iert durch ihre Mitglieder und eingebundenin demokratische innere Strukturen. <strong>Die</strong> „Initiative Neue Soziale”Marktwirtschaft wird vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall finanziert.Der „BürgerKonvent” investierte etwa sechs Millionen Euro in seine Startkampagne,aber bis heute sind Weg und Herkunft des Geldes nicht eindeutigklar.40
4. Wer steckt oder wer versteckt sich hinter Kampagnen?Frank Bsirske:Undurchsichtigkeit ist geradezu Merkmal vieler solcher Kampagnen. Werzieht wirklich die Fäden und wer ist Galionsfigur? <strong>Die</strong> „Initiative NeueSoziale Marktwirtschaft” hat Politiker vieler Parteien in ihr Netz verstrickt:Von Edmund Stoiber über Michael Glos bis zu Christine Scheel von denGrünen, Staatssekretär Rezzo Schlauch und den Ex-Grünen-AbgeordnetenMdB Oswald Metzger, dazu Siegmar Mosdorf, aus dem Gewerkschaftslagerstammender Ex-Staatssekretär und heutiger Unternehmensberater,und der umtriebige Sozialdemokrat Peter Glotz – und all das finanziertvom Arbeitgeberverband Gesamtmetall und anderen nicht genanntenSponsoren und Spendern. Zahlreiche Unternehmervertreter wie Späth,Stihl, Roland Berger signalisieren, welche Interessen dort tatsächlichbesser positioniert werden sollen. So wird Raum geschaffen, um verschanztunter dem Deckmantel des Gemeinwohls und der Eigen- undGesamtverantwortung, eigene Interessen voran zu treiben.5. Gibt es eine moralische Verpflichtung zur Offenlegungdes Finanziers und der Hintermänneroder bedarf es eines gesetzlichen Zwanges, dies offenzulegen?Frank Bsirske:Es darf nicht sein, dass die Meinungsbildung massiv beeinflusst wird,und die Quellen und Finanziers einer solchen Beeinflussung <strong>im</strong> Dunkelnbleiben wie etwa be<strong>im</strong> „BürgerKonvent”, der in kürzester Zeit über einenEtat von mindestens sechs Millionen Euro verfügen konnte, ohne je darüberRechenschaft abzulegen. Dazu kommen undurchsichtige Strukturen,und die Interessen, die vertreten werden, sind nicht demokratischlegit<strong>im</strong>iert. Das zeigt: Es muss klar sein, wer da soviel Geld gibt. <strong>Die</strong>seTransparenz muss notfalls auch mit gesetzlichen Mitteln geschaffen werden,wenn Demokratie und Meinungsbildung nicht zum Investitionsobjektvon anonymen Hintermännern herabsinken sollen.Heribert Prantl:<strong>Die</strong> irreführende Werbung um den Konsumenten von Waren ist verboten –<strong>im</strong> Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Dort sind etwa irreführendeAngaben über Beschaffenheit, Ursprung etc. verboten, auch dieUnterlassung von gebotenen Angaben wird geahndet.<strong>Die</strong> unlautere Werbung um Wähler ist aber bekanntlich erlaubt, wird41
jedenfalls nicht ordnungs- oder strafrechtlich geahndet. Hier sollte manauch nicht mit einem neuen Gesetz daherkommen. Es ist Aufgabe derPresse, solche Unlauterkeiten darzustellen.Im übrigen: Vor über fünfzehn Jahren wurde per Gesetz ein strafbewehrtesVermummungsverbot eingeführt. Man kann sich fragen, ob derjenige,der vermummte Werbung betreibt, besser ist als ein vermummter Demonstrant.6. Welche demokratische Legit<strong>im</strong>ation gibt es für Kampagnen?Frank Bsirske:Es ist legit<strong>im</strong>, wenn sich mündige Bürgerinnen und Bürger zusammentunund ihre Interessen artikulieren. Nicht legit<strong>im</strong> ist es, wenn dieFinanzquellen und damit die dahinter stehenden Interessen nicht durchblicktwerden können wie etwa be<strong>im</strong> BürgerKonvent – einem Verein ohnebreite Mitgliederbasis und Mitgliedsbeiträge. <strong>Die</strong>se Kampagnen sind nichtdas Ergebnis von Meinungsbildungs- und demokratischen Entscheidungsprozessenwie etwa in Gewerkschaften oder Parteien. Sie entstehenin kleinen, undurchdringlichen Zirkeln und werden in der Regel vonKampagnenprofis aus Agenturen für viel Geld umgesetzt. Das hat mitDemokratie nichts zu tun – auch wenn der aktive Bürger permanent beschworenwird.Heribert Prantl:<strong>Die</strong> Meinungsfreiheit.7. Bedrohen solche Kampagnen die demokratische Öffentlichkeitoder schwächen und entwerten sie das parlamentarische System?Hans Leyendecker:<strong>Die</strong> üblichen Kampagnen bedrohen weder demokratische Öffentlichkeit,noch entwerten sie das parlamentarische System. Sie kommen und verschwinden.Frank Bsirske:Wenn nicht-demokratisch entwickelte und gestaltete Kampagnen dieParteien und Gremien unter politischen Druck setzen, besteht die Gefahr,dass Raum für nicht-legit<strong>im</strong>ierte, durch Mehrheiten abgesichertePositionen und Strukturen geschaffen wird. Das ist nicht demokratischund unterminiert das Parlamentarische System.42
Heribert Prantl:<strong>Die</strong> Kampagnen nähren die landläufigenVorurteile über die Unfähigkeit der Politik.Motto: <strong>Die</strong> Politik tut nichts, die Wirtschaftweiß, wie es geht – und das muss mandem Bürger beibringen. Es handelt sichdaher <strong>im</strong> Kern um undemokratischeKampagnen. Sie setzen auf exzessive Weisefort, was so genannte Parteienkritiker mitPauschalurteilen über Politiker begonnenhaben: Raffgierig seien sie, unfähig, einSelbstbedienungskartell. <strong>Die</strong>ses Pauschalurteilist auf gefährliche Weise falsch, auchwenn jeder Beispiele in jeder Partei kennt,auf die sich ein solches Urteil stützen könnte. Beinahe jeden Tag kannman sich das Vorurteil vermeintlich bestätigen lassen: Weil lässlicheSünden, kleines Fehlverhalten (Miles and more etc.) zusammengerührtwird mit den echten Skandalen.Parteienkritiker und die neuen Kampagnen verlangen von den Politikern,was ansonsten nur von Mönchen und Klosterschwestern verlangt wird:Selbstlose Aufgabe und Hingabe. Politiker sollen so gut sein, wie manes selber nicht ist. Und wenn Politiker nicht so hilfreich und gut sind,wie man es gerne hätte, dann redet man über sie, als handele es sichum die Hausschweine der Demokratie.Es ist deshalb Zeit nicht für Kampagnen gegen die Politik, sondern Zeitfür eine Verteidigung der Politik gegen ihre Verächter. <strong>Die</strong> Politik istbesser als ihr Ruf. Wären zum Beispiel die vielen Ignoranten, die derPolitik Faulheit vorwerfen (weil sie wieder einmal ein leeres Parlamentsehen) nur halb so fleißig wie diese – durch das Land würde längst derRuck gehen, den einst Bundespräsident Herzog gefordert hat. Und werwieder einmal davon schwadroniert, dass Politiker zu viel verdienen, dermöge sich kurz vor Augen halten, dass schon ein Manager eines mittlerenBetriebes es für eine Beleidigung hält, wenn man ihm ein Abgeordnetengehaltanbietet.<strong>Die</strong> gesamten Kampagnen schüren ein Kl<strong>im</strong>a der aggressiven Unduldsamkeit,für die die düstere Gesamtlage die vermeintliche Rechtfertigungbildet. Je schwärzer die Lage gemalt wird, um so maßloser darf mansein. Es fällt auf, dass die politische Kraftrhetorik, wie sie früher nur <strong>im</strong>Wahlkampf und bei einzelnen Parlamentsdebatten üblich war, in jüngererZeit zur politischen Alltagssprache geworden ist. Der Vorwurf der „Lüge”43
und des „Betrugs” wird so inflationär verwendet, dass er in berechtigtenFällen seinen Wert verliert. Es handelt sich um Anzeichen eines Niedergangsder politischen Kultur, der gefährlicher sein könnte als die schwierigeWirtschaftslage. Es ist Zeit für eine Entgiftung der Politik, für verbaleAbrüstung. <strong>Die</strong> neuen Kampagnen sind da kontraproduktiv.8. Gehen Journalisten und Medien zu unkritisch mit Kampagnen um?Hans Leyendecker:Journalisten gehen oft unkritisch mit Kampagnen um, weil sie nicht gewohntsind, Dinge zu Ende zu bringen. Man gesteht sich keine Fehler ein.Frank Bsirske:Das sind die entscheidenden Fragen. Schlecht ausgebildete Journalistinnenund Journalisten in schlecht finanzierten und personell unterbesetztenRedaktionen, Kahlschlag in den Redaktionen und „Billigjournalismus”gefährden die Qualität der Medien. Wo solche Verhältnisse herrschen,wo es keine Zeit und keine Ausbildung gibt, kritisch zu hinterfragen,fragt niemand nach dem „qui bono” solcher Kampagnen, also danach,wem sie wirklich nützen, und dort hört man auch nicht die andere Seite,sondern übern<strong>im</strong>mt – froh um jede Arbeitserleichterung – die fertig formuliertenArtikel aus dem Angebot der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft”und sendet beispielsweise ausgerechnet in der ARD zurbesten Sendezeit drei Filme von Günter Ederer. Themen: Steuern, Rente,Arbeitsmarkt. <strong>Die</strong> Videos dieser gesponsorten Sendungen sind über die„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” kostenlos (!) zu beziehen.Heribert Prantl:Es handelt sich überwiegend um maskierte Kampagnen. JournalistischeAufgabe ist Aufklärung, also Demaskierung. Das Wort „BürgerKonvent”zum Beispiel kann man auch <strong>im</strong> nachrichtlichen Kontext nicht einfach sostehen lassen. Es muss erklärt werden, worum es sich handelt – etwaso: „der BürgerKonvent, ein wirtschaftsorientierter Interessenverband”.Anderes Beispiel: Wenn ein Verein sich „Pro Vita” nennt, weil er besserenSchutz von Leib und Leben der Bürger vor Verbrechen fordert, zudiesen Forderungen aber die Todesstrafe gehört, dann muss dies ineiner Meldung über Aktivitäten von „Pro Vita” gesagt werden.44
PANEL2: „BOULEVARD-JOURNALISMUS –DIE NEUE LEITWÄHRUNG IN DEN MEDIEN”Petra Kaminsky, Wolfgang Kenntemich,Klaudia Brunst, Ulrich Felix SchneiderIm Folgenden sind die Aussagen der verschiedenen Teilnehmer desPanels zu den einzelnen Fragen dokumentiert und hintereinander montiert.<strong>Die</strong> Reihenfolge der Darstellung ist also konstruiert.1. Selbst das „erfolgreichste politische TV-Magazin frontal 21”spricht anlässlich des 100. Sende-Jubiläums davon,unterhalten und informieren zu wollen.Hat sich nach ihrer Einschätzung das journalistischeSelbstverständnis bezogen auf den Stellenwert der Unterhaltung<strong>im</strong> Journalismus in den vergangenen Jahren verändert?Petra Kaminsky, (Ressortleiterin „Neue Medien”, dpa):Nein. Interessant geht vor relevant gilt für viele schon länger als einigeJahre.Wolfgang Kenntemich, (Chefredakteur, MDR):Unterhaltung und Information sind kein Widerspruch. Informationssendungenkönnen spannend und emotional sein, und so teilweise unterhaltendenCharakter haben. Dennoch wird wohl Frontal 21 (wie auchandere erfolgreiche Politmagazine, z.B. Fakt) nicht vorhaben, sich nunmehrauch den Bettgeschichten eines <strong>Die</strong>ter Bohlen zu widmen. Wobe<strong>im</strong>an sich in der Tat fragt, ob die noch unterhaltsamer sind als deraktuelle Berliner Polit-Stadl. Aber ernsthaft: Unterschiede von Spannungund Emotion als Gestaltungselemente <strong>im</strong> Fernsehen bleiben: Insbesonderebei politischen Magazinen werden sie seit jeher eingesetzt, um aufgesellschaftliche oder politische Missstände hinzuweisen, wachzurütteln,Veränderungen anzustoßen. Im Fiktionalen und in der Unterhaltung dienensie dagegen in der Regel als Selbstzweck, um den Zuschauer zu fesseln,zu unterhalten eben. Sicher gibt es eine Tendenz, als „trocken” empfundeneInformationsangebote „unterhaltsamer” zu gestalten. In den Info-Magazinen und auch in Nachrichtensendungen werden breitere Themenspektrenaufgegriffen als vor 20 Jahren. <strong>Die</strong> Berichterstattung ist emotionaler,eher einzelfallbezogen, an konkreten Menschen festgemacht.Draufsicht und allgemeine Analyse finden seltener statt.45
Klaudia Brunst, (Publizistin):Ja, es gibt jetzt eine Vorstellung davon, dass man als Journalist seinPublikum erreichen können muss. Weil <strong>im</strong> Medienzeitalter Informationkeine Bürgerpflicht mehr ist, der jeder Zuschauer/Leser selbstverständlichnachkommt, egal wie hoch die Journalisten die Hürden legen.Ulrich Felix Schneider, (Kommunikationswissenschaftler, Frankfurt):Beides – Unterhaltung und Information – haben ihre öffentliche Existenzberechtigung.<strong>Die</strong> Frage ist nur, an welchem Ort, zu welchem Zeitpunktund in welcher Gewichtung diese unterschiedlichen Faktoren eine Rollespielen. Sie leisten nämlich, entgegen der landläufigen Auffassung, durchausUnterschiedliches: Das Positive an Unterhaltung ist ihre große und kollektivverbindende Kraft. Sie ist aber unpolitisch. Nicht umsonst wirdUnterhaltung insbesondere in totalitären Systemen <strong>im</strong>mer wieder gernedazu benutzt, die wirklich wichtigen Fragen aus den Medien zu verdrängen.Unterhaltung ist – um mit dem Zirkus eines der klassischen Unterhaltungsmedienherauszugreifen – durchaus in der Lage, unterschiedlichsteMenschen zusammenzuführen und für einen Moment auf emotionaleWeise zu vereinen. Da sitzen alt und jung, arm und reich,gebildet und ungebildet beisammen. Das Problem liegt in genau jenerUnbefangenheit und Voraussetzungslosigkeit, die zwar einerseits konkurrenzlosviele Menschen anzieht, andererseits aber <strong>im</strong>mer mit einemdeutlich geringeren intellektuellen Niveau und Umfang der kommunizierbarenInhalte verbunden ist. Nur was den kleinsten gemeinsamenNenner trifft, kann die Aufmerksamkeit des breiten Publikums erhalten.Ein Zirkus, zu dem <strong>im</strong>mer auch Lärm, Lichteffekte, Zauberei und Clownsgehören, kann daher niemals pr<strong>im</strong>är eine Plattform zur Vermittlung vonInformationen bilden.<strong>Die</strong> pr<strong>im</strong>äre Aufgabe des Journalismus hingegen ist es, umfassend zuinformieren. So lange sich manche Kollegen zur Erreichung dieses Zieleszusätzlich unterhaltender Elemente bedienen – um über die Schaffungweiterer Rezeptionsanreize einen größeren Personenkreis ansprechen zukönnen – ist dies durchaus legit<strong>im</strong>. Mittlerweile haben wir allerdingsvielfach einen bedenklichen Grad der Gewichtung beider Elementeerreicht: Es scheint, als werde pr<strong>im</strong>är unterhalten und als gäben sichJournalisten weitgehend damit zufrieden, wenn sie auf diesem Wegenoch ein paar Informationen mit an den Mann oder die Frau bringenkönnen. So wie das Kurzweilige, Schillernde und das Staunen zumZirkus gehören, so erfordert eine politisch anspruchsvolle Sendung einenachdenkliche Distanz sowie die Konzentration auf das Wesentliche. So46
frisch, schnell, theatralisch und bunt etwa ein <strong>Format</strong> wie „Frontal 21”auch daher kommen mag – sicherlich hat dieser Relaunch neue Zuschauergefunden – desto mehr hat man sich mit der Präsentationsform aberauch dem Varieté angenähert: Spätestens am Ende der Sendung werdenSie mit „Toll”, einer Mischung aus Kabarett und Klamauk direkt in dieSpaßgesellschaft entlassen: Ist doch alles irgendwie komisch und vielleichtsollte man das, was in unserem Land geschieht doch nichtmehr so ganz ernst nehmen, ist dann häufig der Gedanke, der übrigbleibt.Was uns eine kritische Bilanz des Zustandes unserer Mediengesellschaftzur Jahrtausendwende vor Augen führt, ist doch, dass wir jener von NeilPostman Mitte der 80er Jahre kritisierten medialen Transformation derUrteilsbildung inzwischen weit näher gekommen sind, als wir dasdamals für möglich gehalten haben. Vor allem die Rolle der Qualitätsmediendabei ist verblüffend: Sie bilden keineswegs einen Gegenpoloder gar ein letztes Reservat, haben sie sich <strong>im</strong> Grunde doch weitgehendder Gesamtentwicklung angepasst. Sollte dieser Trend einer umsich greifenden Relevanzumkehrung von Inhalt und Form zukünftigweiter Fuß fassen, so bedeutet dies faktisch die Abkehr von der aufklärerischenKernfunktion des Journalismus. Damit lässt sich dann aber auchdie Sonderstellung der Presse gegenüber anderen Produzenten von<strong>im</strong>materiellen Konsumkulturgütern <strong>im</strong>mer weniger aufrechterhalten.2. Was sind die tieferen Ursachen für diese mögliche Veränderung?Petra Kaminsky:Siehe oben.Wolfgang Kenntemich:<strong>Die</strong> Erfindung der Fernbedienung in Kombination mit der Einführung desDualen Rundfunksystems hat zweifellos zu einer Veränderung derSehgewohnheiten auch be<strong>im</strong> deutschen Fernsehzuschauer geführt. <strong>Die</strong>Macher sind angesichts der Quote als einzig wahre Fernsehwährung<strong>im</strong>mer stärker gefordert, mit unterhaltsameren Dramaturgien auf ihreHervorbringungen aufmerksam zu machen.Nach der zuweilen zwanghaften Selbstkasteiung deutscher Medien inden 60er-80er Jahren, als Seriosität und Qualität manchmal mit Langeweileund abstraktem, aber korrektem politischen Diskurs verwechseltwurden, hat sich eine ja auch erfreuliche Öffnung hin zu Themen ausallen Bereichen des Lebens vollzogen.47
Klaudia Brunst:Auf beiden Seiten (Sender/Empfänger der Botschaft) wird das Mediumnun endlich medial wahrgenommen. Nicht als Gefäß, in das man beliebigSachverhalte legt und wieder herausn<strong>im</strong>mt. Sondern als Beschäftigung:Wir sehen, um fernzusehen. Wir lesen, weil wir gerne lesen. Wir schreibenund machen Filme, weil es uns Spaß macht, unsere Gedanken zu distribuiteren.Ulrich Felix Schneider:<strong>Die</strong> Hauptursache für die Boulevardisierung der Medienlandschaft, diebemerkenswerter Weise gerade auch die Qualitätsmedien erfasst, liegtmeines Erachtens in der Absolutsetzung des wirtschaftlichen Effizienzprinzips.Medien waren schon <strong>im</strong>mer Ware und Botschaft zugleich.Inzwischen hat sich das ehemals <strong>im</strong> Wirtschaftsbereich vorherrschendeProfitdenken in allen Gesellschaftsbereichen ausgebreitet. Wir müsseneffizient leben, lernen und sogar sterben. Wir sind, wie es DirkKurbjuweit kritisiert, auf dem Weg in eine „McKinsey-Gesellschaft”. Überträgtman diese „Diktatur der Effizienz” auf den Journalismus, so kanndies eine Verschiebung der Prioritäten beruflichen Wirkens erklären:<strong>Die</strong>ser geringstmögliche Einsatz bei größtmöglichen Nutzen heißt hierEinschaltquote, beziehungsweise Auflage. Man will heute für jedesMedienangebot möglichst das breite Publikum ansprechen um damitseine Legit<strong>im</strong>ationsgrundlage zu sichern.Niemand, der heute eine breite Öffentlichkeit ansprechen möchte, kannes sich dabei erlauben nicht unterhaltend zu sein. Damit ist das Kommunizierenvon Inhalten heute in dem Sinne anspruchsvoller und damitauch schwieriger geworden, indem die Menschen nicht mehr alleine kognitiv,sondern gleichzeitig auch emotional erreicht werden müssen. Mitder Verbindung ehemals getrennter Anliegen und der Verschiebung ihrerGewichtung erhält das Programm eine andere Qualität. Eine Rückkehrzur ehemals strikten Trennung von Unterhaltung und Information wirdkaum mehr möglich sein. Gleiches gilt übrigens auch für die Frage derTrennung von Privatheit und Öffentlichkeit in den Medien.Der Wandel des journalistischen Selbstverständnisses bedeutet letztlich,dass sich die Legit<strong>im</strong>ationsgrundlage des beruflichen Handelns nichtmehr überwiegend am Wert der vermittelten Information, sondern ander realisierten Quantität der Rezeption bemißt. Darin sehe ich ganzdeutlich einen Paradigmenwechsel. <strong>Die</strong> Vertreter des journalistischenBerufsstandes agieren damit <strong>im</strong>mer weniger als Botschafter eines inhaltlichenAnliegens <strong>im</strong> öffentlichen Auftrag.48
3. Welche Veränderung be<strong>im</strong> so genannten „agenda setting”beobachten Sie in den Medien? Haben Themen aus der Weltdes Sports und des Entertainments auch die „seriösen”Nachrichtensendungen, die Magazine erreicht?Petra Kaminsky:Ja.Wolfgang Kenntemich:Auch in Informationssendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehensgibt es praktisch keine Themen-Tabus mehr. Dadurch, dass faktisch alleLebensbereiche vorkommen, hat auch das Fernsehen etwas von seinerfalsch verstandenen Lehrer-Mentalität verloren. Einzig die Frage der Relevanzsollte nach wie vor das Agenda-Setting in ARD und ZDF best<strong>im</strong>men,<strong>im</strong> Unterschied übrigens zu den kommerziellen Anbietern. Aber wie wiralle wissen, können sowohl der Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaftals auch das Wetter stärkeren Einfluss auf gesellschaftlicheund wirtschaftliche Befunde haben, wie der tausendste Gesetzentwurfaus Berlin, der sowieso so nicht umgesetzt wird. So genannte weicheThemen haben sicher in letzter Zeit ein stärkeres Gewicht bekommen.Das gilt aber nicht nur fürs Fernsehen. In den großen Print-Magazinenwie Spiegel, Stern und Focus finden sich nur noch selten harte politischeTitel-Geschichten. Aber hat nicht auch schon Goethe bei seinenThemen aus der Fülle des prallen Lebens geschöpft?Klaudia Brunst:Ja. Denn Schumis Sieg ist allemal leichter zu vermitteln als die Friedensbotschaftder amerikanischen Truppen <strong>im</strong> Irak.Ulrich Felix Schneider:Der Anstieg boulevardisierender Elemente in den Qualitätsmedien zeigtsich bereits in den Titelkopfzeilen der Zeitungen, in denen mit Farbfotosauf Beiträge <strong>im</strong> Innenteil verwiesen wird. Denken Sie etwa an die FrankfurterRundschau oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Hinzukommen größere Überschriften und überd<strong>im</strong>ensionale Farbfotos, wie wirsie vor vielen Jahren nur von Bild oder dem Stern her kannten.Jetzt werden Sie sich fragen, was diese Präsentationsformen mit derNotwendigkeit einer Favorisierung von Entertainment oder Sportthemenzu tun haben? Auf den zweiten Blick sehr viel: Derartige Themen sindmeistens personalisierte Themen und diese lassen sich mit den zuvor49
eschriebenen Mitteln viel effektiver darstellen als komplexe Sachverhalte.Insofern fördern derartige Gestaltungsmittel auch andere Inhalte.Man setzt auf Aufmacher und Eye-Catcher.Ein weiterer Grund für die Ausbreitung derartiger Themen liegt nicht nur<strong>im</strong> Versuch, aus Wirtschaftlichkeitsgründen breitere Rezipientenschichtenanzusprechen. Wer die Produktionsbedingungen <strong>im</strong> Medienbereich kennt,weiß, dass etwa eine Talkshow oder eine <strong>im</strong> Rahmen der freien Berichterstattungohne Lizenzgebühren stattfindende Sportberichterstattung ungleichgünstiger zu produzieren ist, als ein aufwendiger Sach- oder garSpielfilm. <strong>Die</strong>s erklärt auch, warum etwa die Qualitätszeitungen einerseitsihre Berlin-Büros schließen und Feuilleton-Redakteure entlassen,gleichzeitig aber <strong>im</strong>mer häufiger beispielsweise Trivialitäten aus dem Bereichder Prominenz einen Raum geben. An konkreten Beispielen veranschaulichtbedeutet dies, dass in den Qualitätszeitungen, beispielsweiseder Frankfurter Rundschau oder der F.A.Z (Analoge Belege finden sichebenso in der Zeit oder der Süddeutschen Zeitung) folgendes für einerelevante Nachricht gehalten wird: dass Prinz Harry einen Hamburgergutscheinam Flughafen einlöst, Martin Schmidt seine neue Freundin zumersten Mal zu Hause geküsst sowie dass Robert de Niro Probleme mitseiner Prostata hat. <strong>Die</strong>s sind diesen Medien eigenständige Meldungenwert.4. In einer Untersuchung der Universität Dresden wurdefestgestellt, dass auch die Regionalzeitungen ihren Boulevard-Anteil in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet haben.Teilen Sie diesen Befund? Welche Veränderungen in derKonstruktion der lokalen Öffentlichkeit beobachten sie?Petra Kaminsky:Nichts bleibt, wie es mal war. Optik und Bilder sind sicher auch fürRegionalzeitungen wichtiger geworden. Bilder transportieren Inhalte –manchmal eindrucksvoller und nachhaltiger als Texte. Und natürlich gibtes schöne vermischte Seiten – aber auch gute Wissenschafts- und Verbraucherseiten.Daneben sind doch gerade für Lokalblätter lokale Angelegenheitensehr wichtig: Gemeinderatssitzungen, Umgehungsstraßen,Baustellen und Müllgebühren – nicht gerade die typischen Unterhaltungsthemen,und doch Gesprächsstoff.Sollten die Regionalzeitungen wirklich die besseren Boulevardblätterwerden, dann müssten sich Bild und Co. warm anziehen!50
Wolfgang Kenntemich:Eine zunehmende Boulevardisierung in Regionalzeitungen muss mandifferenziert sehen. In der Untersuchung der TU Dresden zur SächsischenZeitung wurden offenbar Boulevardisierungstendenzen in den BereichenAufmachung, Stil und Inhalt teilweise festgestellt. <strong>Die</strong> Berichterstattunghingegen soll sich nicht grundlegend verändert haben. <strong>Die</strong> Erklärungdafür könnte sein, dass das, was vor der Haustüre des Lesers passiert,sein Hintergrundwissen nicht übersteigt. Hier sind für den Redakteurwomöglich Abstecher in Richtung Boulevard, die zusätzliche Aufmerksamkeitsichern sollen, nicht so zwingend.Klaudia Brunst:Ich informiere mich nicht über meine Region. Das Fernsehen ist eineLandschaft ohne Orte.Ulrich Felix Schneider:Wir sind <strong>im</strong> McLuhan’schen „globalen Dorf” angekommen. Denn die Bedeutungdes Lokalen hat sich gewandelt. Dort, wo der Einzelne nur nochpartiell in seine regionale Umgebung involviert ist, wird der damit verbundeneVerlust ehemaliger lokaler Bezugspersonen durch die Medienkompensiert. Das, was Menschen verbindet, spielt sich zunehmend auchauf der großen Medienbühne ab. Prominente beispielsweise agieren <strong>im</strong>Rahmen des öffentlichen Medienklatsches als Kollektivpersönlichkeiten,an Hand derer sich die Menschen verständigen und ihre Zuneigung oderAbneigung artikulieren können. <strong>Die</strong> Regionalmedien können sich diesemBedürfnis der Teilnahme an den personalisierten großen überregionalenErzählungen unserer Zeit nicht mehr entziehen. Sie wollen diesen Marktnicht den überregionalen Medien überlassen.Im Rahmen meiner jüngst fertiggestellten Studie bin ich, bezogen aufdie Rolle der bundesweiten Qualitätsmedien, zu einem ganz ähnlichenErgebnis wie die Dresdner Untersuchung gelangt. Ausgangspunkt war dieFrage, weshalb heute auch diejenigen Rezipienten jene Prominente unddie mit Ihnen verbundenen Geschichten kennen, welche nicht die Boulevard-,sondern nahezu ausschließlich die Qualitätsmedien konsumieren.<strong>Die</strong>s liegt daran, dass Prominenz inzwischen auch in diesem Bereich einenbreiten Stellenwert einn<strong>im</strong>mt. <strong>Die</strong> bildungsbürgerliche Illusion, Prominenzwürde als Populärkultur in den Bastionen der hohen Kultur kaum eineRolle spielen und sich auf die Gefilde der Yellow-Gazetten beschränken,geht damit an der heutigen Realität vorbei. Dass es hier <strong>im</strong> LeserinteresseÜberschneidungen zu geben scheint, können Sie bereits an der Tatsache51
erkennen, dass etwa die Bunte neuerdings Werbeanzeigen in derFrankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schaltet.<strong>Die</strong>se Boulevardisierungswelle ist ein Phänomen, das sich durch die gesamteMedienlandschaft zieht. Erfasst man alle Medienangebote, in denenbeispielsweise Prominente einen zentralen Bestandteil des Medienkonzeptesausmachen, lässt sich erstens ein zahlenmäßiger Anstieg jenerForen empirisch nachweisen. Von diesem Wachstum der Prominenzforen istzweitens der Printbereich ebenso betroffen wie das Fernsehen. <strong>Die</strong> dritteErkenntnis ist, dass hierbei vor allem auch die Qualitätszeitungen und deröffentlich rechtliche Rundfunk von Beginn an eine zentrale Rolle spielen.Derartige Themen reichen weit über eine flankierende Berichterstattunghinaus, etwa <strong>im</strong> Feuilleton oder den sogenannten noch vergleichsweisejungen Medienseiten. <strong>Die</strong> privatisierende oder int<strong>im</strong>isierende Inszenierungvon Einzelpersonen finden Sie auch in den Magazin- oder gar in den Wirtschaftsteilen.Nicht zuletzt wurden neue Prominenzbühnen institutionalisiert:Denken Sie etwa an die Zeit-Rubrik „Ich habe einen Traum”. Auchwenn uns dies vielfach noch nicht bewusst ist: Bei Sabine Christiansentummeln sich keineswegs ausschließlich Gäste aus dem Politikbereich.Umgekehrt buhlt die Politikprominenz um Auftritte in der Harald SchmidtShow. Ein Blick in die Gästelisten belegt, dass sich dieser Trend quer durchden ganzen Bundestag zieht. Gleiches gilt für Prominenzbühnen wie Alfrediss<strong>im</strong>ooder zuletzt Boulevard Bio. Es ist allerdings keineswegs eine Selbstverständlichkeit,dass die Qualitätsmedien heute Prominenzthemen inderartigem Umfang für relevant erachten. Mein Eindruck ist, dass es sichhierbei weniger um eine journalistisch getroffene Wertentscheidung handelt,sondern vielmehr um eine kommerzielle. <strong>Die</strong>s trägt allerdings dazubei, dass Prominenz zunehmend als Qualität an sich empfunden wirdund den Betroffenen damit unabhängig von einem best<strong>im</strong>mten sachlichinhaltlichenBezug eine <strong>im</strong>mer größere Macht verschafft wird.52
5. Geliefert wird, was das Publikum wünscht, was ankommt oderverkauft wird – so die Antwort der Verleger und Programmverantwortlichenauf mögliche Einwände. Hat sich dasPublikumsinteresse in den vergangenen Jahren geändert?Will das Publikum vor allem „Brot und Spiele”?Petra Kaminsky:Wenn ja, dann seit den alten Römern! Allerdings gibt es nicht das einePublikum. Und eine enorm gewachsene Vielzahl von Medienangeboten.Kritisch wird es erst, wenn jemand die von ihm gesuchte Mischung nichtmehr findet. Außerdem will ein Teil des Publikums etwas ganz anderes:Service! <strong>Die</strong>ser Trend ist auch nicht <strong>im</strong>mer die Krönung des kritischenJournalismus.Wolfgang Kenntemich:Das Publikum wollte schon <strong>im</strong>mer „Brot und Spiele”. Und es wurdedamit auch schon <strong>im</strong>mer „bedient”. Im Fernsehen hat sich das in der Tatverstärkt. Container- und Krawall-Talkshows, eine Inflation von Quiz-Sendungenund sogenannten Superstar-Wettbewerben haben die Fernsehlandschaftüberschwemmt. Keine wirklich neuen <strong>Format</strong>e, nur spektakulärerin der Wirkung, konsequenter in der Marketing-Strategie, aber mitgeringerer Halbwertzeit. Also insgesamt kein Grund zur Aufregung.Klaudia Brunst:Das Publikum wollte schon <strong>im</strong>mer „Brot und Spiele”. Sonst wäre dieseZuschreibung ja nicht schon so alt. Lange war aber Information etwas,das sich für Reiche und Gebildete anders buchstabierte als für Arme undweniger Gebildete. Auch der Begriff „Herrschaftswissen” ist ja nicht gesternerfunden worden. Nun hat die Weltrepublik auch eine republikanischeMedienlandschaft, die Mehrheiten bilden muss.Ulrich Felix Schneider:„Brot und Spiele” haben schon <strong>im</strong>mer für regen Zulauf gesorgt. Dort woman die Masse erreichen will, kommt man mit dieser Strategie am weitesten.<strong>Die</strong>ses beliebte Argument der Kundenorientierung ist aber zueinseitig. Wenn es um ein durchaus von allen geteiltes und als notwendigerachtetes verantwortungsvolles Handeln geht, schiebt jeder dem anderenden schwarzen Peter zu. <strong>Die</strong> Rezipienten ziehen sich mit einem ganzanderen Argument aus ihrer Verantwortung, wenn sie sagen, sie würdendas Gesehene nur sehen, weil die Medien nichts anderes böten. Und53
obendrein behaupten dann die Prominenten etwa, sie seien ineiner Opferrolle hilflos der Medienöffentlichkeit ausgeliefert.Es handelt sich doch vielmehr um ein Zusammenspiel verschiedenerKräfte und hierbei muß sich jeder auf seinen Part konzentrieren:<strong>Die</strong> Medienmacher können den Mut haben, Dinge anzubietenvon denen sie glauben, dass diese einen inhaltlichen Werthaben. <strong>Die</strong> Rezipienten können sich den Luxus gönnen, Uninteressanteszu verschmähen. Und die Prominenten sollen sichgut überlegen, inwieweit sie sich in der Öffentlichkeit exhibitionierenund damit einen faustischen Pakt eingehen, für den siedann später inkonsequenter Weise jegliche Verantwortung vonsich weisen wollen. Summa summarum glaube ich aber, dass <strong>im</strong>Vergleich zu früher das Bedürfnis nach Bildung und Informationso hoch ist wie nie zuvor.6. <strong>Die</strong> BILD-Zeitung hat sich mit ihrer Titel-Politik längst auchzum Leitmedium für die so genannten seriösen Medienentwickelt. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?Wie wird sich diese Tendenz künftig entwickeln?Petra Kaminsky:<strong>Die</strong> Zukunft hängt vom Chefredakteur ab. Und zur Gegenwart: Wenndie Bild eine spannende politische Nachricht ausgegraben hat,dann meldet dpa das genau so wie dieselbe Nachricht vom Spiegel.Wolfgang Kenntemich:Als Leitmedium würde sich die Bild-Zeitung wahrscheinlich selberganz gerne sehen. Festzustellen ist eine <strong>im</strong> Vergleich zu anderenMedien seit Jahren sich verstärkende Exklusiv-Berichterstattungauch <strong>im</strong> Bereich der harten Informationen. Das begann bereits inden 80er Jahren, damals übrigens sehr zum Leidwesen desSpiegel, der sich seinerzeit tatsächlich als der Platzhirsch <strong>im</strong> deutschenInfo-Geschäft verstanden hat. Dazu kommen aussagekräftigeInterviews und pfiffige Polit-Kampagnen. Durch die täglicheVerbreitung wird das sicher auch stärker wahrgenommen, als dieExklusiv-Geschichten der Nachrichtenmagazine oder Sonntags-Gazetten. <strong>Die</strong> Vielfalt ist insgesamt größer geworden. Übrigensnicht nur bei Bild gilt, wenn es um die Beurteilung der Exklusiv-Storys durch die Journalisten anderer Medien geht: die guten insKöpfchen, die schlechten ins Töpfchen (...).54
Klaudia Brunst:So lange die Branche mit ihrem Jugendwahn „abschreiben” und „nachlaufen”als Tugenden des beschleunigten Journalismus preist, wird daswohl so bleiben.Ulrich Felix Schneider:<strong>Die</strong>se Entwicklung ist bedenklich und aus meiner Sicht wird sich dieseaus kommerziellen Motiven heraus betriebene Boulevardisierung derQualitätspresse langfristig als Milchmädchenrechnung erweisen. Denndie gebotene Qualität, etwa <strong>im</strong> Bereich der Prominentenberichterstattungunterbietet <strong>im</strong> Prinzip häufig noch das Niveau der Boulevardmedien.Beispielsweise wenn Erstveröffentlichungen von den Qualitätsmedienlediglich zitierend zweitpräsentiert oder direkt von den Nachrichtenagentureneingekauft werden. In beiden Fällen unterbleiben regelmäßigeigene Recherchen oder gar eine kritische Kommentierung oder Infragestellungder behandelten Sachverhalte.Qualitätsmedien, die auf diesem Gebiet keine Vorreiterrolle spielen, sondernein qualitatives Schlusslicht bilden, werden auf Dauer einen Preisdafür bezahlen müssen. Man hat sich hier mit dem Betreten eines neuenTerrains in eine Zwickmühle manövriert: Man kann doch nicht neueBereiche ansteuern, aber dafür keine richtigen Budgets bereitstellen.Wenn derartige Themen beispielsweise in ihrem quantitativen Umfangden halben Umfang eines Wirtschaftsteiles ausmachten, dann müsstenbei 14 Wirtschaftsredakteuren <strong>im</strong> Verhältnis auch zusätzlich 7 Boulevardspezialisteneingestellt werden. <strong>Die</strong> Qualitätsmedien begehen denschweren Fehler, auf der Suche nach neuen Kunden ihren Bauchladen<strong>im</strong>mer weiter zu vergrößern und dabei die Qualität der angebotenenWaren aus dem Blickwinkel zu verlieren.Was folgt daraus? Aus meiner Sicht stehen die Qualitätsmedien nun aneinem Scheideweg: Entweder müssen sie massiv investieren oder deneingeschlagenen Weg zurückgehen und sparsamer mit Boulevardanteilenhaushalten. Es ist nun an der Zeit, endlich interne Qualitätsrichtlinien,etwa für den Bereich der Prominentenberichterstattung zu entwickeln.Zu diesen hausintern festgelegten Standards gehört der Umgang mitdiesen Themen und die Festlegung von inhaltlichen Gütekriterien. Nichtzwangsläufig müssen derartige Themen wieder zurückgeschraubt werden.Aber selbst bei gleichbleibender Quantität besteht hier ein bislangunzureichend genutzter Spielraum für einen qualitativen Quantensprung.Eine systematische Missachtung der für andere Themen geltendenGütekriterien kann andernfalls nur zu einem Me-Too-Angebot und55
obendrein <strong>im</strong> Ergebnis zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen. Imschl<strong>im</strong>msten Fall kann dieser dann auch auf andere Rubriken abstrahlen.Was sich in diesem Genre gegenwärtig abspielt, hat mit aufklärerischemJournalismus wenig zu tun. Ein großes Problem ist hierbei etwa die symbiotischeVerflechtung von Prominenten und Journalisten. Der Rummelum die Prominenz ist ein Spiel, von dem alle profitieren, bei dem aber amEnde ein aufklärerischer und seriöser Journalismus auf der Streckebleibt. Wenn Sie sich etwa vor Augen halten, dass die ehemalige-Chefredakteurin von Bunte, Beate Wedekind, nun von der Journalistinzur PR-Beraterin von Frau Juhnke avanciert ist und deren Lebensleidinteressensgeleitet vermarktet oder auch an die Verflechtung desEhepaares <strong>Die</strong>kmann/Kessler <strong>im</strong> Fall der Biografie von <strong>Die</strong>ter Bohlendenken; eine ebenso spannende Konstellation finden Sie auch be<strong>im</strong>Prominentenanwalt Matthias Prinz und seiner Frau, der Personality-Beraterin Alexandra von Rehlingen – hier bildet sich meines Erachtenseine Industrie heraus, die auf kartellartige Zustände hin zusteuert. <strong>Die</strong>Buchtitel „Nichts als die Wahrheit” und „Ungelogen” provozieren dochnicht zuletzt auch deshalb, weil jedem irgendwo klar ist, dass es sichhierbei nicht um eine unabhängige journalistische Betrachtung von außenhandelt, sondern um eine Personality-PR-Aktion, die in erster Linie denPartikularinteressen der sich selbst behandelnden Autoren dient.Wenn diese Themen schon von Leitmedien wie Bild oder auch Bunte aufdie öffentlichen Agenda gesetzt wurden und wenn die Qualitätsmedienschon in zunehmendem Maße auf diese Nachrichten eingehen, dannsollten sie sich hier <strong>im</strong> Sinne einer Wahrheitsfindung <strong>im</strong> öffentlichen Interesseaktiv betätigen und einen informativen Mehrwert bieten: Etwa inForm eines wirklich investigativen Journalismus, der ein Gegengewichtzu den Selbstdarstellungsinteressen der Prominenten bildet und ihnenauch dort weh tut, wo sie unwahre Informationen aus Ihrem Int<strong>im</strong>lebenstreuen.<strong>Die</strong> Qualitätsmedien betätigen sich aber überwiegend als Resteverwerterder Boulevardmedien, was aus journalistisch-fachlicher Sicht zu einerbedenklichen Situation führt: Sie werden gegenwärtig <strong>im</strong> wachsendenBereich der Prominentenberichterstattung ihrem öffentlichen Informationsauftragnur noch unzureichend gerecht. <strong>Die</strong>s hat zur Folge, dass sie sichan einer Verflachung der öffentlichen Kultur beteiligen. Insbesonderedurch den „Nachrichtenfaktor Prominenz” entstehen hier bedenklicheEinfallstore zur Durchsetzung von Partikularinteressen: Zum einem <strong>im</strong>Sinne der Selbstdarstellungsinteressen Prominenter, zum anderen aber56
auch für Trittbrettfahrer <strong>im</strong> Sinne von Public Relations-Maßnahmen durchDritte, indem diese über Prominente ungehindert Ihre Botschaften inden Medien positionieren. Nicht zuletzt schafft das ständige Zitieren vonBILD und BUNTE auch Cross-Promotion-Effekte für diese Konkurrenzmedien.Solange die Qualitätsmedien hier nicht die gleichen journalistischenMaßstäbe wie in ihren anderen Bereichen anlegen – dies würdedauerhafte große finanzielle Investitionen erfordern – machen sie sich indiesem Feld unter der Missachtung ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe indreifacher Weise zum PR-<strong>Die</strong>nstleister.7. Medienwissenschaftler sprechen ja schon heute von einer„digitalen Spaltung” der Gesellschaft.Wird sich diese Spaltung bezogen auf die Sphären derInformation und der Unterhaltung noch vertiefen?Petra Kaminsky:Ich bin keine Prophetin.Wolfgang Kenntemich:Ja und nein. Nein, weil sich Unterhaltung und Information <strong>im</strong> BereichInfotainment längst vermischt haben. Ja, weil es Zuschauer gibt, die sichentweder überwiegend die Kulturkanäle ansehen und solche, die sicheher be<strong>im</strong> Sensationsfernsehen aufgehoben fühlen. Definiert man Fernsehenals stark prägenden Sozialisationsfaktor ist es natürlich denkbar,dass diese Gruppen irgendwann unterschiedliche Sprachen sprechen.Das ist in der Tat eine beunruhigende Entwicklung, die dem gesellschaftlichenGrundkonsens entgegen wirkt. In dieser Hinsicht ist Infotainmentals Bindeglied sehr wichtig, da es – gut gemacht – beide Gruppen ansprechenkann.Klaudia Brunst:Es wird vielleicht so sein. Aber vielleicht werden wir diese beidenBegriffe Information und Unterhaltung als Gegensatzpaar auch einfachabschaffen.Ulrich Felix Schneider:Es gibt eine wachsende Kluft zwischen Unterhaltung und Information.Aus der in den 90er Jahren aus den USA stammenden „Digital Divide”-Forschung wissen wir, dass technische Kompetenz und die Zugangsmöglichkeitenzu best<strong>im</strong>mten Medien nicht mit einer Informationskompetenz57
gleichzusetzen sind. Das heißt, bestehende soziale Ungleichheiten werdendurch die neuen Medienangebote weiter verschärft, indem etwaweniger gebildete Schichten best<strong>im</strong>mte Angebote nicht nutzen können,da sie nicht in der Lage sind, gezielt selektieren und bewerten zu können.Ein möglicher Wissenserwerb setzt also <strong>im</strong>mer ein gewissesVorwissen voraus. Es ist eben ein Unterschied, ob man sich <strong>im</strong> Internetnur surfend oder auch navigierend verhalten kann.8. Ihr persönlicher Blick in die Zukunft der oft beschworenen„Wissensgesellschaft”: Welche Auswirkungen hat der „WerttreiberUnterhaltung” für die Entwicklung der Mediengesellschaft?Welche Spuren <strong>im</strong> demokratischen Gefüge werden Bohlen undseine Superstars hinterlassen?Petra Kaminsky:Bohlen und die Superstars werden keine Spuren hinterlassen. Dazu sindsie nicht wichtig genug. Sie sind vielmehr Teil einer Welle. Und sie habensich entschieden, gut daran zu verdienen. Unterhaltung, ihre Macher undKonsumenten, stehen nicht <strong>im</strong> luftleeren Raum. Technischer Wandel,Amerikanisierung, Individualisierung, Emotionalisierung, Kontrollverlustund der Versuch, alles <strong>im</strong> Griff zu haben, Informationsmassen und –Defizite zugleich, Risikogesellschaft – all das sind Dinge, die sich in derMedienlandschaft spiegeln, die sie aber auch prägen. Nicht Bohlen.Wolfgang Kenntemich:Ketzerisch gesagt: Bohlen und seine Superstars sind praktizierte Demokratie.Denn die Zuschauer st<strong>im</strong>men ab, wer ihr Superstar sein wird. Hierwird erfahren: Meine St<strong>im</strong>me zählt. Das schafft das Bewusstsein, etwasbewirken zu können. Ein Bewusstsein, dessen Fehlen bei der Wählerschaftin unserem parlamentarischen System <strong>im</strong>mer wieder beklagt wird.Zu befürchten ist allerdings, dass sich unsere Politiker mit ihren kompliziertenKonzepten und Botschaften <strong>im</strong>mer schwerer tun, be<strong>im</strong> Publikumbemerkt und gewürdigt zu werden. Deshalb ist es zwingend, dassseriöse, qualitativ gut gemachte Nachrichten- und Magazin-Sendungenam Markt und be<strong>im</strong> Zuschauer erfolgreich bleiben. Sonst heißt es inwenigen Jahren womöglich: Bohlen for President.Klaudia Brunst:Bohlen und die Popstars verkünden eine egalitäre Botschaft: Jeder kannalles werden. Andere vor ihnen – zum Beispiel sozialdemokratische58
Bildungspolitiker – haben das auch schon formuliert. Jede Dekade fülltdiesen Traum eben mit anderen Inhalten.Ulrich Felix Schneider:In der öffentlichen Wahrnehmung der Prominenz hat ein Paradigmenwechselstattgefunden, den ich als „Strukturwandel der Prominenz” bezeichne.Damit ist einerseits eine gesamtgesellschaftlich veränderteWahrnehmung gemeint: <strong>Die</strong> ehemals ablehnende Haltung etwa gegenüberdem Starwesen, wie sie beispielsweise die Intellektuellen derFrankfurter Schule in ihrem Konzept der Kulturindustrie formuliert haben,und die sich auch nachweisbar noch längere Zeit in den Konversationslexikahält, ist inzwischen einer weitgehend affirmativen Grundhaltunggewichen.<strong>Die</strong>s hat sehr viel mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun, wie ihnetwa Ulrich Beck in seiner Individualisierungstheorie treffend beschreibt.Menschen sind heute <strong>im</strong> Vergleich zu früher stärker auf sich selbst verwiesen.Jeder muss täglich eigene Entscheidungen darüber treffen, wie ersein Leben weiter gestalten will. Wir müssen uns heute gewissermaßenständig selbst erfinden und bewegen uns weniger in vorgefertigten konventionellenBahnen. Unter diesem Hintergrund werden Prominenteheute aus einer veränderten Perspektive beobachtet: Waren sie bislangGegenbilder aus einer entgegengesetzten Lebenswelt, so hat sich dieseasymmetrische Beobachterperspektive deutlich reduziert. Prominentewerden heute weiterhin bewundert, sie erscheinen aber plötzlich als dieerfolgreicheren Konkurrenten in einem Spiel, bei dem heute prinzipiellalle mitspielen: Es geht um die Inszenierung der eigenen Person unddas Buhlen um öffentliche Aufmerksamkeit. Während Prominente somitfrüher pr<strong>im</strong>är der Kompensation der eigenen unerfüllten Wünsche dienten,so sind sie heute stärker Vorbilder <strong>im</strong> eigentlichen Sinne geworden.Sie führen vor, wie man sich in unserer Mediengesellschaft geschicktselbst vermarkten und davon auch leben kann.Mit „Strukturwandel der Prominenz” meine ich auch, dass der klassischeProminenzbegriff nicht mehr Medienphänomene wie <strong>Die</strong>ter Bohlen,Verona Feldbusch oder Daniel Küblböck hinreichend erklären kann. Dennes hat eine Diversifikation hin zu unterschiedlichen Prominenzformenstattgefunden. Beispielsweise finden wir heute eine neue „Prominenzrasse”,die als denkbare Möglichkeit der Prominenzforschung noch Mitteder 90er Jahre explizit verneint wurde: Eine selbstreferenziell eigensdurch die Medien produzierte Prominenzform. Während sich früher dieMedien noch jener Personen bedienten, die sich in den gesellschaftlichen59
Teilbereichen gewissermaßen als Prominente vorqualifiziert hatten, werdendiese heute auch direkt <strong>im</strong> und vom Mediensystem geschaffen.Für die Möglichkeit, <strong>im</strong> heutigen Mediensystem selbst prominent werdenzu können, heißt dies folgendes: Mit den sogenannten Nachmittagstalkshowserreichten wir eine erste Phase, in der <strong>im</strong> Sinne von Warhol gewissermaßenjedermann für 15 Minuten zum Star werden konnte. Eineweitere Stufe wurde mit Big Brother erreicht. <strong>Die</strong>ses Sendekonzept führteuns zum ersten Mal die Prominenz des Faktischen vor Augen. Es warenweniger die Teilnehmer der Sendung an sich, die diese breite gesellschaftlicheAufmerksamkeit ausgelöst haben, sondern vielmehr die zugleichschockierende wie faszinierende Erkenntnis, dass Menschen <strong>im</strong>Rahmen eines Sendekonzeptes plötzlich ohne besondere Leistungenprominent werden und damit sogar eine Zeit lang gewissermaßen hauptberuflich<strong>im</strong> öffentlichen Leben agieren konnten. Mit den sogenanntenCasting-Shows, und hier sind wir bei der Superstar-Sendung von <strong>Die</strong>terBohlen angelangt, wurde eine dritte Stufe erreicht, auf welcher derProminenzbegriff sich wieder in Richtung eines gesellschaftlichen Elitegedankenszurückbewegt. Denn Eliten qualifizieren sich unter demokratischenDurchführungsbedingungen über eine Leistung innerhalb einesSelektionsprozesses, an dessen Ende die Besten übrigbleiben. Mit dieserEntwicklung sind wir auf einem guten Weg.Im Zuge der nun beginnenden Verteilungskämpfe wird nämlich die Fragegesellschaftlicher Macht stärker diskutiert und hinterfragt werden. DennMedienpräsenz schafft Prominenz und damit auch Formen sozialer Ungleichheit.<strong>Die</strong>se wird von der Gesellschaft aber in Zukunft verstärktdann akzeptiert werden, wenn sie das Ergebnis einer persönlichenLeistung ist, die letztlich auch dem öffentlichen Allgemeinwohl einenMehrwert bietet.Wolfgang Klein, (Redaktionsleiter „Sabine Christiansen”) antwortet auf alleFragen:Ich bin ganz sicher, dass sich das journalistische Selbstverständnis – bezogenauf den Stellenwert der Unterhaltung – in den letzten zwei Jahrzehntenentscheidend verändert hat. In den 70-er und frühen 80-erJahren hätte sich jeder „anständige Journalist” geniert, wenn er bei derLektüre der Bild-Zeitung ertappt worden wäre. Man ging mit der Zeitunter dem Arm ins Büro und nach Hause. Aber wir haben auch damalsschon an TV-<strong>Format</strong>en gebastelt, die „den Menschen”, der Politik macht,mehr in den Vordergrund rückten – weniger Sachinformationen, mehrUnterhaltung, mehr „Infotainment”. Der Trend war da, auch bei den60
„Öffentlich-Rechtlichen” (...) – Der entscheidende Ruck in den Köpfenkam m. E. mit dem Erfolg der Privatsender und der damit verbundenenKonzentration auf die Quote. <strong>Die</strong> Quote misst nun mal die Zuschauer-Menge und nicht die Qualität einer Sendung. – Für ein Massenmediumwie das Fernsehen finde ich diese Entwicklung <strong>im</strong> Prinzip auch richtigund gesund. Sie zwingt keineswegs dazu, den Kopf an der Garderobeabzugeben und die Seele zu verbiegen. Das belegen viele spannendeund informative Sendungen, die „trotzdem” Erfolg haben – dazu zähleich auch unsere. – Natürlich haben Themen aus der Welt des Sports unddes Entertainments inzwischen „seriöse” Nachrichten-Sendungen undMagazine erreicht. Sie gehören zum Leben und insofern auch in solcheProgramme. Wenn die „Tagesschau” nicht melden würde, dass MichaelSchumacher wieder Weltmeister geworden ist und Steffi Graf ein zweitesKind bekommen hat, würde ich mich nicht umfassend informiert fühlen.Allerdings dürfen solche news nicht wichtige andere Themen verdrängen.In manchen Nachrichten-Sendungen tun sie das – deshalb schaue ichmir die auch so gut wie nie an. <strong>Die</strong>se Freiheit des Zuschauers – best<strong>im</strong>mteProgramme zu schauen, andere nicht – ist von zentraler Bedeutung.Dass das Publikum vor allem „Brot und Spiele” will, ist nicht neu. Mandarf, man muss diese Interessen auch befriedigen. Aber man muss auchanderes anbieten. Für das demokratische Gefüge haben Bohlen undseine Superstars aus meiner Sicht keine Bedeutung. Es gibt ja auchnoch „Christiansen” und Jauch, die Tagesschau und die kritischenMagazine, Brennpunkte und Hintergrund-Sendungen – mit höchst erfreulichenQuoten (...).61
PANEL 3: „PFLEGEFALL QUALITÄTSZEITUNG –MUSS DIE PRESSEFREIHEIT SUBVENTIONIERTWERDEN?”Martin Lohmann, Dr. Michael Maier, Horst RöperIm Folgenden sind die Aussagen der verschiedenen Teilnehmer des Panelszu den einzelnen Fragen dokumentiert und hintereinander montiert. <strong>Die</strong>Reihenfolge der Darstellung ist also konstruiert.1. Haben Qualitätszeitungen eine Überlebenschance?Martin Lohmann, (Chefredakteur, Rhein-Zeitung):Ja. Wenn sie wirklich gut gemacht sind, wenn also ihre Qualität dasErgebnis eines handwerklich sauberen, anständigen und unabhängigenJournalismus ist. Wichtig: <strong>Die</strong> Zeitung muss stets die Leser <strong>im</strong> Blickhaben. Denn diese verlangen informative Qualität. Und Qualität <strong>im</strong> Journalismusist kein Pflegefall, es sei denn, man erkennt die Herausforderungenfür morgen nicht oder zu spät.Dr. Michael Maier, (Chefredakteur, NZ – Netzeitung):Gerade die Qualitätszeitungen! Sie müssen allerdings wirklich einzigartigejournalistische Leistungen bieten, d.h. brillante Reportagen, investigativeAufklärung und meisterhaft erzählte Geschichten.Horst Röper, (<strong>Format</strong>t-Institut Dortmund):Ja. Das gilt für die überregionalen Titel und für die wenigen Regionalzeitungen,die überdurchschnittlich in die Redaktion investieren. Aberdas gilt nicht für alle Titel in gleicher Weise. <strong>Die</strong>jenigen Titel, die schonvor der Werbekrise wirtschaftliche Probleme hatten, werden in schwierigeSituationen kommen. Im Klartext: „<strong>Die</strong> Welt” und kleinauflagige aberbundesweit verbreitete Titel wie das „Neue Deutschland”. Andere Titelwie die „FAZ”, „FR” auch die „SZ” sowie die beiden Wirtschaftstitelhaben sich bereits neu aufgestellt.2. Muss das Kartellrecht geändert werden,damit die Pressevielfalt erhalten bleibt?Martin Lohmann:Nein.62
Dr. Michael Maier:Eine Lockerung des Kartellrechts erhöht nicht die Vielfalt, sondern schafftein Oligopol. Es wäre viel sinnvoller, Investitionsanreize zu schaffen,damit es für neue Investoren attraktiv wird, Zeitungen als Zukunftsprojektezu erwerben.Horst Röper:Nein, umgekehrt: Das Kartellrecht darf nicht dereguliert werden, wenndie Reste der Pressevielfalt erhalten werden sollen. Allenfalls geht esdarum, Löcher <strong>im</strong> Kartellrecht zu stopfen.3. Sollen Zeitungen öffentlich-rechtlich organisiert werden?Martin Lohmann:Nein.Dr. Michael Maier:Absolut nein. <strong>Die</strong> Trennung von Redaktion und Verlag muss innerhalbeines Verlages organisiert sein. Eine schleichende Enteignung wäre dasEnde der Zeitungen.Horst Röper:So lange nicht, bis der Markt bewiesen hat, dass allein über ihn bzw.mit Hilfen der Politik Vielfalt nicht erhalten bzw. wieder erreicht werdenkann.4. Was ist eine Qualitätszeitung?Ist BILD etwa ein Qualitätsboulevardblatt?Martin Lohmann:Eine Qualitätszeitung ist vor allem eine, die sich dem Artikel 1 desGrundgesetzes verpflichtet weiß: <strong>Die</strong> Würde des Menschen ist unantastbar.BILD ist ein erfolgreiches Boulevardblatt. Punkt.Dr. Michael Maier:Eine Qualitätszeitung bildet die Wirklichkeit faktengetreu ab und ordnetsie mit diversen, unterschiedlichen Werkzeugen in die Gesellschaft ein.<strong>Die</strong> Bild-Zeitung heute bildet eine virtuelle Realität (Bohlen und Anhang)ab und ist insoweit kein Qualitätsboulevardblatt.63
Horst Röper:BILD ist keine Qualitätszeitung, aber eine Zeitung, die mit extrem hohemredaktionellem Aufwand arbeitet.5. Haben die Zeitungen das Online-Geschäft verschlafen?Martin Lohmann:Nein. Aber es ist eine große Herausforderung.Dr. Michael Maier:Sie haben zur falschen Zeit zuviel Geld in die falschen Dinge gesteckt.Heute erkennen die Zeitungen, was richtig ist. Ob sie jetzt noch flexibelgenug sind – und ob ihnen der Markt die Zeit lässt! – wird sich erst zeigen.Horst Röper:Welches Geschäft?6. Sind Zeitungen nur ein Wirtschaftsgut,soll allein der Markt entscheiden?Martin Lohmann:Zeitungen sind auch ein Wirtschaftsgut, aber nicht nur. Sie haben, auchwenn sie nicht öffentlich-rechtlich organisiert sein sollten, einen quasiöffentlich-rechtlichen Auftrag. Der Markt entscheidet mit, sollte aber angesichtsder Verantwortung der Medien nicht alleine entscheiden dürfen.Nirgendwo sonst spiegelt sich das Spannungsgeflecht von Freiheit undVerantwortung so deutlich wie in der Medienwelt. Das ist ein eminentdemokratischer Auftrag.Dr. Michael Maier:Der Markt kennt Kontrollmechanismen und setzt diese auch ein. Grundsätzlichgilt: Wenn die Spielregeln so sind, dass es Gerechtigkeit durchBegrenzung der Marktdominanz gibt, ist der freie Markt das Beste.Horst Röper:Zeitungen sind, gerade weil sie nicht nur Wirtschaftsgut sind, anderenRegeln ausgesetzt (Kartellrecht, Mehrwertsteuer, etc.). Es fehlt aber nachwie vor an Instrumenten, um zielgerichtet in den Markt zu intervenieren.Derzeit wird <strong>im</strong>mer noch ausschließlich Unterstützung nach dem Gießkannenprinzipgewährt. Das ist teuer und ineffizient.64
7. Soll der Staat die Pressefreiheit retten? Nach welchem Modell?Martin Lohmann:<strong>Die</strong> Pressefreiheit ist ein hohes und sensibles Gut. Pressefreiheit undFreiheit der Berichterstattung sowie Meinungsfreiheit sind zu gewährleisten.Das deutsche Modell des Grundgesetzes hat sich bewährt und solltenicht angetastet werden. Der Staat hat da nichts zu retten, denn der Staatsind die Bürger. <strong>Die</strong>se aber brauchen in einem freiheitlichen und rechtsstaatlichenGemeinwesen grundsätzlich die Meinungs- und Pressefreiheit,weil nur dann eine freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie funktioniert.Wer die Pressefreiheit beschädigt, beschädigt die Demokratie.Dr. Michael Maier:<strong>Die</strong> Pressefreiheit ist in Russland oder in China unterdrückt, in den meistenarabischen Ländern – ich halte es für unangemessen, die deutscheSituation – die für manche unwirtlich ist – so zu überspitzen.Horst Röper:Ja, eindeutig. Durch aktive Einmischung in die Marktabläufe. Modelledafür gibt es zahlreich und obendrein vielfältige Erfahrungen damit, weilsie teilweise schon seit Jahrzehnten <strong>im</strong> Ausland praktiziert werden.65
66ZWISCHEN WETTBEWERB UND PLURALISMUS„ENTWURF EINES SIEBTEN GESETZES ZURÄNDERUNG DES GESETZES GEGENWETTBEWERBSBESCHRÄNKUNG”Kurt Beck, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz1. <strong>Die</strong> Medienbranche, das heißt Hörfunk, Fernsehen, Presse und NeueMedien befinden sich seit geraumer Zeit, gerade auch durch den Rückgangvon Werbeeinnahmen, in einer wirtschaftlich schwierigen Situation.Als Synonym für diese Entwicklung möchte ich nur an die Insolvenz derKirchgruppe erinnern.Ursachen hierfür sind zum einen die allgemeinewirtschaftliche Lage, aber auch durchgreifendestrukturell veränderte Rahmenbedingungen desMedienmarktes. <strong>Die</strong>s betrifft die Presse und hierden Zeitungsmarkt <strong>im</strong> Besonderen. Neben derschwierigen Entwicklung bei den großen Tageszeitungensind es auch gravierende Veränderungen<strong>im</strong> Umfeld kleinerer Regionalzeitungen, die Konzentrationsbewegungenfeststellen lassen. Es entstehendort hauptsächlich Gebietsmonopole, dienur noch an den Rändern Wettbewerb zulassen.Verstärkt werden diese Monopole noch durch Beteiligungen,vor allem <strong>im</strong> Hörfunkbereich.<strong>Die</strong> Schwierigkeit der Situation, in der sich viele Zeitungen befinden, wirddeutlich, wenn man sich die rückläufigen Auflagen und die schwindendeAnzahl der Tagezeitungen betrachtet, ebenso wie die abnehmenden Werbeeinnahmenauf Grund zurückgehender Anzeigen. <strong>Die</strong>s ist auch ein Zeichengrundlegender Änderungen <strong>im</strong> Verhalten der Menschen <strong>im</strong> Hinblick aufdie Mediennutzung. <strong>Die</strong> jüngere Bevölkerung deckt ihren Informationsbedarfzunehmend visuell über entsprechende Internetangebote.<strong>Die</strong> festgestellten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:So beträgt auf Grund der existenzbedrohenden Werbeeinbrüche derAnteil des Anzeigenaufkommens an den Einnahmen einer Tageszeitung
<strong>im</strong> Schnitt in den neuen Bundesländern zwischenzeitlich nur mehr 54%,in den alten Bundesländern sogar nur noch um die 43%. Im Zeitraumder letzten 20 Jahre sind die Auflagenzahlen der Tageszeitungen umnahezu 7% gesunken, so dass die Tageszeitungen nach entsprechendenSchätzungen heute lediglich noch drei Viertel der Bevölkerung erreichen.Wie sehr sich das Umfeld verändert hat, zeigt auch ein Blick auf die Entwicklung<strong>im</strong> Bereich der Wochen- und Anzeigenblätter sowie die Zunahmeder Internetnutzung mit entsprechenden Onlineangeboten. Anzeigen werdenverstärkt über weltweite Anbieter wie Ebay – mit allen seinenFolgeproblemen – geschaltet. <strong>Die</strong>se veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungenwurden in der Vergangenheit von den Zeitungsverlegernoft nicht hinreichend wahrgenommen. Sie führen nunmehr bei den Großenzu Schwierigkeiten, wie die Probleme bei der Süddeutschen Zeitung undder Frankfurter Rundschau gezeigt haben. Darüber hinaus schafft die veränderteLage eine noch höhere Monopolisierung <strong>im</strong> Bereich der Regionalzeitungenund dort eine z. T. deutliche Verengung der Meinungsvielfalt.2. Angesichts dieser den Zeitungsbereich betreffenden Strukturkrise, machtes grundsätzlich Sinn, dass die Bundesregierung sich dieses Bereiches <strong>im</strong>Rahmen des Entwurfes eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Gesetzesgegen Wettbewerbsbeschränkung angenommen hat. Dabei ist jedochmit Maß und Ziel an die Problemstellungen heranzugehen. Denn nur eineausgewogene, die tatsächlichen Auswirkungen zutreffend vorausschauendeGesetzgebung vermag zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu setzen.3. Aus meiner Sicht sollten sich entsprechende Regelungen daher anfolgenden Grundsätzen orientieren:• Erstens:Pluralismus und damit Medienvielfalt <strong>im</strong> Wettbewerb sind oberstesZiel. Pluralismus kann nur dann gewährleistet werden, wenn auchökonomisch ein Wettbewerb der Zeitungen künftig möglich bleibt unddamit das Nebeneinander von kleinen, mittleren und großen Unternehmengesichert ist. Ferner muss die Freiheit der Redaktionen gewährleistetsein. <strong>Die</strong>s betrifft zum einen die innere Verfasstheit derRedaktionen, zum anderen aber auch den Schutz vor drohenden wirtschaftlichenAbhängigkeiten.• Zweitens:Vielfältige Kooperationen sind besser als Fusionen. Hier gilt es mitMaß und Ziel Gestaltungsspielräume zu schaffen, damit sich Presse-67
unternehmen die notwendigen Existenzgrundlagen selbst sichernkönnen. An diesen Maßstäben müssen sich künftige Regelungenmessen lassen.4. Deshalb möchte ich auf die von der Bundesregierung vorgeschlagenenpressespezifischen Regelungen <strong>im</strong> Rahmen des Entwurfs wie folgt eingehen:• § 31 GWB-Entwurf (Freistellung von Kooperationen von Zeitungsverlagen<strong>im</strong> Anzeigenbereich vom Kartellverbot)Mit dieser Regelung sollen Anzeigenkooperationen von Zeitungen generellaus dem Bereich der Kartellaufsicht herausgenommen werden.<strong>Die</strong> Regelung ist <strong>im</strong> Grundsatz zu begrüßen, da durch eine Kombinationerweiterter Kooperationsmöglichkeiten das Spektrum der Formen derZusammenarbeit gerade <strong>im</strong> Anzeigenbereich ergänzt werden kann.<strong>Die</strong>s mag in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sicher hilfreich sein, umdurch Kooperation mögliche Fusionen zu verhindern.Dennoch sehe ich hier die Gefahr des Missbrauchs. Denn es darf nichtangehen, dass etwa zwei Marktteilnehmer zu Lasten eines Dritten kooperieren,um diesen aus dem Markt zu drängen. An dieser Stelle würdedas Gesetz keine Abhilfe bieten, sich sogar ins Gegenteil verkehren.• Pressegrosso<strong>Die</strong> bisherigen Vertriebsstrukturen des Pressegrosso beruhen auf Vereinbarungendes Handels. Insofern ist zu begrüßen, dass die BundesregierungAbstand davon genommen hat, entsprechende Vorgabenzum Pressegrosso vorzusehen. Denn hier handelt es sich um ein überdie Jahrzehnte bewährtes Instrument mit seinen gewachsenen Vertriebsstrukturen,die vor allem kleineren Zeitungen nützen. Ich haltees deshalb für gut, dass man zunächst Gespräche der Beteiligten abwartenmöchte, die das bestehende Instrument auch in Zukunftsichern sollen.Klar ist jedoch für mich: Das Instrument des Pressegrosso ist für Pluralismusund Meinungsvielfalt unverzichtbar. Insofern wird das Ergebnisder Gespräche sehr sorgfältig auszuwerten sein, auch ob danachnoch weiterer Handlungsbedarf besteht.• § 36 Abs. 1 GWB-Entwurf (Altverlegerregelung)Ziel dieser Regelung ist es, trotz Zusammenschlüssen von Unternehmeneigenständige redaktionelle Einheiten zu erhalten. <strong>Die</strong>s soll gesetzlichvermutet werden, wenn durch den Altverleger über entsprechende68
Anteils- und St<strong>im</strong>mrechte der übernommene Titel publizistisch eigenständigbleibt. <strong>Die</strong>se Variante ist sicherlich ein diskussionswürdigerAnsatz.In diesem Zusammenhang sehe ich das WAZ-Modell, mit dem Verbleibformell selbständiger Redaktionen (oft auch als Redaktionsgesellschaft)innerhalb der Unternehmensgruppe beziehungsweise des Konzerns.Das WAZ-Modell ist erfolgreich. Es ist darüber hinaus attraktiv für dieBeteiligten und hat zum Erhalt unterschiedlicher Zeitungen beigetragen.Leider läuft das Modell Ende des Jahres aus. Es könnte jedoch auchfür andere eine zukunftsweisende Lösung sein.Ungeachtet dessen will ich jedoch Zweifel an einer ausreichendenSicherung durch das „Altverlegermodell” anmelden. So bleibenFragen: Publizistische Eigenständigkeit einer Redaktion und gesellschaftsrechtlicheBeteiligung haben nur bedingt etwas miteinander zutun. Problematisch könnte es zusätzlich werden, wenn der Altverlegersich letztlich doch vom Unternehmen trennen möchten und <strong>im</strong>Rahmen von Absprachen dem Übernehmenden freie Hand lassen will.Dann handelt es sich lediglich um eine formelle Beteiligung, die keinenBetrag zu Meinungsvielfalt leisten kann. Aber auch ein Weiteres istdenkbar: Der Übernehmende könnte ein ökonomisches Druckpotentialaufbauen, das jede Unabhängigkeit einer Redaktion undjeden Einfluss eines Altverlegers in Frage stellt. Das alles scheint mirnoch näher erörterungswürdig.• Zu § 35 Satz 2 GWB-Entwurf (Einführung einer Bagatellklausel für denPressebereich)Auch hier sehe ich noch Diskussionsbedarf. Aufgrund der Einführungeiner solchen Klausel für den Pressebereich könnten bundesweit ca.30 selbständige Zeitungsverlage kontrollfrei aufgekauft werden. <strong>Die</strong>swäre eine Reduzierung von Medienvielfalt, die nicht so ohne Weitereshingenommen werden darf. Erschwerend kommt hinzu, dass dieseGesetzesänderung gerade Großverlagen den Erwerb kleinerer Unternehmenmit einem Umsatz bis zu 2 Mio. € erlaubt. Insofern sehe ichdie Gefahr, dass gerade kleinere Unternehmen schutzlos gestellt werden.• § 38 Abs. 3 GWB-Entwurf (Anhebung der Aufgreifschwellen)<strong>Die</strong> hier beabsichtigte Ausweitung der Möglichkeiten des kontrollfreienZusammenschlusses von Zeitungen bis zu einem Umsatzgrößevon 50 Mio. € ist ebenfalls nicht unbedenklich. Ich erkenne sicherlichan, dass der heutige Wettbewerb Unternehmen von größerer69
wirtschaftlicher Basis erfordert, als dies noch vor Jahren der Fall war.Durch einen so weitgesteckten Rahmen besteht jedoch die Gefahr zusätzlicherKonzentrationen <strong>im</strong> Pressebereich. Solche Konzentrationenhaben Sogwirkungen.Ich meine daher, dass die möglichen Auswirkungen die Regelungennoch nicht hinreichend geprüft sind.5. Ich fasse zusammen:Insgesamt ist es richtig, angesichts der wirtschaftlichen und strukturellenSchwierigkeiten der Branche die pressekonzentrationsrechtlichen Regelungendes GWB ins Blickfeld zu nehmen. Hierbei dürfen jedoch die Zielevon Pluralismus, Meinungsvielfalt und Wettbewerb nicht aus dem Augeverloren werden. Es muss zum einen um eine maß- und verantwortungsvolleErweiterung vorhandener Gestaltungsspielräume gehen. Esmuss auf der anderen Seite jedoch durch entsprechende RegelungenGefahren für Pluralismus und Meinungsvielfalt begegnet werden. Vordiesem Hintergrund sehe ich noch Diskussionsbedarf. Insofern wird sichdie Landesregierung hinsichtlich der Vorschriften zur Pressefusionskontrollegegenwärtig enthalten, aber – wie Sie hören – die Diskussionaktiv mitgestalten.70
BOULEVARD, TALK, RETRO UND OSTALGIE –WANN FOLGT DIE RENAISSANCE DESJOURNALISMUS?Prof. Dr. Siegfried Weischenberg, Universität HamburgMeine Damen und Herren,da während der vergangenen neun Stunden vielleicht schon alles gesagtworden ist, aber noch nicht von allen, komme nun ich mit einer Speechvor dem Dinner. Sie soll nicht alles noch einmal aufwärmen, sonderneiniges ein wenig anders aufbereiten, als das bisher geschehen ist. DerVeranstalter hat dafür einen recht pompösen Titel gewählt. Darin istsogar von Renaissance, also Wiedergeburt die Rede.Ich verkürze ihn, Messdiener, der man mal war, auf die s<strong>im</strong>ple Frage:Wie sehr kann man Weihwasser verdünnen, ohne dass es seine Wirkungverliert? Oder, säkularer gefasst und besser passend zum Abendessen:Wie sehr darf man Wein verdünnen, ohne dass die Schorle geschmackloswird?Es soll also darum gehen, ob und wann dem Journalismus durch dieBoulevardisierung und andere Folterwerkzeuge so viel Substanz verlorengeht, dass er seine Identität verliert. Seine Identität als Einrichtung,mit deren Hilfe die Gesellschaft sich selbst beobachtet und dadurch anaktueller Orientierung in unübersichtlichen Zeiten gewinnt.<strong>Die</strong>sem Problem der Identitätsfindung und vielleicht auch ein wenig derIdentitätsstiftung, widme ich mich in vier Gängen, wobei schon ausZeitgründen jeweils nicht mehr auf dem Teller liegen kann, als weilandbei der Nouvelle Cuisine. Es gibt wie bei „unserem Italiener” – eineVorspeise, einen ersten und zweiten Gang und dann eine Nachspeise.Be<strong>im</strong> Antipasto starten wir mit einem Zitat, dass leider noch nicht alleProbleme löst, weil es <strong>im</strong>mer mehr Gegenmeinungen dazu gibt und dieKommunikationswissenschaft wieder einmal nicht solch eindeutige Hilfestellungenliefert, wie sie sich der Praktiker so sehr wünscht. Der Pr<strong>im</strong>owird sozusagen ein Fischgang, weil dazu eine einschlägige Aussage vorliegt,die hier kulinarisch und auch sonst erstmals voll gewürdigt wird.Danach wollen wir klären, was das Publikum eigentlich essen will. Be<strong>im</strong>Secondo, dem Hauptgang, kommt, wie es sich zumindest in diesem Jahrgehört, zunächst Theodor W. Adorno zu Wort. Das ist schwer verdaulicheKost, ebenso wie eine gewisse Systematisierung der Standpunkte undihre Zuordnung zu einem best<strong>im</strong>mten Verständnis von Demokratie. Aber71
Antipastowir wollen ja satt werden. Das Dessert wird nicht so dolce sein, wie esvielleicht wünschenswert wäre. Es wird bereitet nach dem Rezept vonMedienrechtlern, die dafür plädieren, wenn nicht vor Gott, so doch zumindestvor Gericht eine Qualifizierung der Speisen vorzunehmen, dieder Journalismus präsentiert. Das wird gewiss einem Teil der Anwesendennicht schmecken.„Wir müssen aufhören von Journalismus zu reden, wenn es sich nichtum Journalismus handelt. Zerstreuung, Kurzweil, Larifari ist Unterhaltung,nicht Journalismus. (...) Ein Journalismus, dem es nur noch darum geht,möglichst hohe Einschaltquoten und möglichst hohe Auflagen zu erzielen,ganz gleich mit welchen Mitteln, das ist ein ganz normaler Wirtschaftsbetrieb.”Das ist nicht von mir. Heribert Prantl hat dies 1996 geschrieben. Ichdenke, dass er das <strong>im</strong>mer noch so sieht. Ich bin mir aber nicht sicher(zumal <strong>im</strong> Lichte der heute geführten Diskurse), ob das noch allzu vieleMenschen aus der Branche unterschreiben. Natürlich entspricht es derreinen Lehre. Natürlich ist es richtig, Journalismus ernst zu nehmen. DerPhilosoph Karl Jaspers hat einst behauptet, es sei schicksalhaft für dasVolk, welchen Journalismus es habe.In der Praxis erfährt das, was hier apodiktisch festgestellt wird, ja längstin vielfältiger Weise eine Aufweichung. <strong>Die</strong> Medien orientieren sich nichtan reinen Unterscheidungen, sondern verhalten sich teleologisch (nicht:theologisch): Der Zweck heiligt fast alle Mittel.Das Mittel ist die Boulevardisierung, der Zweck ist der kommerzielleErfolg. Boulevardisierung bedeutet nicht nur Personalisierung, sondern:Familiarisierung, S<strong>im</strong>plifizierung, Melodramatisierung und Visualisierungaller Themen. Aller Themen: Man verdünnt z. B. das Thema Ostdeutschland,bis nur noch ein paar showfähige Ossis à la Kati Witt übrig bleiben,die über die vergangenen Zeiten schwadronieren. Auf dem Retro-Mobilwerden sogar die RAF-Morde telegen zur lockeren Mediensottise verrührt.Auch <strong>im</strong> Journalismus ist die Boulevardisierung offenbar der Preis, denwir heutzutage für die Pressefreiheit zahlen müssen. Wir müssen deshalbwohl auch akzeptieren, wenn politische Kampagnen gestartet werden,damit die Kasse st<strong>im</strong>mt. Wir müssen akzeptieren, dass das Parlamentals Forum der repräsentativen Demokratie nicht mehr die erste Geigespielt. Wir müssen akzeptieren, dass so genannte Qualitätsmedien auf72
der Intensivstation liegen. Und wenn schon nicht akzeptieren: Wir müssenes registrieren.Egal, wie wir Journalismus definieren – wir müssen seit Jahren registrieren,dass insbesondere die Personalisierung wie ein Virus jedes Medium undjedes Thema erreicht. Kommunikationswissenschaftler haben inzwischensystematisch nachgewiesen, dass die Fernsehnachrichten <strong>im</strong> letzten Jahrzehnt<strong>im</strong>mer unpolitischer, zu Personality-Shows geworden sind. Regionalzeitungenversuchen, so zeigen Analysen, durch Ausweitung ihres Boulevardanteilsan den Inhalten zu überleben. Mit Hilfe von Algorithmen wirdder Nachrichten-Journalismus mittlerweile von Online-Portalen so gekonntverwässert, dass man dort vergeblich nach Journalisten sucht.Eine norddeutsche Produktionsfirma hat die Geschäftsidee perfektioniert,Recherchestrategien exklusiv auf das Sammeln von O-Tönenprominenter Menschen zu fokussieren: „Jeden Tag 3 Stars mit jeweils3 O-Tönen” – frisch für die Frühsendung, wirbt die Firma. Sie residiert inder Pastorenstraße 16 in Hamburg und nennt sich deshalb „Pastor 16”.So hat auch der Boulevard seine guten Hirten...Wir tun uns aber <strong>im</strong> Einzelfall recht schwer, präzise gegen die Zeitläuftezu argumentieren. Etwa, wenn die taz in diesen Tagen die Erkrankungvon Robert De Niro unter der Titelzeile „Seine härteste Rolle” zum Anlassn<strong>im</strong>mt, auf einer ganzen Seite über Prostatakrebs und „Sex, sperm &rock’n’roll” zu entertainisieren. Hat das Virus nun auch die Qualitätspresseinfiziert – oder handelt es sich um nützliche Information überProbleme des alternden Mannes?Aus der Perspektive von Frauen erfährt die Boulevardisierung sogar eineunerwartete Legit<strong>im</strong>ation, wenn Gender-Forscherinnen aus der Kommunikationswissenschaftkühl feststellen, das Gegenteil von Informationsei nicht Unterhaltung, sondern Desinformation und das Gegenteil vonUnterhaltung Langeweile. Da vor allem Frauen Unterhaltung zu goutierenwüssten, könne sie grundsätzlich nicht schlecht sein, solle man sichnicht so haben mit der Kritik am Infotainment und den „Konzeptkünstler”Tom Kummer gefälligst in Ruhe lassen.Deshalb hat sich unsereiner, weil er sich mit den Kolleginnen nicht zusehr entzweien will, angewöhnt, vorsichtiger zu formulieren – auch wenn<strong>im</strong>merhin Sigrid Löffler den Boulevard-Journalismus mit dem Etikett„Journalismus light” versehen hat, der nur als Vehikel der Unterhaltungdiene und nicht als Instrument ernst gemeinter Information. Ich selbsthabe mal von „Schreinemakerisierung” geschrieben, als ich mir nochhundertprozentig sicher sein konnte, dass Journalismus als Seifenoper,Fernsehen als Rummelplatz und Kasperle-Theater, dass Programme, die73
Pr<strong>im</strong>o<strong>im</strong> Leerlauf drehen, und Gaukler mit Moderatoren-Tarnkappe nichts mitJournalismus zu tun haben.Doch inzwischen kommt man ja ins Grübeln:• Wenn Unterhaltung (als permanente formale Variation stereotyperInhalte) zur grundlegenden Farbe einst anspruchsvoller Kulturprogrammedes Radios wird;• wenn die – gewiss professionell gemachte und moderierte – Talkshow„Hart aber fair” den Deutschen Fernsehpreis als beste Informationssendungerhält;• wenn die Fernsehsender in ihren Nachrichtensendungen Sportinformationenauf Werbung für die eigenen Highlights reduzieren können,für die sie die Rechte besitzen;• und wenn Günther Jauch, der professionell und geschäftstüchtigzwischen Journalismus, Werbung und Unterhaltung hin und her turnt,durch seine TV-Präsenz zur glaubwürdigsten Figur in Deutschland aufsteigenkonnte (68 % der Mecklenburger wünschen ein wichtigespolitisches Amt für ihn).<strong>Die</strong> Verhältnisse sind ganz schön unübersichtlich, die Grenzen fließendund die Bewertungen schwierig. Wir haben an der Universität Hamburg<strong>im</strong> Rahmen eines DFG-Projekts mehrere Jahre lang versucht herauszufinden,welche D<strong>im</strong>ensionen die Entgrenzung des Journalismus angenommenhat. Nachdem wir viele Programme analysiert, Medienmenschenbefragt und Tausende von Daten ausgewertet haben, können auch wirleider nicht mit einfachen Antworten dienen.Überall, so zeigt auch unsere Studie, wird der Journalismus inzwischenauf Trinkstärke gebracht, mit allen möglichen unterhaltsamen und sogarfiktionalen Elementen angereichert – mögen die Themen auch noch sokomplex sein. Andererseits gibt es aber <strong>im</strong>mer wieder Leute, die dasmerken, sich auf alte Tugenden besinnen und gegensteuern. Wir nennensie nach wie vor: Journalisten.Der Erfolg von Medien be<strong>im</strong> Publikum basiert <strong>im</strong> Grunde genommen aufeiner idealistischen Illusion: Dass die Medien kein Geschäft sind, sondernvon edlen Menschen betrieben werden. Von Menschen, die sich um Aufklärung,um demokratische Öffentlichkeit, um offene Kommunikation,sogar um gute Literatur kümmern, um Kritik und Kontrolle, um74
Orientierung – und damit so eben auf ihre Kosten kommen.Meine Damen und Herren: So war das nie, wie ein Streifzug durch diePressegeschichte lehrt. Aber von dieser Illusion hat man <strong>im</strong>mer schon gutgelebt. Immer schon – das wissen wir seit den griechischen Tragödien –haben Leute versucht, mit Hilfe von menschlichen Abgründen Ruhm undGeld zu ernten. Sie haben es menscheln lassen, weil es <strong>im</strong>mer schonLeute gab, die sich dafür – und für nichts anderes – interessierten.Und schon lange vor den heutigen Glücksrittern der Medienindustrie gabes Akteure, welche die Neugierde der Menschen ausgebeutet haben. EinBeispiel dafür ist der Renaissance-Glücksritter Pietro Aretino aus Arrezzo:einerseits investigativer Reporter, der den damals Herrschenden zuschaffen machte, andererseits ein gewissenloser Profiteur des Handelsmit boulevardesken Informationen. „Renaissance des Journalismus” solltenwir also nicht allzu wörtlich nehmen.Immer schon gab es auch Leute, die sich ganz zynisch auf den Publikumsgeschmackzurückgezogen haben, wenn es um eine Legit<strong>im</strong>ationihrer Medienangebote ging. Als klassisch gilt hier der Satz: „Der Ködermuß dem Fisch gefallen und nicht dem Angler!” Er stammt bekanntlichvom ehemaligen RTL-Chef Helmut Thoma. Und zwar aus einer Zeit, alsRTL noch „RTLplus” hieß und in seinen Stellenanzeigen ganz besonderesPersonal suchte, nämlich „weibliche Vorzeigeköpfe mit Einstein-Grips(...) Gesichter, bei denen Kameramänner den Atem anhalten (...) St<strong>im</strong>men,die einen Stein zum Lächeln bringen” sowie „Supermänner, die mit einerPommes-Frites-Gabel die Rocky Mountains umgraben können”.So haben sie damals jemanden wie Frauke Ludowig gefunden, die einBeispiel ist für die kühle Professionalität des Boulevard-Journalismusunserer Tage. <strong>Die</strong> Arbeit sei einfacher geworden, weil auch die Promissich daran gewöhnt hätten, ihr Privatleben mehr oder weniger ausladendin der Öffentlichkeit auszubreiten, sagte sie kürzlich der FrankfurterAllgemeinen Sonntagszeitung. Und wörtlich: „Ganz klar, wir benutzendie Prominenten. Und sie benutzen uns.” Das sei eine „Mischkalkulation”zwischen Publikums- und Promi-Interessen.Was nun Helmut Thoma angeht, so ist sein Satz in Hinblick auf diePublikumsinteressen eigentlich nie so ganz richtig gewürdigt worden.Denn die Metapher suggeriert ja eigentlich nicht, dass dem Publikumetwas Schmackhaftes präsentiert wird, sondern dass es geködert und –das ist schließlich das Ziel des Angelns – gefangen und in die Pfannegehauen wird. Von einem christlichen Menschenbild scheint mir diesdoch ziemlich weit entfernt zu sein.Das heutige Publikumsbild des Fernsehens ist aber ohnehin kein75
SecondoKompl<strong>im</strong>ent für die Zuschauer. Man hat offenbar die Vorstellung voneiner tumben Masse, die nach Gewinnspielen giert, bei denen Fragenauf dem Niveau von „Wo liegt Köln am Rhein?” zu bewältigen sind.<strong>Die</strong> Publikumsforschung bietet uns hier auch nur Informationen an, dieambivalente Eindrücke vermitteln. Bei den Nutzungsmotiven für dasFernsehen, den Hörfunk und die Tageszeitung gibt es eine Mischung ausder Suche nach Information, Entspannung und Spaß. Manches ist Gewohnheit.Immerhin sagen die jungen Zeitungsleser überproportionaloft, dass sie Zeitung lesen, um sich <strong>im</strong> Alltag zurechtzufinden.Drehen wir die Bedürfnislage mal herum: Wie viel Bohlen brauchen wireigentlich, um in der Umwelt klarzukommen? Wie sehr kann ein Journalismusorientieren, der alles auf die Frage reduziert, ob ein ThemaPromi-Charakter hat und nur so vermittelbar ist? Oder: Wie viel Unterhaltungswertmuss der Journalismus wirklich haben, um vom Publikumakzeptiert zu werden?<strong>Die</strong> Frau, die <strong>Die</strong>ter Bohlen die Feder führt und an die geschlossene Verwertungskettelegt, sieht das natürlich ganz gelassen. Intelligent, promoviert,will sie uns glauben machen, dass uns eigentlich der Humorfehle, wenn wir alles, was sie macht, zu wichtig nehmen. Auch, als siedie Miezentexte in der Bild-Zeitung schrieb, die so unterirdisch waren,dass man sich fragte, für welche Menschen die eigentlich best<strong>im</strong>mt sind.Selbst das Klischee vom durchschnittlichen Bauarbeiter half hier nichtweiter.Sind die Leute wirklich so, dass sie nur noch auf dem Boulevard flanierenwollen? <strong>Die</strong> selben Leute, die doch bei der Wahl – jeder und jede –eine St<strong>im</strong>me haben und gemeinsam best<strong>im</strong>men, was aus diesem Landewerden soll. Wenn das egal wäre, wenn die Abst<strong>im</strong>mung am Kiosk wirklichder höchste Wert wäre, könnten wir an dieser Stelle den Diskurs beenden.Das tun wir aber nicht, und zwar aus guten Gründen.„Scheinheilig beansprucht die Kulturindustrie, nach den Konsumentensich zu richten und ihnen zu liefern, was sie sich wünschen,” schreibtTheodor W. Adorno in seinen „Min<strong>im</strong>a Moralia”. Und weiter: „Nichtsowohl paßt Kulturindustrie sich den Reaktionen der Kunden an, als daßsie jene fingiert. Sie übt sie ihnen ein, indem sie sich ben<strong>im</strong>mt, als wäresie selber ein Kunde. (...) Ihr Produkt ist gar kein St<strong>im</strong>ulus, sondern einModell für Reaktionsweisen auf nicht vorhandene Reize.” Adorno teiltdies unter dem Stichwort „<strong>Die</strong>nst am Kunden” mit.76
<strong>Die</strong>s ist natürlich eine ganz andere Beschreibung der Verhältnisse alszum Beispiel bei Helmut Thoma. Er brachte es <strong>im</strong>merhin zum Beraterdes Medienpolitikers, der zurzeit damit beschäftigt ist, einen neuenRahmen für Zeitungsvielfalt zu entwerfen. Das müsste eigentlich einGlücksfall sein, denn dieser Superminister kennt sich aus mit der Brancheund ihrem glatten Boulevard. Andererseits erinnern wir uns noch daran,wie er 1988, als Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, Uwe Barschel<strong>im</strong> Sommerloch ermorden ließ.Im Exempel Wolfgang Clement steckt eine Offenbarung: Wenn nicht einmalein so starker, kompetenter Mann den Anfechtungen standhaltenkonnte, welche die kommerziellen Zwänge so mit sich bringen – müssenwir dann nicht ernsthaft über die Strukturen nachdenken, über eineaktive, demokratische Medienpolitik, die zumindest das Schl<strong>im</strong>mste verhindert?Über Bemühungen um die Sozialverantwortung der Medien,also das Gegenteil von Deregulierung nach dem Muster des wahrscheinlichverfassungswidrigen Hamburger Mediengesetzes.Sein (unheiliger) Geist folgt, ebenso wie einige der von mir Zitierten undder heute zu Wort gekommenen, einem neoliberalen Modell von Öffentlichkeit.Danach ist der Kunde König, folgen die Medien bei der Auswahlund Präsentation der Nachrichten ausschließlich den Präferenzen derBürgerinnen und Bürger. Es gibt hier keine Skrupel gegenüber Irrelevanzder Themen und keine prinzipiell sich verbietende Form der Darstellung<strong>im</strong> Rahmen der geltenden Gesetze.<strong>Die</strong>s ist etwas grundlegend anderes als das republikanisch-diskursiveModell von Öffentlichkeit, das die freie Arena zum Austausch vonArgumenten <strong>im</strong> Blick hat und nach dem Beitrag des Journalismus für diedemokratische Willensbildung fragt. <strong>Die</strong>ses Modell lehnt die Boulevardisierungder Inhalte grundsätzlich ab; zu bekämpfen wäre demnachalles, was die ernst zu nehmende Berichterstattung aufweicht.<strong>Die</strong>ses Modell wirkt inzwischen ziemlich anachronistisch. Seine Vertretererscheinen wie die letzten Mohikaner der Aufklärung, die von denMarketing-Leuten innerhalb und außerhalb der Medien längst nicht mehrernst genommen werden.Dennoch behaupte ich, dass ein Ansatz, der zumindest auf dem Konsensüber best<strong>im</strong>mte Grenzen beharrt, die der Journalismus nicht überschreitensollte, gut begründet werden kann. Stellen wir uns nur vor, in derPädagogik würden dieselben Maßstäbe angelegt wie bei den Medien.Gelehrt und gelernt würde dann nur noch das, was gefällt. <strong>Die</strong> Schülerund Studenten würden den Stoff auswählen, die Lehre nach dem Unterhaltungswertbewerten und nach Lust und Laune wegzappen.77
DessertEin schiefer Vergleich? Äpfel und Birnen? Wer das sagt, sollte daranerinnert werden, dass heutzutage mehr denn je junge Leute ihr Weltbildeher aus den Medien als aus den Schulklassen und Seminarräumenbeziehen. Das führt dann dazu, dass auch Sabine Christiansen, verdammtnoch mal, endlich hohe politische Verantwortung übernehmensoll; fast die Hälfte der Bevölkerung will das so (Bohlen, das tröstetkaum, kommt nur auf 4 Prozent).Es gibt keine Legit<strong>im</strong>ation für ein Mediensystem, das ausschließlich ökonomischtickt. Sondern die Verpflichtung aller an den Medien Beteiligter,Sozialverantwortung zu übernehmen.Wir reden so viel über die Zukunft der Wissensgesellschaft und entwerfen– zumal nach Pisa – <strong>im</strong>mer ambitioniertere Pläne für Schulen und Hochschulen.Aber wie können wir glauben, dass wir tolle, gebildete Kinderund Jugendliche hervorbringen, wenn ihnen von den Medien vorgegaukeltwird, dass man Wissen akkumulieren kann, ohne sich anstrengenzu müssen? Es erscheint mir problematisch, dass inzwischen jeder medienpädagogischeAnspruch unter Ideologieverdacht steht – zumindest aberunter dem Verdacht der Geschäftsschädigung.<strong>Die</strong> Profiteure der Boulevardisierung handeln für sich selbst hier ganzcool. <strong>Die</strong> schwungvolle Feder des <strong>Die</strong>ter Bohlen wird ihre Kinder gewissauf die Waldorf-Schule schicken. Von Silvio Berlusconi wissen wir, dasser seine Kinder konsequent vor Fernsehkonsum schützen ließ. UndChristiane zu Salm vertieft sich – so lernen wir aus der FAZ – privat indie Sozialtheorien von Niklas Luhmann und Jürgen Habermas. Aber vielleichtfolgt Neun Live ja he<strong>im</strong>lich dem republikanisch-diskursiven Modellvon Öffentlichkeit à la Habermas; wir haben es nur noch nicht gemerkt.Wir Deutschen, miesepetrig wie wir sind, lieben es, zumindest unsereProbleme exklusiv zu haben. Da irren wir uns auch bei der Boulevardisierung.Im Ausland wird über die Verwässerung des Journalismusgenauso geklagt wie bei uns.Überall ist der Journalismus heutzutage be<strong>im</strong> Berufsprestige dritteKlasse; knapp vor den Politikern. Als vierte Gewalt ist er nur bedingt abwehrbereit.Als fünfte Kolonne dient er für PR und andere Interessenkommunikation,und zwar allzu willfährig.Boulevardisierung ist insofern Ausdruck von <strong>im</strong>manenten Selbstgefährdungenauf den globalen Informationsmärkten. Dabei wird mit demFeuer insbesondere dann gespielt, wenn der Journalismus schutzlos78
Kampagnen ausgesetzt ist, weil seine Rechercheressourcen nicht ausreichen,und wenn er, hilflos auf Erfolge stierend, mit der Grenze zwischenFakten und Fiktionen spielt.In einer Vielzahl von Gerichtsurteilen ist mangelhafte Qualität des Journalismus– insbesondere <strong>im</strong> Bereich der Recherche – nachgewiesen worden.Allein deswegen erscheint es geboten, Risikovorsorge zu betreibenund sich ernsthafter als bisher mit Strukturen für die Qualitätssicherungzu beschäftigen. Medienjuristen steuern dazu Vorschläge bei, die Medienverantwortlicheunruhig werden lassen müssten.Konkret geht es um die Idee, Sorgfaltsanforderungen an die Medienkünftig mit dem Nachweis eines best<strong>im</strong>mten Qualitätsmanagements zuverknüpfen. Also nicht länger Arbeitsweisen mit zu privilegieren, die aufunzulänglichen Bedingungen beruhen. Befördert würde Berechenbarkeitund damit der Entzug von Privilegien – auf der Basis einer Differenzierungvon Standards für die Pressehaftung. Zahlen muss, <strong>im</strong> Falle desRechtsstreits, wer systematisch die Recherche vernachlässigt, fordertzum Beispiel mein Hamburger Kollege Karl-Heinz Ladeur.Wie auch <strong>im</strong>mer: Wir brauchen ein Modell von Medien und Öffentlichkeit,das Mindeststandards für die Qualität der Medien sichert – wieüberall dort, wo es um hohe Risiken geht. Wir brauchen nicht mehrJournalisten, die ökonomisch denken können, wie Verlagsmanager seitlängerem fordern, sondern mehr Journalisten, die denken können.Andernfalls zahlen wir einen zu hohen Preis für den offenen Berufszugang.<strong>Die</strong> Zahl der Journalistinnen und Journalisten hat sich in denletzten 20 Jahren verdreifacht, ohne dass die Aus- und Weiterbildungsanstrengungenund die Qualitätskontrolle dem gerecht geworden wären.Wenn es, mit Adorno, kein richtiges Leben <strong>im</strong> falschen gibt, dann gibtes auch keinen richtigen Journalismus in den falschen Medien. Was’richtige’ Medien, was ’falscher’ Journalismus ist, darüber wird manweiterhin trefflich streiten können. So viel steht <strong>im</strong>merhin fest: Darübermuss man wohl intensiver streiten als bisher.<strong>Die</strong> Meinungsfreiheit ist – so räumen selbst Ökonomen ein – ein öffentlichesGut, das wir uns etwas kosten lassen müssen. Bei seiner Pflegemuss der Staat mitwirken, und sei es nur durch die Regulierung vonSelbstregulierung.„Öffentliche Güter,” schrieb Julian Nida-Rümelin kürzlich in der FrankfurterRundschau, „setzen der Kommerzialisierung Grenzen. Öffentliche Güternehmen die Bürgerinnen und Bürger nicht nur als Konsumenten, sondern79
als Kooperationspartner wahr. (...) Öffentliche Güter sind Ausdruck einerDemokratie, in der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, Solidarität undKooperation einen hohen Stellenwert haben.”Das ist gut gesprochen, und deshalb kann ich am Ende nun reinenHerzens und guten Gewissens zum Anfang zurückkehren.Weihwasser soll – wie der Journalismus – der Abwehr von Gefahren dienen.Im Weihwasser steckt die Kraft der Reinigung – gegen den Teufel undalles andere, was der Seele schadet. Deshalb müssen wir alles dafürtun, dass es seine Wirkung nicht verliert. Einerseits.Andererseits schreckt die Meldung auf, dass <strong>im</strong> Weihwasser millionenfachKe<strong>im</strong>e enthalten sind: Staphylokokken, Rädertierchen, Würmer, Hautfetzen,Streptokokken. Das Hygieneinstitut der Münchner Universität hatalles dies und anderes in bayerischen Kirchen gefunden. Am schlechtestenschnitt die Gnadenkapelle <strong>im</strong> Wallfahrtsort Altötting ab (Herbert Riehl-Heyse wäre amused gewesen).Wenn das so ist, müssen wir vielleicht tatsächlich die Ansprüche herunterschrauben,auf keine Renaissance warten und froh sein, wenn derJournalismus nicht allzu kontaminiert ist. Vielleicht ist das aber aucheine zu anspruchslose Haltung.Denken Sie mal be<strong>im</strong> Essen darüber nach! In diesem Sinne:Buon appetito!Dinner Speech be<strong>im</strong> 8. MainzerMedienDisput, 4. November 200380
REDE „LEUCHTTURM” – PREISVERLEIHUNGJürgen Dahlkamp, Der Spiegel„Der beste Freund des Journalisten istdie Akte.” So lautet das Cetero censeomeines geschätzten Kollegen GeorgMascolo, der in seinen Schränken vielegute Freunde hat, darunter ein paar,deren Freundschaft ziemlich exklusivist. Der Satz ist <strong>im</strong>mer gut, wenn ihmeiner mit „könnte”, „sollte”, „würde”kommt, mit Gerüchten und Gerede,wenn ein Tipp so heiß ist, dass Journalistensofort Feuer und Flamme sindund deshalb umso mehr aufpassenmüssen, sich be<strong>im</strong> Schreiben nicht dieFinger zu verbrennen.Akten zu lesen, kann mühselig sein, ihre Beschaffung noch mühseliger,so wie journalistische Recherche überhaupt schwierig, ermüdend undfrustrierend sein kann. Menschen, die nicht reden oder nur die Hälfteder Wahrheit sagen, ohne zu verraten welche Hälfte die richtige ist.Papiere, die nicht zusammenpassen, Lücken lassen, lügen. Indizien, diesich aufs Schönste in Arbeitshypothesen aus Wille und Vorstellungfügen. Bis man hier noch einen mehr fragt und da noch etwas weiterliest, und plötzlich knirscht die Geschichte oder bricht zusammen, weilsie eben doch zu schön war, um wahr zu sein.Gerade deshalb aber ist gründliche Recherche unverzichtbar, dasFundament, auf dem eine Story am Ende stehen und bestehen muss.Recherche ist journalistischer Selbstschutz, schon damit der Journalistsicher ist vor den Anwälten der Betroffenen und Getroffenen. Sie ist aberauch journalistische Schutzpflicht, damit er gewissenhaft ist, gewissenhaft<strong>im</strong> eigentlichen Sinne des Wortes gegenüber den Menschen undden Gegenständen, die er beschreibt.Daraus ergeben sich notwendigerweise die aus meiner Sicht wichtigstenbeiden Grundsätze einer soliden Recherche. Erstens: ein ständiges Misstrauengegenüber den Ergebnissen. Zweitens: die Bereitschaft, auch einResultat hinzunehmen, das die Geschichte totmacht.81
Vorschläge und Bewerbungen bittejeweils bis zum1. September (eines Jahres) an:info@netzwerk recherche.derichten.<strong>Die</strong> Preisträger werden mit einerLeuchtturm-Grafik und einem Preisgeldin Höhe von 3.000 Euro ausgezeichnet.Der „Leuchtturm 2004“wird in diesem Jahr während des9. MainzerMedienDisputs verliehen.Der Medienpreis „Leuchtturm fürbesondere publizistische Leistungen“wird gefördert von dem Verein„kontext – Gesellschaft zur Förderungjunger Journalisten. Eine Initiative derRuhrgas AG.“Stefan L. WolfLeuchtturmfür besondere publizistischeLeistungenMedienpreis des netzwerkes recherche e.V.Ausgezeichnet werden Personen und Projekte:• aussergewöhnliche Recherchen, die für den öffentlichen Diskursvon grosser Bedeutung sind• eindrucksvolle Reportagen, Essays oder Interviews, die derÖffentlichkeit ein bislang unbeachtetes Thema präsentieren sowie• wegweisende Medienprojekte oder Initiativen, die öffentlicheDebatten in der Bürgergesellschaft anregen.
<strong>Die</strong> erste Bedingung für eine solide Recherche ist dagegen der Wille,solide zu recherchieren, er muss nicht nur be<strong>im</strong> Journalisten vorhandensein, sondern auch bei seinem Arbeitgeber. Wer täglich eine oder zweiZeitungsseiten abfüllen muss, weil sein Verleger <strong>im</strong> Wirtschaftsplan dasso ausgerechnet hat, wird schon froh sein, wenn keine Löcher in seinenSeiten klaffen, höchstens in der Recherche.Be<strong>im</strong> SPIEGEL zu arbeiten, bedeutet, Informanten persönlich treffen zukönnen, zu ihnen zu fahren, auch zu fliegen, auch ins Ausland, bedeutetFern- und Fernsttelefonate, ohne dass ein Taylorist die Sekundenmisst, bedeutet vor allem Zeit für Recherche. Das alles ist natürlichmehr, als man voraussetzen kann, wenn man in einer kleinen Lokalredaktionarbeitet.<strong>Die</strong> andere Seite: Wer nur schnell fertig werden will und dazu dieFertiggerichte der Pressestellen aufkocht, oder wer von seiner Meinungschon so begeistert ist, dass er sich durch Fakten nicht ernüchtern lassenwill, der wird sich mit Recherche nicht groß belasten. Auch das habe ichin meiner Zeit als freier Mitarbeiter <strong>im</strong> Lokalen erlebt – so wie dasGegenteil, Redakteure, die trotz beschränkter Möglichkeiten kritischenund nachforschenden Journalismus machten.Wer recherchieren will undrecherchieren kann, der musses erst mal lernen. Wahrscheinlichkann man sich nicht allesbeibringen lassen: Wer einmalden begnadeten Kollegen erlebthat, der bei wildfremden Menschenan der Haustür klingeltund in ein paar entscheidendenSekunden Vertrauen bei ihnenweckt, der weiß, dass einigesauch mit Talent zu tun hat,manchmal nur mit dem richtigenZungenein- oder Augenaufschlag.Was aber erlernbar ist, liegt nicht in der Luft und fliegt einemdeshalb auch nicht zu, man wird es sich mühsam aneignen müssen, weilTalent und Courage dafür kein Ersatz sind.Dazu braucht es Zeit, Zeit für Erfahrungen, Zeit für Ausdauer. Dass eszum Beispiel ein höchstrichterliches Urteil gibt, mit dem Journalisten sich83
84die früher sonst nur schwer zugänglichen Grundbücher öffnen können,wird einem nicht in die Wiege gesungen; man darf wohl auch vermuten,dass es nur die wenigsten Volontäre in ihrer Ausbildung erfahren. Dasgleiche bei der Suche nach einem Menschen, von dem man gerne etwaswüsste, wüsste man nur, wo man ihn fände – ohne Einträge <strong>im</strong> Telefonbuch:Wie man sich also von Adresse zu Adresse hangelt, zur Not überden Friseur <strong>im</strong> Dorf zum Ex-Nachbarn, vom Ex-Nachbarn zum Ex-Vermieter,vom Ex-Vermieter zur neuen Anschrift, so etwas ist keine Hexerei,nur Kärrnerarbeit, jedoch kein Lehrbuch-Stoff. Viele größere Recherchensind aber vor allem darauf angewiesen, dass über Jahre ein Verhältniszu Informanten entstanden ist, Gesprächspartnern, die Hintergründeausleuchten und Vordergründiges entlarven, die Belege beschaffen könnenund Belege auch beschaffen wollen.Schließlich gehört der Großteil der Arbeit aber zum Handwerk, und wennjeder seines Glückes Schmied ist, dann ist die Recherche deshalb dasSchmiedehandwerk des Journalisten.
BOULEVARDISIERUNGUNDQUALITÄTIMJOURNALISMUS
INFO MIT –TAINMENTNACHRICHTEN IM LANGZEITVERGLEICHProf. Dr. Georg Ruhrmann, Universität JenaEinleitungInfo mit –tainment! Privatheit, Int<strong>im</strong>ität, ja sogar Ängste aller Art sindfernsehrelevant geworden. <strong>Die</strong> Spekulation eines privaten Senders, obein früherer Bundespräsident nach dem Tode seiner Frau so bald schonwieder heiraten dürfe, war seinerzeit Aufmacher einer Hauptnachrichtensendung.Ist das eine journalistische Fehlleistung? Nein. Es ist der Ausdruckdes Wandels unserer Fernsehnachrichten.<strong>Die</strong> Konkurrenz macht’s möglich. <strong>Die</strong> Technik macht’s möglich. Und: der Zuschauermacht’s möglich. Doch: „Fernsehen wird noch härter, noch verrückter”schreibt BILD <strong>im</strong> April 2004 bei der Ankündigung von „Fear Factor” (...).Was bekommt man eigentlich zu sehen, wenn man sich Nachrichtennicht nur von Tag zu Tag anschaut. Sondern wenn man einen Zeitraumvon 10 Jahren beobachtet? Wir – ein Team von Kommunikationswissenschaftlernder Universtäten Jena, Berlin, Salzburg und Stuttgart – habenuns über 2400 Fernsehnachrichten angeschaut (vgl. Maier 2003; Ruhrmannu. a. 2003). Wir haben außerdem die Journalisten gefragt, wie sichaus ihrer Sicht die Nachrichten verändert haben, insbesondere was ihreeigenen Auswahlkriterien angehen (vgl. <strong>Die</strong>hlmann 2003). Und wir berücksichtigeneinen ganz und gar nicht journalistischen Akteur <strong>im</strong> Nachrichtenprozess:die Zielgruppe der jeweiligen Angebote. Oder sagen wirbesser, die vorgestellte Zielgruppe (vgl. Ruhrmann 2003a; Woelke 2003).1. Ziel und KonzeptNachfolgend wird ein Modell zur Analyse von Nachrichten und Befundeeiner Langzeitstudie über deutsche Fernsehnachrichten knapp skizziert(vgl. Ruhrmann/Woelke 2003). Es geht dabei um drei Fragenkomplexe:1. Wie berichten die acht wichtigsten Sender in ihren Hauptnachrichtensendungenüber best<strong>im</strong>mte Ereignisse? Welche Nachrichtenfaktoren,also Auswahlkriterien, weisen die präsentierten Meldungen auf?88
2. Welche „Nachrichtenfaktoren” schreiben Journalisten einzelnen Ereignissenund Themen zu? (Wie) definieren Journalisten ihre Rolle?3. Und: Welche Nachrichtenfaktoren beeinflussen die Auswahl und Erinnerungder Zuschauer? Lassen sich die Nachrichtenrezipienten typisieren,welche Zielgruppen gibt es?Doch was sind eigentliche Nachrichtenfaktoren?NachrichtenfaktorenSeit Mitte der 50er zeigen amerikanische und europäische Sozialforscher,dass spezifische Merkmale, die Ereignissen zugerechnet werden, überihre <strong>Publikation</strong> entscheiden. Einar Östgaard vom Osloer Friedensforschungsinstitutwar 1965 der Erste, der diesen Merkmalen einenNamen gab: Nachrichtenfaktoren. Ich erörtere die ersten drei:• Vereinfachung best<strong>im</strong>mt nicht nur die journalistische Selektion, sondernauch die redaktionelle Verarbeitung. Komplexere Zusammenhängekönnen kaum zur Nachricht werden.• Identifikation bedeutet, dass vor allem Personen oder Geschehnisse,die dem Publikum schon vertraut sind, zur Nachricht werden können.• Sensationalismus meint, dass Presse und Fernsehen bevorzugt überKonflikte, Unfälle und Katastrophen berichten. Letztendlich geht esum die effiziente Bündelung öffentlicher Aufmerksamkeit.Doch allein diese Auswahlfaktoren, so wird seit den 60er Jahren kritischdiskutiert, erhalten den Status quo der Weltordnung. Betont werden dieindividuellen Handlungen politischer Führer oder internationaler Großmächte.Und – wie der renommierte Sozialforscher Johan Galtung <strong>im</strong>Mai 2004 anläßlich eines Festvortrages in Erfurt treffend feststellt: Fernsehnachrichtenzeigen keine Konflikte, sondern Gewalt. Langwierige Konfliktlösungsversucheund Diplomatie sind somit kaum Nachrichtenthema.Insgesamt haben mehrere Forscher das Konzept der Nachrichtenfaktorenausgebaut. Ich nenne nur die bekanntesten europäischen: die norwegischenSozialforscher Galtung/Ruge (1965) sowie die deutschen KommunikationswissenschaftlerWinfried Schulz (1970), Friedrich Staab (1990)und Christine Eilders (1997).89
Hier setzen wir ein: Unsere Studie untersucht – ausgehend von Theorienzur Selektivität von Massenkommunikation (Vgl. dazu aus unterschiedlicherPerspektive: Schulz 1976; Giegler/Ruhrmann 1990; Iyengar 1991;Ruhrmann 1991; Ruhrmann 1994; Luhmann 1997; Ruhrmann/Woelke1998; Görke/Ruhrmann 2003) – den gesamten Prozess der Nachricht ineiner aufeinander bezogenen Perspektive: von der Nachrichtenproduktion,über die Nachrichteninhalte bis hin zur Nachrichtenrezeption (vgl. Abb.).Abb.: Theoretisches Modell für die Analyse von NachrichtenQuelle: Ruhrmann/Woelke 2003: 152. Anlage der UntersuchungUm dieses Ziel zu erreichen, mussten wir in verschiedene Richtungenforschen. Dazu haben wir unser Projekt in drei Teile gegliedert:90
1. Der erste Teil beinhaltete eine Befragung von ausgewählten Nachrichtenjournalistenzu ihren Auswahlkriterien und ihrem Selbstverständnis(vgl. <strong>Die</strong>hlmann 2003).2. Das Herzstück der Studie war die Inhaltsanalyse ausgewählter Nachrichtensendungen,die wir nach dem Konzept der Nachrichtenfaktorenuntersucht haben. Dabei haben wir über 2400 Meldungen von denHauptnachrichtensendungen der acht wichtigsten Sender über zehnJahre hinweg gründlich unter die Lupe genommen (vgl. Maier 2003).3. Der dritte Bereich drehte sich um die Zuschauer. Wir wollten erfahren,wie Zuschauer gerade gesehene Nachrichten wiedergeben und was siesich besonders gut behalten haben. Dazu wurden <strong>im</strong> Rahmen einerPilotstudie 315 Interviews geführt (vgl. Ruhrmann 2003; Woelke 2003).3. Ergebnisse der NachrichtenanalyseLassen Sie mich mit den Ergebnissen der Nachrichtenanalyse beginnen,aus deren großer Fülle hier nur ganz wenige Resultate mitgeteilt werdenkönnen:Stark vermehrt hat sich der Anteil von Meldungen zu Human-Touch-Themen, insbesondere zum Thema Personality und Angst. Im Untersuchungszeitraum1990-2001 hat die Bedeutung der politisch-gesellschaftlichenBerichterstattung deutlich von rund 74 auf 61 Prozent abgenommen,insbesondere zwischen 1998 und 2001.Während bei den öffentlich-rechtlichen Sendern der Anteil politischerThemen mit leichten Schwankungen konstant bleibt, fällt er bei den privatenSendern ab, besonders stark bei RTL und RTL2. Sowohl die Visualisierungvon Nachrichten als auch die bildliche Darstellung von Emotionenhaben seit Anfang der 90er Jahre deutlich zugenommen. Insofern kann dieThese von einer zunehmenden Orientierung der Nachrichtenredakteurean Sensationalismus und Emotionen bestätigt werden (vgl. Maier 2003).4. Ergebnisse der Journalistenbefragung<strong>Die</strong> Journalistenbefragung zeigt: <strong>Die</strong> wachsende Konkurrenz auf demdeutschen Fernsehmarkt verändert die Arbeitsprozesse der Journalisten91
deutlich. Sie stellen eine weitere Zunahme von Tempo und Dynamikfest. Bei extremen Ereignissen müssen Nachrichtenredaktionen sofortreagieren: <strong>Die</strong> Chefetagen, aber auch zunehmend die Zuschauer fordernein „first on”. Zunehmend dominiert nach Ansicht der befragten Nachrichtenredakteureder Trend zur Visualisierung. <strong>Die</strong> schnelle und umfassendereVerfügbarkeit von Bildern und Bildmaterial verstärkt dieseEntwicklung.Noch gravierender erscheint der Befund, dass die Schnelligkeit journalistischeLeistungen wie eingehende Recherchen, Kontrolle und Reflexionvermindert. Beispiel Sebnitz: Alle haben sofort reagiert, dann kamen dieRecherchen und alles war doch ganz anders (...) Dadurch riskieren Redaktionen,dass Bilder dominieren und die zugrunde liegende Komplexitätder politischen Konflikte viel zu kurz kommt.Norbert Schneider, Direktor der Landesmedienanstalt in NRW (LfM) undAuftraggeber unserer Studie, hat das in einem Artikel für die SüddeutscheZeitung (10. Januar 2003) treffend zusammengefasst. Ich zitiere:„Immer häufiger stößt man auf die nervöse Nachricht. Man sieht ihr an,dass sie weiß, dass sie bald nicht mehr st<strong>im</strong>men wird. Zu wenig zählt, wasetwas bedeutet. Dafür zählt, wer es als erster hat. Es zählt, wem es nützt(...) Es zählt, wofür gezahlt wird.”<strong>Die</strong> befragten Journalisten der privaten Sender, in Teilen auch deröffentlich-rechtlichen, orientieren sich an den Zuschauern; sie gestaltenNachrichten zunehmend zuschauer- und serviceorientiert. In diesem Zusammenhangstellen einige befragte Journalisten fest, dass sich dieBerichterstattung der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender angeglichenhat (vgl. <strong>Die</strong>hlmann 2003).5. Ergebnisse der ZuschauerbefragungErkennen die Zuschauer auch diese Trends oder entdecken sie anderes?Unterscheiden sie auch in öffentlich-rechtlich und privat wie wir? <strong>Die</strong>seFragen erschienen uns als spannend. <strong>Die</strong> befragten Zuschauer bewertetenalle acht Hauptnachrichtensendungen ähnlich, u. a. nach Relevanz, Ereignisstrukturoder Güte. Nachrichten, bei denen die NachrichtenfaktorenVereinfachung, Identifikation und Sensationalismus zutreffen, bliebenauch in den Köpfen der Zuschauer am besten haften. <strong>Die</strong>ses Ergebnisdeckt sich mit den Osloer Thesen aus den 60ern: Dort hieß es, dass92
Meldungen auf wenige Aspekte reduziert werden. Dafür spricht auch, dassRezipienten vielfach die Relevanzstrukturen der Nachrichtenangebote übernehmen(vgl. Ruhrmann 1989; Ruhrmann/Woelke 1998; Woelke 2003).Interessant waren die Ergebnisse bei den Zuschauern kleinerer Sender.<strong>Die</strong> Funktion von RTL 2-News oder K1-Nachrichten besteht offenbar darin,eine Art Zusatzangebot aus den Bereichen Prominente, Stars und HumanTouch zu erhalten. Vor allem RTL und RTL 2 haben dabei offensichtlicheine vergleichsweise ‚stabile’ Zuschauerschaft gerade auch bei denJüngeren. Was m. E. brisant ist: <strong>Die</strong> Zuschauer solcher Angebote könnennicht <strong>im</strong>mer zuverlässig angeben, welchen Sender sie gesehen haben,halten aber bisweilen das Gesehene für die „Tagesschau” oder für„heute” (vgl. Woelke 2003). „Das kam <strong>im</strong> Fernsehen in den Nachrichten”,lautet ein typischer Satz. Werden hier nur die Sender verwechselt oder auchdie Qualität? Wir vermuten eher Letzteres!Betrachtet man die Zuschauer genauer hinsichtlich ihrer Aufmerksamkeitfür Nachrichten, ihrer politischen Interessen, ihrer soziodemographischenMerkmale und der damit verbundenen Lebensstile, so zeigen sich sechsGruppen (vgl. ausführlicher: Ruhrmann 2003a: 217 ff.):„Ältere, konservative Nachrichteninteressenten” (etwa 18 Prozent der Befragten),die überdurchschnittlich gut die Meldung reproduzieren können.<strong>Die</strong>se Zielgruppe ist für politische Themen in Nachrichten empfänglich.„Jüngere, aufmerksamere Nachrichtenverarbeiter” (etwa 17 Prozent), dieüberdurchschnittlich gut die Nachrichten reproduzieren und verstehen.Auch diese Gruppe ist an politischen Themen interessiert.„Harmonieorientierte Nachrichtenvergesser” (etwa 16 Prozent), die diegesehenen Nachrichten nur schlecht wiedererzählen. <strong>Die</strong>ses Publikumssegmentwird für Politik nicht sensibilisierbar sein.„Durchschnittsrezipienten” (etwa 21 Prozent), zu denen mehrheitlich Personenmit einem relativ geringen Einkommen zu zählen sind, die Nachrichtendurchschnittlich gut rekonstruieren können. Politik findet auch indieser Gruppe nur ein mäßiges Interesse.„Junge, freizeitorientierte Nachrichtenseher (RTL)” (etwa 15 Prozent), diebevorzugt auf RTL sowie auch RTL 2 – und weniger auf ZDF und ARD –93
Nachrichten verfolgen. Politische Themen werden hier eher als langweiligempfunden.Und zuletzt die so genannten „Nachrichtenvermeider” (etwa 13 Prozent),die sich nur an sehr wenige Meldungen erinnern können. PolitischeThemen: auch für diese Zielgruppe eher Fehlanzeige!6. Thesen und Diskussion<strong>Die</strong> vorstehenden Ausführungen lassen sich in 9 Thesen zusammenfassen:1. Hauptnachrichten der privaten TV-Programme sind unpolitischergeworden.2. Vor allem die Nachrichtenfaktoren Konflikt, Negativität sowie Nutzenund Prominenz beeinflussen die Auswahl der Journalisten.3. Es gibt eine zunehmende Orientierung der Nachrichtenredakteure anSensationalismus und Emotionen.4. <strong>Die</strong> wachsende Konkurrenz verändert die Arbeitsprozesse der Journalistennachhaltig.5. Journalisten der privaten Sender gestalten Nachrichten zunehmendzuschauer- und serviceorientiert.6. Einige Journalisten gehen von einer Konvergenz, also einer Annäherungder politischen Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen undprivaten Sender aus.7. Vor allem die Nachrichtenfaktoren Vereinfachung, Identifikation undSensationalismus befördern die Rezeption.8. Es gibt (gerade auch innerhalb der Gruppe jüngerer) Zuschauer, dieöffentlich-rechtliche und privat-kommerzielle Nachrichtenangebote nichtzuverlässig unterscheiden können.9. Knapp 30 Prozent der deutschen Zuschauer vergessen oder vermeidenTV–Nachrichten. Mit anderen Worten: sie sind durch die Hauptnachrichtensendungennicht oder nur schlecht „erreichbar”.94
<strong>Die</strong> beiden letzten Thesen bedeuten auch <strong>im</strong> Zusammenhang mit früherenStudien u. a. aus der ARD- und ZDF-Medienforschung, die in Ostdeutschlandfür junge Menschen eine tendenziell geringere Wahrnehmungöffentlich-rechtliche Informationsangebote messen (vgl. Maier/Ruhrmann2000; Frey-Vor u. a. 2002a; Frey-Vor u. a. 2002b; Maier 2002), dass dieJugendliche eine geringere Chance haben bzw. haben werden, über Fernsehenfundiertere politische Information zu erhalten.<strong>Die</strong>s wird hier ausdrücklich nicht gesagt, um zu behaupten, die Senderhätten etwas falsch gemacht. Gerade die öffentlich-rechtlichen Senderbringen formal und inhaltlich ein erstklassiges Nachrichtenangebot. Siepräsentieren bisweilen doppelt so viel Politik in den Nachrichten wie diePrivaten. Und auch das Themenspektrum von ARD und ZDF ist vielfältig,wie zahlreiche frühere Studien empirisch belegt haben (vgl. Krüger 2002).Auch Qualität und Umfang der politischen Berichterstattung (und Nachrichtengebung)des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) kann man – unabhängigvon einer systematischen wissenschaftlichen Prüfung – alsdurchaus ausreichend und angesichts der Situation in Mitteldeutschlandsogar als angemessen empfinden.Das Problem liegt vielmehr woanders: Eine möglicherweise wachsendeGruppe auch jüngerer Menschen können (oder wollen) die Qualität derInformationsangebote, gerade auch der öffentlich-rechtlichen Sendernicht wahrnehmen bzw. erkennen. Es ist ihnen egal, guter Journalismusbedeutet ihnen wenig. Einige bevorzugen eher das Internet, und erschaffensich die „Unterhaltungswelt”, auf die sie gerade Bock haben.Andere hingegen sind weder <strong>im</strong> Netz, noch lesen sie eine Tageszeitung.Wenn bei solchen Gruppen die Rezeptionsleistungen für Nachrichtenzurückgehen, kann – nicht zuletzt für die Demokratie – unmerklich eineSchieflage entstehen. So als wäre man in den ersten Etagen des Turmsvon Pisa.Der Vortrag wurde erstmals anlässlich der 37. Mainzer Tage der Fernsehkritik am26. April 2004 be<strong>im</strong> ZDF gehalten.Literatur• <strong>Die</strong>hlmann, N. (2003): Journalisten und Fernsehnachrichten.In: Ruhrmann, G. u. a., S. 99-144.95
96• Eilders, C. (1997): Nachrichtenfaktoren und Rezeption.Opladen: Westdeutscher Verlag.• Frey-Vor, G./Gerhard, H./Mende, A. (2002a): Daten der Mediennutzung inOst- und Westdeutschland. In: Media Perspektiven 2/2002, S. 54-69.• Frey-Vor, G./Gerhard, H./Mohr, I. (2002b): Mehr Unterschiede als Annährung?In: Media Perspektiven 2/2002, S. 70-76.• Galtung, J./Ruge, M. H. (1965): The Structure of Foreign News.In: Journal of Peace Research 1, S. 64-91.• Giegler, H./Ruhrmann, G. (1990): Remembering the News.In: European Journal of Communication 5, 4, S. 463-488.• Görke, A./Ruhrmann, G. (2003): Public Communication between facts and fictions.In: Public Understanding of Science, S. 229-242.• Iyengar, S. (1991): Is anyone responsible? Chikago: The University of Chikago Press.• Krüger, U. M. (2002): Politikvermittlung <strong>im</strong> Fernsehen.In: Media Perspektiven 2/2002, S. 77-87.• Luhmann, N. (1997): Massenmedien und ihre Selektion von Selbstbeschreibungen.In: Luhmann, N.: <strong>Die</strong> Gesellschaft der Gesellschaft, Bd. 2,Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 1096-1109.• Maier, M. (2002): Zur Konvergenz des Fernsehens in Deutschland. Konstanz: UVK.• Maier, M. (2003): Analysen deutscher Fernsehnachrichten 1992-2001.In: Ruhrmann, G. u. a., S. 61-98.• Maier, M./Ruhrmann, G. (2000): Deutschland – einig Fernsehland?In: IP Deutschland (Hg.): Deutschland – einig Fernsehland? Köln: IP Deutschland.• Östgaard, E. (1965): Factors influencing the flow of news.In: Journal of Peace Research 2, S. 39-63.• Ruhrmann, G. (1989): Rezipient und Nachricht. Opladen: Westdeutscher Verlag.• Ruhrmann, G. (1991): Zeitgeschehen a la carte. In: DIFF (Hg.): Funkkolleg„Medien und Kommunikation”, Studienbrief 6. Weinhe<strong>im</strong>: Beltz, S. 49-80.• Ruhrmann, G. (1994): Öffentliche Meinung. In: Dammann, K. u. a. (Hg.):<strong>Die</strong> Verwaltung des politischen Systems. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 40-52.• Ruhrmann, G./Nieland, J. – U. (1997): Interaktives Fernsehen.Opladen: Westdeutscher Verlag.• Ruhrmann, G./Woelke, J. (1998): Rezeption von Fernsehnachrichten <strong>im</strong> Wandel.In: Kamps, K./Meckel, M. (Hg.): Fernsehnachrichten.Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 103–110.• Ruhrmann, G. (2003a): Nachrichtenaufmerksamkeit von Fernsehzuschauertypen.In: Ruhrmann, G. u. a., S. 217-228.• Ruhrmann, G. (2003b): Fernsehnachrichten werden unpolitischer.In: epd-Entwicklungspolitik 16/17, 2003, S. 62-66.• Ruhrmann, G./Woelke, J. (2003): Der Wert von Nachrichten.In: Ruhrmann, G. u. a. 2003, S. 13-26.• Ruhrmann, G./Woelke, J./Maier, M., <strong>Die</strong>hlmann, N. (2003):Der Wert von Nachrichten <strong>im</strong> deutschen Fernsehen. Opladen: Leske + Budrich.• Schneider, N. (2003): Schnelle neue Welt: In: Süddeutsche Zeitung, 10. Januar 2003.• Schulz, W. (1976): <strong>Die</strong> Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien.Freiburg: Alber.• Staab, J. F. (1990): Nachrichtenwert – Theorie. Freiburg: Alber.• Woelke, J. (2003): Rezeption von Fernsehnachrichten.In: Ruhrmann, G. u. a., S. 163-200.
„JENSEITS DER SUPERSTARS –PROGRAMMENTWICKLUNG BEI PRIVATEN”Dr. Norbert Schneider, Direktor LfM Düsseldorf1.Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte fast vierzig Jahre Zeit, sich unbehelligtvon konkurrierenden Systemen zu entwickeln. Auch der Kampfzwischen ARD und ZDF um die Palme be<strong>im</strong> Publikum hat dieser prinzipiellenUngestörtheit nie Wesentliches genommen.Man muss daran erinnern: <strong>Die</strong>ses Privileg hatte der private Rundfunk inDeutschland nicht. Vom ersten Tage an stand er <strong>im</strong> Wettbewerb um einöffentlich-rechtlich sozialisiertes Publikum und damit in der Versuchung,alles zu machen, was ihm möglichst viel von diesem Publikum brachte,also Quote; und was zugleich – in den ersten Jahren bei geringer Reichweite– bezahlbar war.<strong>Die</strong>sen Kampf um die Aufmerksamkeit bestritten die jungen Privaten u.a.auch mit Brüllsendungen, scheinbar vollerotischen Shows und ein bisschenJodeln aus der Lederhose – Stücke aus dem Stehsatz des verklemmtenFilms.Zeugen der ersten Stunde sind diese Sendungen in lebhafter, meistgrauenhafter Erinnerung. Ebenso die vor Empörung aufgeblasenen Backender Privilegierten, die sich in ihrem Vorurteil bestätigt fühlten, der Gangins Seichte sei nun unabwendbar.Mit steigender technischer Reichweite und den ersten geglückten Versuchen,Sportrechte zu kaufen, die bis dahin zum Tafelsilber von ARD undZDF gehörten, erhob sich der Wettbewerb aus diesen Niederungen derersten Stunde. Nach und nach entwickelten die Privaten in allen Programmbereichen<strong>Format</strong>e, die ohne größere Marktschreiereien be<strong>im</strong> PublikumInteresse weckten, oft einfach schon dadurch, dass sie altbekannte <strong>Format</strong>elifteten, entstaubten. Eher nebenbei leisteten sie in vielen Kleinigkeitendurch eine programmatische Respektlosigkeit gegenüber eingeübtenRitualen einen beträchtlichen Beitrag zur Entautorisierung desFernsehens wie zur Entwicklung des Programms. Sie wagten sich – darindamals natürlich viele freier als die gesellschaftlich und politisch korrektkontrollierten Öffentlich-Rechtlichen – auf Abschnitte des Boulevards,die bisher vom Fernsehen gemieden wurden. Sie bauten nun, da die Ein-97
nahmen sich gut entwickelten, auch die Departements auf und aus,deren Umsatzrendite sich überall in Grenzen hält: die news shows, auchsolche übrigens nach Mitternacht.Das geschah fast zeitgleich mit einem weltweiten Trend, Nachrichtenkanäleeinzurichten, teils zur Entlastung von Vollprogrammen, teils auch,um über ein spezielles Publikum neue Quellen anzuzapfen, wie diesinternational agierenden Veranstaltern wie CNN oder Bloomberg vorschwebte.Überhaupt kam mit der zweiten Lizenzierungswelle bis Mitteder 90er Jahre das Spartenprogramm als Teil eines Gesamtangebotszunehmend zum Zuge, mit überschaubaren Reichweiten, aber doch auchmit neuen Möglichkeiten. Sportprogramme, Musikprogramme und Kinderprogrammekennzeichnen diese Phase – mit Programmleistungen, diesich in vielerlei Hinsicht von entsprechenden öffentlich-rechtlichen Angeboteneher in der Anmutung und der Temperatur als in der Substanzunterschieden. Eine Bewertung, die auch heute kaum anders ausfällt.Was die Vollprogramme betrifft – also: RTL, SAT 1, Pro 7, VOX, RTL 2 undKabel 1 – so wird man insgesamt sagen können, dass sich die Großen,also RTL und SAT 1, nach wie vor bei allen unübersehbaren Unterschiedenaufgrund der unterschiedlichen Absichten auf der Konvergenzliniebewegen. Man findet bei RTL und SAT, wenn auch nicht in derHäufigkeit, Fernsehspiele, die so auch vom WDR oder dem ZDF hättenproduziert werden können. Man findet bei den Serien mittlerweile dieinteressanteren und innovativeren bei den Privaten – ich erinnere an„<strong>Die</strong> Anstalt” oder „Abschnitt 4o”, beides Produktionen, für die MarcConrad, ehedem bei RTL, verantwortlich zeichnet. Der Verzicht auf Programmwareaus USA war eine Tat der Privaten. <strong>Die</strong> deutsche Produktionhat als Effekt dieser Programmpolitik mit Beginn der 90er Jahre einenentsprechend steilen Aufstieg erlebt.Man findet in der Unterhaltung Wort, wie dies be<strong>im</strong> ZDF heißen würde,sozusagen dem core business der Privaten, was niemanden überraschenwird, inzwischen die weitaus interessanteren Angebote: von den Jauch-Shows bis zur Comedy der Samstagnacht, in der sicher nicht alles geschmacksversiegeltist, in der aber doch ein neuer Ton angeschlagenwurde, der so bisher nicht möglich oder auch nicht erwünscht war.Eine Show wie die von Harald Schmidt ist nach wie vor der Maßstab, andem die Gr<strong>im</strong>me-Preise für Unterhaltung vorbei müssen, wenn sie siegenwollen. Das ortsfeste Tief der öffentlich-rechtlichen Unterhaltung hatauch darin seinen Grund, dass die größeren und großen Entertainer, von98
Gottschalk abgesehen, seit Jahren privat gehen. Was nicht nur mit denGagen zu tun hat.Wiederum nicht <strong>im</strong> Quantum wohl aber in der Qualität, sind die Magazineder Privaten, in der Regel freilich als die Produkte unabhängigerDritter, sehenswert und konkurrenzfähig. Stern-TV, Spiegel-TV, letzteresnach einer zwischenzeitlichen Neigung zum Rotlichtigen längst wiederauf dem Niveau angelangt, dass sich mit der Marke Spiegel verbindet,aber auch Focus TV für Pro 7 leisten Beträchtliches und haben dieMagazin-Tradition von „Panorama” und Co. auf ihre Weise aufgegriffenund fortgeschrieben.<strong>Die</strong> Informationsleistungen der großen Vollprogramme sind – da auch siedem Postulat der Quote unterliegen – nach wie vor wesentlich stärkerals die der public broadcaster durch die weichen Themen, die HumanTouch-Themen best<strong>im</strong>mt. <strong>Die</strong> regelmäßig vorgelegten Untersuchungenvon Hans-Jürgen Weiss belegen das aufs Genaueste. Infotainment istzwar nicht nur systemspezifisch aufzufinden, aber es hat bei den Privatennach wie vor, was auch nicht verwundern kann, seine erste Adresse. <strong>Die</strong>täglichen news shows der beiden Systeme sind dabei <strong>im</strong>mer noch gutunterscheidbar, aber keineswegs jene Lichtjahre auseinander, die sehschwacheIdeologen <strong>im</strong>mer noch wahrnehmen. Peter Klöppel und KlausKleber sind sich sowohl in der Art des Präsentierens als auch der Auffassungüber den Zweck und die Möglichkeiten einer news show näherals es nach der Vorstellung der Systempuristen eigentlich sein dürfte.Der große Bereich der expliziten Kinderprogramme ist bei den großenPrivaten wie bei den Öffentlich-Rechtlichen nur noch marginal, vorzugsweiseam Wochenende präsent. Eigens dafür aufgemachte Programme –Super RTL nach dem Ende von Nickelodeon mit einer Alleinstellung undder Kinderkanal – wirken auch entlastend für das jeweilige System.<strong>Die</strong> Sportsendung ist mit Aufkommen der Privaten das Angebotssegment,das sich nach meiner Beobachtung am meisten gewandelt hat und beidem Konvergenz sich am deutlichsten zeigt. Ich verweise der Einfachheithalber auf ran und die Sportschau und bitte <strong>im</strong> Zweifel um Angabenüber die unterschiedlichen Merkmale. Ein Elend mag darin nur sehen,wem der Prozess der Konvergenz <strong>im</strong>mer schon ein Gräuel war oder wernach der Devise wertet, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Dasses noch zahlreiche Unterschiede gibt, die nicht unter Konvergenzdruckgeraten, bleibt ja wahr. Schließlich ist der Unterschied der Finanzierungschlechthin konvergenzresistent.99
Sehr viel anders fällt der Vergleich aus, wenn man in die Zweite Liga derVeranstalter geht, zu RTL 2, Kabel 1 und VOX. <strong>Die</strong> Untersuchung der Programmentwicklungbei diesen Programmen fördert, vor allem mit Blickauf die Informationsleistungen, mehr oder weniger starke Defizite zutage, wobei freilich VOX eine besondere Rolle spielt, was mit derDoppellizenz für VOX und die DCTP zusammenhängt.2.Soweit ein grober Überblick, der für manchen in der Summe etwas positiverals erwartet klingen dürfte, und der natürlich wie <strong>im</strong>mer mitGegenbeispielen en detail dementiert werden kann. Aber Vorurteile,auch gesunde, helfen hier wenig. N<strong>im</strong>mt man die durchaus verschiedeneZweckbest<strong>im</strong>mung der beiden Rundfunksysteme, dann wird man nichtumhin können festzustellen, dass sie sich in wichtigen Feldern nicht annäherndso scharf unterscheiden lassen, wie dies aus ideologischenund apologetischen Gründen gelegentlich erwünscht scheint. Siehtman Information und Unterhaltung als die beiden Hauptfaktoren desProgramms, dann kann man ohne große Abstriche sagen, dass die einenbei der Information, die andern bei der Unterhaltung die relevanteren,die interessanteren, die attraktiveren Angebote machen.<strong>Die</strong>s bedeutet aber auch, dass die Summe von beidem ein einmaliges,in der Qualität schwer zu überbietendes Ensemble von Sendungenpräsentiert, dass das Image des deutschen Fernsehens weltweit begründethat.Noch einmal zum Nachempfinden: Es gibt Ausnahmen, es gibt Ausrutscher,vor allem auf dem glitschigen Boulevard. Aber insgesamt wirdman sagen können, dass weithin, jedenfalls <strong>im</strong> Fernsehen, gerade auchdem privaten, nicht mehr danebengeht als in der Presse. Jedenfalls istdie Aufsicht, die hier ein wenig weiter weg ist vom einzelnen Programmals bei den Öffentlich-Rechtlichen, bis heute nur selten mit Fällen befasstworden, die etwa die Menschenwürde betroffen oder unerlaubt indas Recht einer Persönlichkeit eingegriffen hätten.3.Doch es bleibt ein Aber – alles andere wäre nun wirklich zu schön.Mindestens. Jedenfalls eines, das ich hier deutlich machen will. Was inder Summe halbwegs akzeptabel, vielleicht sogar komplementär be-100
trachtet glänzend dasteht, enthält gleichwohl problematische Momente,über die man nicht hinwegsehen kann.Ich will mich – aus zeitlichen Gründen – nur auf drei solcher Momentebeziehen, die in einem inneren Zusammenhang stehen, die ich für problematischund prekär halte. Den Veranstalter <strong>im</strong> Blick bewege ich michdabei nur auf dem Boden journalistischer Werte und Leistungen undlasse die Unterhaltung hier unerwähnt.Es ist erstens die Reduzierung der Objekte, seien es Menschen oderSachen, auf ein Zeitmaß von höchstens einer Minute, auf die Länge eineslangen spots. Das dauerhafte Gescherze über jene endre<strong>im</strong>fähigen 1:30verdeckt, dass hier etwas überhaupt nicht Lustiges Platz genommen hat.Eine pure Quantität hat sich als eine Qualität der Bewertung in das täglichHandwerk eingenistet, eine Quantität, die für die Wahrnehmung derWirklichkeit nur selten die angemessene ist. Das Zurückdrücken, dasEinschränken der Realität auf die kleine Einheit fördert zum Beispiel denEffekt, dass das Einzelne, was seinen Rang, seine Bedeutung, seinenStellenwert betrifft, nicht mehr unterscheidbar bleibt. Beckers Scheidungwird auf dieser Folie so relevant wie ein Genozid in Afrika.<strong>Die</strong> zeitlich einheitliche und dabei <strong>im</strong>mer kurze Bemessung für die einzelneInformation macht alles gleich und dann alles gleich grau. Siewirkt sich aus wie ein Rasenmäher in einem Blumengarten.Ein besonders tückischer Effekt der Verknappung ist, dass sie vereinfachend,s<strong>im</strong>plifizierend wirkt. Sie begünstigt und schafft gleichermaßenjede Art von Gegensatz. <strong>Die</strong>s öffnet zumal dann, wenn die Gesellschaftsich abgesehen von ihrer Darstellung in den Medien tatsächlich überkomplexentwickelt, die Hintertür für Manichäer aller Art. Unter der Handdieser verknappenden Beschleunigung kehren zum Beispiel gut undböse, ihrem Ursprung nach moralische Kategorien, als realitätsordnendeBegriffe zurück. Sie werden politisch gebrauchsfähig. Man ist oben oderman ist unten. Man ist reich oder arm. <strong>Die</strong>s hilft zwar, den nivellierendenEffekt, den ich eingangs beschrieben habe, neu zu überwinden. Aber umwelchen Preis. Nun wird alles binär: in oder out, rauf oder runter, drinoder draußen, alt oder neu. Was wir dabei eigentlich beobachten ist dieHe<strong>im</strong>kehr der Religion in die Politik. <strong>Die</strong> Veränderung von Politik inReligion.<strong>Die</strong> zeitliche Verknappung fördert alles, was sich an „künstlicher Aufgeregtheitder Gesellschaft” (Luhmann) ins Werk setzen lässt. Sie begünstigteinen Hang zur Hysterisierung und bringt jenen teils chiliastischen,101
teils einfach nur pathologisierenden Zug ins Geschäft, der sich in Annoncenwie „Deutschland am Abgrund”, „Ist der Kanzler noch zu retten?”,„Eichel vor der Pleite” oder „Patient Börse” Ausdruck verschafft. Der Zeitmangelmacht aus jeder Zeit Endzeit, aus jeder Pause Eile, aus GeduldigenWeicheier und aus Journalisten Sauhirten <strong>im</strong> global village.Der Grund für diesen Trend zur Beschleunigung ist das zweite Moment,das sich hier durchsetzt: die Legit<strong>im</strong>ation für das, was man sendet. Es ist,so die Behauptung, gemessen als Quote der Zuschauer. Er bekommt, sodie Behauptung, was er will. Ihm dient man, so die Behauptung, obwohlman mit ihm tatsächlich verdient.Es ist entweder eine wissentlich falsche Behauptung. Ein logischer fake.Oder, was ich zugunsten der Vertreter dieser These annehmen möchte,eine frohgemut eingeleitete Deprofessionalisierung, die sich in dieserAbgabe von Senderkompetenz an die Empfängerkompetenz vollzieht:ein partieller Verzicht auf Berufsausübung, ein Weiterreichen der Entscheidungüber Themen und Macharten, also eben auch: ein mindestensscheinbares Abgeben der Verantwortung an den Empfänger.<strong>Die</strong> Verherrlichung des Senders, seine Anbetung, vor allem auch die derHierarchen, ist eine bekannte und keineswegs erstrebenswerte Erscheinungin den Jahren 1950 bis 1990. Sie abzubauen war wichtig. Nichtaber, sie einfach auf den Kopf zu stellen. Denn mittlerweile ist sie einergespielten Demut gewichen, die sich als modern und als Gegenbewegunggegen alles Autoritäre gibt. Zu behaupten, der Zuschauer entscheideletzten Endes über das, was er sehe, meist noch verbunden mitdem Hinweis auf seine Möglichkeit, sich abschaltend allem zu verweigern,ist am Ende nichts als wohl kalkulierter Zynismus: ein Mangel anöffentlich wahrgenommener, also auch belangbarer, also auch kritisierbarerVerantwortung.Dagegen steht nach wie vor: Ein Sender hat selbst dafür einzustehen,was er sendet und nichts von seiner Kompetenz scheinheilig weiterzureichen,so, als habe er Geschenke zu machen, wo er doch in Wirklichkeitn<strong>im</strong>mt oder doch nehmen möchte: Zeit vor allem, Aufmerksamkeit undzuletzt Geld.Es ist klar, dass es die Quote ist, die solchen <strong>im</strong> Grunde auch noch unredlichenund keineswegs fröhlichen Zynismus begründet, die Quote,die inzwischen für das gesamte duale System die einzig verbindlicheWährung ist.102
4.Faktisch beobachten wir in der Verlagerung der Verantwortung hin zumPublikum, zum Konsumenten, zum Nutzer, der ja nun auch mündig ist,bei gleichzeitiger genauester Kalkulation dessen, was be<strong>im</strong> Publikumankommt – wir beobachten die Wirksamkeit des Faktors Ökonomie.Doch ich warne Neugierige. Journalismus war <strong>im</strong>mer – dies sei gegenübereiner hoffärtigen Blauäugigkeit vorsichtshalber angemerkt – eineAngelegenheit des Geldes. Information hatte <strong>im</strong>mer ihren Preis. FürJudas zum Beispiel dreißig Silberlinge. Aber es macht einen großenUnterschied, ob man von Ökonomie redet oder von einer Ökonomisierungder Publizistik. <strong>Die</strong> Ökonomie ist eine unverzichtbare, wesentliche undauch nicht nur verschämt begründbare Grundlage von Senden und Verlegen.Non olet. Wird sie aber zur einzigen Grundlage, dann ist es mitdem Journalismus nach und nach vorbei, auch wenn er sich nach wievor so nennen wird. Dann wird der Journalist zum Vertreter, der eineWare anpreist.Ich will nicht behaupten, wir seien schon so weit. Ich will nur – belegtmit dem Moment einer Reduzierung der Wirklichkeit auf eine vermuteteBekömmlichkeit – auf diesen Trend hinweisen, auf diese schiefe Ebene,die nicht nur schief ist, sondern auch schief macht.<strong>Die</strong> Folge dieses Trends zur Beschleunigung – das Ereignis und die verbreiteteNachricht nahezu synchron, vorgemacht in den mails von CNN –eine Folge ist ein ungeheurer Materialverbrauch. Etwas ungenutzt zulassen, kann man sich nicht leisten. Alles wird Information, alles wirdversendet.5.Und nun noch ein weiteres Moment möchte ich nennen, das Beachtungverdient. Es ist die grassierende Identifizierung von Information undPerson. Eine Information ist ohne alsbaldige Zuschreibung und Zuspitzungauf eine Person, ohne Personalisierung mehr und mehr chancenlos,nicht mehr vermittelbar. Geschichten gehen überwiegend nurnoch als Personengeschichten. Das führt dazu, dass viele Menschenetwa die Steuerreform als ein Problem für die Biographie des Finanzministerssehen, nicht aber als eines einer Volkswirtschaft, an der auchsie ihren Anteil haben. Zeigen heißt <strong>im</strong>mer mehr: Personen zeigen.Das ist nicht zu tadeln, wenn es denn die Personen sind, die die Sache103
ausmachen. Zur Politik des Kanzlers gehört der Kanzler gewiss dazu.Aber leider sind die meisten wirklichen Probleme nicht oder nur sehrschwer und wenn doch, dann unter Aufwand von viel Zeit personalisierbar.Da dieser Aufwand sich be<strong>im</strong> Publikum – so die These – nichtauszahlt und die Zeit nicht da ist, geraten personenschwache Themenund Sachverhalte also entweder von der Agenda oder werden, komme,was wolle, personalisiert und verlieren damit ihren Kern.Auch dieser Trend ist derzeit erst einmal ein Trend. Doch wenn man mitUS-amerikanischen Journalisten diskutiert, etwa den Hauptstadtkorrespondentender großen Networks, dann ist für sie völlig klar, dass sieGeschichten ohne eine Person <strong>im</strong> Zentrum nicht mehr los werden.Damit ich auch hier nicht missverstanden werde: die Personalisierungvon Informationen ist ein ziemlich alter Hut. Von Konzepten der Geschichtsschreibung– Männer machen Geschichte – bis zu politischen Devisen –auf den Kanzler kommt es an – ist diese Methode gut probiert. <strong>Die</strong> Frageist auch hier, ob ein Trend dominant wird. Und ob die Effekte des Trendsgenügend deutlich sind. Denn Personalisierung bedeutet unausweichlichden Eingang personaler Kategorien in jede Bewertung von Sachen. Danngeht es z.B. nicht mehr um Ursachen, dann es geht um Schuld. <strong>Die</strong> Personalisierungöffnet das Tor in eine Welt der Sündenböcke. Verhältnissekann man nicht rauf- und runterschreiben. Das geht nur mit Personen.Personalisierung bewirkt auch einen partiellen Abschied an die Kategoriedes Privaten bzw. das Spiel mit diesem privaten Teil der Person,den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und schließlich dient die Personalisierungden unstillbaren selbstreferentiellen Gelüsten der happy few,wirkt wie eine Meistbegünstigungsklausel für Prominente, die noch prominenterwerden. Dass dabei die Kategorie der Relevanz ein weiteresMal unters Glücksrad kommt, macht die Dinge nicht erträglicher.Verkürzung, Beschleunigung, Ökonomisierung, Personalisierung – dassind vier Schlagworte, um deren Entfaltung sich eine Diskussion überQualitätsstandards nicht drücken sollte.Überarbeitete Version der Rede vom 29. September 2003, gehalten be<strong>im</strong> Herbstforumder Initiative „Qualität <strong>im</strong> Journalismus” des Deutschen Journalistenverband e.V.104
ZWISCHEN KEF UND QUOTE:DER QUALITÄT GEHÖRT DIE ZUKUNFT?Qualität mit Brief und Siegel –Bewertungsmaßstäbe <strong>im</strong> JournalismusErnst Elitz, Intendant DeutschlandRadio Köln/BerlinIch glaube, der Veranstalter meint es nicht gut mit Ihnen, denn er hatan den Anfang dieser Tagung ein Referat gestellt, das den Titel trägt„Zwischen KEF und Quote”. Nun haben alle öffentlich-rechtlichenMedienunternehmen sich in den letzten Jahren zur Vorbereitung auf dieneue Gebührenrunde tagtäglich mit der KEF befaßt, Fragebogen ausgefüllt,Aktenordner abgeschickt, Tadel eingesteckt, neue Zahlenkolonnengeliefert, Textentwürfe der KEF studiert, Bedenken angemeldet, Verbesserungsvorschlägegemacht und sich dabei rund um die Uhr mit Begriffenherumschlagen wie Zuhörerkontaktaufwand, index-gestütztesintegriertes Prüf- und Berechnungsverfahren gemäß Verfahrensheft(IIVF), mittelfristige Finanzbedarfsplanung nach modifizierter liquiditätsorientierterPlanungsmethode, quantitativer Nachweis der Wirtschaftlichkeitund Sparsamkeit zusammengefaßt in Aufwandarten gemäß Verfahrensheftzum IIVF Nr. 9 ( Hauptschritt C ), Erläuterung der Wiederverwendungvon Einsparungen <strong>im</strong> Wege der Umschichtungen <strong>im</strong> Bestand, rundfunkspezifischePreissteigerungsrate, eigenmittelmindernd berücksichtigteInstandhaltungsrückstellungen, finanzbedarfsmindernde Netto-Einsparungen,Ressourcenwidmungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufder Basis der Erstsendeminuten und hierarchische Clusteranalyse aufBasis der Sendegattungsanteile.Meinen sie es wirklich ernst? Soll ich sie wirklich damit behelligen?Machen wir am frühen Morgen lieber einen Ausflug in die abwechslungsreicheund faszinierende Welt des Quotenjournalismus. Da ist eher Lebenin der Bude. Quotenjournalismus gewinnt sein Publikum mit lockeren undanzüglichen Morgengesprächen und mit Kampagnen gegen italienischePolitiker, die die Deutschen als „einförmige supernationalistische Blonde”beleidigen, die „mit Rülpswettbewerben, Biergelagen und Pommes frites-Völlereien” aufwachsen. Quotenjournalismus macht St<strong>im</strong>mung gegenFlorida-Rolf und Viagra-Paule. Er fordert: „Kanzler, heute gilt es! Steuernrunter, macht Deutschland munter!”.105
Den Medienpolitikern ist nicht ganz wohl bei dieser Art von publizistischerPrägung der öffentlichen Meinung und so rufen sie lauthals nacheiner anderen Qualität in den Medien. Aber Politiker verfügen zuweilenüber multiple Persönlichkeitsstrukturen. Der Widerspruch zwischen Redenund Handeln ist inhärent. So fordern sie Qualität und feiern selbst nochdie Ansiedlung von Dauerwerbekanälen für Goldkettchen, Heizdeckenund Rohrreiniger als medienwirtschaftliche Großtat und bevorzugen beider Zuweisung von Frequenzen für Radio-Programme und bei der Plazierungauf Kabelplätzen nicht etwa arte, PHOENIX, 3sat und Deutschland-Radio, sondern häufig genug jene Angebote, über deren Qualität sie sichsonst gern mokieren und die Medienanstalten gefallen sich in der Rollequalitätsmindernder Verteilorganisationen.Leitbilder nach den Gesetzen des MarktesDas novellierte Hamburger Mediengesetz gestattet dem Privatfunk einebislang noch <strong>im</strong>mer kritisierte „Entwortung”, die den Verzicht auf dieletzten Residuen von Nachrichtensendungen legit<strong>im</strong>iert. Hatte bislangjedes Privatradio der Hansestadt noch die Auflage, während jeder Programmstundewenigstens sechs Minuten Wortbeiträge zu senden, sodarf sich jetzt der Musik- und Reklameteppich auch über diese Streckenlegen. Was anderswo aus Kostengründen klammhe<strong>im</strong>lich aus den kommerziellenProgrammen verschwunden ist, wird in Hamburg formal korrektwegreguliert. <strong>Die</strong> <strong>im</strong> Artikel fünf des Grundgesetzes garantierte „Freiheitder Berichterstattung” wird so zur Befreiung von jedweder Berichterstattung.<strong>Die</strong> menschliche Natur, so erläuterte uns deren int<strong>im</strong>er Kenner FriedrichSchiller, dürste nicht nur nach auserlesenen Vergnügungen, sondern derMensch stürze sich auch gern „zügellos in wilde Zerstreuungen, dieseinen Hinfall beschleunigen und die Ruhe der Gesellschaft zerstören.Bacchantische Freuden, verderbliches Spiel, tausend Rasereien, die derMüßiggang ausheckt, sind unvermeidlich, wenn der Gesetzgeber diesenHang des Volkes nicht zu lenken weiß”. Der Staat lenkt in der Marktwirtschaftnicht gern. Und wenn, dann in die andere Richtung: Siehe Hamburg.<strong>Die</strong> Kulturkritiker dagegen fordern von den Medien, sie sollten in unsererdesorientierten Gesellschaft Vorbilder präsentieren. Aber was Generationenvon Pastoren, Pädagogen und utopischen Sozialisten nicht erreichthaben – den besseren Menschen zu schaffen – das wird auch denAngestellten der Medienbetriebe nicht gelingen. Dafür bildet sie keine106
Journalistenschule aus und selbst unter den Fortbildungsangebotenfinden sie keine Workshops zu diesem Thema. Mediale Leitbilder werdennach den Gesetzen des Marktes geboren und nicht aus der Sehnsuchtnach einer besseren Welt.Der Typ muß zur Marke passenNehmen wir den Fußballer David Beckham von Real Madrid und seineGattin Victoria. Er rasiert sich die Brust, verwendet Nagellack, trägtschon mal die Dessous seiner Frau, verpflegt sich nach Single-Art mitFertiggerichten, trägt Brillianten <strong>im</strong> Ohrläppchen und wertet das eigeneSelbst durch Markenartikel auf. Mit Haargel, Nagellack, Haarkamm,Sarong-Röckchen, Faltencreme, teuren Klamotten und schnellen Autoskann er die Wunschwelt von Heteros, Homos und Transsexuellen symbolisieren.Und um am Markt und in den Medien präsent zu bleiben,muß er sich selbst <strong>im</strong>mer weiter verrätseln.Als Beckham bei Real Madrid eingekleidet wurde, trug sein Trikot dieNummer 23. <strong>Die</strong> ungewöhnliche Zahl wurde bewußt als Mythos plaziertund provozierte in Abermillionenauflage neue Personality-Storys. In Berichtenüber das Ehepaar Beckham werden durch deren Hausagenturenfolgende Markennamen plaziert: Dolce & Gabbana, Police-Sonnenbrillen,Adidas, Vodafone, Bentley Arnage T, BMW X5, Ferrari Maranello, AstonMartin, Lincoln Navigator, Gucci, Versace, Pepsi und Super-Nudeln. Ebenweil Beckham das „blankpolierte Nichts” ist, „in dem wir unsere Träumespiegeln”, bietet er die ideale Projektionsfläche für kreative Journalistenund Werbeverkäufer. <strong>Die</strong>se Verknüpfung von Prominenz, Produktwerbungund ausführlicher redaktioneller Berichterstattung ist Gift für denQualitätsjournalismus. Sie verstößt gegen den klassischen Grundsatz derUnabhängigkeit von werblichen Interessen.„Human brands” (menschliche Marken) heißt die Branche, die Promisund Produkte zusammenbringt. Der Typ muß zur Marke passen wieGünter Jauch, der gute Mensch, mal zum Beton und mal zum Regenwald.Als aufgeregte Berliner herausfanden, daß viele Prominente lukrativePapiere einer aus Steuergeldern mühsam am Leben erhaltenen Bankerworben hatten, machten sie Ausflüge zu deren Villen und fordertenSteuergelder zurück. Welche Gefahr droht da Manne Krug, der uns mitder Treuherzigkeit eines Kleine-Leute-Anwalts aus Berlin-Kreuzberg dieTelekom-Aktie aufschwatzte? Was passiert vor dem Haus von Uschi Glas,wenn uns nach dem Genuß ihrer Soja-Würstchen ein plötzliches Un-107
wohlsein überfällt? Welches Lied muß Karl Moik zur Strafe singen, fallsdie von ihm empfohlene Investment-Rente doch nicht für die Miete <strong>im</strong>Altershe<strong>im</strong> reicht? Prominenz als Werbeträger fühlt so viel Verantwortungfür das beworbene Produkt wie ein leeres Stück Pappe.<strong>Die</strong> Wunschbox des PublikumsDer Veranstalter hat dem Thema meines Vortrages noch eine Unterzeilehinzugefügt: „Der Qualität gehört die Zukunft?” Das Fragezeichen gefälltmir. Kommt der Begriff „Qualität” in der Wunschbox des Publikumsüberhaupt vor?Jedes Medium orientiert seine Form und seine Inhalte an Wünschen undSehnsüchten des jeweiligen Zielpublikums. Bei einigen gehört die Qualitätdazu.Der Qualitätsauftrag für Information und Kultur ist in den Rundfunkgesetzenformuliert. Exemplarisch steht in dem Staatsvertrag für das DeutschlandRadio:„<strong>Die</strong> Programme haben ihren Schwerpunkt in den BereichenInformation und Kultur” (§ 2); die „kulturelle Vielfalt Deutschlands ist angemessen<strong>im</strong> Programm darzustellen” (§ 6). Und so wie das Bundesverfassungsgerichtdie Existenz kommerzieller elektronischer Medien an dieBest<strong>im</strong>mung geknüpft hat, daß auch der öffentlich-rechtliche Rundfunkeine Bestands- und Entwicklungsgarantie hat, ebenso ist die vielfältigeFörderung des Quotenjournalismus an die Präsenz und Stärkung von Qualitätsmediengebunden. So verstehen wir das Bundesverfassungsgericht.Auf dem Fernsehschirm gibt es weit mehr Privatprogramme als öffentlichrechtlicheAnbieter. Auch bei den 323 Radio-Programmen, die die Media-Analyse 2003 erfaßt, sind die öffentlich-rechtlichen Programme längst inder Minderheit. Gegenüber dem Einerlei der Privaten, die jeweils mit 400bis 600 Titeln ein eher gleichförmiges Angebot mit automatisch abgespieltenCDs des musikalischen Mainstreams bieten, steht der öffentlichrechtlicheHörfunk mit seinen 61 Programmen dagegen für ein Vielfachesan Information, Service und Kultur. Gemessen an der Zahl der Nutzer istder öffentlich-rechtliche Hörfunk zweifellos weit erfolgreicher als seinekommerziellen Konkurrenten. Er erreicht täglich 54 Prozent der Hörerschaft,während das Massenaufgebot der Privaten lediglich auf 46 Prozentkommt.In der Wunschbox einiger Zielpublika klingelt es be<strong>im</strong> Stichwort Qualität.Beachtlich ist die Zahl der sogenannten gehobenen Programme (Infor-108
mationsprogramme wie der Deutschlandfunk und Kulturprogramme wieBayern Klassik, DeutschlandRadio Berlin, WDR 3 oder NDR Kultur). Jederdritte Radiohörer hört regelmäßig eines dieser Programme. Von den4,4 Millionen täglichen Hörern dieser Programme schalten 32 Prozent denMarktführer DeutschlandRadio mit seinen beiden Angeboten (Deutschlandfunk,DeutschlandRadio Berlin) kontinuierlich ein.Bedarf an kulturellen Qualifikationsangeboten gibt es auch <strong>im</strong> Fernsehen.Er läßt sich dort nicht allein an den mäßigen Marktanteilen von3sat (2002: 0,9 Prozent), arte (0,3 Prozent) messen, sondern vor alleman der Nutzung kultureller Informationssendungen, die das Erste, dasZDF und die Dritten anbieten. 15 Prozent aller deutschen Fernsehzuschauer(9,3 Millionen) sehen kulturelle Informationssendungen wie„Kulturreport” mit 1,62 Mio. Zuschauer (9,1 Prozent Marktanteil), „Kulturweltspiegel”mit 1,28 Mio. Zuschauern (8,5 Prozent Marktanteil) und„Titel, Thesen, Temperamente” mit 1,48 Mio. Zuschauern (8,1 ProzentMarktanteil), dazu die ZDF-Sendung „Aspekte” mit 1,3 Millionen Zuschauern(Marktanteil 6,6 Prozent) und andere Kulturberichte. Für die109
Medienforscher ist eindeutig, daß „das Fernsehen ganz offensichtlich inder Vermittlung von Kulturkontakten eine sehr wichtige Rolle für dieBundesdeutschen spielt” (Walter Klingler und Ulrich Neuwöhner: Kulturin Fernsehen und Hörfunk. Kulturinteresse der Bevölkerung und die Bedeutungder Medien in Media-Perspektiven 7/2003, Seite 315).Schneisen durch die UnübersichtlichkeitDer Kultur- und Informationsinteressierte erwartet von den Qualitätsmedien,daß sie ihm Schneisen schlagen durch die neue Unübersichtlichkeitaller möglichen Angebote von der privaten Rentenversicherungbis zum Regal des Buchhändlers. Fünfundsiebzig Prozent der Lektürewilligengeben an: „Es erscheinen so viele Bücher, daß es unmöglich ist,den Überblick zu behalten”. Vor ein paar Jahren waren es nur vierundsechzigProzent, die das sagten. Aber neunundsechzig Prozent der anLektüre Interessierten sagen auch: „Durch Radio und TV kann ich michschneller über das Wichtigste informieren” (Bodo Franzmann: Lesezappingund Portionslektüre. In Media Perspektiven 2/2001, S. 91).Qualitätsmedien bieten Service. Sie liefern ausführlich und pointiertaktuelle Materialien und Hintergründe zur Meinungsbildung für die politischeEntscheidung, für die Geschmacksbildung und zur Auswahl vielfältigerkultureller Angebote.Nirgendwo sind Medien- und Kulturpolitik so eng miteinander verzahntwie <strong>im</strong> Konzertbetrieb. <strong>Die</strong> enge Beziehung zwischen dem Medium undder Musik hat eine lange Geschichte. Schon als der Sendebetrieb des„Kultur- und Unterhaltungsrundfunks” 1923 mit dem Andantino von ErnstKreisler begann, wurde diese Symbiose begründet. Selbst in den Zeitendes Talk- und Kreisch-Radios strahlen die öffentlich-rechtlichen ProgrammeTag für Tag 250 Stunden E-Musik aus, viel davon selbst produziert. <strong>Die</strong>23 Orchester, Chöre und Big Bands der Landesrundfunkanstalten der ARDund des DeutschlandRadios bieten rund 1.300 öffentliche Konzerte proSaison, und von Schleswig-Holstein bis Bayern wären die großen nationalenFestivals ohne den Rundfunk und seine Orchester nicht denkbar.<strong>Die</strong> deutschen Rundfunkorchester sind mit Dirigenten wie Lorin Maazel,Kent Nagano, Marek Janowski, Mariss Jansons und Christoph EschenbachExportschlager und Botschafter der deutschen Kulturnation auf allenKontinenten.110
In der <strong>im</strong>mer aktuellen Debatte über Zukunft und Finanzierung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks dokumentiert sich exemplarisch die Kurzschlüssigkeitund das mangelnde strategische Vermögen der Kultur- undMedienpolitik. Während der Oberbürgermeister die Schließung der Opernsparteund den Abbau des städtischen Orchesters mit dem Argument zurechtfertigen versucht, die Klangkörper des Rundfunks könnten mit Konzertenvor Ort den Mangel ausgleichen, wird andernorts von Medienpolitikerngefordert, „dringend Alternativen zu eigenen festangestelltenRundfunkorchestern und -chören zu prüfen”. Schließlich brauche nichtjeder Sender eigene Klangkörper.Literaturhäuser werden geschlossen – mit Verweis auf öffentliche von denRundfunkanstalten angebotene Lesungen und literarische Diskussionen.Doch wenn Gebühren reduziert werden, sinkt zwangsläufig auch die Zahlöffentlicher Veranstaltungen. Eigenproduktionen müssen gestrichen werden.Kulturelle Aufgaben werden angesichts der diffundierenden kulturpolitischenZuständigkeiten zwischen Bund, Ländern, Kommunen undRundfunkanstalten wie eine heiße Kartoffel hin- und hergerollt. Jederhofft, daß der andere sie auffängt und Kulturaufgaben übern<strong>im</strong>mt, dieman sich selber nicht mehr leisten kann. Das Ergebnis: ein kulturellerAbbau und sinkende kulturelle Leistungskraft auf allen Ebenen.Dabei könnte es durchaus für die Rundfunkorchester oder andere Rundfunkangebotezu neuen Aufgabenzuweisungen kommen, mit denenKommunen und Gebietskörperschaften entlastet werden. <strong>Die</strong>s setzt abervoraus, daß eine entsprechende Finanzierung durch die KEF-Vorschlägeund durch die die Gebühr letztendlich festlegenden Länderparlamentesichergestellt werden kann.Populismus der GebührendebatteAber auch die Gebührendebatte ist geprägt von populistischen Argumenten.Belobigt wird, wer kostengünstig CDs abspielt, mit Pop-Tapetenmöglichst viele Hörer erreicht, wer möglichst viel wiederholt und möglichstwenig selber produziert. Da sind die KEF und die Quote sich manchmaleinig.Nichts dagegen, daß kostengünstig Quote gemacht wird. Aber auch derzweite Satz muß gelten: „<strong>Die</strong> Rundfunkanstalten bekommen die Gebühr,damit sie auch und gerade Qualitätsprodukte mit dem dafür nötigen Aufwandproduzieren können.” Dazu bedarf es eines extensiven Programmverständnisses.111
Bei den Selbstverpflichtungserklärungen, die der neue Rundfunk-Änderungsstaatsvertragvon den öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmenverlangt, muß auch die Politik medienpolitisch Farbe bekennen. Kulturund ausführliche Information sind keine billig zu erstellenden Wegwerfprodukte.<strong>Die</strong> Gebühr muß in erster Linie den notwendigen technischen undpersonellen Aufwand für die Informations- und Kulturprogramme sicherstellen.Hier sind klare medienpolitische Festlegungen nötig – anstelleder üblichen wohlfeilen Floskeln.„Was ist ein Funk-Intendant? Ein Attrappe? Ein Kegelclub-Präsident?” fragte1929 die „Weltbühne”. Nichts von alledem solle er sein, sondern er wäreein Mann, dem „das geistige, künstlerische und gesellschaftliche Wohlder heutigen Menschheit mit in die Hand gegeben ist”. Er wäre der„oberste Leibkoch seiner Nation, Kämmerer und Mundschenk”. Auchhabe er zu entscheiden, „ob die seiner Hut anvertrauten Geschöpfe mitrapider Geschwindigkeit verdummen oder nach Maßgabe ihrer Fähigkeitenan Geisteskräften zunehmen” und wir haben uns für die Geisteskräfteentschieden. Aber nicht, indem wir nur alte Formen bewahren. Nurwer sich verändert, bleibt sich treu. Auch Kultur und Information <strong>im</strong>Radio und Fernsehen muß sich dem Wettbewerb stellen und offensiv umZuschauer und Hörer werben. Aber die Wirkung ihrer Programme läßtsich nicht allein mit statistischen Methoden messen.Wer anspruchsvolle Programme sieht oder hört, zählt zu den Meinungsbildnern.Ob am Arbeitsplatz oder <strong>im</strong> Bekanntenkreis prägt er Diskussionen,n<strong>im</strong>mt Einfluß auf Stil und Geschmack. Radio und Fernsehen istKultur für die Gesellschaft. Sie ist keine Kultur für Eliten. Sie erreichtviele. <strong>Die</strong> einen direkt, andere erst auf Umwegen. Bei manchen kommtsie zugegebenermaßen gar nicht an. Aber sie ist ein Lebenselexier fürdie Gesellschaft. Das Leitwort für Qualitätsangebote in den Medien verkündeteBert Brecht in seiner „Radiotheorie”: „Ein Mann, der etwas zusagen hat und keine Zuhörer findet, ist schl<strong>im</strong>m dran. Noch schl<strong>im</strong>mersind die Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen etwas zu sagen hat”(Bert Brecht: Radiotheorie. In Gesammelte Werke, Band 18, Frankfurt/Main 1967, Seite 121). Deshalb sollte Qualität in den Medien nicht verstummen.Überarbeitete Version der Rede vom 29. September 2003, gehalten be<strong>im</strong> Herbstforumder Initiative „Qualität <strong>im</strong> Journalismus” des Deutschen Journalistenverband e.V.112
„QUALITÄT IN DER KRISE:WAS ZEITUNGEN SICH LEISTEN KÖNNEN”Bodo Hombach, Geschäftsführer WAZ-GruppeDass Journalisten von solcher Erfahrung und Kaliber einen Verlagsmanagerzum Thema „Journalistische Qualität” vortragen lassen, ist verdächtig.Viel spricht dafür, dass Sie entweder einen Sparrings- oderPunch-Partner suchen oder aber mir was beibringen wollen. Darauf freueich mich. Das ist die richtige Arbeitsteilung. Ich danke für die Einladungund stehe zur Verfügung.<strong>Die</strong> Sorge um journalistische Qualität muss eine gemeinsame sein. DassIhre Veranstaltung parallel zum BDZV-Kongress stattfindet, ist Zeichenund anregende Initiative. Ich hoffe, dass der Eindruck des diesjährigenZeitungsverlegerkongresses am Ende nicht allzu verzagt ist. Wir dürfennicht alles Krise nennen, was in Wirklichkeit notwendige Anpassungsleistungist. Reform und Modernisierung sind Angstwörter geworden.Was wir wollen, nenne ich Fortschritt. Wer soll uns loben und anpreisen,wenn wir es nicht selber tun?<strong>Die</strong> Automobilindustrie hat in Frankfurt ihre neue Qualität und ihre schönstenModelle gefeiert. Statt Krisengipfel Aufbruch und verlockende Produkte.Natürlich ist Opt<strong>im</strong>ismus manchmal mehr Appell als Interpretationder betriebswirtschaftlichen Daten. Aber dass den Markt auch Psychologieregiert und dass der Käufer ein scheues Reh ist, ist Wirtschaftswissen.Erinnern wir uns an die Krisendebatte der Uhrenindustrie. <strong>Die</strong> Digitaltechnikschrumpfte auf Handgelenkgröße. Ganze Standorte gingen verloren,Dynastien verschwanden. Es herrschte Endzeitst<strong>im</strong>mung. Dennoch:Das Produkt Uhr ist attraktiver und vielfältiger als zuvor. In jeder Qualitätsstufezu bekommen – von halb geschenkt bis teuer wie ein Oberklassefahrzeug– und ein phantastischer Anzeigenkunde.<strong>Die</strong> Uhr ist ein Kultprodukt, aber die Zeitung ist es auch. <strong>Die</strong> digitaleKonkurrenz haben wir längst. Der Qualitätssprung, die Frischzellenkurbei den Printmedien steht noch aus. Bei allen notwendigen Spar- undRationalisierungsmaßnahmen <strong>im</strong> Medienbereich muss eine Qualitätsoffensivein Optik, Logistik und Inhalt der Printmedien die zentrale Überlebens-und Zukunftsstrategie sein. Investitionsschwerpunkt. Abwarten undAussitzen ist auf jeden Fall gefährlich!Be<strong>im</strong> Forum Lokaljournalismus 2003 der Bundeszentrale für politischeBildung hat der kluge Herausgeber der Badischen Zeitung, Dr. Hodeicke,113
114über Qualitätsjournalismus gesprochen. Er begann mit einer brillanterfundenen Anekdote:Er sei in China gewesen, um dort vor Fachpublikum über Qualitätsjournalismuszu sprechen. Der Dolmetscher habe blockweise übersetzt. Erhabe in Blöcken von 10 Minuten gesprochen. Nach dem ersten Blockhabe der Dolmetscher einen Satz gesagt. Nach dem zweiten auch einenSatz. Nach dem dritten und nach dem vierten, dem letzten Block, jeweilswieder nur einen Satz. Dr. Hodeicke habe später irritiert einen Sprachkundigengefragt, was denn der Dolmetscher übersetzt hätte. Der gabAuskunft: „Nach dem ersten Block sagte er: Er hat nichts Neues gesagt’.Nach dem zweiten: Er hat <strong>im</strong>mer noch nichts Neues gesagt’. Nach demdritten: Ich glaube nicht, dass er noch etwas Neues sagen wird’. Undnach dem Ende deiner Rede sagte er: Ich hatte Recht.’ – Für mich heißtdie Lehre: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.Laute Klage, dass die Medien an Qualität verlieren, wird emsig verbreitet.Sie ist feste Größe <strong>im</strong> Kulturpess<strong>im</strong>ismus. Deshalb ist die Medienkritikin Deutschland mit Zitaten zu belegen, die älter als 200 Jahre, aberheute noch gängig sind. In meiner Sammlung „Witze über Medien undPresse” gibt es keinen, der nicht ätzt – gleich so wie Witze über Politik.<strong>Die</strong> Beobachteten und Kritisierten haben natürliches Vergnügen, die Verluderungmedialer Sitten zu beklagen.Medien, die von der Politik Hüte erwarten, holen sich den Belzebub insHaus. Nur wirtschaftlich selbständige und starke Verlage können dieFreiheit der Berichterstattung sichern. Nur eine wirtschaftlich stabileZeitung ist wirklich unabhängig. Wo für wirtschaftlich schwierige Zeitenvorgesorgt wurde, wo also aus Herausgebern nicht Herausnehmer wurden,kann man nun an Innovation und Qualitätsverbesserung denken.Unser Haus investiert gerade 200 Millionen Euro in neue und bessereTechnik. Wir wollen, dass die Qualitätsverbesserung <strong>im</strong> technischen BereichAnstoß ist, in allen anderen Bereichen zu opt<strong>im</strong>ieren. Es ist erfreulichzu sehen, welche Dynamik dadurch ausgelöst wurde. Als Verlagsmanagersehe ich nicht die Aufgabe zu definieren, was Qualitätsjournalismus ist. Esist meine Aufgabe, diesen möglich zu machen.Es ist die Stunde der Arbeitsteilung. Für andere Branchen ein alter Hut.Sie ist Kern der Industrialisierungsstrategie. In einigen, von dominanten,allseits aktiven Verlegern geführten Medienhäusern ist das neu. Als 1972der aufstrebende SPD-Abgeordnete Björn Engholm gegen Helmut Schmidtdie Pressefusionskontrolle in GWB drückte, wurde eine marxistische Grundüberzeugungzum Argument: Wem die Druckmaschinen gehört, der best<strong>im</strong>mtauch den Inhalt des Kommentars. Das ist anachronistisch! Immer
mehr Verlagshäusern werden von Managern geleitet. Der alles best<strong>im</strong>mendeVerlegertypus wird zunehmend Rarität. Das sind Vorboten einesIndustrialisierungsprozesses, auch bei den Printmedien.<strong>Die</strong> Qualitätssteigerung be<strong>im</strong> Inhalt des Produktes ist Sache der Chefredaktion,beraten von Verkauf und Marketing. Der Vertrieb und dieTechnik haben abzusichern und mitzusparen. Der Vertrieb bemüht sichmehr um den Kunden und konzipiert attraktive Nebengeschäfte. DerPersonalchef muss noch höhere Flexibilität aufbringen, als er von Mitarbeiternerwartet. Der Anzeigenverkauf kann noch mehr Unterstützungund Aufmerksamkeit verlangen als sonst. Der Kunde ist König. Kunde –das sind die Leserinnen und Leser, aber auch die, die Anzeigen schalten.Das Verlagsmanagement muss die Gratwanderung zwischen hartenSparschnitten, Konsolidierung und Zukunftsfähigkeit, Qualitätssteigerungund, wenn möglich, Expansion verantworten.Das Management muss nachweisen, dass der Satz: „<strong>Die</strong> Krise birgt vorallem neue Chancen” vorzeigbare Ergebnisse hat. Gerne würde ich Ihnenan dieser Stelle von verschiedenen Synergieprozessen und Opt<strong>im</strong>ierungen<strong>im</strong> Verlagsbereich berichten, Sie teilhaben lassen an den Sorgen einesVerlagsmanagers. Aber aus Zeitgründen möchte ich bei Ihrem Themableiben und zuspitzen.Ich war vor mehr als 25 Jahren mal Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehungund Wissenschaft (GEW). <strong>Die</strong>se Organisation diskutierte viel überBildungspolitik, über besondere Fördermaßnahmen für Schüler, über daszehnte Schuljahr für alle und Ganztagsbetreuung. Auf unvergessliche Weisehabe ich erfahren, dass diese gesellschaftspolitische Diskussion instrumentellenCharakter hatte. In Wirklichkeit ging es um ständische Interessen: umhöhere Besoldung, kürzere Arbeitszeiten, mehr Stellen. <strong>Die</strong> neueste Pisa-Studie sieht Deutschland bei den Lehrergehältern an erster Stelle – bei günstigenArbeitszeiten. Be<strong>im</strong> Schulerfolg sind wir entsetzlich abgeschlagen.Am Freitag der letzten Woche wurde uns von Experten eine Analyseder Lokalrundfunkstationen unserer Mediengruppe präsentiert. <strong>Die</strong> dreibeliebtesten Radiostationen und die mit der höchsten Reichweite warengleichzeitig die mit dem kleinsten Team und folglich den geringsten Personalkosten.<strong>Die</strong> drei Stationen mit der größten Mannschaft und denhöchsten Personalkosten waren – und ich muss annehmen, nicht durchZufall – die mit der geringsten Reichweite und der mit Abstand niedrigstenAkzeptanz.<strong>Die</strong>se Beispiele ließen sich fortsetzen. Ich will gestehen: Ich glaube nichtan den positiven Zusammenhang zwischen Quantität und Qualität.115
Natürlich müssen die Arbeitsbedingungen st<strong>im</strong>men. Natürlich müssen hervorragendeLeistungen honoriert und motiviert werden. Natürlich brauchtman ausreichend Zeit für eigene Recherchen. Aber Qualitätssteigerungensind nicht in Tarifverhandlungen zu erreichen. Natürlich wird nicht umsonstmit glücklichen Kühen geworben, wenn Qualitätsmilch angebotenwird. Aber wir wissen alle: Geld allein macht nicht glücklich und nichtautomatisch Qualität.Wir werden über neue Organisationsformen, neue Arbeitsverteilung,neue Teamzusammensetzung, bessere Aus- und Fortbildung, aber auchüber mehr Kontrolle und Würdigung von Qualität reden müssen. Nichtsüberzeugt mehr als das gute Beispiel. Eine Debatte über Standards wirdhelfen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Nur Sie, die Journalistinnenund Journalisten, können eine solche Diskussion überzeugend rührenund zusammenfassen.<strong>Die</strong> letzte Instanz ist aber der Markt, die Auflage. So wie Politik ihreKonzepte weder verantwortlich noch erfolgreich aus Meinungsumfragenableiten kann, so kann Qualitätsjournalismus kein anspruchsloser, allseitsgefälliger, seichter und bequemer sein. Der Leser will nicht überfordert,aber auch nicht unterfordert werden. Am Ende ist es ihm was wert,dass er mehr verstanden hat von der ihn umgebenden Realität. <strong>Die</strong>116
Mischung macht es. Kein pädagogischer Zeigefinger, aber Aufklärungsanspruch.Didaktik ist nicht Qualitätsverlust, sondern hohe Schule derVermittlung. Nicht die Bleiwüste steht für höchste Qualität, sondern dieDidaktik auf der Höhe der Zeit.Wir merken es an uns selbst, wenn wir in ein neues, modernes Museumgehen oder ein gut gemachtes, didaktisch aufgebautes Fachbuch lesen.Wir sind dankbar für das Bemühen, uns was Neues zu lehren, aber esuns dabei nicht unnötig schwer, sondern unterhaltsam leicht zu machen.Natürlich liebt man den anspruchslosen Small-Talk, aber nur geschenktoder ganz billig.Hier möchte ich in kurzen Beispielen beweisen, dass Ihre Sorge um dieQualität des Journalismus auch die Sorge eines Verlagsmanagers umzukünftige Märkte sein muss. Auch vor Gewerkschaftern möchte ichdarauf beharren: Hier gibt es keinen Antagonismus zwischen Verlag undRedaktion.Der Wert einer Information verfällt, wie der Preis eines Rohstoffes <strong>im</strong>Überangebot. Es gibt keinen Mangel an Informationen. Man wird zugekübelt,mit Wichtigem und Unwichtigem überflutet. Von nah und fern,meist von fern.<strong>Die</strong> journalistische Leistung, die Vorauswahl und die Bearbeitung desRohstoffes wird <strong>im</strong>mer wichtiger. <strong>Die</strong> zukünftige verlegerische Wertschöpfungrückt noch dichter an die Qualität journalistischer Leistung.Dabei wird die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit ein noch größerer Wert –am Markt, als Markenzeichen. Der Überdruss an Info- und Meinungsmüll,an Verschwörungstheorien, an eifernder Diskr<strong>im</strong>inierung und Phantastereienwird gerade bei der damit überfluteten Internetgeneration größer.<strong>Die</strong> Bereitschaft, sich für dumm halten und sich dumm machen zu lassen,sinkt. Zutreffend unterrichtet zu sein, wird wertvoller. Das Tendenziöseund Manipulierende verliert seinen Marktwert. Es wird verschenkt werdenmüssen. <strong>Die</strong> Frage kommt auf: Was ist wichtiger: Etwas sofort zuwissen oder etwas genauer zu wissen? Ist es wertvoller, den Gesundheits-und Gemütszustand eines Promis besser zu kennen als seinen eigen?Ist es wertvoller, das Ereignis am Ende der Welt in Echtzeit mitzukriegenals die Probleme zu verstehen, mit denen man es selber zu tun hat?Man muss keine Zukunftsvisionen haben, um zu erkennen, dass derzukünftige Wert einer Nachricht sich <strong>im</strong>mer mehr nach der Relevanzbemisst, Relevanz aus der Sicht unserer Kunden. <strong>Die</strong> Nachrichten- undInformationsflut wird noch ungeheuer anschwellen. Aber auch das Bedürfnis,davon verschont zu bleiben. Man will mehr erklärt haben, aller-117
dings leichter und schneller verständlich. Wenn es etwas unterhaltendist, umso besser. Unsere Schulbücher sind schon viel besser geworden.Unsere Zeitungen werden es auch. Hier ist Anpassung Fortschritt.Ein böser Trend stört. Ein eigener Berufsstand versucht, Werbung, PRund Redaktionelles zu vermischen: Einige TV-Shows verlieren fast jedeHemmung. Einige Blätter ziehen die Grenzen nicht mehr streng. Es wirdam eigenen Ast gesägt, auch am ökonomischen. Dadurch droht langfristigGefahr für die reellen Werbeeinnahmen. Gefährlicher noch ist der Glaubwürdigkeitsverlust.Denn dieses Treiben fällt auf. Erst ein bisschen, dann<strong>im</strong>mer mehr.Es ist für Verlag und Journalist Kapital, dass bei allen Umfragen der letztenZeit – ganz gegen den Trend – die Regionalzeitungen an Glaubwürdigkeitund Akzeptanz erheblich gewinnen. Sie sind Akzeptanz-Spitzenreiter.Das ist gleichzeitig Verantwortung.<strong>Die</strong> Enthüllung und der Skandal sind nicht sonderlich verkaufsfördernd.Es gibt ein Überangebot. Aber die Enthüllung bleibt wesentliche Pflichtder Presse. Unabhängigkeit, Kritik und Enthüllung sind unverzichtbarerBestand ihrer besonderen gesellschaftlichen Rolle. Wer soll Wächter sein,wenn nicht die Presse? Es gibt kein wirksameres Mittel gegen Machtmissbrauchund Korruption und für gesellschaftliche Hygiene.Ich habe in den verschiedensten Rollen Erfahrung. Habe skandaliert undwurde skandaliert. Dass ich bei allen Vorwürfen, Attacken und tiefgehendenUntersuchungen am Ende entlastet wurde, liegt – ehrlich gesagt –nur an der Presse. Dass ich Quittungen aufgehoben und Vorteile nichtgenommen habe, trickreiche Wege nicht gegangen bin, war nicht übermenschlicherEdelmut oder unanfechtbare Moral, sondern Kalkül.Schon für junge Politiker ist die Frage „Was passiert, wenn das in derZeitung steht?” hilfreicher Wegweiser. Gerade erlebe ich auf dem Balkan,dass wirtschaftlich unabhängige Medien Motor der demokratischenEntwicklung und des Kampfes gegen Nepotismus, Willkür, Machtmissbrauchund Korruption sind. Es waren wesentlich mutige Journalistenserbischer Medien, die den letzten Diktator Europas Milosevic von innenbekämpft und letztlich gestürzt haben. Also bleibt klar: Qualitätsjournalismusmuss auch anecken und unbequem sein. Es ist ärgerlich zubeobachten, dass wir zwar mehr Medien, aber eine geringere Meinungsbreitehaben. Es langweilt auch die Konsumenten, wenn fast alle zurgleichen Zeit „die gleiche Sau durchs Dorf treiben”. Trendberichterstattungist weder Qualitätsjournalismus noch verkaufsfördernd.118
Einige glauben, das Internet wäre strukturell überlegen, weil es auseinem riesigen Angebot eine individuelle Abfrage ermögliche, in Zukunftsogar eine individuell zusammengestellte Zeitung nach eigenen Interessensgebieten.Ich sehe das ganz anders, fast umgekehrt. Hier liegt dasbesondere Problem des Internets. Man muss nämlich ganz genau wissen,was man will. <strong>Die</strong> Überraschung, die morgen die Zeitung bietet,etwas zu finden, wonach man nicht gefragt hat und was man nichterwartete, ist attraktiv. Guter Journalismus ist auch hier gefragt. Früherwar Überangebot Luxus, heute gibt es zu viel davon. Dass <strong>im</strong> Supermarkt18 Firmen vergleichbaren Kräuterquark anbieten, ist mehr Qual derWahl als Freiheitserlebnis.Viele erleben die Vorauswahl nach glaubwürdigen Qualitätskriterien, dieAldi be<strong>im</strong> Kräuterquark vorgenommen hat, als erleichternden Service.Vor 10 Jahren wurde das noch assoziiert mit kommunistischen Konsumstätten.Heute ist es Kult – ökonomisch der erfolgreichste.<strong>Die</strong> Tatsache, dass sich in den Printmedien die Berichterstattung vomInformations- zum Bedeutungsjournalismus wandelt, wird der Profilierungund Platzierung <strong>im</strong> Medienkonzert gerecht. <strong>Die</strong> zunehmende Informationsverfügbarkeitist nicht gekoppelt an vermehrter Informationsaufnahme.Das Zeitbudget des Konsumenten steigt nicht. Es gibt keineChance, die Informationsfülle individuell zu bewältigen. Der Journalistmuss helfen, <strong>im</strong> virtuellen Spektakel noch Übersicht zu behalten. Dassviele versuchen, die Informationsfunktion durch Unterhaltungs- und Servicefunktionenzu verstärken, ist ein vernünftiger Weg. Für die Printmedienwird es dennoch zur entscheidenden Frage, den Informationswertzum Thema zu machen. Ob eine verbreitete Information von Belangist oder nicht, kann bei der Bewertung der Werthaltigkeit nicht außeracht bleiben.<strong>Die</strong> Tageszeitung soll natürlich ihre publizistische Identität nicht verlieren,aber es gibt Anpassungsmodelle, die niemandem schaden. Zum Beispiel:farbige Gestaltung, kürzere Texte, die Aufspaltung von Themenblöckenin mehrere Informationseinheiten, die Visualisierung von Sachverhaltenmittels Informationsgrafik, der verstärkte Einsatz von Bildern, die übersichtlicheStrukturierung des Blattes. – Ich werde keine Eulen nach Athentragen und erfahrenen Journalisten erklären wollen, was ihr Job ist.Ich möchte nicht enden, ohne den Lokaljournalismus zu würdigen: DemLokaljournalismus gehört mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung, Ausbildung,119
Anregung und Ehre. Der lokale Journalist ist auf sich gestellt. KeineAgentur liefert ihm zu und prägt den Trend. Was interessant und relevantist, muss er jeden Tag selbst entscheiden und rechtfertigen. Oft ister mit den Menschen einer Berichterstattung persönlich bekannt, ihrenEinwirkungen direkt ausgesetzt. Soziale Geflechte und organisierteInteressen wirken auf ihn ein. Der Wahrheitsgehalt seiner Informationenunterliegt unmittelbarer Kontrolle.Wir wollen diesen tatsächlichen Frontarbeiter des Journalismus inZukunft mehr belobigen, ehren, ausbilden und unterstützen. Eine wichtigeUnterstützung ist es auch, einen über nationale Grenzen hinausgehendenErfahrungsaustausch zu pflegen. Unser Haus ist auch auf diesemFeld aktiv. Es ist zum Beispiel an der Universität Dortmund das Erich-Brost-Institut <strong>im</strong> Wissenschaftszentrum für internationalen Journalismuseröffnet worden, das neben unserer bewährten Journalistenschule inEssen dazu wichtige Impulse geben wird. Natürlich werden wir diese verlegerischeKernkompetenz nach Kräften ausbauen. Das wäre auch einlohnendes Thema, für das ich gerne wiederkomme.Bitte glauben Sie nicht, dass meine Unterstützung für Ihre Arbeitbesonders kraftvoll ausfällt, weil ich heute hier Gast bin. Das Verlagsmanagementder WAZ-Mediengruppe wird alles tun, um die Debatte fürmehr Qualitätsjournalismus zu flankieren und zu unterstützen. KeineSorge: Dabei treibt mich nicht etwa Idealismus, sondern kühles Marktkalkül.Bismarck hat mal spöttisch gesagt, Presse, das sei Papier undDruckerschwärze. Das könnte heute nicht mal mehr ein Marketinggenieverkaufen. Ich sehe durchaus eine gute Zukunft für die Printmedien. IhreDebatte spielt dabei eine wichtige Rolle, und ich bin sicher, dass derSieger schon fest steht: Der Leser!Rede vom 29. September 2003, gehalten be<strong>im</strong> Herbstforum der Initiative „Qualität <strong>im</strong>Journalismus” des Deutschen Journalistenverband e.V.120
DIE RELEVANZ DER MAGAZINEDr. Joach<strong>im</strong> Huber, Der Tagesspiegel1. Ist das Fernsehen für das Magazin erfunden worden?„<strong>Die</strong> Relevanz der Magazine” soll das hier diskutierte Thema sein. Ichhabe mich gefragt: Ist das Fernsehen für das Magazin erfunden worden,oder das Magazin für das Fernsehen? <strong>Die</strong> Zahl der Magazine <strong>im</strong> deutschenFernsehen ist sehr groß, der Umfang am täglichen Programm sehrbeachtlich. Nach den neusten Zahlen („Media Perspektiven”, Ausgabe12/2003) von Udo Michael Krüger senden folgende Programme in derZeit zwischen 17 Uhr und ein Uhr nachts so viele Minuten Magazine: dieARD 53 Minuten, das ZDF 52 Minuten, RTL 64 Minuten, Sat.1 63 Minutenund ProSieben 60 Minuten. Allein in der Woche, die ich zur Auswahl genommenhabe, es war die Woche vom 22. März bis zum 28. März 2004,sind mehrere hundert Magazinsendungen über den Bildschirm gelaufen.Ich habe in 18 Programmen 334 Magazintitel gezählt, dann habe ich aufgehört.Das Magazin <strong>im</strong> deutschen Fernsehen ist es wert, näher betrachtetzu werden. Unter dem Kriterium der Relevanz. Ein vielschichtiger Begriff.Im Groben soll es um drei Formen von Relevanz gehen. <strong>Die</strong> Relevanz derMagazine für die Sender, erstens, zweitens für das Publikum, drittens fürdie Betroffenen.2. Relevanz, die fern von jeder Relevanz istEin Magazineur hat, nach der Bedeutung seines Magazins für denSender gefragt, gesagt: „Der Sender unterstützt uns nicht, macht keineCross-Promotion, macht keine interne Werbung. Wir sind für diese Arschlöcherdas Feigenblatt – besonders in der laufenden Gebühren-Diskussion.”Sie werden es bemerkt haben, meine Leserinnen und Leser: Es geht umein Kulturmagazin und um eine besondere Form von Relevanz: Nämlicheine Relevanz, die fern von jener Relevanz ist, die sonst gilt: Quotemachen, Werbegelder ziehen. <strong>Die</strong>se Fern-von-jeder-Relevanz ist auchschön. Der Kultur-Magazineur nämlich sagt: „Wir haben Narrenfreiheit,weil sich der Sender auf Hochglanzentertainment, d.h. auf Wissens- undGeschichtssendungen à la Bublath und Knopp konzentriert.” Druck werdevom Sender nur bei der Quote ausgeübt – und die st<strong>im</strong>me zum Glück.Wirklich einfach wird das Leben dadurch auch nicht, bedeutet es doch121
die Auflösung des Begriffs vom Kulturmagazin. „Unsere Sendung”, sagtder Magazineur, „ist relevant für alle Menschen, die daran interessiertsind, was in dieser Welt passiert.” Damit ist der Radius so weit gesteckt,dass schier alle Themen hineinpassen.Anspruch des Magazins sei ein „Massenpublikum”, das sich nicht ausden segmentierten Gruppen wie den Kino-Gängern und den Opern-Fanszusammensetze, die dann einzeln bedient würden. Das Magazin bediene<strong>im</strong> Kontrast zur „Kulturzeit” nicht die „Szene”, deshalb sei die Kategorie„Betroffene” nicht relevant. „Kulturzeit”, das ist das werktägliche Magazinbei 3sat. Eine leitende Redakteurin von „Kulturzeit” sagt, Relevanzder Sendung bei den „Betroffenen” sei „wichtig”. Wie dieser Anspruchüberprüft werde? Durch private und professionelle Kontakte wissen die„Kulturzeit”-Macher: <strong>Die</strong> Community der Kulturschaffenden wird zu fasthundert Prozent erreicht. <strong>Die</strong> Quote von unter einem Prozent Marktanteil„wird von uns souverän nie überschritten”, sagt die Redakteurin.Merken Sie etwas, meine Damen und Herren? Was die „Kulturzeit”-Redakteurin heute aussagt, das hätte früher locker jeder „Aspekte”-Chefgesagt. Würde er es heute noch sagen und in die Tat umsetzen, dannwäre „Aspekte” längst auf der Kulturdeponie von 3sat gelandet. Es gibtaber noch schl<strong>im</strong>mere Strafen und Belohnungen – die Kulturmagazineder ARD – sind so weit in die Nacht geschoben worden, dass sie dassein können, was sie sein wollen: Kulturmagazine nämlich.3. Relevanz ohne Akzeptanz istin den Hauptprogrammen nicht denkbarIch will damit festhalten: Eine Relevanz ohne Akzeptanz ist in denHauptprogrammen des deutschen Fernsehens zur einschaltstärkstenSendezeit überhaupt nicht denkbar. Und sie wird auch nicht gedacht. Inihrer Extravaganz sind „Aspekte” und all die „Kulturreporte” von einerganz feinen Relevanz: Sie nutzen dem eigenen Image des Senders unddem Prestige des Programms. Sie werden in Kauf genommen.Und dann gibt es den Fluch der guten Tat: Hat sich ein Sender über Jahreum ein Image bemüht, dann hat er es auch verdient, nicht wahr? Eszu ändern, ganz oder wenigstens partiell, ist so gut wie aussichtslos.Das ZDF zum Beispiel ist ein Sender für die älteren Mitbürger. „Bravo TV”ist dann nichts als der hilflose Versuch, für die deutsche Jugend relevantzu werden. Aber lassen wir mal die Relevanz weg, redundant ist selbst„Bravo TV” für das ZDF nicht. Der Flirttest in Zusammenarbeit mitdem Rasierer-Hersteller „Wilkinson”, die Bravo-TV-Charts, die Beratung122
durch das Dr. Sommer-Team in Sachen Eifersucht sind Themen, die inkeinem anderen ZDF-Magazin auftauchen werden und auftauchenkönnen. Was nicht eben für die Relevanz zeugt, wohl aber für denHinweis, dass hier kein redundantes Sendungsformat vorliegt. Oft ist esauch nur die Machart, die Redundanz verhindert. Wenn in „Aspekte”über den neuen Kr<strong>im</strong>i von Leena Lehtolainen berichtet wird, dann könntedies auch bei Elke Heidenreich passieren, aber in dieser Art und Weise,in diesem Tonfall nur bei „Aspekte”. So gesehen ist „Bravo TV” dochrelevant, oder?4. Akzeptanz schafft RelevanzAkzeptanz schafft Relevanz, habe ich gesagt. Und Akzeptanz schafftBindung, Zuschauerbindung. Gerne auch über Penetranz. Es hat sich <strong>im</strong>deutschen Fernsehen bewahrheitet, dass ein Magazin meist über seinefortgesetzte Ausstrahlung zu seiner Relevanz kommt. Verlässlichkeit istda ein hohes Gut. Nehmen wir „Galileo” bei Pro 7. Ein Magazin ohneThemenschlüssel, aber mit einem verlässlichen Sendungsmotto: „Sehen,staunen, verstehen”, das jeden Werktag aufs Neue eingelöst wird. Sehenbedeutet ein Eyecatcher-Thema, staunen ein verblüffendes Thema, verstehenein erklärendes Thema. Umgekehrt, betrachten wir den „Berichtaus Berlin” in der ARD. Das ist der Ruin einer Sendung trotz bestenWillens. Irgendwo zwischen frauenaffinem Herz-Schmerz, einem StückARD-Humorverständnis und vor dem Peng-ich-schieß-dich-tot-Kr<strong>im</strong>ifloatend, sind dem „Bericht” seine Zuschauer abhanden gekommen. Beialler punktuellen Relevanz: Ohne Akzeptanz, ohne verlässliche Penetranzist da nichts zu wollen. Jeder darf seinen Zweifel haben, ob die angekündigteLösung – der „Bericht aus Berlin” <strong>im</strong> Gedärm der „Tagesthemen”– verlässlich nicht beide Sendungen ruiniert. Der „Bericht ausBerlin” hat nur noch seinen symbolischen Wert – seht her, wir haben dieBerliner Politik hautnah – und nur dieser symbolische Wert steht für dieARD außer Frage, nicht der Bericht selbst.5. Magazine dienen der ZuschauerbindungEin Magazin dient der Zuschauerbindung, es dient dem Zuschauerfluss,und es wird von ihm bedient. <strong>Die</strong> Quote ist da die eine Münze, die kommerzielle,die Werberelevanz die andere. Der Zuschauerfluss: Ich hatteschon das Vergnügen, bei den harten Hunden der zeitkritischen Magazinezu sitzen, also den Magazineuren, die dir in 45 Minuten, was sage ich,123
in sieben Minuten eine neue Weltordnung hinhauen. Und da lernst DuErstaunliches: Es wird ausführlich gefachs<strong>im</strong>pelt, welche Sendung, welches<strong>Format</strong> das liebste, das beste wäre, das dem eigenen Magazin vorauslaufensollte. Und kann es Sie überraschen? Es wird jede, aber auchjede Niveau-Unterschreitung akzeptiert, auf dass die große Zuschauerzahlvor der eigenen Sendung steht. Es wird um eine Serie, um eineComedy, es wird um Volksmusik, es wird um Unterhaltung gebettelt. Wasder Magazineur <strong>im</strong> Vorlauf nicht so gerne hat: Ein Magazin. „Brisant” <strong>im</strong>Ersten! Ja, das ist das „Mondamin” für die Zuschauerbindung der ARD,auch wenn der Preis die Themen-Diarrhoe ist.Beispiel 1: „Brisant”, ARD, am 27. März 2004Was hinten rauskommt, ist diesen Typen übrigens fürchterlich egal. Relevantbin ich selber.Geht man davon aus, dass <strong>im</strong> deutschen Fernsehen folgende Formelgilt: Penetranz schafft Akzeptanz und Akzeptanz schafft Relevanz, wennferner gilt, dass nichts gezeigt wird, was kein Publikum hat, darf manunter dieser vulgären Prämisse annehmen, dass für das Publikum allesrelevant, also alles irgendwie interessant ist. Im Magazin-Fernsehenherrscht Marketing-Journalismus vor: Das Publikum wird als handelndeIndividuen gesehen, die als Konsumenten Medienangebote nach eigenenBedürfnissen nutzen. Der Journalist ist <strong>Die</strong>nstleister, Verkäufer, derwichtigste Themenlieferant der Zuschauer. Er will die Aufmerksamkeitund die Zufriedenheit der Zielgruppe. Das dahinter liegende Bild vomPublikum: konsumorientiert und wählerisch.6. Lebensberatung muss seinAlsdann: Für die „lieben Freunde der gepflegten Sexualunterhaltung”,wie Lilo Wanders ihr Magazin „Wa(h)re Liebe” bei Vox zu eröffnen pflegt,bieten sich folgende Wege der Lebensberatung an:1. Julia Miles hat sich 900 Gramm Silikon in ihre Brüste transplantierenlassen. Julia Miles ist ein Busenwunder. Aber, keine Rose ohneDornen: Julia Miles hat jetzt starke Rückenschmerzen. Der Trost ausdem Off: „Je größer der Busen, desto beliebter die Trägerin.” (...)2. Es gibt eine neue Kontaktbörse, sie heißt „Lucy”. Dadurch sind jetzteine Einzelhandelskauffrau und ein Schornsteinfeger miteinanderglücklich.3. Akute Potenzprobleme löst neuerdings die Droge „Cialis”. So wunderbar,dass die Ehefrau mit Lob nicht spart: „Hammerhart”.124
Alles andere wollen „Wiso”, das Magazin für Wirtschaft und Soziales, <strong>im</strong>ZDF, und „Extra” in RTL abdecken. Dort, bei „Wiso”, verbinden sich „Service”und Unterhaltung auf das Schönste, weil, wie ein Redakteur betont,„45 Minuten Schwarzbrot geht nicht”.„Wiso” packt rein:1. Krankgeschrieben – was ist erlaubt?2. Neue Lust auf Autos? Wiso zeigt neue Modelle.3. Computer – künftig auch fürs Fernsehen?4. Kaufen mit Kienzle: Der ZDF-Doppelgänger von Saddam Hussein a. D.isst und trinkt sich durch die Champagne.5. <strong>Die</strong> gefährlichen Dialer6. Neue HandysUsw. usf. Und gerne auch auf www.zdf.de, als Fax-Abruf, auf CD-ROM.„Extra” hat <strong>im</strong> Angebot:1. Händler auf deutschen Wochenmärkten waschen sich nach dem Toilettengangnicht <strong>im</strong>mer die Hände. Das gefährdet die Volksgesundheit.Aber, Obacht, es gibt ein Gegenmittel. In Zeitlupe wird es erklärt: Wiewasche ich meine Hände richtig? <strong>Die</strong> mit der versteckten Kamera überführtenHändler schwören: Ab jetzt wasche ich meine Hände <strong>im</strong>merrichtig nach der RTL-Methode. Danke, RTL.2. Zwei Lotto-Millionäre erklären: Geld macht reich, aber nicht glücklich.3. Im Sperrmüll stecken <strong>im</strong>mer noch ein paar Euro, die über Ebay erlöstwerden können. Also: Nix mehr wegwerfen.4. Wie fahre ich richtig schwarz?5. In Amerika schlagen sich Hausfrauen für eine Handvoll Dollars <strong>im</strong> Boxringden Schädel ein. Den „Chick Fight” sollten wir in Deutschlandnicht erlauben, denn eine tote deutsche Hausfrau ist keine gute deutscheHausfrau.6. Eine Verkäuferin und eine Angestellte in Berlin reißen jedes WochenendeMänner auf. <strong>Die</strong> versteckte Kamera beweist: Nach 1 Minute und25 Sekunden Anmache geht es spätestens zu ihm und in die Kiste.7. Lebensweltliche Relevanz der Magazine:„Nach dem Toilettengang bitte Hände waschen”Lebensberatung muss sein, klar, und deswegen hat das Magazinfernsehenhier vielleicht seine stärkste Seite. Es ist alltagsrelevant, esist alltäglich, <strong>im</strong> idealen Falle steckt gar die Qualität einer Anwendungdrin. Sie erinnern sich: Nach dem Toilettengang bitte Hände waschen!125
Ein Thema sollte lebensweltliche Relevanz besitzen, den antizipiertenZuschauer in seinem persönlichen Sein treffen. Ein bisschen schlichterformuliert: <strong>Die</strong> konkrete persönliche Lebenssituation muss erwischt werden.Und irgendeine Lebenswirklichkeit wird <strong>im</strong>mer erwischt. Und eswird darauf geachtet, dass eine große Zahl von Zuschauern angesprochenwird. Computer, Handys, Autos, saubere Hände, Lottospielen – dasist millionenfach von Interesse. Ein leitender Redakteur von „Wiso” sagt:„Wiso ist relevant für alle, da das Themenspektrum von „Handy bis zumSterbebett” reicht, also alle Altersgruppen umfasst.” Bei der Themenwahlsei der Massenappeal entscheidend, statt der Detail-Frage zu einerprivaten Krankenkasse werde eher die ganze Gesundheitsreform angegangen.Der Redakteur: „Wiso ist keine Spezialsendung, bei 45 Sendungen<strong>im</strong> Jahr muss alles zum Thema gemacht werden.”8. Kontextlose St<strong>im</strong>mungmacheAber: Lebensberatung muss sein, soll sein, Orientierung – natürlich. Woes anfängt, fragwürdig zu werden? Nicht dort, wo Info und –tainment zumVerbund gebracht werden, wo die Alltagsrelevanz tobt, sondern dort, wodie dritte Stufe gezündet wird: In der Ranschmeiße ans Publikum, in derZone, wo keine Info mehr ist, kein –tainment mehr. Ein Beispiel aus der„Wiso”-Sendung vom 22. März 2004. In einem durchaus objektiven Filmbeitragwird geschildert, wie einem Bundesbürger durch die Säumigkeiteines hohen Gerichts ein beträchtliches Vermögen vorenthalten wird.Das ist beklagenswert, der ZDF-Sendung aber nicht genug.Beispiel 2: „Wiso”, ZDF, 22. März 2004Ich kann hier keine Relevanz erkennen, ich kann nur auf kontextloseSt<strong>im</strong>mungsmache erkennen. Wofür soll hier auch Relevanz erkennbarsein? Ein Einzelbeispiel in den beobachteten Magazinen ist das nicht.Der Staat und seine Institutionen werden verungl<strong>im</strong>pft. Und st<strong>im</strong>mt esnicht auch? Irgendwo sitzen die Bösen und treiben den Bürger in dieUnzufriedenheit. Das ist schäbig, aber vom Magazineur so schäbig gemacht.<strong>Die</strong> Journalisten begreifen sich als Teil der Betroffenen-Welt, wosie doch davon abgrenzen müssten.9. Infotainment als Enlighttainment?Gibt’s <strong>im</strong> deutschen Fernsehen selbstredend auch. „Galileo” bei Pro 7,davon hatten wir schon gesprochen. Nehmen wir die andere Variante,126
nehmen wir „Nano”, das Wissenschaftsmagazin in 3sat. „Nano”, sagt dieRedaktionsleiterin, „ist relevant für alle wissensorientierten Menschen.”Das Motto der Sendung lautet: „Forschung statt Service”. Einige Themender Sendungen vom 22. bis zum 27. März 2004: Wie Solarzellen Sonnenlichtin Strom umwandeln; Warum Antibiotika nicht mehr wirken. DerThemenradius ist kein Zufall: Geistes- und Sozialwissenschaften nehmenselbst in Wissenschaftsmagazinen nur eine geringe bis keine Rolle ein.Auch in den Kulturmagazinen fallen sie durch. Das Fernsehen schreitnach Visualisierung, und wer kann schon den Weltgeist visualisieren.Also „Nano”, will heißen: Naturwissenschaft bis Mathematik. Und waserfasst die Selbstkritik der Macher? „Gehen oft zu sehr in die Tiefe.” „Wirmüssen unterhaltsamer und anschaulicher präsentieren, daran müssenwir noch arbeiten.”<strong>Die</strong> Gruppe der Forscher und Wissenschaftler sei eine wichtige Zuschauergruppe,rund ein Fünftel aller Zuschauerbriefe stamme von ihnen, diewürden Ungenauigkeiten oder falsche Assoziationen bei Beiträgenmonieren.127
10. Qualitätsfernsehen oder sympathischer Gemeindefunk?„Ohne Quotendruck können wir es uns leisten, Qualitätsfernsehen zumachen”, sagen sie bei „Nano”. Das hat etwas vom sympathischen Gemeindefunk.Es gibt sie durchaus, die Sendungen, die Magazine, dienachrichtlich informieren, die erklären. Für ihre Relevanz heißt das: Jemehr Wissen, je mehr Fakten, desto geringer der Anteil der Unterhaltung,desto weniger -tainment bei der Info. Eine Sendung wie „Nano”hat in den Hauptprogrammen des deutschen Fernsehens keine Chance.Oder lassen Sie sich, verehrte Magazineure in den Top-5-Programmen,nur mal durch den Kopf gehen, was Sie aus dem Thema „WarumAntibiotika nicht mehr wirken” gemacht hätten. Eine gar nicht sounwahrscheinliche, eine weltexklusive These: Antibiotika abgelaufen –die Deutschen sterben aus.Und wenn die Deutschen nicht an den wirkungslosen Antibiotika sterben,dann sterben sie wegen der Neugeborenensterblichkeit aus. Sie könntesteigen, übrigens wegen der Gesundheitsreform. In einem Beitrag von„Frontal 21” werden die Folgen der Fallpauschale beschrieben, die, verkürztgesagt, an die Stelle der Tagespauschalen bei einem Krankenhausaufenthalttreten werden. Der geschilderte Fall bleibt <strong>im</strong> Ungefähren, <strong>im</strong>Möglichen. Keiner, aber auch wirklich keiner kann seriös die Folgen derTagespauschalen abschätzen. „Frontal” kann. „Frontal” kann, nicht derRelevanz wegen, sondern um seiner Akzeptanz willen. <strong>Die</strong> Bürger sind,noch vor allen politischen Themen, an ihrer Gesundheit interessiert. Damuss „Frontal” ran. Und will über einen singulären Fall die Identifikationsbrückezum Zuschauer schlagen. Und muss das Thema ebensoan anspruchs- und vorbildungsarme Publika adressieren wie an eineinteressierte und vorinformierte Öffentlichkeit. Und beunruhigen muss„Frontal”.„Frontal 21” nennt sich ein „zeitkritisches Magazin”. Politische Themengibt es als Einsprengsel, nicht als rote Linie. „Monitor”, ARD/WDR, verstehtsich als „politisches Magazin” wie „Panorama” übrigens, und beidemit steigenden Quoten. <strong>Die</strong> Themen von „Monitor” am 24. März 2004:1. Altersdiskr<strong>im</strong>inierung 2. Betriebe go east 3. <strong>Die</strong> Steuerreform derUnion 4. Industrielobbyist unterstützt Bürgerinitiativen gegen Windkrafträder.Relevanz heißt hier: Beiträge zur politischen Willensbildung aus demGeist der durch pure Willensanstrengung gebildeten Meinung. Gegen dieSteuerreform der Angela Merkel, welche die Armen übrigens ärmermacht, sind sogar die Besserverdiener. Aufgedeckt hat das „Monitor”.128
Wird das Thema auch mit dem Stahlkamm frisiert, so wird <strong>im</strong>merhinnoch über ein politisches Konzept berichtet. Wo gibt es das noch? Dasalles wird von „Monitor” mit heiligem Ernst vorgetragen, mit der eingebautenHoffnung auf ein wenig Provokation, auf ein bisschen Krawall,mit strikter Reizorientierung, alles drei Nachweise für die eigene Existenzberechtigung.11. Nun ist es <strong>im</strong>mer blöd, wenn man als Sauertopf gilt.Das hat schon Klaus Bednarz erkannt, erst hat er einen Pullover übergezogenund dann die Glosse ins politische Magazin eingeführt. Heuteist es schön, wenn Sonia Mikich, Theo Koll und Andreas Bönte ihre betroffenenGesichter ablegen, ein wenig grinsen und seltsam reden. Dannist Zeit fürs Spaßmachen, was in der Regel so gut funktioniert wie dieARD, wenn sie so lustig sein will wie das ZDF. Es war schon richtig, dasssich Politikredakteure eines Tages gegen eine Kabarettisten-Karriere entschiedenhaben. Der Informationsauftrag muss nicht komisch sein.Ich will nicht sagen, dass die zeitkritischen, die politischen Magazine nurnoch dem eingangs ausgeführten Marketing-Journalismus gehorchen. Esgibt sie, übrigens auch bei „Spiegel TV”, die Spurenelemente des PublicJournalism. Wo das Publikum als sozialer Akteur verstanden wird, dervon den Medien unterstützt wird, sich in der Gesellschaft zu beteiligenund einzubringen. Der Journalist organisiert <strong>im</strong> Idealfalle den Dialog,seine Intention ist die Lösung der Probleme aus Bürgersicht, sein Bildvom Publikum ist: Gemeint und mobilisierbar.<strong>Die</strong> Entgrenzung, die fortgesetzte Entpolitisierung selbst des politischenMagazins in ein Allerlei-Magazin hat erfolgreiche Hybrid-<strong>Format</strong>e wie„Stern TV” oder „Frontal 21” hervorgebracht. Was da vereinzelt, was daoft passiert, geschieht massenhaft <strong>im</strong> Reich der Boulevardmagazine:soziale Sinnstiftung. Teilhabe an fremden Lebenswelten durch die eigeneGefühlswelt. <strong>Die</strong> Boulevardisierung selbst existenzieller Themen. Siehe„Exclusiv” bei RTL; Cora und Corinna Schumacher werden gegeneinanderausgespielt: <strong>Die</strong> häusliche Corinna gegen die glamouröse Cora;Andreas Türcks Ruf wird angezweifelt: Immer mehr Freunde berichtenvon den dunklen Seiten des der Vergewaltigung Angeklagten; Neid undsoziale Differenzierung werden gefördert a) durch einen Bericht voneiner Maserati-Show, auf der Promis erzählen, dass sie sich bereits zweiModelle – eins für unter die Woche, eins fürs Wochenende – gekaufthaben und b) durch einen Bericht über ein Luxushotel für Hunde undihre Besitzer.129
Das mit der sozialen Sinnstiftung geht aber auch ganz anders – siehe„Frontal” und der Beitrag über „Gottes he<strong>im</strong>liche Kinder”. Demnach hatdie Hälfte aller katholischen Priester sexuelle Kontakte. <strong>Die</strong> sind ja nunmal untersagt und sorgen für ziemlich viel Kummer. Das ZDF ist übrigensgegen diesen Kummer und damit auch gegen das Zölibat.12. Ist relevantes auch wichtig?Relevantes Thema? Tja, schon interessant, aber ist es auch wichtig? DasThema ist auf jeden Fall überraschend. Kein zweites Magazin hat in dieserWoche vom 22. bis zum 28. März auf das Thema „Gottes he<strong>im</strong>licheKinder” hingewiesen. Für die aktuellen Zeitläufe ist es nicht eben best<strong>im</strong>mend,aber es hat etwas, was der Zuschauer von einem Magazinauch erwarten darf: Überraschung. Der Zuschauer soll staunen, und erstaunt auch. Von sozialer Sinnstiftung würde ich nicht reden. Es geht umdas Wecken von Interesse, und es geht um Unterhaltung. BeidesVoraussetzung von Akzeptanz. Wenn Sie mich fragen, wo ich die lebenswichtigenBereiche von Familienpolitik oder Bildungswirklichkeit, wo ichHartz I bis Hartz IV, das Arbeitslosengeld II gesehen habe, muss ichIhnen sagen: Gar nirgendwo. Hab’s einfach übersehen. Um die Bildungkümmern sich die seriösen Zeitungen <strong>im</strong> Land, und das Fernsehenkümmert sich um die Unterrichtung der bildungsfernen Schichten. Derehemalige katholische „Frontal”-Priester, jetzt übrigens Protestant, stehtauch für seine eigene Relevanz, für die Relevanz des Betroffenen. Betroffenehaben es gut <strong>im</strong> deutschen Magazin-Fernsehen, vorausgesetzt,sie sind in der Opferrolle oder in der positiven Täter-Rolle. Das Fernsehen,klar, setzt auf die Teilhabe, die Teilnahme der Betroffenen, schließlichmüssen die betroffenen Opfer mit der Bildaufnahme ja einverstandensein. Das führt in den meisten Beiträgen, die ich gesehen habe, zu einerbesonderen Nähe, zur Anteilnahme, zur Betroffenheit der Macher undJournalisten. Bei „ZDF-Reporter” sitzt der Journalist, die Journalistin demMitbürger fast schon auf dem Schoß und auf jeden Fall <strong>im</strong> Auto auf demBeifahrersitz.Drei Beispiele für Betroffene und Betroffenheit: „Galileo” berichtet überMenschen, die von einem Zwang gepeinigt sind, speziell über einenjungen Mann, der sich selber schlägt und Verletzungen zufügt. Ein sogenannter „Hirnschrittmacher” könnte Abhilfe leisten. <strong>Die</strong> Operation gelingt,zeitigt aber nicht die erwünschten positiven Folgen. Das istschl<strong>im</strong>m, die Mutter ist traurig, der operierende Professor bleibt opt<strong>im</strong>istisch.Zum Schluss wird nachgelegt: <strong>Die</strong> Krankenkasse wird für die130
weiteren Kosten nur noch insofern aufkommen, als der junge Mann alsPflegefall gesehen wird. Weitere operative Eingriffe würden nicht mehrbezahlt. Pfui, möchte der Zuschauer da rufen.13. Betroffenheit allüberallDas muss er noch öfters tun. Ein besonderer Trick der Magazineurebesteht doch darin: Ein Einzelfall, lieber noch ein Einzelschicksal, wirdgeschildert. Mitfühlend, mitglühend, es ist zum Jammern. Betroffenheiteben. Nun ist der Mensch dem Menschen ein Wolf. Ein Dritter, noch liebereine Behörde, eine Institution plagt einen offensichtlich unschuldigenMitbürger. Sicherlich, es gibt Ungerechtigkeiten, richtige Schweinereiensogar. Ich erinnere nur an den „Monitor”-Bericht über „Alterdiskr<strong>im</strong>inierung”:57-Jährige wird von ihrer Bank bei der Existenzgründung nichtüberstützt, ältere Frau bekommt keine Zusatzversicherung für ihreZähne. Da staunt selbst der Versicherungsmann, da gesteht selbst derVertreter eines Ministeriums eine Gesetzeslücke ein. Ein offensichtlicherMissstand, zu recht ins Fernsehlicht gebracht. Betroffenheit allüberall,Relevanz in der zweiten Potenz. Relevant eben, weil ein Erkenntnisgewinn,ein weithin sichtbarer und anerkannter drin steckt.Was den guten Eindruck hier wie dort wieder eintrübt, ist der Senf, den derModerator, die Moderatorin nach einem Bericht <strong>im</strong>mer noch dazu gebenmuss. Noch einmal „Monitor”. In einem Beitrag über die „Lohnkarawane”von West nach Ost wird eindrucksvoll aufgezeigt, wie ein deutscherKleiderhersteller von Cottbus nach Rumänien und dann nach Moldawienwandert, um die Herstellungskosten <strong>im</strong>mer weiter zu drücken. Verdient eineNäherin in Cottbus 900 Euro netto <strong>im</strong> Monat, sind es in Moldawien noch80 Euro. Sonia Mikich legt nach und wird zur Wirtschaftsweisen:Beispiel 3: „Monitor”, ARD, 24. März 2004:Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren Magazineure: In Ihren An- undAbmoderationen w<strong>im</strong>melt es von Behauptungen, kruden Feststellungen,scharfen Anklagen, wildesten Spekulationen – und, natürlich, von eigenerBeroffenheit via Selbstbezichtigung. Ein Beitrag über Deutschlands bekanntesteWahrsagerin geht gar nicht ohne Verweis auf das eigene Horoskopvom Tage ab. In der Regel wird radikalisiert, damit die Aufmerksamkeitdes Zuschauers für das neue Thema geweckt und gebunden wird.Aber: Ich habe nicht erkennen können, dass die Betroffenen, also dieUrheber, die Beteiligten und die Beklagten, dass weder die so genanntenOpfer noch die so genannten Täter verraten werden. <strong>Die</strong> Berichte sind131
in dem Sinne seriös, als sie glaubwürdig sind. <strong>Die</strong> Berichtsgegenständeund ihre Besitzer gibt es. Damit ist überhaupt nichts darüber ausgesagt,wie akzeptabel und wie überflüssig die Themen sind. Das Wichtige stehtgleichberechtigt neben dem Nichtigen. Das Magazin-Fernsehen, auchdas Magazin-Fernsehen in seinen nicht vordergründig boulevardesken Erscheinungen,hat sich dem Reiz-Fernsehen verschrieben. Ein Thema wirdweniger auf seine kritischen Punkte als auf seine Ausreizbarkeit untersucht.14. Alarmismus, Sensationsheische, Panikmachesind die Mittel zum ZweckWundert es die Magazineure eigentlich gar nicht, dass nach einer WocheMagazin-Fernsehen die Welt sich <strong>im</strong>mer noch dreht und steht? Undwundern sie sich nicht darüber, dass die Relevanz gerade mal so großist wie der Beitrag lang? Bei der nächsten Ausgabe ist dann von all denMerkwürdigkeiten, Grausamkeiten und all der Aufregung und all derUngerechtigkeit keine Rede mehr. <strong>Die</strong> Sahne wird hochgeschlagen, dannfällt sie wieder in sich zusammen.Und dieser totsichere Populismus! <strong>Die</strong>ses Anbiedern an Otto Normalverbraucher,der sich nicht nur vor dem Fernseher als Opfer sehen, sondernlängst auch als Opfer vom Fernsehen dargestellt sehen darf. <strong>Die</strong>serMagazin-Populismus will nur eines: Das Befinden des ewig abgezockteBeitrags- und Steuerzahlers feststellen. Offenbar ist dieser Staat einStaat, der seine Bürger ewig belügt und betrügt. Richtige Politik kannnur die sein, die an der Sicherung des individuellen wie des kollektivenParadieses arbeitet. Auch wenn das Große und Ganze es gar nicht erlaubt.Aber frag’ mal nach den Zusammenhängen und den Hintergründen.Da wird’s abstrakt, komplex, kompliziert – drei Begriffe, bei denen dergemeine Magazineur in Ohnmacht fällt. Nein, sein Bild ist klar in Treuezu sich selbst: Deutschland, ein Land von Opfern, ohne Zukunft. Dabeiregiert die eletronenmikroskopische Perspektive. Und es kommt stetsheraus eine bizarre Mischung aus Verbrauchermagazin und „AktenzeichenXY ungelöst”.Wer soll denn vor einem solchen Fernsehen noch Respekt haben? <strong>Die</strong>Politiker vielleicht? <strong>Die</strong> Mächtigen der Republik halten von den Magazinen,den zeitkritischen und den politischen, übrigens so viel, dass sie sich nichteinmal für ein Minütchen Statement Zeit nehmen; wohl wissend, dass dieTalkshow-Stühle ihnen schon bald unter die Hintern geschoben werden.Das spüren auch die Magazineure. Da viele von ihnen längst um die Kleinwüchsigkeitihrer Themen wissen, arbeiten sie an ihren Inszenierungs-132
künsten. Merke: Im Scheinwerferlicht wirft auch ein Zwerg lange Schatten.Was bietet die Fernsehtechnik nicht alles an: Versteckte Kameras,grafisch verfremdete Schriftstücke mit farblich abgesetzten Paragrafen, mitder Handkamera kunstvoll verwackelte Bilder, St<strong>im</strong>menverzerrung, verpixelteGesichter. Das eigentlich Authentische wird stilisiert, nachgeradeverspottet.15. „Ohne Phoenix is nix”Es ist ja nun nicht so, dass die Magazin-Macher sich hinter irgendwelchenBäumen verstecken und dann ein Berichtsopfer überfallen müssen. Ichweiß es nicht genau, aber ich ahne, dass viele, viele Themen mitsamt denBetroffenen in die Redaktionen gelaufen kommen. Warum das so sein wird?Eine Aussage, ein Beispiel:Ein Redakteur von „Galileo” sagt, die Pro7-Sendung sei für Forscher undWissenschaftler relevant, weil beide Betroffenengruppen unter aktuellemKürzungsdruck ihrer Ressourcen ihre Themen zunehmend in den Medienstattfinden lassen müssen. Der aus dem politischen Raum stammendeSpruch, „Ohne Phönix is nix”, gilt auch für andere Bereiche.Das Beispiel: „Exclusiv” bei RTL: Uschi Glas, die vielgeprüfte Ex-Ehefrauund Schauspielerin, darf ihre Gesichtscreme ausführlich verteidigen. <strong>Die</strong>Gesichtscreme soll Pusteln verursachen. Uschi Glas sagt, die vielen, vielenKäuferinnen der Uschi-Glas-Produkte können nicht irren. Der Vollständigkeithalber wird auch die Stiftung Warentest befragt, welche die Uschi-Glas-Gesichtscreme getestet hatte. Oder die Wundertüte „Stern TV”, ebenfallsbei RTL. Mitbürger blamieren sich vor der Kamera in Sachen Geografie,eine Frau berichtet über ihre verdrängte Schwangerschaft, Parkplatz-Mieter, Falschparker und die Verkäuferin von Parkkrallen inszenieren denewigen Konflikt ums falsche Parken in Deutschland. Denn inszeniert wirdgerne und viel. Was mich <strong>im</strong>mer noch verblüfft: <strong>Die</strong> offensichtliche133
Bereitschaft so vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, aktiv, freiwillig undoffenherzig ihre Person, ihr Anliegen und ihr Thema <strong>im</strong> Magazinfernsehenauszubreiten. Offensichtlich erscheint vielen <strong>im</strong> Zeitalter der Befriedigungund Sättigung materieller Bedürfnisse die öffentliche Wirkung alswichtiges, vielleicht sogar als das letzte Gut in unserer Gesellschaft. Jetzthaben Sie, meine Leserinnen und Leser, eine Ahnung davon, warum „BigBrother” funktioniert.Wenn sich Mitbürger mit ihren mitmenschlichen Themen offensichtlich sogerne <strong>im</strong> Magazinfernsehen platzieren lassen, kann es bei den eigentlichenThemen auch nicht anders sein. Natürlich weiß ich nicht, welcheThemen abgelehnt wurden und werden, denn ich referiere auf der Grundlagedes gesendeten Materials. Und die allfällige Beobachtung, dass dieÖffentlich-Rechtlichen mehr über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,über die Trias Mensch/Welt/Natur berichten als Privatsender, dass diePrivaten mehr Human-Touch-Themen <strong>im</strong> Programm haben, dass keinervon beiden den Sport zum Magazin-Thema n<strong>im</strong>mt, diese Beobachtunghabe ich auch gemacht.16. Können Betroffene ihre Themen in den Magazinen gut platzieren?Sie können. Ich hatte eingangs davon gesprochen, dass die „Kulturzeit”bei 3sat sich als Community-Sendung versteht. Vom Fernsehkulturschaffendenfür den Theaterschaffenden etc. pp. Umgekehrt speist die Communitydie Sendung.Also: Deutscher PEN ruft Moslems auf, sich aktiv gegen Terrorismus auszusprechen;Stiftung Kulturfonds warnt vor Schließung wichtigerKulturinstitutionen;Harry Rowohlt, Peter Handke und andere Schriftstellerfordern die Leipziger Buchmesse auf, die Bundeswehr nicht mehr zurMesse einzuladen.Ob die Magazinmacher <strong>im</strong>mer überblicken, welche raffinierten Popularisierungskonzepteoftmals hinter der Platzierung von Themen stecken?Oft ist es doch so: Schon längst bekannte Themen und existente Thesenwerden über die massenmediale Rekonstruktion wieder in die öffentlicheKommunikation eingeführt.Schnitt – „Exclusiv”: Uschi Glas darf ihre Pusteln verursachende Gesichtscremeausführlich verteidigen. Wir sprachen bereits davon.Mein Eindruck ist: <strong>Die</strong> Magazine haben einen unglaublichen Themen-Hunger, den zu stillen nicht leicht ist. Weshalb Mitbürger mit mitmenschlichenThemen herzlich willkommen sind. Aber bitte unter derPrämisse: Jedes Skandalönchen gibt’n Tönchen. Wie sonst auch soll das134
Wegzappen verhindert werden? Fernsehen, Magazin-Fernsehen ist <strong>im</strong>meraufgeregt, damit der Zuschauer angeregt wird.17. Der gewonnene Reichtum an Themen gehteinher mit einer speziellen Armut der ThemenSoll heißen, das Magazin-Fernsehen tritt in den Lebenszyklus einesThemas spät ein. Themen erlangen ihre Relevanz nicht durch das Fernsehen,sondern gelangen erst ins Fernsehen, wenn sie bereits Relevanzbesitzen. Das bedeutet auch: Der Mainstream der Themen wird durch den„Wiederkäuerjournalismus” und die Recherchefaulheit ebenso befördertwie das permanente Recyclen von Themen. Zudem wird der Verfallsprozesseines Themas vom Magazin-Fernsehen enorm beschleunigt.Aus der „Fit for Fun TV”-Redaktion hört man, die Betroffenen aus derWellness- und Fitness-Industrie wollten schon sehr gezielt ihre Produkteuntergebracht bekommen, da gebe es manchmal Konflikte mit dem journalistischenHandwerk. In der Ausgabe vom 28. März 2004 gibt es einenGeschmackstest folgender Soja-Produkte: „Alpro-Soja” – der entsprechendeTV-Spot wird <strong>im</strong> Ganzen gezeigt – „Provamel”, „Grüner Hof”, „Taifun”, „Dr.Ritter” und anderer.Zusammenfassend muss ich sagen: So sehr ich bei meinem Thema überdie Relevanz der Magazine graben und grübeln musste, so einfach wardie Aufgabe zu erkennen, wie relevant viele, sehr viele und zu vieleMagazine für die Produkthersteller <strong>im</strong> Lande sind. Sie sind es.<strong>Die</strong> Relevanz der Magazine: Gibt es zum guten Schluss so etwa wieeinen Relevanzmesser? Für mich gibt es ihn. Er ist ziemlich objektiv. Esist das „Zitaten-Ranking” des Medien-Tenors. Was war 2003 das meistzitierteMedium in Deutschland? 1. „Spiegel”. 2. „Bild”. 3. „Focus”. 4. „Bildam Sonntag”. 5. „Welt am Sonntag”. 6. „Berliner Zeitung”. 7. „Der Tagesspiegel”.8. „Süddeutsche Zeitung”. Und dann auf Rang neun das ersteelektronische Medium: Das ZDF. <strong>Die</strong> Magazine <strong>im</strong> deutschen Fernsehensind aus vielerlei Gründen relevant – aber sind sie relevant? Warum gibtes sie nun, die Magazine <strong>im</strong> deutschen Fernsehen? Eine Studie sagt, dassZapper nach sechs, sieben Minuten wieder dort ankommen, wo sie mitdem Zappen gestartet haben. Für die Magazine brillant. Der Zapper landetwieder be<strong>im</strong> Magazin und sieht doch ein ganz neues Fernsehen. NeueBetroffene, neues Thema, neues Interesse. Für wen ist deswegen dasMagazin <strong>im</strong> deutschen Fernsehen relevant? Für den Zapper. Also für unsalle.135
136MEDIENPROMINENZ ALSGESELLSCHAFTLICHER SPIEGEL?Ein kulturkritischer Diskussionsbeitrag zurBoulevardisierung der MassenmedienDr. Ulrich F. Schneider<strong>Die</strong> Akteure verantwortlichen HandelnsFordert man in Zusammenhang mit den Medien ethisches und moralischesVerhalten, so trifft dies zunächst auf breiten Zuspruch. Meist heißt esdann, solchen Fragestellungen müsse eine viel stärkere Bedeutung beigemessenwerden. Wird es dann konkret, zerrinnt dieser Konsens. Denndas als notwendig erachtete verantwortungsvolle Handeln <strong>im</strong> Spiel umdie Prominenz bezieht sich in der Regel ausschließlich auf die Anderen,obwohl alle daran beteiligt sind: <strong>Die</strong> Medienschaffenden ziehen sich aufihre Vermittlerrolle mit dem Hinweis zurück, dass die Verantwortung desin den Medien Stattfindenden bei den Rezipienten liege – schließlichkönne man nur das anbieten, was die Abnehmer verlangen. <strong>Die</strong> Rezipientenargumentieren hingegen, sie würden das Gesehene nur deshalbsehen, weil die Medien nichts anderes böten. <strong>Die</strong> Prominenten wiederumsehen sich in einer Opferrolle den Medien hilflos ausgeliefert. Resigniertstellte etwa Roy Black 1991 fest: „Ich war eine Marionette. Wer ichwirklich war, hat niemand interessiert”. (ARD-Homepage 2002) BemerkenswerterWeise werden derartige Stereotypen häufig auch von denMedien selbst bedient, man denke an die Berichterstattung über LadyDiana oder die Behauptung von Angehörigen, die Krebserkrankung undder Tod des Schauspielers Klaus Löwitsch stünden indirekt mit der negativenMedienberichterstattung und ihren Folgen in Zusammenhang. In derTitelgeschichte „Was ihn wirklich umbrachte” behauptete die Witwe:„ ...die ganze Wahrheit ist, dass ihn der Prozess umgebracht hat. DerProzess, in dem eine Frau behauptet hat, er hätte sie sexuell genötigt.Da hat man ihm die Würde, die Ehre und den Stolz geraubt. Der Kummerüber die Lügen brachte den Krebs zum Ausbruch.” (NEUE REVUE 12/2002).Der Sonderstatus und seine KonsequenzenZwangsläufig kommt es bei den Personen des öffentlichen Lebens zueiner Veränderung des Verhältnisses zwischen dem Individuum und der
Gesellschaft: Der Prominente ragt durch seine mediale Existenz aus derGesellschaft heraus, ist <strong>im</strong> Vergleich zu allen anderen nicht ‘normal’ unddaher per se ungewöhnlich. Allein dieser Umstand macht ihn bereitsinteressant und für manchen auch beneidenswert. <strong>Die</strong> Einbeziehung persönlicherund privater Belange in die öffentliche Erscheinung einesProminenten – sei diese durch die Medien motiviert oder den Prominentenselbst – bedeutet, dass diese Informationen nicht mehr dessen reinePrivatangelegenheit bleiben können. Hier muss der Prominente eineSozialbindung seiner Privatheit akzeptieren: <strong>Die</strong>se wird mit ihrer Veröffentlichungzu einem Gegenstand, welcher der Öffentlichkeit als Diskussionsstoffdient und vom Einzelnen als Fixpunkt gesellschaftlicherOrientierung genutzt werden kann. <strong>Die</strong> thematisch nicht begrenzten Einblickein das Leben von Personen des öffentlichen Lebens können somitals exemplarisches Anschauungsmaterial dienen, an Hand dessen sichAblehnung oder Zust<strong>im</strong>mung zu bilden vermag.Der Prominente wird zu einem Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung,zu einer modellhaften Person und damit zum Objekt der Gesellschaft.Anschaulich bringt dies der englische Schauspieler Stephen FRYzum Ausdruck: „Prominenz macht angreifbar. Manchmal komme ich mirvor wie öffentliches Eigentum, das ständig von der Außenwelt untereinem Mikroskop betrachtet wird.” (FR 05/2003)Prominenz als Instrument sozialer Selbstverwirklichung<strong>Die</strong> Widersprüchlichkeit eines öffentlichen Lebens liegt in der paradoxenSonderstellung inmitten der Gesellschaft: Prominente sind <strong>im</strong> Mittelpunktstehende Außenseiter. Waren sie dies nicht bereits zuvor, sowerden sie dies spätestens durch ihren Prominentenstatus. Als weiteresParadoxon kommt hinzu, dass viele Personen des öffentlichen Lebensdiese ambivalente Prominenz-Situation nicht nur als Nebeneffekt ihrerTätigkeit dulden, sondern geradezu als Verwirklichung ihrer selbst anstreben:„Prominenz ist eine Form gesellschaftlicher Anerkennung oder Schwärmerei– eine Art von Zuwendung, die in der Kindheit zu kurz gekommenist. (...) Auch wenn ich es mir gern gefallen lasse, umschwärmt undgemocht zu werden, bin ich nicht <strong>im</strong>mun gegen die Reaktion der Menschen,die mich umgeben (...) Gleichzeitig wollte ich auch anders sein,einzigartig und auf Distanz zu den Anderen. Ein Außenseiter, der sich aufniemanden wirklich einlässt. (...) Andererseits ist man stolz auf das, waseinen aus der gewöhnlichen Masse hervorhebt und wie ein göttlicher137
138Sch<strong>im</strong>mer unterscheidet vom gewöhnlichen, durchschnittlichen Menschen.<strong>Die</strong>se doppelte Energie ist ebenso widersprüchlich wie sie fruchtbar ist.”(FR 05/2003).<strong>Die</strong>s bedeutet <strong>im</strong> Vergleich zum Nichtprominenten, dass durch die massenhafteBezugnahme vieler Menschen der Prominente einerseits alshochsozial erscheint, da er in die Gesellschaft wie kein anderer integriertist, anderseits wiederum asozial, weil er auf seine Umgebung nicht mehrsozialadäquat reagieren kann: Ein nicht abgestuftes Int<strong>im</strong>itätsverhalten,das weder situativ noch personell differenziert gegenüber Anderen inder sozialen Umgebung geleistet wird, stufen Psychologen bei nichtprominentenMenschen als pathologische Störung ein.Betrachtet man in den Worten von Paul Sahner „einen intensiven Darstellungsdrang,eine richtige Sucht nach Öffentlichkeit,” (MAX 12/2002)als mögliche Gemeinsamkeit aller Prominenten so sind mit Prominentenauch hier gleichzeitig sozial negative Eigenschaften verbunden. Über dieSelbstbezogenheit von Marlene <strong>Die</strong>trich heißt es etwa, ihr Lieblingsthemasei sie selbst gewesen (HEINZELMEIER 2000: Marlene). Im Widerspruchzu diesem als negativ beschriebenen Geltungsdrang handelt essich aber wiederum um Eigenschaften, die in der heutigen Gesellschaftals Erfolgsfaktoren gelten: Etwa Selbstbezogenheit und die FähigkeitEllenbogen zu gebrauchen. In diesem Sinn ist Prominenz ein zweischneidigesPhänomen. UHLENBRUCK konstatiert „Um sich selbst ins richtigeLicht setzen zu können, muss man die anderen in den Schatten stellen.”(Duden 2002: Zitate und Aussprüche).Umgekehrt kann wiederum das Nach-Außen-Gekehrtsein zum Problemwerden, wenn etwa das erfolgreich etablierte Image zur Hypothek wird.Der Fernsehmoderator Robert LEMBKE stellte einmal fest: „Image isteine maßgeschneiderte Zwangsjacke”. (Duden 2002: Zitate und Aussprüche)Eine besondere Tragik eines verfestigten Images kann auch ineinem inneren Zwang des Prominenten liegen. Obwohl Marlene <strong>Die</strong>triches stets verstanden hatte, sich öffentlich zu inszenieren und dabei einerstaunliches Geschick bewies, ihre Privatheit aus der Öffentlichkeit herauszu halten, wurde sie zum Opfer der von ihr gepflegten und glorifiziertenSchönheit. Sie zahlte für ihre Prominenz einen hohen Preis,indem sie sich – unter der Aufrechterhaltung ihrer selbst geschaffenenöffentlichen Person – nicht mehr aus diesem Korsett befreien konnte undletztlich zur Eremitin <strong>im</strong> eigenen Image wurde. Nach ihrem Rückzug ausder massenmedialen Öffentlichkeit mied sie bis zu ihrem Tod selbst diebegrenzte Öffentlichkeit der Straße.Das vielfach narzisstisch geprägte Verhältnis des Prominenten zur
Öffentlichkeit ist um so komplizierter, als es auf der Seite der Rezipientenebenfalls auf narzisstische Bedürfnisse trifft. Im Grunde ist das persönlichmassenhaft entgegengebrachte Interesse an der Persönlichkeit einesProminenten <strong>im</strong> Ergebnis unpersönlich, denn der Betrachter möchte sich<strong>im</strong> Spiegel des Prominenten in erster Linie selbst betrachten. Eine professionelleEinstellung eines Prominenten gegenüber seinem Prominentseinmuss in den Worten von FRISCH darin bestehen, seine Prominenznicht mehr so persönlich zu nehmen:„Der Name, den er bei seiner Geburt bekommen und ein Leben lang alsUnterschrift verwendet hat, bezeichnet eine öffentliche Wirkung und hatsich von der Person abgelöst. Das muß er lernen, wenn er es nicht lernt,so verletzt er sich unentwegt. Ruhm bewirkt nicht Einstellung der Kritik, nurwird erwartet, dass Kritik nicht mehr persönlich treffe, und das zu Recht,denn es wird Kritik nicht an einer Person und ihrer Arbeit, sondern amRuhm. <strong>Die</strong> Gesellschaft braucht Berühmtheiten; wen sucht sie sich dafüraus? Kritik wird zur Kritik an der Gesellschaft.” (FRISCH 2002: Montauk).Es ist sicherlich nicht einfach, mit den aufgrund des Prominentendaseinsveränderten Mechanismen des sozialen Bezugs zur Umwelt zurecht zukommen. Insbesondere dann nicht, wenn man wie Alice SCHWARZERfeststellt, dass das eigene Verletzbarkeitsempfinden <strong>im</strong> Laufe der Zeitnicht ab-, sondern weiter zun<strong>im</strong>mt:„Ich werde ja <strong>im</strong>mer wieder gefragt, ich müsste das doch eigentlich jetztgewohnt sein – fast 30 Jahre öffentliche Frau – und das würde mir dochbest<strong>im</strong>mt nicht mehr so viel ausmachen. In der Tat ist das Gegenteil derFall: Man versteht <strong>im</strong>mer mehr, man sieht <strong>im</strong>mer mehr und in Wahrheitwird man eben <strong>im</strong>mer dünnhäutiger.” (ARTE 12/2002).Prominenz als Spiegel der zeitgenössischen KulturFür den gegenwärtig dominierenden Prominenzbegriff reicht das Überschreiteneiner best<strong>im</strong>mten zahlenmäßigen Bekanntheitsschwelle fürdas Eintreten in den Prominentenstatus aus, eine weitere Differenzierungfindet nicht statt. Prominenz beschränkt sich in dieser Definition aufeine Frage des Dazugehörens, des sich Abgrenzens von den Nicht-Prominenten.Im Unterschied zu den Eliten befindet nicht der Kreis derProminenten über die Aufnahme oder das Ausscheiden aus dieser Kategorie,sondern sie vollzieht sich alleine dadurch, dass man sich durchdas Gekanntwerden von den Normalbürgern abhebt. Bekanntheit istzudem nicht zwingend an Leistungen gebunden, sie kann <strong>im</strong> Gegenteilauch auf eigenes Unvermögen oder negativen Empfindungen beruhen.139
Demokratietheoretisch gesehen ist es prinzipiell zu begrüßen, dass esfür den Prominenzgrad völlig unerheblich ist, wem diese Prominentenbekannt sind, denn jeder Aufmerksame hat ein gleiches St<strong>im</strong>mrecht –vom Hilfsarbeiter bis hin zum Gelehrten.Eine unreflektierte Verherrlichung best<strong>im</strong>mter Personen oder des Prominentenstatus<strong>im</strong> Allgemeinen kann aber zu einer bedenklichen Situationführen. So kann Prominenz unter dem Deckmantel allgemeinwohl-orientierterBelange für die Instrumentalisierung von Partikularinteressengenutzt werden. Ein derart anbetungsvolles und affirmatives Verhältnisder Gesellschaft zur Prominenz wird zudem durch das gegenwärtig herrschendeGeltungskriterium der ‘Bekanntheitsgrad-Prominenz’ begünstigt:Einer Prominenz, die sich am Ergebnis medialer Präsenz orientiert undkaum noch nach den Gründen ihrer Entstehung fragt. Wenn sich dieLegit<strong>im</strong>ation der Prominenz auf die Höhe des Bekanntheitsgrades in derBevölkerung beschränkt – dies ist nämlich nur ein mögliches Prominenzkriterium– dann unterscheiden sich die Prominenten nur noch in derSumme ihres zahlenmäßigen Gekanntwerdens in der breiten Öffentlichkeit:Es existieren dann lediglich jene Personen, die weniger prominentsind und diejenigen, die prominenter sind als andere. Wenn das quan-140
titative Element zum alleinigen Erfolgskriterium erhoben wird und damitfachliche Erwägungen verdrängt werden, dann wird Prominenz zu einemErfolgsfaktor, der sich vornehmlich an werblichen Kriterien orientiert.Hinter dem heiklen und oft tabuisierten Thema der professionalisiertenOrganisation und Darstellung eines Prominenten, mittels darauf spezialisierterHelfershelfer, verbirgt sich die latente Forderung der Gesellschaft,ein öffentlicher Akteur solle aus freien Stücken und aus eigenerKraft öffentlich zu dem werden, was er bereits vor seinem Bekanntwerdensei: ein <strong>im</strong> Vergleich zu seinen Fachkollegen herausragender undfähiger Mensch, der infolgedessen die Anerkennung und das Vertrauender breiten Öffentlichkeit verdient. <strong>Die</strong>ser Glaube an Prominenz wird solange aufrechterhalten, wie nur möglich. Kann dieser Anschein aufgrundvon bekanntwerdenden Informationen nicht mehr gewahrt werden, distanzierensich meist alle Beteiligten. Dahinter steht die kaum öffentlichdiskutierte Frage, inwieweit eine Gesellschaft bei den Personen desöffentlichen Lebens, aufgrund der käuflich erwerbbaren Hilfestellung beider Prominenzierung, einen heute nicht mehr freien Wettbewerb derKöpfe zu akzeptieren bereit ist.Prominenz als einträglicher BerufDer Stellenwert der kommerziellen D<strong>im</strong>ension der Prominenz hat sich <strong>im</strong>Zeitverlauf gravierend verändert. Während etwa bei den Werbeauftrittender prominenten Test<strong>im</strong>onials ehemals lediglich der Zeitaufwand für dieHerstellung des Werbemittels vergütet wurde, zahlen die Unternehmenheute eine Art Lizenzgebühr für die Nutzung einer Prominenzmarke.Berücksicht man die entwickelte These, die Werbung mit Prominentenführe aus Sicht dieser Personen zu einer dreifachen Entlohnung – bei derüber das gezahlte Honorar hinaus Einnahmen in Form von quantitativenund qualitativen prominenzfördernden Effekten realisiert werden können –dann erscheinen die ohnehin astronomischen Höhen dieser Honorare umso mehr als unangemessen. Angesichts der horrenden Einnahmemöglichkeitendurch die Kommerzialisierung des Prominentenstatus liefert dieRolle der Nebeneinnahmen Prominenter einen Schlüssel zur Erklärungihres öffentlichen Verhaltens. <strong>Die</strong> Erhaltung und der Ausbau des Prominentenstatuskann daher aus finanzieller Sicht wichtiger sein als dieeigentliche Tätigkeit, deren Folge Prominenz ist.<strong>Die</strong> Rolle der Nebentätigkeit, die einst zu einer Nebeneinnahme führte,hat sich in diesem Fall verkehrt: Im Ergebnis wird dann die Haupttätigkeitfinanziell zur Nebentätigkeit und umgekehrt die Nebentätigkeit141
zur Haupttätigkeit des Wirkens einer Person des öffentlichen Lebens.<strong>Die</strong>s trägt zu der Situation bei, dass in der gegenwärtigen Gesellschaftkaum eine Tätigkeit finanziell annähernd so üppig honoriert wird, wie dasProminentendasein. In Konkurrenz stehen hier allenfalls die in den Augender Öffentlichkeit als nicht gerechtfertigt geltenden Gehälter und Abfindungenvon leitenden Führungskräften der Wirtschaft. Prominenz, die sichin der Vergangenheit aus der Sicht eines öffentlichen Akteurs vielfach alsein Nebenprodukt eines gesellschaftlich relevanten Handelns vollzog,wird heute zunehmend durch ein egozentrisches öffentliches Handeln verdrängt,das viele in der Gesellschaft interessiert beobachten und auf dieseWeise nicht nur legit<strong>im</strong>ieren, sondern paradoxerweise erst ermöglichen.Prominenz und die Boulevardisierung der QualitätspresseIn den letzten Jahren haben die Qualitätsmedien ihr Angebot in RichtungBoulevard- und Prominenzthemen ausgeweitet und dafür institutionellePlattformen geschaffen. Dass derartige Themen von der Qualitätspresseals relevant erachtet werden, ist keine Selbstverständlichkeit, sonderneine journalistisch getroffene Wertentscheidung. Der BundestagspräsidentWolfgang THIERSE konstatiert:„<strong>Die</strong> Suggestion ist, dass die neue Freundin von Boris Becker oderOliver Kahn genau so wichtig ist, wie eine vorgezogene Steuersenkungoder der Angriff von Rechtsextremisten gegen einen ihnen fremderscheinenden Passanten. Dass es um die Unterscheidung zwischenwichtig und unwichtig <strong>im</strong>mer seltener geht, erkennt man auch daran,dass in den Redaktionen nicht mehr so häufig wie früher gestritten wird,was in welcher Länge an welcher Stelle der Zeitung stehen soll odergesendet wird.” (FR 11/2003).Der Hintergrund dieser Entwicklung ist in den Worten von KURBJUWEITin der „Diktatur der Ökonomie” zu suchen, welche aus dem Wirtschaftssystemin alle Gesellschaftsbereiche diffundiert. (KURBJUWEIT 2003: Unsereffizientes Leben) Respektiert man diese Entscheidung, so wiegt dennochein weiterer Punkt schwer: <strong>Die</strong> Erkenntnisse der Studie „Januskopf derProminenz” (Schneider 2004) deuten auf ein beträchtliches Defizit derQualitätspresse <strong>im</strong> Bereich der Boulevard- und Prominentenberichterstattunghin. Derartige Themen werden mitbedient, ohne dass hierfür diegleichen Qualitätskriterien wie in anderen Ressorts Anwendung finden.Im krassen Gegensatz zu den eigenen Qualitätsmaßstäben – man denkeetwa an die F.A.Z. und ihre realisierten Gütekriterien in ihrem Wirt-142
schaftsteil – betätigen sich die Qualitätsmedien <strong>im</strong> Bereich der Prominentenberichterstattungüberwiegend als Resteverwerter der Boulevardmedien:<strong>Die</strong>s geschieht, indem sie deren Veröffentlichungen lediglichzitierend zweitpräsentieren oder derartige Informationen direkt vonNachrichtenagenturen beziehen. In beiden Fällen unterbleiben in derRegel eigene Recherchen oder das Hinzufügen kritischer Kommentare.Man gibt derartigen Themen einen Raum, bedient sich zum Teil ungeprüftzweifelhafter Quellen und veröffentlicht meist eine abgestandeneInformationsware aus zweiter Hand. In diesem journalistischen Genrebeanspruchen die Qualitätsmedien <strong>im</strong> Ergebnis keine Vorreiterrolle, sondernsie bilden hier das qualitative Schlusslicht.Eine Ursache für diesen Missstand könnte darin liegen, dass es in derVergangenheit bei der Besetzung dieser neuen Themenschwerpunkteund Ressorts <strong>im</strong> Bereich des Boulevards und der Prominenz offenkundigversäumt wurde, die vorhandenen Budgets aufzustocken. Will man dergegenwärtig schwierigen Situation auf dem Medienmarkt künftig durcheine Rückbesinnung auf die inhaltliche Qualität mittels der Focussierungauf die Kernkompetenzen begegnen, wie es das ZDF auf den MainzerTagen der Fernsehkritik 2003 ankündigte, so können daraus zwei entgegengesetzteKonsequenzen gezogen werden. Entweder muss die erfolgteAngebotsausweitung in den Qualitätsmedien wieder revidiertwerden, oder es müssen unter der drastischen Ausweitung der Boulevard-Budgets andere Ressorts für eine Einschränkung herhalten.Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen sollten sich Journalisten inBezug auf Prominente einerseits mehr in der „Kunst des Wegsehens”üben (GERHARDT/STEFFEN 2001: Kleiner Knigge des Presserechts).Schließlich liegt die Definition des <strong>Publikation</strong>srelevanten zunächst prinzipiellin ihrer Hand, sie können der vielbeklagten Boulevardisierungund Veröffentlichung des Privaten begegnen. Seriöse Medien sollten essich daher zum Grundsatz machen, über das Private eines Prominenten<strong>im</strong> Rahmen einer eigenständigen Meldung etwa nur dann zu berichten,wenn diese Information in einem konkreten Zusammenhang mit dessenöffentlichem Wirken steht, eine stark gesellschaftlich bedeutende Informationerhält und sich folglich <strong>im</strong> Ergebnis nicht <strong>im</strong> reinen Nachrichtenwert‘Prominenz’ erschöpft.Andererseits sollten Journalisten <strong>im</strong> Bereich des Prominentenjournalismuskünftig stärker die ‘Kunst des Hinsehens’ praktizieren. Denn die Kritikfreiheitder Medien muss auch <strong>im</strong> Rahmen der Berichterstattung überProminente zur Anwendung kommen. Sonst verfehlen die Medien in diesemjournalistischen Genre ihren Informationsauftrag und ihr Wächteramt. An-143
144dernfalls agieren die Journalisten erstens – statt als Lieferanten eines wirklichkeitsgetreuenAbbilds <strong>im</strong> Sinne einer Vielst<strong>im</strong>migkeit der präsentiertenMeinungen über eine Person des öffentlichen Lebens und nicht zuletztihrer kritischen Kommentierung – als Hofberichterstatter der Prominenz.Noch bedenklichere Gefahren ergeben sich zweitens in Hinblick auf diePublic Relations Maßnahmen der Wirtschaft. Denn auch hier eröffnet der‘Nachrichtenwert Prominenz’ lukrative Beachtungschancen.<strong>Die</strong> Schwierigkeit des sich Enthaltens einer sich <strong>im</strong> Prominenzaspekterschöpfenden Medienpräsenz liegt in der sogenannten ‘win to win’ Konstellationfür drei Beteiligte: (a) Für die Medien kann die durch Prominentegenerierte Aufmerksamkeit als Selbstzweck in Form von wertvollenWerbeumfeldern weiterverkauft werden, (b) für die Prominenten selbststeigert die Medienpräsenz <strong>im</strong> Zirkelschluss ihren Prominenzwert und(c) für Unternehmen, die sich kommunikativ an Prominenten koppeln,öffnet sich der begehrte redaktionelle Medienbereich.Der Prominente kann als eigenes Medium verstanden werden, das alsQuerschnittsmedium in alle anderen Medien hineinreicht. Wer den Zugangzum Prominenten schafft, der gelangt damit automatisch in zahlreicheMedien. Hier setzen die Bemühungen der PR-Industrie an. Denn auch dieQualitätspresse ist durchaus bereit, einer Unterhosenfirma einen ganzseitigenArtikel mit Farbfotografien zu widmen, wenn es sich angeblichum die Kultunterhosenmarke der Prominenz handelt. Unter der bezeichnendenÜberschrift „Erfolg unter der Gürtellinie” heißt es dann etwa,„Wahrscheinlich sitzt auch Milosevic in Z<strong>im</strong>merlis vor seinen Richtern.”(ZEIT 01/2003) Aus journalistisch-fachlicher Sicht nicht veröffentlichungswürdigeInformationen, finden über das Vehikel eines Prominenten dochnoch den Weg in die redaktionelle Medienberichterstattung.<strong>Die</strong>s wusste auch die PR-Agentur ECC Kothes & Klewes GmbH ausFrankfurt in der BSE-Krise zu nutzen. Für den Gelatine Verband präpariertesie die Leichtathletin Heike Drechsler als Medienthema. In zahlreichenFrauenzeitschriften und Gesellschaftsmagazinen – zum Teil handelte es sichum exklusive Medienkooperationen und Homestories – konnte sich dieÖffentlichkeit vom Gesundheitsaspekt der Gelatine und dem angeblichauf Gelatine beruhenden Erfolgsrezept der Sportlerin überzeugen.(Agenturvortrag 4/2003 für DPRG) Das ZDF etwa präsentiert auf seinerHomepage als Rezept „Heike Drechslers Gelatine-Drink Selektion”. Im„ZDF-online-Interview” betont die Sportlerin <strong>im</strong> letzten Absatz die Wichtigkeitder körperlichen Fitness und Knochenpflege: „Ich tue dies mit demhochwertigen Eiweiß Gelatine. Gelatine enthält wichtige Aminosäuren,die eine positive Wirkung auf Knochen, Gelenke, Sehnen und Bänder
haben.” <strong>Die</strong> zugehörigen Fotografien stammen allesamt von der Agentur.(ZDF-Homepage 05/2003) <strong>Die</strong> Wirkung der Kampagne zeigt sich auchin ihrer Anerkennung mit dem Deutschen PR-Preis 2002 in Gold in derKategorie Kommunikationsmanagement sowie dem Golden World Awardder IPRA (International Public Relations Association). Ein anderes Beispielist die doppelseitige Promotion der „Jahrhundertgeigerin” Hilary Hahnin einer Qualitätstageszeitung. <strong>Die</strong> überd<strong>im</strong>ensionalen Farbfotografiensind deckungsgleich mit dem Cover der neu erschienen CD. (FR 10/2003)Das Prominentenrecht auf dem PrüfstandWer sich in das Licht der Medienöffentlichkeit begibt oder gerät und dortdauerhaft präsent ist, muss per se Einschränkungen seiner Privatheithinnehmen, die zudem durch unbesonnenes Verhalten eine deutlicheAusweitung erfahren können, ohne dass man sich dagegen auf juristischemWeg wehren kann. Speziell <strong>im</strong> Hinblick auf Prominente wäre darüberhinaus eine Korrektur der rechtlichen Situation in zweifacherRichtung wünschenswert: <strong>Die</strong> Veröffentlichungsregelung in der Sozialsphärekönnte erstens vom Grundsatz her zu Gunsten der Prominentennach französischem Recht angepasst werden. <strong>Die</strong>s hätte keineswegs zurFolge, dass alltägliche Verrichtungen prominenter Persönlichkeiten nichtmehr bildlich gezeigt werden dürften. Man könnte diese aber denBetroffenen nicht mehr gegen ihren erklärten Willen aufdrängen. Gleichzeitigwürde man damit auch ein Signal setzen für die grundsätzlicheVerortung des öffentlichen Diskurses jenseits profaner Alltäglichkeiten.Darüber hinaus muss man sich bei einer derartigen Veränderung dergegenwärtigen juristischen Spielregeln <strong>im</strong> Klaren darüber sein, dasshierdurch spürbare wirtschaftliche Einschnitte <strong>im</strong> gesamten Yellow-PressMarkt zu erwarten wären.Entscheidet man sich für die <strong>im</strong> „Januskopf der Prominenz” (Schneider2004) als sinnvoll erachtete und vertretene Verschärfung des PrivatheitsschutzesProminenter, sollte dies aber zweitens gleichzeitig in Kombinationmit einer Lockerung der Berichterstattungsfreiheit der Medien verbundenwerden. Denn bei der Veröffentlichung des Privaten von Prominentensollte man verstärkt die zweite Seite der Medaille mitberücksichtigen:<strong>Die</strong> veröffentlichte Privatheit Prominenter, diese vielbeklagte Durchdringungdes öffentlichen Raums mit höchst persönlichen Belangen, liegtgegenwärtig – anders als vielfach behauptet – verstärkt <strong>im</strong> Verhalten derProminenten. <strong>Die</strong> Urheberschaft einer solchen Entwicklung ist nur zumTeil durch die Medien gegen den Willen der Prominenten initiiert, sie liegt145
mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar in der überwiegenden Mehrzahlder Fälle auf Seiten der Prominenten selbst.Im Ergebnis hieße die hier vorgeschlagene Änderung des ‘Prominentenrechts’,dass man einerseits den Prominenten mehr Autonomie zugesteht,indem man ihnen grundsätzlich einen Bildberichterstattungsschutzihrer Alltagshandlungen zugesteht, gleichzeitig aber die bereitsheute in der Rechtsprechung vorhandene Entkräftung des Persönlichkeitsschutzesnoch stärker anwendet, falls das in die Öffentlichkeit geratenePrivatleben Prominenter eine Folge des eigenen Verhaltens darstellt.Bei Medienprominenten, deren Darstellungsfokus breit angelegt ist, solltedem investigativen Journalismus mehr Handlungsspielraum als gegenwärtigeingeräumt werden.Wie notwendig diese Auseinandersetzung um die Modernisierung desProminentenrechts ist, und um welch schwieriges Unternehmen es sichdabei handelt, kann man an den jüngsten juristischen Kämpfen umCaroline von Monaco erkennen. Der Europäische Gerichtshof hat <strong>im</strong> Juni2004 in einem überraschendem Urteil festgestellt, dass die 1999 durchdas Bundesverfassungsgericht für zulässig erklärten Aufnahmen, welchedie Prinzessin bei alltäglichen Tätigkeiten auf öffentlichem Grund zeigen,ein Verstoß gegen die „Achtung des Privat- und Familienlebens” (gemäßArt 8. EMRK) darstellen. <strong>Die</strong>ses Urteil bedeutet einen radikalen Bruchmit dem bisherigen deutschen Prominentenrecht, dessen Auswirkungengravierende Folgen für die Machtkonstellation zwischen Prominentenund Medien haben dürften. Im Prinzip stellt dieses Urteil einen Schrittin die richtige Richtung dar. Denn sein Dreh- und Angelpunkt liegt in derPostulierung der inhaltlichen Relevanz des Veröffentlichten. Umso mehrwird es künftig aber auch darauf ankommen, die jeweils individuellunterschiedliche Rolle der Privatheit eines Prominenten <strong>im</strong> Kontext seineröffentlichen Darstellung zu bewerten. Denn bei jenen Prominenten,deren Privatleben ein Bestandteil ihres öffentlichen Images bildet, istdamit eine inhaltliche Relevanz durchaus gegeben. Ein Verbot der Berichterstattungüber jene Themen würde nämlich bei diesen Prominenten zuLasten der Pressefreiheit bedeuten, dass man die Presse in die Rollevon Hofberichterstattern zwingt und damit letztlich den SelbstdarstellungsinteressenProminenter ein Monopol verschafft. Ohne das Gegengewichteiner kritischen Fremddarstellung entstünde paradoxer Weisegenau das Gegenteil dessen, was man mit dem neuen Kriterium derinhaltlichen Relevanz zu beabsichtigen behauptet: eine journalistischeBerichterstattung, die der objektiven Wahrheit und der kritischen Ausein-146
andersetzung mit den in der Öffentlichkeit vorhandenen Themen dient.Nur dann ist letztlich der juristisch erforderlichen „Wahrnehmung einesöffentlichen Informationsinteresses” gedient.<strong>Die</strong> Eigenverantwortung Prominenter als unterschätzte GrößeÖffentliche Anerkennung und Bekanntheit sind für den Betroffenen nichtnur eine Belohnung in Form eines materiellen- und <strong>im</strong>materiellen Profits,sondern stellen gleichzeitig an ihn auch höhere Anforderungen hinsichtlichseines sozialen Wirkens. Kompromisslos formuliert dies EBNER-ESCHENBACH: „Wer in die Öffentlichkeit tritt, hat keine Nachsicht zuerwarten und keine zu fordern.” (Duden 2002: Zitate und Aussprüche)<strong>Die</strong> Rolle des eigenen Verhaltens Prominenter sollte daher sowohl in derRechtsprechung als auch in der öffentlichen Diskussion künftig einestärkere Beachtung und Bewertung finden: Denn Prominente tragendurch ihr öffentliches Wirken <strong>im</strong> Vergleich zum Privatmann eine doppelteVerantwortung: gegenüber der Gesellschaft und gegenüber sich selbst.Insbesondere die in der Studie (Schneider 2004) entwickelten Individualisierungsstufender ‘Entertainisierung’, ‘Privatisierung’ und ‘Int<strong>im</strong>isierung’können der Steigerung von Aufmerksamkeitseinkünften dienen.Sie sind seitens der Prominenten Teil eines rationalen Geschäfts. Werjedoch bei diesem Kosten-Nutzen-Verhältnis einseitig auf den Nutzenaspektreflektiert, kann sich unter Umständen schnell verkalkulieren,indem er plötzlich mit Ausgaben konfrontiert wird, die sich in der Bilanzals Verlustgeschäft herausstellen können. In der Tat bedeutet die Popularisierungzur Herstellung und zum Erhalt ihres Prominentenstatus fürdie Prominenten eine schwierige Gratwanderung. <strong>Die</strong> MedienprominenteDolly BUSTER stellt zum Spiel mit den Medien fest: „Weder auf diedamit verbundenen Vorteile, noch auf die Nachteile kann man sich vorbereiten(...) Dazu gehört auch der Umgang mit der Presse. Sie kanndein Glück wie dein Verderben sein.” (BUSTER 2000: Alles echt).Prominente, die ihr Privatleben oder gar Int<strong>im</strong>leben selbst preisgeben,verlieren ihre „informationelle Privatheit” <strong>im</strong> Sinne von RÖSSLER, das heißtdie Möglichkeit, ein Wissen nicht oder nach Personen abgestuft mitzuteilen.Sie enteignen sich damit ihres Rechts auf eine kontrollierte Selbstöffnung,wie sie prinzipiell jedem Menschen zusteht. <strong>Die</strong>se Gehe<strong>im</strong>nislosigkeitproduziert <strong>im</strong> Sinn von SIMMEL keine Nähe, sondern Einsamkeit,da für den Prominenten aufgrund dieser Differenz- und Distanzlosigkeitkaum mehr Int<strong>im</strong>ität mit anderen Menschen möglich wird. Sicher liegt hierein Schlüssel für die vielfach von Prominenen, beklagte Vereinsamung.147
Hinzu kommt der Verlust <strong>im</strong> Sinne der sogenannten „dezisionalen Privatheit”(RÖSSLER 2001: Der Wert des Privaten), einem Recht auf Nichteinmischunggegenüber öffentlich gezeigten und für andere sichtbarenHandlungen, die ein Ausdruck der eigenen Privatheit darstellen. BeiProminenten werden diese Alltagshandlungen nicht nur von den Anwesendenkommentiert, sondern durch technische Hilfsmittel in die massenmedialeÖffentlichkeit getragen und dort moralisch diskutiert. So musssich etwa Michael Schumacher, angesichts des Todes seiner Mutter, dieprivate Frage in Bezug auf seine Berufsausübung gefallen lassen: „Wares richtig zu starten?” (Bild 04/2003)<strong>Die</strong> zunehmende Medientauglichkeit und -kompetenz der Menschen führtzu einer veränderten Form der Partizipation am öffentlichen Geschehen:Aus den Reihen der Rezipienten heraus findet eine aktive Teilnahme aufder medialen Bühne statt (Talkshows, Reality-Soaps und Castingshows).Insbesondere bei den ‘Jedermann-Prominenten’ stellt sich daher dieFrage, inwieweit diese vor ihrem Geltungsdrang und ihrer Bereitschaftzur Selbstentblößung geschützt werden müssen. Hier ist sicher einerseitsein neues Verantwortungsbewusstsein auf Seiten der Medientreibendenerforderlich, das bislang in nur unzureichendem Maße entwickelt wordenist und noch der Herausarbeitung einer speziellen Ethik bedarf.Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die vielfach festgestellte steigendeMedienkompetenz der Rezipienten gleichzeitig auch hier eineVerantwortung gegenüber sich selbst nicht ausschließen darf. <strong>Die</strong>serschwierigen Anforderung an die Professionalisierung, die allerdings gegenwärtigselbst von den Prominenten vielfach nur unzureichend beherrschtwird, muss künftig mehr Gewicht beigemessen werden.Keinesfalls darf die allgemein gestiegene Bereitschaft der Selbstentblößungdurch die Medien als konventionell definierte Grenze gehandhabtwerden: Bei der Veröffentlichung prinzipiell geschützter, aber durch eigenesVerhalten einbeziehbarer Bereiche, dürfen in der Veröffentlichungspraxisdie Grenzen nicht eigenmächtig von den Medien angepasst werden,so wie dies etwa der ehemalige Chefredakteur von BUNTE HansJosef Wagner praktiziert, wenn er behauptet, die Grenze der Zulässigkeitläge dort, wo es weh tue. Denn in Bezug auf eine an diesem Maßstabgemessene legit<strong>im</strong>e Fotoveröffentlichung gelangt er schließlich zu derEinschätzung: „ein schöner Busen tut nicht weh”. (F.A.Z. 1/1994)<strong>Die</strong> ausschlaggebende Größe kann hingegen nur der Einzelfall bilden.Eine Verletzung ist <strong>im</strong>mer individueller Natur, jeder muss für sich ent-148
scheiden, wie empfindlich er ist und er hat sein Verhalten daraufhin auszurichten.<strong>Die</strong>s beginnt mit dem Betreten best<strong>im</strong>mter ‘Bühnen’ und‘Börsen’ und endet mit der Instrumentalisierung der eigenen ‘Individualisierungsgrade’.Auch dann kann es einmal eine Übertretung geben,indem diese selbstgewählte Grenze überschritten wird. Im Regelfall wirddas eigene zurückhaltende Verhalten hingegen einen verlässlichen Schutzermöglichen. Weitaus problematischer ist, dass Prominente sich der mittelfristigenHandlungsspielräume nur unzureichend bewusst sind. Hierbesteht Nachholbedarf. Eine besondere Gruppe bilden hier prominenteKinder und Jugendliche, da sie die Folgen ihres Handelns nur schwerüberschauen oder von Dritten gemanagt werden.Prominenz und die ambivalente Bewertungihres gesellschaftlichen Wertes<strong>Die</strong> letztendlich wertende Frage zum gesellschaftlichen Wert der Prominenzlässt sich, ähnlich wie bei der vielbemühten Metapher des halbvollenoder halbleeren Glases, <strong>im</strong>mer aus zwei gegensätzlichen Perspektivenbeantworten: So wie etwa MCLUHAN eine opt<strong>im</strong>istische Sichtgegenüber den Medien einn<strong>im</strong>mt – als Erweiterung des menschlichenErfahrungsraums und als gemeinschaftsstiftende Kraft – kann man Prominenteebenfalls positiv auffassen: Sie haben eine Thematisierungsfunktion,können durch ihre veröffentlichte Privatheit zeigen, dass in dergegenwärtigen Gesellschaftsform vorgestanzte Rollenbilder obsolet sind149
und sie wirken nicht zuletzt integrierend, indem sie als gemeinsamerGesprächsstoff unterschiedlichste Menschen zusammenführen können.Aus der pess<strong>im</strong>istischen Perspektive, ähnlich wie BOURDIEU das Fernsehenals Verdrängung der geistigen Auseinandersetzung auffasst, fördertProminenz eine Oberflächlichkeit und Irrationalität des öffentlichen Diskurses.Durch die Personalisierung werden Sachfragen verdrängt, letztenEndes nutzen die Prominenten aus dieser Perspektive eher dieGesellschaft zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse, als dass sie denBedürfnissen der Gesellschaft dienen.Es dürfte wenige Tätigkeiten geben, an welche die Gesellschaft sowidersprüchliche Ansprüche stellt: Der Herausgehobene soll anders alsandere sein, damit sein Sonderstatus gerechtfertigt ist, gleichzeitigmöchte man sich in dieser Person wiedererkennen. Nicht zuletzt werdenMenschen, die ein Leben in den Medien führen und somit Personen desöffentlichen Lebens sind, nicht nur bewundert, sondern auch beneidet.Es mischt sich <strong>im</strong>mer auch ein wenig Schadenfreude mit, wenn auf diejenigen,die sonst andere in den Schatten stellen, einmal selbst dunkleSchatten fallen.<strong>Die</strong> Zwiespältigkeit der gesellschaftlichen Exponiertheit einzelner Persönlichkeitenlässt sich in das literarische Bild gegensätzlicher Schreckenszenariender Literatur fassen: Während die Diktatur einiger weniger tonangebenderPersonen in eine ORWELL’sche Einfalt führen kann („1984”),so ist es umgekehrt die von HUXLEY befürchtete Zerstreuung durchunterhaltsame Vielfalt, in welcher die Gesellschaft zu einem Varieté verkommenkann („Schöne neue Welt”). (vgl. POSTMAN 1985: Wir amüsierenuns zu Tode). Mit anderen Worten: <strong>Die</strong> Gesellschaft sollte bei der‘Prominenzierung’ einzelner Mitglieder eine Balance anstreben, bei derweder zu viele noch zu wenige Personen herausgehoben werden, damitsie durch diese Exponierung einen fruchtbaren Nutzen ziehen kann. <strong>Die</strong>massenmedial öffentlich sichtbaren Persönlichkeiten sollten <strong>im</strong> Idealfalleinen Pool bilden, der ein ausgewogenes Spektrum abdeckt: zwischenAnpassung und Rebellion, zwischen Vorbildhaftigkeit und abschreckendemBeispiel und nicht zuletzt zwischen Altbewährtem und der visionärenKraft der Veränderung. Ein derart gelungenes Spannungsfeld ist <strong>im</strong>Stande, die Gesellschaft intellektuell in Bewegung zu halten.Der vorliegende Text ist die überarbeitete und aktualisierte Version eines Beitrags derfolgenden Dissertation: Ulrich F. Schneider: Der Januskopf der Prominenz: zum ambivalentenVerhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit; Wiesbaden: Verlag fürSozialwiss.; 2004.150
ETHIKIMJOURNALISMUS
152OHNE FURCHT UND ADEL?Ethische Konfliktfelder <strong>im</strong> JournalismusProf. Dr. Günther Rager, DortmundSich auf ethischen Konfliktfeldern bewegen und bewähren zu müssen,das ist für viele Journalisten ein Problem der anderen. Da fallen einemzunächst die Politiker und Verleger ein. Und natürlich auch das Publikum,weil es sich von der Unterhaltungsindustrie an zunehmend voyeuristischePerspektiven gewöhnen lässt. Schließlich zählen nach landläufiger Journalisten-Sichtauch die folgenden Kollegenkreise zu den ethischen Hoch-Risikogruppen: Reisejournalisten, Boulevardjournalisten oder PolitischeKorrespondenten.Reisejournalisten, weil sie sich von Tourismus-Veranstaltern einladenlassen. Und deshalb geneigt sein könnten, die strahlende Urlaubs-Fassadelieber zu beleuchten als die Schattenseiten eines wuchernden Massentourismus.Boulevardjournalisten, weil sie <strong>im</strong> Privatleben von Prominenten,Unfallfahrern oder Mordopfern wühlen, Skandale inszenieren oderaus Angeklagten lange vor dem Urteil „Verbrecher” machen. PolitischeKorrespondenten, weil sie ihre Quellen „pflegen” und zu Informations-Deals bereit sind. Da fragt man sich: Kann man die Arbeit eines Politikers,den man duzt, wirklich noch unabhängig beurteilen? <strong>Die</strong> Zwickmühle, inder bundes- wie landespolitische Berichterstatter stecken, ist mittlerweilesprichwörtlich: „Wer Nähe schafft, zensiert sich, wer Distanz hält,erfährt nichts” (Martin E. Süskind 1989).Ethik oder Qualität?Verantwortung von Journalisten und MedienunternehmenAbgesehen davon, dass selbst bei dieser Eingrenzung schon ein nichtunerheblicher Teil der Profession in die eine oder andere Risikokategoriefällt: <strong>Die</strong> landläufige Sicht greift zu kurz. Wer die Frage nach ethischenKonfliktfeldern etwas grundsätzlicher stellt, dem wird klar: Jede Journalistin,jeder Journalist stößt jeden Tag auf ethische Probleme. Sie sindmeist eher klein als groß, aber auf die Dauer eines Berufslebens summierensie sich.Woran liegt das? Einmal ganz banal daran, dass der Journalist viel mitMenschen zu tun hat, nicht mit Maschinen oder abstrakten Strukturen. Dastrifft natürlich auf andere Berufe ebenfalls zu, man denke nur an Medizi-
nerinnen, Altenpfleger oder Sozialarbeiter. Aber dem Journalisten passiertes wahrscheinlich besonders häufig, dass er Menschen für seine Berufsausübungbraucht, ohne dass sein Verhältnis zu ihnen genau definiertist. Das gilt beispielsweise für seine Informanten und für die Informationen,die er von ihnen erhält. Denn wie kann ein Journalist beispielsweiseseine Informanten charakterisieren? Sind sie seine Kunden? SeineKlienten? Gar seine Patienten? Und wie möchte man die Menschen bezeichnen,über die Journalisten berichten: Auftraggeber? Subjekte oderObjekte der Berichterstattung? Opfer? Alles zusammen? Nichts davon?Wenn Kommunikationswissenschaftler das Verhältnis von Politikern undpolitischen Berichterstattern charakterisieren, dann ist häufig von einem„Geben und Nehmen” die Rede oder einer „Symbiose”. Machen wir unskeine Illusionen: Solche Verhältnisse pflegen nicht nur die Kollegen inden Hauptstädten der Welt. Nach der reinen Berufsethik, wonach sichder Berichterstatter mit niemandem gemein machen soll, sind sie sicherlichein Sündenfall, der auch nicht dadurch geheilt wird, dass diese„Symbiose” <strong>im</strong> Alltag angeblich oft genug „konfliktreich” abläuft.Der Umgang mit Informationen und mit Informanten gehört also aufjeden Fall zu jenen Feldern, denen wir einige Zeilen Aufmerksamkeitschenken sollten. Wie ein Journalist Informationen beschafft und verwendet,und wie er dabei Menschen behandelt, das hängt stark von seinerpersönlichen Kompetenz oder Inkompetenz ab. <strong>Die</strong> Qualität seiner Ausbildungdürfte hier eine Rolle spielen, sein berufliches Selbstverständnis,aber auch so komplexe Größen wie sein Charakter.Das klingt so, als seien Fragen der journalistischen Ethik vor allemFragen an die Persönlichkeit von Journalisten. Zum Teil st<strong>im</strong>mt das, unddas verhindert, dass sich alle diese Fragen einfach mit Richt- oder Leitlinienbeantworten lassen. Welchen Grad an Konfliktfähigkeit soll derPresserat oder eine andere berufene Instanz beispielsweise einemdurchschnittlichen Kollegen ans Herz legen? Und wer wacht dann überUmsetzung und Einhaltung der Direktive?Aber natürlich ist diese persönliche Verantwortung nur eine Seite derMedaille. Journalisten sind eingebunden in Medienbetriebe, die profitorientiertagieren. Das heißt, dass diese Betriebe zu möglichst geringenKosten ein möglichst großes zahlendes Publikum ansprechen wollen –und zudem überwiegend von Werbung abhängig sind.Deshalb gehören die Ökonomisierung der Medienwelt und ihre Folgenselbstverständlich ebenfalls in diesen Aufsatz. Denn genauso falsch wiedie Leugnung der persönlichen Komponente ist eine andere Tendenz:Viele Probleme, über die sich Experten für Medienethik den Kopf zer-153
echen, könnten durch bessere Qualitätskontrollen in Medienbetriebenvermieden oder begrenzt werden. Doch selten wird in solche Kontrolleninvestiert. Stattdessen, so mein Eindruck, werden viele dieser Qualitäts-Probleme heutzutage vorschnell zur „ethischen Frage” stilisiert. Damitkann man sie dann auf den einzelnen Journalisten abschieben. Im Windschattenan sich begrüßenswerter Debatten über Berufsethik betreibenMedien ein für sie lukratives Outsourcing von Verantwortlichkeiten. Dassollten wir stets <strong>im</strong> Hinterkopf behalten.Woher, wohin, wozu? Der Umgang mit Informationen„Suchst du noch oder schreibst du schon?” <strong>Die</strong> Recherche ist eine Problemzonedes deutschen Journalismus. Das hat mehrere Gründe. In kaumeinem Punkt wirken persönliche und strukturelle Defizite derart starkzusammen. In der Journalistenausbildung spielt die Recherche oft eineeher untergeordnete Rolle. Weit weniger als etwa in Amerika wird hierzulandedie Recherche systematisch geübt.Das hat verschiedene Gründe: An der Hochschule oder <strong>im</strong> Volontärskurserfordert die S<strong>im</strong>ulation anspruchsvoller Recherchen einen viel größerenAufwand als die Vermittlung von Darstellungsformen. Und später – welchergestandene Journalist mag dann schon zugeben, dass er beispielsweisenoch nie <strong>im</strong> Handelsregister gestöbert hat? Schließlich ist das journalistischeQualitätsverständnis <strong>im</strong>mer noch stark auf Stil, Schreibe undDarstellung ausgerichtet – auch wenn es das schon lange nicht mehrsein sollte. Recherche gilt da manchmal als notwendiges Übel, das manmöglichst schnell hinter sich bringen sollte, um einen schönen Berichtzu produzieren.Zudem fehlt dem Journalisten nicht selten die Motivation zur vertieftenRecherche. Er fragt sich: Warum soll ich mir so ein aufwendiges Themaans Bein binden, das wahrscheinlich eher Ärger bringt als Lorbeeren?Keine ganz falsche Einschätzung. Denn die Notwendigkeit, Informationenmöglicherweise auf Umwegen zu recherchieren, legt ja schon nahe, dassda jemand nicht erbaut sein wird, wenn sie an die Öffentlichkeit gelangen.Außerdem kann man sich gerade bei schwierigen Recherchen schnellungewollte ethische Probleme einhandeln. Muss ich denn <strong>im</strong>mer sagen,dass ich als Journalist hier bin? Kann ich mir nicht einige Informationenleichter dadurch abholen, dass ich so tue, als sei ich als Privatpersonhier? Nicht alle Recherchebücher geben dem Suchenden zu solchen Fragenkorrekte Auskünfte.154
Schließlich bleibt in schrumpfenden Redaktionen schlicht <strong>im</strong>mer wenigerZeit und Geld für die vertiefte Informationsbeschaffung. Dann gilt: „Recherchierstdu noch oder sparst du schon?” Und der Griff in die Kiste mitden praktischen, kostenlosen PR-Artikeln wird wahrscheinlicher.Doch machen wir es uns nicht zu leicht. Nicht nur die Verlockungen derPR und der Zeitdruck begründen mangelndes Rechercheverhalten. DasThema, das mit zwei, drei Anrufen vermeintlich ausrecherchiert und publikationsreifist, verlockt einfach durch weniger Arbeit. Und für denfreien Journalisten heißt das auch, dass er in der gleichen Zeit mehrArtikel produzieren kann und damit mehr Geld verdient.Der Kampf um die knappe Ressource Aufmerksamkeit wird mit zunehmenderMedienkonkurrenz <strong>im</strong>mer heftiger. Das hat unter anderem zurFolge, dass die Inszenierung der Ereignisse nicht nur vor der Kamerawichtiger wird. Sie wird auch <strong>im</strong> Journalismus <strong>im</strong>mer wichtiger. <strong>Die</strong>Spirale der angewandten Inszenierungstechniken dreht sich schnellerund schneller. Jeder journalistische Beitrag ist das Ergebnis einer selektivenNeuordnung der Wirklichkeit. Und auch der blendend recherchierteaufklärerische Enthüllungsbeitrag liest, hört oder sieht sich angenehmeran, wenn er gut inszeniert ist. Gekonnte, dem Thema angemesseneInszenierung fördert durchaus die Vermittlung wichtiger Informationen.Aber es gilt auch: Je mehr Inszenierung, desto mehr Interpretation desEreignisses. Dem Publikum wird eine spezielle, subjektive Perspektiveauf das Ereignis vermittelt. Das erfordert nicht nur hohe Qualität derVermittlungsleistung, sondern auch eine besondere Verantwortung. EineVerpflichtung zur Wahrhaftigkeit.<strong>Die</strong>ser Verantwortung kommen Journalisten natürlich nicht nach, wennsie den „schönen Schein” übernehmen, den Prominente, Wirtschaftsbosseund zunehmend auch Politiker gerne um sich verbreiten. Es gibt indiesem Zusammenhang wohl keine schönere Realsatire als die Berichterstattungdes SFB von den ersten Pressebällen in der neuen HauptstadtBerlin. Wunderbar anzuschauen, wie die Live-Interviews unsererpublizistischen und politischen Elite abendfüllend mit drei Folgen „KirRoyal” alternierten.Aber auch das andere Extrem birgt Tücken: Negativismus und Skandalisierungum jeden Preis sind wichtige Mittel <strong>im</strong> Kampf um Aufmerksamkeit.Dass die Liebesbeziehungen von Prominenten gewissermaßen in Echtzeitöffentlich verhandelt werden, ist da nur die Spitze des Eisbergs.Wem nützt es eigentlich, wenn jede innerparteilichen Diskussion gleichzur „Zerreißprobe” hochgejazzt wird, jede zweite Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtsals „Super-Gau für die Politik” daherkommt? Dem155
politischen Diskurs wahrlich nicht. Es führt eher dazu, dass nötige Diskussionenunterbleiben. Wer widerspricht, muss ja damit rechnen, sofortzum „Parteirebellen” gestempelt zu werden. Und irgendwann haben sichsowohl Medienmacher als auch Rezipienten an die schrillen Töne gewöhnt,die oft auch falsche enthalten. Eine Gefahr, um die eigentlich alle wissen.Es gibt aber offensichtlich viele Journalisten – nicht nur bei Boulevardmedien– die diese Entwicklung nicht nur mitmachen, sondern sogarvorantreiben. Wer oder was zwingt sie?Aktualität und Exklusivität dominierenalle anderen QualitätsmaßstäbeKonkurrenz? Konkurrenz belebt doch das Geschäft. Eigentlich. Auch <strong>im</strong>Journalismus. Auf jeden Fall quantitativ. Untersuchungen zeigen, dass inKonkurrenzgebieten Redaktionen besser besetzt sind und Lokalausgabendort üppiger ausfallen als in Monopolkreisen. Auch journalistische Qualitätkann <strong>im</strong> Wettbewerb gewinnen. Allerdings nur, wenn klar ist, was Qualitätist – und was beispielsweise die Kunden, die Leser, Hörer und Zuschauerdarunter verstehen. Das ist aber nicht klar und diese Unklarheit einProblem. Denn so beschränken sich viele Medien auf zwei relativ einfacheIndikatoren: Aktualität und Exklusivität.156
Aktualität ist ein wichtiges Qualitätskriterium, das journalistische Produktevon anderen <strong>Publikation</strong>en unterscheiden hilft. In der härter werdendenMedienkonkurrenz um Aufmerksamkeit und damit um Quotenoder Käufer, entfaltet dieses Qualitätskriterium aber auch destruktiveWirkungen. <strong>Die</strong> zunehmende Beschleunigung der Übermittlung mit demWunsch, möglichst zur Ist-Zeit des Ereignisses zu berichten, führt zuabnehmenden Kontrollen und damit zu Fehlleistungen. Zumindest aberdazu, dass neben guter Kenntnis der Hintergründe und Fähigkeit zurAnalyse mehr und mehr auch ein Quentchen Glück für eine korrekteBerichterstattung nötig ist. Früher hätte man noch einen Tag gewartet,um weiter zu recherchieren, sagen Korrespondenten in Berlin, „heuteschickt man manchmal Geschichten raus, die zu zehn oder zu dreißigProzent st<strong>im</strong>men.” Aus Angst, die Konkurrenz könnte schneller sein(zitiert nach Jung, Begegnung vor dem „Staatstheater” 2003, S. 205).Exklusiv soll es sein. <strong>Die</strong> Geschichte, die kein anderer hat, ist für Mediumund Journalist von besonderem Wert. Sie kann Quoten und Kassebringen. Sie kann Karrieren und Geldbeutel gut tun, selbst wenn vorherExklusivität durch Honorar abgesichert wurde. Und gelegentlich wird derExklusivität auch durch Phantasie nachgeholfen, wie Fakes selbst in seriösenMedien <strong>im</strong>mer wieder belegen. Manche Journalisten machen sichund anderen Kummer, weil sie Geld und Ruhm auf diese Weise erlangenwollen.Das ist aber nicht nur ein individuelles Problem. Wir müssen uns fragen,ob diese in der redaktionellen Praxis dominierenden Qualitätsmaßstäbenicht geradezu ethische Probleme provozieren. Zumal es so aussieht,als befänden sie sich in einem Prozess zunehmender Verschärfung,ja Überspitzung.Denn was ist in einem Mediensystem, in dem alle Beteiligten dem Live-Prinzip huldigen, wirklich aktuell, was exklusiv? Der ideale Journalist istheute nicht nur ganz nah an den Ereignissen, er ist ihnen einen Schrittvoraus. Er denkt nach vorn, er „dreht die Geschichte weiter”. <strong>Die</strong> Gefahrdabei: Was passiert ist, kann man prinzipiell überprüfen, eine Darstellungdes Geschehenen kann richtig sein oder falsch. Für Spekulationen über dieZukunft gilt das nicht, jedenfalls nicht sofort. <strong>Die</strong> Falschmeldung musskorrigiert werden, die fiktionalen Elemente der Meldung nicht.So überraschte selbst ein grundseriöses Blatt wie die Rheinische Postaus Düsseldorf <strong>im</strong> Frühsommer 2003 während der rot-grünen Koalitionskrisein Nordrhein-Westfalen seine Leser mit allerhand Spekulationenüber den bevorstehenden Bruch. Dafür gab es durchaus Quellen,Anzeichen, Indizien. Doch bewahrheitet hat es sich letztlich nicht.157
158Vielleicht auch, weil manche Medien so heftig über das Ende derRegierung spekulierten?Viel spektakulärer daneben lag das nach wie vor Spekulations- undKampagnen-freudigste Blatt der deutschen Presselandschaft, die Bild-Zeitung. Sowohl be<strong>im</strong> vermeintlichen Kindermord von Sebnitz als auchbei dem aus dem Zusammenhang montierten Foto, das UmweltministerJürgen Trittin neben angeblich bewaffneten Demonstranten zeigte. <strong>Die</strong>haarsträubenden Fehlleistungen des Boulevard-Blatts änderten indeswenig daran, dass viele politische Journalisten die auflagenstarke Bild-Zeitung zunehmend als relevantes Medium betrachten, wie eine Untersuchungdes Mainzer Medienwissenschaftlers Carsten Reinemann zeigt.Wie das kommt? Politiker achten darauf, ihre Botschaften in reichweitenstarkenMedien unterzubringen. Stichwort Bild, BamS und TV. <strong>Die</strong> könnenseriöse Journalisten dann nicht mehr ignorieren.<strong>Die</strong> Konzentration auf Aktualität und Exklusivität wirkt um so schwerer,als Qualitätsdiskussionen zwar in Mode sind, der externe Druck, wirklichauch Qualität zu liefern, aber abn<strong>im</strong>mt. Der Medienjournalismus als Instanzexterner Qualitätskontrolle ist geschwächt. Nach einer Dekade desAufbaus werden vielerorts die Medienressorts ausgedünnt, Seiten undSendeplätze gestrichen. Das Fähnlein, das die Erosion überstanden hat,sieht sich oft mit ganz besonderen Problemen konfrontiert: WelcherMedienjournalist schreibt etwa wirklich frei über Probleme oder fragwürdige(Fusions-)Aktivitäten des eigenen Konzerns? Und wer mag schonetwas Böses über die Landesmedienanstalten bringen, die mit ihrenKongressen und <strong>Publikation</strong>en für Nebenbeschäftigungen sorgen?Und problematischer noch: Das Publikum scheint spekulative Tendenzen<strong>im</strong> Journalismus nicht als Qualitätsmanko zu begreifen, sondern vielleichtsogar als Ausweis guter Information. Jedenfalls ist aus der jüngeren Zeitnur ein einziges Aufbegehren der Nutzer bekannt geworden, weil ihnenein Medium zu viele Halbwahrheiten, Spekulationen oder gar Entenzugemutet hätte. Be<strong>im</strong> öffentlich-rechtlichen französischen FernsehsenderFrance-deux musste der Informationsdirektor gehen. Er hatte zugelassenoder gar veranlasst, dass ein Nachrichtensprecher seines Senders denRückzug von Alain Juppé aus der Politik verkündete – just in dem Moment,als auf dem Konkurrenzkanal TF 1 ein Exklusivinterview mit dem Ex-Premier begann. Drei Minuten später verkündete Juppé, er werde bleiben.(nach: FR, Medien-Seite, 12. Februar 2004). Das Beispiel ist indes soextrem, dass es wohl die Ausnahme darstellt, welche die Regel von dererstaunlichen Toleranz des Publikums gegenüber Übertreibungen undSpekulationen bestätigt.
<strong>Die</strong> Beispiele zeigen: Solche spekulativen Tendenzen <strong>im</strong> Journalismussind durch eine Qualitätsdebatte allein nur sehr schwer zu regulieren.Das hat einen einfachen Grund: Es ist ja nicht jede Spekulation wertlos.Sie darf als qualitätvoll und salviert gelten, falls sie sich als zutreffenderweist. Leider kann man das erst <strong>im</strong> Nachhinein entscheiden, und hatdann oft schon vergessen, von wem eine falsche Prophetie kam. DerUmgang mit Spekulationen ist also eine ethische Frage: Darf man’s oderdarf man’s nicht?Wer missbraucht hier wen? Der Umgang mit InformantenJournalisten müssen nah dran sein am Geschehen. Dazu brauchen sieInformanten, von denen sie Fakten-Informationen und Einschätzungenbekommen. Jeder Journalist weiß eigentlich, dass seine Informanten dasnicht ohne Hintergedanken tun. Der Informant will Publizität gewinnenund sich selbst via Medien positiv darstellen. Er betreibt wirtschaftliche,politische oder persönliche PR. Er will gegnerische Positionen schwächen,indem er offen oder „unter drei” vorgetragene Kritik an Parteifreundenäußert. Oder der Informant will mutmaßliches Fehlverhalten aufdeckendurch – anonyme – Weitergabe von Informationen. Erinnert sei an dentragischen Fall des Waffeninspekteurs David Kelly.Für das Verhältnis von Journalisten und Informanten hat der Journalismusdurchaus einige Anforderungen parat, die „ethisch” und „qualitätssichernd”wirken. Der Journalist muss einschätzen, ob der Informanteiner öffentlichen Auseinandersetzung gewachsen ist. Er darf keineHoffnungen erwecken, seine Position einfach zu übernehmen. Er mussBehauptungen prüfen und der „Gegenseite” die Möglichkeit zu einemKommentar geben. Der Journalist muss den Informantenschutz beachten.Wenn Anonymität notwendig ist und es gerechtfertigt erscheint,muss er das Gebot der Quellentransparenz dieser unterzuordnen.In den meisten Fällen werden Journalist und Informant eine Win-Win-Situation anstreben. Beide sollen etwas von der Beziehung haben.Gelingt das, entsteht längerfristig ein Näheverhältnis, das wiederum problematischwerden kann. Beispiele sind die Duz-Freundschaften zwischenJournalisten, Unterhaltungsstars, Sportlern (unplanmäßig auf dieöffentliche Bühne gebracht von Rudi Völler: „Du trinkst drei Weißbier...”)oder Journalisten und Politikern. Wobei letztere mitten in einem Generationswechselauf beiden Seiten heutzutage seltener sein dürften, alsnoch vor zehn Jahren. Doch auch wenn die Verhältnisse insgesamtgeschäftsmäßiger geworden sind, hat das Diktum von Stern-Vizechef159
Hans-Ulrich Jörges mehr als nur rhetorischen Wert, wonach „EmbeddedJournalism” in der deutschen Politikberichterstattung weit verbreitet ist:die Begleitung des Kanzlers auf Staatsbesuchen, der Zugang zu Hintergrundkreisen,die kurzfristige Chance auf ein Interview. Im politischenGeschäft gibt es zahlreiche Privilegien, die ein Journalist erringen – undwieder verlieren – kann.Oft wird dabei eine merkwürdige Verknüpfung von Exklusivität undGruppengefühl angestrebt: Weil man die Information schon nicht für sichalleine haben kann, will man sicherstellen, dass sie nur einem kleinenZirkel zukommt. <strong>Die</strong>ser Zirkel ist wenigstens exklusiv gegen andere.Statt sich dafür einzusetzen, Informationen frei zugänglich zu machen,mühen sich Journalisten, sie so weit wie möglich zu monopolisieren.Und ziehen noch persönliches Prestige daraus, einem Hintergrundkreisanzugehören, der den Ruf hat, beileibe nicht jeden aufzunehmen.<strong>Die</strong> Konfliktfähigkeit von Journalisten„Wir danken Ihnen für dieses Gespräch” – bei „Spiegel”-Interviews kanndiese freundliche Floskel durchaus einen verbalen Ringkampf beschließen.Häufig sind Journalisten aber nett zu ihrem Gegenüber, oft sogar zu nett.Denn Journalisten sind auch nur Menschen, und die meisten Menschenleben lieber in Harmonie mit ihrer Umgebung. Man streitet sich nichtgern mit Leuten, die einem persönlich nichts getan haben. Erschwerendkommt hinzu, dass zur beruflichen Umgebung von Journalisten mächtigeLeute gehören: Der Bürgermeister, die Staatsanwältin, der Unternehmensboss.Von Journalisten wird erwartet, dass sie nachhaken, aufdecken, kritisieren.Dazu müssen sie die Kunst des kontrollierten Konflikts und der gesteuertenEskalation beherrschen. Top-Leute in Wirtschaft und Politik sindgewohnt, ihre Ellenbogen einzusetzen – oder sie belegen dafür Kurse.Wo lernen es die Journalisten? In der Ausbildung? Am Arbeitsplatz? Hierherrscht ein echtes Defizit, dessen Konsequenzen für die praktischeBerufsausübung niemand unterschätzen sollte.Mancher Streitpunkt um die Autorisierung von Interviews betrifft ausdieser Perspektive nicht nur die Interviewten. Denn häufig gibt derJournalist zwar korrekt wieder, was diese gesagt haben. Aber die Formulierungder eigenen Fragen ändert sich bisweilen noch. So lange derInterviewpartner gegenüber saß, waren sie sehr verbindlich. Erst <strong>im</strong>geschützten Redaktionsraum werden sie glasklar und knochenhartumgetextet.160
Zugestanden: Es gibt mutige Journalistinnen und Journalisten, die vorAutoritäten keine Angst haben. Aber es gibt auch genug, die unter demVorwand sachlicher Kritik persönliche Konflikte austragen. Und wenn einMächtiger strauchelt oder fällt, trauen sich plötzlich ganz viele ganz nahan ihn heran. Möglicherweise sogar so nah, dass sie ein paar Umstehendeübersehen, auf die sie lieber auch ein Auge haben sollten.Sie ahnen es, es kommt der „Fall Gerster”. Der war wahrlich keinRuhmesblatt des deutschen Journalismus. Man muss kein Freund vonFlorian Gerster sein, um zu erkennen, dass der Mann für Dinge in dieWüste geschickt wurde, die bei vielen anderen toleriert wurden. Unddass einige Personen <strong>im</strong> Hintergrund ein bisschen gut weggekommensind. Betrachten wir doch noch einmal die verschiedenen Phasen dieses„Skandals”: <strong>Die</strong> sachliche Auseinandersetzung dreht sich um einen nichtkorrekt vergebenen Berater-Vertrag. Zunächst läuft alles nach denüblichen Standards der Berichterstattung. Der Bundesrechnungshofprüft. Gutachten werden veröffentlicht, Politiker kritisieren Gerster, Gersterverteidigt sich. Der Berater-Vertrag wird aufgelöst. Dann kommenGerüchte auf über weitere nicht korrekt vergebene Verträge. <strong>Die</strong> Innenrevisionprüft, es werden widersprüchliche Informationen über Art undUmfang von Beanstandungen publik. Dann zeichnet sich ab: Der Verwaltungsratwird sich von Gerster distanzieren. <strong>Die</strong> Medien spekulieren:Fällt Gerster? Der Verwaltungsrat lässt Gerster fallen. Begründung: DasVertrauensverhältnis sei zerstört. <strong>Die</strong> Auftragsvergabe, bisher zentralesArgument für einen möglichen Rauswurf Gersters, rückt in den Hintergrund.In den meisten aktuellen Medien irritiert dieser argumentative Schwenkzunächst nur wenige. Gerster war arrogant und unbeliebt, das wird alsErklärung für den Sturz akzeptiert. Denn Hochmut kommt vor dem Fall.Teile der Presse geben sich als moralische Anstalt. Mancher übersiehtsogar, dass der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit für Gerstereinen Nachfolger bestellt, der als Finanzvorstand noch direkter als dergestrauchelte Chef für die Auftragsvergabe zuständig war. Es geht aberauch anders. Einige Medien haben den Mut und die Kompetenz, sich kritischmit den Mitgliedern des Verwaltungsrats auseinander zu setzen.Sie bemühen sich um Hintergründe und fragen: Welche Interessen habenGewerkschafter und Industrie-Lobbyisten? Welche politischen Allianzenbestehen? Ergebnis: Vermutungen. Doch die legen nahe, dass man den„Fall Gerster” auch ganz anders erzählen kann. Als politische Intrige, inder sowohl die zweifelhaften Aufträge als auch die Kritik am Charakterdes BA-Chefs Mittel zum Zweck sind.161
Der „Fall Gerster” deutet noch auf einen anderen problematischen Trendhin: <strong>Die</strong> Ferndiagnose als Methode des Journalismus. <strong>Die</strong> hat es <strong>im</strong>mergegeben, man denke nur an die „Kreml-Astrologie” des Kalten Krieges.Doch je stärker der Journalismus, auch der aktuelle und der politische, denAnspruch erhebt, nicht nur dürre Nachrichten weiterzuverbreiten, sondern„Geschichten über Menschen” zu erzählen, desto eher berühren dieseFerndiagnosen Psychologie und Persönlichkeit von Menschen. Journalistenhaben zunehmend den Anspruch, den Objekten ihrer Berichterstattungnahe gekommen zu sein. Doch wer kennt schon Florian Gerster?Sicher nur ein Teil derer, die den BA-Chef so gekonnt analysierten.Kaufen, sponsern, schenken.Wie sich PR, Journalisten und Medienbetriebe einander annähernAngeblich gibt es in Amerika eine Anekdote – Typus moderner Mythos –die man sich jenseits des Atlantiks erzählen soll, um Selbstherrlichkeitund Machtmissbrauch von FBI-Beamten zu illustrieren. <strong>Die</strong> „FrankfurterRundschau” hat sie vor kurzem in einem Artikel nacherzählt: Ein FBI-Agent kommt in ein Café und bestellt ein Sandwich. Er hat gehört, dassMitarbeiter der Bundespolizei dort bevorzugt bedient würden und erwarteteine besonders große Portion Roastbeef. Der Wirt kredenzt ihm aber einganz normales Stück. Darauf zückt der Beamte seinen <strong>Die</strong>nstausweisund ruft: „FBI. Mehr Roastbeef.” (nach: FR plus Politik, 11. Februar 2004)So mancher Journalist müsste bei dieser Geschichte ins Grübeln kommen.Schließlich hat sich der Presseausweis längst zu einer Payback-Karte derExtraklasse entwickelt. Verbilligte Flüge, Prozente be<strong>im</strong> Autokauf, freierEintritt ins Museum. Viele Kollegen nehmen das als selbstverständlichhin. Das Internet-Portal www.journalismus.com wirbt mit hunderten Rabatt-Tipps. Doch selbst hartnäckige Schnäppchenjäger sind der Auffassung,dass all die Rabattangebote ihre Berichterstattung nicht beeinflussen.Chapeau – wenn‘s st<strong>im</strong>mt.Aber ist denn schon hoffnungslos gekauft, wer sich die Grundgebührfürs Handy spart? Wohl kaum. Problematischer erscheint es, wenn Journalistennebenher für Mitarbeiter- oder Kundenmagazine von Firmenschreiben, die dann teilweise sogar aus der firmeninternen Öffentlichkeitan den Kiosk drängen („Business Traveller”). Oder wenn Presseleute garparallel zu ihrer journalistischen Tätigkeit Politikberatung betreiben.<strong>Die</strong>ser Art von individueller Rabatt-und-Zubrot-Hatz könnte man mit Verhaltensregelnvielleicht sogar einen Riegel vorschieben. Manche Verlage,etwa Springer, haben auch schon „Leitlinien zur Sicherung der journali-162
stischen Unabhängigkeit” erlassen. Deren Überzeugungskraft leidet allerdingsdarunter, dass Springer-Gewaltige wie Vorstand Andreas Wieleandererseits kein Problem damit haben, die „intelligente Zusammenarbeit”zwischen Redaktionen und Werbeindustrie zu verteidigen. O-Ton Wiele:„In Frauen- und Jugendzeitschriften ist kaum die redaktionelle Unabhängigkeitgefährdet, wenn Kosmetikfirmen und Redaktionen engerkooperieren.” Wahrlich ein gutes Vorbild für die eigenen Mitarbeiter.<strong>Die</strong> Verlage müssen oder wollen sparen. Ein schönes Sparschwein bietetihnen die PR, die <strong>im</strong> Gefolge der aktuellen Medienkrise ungeahnteEintrittschancen erhält. Oft erhalten Journalisten von der Redaktion dieAnsage, nur kostenloses Bildmaterial zu verwenden. Also nehmen sieUnternehmens-Fotos. Als Quelle der Bilder muss natürlich die jeweiligeFirma genannt werden. Der Foto-Verweis ist zwar klein, aber für die PR-163
164Abteilungen eine feine Sache, schauen die meisten Leser doch zuerstaufs Foto und damit auch auf den Quellenvermerk. Ähnliche Hilfestellungenwerden auch bei Grafiken oder Berechnungsdienstleistungengern akzeptiert. Da lässt sich dann das Magazin „Geldidee” schon malvon der LBS berechnen, für wen sich ein Bausparvertrag lohnt. PR hat nacheiner aktuellen Umfrage gute Chancen, redaktionell verwertet zu werden.80 Prozent der Befragten wünschten sich kostenloses Bildmaterial. Undauch Texte segeln glatt ins Blatt wenn sie nur gut, also journalistisch,gemacht sind. In den ausgedünnten Redaktionen hat kaum noch jemandZeit und Lust, selbst Hand an eine Pressemeldung anzulegen.Ob daran die Glaubwürdigkeit der Medien und ihre Qualität leidet, istdie eine Frage. <strong>Die</strong> andere ist: Wie lange wird in journalistischenDebatten noch die Fiktion am Leben erhalten – und sogar als Maßstabausgegeben –, das journalistische System könne alle notwendigen Informationenselbst beschaffen. Sie führt zwangsläufig dazu, dass z.B.exklusive Meldungen, dass selbst induzierte Themen per se als höherrangiggelten als solche, die durch PR in die Redaktion flattern. Führenwir diese Diskussion mit der angemessenen Gründlichkeit und Redlichkeit?Längst nicht <strong>im</strong>mer. Um wirklich aus eigener Kraft den Überblicküber alle Entwicklungen zu halten, bräuchten die Medien einen Apparatvon Stasi-Ausmaßen. Den haben sie, zum Glück, nicht. Indem Journalistenaber an dieser Lebenslüge festhalten und „PR-Themen” geringschätzen, überfordern sie sich selbst. Welche Folgen das haben kann,dafür gibt es gerade aus dem Wissenschaftsbetrieb drastische Beispielewie die öffentliche Wahrnehmung von AIDS. (Hingst, Weber, Rager:Seismograph statt Sirene, Münster 1995)Sind Allianzen mit der Wirtschaft und Umstieg auf neue Geschäftsfelderbedenklich? Sicher. Noch bedenklicher wird es aber, wenn die Grenzezwischen PR, Werbung und Journalismus quasi institutionell verwischtwird. Was der kleine freie Mitarbeiter <strong>im</strong> stillen Kämmerlein tut – nebenhermal einen PR-Text verfassen – das machen viele Medienunternehmen <strong>im</strong>großen Maßstab. Attraktive Angebote, die Firmen <strong>im</strong> Netz betreiben,werden von Medien gerne aufgegriffen – auch auf die Gefahr hin, damitGeschäftsanbahnung zu betreiben. „Capital” bot etwa online einen Vergleichsrechnerfür Baukredite an – der Internet-Laie erkannte nicht, dassdie Berechnung auf den Seiten eines Finanzdienstleisters stattfindet, derbe<strong>im</strong> Vergleich gut abschneidet. „Bild” führte ihre „Teuro”-genervtenLeser an die Kassen großer Einzelhandelsunternehmen. Bei Vorlage derZeitung bekamen sie dort Rabatt. Für „Bild” übrigens eine ganz normaleredaktionelle Idee <strong>im</strong> Rahmen der Berichterstattung. Ob’s der Glaub-
würdigkeit der Zeitung nutzt? Selbst Nachrichtenagenturen sind längst<strong>im</strong> PR-Geschäft aktiv. Etwa die dpa, die über ihre Tochter news aktuellPR-Material von Firmen über den Ticker schickt.Gerade diese neuen Geschäftsfelder, die sich Medienunternehmen langsamerschließen, eröffnen ethische Problemzonen. Dabei geht es allerdingskaum noch um journalistische Ethik <strong>im</strong> engeren Sinne, sondern um allgemeineUnternehmensethik. Wenn nämlich nicht ganz klar ist, ob dieKundschaft gerade von einem Medium informiert oder einer getarntenWerbeagentur gleichen Namens penetriert wird. Manche Medien reizenihren Glaubwürdigkeitsbonus be<strong>im</strong> Publikum derzeit stark aus. OhneDinge, die in ihrem Maßstab nicht vergleichbar sind, allzu nah zusammenzu rücken, sei dazu noch eines bemerkt: Niemand von uns kann dieGrauzonen zwischen Medien und PR ganz vermeiden. Jeder Buchverweis,den ein Medium unter einen Gastbeitrag setzt, führt in diese Grauzone.Es verwundert natürlich nicht, dass die PR bei Untersuchungen <strong>im</strong>merwieder als versteckter Riese erscheint. Beispielsweise waren satte 67Prozent der journalistischen Beiträge zur Expo 2000 PR-induziert. Dasheißt natürlich nicht, dass alle diese Beiträge verzerrt oder gar überflüssiggewesen wären. Ein Großprojekt wie die Expo würde auch ohnePR-Aktivitäten breite mediale Beachtung finden. Gleichwohl hat die vorbereiteteInformation natürlich eine steuernde Wirkung. Vor allem, wennsie sich, wie <strong>im</strong> Fall der Expo, auf engagierte Politiker und Wirtschaftsleuteals Fürsprecher des Projekts stützen kann. Auf längere Sicht dürftedie Bedeutung der PR sogar noch wachsen. Während MedienbetriebePersonal und Rechercheressourcen kappen, wächst die PR-Branche, undsie professionalisiert sich (so z.B. Ruß-Mohl in: „Spinning, Spoonfeeding,Whistleblowing”, 1999).Wie reagieren Journalisten darauf? Zum einen mit Gewöhnung. Sie nutzenPR-Angebote, was auch vernünftig sein kann, wenn die schnelle Informationmehr Raum für eigene Recherchen eröffnet. Erstaunlicher Weiseneigen Presseleute aber gleichzeitig dazu, PR <strong>im</strong>mer noch zu unterschätzen.Es gibt in vielen Redaktionen noch recht wenig Wissen übermoderne PR-Strategien. Das kann ungewollte Übernahmen von PR-Inhalten begünstigen. Denn längst ist nicht mehr nur die Pressemitteilungund das, was vom Pressesprecher kommt, PR-geprägt. GroßeUnternehmen und politische Organisationen verfügen über Kommunikationskonzepte,in die Mitarbeiter und die Chefetage eingebunden sind.Wer sich also der „offiziellen” PR verweigert, „graue”, vemeintlich vertraulicheInformationen aber nutzt, kann keineswegs sicher sein, PR-freizu berichten.165
FazitJournalisten müssen sich berufsethische Standards stets vor Augen führenund in Leit- und Richtlinien festzurren. Damit ist es aber nicht getan.Persönliche Faktoren wie die Konfliktunfähigkeit einzelner Journalistenund Rahmenbedingungen des Mediensystems wie der Sparkurs, dasAusgreifen auf andere Geschäftsfelder oder die Betriebsblindheit <strong>im</strong> Verhältniszur PR wirken zusammen. Sie bergen die Gefahr, die Standardsder Berufsethik zu untergraben. Nur wer diese schwierige Gemengelage<strong>im</strong> Blick hat, kann verhindern, dass die Maßstäbe der Branche nochweiter verrutschen.Der Zusammenhang mit der Ökonomisierung macht besonders deutlich,wie eng Konfliktfelder von Ethik und Journalismus mit allgemeinen gesellschaftlichenEntwicklungen verbunden sind. Insofern darf es nichtwundern, wenn bisherige Selbstverständlichkeiten plötzlich in Frage gestelltwerden. Wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt, alte Zöpfe abzuschneiden.Wir haben aufgezeigt, dass das Bewahrte nicht <strong>im</strong>mer dasBewährte ist. Wir dürfen uns jetzt nicht wundern, wenn nicht allengemeinsam klar ist, was nun das Bewährte sein soll, das sich in Zukunftzu bewahren lohnt.Der Vorrat an gemeinsam geteilten Werten und Normen scheint in unsererGesellschaft kleiner zu werden. <strong>Die</strong> Debatte über Ethik und Qualität istdaher um so dringlicher. Sie muss dazu dienen, das herauszuarbeiten,was grundlegend für die Rolle des Journalismus innerhalb unsererGesellschaft ist. Wünschenswert wäre, wenn sich dabei die subjektiveWahrhaftigkeit als zentraler Wert herausstellen würde. Er böte eineBasis, um nach Antworten zu suchen, mit denen Journalisten sich in derPraxis konfrontiert sehen.Orientieren wir uns alle am gleichen Qualitätsmaßstab? Können undmüssen wir das überhaupt? Falls nein: Können wir wenigstens gutbegründen, warum wir Unterschiede machen? Welcher Maßstab soll inunserer ethischen Diskussion gelten? Und bleibt es überhaupt dabei,dass die Ethik nach wie vor jeder Qualitätsdiskussion gewissermaßendie Leitplanken vorgibt? Als eine Art Grundgesetz, das die sich wandelndeeinfache Gesetzgebung der Qualitätsdiskussionen unterfüttertund notfalls korrigiert?Es gibt noch keine Antworten. Stellen wir erst mal die richtigen Fragen.Überarbeiteter Vortrag in der Evangelischen Akademie Arnoldshain am 20. Februar 2004166
MASSSTÄBE GEGEN MASSLOSIGKEITEthische Standards zur Verbesserung der Medienqualität –Thesen und Fakten zur journalistischen KulturProf. Dr. Barbara Thomaß, Universität Duisburg1. Für die publizistische Funktion von MedienEine anspruchvollere journalistische Kultur in Zeiten der Krise zu fordern,heißt, <strong>im</strong> Rahmen des Pr<strong>im</strong>ats des Ökonomischen eine Lanze zu brechenfür die publizistische Funktion von Medien – und Mitstreiter dafür zuwerben. Das ist nicht einfach. Wer bessere Standards fordert, darf vonÖkonomie nicht schweigen. Dennoch tue ich das hier. Denn auch alleinbei den Standards gilt es, das Denken weiterzuentwickeln.Gerade in der Medienkrise ist es ein wichtiges Argument geworden, Rezipientenwünschezu beachten und die Ausrichtung an ihnen als wichtigesElement für publizistischen Erfolg zu werten. <strong>Die</strong>s verweist aberauch auf die grundsätzliche Frage: Ist Journalismus ein Nachfrageprodukt:Gedruckt wird, was der Leser zu lesen wünscht? Oder ein Angebotsprodukt,das sich nach einer ihm zugeschriebenen Aufgabe ausrichtet?Letzteres spielt noch eine Rolle, solange Medien die Aufgabe zugeschriebenwird, die ihnen in einer Demokratie zukommen: Anzustrebenist eine sinnvolle Verbindung von beidem.Wenn wir von Missständen innerhalb des Journalismus sprechen, müssenwir zuvorderst die Veränderungen <strong>im</strong> Mediensystem <strong>im</strong> Blick haben, diemit ursächlich für Fehlentwicklungen innerhalb der journalistischenProdukte heranzuziehen sind: Zwei wesentliche Grundtendenzen lassensich international beobachten:• Der Journalismus wird zunehmend durch eine Universalisierung derMarktmechanismen beherrscht. Das bedeutet, dass seine Grenzensich auflösen, dass durch die damit einhergehende Kommerzialisierungund Entertainisierung der Gehalt von Journalismus für demokratischeWillensbildung gefährdet wird. Ein daraus folgendes Gebot für dieOrganisation in Medienunternehmen ist die klare Trennung von Redaktionund Marketing, damit eine innere Unabhängigkeit der Journalistinnenund Journalisten gewahrt werden kann.• <strong>Die</strong> Dominanz des Unterhaltungsangebotes und der sie förderndenMedienstrukturen lässt das Bewusstsein von Journalismus als dem167
Fundament von Demokratie und Partizipation schwinden. Damit gehteine Abnahme der Verbindlichkeit eines in Auflösung befindlichenWertekonsenses einher.Sichtbar werden diese Grundtendenzen vor allem in veränderten Standardsder Darstellung von Inhalten – und hier gilt es Maßstäbe zu finden, welchedie Grenze zwischen journalismusspezifischen Formen und ihren Auflösungenmarkieren:Geht es um Komplexitätsreduktion oder um schlichte S<strong>im</strong>plifizierung?Liegt eine unterhaltende Informationsgebung vor oder lediglich eineBanalisierung?Leistet ein Artikel die Zuspitzung einer Kontroverse oder liefert er nureine sinnentstellende Polarisierung <strong>im</strong> Sinne eines Schwarz-Weiß-Denkens?Nutzt eine Darstellung veranschaulichende Personalisierungen oder bedientsie einen Reduktionismus, der zum Beispiel die komplexen Zusammenhängevon Sparpolitik auf den Namen Eichel reduziert?In einem Seminar an der Ruhruniversität Bochum haben Studierendeneine Inhaltanalyse zum Weltgipfel zur Informationsgesellschaft vorgenommen,und mussten zu dem Schluss kommen, dass das Ereignis inder kommerziellen Fernsehsendern nicht stattfand, weil eine Personalisierungnicht möglich war.2. Schwarz-Weiß-Schemata dominierenWir hantieren in den Gesellschaftswissenschaften mit Systemtheorien,komplexen Modellen, Chaostheorien, die einfachen Ursache-Wirkungs-Schemata haushoch überlegen sind, und sehen zu, wie die mediale Darstellungvon Realität s<strong>im</strong>plifiziert, personalisiert, banalisiert wird – weitüber ein mediennotwendiges Maß hinaus; einfache Schwarz-Weiß-Schemataund Wenn-Dann-Muster werden als ausreichend für das Verständniskomplexer Zusammenhänge betrachtet. <strong>Die</strong>se Art von Vereinfachung istein zentraler Angriff auf die Standards von Fairness und Sorgfaltspflicht,die kaum als beschwerderelevant für den Presserat zu händeln sind. Dennochmuss man sie, wenn es um Fakten zur journalistischen Kultur geht,benennen.Es hat sich verbreitet, die zunehmende Bedeutung von Wissen für dieKonstitution von Produktion und Gesellschaft in dem Begriff von derWissensgesellschaft zusammenzufassen, und ich habe an anderer Stelledie Rolle der Medien in der Wissensgesellschaft als die von Distribu-168
toren für popularisiertes Wissen dargestellt. Allerdings laufen wir Gefahr,durch die skizzierte Art von Journalismus ein noch weiteres Auseinanderdriftenvon Experten und Alltagswissen zu erhalten, am Endedieses Prozesse stünde der diametrale Gegensatz von dem, was unterExperten und was innerhalb der Bevölkerung zu relevanten Themenunseres Zusammenlebens für gültig gehalten wird, statt dass das Verhältniszwischen diesen beiden Wissensformen nur als enger und weiterzu fassen wäre.Notwendig ist also die Suche nach Ressourcen, die Inhalte undStrukturen von Ethik <strong>im</strong> Journalismus fördern können. Ethische Standardszur Verbesserung der Medienqualität müssen – so lautet die Hauptthesedieses Beitrages – be<strong>im</strong> gegenwärtigen Stand der Diskussion kommunikativeStandards der Verständigung über Medienqualität sein.Der Ehrenkodex des Deutschen Presserates ist solch eine Ressource, undder Presserat, der ihm zur Durchsetzung verhelfen soll, eine entsprechendeStruktur. Damit dachten wir lange, wir hätten das in einer DemokratieMögliche zur Verfügung. Aber nicht nur die wiederkehrendenMedienskandale, sondern auch das tägliche Angebot lehren uns einesBesseren, in diesem Fall Schlechteren. Im Rahmen der Kritik an bestehendenMedienleistungen ist eine Verschiebung des Diskurses vomBegriff der Ethik hin zu dem der Qualität erfolgt. Das ist von Vorteil, weiles andere Akteure als jene, die bislang in der medienethischen Diskussionaktiv sind, für das Nachdenken über Standards <strong>im</strong> Journalismussensibilisiert hat. Und das ist gut so.Qualität und Ethik sind gewiss nicht das gleiche. Aber eine lebendigejournalistische Ethik mündet in einer Verbesserung der Qualität, ohne dassich mich hier auf das Glatteis begeben will, diesen Begriff zu definieren.Also benutze hier vorläufig weiter den Begriff der Ethik. Dabei halte ichdie Unterscheidung zwischen prozeduraler und materieller Ethik für notwendig.Was steht <strong>im</strong> Vordergrund: Bessere Normen und Standards oderNormen über den Prozess der Verständigung über Standards der Medienqualität?Ich will hier ein Plädoyer für eine prozedurale Ethik halten, d.h.den Focus auf den Teil der journalistischen Kultur legen, der den Arbeitsprozessin Augenschein n<strong>im</strong>mt bzw. das Procedere darin.3. Plädoyer für prozedurale EthikWarum dieser Schwerpunkt? Normenkataloge, die sowohl Qualitätskriterienals auch ethische Standards ausdrücken, gibt es zur Genüge,und wir kennen sie hier alle. Da ist natürlich der Pressekodex, dann169
können wir auf systematischere und grundsätzlichere Normenkatalogezurückgreifen, z.B. den von Günther Rager, der Aktualität, Relevanz,Richtigkeit, Vermittlung und Ethik als Grundnormen benennt. AndereNormenkataloge enthalten die Begriffe Transparenz, Sachlichkeit undAusgewogenheit, Vielfalt, Seriosität, Glaubwürdigkeit, Professionalität,Rechtmäßigkeit, Informativität und Verständlichkeit; oder Maßstabsgerechtigkeit,Vollständigkeit, Wichtigkeit, Neutralität, Trennung von Nachrichtund Meinung usw.. <strong>Die</strong> präzise Fassung dieser Begriffe ist <strong>im</strong> einzelnensicherlich schwierig. Aber jeder Journalist, jede Journalistin, weißetwas mit diesen Begriffen anzufangen, auch wenn nicht alle das gleichedarunter verstehen, auch wenn sie nicht alle kompatibel sind, oder ineinem Spannungsverhältnis untereinander stehen. Das sind letztlichnachgeordnete Probleme. Es gibt Normen, wir kennen sie, wir wissen,dass sie umgesetzt werden sollten, aber es geschieht nicht oder nichtausreichend.Warum nicht? Hier setzt der Unterschied von materieller Ethik, also den170
Normen selbst, und prozeduraler Ethik ein. Und auch hier kann ich eineUnterscheidung treffen: Geht es um den Prozess der Normenfindung oderden der Normenanwendung? Und sind beide sogar miteinander verquickt?Antworten darauf würden wir in dem Konzept der Diskursethik finden,das sich anbietet, weil es ja angetreten ist mit dem Anspruch, genuineine Kommunikationsethik zu sein. Und tatsächlich könnte die zentraleForderung der Diskursethik auch wegweisend für die Findung und Durchsetzungvon Normen sein, wenn man sie nur anwenden würde oderkönnte. Genau dies scheint aber problematisch zu sein. Aber zunächstdiese zentrale Forderung (<strong>im</strong> Originalzitat bei Jürgen Habermas):„Der Diskursethik zufolge darf eine Norm nur dann Geltung beanspruchen,wenn alle von ihr möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer einespraktischen Diskurses Einverständnis darüber erzielen (bzw. erzielenwürden), daß diese Norm gilt” (Habermas 1983: 76).Das ist graue Theorie. Nicht wahr? Der Vorwurf lautet, dass diese Visionwelt- und dem Journalismus wesensfremd sei, zumindest dass sie nichtpraktikabel sei, solange es keine Institutionen und Orte gebe, in denensolcher Art anspruchsvolle Diskurse gepflegt werden können. <strong>Die</strong>se Ortegibt es jedoch bereits: <strong>Die</strong> hier stattfindende Tagung kann als solch ein Ortgelten. Aber lassen wir uns einmal darauf ein:4. Wer sind die von journalistischen Normen Betroffenen?Da sind die Informanten der Journalisten; dann die Menschen, über dieer berichtet; weiter seine Kollegen; sein unmittelbares Publikum; aberauch eine weiter zu verstehende Öffentlichkeit, die sich ihr Bild von Zustanddes Journalismus, von seinen Standards jenseits der einzelnenProdukte und Produktionen macht. Für einige dieser Beziehungenbestehen klare Normen, um deren Einhaltung zwar <strong>im</strong>mer wieder gerungenwird, <strong>im</strong> Prinzip sind sie jedoch klar:• der Informantenschutz, für jene, die als Quellen dienen;• der Persönlichkeitsschutz für die, über die berichtet wird;• Fairness und Sorgfaltspflicht sollen den Rezipienten ermöglichen, dieArbeit der Journalisten für glaubwürdig zu halten.• Das Bild, welches in der Öffentlichkeit von den Journalisten herrscht,hängt u.a. davon ab, ob und inwieweit sie sich in ihrer Arbeit anmoralische Gepflogenheiten halten, die auch in anderen gesellschaftlichenBereichen gelten. Hierzu gehört die Art und Weise, wie sie sichihre Informationen beschaffen und ihre Unabhängigkeit wahren.• Letztlich sind auch die Beziehungen zu den Kolleginnen und Kollegen171
nur von einer gewissen Gedeihlichkeit, wenn Journalisten sich gegenüberihnen keine unlauteren Vorteile erschleichen und den Beruf alsnicht in Misskredit bringen.Über all das herrschen verschiedene Vorstellungen, und über diese lässtsich reden. Im Falle des Informantenschutzes geht das meistens klar, essei denn, man muss vor Gericht die Idee der Unabhängigkeit der Presseverteidigen und das Zeugnisverweigerungsrecht einklagen. Auch überden Persönlichkeitsschutz findet die Debatte oft vor Gericht statt. Objedoch Fairness und Sorgfaltspflicht eingehalten werden, wie sich Journalistenihre Informationen beschaffen und ihre Unabhängigkeit wahren –darüber wird vielleicht in der Öffentlichkeit debattiert, wenig jedoch zwischenJournalisten und Vertretern der Öffentlichkeit. <strong>Die</strong>ser Dialog ist einer,den es zu stärken gilt, wenn wir die Hebung von ethischen Standards inder Medienqualität anstreben.Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich Journalisten ihrerseits ineinem ständigen Gespräch darüber befinden, wie sie ihren Beruf, wie ihreöffentliche Aufgabe ausüben. Dafür ist es notwendig, diese Diskurse indie Redaktionen hineinverlagern. Und dies wiederum erfordert die Stärkungder Unabhängigkeit der Redaktionen von Marketingabteilungen.5. Stärkung der redaktionellen Unabhängigkeitvon MarketingzwängenAlles Weitere soll sich um diese Fragen drehen. Ich will den Blick auf dieKommunikation über Normen und ihre Einhaltung in der journalistischenPraxis richten, und ich behaupte: diese finden nicht statt. <strong>Die</strong>se Behauptungwill ich durch einige Thesen, untermauern:• Journalismus ist ein Beruf der Teamarbeit, wird aber als einsamer verstanden.• Kritik ist das Geschäft der Journalisten, aber nicht Selbstkritik.• Journalisten sind begabt in Einbahnstraßenkommunikation, nichtaber in dialogischer Kommunikation.• Journalisten stehen in Konkurrenz mit ihren Einzelprodukten untereinander,und sind deshalb wenig gewillt, sich auf eine gemeinsameSuche nach verbesserter Anwendung der als richtig erkanntenNormen zu bewegen.• <strong>Die</strong> Ausnahme gilt <strong>im</strong>mer für den, der gerade gute Gründe dafür hat. Alsomuss er auch die Ausnahmegründe für Normenverstöße des anderen geltenlassen. Somit bewegen wir uns in einem Dickicht von Ausnahmen.172
• Das Hineintragen von Interessen des Marketing in die Redaktionenmacht ihnen dessen Diskurs zunehmend zueigen.• Darüber wird versäumt, über die eigenen Aufgaben eine vorwärtstreibendeVerständigung zu erreichen.Dagegen gilt: Dialog muss Teil einer Redaktionskultur sein, die Medienqualitätfördern will. <strong>Die</strong>s ist auch das Ergebnis der jüngsten Bemühungen,Erkenntnisse des Qualitätsmanagements aus anderen Industriesektorenfür den Journalismus fruchtbar zu machen. Der kardinale Einwandgegen diese Bemühungen lautet – deshalb nehme ich ihn hier gleichvorweg –: Das journalistische Produkt ist <strong>im</strong>mer ein Unikat (<strong>im</strong> Unterschiedzu den massenhaft und standardisiert erzeugten Produkten derIndustrie). Es lässt sich also nicht mit aus der Industrie gewonnenRezepten qualitativ verbessern. <strong>Die</strong>s gilt es also zu entkräften.Bitte bedenken Sie: Es gibt auch viele andere Berufe und Tätigkeitsbereiche,die nicht standardisiert vorgehen (können), die nicht industriellbest<strong>im</strong>mt sind, z.B. weil sie es mit Menschen, mit Beratung, mitProzessen etc. zu tun haben, die dennoch einen kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozesseingebaut haben. Wir können also festhalten:Qualitätssicherung hat etwas mit Kommunikation zu tun.6. Qualitätssicherung und KommunikationKommunikation <strong>im</strong> Journalismus tut not über Arbeitsabläufe, Auswahlkriterien,Zielvorstellungen, Zielpublika und die Aufgaben des Journalismus.Notwendig ist dabei, das Bewusstsein von Normen zu stärken,dies geschieht durch Kommunikation über Normen. Sie sind nicht etwas,was dem Intellekt und dem Individuum eigen ist, sondern das in tätigerAuseinandersetzung aktiviert und vitalisiert wird.Damit dies kein frommer Wunsch bleibt, muss es Angebote undStrukturen geben innerhalb dieser Kommunikation, damit eine Verständigungüber Werte und Normen, angewandt auf praktische Gegenstände,stattfindet. Alles, was es zur Routine macht, Normen zu thematisierenund die Thematisierung von Normen nicht als ein Sonntagsgeschäftabtut, ist nützlich.Ich komme auf den Begriff der Qualität zurück – wobei auch hier nicht analytischsauber zwischen Ethik und Qualität unterschieden wird – und macheAnleihen bei Qualitätssicherungskonzepten anderer Industriezweige. TotalQuality Management hat sich hier als Begriff durchgesetzt, mit dem auchviel Schindluder getrieben wird. Dennoch: <strong>Die</strong> grundelegende Idee,einen Prozess ständiger Verbesserung einzuleiten, ist vielversprechend.173
7. Prozess ständiger QualitätsverbesserungWas passiert <strong>im</strong> Rahmen dieses Prozesses? Problembestände werdenanalysiert, Ursachen und Wirkungsbeziehungen aufgezeigt, Ziele präzisebest<strong>im</strong>mt, Arbeitsabläufe darauf hin evaluiert, ob sie zur Zielerreichungbeitragen, und dabei Leitlinien und Wertsetzungen beachten (und diesind dank der Normenkataloge ja vielfältig vorhanden). Der Prozessständiger Qualitätsverbesserung bezieht sich also auf Input, Arbeitsabläufe,Strukturen, Produkte und Ergebnisse, und dies lässt sich journalistischübersetzen. Dann handelt es sich um Themenfindung, Themenauswahl,Recherche, Materialauswahl, Verarbeitung, Darstellung und dieaktuelle Vermittlung. Für all diese Schritte ist es möglich, ethischeLeitlinien zu formulieren, und dann ist in all diesen Schritten auch eineRückkoppelung möglich und notwendig. Und das ist der übliche Weg beiQualitätssicherung: Man legt Leitlinien dessen fest, man zu erreichengewillt ist, und überprüft ex post, inwieweit die Zielerreichung geglücktist.Bei der Verfertigung des journalistischen Produktes, also während dieserSchritte, ist es darüber hinaus möglich, <strong>im</strong> Dialog die Einhaltung der alsrichtig erkannten Leitlinien zu überprüfen – was <strong>im</strong> Zweifelsfalle dannauch heißen kann, auf ein Thema – vorerst vielleicht – zu verzichten, best<strong>im</strong>mteRechercheschritte nicht zu gehen oder bei der Darstellung – Stichwortesind hier zum Beispiel Gewaltdarstellungen, Tabuverletzungen –Zurückhaltung walten zu lassen.Üblich sind diese Klärungen ex post in der Redaktionskonferenz und derBlattkritik – aber jeder frage sich ehrlich, wie substanzreich eine Kritik<strong>im</strong> Hinblick auf ethische Leitlinien erfolgt. Und sie erfolgen während derProduktion natürlich während der Gespräche zwischen Tür und Angel.<strong>Die</strong> sind notwendig. Aber sind sie ausreichend? Es fehlen die Kommunikationsformen,innerhalb derer eine solche prozessorientierte Bewertungvon Qualitäten, besser noch von ethischen Qualitäten vorgenommenwerden kann. In anderen Berufen als dem journalistischen, liegt da bereitsein breiterer Erfahrungsschatz vor, den es zu heben gilt. Beispielefür Dialogformen in anderen Berufen sind Coaches, Supervision, Teambesprechungen,Mitarbeiterbesprechungen, Feedbackschleifen nach beendetemProzess oder Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gespräche.Nun wird vermutlich kritisiert, dass viele dieser Formen nicht eins zueins auf den Journalismus zu übertragen sind. Recht so. Aber heißt das,dass der Journalismus in seinen tagtäglichen Abläufen keinerlei solcherAbst<strong>im</strong>mungsprozesse in Hinblick auf ein (ethisch motiviertes) Qualitäts-174
ziel bedarf? Dass die gute alte Blattkritik der Weisheit letzter Schluss ist?Hier haben ethische Standards zur Verbesserung von Medienqualität einzusetzen,als Standards zur Verbesserung der Kommunikation überMedienqualität.8. Das Beispiel der Ethik Coaches<strong>Die</strong> oben genannten Formen ließen sich – so man es will – auf denJournalismus übertragen. Aus den USA stammt das Beispiel, dass ethiccoaches Kollegen bei der Klärung schwieriger journalismusethischerDilemmata beistehen. Supervision, als Einzel- oder als Gruppenvision,dient der Klärung komplexer beruflicher Situationen, die sich insbesondereauf Kooperationsformen und -konflikte beziehen, ließe sich aberauch denken, wenn es um die Umsetzung von Leitlinien oder die Problemedabei dreht. Teambesprechungen finden sich – siehe Redaktionskonferenz– noch am ehesten <strong>im</strong> Journalismus, aber auch ihre Qualitätließe sich verbessern. Und Mitarbeiterbesprechungen, Feedbackschleifennach erfolgtem Prozess oder Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gespräche machendann <strong>im</strong> Hinblick auf die gewünschte Verbesserung ethischer StandardsSinn und sensibilisieren für sie, wenn es in den Redaktionen das angesprocheneLeitbild gibt. Be<strong>im</strong> Schweizerischen Tages-Anzeiger, wo es einsolches gibt, heißt es dazu: „Über Qualität schreiben wir, damit wir darüberreden; die Grundsätze halten wir fest, um sie weiterzudrehen.”9. Das Konzept des Media Accountability SystemsIch will <strong>im</strong> Abschluss einige Beispiele aus einem Konzept eines französischenKollegen aufzeigen, die als Media Accountability Systems in dieLiteratur eingegangen sind, hier aber wenig rezipiert worden sind.Claude-Jean Bertrand hat über lange Jahre Beispiele aus der Redaktionspraxisweltweit gesammelt, wo und wie dieser Dialog und die Rückkoppelungmit der Öffentlichkeit erfolgt sind.Einige davon sind vertraut und erscheinen hier nur in einem anderenLicht – wie zum Beispiel Leserbriefe – andere mögen als Anregung dienen,wie sich die Kommunikation über ethische Standards in den Redaktionenund zwischen Redaktionen und Lesern, Hörerinnen und Zuschauerrinnenverbessern ließe.Für alle Beispiele gibt es eine reale Entsprechung irgendwo in der Welt:• der Medien-Kodex als Bestandteil des Arbeits- und/oder Tarifvertrages,175
• spezifische Ethik-Leitbilder in den Redaktionen,• die Bestellung von Ombudsleuten in den Redaktionen,• Newsletter an Leser zum Transparentmachen redaktioneller Entscheidungen,• der Abdruck von Leserbriefen, die auch Kritik an der jeweiligenRedaktion beinhalten,• die Selbstverpflichtung zu einsichtigen Korrekturen,• die Selbstverpflichtung zu transparenter nachvollziehbarer Veröffentlichungvon Rügen,• Umfragen zur Umsetzung des Sorgfalts- und Fairnessgebotes beiBetroffenen der Berichterstattung,• die Inhouse-Kritik gemäß spezifischem Ethik-Leitbild,• Kommissionen zur Inhaltsevaluierung,• ein Ethik-Komitee innerhalb der Redaktion, rotierend zusammengesetzt,zur Diskussion aktueller ethischer Entscheidungen,• Ethik-Coaches in den Redaktionen,• Bürger <strong>im</strong> Herausgebergremium oder in einzelnen Redaktionssitzungen,• ein regelmäßig zur Einhaltung von Standards befragtes Leserpanel,• Telefonaktionen zu Standards der Zeitung,• ein Ethik-Audit, durchgeführt durch externe Experten,• und ein Vorschlag von Studierenden aus einem meiner Seminare:„Preise” für die <strong>Publikation</strong>en mit den meisten und/oder den wenigstendurch den Presserat ausgesprochenen Rügen.Unter Supervisoren gibt es – nachempfunden dem Jargon von Psychologen– den Spruch: Gut, dass wir darüber geredet haben. Das gilt auchfür die Kommunikation über journalistische Ethik. Ein Fortschritt wärees, sagen zu können: Gut dass wir so gehandelt, wie wir geredet haben.In diesem Sinne bin ich neugierig auf die Diskussion, die jetzt folgt.Rede in der Evangelischen Akademie Arnoldshain 20.-22. Februar 2004176
Top Ten der vernachlässigten Themen 20032003 gab es wieder eine Fülle wichtiger Themen,die entweder die Schreibtische der Journalisten nicht erreicht odervon dort aus nicht den Weg in die Medien gefunden haben.Das Netzwerk Recherche hat daher Anfang Februar zusammenmit der Initiative Nachrichtenaufklärung die Top Ten dervernachlässigten Themen 2003 herausgegeben:1. Korruption: Deutsche Unternehmen schmieren <strong>im</strong> AuslandDeutsche Unternehmen bestechen Auftraggeber <strong>im</strong> Ausland. DeutscheMedien interessiert das in der Regel wenig – zu wenig.2. Europa entscheidet – Machtverschiebung nach BrüsselMehr als die Hälfte der Gesetzgebung in deutschen Parlamenten wird inzwischenauf EU-Ebene vorbest<strong>im</strong>mt. <strong>Die</strong>se Entscheidungsstrukturensind wenig transparent und bleiben es, da die Medien kaum über sieinformieren.3. Mangelnde Hochwassersicherheit von ChemieanlagenDeutsche Chemieanlagen sind Experten zufolge nur unzureichend gegenHochwasser gesichert. <strong>Die</strong> Medien berichten über Hochwasser, nichtaber über mögliche Gefahren.4. Greenwash: Unternehmen und ihr ökologischer DeckmantelGroße Unternehmen betreiben „grüne PR“ über <strong>im</strong>agefördernde Organisationenund infiltrieren Aktivistengruppen. Tatsächlich sorgen sie mitLobby-Arbeit dafür, dass kl<strong>im</strong>aschützende politische Entscheidungen aufgeschobenoder verwässert werden.5. Auslandsgeschäfte mit Giften und Pestiziden:die Doppelstandards der IndustrieBe<strong>im</strong> Geschäft mit Pestiziden wird mit zweierlei Maß gemessen: <strong>Die</strong> Industrieverdient mit giftigen Stoffen, die in Deutschland verboten sind,<strong>im</strong> Ausland auf legalem Weg viel Geld – weitgehend unbeachtet von denMedien.177
6. Abgestufte UN-Resolutionen<strong>Die</strong> Resolutionen der Vereinten Nationen ziehen unterschiedliche Konsequenzennach sich. <strong>Die</strong> Medien differenzieren in der Berichterstattungjedoch meistens nicht.7. Sozialhilfeempfänger: Unbekannte Chancen für SelbstständigkeitSozialhilfeempfänger können von ihrer Kommune Darlehen zur Existenzgründungerhalten. <strong>Die</strong> Medien informieren kaum darüber, während überpolitische Fördermaßnahmen für Arbeitslose (Ich-AG) intensiv berichtetwird.8. Das verschwundene Stasi-VermögenAuch 14 Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR-Staatssicherheit ist derVerbleib des Stasi-Vermögens noch nicht geklärt. <strong>Die</strong> Medien haben dieSpurensuche anscheinend aufgegeben.9. Leistungen für Asylbewerber weit unter SozialhilfeniveauBei der Berichterstattung über Asylbewerber wird vernachlässigt, dassihre Leistungen oft gekürzt werden und sie weit unter dem Sozialhilfeniveauleben müssen.10. Fehlende Rechte von US-BesatzungskindernBesatzungskinder aus deutsch-amerikanischen Verbindungen könnenRechte, die sich aus der Verwandtschaft mit ihren Vätern ergeben, nichtdurchsetzen. Grund: Es existiert kein diesbezügliches deutsch-amerikanischesAbkommen.Auch <strong>im</strong> Jahr 2004 sind das Netzwerk Recherche und die InitiativeNachrichtenaufklärung wieder auf der Suche nach relevanten Themen,über die in den Medien nicht oder noch nicht ausreichend berichtet wird.Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge per Mail an info@netzwerkrecherche.de.178
RECHERCHEIMJOURNALISMUS
REDE VON BUNDESPRÄSIDENTJOHANNES RAU BEIMJAHRESTREFFEN DES „NETZWERK RECHERCHE”„Medien zwischen Anspruch und Realität”1. Journalisten verzichten gern auf LobSie haben mich eingeladen, über dieEntwicklung der Medien in Deutschlandzu sprechen. Ich habe spontanzugesagt – und will die Gelegenheitgerne nutzen, Ihnen einmal ausführlichdarzustellen, welche Artikel michin den vergangenen 46 Jahren, solange habe ich jetzt politischeMandate inne, geärgert haben. Ichhoffe, Sie haben genug Zeit mitgebracht(...).Nein, <strong>im</strong> Ernst: Ich habe zum einenzugesagt, weil mich dieses Themaseit langem bewegt, und weil es eineganze Reihe von Entwicklungen gibt,die mir Sorgen machen. Zum anderen,weil ich viele Journalisten seit langemkenne und schätze, die hier <strong>im</strong>netzwerk recherche zusammengeschlossensind.Damit bin ich aber auch schon be<strong>im</strong> ersten Problem angekommen.Normalerweise freuen sich Menschen ja über Lob. Wenn aber PolitikerJournalisten loben, dann fürchten die Gelobten nicht selten eine besondersperfide Form von Rufmord. Das liegt daran, dass Journalistengenerell völlig uneitel sind und deshalb gut auf Lob verzichten können –da gleichen sie ja den Politikern.Der andere Grund für dies Misstrauen liegt in der professionellen Distanzzwischen Politik und Journalismus. Erst diese Distanz macht ein unabhängigesund objektives Urteil möglich. Nichts belegt diese Distanz an-180
geblich eindrucksvoller als harte Kritik. Wer also gelobt wird, war möglicherweisenicht kritisch und damit auch nicht distanziert genug. Werwill sich das schon – selbst in ein Lob verpackt – vorwerfen lassen?Damit bin ich be<strong>im</strong> zweiten Problem. Wenn Politiker über Journalistensprechen, werden sie schnell verdächtigt, Beschwerdeführer in eigenerSache zu sein. Politiker fühlen sich falsch verstanden, fehlinterpretiertoder – schl<strong>im</strong>mer noch – ignoriert. Schnell ist heute von Kampagnen dieRede. Auch die Debatte um die Autorisierung von Interviews hat gezeigt,wie aufgeladen die Atmosphäre ist. Ich kenne solche gegenseitigenSchuldzuweisungen seit vielen Jahren und auch ich selber hatte in fastfünf Jahrzehnten politischer Arbeit Anlass zu mancher Beschwerde. Damitwären wir aber wieder in der klassischen Gesprächssituation: Journalistensch<strong>im</strong>pfen über Politiker, Politiker sch<strong>im</strong>pfen über Journalisten.Das ist manchmal vielleicht ganz unterhaltsam, aber in der Sache bringtuns das nicht weiter.2. Eine ehrliche BestandsaufnahmeIch sehe reichlich Anlass zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme. <strong>Die</strong> Medienlandschafthat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändertund mit ihr auch der Journalismus. <strong>Die</strong> Politik hat sich verändert, unddas hat auch mit den Medien zu tun. Und schließlich hat sich unsereGesellschaft verändert und das politische Kl<strong>im</strong>a in unserem Land. Daswiederum hat mit beidem zu tun.Ich will hier also nicht lamentieren über die Frage, ob der Journalismuszu schlecht ist, um eine gute Politik zu vermitteln oder ob die Politik soschlecht ist, dass sie den hohen Anforderungen der Journalisten nichtgenügt. Ich verzichte heute auch darauf, über manche Klischees undEtiketten zu sprechen, die mir Journalisten in all den Jahren so angehängthaben – und ich hoffe, dass Sie mir diesen Akt der Selbstzensur zugutehalten!Ich möchte Ihnen vielmehr sagen, was ich für guten Journalismus halte.Das mag ein wenig schlicht klingen, aber mir scheint es dringend notwendigzu sein, an das vermeintlich Selbstverständliche zu erinnern,bevor wir in der Diskussion nachher zu intellektuellen Höhenflügen aufbrechen.Um diese Diskussion zu erleichtern, habe ich einige Sätze formuliert,die ich näher erläutern will. Ich wollte nicht von „Thesen” sprechen,weil das doch sehr gewaltig klingt, und ich mir nicht anmaße, denJournalismus neu erfinden zu wollen. Zehn Sätze sind es aber trotzdemgeworden.181
3. Gute Journalisten brauchen eine gute AusbildungMein erster Satz lautet: Gute Journalisten brauchen eine gute Ausbildung.Im vergangenen November habe ich in Marbach die so genannte„Schiller-Rede” gehalten. Darin ging es unter anderem um die Entstehungvon Kultfiguren und um die Wechselbeziehung von Medienwirkungund Wirklichkeit. „Bildung,” so habe ich damals gesagt „hat indieser von den visuellen Medien geprägten Gesellschaft eine besondere,nämlich eine kritische Funktion. Und ich bin fest davon überzeugt, dasszu einem solchen Begriff von Bildung die Bildung des sprachlichenVermögens und die literarische Bildung unverzichtbar sind.” So weitmein eigenes Zitat. Nach dieser Rede kam eine junge Reporterin aufmich zu, hielt mir das Mikrofon hin und fragt unvermittelt: „Herr Rau,was war das Wichtigste in Ihrer Rede?” Ich habe ihr geantwortet: „<strong>Die</strong>Einleitung, der Hauptteil und der Schluss.”Man mag über die junge Frau schmunzeln. Sie ist aber leider keinEinzelfall. Sie kennen alle die Geschichte von dem jungen Kollegen, derein kritisches Interview in der Bundestagslobby führt und sich anschließendnach dem Namen des befragten Politikers erkundigt. Selbst wennsie nicht st<strong>im</strong>mt, ist sie zumindest gut erfunden und sie illustriert eindurchaus verbreitetes Problem. Ich halte es jedenfalls noch nicht füreinen Ausdruck von emanzipiertem Journalismus, wenn das Selbstbewusstseineines Journalisten seiner Kompetenz weit voraus ist. AuchUnhöflichkeit kann nur vorübergehend verbergen, dass man von einerSache möglicherweise keine Ahnung hat. Forschheit und Kritikfähigkeitsind noch lange nicht dasselbe.Deshalb plädiere ich für eine solide und umfassende Ausbildung vonJournalisten. Dazu gehört zum einen das Handwerk: Das beginnt mit derSprache und endet noch nicht mit der Kenntnis journalistischerDarstellungsformen. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Nachrichtund Kommentar, und nicht alles, was mit einem Witz endet, ist deshalbschon ein Feature.Der Journalismus lebt – wie die Politik – von der Glaubwürdigkeit. Darummuss eine Information, die glaubwürdig sein will, auch einen sauberenhandwerklichen Rahmen haben. Da mag man noch so modischeFachbegriffe benutzen: Wer Objektivität verspricht und die Fakten derMeinung unterordnet, der manipuliert. Und wer ein Interview erfindet,betreibt keinen Borderline-Journalismus, wie das neudeutsch heißt,sondern hat ein Interview erfunden. Das ist das eine: Junge Journalistenmüssen ihr Handwerk beherrschen.182
Das andere ist: Journalistenbrauchen auch Bildung, jenseitsder Berufsausbildung.Ich erwarte von politischenJournalisten, dass sie dieGrundlagen unseres politischenSystems und die inihm handelnden Hauptpersonenkennen. Der Bundespräsidentheißt eben nichtJohannes Rau – SPD, weilder Bundespräsident nunmal keiner Partei angehört. Ich kann das verschmerzen. Blamabel wirdes aber, wenn die Berichterstattung über zentrale politische Themeneklatante Wissensmängel über das Gesetzgebungsverfahren oder überdie Zuständigkeit von Verfassungsorganen offenbart. Wie wollenJournalisten ihre Leser informieren, wenn sie selbst nicht verstehen, waspassiert? Ich sage das aus Erfahrung: Als Leser, als Zuhörer und Zuschauerhabe ich den Eindruck, dass sich die Kompetenz der Berichterstattungvielerorts deutlich verschlechtert hat.4. Guter Journalismus kostet GeldDamit bin ich bei meinem zweiten Satz: Guter Journalismus kostet Geld.Wir wissen alle, wie sehr die schlechte Wirtschaftslage viele Verlage undSender getroffen hat. <strong>Die</strong> Anzeigen- und Werbeerlöse sind erheblichzurückgegangen, die hohe Arbeitslosigkeit führt in vielen Städten zusinkenden Auflagen. Zugleich ist mit dem Internet eine starke Konkurrenzvor allem <strong>im</strong> traditionellen Geschäft der Rubrikenmärkte entstanden.<strong>Die</strong> Folgen sind unübersehbar. In den Redaktionen wurden inden vergangenen Jahren massiv Stellen abgebaut, der Umfang vonZeitungen und Zeitschriften wurde reduziert, und wo es geht, arbeitenVerlage zusammen – mit gemeinsamen Korrespondenten oder mit gemeinsamenBeilagen.Natürlich sind auch Medienunternehmen in erster Linie Unternehmenund müssen auf eine solide Ertragslage achten. Aber wir müssen unsklarmachen, wohin diese Entwicklung führt. Wenn <strong>im</strong>mer wenigerJournalisten <strong>im</strong>mer mehr Themen bearbeiten müssen, n<strong>im</strong>mt das Fachwissenzwangsläufig ab. Flexibilität allein macht aber noch keinen gutenJournalismus.183
In einer globalisierten Welt werden auch die Sachverhalte <strong>im</strong>merkomplexer. Wer <strong>im</strong> Lokalteil über Umweltschutz berichtet, wird sichzwangsläufig auch mit dem EU-Recht beschäftigen müssen. Wer überGesundheits- oder Rentenreformen schreibt, hat mit einer hochkompliziertenGesetzesmaterie zu tun. Journalisten brauchen Zeit, um sich solchesWissen anzueignen, und sie brauchen Platz, um ihre Erkenntnisse darstellenzu können. Wenn beides fehlt, sind Journalisten in einer schwachenPosition – gegenüber ihren Gesprächspartnern, gegenüber den Einflüsterungeneiner <strong>im</strong>mer mächtiger werdenden PR-Industrie und damitletztlich auch gegenüber ihren Zuschauern und Lesern.5. Journalisten müssen unabhängig von ökonomischen Interessen seinDas führt mich zu meinem dritten Satz: Journalisten müssen unabhängigvon ökonomischen Interessen sein. Ich spreche jetzt gar nicht von kr<strong>im</strong>inellenInsider-Tipps oder davon, dass Journalisten unbestechlich sein sollten– diesen Anspruch halte ich <strong>im</strong>mer noch für selbstverständlich. Schwierigerwird es schon, wenn Motor- oder Reisejournalisten ihre Arbeit nur nochtun können, wenn sie von den Unternehmen dazu eingeladen werden.Es gibt heute aber andere Anfechtungen, die für das Publikum vielschwerer zu durchschauen sind.Wenn Medien über neueTrends berichten, beeinflussensie damit natürlichauch das Kaufverhaltenihrer Leser oder Zuschauer.Ich frage mich inzwischen<strong>im</strong>mer öfter, an welchenKriterien sich eine solcheBerichterstattung orientiert.Ist ein Trend wirklichein Trend? Oder stellt sichdie Publizistik in den<strong>Die</strong>nst einer umfassenden Verwertungskette der beteiligten Medienkonzerne?Ist ein Superstar wirklich ein Talent? Oder werden Menschenaus ökonomischem Interesse mit journalistischen Mitteln zum Medienereignisgemacht?Wie entstehen eigentlich Themen, die uns wochen-, manchmal auchmonatelang beschäftigen? Natürlich durch aktuelle Ereignisse. Immer öfter184
aber stellt sich doch die Frage, was der eigentliche Anlass großer Debattenin unserem Land ist. Auch das hat mit Unabhängigkeit zu tun, allerdingsnicht mit ökonomischer, sondern mit geistiger Unabhängigkeit.6. Gute Journalisten brauchen einen eigenen KopfMein vierter Satz lautet deshalb: Gute Journalisten brauchen einen eigenenKopf. Das sagt sich leicht dahin, und selbstverständlich ließe sich keinJournalist vorwerfen, er sei leicht zu beeinflussen. Aber wie kommt esdann, dass manche Themen wie aus dem Nichts auftauchen und nacheiner Phase hektischer Betriebsamkeit ebenso plötzlich wieder <strong>im</strong> Nichtsverschwinden? Hat das vielleicht nicht doch etwas zu tun mit dem neuentstandenen Berufsbild des Spin-Doctors, dessen Aufgabe ja darinbesteht, <strong>im</strong> Sinne seines Auftraggebers Themen zu setzen und Meinungzu beeinflussen? Wenn spekulative Exklusivmeldungen zu harten Nachrichtengemacht werden – hat das vielleicht auch etwas mit fehlenderRecherche zu tun?Ich höre gelegentlich von Chefredakteuren, dass man an diesem oderjenem Thema nicht vorbeigekommen sei, obwohl es nicht wirklich relevantwar oder gar den Tatsachen widersprach. Warum eigentlich? Weileine große Zeitung es zu ihrem Thema gemacht hat? Natürlich gab es<strong>im</strong>mer Medien, die Meinungsführer waren. Aber es ist schon bemerkenswert,wenn der „journalist”, die Zeitschrift des Deutschen Journalistenverbandes,schreibt: „’Bild’ gilt der erstaunten Branche inzwischenals ’Leitmedium’.” Ich habe nichts gegen den Boulevard. Aberkann es wirklich sein, dass ein Boulevardblatt zum „Leitmedium” derdeutschen Presse wird?Es gibt viele Möglichkeiten, ein Thema zu betrachten – unter politischen,weltanschaulichen oder auch nur unter regionalen Aspekten. Ich wünschemir, dass Journalisten sich ihren eigenen Kopf darüber machen,dass sie Themen setzen, weil sie dies aus eigener Erkenntnis, geprüftdurch eigene Recherche, für sinnvoll halten. Sie kennen die berühmteAntwort des Bergsteigers auf die Frage, warum er einen Berg besteigenwill: „Weil er da ist”. Das gilt nach meiner Auffassung nicht zwangsläufigauch für Journalisten. Man muss nicht jeder Ente hinterherjagen, nur weilsie jemand in die Welt gesetzt hat. Ich wünsche mir da manches Malauch in den Chefredaktionen größeres Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit.Dabei sein ist nicht <strong>im</strong>mer alles, und von Zeitungen, vonRadio- und Fernsehprogrammen erwarte ich mehr als hohen Unterhaltungswert.185
7. Journalisten müssen Zusammenhänge erkennenDas ist der Kern meines fünften Satzes: Journalisten müssen Zusammenhängeerkennen. Jürgen Leinemann hat das vor einigen Jahren einmalziemlich polemisch formuliert. Er hat vorausgesagt, dass die ärgerlicheNeigung der Journalisten abnehmen werde, Dinge aus dem Zusammenhangzu reißen – „denn Zusammenhänge, aus denen man etwas reißenkönnte, sind den wenigsten Journalisten bekannt”. So weit will ich nunnicht gehen. Aber haben Sie nicht auch manchmal, in stillen Momenten,das Gefühl, dass es in der Politik eigentlich nicht nur und nicht ausschließlichum die Frage geht, ob nun Gerhard Schröder, Angela Merkeloder Edmund Stoiber <strong>im</strong> Politbarometer oben stehen?Ich lese es doch auch regelmäßig in Leitartikeln und höre es inKommentaren: Politik müsse sich den Sachproblemen zuwenden, derdauernde Streit verstelle den Blick aufs Wesentliche und die Bürgerwollten konkrete Antworten und keine Wahlkampf-Slogans. Wenn ichdann aber weiterblättere oder weiterhöre, erfahre ich oft genug ausschließlichdas: Wer streitet mit wem, und wer liegt vorn? Manchmalerfährt man auch noch, worüber gestritten wird. Aber den Kern derAuseinandersetzung erreicht die Berichterstattung <strong>im</strong>mer seltener.Ich räume sofort ein, dass die Politik selber einen großen Anteil an dieserEntwicklung hat. Medien erwarten ja zu Recht, dass Politiker in verständlichenWorten erklären, was sie tun. Aber Politiker sind dabei aufdie Vermittlung durch Medien angewiesen. Man kann die Probleme derSozialversicherung nicht sinnvoll in einem Statement von einer Minuteerklären. Und es ist inzwischen eher die Regel als die Ausnahme, wennbei der Kürzung von Interviews in den Sachaussagen gestrichen wirdund nicht bei den Aussagen über Personen.Ich halte es für eine der wichtigsten Aufgaben von Journalismus, denMenschen komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln. Es magzwar bequemer sein, Konflikte zu personalisieren und sie damit auf dieFrage „Wer-gegen-wen?” zu reduzieren. Das Ergebnis ist aber auf Dauerverheerend für unsere Demokratie. Wenn Menschen Zusammenhängenicht begreifen, wenn Transparenz fehlt, dann wird es umso schwieriger,Zust<strong>im</strong>mung für politische Lösungsvorschläge zu gewinnen. Das isteines der Probleme, vor denen wir derzeit <strong>im</strong> Zusammenhang mit derReformdebatte stehen. Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass durchdiesen Hang zur Boulevardisierung die Medien selbst zu der Reformblockadebeitragen, die sie selber häufig in ihren Kommentaren beklagen.186
8. Journalisten sollen einen Standpunkt habenDeshalb ist mein sechster Satz: Journalistensollten einen Standpunkt haben.Ich meine das wahrlich nicht <strong>im</strong> parteipolitischenSinne. Natürlich haben auchJournalisten ihre politischen Präferenzenund solange sie das nicht daran hindert,die Dinge nüchtern und unvoreingenommeneinzuschätzen, ist dagegen nichtseinzuwenden. Ich meine das vielmehr ganzwörtlich: Es wäre hilfreich, wenn mehrJournalisten in ihrer eigenen Arbeit sostandfest wären, wie sie das von Politikernhäufig fordern.Ich glaube, es ist gibt einen Zusammenhangzwischen dem vielfach beklagtenPopulismus in der Politik und dem Populismusin manchen Medien. Beides wiederumhat gewiss mit zu der Situation geführt,die seit Jahren unter der Überschrift „Reformstau” beschriebenwird. Es gehört fast schon zur Standardforderung in Leitartikeln undKommentaren, dass die Politik angesichts der Haushaltsnöte sparenmüsse. Werden aber konkrete Sparvorschläge vorgelegt, rollt eine publizistische„Wut-Welle” durchs Land. Überall ist vom notwendigen Subventionsabbaudie Rede – darüber, was Subventionen sind, ließe sich übrigenstrefflich streiten. Werden aber Subventionen gestrichen, erhebt sich auchin vielen Redaktionen genau darüber vielfach großes Klagen.Ich höre und lese ständig, dass die Steuern sinken müssen, aber in dergleichen Sendung oder in der gleichen Zeitung wird mehr Geld vomStaat für dieses oder jenes gefordert. Neuerdings verteilt die „Bild”-Zeitungsogar Aufkleber, mit denen gegen den hohen Benzinpreis und die Ökosteuerprotestiert werden soll. Nun will ich mich nicht zur Ökosteueräußern. Aber wissen die Menschen, die solche Aufkleber tragen, dassihre Ökosteuer in die Rentenkasse fließt? Und kommt dann auch konsequenterweisedie nächste Aktion – Aufkleber für höhere Rentenbeiträgeoder gar für Rentenkürzungen?Jeder kennt die Wechselwirkung von Medienberichterstattung und Wahlentscheidungen.Wenn Journalisten also von Politikern unpopuläre Maßnahmenverlangen, können sie nicht am nächsten Tag die gleichen187
Politiker dafür kritisieren, dass sie Unpopuläres tun. Das ist zumindestgedankenlos. Meistens ist es populistisch. Beides schafft weder Glaubwürdigkeitnoch Vertrauen.9. Journalisten sind Beobachter, nicht HandelndeMein siebter Satz hängt damit eng zusammen: Journalisten sind Beobachter,nicht Handelnde. Ich habe diese Aufkleber-Aktion gerade erwähnt.Man mag das für eine Spielart des Boulevard halten und nichtweiter wichtig nehmen. Aberich stelle doch fest, dass Medienund Journalisten <strong>im</strong>merhäufiger selbst zu Handelndenwerden wollen. Täuschtmein Eindruck, dass selbst ingroßen Magazinen die modischeTrendgeschichte heutemehr gilt als die profundeAnalyse? Dabei werden Fakten,die der Überschrift entgegenstünden,ganz bewusst ignoriert,um den Effekt der These zu verstärken und <strong>im</strong>mer öfter kann man auchden Eindruck gewinnen, der Weltuntergang stehe unmittelbar bevor.Ich spreche hier nicht über kritische Berichterstattung, die Missständeenthüllt und Skandale aufdeckt und damit natürlich auch Einfluss n<strong>im</strong>mtauf politische Entwicklungen. Das ist eine geradezu klassische Aufgabedes Journalismus und deshalb empfinden sich die Medien zu Recht auchals Kontrollinstanz <strong>im</strong> demokratischen System. Gefährlich wird es da, woJournalisten politische Prozesse oder gar Wahlentscheidungen durchaktives, von anderen Interessen geleitetes Handeln beeinflussen. Gefährlichwird es da, wo durch Zuspitzung oder Halbwahrheiten St<strong>im</strong>mungenabsichtlich verstärkt oder sogar erst gemacht werden. In einemdemokratischen System unterwerfen sich die gewählten Repräsentantender Kontrolle durch den Bürger – sie übernehmen für eine begrenzte ZeitVerantwortung und sie können bei Wahlen abgewählt werden. Medien undJournalisten unterliegen einer solchen demokratischen Kontrolle nicht.Warum auch? Sie machen ja keine Gesetze, sie wählen keine Regierungen,sie berufen keine Minister. Was aber geschieht, wenn sie dochEinfluss nehmen? Wer kontrolliert, ob und auf welchem Wege sie das tun?188
Wer prüft, welche ökonomischen Interessen die beteiligten Medienunternehmendabei möglicherweise haben? Wo verläuft die Grenze zwischenAufklärung, Meinung und Manipulation?Vor diesem Hintergrund muss man sehr vorsichtig umgehen mit Begriffenwie „Kampagne”. Wird dieser Vorwurf aber erhoben, dann mussman ihn umso ernster nehmen. Es geht dabei um mehr als nur um dieAuseinandersetzung zwischen Politikern und Journalisten. Es geht letztlichum die Transparenz von politischen Entscheidungsprozessen und dieseTransparenz ist ein Grundpfeiler unseres demokratischen Systems. Manipulationkann auf unterschiedliche Weise stattfinden. Eine halbe Wahrheitist oft schl<strong>im</strong>mer als eine ganze Lüge, habe ich in meiner letzten„Berliner Rede” gesagt.10. Journalisten sollen die Wirklichkeit abbildenDeshalb ist mir der nächste Satz so wichtig: Journalisten sollen die Wirklichkeitabbilden. Über die in Deutschland verbreitete Lust zur Schwarzmalereihabe ich ja vor einigen Wochen gesprochen. Es gibt aber nochein anderes Phänomen, das mich beunruhigt. Es gehört ja inzwischenzum guten Ton, dass Medien ständig Exklusives melden und damit ineigener Sache werben. Daran ist nichts auszusetzen, wenn die Meldungdenn auch st<strong>im</strong>mt. Inzwischen hat sich aber ein verhängnisvoller Medien-Mechanismus entwickelt, der die Politik und das Land in einen atemlosenZustand Art permanenter Dauererregung versetzt.Ich will versuchen, diesen Mechanismus an einem Beispiel ganz plastischzu erläutern. Vor drei Wochen erklärte der Bundesverkehrsminister ineinem Interview mit einer Sonntagszeitung, was seit Jahren die Rechtslagein Deutschland ist: Privatunternehmen, die ein neues Verkehrsprojektprivat finanzieren und betreiben, können eine Mautgebühr fürdieses Projekt erheben. „Allerdings”, so sagte Manfred Stolpe, „ist dieseVariante auf Grund europäischer Rahmenbedingungen beschränkt aufTunnel, Brücken oder Gebirgspässe und einige wenige Bundesstrassenund Autobahnen.” So weit der Originalton.<strong>Die</strong> Zeitung macht daraus die Überschrift „Stolpe will Maut für Pkw” undgibt eine Vorabmeldung an die Nachrichtenagenturen. Am Samstag meldetdie erste Agentur: „Stolpe – Maut auch für Pkw denkbar”. <strong>Die</strong> nächstespitzt schon weiter zu: „Stolpe plant Maut auch für Pkw”. Am Abend,das Interview ist noch <strong>im</strong>mer nicht erschienen, beliefert eine andereZeitung die Agenturen vorab mit einer exklusiven Stellungnahme desADAC, der „mit allen Mitteln gegen die Pkw-Maut kämpfen” wolle. Am189
Sonntag, das Interview ist endlich erschienen, stellt das Ministeriumklar, dass keine Maut geplant sei. Wenige Stunden später weist einGrüner die Pläne Stolpes zurück, der CSU-Generalsekretär spricht von„hemmungsloser Abzockerei”, die CDU kritisiert die „neue Schröpfkur”.Am Montag ist die offenbar unmittelbar bevorstehende Einführung einerPkw-Maut in Deutschland das Thema aller Kommentare, es gibt Sonderberichte<strong>im</strong> Fernsehen, Experten werden befragt, die Opposition besch<strong>im</strong>pftdie Regierung und umgekehrt.So geht das noch drei, vier Tage. Danach kehrt langsam wieder Ruheein. Der Nebel lichtet sich. Es gibt keine allgemeine Pkw-Maut, das hatauch niemand geplant. Der Verkehrsminister sei „lädiert”, schreibt eineZeitung, und nicht nur die Bürger sind verunsichert und fragen sich:„Sind denn alle verrückt geworden?” Es gibt inzwischen leider vieleBeispiele dieser Art. Virtuelle Debatten, deren Ursprung keinerlei Aufregungrechtfertigen würde, beschäftigen Journalisten und Politiker tagelang,manchmal wochenlang. Aus Referentenentwürfen werden in denNachrichten Gesetzesvorhaben, aus Interviewäußerungen werden in derflotten Moderation gleich Pläne. Das Ergebnis ist <strong>im</strong>mer dasselbe: <strong>Die</strong>Bürger verstehen <strong>im</strong>mer weniger, was wirklich und was wirklich wichtigist. Sie wenden sich ab und beschließen, vorsichtshalber gar nichts mehrzu glauben. Dafür tragen Journalisten eine erhebliche Mitverantwortung.11. Journalisten tragen Verantwortung für das, was sie tunDas führt mich zu meinen beiden letzten Sätzen. Der eine lautet: Journalistentragen Verantwortung für das, was sie tun. Es ist in den vergangenenWochen viel von Ethik in Politik und Wirtschaft die Redegewesen. Auch ich habe mich dazu ja häufig geäußert. <strong>Die</strong> Medienverweisen gern darauf, dass es solche Richtlinien dort längst gibt undauch Kontrollinstanzen wie den Presserat. Aber sind Sie sicher, dass das,was sich in Jahren bewährt hat, auch heute noch zuverlässig wirkt? ImKampf um Quoten, und damit um den lukrativen Werbemarkt, geht esheute um viel Geld. Ich fürchte, dass <strong>im</strong>mer mehr Verantwortliche in derMedienbranche bereit sind, dafür auch einen hohen Preis zu zahlen.Ich finde es nicht akzeptabel, wenn Fotos von toten deutschen Polizeibeamten<strong>im</strong> Irak veröffentlicht werden. Ich finde es abstoßend, wennMenschen zur Belustigung anderer <strong>im</strong> Dschungel oder in he<strong>im</strong>ischen Talkshowsin demütigenden Situationen vorgeführt werden. Auch der Einwand,dass dies doch freiwillig geschehe, überzeugt mich nicht. Ichbezweifle, dass die Betroffenen <strong>im</strong>mer richtig einzuschätzen können,190
was mit ihnen geschieht. <strong>Die</strong> Würde des Menschen ist unantastbar, steht<strong>im</strong> Grundgesetz. Und dennoch wird die Menschenwürde in Medien<strong>im</strong>mer öfter angetastet – nicht selten unter dem Vorwand journalistischerKritik. Persönliche Angriffe auf Menschen sind aber etwas anderes alssachliche Kritik. Ich weiß, dass der Grat zwischen beidem manchmal schmalist. Aber kein journalistisches Interesse kann die gezielte Verletzung vonMenschen rechtfertigen. Übrigens: auch Politiker sind Menschen. Undeine Schlagzeile wie „Frau Minister, Sie machen uns krank”, ist keinKommentar zur Gesundheitspolitik. Das ist schlicht und einfach eineEntgleisung.Wer <strong>im</strong> Privatleben anderer Menschen wühlt, kann sich nicht einfach aufein öffentliches Interesse berufen und die Tragödien ignorieren, die sichaus solchen Berichten nicht selten ergeben. Wer einem Menschen, derden Bundeskanzler tätlich angreift, über mehrere Seiten Raum zurunreflektierten Selbstdarstellung gibt, muss sich der Folgen einer solchenBerichterstattung bewusst sein. Wer grausame Gewaltverbrechen oderKriegsgräuel um des Schockeffektes willen detailreich ausbreitet, musswissen, was er damit anrichtet. Das häufigste Argument zur Verteidigungsolcher journalistischen Grenzverletzungen ist für mich zugleich dasarmseligste: <strong>Die</strong> Zuschauer oder die Leser, so heißt es, wollten das so.Selbst wenn es so wäre – was ich in vielen Fällen bezweifle: Ist es nichtein Armutszeugnis, wenn sich Blattmacher oder Programmplaner damitaus der eigenen Verantwortung für ihr Blatt oder ihr Programm stehlen?12. Journalisten tragen Verantwortung für unser GemeinwesenMein letzter Satz ist letztlich nur eine Erweiterung dieses Themas:Journalisten tragen Verantwortung für unser Gemeinwesen. Ich weiß,dass da mancher zusammenzuckt, denn Journalisten wollen ja geradenicht staatstragend daherkommen. Aber sollten Sie das nicht gelegentlichdoch? Bei aller gebotenen Distanz: Es ist auch Ihr Staat, über den Sieberichten, dessen Bild Sie durch Ihre Arbeit prägen. Es kann Ihneneigentlich nicht gleichgültig sein, wie es um diesen Staat bestellt ist.Wenn Sie erlauben, will ich mich ein zweites mal selber zitieren: „Vielesin unserer Gesellschaft, vieles in Politik und Wirtschaft gibt wahrlichAnlass zu Kritik. <strong>Die</strong> kritische Auseinandersetzung mit Fehlern undMängeln kann das Vertrauen stärken. Es gibt aber auch in den Medieneine fatale Lust an Schwarzmalerei und klischeehafter Übertreibung.<strong>Die</strong>se Lust fördert die Entfremdung der Bürger von Politik und Staat.”Das habe ich vor wenigen Wochen in der „Berliner Rede” gesagt.191
Noch einmal: Natürlich tragen Politiker eine erhebliche Verantwortungdafür, wenn durch Missmanagement oder das Fehlverhalten einzelnerdie Politik insgesamt in Misskredit gerät. Das habe ich ja vor kurzemnochmals sehr deutlich kritisiert. <strong>Die</strong> häufig zu beobachtende Politikverdrossenheitwird aber auch durch ein undifferenziertes Bild gefördert,das Medien von Politik vermitteln.Häme und Zynismus können einGemeinwesen ebenfalls in Gefahrbringen. Kritik an Politik darf sein, jasie muss sein. <strong>Die</strong> Grenze verläuftaber da, wo Politik und Politiker insgesamtverächtlich gemacht werden.Das Bild vom Parlament als „Quasselbude”hat eine traurige Traditionin Deutschland. Wer Politiker unterPauschalverdacht stellt, zerstörtebenso Vertrauen wie jene Politiker,die den Verdacht <strong>im</strong> einzelnen Fallbestätigen. Übrigens: Auch Journalistenkönnen gelegentlich irren.Allerdings erfahren die Leser undZuschauer davon bemerkenswertselten. Dabei könnte die Glaubwürdigkeitder Medien sogar zunehmen,wenn sie falsche Meldungen bei besseremWissen revidierten. Allzu häufigbleibt es aber bestenfalls bei einerverschämten Kurzmeldung, wenn sich ein zunächst groß aufgemachterVorwurf hernach als falsch erweist.Ich will hier gar nicht von eigenen Erfahrungen sprechen. Ich nenneIhnen als Beispiel den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl. Über langeZeit hinweg wurde der ungeheuerliche Verdacht erhoben und <strong>im</strong>mer wiederpubliziert, er und seine Bundesregierung seien <strong>im</strong> Zusammenhangmit dem Thema Leuna bestochen worden. <strong>Die</strong>ser Verdacht hat sich alshaltlos erwiesen. Ich habe nicht wahrgenommen, dass Helmut Kohl indieser Frage mit großen Aufmachern rehabilitiert worden wäre – vonwenigen Ausnahmen abgesehen. Dafür ist beispielsweise Hans Leyendeckerzu danken. <strong>Die</strong> Mehrheit ist dagegen irgendwann zur Tagesordnungübergegangen und die alte Weisheit könnte sich einmal mehrbestätigen: Irgendwas bleibt <strong>im</strong>mer hängen.192
Was da hängen bleibt, beschädigt nicht nur den Ruf von Personen. Esbeschädigt den Ruf und die Glaubwürdigkeit von Institutionen und zerstörtso Vertrauen. Wir brauchen aber dringend neues Vertrauen, gerade inschwierigen Zeiten. Wir brauchen aktive Bürger, die sich in ihre eigenenAngelegenheiten einmischen und Verantwortung übernehmen. <strong>Die</strong>Demokratie lebt nicht von Gesetzen, sondern von leidenschaftlichenDemokraten.13. Wir brauchen leidenschaftliche JournalistenWir brauchen in dieser Demokratie auch leidenschaftliche Journalisten,die sich einmischen und Verantwortung übernehmen. Ich habe mancheSorge geäußert, aber ich sehe auch viel Positives. Wir haben noch<strong>im</strong>mer eine bemerkenswert vielfältige Medienlandschaft. Es gibt vieleJournalisten, bekannte und unbekannte, die in ihrem Beruf weit mehrleisten, als der Tarifvertrag von ihnen fordert. Sie leisten einen unverzichtbarenBeitrag zu unserem Gemeinwesen, auch indem sie Missständeaufdecken und Fehlentwicklungen aufzeigen. Viele von ihnen sindheute hier, und ich freue mich darüber, dass Sie bei dieser Jahrestagungdes Netzwerks Recherche Ihre eigene Arbeit so kritisch hinterfragen.Politiker, und seien sie Bundespräsidenten, sind nur bedingt alsMedienkritiker geeignet – ich habe das am Anfang erwähnt. UnsereGesellschaft braucht eine selbstkritische Debatte innerhalb der Medien.Wir brauchen eine Diskussion über die Rolle und über das Verhalten vonMedien aber nicht nur bei Treffen wie diesem, bei Gewerkschaftsversammlungen,auf Medientagen oder <strong>im</strong> Rundfunkrat. Ich wünschemir, dass <strong>im</strong> Alltag, in Redaktionskonferenzen, aber auch bei Vorstandstreffen,kritisch über die eigene Arbeit und ihre Folgen und Wirkungengesprochen wird. Deutschlands Presse hat noch <strong>im</strong>mer einen guten Ruf.Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, und das ist auch nicht für<strong>im</strong>mer gesichert. <strong>Die</strong> Medien vermitteln ein Bild der Wirklichkeit, aber sievermitteln damit gleichzeitig auch ein Bild von sich selbst. Beideserscheint mir reformbedürftig.Rede am 12. Juni 2004 <strong>im</strong> NDR Hamburg193
„VERSCHLOSSENEN AUSTER”AN ALBRECHT SCHMIDTVerleihung von Netzwerk RechercheChristoph Arnowski, LaudatorStellen Sie sich vor, Sie werden alsFernseh- oder Hörfunk-Journalist zu einerHauptversammlung einer Aktiengesellschafteingeladen, und erfahren dann,dass Sie nur das aufnehmen dürfen,was die Firma will, die Rede des Chefs,nicht aber die Aussprache mit denAktionären. Sie sagen unvorstellbar?Ich muss Ihnen leider sagen, dass istbundesdeutscher Alltag. Was Schremppund Co. an Kritik zu hören bekommen,kann so nur noch sehr indirekt berichtet werden. Das Drehverbot in derHalle, ein einfaches, aber wirksames Mittel. Deutsche Aktiengesellschaftenverhalten sich wie Staatskombinate <strong>im</strong> Ostblock.Freie Berichterstattung ist für Unternehmen oft ein Fremdwort, das manallenfalls in Sonntagsreden schreibt. Werktags gilt Zensur. Manager, diefür zehntausende Arbeitsplätze Verantwortung tragen, die mit ihrenStandortentscheidungen mehr Politik machen als Wirtschafts- undFinanzminister zusammen, mögen es noch weniger als die Minister,wenn sie von uns kritisch begleitet werden. Und deshalb tun sie, wassie können, um unsere Arbeit zu beeinflussen.Auch bei Hauptversammlungen.Und dafür gehört Herrn Dr. Albrecht Schmidt, dem Aufsichtsratsvorsitzendender HypoVereinsbank, die verschlossene Auster. Netzwerk Recherchezeichnet Sie stellvertretend für alle Informationsverhinderer aus. Siebefinden sich – ich muss leider sagen – in schlechter Gesellschaft. Von 30deutschen DAX-Unternehmen handeln 29 wie das Ihre. Nur Adidas-Salomon nicht. Bei der Hauptversammlung des Sportartiklers darf allesaufgenommen werden. Und die AG ist außerordentlich erfolgreich.194
„Transparenz durch Vertrauen” schreibt die MünchnerRück, der Großaktionär der HVB, auf seine Homepage,predigt das hohe Lied der Corporate Governance.Wenn aber Frauke Ancker, die Geschäftsführerindes Bayerischen Journalisten-Verbandes auf derHauptversammlung mit einer Aktie in der Hand perGeschäftsordnungsantrag unbehinderte Berichterstattungeinfordert, verweist sie Aufsichtsratschef UlrichHartmann vom Rednerpult, läßt sie nichteinmal ausreden.Sie sagen unvorstellbar, ich muss Ihnen, liebeKolleginnen und Kollegen, sagen, das ist letztes Jahrleider passiert.<strong>Die</strong> bayerischen Journalisten, und das darf ich jetzt hier <strong>im</strong> hohenNorden einmal mit einem gewissen Stolz sagen, wir lassen uns von dieserPressefeindlichkeit nicht beeindrucken. Wir haben uns was einfallen lassen.Wir sind unter die Kleinaktionäre gegangen, haben uns damit dasRederecht erkauft und fordern jetzt auf jeder Hauptversammlung eigentlichnur Eines: Lasst uns bitte ganz normal arbeiten, wie auf Parteitagenbeispielsweise.Und dann treffen wir auf Herren wie Herrn Schmidt. Und was machendie? Mit unhaltbaren Argumenten versuchen sie uns weis zu machen,dass die Berichterstattung rechtlich nur so möglich ist, wie Sie das wollen.Sagen, dass so ein Treffen mit mehreren tausend Besuchern eine privateVeranstaltung sei. Ich frage Herrn Schmidt und seine Kollegen nochmal:Ja warum laden Sie uns dann überhaupt ein? Und warum fragen Sie nichteinmal ihre Aktionäre, was die davon halten? Stattdessen bevormundensie die Besitzer der Unternehmen, und geben dabei vor, deren Persönlichkeitsrechtezu schützen.Das Motiv ist durchsichtig: Gerade in Zeiten, in denen die Gehälter mitOptionsprogrammen in Höhen gepuscht werden, die selbst dem BayerischenMinisterpräsidenten suspekt sind, in diesen Zeiten, wo gleichzeitigjeden Tag die Arbeitsplätze zu tausenden gestrichen werden,sind Hauptversammlungen für die Unternehmensführungen der vermutlichunangenehmste Arbeitstag des Jahres. Stundenlang bekommen Sie meistsehr fundiert entgegengehalten, was Sie alles falsch gemacht haben.Klar dass Sie das am Abend nicht auch noch in der Tagesschau sehenwollen.195
Da wollen Sie lieber ihre salbungsvollen Prognosen hören, dass zumBeispiel – ich will mal den HypoVereinsbankvorstand zitieren – die Bank<strong>im</strong> Rahmen ihrer ambitionierten Erwartungen liege. <strong>Die</strong> Börse hat es anjenem Vormittag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen anders gesehen,die HVB-Aktie ist innerhalb von vier Stunden um zehn Prozent abgeschmiert,ein unvorstellbarer Crash für ein solches Börsenschwergewicht.Den Aktionären hat man das in der Halle übrigens gar nicht gesagt, dasnenne ich doch eine Informationspolitik, so wie sie Ihrem Großaktionär,der Münchner Rück, vorschwebt: Vertrauen durch Transparenz.Im Ernst, ich bin überzeugt, mehr Transparenz täte der Börse wirklichgut. Wenn Sie den Leuten endlich vermittelten, dass Sie nichts zu verbergenhaben, dann wird das Vertrauen in die Wirtschaft wachsen. Unddas brauchen wir ganz dringend.Doch statt mit einer offenen Informationspolitikversuchen Sie ihre Aktionärelieber mit Bockwürsten und Leberkässemmelnzu ködern. Uns Journalistenspeisen Sie auf der Hauptversammlunganders ab. Trotz gestrichener Dividende,das Essen <strong>im</strong> Pressezentrum ist nachwie vor erstklassig, nach dem Motto,wenn die Reporter schon nicht richtigberichten dürfen, sollen sie wenigstensgut essen. So hält man uns bei Laune.Nicht alle von uns, aber doch manche.Und an dieser Stelle komme ich nicht umhin, einige kritische Anmerkungenan die eigene Zunft zu richten. Und ich bleibe beispielhaftwieder be<strong>im</strong> Preisträger, der HypoVereinsbank. Dass man sich ab und zutrifft, <strong>im</strong> lockeren Rahmen, be<strong>im</strong> Neujahrsempfang oder be<strong>im</strong> Sommerpressefest,das gehört zu unserem Job. Aber muss ein solches Fest überzwei Tage gehen mit Golf-Schnupperkurs oder Bootsausflug, kostenlosemL<strong>im</strong>ousinen-Service ins Hotel, in dem dann die Z<strong>im</strong>mer für auswärtigeKollegen, wie man so hört, auch noch von der Bank bezahlt werden.Wundert das dann einen noch, das die kritische Distanz irgendwannverloren geht, wenn man so herzlich umsorgt wird? Wundert man sichnoch, – ich will ein letztes Mal ein konkretes Beispiel unserer Preis-196
trägers nennen –, wundert man sich also, wenn diese Bank vomBundesgerichtshof erstmals in einem Streit um sogenannte Schrott<strong>im</strong>mobilienzur vollständigen Rückabwicklung verurteilt wird, und in dieserAuseinandersetzung geht es um zehntausende von Fällen, wundertman sich, dass dann renommierte Agenturen und Zeitungen diesesLandes völlig einseitig berichten. Ausführlich schreiben, wie die Bankdieses Urteil bewertet, aber kein Wort davon zu lesen ist, was Verbraucheranwälteoder auch unabhängige Juristen dazu sagen?Wenn ich so etwas lese, muss ich sagen, diese Kollegen haben ihrenBeruf verfehlt. Wir dürfen uns nicht als wohlwollende Begleiter derUnternehmen sehen, wir sind nicht die he<strong>im</strong>lichen Pressesprecher, derenAufgabe es ist, Managementfehler oder Innovationsschwäche mit blumigenFormulierungen herunterzuspielen. Wir müssen kritische Distanz wahren,auch und gerade in der Wirtschaftsberichterstattung. Verluste solltenwieder Verluste genannt werden und nicht, wie es Pressestellen schönfärberischverbreiten: negative Ergebnisbeiträge oder negative Gewinne.Ich appelliere an alle Kollegen, auch wenn ich weiß, dass ich hier be<strong>im</strong>Netzwerk Recherche eigentlich die Falschen vor mir habe: Zeigen Siewieder mehr Distanz, ereifern Sie sich nicht nur völlig zu Recht über dieWeltecke-Sause, sondern lassen Sie sich selbst ein bißchen wenigereinladen!So jetzt hätte ich fast unseren Info-Blocker vergessen.Gegenüber einem Preisträger wäre dasnatürlich unhöflich. Mein Appell an Herrn Schmidtund alle anderen Schmidt’s in der deutschen Wirtschaft,und davon gibt es in den Vorständen undAufsichtsräten leider viel zu viele: Sparen Sie sichso manchen Euro für Sachen, die wir gar nichtbrauchen. Wir kommen auch so zu Pressekonferenzen,ohne Geschenke. Viel wichtiger aber: LassenSie uns vernünftig arbeiten, behindern Sie uns nichtdabei. Auf Hauptversammlungen genauso wie auchsonst in ihren Unternehmen.”197
198DER STRUKTURELLE ZWANGWarum es Recherche so schwer hatSven PregerEs ist eine schöne Illusion: Journalisten durchforsten Archive, lesen Akten,telefonieren, interviewen Betroffene vor Ort, tragen ihre Erkenntnissesystematisch zusammen und verfassen ein journalistisches Produkt. Siewollen die Bürger informieren, auf Missstände hinweisen, an der WillensundMeinungsbildung mitwirken, um so den gesellschaftlichen Diskursanzuregen. Ihr wichtigstes Mittel bei der Erfüllung dieser gesellschaftlichenAufgabe: die Recherche. Gemessen an der Realität in deutschenRedaktionen entspricht dieses Szenario allenfalls einem frommenWunsch.Doch trotz einer verstärkten Kritik an diesem ganz besonderenMissstand hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas verbessert.Warum? Natürlich, Zeit und Geld als wichtigste Recherche-Ressourcensind in Zeiten der Werbekrise und Diskussion um Rundfunkgebührenknapp. <strong>Die</strong>s jedoch als alleiniges Argument für den Recherchemangelanzuführen, greift zu kurz. Nicht allein die äußeren Zwänge prägen dasjournalistische Handeln. In letzter Instanz sind es die Journalisten selbst,die Entscheidungen treffen, eine Recherche beginnen oder sie gar nichterst anfangen. Insgesamt lassen sich drei verschiedene D<strong>im</strong>ensionenausmachen, die zusammen die journalistische Informationsbeschaffungbeeinflussen. Erstens die politische Kultur Deutschlands, zweitens derAufbau des deutschen Mediensystems und drittens der journalistischeAlltag. Alle drei Ebenen sind umgeben von den rechtlichen Rahmenbedingungen.Kontinuität der BrücheBis heute hat sich in Deutschland ein kritischer, aufklärender und recherchierenderJournalismus kaum etabliert. Maßgeblich mit dafür verantwortlichist die deutsche Geschichte: <strong>Die</strong> radikalen Brüche in der politischenEntwicklung Deutschlands haben sich direkt auf den Journalismusund das Verhältnis der Journalisten zur jeweils herrschenden Klasseausgewirkt. Als Grundkonstellation zeigt sich dabei eine Kontinuität vonBrüchen in den vergangenen 150 Jahren von der ersten zaghaften Revolution1848 zur Gründung des ersten Nationalstaates in der Zeit
Bismarcks über den Ersten Weltkrieg, die We<strong>im</strong>arer Republik, das NS-Reg<strong>im</strong>e bis hin zur Teilung Deutschlands in zwei Staaten, die schließlichwiedervereinigt wurden. <strong>Die</strong>se Entwicklung beeinflusst grundlegend diedeutschen Medien, die oftmals als politisches Instrument der Herrschendeneingesetzt wurden. Immer wieder kämpften Journalisten gegen die Zensuroder andere Einschränkungen wie die Karlsbader Beschlüsse 1819, dieSozialistengesetze 1878 und schließlich die Gleichschaltung durch dieNationalsozialisten. <strong>Die</strong>se wussten vor allem die jungen Medien Hörfunkund Film für ihre Propaganda zu nutzen. Über diese Brüche hinweg bliebin der deutschen Gesellschaft das Ideal einer verklärenden Harmonie festverankert – eine freie, kritisch-recherchierende und in diesem Sinne demokratischeMedienlandschaft war nicht erwünscht. Dabei ist nicht einmalsicher, dass alle Journalisten diese wirklich wollten – waren sie dochauch Kinder ihrer Zeit und insofern an das obrigkeitsgläubige Dasein gewöhnt.<strong>Die</strong> Instrumentalisierung der Medien ließ keine kritische Traditionwachsen.Pressefreiheit von außenDas änderte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Deutschlandwar nicht nur wirtschaftlich und materiell am Ende, sondern auch ideologisch.Viele Menschen hatten ihre Hoffnungen und Ideale mit einem Reg<strong>im</strong>everbunden, das mit seinen Werten zu Massenmord und Untertanen-Kultur beigetragen hatte. Für irgendeine „Ersatzideologie” konnte sichdie Bevölkerung zunächst kaum begeistern. Moralische Werte wurdenaus Prinzip abgelehnt. <strong>Die</strong>se Umstände boten keine opt<strong>im</strong>alen Voraussetzungenfür kritische Medien. Denn diese wurden zunächst noch vonden Alliierten kontrolliert, bevor sie zurück in deutsche Verantwortunggelangten. In drei Phasen sollten die Medien zur Demokratie erzogenwerden. Zuerst wurden alle – insbesondere galt dies für Zeitungen –deutschen Informationsdienste ausgeschaltet, dann neue, alliierte Medieninstalliert, die schließlich auf Deutsche zurück übertragen wurden. Aufdem Pressemarkt wurden entsprechende Lizenzen verteilt. Opt<strong>im</strong>al füreine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit wardieses Verfahren jedoch nicht. So ging die Aufsicht der Alliierten so weit,dass unkonforme Meinungsbeiträge nicht gedruckt wurden. <strong>Die</strong>s ändertesich erst 1949. Von nun an konnte jeder ohne vorherige Genehmigungein Blatt herauszubringen. Damit drängten die Altverleger zurück auf denMarkt. Eine ideologische und wirtschaftliche Konzentration der Presse wardie Folge. Aktiv konnte sich keine Kritikfunktion der Medien etablieren.199
<strong>Die</strong> deutsche Pressefreiheit entstand also zunächst durch die Alliiertenund dann durch das Grundgesetz als ein Wert von außen, jedoch nichtaus der Mitte der Gesellschaft.Um die Unabhängigkeit der Medien auch in anderen Bereichen zusichern , wurde der Rundfunk schließlich öffentlich-rechtlich organisiert;1950 schlossen sich die Landesanstalten zur ARD zusammen. Zu einerkritischen Aufarbeitung der jüngsten Ereignisse trug das jedoch nichtbei. Dass sich die Bevölkerung mit der jungen Demokratie vor allemüber die boomende Wirtschaft identifizierte, spiegelte sich auch in denMedien wider. Recherchierender Journalismus, der sich kritisch mitPolitik und Wirtschaft auseinandersetzte, blieb selten. <strong>Die</strong> Folgen dieserEntwicklung sind bis heute <strong>im</strong> deutschen Journalismus in zweifacherWeise spür- und sichtbar: Zum einen hat sich keine Recherchekultur <strong>im</strong>deutschen Journalismus gebildet. Kritik und Kontrolle wurden und werdenkaum als eine pr<strong>im</strong>äre Aufgabe der Medien verstanden, wichtiger sindChronistenpflicht, journalistische Edelfelder – wie die Seite-Drei-Geschichteder SZ oder die große Spiegel-Reportage und der Meinungsjournalismus.Der Leitartikel ist direkter Ausdruck der selbsternannten Leitmedien.Dabei stellt sich unweigerlich die Frage, wie Sachverhalte und Missständekommentiert werden können, die gar nicht recherchiert wordensind. Zwei Antworten sind denkbar: Gar nicht oder beliebig. Bereits 1980hat der damalige ZDF-Redakteur und heutige Intendant des DeutschlandradiosErnst Elitz den Recherche-Zustand <strong>im</strong> deutschen Journalismuspassend beschrieben: „Journalisten, die lieber gleich ihre Meinung sagen,anstatt zu recherchieren, Kommentatoren, die über die Köpfe des Publikumshinweg argumentieren – das ist der Alltag der Medien in derBundesrepublik.” Daran scheint sich bis heute nichts geändert zuhaben, wie Hans Leyendecker kritisiert: „<strong>Die</strong> Deutschen sind Meister <strong>im</strong>Meinungsjournalismus. Wer den Leitartikel schreiben darf, <strong>im</strong> Presseclubsitzt, hat den Ausweis höchster Kompetenz erreicht.” Ob die Medien tatsächlichals Vierte Gewalt <strong>im</strong> Staat gelten können, muss folglich nichtnur aus presserechtlicher, sondern auch aus journalistischer Sicht angezweifeltwerden. Wichtiger als Kritik und Kontrolle ist die Nähe zurMacht. So überrascht es kaum, dass die Berufe des Politikers und desJournalisten <strong>im</strong> Ansehen der Bevölkerung in trauter Zweisamkeit auf denhinteren Plätzen rangieren. In der Prestigeskala des Allensbacher Institutsfür Demoskopie vom Jahr 2003 liegt der Journalist <strong>im</strong> Ansehen aufPlatz 14, der Politiker auf Platz 16 – von <strong>im</strong>merhin 18. Tendenz fallend.200
Nestbeschmutzer und SchnüfflerZum anderen ist eine Spezialisierung zum Recherche-Profi ausgeblieben.Deutsche Journalisten sind Generalisten. Zeitungsseiten planen, mit derDigital-Kamera Fernsehbeiträge filmen, Hörfunkreportagen produzierenund gleichzeitig auf den Inhalt achten. <strong>Die</strong> Recherche bleibt dabei aufder Strecke. In diesem Umfeld werden auch Nachwuchs-Journalisten sozialisiert,die größtenteils volontieren, ohne auch nur ein Recherche-Seminar zu absolvieren. Ähnliches gilt für die Journalistenausbildung anden Hochschulen. Immer noch fehlt das Bewusstsein für die Wichtigkeitder Recherche. Das zeigt sich auch an den Reaktionen der Kollegen <strong>im</strong>Redaktionsalltag. Wer recherchiert, fällt für die aktuelle Produktion ausund hat nicht selten den Rechtfertigungsdruck gegenüber der eigenenRedaktion <strong>im</strong> Nacken. Hinzu kommen die Probleme der eigentlichenRecherche.Erkennt die eigene Profession schon nicht den Sinn und Zweck des investigativenJournalismus an, so kann kaum auf Verständnis in der Bevölkerunggehofft werden – <strong>im</strong> Gegenteil: Der Überbringer schlechter Nachrichtenmuss in Deutschland regelmäßig damit rechnen, als Nestbeschmutzeroder Schnüffler zu gelten. Recherche muss sich also <strong>im</strong>merwieder neu behaupten: Gegenüber dem Publikum, der eigenen Redaktionund sich selbst. Denn auch die Rechercheure müssen sich <strong>im</strong>merwieder dazu motivieren, trotz aller Widerstände Akten zu durchforstenund unbequeme Fragen zu stellen. Bemerkenswert ist, dass sich diemeisten Journalisten dieses Mangels überhaupt nicht bewusst sind. ImVergleich zu amerikanischen Journalisten glauben sie viel eher, ihreFunktion in der Demokratie angemessen zu erfüllen, wie Wolfgang Donsbachgezeigt hat. Zu diesen Aufgaben gehört durchaus auch das Aufzeigenvon Missständen. Donsbach ist sich jedoch nicht sicher, ob dieseSelbsteinschätzung „eher Ausdruck eines stärkeren Selbstwertgefühlsoder einer unterentwickelten Fähigkeit zur Selbstkritik ist.” Das wirftauch die Frage auf, was in deutschen Redaktionen überhaupt unterRecherche verstanden wird. Das Heraussuchen von Telefonnummern,Googlen oder der Anruf be<strong>im</strong> bereits x-mal zitierten Experten? Rechercheergibt nur dann Sinn, wenn sie eine demokratietheoretische Funktion erfüllt,oder anders gedrückt: Anliegen und Ziel der Recherche sind entscheidend.Dabei geht es grundsätzlich darum, gesellschaftliche Missständeaufzudecken. Insofern grenzt sich Recherche <strong>im</strong>mer vom Boulevardjournalismusab, der teilweise zwar die gleichen Methoden benutzt,201
jedoch kaum politisch relevante oder komplexe Themen aufgreift.Entscheidend ist darüber hinaus, dass der Journalist selbst aktiv wirdund nicht aus Pressekonferenzen oder -mitteilungen die Nachrichtenminuteoder den Artikel schreibt.Vergebliche Suche nach VielfaltDer Rechercheur braucht Neugier, Misstrauen, ein wenig Respektlosigkeitund viel Phantasie als grundlegende Eigenschaften. Das reicht jedochnicht aus, denn <strong>im</strong>mer wieder ergeben sich Einschränkungen institutionellerArt. <strong>Die</strong> privatwirtschaftliche Struktur der deutschen Pressewirkt sich negativ auf die Recherchebedingungen aus. Wenige Zeitungskonzernehaben den deutschen Markt unter sich aufgeteilt, in vielenStädten steht den Lesern nur eine Lokalzeitung zur Verfügung. Vielfaltist wird hier vergebens gesucht. Auch die Wiedervereinigung wurde nichtdazu genutzt, den publizistischen Markt zu erweitern. Im Gegenteil: DasWestsystem wurde auf den Osten übertragen, und Unternehmen wie derWAZ-Konzern haben ihre Vormachtstellung weiter ausgebaut. Vor allemdie lokale Recherche hat mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen,was eigentlich paradox ist, schließlich sind die Leser vor allem an Informationenüber ihr eigenes Umfeld interessiert. Insofern würden erhellendeRecherchen aus diesem Bereich besonders geschätzt werden.Doch oftmals ist die Abhängigkeit der Zeitungen von lokalen Unternehmenzu groß. Wenn der Verlust von Anzeigen droht, wird auf eine kritischeBerichterstattung schon mal verzichtet. Dabei ist eigentlich die Meinungskraftder einzigen Zeitung am Ort nicht zu unterschätzen. Dennweder kritisierte Politiker noch Unternehmer haben die Möglichkeit, ihreSicht der Dinge in einem anderen Medium zu platzieren. Doch oftmalshaben Lokaljournalisten überhaupt nicht die Möglichkeit, Zeit in Recherchezu investieren. Stellen werden gestrichen und die Arbeitsbelastungsteigt. So wird der eigentliche Inhalt <strong>im</strong>mer mehr von freienMitarbeitern gestaltet. Das führt zum nächsten Problem: <strong>Die</strong> Honorierung.Finanziell gesehen lohnt sich Recherche nicht. Bezahlt wird nichtnach Aufwand oder Dauer der Recherche, sondern nach produzierterZeile. Ergebnislose Recherchen werden gar nicht bezahlt. Alle Journalisten,denen Recherche wichtig ist, werden so zu einer Mischkalkulationgezwungen: Durch das aktuelle Geschäft werden genügend Freiräumegeschaffen, um von Zeit zu Zeit auch aufwändige Geschichten zu recherchieren.Auch dadurch wird eine Spezialisierung der Recherche-Tätigkeitverhindert.202
Nur für wenige Medien ist Recherche als fester Bestandteil des journalistischenImages wirtschaftlich lukrativ. Es stellt sich die Frage, ob nichtauch lokale Medien dem Vorbild der bundesweiten Blätter wie Spiegel,Zeit und Süddeutsche folgen sollten. Das scheint aus unternehmerischerSicht zurzeit allerdings unwahrscheinlich. Zu gut verkauft sich derBoulevard.Zu wenig Dualität der RechercheDer Erfolg des Boulevard lässt sich <strong>im</strong> Printsektor genauso wie <strong>im</strong> Rundfunkfeststellen. Zwar kann mit einigen öffentlich-rechtlichen Sendernüber Recherchezulagen verhandelt werden, doch richtet sich dasHonorar in der Regel nach der Länge der Beiträge. <strong>Die</strong> Dualität desRundfunksystems scheint keine Dualität der Recherche mit sich zu bringen,die sich an dem Muster orientiert: Hier der öffentlich-rechtliche Investigativjournalismus,dort der private Boulevard. <strong>Die</strong> Öffentlich-Rechtlichenhaben es nach der Einführung der Privaten versäumt, sich bewusst vonder kommerziellen Konkurrenz abzugrenzen. Stattdessen haben siekopiert und das Programm boulevardisiert. <strong>Die</strong> Folgen sind bekannt:Vor allem die Debatte um die Rundfunkgebühren wird regelmäßig zurFarce, in der es eher um politische Profilierung denn um inhaltlicheEntscheidungen geht. Dass das Bundesverfassungsgericht bereits 1992die Gebührenfinanzierung eindeutig bestätigt hat, wird oft und gernevergessen.Durch verpackte Werbesendungen wie „Wellness TV” oder „Praxis – DasGesundheitsmagazin” machen sich die öffentlich-rechtlichen Programmeallerdings selbst angreifbar. Thomas Assheuer hat es <strong>im</strong> Januar 2004 <strong>im</strong>Zeit-Dossier klar herausgestellt: „Der eigentliche Skandal ist derBanalisierungsschub, von dem ARD und ZDF he<strong>im</strong>gesucht werden, ihretief empfundene Neigung und Schamlosigkeit.” <strong>Die</strong> Lösung des Problems?„Warum machen sie sich die Reform so schwer, obwohl sie dochganz einfach wäre? ARD und ZDF müssten sich nur wieder an ihrenursprünglichen Auftrag erinnern.” Dabei ist jedoch auch zu betonen:„Panorama”, „Monitor” und „Phoenix” sind allesamt öffentlich-rechtlicheProdukte. Ebenso sind die ersten Rechercheredaktionen be<strong>im</strong> MDR undZDF entstanden. Ersten Untersuchungen zufolge lohnt sich die Arbeit derneu geschaffenen Einheiten. Inwieweit sie Vorbild sein können, musssich noch zeigen. Finden sich genug Nachahmer, könnte Recherche nachund nach in der deutschen Medienlandschaft institutionalisiert werden.Zurzeit ist das nicht der Fall.203
Pseudo-Vielfalt statt KontinuitätSolange sich nichts ändert, fehlt eine wichtige Bedingung der Recherche:Kontinuität. Immer wieder sorgen Quoten- bzw. Auflagen- und Aktualitätsdruckdafür, dass komplexe Themen warten müssen. Sowohl freienals auch festangestellten Journalisten ist es kaum möglich, über Wochenoder Monate an einem Thema dran zu bleiben. Nur eine sehr hoheEigeninitiative ermöglicht diesen Einzelkämpfern ihre Arbeit. Dabei hatsich gezeigt, dass wichtige Recherchen über einen längeren Zeitraumverfolgt werden müssen, sei es <strong>im</strong> Watergate-, <strong>im</strong> Flick-Skandal oder beider CDU-Spendenaffäre. Der journalistische Alltag ist jedoch auf Schnelligkeitund Exklusivität angelegt. In <strong>im</strong>mer knapperer Zeit müssen Informationengesammelt, gesichtet, ausgewertet und in ein journalistisches<strong>Format</strong> umgesetzt werden, um sie danach laufend zu aktualisieren. Unterdiesem Druck greifen Journalisten auf bereits vertraute Muster zurück.<strong>Die</strong>s gilt besonders für die Nutzung von Quellen. Je einfacher Informationenverfügbar sind, desto eher werden sie Bestandteil des journalistischenProdukts. Neben den Nachrichtenagenturen gewinnen damit PRund Öffentlichkeitsarbeit an Bedeutung. Ist es ökonomisch noch geboten,204
auf die abonnierten Agenturen zurück zu greifen, so leidet gleichzeitigallerdings die Vielfalt darunter, dass die meisten Medien dieselbenQuellen nutzen. Pseudo-Vielfalt ist die Folge, die sich dadurch auszeichnet,dass in unterschiedlichen Zeitungen oder Sendern exakt dieselbenNachrichten oder Berichte publiziert werden.Medien als Wirtstier der PRBedenklich ist darüber hinaus die weiter zunehmende Bedeutung derPR. Hat Barbara Baerns schon 1985 den Einfluss der Öffentlichkeitsarbeitauf den Journalismus hervorgehoben, so bestätigt eine Untersuchungder Düsseldorfer DIKOM-Agentur aus dem Jahr 2002 diesen Trend.Analysiert wurden die Auswirkungen der aktuellen Einsparungen auf denredaktionellen Alltag. Demnach geben fast die Hälfte der befragten Journalistenan, für eigene Recherche keine Zeit mehr zu haben. Eindeutigist ebenfalls die Schlussempfehlung der Agentur: „Wer Journalistendurch qualitativ hochwertige Zulieferungen Arbeit abn<strong>im</strong>mt und damitden Verlagen Kosten erspart, dringt mit seinem Anliegen wesentlichleichter durch als derjenige, der nicht in die Aufbereitung von Informationeninvestiert.” Da ebenfalls die Menge an Pressemitteilungen<strong>im</strong>mer weiter wächst, haben gut formulierte PR-Mitteilungen steigendeChancen, unredigiert publiziert zu werden. Dabei ist auch klar, dass dieÖffentlichkeitsarbeit selbst ein hohes Interesse daran hat, die Seriositätder Medien aufrecht zu erhalten. Nur so überträgt sich die Glaubwürdigkeitder Medien auf die veröffentlichten PR-Mitteilungen. In einer geradezuaufreizenden Deutlichkeit greift diesen Gedanken der PR-ManagerKlaus Kocks in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau anlässlichihres Relaunchs auf: „Daraus sollten PR-Manager die Überzeugung gewinnen,dass es gilt, für die Grundfesten der Publizistik einzutreten –auch und gerade als „spin doctor”. Der Parasit hat nämlich das allergrößteeigene Interesse an der Gesundheit seines Wirtstieres, von demer (gut) lebt.” <strong>Die</strong>se Offenheit sollte ein Appell an den kritischen Geistder Journalisten sein.Medien-Mainstream durch SelbstreferenzNeben der PR und den Agenturen nutzen die Medien darüber hinaussich selbst besonders gerne als Quelle. Einerseits ergibt sich dadurchdie Möglichkeit, dass mehrere Medien offensiv auf Missstände hinweisenund so eine größere Öffentlichkeit herstellen, andererseits besteht die205
206Gefahr der Selbstreferenz ohne Neuigkeitswert, <strong>im</strong> schl<strong>im</strong>msten Fallsogar die Weiterverbreitung von falschen Tatsachen. Sebnitz mag da alsabschreckendes Beispiel dienen. Entscheidend be<strong>im</strong> Aufgreifen vonThemen sind zwei Aspekte: <strong>Die</strong> Journalisten müssen eigenständig(weiter-) recherchieren und dürfen nicht nur kopieren; außerdem mussdas Thema gesellschaftlich relevant sein. So kann das Profil des eigenenProdukts geschärft werden. Wird nur wahllos kopiert, so bleiben dieThemen jenseits des Medien-Mainstreams auf der Strecke.Entscheidend be<strong>im</strong> „Weiterdrehen” einer Geschichte erscheint somit dieFrage, woher die bereits vorhandenen Informationen bezogen werden.Einer Analyse von Michael Haller zufolge fehlt etlichen Redaktionen derZugriff auf ein eigenes Archiv. Das journalistische Produkt muss somit<strong>im</strong>mer wieder neu gestaltet werden – systematisches Anknüpfen an bereitserledigte Recherchen ist kaum möglich. Das Ergebnis: Arbeitenwerden doppelt erledigt und für die wirklich spannenden Fragen bleibtmal wieder keine Zeit. Wissensmanagement scheint in deutschen Redaktionenmeist noch ein Fremdwort, schlecht geführte Adressverzeichnissegehören dafür eher zum Alltag. Insbesondere für Nachwuchs-Journalistenerweist es sich so als schwierig, in redaktionellen Abläufen neue Recherchewegezu gehen.Das Internet wird schließlich zu einer der wichtigsten Quellen. Nebendem E-Mail-Verkehr dienen vor allem Datenbanken als Hilfe bei derInformationssuche. Einer Umfrage unter 500 IT- und Wirtschaftsjournalistenaus dem Jahr 2004 zufolge wird die redaktionelle Arbeit durch dasInternet unabhängiger und eigenständiger als früher. Vor allem Basisrecherchenwerden online erledigt – also das Suchen nach Telefonnummern,Ansprechpartnern und Adressen. Darüber hinaus können über denAnhang von E-Mails problemlos Dokumente ausgetauscht werden.Elektronische Quellen verdrängen zunehmend andere Informationsträger.<strong>Die</strong>s bedeutet aber auch, dass die Journalisten verantwortungsvoll mitder Technologie umgehen müssen. Ein effektiver Informantenschutz erweistsich beispielsweise als außerordentlich schwierig, wenn derKontakt via E-Mail besteht. Schließlich können die Botschaften auf verschiedenenEbenen mitgelesen und kopiert werden.Während in deutschen Redaktionen eher der Grundsatz „learning bydoing” <strong>im</strong> Umgang mit neuer Technologie gilt, wird in den USA gleichein neues Berufsfeld etabliert: Unter der Bezeichnung ComputerAssisted Reporting (CAR) führen vor allem Zeitungen selbst statistischeAnalysen durch und bilden hierfür extra Mitarbeiter aus. Darüber hinausist die Evaluation der genutzten Online-Quelle maßgeblich. Wird unsauber
echerchiert, so fällt dies in der Regel allerdings nicht unmittelbar auf.Denn ein systematisches Überprüfen der Fakten findet in der Regel– Ausnahme ist die Dokumentation be<strong>im</strong> Spiegel – nur selten statt.Selbstbeschränkung der RechercheManchmal sind es gar nicht die Kollegen, die das journalistische Produktgegenlesen oder überprüfen, sondern vielmehr diejenigen, über die berichtetwird. Das Autorisieren von Interviews ist <strong>im</strong> angelsächsischen Raumunüblich. In Deutschland dagegen geht die Macht des Gesprächspartnersteilweise so weit, dass einzelne Zitate in Artikeln zur Veröffentlichungfreigegeben werden müssen. Im November des vergangenen Jahres sinddeshalb Berliner Zeitung, SZ, Kölner Stadt-Anzeiger, Tagesspiegel, FAZ,FTD, <strong>Die</strong> Welt, FR und taz in einer gemeinsamen Aktion der Frage nachgegangen,wie sinnvoll diese gängige Praxis ist. <strong>Die</strong> taz machte sogarauf der Titelseite mit dem Thema auf. Ursprünglich war hier die Veröffentlichungeines Interviews mit dem damaligen SPD-Generalsekretär OlafScholz geplant. <strong>Die</strong>ser korrigierte jedoch so viel an dem Interview, dass dietaz schließlich die autorisierte Fassung nicht veröffentlichte. Stattdessen erschienauf dem Titelblatt das Interview in der Originalfassung; alle Stellen,die Scholz korrigiert hatte oder hatte korrigieren lassen, waren geschwärzt.Das Resultat: Nur die Fragen waren noch zu lesen. <strong>Die</strong>ser Konflikt weistauf gegenseitiges Misstrauen hin. Nicht nur die Politiker ändern Passagenan den transkribierten Interviews, sondern auch die Journalisten haltensich möglicherweise nicht <strong>im</strong>mer exakt oder sinngemäß an das gesprocheneWort und dessen Kontext. <strong>Die</strong> Hoheit über das journalistischeProdukt wird bewusst aus der Hand gegeben. Taz-ChefredakteurinBascha Mika beschreibt das Problem treffend: „So bleibt die Frage, ob eineseriöse Presse an einer journalistischen Form festhalten kann, die derartigenManipulationen ausgesetzt ist.” <strong>Die</strong> Kraft des Interviews, dem GesprächspartnerAussagen zu entlocken, die dieser eigentlich nicht preisgebenwill, geht verloren. Eine journalistische Darstellungsform wird soihrer Stärken beraubt. Ein Ausweg aus der Misere kann nur wie folgtaussehen: Das gesprochene Wort wird gedruckt, alles andere nicht.Dass auch gefälschte Interviews sehr großen Erfolg haben können, hatdie Vergangenheit gezeigt: Der selbsternannte Borderlinejournalist TomKummer hat jahrelang <strong>im</strong> SZ-Magazin Interviews mit Hollywood-Starsplatzieren können, die nie stattgefunden haben. Damit befindet er sichinternational in guter Gesellschaft. Ob Stephen Glass <strong>im</strong> Magazin NewRepublic, Patricia Smith in der Boston Globe oder Jayson Blair und Judith207
Miller in der New York T<strong>im</strong>es. Im letztgenannten Fall ging es allerdingsnicht um direkte Fälschungen, sondern um die sehr einseitige Berichterstattungder T<strong>im</strong>es vor dem Irak-Krieg. <strong>Die</strong> Konsequenz: <strong>Die</strong> Zeitungentschuldigte sich jüngst für die tendenziösen Artikel.Keine Recherche ohne ProblembewusstseinZusammenfassend zeigt sich: Recherche ist <strong>im</strong> deutschen Journalismuskaum verankert. Weder auf organisatorischer Ebene der Verlage, Redaktionenund Sender, noch in den Köpfen der Journalisten und Ausbilder.Das gilt, obwohl die rechtlichen Rahmenbedingungen gut sind. Immerwieder hat das Bundesverfassungsgericht die Bedeutung der Medienund damit auch der Recherche betont. Verbesserungen sind allerdingsauch hier möglich – etwa durch die Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes(IFG), wie es vom Netzwerk Recherche, den Gewerkschaftensowie humanitären Organisationen gefordert und als Gesetzesvorlage anden Bundestag überreicht wurde. Bereits <strong>im</strong> vergangenen Jahr hat dieBertelsmann Stiftung hierzu eine Analyse vorgelegt, die Sinn und Zweckeines IFG einschätzen sollte – das Fazit: „Möglicherweise könnte einInformationsfreiheitsgesetz sogar ein Signal für eine neue Recherchekulturund eine Stärkung des investigativen Journalismus setzen.” Dassdiese Prognose eintrifft, dafür müssen die Journalisten selbst sorgen.Das weist auf einen entscheidenden Aspekt hin. <strong>Die</strong> Journalisten müssensich darüber bewusst werden, dass Recherche die originär journalistischeTätigkeit schlechthin ist. In den vergangenen Jahren scheint sich einesolche Haltung langsam auszubreiten. Wie beschrieben, haben sich dieersten Recherche-Redaktionen gebildet. Es wäre wünschenswert, wenndamit auch eine Professionalisierung der Informationsbeschaffung einherginge.Nur dann kann auch der journalistische Nachwuchs entsprechendausgebildet werden.Wirft man einen Blick zurück in die 70er Jahre, in denen die Diskussionum den investigativen Journalismus in Deutschland zum ersten Mal aktivgeführt wurde, so zeigt sich die volle Relevanz der Diskussion. Ausgangspunktfür die damalige Auseinandersetzung war die Berichterstattungüber den Bundestagswahlkampf 1976, der <strong>im</strong> Nachhinein als besondersunkritisch galt (Wolfgang Langenbucher: Selbstabdankung eineseigenständigen Informationsjournalismus”). Unter investigativem Journalismuswurde damals nicht nur die journalistische Tätigkeit, sondernauch die kritische Selbstreflexion über eben diese verstanden. Ein wenigRückbesinnung kann nicht schaden!208
DIENEUENSPIN DOCTOREN
210BOULEVARD SCHRÖDER, BOULEVARD BLAIRWARUM SPIN DOCTORSNICHT TOT ZU KRIEGEN SINDStefan Marx<strong>Die</strong> Produkteinführung ist geglückt. Gleich nach seiner Nominierung zumUnionskandidaten für das Amt des Bundespräsidenten tritt Horst Köhlerbei „Kerner” auf. Daneben sitzt Ehefrau Eva, man parliert über dieschwäbische He<strong>im</strong>at und Köhlers Kinder. Noch mehr Privates zu denKöhlers findet sich bei „Bild”. Schon kurz vor seiner Wahl kommt einBuch auf den Markt, in dem Köhler in Interviewform seine Ansichten zumbesten gibt – ein alter Koautor Angela Merkels darf die Stichworte geben.In seiner ersten Rede nach der Wahl führt Köhler den Slogan vom „Landder Ideen” ein, den er seitdem beständig wiederholt. Mit FDP-ParteikommunikatorMartin Kothé holt er sich einen bei Hauptstadtjournalistenangesehenen Pressesprecher ins Bundespräsidialamt.Nichts ist mehr zu hören vom Notkandidaten, von „Horst Wer?”, wie„Bild” noch <strong>im</strong> März 2004 schlagzeilte. Aus dem unbekannten Produkt„Ökonom mit internationaler Erfahrung” ist die gut eingeführte Politik-Marke „Präsident für alle” geworden. Soweit hat Köhler all das bedient,was die Berliner (Medien-)Republik heute verlangt: Nettes privates Geplaudermacht sympathisch, „Bild” ist König, und für den politischenInhalt reichen ein paar häufig zu wiederholende Textbausteinchen – derRest lässt sich <strong>im</strong> Buch nachlesen. Köhler scheint seine Zeit in den USAnicht nur dafür genutzt zu haben, den Internationalen Währungsfondszu leiten, sondern auch etwas über Spin Doctoring zu lernen.Spin Doctor – ein Wesen gerät in VerrufDas Spin Doctoring, die gezielte Einflussnahme auf Journalisten, um eineMeldung in eine best<strong>im</strong>mte Interpretationsrichtung zu drehen, ihr einenDrall („spin”) zu geben – das versucht die Politik eigentlich schon <strong>im</strong>mer.Der Begriff soll aber beschreiben, dass dies nun ressourcenreicher undmit sorgfältigerer Planung geschieht. Der „Spin Doctor” ist nicht wissenschaftlichdefiniert, er ist ein Wesen der Medienwelt. Er hat etwasvon der Aura des finsteren Medien-Manipulators, des Einflüsterers hinterden Kulissen. Im Allgemeinen werden jene politischen Berater als „SpinDoctor” bezeichnet, die freien Zugang zum Denken ihres Chefs haben,
sie beraten und daher Journalisten kompetent Auskunft geben können –meist off the record. Sie sind auch in den Medien eine Art Spürhund fürihren Chef – sie erfühlen, welches Image ihr <strong>Die</strong>nstherr bei der Journalisten-Meutehat. Der „Spin Doctor” ist also in den Medien ein Wesender Dunkelheit, ein Politikberater, dessen Ziel vor allen Dingen ist, dieMedien in seinem Sinne zu manipulieren.Ein Grund für den Bedarf an mehr Kommunikationsberatung in derPolitik ist das gewachsene Medienangebot. In den USA wirkt die offiziellePolitik schon seit Jahrzehnten gezielt auf die Journalisten ein, um sichselbst ins beste Licht zu rücken. So bildete Präsident Richard Nixon 1969<strong>im</strong> Weißen Haus das „Office of Communications”, das sich in bewussterAbgrenzung vom „Press Office” um die langfristige Kommunikations-Strategie kümmert. Heutzutage hat sich in Washington eine Berater-Industrie aus „Spin Masters” formiert, die begierig Aufträge von Regierenden,Abgeordneten und Kandidaten aufsaugt. <strong>Die</strong> Techniken der SpinDoctors haben deutsche Wahlkämpfer schnell gelernt, während es <strong>im</strong>Regierungsalltag daran noch mangelt. <strong>Die</strong> zentralen Ideen sind aberauch deutschen Politikern und ihren Sprechern geläufig: Es braucht eineZentralisierung der Kommunikation, damit eine klare Linie und keineKakophonie nach außen kommuniziert wird. Angriffe des politischenGegners und Falschmeldungen müssen sofort beantwortet werden, sonstbleiben sie <strong>im</strong> 24-Stunden-Nachrichtenzyklus ohne Widerspruch stehenund schlagen Wellen. Journalisten muss man gezielt mit Exklusivem füttern,um die eigene Botschaft ständig <strong>im</strong> Gespräch zu halten.Das sind die Weisheiten aus dem Handbuch des Spin Doctors. Nur ist derBegriff in Verruf geraten: Wollte vor ein paar Jahren noch jeder Pressestellen-Praktikantin Berlin gern mal ein großer „Spin Doctor” sein, so löstdas Wort jetzt bei deutschen Politikberatern Naserümpfen aus: „Wer fürsich reklamiert, Spin Doctor zu sein, der wirkt auf jeden Fall unseriös”,sagt etwa der deutsche Regierungssprecher Bela Anda. Das Unseriöse warnicht <strong>im</strong>mer da: Tony Blair stellte die Medienarbeit von dem Moment anins Zentrum, an dem er 1994 den Labour-Vorsitz in London übernahm. Ausder zerstrittenen, altlinken, von der Boulevardpresse gehassten LabourParty machte er eine nach außen geeinte, gut geölte Kampagnenmaschinerie.Gerhard Schröder und die SPD machten sich Blair zumVorbild. Legionen von SPD-Kampagnenmanagern pilgerten über denÄrmelkanal, um von New Labour zu lernen. Doch schon mit dem Wahlsieg1997 wurde Blairs Ansatz, <strong>im</strong>mer die Schlagzeilen des nächsten Tagespositiv beherrschen zu wollen, unter Beschuss – bis die Glaubwürdigkeiternsthaft litt. Das beobachteten auch Schröders Berater aufmerksam.211
Der Ärger, den New Labour in Großbritannien mit „Spin” hatte, ist inDeutschland insgesamt nicht unbeachtet geblieben: Blairs Regierungmusste sich den Vorwurf gefallen lassen, statt klarer Politikentwürfe nurInszenierung zu bieten. <strong>Die</strong> guten Verkäufe von New Labour haben sichgegen die Regierung gewendet. Jahrelang versprach Blair neben stabilemWirtschaftswachstum bessere Schulen, Krankenhäuser und Eisenbahnen.Jetzt zeigen sich erste Erfolge, doch Labour profitiert davon kaum –stattdessen dominiert das „I was lucky”-Syndrom: Viele Wähler sehenVerbesserungen, glauben aber, das sei nur ein individuelles Erlebnis, dassich nicht verallgemeinern lässt. Als Sargnagel für den „Spin Doctor”wirkte schließlich die unklare Rolle von Blairs Spinmaster-in-chief AlastairCampbell bei der propagandistischen Vorbereitung des Irak-Kriegs.<strong>Die</strong> Medien-Hydra will gefüttert werdenDer Vergleich Blair – Schröder lohnt sich: Ein Zuviel an Marketing scheintein Anfängerfehler beider Regierungschefs zu sein. Auch in Deutschlandwurde wohl überinszeniert: 1998 winkten Schröder und Lafontaine fröhlichzu pathetischer Musik und Lichteffekten auf dem Leipziger Wahlparteitag –nicht einmal ein Jahr später wechselten sie kein Wort mehr miteinander.Schröder ließ sich mit Cohiba <strong>im</strong> Brioni-Anzug ablichten und zierte Gott-212
schalks Couch bei „Wetten dass”. Der Spaß am Regieren ist aber schonlange vorbei, und das Wort vom „Medienkanzler” folgt nun meist denWorten „Schröder galt einst als”. Also bye, bye, Spin Doctor?Ja, es st<strong>im</strong>mt: Der „Spin Doctor” ist ein Abwehrbegriff der Medien gegenpolitische Öffentlichkeitsarbeit. Er soll den Lesern suggerieren: „Ich, derunabhängige Journalist, lasse mich nicht von der Gaukelei der Politiktäuschen”. Im Extremfall soll er sogar die politische Medienarbeit per sediskreditieren – egal ob sie als professionelle Inszenierung oder als unschuldig-langweiligerWaldschadensbericht daherkommt. Aber eineslässt sich nicht wegdiskutieren: <strong>Die</strong> Medien haben sich gewandelt, sindschneller, hektischer, wettbewerbsorientierter als früher – und die Politikmuss darauf reagieren, ob sie will oder nicht. Ob man das nun als „SpinDoctoring” bezeichnen will, ist wohl eher Geschmackssache.Tausende akkreditierte Journalisten lauern in Berlin auf Storys. VorOrt sitzen neben einem opulenten „Bild”-Büro zwei weitere Boulevardzeitungen.Auch die seriöse Presse lässt sich trotz Medienkrise nichtlumpen und ist in großer Besetzung präsent. Das öffentlich-rechtliche EreignisfernsehenPhoenix braucht Live-Bilder und aktuelle Statements,ebenso wie die beiden Nachrichtensender n-tv und N24.In Großbritannien ist die Atmosphäre <strong>im</strong> „Westminster Village” sogarnoch heißer: Ein Dutzend nationale Zeitungen, drei Nachrichtensenderund die Politiker und Beamten hocken auf engstem Raum aufeinander.<strong>Die</strong> deutschen Institutionen sind traditionell dezentraler und föderalistischerangelegt. In Deutschland und England gilt so oder so: Alle dieseMedien wollen neue Nachrichten haben und müssen gefüttert werden.Weil die Chefredaktion ihr Medium gern in den Nachrichtenagenturenzitiert sieht, sind Exklusivstorys zum Fetisch geworden – ob das dieLeser interessiert oder nicht, ob der Werbeeffekt, als Quelle in den Morgennachrichtengenannt zu werden, wirklich hilft oder nicht. Am klarsten hates die 2000 neugegründete „Financial T<strong>im</strong>es Deutschland” ihren Redakteureneingeschärft: „Wir sind <strong>im</strong>mer auf der Suche nach exklusivenGeschichten. Wir wollen Scoops – relevante Informationen, die andereBlätter nicht haben.” Damit sollte die britische Tradition des investigativenJournalismus in Deutschland zum Blühen gebracht werden.Jede politische Organisation – ob Partei oder Behörde – sieht sich in Berlineiner hungrigen Medien-Meute gegenüber. <strong>Die</strong> einen müssen um Aufmerksamkeitkämpfen, die anderen bekommen sie mehr, als ihnen zuweilenlieb sein kann. <strong>Die</strong> Rede ist von Bundesregierung und den Koalitionsparteien.Sie müssen den Medien Stoff bieten. Tun sie das nicht,findet sich für Journalisten <strong>im</strong>mer etwas: Da wird aus einer kleinen Ab-213
st<strong>im</strong>mungsschwierigkeiten zwischen Ressorts ein Riesen-Streit. Referentenentwürfelanden als Plan der Bundesregierung in der Zeitung. Undsieht ein Minister mal müde aus, kommen sofort die Spekulationen überseine baldige Demission.Ohne politische Strategie misslingt jede Medien-Taktik<strong>Die</strong> Regierung muss zumindest versuchen, dem etwas entgegenzusetzen.Das ist nicht nur in ihrem eigenen Interesse, sondern auch ein <strong>Die</strong>nst ander Demokratie. Denn endlose Spekulationen verunsichern die Bürger undtragen zum Verdruss bei. Man nehme zum Beispiel die ständige Saga ummögliche Kabinettsumbildungen oder den Rücktritt des Kanzlers: Für Journalistenund politisch Interessierte ist das eine interessante Daily Soap –für die restlichen zwei Drittel der Bevölkerung kommt der Eindruck auf, inder Politik gehe es überhaupt nicht mehr um Lösungen, sondern nur nochum Pöstchen, Ämter und Egos. Zur Verunsicherung tragen dann nochunausgegorene Vorschläge und Profilierungsversuche bei: Wenn es beispielsweisedas gesamte Wochenende über heißt, der Sparkurs <strong>im</strong>Bundeshaushalt werde aufgegeben, ohne dass schnell ein klares Dementides Bundeskanzlers kommt, muss der Eindruck entstehen, die Regierungbeabsichtige, einen Testballon steigen zu lassen. Wenn Ideen wie Wegfalldes Sparerfreibetrags, Streichung von Urlaubstagen oder mögliche Steuererhöhungdurch die Medien geistern – teilweise von Bundesministernangestoßen –, ist es umso nötiger, dass die Zentrale, sprich das Bundeskanzleramt,eine klare Linie vorgibt und kommuniziert.Womit schon eine Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation – odererfolgreiches Spin Doctoring – angesprochen ist: Nötig ist eine vorausgedachte,klar abgest<strong>im</strong>mte politische Strategie. Wer kein Konzept hat,kann auch keines kommunizieren. Reagiert die Regierung nur auf Ereignisse,ist sie <strong>im</strong> Amt, aber nicht an der Macht (wie der frühere britischeFinanzminister Nigel Lawson sagte). Und so befindet sich die SPD schonseit den 90er Jahren in einer Identitätskrise. Sie hat sich nicht programmatischauf die Realitäten des Regierens eingestellt, wie es New Labourtat. Deswegen hat die zentrale Botschaft von Rot-Grün in den vergangenenJahren häufig gewechselt, es fehlte die Überschrift. Der damaligeRegierungssprecher Uwe-Karsten Heye wollte den Journalisten gar weismachen,die Essenz von Rot-Grün bestehe in „trial and error” – wohl dasLetzte, was ein Spin Doctor sagen kann, wenn nichts zum Drehen da ist.Erst seit Anfang 2003 versucht Bundeskanzler Schröder, sich mit derAgenda 2010 ein neues Gesamtkonzept zu geben. Dabei kam die Bot-214
schaft des Modernisierers relativ unvorbereitet und konzentrierte sichschon in der ersten Regierungserklärung zu sehr auf die technischenDetails der sozialen Einschnitte, statt die Ausgangslage und das eigentlicheZiel der Reformen zu schildern. Zumindest ist nun aber eine klareLinie erkennbar, die der Kanzler offenbar auch gegen Widerständedurchhalten will. Das könnte sich langfristig auszahlen, auch wenn dieSPD kurzfristig durch ein Tal der Tränen gehen muss.„Bild” sitzt am KabinettstischDafür scheint das Tischtuch mit der „Bild”-Zeitung zerschnitten zu sein.Kein Interview mehr, das ist die Ansage Gerhard Schröders, was es seinenSprechern nicht gerade leichter macht: Wo nur eine nationale Boulevardzeitungexistiert, kann man nicht mehrere gegeneinander ausspielen,so wie es Blairs Spin Doctors gern taten. Und die auflagenstärksteTageszeitung zum erklärten Feind zu haben erschwert das Regieren.Dabei verlässt sich Schröder doch so gern auf St<strong>im</strong>mungen in großenBuchstaben: Aus den Koalitionsverhandlungen 1998 ist überliefert,Schröder habe mehrfach die Grünen aufgefordert, daran zu denken, wasdie „Bild”-Zeitung zu ihren Forderungen sagen würde. So saß „Bild”gleich von Anfang an mit am Regierungstisch. Der Fall „Florida-Rolf” war2003 ein Musterbeispiel für die „Politik <strong>im</strong> System Schröder”, wie die„Süddeutsche Zeitung” am 3. September 2003 unter der Überschrift„Boulevard Schröder” feststellte. „Entschieden wird oft ad hoc, und dieGesetze haben ihren Ursprung nicht selten in den Medien, besondersjenen mit den dicken Schlagzeilen.” Der Fall eines Sozialhilfeempfängersin Florida reichte aus, um mal eben das Bundessozialhilfegesetz zuändern, um solche Fälle zu unterbinden. Tagelang hatte „Bild” über denFall berichtet, und die Bundesregierung reagierte prompt. Einspareffekt:rund vier Millionen Euro. Auch Schröders Kollege Tony Blair musste 2004St<strong>im</strong>mungen am Boulevard nachgeben: Nachdem die Presse tagelang kurzvor der EU-Osterweiterung vor Sozialschmarotzern aus Osteuropa gewarnthatte, berief er in Downing Street einen „Einwanderergipfel” ein, umMasseneinwanderung zu verhindern. <strong>Die</strong> Ergebnisse des Treffens warenmin<strong>im</strong>al, und am ersten Tag der neuen EU wurden noch nicht einmal 30arbeitswillige Neu-EU-Bürger an Englands Küste gesichtet. Symbolpolitik,die der Presse und den Bürgern suggerieren soll: <strong>Die</strong> Politik kümmert sich.Dabei kann sie in Wahrheit gar nichts tun: <strong>Die</strong> EU-Osterweiterung warschon lange beschlossene Sache. Und die Änderung des Sozialhilfegesetzeskönnte sogar den Staat teurer gekommen sein als der Status quo.215
Politik – nur noch Getriebene des Boulevards?<strong>Die</strong> Politiker müssen also aufpassen, nicht zu Getriebenen der Krawall-Medien zu werden. Längst gilt „Bild” bei den deutschen Journalisten alsLeitmedium, ein stolzer Titel, den vorher allenfalls „Spiegel” und „FAZ”für sich beanspruchen konnten. Dabei geriert sich „Bild” geradezuverantwortungslos: <strong>Die</strong> Zeitung warb zum Beispiel mit einer kräftigenKampagne für eine Streichung der Ökosteuer, damit die Spritpreisefallen – wie die Lücke bei den Rentenbeiträgen gefüllt werden soll, verrietdas Blatt den Lesern aber nicht. Trotzdem: Personalspekulationen, Skandaleund Polit-Kampagnen interessieren nun auch die Kollegen von derseriösen Presse. <strong>Die</strong> Skandalisierung öffentlicher Vorgänge wird weitergehen.Der Fall Welteke zeigt, dass heute schon der Anschein einer Beeinflussungausreicht, um das Amt zu verlieren – wenn noch eine falscheReaktion wie bei der ersten Pressekonferenz Weltekes dazukommt, istdas Fallbeil kaum noch aufzuhalten. Wie die Politik hier gegensteuernkann? Dafür gibt es keine Patentrezepte, am ehesten hilft es noch,erfahrene Sprecher oder Spin Doctors zu haben – Profis, die wissen, wiedie Medienmeute tickt und die die Routinen ihrer Kollegen kennen.Ohne diese Profis geht es nicht mehr. Sie müssen auch als enge Beraterdabeisitzen, wenn politische Konzepte ausgearbeitet werden, alleinschon um zu verstehen, was sie da später an die Öffentlichkeit verkaufensollen. Zu oft herrscht noch in deutschen Amtsstuben die Denke, erstmüsse das fertige Politikkonzept vorliegen, bevor man sich Gedankenüber die Vermittlung macht. Gute Präsentation, das schärfte Blairs SpinDoctor Campbell gleich zu Amtsantritt allen Kollegen ein, ist kein Zusatz,sondern Kernbestandteil einer guten Politik. Das muss keine Luftnummernohne Substanz produzieren – das erkennen die Medien schnell, wieauch Campbell bald zu spüren bekam. Es heißt, dass kluge Denker beider konzeptionellen Arbeit auch darauf achten müssen, was daraus späterfür Schlagzeilen (gewollte und ungewollte) werden können. Nunkann man einwenden, dass Spin Doctoring in Deutschland ohnehin nichtgeht: Zu viele Machtzentren lassen eine zentrale Kommunikation nichtzu – Parteiflügel, Bundesrat und Länderfürsten seien schnell mit Widerspruch,die Bundesminister pochten auf ihre Ressortkompetenz, währendin London eine Machtzentrale schaltet und waltet. Aber genau das sollteeher Ansporn sein, wenigstens jene Kakophonie <strong>im</strong> eigenen Kabinettund in der eigenen Partei klein zu halten, auf die man Einfluss hat. SpinDoctoring muss dann Schadensbegrenzung leisten. Mit den Regeln derBundespressekonferenz („unter Drei”) und den traditionellen Hinter-216
grundkreisen von Journalistenmit Politikern hat sich seitJahrzehnten ohnehin gezeigt,dass die Politik sanften Einflussauf die Presse nehmenkann. Dass die Journalistenheute weniger unterwürfigsind als früher, ist eine positiveEntwicklung. Problematischwird es nur, wennSkandalisierung und Spekulationeneine vernünftigepolitische Debatte unmöglichmachen – und dieser Punktist oft erreicht.Kanzler allein zu HausSchröder lässt sich gern von Medienexperten beraten. Waschechte SpinDoctoren fehlen aber <strong>im</strong> Kanzleramt: Hausmeier Frank-Walter Steinmeierkommuniziert auch gern in Hintergrundkreisen, aber er kommt eher vonder administrativen Seite. Da hatte sich Schröders Vorgänger Helmut Kohlmit den beiden Medienberatern Eduard Ackermann und Andreas Fritzenkötterschon eher auf die neuen Zeiten eingestellt. Sie waren sich nichtzu schade, hinter den Kulissen für ihren Chef die Fäden zu ziehen. <strong>Die</strong>Regierungssprecher können das schon aus rechtlichen Gründen nichtleisten. Hans Eichel hat sich mit Klaus-Peter Schmidt-Deguelle schon seitAmtsantritt als Bundesfinanzminister 1999 einen Medienprofi an dieSeite geholt. Schmidt-Deguelle, der sich selbst auch gern als Spin Doctorbezeichnete, war lange erfolgreich. Aus dem langweiligen Hessen wurdefür ein paar Jahre der Star der Regierung. Schmidt-Deguelle hatte guterkannt, dass es heute in der Politik menscheln muss. Auch das mussein politischer Sprecher oder Spin Doctor wissen: <strong>Die</strong> Boulevard-Medienund zunehmend auch die Qualitätspresse wollen etwas Privates vomPolitiker erhaschen. <strong>Die</strong> Berater müssen geschickt von Fall zu Fall entscheiden,wie hoch die Dosis sein kann. Ohne etwas Menschelei stehtder Politiker schnell als kalt, uninteressant und langweilig dar, wer aberzu viel preisgibt, endet als Kaspar. Eichels Sparschweine auf demSchreibtisch, seine Ikea-Möbel zu Hause, sein angeblicher Hexenschuss,weil er zu Hause noch selber putzt (was sich als nett erfundene217
Geschichte erwies) – all das kam gut an und unterstrich die KernaussageSparen auf unterhaltsame Weise. 2002 wurde Eichels Sparpolitik hinweggeschwemmt,seitdem geht es mit seinem Image wieder bergab.Was sich daran zeigt? Dass auch die beste Pressearbeit schl<strong>im</strong>mstenfallszum Bumerang wird, wenn die klare Strategie fehlt.Ohne Medienexperten als Berater wird es heute für die Politik garnicht mehr gehen – vom Bundespräsidenten bis herunter zum Ministerpräsidenten.Horst Köhler hat sich mit einem sanften Image, aber klarenPositionen erfolgreich eingeführt. Für einen Bundespräsidenten ist dasauch nicht so schwer wie für die Verantwortlichen des Tagesgeschäfts.Gerade weil Politiker nicht zum Jagdobjekt der Journalisten werden sollen,gerade weil eine klare Botschaft bei den Bürgern Vertrauen statt Verunsicherungauslöst, ist der Einsatz von Medienprofis als Berater nötig –oder zumindest das ständige Denken an die Vermittlung der eigenenKonzepte. Wer das als Politiker ignoriert, wird von den Medien gefressenwerden, spätestens bei der ersten ernsthaften Krise. Aber noch schl<strong>im</strong>mer:Wer die konzeptionelle Arbeit schleifen lässt und täglich <strong>im</strong>provisiertstatt langfristig führt, sollte besser auch kein gutes Medienmanagementwalten lassen. Das folgt aus einer alten Weisheit der US-Werbeindustrie:Nichts tötet ein schlechtes Produkt so nachhaltig wie eine guteVerkaufe.Tony Blairs Presse-Manager haben ihr Spin Doctoring inzwischen zurückgefahren.Kein aggressives Einwirken mehr auf Journalisten, kein Aufhypenbescheidener Zahlen. <strong>Die</strong> Grundkonstruktion seiner Medienmaschinerieund der Policy-Makers ist jedoch weiter intakt. Jeder Nachfolgerwird darauf aufbauen. <strong>Die</strong> deutsche Politik wird das nicht völlig kopierenkönnen, aber auch hier ist klar: Inszenierung ohne Inhalt geht nichtmehr. Inhalt ohne Inszenierung funktioniert genau so wenig.Zur PersonStefan Marx ist wissenschaftlicher Mitarbeiter <strong>im</strong> britischen Unterhaus und freierJournalist in London. Am Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft derUniversität München schreibt er gerade eine Doktorarbeit über Regierungskommunikationin Deutschland und Großbritannien und das Phänomen „Spin Doctoring”.218
INSM UND BÜRGERKONVENT –SEGENSREICHE NEUERUNG ODER„PROTEST IN LACKSCHUHEN” 1Dr. Rudolf Speth, Dörte Schulte-Derne1. Neue Ideen gegen den Abstieg Deutschlands„Ist Deutschland noch zu retten?” Der Abstieg Deutschlands und seinerWirtschaft ist zur Zeit in aller Munde, sind doch Diskussionen über Arbeitszeitverlängerungen,Einschnitte ins Sozialsystem und sogar die Verringerungvon Managergehältern aktueller denn je. Gabor Steingart sieht alsUrsache für den Abstieg die „müde gewordene Gesellschaft”, welche sichvon den Errungenschaften der marktwirtschaftlichen Ursprünge zu weit entfernthabe 2 . <strong>Die</strong>se Aussage würden wohl nicht nur einzelne Bürger unterschreiben,sondern sie würde wohl auch von Vertretern der Initiative NeueSoziale Marktwirtschaft (INSM) und des BürgerKonvents als st<strong>im</strong>mig betrachtet.Hiernach müsse etwas geschehen, denn <strong>im</strong>mer weniger gehörtenzum produktiven Kern eines Landes, dessen Erträge von <strong>im</strong>mer mehr unproduktivenMenschen verzehrt würden. Daher haben es sich vieleUnternehmen und Multiplikatoren auf die Fahne geschrieben, der Marktwirtschaftund dem Leistungsdenken in Deutschland zu einer Renaissancezu verhelfen. Zu diesen gehören auch die INSM und der Bürger-Konvent.Ideen allein helfen jedoch nicht, einen Ruck durch Deutschland gehen zulassen, wie es der ehemalige Bundespräsident Herzog 1997 forderte, dennin der Mediengesellschaft herrschen die Gesetze der Public Relations undder Werbeindustrie. Es genügt daher nicht, Ideen von Intellektuellen produzierenzu lassen, vielmehr müssen Ideen kommunikativ so aufbereitetwerden, dass sie wahrgenommen und auf die Agenden gesetzt werden.<strong>Die</strong>s scheint ein guter Ansatz, doch bleibt erstens zu hinterfragen, wer sichhinter der INSM und dem BürgerKonvent genau verbirgt und welche Zieleverfolgt werden. Zweitens soll untersucht werden, in welche Richtung diebeiden Initiativen das Land verändern wollen und drittens welche Strukturensich die Initiativen zur Zielerreichung gegeben haben. Viertens scheintes von Interesse auszuleuchten, in welchem Verhältnis die beiden Initiativenzu den Parteien stehen und letztlich soll überprüft werden, welchen Herausforderungensich die beiden Initiativen künftig stellen müssen, umweiterhin bestehen zu können.219
2. <strong>Die</strong> Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft<strong>Die</strong> Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) wurde <strong>im</strong> Jahr 2000von den 16 regionalen Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrieins Leben gerufen. <strong>Die</strong> Initiative versucht, für die Ordnung derSozialen Marktwirtschaft zu werben und für deren Reform und Anpassungan die veränderten Bedingungen zu kämpfen. Ausgestattet miteinem Jahresbudget von 10,25 Mio. Euro betreibt die Initiative professionelleKampagnenpolitik, die von der eigens dafür gegründeten PR-Agentur berolina.pr, unter der Leitung von <strong>Die</strong>ter Rath und Tasso Enzweiler,entworfen und koordiniert wird. <strong>Die</strong> Initiative beschäftigt beiberolina.pr 7 Mitarbeiter, verfügt aber noch über ein breites Netzwerkvon zuarbeitenden Agenturen, die Hauptarbeit der Kampagnenführungtragen. 3<strong>Die</strong> INSM versteht sich auch als ein Think Tank. 4<strong>Die</strong> wissenschaftlicheFundierung liefert das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW). Prof.Dr. Hans Tietmeyer, von 1993 bis 1999 Präsident der Deutschen Bundesbank,konnte für den Vorsitz des Kuratoriums der Initiative NSM gewonnenwerden, dem weitere Prominente angehören. Charakteristisch ist, dasssich die INSM <strong>im</strong> Unterschied zum BürgerKonvent an Politiker wendet.So waren beispielsweise <strong>im</strong> Kuratorium der Bundesminister für Wirtschaftund Arbeit, Wolfgang Clement sowie der bayerische MinisterpräsidentEdmund Stoiber vertreten. Edmund Stoiber ist nach der Plakataktion derInitiative gegen die Subventionen für die Landwirtschaft <strong>im</strong> Frühjahr 2004von seinem Botschafteramt zurückgetreten. Auch bei den Botschafternder Initiative, welche die Aufgabe haben, die Ziele der Initiative öffentlichkeitswirksamzu vertreten, finden sich auffällig viele Politiker. <strong>Die</strong>s istAusdruck der Zielrichtung der Initiative, nicht nur in der breiten Bevölkerungfür marktwirtschaftliche Reformen zu werben, sondern auch gezieltauf die Politik einzuwirken.Ähnlich wie be<strong>im</strong> BürgerKonvent ging es in der Anfangsphase erst einmaldarum, bekannt zu werden und die Medienaufmerksamkeit zugewinnen. Dazu wurden in der Startphase innerhalb von drei Monaten9 Mio. Euro für klassische Werbemaßnahmen ausgegeben. <strong>Die</strong> INSMkonnte so auch eine Blaupause für die weitere Strategie des Bürger-Konvents liefern. Zeitungsanzeigen mit dem Slogan „Chancen für alle”und mit den Gesichtern von Prominenten wurden in den Medien Stern,Spiegel, FAZ und Handelsblatt geschaltet. Eigene Broschüren undThemenhefte wurden produziert und kostenlos verteilt. Der Präsidentdes Verbandes der bayerischen Metall- und Elektroindustrie, Randolf220
Rodenstock, veröffentlichte ein Buch „Chancen für alle. <strong>Die</strong> Neue SozialeMarktwirtschaft”, das durch die Initiative kostenlos vertrieben wird undmit einer Auflage von 23.000 Stück erschien. Regelmäßige Pressemeldungen,mehrere TV-Spots und sechs Fernsehbeiträge in Kooperationmit n-tv brachten der Öffentlichkeit die Themen der INSM näher. In derARD lief zur Pr<strong>im</strong>e t<strong>im</strong>e eine dreiteilige Fernsehserie zum den ThemenSteuern, Rente und Arbeitsmarkt von TV-Autor Günter Ederer, die jetztvon der INSM vertrieben wird – eine rechtlich fragwürdige Form desProgrammsponsorings. Journalistenwettbewerbe und andere Aktionen(Reformbarometer, Professorenpanel und eine Zeugnisaktion, bei der dieLeser der Bild am Sonntag die Arbeit der Bundesregierung und derOpposition benoteten) halten die zentralen Themen der Initiative in derDiskussion.Bei der Internetpräsenz wird eine Besonderheit der Strategie der INSMdeutlich. <strong>Die</strong> Initiative tritt nicht unter eigenem Namen an, sondernbetreibt drei unterschiedliche Websites: www.wassollwerden.de für Jungendlicheund Studierende, www.wirtschaftundschule.de zielt auf dieLehrer und www.chancenfueralle.de bietet als Hauptseite einen Überblicküber die Themen der Initiative und Stellungnahmen zu aktuellenThemen. <strong>Die</strong> letztgenannte Website verzeichnete 2002 nach eigenenAngaben knapp 600.000 Besucher.Ziel der INSM ist, die öffentliche Diskussion über marktwirtschaftlicheReformen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Im Kern geht es ihr um mehrEigenverantwortung und um weniger Staat. Im Einzelnen sind es folgendeThemen: Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Reform der sozialenSicherungssysteme (Renten- Kranken-, Arbeitslosenversicherung sowieSozialhilfe), Beschränkung des Staates auf Kernkompetenzen, Subventionsabbau,Förderung der Selbstständigkeit, Reform von Schulen undUniversitäten. Sie unterstützt dabei zum Teil den Reformkurs vonGerhard Schröder, geht aber in vielen Punkten entschieden weiter inRichtung eines neoliberalen Programms. Durch die einzelnen Maßnahmensoll die Reformst<strong>im</strong>mung in der Bevölkerung gefördert und dieBereitschaft der Politik, Reformen auch durchzusetzen, unterstützt werden.Wenngleich der Erfolg dieser Initiative von Arbeitgeberverbänden nichtexakt angegeben werden kann, so ist doch die Mischung aus professionellerKampagnenpolitik, vergleichsweise hohem Budget und längerfristigerKampagnenführung so abgest<strong>im</strong>mt, dass die Botschaften auchvon der Öffentlichkeit aufgenommen werden.221
3. Der BürgerkonventDer BürgerKonvent ist <strong>im</strong> Mai 2003 mit mächtigen PR-Aktionen an dieÖffentlichkeit getreten. Mit 6 Mio. Euro von bis heute nicht bekanntenFinanziers ausgestattet, schaffte der Bürgerkonvent innerhalb der erstenMonate eine breite Bekanntheit in der Bevölkerung. Der BürgerKonventvertrat Prof. Dr. Meinhard Miegel, geschäftsführendes Vorstandsmitglieddes Institutes für Wirtschaft und Gesellschaft (IWG) in Bonn und alsSprecher fungierte Prof. Dr. Gerd Langguth. <strong>Die</strong>ser war in vielen Funktionenfür die CDU aktiv und gilt als int<strong>im</strong>er Kenner der CDU. Der Bürgerkonventarbeitet mit einer anderen Strategie als die INSM. Er pflegt eine aggressivereAnti-Parteienrhetorik und verfolgt das Ziel, die Politiker unterDruck zu setzen. Inzwischen haben sich 14 lokale Bürgerkonvente gegründetund die Zahl der Mitglieder ist auf 2.500 gestiegen. In derSelbstbeschreibung wird der Bewegungscharakter der Initiative betont.Der Bürgerkonvent sei eine NGO des Bürgertums, der bürgerlichen Mittelschichten.Der Bürgerkonvent möchte mit der Macht der Mitglieder Druck„von unten” erzeugen. Deutlich wird dabei ein Politikverständnis, dasemphatisch den Bürgerbegriff hochhält und mit bürgerlichen Tugendenrechnet. <strong>Die</strong> Politik dürfe man nicht, wie es beispielsweise bei der INSMgeschehe, den Werbe-Agenturen überlassen, heißt es aus dem Bürgerkonvent.<strong>Die</strong>ser steht gegenwärtig vor dem Problem, dass er mit einerbreiten und finanzkräftigen Kampagne sich wieder bemerkbar machenmüsste, mangels finanzieller Möglichkeiten dazu aber sich kaum in derLage sieht.4. Andere InitiativenDer BürgerKonvent ist in der Landschaft bürgerlicher Initiativen undbürgerlichen Protestes keine singuläre Erscheinung. Es gibt nach Angabenvon Meinhard Miegel inzwischen rund 25 Initiativen mit einemähnlichen Charakter und einer vergleichbaren Zielrichtung. 5 Ein ähnlicheZielrichtung verfolgt auch die Initiative „Deutschland packt’s an”. Vonder jüngeren Generation kommt die Initiative „Marke D”, die zudemstärker von PR-Agenturen und Beratungsbüros unterstützt wird. <strong>Die</strong>Initiative „D 21” hat die Förderung der neuen Technologien in den Mittelpunktihrer Kampagne gestellt. 10 der Initiativen haben sich <strong>im</strong> Mai 2004auf Drängen der Wirtschaftsverbände unter dem Dach „AktionsgemeinschaftDeutschland” zusammengeschlossen und versuchen nun ihreAktionen zu koordinieren.222
5. Wie soll das neue Deutschland aussehen?Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft<strong>Die</strong> INSM hat versucht, den Mythos Soziale Marktwirtschaft aus den 50erJahren neu zu beleben. Sie vermied es aber, in ihrem Werben für denMarktliberalismus die dahinter stehenden theoretischen Debatten (FreiburgerSchule des Ordoliberalismus) wieder aufzugreifen. Der INSM kommthier vielmehr der Zeitgeist der 80er und 90er Jahre entgegen, der dasMischungsverhältnis von Markt und Staat zugunsten des Marktes zu veränderntrachtet.Gerhard Schröder hat zu Beginn seiner ersten Legislaturperiode das„Schröder-Blair-Papier” von Bodo Hombach verfassen lassen. Es solltedie Richtung für eine erneuerte Sozialdemokratie vorgeben, die dem Umverteilungs-und Staatsgedanken abgeschworen hat. Das zentrale Themades Papiers war die Programmatik des „Dritten Weges” wie sie – vonAnthony Giddens entwickelt – Tony Blair schon lange in Großbritannien alsReformperspektive vertreten hat. Ein zentraler Satz darin lautet: „<strong>Die</strong>Steuerungsfunktion von Märkten muss durch die Politik ergänzt und verbessert,nicht aber behindert werden.” 6Flexible Märkte, auch <strong>im</strong> Bereichdes Arbeitsmarktes, werden dort als modernes sozialdemokratisches Zielausgegeben. Das Papier, von vielen wegen der neoliberalen Stoßrichtunggegeißelt, atmet ordoliberalen Geist. Denn das Werben für einen wettbewerbsfähigenmarktwirtschaftlichen Rahmen, für mehr Selbstständigkeitund mehr Unternehmensgründungen will das alte sozialdemokratischeProgramm des Ausgleichs und der Korrektur von Marktergebnissen nichtfortsetzen. Das Papier bekennt sich ausdrücklich zur Chancen- und nichtzur Ergebnisgleichheit. Immerhin ist es gelungen, – wenn auch sicherlichnicht ausschließlich durch Verdienste der INSM – die Debatte über neueLeitbilder der ökonomischen und sozialen Entwicklung in Medien derpolitischen Bildung auf die Agenda zu bringen.Den Kuratoren der INSM 7sind die Kernanliegen des „Dritten Wegs”wichtig. <strong>Die</strong> Idee eines einfachen Steuersystems wird ebenso vertretenwie die Befürwortung einer deutlicherer Lohnspreizung. Auch ein Rentenversicherungssystemmit einer Kapitaldeckung wird befürwortet. SozialstaatlicheSicherungssysteme sollen nach Auffassung der INSM-Vertreternur in Notfällen einspringen und nicht der allgemeinen Absicherung derLebensführung breiter Bevölkerungskreise dienen.BürgerKonvent<strong>Die</strong> plakative Gegenüberstellung von handlungs- und verantwortungs-223
ereiten Bürgern und unfähiger Parteipolitik und die inhaltliche Ausrichtungdes BürgerKonvents lassen den Schluss zu, dass wir es hier mit einermarktliberalen Auffassung von Bürgergesellschaft zu tun haben. MehrSubsidiarität und mehr Selbstvorsorge – <strong>im</strong> Gesundheitsbereich und inder Altersicherung durch private Vermögensbildung – sind die beidenEckpunkte. <strong>Die</strong> Betonung von Verantwortung, Bürger- und Gemeinsinnnutzen die semantisch-symbolischen Gehalte der Bürger gesellschaftsdiskussion.Im Kern geht aber um weniger Staat und mehr Eigenverantwortung<strong>im</strong> Sinne höherer Beteiligung des Einzelnen an den Kosten dersozialen Sicherung bei diesem Gegenentwurf zur herrschenden Politik.6. Welche Strukturen wählten INSM undBürgerKonvent zur Umsetzung ihrer Ziele?Initiative Neue Soziale MarktwirtschaftZum Medien- und Öffentlichkeitskonzept der INSM gehört ein Kreis prominenterPersonen, die die inhaltlichen Ziele wirksam auf die öffentlicheAgenda setzen. <strong>Die</strong> Reigen der Köpfe teilt sich auf in Kuratoren undBotschafter, die alle – mit einigen Ausnahmen – ehrenamtlich tätig sind.Im Vergleich zu anderen Initiativen sind hochrangige Politiker gerne gesehen.Von den insgesamt rund 36 Personen sind die Kuratoren diewichtigsten und die Aktivsten. Dort finden sich Martin Kannegießer,Präsident von Gesamtmetall, Prof. Dr. Hans Tietmeyer, Ex-Bundesbank-224
präsident und Vorsitzender des Kuratoriums, Oswald Metzger, Finanzexperteder Grünen und Ex-MdB, Randolf Rodenstock, Vorsitzender desAufsichtsrates der Rodenstock AG sowie die beiden Führungsfiguren desInstituts der deutschen Wirtschaft, Dr. Hans-<strong>Die</strong>trich Winkhaus und Prof.Dr. Gerhard Fels.Aus dem Kreis der Botschafter ragen heraus: Roland Berger, Dr. NikolausSchweikart, Vorsitzender der Altana AG, Christine Scheel, Vorsitzendedes Finanzausschusses des Deutschen Bundestags, Erwin Staudt, Ex-Vorsitzender der Geschäftsführung von IBM Deutschland, Prof. Dr. Ing.Dagmar Schipanski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst inThüringen, Dr. Silvana Koch-Mehrin, Mitglied des Europarlamentes, FDP.<strong>Die</strong> Wissenschaftler, vorzugsweise Ökonomen, bilden eine weitere wichtigeGruppe bei den Kuratoren und Botschaftern der Initiative. Zum Wissenschaftlerkreiszählt nicht nur Prof. Dr. Paul Kirchhof, sondern auch Prof.Dr. Gerhard Fels, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln,Prof. Dr. Juergen Donges, Professor für Wirtschaftliche Staatswissenschaftenan der Universität zu Köln und Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik,Prof. Dr. Rolf Peffekoven, Direktor des Instituts für FinanzwissenschaftJohannes Gutenberg-Universität Mainz, Prof. Dr. Ulrich vanSuntum, Geschäftsführender Direktor des Centrums für angewandte WirtschaftsforschungMünster (CAWM), Universität Münster, Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Magdeburg.Paqué ist auch Minister der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt undstellvertretender Landesvorsitzender der FDP Sachsen-Anhalt.<strong>Die</strong> Riege der Wirtschaftwissenschaftler verschafft der Initiative dasnotwendige backing in der scientific community und sie liefern denAnschluss an ökonomische Konzepte, die gemeinhin unter dem ZeichenNeoliberalismus laufen. <strong>Die</strong>ser starke Einbezug von Wirtschaftswissenschaftlernist für die INSM ein wesentlicher Stützpfeiler, auf dem dasstrategische Kalkül ihrer Öffentlichkeitsarbeit ruht. Denn nur so wird sieauch in Fachkreisen ernst genommen und nur so sind weitere Kollegenbereit, die Ideen der Initiative weiter zu tragen.BürgerKonventEin wesentlicher Kritikpunkt während der ersten Phase des Bürgerkonventsbezog sich auf die fehlende Transparenz der Strukturen und der Herkunftder Finanzmittel. Meinhard Miegel hat bis heute zur Herkunft der 6 Mio.geschwiegen, die als Startkapital dienten. Rechtlich als Verein organisiert,untern<strong>im</strong>mt der BürgerKonvent kaum etwas, um seine Strukturentransparenter zu gestalten. Vielmehr ist die Satzung min<strong>im</strong>alistisch an-225
gelegt, um die Mindestanforderungen des deutschen Vereinsrechts einzuhalten.Der BürgerKovent verfügt heute über mehr als ein Dutzendlokaler Gruppen und auch überregionale Themengruppen. Von den2.700 Mitgliedern sind 600 aktiv, der andere Teil unterstützt den Vereindurch Mitgliedsbeiträge. In diesen Regionalgruppen und in den Themengruppenorganisiert sich das bürgerliche Lager, Mittelständler, Handwerker,Selbständige und Manager. Durch diese Struktur läuft viel Energieins Leere, weil sie dadurch Querulanten und Aktivisten für allerlei Ideenangezogen werden.Prof. Dr. Gerd Langguth ist inzwischen als Geschäftsführer ausgeschieden,seine Aufgaben hat Thomas Grundmann übernommen. Sprecher desBürgerKovents sind gegenwärtig, Prof. Dr. Meinhard Miegel, und neuberufen, Wolf-<strong>Die</strong>ter Hasenclever, seit April 2002: BildungspolitischerReferent und Berater der FDP-Bundestagsfraktion. Hasenclever war dererste Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg ist heute fürdie Umweltstiftung aktiv.Der BürgerKonvent ist als Verein organisiert. Der Bonner VerlegerThomas Grundmann fungiert als Sprecher. Zum Vorstand gehören weiterdie Journalistin Gabriele Jahn, der Unternehmer Hans-Günther Lind, derRechtsanwalt Claus <strong>Die</strong>ter Müller-Hengstenberg sowie die SozialwissenschaftlerinStefanie Wahl. Sich selbst sieht dier BürgerKonvent gerne alsNGO des Bürgertums oder der Mittelschichten. <strong>Die</strong>se Usurpation linkerBewegungs- und Politikformen kann aber nicht über das Grunddilemmahinwegtäuschen, dass es staatstragende Charaktere und Gruppen sind,die gerne ihre bereits bestehenden Einflusskanäle durch neue Formenerweitern möchten.7. In welchem Verhältnis stehen INSMund BürgerKonvent zu den Parteien?Initiative Neue Soziale MarktwirtschaftGetragen wird die INSM von einem tiefen Unbehagen gegenüber deretablierten Politik, das aber nicht artikuliert wird, weil das strategischeInteresse an der Zusammenarbeit überwiegt. Dennoch wird versucht, dieParteien von außen – also durch die INSM – mit externen Impulsen zuversorgen. Trotzdem besteht ein grundsätzliches Misstrauen gegen überden Parteien und dem politischen Apparat. Da die Parteien es nichtmehr verstünden, Themen zu setzen und Mehrheiten für die notwendigeRenovierung des Landes zu organisieren, sei es gut eine neue Kontrollinstanzzu bieten. Hier wird auch die CDU – welcher die INSM relativ nahe226
steht – nicht geschont. <strong>Die</strong> Initiative hält insgesamt zu den Parteien –nicht zu einzelnen Politikern – sehr große Distanz. Auch und gerade zurFDP, die den Machern viel zu elitär und klientelistisch ist. Weinig besserkommt dabei die Regierung Kohl weg, die den Anstieg der Staatsverschuldungund die Arbeitslosigkeit tatenlos zugelassen hat. Gefordertwerden durchgreifende Reformen und ein handlungsfähiges politischesSystem.Es wird das Bild einer blockierten Republik gezeichnet, das inzwischenEingang in die Talkshows und Feuilletons gefunden hat. Das Gegenbild– ein schlanker und effizienter Staat, der Spielraum für Eigeninitiative lässt –hat seine Wurzeln <strong>im</strong> Liberalismus, aber nicht <strong>im</strong> politischen, sondern<strong>im</strong> Wirtschaftsliberalismus. Faktisch ist die INSM auch Ausdruck davon,dass best<strong>im</strong>mten Gruppen in der Gesellschaft, das sozialstaatliche Solidarsystemzu teuer ist und sozialstaatliche Leistungen auf Armenfürsorgezurückgeschnitten gehören.BürgerKonventDer BürgerKonvent ist einerseits eine Gründung aus dem bürgerlichenLager mit einer beträchtlichen Nähe zur CDU, andererseits gibt er sichnach außen überparteilich und schw<strong>im</strong>mt auf der Welle der pauschalenund undifferenzierten Parteienkritik. Kritisiert werden insbesondere dieParteipolitiker, die auch nicht Mitglied <strong>im</strong> BürgerKonvent werden können.Denn alle diejenigen sind ausgeschlossen, die politische Ämter innehabenoder anstreben und die von der Politik leben. 8<strong>Die</strong> Abgeordneten sindauch gleichzeitig die Zielgruppe der Aktivitäten des BürgerKonvents. Siesollen mit den Reformthemen konfrontiert werden, direkt in den Wahlkreisen,u. a. mit vorbereiteten Musterbriefen.Der BürgerKonvent gehört von der Zielgruppe, der Herkunft der Akteureund der ideologischen Ausrichtung her zum bürgerlichen Lager. Interessantdürfte daher die Entwicklung des Verhältnisses zur CDU sein. Ingewisse Weise saugt der BürgerKonvent den frustrierten und richtungslosenProtest <strong>im</strong> bürgerlichen Lager auf, der sich nach der schon sichergeglaubten Bundestagswahl 2002 gebildet hat. Der Bürgerkonvent verfolgteine Parallelkampagne zur CDU. Er kann eigenständiger agieren undmuss nicht, wie eine Volkspartei, auf eine heterogene MitgliedschaftRücksicht nehmen. Vielen in den Parteien ist diese Art der Themensetzungwillkommen, weil auch sie nicht mehr glauben, dass die Parteien aussich heraus noch fähig sind, innovative Themen zu setzen.Im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren Initiativen wendet sichder BürgerKonvent aggressiv gegen Parteien und Parteipolitik. In einem227
gewissen Sinne formiert sich hier bürgerlicher Protest <strong>im</strong> populistischenGewand. Man versucht in das politische Vakuum des konservativenSpektrums einzudringen und auf Chaos der Meinungsbildung zu den anstehendenReformen ordnend zu reagieren. Gestärkt werden soll derCDU-Wirtschaftsflügel. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sichdas frustrierte Bürgertum eine neue politische He<strong>im</strong>at schafft, auchwenn die Gründer des BürgerKonvents eine Parteigründung erst einmalausgeschlossen haben. <strong>Die</strong> Gründer des BürgerKonvents haben <strong>im</strong>merwieder hervorgehoben, dass es <strong>im</strong> Sympathisantenumfeld starke Erwartungenin Richtung einer Parteigründung gab.8. Welchen Herausforderungen werden sich INSM undBürgerKonvent stellen müssen?Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft<strong>Die</strong> Themen der Initiative sind einerseits Dauerthemen, andererseitsbenötigen die Maßnahmen der Initiative Zeit, bis sie wirken. Der ArbeitgeberverbandGesamtmetall unterscheidet hier klar zwischen dem kurzfristigentaktischen Politikgeschäft und den längerfristigen Wirkungender Arbeit der Initiative. Gesamtmetall begründet dieses langfristigeEngagement damit, dass viele Themen „Dauerthemen” sind und es Zeitbraucht, bis Sichtweisen und Überzeugungen angekommen. Einen Wandel<strong>im</strong> Bewusstsein und in den Einstellungen der Bevölkerung lässt sich nurlangfristig erreichen, indem best<strong>im</strong>mte Themen <strong>im</strong>mer wieder auf diepolitische Agenda gesetzt werden und langfristig in den Medien präsentbleiben.Gesamtmetall und die anderen Verbände sind hier zwar ein Stück weitvorangekommen, doch müssen sie eine hartnäckige Reformresistenz inder Bevölkerung feststellen. Hier wurde ein weiteres Aufgabenfeld fürdie INSM entdeckt, positive Perspektiven aufzuzeigen. Erkennbar wirddies jetzt schon, wenn die Initiative Neuseeland als Beispiel dafür anführtwird, wie erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialreformen durchgeführtwerden können. Weitere Elemente sind Beispiele, die zeigen wie Menschensich erfolgreich selbständig machen.Zum langen Atem gehört auch die lange Leine. Denn die politischeStrategie des gesamten Unternehmens geht nur auf, wenn die INSMnicht als Anhängsel des Verbandes oder als Erfüllungsgehilfe des BDI inder Öffentlichkeit agiert. <strong>Die</strong> Initiative kann nur erfolgreich agieren,wenn ihr Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird.228
BürgerKonventUm den BürgerKonvent ist es heute ruhig geworden. Es gibt kaumAktionen, mit denen er an die Öffentlichkeit tritt. 9 <strong>Die</strong>s liegt zum Teil anden fehlenden Finanzmitteln, zum Teil aber auch an der Struktur derlokalen Konvente und Themengruppen. Sie verbrauchen die Energie derAktiven für interne Zwecke, für Abst<strong>im</strong>mungen, Grundsatzdiskussion und– bei solchen Gruppen <strong>im</strong>mer üblich – für Profilierung und Abgrenzung.Der BürgerKonvent hat sich zwar die Formen der sozialen Bewegungenangeeignet, die Mitgliederschaft kann diese aber nicht füllen. Sie ist ungeübt,diese Protestformen zu nutzen.<strong>Die</strong> fehlenden Handlungsoptionen des BürgerKonvents wächst sich aufder gegenwärtigen Stufe der Kampagne, bei der lokale Bürgergruppengebildet werden, zu einem realen Problem aus. Der Aufruf, sich zusammenzufindenund zu diskutieren, hat Alibi-Charakter, weil konkrete Handlungsoptionender Mitglieder nicht erkennbar sind.9. Eine kritische Bewertung<strong>Die</strong> verfolgten Ziele und ihre Legit<strong>im</strong>ität<strong>Die</strong> INSM erfüllt einen konkreten Auftrag für Gesamtmetall, der darinbesteht, Themen auf der Agenda zu halten und für einen politischenKl<strong>im</strong>awechsel in der Gesellschaft zu sorgen. Dabei wird nicht die direkteAuseinandersetzung mit den Gewerkschaften und der SPD gesucht, sondernvielmehr der „überparteiliche Charakter” der Initiative unterstrichen.<strong>Die</strong> INSM zielt auf marktliberale Reformen, auf den Rückzug des Staatesund auf eine größere Verantwortung des Einzelnen. Konkrete bedeutetdies, den Rückbau des Wohlfahrtsstaates zum Sozialstaat, der nur nochdenjenigen Unterstützung gewährt, die in Armut gefallen sind.<strong>Die</strong>sen Inhalten ist auch derBürgerKonvent verpflichtet, der allerdings dieetablierte Politik und die Parteien scharf ins Visier n<strong>im</strong>mt. Hier betreibenerfahrene Politiker Parteienschelte und nutzen die bestehende Politikverdrossenheit,das Politikmonopol der Parteien zu brechen, um Raum für andereInteressenvertreter zu schaffen. <strong>Die</strong> INSM wie auch der BürgerKonventsind PR-gesteuerte Öffentlichkeitskampagnen, wobei der BürgerKonvent– wegen der unbekannten Geldgeber und – besonders fragwürdig scheint,während INSM klar die Interessen der Arbeitgeberverbände Gesamtmetallvertritt. Im Gegensatz zum BürgerKonvent entwickelt sich die INSM zu einemThink Tank, der mit ständig neuen Thesenpapieren und Expertisen medientauglicheStatements produziert und durch seine Botschafter massenmedientauglichePersonifikationen und Multiplikatoren für seine Ziele hat.229
<strong>Die</strong> Organisationsstruktur und ihre Effektivität<strong>Die</strong> INSM verfügt über eine professionelle und effektive Organisationsstruktur,bestehend aus der Geschäftstelle in Köln, welche die Zusammenarbeitmit PR- und Event-Agenturen koordiniert. Insgesamt hat die Initiativeeinen Netzwerk-Charakter und kann daher als sehr flexibel gelten.Anders verhält es sich be<strong>im</strong> BürgerKonvent, der in sich als gemeinnützigerVerein mit Sitz der Geschäftsstelle in Bonn organisiert hat. Er nutzt dieBewegungsform, kann sie aber nicht adäquat füllen. Moderner dagegenist die INSM aufgestellt. Sie agiert auf Höhen der Mediengesellschaftund beherrscht souverän das Politik-Marketing. Der BürgerKonvent istzwar stolz darauf, dass er – <strong>im</strong> Gegensatz nur INSM – nicht PR-getriebensei, doch auch in seinen Reihen macht sicht die Einschätzung breit, dassohne eine professionalisierte „Politikmaschine” kaum etwas erreicht werdenkann. <strong>Die</strong> mitglieder-basierte NGO-Struktur würde zwar Vertrauenbei den Bürgern schaffen, doch kann sie nicht gefüllt werden, weil denMitgliedern die Aktionsorientierung fremd ist.<strong>Die</strong> Handlungsmöglichkeiten und ihre Einschätzung<strong>Die</strong> INSM ist über viele prominente Kuratoren und Botschafter in denMedien präsent. <strong>Die</strong> Prominenz und Parte<strong>im</strong>itgliedschaft der INSM-Vertreter führt dazu, dass die Ideen der INSM schneller in Gesellschaftbekannt und diskutiert werden. <strong>Die</strong>ses Potential wird durch eine professionellePR-Agentur bereitgestellt. ,<strong>Die</strong> Agentur Scholz’ & Friends entwickeltdie Kampagnen und sorgt auch für deren Durchführung. Von hieraus erfolgt auch die tagesaktuelle redaktionelle Betreuung der Website.Ganz anders der BürgerKonvent. Er kaufte während seiner Startphaseeine professionell gestaltete Kampagnenpolitik ein, welche „Protest inLackschuhen 10 ” gegen Parteien und Politik betrieb. Dem BürgerKonvent stehenheute nur wenige prominentere Mitglieder zur Verfügung, was denMangel an Handlungsmöglichkeiten noch weiter verstärkt. Ein gutes Jahrnach seinem ersten öffentlichen Auftreten ist es still um ihn geworden.Das Hervortreten dieser beiden und ähnlicher „Reforminitiativen” währendder Regierungszeit von rot-grün verdeutlichen zum einen die Versäumnissedes bürgerlichen Lagers während der lagen Kohl-Ära. Lange Jahrean die klientelistische Kohlsche Politik gewöhnt, sollte nun Rot-Grünunter Druck gesetzt werden. Wenn bei Initiativen das Bürgertum repräsentieren,so ist es doch etwas verwunderlich, das es das Bürgertum plötzlich– nach 1998 – eilig hatte mit Reformen.<strong>Die</strong>se beiden und die zahlreichen anderen „Reforminitiativen” verdeutlichenaber auch noch einen anderen Trend: Politik wird <strong>im</strong>mer stärker230
von Werbeagenturen und Marketingkonzepten best<strong>im</strong>mt. Unter der Handverändert sich dadurch das Politikverständnis. Eingebettet und vorangetriebenwird diese Veränderung durch die Trends der Mediengesellschaft.Darüber hinaus eigen sich diese beiden und die anderen „Reforminitiativen”Formen der linken Protestkultur und Politik an und pflegendie sympathische Rhetorik der Bürgergesellschaft, die nun plötzlich wirtschaftsliberaleZüge trägt.Fußnoten1Der Artikel basiert auf der Studie von Rudolf Speth zum BürgerKonvent: Der Bürger-Konvent – Kampagnenprotest von oben ohne Transparenz und Bürgerbeteiligung,Düsseldorf 2003, Hans Böckler Stiftung, (www.boeckler.de). Rudolf Speth arbeitet gegenwärtig<strong>im</strong> Auftrag der Hans Böckler Stiftung an einer weiteren Studie zu den politischenund kommunikativen Strategien der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.2Garbor Steingart, Deutschland. Der Abstieg eines Superstars, München, Zürich 2004.3Zu den Zahlen: Der Spiegel 22/2003, 26. Mai 2003.www.spiegel.de/spiegel/0,1518,250934,00html.4Bei der INSM handelt es sich jedoch nicht um einen klassischen Think Tank derPolitikberatung, bei welchen es sich um praxisorientierte sozial- und wirtschaftswissenschaftlicheForschungsinstitute handelt, welche versuchen, auf die Politikeinzuwirken. <strong>Die</strong> INSM ist nach Martin Thunert (vgl. Think Tanks in Deutschland –Berater der Politik? In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 51/2003. S. 32) als „advokatorischerThink Tank” zu bezeichnen, welche sich nicht durch eigenständige wissenschaftlicheAnalyse auszeichnen. Sie lassen sich Analysen durch Netzwerke undexterne Experten erstellen und betreiben Anwaltschaft für best<strong>im</strong>mte Themen.5„Wir haben 25 Institutionen gezählt, die eine ähnliche Ausrichtung haben wie wir”,erklärt Meinhard Miegel in einem Interview, <strong>Die</strong> Welt, „Gewaltiger Zulauf”, 22. Mai 2003.6www.blaetter.de, „Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten”, S. 2.7Vgl. Kap. 6.8Interessant ist, dass die extreme Politiknähe der beiden Hauptakteure hier nichtbedacht zu werden scheint.9Im Juni hat der BürgerKonvent einen Brief an alle Abgeordneten des DeutschenBundestages geschrieben. Darin wird dazu aufgerufen, die Agenda 2010 zu verabschiedenund umzusetzen. Der „ausgeuferte Wohlfahrtsstaat” müsse begrenztwerden und Politiker dürfen nicht nur den nächsten Wahltermin <strong>im</strong> Auge haben.10Vgl. Fußnote 1.231
netzwerk rechercheunterstütztjunge, talentierteJournalisten dabei,einer Geschichteauf den Grund zu gehen.<strong>Die</strong> Recherche relevanter,unveröffentlicher Themenwird mit einem Stipendiumin Höhe von bis zu5.000 Euro gefördert.Interesse?Mehr Information unter:www.netzwerkrecherche.deoder Rückfragen unter:info@ netzwerkrecherche.de
INFORMATIONSGESELLSCHAFTOHNE INFORMATIONSZUGANG?Das Ringen um ein Akteneinsichtsrecht für jedermannManfred Redelfs„Da könnte ja jeder kommen”,ist ein beliebter Satz der Informations-Verhindererin deutschenAmtsstuben. Für alle,die sich hinter dieser abwehrendenFormulierung verschanzen,muss das sogenannteInformationsfreiheitsgesetz,kurz IFG, eine echte Bedrohungihres Herrschaftswissenssein: Das Gesetz würde es tatsächlichjedem erlauben, diebei öffentlichen Stellen vorhandenenAkten einzusehen oderKopien zu erhalten. Eine eigeneBetroffenheit muss dafür nichtnachgewiesen werden, undauch eine Antragsbegründungist nicht erforderlich. Das in derdeutschen Verwaltung noch <strong>im</strong>mervorherrschende Prinzipdes „Amtsgehe<strong>im</strong>nisses”, nachdem Behördenunterlagen <strong>im</strong>Regelfall internen Charakterhaben, wird somit genau umgekehrtund vom Grundsatz der Öffentlichkeit abgelöst. Nach dem IFGmuss nicht mehr der Antragsteller ein berechtigtes Interesse nachweisen,sondern die Behörde ist in der Begründungspflicht, wenn sie Unterlagennicht herausgeben will. Ausnahmen vom Transparenzgebot greifen ingenau definierten Fällen, z.B. wenn der Schutz personenbezogenerDaten vorgeht, wenn polizeiliche Ermittlungsarbeit gefährdet würde oderwenn Betriebs- und Geschäftsgehe<strong>im</strong>nisse privater Firmen berührt sind.233
Gerade die Beispiele aus dem zurückliegenden Jahr – vom Maut-Desasterbis zum Streit um Beraterverträge bei der Bundesagentur für Arbeit undbei verschiedenen Ministerien – zeigen deutlich, wie wichtig mehr Transparenzist. Gehe<strong>im</strong>haltung schafft Gelegenheiten für Machtmissbrauch, undein abweisender bürokratischer Apparat heizt die Politikverdrossenheitan. Wer von vornherein weiß, dass ein Vertragswerk der öffentlichen Prüfungunterliegt, wird sich schwerer tun mit Klauseln, die auf Kosten derAllgemeinheit gehen, wie be<strong>im</strong> Mautvertrag geschehen. Trotz dieser Erfahrungenkommt das in der Öffentlichkeitweitgehend unbekannte ReformprojektIFG nur langsam voran: Zwar istes auf Druck der Grünen Bestandteilder Koalitionsverträge von 1998 und von2002. Aber eine desinteressierte Ministerialbürokratieund eine ablehnendeWirtschaftslobby haben die gesetzlicheVerankerung von mehr Transparenz inder deutschen Verwaltung bisher verhindert.Erst aufgrund des Drucks mehrererJournalistenverbände und Bürgerrechtsgruppenist <strong>im</strong> Sommer 2004 neueBewegung in die Angelegenheit gekommen,so dass seit kurzem wieder Aussichtbesteht, dass in dieser Legislaturperiodedoch noch ein Gesetz verabschiedetwird.Dabei haben vier Bundesländer, die dieInformationsfreiheit bereits eingeführthaben, damit rundum positive Erfahrungengesammelt. Auch international istein solches Gesetz längst Standard:Rund 50 Staaten haben das Prinzip derInformationsfreiheit bereits gesetzlichverankert. Innerhalb der EU ist Deutschlandzusammen mit Luxemburg mittlerweiledas letzte Land, das seinen Bürgernein solches Recht auf Bundesebenevorenthält und stattdessen das obrigkeitsstaatlicheErbe der „Amtsverschwie-234
genheit” verteidigt. Während den Bürgern einerseits abverlangt wird, in<strong>im</strong>mer mehr Bereichen zusätzliche Verantwortung zu übernehmen undeigene Initiative zu entwickeln, sich selbst um die Absicherung <strong>im</strong> Krankheitsfalloder <strong>im</strong> Alter zu kümmern, ist die Behördentransparenz auf derStufe des 19. Jahrhunderts stehen geblieben: Der Bürger muss denÄmtern als Bittsteller gegenüber treten.Gegner der InformationsfreiheitDass ein IFG auf Bundesebene noch <strong>im</strong>mer auf sich warten lässt, istschlüssig aus der Interessenkonstellation zu erklären, mit der ein solchesReformprojekt konfrontiert ist. Der erste Versuch, einen Gesetzentwurfzu erarbeiten, ging von der Ministerialbürokratie aus. Das federführendeInnenministerium legte <strong>im</strong> Dezember 2000 einen sehr halbherzigenEntwurf vor. <strong>Die</strong> Vorlage enthielt keinerlei Fristen für die Antragsbearbeitung,zahlreiche schwammige Formulierungen, die von kooperationsunwilligenBehörden zur Informationsblockade benutzt werden konntenund weitreichende Ausnahmeklauseln, mit denen der Grundsatz der Öffentlichkeitwieder unterlaufen wurde. <strong>Die</strong>ser unzureichende Entwurfwurde in der anschließenden Ressortabst<strong>im</strong>mung weiter verwässert. DasVerteidigungsministerium wollte ganz ausgeklammert werden, einschließlichseines zivilen Bereichs, das Finanzministerium verlangte kostendeckendeGebühren und das Wirtschaftsministerium machte sich zumSprachrohr des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) undfürchtete um die Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgehe<strong>im</strong>nissen.Ein Teilnehmer der Verhandlungsrunden beschrieb den Prozess mit demHinweis, dass natürlich jeder für mehr Offenheit sei – nur eben bei denanderen und nicht <strong>im</strong> eigenen Zuständigkeitsbereich, für den <strong>im</strong>merganz besondere Gehe<strong>im</strong>haltungsgründe reklamiert würden. Der Versuch,dass die Ministerialbürokratie sich aus eigenem Antrieb mehr Transparenzverordnet, war somit zum Scheitern verurteilt. Im Sommer 2002ergriffen deshalb die Fraktionen von Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen und SPD dieInitiative, konnten sich vor der Wahl allerdings nicht auf einen gemeinsamenText verständigen, zumal das Reformprojekt auf Seiten der SPDnur wenige Fürsprecher hat.In der neuen Legislaturperiode wurde der mühselige Prozess der Ressortabst<strong>im</strong>mungwieder aufgenommen. Da sich an der Grundkonstellationnichts geändert hatte, war der Stillstand vorprogrammiert. Der Ministerialbürokratiekam dabei zugute, dass es an öffentlichem Druck für das Re-235
formprojekt weitgehend fehlte: In einem politischen Umfeld, in dem dieöffentliche Debatte vom Streit um Sozialleistungen geprägt wird, genießtdie Stärkung der Bürgerrechte keine Priorität. <strong>Die</strong> Blockadehaltung desBDI, der nach eigenem Bekunden mehr Bürokratie und das Bekanntwerdenvon Betriebs- und Geschäftsgehe<strong>im</strong>nissen fürchtet, wurde in Zeiten konjunkturellerFlaute <strong>im</strong> Wirtschaftsministerium besonders aufmerksamregistriert. Eine „Nachfrage” nach dem IFG wird ferner schon dadurch behindert,dass das Rechtsprinzip für die Öffentlichkeit völlig neu ist undauch die bestehenden Landesgesetze wenig bekannt sind. So scheitertein Nordrhein-Westfalen eine geplante Werbekampagne für das Landes-IFG an einer Haushaltssperre. Wie aber soll ein Bürger Rechte nutzen,die ihm gar nicht bekannt sind? Schon der Begriff „Informationsfreiheit”stößt in Deutschland weitgehend auf Unverständnis und erschwert jeglicheKampagne für ein solches Gesetz.Initiative aus der ZivilgesellschaftIn dieser Situation hat die Journalistenorganisation Netzwerk Recherchedie Initiative ergriffen und <strong>im</strong> Bündnis mit weiteren Journalistenverbändenund Bürgerrechtsgruppen, die am IFG ein Interesse haben, einen eigenenGesetzentwurf samt Begründung ausgearbeitet (dokumentiert unterwww.netzwerkrecherche.de). Anfang April 2004 wurde der Gesetzesvorschlagvon Netzwerk Recherche, Deutschem Journalisten-Verband (DJV),Deutscher Journalisten-Union (dju in ver.di), Transparency Internationalund Humanistischer Union an Bundestagspräsident Wolfgang Thierseübergeben und <strong>im</strong> Rahmen der Bundespressekonferenz in Berlin derÖffentlichkeit vorgestellt. Gleichzeitig wurde der Gesetzentwurf an alleBundestagsabgeordneten geschickt, an alle Landtagsfraktionen sowiean die Landespressekonferenzen. <strong>Die</strong> Initiatoren betrachten diesen Vorstoßaus der Zivilgesellschaft heraus als einen Akt demokratischerNotwehr: Nachdem Politik und Verwaltung es nicht geschafft haben, dasThema voranzubringen, soll es nunmehr aus der Mitte der Gesellschaftheraus auf die politische Agenda gesetzt werden. Im Juni 2004 startetezur Unterstützung eine Internet-Kampagne, mit der Unterschriften für dieEinführung eines solchen Gesetzes gesammelt werden. <strong>Die</strong>se Initiativeunter der Adresse „www.pro-information.de” wird von prominenten Erstunterzeichnerwie Gesine Schwan, Hans Leyendecker, Klaus Staeck,Frank Bsirske und Gerd Schulte-Hillen unterstützt. Zeitgleich warb dasAktionsbündnis mit Großplakaten in Berlin für das überfällige Transparenzgesetz.236
<strong>Die</strong> Politik hat bereits auf die veränderte Konstellation reagiert: <strong>Die</strong>medienpolitischen Sprecher von Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen und der SPDbegrüßten die Initiative und intensivierten ihre Bemühungen, doch nochein IFG zustande zu bringen. Offensichtlich war der Druck von außen notwendig,um das Thema wieder auf die Agenda zu setzen, wie Beteiligteeinräumen. <strong>Die</strong> Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs wurde aufgrund derBlockadehaltung der Ministerialbürokratie <strong>im</strong> Frühjahr 2004 erneut vonden Fraktionen übernommen, die nun gleich nach der Sommerpauseeinen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen wollen.Informationsfreiheit als VerhandlungsmasseDas mühselige Ringen um die Informationsfreiheit auf Bundesebenewirft die Frage auf, unter welchen Rahmenbedingungen es eigentlich zuden bisher vier Landesgesetzen zur Informationsfreiheit gekommen ist.In der Tat zeigt deren Gesetzgebungsgeschichte, dass die Informationsfreiheitin Deutschland eher als Verhandlungsmasse benutzt wurde, dennals Bürgerrecht, das um seiner selbst willen eingeführt worden ist.Vorreiter war 1998 Brandenburg. Dort ist die Informationsfreiheit als wichtigesAnliegen der Bürgerrechtsbewegung sogar in der Landesverfassungvon 1992 verankert, genießt also einen besonders herausgehobenen Stellenwert.<strong>Die</strong>se Pionierrolle Brandenburgs ist damit zu erklären, dass dasBündnis 90 – noch vor dem Zusammenschluss mit den Grünen – in demBundesland an der ersten Regierung von Ministerpräsident Stolpe beteiligtwar und so ein Projekt durchsetzen konnte, das in der Tradition derTransparenzforderungen der DDR-Opposition steht. Mit der Aufnahme indie Landesverfassung hatte sich Brandenburg frühzeitig festgelegt, auchwenn es angesichts vieler Bedenken in der Verwaltung sechs Jahredauerte, bis das Akteneinsichtsrecht schließlich Gesetz wurde. Auch aufBundesebene waren es Bündnis90/<strong>Die</strong> Grünen, die bereits 1997 unterder Regierung Kohl vergeblich einen IFG-Entwurf <strong>im</strong> Bundestag eingebrachthatten.1999 folgte schließlich das Bundesland Berlin mit einem eigenen Landesgesetz.Beschlossen wurde es zu Zeiten der großen Koalition in derletzten Sitzung der alten Legislaturperiode. Weil allgemein mit einemEnde der CDU/SPD-Koalition und einer rot-grünen Regierung nach denWahlen zum Abgeordnetenhaus gerechnet wurde, fand ein IFG-Antragder Grünen aus dem Jahr 1997 eine Mehrheit – mit den St<strong>im</strong>men von SPD,Grünen und PDS, aber gegen die des Regierungspartners CDU. <strong>Die</strong> Wahlen237
achten dann überraschend eine Fortsetzung der großen Koalitionunter Eberhard <strong>Die</strong>pgen.Anfang 2000 kam in Schleswig-Holstein ein Landes-IFG zustande, dasseine Entstehung ebenfalls einer ungewöhnlichen Wahlarithmetik verdankt:<strong>Die</strong> SPD unter Ministerpräsidentin Heide S<strong>im</strong>onis musste fürchten,nach der nächsten Landtagswahl auf die St<strong>im</strong>men des SüdschleswigschenWählerverbandes (SSW) angewiesen zu sein, der Vertretung der dänischenMinderheit <strong>im</strong> Parlament. Um gute Beziehungen bemüht, prüfte die SPDdeshalb, welche inhaltlichen Forderungen des potenziellen Partners dennproblemlos aufgegriffen werden konnten. Dabei besann sie sich auf denIFG-Entwurf, den der SSW ganz <strong>im</strong> Sinne der aus Skandinavien bekanntenTransparenzverpflichtungen eingebracht hatte. Vor diesem Hintergrundwurde das Landesgesetz dann noch in der alten Legislaturperiodeschnell und unaufgeregt verabschiedet.In Nordrhein-Westfalen als viertem Bundesland trat das IFG <strong>im</strong> Januar2002 in Kraft. Vorausgegangen war eine entsprechende Vereinbarung <strong>im</strong>Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung. Handlungsdruck fürdie Koalitionspartner entstand allerdings erst dadurch, dass die CDU-Opposition wenig später einen ersten Gesetzentwurf präsentiert hatteund damit die Regierung auf ihrem eigenen Terrain vorzuführen drohte.Nach einem Expertenhearing, das eine breite Unterstützung für ein solchesVorhaben aufzeigte, legten die Fraktionen von SPD und Grünen schließlicheinen eigenen Entwurf vor, der <strong>im</strong> Landtag verabschiedet wurde.Das IFG verdankt seine Existenz in Deutschland somit vor allem dem taktischenKalkül der Parteien. Ein wahres politisches Anliegen ist es der SPDbisher nicht gewesen. <strong>Die</strong>se Schlussfolgerung gilt ungeachtet der Tatsache,dass die Erfahrungen mit dem IFG auch aus der Perspektive der Sozialdemokratenüberaus positiv sind. So bilanzierte der Innenministervon Nordrhein-Westfalen, Fritz Behrens, <strong>im</strong> April 2003 auf der Tagung derBertelsmann Stiftung „Informationsfreiheit und der transparente Staat” <strong>im</strong>Rückblick auf ein Jahr Anwendungspraxis in NRW, „dass das Mehr anDemokratie und Transparenz mit dem IFG günstig eingekauft ist”.Erfahrungen aus den Bundesländern und dem AuslandTatsächlich zeigt eine genauere Betrachtung der Befürchtungen, die vonIFG-Kritikern geäußert werden, dass diese Argumente nicht von den bisher238
vorliegenden Erfahrungswerten gestützt werden. <strong>Die</strong> zentralen Vorbehaltegegen das IFG beziehen sich auf eine Überlastung der Ämter und damitverbunden einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand sowie auf dasBekanntwerden von Betriebs- und Geschäftsgehe<strong>im</strong>nissen.<strong>Die</strong> Arbeitsüberlastung, mit der aufgrund einer unterstellten Antragsflut<strong>im</strong>mer wieder argumentiert wird, ist nirgendwo eingetreten. In Berlinwurden von Oktober 1999 bis November 2000 lediglich 164 Anträge gestellt,darunter elf von Pressevertretern, so eine Erhebung des Innensenators.Für das Land Brandenburg erfasst nur die Stadt Potsdam regelmäßigdie Zahl der Anträge – und kommt dabei auf 303 Anfragen <strong>im</strong> gesamtenZeitraum vom März 1998 bis September 2002. In Nordrhein-Westfalen,dem bevölkerungsreichsten Bundesland, wurden <strong>im</strong> Jahr 2002 insgesamt1.152 Anträge gezählt.Für Schleswig-Holstein hateine landesweite statistischeAuswertung ergeben, dasswährend der ersten zwei Jahredie meisten der 2.000 Anträgevon Bürgern kamen, die völligplausible Fragen zu Bau- undPlanungsvorhaben in ihrenGemeinden hatten. Außerdemging es z.B. um die Vergabevon Kindergartenplätzen, dieWirtschaftlichkeit der Kurverwaltungoder die Arbeitsbelastungder Richter am Oberlandesgericht.<strong>Die</strong> Daten zeigen,dass von einer Überlastungder Ämter oder einererheblichen Kostensteigerungauch <strong>im</strong> nördlichsten Bundesandkeine Rede sein kann:<strong>Die</strong> Hälfte der Ämter <strong>im</strong> LandSchleswig-Holstein erhielt keineneinzigen IFG-Antrag, undbei denen, die Anfragen bekamen,lag die durchschnittlicheAntragszahl bei fünf239
innerhalb von zwei Jahren. Wer angesichts dieser Werte von einer unzumutbarenÜberlastung der Ämter spricht, muss ein äußerst geringesZutrauen in die Leistungsfähigkeit der deutschen Verwaltung haben.<strong>Die</strong> deutschen Erfahrungen sind deckungsgleich mit den internationalen,denn in fast allen Industrieländern gibt es mittlerweile Informationsfreiheitsgesetze,ohne dass bekannt geworden ist, dass deswegen irgendwoder Staatsbankrott droht oder die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftgefährdet wird. Kanada beziffert seine Ausgaben für die Bearbeitung derjährlich rund 20.000 Informationsanträge zwar auf rund 25 Millionen KanadischeDollar. Doch weist der dafür zuständige Regierungsbeauftragtegleichzeitig darauf hin, dass dies nur 2,5 Prozent der Summe sind, die derStaat Kanada allein für PR-Maßnahmen ausgibt. In ganz Skandinavienist die Behördentransparenz seit Jahrzehnten verankert, darunter inSchweden sogar seit 1766. Niemand befürchtet dort auf Seiten der Industrie,dass es zu Gehe<strong>im</strong>nisverrat kommen könnte, weil die offeneVerwaltungskultur längst selbstverständlich geworden ist. In den USAgilt der Freedom of Information Act seit 1966 und wurde fortlaufendaktualisiert.Als Totschlagargument gegen das IFG wird mitunter auch ins Feldgeführt, wenn es denn keine Antragsflut geben würde, spräche dochgerade die moderate Nachfrage dafür, dass die Bürger ein solchesGesetz gar nicht vermissen würden. Hierzu ist anzumerken, dass einBürgerrecht sich grundsätzlich nicht aus seiner quantitativen Inanspruchnahmeheraus rechtfertigt, sondern einen Wert an sich darstellt.<strong>Die</strong> prinzipielle Möglichkeit, Akten einzusehen, ist also der entscheidendeFortschritt. Auch das Petitions- oder Demonstrationsrechtwird bekanntlich nur von wenigen genutzt, ohne dass deswegen aus Politikoder Verwaltung St<strong>im</strong>men laut werden, eine Kosten-Nutzen-Analysevorzunehmen. Richtig ist allerdings, dass die IFG-Landesgesetze bisherunzureichend bekannt sind. In Nordrhein-Westfalen fiel z.B. die geplanteÖffentlichkeitskampagne, die auf das neue Bürgerrecht hinweisen sollte,einer Haushaltssperre zum Opfer. <strong>Die</strong>ses Paradox, dass ausgerechnet einTransparenzgesetz öffentlich kaum wahrgenommen wird, hat leidererhebliche Folgen für den Gesetzgebungsprozess in weiteren Ländernund auf Bundesebene, denn ohne Druck der Öffentlichkeit verspürenVerwaltung und Politik auch keine Notwendigkeit, die Aktenschränke zuöffnen.240
<strong>Die</strong> Vorbehalte der Wirtschaft und dabei insbesondere des BDI, eskönnten Betriebs- und Geschäftsgehe<strong>im</strong>nisse öffentlich werden, lassensich gleichfalls nicht durch Erfahrungswerte untermauern. Trotz jahrelangerPraxis in den vier Bundesländern mit IFG kann der BDI nicht ein Beispieldafür nennen, dass ein Schaden eingetreten ist. Auch aus der Anwendungdes Umweltinformationsgesetzes (UIG), mit dem in Deutschland aufgrundeiner EU-Richtlinie bereits 1994 das Öffentlichkeitsprinzip für alle umweltrelevantenInformationen bei Ämtern und Behörden eingeführtwurde, ist nicht ein Beispiel bekannt. Dabei geht es be<strong>im</strong> UIG <strong>im</strong> Laufevon mittlerweile zehn Jahren um etliche Tausend Praxisfälle, so dass derBDI sich nicht mit dem Standardargument herausreden kann, die Erfahrungenseien noch nicht ausreichend für eine Bewertung. Da BetriebsundGeschäftsgehe<strong>im</strong>nisse sowohl nach dem UIG als auch nach dem IFGausdrücklich geschützt werden und eine langjährige Spruchpraxis derGerichte vorliegt, was als Betriebs- und Geschäftsgehe<strong>im</strong>nis gelten muss,drängt sich ohnehin der Verdacht auf, dass es dem BDI nicht um einreales Risiko geht, sondern dass ihm letztlich die ganze Richtung hin zumehr Transparenz nicht passt. <strong>Die</strong>se Haltung ist umso unverständlicher,wenn man bedenkt, dass in anderen Ländern ein besserer Informationszugangals positiver Standortfaktor gesehen wird. In den USA zählt dieWirtschaft mit rund 80 Prozent aller Anträge sogar zu den Hauptnutzerndes Freedom of Information Act. Eine ausgeprägte Wirtschaftsfeindlichkeitwird auch der BDI der amerikanischen Politik schwerlich vorwerfenkönnen.Vorteile des IFG – nicht nur für Journalisten<strong>Die</strong> Argumente der IFG-Kritiker hatten bisher auch deswegen eine großeWirkung, weil das Prinzip der Informationsfreiheit in Deutschland bis vorkurzem zu wenige Fürsprecher gefunden hat. Auch die Journalistenhaben bisher wenig dazu beigetragen, das IFG bekannt zu machen. Dasliegt zum einen daran, dass kompliziert klingende Gesetze nicht <strong>im</strong>Mittelpunkt des Medieninteresses stehen, zum anderen aber auch daran,dass viele Journalisten selbst noch nicht mitbekommen haben, wie siedas IFG für ihre eigene Arbeit nutzen könnten. Aus journalistischer Sichtist das Informationsfreiheitsgesetz wichtig, weil es die deutsche Traditionder Amtsverschwiegenheit von der Regel zur begründungsbedürftigenAusnahme macht und damit zu einem generellen Kl<strong>im</strong>a der Offenheitbeiträgt. <strong>Die</strong>se Umkehrung ist überfällig, weil Journalisten <strong>im</strong>merwieder durch zugeknöpfte Behördenvertreter in der Recherche behindert241
werden. Pressesprecher deutscher Behörden erteilen Auskünfte nichtselten nach Gutsherrenart, Informationsblockaden sind an der Tagesordnung.Während der Auskunftsanspruch der Medienvertreter nach denLandespressegesetzen bereits erfüllt ist, wenn die Pressestelle ehervage mündliche Auskünfte gibt, wird mit dem IFG ein Anspruch aufEinsicht in Originaldokumente etabliert. Und da das IFG ein Jedermannsrechtist, braucht ein Journalist, der einer für die Behörde brisantenAngelegenheit auf der Spur ist, auch sein berufliches Interesse nichtgleich zu offenbaren. Es ist problemlos möglich, den IFG-Antrag als Privatpersonzu stellen. Damit wird es für Behörden schwieriger, heikle Anfragenüber die Pressestelle abzublocken. Weil vom IFG eine Verbesserungder Recherchemöglichkeiten in Deutschland zu erwarten ist, setztsich das Netzwerk Recherche für diese Reform ein.Wie wichtig die Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes wäre,zeigt sich be<strong>im</strong> Blick auf das Korruptionsranking der Anti-KorruptionsorganisationTransparency International (TI). Im vergangenen Jahr belegteDeutschland hier lediglich den 18. Platz. Aus diesem Grund fordert auchTI die rasche Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes. Staatenwie die skandinavischen Länder, die bereits über ein IFG verfügen undTransparenz <strong>im</strong> staatlichen Handeln zeigen, schneiden <strong>im</strong> Vergleich deutlichbesser ab, verfügen also über signifikant weniger Korruption.Aber auch für die Verwaltung selbst ließe sich das IFG zu einem Modernisierungsschubnutzen: Je besser ein Amt organisiert ist, desto leichterkann es Auskunftsbegehren nachkommen. <strong>Die</strong> Nutzung des Internet, sowie sie in den USA mit der Veröffentlichung von häufig angefragten Behördenunterlagenin electronic reading rooms sogar gesetzlich vorgeschriebenist, eröffnet die Chance, Transparenz bürgerfreundlich undkostengünstig einzuführen. Letztlich würde die neue Offenheit auch dieAkzeptanz von Verwaltungshandeln erhöhen und auf diese Weise denBehörden nutzen.Unter den politischen Parteien steckt vor allem die SPD in einer Zwickmühle:Wer den „aktivierenden Staat” will, wie es die Sozialdemokratiengerne verkünden, sollte den Bürgern dann auch die Informationen zugänglichmachen, die für ein erfolgreiches politisches Engagement dieGrundvoraussetzung sind. Das demokratietheoretische Potenzial, das inder Informationsfreiheit steckt, wird bisher vor allem von den Grünen betont,aber nur von einzelnen Sozialdemokraten, vor allem dem medien-242
politischen Sprecher, Jörg Tauss. Der Druck von der Wirtschaftsseite wogfür die SPD lange Zeit offenbar schwerer als die <strong>im</strong> Koalitionsvertrag eingegangeneVerpflichtung, mit dem IFG auf der Ebene der Bürgerrechteeine Reform durchzusetzen.<strong>Die</strong> Tatsache, dass Deutschland <strong>im</strong> internationalen Vergleich zum Schlusslichtbei der Informationsfreiheit geworden ist, sollte keineswegs Anlasszur Resignation geben, sondern als Chance begriffen werden. Da auspraktisch allen westlichen Ländern Erfahrungen mit Informationsfreiheitsrechtenvorliegen, bietet sich die Möglichkeit, darauf aufzubauen und diebewährten Regeln zu übernehmen, um ein modernes, weitreichendes undbürgerorientiertes Gesetz zu schaffen. Mit dem Entwurf der Journalistenverbändeund Bürgerrechtsgruppen, der Anfang April 2004 präsentiertwurde, ist dieser Schritt unternommen worden. Nunmehr liegt ein ausgearbeiteterGesetzesvorschlag auf dem Tisch, an dem sich der angekündigteFraktionsentwurf messen lassen muss. <strong>Die</strong> andere Rechts- und Verwaltungskulturder Vorreiterstaaten kann schwerlich als Begründung für einedeutsche Abstinenz bei der Informationsfreiheit herangezogen werden,da auch in vier Bundesländern reichhaltige und positive Erfahrungen gesammeltwurden, die in den Bundesentwurf einfließen können. Den Bedenkenträgernin den Ministerien sei die Bilanz nach einem Jahr Informationsfreiheitin Nordrhein-Westfalen zur Lektüre empfohlen. InnenministerBehrens stellt dort unumwunden fest: „Das neue Gesetz entwickelt sich eindeutigpositiv. <strong>Die</strong> NRW-Verwaltung ist offener geworden und anfänglicheVorbehalte gegen dieses Gesetz haben sich als unberechtigt erwiesen.”Weitere Informationen zum IFG, vor allem der Text des Gesetzentwurfsder Journalistenorganisationen und Bürgerrechtsgruppen, sind zu findenunter www.netzwerkrecherche.de und unter www.pro-information.de.243
Öffentliche Vorabendveranstaltung zum MainzerMedienDisput 20043. November 2004, 19.00 Uhr,Foyer Landesfunkhaus SWRAm Fort Gonsenhe<strong>im</strong> 139, 55122 MainzPodiumsdiskussion:„Zwischen Enthüllungs-Druck und Quotenfieber –über die schleichende Veränderungder politische Fernsehmagazine“Musikalische Umrahmung: Anne Bärenz & Frank WolffImpulsreferat: Rainer Braun, FunkkorrespondenzThomas Fuhrmann, Frontal 21 (ZDF) Cassian von Salomon, Spiegel TVSonia Mikich, Monitor (WDR)Petra Lidschreiber, Kontraste (RBB)Andreas Bönte, Report München (BR) Wolfgang Fandrich, Fakt (MDR)Birgitta Weber, Report Mainz (SWR)Moderation: Kuno Haberbusch, Zapp Medienmagazin (NDR)<strong>Die</strong> Tradition der Magazine, getragen von den großen Namen des Nachkriegsjournalismus,belastet die aktuellen politischen Magazine heute wie einschwerer Mühlstein. Denn sie werden <strong>im</strong>mer wieder gemessen an den publizistischenVorgängern, dessen Erbe sie heute verwalten. Gleichzeitig habensie die Rahmenbedingungen für die Magazine entscheidend verändert: verschärfteKonkurrenz, ein breites Spektrum von Anbietern, die unter demSegel „politische Magazine” unterwegs sind und völlig veränderte Erwartungendes Publikums: auch deshalb ist heute vom publikumsträchtigen „Gesprächswert”eines Themas die Rede und nicht mehr von der „Aufklärungsfunktion”der interessierten Bürger.In diesem Forum werden die Schlüsselfragen thematisiert, die <strong>im</strong>mer wiedervon der Medienkritik formuliert werden:• Wie viele wirkliche Enthüllungen liefern die Magazine heute noch?• Wie oft geht es nur noch um den Effekt der (Pseudo)-Exklusivität?• Wie mutig ist die „neue“ Journalistengeneration –welche Spielräume gibt es noch – werden sie auch genutzt?• Wie können sich die Magazine einer Instrumentalisierung von Informantenund Interessengruppen entziehen?• Wie können sie ein eigenes publizistisches Profil entwickeln?Eine Veranstaltung von:245
9. MainzerMedienDisput 4. November 2004KOMMERZ, KARTELLE, KUMPANEI –Medien und Politik zwischen Populismus und Verantwortungab 9.00 Uhr Kaffee & KommunikationPROGRAMM9.20 Uhr AuftaktGeorg Schramm9.30 Uhr Einstieg und BegrüßungKurt BeckManfred HelmesMarkus SchächterMainzer Medien AgentMinisterpräsident Rheinland-Pfalz undVorsitzender der Rundfunkkommission der LänderLandeszentrale für privateRundfunkveranstalter (LPR), DirektorZDF, Intendant246Eröffnungsrede zum KongressthemaEdgar ReitzRegisseur, Filmemacheranschließend PodiumsdiskussionKommerz, Kartelle, Kumpanei – Macht und Medien in Europa11.00 Uhr Thesen und Positionen:Jürgen KrönigJosé ComasDaniel Vernet11.15 Uhr Anschließend eine Diskussion mit:<strong>Die</strong> Zeit, KorrespondentEl Pais, DeutschlandkorrespondentLe Monde, International DirectorFre<strong>im</strong>ut Duveehem. Medienbeauftragter der OSZERoger Köppel<strong>Die</strong> Welt, ChefredakteurDaniel Cohn-Bendit Fraktion der Grünen/Freie europ. Allianz<strong>im</strong> EU-Parlament, VorsitzenderDr. Hermann Scheer MdBKurt BeckMinisterpräsident Rheinland-Pfalz undVorsitzender der Rundfunkkommission der LänderAlexandra Föderl-Schmid Der Standard, Korrespondentin,Vorsitzende der Auslands-PressekonferenzModeration:12.45 Uhr MittagspauseLilli Gruber, Fernsehjournalistin,Mitglied des europäischen Parlaments
Das organisierte Versagen: die „Meute“ trifft die „Bande“14.00 Uhr Georg Schramm Mainzer Medien Agent14.15 Uhr KurzanalyseHans Ulrich Jörges14.25 Uhr Eine Diskussion mit:Peter MerseburgerProf. Dr. Jürgen E. ZöllnerGerhart-Rudolf BaumMathias MachnigBettina GausDr. Thomas StegChristoph KeeseModeration:Stern, Stv. ChefredakteurJournalist und AutorKultusminister Rheinland-PfalzBundesinnenmister a.D.Politik- und Unternehmensberatertaz - die tageszeitungStv. RegierungssprecherChefredakteur, Welt am SonntagMichael Jürgs, Publizist16.15 Uhr Preisverleihung „Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen“ –Medienpreis des „netzwerk recherche“„Sind die noch zu retten?“ –der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Krise16.30 Uhr Streitgespräch:Michael Hanfeld vs. Ernst ElitzFAZ, Medienredakteur Deutschlandfunk, Intendant16.50 Uhr Anschließend eine Diskussion mit:Dr. Ekkehard WienholtzRegina ZieglerNikolaus BrenderAndrea NahlesAntje Karin PieperGernot LehrModeration:Vorsitzender des Medienrates (ULR)Film- und FernsehproduzentinZDF, ChefredakteurMitglied des ZDF-FernsehratesMABB, MedienrätinRechtsanwalt,Medienberater Deutsche Bischofskonferenz<strong>Die</strong>mut Roether, epd medien, Redakteurin18.30 Uhr NachschlagWalter SchumacherSprecher der Landesregierung Rheinland-Pfalz18.45 Uhr Mainzer MedientreffEmpfang der Landesregierung Rheinland-Pfalz247
248KOMMERZ, KARTELLE, KUMPANEI –Medien und Politik zwischen Populismus und VerantwortungDer 9. MainzerMedienDisput wird sich mit der Zukunft der Presse- undInformationsfreiheit angesichts massiver Angriffe auf die demokratischeÖffentlichkeit beschäftigen. Wie kann es gelingen, längst erreichte Standardsder journalistischen Arbeit in einem zunehmend deregulierten undmarktradikalen Europa zu verteidigen? Wie kann der Dialog zwischenMedien und Politik noch funktionieren? Und welche Rolle spielt deröffentlich-rechtliche Rundfunk zukünftig in der sich verändernden Medienlandschaft?In drei großen Panels soll über diese Themen lösungsorientiert diskutiertwerden:• Konzentration, Kommerz und Kungelei in Europas Medien gefährdendie Demokratie. Weitgehend unkontrollierte Machteliten sind dabei,neue Meinungsmonopole zu schaffen. Was können Journalisten,Medien und Politiker tun, damit der Weg in das neue Europa nicht zurGeisterbahn des Kommerzes verkommt?• Das Verhältnis von Politik und kritischem Journalismus wirkt zunehmendgespannt. Politiker bevorzugen die große Plattform ohne Rückfragen;Journalisten setzen zu oft auf Personalisierung ohne Hintergrund.Am Beispiel der grundlegenden Veränderungen in der Tarif-,Sozial- und Wirtschaftspolitik wollen wir die Grenzen der Politikvermittlungder aktuellen „Reformpolitik“ diskutieren.Welche Verantwortung haben Politik und Medien in dieser Umbruchsituationbei der Vermittlung einer kontroversen Debatte zur Zukunft derRepublik? Welche Folgen hat es, wenn Politiker Getriebene von Kampagnenund Schlagzeilen werden? Wie können sich die Medien demsüßen Gift der populistischen Vereinfachung verweigern?• Ein Gral der Unabhängigkeit und die Stütze der Demokratie sollte ernach dem Willen der Verfassungsväter und -mütter einst werden: deröffentlich-rechtliche Rundfunk. Heute scheint er sich – <strong>im</strong> Quotenschattendes volljährigen Privatfunks – nur noch über den Tag zu retten.<strong>Die</strong> Quote ist zum Viagra journalistischen Denkens geworden. Waswird aus einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seine Programm-
farben, seine Anmutung, seine Planung und seine Programmakzentezunehmend dem unterhaltsamen Profil der kommerziellen Konkurrenzanpasst?Während des 9. MainzerMedienDisputes wollen wir eine Reise durch dieMedienwelt unseres schönen neuen Europas unternehmen. UnsereReiseführer werden in vielen Referaten, Statements und Diskussionsrundenneue und alte Meinungsmonopole und Konzentrationstendenzenkritisch beleuchten. Praktiker, Wissenschaftler und Kritiker berichten vonvielen europäischen Fronten, vom Kampf gegen Kommerz, Kartelle undKumpanei...Wir würden uns freuen, wenn Sie be<strong>im</strong> 9. MainzerMedienDisput mit unsdie Medienentwicklung in unserem schönen neuen Europa aufmerksambeobachten und kritisch begleiten würden.249
VeranstalterStaatskanzlei Rheinland-Pfalzin Zusammenarbeit mit derLandeszentrale für PrivateRundfunkveranstalter (LPR)ProjektgruppeDr. Thomas LeifUli RöhmBertold RungeChristoph Schmidt-Lunau<strong>Die</strong>mut RoetherBeiratStephan Engelfried, DGBDr. Joach<strong>im</strong> Kind, LPRManfred Helmes, LPRWalter Schumacher, StaatskanzleiDr. Stefan Weiler, StaatskanzleiWir danken für die UnterstützungAnmeldung und OrganisationMainzerMedienDisputc/o MGS Marketing GmbHTel. 02634/9688-12/13/14Fax 02634/968819Mittelstraße 556579 HardertEmail: info@mediendisput.deAnmeldeformular und weitere Informationeninfo@mediendisput.de250
DOKUMENTATIONENFolgende Dokumentationen können bei der MGS, Mittelstr. 5,56579 Handert bestellt werden:Wahre Nachrichten – Berichterstattungzwischen Medien-Realität und WirklichkeitMainzerMedienDisput vom 26. November 1998Markt, Macht und Macher – Wohin treibt das ProgrammMainzerMedienDisput vom 4. November 1999Im Seichten kann man nicht ertrinken...... Medien zwischen Sinn und SensationMainzerMedienDisput vom 9. November 2000New Journalism – vom Kulturgut zum WirtschaftsgutMainzerMedienDisput vom 27. November 2001Verschwiegen, verschwunden, verdrängt –was (nicht) öffentlich wirdMainzerMedienDisput vom 30. Oktober 2002Auf dem Boulevard der Öffentlichkeit –was kostet uns die MeinungsfreiheitMainzermedienDisput vom November 2003<strong>Die</strong> Dokumentationen der Jahre 2000, 2001, 2002 und 2003 erhalten Sieaußerdem als <strong>PDF</strong>-Download unter www.mainzermediendisput.de251
IMPRESSUMDER BOULEVARD DER ÖFFENTLICHKEIT – WAS KOSTET UNS DIE MEINUNGSFREIHEIT?8. MainzerMedienDisput vom 4. November 2003Veranstalter:Beirat:Organisation:Konzeption und Redaktion:Redaktionelle Mitarbeit:Layout & Artwork:Illustration Titel:Fotos:Karikaturen:Korrekturen:Druck:Staatskanzlei Rheinland-Pfalz,Landeszentrale für private Rundfunkanbieter Rheinland-Pfalzin Zusammenarbeit mit der Projektgruppe MainzerMedienDisput:Dr. Thomas Leif, Uli Röhm, Berthold Runge; Christoph Schmidt-Lunau;<strong>Die</strong>mut RoetherStefan Engelfried (DGB), Dr. Joach<strong>im</strong> Kind (LPR), Manfred Helmes (LPR),Dr. Stefan Weiler, Walter Schumacher (Staatskanzlei)Günter Schreiber (MGS, Hardert)www.info@MedienDisput.deDr. Thomas Leif (verantw.)Johannes Bentrup, Dörte Schulte-DerneNina Faber de.sign, WiesbadenGerhard Mester, WiesbadenRico Rosival (ZDF), Pressestelle, NDRGerhard Mester, WiesbadenAlbrecht Ude, Dörte Schulte-DerneColorDruck, Le<strong>im</strong>enISBN 3-89892-293-6 Oktober 2004252




![Dokumentation des 7. MainzerMediendisputs (2002) [PDF]](https://img.yumpu.com/52469993/1/185x260/dokumentation-des-7-mainzermediendisputs-2002-pdf.jpg?quality=85)




![Dokumentation des 12. MainzerMediendisputs (2007) [PDF]](https://img.yumpu.com/52373740/1/184x260/dokumentation-des-12-mainzermediendisputs-2007-pdf.jpg?quality=85)

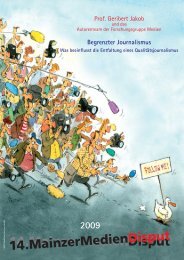

![(2008) [PDF] - Netzwerk Recherche](https://img.yumpu.com/52288699/1/184x260/2008-pdf-netzwerk-recherche.jpg?quality=85)