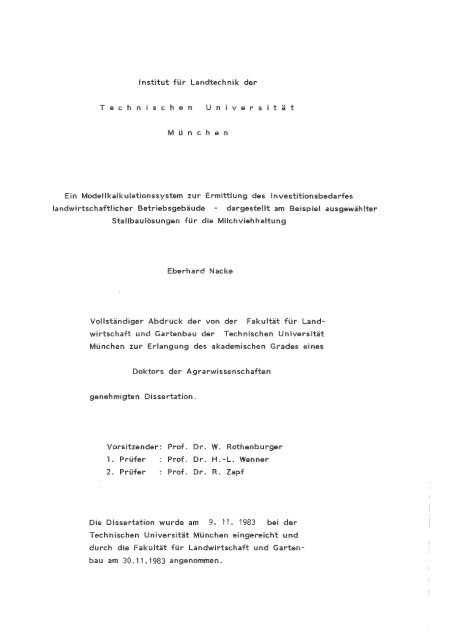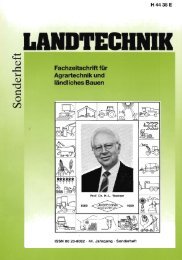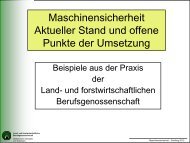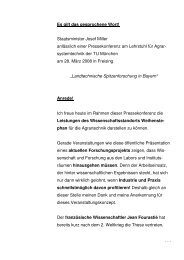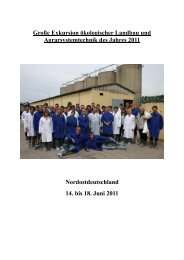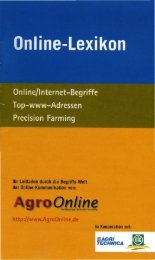1lJ1 - Tec.wzw.tum.de
1lJ1 - Tec.wzw.tum.de
1lJ1 - Tec.wzw.tum.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut für Landtechnik <strong>de</strong>r<br />
<strong>Tec</strong>hn sehen Un vers tät<br />
München<br />
Ein Mo<strong>de</strong>llkalkulationssystem zur Ermittlung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes<br />
landwirtschaftlicher Betriebsgebäu<strong>de</strong> dargestellt am Beispiel ausgewählter<br />
Stallbaulosunqen für die Milchviehhaltung<br />
Eberhard Nacke<br />
Vollständiger Abdruck <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Fakultät für Land<br />
wirtschaft und Gartenbau <strong>de</strong>r <strong>Tec</strong>hnischen Universität<br />
München zur Erlangung <strong>de</strong>s aka<strong>de</strong>mischen Gra<strong>de</strong>s eines<br />
Doktors <strong>de</strong>r Agrarwissenschaften<br />
genehmigten Dissertation.<br />
Vorsitzen<strong>de</strong>r:<br />
1. Prüfer<br />
2. Prüfer<br />
Prof. Dr. W. Rothenburger<br />
Prof. Dr . H.-L. Wenner<br />
Prof. Dr. R. Zapf<br />
Die Dissertation wur<strong>de</strong> am 9. 11. 1983 bei <strong>de</strong>r<br />
<strong>Tec</strong>hnischen Universität München eingereicht und<br />
durch die Fakultät für Landwirtschaft und Garten<br />
bau 'Im 30.11.1983 angenommen.
© 1983 by Or. aqr . E. Nacke<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, Wie<strong>de</strong>rgabe, Vervielfältgigung und<br />
Übersetzung nur mit Genehmigung <strong>de</strong>s Autors.<br />
Selbstverlag im Eigenvertrieb: Landtechnik Weihenstephan<br />
Vbttinger Str. 36<br />
0-8050 Freising
Vor W 0 r t<br />
Investitionen für landwirtschaftliche Betriebsgebäu<strong>de</strong> führen in <strong>de</strong>r<br />
Regel zu einer Bindung erheblicher Kapitalmittel und gleichzeitig zu<br />
einer längerfristigen Festlegung <strong>de</strong>r betrieblichen Produktionsschwerpunkte.<br />
Die Größenordnung <strong>de</strong>r jeweils erfor<strong>de</strong>rlichen Kapitalmittel wird dabei<br />
erheblich von <strong>de</strong>r Grundrißgestaltung und <strong>de</strong>r konstruktiven Auslegung<br />
eines Gebäu<strong>de</strong>s bestimmt. Ebenso können regional begrenzte behördliche<br />
Auflagen o<strong>de</strong>r die spezifische Marktsituation einen starken Einfluß<br />
auf die Höhe <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes ausüben. Vor diesem Hintergrund<br />
vielfältiger Einflußfaktoren auf die Höhe <strong>de</strong>s jeweils erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Finanzierungsvolumens erscheint es kaum möglich, mit Hilfe allgemeiner<br />
Richtwerte einen hinreichend genauen Vergleich unterschiedlicher<br />
Planungslösungen durchzuführen.<br />
In <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit wird eine Metho<strong>de</strong> vorgestell , die aufgrund<br />
einer sehr differenzierten Berechnung und Aufschlüsselung <strong>de</strong>s lnvestitionsbedarfes<br />
von Gebäu<strong>de</strong>n eine exakte Analyse <strong>de</strong>r spezifischen<br />
Ursachen von Preisunterschie<strong>de</strong>n beliebiger Alternativlösungen erlaubt.<br />
Dabei wird vor allem auch <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Landwirtschaft sehr verbreiteten<br />
Formen <strong>de</strong>r baulichen Selbsthilfe Rechnung getragen.<br />
Die beispielhaften Untersuchungen an verschie<strong>de</strong>nen Planungslösungen für<br />
Milchviehställe zeigen, daß die Metho<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Lage ist, <strong>de</strong>r Praxis,<br />
<strong>de</strong>r Beratung und nicht zuletzt <strong>de</strong>r Wissenschaft dringend benötigte<br />
formationen über die notwendigen Aufwendungen zur Erstellung landwirtschaftlicher<br />
Betriebsgebäu<strong>de</strong> zu liefern.<br />
Weihenstephan, im Dezember 1983
Nach Fertigstellung dieser Dissertationsschrift ist es mir ein beson<strong>de</strong>res<br />
Anliegen, all <strong>de</strong>njenigen meinen beson<strong>de</strong>ren Dank abzustatten, die mich in<br />
<strong>de</strong>n letzten drei Jahren geför<strong>de</strong>rt und unterstützt haben.<br />
An erster Stelle steht hier mein Doktorvater, Prof. Dr. Wenner, <strong>de</strong>r mir<br />
nicht nur das Thema zur Bearbeitung überlies, son<strong>de</strong>rn auch durch sein un<br />
beirrbares Vorschußvertrauen und die Hilfestellungen bei <strong>de</strong>n grundsätzli<br />
chen Fragen sehr zum Gelingen <strong>de</strong>r Arbeit beitrug. Prof. Dr. Zapf gebührt<br />
ebenso mein Dank für die Übernahme <strong>de</strong>s Korreferates.<br />
Die mühsame und sehr zeitaufwendige Aufgabe eines Ansprechpartners und Be<br />
raters in allen inhaltlichen und methodischen Fragen hingegen nahm Dr.<br />
Auernhammer auf sich, <strong>de</strong>m ich zu<strong>de</strong>m auch für die Erarbeitung <strong>de</strong>r grund<br />
sätzlichen Voraussetzungen im Bereich <strong>de</strong>r Software danke.<br />
Dem Leibnitz-Rechenzentrum <strong>de</strong>r Bayerischen Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften und<br />
<strong>de</strong>m Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For<br />
sten gilt auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite mein Dank für die kostenlose Bereitstel<br />
lung <strong>de</strong>r Rechenanlagen. Ebenso ist hier die Deutsche Forschungsgemein<br />
schaft zu nennen, die durch die Einrichtung <strong>de</strong>s Son<strong>de</strong>rforschungsbereiches<br />
141 diese Arbeit finanziell erst ermöglichte.<br />
Die Familien Neumeier, Riexinger, Pfliegler und Mittermeier gestatteten<br />
uns die Messungen auf ihren Baustellen, wofUr ich ihnen herzlich danke.<br />
Die Messungen selbst wären in dieser Form jedoch nicht ohne die kollegiale<br />
Unterstützung vieler Mitarbeiter unseres Hauses und insbeson<strong>de</strong>re von<br />
Herrn Bierig möglich gewesen, ebenso wie ele "Gute Geister" <strong>de</strong>r Land<br />
technik Weihenstephan an <strong>de</strong>r endgültigen Fertigstellung <strong>de</strong>r Arbeit mitge<br />
wirkt haben.<br />
Ihnen allen will ich an dieser Stelle noch einmal ausdrUcklich danken.<br />
Zum Schluß sei es mir gestattet, auch meine Eltern in <strong>de</strong>n Dank einzubezie<br />
hen, die mich auf diesen Weg gebracht haben und uneigennützig alle meine<br />
Vorhaben stets unterstützt haben.<br />
Freising, im November 1983
Inhaltsverzeichnis<br />
Verzeichnis <strong>de</strong>r Abbildungen<br />
Verzeichnis <strong>de</strong>r Tabellen<br />
Verzeichnis <strong>de</strong>r Abkürzungen<br />
1. AufgabensteIlung<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
Hinführung zum Thema<br />
Problemstellung<br />
Zielsetzung<br />
- V-<br />
2. Definitionen und Abgrenzungen<br />
3.1<br />
3.2<br />
3.2.<br />
3.2.2<br />
3 2.<br />
3.3<br />
3.3.<br />
3 3.2<br />
33.3<br />
3.3.4<br />
3.4<br />
Metho<strong>de</strong>n zur Ermittlung Investitionsbedarf und jahres-<br />
kosten landwirtschaftlicher Betriebsgebäu<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r-<br />
Literatur 10<br />
Die Vorgaben <strong>de</strong>r DIN 276<br />
Verfahren auf <strong>de</strong>r Basis von Nachkalkulationen<br />
Die vergleichen<strong>de</strong> Planungsmetho<strong>de</strong> nach FRITZ<br />
Der Preisbaukasten nach STUBER<br />
Die KostenblocKmetho<strong>de</strong><br />
Verfahren auf <strong>de</strong>r Basis von standardisierten Werten für<br />
Teil eistungen<br />
Die Flächenmetho<strong>de</strong> nach HIRSCH<br />
Der schottische Farm Building Cost Gui<strong>de</strong><br />
Das Informationssystem Bauwesen - ISBAU<br />
Die Kalkulationsmetho<strong>de</strong> von KRABBE<br />
Wertung <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n methodischen Ansätze<br />
Seite<br />
VI<br />
!J(<br />
XI<br />
1<br />
3<br />
5<br />
10<br />
3<br />
'14<br />
14<br />
5<br />
7<br />
17<br />
17<br />
18<br />
20
4.1<br />
4.2<br />
4.2.1<br />
4.2.2<br />
4.2 3<br />
4.2.4<br />
4.3<br />
4.4<br />
4.5<br />
4.5.1<br />
4.5.2<br />
5.<br />
5.1<br />
5.1.1<br />
5.1.1.<br />
5.1.1.2<br />
5.1. 2<br />
5.1.2.1<br />
5.1.2.2<br />
5.1.2.3<br />
5.1.3<br />
5.1.3.1<br />
5.1.3.2<br />
5.1. 4<br />
5.2<br />
5.3<br />
5.4<br />
- VI -<br />
Vorstellung einer differenzierten Kalkulationsmetho<strong>de</strong> im<br />
Rahmen eines landtechnischen Informationssystems<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
Grundsätzliche Merkmale <strong>de</strong>s Kalkulationssystems<br />
Differenzierung in Teilleistungsmo<strong>de</strong>lle<br />
Berechnung <strong>de</strong>s naturalen Aufwan<strong>de</strong>s einer Teilleistung<br />
Berechnung <strong>de</strong>s monetären Aufwan<strong>de</strong>s einer Teilleistung<br />
Mo<strong>de</strong>llaggregation<br />
Mo<strong>de</strong>llaufbau und methodischer Ablauf<br />
Darstellung <strong>de</strong>r Kalkulationsergebnisse<br />
Dokumentation<br />
Aufbau <strong>de</strong>r Einzeldokumente<br />
Gesamtmo<strong>de</strong>llstruktur<br />
Datengrundlage<br />
Arbeitszeitberechnung<br />
Quellen für Arbeitszeitwerte<br />
Arbeitszeitdaten aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>s landwirtschaftlichen<br />
8auens<br />
Arbeitszeitdaten aus <strong>de</strong>m allgemeinen Hochbau<br />
Darstellung <strong>de</strong>r Richtwerte als Planzeitfunktionen<br />
Aufbau und Gültigkeitsbereich <strong>de</strong>r Richtwertetabellen<br />
Ableitung abhängiger Planzeiten<br />
Erstellung unabhängiger Planzeiten<br />
überprüfung <strong>de</strong>r Gültigkeit von Arbeitszeitrichtwerten<br />
Auswertung von Arbeitstagebüchern<br />
Funktionsermittlung durch Zeitstudien<br />
Einordnung <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
Mengenberechnung<br />
Preisberechnung<br />
Vergleich realer Bauaufwendungen mit kalkulatorisch ermittelten<br />
Daten in <strong>de</strong>r Literatur<br />
Seite<br />
25<br />
27<br />
30<br />
31<br />
32<br />
35<br />
35<br />
39<br />
45<br />
48<br />
49<br />
52<br />
57<br />
57<br />
57<br />
57<br />
58<br />
50<br />
61<br />
63<br />
66<br />
66<br />
69<br />
75<br />
78<br />
79<br />
81<br />
83
6.1<br />
6.1.1<br />
6.1.2<br />
6.1. 3<br />
6.1.4<br />
6.1.5<br />
6.1. 6<br />
6.2<br />
6 2.1<br />
6.2.2<br />
6 2.3<br />
6.2 4<br />
6.2.5<br />
6.3<br />
6.3. 1<br />
6.3.2<br />
6.4<br />
6.4.1<br />
6.4.2<br />
6.43<br />
6.5<br />
- VI I -<br />
Vergleich alternativer baulicher und verfahrenstechnischer<br />
Seite<br />
Lösungen <strong>de</strong>r Milchviehhaltung anhand von Mo<strong>de</strong>llrechnungen 86<br />
Beschreibung <strong>de</strong>r Vergleichsansätze<br />
Konstruktive Merkmale <strong>de</strong>r äußeren Hülle<br />
Auswahl <strong>de</strong>r Aufstallungssysteme und Bestan<strong>de</strong>sgrößen<br />
Anbin<strong>de</strong>stallvariationen<br />
Laufstallvariationen<br />
Fütterungs- und Melkeinrichtungen<br />
Preisvorgaben<br />
Ergebnisse und Ergebnisdiskussion <strong>de</strong>r Vergleichsrechnungen<br />
Anbin<strong>de</strong>ställe<br />
Laufställe für Her<strong>de</strong>n mit Nachzucht<br />
Laufställe für Her<strong>de</strong>n ohne Nachzucht<br />
Vergleich <strong>de</strong>r Aufstallungsformen<br />
Gesamtverq l ei ch<br />
Erweiterte Analyse durch Variation von Materialien und<br />
Preisen<br />
Analyse und Variation <strong>de</strong>s Materia1bedarfes <strong>de</strong>r Material<br />
verwendung<br />
Einfluß <strong>de</strong>r Materialpreise<br />
Aussagefähigkeit <strong>de</strong>r Kalkulationen in Bezug auf Ein<br />
sparungsmöglichkeiten durch bauliche Se1bsthi1femaßnahmen<br />
Ergebnisse <strong>de</strong>r Arbeitszeitkalkulationen<br />
Möglichkeiten und Grenzen baulicher Eigen1eistung<br />
Auswirkungen betrieblicher Eigenleistungen auf <strong>de</strong>n<br />
Investitionsbedarf<br />
Auswirkungen einer Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Funktionsmaße<br />
87<br />
88<br />
91<br />
'.l2<br />
96<br />
102<br />
107<br />
108<br />
112<br />
117<br />
127<br />
137<br />
141<br />
7. Ergeb"isdisk u ssion Einordnung <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> 167<br />
7.<br />
7.2<br />
8.<br />
Allgemeine Aussagefähigkeit<br />
Eignung für <strong>de</strong>taillierte Aussagen<br />
Zusammenfassu ng<br />
Litaratu r ver-zeich<br />
Anhang<br />
144<br />
144<br />
151<br />
152<br />
152<br />
155<br />
158<br />
61<br />
177<br />
182
Verzeichnis <strong>de</strong>r Abbildungen<br />
- IX -<br />
Nr . Seite<br />
Investitionen und Fremdkapitalzuwachs <strong>de</strong>r Landwirtschaft in <strong>de</strong>r<br />
Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland für die Zeitspanne 1970-1981 (nominale<br />
Entwicklung, Quelle: Stat. Jahrbuch ELF /24/) 2<br />
Kostenglie<strong>de</strong>rung nach DIN 276, Teil 2 und gefor<strong>de</strong>rter Oifferenzierungsgrad<br />
in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Stufen <strong>de</strong>r Kostenermittlung<br />
(nach BERGER 1981 /16/, verän<strong>de</strong>rt) 13<br />
Aggregation von<br />
(Beispiel)<br />
Mo<strong>de</strong>llen auf verschie<strong>de</strong>nen Glie<strong>de</strong>rungsebenen<br />
38<br />
Glie<strong>de</strong>rungshierarchie <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle zur Analyse <strong>de</strong>s<br />
bedarfesInvestitions-<br />
4GO<br />
Funktionaler Kalkulationsablauf bei einem Mo<strong>de</strong>ll<br />
41<br />
Methodischer Ablauf <strong>de</strong>r Kalkulationen im Gesamtsystem<br />
43<br />
Aufbau und Inhalt eines DOKuments<br />
50<br />
8 Mo<strong>de</strong>llauswahl<br />
53<br />
Glie<strong>de</strong>rung und Zuordnung <strong>de</strong>r Dokumente<br />
54<br />
10 Struktur <strong>de</strong>r DOKumentdatei<br />
56<br />
11 Verfahren <strong>de</strong>s Ist-Zeitbestimmung im Bauwesen<br />
68<br />
12 Soll-1st Abweichungen im<br />
Beton i eren"<br />
Leistungsbereich "Schalen, Bewehren,<br />
72<br />
13 Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Soll-Ist Abweichung für die Dachein<strong>de</strong>ckung nach Erstellung<br />
neuer Funktionen 79<br />
14 Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Soll-Ist Abweichung bei <strong>de</strong>n Schalarbeiten nach<br />
stellung neuer Funktionen<br />
Er-<br />
81<br />
15 Gewichtete und absolute Abweichung <strong>de</strong>r Kalkulationsergebnisse<br />
von <strong>de</strong>n Ist-Daten für verschie<strong>de</strong>ne Bauteilgruppen eines Bullenmaststalles<br />
(nach Völkl 1983 /117/, verän<strong>de</strong>rt) 85<br />
16 Einrichtungen und Maße <strong>de</strong>s Kurzstan<strong>de</strong>s für<br />
(Quelle: Boxberger /22/)<br />
Kühe<br />
17 Anbin<strong>de</strong>stall für 20 Kühe mit Nachzucht, 4jähriger Umtrieb<br />
(Planungslösung 1)<br />
18 Anbin<strong>de</strong>stall für 41 Kühe mit Nachzucht, 4jähriger Umtrieb<br />
(Planungslösung 2)<br />
94<br />
19 Liegeboxenlaufstall für 40 Kühe mit Nachzucht, 2reihige Aufstallung,<br />
4jähriger Umtrieb Planungslösung 3 97
- x -<br />
20 Liegeboxenlaufstall für 40 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstal-<br />
1ung, 4jähriger Umtrieb (Planungslösung 4) 98<br />
21 Liegeboxenlaufstall für 60 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstal-<br />
1ung, 4jähriger Umtrieb Planungslösung 5) 100<br />
22 Liegeboxenlaufstall für 57 Kühe mit Nachzucht, Queraufstallung,<br />
4jähriger Umtrieb Planungslösung 6) 101<br />
23 Liegeboxenlaufstall für 82 Kühe ohne Nachzucht, 3 + 1reihige<br />
Aufstallung, 4jähriger Umtrieb (Planungslösung 7) 103<br />
24 Liegeboxenlaufstall für 80 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige<br />
Aufstallung, 4jähriger Umtrieb (Planungslösung 8) 104<br />
25 Liegeboxenlaufstall für 100 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige<br />
Aufsta11ung, 4jähriger Umtrieb (Planungslösung 9) 105<br />
26 Liegeboxenlaufstall für 103 Kühe ohne Nachzucht, Queraufstal-<br />
1ung, 4jähriger Umtrieb (Planungs lösung 10) 106<br />
27 Übersicht über die Grundrisse <strong>de</strong>r zehn Planungslösungen 109<br />
28 Investitionsbedarf <strong>de</strong>r zehn Alternativlösungen, aufgeschlüsselt<br />
nach Rohbau-, Ausbau- und Einrichtungsaufwendungen 110<br />
29 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
n<strong>de</strong>stall, 20 Kühe mit Nachzucht Anbi<br />
Nachzucht<br />
30 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen<br />
Laufstall, 40 Kühe mit Nachzucht, 2reihi Aufstallung<br />
sta11, 40 Kühe mi t Nachzucht, 3rei hi ge I ung<br />
31 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
Laufstall, 60 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstal ung<br />
stall, 57 Kühe mi Nachzucht, Queraufstallung<br />
32 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
Laufstall, 40 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstal<br />
stall, 60 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstallung<br />
KUhe mit<br />
Lauf-<br />
Lauf-<br />
Lauf-<br />
33 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen<br />
Laufstall, 80 Kühe ohne Nachzucht, 3 + lreihige Aufstallung<br />
Laufstall, 82 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige Aufstallung 132<br />
34 <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
1, 100 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige<br />
Laufstall, 103 Kühe ohne Nachzucht, Queraufstallung<br />
1ung<br />
35 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
Laufstall, 80 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige lung<br />
Laufstall, 100 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige Aufstallung 135<br />
36 Verg1eic <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
Anbin<strong>de</strong>s a l l , KUhe mit Nachzucht Laufstal<br />
Nachzuch , 3reihige Aufstallung<br />
Kühe mit<br />
115<br />
120<br />
124<br />
127<br />
134<br />
140
- Xl -<br />
37 Investitionsbedarf <strong>de</strong>r zehn Alternativlösungen pro Kuhplatz und<br />
pro Großvieheinheit 143<br />
38 Investitionsbedarf für Baumaterialien bei <strong>de</strong>n drei Stallbaulösungen<br />
für 40 Kühe 145<br />
39 Investitionsbedarf für das Dach bei unterschiedlicher Dachneigung<br />
und Dachein<strong>de</strong>ckung am Beispiel <strong>de</strong>s 3reihigen laufstalles<br />
für 40 Kühe 150<br />
40 Investitionsbedarf <strong>de</strong>r zehn Alternativlösungen, aufgeschlüsselt<br />
nach Baumaterialien, Löhnen und pauschal bewerteter Einrichtung 153<br />
41 Vergleich <strong>de</strong>s Arbeitszeitbedarfes zur Erstellung <strong>de</strong>r Planungslösungen<br />
für 40 Kühe 154<br />
42 Wöchentliche Arbeitszeiten <strong>de</strong>r selbständigen Landwirte, selbständigen<br />
Gewerbetreiben<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r Industriearbeiter in <strong>de</strong>r<br />
Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland ab 1957<br />
43 Arbeitsaufriß <strong>de</strong>r Erstel ung eines Bullenmaststalles<br />
(56 Plätze; 16,50 X 15,48 m) 58<br />
44 Alternative Planungslösung für <strong>de</strong>n 3reihigen Liegeboxenlaufstall<br />
für 40 Kühe mit Nachzucht 164<br />
45 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes nach Baugruppen für die unterschiedlichen<br />
Planungslösungen <strong>de</strong>s 3reihigen Laufstalles für<br />
40 Kühe 15<br />
46 Anbin<strong>de</strong>stall für 26 Kühe mit Nachzucht<br />
Betrieb 1 <strong>de</strong>r Ist-Zeitermittlung 208<br />
47 Liegeboxeniaufstall für 49 Kühe ohne Nachzucht<br />
Betrieb 2 <strong>de</strong>r Ist-Zeitermittlung 209<br />
48 Builenmaststal , 56 Plätze<br />
Betrieb 3 <strong>de</strong>r Ist-Zeitermittlung
Verzeichnis <strong>de</strong>r Tabellen<br />
- XI I I -<br />
NI". Seite<br />
Begriffsverwendungen in verschie<strong>de</strong>nen Literaturstellen<br />
2 Baupreisermittlung nach DIN 276 "Kosten von Hochbauten"<br />
3 Kennzeichen und Vorteile verschie<strong>de</strong>ner Verfahren <strong>de</strong>r Baupreisermittlung<br />
4 Mengen- und Preisgerüst 46<br />
5 Vertikale Aufschlüsselung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes 47<br />
6 Struktur <strong>de</strong>r Dokumentebene VI: Arbeit + Materialien 55<br />
7 Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau: Tabelle für Betonarbeiten<br />
(Auszug, /1461)<br />
8 Kenndaten <strong>de</strong>r Untersuchungsobjekte für die Ist-Zeitermittlung<br />
9 Anteil verschie<strong>de</strong>ner Bauabschnitte an <strong>de</strong>r Gesamtarbeitszeit<br />
<strong>de</strong>n Betrieben 1 - 3 71<br />
10 Prüfung <strong>de</strong>r Gültigkeit <strong>de</strong>r ARH - Richtwerte am Beispiel "Fundamente<br />
betonieren" ( Betrieb 3 ) 74<br />
11 Mittellohnberechnung (Beispielsberechnung nach Erhebung 19B3) 83<br />
12 41<br />
eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes <strong>de</strong>r Anbin<strong>de</strong>ställe für 20 bzw.<br />
ätze mit Nachzucht (ohne Gülle- und Futterlager) 113<br />
13 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen<br />
Anbin<strong>de</strong>stall , 20 Kühe mit Nachzucht Anbin<strong>de</strong>stall , 41 Kühe mit<br />
Nachzucht 114<br />
14 Kennzahlen über <strong>de</strong>n Investitionsbedarf <strong>de</strong>r Liegeboxenlaufställe<br />
mit Nachzuchtplätzen (ohne Gülle- und Futterlager) 118<br />
15 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
1, 40 Kühe mit Nachzucht, 2reihige Aufstal ung Laufsta<br />
11 , 40 Kühe mit Nachzucht, 3reihige Aufstallung 119<br />
16 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes für<br />
I, 40 Kühe mit Nachzucht, 2re i hi Laufsta11<br />
, 40 Kühe mit Nachzucht, 3reihige 122<br />
17 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
1, 60 Kühe mit Nachzucht, 3rei ung Lauf<br />
Kühe mit Nachzucht, 123<br />
18 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen<br />
1, 40 Kühe mit Nachzucht, 3reihi Aufstallung Laufsta<br />
l l , 60 Kühe mi Nachzucht, 3reihige lung<br />
8<br />
12<br />
25<br />
62<br />
70
- XIV -<br />
Kennzahlen über <strong>de</strong>n Investitionsbedarf <strong>de</strong>r Liegeboxenlaufstäl e<br />
ohne Nachzuchtplätze (ohne Gülle- und Futterlager) 29<br />
20 Investitionsbedarfes einzelner Baugruppen<br />
Kühe ohne Nachzucht, 3 + lreihige Aufstallung<br />
Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige Aufstallung 131<br />
21 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes<br />
, 100 Kühe ohne Nachzucht,<br />
Laufstal ,103 Kühe ohne Nachzucht, 133<br />
22 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
1, 80 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2rei hi ge ung<br />
Laufstall, 100 Kühe ohne Nachzucht, 2 + 2reihige Aufstallung 136<br />
23 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes <strong>de</strong>s Anbin<strong>de</strong>stalles für 41<br />
mit Nachzucht und <strong>de</strong>s 3reihigen Laufstalles für 40 Kühe mi<br />
Nachzucht 138<br />
24 eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
n<strong>de</strong>sta11, 41 Kühe mit Nachzucht Laufstal Kühe mi<br />
Nachzucht, 3reihige Aufstallung 139<br />
25 eich <strong>de</strong>s Arbeitszeitbedarfes für die Erstell <strong>de</strong>r Dachon<br />
beim 2reihigen und 3reihigen Laufstall 40 Kühe 148<br />
26 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes für die Erstel <strong>de</strong>r Dachkonstruktion<br />
beim 2reihigen und 3reihigen Laufstall 40 Kühe 148<br />
27 Lohnaufwendungen zur Erstell<br />
Kühe bei unterschiedlichem<br />
<strong>de</strong>s 3reihigen Laufstalles für<br />
satz 160<br />
28 Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes von Liegeboxenlaufställen für<br />
40 Kühe bei unterschiedlichem Raumprogramm und unterschiedlicher<br />
Ausstattung 163<br />
29 Beispiel für ein Arbeitszeitdokument<br />
30 Beispiel für ei Materialdokument<br />
31 Beispiel für ein Dokument <strong>de</strong>r Ebenen llBauteile ll<br />
32 Beispiel für ein Verweismo<strong>de</strong>ll zum Dokument Nr. 40000<br />
sdatei<br />
34 Ergebnisse <strong>de</strong>r Soll-1st-Vergleiche in <strong>de</strong>n Betrieben<br />
35 Formblatt zur Zeitstudien-Erhebung 21<br />
Zeitnahmebogen (Formblatt 2) zur Zeitstudien-Erhebung<br />
37 Zusammenfassung <strong>de</strong>r Kennzahlen zum 1nvesti onsbedarf <strong>de</strong>r 10<br />
Planungslosungen<br />
Kalkulation:;protclko<br />
1 für 40 Nachzucr\t<br />
199<br />
200<br />
201<br />
214<br />
6
Verzeichnis <strong>de</strong>r Abkürzungen<br />
Akh Arbeitskraftstun<strong>de</strong>n<br />
Aph Arbeitspersonenstun<strong>de</strong>n<br />
- xv -<br />
a absolutes Glied (Achsenabschnitt)<br />
B Bauhilfsmittel<br />
b Regressionskoeffizient<br />
bb Breite eines Bauteiles<br />
GA gewichtete Abweichung<br />
GAZ Gesamtarbeitszeit<br />
h b<br />
Höhe eines Bauteiles<br />
IZ IST-Zeit<br />
l b<br />
Länge eines Bauteiles<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
M Material aufwand<br />
min Minimum<br />
m<br />
z<br />
Zuschläge zur Betonmenge<br />
m Betonmenge<br />
natural er Aufwand<br />
SZ So11ze i t<br />
T Arbeitszeit<br />
Bauteilvolumen
- 2 -<br />
Abbildung I: Investitionsbedarf und Fremdkapitalzuwachs <strong>de</strong>r<br />
in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland für die Zei<br />
(nominale Entwieklunq, Quelle' Stat, Jahrbuch<br />
Landwirtschaft<br />
1970-1981<br />
kehrte f ür die Landwirtschaft die in <strong>de</strong>n Zeiten rtschaftlichen Auf-<br />
schwungs vorhan<strong>de</strong>ne Sogwirkung in einen agrarpol i sch induzierten Anpas<br />
sungsdruck um, <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>s wissenschaftlichen Beirats<br />
beim Bun<strong>de</strong>slandwirtschaftsminister noch weiter verstärkt wer<strong>de</strong>n soll<br />
/128/, Die gravieren<strong>de</strong> Verschlechterung <strong>de</strong>r Arbeitsmarktsituation vor<br />
lem in <strong>de</strong>n ländlichen, s t rukt.urschwa chen Räumen und steigen<strong>de</strong>s auße r l and<br />
wi r t schaftlt che s Arbeitsplatzrisiko haben gleichzeitig <strong>de</strong>n Strukturwan<strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>r Landwirtschaft stark gebremst. FUr die überlebenswilligen Betriebe er<br />
gibt sich somit aufgrund sinken<strong>de</strong>r Gewinnspannen pro Produktionseinheit<br />
ein Zwang zur Produktionsaus<strong>de</strong>hnung, Die damit im allgemeinen einhergehen<br />
<strong>de</strong> einseitige Spezialisierung fUhrt gleichzeitig einer Abnahme <strong>de</strong>r Sta<br />
bilität und Flexibilität sowie einer wachsen<strong>de</strong>n Empfindlichkeit gegen Ver<br />
än<strong>de</strong>rungen Bkonomischer Rahmenbedingungen.<br />
Die MBglichkeivon Fehleinschätzungen <strong>de</strong>r Entwicklung wichti Einfluß<br />
faktoren bedingen dabei das eigentliche nvestitionsrisiko, da Investi<br />
tionsentscheidungen immer in die Zukunft gerichtet sind, al so e x r an t e ge<br />
fällt wer<strong>de</strong>n müssen, Somit naben wichtige Ent5cheidungsparameter, <strong>de</strong>-<br />
nen Rentabilität und Finanzierbarkei geplanter I tionen beurteilt
wer<strong>de</strong>n können, fUr <strong>de</strong>n Landwirt nur Erwartungscharakter. Es besteht daher<br />
die dringen<strong>de</strong> Notwendigkeit, <strong>de</strong>n Entscheidungsträgern in ausreichen<strong>de</strong>m<br />
fang fundierte Informationen über <strong>de</strong>n Stand und die voraussicht.liche Ent<br />
wicklung aller für die Wirtschaftlichkeit einer Investition relevanten Pa<br />
rameter anzubieten. Eine <strong>de</strong>r wichtigsten Ausgangsgrößen stellt dabei <strong>de</strong>r<br />
voraussichtl che Investitionsbedarf dar, <strong>de</strong>r Grundlage für die Finanzie<br />
rungsplanung, Liquiditätsplanung und Wirtschaftlichkeitsrechnung st.<br />
Problemstellung<br />
Die investitionstheoretischen Zusammenhänge wur<strong>de</strong>n n <strong>de</strong>n letzten 20 Jah<br />
ren gründlich erforscht, und es mangelt nicht an methodischen Ansätzen für<br />
mehr überschlägige o<strong>de</strong>r auch sehr differenzierte Investitions- und Finan<br />
zierungsrechnungen (z.B. /2,23,75,123/). In diese Metho<strong>de</strong>n geht jedoch<br />
voraussichtliche Investitonsbedarf im allgemeinen nur als Uberschlägiger<br />
Schätzwert ein, so daß das erwähnte Risiko, welches sich aus <strong>de</strong>r Unsicher<br />
heit über die Entwicklung wichtiger Parameter während <strong>de</strong>r Nutzungsdauer<br />
<strong>de</strong>r Investition ergibt, noch weiter verstärkt wi Zu<strong>de</strong>m wi auch<br />
Liqui ditätsentwi ck 1ung ei nes Betri ebes während <strong>de</strong>r Nutzungsdauer , die<br />
ebenfall s sehr stark durch <strong>de</strong>n Investitionsbedarf geprägt wird, meist<br />
wenig Beachtung geschenkt, obwohl gera<strong>de</strong> di eser Aspekt zahl rei ehe Betriebe<br />
durch Überschreiten <strong>de</strong>r nachhaltigen Kapitaldienstgrenze in große Schwie<br />
rigkeiten geraten läßt. Der Kenngröße "Investitionsbedarf" kommt somit<br />
Rahmen unternehmer i scher Pl anungen und Entscheidungen ei ne hohe Be<strong>de</strong>utung<br />
zu.<br />
Aus diesem Grund wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n letzten zwanzig Jahren verschie<strong>de</strong>ne An<br />
strengungen unternommen, mehr Transparenz i die monetären Aspekte<br />
wirtschaftlicher Bauvorhaben zu bringen. Methodisch lassen sich l e Ver-<br />
fahren nach <strong>de</strong>r Datengrundlage glie<strong>de</strong>rn in<br />
a) Verfahren auf <strong>de</strong>r Basis von Nachkalkulationen,<br />
b) Verfahren auf Basis von standardisierten Daten für Teilleistungen.<br />
Nachkalkulationen anhand fertiggestellter und abgerechneter Gebäu<strong>de</strong><br />
je nach Differenzi erungsgrad <strong>de</strong>r verwen<strong>de</strong>ten Metho<strong>de</strong> zu a11 gemei nen An<br />
haltswer-ten o<strong>de</strong>r auch sehr genauen Aussagen Uber die Zusammensetzung <strong>de</strong>s
- 4 -<br />
Investitionsbedarfes <strong>de</strong>r untersuchten Gebäu<strong>de</strong> /42,47,85,114/, Die Metho<strong>de</strong>n<br />
tragen jedoch mehr o<strong>de</strong>r weniger rein statischen Charakter, und es kann da<br />
her in strengem Sinne nur beispielhaft für e konkreten, untersuchten Lö<br />
sungen eine Aussage gemacht wer<strong>de</strong>n, Zu<strong>de</strong>m weisen a l l e Verfahren auf Basis<br />
von Nachkalkulationen <strong>de</strong>n charakteristischen Nachteil von ex-post-Analysen<br />
auf, die <strong>de</strong>r Bereitstellung von Planungsdaten zukünftig zu r ea l i sia<br />
ren<strong>de</strong> Objekte dienen sollen: Je größer die Variabilität <strong>de</strong>r Haupteinfluß<br />
größen im Zeitablauf ist, <strong>de</strong>sto mehr steigt die Wahrscheinl i che i t , daß die<br />
Pl anungsdaten zum Zei tpunkt i hrer Veröffent1i chung bereits veraltet sind,<br />
Für Planungsdaten im Bauwesen gilt dies in beson<strong>de</strong>rs starkem Maße, da ei<br />
nerseits die Preisentwicklung am Baumarkt <strong>de</strong>n Hauptbestimmungsfaktor aller<br />
Daten darstellt und an<strong>de</strong>rerseits <strong>de</strong>r zeitliche Abstand zwischen <strong>de</strong>r Rech<br />
nungsstellung und <strong>de</strong>r Veröffentlichung <strong>de</strong>r Daten naturgemäß sehr groß ist.<br />
Zu<strong>de</strong>m müssen sich die Autoren auf die Nachkalkulation weniger Verfahren<br />
beschränken, da <strong>de</strong>r Rechenaufwand bei allen Metho<strong>de</strong>n erheblich i<br />
Bei <strong>de</strong>n Verfahren auf <strong>de</strong>r Basi s standardisierter Daten Tellleistungen<br />
wer<strong>de</strong>n dagegen die Preise teils direkt aus Ausschreibungen ermittelt o<strong>de</strong>r<br />
es wer<strong>de</strong>n die Einzelpreise anhand eigener Berechnungen festgelegt, wobei<br />
teilweise die Unternehmerkalkulation in <strong>de</strong>n Ausschreibungen nachvollzogen<br />
wi rd . Diese Form <strong>de</strong>r Datengewi nnung ermög 1i cht es zwar, <strong>de</strong>n zeit 1i ehen Ab<br />
stand zwi sehen Datenerhebung und -ve ro f'f ent 1i chung st ark zu ve r kürzen,<br />
doch entstehen auch hier erhebliche Probleme bei <strong>de</strong>r Datenfortschreibung,<br />
da eine Aktualisierung <strong>de</strong>r Richtwerte über die In<strong>de</strong>.fortschreibung hinaus<br />
ein völliges Neuberechnen <strong>de</strong>r Beispielslösungen erfor<strong>de</strong>rt. Zu<strong>de</strong>m besteht<br />
auch bei <strong>de</strong>n auf Ausschreibungen basieren<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n Problem, daß di<br />
bs r-echnet.en Lösungen statischen Charakter tragen und die Zusammensetzung<br />
<strong>de</strong>r meist hoch aggregierten Daten zu wenig Transparenz erbringt /60,130/.<br />
Ei in Schottland entwickelter Kostenführer /123/ erlaubt eine ge<br />
nHuere Differenzierung; er erscheint jedoch trotz<strong>de</strong>m nicht uneinqeschränkt<br />
geeignet zur Lösung <strong>de</strong>r gegebenen Fr aqe s t.eTlunqen , v/iein Abschnitt 3..2<br />
näher erläutert wird.<br />
Die einzelnen Versuche, mehr Transparenz in die f t nanz t s l t en Auswirkungen<br />
landwirtschaftlicher Bautätigkeit zu bringen, sind daher nur als tei se<br />
gelungen anzusehen. Alle Verfahren sind vor allem dadurch gekennzeichnet,<br />
daß die Fortschreibung <strong>de</strong>r Daten einen ähnlich hohen Aufwand erfor<strong>de</strong>rt wie<br />
für die eigentliche Entwicklung benötigt wur<strong>de</strong>. Folglich muß versucht
- 5 -<br />
<strong>de</strong>n, eine vielseitigere, auf die Bedürfnisse <strong>de</strong>r Praxis, <strong>de</strong>r Beratung und<br />
<strong>de</strong>r Wissenschaft abgestimmte Metho<strong>de</strong> zu entwickeln, um mit Hilfe systema<br />
ti scher Analysen und Vergl ei ehe fundi erte und rat i onel l begrün<strong>de</strong>te Ent<br />
scheidungen zu ermöglichen.<br />
1.3 Zielsetzung<br />
Da di e <strong>de</strong>rzeit in<strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepub1i k verfügba ren Metho<strong>de</strong>n zur Ermitt1ung<br />
<strong>de</strong>s Investitionsbedarfes <strong>de</strong>n gegebenen Anfor<strong>de</strong>rungen nicht o<strong>de</strong>r nur teil<br />
weise genügen, besteht die Zielsetzung <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit zunächst<br />
Aufbau eines speziell auf das landwirtschaftliche Bauwesen ausgerichteten<br />
Kalkulationsverfahrens, welches folgen<strong>de</strong> Kriterien erfüllen soll:<br />
1. Als eine <strong>de</strong>r Hauptplanungs-, Entscheidungs- und Beurteilungsgrößen<br />
ist <strong>de</strong>r Investitionsbedarf von Gebäu<strong>de</strong>n und baul ichen Anlagen zu er<br />
mitteln. Da allgemeine Angaben für fest vorgegebene Objekte im realen<br />
Planungsfall wenig Aussagekraft besitzen, ist die Metho<strong>de</strong> so auszule<br />
gen, daß spezifische, auf ein beliebiges Projekt bezogene Aussagen<br />
mög 1i eh wer<strong>de</strong>n.<br />
2. Neben <strong>de</strong>r Errichtung kompletter Neubauten vollzieht sich ein Großtei<br />
landwirtschaftlicher Bauvorhaben im Bereich von Umbau- o<strong>de</strong>r Teilneubaumaßnahmen.<br />
Daher sind im Rahmen <strong>de</strong>s Verfahrens auch Berechnungs<br />
mög'l i chkei ten für <strong>de</strong>rarti ge Teillösungen vorzusehen.<br />
3. Ein weiteres wichtiges Merkmal <strong>de</strong>s landwirtschaftlichen Baugeschehens<br />
besteht in<strong>de</strong>r verbre i teten Anwendung baul i eher Selbsthilfemaßnahmel'l,<br />
die sich sowohl auf die Bereitstellung betriebseigener Materialien<br />
und Geräte al s auch auf <strong>de</strong>n Einsatz verfügbarer Arbeitskapazität er<br />
strecken können. Zur Planung <strong>de</strong>rartiger Maßnahmen sind daher im Rah<br />
men <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> über <strong>de</strong>n I nve 5 t i t i onsbeda rf hi naus <strong>de</strong>ta i 1i erte Anga<br />
ben zum Materialbedarf und auch zUm Arbeitszeitbedarf <strong>de</strong>r berechneten<br />
Positionen zu ermöglichen.<br />
In einem anschließen<strong>de</strong>n Schritt ist die Gültigkeit <strong>de</strong>r verwen<strong>de</strong>ten Daten<br />
und Metho<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>s landwirtschaftlichen Bauwesens zu über-<br />
prüfen Da das zu entwickeln<strong>de</strong> Kalkulationsverfahren die exakte Be-
- 6 -<br />
rechnung von Parametern über zukünftig zu realisieren<strong>de</strong> Vorhaben ausge<br />
richtet s t , ist zu<strong>de</strong>m an Einzelbeispielen eine Abschätzung <strong>de</strong>r Genauig<br />
kei t <strong>de</strong>r Vorhersagen durch Vergl ei ch <strong>de</strong>r ka 1 kul i erten So ll-Werte mit <strong>de</strong>n<br />
Ist-Werten abgerechneter Bauvorhaben vorzunehmen"<br />
Die möglichen Aussagen differenzierter und spezifischer Kalkulationen von<br />
Bauvorhaben sollen schließlich an hand eines Vergleiches verschie<strong>de</strong>ner<br />
Stallsysteme <strong>de</strong>r Rindviehhaltung aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, Insbeson<strong>de</strong>re im Be<br />
reich <strong>de</strong>r Milchviehhaltung besteht eine große Variationsbreite bezüglich<br />
<strong>de</strong>r Größenordnung, <strong>de</strong>r Aufstallungsform und sowie <strong>de</strong>r Ausstattung <strong>de</strong>r<br />
Ställe, Im Rahmen dieses Vergleiches s011en daher anhand von Beispielspla<br />
nungen folgen<strong>de</strong> Aspekte untersucht wer<strong>de</strong>n:<br />
L Zunächst interessiert die Frageste1'lung, welchen Verlauf <strong>de</strong>r e r f or-:<br />
<strong>de</strong> r l iche Investitionsbedarf in Milchviehställen bei zunehmen<strong>de</strong>n Be<br />
stan<strong>de</strong>sgrößen zwischen 20 und 100 KUhen nimmt<br />
2" DarUberhinaus sollen <strong>de</strong>tailliertere Untersuchungen über Verän<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r Zusammensetzung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes und <strong>de</strong>ren Ursachen<br />
Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Größenordnung <strong>de</strong>r Ställe vorgenommen<br />
3, Von speziellem Interesse ist zu<strong>de</strong>m, welche Unterschie<strong>de</strong> bezUglich <strong>de</strong>r<br />
Höhe und Zusammensetzung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes zwischen Anbin<strong>de</strong><br />
ställen und Liegeboxenlaufstälien auftreten,<br />
4, Erhebliche Einsparungsmöglichkeiten ergeben s i ch in <strong>de</strong>r' Regel durch<br />
bauliche Selbsthilfemaßnahmeno Eine beispielhafte Untersuchung gilt<br />
hier nicht allein <strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>r möglichen Kapi t a l ers pa r n i s , son<strong>de</strong>rn es<br />
sollen auch die Anfor<strong>de</strong>rungen aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, die in Verbindung<br />
mit Selbsthilfemaßnahmen an verfügbare Kapazi <strong>de</strong>s Betriebes qe<br />
ste1 t wer<strong>de</strong>n"<br />
5, Einer <strong>de</strong>r Risikofaktoren, die <strong>de</strong>n Gesamtkomplex <strong>de</strong>r Unsicherheit von<br />
Investitionsentscheidungen prägen, ist in <strong>de</strong>r nicht exakt ka l kul t e r-:<br />
baren Höhe <strong>de</strong>r zum Zeitpunkt Rechnungsstellung qu l t i cen Preise<br />
begrün<strong>de</strong>t 0 Daher<br />
soll en 1etzt1; ch auch di e Auswi r kun qe n von Prei<br />
<strong>de</strong>rungen einzelner Materialien auf <strong>de</strong>n Gesamtinvestitionsbedarf<br />
tersucht wer<strong>de</strong>n"
2. Definitionen und Abgrenzungen<br />
- 7 -<br />
Die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit beschäftigt sich mit spezifischen Fragestellungen<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen Betriebsplanung, die sehr stark mit<br />
all geme i nen bauökonomi schen Problemen verbun<strong>de</strong>n sind. Da sich an <strong>de</strong>r Naht<br />
stelle zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Disziplinen gewisse begriffliche überschneidun<br />
gen ergeben, soll <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Ausführungen eine Klärung <strong>de</strong>r in dieser<br />
Arbeit verwen<strong>de</strong>ten Begriffe vorangestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Für <strong>de</strong>n allgemeinen Hochbau sind die maßgeblichen Begriffe und Verfahren<br />
für di e im Rahmen di eser Arbei t durchgeführten Ka1ku l ationen in<strong>de</strong>r D1N<br />
Norm 276 "Kosten von Hochbauten" /141/ festgeschrieben. Dabei <strong>de</strong>finiert<br />
di e 01N Kosten als "a 11e für ei n Bauwerk notwendi gen Aufwendungen für Gü<br />
ter, Lei stungen und Abgaben ei nsch1i eß 1i eh Mehrwertsteuer" (1126/, 5.16) .<br />
Oieser Ko stenbegriff 1ehnt sich an <strong>de</strong>n in<strong>de</strong>r all gemei nen betri ebswi rt<br />
schaftlichen Literatur verbreiteten wertmäßigen Kostenbegriff an, nach <strong>de</strong>m<br />
Kosten "die in Gel<strong>de</strong>inheiten bewerteten leistungsbedingten Verzehrsmengen<br />
von Produktionsverfahren" darstellen (150/, 5.2315). Die Unstimmigkeiten<br />
in <strong>de</strong>r Verwendung dieses Kostenbegriffes fin<strong>de</strong>n ihre Ursache letztlich in<br />
<strong>de</strong>r Leistungsbezogenheit <strong>de</strong>r Kosten.<br />
Aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>s anbieten<strong>de</strong>n Unternehmers, <strong>de</strong>r zur Abgabe eines Angebotes<br />
zuvor die ihm entstehen<strong>de</strong>n Kosten für die angebotene Bauleistung ermitteln<br />
muß, ist dieser Kostenbegriff ein<strong>de</strong>utig und zutreffend. An<strong>de</strong>rs hingegen<br />
stellt sich die Situation für <strong>de</strong>n landwirtschaftlichen Unternehmer als<br />
Auftraggeber dar. Die von ihm im Rahmen <strong>de</strong>s Investitionskalküls durchzu<br />
führen<strong>de</strong> Kostenrechnung muß ebenfalls leistungsbezogen sein, doch stellt<br />
die eigentliche Gebäu<strong>de</strong>erstellung für ihn in <strong>de</strong>r Regel nicht <strong>de</strong>n geeigne<br />
ten Leistungsparameter dar. Die für ihn relevante Leistung besteht viel<br />
mehr in <strong>de</strong>r Nutzungsmöglichkeit <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s über eine bestimmte Zeitspan<br />
ne hinweg. Die Kostenrechnung erhält somit zwingend eine zeitraumbezogene<br />
Komponente, wie sie auch <strong>de</strong>r im Agrarbereich allgemein angewandten Kosten<br />
begriff explizit enthält. In <strong>de</strong>r Begriffssystematik für die landwirt<br />
schaftl iche und gartenbaul i che Betriebslehre wer<strong>de</strong>n Kosten <strong>de</strong>finiert a l s<br />
"Leistungsbezogener, Cd. h. produktgebun<strong>de</strong>ner) Gebrauch und Verbrauch an<br />
Produktionsfaktoren i nnerha1b <strong>de</strong>s Rechnungszeitraumes , gemessen in monetä<br />
ren Einheiten" (/78/, 5.66).
- 9 -<br />
Ko s tenbegri ff zu erzi elen, schlagen sie zur weiteren Präz i si erung di e Verwendung<br />
<strong>de</strong>r Bezeichnung Jahreskosten für die im Rahmen <strong>de</strong>s betrieblichen<br />
Rechnungswesens jährlich anzusetzen<strong>de</strong>n Kosten dauerhafter Produktionsmittel<br />
vor. Da dieser Vorschlag weitestgehend eine Fehlinterpretation <strong>de</strong>r Bezeichnungen<br />
ausschließt, wer<strong>de</strong>n auch in <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit die Be<br />
griffe Investitionsbedarf und Jahreskosten verwen<strong>de</strong>t, soweit nicht explizit<br />
auf die Metho<strong>de</strong>n und Begriffe an<strong>de</strong>rer Autoren (5. Tab. 1) ein<br />
gegangen wird.
- 10 -<br />
nvastitionsbedarf und .Iahr-askostan<br />
in <strong>de</strong>r<br />
Zur Erarbeitung eines verbesserten methodischen Ansatzes bedarf zuvor<br />
einer grundlegen<strong>de</strong>n Analyse <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen Ansätze an<strong>de</strong>rer Autoren, es<br />
zur Einordnung <strong>de</strong>r Arbeit unumgänglich erscheint<br />
Auch heute noch ist die Schätzung <strong>de</strong>s Investi onsbedarfes mi lfe von<br />
chtwerten pro Nut ze i nhe i t , pro Quadratmeter Grundfl o<strong>de</strong>r' pro Kubi<br />
umbauten Raumes selbst Dei exakten t.j c n s -'<br />
tsrechnungen weit verbre"j .Aufgrund <strong>de</strong>r<br />
wendigen Anwendungsmöghchkeit ist dieses<br />
1ungen auch au s r e i chend Für kcnkrete<br />
gl ehsrechnungen ist das Verfahren jedoch<br />
zu charakterisieren. da aie<br />
Vi zahl von Ausführungsa"iternativen mi<br />
rd mehr auf einen gebracht<br />
ehen<br />
11Kosten<br />
<strong>de</strong>r<br />
sieh d i ese Vorgehen swei Anwendung<br />
Wohnungsbaugesetz<br />
geför<strong>de</strong>rten ngend vorgeschri<br />
pflichtet Honorarordnung Archi und<br />
di e Planer in § OIN<br />
11ach <strong>de</strong>r Norm i<br />
<strong>de</strong>m Stand<br />
kann (HUTZE_MFYER 1980<br />
lt wer<strong>de</strong>n. Dies geschieht durch<br />
und Kostenfeststeli<br />
s i c h eile<br />
Vorgaben <strong>de</strong>r DIN<br />
b'<br />
DIN 276 i n <strong>de</strong>r II.<br />
<strong>de</strong>s of f entl i<br />
/139,./ Ebenso<br />
(HO!\!. /1421)
- 11 -<br />
Die Kostenschätzung um faßt di e übersch1ägi ge Ermittl ung <strong>de</strong>r Gesamtkosten<br />
aufgrund von vergl ei chswei se undifferenzi erten Bedarfsangaben (Kubi kmeter,<br />
Quadratmeter, Zahl <strong>de</strong>r Nutzeinheiten) und entsprechen<strong>de</strong>n Kostenrichtwer<br />
ten. Sie dient als vorläufige Grundlage für Finanzierungsüberlegungen und<br />
es soll gegebenenfalls von Erfahrungswerten ausgegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Kostenberechnung dagegen dient <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>r angenäherten Gesamt<br />
kosten und nimmt eine zentrale Stellung im Entscheidungsprozess ein, <strong>de</strong>nn<br />
ihre Aussage ist "Voraussetzung für die Entscheidung, ob die Baumaßnahme<br />
wie geplant durchgeführt wer<strong>de</strong>n soll, sowie Grundlage für die erfor<strong>de</strong>rli<br />
che Finanzierung" (a.a.O., Teil 3.1). Die Kostenberechnung soll sich dabei<br />
auf ei n <strong>de</strong>ta i 11i ertes Raumprogramm, Entwurfszei chnungen und ausführl iche<br />
Erläuterungen stützen. Der Preis soll auch hier aus Erfahrungswerten und<br />
pauschalierten Angaben ermittelt wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r, falls diese nicht vorliegen,<br />
summarisch aus Mengen- und Kostenansatz ermittelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Erst im dritten Schritt <strong>de</strong>r Kostenermittlung, <strong>de</strong>m Kostenanschlag sind ge<br />
nauere Berechnungen <strong>de</strong>r tatsächlich zu erwarten<strong>de</strong>n Kosten anhand <strong>de</strong>r end<br />
gült i gen Pl anunterl agen, genauen Massenermittlungen und Erläuterungen zur<br />
Bauausführung vorgesehen. Für die Kostenansätze können Einheitspreise aus<br />
Angeboten o<strong>de</strong>r auch örtsüb1i che Erfahrungswerte zur Anwendung kommen. Der<br />
Kostenanschlag wird <strong>de</strong>mentsprechend also erst nach Abschluß <strong>de</strong>s Planungs<br />
verfahrens durchgeführt.<br />
Die Kostenfeststellung als 1etztes Kostenermi t t l ungsverfahren <strong>de</strong>r DIN 276<br />
trägt in erster Linie dokumentarischen Charakter, da sie erst nach Ab<br />
schluß <strong>de</strong>s gesamten Bauvorhabens durchgeführt wird. Alle tatsächlich ent<br />
stan<strong>de</strong>nen Kosten wer<strong>de</strong>n nachgewiesen und summiert.<br />
Im Teil 2, Anhang A <strong>de</strong>r Norm ist eine Kostenglie<strong>de</strong>rung in Kostengruppen<br />
mit ste i gen<strong>de</strong>m Differenzi erungsgrad vorgenommen, wi e sie im oberen Teil<br />
von Abbildung beispielhaft aufgeführt ist. Diese Kostenglie<strong>de</strong>rung ist<br />
Maßstab für <strong>de</strong>n Differenzierungsgrad <strong>de</strong>r einzelnen Kostenermittlungen.<br />
Nach <strong>de</strong>n Vorgaben <strong>de</strong>r DIN sollen Kostenschätzungen bi s zur Gruppe zwei<br />
durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Kostenberechnungen können, je nach <strong>de</strong>n gegebenen Um<br />
stän<strong>de</strong>n, bis zur Gruppe drei verfeinert wer<strong>de</strong>n. Im Kostenanschlag und bei<br />
Kostenfeststellungen soll die Differenzierung bis zur Spalte vier gehen.
Kostengruppen Bezeichnung<br />
1 2 3 4 5<br />
3<br />
Bauwerk<br />
- 13 -<br />
3 1 Baukonstruktion<br />
I<br />
3 1 I 3 Nichttragen<strong>de</strong> Konstruktionen<br />
I I<br />
3 . 1 ! 3 ! 4 Nichttragen<strong>de</strong> Konstruktionen Dächer<br />
'- __ -I-........l t-->--------------------<br />
3 1 I 3 I 4 ! 1. Dachbeläge<br />
I<br />
----. I<br />
I<br />
I Kostenschätzung (So11)<br />
I I I<br />
I I<br />
I<br />
I (Kann)<br />
• ! Kostenberechnung<br />
I<br />
I I<br />
!<br />
I Kostenanschlag (So 11<br />
I<br />
____I___L.<br />
I<br />
Kostenfeststellung (je nach Verwendungszweck)<br />
Abbildung 2: Kostenglie<strong>de</strong>rung nach DIN 276, Teil 2 und gefor<strong>de</strong>rter Differenzierungsgrad<br />
in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Stufen <strong>de</strong>r Kostenermittlung<br />
(nach BERGER 1981 /16/, verän<strong>de</strong>rt)<br />
lung bieten /126/. Jedoch bleibt auch nach <strong>de</strong>r letzten Neufassung vom<br />
Apri 1 1981 festzustellen, daß das vorgesehene vierstufige Verfahren <strong>de</strong>n<br />
Ansprüchen, die an eine rationale Entscheidungshilfe für bauliche Investi<br />
tionsvorhaben <strong>de</strong>r Landwirtschaft gestellt wer<strong>de</strong>n müssen. nur in sehr be<br />
schränktem Maße genügen kann Denn in <strong>de</strong>n wichtigsten Phasen <strong>de</strong>s Entschei<br />
dungsprozesses wer<strong>de</strong>n keine ausreichen<strong>de</strong>n Informationen gegeben.<br />
3.2 Verfahren auf <strong>de</strong>r Basis von Nachkalkulationen<br />
Nachkalkulationen anhand von erstellten und abgerechneten Bauvorhaben entsprechen<br />
in <strong>de</strong>r Methodik ten<strong>de</strong>nziell <strong>de</strong>r Kostenfeststellung nach DIN 276,<br />
wobei jedoch Unterschie<strong>de</strong> im Differenzierungsgrad bestehen. Sie ermögli<br />
chen eine verhältnismäßig problemlose und sehr genaue Analyse <strong>de</strong>s Preises<br />
eines ßauobjektes, soweit alle Abrechnungsunterlagen verfügbar sind.
- 14 -<br />
2.1 Die vergleichen<strong>de</strong> Planungsmetho<strong>de</strong> FRITZ<br />
Ausgehend von <strong>de</strong>r überlegung, daß rationale Fertigungsmetho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bau<br />
wirtschaft nur durch auf Normung fussen<strong>de</strong> Planungen und Elementierung <strong>de</strong>r<br />
Gebäu<strong>de</strong> E;'ngang in das landwirtschaftliche Bauwesen fin<strong>de</strong>n können, ver<br />
sucht FRITZ 1971 /42/ die Voraussetzungen anhand eines systematischen Ver<br />
gleiches verschie<strong>de</strong>ner Bauobjekte zu schaffen. Zu diesem Zweck führt er<br />
eine <strong>de</strong>taillierte Analyse <strong>de</strong>r Baukosten von 113 Neubauten für Rindvieh,<br />
Zucht- und Mastschwei ne durch. Unter <strong>de</strong>r Zi e 1setzung, Planungsnormen zu<br />
initiieren, baut er darauf umfangreiche Mo<strong>de</strong>llplanungen für unterschiedli<br />
chen Haltungsverfahren und Konstruktionsarten auf. Baukosten und Gebäu<strong>de</strong><br />
kosten wer<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Basis von Massenauszügen aus <strong>de</strong>n Ergebnissen <strong>de</strong>r<br />
Nachkalkulationen errechnet. Es wur<strong>de</strong> somit ein Hi lfsmittel zum Auffin<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r pr-e i sgünstigsten Lösungsalternative für Bauherren und Architekten ge<br />
schaffen, das jedoch aufgrund fehl en<strong>de</strong>r Fortschrei bung kaum noch Aussage<br />
kraft besitzt.<br />
3.2.2 Der Preisbaukasten STUBER<br />
Der Prei sbaukasten von STUBER /114/ wur<strong>de</strong> hi ngegen inverschi e<strong>de</strong>nen Zeit<br />
abstän<strong>de</strong>n fortgeschri eben; di e 1etzte Fassung wur<strong>de</strong> 1978 veröffent 1i cht.<br />
In diesem methodischen Ansatz sind die Ergebnisse einer <strong>de</strong>taillierten Ko<br />
stenberechnung an hand abgerechneter Bauvorhaben als sogenannte<br />
Kostenelemente dokumentiert, n <strong>de</strong>nen alle Aufwendungen für ein "funk<br />
tionstüchtiges" Element zusammengefaßt sind (MEIER 1980 /881). Der Preis<br />
baukasten ist unterglie<strong>de</strong>rt in die vier Abschnitte "8aukonstruktion",<br />
"Stalleinrichtungen" , "allgemeine Betriebseinrichtungen" und "spezielle<br />
Betriebseinrichtungen". Der Begriff Kostenelement umfaßt im Bereich Bau<br />
konstruktionen beispielsweise die Gesamtaufwendungen für die Erstellung<br />
eines Streifenfundamentes o<strong>de</strong>r einer Außenwand, während im Bereich <strong>de</strong>r<br />
Stalleinrichtungen unter diesem Begriff z.B. die Gesamtaufwendungen für 10<br />
Kälberplätze einschließlich Futterplätzen, 8edienungs·-, Treib- und Lauf<br />
gängen zusammengefaßt sind. Der Anwen<strong>de</strong>r kann sich somit aus <strong>de</strong>n verschie<br />
<strong>de</strong>nen Kostenelementen ein Gebäu<strong>de</strong> selbst zusammenstellen und durch Addi<br />
tion <strong>de</strong>r Einzelelemente <strong>de</strong>n Preis ermitteln. Aufgrund <strong>de</strong>s verhältnismäßi
- 16 -<br />
Produktionszweig Milchviehhaltung im Jahr 1980 bisher einmal fortgeschrie<br />
ben und es stehen <strong>de</strong>rzeit Unterlagen für einen schnellen, problemlosen<br />
Vergleich <strong>de</strong>r häufigsten baulichen Alternativen in <strong>de</strong>r Rin<strong>de</strong>r- und Schwei<br />
nehaltung zur Verfügung. Durch die Differenzierung <strong>de</strong>s Gesamtpreises in<br />
vier funktionell selbstständige Einheiten kann auch <strong>de</strong>r Investitionsbedarf<br />
von Teilneubauten abgeschätzt wer<strong>de</strong>n, zumin<strong>de</strong>st insoweit das Bauvorhaben<br />
einen vollständigen Kostenblock umfaßt<br />
Für weitergehen<strong>de</strong> Investitions- und Wirtschaftlichkeitsfragen ist es zu<strong>de</strong>m<br />
von Vorteil, daß die Metho<strong>de</strong> über <strong>de</strong>n reinen Investitionsbedarf hinaus<br />
durch <strong>de</strong>n Ansatz von Abschreibung, Verzinsung, Versicherung, Reparaturen<br />
und Betriebskosten inzwi sehen zusätzl ich die Abschätzung von Jahreskosten<br />
erlaubt /48/.
- 17<br />
3.3 Verfahren auf Basis von standardisierten Werten für Teilleistungen<br />
Auch bei <strong>de</strong>n anschl i eßend vorgeste11ten Verfahren auf <strong>de</strong>r Grundlage \/011<br />
Ausschreibungen ist die Ermittlung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes nur als Vorstufe<br />
zum eigentlichen Ziel <strong>de</strong>r Kostenermittlung zu sehen.<br />
3.3.1 Die Flächenmetho<strong>de</strong> nach HIRSCH<br />
HIRSCH 1962 /60/ nimmt in Anlehnung an die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Maschinenkostenermittlung<br />
von SCHAEFER-KEHNERT /109/ eine Ermittlung <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>kosten \/011<br />
Schwei ne- und Kuhställ en vor. Er ka1kul iert dazu zunächst <strong>de</strong>n Investitionsbedarf<br />
an Hand <strong>de</strong>r Flächen <strong>de</strong>r raumumschließen<strong>de</strong>n Bauteile, wobei er<br />
als Grund1 age auf Untersuchungen von BAASEN /10/ zurückgreift. Oie<br />
Flachenelemerrte wer<strong>de</strong>n weiter aufgesch1üsse 1t in Teilleistungen , für die<br />
auf Grundlage von Ausschreibungsergebnissen Mittelpreise berechnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Durch Aggregation <strong>de</strong>r Teilleistungspreise gelangt HIRSCH zu Preiskennzah<br />
1en für die Flächenelemente. In einem weiteren Aggregationsschritt wer<strong>de</strong>n<br />
durch Zusammenführung entsprechen<strong>de</strong>r Flächenelemente und Ergänzung durch<br />
die Preise <strong>de</strong>r Einbauteile Richtwerte für Gesamtgebäu<strong>de</strong> errechnet. Oie<br />
Teilleistungen wur<strong>de</strong>n so <strong>de</strong>finiert, daß nach Möglichkeit eine Fortschreibung<br />
mit <strong>de</strong>n Preisindizes <strong>de</strong>s statistischen Bun<strong>de</strong>samtes /143/ erfolgen<br />
kann.<br />
3.3.2 Der schottische Farm Buildunq Cost Gui<strong>de</strong><br />
Die von <strong>de</strong>r Scottish Farm Buildings Investigation Unit publizierte Metho<strong>de</strong><br />
/123/ wird hingegen jährlich aufgrund <strong>de</strong>r aktuellen Preisverhältnisse in<br />
<strong>de</strong>r Region Aber<strong>de</strong>en neu berechnet.<br />
Das Tabellenwerk ist in vier Abschnitte mit Daten unterschiedlichen Differenz<br />
i erung sgra<strong>de</strong>s aufgetei 1t. Im ersten Teil wird eine Zeitreihe für <strong>de</strong>n<br />
Baukostenin<strong>de</strong>x <strong>de</strong>r wichtigsten am Bau verwen<strong>de</strong>ten Material ien und für die<br />
zugehörige Arbeit gegeben, wobei für das Erscheinungsjahr jeweils ein geschätzter<br />
Wert angegeben wird.
- 18 -<br />
In einem zweiten, "Quick Gui<strong>de</strong>" genanntem Abschnitt sind Quadratmeter<br />
preise für komplette Gebäu<strong>de</strong> angegeben, die ergänzt wer<strong>de</strong>n durch Maß<br />
zahlen für <strong>de</strong>n Platzbedarf pro Nut.z e i nhe i t.. Die Berechnungsgrundlagen<br />
dieser Angaben sind im Teil 3 zu fin<strong>de</strong>n. Hier sind zunächst für alle<br />
wichtigen Baumaterialien, Geräte, Ausrüstungsteile und die Arbeitskräfte<br />
Einzelpreise bzw. -Iohns für das aktuelle Jahr und die bei<strong>de</strong>n vorhergehen<br />
<strong>de</strong>n Jahre aufgeführt. Darüberhinaus wer<strong>de</strong>n aber auch noch<br />
Richtpreise/Einheit für alle wesentlichen Einzelpositionen eines Bauwerkes<br />
angegeben, so daß eine völlig individuelle Berechnung von Baumaßnahmen<br />
möglich ist. Die Richtpreise umfassen <strong>de</strong>n jeweiligen Gesamtpreis für Ar<br />
bei, Material und Geräte und entsprechen in <strong>de</strong>r Berechnungsart <strong>de</strong>r Ange<br />
botskalkulation von Unternehmen bei Ausschreibungen,<br />
Schließlich sind in einem vierten Teil 20 vorgegebene Gebäu<strong>de</strong> und bauliche<br />
An1agen beschri eben, Die Angabe <strong>de</strong>s nvestitionsbedarfe s für di e Mo<strong>de</strong>ll<br />
gebäu<strong>de</strong> erfolgt nach zwei verschie<strong>de</strong>nen Kriterien, und zwar einerseits<br />
aufgeschlüsselt nach Bauteilgruppen wie "Unterbau" o<strong>de</strong>r "Dach" und an<br />
<strong>de</strong>rerseits differenziert nach Arbeitsarten wie "Erdarbeiten" o<strong>de</strong>r "Be<br />
tonarbeiten",<br />
In England wird in ähnlicher Form das Costs of Buildings Handbook /140/<br />
für insgesamt 100 Mo<strong>de</strong>llställe veröffentlicht, welches methodisch und auch<br />
inhaltlich mit <strong>de</strong>m schottischen Cost Gui<strong>de</strong> vergleichbar ist und daher hier<br />
nicht näher erläutert wer<strong>de</strong>n soll,<br />
3,3.3 Das Informationssystem Bauwesen - iSBAU<br />
Preisindizes eignen sich zur Fortschreibung von Baukostendaten nur be<br />
dingt; <strong>de</strong>shalb gehen WOHLFAHRT und MILLER 1975 /130/ von <strong>de</strong>r Vorstellung<br />
aus, daß ihr System in regelmäßigen Abstän<strong>de</strong>n durch die Auswertung von<br />
Ausschreibungsunterlagen auf einen aktuellen Stand gebracht wer<strong>de</strong>n muß.<br />
Die Autoren konzipieren ein umfangreiches System, welches als Subsystem in<br />
das Bayerische Landwirtschaftliche Informationssystem - BAllS /67/ inte<br />
griert ist.
- 19 -<br />
In ei ner Baudatenbank si nd als Grundl age aller Berechnungen zunächst<br />
Einzelpositionen und zugehörige Einheitspreise abgespeichert, die nach <strong>de</strong>r<br />
Konzeption zu<strong>de</strong>m noch regional untergl ie<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n sollen. Die Einzelpo<br />
sitionen wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>n Vorgaben <strong>de</strong>s Standardleistungsbuches (StLB) fest<br />
gelegt, welches vom Gemeinsamen Ausschuß Elektronik im Bauwesen (GAEB) er<br />
stellt wur<strong>de</strong> /137/. Die Einzelpositionen nach Standardleistungsbuch wer<strong>de</strong>n<br />
in weiteren Schritten aggregiert zu Bautailen , Bauelementen, Sektoren und<br />
schließlich gesamten Bauwerken. Bauelemente sind dabei Konstruktionsteile<br />
wie z.B. Wand- und Dachkonstruktionen. Sektoren umfassen hingegen einzelne<br />
Absc hnitte eines Gesamtgebäu<strong>de</strong>s , be i sp i e1swei se bei einem Li egeboxen1auf<br />
stall <strong>de</strong>n Melk- und Jungviehsektor, <strong>de</strong>n Liegeboxensektor und <strong>de</strong>n Stirn<br />
wandsektor /131/.<br />
Das System ISBAU erlaubt mittels eines Planungsatlanten <strong>de</strong>n Preisvergleich<br />
vorgegebener Gebäu<strong>de</strong> anhand von aggregierten Daten wie Raummeterpreisen,<br />
Quadratmeterpreisen o<strong>de</strong>r Preisen pro Nutzeinheit, wobei zusätzliche Infor<br />
mationen über <strong>de</strong>n Anteil einzelner Positionen gegeben wer<strong>de</strong>n können, nicht<br />
jedoch über Bauteile o<strong>de</strong>r Bauteilgruppen. Dies ist nur über geson<strong>de</strong>rte<br />
Einzelkalkulationen möglich, da die einzelnen Aggregationsstufen nicht<br />
hierarchisch geglie<strong>de</strong>rt sind, son<strong>de</strong>rn die Mo<strong>de</strong>lle jeweils direkt auf die<br />
Mittelpreise <strong>de</strong>r Teilleistungen zurückgreifen.<br />
3.3.4 Die Kalkulationsmetho<strong>de</strong> von KRABBE<br />
Ei n an<strong>de</strong>rer Weg wi rd am dän ischen Bauforschungsin sti tut von KRABBE 1979<br />
/79/ beschritten. Er entwickelte auf EDV-Basis ein System, welches auf ei<br />
ner exakten Definition und separaten Abspeicherung aller für ein Gebäu<strong>de</strong><br />
relevanten Bauteile, <strong>de</strong>n unit constr-ucttons beruht. Je<strong>de</strong>m dieser Konstruk<br />
tionsteile sind in weiteren Dateien Angaben über die benötigten<br />
Materialien, Ausrüstungen und Geräte sowi e di e erfor<strong>de</strong>rl i che Arbeitszeit<br />
für die Erstellung zugeordnet. Eine vom Benutzer beliebig än<strong>de</strong>rbare<br />
Preisdatei enthält zu <strong>de</strong>n naturalen Bedarfsposten <strong>de</strong>n zugehörigen monetä<br />
ren Wert. Die Mo<strong>de</strong>lle für einzelne Bauteile sind dabei variabel gehalten,<br />
so daß beliebige Abmessungen und Ausführungen vorgegeben wer<strong>de</strong>n können.<br />
Schließlich wer<strong>de</strong>n im Kalkulationsprotokoll auch noch Hinweise auf die<br />
entsprechen<strong>de</strong>n, von <strong>de</strong>r Offizialberatung benutzten Planungsunterlagen ge<br />
geben.
- 20<br />
Im Vergleich zu <strong>de</strong>n zuvor dargestellten Metho<strong>de</strong>n kann <strong>de</strong>m System von KRAB<br />
BE somit <strong>de</strong>r höchste Informationsgehalt zugesprochen wer<strong>de</strong>n. Die Kalkula<br />
tion auf Basis variabler Mo<strong>de</strong>lle und Preisvorgaben erlaubt zu<strong>de</strong>m eine wei<br />
testgehen<strong>de</strong> Anpassung an individuelle Bedingungen, sowie auch getrennte<br />
Aussagen. über <strong>de</strong>n Material- und Arbeitszeitbedarf , wodurch eine Vorausset<br />
zung für die Planung von Selbsthilfemaßnahmen erfüllt ist.<br />
3.4 Wertung <strong>de</strong>r methodischen Ansätze<br />
Nach<strong>de</strong>m die bestehen<strong>de</strong>n methodischen Ansätze in ihren Grundzügen darge<br />
stellt wur<strong>de</strong>n, soll nachfolgend eine kritische Betrachtung <strong>de</strong>s Stellenwer<br />
tes und <strong>de</strong>r Einsatzmöglichkeiten <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Verfahren vorgenommen<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Schätzungen <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes a"hand von Richtpreisen pro Quadrat<br />
meter o<strong>de</strong>r Kubikmeter sind zwar nach wie vor weit verbreitet und bil<strong>de</strong>n<br />
die Grundlage für ßaugenehmigungsanträge und Finanzierungsüberlegungen;<br />
sie sind jedoch für konkrete Investitionsplanungen und systematische Ver<br />
gleiche völlig unzureichend, da sie das Gebäu<strong>de</strong> als geschlossene Einheit<br />
betrachten und di e Viel zah1 <strong>de</strong>r Einfl ußfaktoren nicht wie<strong>de</strong>rgegeben wird<br />
(PIOTROWSKI 1978 /97/). Große Ungenauigkeiten ergeben sich insbeson<strong>de</strong>re<br />
auch durch die fehlen<strong>de</strong> Berücksichtigung unterschiedlicher Baumaterialien<br />
o<strong>de</strong>r Bauausführungen. Dementsprechend ist auch keine Anpassung an speziel<br />
le Baumaterialien o<strong>de</strong>r Bauausführungen möglich /108/.<br />
Die Verfahren auf <strong>de</strong>r Basis von Nachkalkulationen dienen in erster Linie<br />
<strong>de</strong>m Vergleich unterschiedlicher baulicher Lösungen. Bei vol l st änd i qer Er<br />
fassung aller mit <strong>de</strong>m Bauvorhaben zusammenhängen<strong>de</strong>n Ausgaben ist eine re<br />
lativ exakte Information über <strong>de</strong>n Investitionsbedarf und seine Zusammen<br />
setzung möglich. Begrenzend wirkt hier allein <strong>de</strong>r jeweilige Differenzie<br />
rungsgrad <strong>de</strong>r Abrechnungsunterlagen. Einschränkungen sind allerdings hin<br />
sichtlich einer Aufschlüsselung bzw. Zuordnung von Arbeitszeiten zu<br />
machen, da hier in <strong>de</strong>r Regel keine Angaben vorliegen.<br />
Nachkalkulationen tragen jedoch zunächst allein beispielhaften Charakter<br />
und erlauben letztlich nur Aussagen über die speziellen, abgerechneten Ge<br />
bäu<strong>de</strong>. Für breitere, allgemeingültig angelegte Aussagen sind daher sehr
- 21 -<br />
umfangreiche und zeitaufwendige Analysen erfor<strong>de</strong>rlich, wie sie in <strong>de</strong>r Stu<br />
die von FRITZ 1971 /42/ durchgeführt wur<strong>de</strong>n.<br />
Trotz<strong>de</strong>m kann <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> heute kei ne praktische Be<strong>de</strong>utung mehr zugemessen<br />
wer<strong>de</strong>n, da eine Fortschreibung nicht erfolgt ist. Selbst relative Aussagen<br />
hinsichtlich einer Beurteilung alternativer Lösungsmöglichkeiten sind ohne<br />
Datenaktual i sierung nicht sinnvoll, da sich nicht nur die absoluten Preise,<br />
son<strong>de</strong>rn auch die Preisrelationen in einem ständigen Wan<strong>de</strong>l befin<strong>de</strong>n.<br />
Der Preisbaukasten von STUBER /114/ ist aufgrund gleicher Zusammenhänge<br />
<strong>de</strong>rzeit ebenfalls kaum noch einsetzbar. Es ist jedoch zu erwarten, daß in<br />
absehbarer Zeit eine neuberechnete Auflage erscheint.<br />
Die Kostenblockmetho<strong>de</strong> hingegen steht <strong>de</strong>rzeit uneingeschränkt für die we<br />
sentlichen Produktionszweige <strong>de</strong>r Schweine- und Rin<strong>de</strong>rhaltung zur Verfügung,<br />
da sich alle Berechnungen auf <strong>de</strong>n bei ex-post Analysen maximal er<br />
reichbaren Aktualitätsgrad <strong>de</strong>s Vorjahres beziehen, Die methodische Vorgehensweise<br />
bei <strong>de</strong>r Datenermittlung läßt es jedoch zweifelhaft erscheinen,<br />
ob die Metho<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r vorl iegen<strong>de</strong>n Form regelmäßig auf <strong>de</strong>n neuesten Stand<br />
gebracht wer<strong>de</strong>n kann, da zur Aktual isierung eine mehr o<strong>de</strong>r weniger vollständige<br />
Neuberechnung erfor<strong>de</strong>rl ich ist. Die Datenermittlungsform bietet<br />
jedoch <strong>de</strong>n Vorteil, daß Abrechnungsunterlagen verschie<strong>de</strong>ner Quellen im<br />
System verwertet wer<strong>de</strong>n können.<br />
DarUberhinaus ist anzumerken, daß aus <strong>de</strong>r Kostenblockmetho<strong>de</strong> nur Richtwerte<br />
für fix vorgegebene Beispielssysteme gewonnen wer<strong>de</strong>n können. Zwar wur<br />
<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Verfassern die gängigsten baulichen Alternativen für unterschiedliche<br />
Bestan<strong>de</strong>sgrößen berechnet, doch fehlt weitgehend die Anpassungsmöglichkeit<br />
an individuelle Bedingungen, da die Kostenblöcke einen<br />
verhältnismäßig hohen Aggregationsgrad aufweisen. So wer<strong>de</strong>n im Kostenblock<br />
Stall eine Vielzahl von unterschiedlichen Positionen zu einem einzigen<br />
Zahlenwert aufsummiert, ohne <strong>de</strong>m Anwen<strong>de</strong>r einen Einblick in die Zusammen<br />
setzung di eses Richtwertes zu gewähren. Wi rd bei spie1swei se einem Bauher-rn<br />
statt eines mit Wellasbestplatten ge<strong>de</strong>ckten Daches eine Ziegelein<strong>de</strong>ckung<br />
vorgeschrieben, so bietet ihm die Kostenblockmetho<strong>de</strong> keinen Anhaltspunkt<br />
mehr, selbst wenn er <strong>de</strong>n Preis <strong>de</strong>r Dachein<strong>de</strong>ckung auf Mark und Pfennig genau<br />
kennt, da <strong>de</strong>r Prei santei I <strong>de</strong>r Dachein<strong>de</strong>ckung nicht ausgewiesen ist.<br />
Die Preisdifferenz unterschiedlicher DachausfUhrungen kann jedoch erhebli-
- 22 -<br />
ehe Dimensionen annehmen, wie in Kapitel 6.3.1 an einem Berechnungsbei<br />
spiel erläutert wird.<br />
Zu<strong>de</strong>m erscheint die Metho<strong>de</strong> für die Planung von Umbau- o<strong>de</strong>r Teilneubaumaß<br />
nahmen nicht geeignet, da im Regelfall nicht komplette Kostenblöcke wie<br />
"Stall" o<strong>de</strong>r "Gülle" neu errichtet wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn nur Teilbereiche ver<br />
schie<strong>de</strong>ner Blöcke. Letztl ich muß noch hinzugefügt wer<strong>de</strong>n, daß eine korrek<br />
te Abgrenzung einzelner Kostenblöcke nicht in je<strong>de</strong>m Falle möglich ist, da<br />
manche Bautei le mehrere Funktionen erfüllen und sich somit nicht ein<strong>de</strong>utig<br />
zuordnen lassen. Die Ausweisung fixer Mo<strong>de</strong>lle o<strong>de</strong>r fertiger Bauvorhaben<br />
erscheint somit grundsätzlich problematisch, und dies insbeson<strong>de</strong>re dann,<br />
wenn die Zusammensetzung eines allgemeinen Richtwertes nicht weitestgehend<br />
transparent gemacht wird. Vor allem ergeben sich so keinerlei Anhaltswerte<br />
über die Auswirkungen baulicher Selbsthilfemaßnahmen, obwohl diese gera<strong>de</strong><br />
in <strong>de</strong>r Landwirtschaft sehr relevant sind.<br />
Bezüglich <strong>de</strong>r Abgrenzung von Teilbereichen ist <strong>de</strong>r Preis- und Kostenbe<br />
rechnung von HIRSCH 1962 /60/ <strong>de</strong>r Vonang ei nzuräumen, da aufgrund <strong>de</strong>r<br />
stärkeren Differenzierung in Teilleistungen kaum Probleme auftreten und<br />
eine bessere Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedingungen gegeben ist.<br />
Jedoch ist auch bei diesem Verfahren <strong>de</strong>r Aufwand für die Datenpflege so<br />
groß, daß eine Aktualisierung nur einmal von ADAM et a l . 1979 /1/ für das<br />
Land Ba<strong>de</strong>n-Württemberg vorgenommen wur<strong>de</strong>.<br />
Der schotti sehe Farm Building Cast Gui<strong>de</strong> /123/ hi ngegen wur<strong>de</strong> bi sher jähr<br />
lich fortgeschrieben und stellt gleichzeitig auch die <strong>de</strong>rzeit umfangreich<br />
ste und vielseitigste Datensammlung für Investitionsrechnungen bei Gebäu<br />
<strong>de</strong>n dar. Diese Metho<strong>de</strong> bietet sowohl die Mögl ichkeit eines schnellen Ver<br />
gleiches von Gesamtgebäu<strong>de</strong>n als auch <strong>de</strong>r gezielten Berechnung von speziel<br />
len Objekten auf <strong>de</strong>r Basis individueller Vorgaben. Die starke Unterglie<br />
<strong>de</strong>rung bis zur Angabe <strong>de</strong>r Preise von Baumaterialien und Ausrüstungsteilen<br />
erlaubt selbst Einzelpreisvergleiche. Jedoch sind für Kalkulationen an hand<br />
<strong>de</strong>r Einzeldaten als Voraussetzung doch erhebliche fachliche Kenntnisse<br />
vonnöten. Zu<strong>de</strong>m muß für diese Kalkulationen ein erheblicher Zeitaufwand<br />
veranschlagt wer<strong>de</strong>n. Trotz <strong>de</strong>r für viele Fragestellungen vorteilhaften<br />
starken Differenzierung läßt jedoch <strong>de</strong>r Farm Building Cast Gui<strong>de</strong> Angaben<br />
über <strong>de</strong>n zu veranschlagen<strong>de</strong>n Arbeitszeitbedarf vermissen, was sich vor al<br />
lem bei Planungen von baulichen Selbsthilfemaßnahmen als sehr nachteilig
erweist.<br />
- 23 -<br />
Auch das Informationssystem Bauwesen ISBAU /130/ kann dieser For<strong>de</strong>rung<br />
nicht gerecht wer<strong>de</strong>n, da die als Oatengrundlage verwen<strong>de</strong>ten Ausschrei<br />
bungsangebote hierüber keine Angaben machen. Das System ermöglicht es<br />
zwar, über Gesamtgebäu<strong>de</strong> hinaus auch einzelne Bauelemente o<strong>de</strong>r Bauteile zu<br />
berechnen, doch treten die Einzelpositionen für <strong>de</strong>n Benutzer auf <strong>de</strong>n ver<br />
schie<strong>de</strong>nen Aggregationsebenen nicht Erscheinung. Statt <strong>de</strong>ssen erhält<br />
<strong>de</strong>r Benutzer bei Berechnung <strong>de</strong>r in einem Planungsatlas vorgegebenen Mo<strong>de</strong>l<br />
le allein Aggregationswerte wie DM pro Kuhplatz o<strong>de</strong>r DM pro m 2 Nutzfläche<br />
/131/ .<br />
Zu<strong>de</strong>m berücksichtigen die Autoren bei <strong>de</strong>r Basisdatengewinnung die tatsäch<br />
1i ehen Gegebenhei ten <strong>de</strong>s 1andwi rtschaftlichen Bausektors nur unzureichend.<br />
Das Standardleistungsbuch liefert die Basis zu extrem <strong>de</strong>taillierten Aus<br />
schreibungen und wur<strong>de</strong> konzipiert für Großunternehmen, die eigene, EO\l-Uli<br />
terstützte Kalkulationsabteilungen unterhalten. Der landwirtschaftliche<br />
Bausektor ist hingegen von kleinen Handwerksbetrieben geprägt, wobei<br />
<strong>de</strong>r Auftragsvergabe sogar in einer großen Anzahl von Fällen ganz auf eine<br />
Ausschreibung verzichtet wird und allein auf Nachweis von lohn Mate<br />
rial abgerechnet wird /97/.<br />
P10TROWSKI und GARTUNG 1978 /97/ führen zu<strong>de</strong>m an, daß differenzierte Aus<br />
schreibungen nach Standardleistungsbuch und entsprechen<strong>de</strong> Abrechnungsan<br />
for<strong>de</strong>rungen sogar häufig zu Verteuerungen führen. Die Erstellung einer ak<br />
tuellen, noch dazu regional unterteilten Baudatenbank wird letztl dann<br />
scheitern, daß <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r landwirtschaft vorherrschen<strong>de</strong>n Baubetrieben<br />
per sone 11e und instrumentell e Kapaz i tät für entsprechen<strong>de</strong> s regelmäßige<br />
gebote fehlt. Die <strong>de</strong>rzeitige ausschließliche Nutzung <strong>de</strong>s Systems durch die<br />
Stadt München für die Planung von Großprojekten sind ein Indiz für<br />
Richtigkeit dieser Annahme.<br />
Die von KRABBE 1979 /791 vorgestellte Metho<strong>de</strong> hingegen erfüllt weitestge<br />
hend die Anfor<strong>de</strong>rungen an ein umfassen<strong>de</strong>s landwirtschaftlich-bauliches In<br />
formationssystem. Neben <strong>de</strong>r Kalkulation einzelner Bauteiie ist jedoch le<br />
diglich eine Aggregationsstufe vorgesehen, die dann ein gesamtes Gebäu<strong>de</strong><br />
umfaßt. Der erfor<strong>de</strong>rliche Eingabeaufwand für die Berechnung von Teilneu<br />
bauten o<strong>de</strong>r speziellen Gebäu<strong>de</strong>n, die über die aggregierten Mo<strong>de</strong>lle nicht
zu erfassen sind, dürfte daher sehr hoch sein.<br />
Die vorstehend beschriebenen Kalkulationsmetho<strong>de</strong>n basieren somit sämtlich<br />
auf einer mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r differenzierten Analyse von Gebäu<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Ge<br />
bäu<strong>de</strong>tei len und wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n an sie gestellten Anfor<strong>de</strong>rungen teilweise<br />
durchaus gerecht. Die Zielstellung <strong>de</strong>r Entwicklung eines Kalkulations<br />
sv s tems , welches speziell auf <strong>de</strong>n im landwirtschaftlichen Bauwesen täti<br />
gen Personenkreis ausgerichtet ist, sollte sich daher an <strong>de</strong>n Vorteilen <strong>de</strong>r<br />
bereits bestehen<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>lle orientieren (Tab. 3).
- 26 -<br />
4. Vorstellung einer differenzierten Kalkulationsmetho<strong>de</strong> im Rahmen eines<br />
landtech nrschan Informationssystems<br />
In allen Phasen <strong>de</strong>r Entscheidungsfindung wer<strong>de</strong>n als Grundlage Informatio<br />
nen benötigt, wobei nicht nur die Informationsbeschaffung an sich Probleme<br />
bereitet, son<strong>de</strong>rn vor allem auch die Informationsbereitstellung in <strong>de</strong>r er<br />
for<strong>de</strong>rl iehen Genauigkeit, einem ausreichen<strong>de</strong>n Umfang und <strong>de</strong>m geeigneten<br />
Differenzierungsgrad zum jeweils richtigen Zeitpunkt.<br />
Der Entscheidungsprozess über ein Bauvorhaben läßt sich analog zu an<strong>de</strong>ren<br />
Entscheidungsabläufen nach <strong>de</strong>m Phasentheorem (WITTE 1968 /129/) aufglie<br />
<strong>de</strong>rn in:<br />
1. Analyse <strong>de</strong>r Ausgangssituation und Problemstellung<br />
2. Suche nach Handlungsalternativen<br />
3. Überprüfung und Beurteilung <strong>de</strong>r Alternativen<br />
4. Bewertung <strong>de</strong>r Handlungsmöglichkeiten und Entscheidung<br />
5. Durchführung <strong>de</strong>r notwendigen Maßnahmen<br />
6. Kontrolle <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
Informationen entstehen aus <strong>de</strong>r Verarbeitung von Daten auf eine bestimmte<br />
Frage- o<strong>de</strong>r Problemstellung hin. Als Hilfsmittel dazu können Mo<strong>de</strong>lle ver<br />
wandt wer<strong>de</strong>n. Die Verknüpfung von Daten einer Datenbank und zugehörigen<br />
Mo<strong>de</strong>llen kann nach STEFFEN und BORN 1975 als Informationssystem bezeichnet<br />
wer<strong>de</strong>n, "wenn gewährleistet ist, daß entsprechend <strong>de</strong>m Ablauf <strong>de</strong>s Entschei<br />
dungsprozesses die richtigen Mo<strong>de</strong>lle mit <strong>de</strong>n dazugehörigen Daten zur Ver<br />
fügung stehen" (/112/, S. 127).<br />
Zur Bereitstellung geeigneter Informationen in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Phasen<br />
<strong>de</strong>s Entscheidungsprozesses bei baulichen Investitionsprojekten wur<strong>de</strong> im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r Aufbauarbeiten zu einem landwirtschaftlichen tnfor-mationssvstem<br />
landtechnik liSL /7/ eine Metho<strong>de</strong> zur Ermittlung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes<br />
landwirtschaftlicher Betriebsgebäu<strong>de</strong> entwickelt, dt e sich zum Teil an die<br />
vorstehend beschri ebenen Verfahren anlehnt. Bei <strong>de</strong>r Konzeption wur<strong>de</strong>n je<br />
doch eine Reihe weiterer Prämissen gesetzt, die für eine umfassen<strong>de</strong> An<br />
wendbarkeit <strong>de</strong>s Systems von Be<strong>de</strong>utung sind.
4.1 Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
- 27 -<br />
Bisherige Kalkulationsverfahren wie die Kostenblockmetho<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r das System<br />
ISBAU beschränken sich in ihrer Aussage mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r auf eine Angabe<br />
<strong>de</strong>s Investiti onsbedarfes für ei ne Anzahl fix vorgegebener Pl anungsvari an<br />
ten und erlauben somit einen ersten allgemeinen Vergleich verschie<strong>de</strong>ner<br />
Gebäu<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>teile. Im Rahmen <strong>de</strong>s oben charakterisierten Entschei<br />
dungsprozesses sind <strong>de</strong>rartige Schätzwerte unterschied1 ieher Planungsva<br />
rianten für die ProbIemstellungs- und Suchphase notwendig und auch voll<br />
ausreichend. Für die Beurteilungsphase und die nachfolgen<strong>de</strong> Entscheidungs<br />
phase sind jedoch weitergehen<strong>de</strong> Anfor<strong>de</strong>rungen zu stel en .<br />
Eine rationale und fundierte Entscheidung läßt sich nur dann treffen, wenn<br />
di e unterschi edl i c hen Lösungsa 1ternat i ven unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r<br />
tatsächlichen betrieblichen Planungsdaten <strong>de</strong>s jeweiligen Einzelfalls ana<br />
lysiert wer<strong>de</strong>n Unter dieser Voraussetzung ist jedoch fUr ein Kalkula<br />
ti on sverfahren zwi ngend zu for<strong>de</strong>rn, daß es auf ei ne r Verrechnung variabler<br />
Parameter basiert, da nur so für <strong>de</strong>n Betrieb relevante Vorgabewerte in die<br />
Berechnung eingehen können. Hier scheint also nur eine Anlehnung an die<br />
Metho<strong>de</strong> von KRABBE erfolgversprechend zu sei . Kriterium für die Beurtei<br />
lung sollte dabei nicht allein <strong>de</strong>r Gesamtkapitalbedarf für Gebäu<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r<br />
Gebäu<strong>de</strong>systeme sein, da im Gegensatz zu Maschineninvestitionen bauliche<br />
Anlagen nicht als komplette Einheit gekauft wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn sich aus mehr<br />
o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r frei kombinierbaren Einzelteilen zusammensetzen. Der Investor<br />
steht somit im Grun<strong>de</strong> vor <strong>de</strong>r Aufgabe, für je<strong>de</strong>s einzelne Bauteil Einzel··<br />
entscheidungen zu fäl en. Eine praktikable Entscheidungshilfe sollte<br />
folgl ch differenzierte Analysen zumin<strong>de</strong>st bis herunter zu einzelnen Bau<br />
teilen ermöglichen, wie es beispielsweise das System ISBAU o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Cast<br />
Gui<strong>de</strong> erlauben.<br />
Selbst dieser Differenzierungsgrad kann jedoch noch nicht als optimal an<br />
gesehen wer<strong>de</strong>n. Ei n Großteil 1andwi rtschaft1i cher Bauprojekte wi rd im Ge<br />
gensatz zum allgemeinen Hochbau nicht als kompletter Auftrag an Unterneh<br />
mer vergeben. Häufi g erfolgt hi ngegen en twe<strong>de</strong>r ei ne Vergabe auf Nachwei s<br />
von Materialverbrauch und Arbeitszeit (wobei <strong>de</strong>r Betrieb meist einen Teil<br />
<strong>de</strong>r Arbeitskräfte stellt) o<strong>de</strong>r es wer<strong>de</strong>n das Gesamtprojekt o<strong>de</strong>r Teile <strong>de</strong>s<br />
selben völlig in EIgenleistung erstellt. Für <strong>de</strong>n Investor, <strong>de</strong>r somit auch<br />
über die Organisation <strong>de</strong>r Bauabwicklung zu entschei<strong>de</strong>n hat, stel t sich
- 29 ..<br />
bauten o<strong>de</strong>r Teilneubauten, für die eine globale Kalkulationsmetho<strong>de</strong> kaum<br />
Informationen bereitstellen kann.<br />
Gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>r wichtige Bereich <strong>de</strong>r Umbauplanungen läßt sich jedoch nur mit<br />
einer stärker differenzieren<strong>de</strong>n Vorgehensweise ähnlich <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> von<br />
KRABBE kalkulieren, da hier wie in keinem an<strong>de</strong>ren Planungsfall auf die ge<br />
gebenen Bedingungen eingegangen wer<strong>de</strong>n muß.<br />
Zusammenfassend sind aus diesen überlegungen folgen<strong>de</strong> Anfor<strong>de</strong>rungen an ei<br />
umfassen<strong>de</strong>s Kalkulationssystem abzuleiten:<br />
I. Für grundsätzliche Aussagen zum Investitionsbedarf sowie für die Vor<br />
planungsphase ist ein allgemeiner Vergleich vorgegebener Alternativ<br />
lösungen zu ermöglichen.<br />
2. Für die Realplanung ist hingegen eine möglichst exakte Ermittlung <strong>de</strong>s<br />
tatsächl ich zu veranschlagen<strong>de</strong>n Investitionsbedarfes eines Objektes<br />
erfor<strong>de</strong>rlich. In die Berechnung müssen folglich die konkreten a<br />
nungsdaten <strong>de</strong>s Betriebes Eingang fin<strong>de</strong>n können, soweit sie in diesem<br />
Stadium schon bekannt sind. Hierzu gehören u.. :<br />
- Abmessungen <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s und einzelner Bauteile<br />
- Spezifische Materialvorgaben<br />
- Angaben über konstruktions- und Ausführungsarten<br />
- Al gemeine Vorgaben über Baubedingungen<br />
(z.B. Baustel eneinrichtung o<strong>de</strong>r Qualifikation <strong>de</strong>r Ausführen<strong>de</strong>n)<br />
- Materialpreise und Löhne<br />
3. Zur fundierten Beurteilung baulicher Alternativlösungen ist nicht nur<br />
<strong>de</strong>r Investiti onsbeda r f , son<strong>de</strong>rn auch <strong>de</strong>r preisunabhiingige Baumassen<br />
bedarf nach <strong>de</strong>n Einzelkomponenten aufzuschlüsseln.<br />
4. Die Planung baulicher Selbsthilfemaßnahmen erfor<strong>de</strong>rt zu<strong>de</strong>m eine <strong>de</strong><br />
tai 11ierte Angabe <strong>de</strong>s Arbeitszeit- und Mater-Ialbedarfes für alle<br />
Bauabschnitte.
- 30 -<br />
5. Für die Kalkulation von Teilneubauten und Umbauten müssen in gleicher<br />
Weise alle Berechnungen auch für Teilbereiche eines Gebäu<strong>de</strong>s vorge<br />
nommen wer<strong>de</strong>n können.<br />
4.2 Grundsätzliche Merkma!e <strong>de</strong>s Kalk ulationssvsterns<br />
Ein System, welches in <strong>de</strong>r Lage ist, allen aufgezeigten Anfor<strong>de</strong>rungen zu<br />
genügen, äßt si eh aufgrund <strong>de</strong>r notwendi gen Kamp i ex i t ä t und <strong>de</strong>s erfor<strong>de</strong>r<br />
lichen Differenzierungsgra<strong>de</strong>s nur noch mi Hilfe <strong>de</strong>r elektronischen Daten<br />
verarbeitung (EDV) bewältigen. Dies gi1 vor allem auch in Hinblick auf<br />
sinnvolle und zeitlich realisierbare Datenfortschreibungsmöglichkeiten<br />
Weiterhin ist aus <strong>de</strong>n' Anfor<strong>de</strong>rungen abzuleiten, daß das Verfahren a l<br />
mo<strong>de</strong>llhafte Abbildung reale. o<strong>de</strong>r realisierbarer zu konzipieren<br />
ist, da nur so eine Darstellung und Kalkulation beliebig dimensionierter<br />
Bauobjekte ermöglicht wird, soweit die zugehörigen Parameter für die Defi<br />
nition <strong>de</strong>r Aufwandsfaktoren bekannt sind. Angaben auf <strong>de</strong>r Grundlage beste<br />
hen<strong>de</strong>r und somit fixer Gebäu<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>teile hingegen besitzen<br />
strengem Sinne nur für das spezi 1 ana.lysierte Objekt Gülti t.<br />
Oie For<strong>de</strong>rung nach einerseits globalen und an<strong>de</strong>rerseits sehr differenzier<br />
ten Aussagen kann bei vertretbarem Mo<strong>de</strong>llumfang in einem einzigen Gesamt·<br />
verfahresmo<strong>de</strong>ll nicht erfüllt wer<strong>de</strong>n. Vielmehr ist ein System von Moelell<br />
auf unterschiedlichen Differenzierungsstufen zu entwickeln, d i e in einer<br />
logischen Beziehung zueinan<strong>de</strong>r stehen. Dies wi möglich, in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>m System<br />
eine hierarchische Struktur gegeben wi r-d, in <strong>de</strong>r durch additive Verknüp<br />
fung von Mo<strong>de</strong>llen gleichen Differenzierungsgra<strong>de</strong>s höher aggregierte Mo<strong>de</strong>l<br />
le gebil<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Der Mo<strong>de</strong>llbegriH im Rahmen dieses Kalkulationssystems<br />
kann somit <strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n als "mathematische Darstellung <strong>de</strong>r Beziehungen<br />
und Abhängi gkeiten zwi sehen Aufwandsfaktoren und Zi el größen für Bauab<br />
schnitte unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung auf Basis Ein<br />
f1 ußqrößen".<br />
Da einerseits die \IIi rkungen <strong>de</strong>s Faktors "Zeit" in <strong>de</strong>m Berechnungsverfahren<br />
zu berücksichtigen sind und an<strong>de</strong>rerseits <strong>de</strong>r bauliche Ablauf im Mo<strong>de</strong>ll ex<br />
akt vorgegeben wird, ergibt sich ein EDV-gestütztes Mo<strong>de</strong>llkalkulations<br />
system auf Basis <strong>de</strong>terministischer, diskontinuierlich-dynamischer' Mo<strong>de</strong>lle.
- 31 -<br />
Die Abbildungsgenauigkeit <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle hängt dabei entschei<strong>de</strong>nd von <strong>de</strong>r re<br />
alitätsnahen Nachbildung <strong>de</strong>r tatsächlichen Bauvorgänge ab.<br />
4.2. Differenzierung in Teilleistunqsmcdalle<br />
Die Festlegung <strong>de</strong>r strukturellen Glie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>llsystems orientiert<br />
sich zweckmäßig an <strong>de</strong>n tatsächl ehen Einze l l e t stunqen , aus <strong>de</strong>nen sich<br />
Gesamtaufwand zur Erstellung eines Baukörpers zusammensetzt. Die Defini<br />
tion <strong>de</strong>r jeweiligen Einzelleistungen erfolgt dabei im realen Baugeschehen<br />
nach <strong>de</strong>n Richtlinien <strong>de</strong>r Verdingungsordnung fUr Bauleistungen VOB 1136/.<br />
Hier ist als kleinste Ausschreibungseinheit <strong>de</strong>s Leistungsverzeichnisses<br />
die Position o<strong>de</strong>r Teilleistung festgelegt (/136/ DIN 1960, §9). Da sich<br />
erst anhand <strong>de</strong>rartiger Positionsbeschreibungen <strong>de</strong>r Leistungsumfang einer<br />
beliebigen Konstruktion exakt <strong>de</strong>finieren läßt, ergibt sich analog für<br />
Mo<strong>de</strong>llaufbau die Notwendigkeit, bis zu entsprechen<strong>de</strong>n Einzelleistungen<br />
di fferenzi er-en, da nur so di e angestrebte a11gemeine Einsatzfähigkei <strong>de</strong>s<br />
Systems erreichbar ist.<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Positionen einer Ausschreibung enthalten jedoch immer<br />
wie<strong>de</strong>r vergleichbare Tätigkeitsmerkmale, die sich häufig durch Lei<br />
stungsumfang o<strong>de</strong>r -art <strong>de</strong>r jeweiligen Teilleistung unterschei<strong>de</strong>n.<br />
Mo<strong>de</strong>llbildung bietet es sich daher an, für i<strong>de</strong>ntische Leistungen<br />
schiedlichen Umfanges jeweils nur ei Mo<strong>de</strong>ll zu erstellen, welches jedoch<br />
variable Berechnungsparameter enthält und so <strong>de</strong>r Ermittlung je<strong>de</strong>s beliebi<br />
gen Leistungsumfanges dienen kann.<br />
Zu diesem Zweck ist es erfor<strong>de</strong>rlich, die Teilleistungen weiter Hinblick<br />
auf ihre naturale Aufwandszusammensetzung zu analysieren und entsprechen<strong>de</strong><br />
Berechnungsparameter festzulegen.
- 33 -<br />
mi absolutes Glied (Achsenabschnitt)<br />
Regressionskoeffizienten<br />
Variable<br />
Für die tatsächliche Berechnung läßt sich diese Funktion jedoch noch wei<br />
ter vereinfachen. Da für ein Bauteil erfor<strong>de</strong>rliche Betonmenge (m) zunächst<br />
proportional <strong>de</strong>m Bautellvolumen (V) ist, erhält b l <strong>de</strong>n Wert 1.<br />
Die erfor<strong>de</strong>rlichen Zuschläge für Betonverluste können mit hinrei<br />
chen<strong>de</strong>r Genauigkeit ebenfalls als linear abhängig von <strong>de</strong>r Betonmenge und<br />
somit vom Bauteilvolumen angesehen wer<strong>de</strong>n, während das absolute Glied <strong>de</strong>r<br />
Funktion <strong>de</strong>n Wert 0 erhält. Die Funktion reduziert sich somit auf einen<br />
einfachen algebraischen Ausdruck:<br />
( 4) 1'1 0 0 + 1 • V + m 2 ' V 0 I b • bb ' h b • (1 + m z )<br />
Wird jedoch für das gewählte Beispiel statt Transportbeton eine Eigenmi<br />
schung unterstellt, so ist <strong>de</strong>r Materialaufwand in die erfor<strong>de</strong>rlichen Ein<br />
zelkomponenten Kies, Zement und Wasser zu unterglie<strong>de</strong>rn und <strong>de</strong>ren Bedarf<br />
j ewei1s geson<strong>de</strong>rt zu berechnen. Der Rechenweg verläuft jedoch pri nzi pi e 11<br />
analog zu (3) und (4).<br />
Da die zur Berechnung <strong>de</strong>r Materialmenge notwendigen Dimensionsangaben auch<br />
zur allgemeinen Definition einer Teilleistung benötigt wer<strong>de</strong>n und somit<br />
zwangsläufig in <strong>de</strong>n Positionsmo<strong>de</strong>llen enthalten sein müssen, ist es zweck<br />
mäßig, die Materialmenge über eine entsprechen<strong>de</strong> Formel in <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen<br />
selbst zu errechnen. Zur exakten Definition <strong>de</strong>s Materialaufwan<strong>de</strong>s sind da<br />
bei über die reinen Dimensionsangaben hinaus eventue l noch Informationen<br />
über die Materialzusammensetzung o<strong>de</strong>r die technischen Ausführungsregeln<br />
erfor<strong>de</strong>rlich. Im Mo<strong>de</strong>ll sind hierzu ebenfalls entsprechen<strong>de</strong> variable Para<br />
meter al s zusätzl iche Einflußgrößen zu formulieren und entsprechend in die<br />
Berechnungsformel zu integrieren.<br />
Der erfor<strong>de</strong>rliche Arbeitszeitaufwand für das Zusammenfügen <strong>de</strong>r Materialien<br />
wird sinnvollerweise auf <strong>de</strong>r Basis von Planzeitfunktionen ermittelt<br />
(vergI. Kap. 5.1.2). Auch hier kann die jeweil ge Höhe <strong>de</strong>s Arbeitszeitauf-
geordnet wer<strong>de</strong>n.<br />
- 35 -<br />
4.2.3 Berechnung <strong>de</strong>s monetären Aufwan<strong>de</strong>s einer Teileistung<br />
Ausgehend von <strong>de</strong>m mengenmäßigen Aufwand, <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n Arbeitszeitbedarf<br />
und <strong>de</strong>n Materialbedarf ein<strong>de</strong>utig festgelegt ist, erfolgt die monetäre Be<br />
wertung in einem getrennten Berechnungsschritt, in<strong>de</strong>m Arbeitszeitbedarf<br />
und Materialbedarf jeweils mit <strong>de</strong>n Einzelpreisen pro Einheit multipliziert<br />
wer<strong>de</strong>n. Bei entsprechen<strong>de</strong>r Berücks i chtigung eventue1 erfor<strong>de</strong>rl i eher Zu<br />
schlage in <strong>de</strong>n Einzelpreisen läßt sich somit <strong>de</strong>r Investitionsbedarf einer<br />
Teilleistung mit Hilfe eines einfachen algebraischen Ausdrucks relativ ge<br />
nau ermitteln. Durch Einzelberechnung aller Mo<strong>de</strong>lle, die die erfor<strong>de</strong>rli<br />
chen Teilleistungen für ein Gebäu<strong>de</strong> repräsentieren, kann entsprechend <strong>de</strong>r<br />
Investitionsbedarf einer gesamten Stallanlage errechnet wer<strong>de</strong>n. Dabei ist<br />
jedoch zu berücksichtigen, daß <strong>de</strong>r Gesamtinvestitionsbedarf neben <strong>de</strong>n in<br />
Positionen zu beschreiben<strong>de</strong>n Leistungen zusätzlich weitere Aufwendungen<br />
wie Architektenleistungen o<strong>de</strong>r die Kosten <strong>de</strong>r Statik enthält, die in ge<br />
son<strong>de</strong>rten Mo<strong>de</strong>llen zu erfassen sind.<br />
4.2.4 Mo<strong>de</strong>llaggregation<br />
Da die Kalkulation <strong>de</strong>s Gesamtgebäu<strong>de</strong>aufwan<strong>de</strong>s anhand einer separaten, vom<br />
Anwen<strong>de</strong>r zu steuern<strong>de</strong>n Berechnung a 11er erfor<strong>de</strong>rl i ehen Posi t ionsmo<strong>de</strong>lle<br />
eines Gebäu<strong>de</strong>s einen extrem hohen Zeitaufwand beansprucht und zu<strong>de</strong>m vom<br />
Benutzer verhältnismäßig große fachliche Kenntnisse über die baulichen Ab<br />
läufe und die genaue Zusammensetzung <strong>de</strong>s Kal kulationsobjektes erfor<strong>de</strong>rt,<br />
ist dieses Vorgehen nicht praktikabel. Nicht zuletzt besteht aufgrund <strong>de</strong>r<br />
großen Zahl notwendiger Einzelkalkulationen immer die Gefahr einer Ver<br />
nachlässigung wichtiger Leistungsteile (SAUER 1981 /106/1.<br />
Im Sinne eines anwen<strong>de</strong>rgerechten Systemaufbaus ist es daher unbedingt er<br />
for<strong>de</strong>rlich, weitere Mo<strong>de</strong>lle für komplexere bauliche Einheiten zu erstel<br />
ien, die alle benötigten Einzelleistungen für <strong>de</strong>rartige größere Baueinhei<br />
ten bereits umfassen. Der jeweilige Umfang <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen dargestell<br />
ten baulichen Einheiten und die Zahl unterschiedlicher Aggregationsstufen<br />
r i chtet sich da be i nach <strong>de</strong>n spezifi sehen Anf or<strong>de</strong> runqen und ist daher im
- 37 -<br />
mer alle möglichen Mo<strong>de</strong>lle auch tatsächlich benötigt wer<strong>de</strong>n. So können im<br />
Einzelfall bei <strong>de</strong>m gewählten Beispiel bis auf die 5. le an<strong>de</strong>ren<br />
Mo<strong>de</strong>llberechnungen entfallen, da sie nicht relevant<br />
Die Betonplatte fUr einen Nebenraum ist jedoch nur ein Teil <strong>de</strong>r Gesamtbo<br />
<strong>de</strong>nplatte eines Stalles. Letztere kann wie die Außenwän<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r das<br />
als Bauteilgruppe aufgefaßt wer<strong>de</strong>n, da s i e ei ne bautechni sch funktionale<br />
Einheit darstell. Der Gesamtbauaufwand fUr die Bauteilgruppe Bo<strong>de</strong>nplatte<br />
läßt sich ermitteln, in<strong>de</strong>m mit Hilfe <strong>de</strong>s gewählten, variabel einsatzbaren<br />
Beispielmo<strong>de</strong>lls "Betonplatte" nicht nur <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n eines Nebenraumes, son<br />
<strong>de</strong>rn auch alle an<strong>de</strong>ren Betontei le durch Spezifizierung <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Einflußgrößen berechnet wer<strong>de</strong>n. Zusätzlich sind weitere Mo<strong>de</strong>lle beispiels<br />
weise für <strong>de</strong>n Einbau <strong>de</strong>r Futterkrippe o<strong>de</strong>r die Erstellung eines Estrichbe<br />
lages zu berechnen.<br />
Von <strong>de</strong>r Systematik <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstruktur her bietet es sich daher gera<strong>de</strong>zu<br />
an, be i <strong>de</strong>r Erste11ung von Mo<strong>de</strong>11en , di e über die Stufe <strong>de</strong>r Bautei hi n<br />
aus aggregiert sind, nicht mehr direkt auf Positionsmo<strong>de</strong>lle zurückzugrei<br />
fen, son<strong>de</strong>rn die bereits aggregierten Bauteilmo<strong>de</strong>lle weiter zusammenzufas<br />
sen. Zwangsläufig ergibt sich somit eine <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstruktur<br />
verschie<strong>de</strong>ne Ebenen, wobei je<strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>l gleichzei g als Submo<strong>de</strong>ll<br />
mehrere Ubergeordnete, höher aggregierte Mo<strong>de</strong>lle fungieren kann (Abb.<br />
Die Bauteilmo<strong>de</strong>lle wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>mentsprechend in <strong>de</strong>r übergeordneten Kal<br />
tionsebene zu Bauteilgruppen zusammengefaßt. Aus wenigen Bauteilgruppenmo<br />
<strong>de</strong>ilen läßt sich bereits <strong>de</strong>r Gesamtaufwand für ein Stall gebäu<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r eine<br />
sonstige bauliche Anlage ermitteln. Es liegt daher nahe, für eine <strong>de</strong>rarti<br />
ge, geschlossene bauliche Einheit eine eigene Mo<strong>de</strong>llebene zu I<strong>de</strong>n. Beim<br />
Aufbau <strong>de</strong>r <strong>de</strong>rzeitigen Mo<strong>de</strong>llstruktur erwies es sich als sinnvol , die Ge<br />
samtmo<strong>de</strong>lle für einzelne Stallgebäu<strong>de</strong> nach unterschiedlichen<br />
ttonsar-ten von Gebäu<strong>de</strong>tragwerken ei nzute i 1en , di e jewei 1s ei n ganzes<br />
Bauwerk umfassen *).<br />
Für globale Vergleiche gesamter Produktionsverfahren st es letztlich not-<br />
An dieser Stelle wird es l'Tngerfristig s i nnvo l zusätzliche<br />
lebene einzufUgen, so daß verschie<strong>de</strong>ne zunächst auf<br />
Submo<strong>de</strong>lle zurückgreifen, die beispielsweise nach unterschiedlichen 1ragwerkkonstruktionen<br />
differenziert sind. Ein <strong>de</strong>rartiges Einfügen zusätzlicher<br />
Mo<strong>de</strong>l ebenen ist von ,Jer grundsätzlichen Systemstruktur<br />
zeit möglich.
Produktionsverfahren<br />
arten<br />
Bauteile<br />
Arbeit.<br />
Material<br />
- 38 -<br />
Abbildung 3: Aggregation von Mo<strong>de</strong>llen auf verschie<strong>de</strong>nen Glie<strong>de</strong>rungsebenen<br />
(Beispiel<br />
wendig, die verschie<strong>de</strong>nen Gebäu<strong>de</strong> und baulichen Anlagen, e in die Beur<br />
teilung eines Gesamtverfahrens als Aufwands f s kt.o ren eingehen müssen, zu<br />
jeweils einem Mo<strong>de</strong>ll für die baulichen Anlagen eines gesamten Produktions<br />
verfahrens zusammenzufassen. Insgesamt ergibt sich somit eine hierarchi<br />
sche Glie<strong>de</strong>rungsstruktur, die aus 5 verschie<strong>de</strong>nen Mo<strong>de</strong>llebenen unter-
- 39 -<br />
schiedlichen Aggregations- bzw. Differenzierungsgra<strong>de</strong>s aufgebaut ist. Da<br />
zu kommen als Kalkulationsbasis die Arbeitszeitfunktionen und die liste<br />
a11er Materialien, Bauhi1fsmittel und Ausrüstungsgegenstän<strong>de</strong>, die hier<br />
einer zusätzlichen Ebene abgelegt sind, aber ebensogut völlig getrennt<br />
<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>lien in einer eigenen Datei geführt wer<strong>de</strong>n könnten (Abb. In<br />
Abhängigkeit von <strong>de</strong>n spezifischen Anfor<strong>de</strong>rungen können <strong>de</strong>mentsprechend<br />
einem Kalkulationslauf wahlweise einzelne Teilleistungen, Bauteile, Bau<br />
tei 1gV'uppen, Gebäu<strong>de</strong> unterschi edl i eher Konstruktionsart o<strong>de</strong>r Gesamtanlagen<br />
für ein Produktionsverfahren berechnet wer<strong>de</strong>n.<br />
4.3 Mo<strong>de</strong>llaufbau und methodischer Ablauf<br />
Nach<strong>de</strong>m die grundsätzliche Zusammensetzung <strong>de</strong>s Systems aus fünf verschie<br />
<strong>de</strong>nen Aggregationsebenen und ei ner sechsten Ebene mit <strong>de</strong>n Basi sdaten er<br />
läutert wur<strong>de</strong>, ist nun <strong>de</strong>r grundsätzliche Aufbau, die Verknüpfung Mo<br />
<strong>de</strong>lle untereinan<strong>de</strong>r und <strong>de</strong>r Kalkulationsablauf zu erklären.<br />
Im voranstehen<strong>de</strong>n Kapitel wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, daß <strong>de</strong>r methodische Aufbau <strong>de</strong>s<br />
Kalkulationssystems "von unten nach oben" erfolgt. Dies be<strong>de</strong>utet, daß<br />
Gesamtbauaufwand bis in die kleinsten Grun<strong>de</strong>inheiten analysiert rd ,<br />
bis zu <strong>de</strong>n einzelnen Baumaterialien, die mit Hilfe <strong>de</strong>s Einsatzes von Ar<br />
beitszeit und Bauhilfsmitteln zu Teilleistungen zusammengefügt wer<strong>de</strong>n. Für<br />
<strong>de</strong>rartige Teilleistungen wer<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>lle erstellt, in <strong>de</strong>nen die notwendigen<br />
Parameter für die Berechnung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Aufwandsposten als variable<br />
Einflußgrößen angegeben sind. Diese Positionsmo<strong>de</strong>lle wer<strong>de</strong>n dann<br />
weise zu höherwertigen Mo<strong>de</strong>llen unterschiedlicher Aggregationsintensitlt<br />
zusammengefaßt, di e ebenfall s entsprechen<strong>de</strong> Spezi fi kat ionen für die Be<br />
rechnung enthalten.<br />
Die additive Verknüpfung mehrerer Mo<strong>de</strong>lle zu aggregierten Einheiten, die<br />
dann ihrerseits auf gleiche Weise zu höheren Mo<strong>de</strong>llen verknüpft wer<strong>de</strong>n,<br />
führt jedoch ohne entsprechen<strong>de</strong> Einschränkungen zu einem fast exponentiej<br />
len Anwachsen <strong>de</strong>r Einflußgrößenlisten bei <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>l en höherer Ebenen.<br />
eine sinnvolle und praktikable Anwendbarkeit <strong>de</strong>rartig umfangreicher<br />
le jedoch stark in Frage gestellt ist, muß das Bemühen darin liegen, die<br />
Zahl <strong>de</strong>r vom Anwen<strong>de</strong>r zu kontrollieren<strong>de</strong>n und bei Bedarf zu aktualisieren<br />
<strong>de</strong>n Einflußgrößen möglichst gering zu halten. Diesem Ziel wur<strong>de</strong> Rechnung
- 44 -<br />
6. In je<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r aufgerufenen Untermo<strong>de</strong>lle wer<strong>de</strong>n daraufhin analog zum<br />
Einstiegsmo<strong>de</strong>ll die Schritte 3 - 5 erneut durchgeführt.<br />
7. Gemäß <strong>de</strong>m Kalkulationsablauf oben nach unten" wer<strong>de</strong>n sami<br />
schließlich Mo<strong>de</strong>lle für sämtliche Einzelpositionen aufgerufen, die<br />
für das Kalkulationsobjekt benBtigt wer<strong>de</strong>n. Von diesen Mo<strong>de</strong>ll aus<br />
gehend erfolgt daraufhin die tatsächliche Berechnung <strong>de</strong>s Mengenbedar<br />
fes mit HiHe <strong>de</strong>r Arbeitszeit- Materialbedarfsfunktionen s im<br />
Kalkulationsablauf wie Mo<strong>de</strong>lle behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n d.h. die Funkti<br />
wer<strong>de</strong>n in gleicher Form ausgewählt, aufgerufen und die EinflußgrBßen<br />
mit <strong>de</strong>n spezifischen Kalkulationsparametern belegt<br />
Das Kalkulationsergebnis besteht somit schließlich<br />
einzelnen Materialbedarfs- und Arbeitszeitangaben,<br />
Verrechnung mit <strong>de</strong>n Einzelpreisen entsprechen<strong>de</strong><br />
tionsbedarf resultieren,<br />
einer Vielzahl von<br />
<strong>de</strong>nen durch weitere<br />
<strong>de</strong>n l nve sti-:<br />
Somit wird <strong>de</strong>utlich, daß unabhängig von <strong>de</strong>r Wah'l <strong>de</strong>r Einstiegsebene in <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>llkalkulation immer eine <strong>de</strong>taillierte AufschlUsselung <strong>de</strong>r erfür<strong>de</strong>rl!<br />
ehen Mengen, getrennt nach Arbeitszeit und<br />
Einstiegsebene wer<strong>de</strong>n dazu systemintern maximal<br />
führt. Die Wahl <strong>de</strong>r Einstiegsebene richtet sich dabei jedoch n<br />
nach <strong>de</strong>m tatsächlichen Bauumfang <strong>de</strong>s Kalkulationsobjektes. Vielmehr kann<br />
durch die Wahl <strong>de</strong>r Einstiegsebene auch <strong>de</strong>r Kalkul ionsaufwand und<br />
nauigkeit <strong>de</strong>r Kalkulation beeinflußt wer<strong>de</strong>n, Wie bereits am En<strong>de</strong><br />
ten Abschnittes <strong>de</strong>utlich gemacht wur<strong>de</strong>, wer<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Ubertragung von ak<br />
tuellen Werten auf die Submo<strong>de</strong>lle jeweils nur wichtigsten ußgrB<br />
ßen überschrieben Dies hat zur Konsequenz, daß mit zunehmen<strong>de</strong>m i\ggrega<br />
tionsgrad <strong>de</strong>s gewählten KalKulationsmo<strong>de</strong>ll die Zahl <strong>de</strong>rjenigen Einf1uß<br />
grBßen ansteigt, die nicht mit objektspezifischen Parametern Uberschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n konnen , bei <strong>de</strong>nen also Voreinstellwerte i die Kalkulation einge<br />
hen, die nicht unbedingt fUr das jeweilige Objekt GUltigkeit besitzen müs<br />
sen. Mit zunehmen<strong>de</strong>m Aggregationsgrad <strong>de</strong>s Einstiegsmo<strong>de</strong>lls sinkt folgli<br />
die Genauigkeit <strong>de</strong>r Kalkulation.<br />
In umgekehrter Richtung steigt hingegen bei einer entsprechend differen<br />
zierteren Kalkulation mit geringer aggregierten Mo<strong>de</strong>llen <strong>de</strong>r Eingabeauf<br />
wand stark an, da für das gleiche Kalkulationsobjekt mehr Mo<strong>de</strong>lle mi ei-
- 45 -<br />
ne r nsgesamt höheren Zahl an Einflußgrößen kalkuliert wer<strong>de</strong>n müssen.<br />
Durch die gezielte Wahl <strong>de</strong>r Einstiegsebene ist <strong>de</strong>m Benutzer somit die Mög<br />
1 chkeit gegeben, <strong>de</strong>n Eingabeaufwand und die Kalkulationsgenauigkeit zu<br />
steuern. Die Form <strong>de</strong>r Ergebnisdarstellung hirgegen ist unabhängig von <strong>de</strong>r<br />
Wahl <strong>de</strong>r Kalkulationsebene wie im nachstehen<strong>de</strong>n Abschnitt gezeigt wer<strong>de</strong>n<br />
so11 .<br />
4.4 Darstellung <strong>de</strong>r Kalkulationsergebnisse<br />
Entsprechend <strong>de</strong>r Ziel vorgabe bei <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s Systems erlaubt das<br />
Kalkuiationsel'gebnis einen differenzierten Einblick in die rein mengen<br />
mäßige Aufwands7usammensetzung auf <strong>de</strong>r eioen Seite und die Zusammensetzung<br />
<strong>de</strong>s Investitionsbedarfes auf. <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite. Aufgrund <strong>de</strong>s sehr stark<br />
disaggregieren<strong>de</strong>n Kalkulationsablaufes e nt s t eht eine Vielzahl von Mate<br />
r i s l be dar-fs-: und Arbeitszeitbedarfsangaben, aus <strong>de</strong>nen in einem sekundären<br />
Berechnungsschritt entsprechen<strong>de</strong> Prei sangaben r e sul tieren. Die Ergebei,<br />
darstellung erfolgt daher in einem <strong>de</strong>ssen Aufbau<br />
kurz erklärt wer<strong>de</strong>n soll (ve rq l . Tab. 4).<br />
Bei <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>ll,'echnungen zu kalkulieren<strong>de</strong>n Systemen treten in <strong>de</strong>r<br />
Regel gleiche o<strong>de</strong>r zumin<strong>de</strong>st ähnliche Teilleistungen an verschie<strong>de</strong>nen<br />
Stellen <strong>de</strong>s Bauobjek:s auf, ebenso wie gleiche Materi ien zu unterschied<br />
licnen Zwecken benötigt wer<strong>de</strong>n. Zum Zwecke <strong>de</strong>r Bedarfsplanung Jnd um al<br />
ternative Lösungsansätze nach <strong>de</strong>n unterschiedl iehen Faktoransprüchen beur<br />
teilen zu können, wer<strong>de</strong>n alle Ansprüche an g'leiche Arbe i t s vor-qanqe o<strong>de</strong>r<br />
Materialien aus <strong>de</strong>n Einzelpositionen aufaddiert, so daß im Kalkulations<br />
protokoll direkt für je<strong>de</strong>n Faktor <strong>de</strong>r naturale Bedarf im Rahmen <strong>de</strong>s Ge<br />
samtobjektes abgelesen wer<strong>de</strong>n kann. Weiterhin ist <strong>de</strong>r' jeweilige Preis bzw.<br />
Lohnansatz pro Einheit aufgeführt, <strong>de</strong>r als Grundlage für die Ermi<br />
<strong>de</strong>r Einzelpreise eines je<strong>de</strong>n Bauelementes dient.<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Arbeiten o<strong>de</strong>r Materialien sind zu<strong>de</strong>m zu einheitlichen<br />
Gruppen zusammengefaßt, die beispielsweise Erdarbeiten, Schalarbeiten o<strong>de</strong>r<br />
Anstricharbeiten umfassen; bei <strong>de</strong>n Materialien sind die Gruppen entspre<br />
chend Zement, Fertigbeton o<strong>de</strong>r Schalmaterial. Eine weitere Gruppierung <strong>de</strong>r<br />
BaueJementangaben erfolgt sch l ießl ich in Rohbauarbeiten und Ausbauarbeiten<br />
sowie in unterschiedliche Baustoffgruppen wie Holz o<strong>de</strong>r Eisen. Neben <strong>de</strong>n
- 48 -<br />
ziehungen im Rahmen <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llanalyse erlaubt im Gegensatz zur reinen An<br />
gabe von Prei sdi fferenzen zwisehen verschi e<strong>de</strong>nen Lösungen ei nen unmi tte1<br />
baren Einbl ick in die Höhe und Struktur <strong>de</strong>s naturalen und monetären Fak<br />
toraufwan<strong>de</strong>s. Während die Kenntnis von Preisdifferenzen a l s Entscheidungs<br />
hilfe bei Planungsverfahren nur bedingt geeignet ist, soweit die Ursachen<br />
<strong>de</strong>rartiger Preisunterschie<strong>de</strong> nicht <strong>de</strong>utlich gemacht wer<strong>de</strong>n, ermöglicht die<br />
vorgestellte, analytisch ausgerichtete Kalkulationsmetho<strong>de</strong>, die jeweiligen<br />
Verursacher einer differieren<strong>de</strong>n Aufwandshöhe anhand <strong>de</strong>s Mengen- und<br />
Preisgerüstes exakt zu i<strong>de</strong>ntifizieren. Die geson<strong>de</strong>rte Ausweisung aller<br />
Lohn- und Preisangaben bietet ebenso die Grundlage für die Beurteilung <strong>de</strong>s<br />
Einflusses regionaler Lohn- und Preisverhältnisse auf die Wettbewerbsfä<br />
higkeit bestimmter Lösungen wie auch für die Simulation zukünftiger Preis<br />
entwicklungen.<br />
4.5 Dokumentation<br />
In <strong>de</strong>n vorhergehen<strong>de</strong>n Kapiteln wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, daß das gesamte Kalkula<br />
tionssystem eine erhebliche Zahl von Einzelmo<strong>de</strong>llen umfaßt. Ein sinnvoller<br />
Systemaufbau und eine fehlerfreie Anwendung ist daher nur realisierbar,<br />
wenn eine ein<strong>de</strong>utige und klare Dokumentation erfolgt. Das gil sowohl für<br />
<strong>de</strong>n Aufbau je<strong>de</strong>s Einzelmo<strong>de</strong>lls als auch für die Struktur und die Zuordnung<br />
<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle untereinan<strong>de</strong>r im Rahmen <strong>de</strong>s Gesamtsystems Hier erUbrigte sich<br />
eine völlige Neukonzeption, da das vor·gestellte Verfahren zur BaukaH.ul<br />
tion nur einen Teilbereich <strong>de</strong>s übergeordneten "Landwirtschaftlichen Infor<br />
mationssystems Landtechnik LlSL" darstellt, Sowohl im Bereich <strong>de</strong>r Dokumen<br />
tation als auch bei <strong>de</strong>r Festlegung <strong>de</strong>s kalkulatorischen Ablaufes konnte im<br />
Rahmen dieses Informationssystems in <strong>de</strong>n Grundzügen auf ein bereits beste<br />
hen<strong>de</strong>s Verfahren zur Arbeitszeitkalkulation zurückgegriffen wer<strong>de</strong>n. Dieses<br />
von AUERNHAMMER /6/ entwickelte System wur<strong>de</strong> von ihm für die Belange <strong>de</strong>r<br />
Baukalkulation lediglich um die erfor<strong>de</strong>rlichen Unterprogramme zur Mate<br />
rial- und Preisberechnung ergänzt. Bedingt durch <strong>de</strong>n methodischen Aufbau<br />
auf vorhan<strong>de</strong>ne Dokumentations- und Kalkulationsstrukturen ergibt sich die<br />
Möglichkeit, einmal erworbene Kenntnisse <strong>de</strong>s einen Verfahrens direkt auf<br />
das an<strong>de</strong>re System zu übertragen, was nicht nur beim Systemaufbau, son<strong>de</strong>rn<br />
vor allem auch für die Am/endung von großem Vorteil ist. Die Formulierung<br />
und Dokumentation <strong>de</strong>r Einzelmo<strong>de</strong>lle wur<strong>de</strong> dabei i Teilen bereits von<br />
KRINNER /81/ durchgeführt.
4.5.1 Aufbau <strong>de</strong>r Einzeldokumente<br />
49 -<br />
f ii r sämt I i ehe Mo<strong>de</strong>lle <strong>de</strong>r verschi e<strong>de</strong>nen Aggregati onsstufen wie auch<br />
Basisdatenmaterial (Funktionen für Arbeitszeit und Materialien)<br />
ein einheitliches Ablageschema in Form eines sogenannten Dokumentes<br />
Der Aufbau <strong>de</strong>r Dokumente ergibt sich aus <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen, die<br />
Mo<strong>de</strong>lle und Daten gestellt wer<strong>de</strong>n (vergI. Abb. 7):<br />
J. Die Kalkulation fußt auf <strong>de</strong>r Berechnung von Funktionen, <strong>de</strong>ren Vari<br />
ablen spezifische Werte annehmen können. Diese Werte sind entwe<strong>de</strong>r<br />
di rekt durch <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>r vorzugeben o<strong>de</strong>r aus übergeordneten Mo<strong>de</strong> l<br />
Ien zu übertragen. Die Dokumente <strong>de</strong>r Basisebene, in <strong>de</strong>nen die Funkti<br />
onen abgespeichert sind, müssen daher neben <strong>de</strong>n Funktionen in Form<br />
algebraischer Ausdrücke eine explizite Ausweisung <strong>de</strong>r Variablen ent<br />
halten, so daß sie durch <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>r ein<strong>de</strong>utig i<strong>de</strong>ntifiziert und be<br />
stimmt wer<strong>de</strong>n können. Diese Variablendarstellung erfolgt in Form ei<br />
ner Einflußgrößenliste (Abb. 7, Abschnitt 3 u. 6).<br />
Mo<strong>de</strong>lle höherer Ebenen enthalten selbst keine Funktionen; sie benöti<br />
gen daher fUr die Kalkulation eine Zugr1ffsmög1ichkeit auf die Ba5i5<br />
dokumente. Zur Festlegung <strong>de</strong>r Kalkulationswer·te durch <strong>de</strong>n Benutzer<br />
Ist auch für diese Dokumente eine Liste mit ein<strong>de</strong>utig beschriebenen<br />
Einflußgraßen erfor<strong>de</strong>rlich, <strong>de</strong>ren Voreinstellwerte vom Benutzer durch<br />
spezifische Angaben ersetzbar sein müssen (Abschnitt 3).<br />
Die Einflußgrößenliste ist auf diejenigen Angaben zu beschränken, die<br />
sich nicht auf an<strong>de</strong>re, bereits vorgegebene Parameter zurückführen<br />
lassen. Zur Berechnung zusätzlich erfor<strong>de</strong>rlicher Variablen sind ent<br />
sprechen<strong>de</strong> algebraische Ausdrücke abzuspeichern, mit <strong>de</strong>ren Hilfe se<br />
kundäre Variablen, hier Hilfsv ar-iablen genannt, errechnet wer<strong>de</strong>n kön<br />
nen. Diese sind wie alle Einflußgrößen im Dokument verbal zu be<br />
schreiben (Abschnitt 3)<br />
Je<strong>de</strong>m Mo<strong>de</strong>ll sind in gleicher Weise aufgebaute Submo<strong>de</strong>lle zugeordnet.<br />
Im übergeordneten Mo<strong>de</strong>ll sind <strong>de</strong>mentsprechend bestimmte Anweisungen<br />
abzuspeichern, die eine gezielte Auswahl <strong>de</strong>r jeweils erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Submo<strong>de</strong>lle vornehmen und <strong>de</strong>ren Einflußgrößen mit <strong>de</strong>n im speziellen<br />
Kalkulationslauf aktuellen Parametern aus <strong>de</strong>r E1nflußgrößen- und
- 51 -<br />
Stelle treten, an <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>n Dokumenten <strong>de</strong>r Basisebene die Funktio<br />
nen abgespeichert sind (Abschnitt 6).<br />
5. Zur gezielten und sinnvollen Anwendung <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle im Rahmen ihres<br />
Gültigkeitsbereiches ist einerseits <strong>de</strong>r jeweilige Kalkulationsumfang<br />
zu umreißen, in<strong>de</strong>m Anfangs- und Endpunkte angegeben wer<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>rer<br />
seits sind in einem weiteren Abschnitt verbale Beschreibungen <strong>de</strong>r<br />
vorgesehenen Einsatzbereiche sowie Anwendungshinweise und eventuelle<br />
Beschränkungen abzulegen (Abschnitt 1 u. 2).<br />
6. Zur fehlerfreien Anwendung ist es letztlich unabdingbar, je<strong>de</strong>s Doku<br />
ment mit einer Überschrift und einem I<strong>de</strong>ntifikationsco<strong>de</strong> zu versehen<br />
(Abschnitt 1).<br />
Sämtlich Dokumente bestehen einheitlich aus 10 Abschnitten zu je 100<br />
Zeilen, die jedoch <strong>de</strong>rzeit nicht vollständig ausgefüllt sind, so daß genügend<br />
Raum für eventuelle Ergänzungen <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle verbleibt. Die in <strong>de</strong>n<br />
Punkten 1-6 umrissenen obligatorischen Angaben wer<strong>de</strong>n in verschie<strong>de</strong>nen,<br />
fest vorgegebenen Abschnitten abgespeichert, wobei jeweils zusammengehörige<br />
Informationen in einem Abschnitt stehen, die im Sinne von Datenbanken<br />
Einzeldateien mit analogem Inhalt darstellen können. Die Dokumente für die<br />
Arbeitszeitfunktionen unterschei<strong>de</strong>n sich dabei von <strong>de</strong>n übergeordneten Mo<strong>de</strong>lldokumenten<br />
allein dadurch, daß die Anweisungen für die Hilfsvariablenerstell<br />
ung und <strong>de</strong>n Untermo<strong>de</strong>llaufruf entfallen und statt <strong>de</strong>ssen ein zusätzl<br />
ieher Abschnitt für die Funktion mit <strong>de</strong>n zugehörigen statistischen<br />
Kennwerten eingefügt ist (Abschnitt 6).<br />
Die Dokumente für die einzelnen Materialien sind in gleicher Form wie die<br />
Arbeitszeitdokumente aufgebaut. Die Funktion ist jedoch vollständig reduziert<br />
bis auf das absolute Glied, welches <strong>de</strong>n Wert 1 erhält. Die Höhe <strong>de</strong>s<br />
Materialaufwan<strong>de</strong>s wird dabei allein durch die Multiplikation <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>r<br />
lichen Häufigkeit mit diesem Wert 1 festgelegt. Beispiele für die drei unterschiedlichen<br />
Dokumentformen sind in <strong>de</strong>n Anhangstabellen 1 bis 3 aufge<br />
führt.
4.5.2 Gesamtmo<strong>de</strong>llstruktur<br />
- 52 -<br />
Entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kriterien für <strong>de</strong>n Aufbau <strong>de</strong>r Gesamtmo<strong>de</strong>llstruktur die<br />
klare Glie<strong>de</strong>rung und mbglichst effektive Speicherung <strong>de</strong>r Dokumente. Da<br />
sich die Zahl <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rl ichen Mo<strong>de</strong>ne auf <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Ebenen mit<br />
zunehmen<strong>de</strong>r Aggregation stark verringert, erscheint es sinnvoll, nicht für<br />
alle Ebenen die gleiche Zahl von Speicherplätzen<br />
ei entsprechen<strong>de</strong> Abstufung vorzunehmen.<br />
son<strong>de</strong>rn<br />
Eine vom Benutzer leicht nachvollziehbare ur c chrcrung<br />
läßt si ch auf Grundlage <strong>de</strong>s normalen, <strong>de</strong>kadischen Zahlensystems au f-'<br />
bauen , in<strong>de</strong>m für e höchste Aggregationsstufe 1e ein cl igen Zahl<br />
für die nächst tiefere die zwe i st e l li oen Zahl USVi. s schließlich zur<br />
sechsten Ebene mit <strong>de</strong>n Zahlen von 100.000 bei 999.999 verwen<strong>de</strong>t. wer<strong>de</strong>n Ir'<br />
einer <strong>de</strong>rartigen hierarchischen Ordnung bil<strong>de</strong>n die Mo<strong>de</strong>lle für die<br />
nen Pr-oduktionaver-fahr-en wie Bullenmast o<strong>de</strong>r lchv i tung som' je-<br />
weils ein Kapitel und erhalten eine Ordnungsnummer zwischen und 9.<br />
Von diesen wer<strong>de</strong>n die Mo<strong>de</strong>lle die unterschiedli<br />
aufgerufen, die <strong>de</strong>m jeweiligen Produktionsverfahren sinc , d h<br />
<strong>de</strong>m Produktionsverfahren 8ullenmast wer<strong>de</strong>n die Mo<strong>de</strong>lle 10-19,<br />
Milchviehhai jenigen von 20-29 zugeordnet<br />
sten Ebene stehen daraufhin bereits 900 PI für<br />
zur Verfügung. Für ein Einzelgebäu<strong>de</strong> ergeben sich<br />
tei l q ruppen wie Bo<strong>de</strong>nplatte, Wän<strong>de</strong> und Dach<br />
schiedliche Konstruktionsarten o<strong>de</strong>r Produkti<br />
schie<strong>de</strong>ne Ausprägungen <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rlichen erscheint<br />
daher s i nnvol l , elsweise verschie<strong>de</strong>ne onsverfahren und<br />
nerhal dieser Verfahren für e unterschiedlichen<br />
zifische Mo<strong>de</strong>ll für die Bo<strong>de</strong>nplatte zu l<strong>de</strong>n.<br />
rechnung <strong>de</strong>s Daches von Vortei 1, wenn für unterschiedl<br />
arten und Spannweiten jeweils eigene Mo<strong>de</strong>lle zur Verfügung stehen Dabei<br />
sind in <strong>de</strong>r Regel nicht völlig neue Mo<strong>de</strong>lle erstellen, son<strong>de</strong>rn ge-<br />
nügt oftmals die Formulierung von Verweismo<strong>de</strong>llen, .h . von Mo<strong>de</strong>ll di<br />
auf gleiche Anweisungen zur Hilfsvariablenerzeugung und zum Untermo<strong>de</strong>ll<br />
aufruf zurückgreifen und sich nur in <strong>de</strong>n Dokument.abschnitten s unter-<br />
schei<strong>de</strong>n (vergi. Anhangstabelle 32).
- 54 -<br />
rigkeit zu einem bestimmten Produktionsverfahren o<strong>de</strong>r einer Bauteilgruppe<br />
gekennzeichnet. Vielmehr wird hier ähnlich wie in <strong>de</strong>r Verdingungsordnung<br />
fUr Bauleistungen VOB /136/ eine Glie<strong>de</strong>rung nach Leistungsgruppen vorge<br />
nommen. Innerhalb einer Leistungsgruppe erfolgt dabei eine weitere Grup'<br />
penbildung wie es im unteren Teil von Abbbildung schematisch erläutert<br />
ist.<br />
Mo<strong>de</strong>11ebene II<br />
Konstr-u k tionsar-ten<br />
Mo<strong>de</strong>llebene 11 :<br />
Bautel Igruppen<br />
L... . Baut.s tlq rupps<br />
L... . V:.onstruktionsart<br />
'-----....--------- Produktionsverfahren<br />
Mo<strong>de</strong>llebene IV:<br />
Bauteile o 9<br />
Mo<strong>de</strong>11ebene V<br />
Positionen<br />
Abbildung 9: Glie<strong>de</strong>rung und Zuordnung <strong>de</strong>r Dokumente<br />
L...--·_--------_··------Bauteilgruppe<br />
L.._.,__. Produkti 0 n C uo"L 'I.,"""<br />
o<br />
L.. Le i stung s qruppen<br />
Die Bas i s- o<strong>de</strong>r Grun<strong>de</strong>bene umfaßt Arbeitszeitfunktionen und Materialien<br />
und ist aus diesem Grun<strong>de</strong> zweigeteilt, Auch f ur die Arbeitszeitfunktionen<br />
wur<strong>de</strong> eine Glie<strong>de</strong>rung nach Lei5tungsbereichen vorgenommen, wobei die Doku<br />
mente von 100.000 bis 100099 die Rohbauarbeiten, diejenigen von 100100
- 55 -<br />
bis 100.199 hingegen die Ausbauarbeiten aufnehmen. Die weiteren Dokumente<br />
von 100.200 bi s 100.999 enthalten di e Materi al i en , so daß darüberhi naus<br />
gehen<strong>de</strong> Speicherplätze <strong>de</strong>rzeit nicht benötigt wer<strong>de</strong>n (Tab. 6). Arbeiten<br />
und Materialien wur<strong>de</strong>n dabei weiterhin nach bestimmten Gruppen und Unter<br />
gruppen geordnet, so daß auch hier eine einheitliche und übersichtliche<br />
Glie<strong>de</strong>rung entsteht.<br />
Je<strong>de</strong>s Einzeldokument <strong>de</strong>r 6. Ebene dient <strong>de</strong>r Berechnung eines bestimmten<br />
Arbeitsumfanges o<strong>de</strong>r einer Materialmenge, die zur Berechnung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes<br />
mit <strong>de</strong>m zugehörigen Preis pro Einheit verrechnet wer<strong>de</strong>n muß.<br />
Die Ookumentation <strong>de</strong>r Einzelpreise erfolgt in einer separaten Datei, die<br />
als Matrix mit 100 Zeilen und 10 Spalten aufgebaut ist. Die Spalten- und<br />
Zeilennummern entsprechen dabei jeweils <strong>de</strong>n letzten drei Ziffern <strong>de</strong>r zuge<br />
hörigen Dokumente, so daß e t ne ein<strong>de</strong>utige und benutzerfreundliche Zuordnung<br />
gegeben ist (vergl. Tab. 32im Anhang).<br />
Tabelle 6: Struktur <strong>de</strong>r Dokumentebene VI: Arbeit + Materialien<br />
100000 - 100099 Rohbauarbeiten<br />
100100 - 100199 Ausbauarbeiten<br />
100200 - 100299 Bin<strong>de</strong>mittel,Naturstoffe,Beton<br />
100300 - 100399 Bausteine<br />
100400 100499 Bedachungsmaterial<br />
100500 - 100599 Eisen und sonstige Metalle<br />
100600 - 100699 Isolier- und Dämmstoffe<br />
100700 - 100799 Steinzeug,Platten und Beläge<br />
100800 - 100899 Fertigteile<br />
100900 - 100999 Holz<br />
Entsprechend <strong>de</strong>r "eins zu vielen-Beziehung kann somit die gesamte Mo<strong>de</strong>ll<br />
datei als ein treppenförmiges Gebil<strong>de</strong> aUfgefaßt wer<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Kalkulationsablauf<br />
von einer beliebigen Stufe aus in Richtung <strong>de</strong>r nächst tieferen<br />
Stufen verläuft (Abb. 10). Aus <strong>de</strong>m Teilergebnis Arbeitszeit- und Materialbedarf<br />
ergibt sich durch Verrechnung mit <strong>de</strong>n zugehörigen Preisen <strong>de</strong>r<br />
Investitionsbedarf. Eine zukünftige Erweiterung <strong>de</strong>s Systems wird an dieser<br />
Stelle ansetzen und über eine Ableitung <strong>de</strong>r Kapitalkosten und Hinzufügen
- 56 -<br />
<strong>de</strong>r Reparaturkosten schließlich zu einer Ermittlung <strong>de</strong>r Jahreskosten ge<br />
langen.<br />
r------""'"'!<br />
,- ----,<br />
I Kapitalkosten<br />
L __- T - ,<br />
1-------------"<br />
r" ..l "l<br />
I Kosten/Tierplnrz.Jenr I<br />
L _<br />
Abbi fdung 10, Struktur <strong>de</strong>r Dokumentdatei
5. Datengrundlage<br />
- 57 -<br />
Bevor auf <strong>de</strong>n Vergleich verschie<strong>de</strong>ner baulicher Systeme eingegangen wer<strong>de</strong>n<br />
kann, ist zunächst die verwen<strong>de</strong>te Datengrundlage im Kalkulationssystem zu<br />
erläutern. Dabei ist auf die Herkunft <strong>de</strong>r Daten und die Form <strong>de</strong>r Übernahme<br />
in das System einzugehen.<br />
5.1 Arbeitszeitberechnung<br />
Kennzeichnen<strong>de</strong>s Element <strong>de</strong>r vorgestellten Metho<strong>de</strong> ist die Analyse <strong>de</strong>s zu<br />
kalkulieren<strong>de</strong>n Objektes bis hin zu <strong>de</strong>n Einzelmaterialien und <strong>de</strong>m erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Zeitaufwand für das Zusammenfügen <strong>de</strong>r Materialien. Der Ermittlung<br />
<strong>de</strong>s Faktors Arbeitszeit kommt dabei eine hohe Be<strong>de</strong>utung zu, die zunächst<br />
darin begrün<strong>de</strong>t ist, daß er im Regelfall auch in <strong>de</strong>r Landwirtschaft einen<br />
erheblichen Anteil am Gesamtinvestitionsbedarf beansprucht /81,103,1051<br />
dieses Aufwandsfaktors entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Möglichkeiten gegeben, die Höhe <strong>de</strong>s<br />
Gesamtinvestitionsbedarfes zu beeinflussen. Wie in kaum einem an<strong>de</strong>ren Sek<br />
tor wird gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Landwirtschaft von <strong>de</strong>r Möglicheit Gebrauch gemacht,<br />
erhebliche Kapitaleinsparungen durch die Einbringung eigener o<strong>de</strong>r nachbarschaftlicher<br />
Arbeitsleistung zu erwirken. Dies gilt insbeson<strong>de</strong>re für Um<br />
baumaßnahmen, die bei einem durchschnittlichen Alter landwirtschaftlicher<br />
Betriebsgebäu<strong>de</strong> von über 50 Jahren /25/ sehr häufig sind, jedoch nur sehr<br />
selten an Unternehmen vergeben wer<strong>de</strong>n. Folgl ich ist <strong>de</strong>r Informationsbedarf<br />
im Bereich Arbeitszeitplanung landwirtschaftlicher Bauvorhaben als beson<br />
<strong>de</strong>rs hoch und wichtig einzuschätzen.<br />
5.1 .1 Quellen fü r Arbeitszeitwerte<br />
5.1.1.1 Arbeitszeitdaten aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>s landwirtschaftlichen Bauens<br />
Im speziellen Bereich <strong>de</strong>s landwirtschaftlichen Bauwesens ist die Daten<br />
grundlage fUr Arbeitszeitwerte spärlich. Allein RITTEL 1979 /104/ hat im<br />
Rahmen von Untersuchungen an Holztragwerken fUr landwirtschaftliche Be<br />
triebsgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rlichen Arbeitszeitaufwand für die Erstellung an<br />
verschie<strong>de</strong>nen Baustellen exakt ermittelt. Die Messungen wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m
- :;8 -<br />
Verfahren <strong>de</strong>r Zeitelementanalyse /1151 durchgeführt und führten über eine<br />
entsprechen<strong>de</strong> statistische Aufbereitung (s. Kap. 5..3.2) zu Planzeiten,<br />
auf <strong>de</strong>ren Grundlage Vergleiche zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Tragwerken ausge<br />
führt wur<strong>de</strong>n.<br />
Da weitere Arbeitszeitdaten aus <strong>de</strong>m landwirtschaftlichen Bereich in einer<br />
hinreichend aufbereiteten Form nicht verfügbar waren, mußte auf einschlä<br />
gige Unterlagen <strong>de</strong>s allgemeinen Hochbaues zurückgegriffen wer<strong>de</strong>n.<br />
5.1.1.2 Arbeitszeitdaten aus <strong>de</strong>m allgemeinen Hochbau<br />
Auch im allgemeinen Hochbau besteht für verschie<strong>de</strong>ne Management-Aufgaben<br />
ein Bedarf an Arbeitszeitwerten . Größere Unternehmen führen zu diesem<br />
Zweck eigene Arbeitszeitstudien durch, während in <strong>de</strong>r Regel die erfor<strong>de</strong>y'<br />
lichen Daten aus <strong>de</strong>r einschlägigen Literatur entnommen und teilweise durch<br />
betri ebsei gene Nachka 1kul a t ionen ergänzt und spezi fi ziert wer<strong>de</strong>n. Richt<br />
werte für <strong>de</strong>n Stun<strong>de</strong>naufwand von Bauarbeiten sind in einer Reihe von Stan<br />
dardwerken enthalten 133,36,40,44,95,102,119/; die Variationsbreite <strong>de</strong>r<br />
veröffentl iehten Werte ist Jedoch so erhebl ich, daß selbst Abweichungen um<br />
ein Mehrfaches eines Vorgabewertes keine Ausnahme sind.<br />
Bei <strong>de</strong>r Beurteilung und Einordnung <strong>de</strong>rartiger Zeitangaben ist daher zu he<br />
rücks i cht i gen, unter we1ehen Prämi s se n di e Daten erhoben wur<strong>de</strong>n und<br />
welchem Verwendungszweck die Daten zugedacht sind. So wer<strong>de</strong>n Arbeitszeit<br />
werte für di e Ab1aufp1anung, Kostenplanung, Arbei tsvorberei tung, Ka1kul e<br />
t i on , Preisprüfung o<strong>de</strong>r Leistungsgrad- und Lohnermittlung veröffentlicht.<br />
Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite wirken sich die eventuell sehr spezifischen Baustel<br />
len- und Betriebsbedingungen, unter <strong>de</strong>nen die Daten erhoben wer<strong>de</strong>n, dahin<br />
gehend aus, daß sie nur für bestimmte Zwecke einsetzbar sind. Schließlich<br />
ist das Alter <strong>de</strong>r Daten zu berücksichtigen, da auch im allgemeinen Bauwe<br />
sen, wo vergleichsweise geringe Rationalisierungsfortschritte zu verzeich<br />
nen sind, in <strong>de</strong>n letzten Jahren eine Reihe von neuen Verfahren und Werk<br />
stoffen Eingang gefun<strong>de</strong>n haben.<br />
Die Verwendbarkeit <strong>de</strong>r Daten ist jedoch vor allem dadurch eingeschränkt,<br />
daß häufig die verschie<strong>de</strong>nen Einflußfaktoren, die entschei<strong>de</strong>nd auf die<br />
Höhe <strong>de</strong>s jeweiligen Wertes einwirken, nicht o<strong>de</strong>r nicht genügend spezifi-
- 59 -<br />
ziert wer<strong>de</strong>n. Statt <strong>de</strong>ssen wer<strong>de</strong>n die Daten als Spannweiten angegeben,<br />
<strong>de</strong>ren Anwendung vom Kalkulator eine entsprechen<strong>de</strong> Erfahrung verlangt. Als<br />
Grundlage für Mo<strong>de</strong>llkalkulationen sind <strong>de</strong>rartige Datensammlungen daher nUr<br />
unter Einschränkungen verwertbar.<br />
Wie in an<strong>de</strong>ren industriellen Bereichen so stellt auch im Baugewerbe inzwischen<br />
die Verwendung von Arbeitszeitdaten für die Leistungslohnermittlung<br />
ein Hauptanwendungsgebiet dar. Zur Schaffung einheitlicher Berechnungs<br />
grundlagen wur<strong>de</strong> 1968 von <strong>de</strong>n Spitzenverbän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bauwirtschaft<br />
<strong>de</strong>r "Bun<strong>de</strong>sausschuß Leistungslohn Bau· gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>ssen Aufgabe in <strong>de</strong>r<br />
methodischen Ermittlung von Arbeitszeitrichtwerten besteht. (KASSEL u.<br />
SPRENGER 1978/72/).<br />
Die Zeitermittlung und statistische Auswertung erfolgt in <strong>de</strong>r Regel in<br />
Form <strong>de</strong>s Multimoment-Verfahrens nach REFA /53/, welches von DRESSEL /34/<br />
auf die spezifischen Belange <strong>de</strong>s Bauwesens zugeschnitten wur<strong>de</strong>. Die Vorteil<br />
e <strong>de</strong>r in Tabe11enform veröffentlichten "Arbeitszeitri chtwerte-Hochbau<br />
ARH" /146/ liegen in <strong>de</strong>r sehr breiten Datenbasis, die auf überregionalen<br />
Messungen an verschie<strong>de</strong>nsten Baustellen beruht. Die Richtwerte wer<strong>de</strong>n ergänzt<br />
durch eine ein<strong>de</strong>utige Beschreibung <strong>de</strong>r Arbeitsverfahren, <strong>de</strong>r Arbeitsmetho<strong>de</strong><br />
und <strong>de</strong>r Arbeitsbedingungen, unter <strong>de</strong>nen die Daten gültig<br />
sind. Zu<strong>de</strong>m sind die Werte in Abhängigkeit von <strong>de</strong>n wichtigsten quantitativen<br />
Einflußgrößen tabelliert, wobei auch eine Angabe <strong>de</strong>s Gültigkeitsbereiches<br />
<strong>de</strong>r Einflußgrößen erfolgt. Die Arbeitszeitwerte enthalten nach Maßgabe<br />
<strong>de</strong>r verschi e<strong>de</strong>nen Einfl ußgrößen Anteil e an abIaufbedi ngter Wartezei t ,<br />
sachlicher und persönlicher Verteilzeit sowie Verlustzeiten bis zu einer<br />
Dauer von einer Viertelstun<strong>de</strong> /111/. Als nachteilig ist jedoch anzusehen,<br />
daß aufgrund <strong>de</strong>r Erhebungsmetho<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Tabellen keine statistischen<br />
Kennwerte <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> 1i egen<strong>de</strong>n Ist-Zeiten entha.l ten sei n können, so daß<br />
eine Beurteilung <strong>de</strong>r Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit <strong>de</strong>r Daten nicht<br />
möglich ist.<br />
In einer Gesamtbeurteilung scheinen die ARH-Tabellen gegenüber <strong>de</strong>n sonstigen<br />
veröffentlichten Vorgabewerten jedoch die geeignetsten Ausgangswerte<br />
für <strong>de</strong>n Aufbau <strong>de</strong>s Kalkulationssystems zu liefern, da sie auf einer ver<br />
hältnismäßig großen Zahl von Messungen beruhen und infolge <strong>de</strong>r Angabe <strong>de</strong>r<br />
signifikanten Einflußgrößen relativ spezifisch verwendbar sind. Ein Großteil<br />
<strong>de</strong>r im Kalkulationssystem verwen<strong>de</strong>ten Arbeitszeitfunktionen beruht
- 60 -<br />
daher auf einer Umformung dieser Tabellenwerte.<br />
5.1.2 Darstellung <strong>de</strong>r Richtwerte als Planzeitfunktionen<br />
Die Darstellung <strong>de</strong>r Arbeitszeitrichtwerte in tabellierter Form bewirkt<br />
aufgrund <strong>de</strong>r Vie1zah 1 von Einfl ußfaktoren, di e berücks i chti gt wer<strong>de</strong>n, ei n<br />
verhältnismäßig umfangreiches Tabellenwerk. Diese Form <strong>de</strong>r Datenvermittlung<br />
hat sicherlich für einfache Kalkulationen von Hand ihre Berechtigung,<br />
da sie auch für <strong>de</strong>n ungeübten Benutzer leicht anwendbar ist. Trotz<strong>de</strong>m darf<br />
nicht übersehen wer<strong>de</strong>n, daß die fertig errechneten Tabellenwerte nur Gesamtergebnisse<br />
repräsentieren, jedoch nichts über das Zustan<strong>de</strong>kommen <strong>de</strong>r<br />
Werte, also <strong>de</strong>n Datenhintergrund aussagen /6/, wenn nicht ein Tabellari um<br />
in einem nicht mehr anwendungsgerechten Umfang erstellt wird. Ebenso las<br />
sen sich in Tabellen die tatsächlichen Abhängigkeiten kaum darstellen.<br />
Als die "natürliche" Form <strong>de</strong>r Darstellung von Arbeitszeitwerten kann hin<br />
gegen di e Funktion angesehen wer<strong>de</strong>n, da di e stati stische Auswertung <strong>de</strong>r<br />
Meßdaten, die in Abhängigkeit von bestimmten Einflußgrößen erfaßt wer<strong>de</strong>n,<br />
auf <strong>de</strong>m Wege <strong>de</strong>r Regressionsrechnung zunächst in je<strong>de</strong>m Falle zu einer<br />
funktionalen Darstellungform fUhren. Tabellenwerte mUssen also nachträg<br />
1ich aus di ese r "Urform" errechnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Verständl i che Handhabungsschwi er i gkei ten von Forme 1n f ür <strong>de</strong>n ungeübten An<br />
wen<strong>de</strong>r ließen diese Form trotz<strong>de</strong>m zunächst keine größere Verbreitung fin<br />
<strong>de</strong>n. Für ein EDV-gestütztes Kalkulationssystem hingegen drängt sich eine<br />
funktionale Abbildung von Zusammenhängen gera<strong>de</strong>zu auf, da sich Anwendungs<br />
probleme durch entsprechen<strong>de</strong> Gestaltung vermei<strong>de</strong>n lassen. Funktionen erfor<strong>de</strong>rn<br />
zu<strong>de</strong>m erheblich weniger Speicherplatz und erlauben eine weit ge<br />
nauere Kalkulation, da die Zielwerte in je<strong>de</strong>m Einzelfall unter Einbeziehung<br />
<strong>de</strong>r spezi fi sehen Ei nf l ußgrößen immer neu berechnet wer<strong>de</strong>n. Sch1i eß<br />
lich lassen sich nur durch Zeitmessungen entsprechen<strong>de</strong> statistische Kenn<br />
größen berechnen, während im Multimomentverfahren nur Arbeitsarten ermittelt<br />
und daraus Zeitwerte abgeleitet wer<strong>de</strong>n. Diese Zusammenhänge führten<br />
dazu, daß in neuerer Zeit die Arbeitszeitfunktion auch in <strong>de</strong>r Bauliteratur<br />
verstärkt Anwendung fin<strong>de</strong>t, lei<strong>de</strong>r jedoch bisher nicht fUr die in diesem<br />
Kalkulationssystem erfor<strong>de</strong>rlichen Bereiche /69,70,101/.
- 61 -<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r Vorteil e <strong>de</strong>r funkt i ona 1en<br />
KRINNER /81/, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>r Erstellung<br />
System begonnen hat, einen Großteil <strong>de</strong>r<br />
Form umzuwan<strong>de</strong>ln.<br />
Darstellung unternahm es jedoch<br />
<strong>de</strong>r Arbeitszeitmo<strong>de</strong>lle für dieses<br />
Tabellenwerte in eine funktionale<br />
5.1.2. Aufbau und Cültigkeitsbereich <strong>de</strong>r Rkhtwertetabellen<br />
Zum weiteren Verständn i s <strong>de</strong>r Umformung bedarf es zunächst ei ner Erl äute<br />
rung <strong>de</strong>s Aufbaues <strong>de</strong>r ARH-Tabellen, die hier am Beispiel <strong>de</strong>r Betonarbeiten<br />
vorgenommen wer<strong>de</strong>n soll. (vergi. Tab. 7).<br />
Die Tabellen sind zunächst nach Gewerken (Arbeitsgebieten) und innerhalb<br />
dieser Gewerke nach <strong>de</strong>r allgemeinen Baustelleneinrichtung geglie<strong>de</strong>rt, z.8.<br />
"Kranbetrieb mit 250-Liter-Transportgefäß und Betonmi scher" o<strong>de</strong>r "Kranba<br />
trieb, Transportbeton". Weitere Untergl ie<strong>de</strong>rungen erfolgen für die Beton<br />
arbei ten nach verschi e<strong>de</strong>nen Bauteil en, <strong>de</strong>m Bauteil umfang, <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rli<br />
chen Betonmenge pro Bauabschnitt sowie nach bewehrten o<strong>de</strong>r unbewehrten<br />
Bauteilen. Neben <strong>de</strong>n Richtzeiten, die für je<strong>de</strong> Kombination dieser Glie<strong>de</strong><br />
rungspunkte angegeben wer<strong>de</strong>n, erfolgen dann noch zusätzliche Zeitangaben<br />
für Rüstzeiten sowie bestimmte Zulagen. Die Bezugsgrößen für die Einzelan<br />
gaben einer Tabelle können dabei variieren; so wer<strong>de</strong>n in dieser Tabel<br />
die Zeitbedarfsangaben auf einen Bauabschn t t t , einen Kubikmeter Beton o<strong>de</strong>r<br />
einen Quadratmeter betonierte Fläche bezogen.<br />
Die Detailglie<strong>de</strong>rung an<strong>de</strong>rer Tabellen ist natürlich jeweiligen Gewerk.en<br />
angepaßt, folgt jedoch grundsätzlich <strong>de</strong>m in Tabelle 7 dargestellten Auf<br />
bau.
- 65 -<br />
Die Abbildungsgenauigkeit, die mit <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Regressionsfunktionen<br />
erreicht wer<strong>de</strong>n konnte, kann dabei fast durchgehend als hoch klassifiziert<br />
wer<strong>de</strong>n. So lag das Bestimmtheitsmaß, welches als Quadrat <strong>de</strong>s multiplen<br />
Korrelationskoeffizienten <strong>de</strong>n Anteil angibt, mit <strong>de</strong>m die Variation <strong>de</strong>r<br />
Zielgröße durch die Einflußgrößen erklärt wer<strong>de</strong>n kann, für <strong>de</strong>n überwiegen<br />
<strong>de</strong>n Tei 1 <strong>de</strong>r Funktionen über 0,9. Nur in einem Fall ist es geringer als<br />
0,8. Auch die Testwerte auf Abweichung <strong>de</strong>r Residuen von <strong>de</strong>r Normalvertei<br />
lung lagen fast durchwegs unter 2. Anhand dieses Residuentests läßt sich<br />
feststellen, inwieweit die Abweichungen <strong>de</strong>r Meßwerte (hier = Tabellenwer<br />
tel von <strong>de</strong>n geschätzten Regressionswerten normalverteilt sind. Sie stellen<br />
somi t e i n Maß für di e Güte <strong>de</strong>r Schätzung dar und können an hand <strong>de</strong>r t-Ver<br />
teilung nach STUDENT getestet wer<strong>de</strong>n.<br />
Die hohe Abbildungsgenauigkeit <strong>de</strong>r errechneten Funktionen kann darauf zu<br />
rückgeführt wer<strong>de</strong>n, daß es sich bei <strong>de</strong>n Arbeitszeit-Richtwerten bereits um<br />
gewichtete und normalisierte Mittelwerte aus verschie<strong>de</strong>nen Einzelmessungen<br />
han<strong>de</strong>lt, so daß keine Grundstreuung mehr auftritt (KASSEL u. SPRENGER 1978<br />
/72/).<br />
Lediglich in zwei Arbeitsbereichen konnte durch einen linearen Ansatz auch<br />
nach verschie<strong>de</strong>nen Transformationen <strong>de</strong>r Zielgröße keine hinreichen<strong>de</strong> An<br />
passung <strong>de</strong>r Regressionsfunktion an die Tabellenwerte erzielt wer<strong>de</strong>n. Für<br />
<strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Bewehrungsarbeiten mit Stabstahl und <strong>de</strong>r Maurerarbeiten<br />
erfolgt eine Form <strong>de</strong>r <strong>de</strong>gressiven Abnahme <strong>de</strong>r Tabellenwerte, die eine Auf<br />
spaltung <strong>de</strong>r Daten und Abbildung in zwei getrennten Funktionen erfor<strong>de</strong>r<br />
lich machte. So wur<strong>de</strong> das gesamte Datenmaterial über die Stabstahlbeweh<br />
rung in zwei Abschnitte mit Stählen über bzw. unter 13 Millimeter Durch<br />
messer getrennt mit <strong>de</strong>r Folge, daß die bei <strong>de</strong>n daraus resultieren<strong>de</strong>n<br />
Funktion eine gute Anpassung an die Vorgabewerte erl·eichten. Ebenso wur<strong>de</strong><br />
es notwendig, für die Mauerarbeiten zwei getrennte Fuktionen für die ßau<br />
abschnitte unter 0 m 3 Mauerwerk und über 10 m 3 Mauerwerk zu berechnen.
- 66 -<br />
5.1.2.3 Erstellung unabhängiger Planzeiten<br />
Ein Teil <strong>de</strong>r Tabellen enthält Zeitelemente, für <strong>de</strong>ren Werte sich keine<br />
signifikante Abhängigkeit von bestimmten Einflußgrößen nachweisen läßt,<br />
bzw. die einen konstanten Zeitwert aufweisen. In diesen Bereich fallen vor<br />
allem Rüstzeiten sowie bestimmte Zulagen, soweit sie nicht bereits in die<br />
Grundzeiten eingearbeitet sind Für diese unabhängigen Planzeiten stell<br />
nach AUERNHAMMER 1975 /5/ <strong>de</strong>r Mittelwert bzw. hier meist direkt <strong>de</strong>r Tabel<br />
lenwert die korrekte Planzeit dar. Unabhängige Planzeiten können darüber<br />
hinaus auch dann entstehen, wenn im Rahmen <strong>de</strong>r multiplen Regressionsreeh<br />
nung keine <strong>de</strong>r verrechneten Einflußgrößen das vorgegebene Signifikanz<br />
niveau erreicht. Eine unabhängige Planzeit kann folglich als reduzierte<br />
Planzeitfunktion nach Formel (6) aufgefaßt wer<strong>de</strong>n<br />
(10) y = a + 0<br />
Unabhängige Planzeiten stellen somi fixe Zeitwerte für bestimmte Arbeits<br />
bereiche dar, für die keine signifikanten Einflüsse nachzuweisen sind<br />
Für die Arbeitsbereiche Dämmen, Ve r-k i e i <strong>de</strong>n , An stre t chen und Dach<strong>de</strong>cken<br />
liegen <strong>de</strong>rzeit noch keine ARH-Tabellen vor. In diesen Bereichen wur<strong>de</strong> da<br />
her im allgemei auf di Angaben <strong>de</strong>s Instituts für Bauforschung, Hanno<br />
ver nach WEILBIER 1968 /119/ zurückgegr'iffen. Die Daten mußten dabei eben<br />
falls als unabhängige Planzeiten übernommen wer<strong>de</strong>n, da anhand <strong>de</strong>r Be<br />
schreibung <strong>de</strong>r Zeitwerte eine funktionale Abhängigkei von bestimmten Ei<br />
flußgrößen nicht nachzuweisen ist.<br />
5.1.3 Überprüfung <strong>de</strong>r Gültigkeit von Arbeitszeitrichtwerten<br />
8ei Akzeptanz durchschni tt1i eher Ungenaui gkei ten von Vorgabezeiten, di e<br />
nach KASSEL 1973 171/ für das Baugewerbe im Regelfall 10-30 % betragen,<br />
kann davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n, daß die von RITTEL 1979 /104/ ermittelten<br />
Planzeitfunktionen für die Errichtung von Gebäu<strong>de</strong>tragwerken im Berei<br />
landwirtschaftlicher Baustellen allgemeine Gültigkeit besitzen. Im Gegen<br />
satz zu diesem Bereich, für <strong>de</strong>n auch die Ausgangsdaten auf landwirtschaft<br />
lichen Baustellen erhoben wur<strong>de</strong>n, kann für die Arbeitszeitdaten aus <strong>de</strong>m
- 67 -<br />
allgemeinen Hochbau von dieser Prämisse nicht ausgegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Bauen im landwirtschaftlichen Sektor vollzieht sich in weiten Teilen<br />
unter vallig an<strong>de</strong>ren Rahmenbedingungen als im allgemeinen Baugewerbe. So<br />
muß in <strong>de</strong>r Landwirtschaft bei <strong>de</strong>n meisten BauabwickJungen zumin<strong>de</strong>st bei<br />
einzelner Abschnitten von <strong>de</strong>r Anwendung baulicher Selbsthilfe o<strong>de</strong>r von so<br />
genannten "Regiebaustellen" ausgegangen wer<strong>de</strong>n. In diesen Fällen kann ver<br />
mutet wer<strong>de</strong>n, daß <strong>de</strong>r Einsatz ungelernter Arbeitskräfte o<strong>de</strong>r die meist<br />
schlechtere Baustelleneinrichtung zu einem Mehrbedarf an Arbeitszeit<br />
fUhrt. Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite darf jedoch <strong>de</strong>r leistungsför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Aspekt<br />
nicht Ubersehen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r allgemein haheren Motivation von Fami<br />
lienmitgl ie<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r Nachbarn resultiert. Bei fast allen Arbeiten ungeach<br />
tet <strong>de</strong>r Organisationsform, kann zu<strong>de</strong>m eine Leistungssteigerung infolge <strong>de</strong>r<br />
ständigen Kontrolle <strong>de</strong>s meist mitarbeiten<strong>de</strong>n Bauherrn vermutet wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>n Richtwerten <strong>de</strong>r ARH-Tabenen ist darUberhinaus zu beachten, daß<br />
di ese mit <strong>de</strong>r Zie I setzung veröffent.li cht wer<strong>de</strong>n, eine überbe trt ebI; ehe<br />
Grundlage für die Leistungslohnberechnung zu schaffen. Die Festlegung <strong>de</strong>r<br />
Einzelwerte unterliegt dabei <strong>de</strong>r Kontrolle <strong>de</strong>r Tarifvertragsparteien <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>utschen Bauhandwerks /72/. Richtwerte zur Lei stungs lohnberechnung sind<br />
jedoch nicht unbedingt mit <strong>de</strong>n tatsächlich zu erwarten<strong>de</strong>n Arbeitszeiten<br />
i<strong>de</strong>ntisch, da je nach Einfluß <strong>de</strong>r Vertragsparteien mit eventuellen Korrekturen<br />
nach oben o<strong>de</strong>r unten gerechnet wer<strong>de</strong>n muß.<br />
Es erscheint daher unbedingt erfor<strong>de</strong>rlich, die Tabellenwerte hinsichtlich<br />
ihrer Gültigkeit für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>s landwirtschaftlichen Bauwesens zu<br />
überprüfen. Die Richtwe,-te sind also in einem Sol l r Is t-Ye rq le tch <strong>de</strong>n tat<br />
sächlich benötigten Arbeitszeiten existenter Betriebe gegenüberzustellen.<br />
FUr di e I st-Zei termi t t I ung auf Bauste 11 en kommen .die in Abbildung 11 dar<br />
gestellten Verfahren in Betracht.<br />
Das Verfahren <strong>de</strong>r NachkaI kul ati on anhand von Unter lagen <strong>de</strong>r<br />
Bauberichterstattung bietet <strong>de</strong>n Vorteil einer verhältnismäßig einfachen<br />
Metho<strong>de</strong>, die <strong>de</strong>nnoch bei sorgfältiger Durchführung für <strong>de</strong>n Soll-Ist-Ver<br />
gleich durchaus erhebliche Aussagekraft besitzt. DRESSEL 1963 /35/ und<br />
KASSEL 1973 /71/ sehen in <strong>de</strong>r Auswertung von Nachkalkulationen eine ent<br />
schei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Voraussetzung für die Vorkalkulation im Baubetrieb. Vom Institut<br />
für Arbeits' und Baubetriebswissenschaft, Leonberq , wur<strong>de</strong> zu diesem
- 68 -<br />
Abbildung 11: Verfahren <strong>de</strong>r Ist-Zeitbestimmung im Bauwesen<br />
Zweck eine auf einen festgelegten Bauarbeitsschlüssel gegrün<strong>de</strong>te Metho<strong>de</strong><br />
entwickelt, die regelmäßige Nachkalkulationen vor allem für Großbetriebe<br />
<strong>de</strong>s Bauhandwerks nach einem einheitlich auswertbaren Schema ermögli<br />
Eine Überprüfung <strong>de</strong>r Tabellen anhand <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Verfahren <strong>de</strong>r<br />
Zeitmessung hi ngegen erfor<strong>de</strong>rt ei nen unverhältni smäßi g hohen Aufwand, wenn<br />
alle als Kalkulationsgrundlage vorgesehenen Richtwerte überprUft wer<strong>de</strong>n<br />
sollen. Daher schei<strong>de</strong>n diese Verfahren fUr die GesamtUberprUfung zunächst<br />
aus. Wie später darzustelien ist, brachten die Soll-1st-Vergleiche jedoch<br />
in einigen Arbeitsbereichen erhebliche Ungenauigkeiten zutage. FUr die in<br />
diesen Bereichen sami erfor<strong>de</strong>rliche neue Planzeiterstellung konnte die<br />
anhand <strong>de</strong>r Nachkalkulationen erreichbare Genauigkeit jedoch n,cht aus<br />
reichend angesehen wer<strong>de</strong>n. Daher wur<strong>de</strong>n in ausgewählten Bereichen über di<br />
Bauberichterstattung hinaus Einzelzeitaufnahmen angefertigt<br />
Das Verfahren <strong>de</strong>r Bauberichterstattung konnte fUr <strong>de</strong>n hier vorzunehmen<strong>de</strong>n<br />
Soll-1st-Vergleich an einzelnen, ausgewählten Baustellen stark vereinfacht<br />
wer<strong>de</strong>n, da das Ziel dieser Untersuchung nicht in einer Vorgabewertermitt<br />
lung, son<strong>de</strong>rn zunächst allein in <strong>de</strong>r ÜberprUfung <strong>de</strong>r Gültigkeit <strong>de</strong>r Richt<br />
werte unter <strong>de</strong>n Baubedingungen <strong>de</strong>r Landwirtschaft besteht. Aus diesem<br />
Grun<strong>de</strong> ist es nicht erfor<strong>de</strong>rlich, die Erfassung <strong>de</strong>r Arbeitsleistung im<br />
Stun<strong>de</strong>n-Rhythmus vorzunehmen, wie es von SPRANZ 1975/111/ gefor<strong>de</strong>rt wird,<br />
son<strong>de</strong>rn vielmehr können die erfor<strong>de</strong>rlichen Informationen bereits durch ei<br />
nen differenzierten Tagesbericht bereitgestellt wer<strong>de</strong>n. Neben <strong>de</strong>r Auf<br />
zeichnung <strong>de</strong>r fUr verschie<strong>de</strong>ne Positionen insgesamt geleisteten Arbeits-
- 69 -<br />
stun<strong>de</strong>n ist dabei für die Auswertbarkeit unbedingte Voraussetzung, auch<br />
<strong>de</strong>n jeweiligen Arbeitsfortschritt in <strong>de</strong>n einzelnen Positionen exakt fest<br />
zuhalten.<br />
In einer ersten, mehr <strong>de</strong>r Erprobung <strong>de</strong>r Vorgehensweise dienen<strong>de</strong>n Auswer<br />
tung konnten bereits anhand summarischer Aufzeichnungen eines Bauherrn<br />
über <strong>de</strong>n Arbeitszeitbedarf für die Erst.ellunq einzelner Bauteile und einem<br />
Vergleich mit <strong>de</strong>n Ergebnissen einer Mo<strong>de</strong>llkalkulation Anhaltspunkte für<br />
weitere Untersuchungen gewonnen wer<strong>de</strong>n. Bei diesem Vergleich, <strong>de</strong>r nur für<br />
die Fundamente und Güllekanäle vorgenommen wur<strong>de</strong>, ergab sich für die Gesamtarbeitszeit<br />
eine Unterschätzung durch die Mo<strong>de</strong>l e von 19 %/93/.<br />
Insgesamt ließen die Ergebnisse dieser ersten Auswertung <strong>de</strong>n SchI zu,<br />
daß das Verfahren <strong>de</strong>r Bauberichtsanalyse bei vertretbarem zeitlichen<br />
finanziellen Aufwand eine Überprüfung <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen verwandten Ar<br />
beitszeitwerte zuläßt. Daher wur<strong>de</strong> für die Ist-Zeit-Analyse auf wesentlich<br />
aufwendigeren Verfahren <strong>de</strong>r Zeitstudie verzichtet.<br />
5.1.3. Auswertung von Arbeitstagebüchern<br />
Die Auswahl <strong>de</strong>r Betriebe zur Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen<br />
te unter <strong>de</strong>r Zielsetzung, <strong>de</strong>n oftmals sehr differrieren<strong>de</strong>n baulichen Voraussetzungen<br />
in <strong>de</strong>r Landwirtschaft Rechnung zu tragen. Dabei mußte aus finanziellen<br />
und zeitlichen Erwägungen eine Beschränkung auf unter<br />
schiedlich organisierte Baustellen mit verschie<strong>de</strong>ner Baustellenausrüstung<br />
vorgenommen wer<strong>de</strong>n, wobei diese jedoch die häufigsten Ausprägungen land<br />
wirtschaftlicher Baudurchführungen repräsentieren (Tab. 8). So<br />
Betrieb die auch im allgemeinen Hochbau übl che Baustel1eneLnricl1tlJna<br />
verwandt und das Gesamtgebäu<strong>de</strong> zum überwiegen<strong>de</strong>n Teil als reine<br />
nehmerleistung erstellt. Im Gegensatz dazu erfolgte im Betrieb 3<br />
wenige Ausnahmen die gesamte Bauabwicklung durch <strong>de</strong>n<br />
Mithi fe von Familienangehörigen. Zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> auf dieser Baustelle<br />
Kran eingesetzt.<br />
Hinsichtlich <strong>de</strong>s Bauvolumens und <strong>de</strong>r Konstruktionsmerkmale sen die vier'<br />
Betriebe relativ geringe Differenzen auf. Alle Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n in Massivbauweise<br />
mit gängigen zimmermannsmäßigen Dachkonstruktionen erri
selben Grundgesamthei , <strong>de</strong>r diejenige Stichprobe entstammt,<br />
Soll-Zeitwert durch Berechnung <strong>de</strong>s arithmetischen Mittels<br />
<strong>de</strong>o Die Nullhypothese lautet somit<br />
12)<br />
)(<br />
aus <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
gebil<strong>de</strong>t wur-<br />
Das Testverfahren folgt <strong>de</strong>n bekannten Entscheidungsregeln <strong>de</strong>s t-Tests nach<br />
STUDENT.<br />
Eine <strong>de</strong>rartige überprüfung <strong>de</strong>r Gültigkeit von Sol lrZet twert en i im Fol<br />
gen<strong>de</strong>n beispielhaft für e Betonarbeiten bei <strong>de</strong>r Erstellung <strong>de</strong>r Fundamen<br />
te im Betrieb 3 aufgezeigt. Aus <strong>de</strong>n Aufzeichnungen <strong>de</strong>r ßauberichterstat<br />
tung konnten die in Tabelle 10 aufgeführten Einzeldaten isoliert wer<strong>de</strong>n,<br />
aus <strong>de</strong>nen sich für diesen Abschnitt ein mittlerer Zeitbedarf von ,01<br />
Stun<strong>de</strong>n pro Kubikmeter Beton ergibt.<br />
Tabelle 10: Prüfung <strong>de</strong>r Gültigkeit <strong>de</strong>r ARH-Richtwerte<br />
ilFundamente betonierenil ( Betrieb 3<br />
Bautei 1<br />
Fundamentfuß<br />
Fundamentfuß<br />
Fundamentsockel 34,<br />
12<br />
34<br />
Beispiel<br />
0,B4<br />
In <strong>de</strong>n Arbeitszeit-Richtwerten-Hochbau fin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r zuqehörige Wert in<br />
Tabelle B .211. Hier wird für das Betonieren von Streifenfundamenten bei<br />
einem ßauteilumfang über 5 m"; Kranbetrieb mi t 250 ter Transportgefäß<br />
und Eigenmischung n Zeitbedarf von 1,15 Stun<strong>de</strong>n pro Kubikmeter ausgewie<br />
sen.
Das Multimomentverfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß in bestimmten<br />
Zeitintervallen die aktuelle gkeit verschi tsoersonen o<strong>de</strong>r<br />
Geräte stichprobenarti festgehalten wird. Ist ne entsprechen<strong>de</strong> Anzahl<br />
<strong>de</strong>rartiger punktueller Beobachtungsdaten vorhan<strong>de</strong>n, so iäßt sich mittels<br />
eines statistischen Auswertungsverfahrens <strong>de</strong>r Häufigkeitsverteilung<br />
auf die Anteile <strong>de</strong>r Einzelzei an <strong>de</strong>r Gesamtzeit j aus <strong>de</strong>nen<br />
dann Richtwerte zu ermitteln nd.<br />
Einige entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kriterien die sinnvolle Anwendung <strong>de</strong>s<br />
sind jedoch im vorliegen<strong>de</strong>n Unte r suchunq sbe re ' land", li<br />
Baustellen nicht e r f ü l l t , so daß das Verfahren<br />
konnte. Im Bauwesen erfuHren Multimomentstudi<br />
starke Verbreitung) da Zeitaufnahmen in erster Li<br />
<strong>de</strong>s Ingenieurbaus durcHgeführt<br />
men sind gekennzeichnet meist<br />
nen längeren Zeitraum mit <strong>de</strong>rsei Arbeit<br />
häufig nur für bestimmte Arbei<br />
können auf Großbaustelien<br />
stet wer<strong>de</strong>n, wobei nacH<br />
tskraft<br />
mehr'eren Wochen<br />
.;c h j 5 t.<br />
setzungen im landwirtschaftlichen<br />
und auch organisatorisch ne ge Aufnahmetechnik mit<br />
baren bewältigen war, mußte d i<br />
Verfahren <strong>de</strong>r kontinuierli Beobachtung zurückgegri<br />
e OurchfUhrung Zeitstudien und sehe Auswertung pe<br />
vo r t e i l haft., auf e Me-<br />
tho<strong>de</strong>n und Auswertungsprogramme ren} wel<br />
wur<strong>de</strong>n.<br />
/104/ für r'iessungen l andwt lingesetzt<br />
Die Ist-Analyse wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>mentsprechend<br />
f ührt , wobe i e we sen t l i chen Merkmale<br />
1s e i nz e l zuvor nach<br />
Arbeitselemente gemessen wer<strong>de</strong>n. Ein Arbei<br />
SCHÖN und AUERNHAMMER 1977<br />
wegungen bZ,
- 77 -<br />
absoluten Zeitwert die möglicherweise zeitbestimmen<strong>de</strong>n qualitativen o<strong>de</strong>r<br />
quantitativen Einflußfaktoren wie in diesem Beispiel die Entfernung<br />
Steinlager o<strong>de</strong>r die Steingröße ebenfal s registriert wer<strong>de</strong>n. Als Voraus<br />
setzung für die Ableitung tatsächlich aussagefähiger Planzeiten st im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r Ist-Analyse zu<strong>de</strong>m nicht al1ein die reine Tätigkeitszeit zu er<br />
fassen, son<strong>de</strong>rn auch di e gesamte Unterbrechungszeit (Verteil zeit), die<br />
sieh zusammengesetzt aus <strong>de</strong>n Komponenten Er-holunqszeit, Wartezeit,<br />
Störzeit und persönliche Zeit. Bei <strong>de</strong>r Erstellung von Planzeiten aus<br />
Werten <strong>de</strong>r Ist-Analyse ist diese Unterbrechungszeit soweit möglich <strong>de</strong>n<br />
bei tsschritten zuzuordnen, unter <strong>de</strong>nen sie angefallen si nd , bzw. anteiJ<br />
mäßig <strong>de</strong>n einzelnen Tätigkeitszeiten zuzuschlagen.<br />
Im fo 1gen<strong>de</strong>n so11 nur kurz da s methodi sehe, Vorgehen bei <strong>de</strong>r Pl anzei ter<br />
stellung aus Ist-Zeitanalysen dargestellt wer<strong>de</strong>n. Eine ausführliche metho<br />
dische Ableitung und Beschreibung fin<strong>de</strong>t sich bei AUERNHAMMER 1975<br />
SAUER 1981 /106/.<br />
Die in einer Zeitmessung ermittelten Fortschrittszeiten und sonstigen An<br />
gaben wer<strong>de</strong>n in Formblättern aufgezei chnet (s , Tab. 35 und 36 im<br />
wobei nach Abschluß <strong>de</strong>r Messung je<strong>de</strong>r Zeitwert durch trgänzung mit<br />
Ko<strong>de</strong> <strong>de</strong>m zugehörigen, <strong>de</strong>finierten Arbeitselement zugeordnet wird. Nach Ab<br />
spei cherung <strong>de</strong>r Daten können mit Hilfe ei ns s Auswertungsprogrammes<br />
Teilzeitanalyse /147/ Parameter über<br />
<strong>de</strong>n absoluten und relativen Zeitaufwand für die Tätigkeitszeit und<br />
die verschie<strong>de</strong>nen Unterbrechungszeiten,<br />
<strong>de</strong>n absoluten und relativen Zeitaufwand je Arbeitselement,<br />
- die Anzahl <strong>de</strong>r Einzelmeßwerte pro Arbeitselement und die<br />
schnittliehe Größe <strong>de</strong>r Einzelmeßwerte,<br />
- sowie <strong>de</strong>n Gesamtzeitaufwand in Minuten und Stun<strong>de</strong>n<br />
ermittelt wer<strong>de</strong>n,<br />
FUr die Erstellung von Arbeitszeitfunktionen ist es erfor<strong>de</strong>rlich, je<strong>de</strong>s<br />
Arbeitselement ner getrennten statistischen Analyse zu unterziehen und<br />
nachfolgend die resultieren<strong>de</strong>n Planzeiten zu "funktionsfähigen"<br />
vorgängen zu aggregieren. Zu diesem Zweck können über ein weiteres Pro<br />
gramm /148/ alle Zeitmeßwerte, die sich auf gleiche Arbeitselemente bezie-
- 78 -<br />
hen , zu Stapeln zusammengefaßt wer<strong>de</strong>n, die dann einzeln zu verrechnen<br />
sind. Oie Verrechnung <strong>de</strong>r Meßwerte erfolgt analog zu <strong>de</strong>r bereits beschrie<br />
benen Planzeiterstellung aus Richtwerten unter Anwendung <strong>de</strong>r multiplen<br />
Regressionsrechnung. Für die Berechnung unabhängiger Planzeiten stand dar<br />
überhinaus noch ein Programm zur Verfügung /149/, welches die statistische<br />
Beurteilung vereinfacht, da zusätzliche statistische Testparameter und<br />
Kenngrößen ausgewiesen wer<strong>de</strong>n.<br />
Zur Verbesserung <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen Planzeitfunktionen aus <strong>de</strong>n Richtwerten<br />
wur<strong>de</strong>n insgesamt ca. 4300 Meßwerte in 64 Einzelmessungen erfaßt, von <strong>de</strong>nen<br />
48 ausgewertet wer<strong>de</strong>n konnten. Nach <strong>de</strong>r Auswertung und entsprechen<strong>de</strong>n Ag<br />
gregation <strong>de</strong>r Planzeiten zu Arbeitseinheiten, die <strong>de</strong>m Differenzierungsgrad<br />
<strong>de</strong>r ARH-Tabellen vergleichbar sind, konnten neun verbesserte Arbeitszeit<br />
funktionen in das Kalkulationssystem integriert wer<strong>de</strong>n.<br />
5.1.4 Einordung <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
Die überprUfung <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rgabegenauigkeit <strong>de</strong>r Funktionen in einem erneuten<br />
Soll-1st-Vergleich mit <strong>de</strong>n Ergebnissen <strong>de</strong>r Bauberichterstattung erbrachte<br />
erwartungsgemäß eine erhebl iche Verbesserung <strong>de</strong>r Genauigkeit. Abbildung 13<br />
zeigt am Beispiel <strong>de</strong>r Dachein<strong>de</strong>ckung die Soll-1st-Abweichung für die ur<br />
sprünglich zugrun<strong>de</strong>gelegten Richtwerte und die neu erstellte Funktion. Die<br />
Verbesserung <strong>de</strong>r Kalkulationsgenauigkeit ist augenfällig; sie ist jedoch<br />
nur bedingt aussagefähig, da die Ist-Zeiten <strong>de</strong>n gleichen Betrieben ent<br />
stammen, die auch <strong>de</strong>r Soll-Zeitermittlung zugrun<strong>de</strong> lagen. Somit beträgt<br />
<strong>de</strong>r systematische Fehler bei drei Betrieben 33 %.<br />
Eine aussagekräftigere überprüfung <strong>de</strong>r Gültigkeit <strong>de</strong>r teilweise verän<strong>de</strong>r<br />
ten Ka l kul at t onsba s t s ist hingegen nur möglich, wenn eine von <strong>de</strong>r 5011<br />
Zeitermittlung unabhängige Vergleichsbasis ausgewählt wird. (s. Abschnitt<br />
5.3) .
79 -<br />
Abbildung 13: Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Soll-Ist Abweichung für die Dachein<strong>de</strong>ckung nach<br />
Erstellung neuer Funktionen<br />
5.2 Mengenberechnung<br />
Während die Kalkulation <strong>de</strong>s zu erwarten<strong>de</strong>n Arbeitszeitbedarfes für eine<br />
Baumaßnahme aufgrund <strong>de</strong>r zahlreichen und häufig im vorhinein nicht exakt<br />
quantifizierbaren Einflußgrößen relativ problematisch ist, gestaltet sich<br />
die Berechnung <strong>de</strong>s naturalen Aufwan<strong>de</strong>s an Baumaterialien und Bauhilfsmit<br />
teln verhältnismäßig einfach. In <strong>de</strong>r Regel ist eine Mo<strong>de</strong>llkalkulatiDn mit<br />
hinreichen<strong>de</strong>r Präzision über einfache arithmetische Verknüpfungen Ab<br />
messungen zu berechnen<strong>de</strong>r Bauteile möglich, soweit erfor<strong>de</strong>rliche Verlust<br />
zuschläge in geeignetem Umfang in die Berechnungsformel integriert wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Genauigkeit <strong>de</strong>r Kalkulation <strong>de</strong>s Baumassenbedarfes hängt somit er<br />
ster Linie von <strong>de</strong>r Berechnungsbasis <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle ab, d.h. inwieweit die<br />
beim Bau von Betriebsgebäu<strong>de</strong>n eventuell benötigten Materialien auch tat<br />
sächlich mo<strong>de</strong>llmäßig erfaßt sind.<br />
Der hierarchische Aufbau <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstruktur und die von <strong>de</strong>n BerechnungsmD<br />
<strong>de</strong>llen getrennte Abspeicherung <strong>de</strong>r Einzelmaterialien gewährleistet, daß<br />
durch einfache Erweiterung <strong>de</strong>r Auswahlkriterien und Hinzufügen einzelner<br />
Dokumente in <strong>de</strong>r Bas i sebene neue Baustoffe i die bestehen<strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>ll<br />
tur integriert wer<strong>de</strong>n können. Erheblich problematischer gestaltet eh
- 80 -<br />
hingegen eine notwendige Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle, wenn die Einführung neuer<br />
Materialien o<strong>de</strong>r Geräte auch gleichzeitig neue Bauausführungsverfahren be<br />
dingen, da in <strong>de</strong>rartigen Fällen zusätzl ch neue Planzeiten zu erstellen<br />
und in das System zu integrieren sind.<br />
Die Form <strong>de</strong>r Bauausführung wird darüberhinaus insbeson<strong>de</strong>re durch die all<br />
gemeine Baustelleneinrichtung geprägt, die sich über <strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Arbeitszeitbedarf, aber auch über die Kosten <strong>de</strong>r Geräte selbst sehr stark<br />
auf <strong>de</strong>n Gesamtinvestitionsbedarf auswirken kBnnen. Die mo<strong>de</strong>llmäßige Erfas<br />
sung grBßerer zeit- o<strong>de</strong>r kostenrelevanter Geräte wie Kran, Betonpumpe,<br />
Schalungs- o<strong>de</strong>r Gerüstmaterial ist in <strong>de</strong>r Regel unproblematisch. Für die<br />
Kalkulationsgenauigkeit ist dabei insbeson<strong>de</strong>re entschei<strong>de</strong>nd, daß in <strong>de</strong>n<br />
Arbeitszeiten ebenfalls eine entsprechen<strong>de</strong> Differenzierung vorgenommen<br />
wird.<br />
In Soll-1st-Vergleichen treten auch bei korrekter Mo<strong>de</strong>llerstellung in ei<br />
nigen Bereichen häufiger Abweichungen in <strong>de</strong>r HBhe <strong>de</strong>s Materialbedarfes<br />
auf, die jedoch weniger auf eine Unzulänglichkeit <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle zurückzufüh<br />
ren sind als vielmehr auf die oftmals nicht exakte Einhaltung <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n<br />
Plänen vorgegebenen Maße. Dabei soll nicht unt.er st el l t wer<strong>de</strong>n, daß gegebe<br />
ne Maße bewußt verfäl scht wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>ra rti ge Abwei chungen treten<br />
beispielsweise im Bereich <strong>de</strong>r Erdarbeiten und Fundamente allein durch Un<br />
ebenheiten in <strong>de</strong>r Gelän<strong>de</strong>gestaltung auf.<br />
Die Verbesserung <strong>de</strong>r Kalkulationsgenauigkeit durch exakte Anpassung <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>lle an die tatsächliche Baustelleneinrichtung wird anhand eines $011<br />
Ist-Vergleichs von VöLKL 1983 /117/ <strong>de</strong>utl ich, <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Berechnung <strong>de</strong>r<br />
$chalarbeiten neben <strong>de</strong>r ursprünglich vorhan<strong>de</strong>nen Mo<strong>de</strong>llversion nach einer<br />
Mo<strong>de</strong>llän<strong>de</strong>rung gleiche Berechnungen auch unter Einbeziehung von Großflä<br />
chenschalungen durchführte. Abbildung 14 zeigt, daß allein durch diese Mo<br />
<strong>de</strong>llän<strong>de</strong>rung eine Verringerung <strong>de</strong>r Soll-1st-Abweichung bis über 16 % bei<br />
<strong>de</strong>n Betonarbeiten für Kanäle und Bo<strong>de</strong>nplatten erreicht wird<br />
Die Baustelleneinrichtung ist jedoch nicht nur entschei<strong>de</strong>nd aufgrund ihres<br />
Einflusses auf <strong>de</strong>n Arbeitszeitbedarf, son<strong>de</strong>rn sie ist auch als Aufwands<br />
faktor zu berücksichtigen. Dabei ist davon auszugehen, daß größere Geräte<br />
in <strong>de</strong>r Regel nicht gekauft wer<strong>de</strong>n, so daß in <strong>de</strong>r Preisdatei nur eine Leih<br />
gebühr in Ansatz zu bringen ist.
120<br />
lOU: Erdnrbeiten u. Fununmente<br />
- 81 -<br />
Abbildung 14: Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Soll-Ist Abweichung bet <strong>de</strong>n Schal arbeiten nach<br />
Erstellung neuer Funktionen<br />
5.3 Preisberechnung<br />
Crunds ä t z l i ehe Vorbehalte, di e methodi sehen Ansätzen zur Voraus schätzung<br />
o<strong>de</strong>r -ermittlung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes entgegengebracht wer<strong>de</strong>n, setzen<br />
in <strong>de</strong>r Regel in erster Linie bei <strong>de</strong>r Preisermittlung an. Es wird argumen<br />
t i er t , daß tat säch 1i eh vom Bauherrn zu zahlen<strong>de</strong>n Prei se ni eht zu er<br />
mitteln seien, da die Variationsbreite sowohl regional als auch bauspezt<br />
fi seh sehr groß sei und zu<strong>de</strong>m aufgrund <strong>de</strong>r ex ante Bet rachtunq ei ne ohne<br />
hin problematische Vorhersage <strong>de</strong>r zukünftigen Preisentwicklung notwendig<br />
sei.<br />
Derartige Argumente müssen grundsätzlich als zutreffend bezeichnet wer<strong>de</strong>n,<br />
und eine große Zahl von Berichten über teilweise extreme Uberschreitungen<br />
<strong>de</strong>r Kostenvoranschläge unterstützen diese Argumentation. Die on<br />
<strong>de</strong>s hier vorgestellten Berechnungsverfahrens Grun<strong>de</strong><br />
"er voll variabl und vom Rechenprogramm al1e<br />
unterschiedlichen Einzelmaterialien sowie <strong>de</strong>r als selbstän-<br />
dige Datei bei je<strong>de</strong>m Kalkulationslauf durch das a<strong>de</strong>n wi und<br />
unabhängig vom Programm geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n kann. Diese on erlaubt es<br />
unterschiedlichen Benutzern, jeweils spezie11, spiel se regi
- 82 -<br />
angepaßte Preisdateien zu verwen<strong>de</strong>n. Ebenso ist es möglich, eine spezifi<br />
sche Prei sdatei für ei n ei nze 1nes Bauvorhaben zu erste '11 en , in di e sukzes<br />
sive die tatsächlichen, vom Bauherrn ausgehan<strong>de</strong>lten Angebotspreise einge<br />
speichert wer<strong>de</strong>n, während bei <strong>de</strong>n noch nicht festgelegten Positionen wei<br />
terhin mi Durchschnittspreisen gerechnet wird. Somit läßt sich im Laufe<br />
<strong>de</strong>s Entscheidungsprozesses aufgrund <strong>de</strong>r spezifischen Anpassungsmöglichkeit<br />
eine steigen<strong>de</strong> Kalkulationsgenauigkeit erzielen, die sich in <strong>de</strong>r zeitli<br />
chen Folge auch <strong>de</strong>m sich än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Informationsbedürfnis <strong>de</strong>s Anwen<strong>de</strong>rs an<br />
paßt.<br />
Während ei ne 1ängerfri sti ge Fortschreibung ei nma1 berechneter Bauka lkul a-'<br />
onsdaten auf <strong>de</strong>r Basis von In<strong>de</strong>xberechnungen abgeiehnt wer<strong>de</strong>n muß, da<br />
die Preisentwicklung einzelner Baustoffe zum Teil sehr unterschiedlich ist<br />
und In<strong>de</strong>xzahlen auch nur fUr einen Teil <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Landwirtschaft verwen<br />
<strong>de</strong>ten Baustoffe veröffent1i cht wer<strong>de</strong>n /144/, können kurzfri sti ge Fort<br />
schreibungen durchaus zu befriedigen<strong>de</strong>n Ergebnissen verhelfen. Eine <strong>de</strong>rar<br />
tige, kurzfristige Fortschreibung sollte dabei allein die voraussichtliche<br />
Preisentwicklung zwischen <strong>de</strong>m Kalkulationszeitpunkt und <strong>de</strong>r jeweiligen<br />
Rechnungsstellung ab<strong>de</strong>cken, wodurch mögl iche Berechnungsfehler sehr klein<br />
gehalten wer<strong>de</strong>n können.<br />
Eine zusätzliche Preisunsicherheit entsteht durch die meist. zu ve rze i ch<br />
nen<strong>de</strong>n Abweichungen <strong>de</strong>s tatsächlich bezahlten Preises vom jeweiligen Li<br />
st.enp r-ei s , da <strong>de</strong>rartige Schwankungen in erster Linie vom Verhandiungsge<br />
schick <strong>de</strong>r Vertragspartner abhängen.<br />
Bei <strong>de</strong>r Festsetzung <strong>de</strong>r Arbeitslöhne ist es nicht möglich, die verschie<strong>de</strong><br />
nen Stun<strong>de</strong>nsätze unterschiedlich qualifizierter t.skräfte direkt zu<br />
verrechnen, da Baust.ellenarbei in <strong>de</strong>r Regel als Gruppenarbei ausgefUhrt.<br />
wird, so daß eine gen aue Differenzierung und Zuweisung von Arbeiten zu be<br />
stimmten Arbeitskräften im Normalfall nicht möglich ist. (KASSEL 1973<br />
/711). Vielmehr ist aus <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Lohnsätzen ein Mittellenn unter<br />
Berücksichtigung <strong>de</strong>r Zusammensetzung einer Arbeitsgruppe zu bil<strong>de</strong>n es<br />
in Tabelle 11 beispielhaft durchgeführt wur<strong>de</strong>.<br />
Eine reine Verrechnung <strong>de</strong>r tariflichen Stun<strong>de</strong>n t chn sa t z e kann dabei keine<br />
befriedigen<strong>de</strong>n Ergebnisse bringen, da <strong>de</strong>m Unternehmer zusätzlich erhebli<br />
che Lohnnebenkosten entstehen und er zu<strong>de</strong>m in seiner Angebotskalkulation<br />
beispielsweise auch die Kosten <strong>de</strong>r Unterhaltung <strong>de</strong>s Bauhofes nbeziehen
- 83 -<br />
Tabelle 11: Mittellohnberechnung (Beispielsberechnung nach Erhebung 1983)<br />
Zusammensetzung <strong>de</strong>r Gruppe Stun<strong>de</strong>nlohn (DM) Summe (DM)<br />
1 Polier 44,-- 44,--<br />
1 Kranführer 40,50 40,50<br />
4 Facharbeiter 39,40 157,60<br />
1 Bauwerker 35,80 35,80<br />
7 Arbei ter Summe (DM) 277,90<br />
Mi tte11ohn (DM) 39,70<br />
muß. Die bei einer Auftrag?vergabe auf Regiestun<strong>de</strong>nbasis in Rechnung gestellten<br />
Löhne stellen hingegen einen realistischen Ansatz dar, da \10m Unternehmer<br />
hier bereits <strong>de</strong>rartige Zuschläge integriert wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n im<br />
Abschnitt 6. beschriebenen Kalkulationen wur<strong>de</strong>n aus diesem Grun<strong>de</strong> die im<br />
Frühjahr 1983 für Regiearbeiten im Raum Freising-Erding durchschnittlich<br />
angesetzten Stun<strong>de</strong>nlöhne zugrun<strong>de</strong>gelegt. Bevor auf diese Berechnungen eingegangen<br />
wird, sind jedoch noch die Ergebnisse einer Gesamtüberprüfung <strong>de</strong>r<br />
Kalkulationsbasis zu erläutern.<br />
5.4 Vergleich realer Bauaufwendurrqert mit kalkulatorisch ermittelten Daten<br />
Die Überprüfung <strong>de</strong>r Gültigkeit <strong>de</strong>r Kalkulationsbasis sollte zweckmäßigerweise<br />
auf Grundlage von Ist-Daten durchgeführt wer<strong>de</strong>n, die unabhängig von<br />
<strong>de</strong>njenigen Daten erfaßt wur<strong>de</strong>n, die bei <strong>de</strong>r Erstellung <strong>de</strong>r Kalkulationsbasis<br />
zugrun<strong>de</strong>lagen. VöLKL 1983 /117/ unternahm es im Rahmen einer Diplomarbeit,<br />
einen Vergleich anhand von zwei Bullenmastställen anzustellen_<br />
Die Ist-Daten für diesen Vergleich wur<strong>de</strong>n aus Abrechnungen und Aufzeichnungen<br />
<strong>de</strong>r Bauherrn gewonnen. Mangels verfügbarer Aufschreibungen bzw.<br />
Kalkulationsunterlagen mußte dabei bei einem Stall auf <strong>de</strong>n Vergleich <strong>de</strong>r<br />
Aufwendungen für die Wän<strong>de</strong> und das gesamte Dach und auch beim zweiten Objekt<br />
auf die Kalkulation <strong>de</strong>s Dachtragwerkes verzichtet wer<strong>de</strong>n. Für die<br />
verbleiben<strong>de</strong>n Bauteilgruppen stellte VöLKL insgesamt eine Abweichung <strong>de</strong>r<br />
Ka lkulati onsergebni sse auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Bautei lqruppen von <strong>de</strong>n Ist-Daten<br />
von 6,37 bzw. 15,08 % fest. In Absolutbeträgen ausgedrückt sind dies ca ,<br />
2.000 bzw. 19.400 DM. Die <strong>de</strong>taillierte Analyse <strong>de</strong>r Ka l kul at i onspr-ot.okol l e
- 84 -<br />
zeigte, daß die Abweichungen in einzelnen Bereichen sogar noch erheblich<br />
höher lagen und sich im Gesamtergebnis Mo<strong>de</strong>llüber- und -unterschätzungen<br />
teilweise neutralisieren. Insbeson<strong>de</strong>re im zweiten Stall ist jedoch ein<br />
Teil <strong>de</strong>r Abweichungen auf übertragungsfehler bei einigen Mo<strong>de</strong>llen zurück<br />
geführt wer<strong>de</strong>n, die nachträglich beseitigt wer<strong>de</strong>n konnten.<br />
Neben <strong>de</strong>r Kal kulation mit Mo<strong>de</strong>llen für gesamte Bauteilgruppen führte VöLKL<br />
auch noch Vergleichsuntersuchungen auf <strong>de</strong>r vierten Kaikulationsebene <strong>de</strong>r<br />
Bauteile durch. Die Soll-Ist Abweichung verringerte sich durch diese zeit<br />
aufwendigere Berechnungsweise auf 2,97 bzw. 10,88 % was von <strong>de</strong>r grundsätz<br />
lichen Konzeption <strong>de</strong>s Kalkulationssystems her ten<strong>de</strong>nziell auch zu erwarten<br />
war.<br />
Aus <strong>de</strong>r Aufschlüsselung <strong>de</strong>r Gesamtabweichungen von 10,88 % beim zweiten<br />
Stall in Abbildung 15 wird <strong>de</strong>utlich, daß insbeson<strong>de</strong>re im Bereich <strong>de</strong>r Erd<br />
arbeiten und bei <strong>de</strong>r Berechnung <strong>de</strong>s Plattenbelages für <strong>de</strong>n Futtertisch<br />
noch eine erhebliche überschätzung <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lle zu verzeichnen war. Trotz<br />
dieser Berechnungsfehler beträgt jedoch die letztlich für <strong>de</strong>n Gesamtver<br />
gleich ausschlaggeben<strong>de</strong> relative Abweichung bei <strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen nur<br />
1,08 bzw. 2,01 %, da die Anteile <strong>de</strong>r jeweiligen Bereiche am Gesamtinvesti<br />
tionsbedarf nur sehr gering sind. Für Erdarbeiten, Fl ießenleger- und Putz<br />
arbeiten wur<strong>de</strong>n zu<strong>de</strong>m inzwischen neue Arbeitszeitfunktionen erstellt, auf<br />
die VöLKL noch nicht zurUckgreifen konnte. In <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Bereichen sind<br />
auch die absoluten Abweichungen mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r gering, währ'end <strong>de</strong>r r e l a<br />
tive Fehler <strong>de</strong>s Kalkulationsergebnisses einzelner Bereiche maximal 3,1 %<br />
beträgt.<br />
Die Überprüfung <strong>de</strong>r Kalkulationsmetho<strong>de</strong> an hand eines So l l r Ls t.-Ye rq l e t che s<br />
bei zwei abgerechneten Bauvorhaben kann sicherl ich nicht verallgemeinert<br />
wer<strong>de</strong>n, da die Bandbre t t.e möglicher Einfiußfaktoren auch nicht annähernd<br />
durch zwei Stallbaulösungen erfaßt wer<strong>de</strong>n kann. Doch zeigt die Untersu<br />
chung' neben einigen nicht zu vernachlässigen<strong>de</strong>n Fehlern im System doch<br />
insgesamt, daß zumin<strong>de</strong>st ten<strong>de</strong>nziell mit <strong>de</strong>m Kalkulationssystem ein gang<br />
barer Weg beschritten wur<strong>de</strong>, Somit kann insgesamt von einer tragfähigen<br />
Mo<strong>de</strong>llbasis fUr <strong>de</strong>tailliertere Untersuchungen Uber die Zusammensetzung <strong>de</strong>s<br />
Investitionsbedarfes von ausgewählten Milchviehställen ausgegangen wer<strong>de</strong>n,<br />
die im Anschluß erfolgen sollen.
- 86 -<br />
Vergleich alternativer baulicher und verfahrenstechnischer Losuriqen<br />
<strong>de</strong>r Milchviehhaltung<br />
Die Milchviehhaltung stellt in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland nach wie vor<br />
einen <strong>de</strong>r Haupterwerbszweige <strong>de</strong>r landwirtschaft dar, obwohl die Zahl west<br />
<strong>de</strong>utscher Betriebe mit Milchviehhaltung in <strong>de</strong>n letzten zehn Jahren um rund<br />
30 % auf ca. 440.000 geschrumpft ist. Der Milchkuhbestand erhöhte sich je<br />
doch gleichzeitig geringfügig um 0,8 %, so daß sich folglich eine nicht<br />
unerhebliche Konzentration in <strong>de</strong>r Milchviehhaltung ergibt. So hat sich die<br />
Zahl <strong>de</strong>r Betriebe mit Bestän<strong>de</strong>n von 20 bis 50 Milchkühen von 1971 bis 1981<br />
mehr als verdoppelt, während die Zahl <strong>de</strong>r Betriebe mit mehr als 50 Milch<br />
kühen sich sogar versechsfacht hat. Dabei ist in dieser Größenklasse eine<br />
beson<strong>de</strong>rs ausgeprägte Strukturentwicklung zu bemerken. So kamen nach<br />
lüCKEMEYER 1982 /87/<br />
1973 - 1975 rund 500 Bestän<strong>de</strong>,<br />
1975 - 1977 rund 1000 Bestän<strong>de</strong>,<br />
1977 1979 rund 1800 Bestän<strong>de</strong> und<br />
1979 1980 in nur einem Jahr 1160 Bestän<strong>de</strong><br />
mit mehr als 50 Kühen hinzu.<br />
Gleichwohl ist eine Überbewertung dieser Entwicklung nicht angebracht, da<br />
trotz<strong>de</strong>m heute nur beschei<strong>de</strong>ne 1,5 % aller mi lchviehhalten<strong>de</strong>n Betriebe<br />
mehr als 50 Kühe halten /30/. Der Verl auf <strong>de</strong>r Grenzkostenkurven und <strong>de</strong>r<br />
Grenzarbeitsbelastung bestimmen bisher <strong>de</strong>n Trend zu immer größeren Produk<br />
tionseinheiten. Bezüglich <strong>de</strong>r zukünftigen Entwicklung sprechen jedoch vie<br />
le Anzeichen dafür, daß die Rahmenbedingungen <strong>de</strong>r Produktion dahingehend<br />
geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, daß zwar die Konzentration in <strong>de</strong>r Milchviehhaltung weiter<br />
zunehmen wird; die Bestan<strong>de</strong>sgrößen aber nicht vornehml ich im Bereich <strong>de</strong>r<br />
oberen Größenklassen bis 100 Tiere und darUberhinaus wachsen wer<strong>de</strong>n. Zu<br />
erwarten<strong>de</strong> administrative Maßnahmen zur Mengensteuerung /26,120/ wer<strong>de</strong>n<br />
voraussichtlich die Rentabilität <strong>de</strong>r Milcherzeugung bei Neuinvestitionen<br />
in größere Bestän<strong>de</strong> so drastisch einschränken, daß sich die Milchviehhal<br />
tung schwerpunktmäßig auf <strong>de</strong>n Bereich zwischen 30 und 60 KUhen einpen<strong>de</strong>ln<br />
dUrfte.
- 87 -<br />
Bei ei ner wei terhi n abzusehen<strong>de</strong>n Modifi zi erung <strong>de</strong>r staatl iehen Investi<br />
tionsför<strong>de</strong>rung wird die einzelbetriebliche Entscheidung über die<br />
ßenordnung und Ausgestaltung von Investitionsvorhaben zukünftig noch stär<br />
ker durch das erfor<strong>de</strong>rliche Finanzierungsvolumen und die Rentabilität<br />
Kapitaleinsatzes bestimmt. Da das Investitionsvolumen in erster linie<br />
<strong>de</strong>r real isierten Bestan<strong>de</strong>sgröße abhängig ist, so l Hi fe <strong>de</strong>r<br />
voran stehen<strong>de</strong>n Abschnitten beschriebenen Metho<strong>de</strong> in einem zweiten<br />
dieser Arbeit zunächst ein Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes<br />
ten für Mil chviehbestän<strong>de</strong> Größenordnung und unterschiedl<br />
eher Haltungsverfahren vorgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Darüberhinaus wird die naturale und monetäre Bedarfsstruktur eines Inve<br />
stitionsobjektes auch entschei<strong>de</strong>nd durch die bauorganisatorischen Rahmenbedingungen,<br />
die Pre t sver-hä l t.n.ts se und die Detailplanung bestimmt. Daher<br />
sollen zu<strong>de</strong>m vergleichen<strong>de</strong> Untersuchungen über die Auswirkungen von Än<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r PIanungs 1ö sunqen und Rahmendaten auf di e Höhe und Zusammenset<br />
zung <strong>de</strong>s naturalen und monetären Aufwan<strong>de</strong>s angestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
1 Beseh reibung <strong>de</strong>r Vergleichsansatze<br />
Konkrete Bauplanungen können sich nur unter BerUcksichtigung <strong>de</strong>r<br />
sehen Rahmenbedi ngungen ei nes Standortes vollziehen. Da bei <strong>de</strong>r Planung<br />
<strong>de</strong>r hier berechneten Alt erna t i ven von fiktiven Bausituationen auszugehen<br />
war, mußte eine Anzahl von Prämissen gesetzt wer<strong>de</strong>n, um die Vergleichbar<br />
keit <strong>de</strong>r Lösungen untereinan<strong>de</strong>r zu gewährleisten. Reale Bausituationen<br />
wer<strong>de</strong>n sich von diesen Planungen mehr o<strong>de</strong>r weniger stark unterschei<strong>de</strong>n, so<br />
daß die angegebenen Daten nur mit Einschränkungen übertragbar sind.<br />
Für die Beispielskalkulationen mußte von <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Planungspraxis sicher<br />
lich nicht überwiegen<strong>de</strong>n Situation eines kompletten, freistehen<strong>de</strong>n Neubaues<br />
ausgegangen wer<strong>de</strong>n. Tatsäch1i eh vo11zi ehen si eh jedoch Neubauplanun<br />
gen meist unter zumin<strong>de</strong>st teilweiser Einbeziehung vorhan<strong>de</strong>ner Gebäu<strong>de</strong>substanz,<br />
beispielsweise zur Unterbringung <strong>de</strong>s Jungviehs o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Mel<br />
trums. Da auch <strong>de</strong>r sehr häufige Anbau an vorhan<strong>de</strong>ne Gebäu<strong>de</strong> nur nach Maßgabe<br />
einer spezifischen Bausituation zu planen ist, wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r<br />
von <strong>de</strong>r oftmals suboptimalen Prämisse eines rechteckigen Gebäu<strong>de</strong>s<br />
durch Iaufen<strong>de</strong>n Außenwän<strong>de</strong>n ausgegangen. Zusätzl ich erfor<strong>de</strong>rl iche<br />
Anlagen wie beispielsweise Bergehallen und Güllebehalter wur<strong>de</strong>n die
PI anungen nicht miteinbezogen .<br />
- 88 -<br />
Die weitere Detailplanung erfolgte insbeson<strong>de</strong>re unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt,<br />
die <strong>de</strong>rzeit im süd<strong>de</strong>utschen Bereich favorisierten Baulösungen in die Pla<br />
nungen mit einzubeziehen, die in <strong>de</strong>r Kostenblockmetho<strong>de</strong> /48/ als <strong>de</strong>m z.Z.<br />
einzigen aktuellen Richtwertekatalog in Deutschland weniger stark berück<br />
sichtigt wer<strong>de</strong>n. Zusätzlich wur<strong>de</strong> ansatzweise versucht, die in <strong>de</strong>n ver<br />
schie<strong>de</strong>nen Projektgruppen <strong>de</strong>s Son<strong>de</strong>rforschungsbereiches 141 "Produktions<br />
techniken <strong>de</strong>r Rin<strong>de</strong>rhaltung" /66/ erarbeiteten Einzelkriterien in die Pla<br />
nungen miteinzubeziehen. Es lassen sich jedoch kaum alle bei einer iso<br />
lierten Betrachtungsweise optimalen Kriterien in einem Gesamtsystem reali<br />
sieren, da doch erhebliche Zielkonflikte zwischen einzelnen Sparten auf<br />
treten, die entsprechen<strong>de</strong> Kompromisse erfor<strong>de</strong>rn. Die <strong>de</strong>n Berechnungen zu<br />
grun<strong>de</strong>liegen<strong>de</strong>n Pläne lassen somit In einigen Bereichen durchaus Verbesse<br />
rungswünsche offen, die jedoch in e r s t e.r Linie von <strong>de</strong>n konkreten Planungs<br />
situationen abhängen.<br />
6..1 Konstruktive Merkmale <strong>de</strong>r äußeren Hülle<br />
Bezüglich <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>hülle wur<strong>de</strong> be i al1en Planungsvaria<br />
ti onen von Baulösungen mit Vollwärmeschutz ausgegangen. Die sogenannten<br />
"Kaltställ e" fl n<strong>de</strong>n In Süd<strong>de</strong>utschI and aufgrund <strong>de</strong>r klimatischen Gegeben<br />
heiten und slcherl ich auch aufgrund persönl icher Präferenzen nur eine<br />
äußerst geringe Verbreitung. Es wur<strong>de</strong>n daher gezielt alle Planungen auf<br />
die in <strong>de</strong>n Untersuchungen von GARTUNG et a l . /48/ nicht berücksichtigten,<br />
aber im süd<strong>de</strong>utschen Bereich absolut vorherrschen<strong>de</strong>n wärmegedämmten Lösun<br />
gen in Mauerwerkausführung abgestellt. Die wirtschaftlich optimalen Dämm<br />
werte können dabei standortspezifisch nach <strong>de</strong>r von ENGLERT 1981 /39/ ent<br />
wickelten Optimierungsmetho<strong>de</strong> berechnet wer<strong>de</strong>n. Unter <strong>de</strong>n im vorliegen<strong>de</strong>n<br />
Planungsfall unterstellten Bedingungen wur<strong>de</strong> ein 36,5 cm starkes Mauerwerk<br />
aus großformatigen Porenziegeln mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,34 W/mK<br />
und im Deckenbereich eine Dämmung aus 6 cm starken Polystyrol-Extru<strong>de</strong>r<br />
schaumplatten (A = 0,041 W/mK) gewählt. Die Dämmplatten wer<strong>de</strong>n dabei di<br />
rekt auf <strong>de</strong>n Bin<strong>de</strong>rn befestigt, so daß sich eine sogenannte "Dach-Decke"><br />
Konstruktion ergibt, die <strong>de</strong>n Einbau einer Trauf-first-Lüftung (Schwer<br />
kraftlüftung) ermcql i cht . Derartige Lüftungsanlagen haben sich trotz<br />
mancher Vorbehalte weitgehend durchgesetzt; im Rahmen <strong>de</strong>r Variation <strong>de</strong>r
- 89 -<br />
Bas I sp 1anungen wur<strong>de</strong>n jedoch auch Berechnungen für Zwangslüftungsanlagen<br />
angestel t.<br />
Als Tragwerkkonstruktion wur<strong>de</strong> einheitlich über alle Stal1größen eine<br />
Kantholzbin<strong>de</strong>rkonstruktion mit 2 o<strong>de</strong>r mehr Stutzen re i her. StaI gewäh1<br />
Stützenkonstruktionen haben allgemein eine sehr weite Verbreitung gefun<br />
<strong>de</strong>n, da sie im Verhältnis zu freitragen<strong>de</strong>n Bauwerken relativ preisgünstig<br />
zu erstellen sind. Stützenfreie Konst.rukt t onen e Leimbin<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r Kasten<br />
träger sind hingegen vor allem im Hinbl ck auf eine erleichterte Wan<strong>de</strong>l<br />
barkeit eines Gebäu<strong>de</strong>s von Interesse. Da im süd<strong>de</strong>utschen Raum aufgrund <strong>de</strong>s<br />
hohen Grünlandanteiles häufig jedoch keine Alternative zur Rindviehhaltung<br />
besteht, wur<strong>de</strong> auf die Berechnung <strong>de</strong>rartiger Konstruktionen verzichtet.<br />
Lediglich für die bei <strong>de</strong>n Anbin<strong>de</strong>ställe wur<strong>de</strong> alternativ auch eine<br />
Gang-nail-Bin<strong>de</strong>rkonstruktion berechnet, wei die geringe Stallbreite von<br />
12 Metern eine verhältnismäßig problemlose und kostengünstige stützen<br />
freie Überspannung ermöglicht.<br />
Die Auswahl <strong>de</strong>r Tragwerkkonstruktion erfolgte zu<strong>de</strong>m unter <strong>de</strong>m Gesichts<br />
punkt <strong>de</strong>r Eigenleistungsfreundl ichkeit verschie<strong>de</strong>ner Konstruktionsarten,<br />
da diesem Bereich gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Landwirtschaft ein beson<strong>de</strong>rer Schwerpunkt<br />
zukommt. Die konstruktiven Details a ller berechneten Alternativen sind so<br />
ausgelegt, daß sie bei durchschnittlichem handwerkl i eher. Geschick in bau<br />
1i eher Se 1bsthi He erstellt wer<strong>de</strong>n können (RITTEL 11041). Unter <strong>de</strong>m Aspekt<br />
<strong>de</strong>r Selbstbaumögl ichkeit sind Holzstützenkonstruktionen <strong>de</strong>n Nord<br />
<strong>de</strong>utschland häufiger anzutreffen<strong>de</strong>n Boxenstän<strong>de</strong>rkonstruktionen 1591 ver<br />
gleichbar, die noch größere Kapitaleinsparungen ermöglichen. Während bei<br />
Stützenkonstruktionen <strong>de</strong>r Stützenabstand 4,6 - 5,0 Meter beträgt, wer<strong>de</strong>n<br />
jedoch bei Boxenstän<strong>de</strong>rkonstruktionen die Stän<strong>de</strong>r auf Liegeboxenbreite ge<br />
setzt, so daß das häufig gegen die im Stallbereich abgestützten Konstruk<br />
tionen angewandte Argument <strong>de</strong>r eingeschränkten Übersicht hier tatsächlich<br />
eine gewisse Berechtigung erhält. Im Stützen s t a l l ist die Einschränkung<br />
<strong>de</strong>r Tierkontrollmäglichkeiten jedoch kaum von Be<strong>de</strong>utung. Die Dimensionie<br />
rung <strong>de</strong>r gesamten Tragwerkkonstruktion und <strong>de</strong>r Gründung erfolgte unter <strong>de</strong>r<br />
Annahme einer Schneelast von 750 N/m2, einer Dachneigung von 25 Grad und<br />
ei ner Dachei n<strong>de</strong>ckung mlt Betondachsteinen . Die gewäh 1te Dachnei gung und<br />
Dachein<strong>de</strong>ckung entspricht sicherlich nicht <strong>de</strong>r wirtschaftlich optimalen<br />
Gebäu<strong>de</strong>p 1anung . Doch ersehe i nen Alternativ1äsungen wi e z . B. Bi<strong>tum</strong>enwe1]<br />
platten für weite Teile Süd<strong>de</strong>utschlands als irrelevant, da für sie auf-
- 90 -<br />
grund mangeln<strong>de</strong>r Anpassung an die gegebenen Hauslandschaften keine Geneh<br />
migung erteilt wird. Baugenehmigungsanträge wer<strong>de</strong>n in elen Regionen Süd<br />
<strong>de</strong>utschlands zunehmend unter <strong>de</strong>m Aspekt <strong>de</strong>r landschaftsgerechten Bauweise<br />
beurteil, da e sbezüql i ch in vergangenen ,Jahrzehnten .T erhebliche<br />
"Sün<strong>de</strong>n" begangen wur<strong>de</strong>n. Di e resul tieren<strong>de</strong>n Vorschriften zur Bauausfüh-<br />
rung implizieren jedoch oftmals einen so erhebli Anstieg <strong>de</strong>r Investi<br />
ti ansaufwendungen s daß tei lwei se r e a1e Wettbewerbsverzerrungen sehen<br />
verschie<strong>de</strong>nen Standorten resultieren können (vergI. Kap. 6.<br />
Die angenommene Schneelast entspricht durchschnittlichen klimati Be<br />
dingungen. In <strong>de</strong>n schneeträchtigeren Lagen Oberbayerns o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Oberall<br />
gäus können die Schneelasten jedoch auf 2000 N/m2 und mehr anstei so<br />
daß hier erhebliche Verstärkungen <strong>de</strong>r gesamten Tragwerkkonstruktion not<br />
wendig wer<strong>de</strong>n. Die Ableitung <strong>de</strong>r auftreten<strong>de</strong>n Kräfte in <strong>de</strong>n Untergrund er-<br />
folgt bei a l l gewählten Konstruktionen über Stahlbetonstiltzen Außen-<br />
mauerwerk und nach Spannweite zwei bi s vier Pen<strong>de</strong>l stiltzenreihen<br />
Holz im Stal nneren<br />
Kennzeichen <strong>de</strong>r hier zur Anwendung gelangten Kalkulationsmetho<strong>de</strong> ci<br />
exakte Berechnung aller einzelnen zur Erstellung eines Gebäu<strong>de</strong>s<br />
lichen Schritte. Die zu diesem Zweck in Mo<strong>de</strong>llform realisierte Defi<br />
<strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong>liegen<strong>de</strong>n Tragwerke mit allen konstruktiven Details fußt<br />
auf geprüften statischen Berechnungen für alle verschie<strong>de</strong>nen Spannweiten,<br />
die aus <strong>de</strong>n einzelnen Stallplanungen resultierten. Eventuel<br />
Abweichungen <strong>de</strong>r hier unterstellten Stallbreiten von <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Statik zug<br />
run<strong>de</strong>liegen<strong>de</strong>n Maßen sind so geringfilgig, daß sie statisch nicht relevant<br />
sind und somit auch keine Än<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>n Material tten e rfor-:<br />
<strong>de</strong>r I i eh wur<strong>de</strong>n.<br />
Die Eingrenzung <strong>de</strong>r Planungslösungen auf diese Vorgaben erschien notwendig,<br />
um <strong>de</strong>n Umfang dieser Arbeit zu beschränken. Die Metho<strong>de</strong> ist prinzipiell<br />
jedoch in <strong>de</strong>r Lage, auch für beliebige an<strong>de</strong>re Planungen entspre<br />
chen<strong>de</strong> Aussagen zu treffen.
- 92 -<br />
aufgrund verbesserter arbei tswi rtschaft1ieher 8edi ngungen im Anbi n<strong>de</strong>sta 11<br />
aligemein die Grenze zwischen bei<strong>de</strong>n Systemen bei ca. 40 Kühen gezogen<br />
wird (WENNER et al. 1980/122/, KOLLER et al. 1979/77/).<br />
Neueste Untersuchungen über <strong>de</strong>n Arbeitszeitbedarf von AUERNHAMMER 1982 /9/<br />
und JONGEBREUR et.a1. ]982 /68/ kommen zu <strong>de</strong>m Ergebnis, daß Anbin<strong>de</strong>ställe<br />
bei entsprechen<strong>de</strong>r technischer Ausrüstung hinsichtlich <strong>de</strong>s Arbeitszeitbe<br />
darfes bis zu 50 sogar 60 Kuhplätzen <strong>de</strong>n Liegeboxenlaufställen über<br />
legen sind. Die nie<strong>de</strong>rländische Untersuchung stellt weiterhin fest, daß<br />
Anbin<strong>de</strong>ställe <strong>de</strong>n Laufställen auch im Kapitalbedarf noch bei 60 Kühen mit<br />
Nachzucht überlegen sind B.a.O., lOg).<br />
Ten<strong>de</strong>nziel erhält <strong>de</strong>r Anbin<strong>de</strong>stall somit wie<strong>de</strong>r eine steigen<strong>de</strong> Wettbe<br />
werbsfähigkeit, so daß' die beispielsweise von HUFFMEIER 1980 vertretene<br />
Ansicht, daß "Neubauten von Anbin<strong>de</strong>ställen aus e rbe t t swi r t schaf t l t chen ,<br />
produktionstechnischen und Kostengrün<strong>de</strong>n nicht vertretbar" seien (/62/,<br />
S. , nicht als Maxime bei <strong>de</strong>r Planung <strong>de</strong>r zu berechnen<strong>de</strong>n Alternativen<br />
ge lten konnte .<br />
. 3 Anbm<strong>de</strong>ataltvar-Ianten<br />
Aufbauend auf diese Uberlegungen wur<strong>de</strong>n in die Berechnungen auch zwei<br />
Anb ln<strong>de</strong>stalle für 20 bzw. 40 Milchkühe mit weiblicher Nachzucht aufgenom<br />
men (Abb. 17 u. 18).<br />
Die Standplatzausbildung orientiert sich im wesentlichen an <strong>de</strong>n auf Unter<br />
suchungen verschie<strong>de</strong>ner Autoren /86,89,90/ ba sieren<strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen, di e<br />
BOXBERGER 1983 /22/ an einen verbesserten Kurzstand stellt (Abb. 16):<br />
- Standplatzlänge 165 cm + 100 cm Treibmistkanalbreite<br />
- Standplatzbreite ]]5 cm<br />
- Futterkrippe mit flexibler Rückenwand; Krippensohle ]2 cm über Stand-<br />
platzniveau<br />
- Kuhtrainer<br />
- Liegefläche mit Gummimatte<br />
Die heute allgemein übliche Gruppenhaltung <strong>de</strong>r weiblichen Nachzucht mit
Knppe mit<br />
flexibler Rückwand<br />
elcsfischer<br />
Standbelag<br />
- 93 -<br />
Kuhtrainer 3-4cm über Wi<strong>de</strong>rrist<br />
( hochziehbcr. 60 crn hinter<br />
Krippenkerne l<br />
Abbildung 16: Einrichtungen und Maße <strong>de</strong>s Kurzstan<strong>de</strong>s für Kühe<br />
(Quelle: Boxberger /22/)<br />
Ausnahme <strong>de</strong>r Biestmi 1chkäl ber erwei st sich bei ei nem Milchkuhbestand<br />
nur 20 Tieren als problematisch, da die erfor<strong>de</strong>rlichen Min<strong>de</strong>stgruppengr6<br />
ßen in einer Altersstufe kaum zu realisieren sind,<br />
Daher wur<strong>de</strong> im kleineren Anbin<strong>de</strong>stall eine Standplatzfixierung <strong>de</strong>s Jung<br />
viehs mit einer speziellen Vertikal-Anbin<strong>de</strong>vorrichtung ab einem Alter von<br />
ca , Wochen ei ngep1ant , Der Größenentwi ck1ung <strong>de</strong>r Tiere wird bei di eser<br />
Haltungsform durch eine schräge Anordnung <strong>de</strong>s Treibmistkanals und somit<br />
kontinuierlicher Verlängerung <strong>de</strong>s Standplatzes Rechnung getragen,<br />
Im Anbin<strong>de</strong>stall für 40 Milchkühe hingegen wur<strong>de</strong>n -w t e in <strong>de</strong>n Laufställen<br />
auch- zwei Jungviehsammelbuchten mit Spaltenbo<strong>de</strong>nbelag für Tiere von 4 bis<br />
14 Monaten und ab 14 Monaten bis zur Hochträchtigkeitsphase eingeplant,<br />
Für die Kalbinnen wur<strong>de</strong> dabei unterstellt, daß sie bereits einige Wochen<br />
vor <strong>de</strong>m Abkalbetermin einen festen Standplatz erhalten, so daß die Plätze<br />
fUr Kalbinnen auch als Kurzstän<strong>de</strong> ausgelegt wur<strong>de</strong>n, Die Dimensionierung<br />
dieser Buchten erfolgte ebenso wie die Planung <strong>de</strong>r Kälberplätze nach Maß<br />
gabe <strong>de</strong>r Arbeitsblätter <strong>de</strong>r ALB-Bayern /134/,<br />
<strong>de</strong>s
- 95 -<br />
Im Bereich <strong>de</strong>r Kälber bis zu 4 Monaten konnte die sehr kostenintensive<br />
und oft problematische vollständige Abtrennung verzichtet wer<strong>de</strong>n, da alle<br />
Gebäu<strong>de</strong> ais wärmegedämmte Ställe geplant wur<strong>de</strong>n< Zur Verhin<strong>de</strong>rung schädl<br />
eher Zuglufteinflüsse ist lediglich eine Abschirmung <strong>de</strong>r Kalberbuchten 1m<br />
Bo<strong>de</strong>nbereich erfor<strong>de</strong>rlich<<br />
Die Nebenräume wur<strong>de</strong>n aus IUftungstechnischen GrUn<strong>de</strong>n nach Mtiglichkett<br />
angeordnet, daß die Abschlußwan<strong>de</strong> mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r in einer Flucht stehen<<br />
Die Min<strong>de</strong>stabmessungen <strong>de</strong>r Milch- und Installationsräume wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>n<br />
Vorgaben <strong>de</strong>s ALB-Blattes 02
6.1.4 Laufstallvarianten<br />
- 96 -<br />
Laufstallanlagen für Milchkühe wer<strong>de</strong>n heute in <strong>de</strong>r überwiegen<strong>de</strong>n Zahl <strong>de</strong>r<br />
Fälle als Liegeboxenlaufställe ausgerichtet, während die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r<br />
Freßboxenställe vornehmlich auf Umbaulösungen beschränkt ist /9,116/. Im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Vergleiches von Ställen für verschie<strong>de</strong>ne Bestan<strong>de</strong>sgrößen wur<strong>de</strong>n<br />
daher nur Liegeboxenlaufställe aufgenommen.<br />
In <strong>de</strong>r Größenordnung von 40 Mi lchkühen mit Nachzucht haben sich im süd<br />
<strong>de</strong>utschen Bereich in erster Linie die zweireihigen und dreireihigen Auf<br />
stallungsformen mit voll überfahrbarem Futtertisch durchgesetzt (Abb.<br />
und Abb. 20). Zweireihige Lösungen erweisen sich als vorteilhaft hinsicht<br />
lich <strong>de</strong>r Stallübersicht, bedingen jedoch in <strong>de</strong>r Regel einen höheren Fi ä<br />
chenbedarf durch das ungünstigere Verhältnis von Liege- zu Laufflächen.<br />
Unter <strong>de</strong>r Prämisse, daß je<strong>de</strong>m Tier ein Freßplatz zur Verfügung gestell<br />
wer<strong>de</strong>n soll, ist bei Stallplanungen mit drei Liegeboxenreihen <strong>de</strong>r Futter<br />
tisch über <strong>de</strong>n reinen Liegebereich hinaus zu verlängern, da sonst die not<br />
wendige Min<strong>de</strong>stfreßplatzbreite von 65 cm nicht eingehalten wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Hier bietet sich in <strong>de</strong>r Regel die Ausrichtung <strong>de</strong>s Melkstan<strong>de</strong>s in Stall<br />
längsrichtung als Lösung an, wodurch gleichzeitig <strong>de</strong>r häufigen For<strong>de</strong>rung<br />
nach gera<strong>de</strong>m Eintrieb in <strong>de</strong>n Melkstand Rechnung getragen wird (Abä.<br />
Bei zweireihigen Lösungen sollte <strong>de</strong>r Liegeboxenzugang nicht vom Futtergang<br />
aus erfolgen, da die Trennung von Freß- und Liegebereich zu mehr Ruhe tm<br />
Stall führt. Zu<strong>de</strong>m kann die Breite <strong>de</strong>s Laufganges am Futtertisch bei die<br />
ser Boxenanordnung auf ca. 2,80 m eingeschränkt wer<strong>de</strong>n. Im sonstigen wer<br />
<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel am Freßplatz Gangbreiten von ca. 3 m und im Liegebereich<br />
von 2,20 m empfohlen, wobei sich die genauen Abmessungen nach <strong>de</strong>n Körper<br />
maßen <strong>de</strong>r jeweiligen Tierrasse ausrichten sollten (BOXBERGER 1983 /22/)*).<br />
Während normalerweise <strong>de</strong>r Milchlagerraum und <strong>de</strong>r Aggregateraum direkt ne<br />
ben <strong>de</strong>m Melkstand plaziert wur<strong>de</strong>, erschien es beim zweireihigen Laufstall<br />
für 40 Kühe sinnvoller, die Nebenräume auf die an<strong>de</strong>re Seite <strong>de</strong>s Futterti<br />
sches zu verlegen, da bei alternativen Lösungen die Diskrepanz zwischen<br />
*) Die in <strong>de</strong>n Planungslösungen vorgegebenen Maße weichen z geringfügig<br />
von <strong>de</strong>n gefor<strong>de</strong>rten Werten ab, da die Außenmaße <strong>de</strong>r Ställe an das Ziegelformat<br />
(36,5x24,Ox23,8 cm) angepaßt wur<strong>de</strong>n.
ausgerüstet;<br />
- 107 -<br />
Ausstattung <strong>de</strong>r Melkstän<strong>de</strong> erfolgte<br />
15 bei<strong>de</strong> ten mi nheiten bestückt wur<strong>de</strong>n.<br />
Fest1egung <strong>de</strong>s und<br />
strukti Auslegung ane Grund l die<br />
darre s ei g festgelegt sind, ist das<br />
nie von <strong>de</strong>n Preisvorgaben abhängi<br />
<strong>de</strong>n i Abschnitt 5.3 nie<strong>de</strong>rgelegten Kriterien<br />
stehen<strong>de</strong>n Berechnungen zugrun<strong>de</strong>liegen<strong>de</strong>n<br />
Aus rüstunc s t.e t 1e n 1 e anbi e t e r sp e z i<br />
au fwei se n, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Bruttopre i<br />
<strong>de</strong>s ßaustoffhan<strong>de</strong>ls im Raum<br />
gewähl . Extrem billige o<strong>de</strong>r teuere<br />
, ob Ka 1<br />
s <strong>de</strong>s marktgängi<br />
o<strong>de</strong>r'<br />
Landwirtschaft nicht ein<strong>de</strong>utig<br />
fur die Pauschalierung<br />
ist es für be t.r i ebswt r t scha f t l i che I
- 109 -<br />
c;<br />
.c<br />
N'"
Anblfl<strong>de</strong>sluli<br />
• Hochzucht<br />
üesumtftbche<br />
15,Gm 1 ;'Kuh rn.KL; 12,Om'jKuh !.'I.xz<br />
Abbildung eich<br />
n<strong>de</strong>stall j<br />
erheb1i<br />
115 -<br />
20 Kühe mit Nachzucht<br />
aufweist.<br />
ußt<br />
Anbill<strong>de</strong>s taH<br />
Kühe- Nachzucht<br />
stärkste Anstieg st<br />
nzelner<br />
Anbin<strong>de</strong>stal , 41<br />
eu Di<br />
s l l e t n Ti erzah1 zur-ückzutuhrnn ,<br />
stark beei<br />
Äncerung <strong>de</strong>r ,Jungviehaufstallungs-<br />
zu <strong>de</strong>r gängigen Aufstallung <strong>de</strong>r Nachzucht in SamneI-:<br />
auf Spa lt.enbo<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> bei d.er Bestan<strong>de</strong>sgr'öße von 20 Kühen aus <strong>de</strong>n<br />
darge'legten Grün<strong>de</strong>n (s,S, 93) eine Anbin<strong>de</strong>haltung eingeplant. Die<br />
AusfUhrung gestaltet sich dadurch relativ kostengUnstiger 1 da<br />
leilaufen<strong>de</strong> Treibmistkanäle und n Querkanalansehluß zu erstel-<br />
während im größeren Anb i n<strong>de</strong> st a11 er un t.e r sch t edl i eh dirnensi 0-<br />
erfor<strong>de</strong>rlich sind. Di Erhöhung <strong>de</strong>s Bauauf-<br />
Uberproporti zur Flächenaus<strong>de</strong>hnung,<br />
zuzuordnen<strong>de</strong> Stallgrundfläche erfährt nur einen<br />
gl Richtung 1st <strong>de</strong>r Zuwachs an Aufwendungen
- 116 -<br />
für e Aufstal ung s owi e für Gitterroste und Spaltenbö<strong>de</strong>n zu beurteilen,<br />
die die nächsthöchsten Zuwachsraten aufwei sen . Hier i die Hauptursache<br />
für die im Vergleich sehr starke Ä,n<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes eben-<br />
f a l s in <strong>de</strong>r Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Aufstallungsform sehen,<br />
Auffall auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite die im Verhäl issehr geringe<br />
gerungsrate bei <strong>de</strong>n Fundamenten und Wän<strong>de</strong>n sowie <strong>de</strong>r Melktechnik, Im letz<br />
teren Bereich ist dieser Umstand vornehmlich darauf zurückzuführen. daß<br />
auch für 20 KUhe bereits ne gewisse Mtn<strong>de</strong>stausstattung technischer<br />
Ei chtung er-fo r<strong>de</strong> r l ich i di sich beim übergang auf 40 Tiere nur<br />
geringem Maße erhöht, Hi wur<strong>de</strong> eine Aufstockung von drei auf vier Melk-<br />
zeuge (+33 unterstellt und die Vakuumversorgung Milchtankgr5ße<br />
sprechend angepaßt, wodurch sich mit ,6 % ein fast analoger Zuwachs 'im<br />
Investitionsbedarf ergibt<br />
Bei <strong>de</strong>n Wän<strong>de</strong>n und Fundamenten hi ngegen wi rd <strong>de</strong>r wesent -Iich geri ngere<br />
wachs an Wandflächen im Verhältnis zur Vergrößerung <strong>de</strong>r Grundrißfläche<br />
<strong>de</strong>utlich, Die Gesamtlänge <strong>de</strong>r Außenwän<strong>de</strong> nimmt um 45,6 , d i <strong>de</strong>r Innen-<br />
wän<strong>de</strong> um % zu, während e Stallgrundfläche um 66,6 % ansteigt. Dabei<br />
ist zu erwähnen, daß im Anbin<strong>de</strong>stall für 40 Kühe Vlie in a l l<br />
größeren 1en eine prozessorgesteuerte Kraftfutterabrufanlage und<br />
sprechend ein "Nanaqement.r-aum'' zur Aufnahme <strong>de</strong>r Steuerungs- und Uberwa<br />
chungseinheit eingeplant wur<strong>de</strong>, Die zusätzliche FUtterungsanlage ist eben<br />
falls mit ausschlaggebend für die Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s prozentualen Anteils <strong>de</strong>r<br />
einzelnen Baugruppen am Gesamtinvestitionsbedarf, Darüberhinaus spiegelt<br />
sich in <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r ationen <strong>de</strong>r differieren<strong>de</strong> Aufwandszuwachs<br />
bei <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Baugruppen wie<strong>de</strong>r<br />
Aufschlüsselung <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rlichen Aufwandsmengen an Materialien und<br />
Arbeitszeit, <strong>de</strong>ren prozentuale Anteile sich analog zu <strong>de</strong>m verän<strong>de</strong>rten<br />
Stellenwert <strong>de</strong>r Bauteilgruppen verschieben, erfolgt einem Gesamtver<br />
gleich aller berechneten Al t e r-nat t in Abschnitt 6,3, Zuvor soll jedoch<br />
n <strong>de</strong>r Darstel ung <strong>de</strong>r Einzelergebnisse mit <strong>de</strong>n Laufstallhaltungen fortge<br />
fahren wer<strong>de</strong>n,
Uegeboxl!I1laufslull<br />
m, Nacbzucl1l,l reihig<br />
Gesamutäche 557 m 2<br />
15.401' /Kuhm.Nl, l1,7m'/M '.NI<br />
- 120 -<br />
40 Kühe m. """"w,.m,J""""y<br />
G"umtflö,., 630 m'<br />
lS,75m'/luh m.MI;11.901'/1uh<br />
Abbildung 30, Investitionsbedarfes einzelner<br />
Kühe mit Nachzucht, 2reihige lung<br />
Kühe mi Nachzucht, 3reihige Aufstallung<br />
Da bei <strong>de</strong>n unterschiedlichen Aufstallungsarten einige Baugruppen von ihrer<br />
Aus1egung her unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Unterschi e<strong>de</strong> aufwei sen, muß aufgrund <strong>de</strong>s<br />
Gesamtpreises geschlossen wer<strong>de</strong>n, daß sich preissteigern<strong>de</strong> und -senken<strong>de</strong><br />
Einflüsse fast vollständi kompensieren. So liegt <strong>de</strong>r Bauaufwand für die<br />
Fundamentierung <strong>de</strong>r dreireihigen Lösung trotz <strong>de</strong>r etwas geringeren Strei<br />
fenfundamentlänge um 16,4 % über <strong>de</strong>r zweireihigen Lösung, da die verän<strong>de</strong>r<br />
te Tragwerkkonstruktion nicht nur die Gründung einer zusätzlichen StUtzen<br />
reihe im Stall erfor<strong>de</strong>rt, son<strong>de</strong>rn darüberhinaus auch die vor l iegen<strong>de</strong> Sta-;<br />
t i k eine insgesamt größere Auslegung <strong>de</strong>r Bewehrung verlangt, die sich im<br />
Preis entsprechend nie<strong>de</strong>rschlägt (Tab. 15). Dagegen liegt die Bo<strong>de</strong>nplatte<br />
mit <strong>de</strong>n Kanälen im Erstellungsaufwand edriger als bei <strong>de</strong>r zweireihigen
- 121 -<br />
Aufstallungsart, weil die Grundrißfläche etwas kleiner ausfällt und zu<strong>de</strong>m<br />
die Kanäle in <strong>de</strong>r Tiefe voneinan<strong>de</strong>r abweichen, da die Kanaltiefe beim<br />
Treibmistverfahren von <strong>de</strong>r Kanallinge abhängt. FUr Spaltenbö<strong>de</strong>n und Gitterroste<br />
muß hingegen aufgrund <strong>de</strong>r größeren Laufflächen mehr investiert<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei oberfl äch1icher Betrachtung verwun<strong>de</strong>rt zunächst, daß <strong>de</strong>r Investt t tonsbedarf<br />
für das gesamte Dach bei <strong>de</strong>r dreireihigen Alternative niedriger<br />
liegt, obwohl allgemein mit steigen<strong>de</strong>r Spannweite ein überproportionales<br />
Ansteigen <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes erwartet wird. Die aufgrund <strong>de</strong>r Berechnungsmethodik<br />
vorliegen<strong>de</strong> weitere Differenzierung zeigt jedoch, daß vornehml<br />
ich die Größe <strong>de</strong>r Dachfläche ausschlaggebend ist für die Höhe <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Aufwendungen, während <strong>de</strong>r Spannweite hier nur eine unter<br />
geordnete Be<strong>de</strong>utung zukommt. Dies ist insbeson<strong>de</strong>re darauf zurückzuführen,<br />
daß bei <strong>de</strong>n Planungen <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Ställe eine Dachein<strong>de</strong>ckung mit Betondachsteinen<br />
sowie innenseitig eine Voll isolation <strong>de</strong>r Dachflächen unterstellt<br />
wur<strong>de</strong>. Wie aus Tabelle 16 hervorgeht, kommt <strong>de</strong>m Tragwerk bei dieser<br />
im Verhältnis sehr aufwendigen Dachauslegung nur noch eine geringe Be<strong>de</strong>utung<br />
zu. Aber selbst die Aufwendungen fUr die Dachkonstruktion liegen bei<br />
<strong>de</strong>m kürzeren Gebäu<strong>de</strong> trotz <strong>de</strong>r größeren Spannweite geringfügig unter <strong>de</strong>r<br />
Alternativlösung. Die Ursachen liegen In <strong>de</strong>r unterschiedlichen Gewichtung<br />
<strong>de</strong>r aufwandsbestimmen<strong>de</strong>n Parameter wie bei <strong>de</strong>r Besprechung <strong>de</strong>s Mengen- und<br />
Preisgerüstes auf Seite 147noch näher erläutert wird.<br />
Während <strong>de</strong>r Preis für die Traufen-First-Lüftung direkt von Gebäu<strong>de</strong>länge<br />
abhängig ist und folglich im zweireihigen Stall höher liegt, unterschei<strong>de</strong>n<br />
sich die restlichen Baugruppen nur sehr geringfügig voneinan<strong>de</strong>r, so daß<br />
letztlich <strong>de</strong>r bereits angesprochene fast gleiche Investitionsbedarf für<br />
bei<strong>de</strong> Alternativen resultiert.<br />
Etwas an<strong>de</strong>re Verhältnisse sind hingegen bei <strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>n nächstgrößeren<br />
Ställen zu vermerken. In dieser Größenordnung wur<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>r dreireihigen<br />
Standardl ösung ei ne Querauf sta11ung mit kamma rti ger Boxenanordnung durchgeplant.<br />
Es zeigt sich jedoch bereits im Gesamtinvestitionsbedarf, daß<br />
diese Alternative als kostenträchtiger einzustufen ist, wobei jedoch zu<br />
berücksichtigen ist, daß zu<strong>de</strong>m aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Raumzuordnung hier nur<br />
Plätze für 57 Kühe einschI. Nachzucht zur Verfügung stehen. Im Investitionsbedarf<br />
pro Kuhplatz vergrößert sich folglich <strong>de</strong>r Abstand <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n
- 124 -<br />
liegeboxenlnufstall<br />
57Kühe. Nachzucht<br />
üuercutstnllunq<br />
Abbildung 31: eich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelner<br />
1, 60 KUhe mit Nachzucht, 3reihige Aufstal ung<br />
Laufstall, 57 KUhe mit Nachzucht, Queraufstallung<br />
hingegen flur unwesentlich voneinan<strong>de</strong>r.<br />
Neben <strong>de</strong>r Unterschie<strong>de</strong>n, die aus unterschiedlichen Aufstallungsarten r-e<br />
sultierer, ist auch bei <strong>de</strong>n Laufställen f ür Her<strong>de</strong>n mit Nachzucht die Ent<br />
wicklung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes bei wachsen<strong>de</strong>r Bestan<strong>de</strong>sgrbße von Inter<br />
esse, FUr einen <strong>de</strong>rartigen Vergleich eignen sich hier die bei<strong>de</strong>n dreirei<br />
higen Lö';ungen f ür 40 bzw , 60 Milchkühe, <strong>de</strong>nen bei <strong>de</strong>r Planung ein glei<br />
ches Raun-: und Funktionsprogramm zugrun<strong>de</strong> lag (s. Abb . 20 u , Abb . 21). Aus<br />
Spalte 5 <strong>de</strong>r Tabelle 14 auf Seitel18geht bereits hervor, daß <strong>de</strong>r Zunahme<br />
<strong>de</strong>r Zahl <strong>de</strong>r Milchkühe um 50 % nur ein Anwachsen <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes<br />
um 23,6 % gegenübersteht. Umgerechnet auf <strong>de</strong>n Tierbestand resultiert da<br />
raus eine Abnahme <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes pro Kuhplatz von 17,6 %. Die
- 125 -<br />
Degression <strong>de</strong>s Kapitalbedarfes bezogen auf die Grundrißfläche o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n um<br />
bauten Raum nimmt sich hingegen mit 4,5 bzw. 4,4 % erheblich beschei<strong>de</strong>ner<br />
aus, worin sich <strong>de</strong>r im Verhältnis zur Tierzahl stark unterproportional ansteigen<strong>de</strong><br />
Gebäu<strong>de</strong>umfang wie<strong>de</strong>rspiegelt. Verantwortlich fUr die Verschie<br />
bung <strong>de</strong>r Relationen ist dabei einerseits <strong>de</strong>r nicht in gleichem Maße ansteigen<strong>de</strong><br />
Flächenanspruch <strong>de</strong>r Nebenräume und an<strong>de</strong>rerseits die beim Stall<br />
fUr 40 KUhe aufgrund <strong>de</strong>r Planungsvorgaben verbleiben<strong>de</strong> zusätzliche Jung<br />
viehbucht, die im größeren Stall kaum mehr ins Gewicht fällt. Die Bemessung<br />
<strong>de</strong>r St.el l anqe und <strong>de</strong>r bei gleicher Breite resultieren<strong>de</strong>n Flächen- und<br />
Faummaße hängt dabei aus sch, i eßl ich von <strong>de</strong>m durch die Kühe beanspruchten<br />
Platz und <strong>de</strong>r Länge <strong>de</strong>s Melkstan<strong>de</strong>s ab, da sich alle an<strong>de</strong>ren Komponenten<br />
auf <strong>de</strong>r resultieren<strong>de</strong>n Fläche verhältnismäßig problemlos anordnen lassen.<br />
Eine <strong>de</strong>ta i 11i erte Untersuchung <strong>de</strong>r Aufwands zunehme anhand <strong>de</strong>r ei nze1nen<br />
Baugruppen zeigt, daß sich <strong>de</strong>r größte Teil <strong>de</strong>r Einzelposten mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r<br />
proportional zur Aus<strong>de</strong>hnung <strong>de</strong>r Grundrißfläche erhöht, die um 185<br />
Quadratmeter o<strong>de</strong>r 29,4 % anwächst (Tab. 18). Der Investitionsbedarf <strong>de</strong>r<br />
Aufstallung hingegen ist weniger von <strong>de</strong>r Stall fläche als vielmehr von <strong>de</strong>r<br />
Tierzahl geprägt und erfor<strong>de</strong>rt daher mit einem Zuwachs von 41 % <strong>de</strong>n mit<br />
Abstand höchsten Mehraufwand. Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite steigt <strong>de</strong>r Investitionsbedarf<br />
für die Fundamente stark unterproportional an, da ein wesentlicher<br />
Teil <strong>de</strong>s Aufwan<strong>de</strong>s aus <strong>de</strong>r sehr kostenintensiven Auslegung <strong>de</strong>r Giebelwandfundamente<br />
resultiert, die bei bei<strong>de</strong>n Lösungen gleich sind. Auch<br />
<strong>de</strong>r Gesamtaufwand fUr die Erstellung <strong>de</strong>r Wän<strong>de</strong> nimmt nur in geringerem<br />
Maße zu, da die Vergrößerung <strong>de</strong>r längsseitigen Außenwän<strong>de</strong> in Relation zur<br />
Gesamtwandfl äche nur ei ne untergeordnete Be<strong>de</strong>utung hat. Im Berei ch <strong>de</strong>r<br />
technischen Einrichtungen für Melken und KraftfutterfUtterung liegt <strong>de</strong>r<br />
Aufwandszuwachs ebenfal1s sehr niedrig, da einerseits für 40 wie 60 Kühe<br />
zwei Kraftfutterstationen ben6tigt wer<strong>de</strong>n und an<strong>de</strong>rerseits die Preisdifferenz<br />
zwisehen <strong>de</strong>m 2x5er und <strong>de</strong>m 2x6er Me Ikstand nicht so stark zu Buche<br />
schlägt.<br />
Insgesamt verschieben sich folglich die Relationen zwischen <strong>de</strong>n einzelnen<br />
Baugruppen in <strong>de</strong>r Weise, daß <strong>de</strong>n Fundamenten und Wän<strong>de</strong>n sowie <strong>de</strong>r technischen<br />
Einrichtung vom Investitionsbedarf her ein geringes Gewicht zukommt,<br />
während di e rest1i ehen Aufwandsträger ei nen zunehmen<strong>de</strong>n Anteil erhalten<br />
wie aus Abbildung 32 <strong>de</strong>utlich wird. Da diese Bereiche jedoch einen Anteil<br />
von ca. 40 % am Gesamtinvestitionsbedarf einnehmen, ergibt sich auch bei
- 128 -<br />
auch für die letzte Gruppe <strong>de</strong>r Laufställe ohne Nachzuchtplätze insgesamt<br />
vier Alternativen bei drei verschie<strong>de</strong>nen Aufstallungsarten durchgerechnet.<br />
Sollen <strong>de</strong>rartige Lösungen mit e i nem durchgehen<strong>de</strong>n, überfahrbaren Futter<br />
tisch und normaler Stallhöhe realisiert werrien , so wird es unter <strong>de</strong>r Prä<br />
misse eines geschlossenen Gebäu<strong>de</strong>s erfor<strong>de</strong>rlich, e Milchviehplätze auf<br />
bei<strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>s Futtertisches anzuordnen. Derartige Lösungen erfor<strong>de</strong>rn<br />
jedoch folglich zu je<strong>de</strong>r Melkzeit ein übertreiben eines Teils <strong>de</strong>r Her<strong>de</strong><br />
über <strong>de</strong>n Futterti sch. In <strong>de</strong>r Planungsalternati Nr. 7 auf Se i tr lC3 wur<strong>de</strong><br />
diese vor allem arbeitswirtschaftlich ungünstige Lösung durch eine<br />
3+1reihige Aufstal1ungsform umgangen, bei <strong>de</strong>r die Kalbinnen und<br />
trockenstehen<strong>de</strong>n Kühe auf <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Melkstand gegenüberliegen<strong>de</strong>n Seite auf<br />
gestallt wer<strong>de</strong>n. Im Vergleich zu <strong>de</strong>m um zwei Plätze kleineren 4reihigen<br />
Laufstall erweist sich diese Lösung zu<strong>de</strong>m sogar' als geringfügig preiswer<br />
ter, wie Tabelle 19 ausweist. In Bezug auf die zur Verfügung stehen<strong>de</strong>n<br />
Kuhplätze ergibt sich sogar eine spürbare Verb i ll i qunq um 3,7 %, die vor<br />
nehmlich aus <strong>de</strong>r Einsparung an Grundrißfläche result.iert, da <strong>de</strong>r Investi<br />
tionsbedarf pro Quadratmeter Stallfläche und pro Vubikmet.er umbauten RilU<br />
mes durchaus über <strong>de</strong>r Alt.ernativlösung liegt..<br />
Die bei<strong>de</strong>n vierreihigen Planungslösungen, die sich von verfügbaren<br />
Vuhplatzzahl um 20 Plät.ze o<strong>de</strong>r 25 % urrt e r s che i <strong>de</strong>n , liegen im Investitions<br />
bedarf dagegen um 20,8 % auseinan<strong>de</strong>r Die Möglichkeiten <strong>de</strong>r Ausnutzung aus<br />
Degressionseffekten durch Planung größer'er Stalleinheiten scheint hier<br />
also im wesentlichen ausgeschöpft zu sein, da sich die prozentuale Ver<br />
t.euerung zunehmend <strong>de</strong>r Aufstockungsrate annähert.. Hingegen wer<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>n<br />
Dat.en <strong>de</strong>r Tabelle 19 die Auswirkungen von Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Aufstallungsart<br />
beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>utlich. So liegt die letzte <strong>de</strong>r geplanten Alternat.iven mit <strong>de</strong>r<br />
kammartigen Anordnung <strong>de</strong>r Liegeboxen bei sonst gleicher Ausstattung um<br />
52.000 DM über <strong>de</strong>r 4reihigen Lösung, wobei jedoch zu berücksichtigen i s t ,<br />
daß bei <strong>de</strong>r Queraufstall ung drei PI ät.ze mehr zur Verfügung stehen. An<strong>de</strong>r<br />
erseits liegt <strong>de</strong>r Inve stt t.on sbeda r f pro Kuhp l a t z bei <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Lösungen<br />
für JOO bzw , 103 Tiere sogar über <strong>de</strong>m e r f or-<strong>de</strong> r l ichen Aufwand <strong>de</strong>r ko s t en<br />
günst.igeren Lösung für 82 Kühe, d.h. durch die geringfügige Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Auf s t a l l unqsa r t t.ritt bei diesen Bestan<strong>de</strong>sgrößen bereit.s eine Umkehrung<br />
<strong>de</strong>s Degressionseffektes auf.
- 130<br />
Oie exakte Analyse <strong>de</strong>r Aufwandsunterschie<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n St ä l l en in <strong>de</strong>r<br />
Größenordnung von 80 Ti eren mi t unt.e rsch t edl i eher Aufsta 11ungsform<br />
daß die Abweichungen keineswegs einheitlich verlaufen. Während im Berei<br />
<strong>de</strong>r gesamten Einrichtungen nur minimale Unterschie<strong>de</strong> auftreten, wird die<br />
Bo<strong>de</strong>nplatte bei <strong>de</strong>r 4reihigen Lösung um 8 %, die Kanalab<strong>de</strong>ckung sogar um<br />
über 18 % teurer (Abb . 33 und Tab. 20). Wie ein Blick auf di bei<strong>de</strong>n<br />
Grundrißzeichnungen (Abb. 23 und Abb. 24) zeigt, ist die Ur s acbe dieser<br />
Abweichung in <strong>de</strong>m ich erfor<strong>de</strong>rlichen Laufgang bei <strong>de</strong>r 4reihigen Al<br />
ternative zu suchen, Die insgesamt größere Stallfläche führt daneben eben<br />
falls zu Mehraufwendungen bei <strong>de</strong>n Erdarbeiten, während an<strong>de</strong>rersei die<br />
Wän<strong>de</strong> insgesamt billiger wer<strong>de</strong>n Dies ist darauf zurückzuführen, daß die<br />
Nebenräume bei <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n vierreihigen Alternativen wesentlich kleiner<br />
ausfallen und aus baulicher Sicht günstiger angeordnet sind, so d?ß gerin<br />
gere Aufwendungen für Ans t ri ch , Putzen und Fliesen q e t ati wer<strong>de</strong>n müssen,<br />
ebenso wie nur eine Decke über <strong>de</strong>n Nebenräumen erfor<strong>de</strong>rlich ist, <strong>de</strong>ren Er<br />
stellungsaufwand jewei1 s mi <strong>de</strong>n Wän<strong>de</strong>n zu einem Posten zusammengefaßt<br />
wur<strong>de</strong>. Entsprechen<strong>de</strong> Einsparungen resultieren auch für die Fundamentierung<br />
<strong>de</strong>r Wän<strong>de</strong>. In bei<strong>de</strong>n Fs l l en sind die Ursachen jedoch nur mittelbar von <strong>de</strong>r<br />
Aufstallungsform abhängig, da sie aus <strong>de</strong>r unterschiedl ichen Größe und<br />
Anordnung <strong>de</strong>r Nebenräume tieren,<br />
Bei <strong>de</strong>n Aufwendungen für die gesamte Dachentellung inclusive <strong>de</strong>r Tr aufen<br />
First-LÜftung weisen bei<strong>de</strong> Sta l l e einen fast i<strong>de</strong>ntischen Investitionsbe<br />
darf auf, da sich preissenken<strong>de</strong> und preissteigern<strong>de</strong> Effekte unter<br />
schiedlichen Stallabmessungen neutralisieren.<br />
Bei <strong>de</strong>n nächstgrößeren lösungen für Bestän<strong>de</strong> von c a . 100 Tieren fin<strong>de</strong>t<br />
sich hingegen auch in diesem Punkt keine Gemeinsamkeit, da die kammartige<br />
Aufstallungsform sowohl 1n Stallängsrichtung als auch in Querrichtuna mehr<br />
atz erfor<strong>de</strong>rt (Abb 25 und 26). Dementsprechend steigt <strong>de</strong>r Investitions<br />
bedarf für alle Baugruppen an mit Ausnahme <strong>de</strong>r Aufstallung und <strong>de</strong>r techni<br />
schen Einrichtungen für Melken und K,'aftfutterversorgung, die fast aus<br />
schließlich durch die Bestan<strong>de</strong>sgröße bestimmt wer<strong>de</strong>n. Da bei <strong>de</strong>r lBsung<br />
mit <strong>de</strong>n querliegen<strong>de</strong>n Boxenreihen die Nebenräume e<strong>de</strong>r ähnlich wie in <strong>de</strong>r<br />
3+1reihigen Alternative für 80 Kühe angeordnet sind, erhöht sich folglich<br />
hier <strong>de</strong>r notwendige Aufwand für die Wän<strong>de</strong> und die Decken <strong>de</strong>r Nebenräume in<br />
Relation zu <strong>de</strong>n Aufwendungen, die bei <strong>de</strong>n 4reihigen Lösungsformen erfor-<br />
<strong>de</strong>rlich si (Tab. 21).
- 135 -<br />
Letztendlich ist im Rahmen <strong>de</strong>r Vergleiche verschie<strong>de</strong>ner Aufstallungsarten<br />
und Bestan<strong>de</strong>sgrößen noch darzulegen, wie sich die Zunahme <strong>de</strong>s Investi<br />
tionsbedarfes bei einer Aufstockung von 80 auf 100 Kühe zusammensetzt<br />
(Abb. 35 und Tab. 22). Der größte Zuwachs wird hier mit 30 % im Bereich<br />
<strong>de</strong>r Melktechnik verursacht. Der hier aus arbeitswirtschaftlichen Grün<strong>de</strong>n<br />
vollzogene Ubergang von einem Fischgrätenmelkstand fUr 2x6 Tiere auf 2x8<br />
Tiere mit <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n technischen Ausstattung fUhrt zu einer überproDortionalen<br />
Erhöhung <strong>de</strong>r Gesamtaufwendungen<br />
tiesumtfläche 903m 2<br />
11.lm fluh<br />
liegebounlaulslall<br />
100 Kühe NI. 4-reih. Aulslllllung<br />
669.800 DM<br />
"'D.3"1occ<br />
\.\",<br />
GesamtHiiche 1110 m 2<br />
11,1 m IKuh<br />
Abbildung 35: Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes einzelne Baugruppen<br />
Laufstall, 80 Kühe ohne Nachzucht, 2 + Zrei ige Aufsta11ung<br />
Laufstal1, 100 I(ühe ohne Nachzucht, 2 + 2re hige Aufstallung
- 137 -<br />
Da sich die gesamte Grundfläche <strong>de</strong>s Stalles mit einem Zuwachs um 22,9 %<br />
nahezu <strong>de</strong>r Erhöhung <strong>de</strong>s Tierbestan<strong>de</strong>s angleicht, 1iegen die meisten an<br />
<strong>de</strong>ren Baugruppen, die entwe<strong>de</strong>r stark flächenabhängig o<strong>de</strong>r tierzahlabhängig<br />
sind, bei einem Zuwachs zwischen 20 und 25 %. Lediglich bei <strong>de</strong>n Wän<strong>de</strong>n und<br />
Fundamenten ist die Steigerung aus <strong>de</strong>n bereits erwähnten Grün<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>rum<br />
geringer. Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Elektro- und Wasserversorgung nimmt mit zunehmen<strong>de</strong>r<br />
Bestan<strong>de</strong>sgröße stetig ab, da die bei allen Ställen gleiche Grundinstallation<br />
vornehmlich ausschlaggebend für die Höhe dieses Aufwandspostens<br />
ist.<br />
Nach<strong>de</strong>m die unterschiedliche Entwicklung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes und<br />
<strong>de</strong>ren Ursachen anhand <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Aufstallungsarten und Her<strong>de</strong>ngrößen<br />
ausführlich dargelegt wur<strong>de</strong>, soll kurz auf die zwei verschie<strong>de</strong>nen Aufstallungsformen<br />
eingegangen wer<strong>de</strong>n.<br />
6.2.4 Vergleich <strong>de</strong>r Aufstallungsformen<br />
Von <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Aufstallungsmöglichkeiten für Milchvieh haben sich<br />
in <strong>de</strong>n letzten Jahren Anbin<strong>de</strong>ställe und Liegeboxenlaufställe als ein<strong>de</strong>utig<br />
favori si erte lösungen durchgesetzt. Sonstige Aufsta 11 ungsformen wie Freßboxenställe<br />
besitzen hingegen nur bei Umbaulösungen eine nennenswerte Be<strong>de</strong>utung<br />
und wur<strong>de</strong>n daher im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt.<br />
Ein Vergleich <strong>de</strong>r Kennzahlen <strong>de</strong>s Anbin<strong>de</strong>stalles für 41 Milchkühe mit <strong>de</strong>n<br />
korrespondieren<strong>de</strong>n Laufställen zeigt, daß <strong>de</strong>r Investitionsbedarf pro Kuhplatz<br />
beim Anbin<strong>de</strong>stall um 17,1 % bzw. 18,4 % unter <strong>de</strong>m Wert <strong>de</strong>r vergleichbaren<br />
Laufställe liegt. Umgerechnet auf 40 Kühe ergibt sich ein Unterschied<br />
von über 50.000 DM, <strong>de</strong>ssen Ursachen im C-olgen<strong>de</strong>n kurz untersucht<br />
wer<strong>de</strong>n so 11 en.<br />
Bedingt durch die fehlen<strong>de</strong>n laufgänge zwischen <strong>de</strong>n Boxen und Im Futtertisch<br />
und <strong>de</strong>n nicht erfor<strong>de</strong>rlichen Melkstand benötigt <strong>de</strong>r Anbin<strong>de</strong>stall für<br />
41 Kühe eine um 110 Quadratmeter o<strong>de</strong>r 17,5 % geringere Grundrißfläche als<br />
<strong>de</strong>r kleinere <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n laufställe. Da <strong>de</strong>r Gesamtinvestitionsbedarf bei<br />
diesem laufstall jedoch nur um 14,3 % über <strong>de</strong>r Alternativlösung liegt, ergibt<br />
sich folg1 ich in bezug auf die Grundfläche o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n umbauten Raum<br />
beim laufstall sogar ein Absinken <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes, so wie <strong>de</strong>r mo-
Tabelle 24: Vergleich <strong>de</strong>s Investitionsbedarfs einzelner Ba uq r-uppen<br />
Anbin<strong>de</strong> s t all , 41 Kühe mit Nachzucht - Laufstall, 40 Kühe mit Nachzucht<br />
Saug ruppe Anb in<strong>de</strong> s t a 11, 41 KÜhe + NZ Laufsta 11, g r-et h t c , 40 Kilne + NZ re 1a t, i ve Ablffe i chung<br />
t nves ti ti on s bed . r-e I. Anteil t nve st i t i onsbed. re I. Ante i ! Spa I te 4 zu Spa I t e 2<br />
--<br />
DM % DM % % --<br />
I 2 3 4 5 6<br />
1 E r-da r-be i ten 3 235 0,9 3 959 0,9 + 22,4<br />
2 Fundamente 211 690 6,6 26 772 s.« + 8,4<br />
3 Bccteno 1a t te 53 692 14,4 63 BD 15,2 + 18,7<br />
4 Spaltenbo<strong>de</strong>n + Gitterras 14 189 3,8 18 106 4,3 + 27,6<br />
5 Wän<strong>de</strong> 72 261 19./-f 85 527 20,3 + 18,4<br />
6 Dach 77 731 20,9 81 543 19,_4 + 4,9<br />
7 LÜftung 17 138 1;,6 12 1{64 3,0 - 27,3<br />
8 Aufst a I I ung 32 88 I 8,8 38 569 9,2 + 17,3<br />
9 Elektro + Wasser 7 960 2, I 7 900 1,9 - 0,8<br />
10 Me1ktechn i k 36 110 9,7 Ij4 148 10,5 + 22,3<br />
11 Kr-aTt Fu t te rfüt-te rung 20 247 5,4 23 287 5,5 t 15.0<br />
12 Nebenkosten 12 731 3,4 14 377 3,4 + 12,9<br />
Gesamt i nvest i t i onsbeda r-r<br />
ohne Gül le- und Futterlager 372 865 100,0 420 382 100,0 + 12,7<br />
'-'<br />
W<br />
- 142 -<br />
1. Oie Degression <strong>de</strong>s Investitonsbedarfes pro Produktionseinheit zeigt<br />
eine stark abnehmen<strong>de</strong> Ten<strong>de</strong>nz. Während <strong>de</strong>r Prei s pro Kuhplatz zwi<br />
schen 20 und 40 Kuhplätzen um 22,8 % abnimmt, beträgt die Abnahmerate<br />
zwischen 40 und 60 KUhen noch 17,6 % und zwischen 80 und 100 Plätzen<br />
nur mehr 4,9 %.<br />
2. Der Anbin<strong>de</strong>stall erreicht gegenUber <strong>de</strong>m Liegeboxenlaufstall bei einer<br />
Her<strong>de</strong>ngröße von 40 KUhen mit Nachzucht je nach Aufstallungsart einen<br />
absoluten Preisvorteil von 52.000 bis 57.000 DM o<strong>de</strong>r pro Kuhplatz einen<br />
Vorteil von ca. 17,1 %.<br />
3. Der Einfluß <strong>de</strong>r Aufstallungsart ist unterschiedlich zu beurteilen:<br />
Während im kleineren Laufstall die Differenz zwischen <strong>de</strong>r zweireihi<br />
gen und dreireihigen Lösung pro Kuhplatz nur 118 DM o<strong>de</strong>r 1,1 % be<br />
trägt, steigt die Differenz bei einer Bestan<strong>de</strong>sgröße von ca. 100 Tie<br />
ren zwischen <strong>de</strong>r 2+2reihigen Alternative und <strong>de</strong>r kammartigen Aufstal<br />
lungsform auf 310 DM o<strong>de</strong>r 4,6 % an.<br />
4. Oie Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Investitonsbedarfes in Abhängigkeit von <strong>de</strong>r Auf<br />
stallungsart ist vornehmlich auf Än<strong>de</strong>rungen im Aufwand fUr die Bo<strong>de</strong>n<br />
platte und die Kanalab<strong>de</strong>ckungen zurUckzufUhren, <strong>de</strong>ren Anteil am Ge<br />
samtinvestitionsbedarf von <strong>de</strong>r kleinsten zur größten Alternativlasung<br />
von 16,7 % auf 24, % ansteigt. Mit einem sinken<strong>de</strong>n Anteil von 28,6 %<br />
auf 16,3 %am Gesamtpreis verläuft die EntwiCklung <strong>de</strong>s Aufwan<strong>de</strong>s fUr<br />
Wän<strong>de</strong> und raumabschließen<strong>de</strong> Decken <strong>de</strong>r Nebenräume in entgegengesetz<br />
ter Richtung.<br />
5. Durch <strong>de</strong>n Verzicht auf Nachzuchtplätze bei einer Her<strong>de</strong>ngröße von 80<br />
MilchkUhen wird pro Großvieheinheit in etwa <strong>de</strong>r gleiche Investitions<br />
bedarf erfor<strong>de</strong>rlich wi fU. einen Tiecbestand von 60 KUhen mit Nach<br />
zucht.<br />
6. Mit einem Anteil von 30 bis 33 %an <strong>de</strong>n Gesamtaufwendungen kommt <strong>de</strong>r<br />
gesamten Stalleinrichtung eine hohe Be<strong>de</strong>utung . Beim Vergleich un<br />
terschiedlicher Stallbaulösungen birgt dieser Teilbereich gleichzei<br />
tig die Gefahr von Fehlinterpretationen, da die erfor<strong>de</strong>rlichen Auf<br />
wendungen in <strong>de</strong>r Regel nicht kontinuierlich, son<strong>de</strong>rn sprunghaft an<br />
steigen, so daß insbeson<strong>de</strong>re bei geringfUgigen Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Tierbe-
- 143 -<br />
stan<strong>de</strong>s starke Verschiebungen im Investitionsbedarf pro Tierplatz<br />
o<strong>de</strong>r pro bauliche Einhei resultieren. Der geringste Investitionsbe<br />
darf ergibt sich somit ten<strong>de</strong>nziell immer im optimalen Ausl as tunqs<br />
punkt von sehr kapitalintensiven Einrichtungen wie <strong>de</strong>r Melk- und Füt<br />
terungstechni k,<br />
Die graphische Darstellung <strong>de</strong>r Ergebnisse <strong>de</strong>r zehn ternativlbsungen in<br />
Abbildung 37 zeigt aufgrund <strong>de</strong>r Planungsunterschie<strong>de</strong> ein verhältnismäßig<br />
uneinheitliches Bild, wodurch letztlich die zu Beginn aufgestellte These<br />
gestützt wird, daß es äußerst problematisch ist, ohne genauere Kenntnis<br />
<strong>de</strong>r spezifischen Umstän<strong>de</strong> eines Planungsfalles und entsprechen<strong>de</strong> Berück<br />
sichtigung bei Investitionsrechnungen über eine grobe Uberschlagskalkul.tion<br />
hinaus Entscheidungskriterien abzuleiten.<br />
Abbildung 37: Inv2stitionsbedarf <strong>de</strong>r zehn AlternativlBsungen pro Kuhpl<br />
und pro Großvieheinheit<br />
Bei Beurteilung <strong>de</strong>r Variation <strong>de</strong>r vorgestellten Ergebnisse ist zu<strong>de</strong>m zu<br />
berücksichtigen, daß wesentliche, die Höhe <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes stark<br />
beeinflussen<strong>de</strong> Faktoren in allen Kalkulationen fix gehalten wur<strong>de</strong>n Inwie<br />
weit sich durch die Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>rartiger Parameter weitere Unterschie<strong>de</strong> er<br />
geben, soll Gegenstand <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Abschnitte sein.
- 144 -<br />
6.3 Erweitere Analyse durch Variation Materialien und Preisen<br />
1m Vergleich zu Angaben an<strong>de</strong>rer Autoren über die Höhe <strong>de</strong>s 1nvestitionsbe<br />
darfes von Milchviehställen kann insgesamt festgestellt wer<strong>de</strong>n, daß die<br />
Ergebnisse <strong>de</strong>r vorgelegten Kalkulationen mit Preisen zwischen 11.600 DM<br />
und 6.700 DM pro Kuhpl (ohne Gül1e- und Grundfutterlager) verhältnis<br />
mäßig hoch ausfallen. Bei <strong>de</strong>r Beurteilung <strong>de</strong>r Ergebnisse ist jedoch zu be<br />
rücksichtigen, daß eine relativ aufwendige Gestaltung <strong>de</strong>s Baukörpers vor<br />
liegt, die gekennzeichnet ist durch Ziegelbauweise mit Vollwärmeschutz und<br />
eine Dachneigung von 25 Grad mit einer Deckung aus Betondachsteinen. Zu<strong>de</strong>m<br />
wur<strong>de</strong> eine Gesamterstellung <strong>de</strong>s Stalles als komplette Unternehmerleistung<br />
unterstellt sowie bereits alle Einrichtungsteile für ein "funktionsfähiges<br />
Stallgebäu<strong>de</strong>" mi in die Berechnungen einbezogen,<br />
Die hier zur Anwendung gelangte Kalkulationsmetho<strong>de</strong> erlaubt es jedoch auf<br />
grund <strong>de</strong>r voll variablen Gestaltung <strong>de</strong>r Einzelmo<strong>de</strong>lle und <strong>de</strong>r differen<br />
zierten Ergebnisdarstellung als Mengen- und Preisgerüst, auch gezielte Än<br />
<strong>de</strong>rungen von Planungsvorgaben durchzuführen. Dera ge Än<strong>de</strong>rungen eignen<br />
sich insbeson<strong>de</strong>re zur exakten Analyse <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Einsparungsmög<br />
lichkeiten, di sich durch Variationen in <strong>de</strong>r Baugestaltung und Aus f öhr-unq<br />
ergeben.<br />
6.3.1 Analyse und Variation<br />
dung<br />
Materialbedarfes und<br />
Wie im Abschni 4.4 dargestell erbringt die zur Anwendung gelangte Kal<br />
kulationsmetho<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>r vertikalen Aufschlüsselung <strong>de</strong>s Investitionsbe<br />
darfes ebenfalls ein Mengen- und PreisgerUst, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Material- und Ar<br />
beitszeitbedarf <strong>de</strong>tailliert aufgeschlüsselt wi Da n <strong>de</strong>rartiges Proto<br />
ko11 für ei n gesamtes Sta 11gebäu<strong>de</strong> sehr umfangrei eh ist, wur<strong>de</strong> a l l n ua s<br />
Ergebnis für <strong>de</strong>n drei higen Laufstall für 4D Kühe i ei leicht ge<br />
rafften Form in Anhangstabelle 38 abgedruckt. Eine Zusammenfassung <strong>de</strong>r mo<br />
netären Ergebnisse aller zehn Alternativen fin<strong>de</strong>t sich i Anhangst.abelle<br />
37. Da eine <strong>de</strong>taillierte Analyse <strong>de</strong>s Material- und Arbeitszeitbedarfes<br />
Alternativen vi e l en Bereichen die gleichen Aspekte wie bei <strong>de</strong>r Auf-<br />
schlüsselung nach Baugruppen erbringt, soll darauf hier verzichtet 'wer<strong>de</strong>n<br />
Abbildung 38 zeigt nur beispielhaft in zusammengefaßter Forrn die
- 146 -<br />
<strong>de</strong>rlichen Aufwan<strong>de</strong>s aus <strong>de</strong>n Materialien resultiert, während ca. 60 % für<br />
Löhne, Installationsarbeiten, Stalleinrichtung und ßaunebenkosten benötigt<br />
wer<strong>de</strong>n. Der Materialaufwand selbst wird im wesentlichen bestimmt durch Be<br />
ton, Mauersteine, Dachkonstruktion und Isolation, die zusammen knapp 60 %<br />
ausmachen.<br />
Während die erfor<strong>de</strong>rl iche Betonmenge, die mit fast 20 % die stärkste Be<br />
<strong>de</strong>utung hat, durch die statischen Anfor<strong>de</strong>rungen und die Grundrißgestaltung<br />
festgelegt ist, sind bei <strong>de</strong>r Auswahl <strong>de</strong>r Mauersteine Variationen möglich.<br />
So sind für die Außenwän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s dreireihigen Laufstalles für 40 Kühe knapp<br />
5.000 Großblockziegel erfor<strong>de</strong>rlich, die in <strong>de</strong>r Kalkulation als Porenziegel<br />
ausgelegt sind. Die Porenziegel wur<strong>de</strong>n aufgrund ihrer guten Wärmedämmei<br />
genschaften gewählt. Wer<strong>de</strong>n statt <strong>de</strong>ssen beispielsweise normale Großblock<br />
ziegel mi einer Rohdichte von 0,8 kg/ dm' und einer geringeren Wärmeleit<br />
fähigkeit von 0,39 W/mK verarbeitet, so vermin<strong>de</strong>rt sich <strong>de</strong>r Mater'ialprei,<br />
um ca. 1.500 DM o<strong>de</strong>r rund 11 %. Eine Verarbeitung von Ziegeln im Normal<br />
o<strong>de</strong>r Hochformat schei<strong>de</strong>t hingegen aus, da hier nicht nur vom Mater·ialauf<br />
wand son<strong>de</strong>rn auch vom Arbeitszeitaufwand her erheblich hdhere Investitio<br />
nen erfor<strong>de</strong>rlich wUr<strong>de</strong>n.<br />
Die aufgrund statischer Anfor<strong>de</strong>rungen vorgegebene Konstruktion <strong>de</strong>s Dach<br />
tragwerks erlaubt zunächst keine Einsparungen, beispielsweise durch Än<strong>de</strong>r<br />
ungen <strong>de</strong>r Materialien. Ein an<strong>de</strong>rer Aspekt ersehe i in dieser Hinsicht<br />
aber bemerkenswert, Bereits bei <strong>de</strong>r Diskussion <strong>de</strong>r einzelnen Alternativlö<br />
sungen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, daß entgegen <strong>de</strong>r ursprünglichen Erwartung die drei<br />
reihige Laufstallösung trotz <strong>de</strong>r größeren Spannweite in <strong>de</strong>r Dachkonstruk<br />
tion nicht teuerer ausfällt als <strong>de</strong>r zweireihige Stal1typ f ür 40 Kühe. Die<br />
se Ten<strong>de</strong>nz spiegelt sich sowohl im Arbeitszeitbedarf für die Dacherstel<br />
lung wie auch im Materialaufwand wie<strong>de</strong>r. Durch die Tragwerkausbildung als<br />
Stützenkonstrukti on nehmen di e Bi n<strong>de</strong>rquerschni tte im brei teren Stall sogar<br />
geringfügig ab, da die zusatz l ich auftreten<strong>de</strong>n Kräfte über eine weitere<br />
Stützenreihe im Stall abgeführt wer<strong>de</strong>n, woraus natürlich ein Mehraufwand<br />
für die Fundamentierung resultiert. Die exakte Aufschlüsselung <strong>de</strong>s Mengen<br />
und Preisgerüstes fUr die Erstellung <strong>de</strong>r Holzkonstruktion in <strong>de</strong>n Tabellen<br />
25 und 26 läßt die unterschiedlichen Auswirkungen von Verbreiterungen bzw.<br />
Verlängerungen eines Gebäu<strong>de</strong>s erkennen.
- 147 -<br />
Im 2reihigen Laufstall wird auf qrund <strong>de</strong>r größeren Stallänge ein Bin<strong>de</strong>r<br />
mehr benötigt, während an<strong>de</strong>rerseits je<strong>de</strong>r Bin<strong>de</strong>rriegel um 1,40 Meter kürzer<br />
ist. Da gleichzeitig in <strong>de</strong>r 2reihigen Version drei Stützen eingespart<br />
wer<strong>de</strong>n, liegt <strong>de</strong>r Aufwand für Montage und Material bei Stützen und Bin<strong>de</strong>rn<br />
im 2reihigen Stall niedriger. Die größere Stal l änqe bewirkt jedoch an<strong>de</strong>rerseits<br />
eine größere Zahl an Pfetten sowie einen Zuwachs von insgesamt 154<br />
Iaufen<strong>de</strong>n Metern an Dach- und Konterl attungen. Zusammen mit <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Mehraufwendungen beim Befestigungsmaterial und <strong>de</strong>r größeren Länge<br />
<strong>de</strong>s Ringankers wer<strong>de</strong>n die Einsparungen überkompensiert, so daß sich insgesamt<br />
ein geringfügiger Preisvorteil <strong>de</strong>s breiteren Stallgebäu<strong>de</strong>s ergibt.<br />
Bei ei ner Gegenüberstell ung <strong>de</strong>r Gesamtaufwendungen für di e DachersteII ung<br />
ist zunächst festzustellen, daß die Dachfläche beim 2reihigen Stall um<br />
rund 30m2 größer ist, so daß di e Aufwendungen für di e Dachei n<strong>de</strong>ckunq und<br />
innenseitige Wärmedämmung höher liegen. Ein vollständiger Vergleich erfor<strong>de</strong>rt<br />
jedoch zusätzlich noch die Einbeziehung <strong>de</strong>r Fundamente und Betonwand<br />
stUtzen, da <strong>de</strong>ren Anzahl und Dimensionierung direkt von <strong>de</strong>r Tragwerkkonstrukti<br />
on abhängt. Der zus ä t zl iche Aufwand für Wandstützen beim 2reihigen<br />
Stall wird hier überkompensiert durch die Einsparungen bei <strong>de</strong>n Einzelfundamenten,<br />
so daß letztlich für <strong>de</strong>n dreireihigen Stall ein höherer Aufwand<br />
resultiert. Insgesamt zeigt somit das bereits in Tabelle 16 auf Seite122<br />
zusammengefaßte Ergebnis, daß sich die Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Tragwerkkonstruktion<br />
und Dachausbildung zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Alternativlösungen bei<br />
<strong>de</strong>n unterstellten Bedingungen nahezu ausgleichen, wobei die dreireihige<br />
Lösung leicht überlegen ist. In Bezug die überbaute Fläche kehren sich<br />
hingegen die Verhältnisse um, da die Stal1fläche bei <strong>de</strong>r dreireihigen Planungslösung<br />
um 27 Quadratmeter größer ausfällt.<br />
Bei <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>r Aufwendungen für das Dach verdient noch ein weiterer<br />
Aspekt Beachtung: Während im süd<strong>de</strong>utschen Raum von <strong>de</strong>n Genehmigungsbehör<strong>de</strong>n<br />
verhältnismäßig starre Vorgaben für die Dachneigung und Dachein<strong>de</strong>ckung<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n. kann im nord<strong>de</strong>utschen Raum in <strong>de</strong>r Regel mit freizügigeren<br />
Gestaltungsmöglichkeiten gerechnet wer<strong>de</strong>n. Um eine Vorstellung von <strong>de</strong>n monetären<br />
Auswirkungen <strong>de</strong>rartiger Vorgaben zu geben, wur<strong>de</strong> beispielhaft beim<br />
dreireihigen Liegeboxenlaufstall für 40 Kühe einerseits für die Ein<strong>de</strong>ckung<br />
alternativ eine Bi<strong>tum</strong>enwellplatte berechnet und an<strong>de</strong>rerseits die Dachneigung<br />
um jeweils 10 Grad erhöht bzw. erniedrigt, wobei sich bei einer Dachneigung<br />
von 15 Grad jedoch eine Ein<strong>de</strong>ckung mit Betondachsteinen nicht mehr
- 149 -<br />
realisieren läßt. Neigungen von 15 Grad sind im nord<strong>de</strong>utschen Raum durch<br />
aus üblich, während an<strong>de</strong>rerseits in einigen Regionen Frankens In Anlehnung<br />
an <strong>de</strong>n historischen Baustil sogar Dachneigungen bis zu 45 Grad angestrebt<br />
wer<strong>de</strong>n, was jedoch bei <strong>de</strong>rartig großen Ställen aufgrund <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>propor<br />
tionen kaum noch sinnvoll ist.<br />
Aus <strong>de</strong>n in Abbildung 39 dargestellten Ergebnissen geht hervor, daß zu<br />
nächst allein durch die Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Dachneigung von 25 Grad auf 35 Grad<br />
eine Mehrinvestition von ca. 8.000 DM erfor<strong>de</strong>rlich wird. Dieser Zuwachs<br />
geht dabei sowohl auf Än<strong>de</strong>rungen im Holzbedarf, bedingt durch die verän<strong>de</strong>rten<br />
Bin<strong>de</strong>r- und Stützenlängen, als auch auf die verän<strong>de</strong>rte Größe <strong>de</strong>r<br />
Dachflächen zurück, die maßgeblich für <strong>de</strong>n Investitionsbedarf <strong>de</strong>r Dachein<strong>de</strong>ckung<br />
und <strong>de</strong>r innenseitigen Isolation ist. Innerhalb <strong>de</strong>r Gruppen gleicher<br />
Dachneigung ergeben sich durch die Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Dachein<strong>de</strong>ckung sogar<br />
Unterschie<strong>de</strong> zwischen 16.500 DM und 18.100 DM. Diese resultieren vornehmlich<br />
aus <strong>de</strong>m niedrigeren Materialpreis und <strong>de</strong>m geringeren Arbeitszeitbedarf<br />
für das Verlegen <strong>de</strong>r Wellplatten. Zusätzlich wer<strong>de</strong>n aber auch noch<br />
Einsparungen im Unterbau durch die entfallen<strong>de</strong> Dach- und Konterlattung er<br />
zielt. Bei einer Reduzi er-unq <strong>de</strong>r Dachneigung auf 15 Grad und gleichzeitiger<br />
EIn<strong>de</strong>ckung mit Bi<strong>tum</strong>enwellplatten sind EInsparungseffekte In ähnlicher<br />
Höhe zu erzielen. Diese summieren sich gegenüber <strong>de</strong>m Dach mit 25 Grad Neigung<br />
und Betondachsteinein<strong>de</strong>ckung bei einer Stallgröße von 31,50 x 20,00 m<br />
auf rund 20.800 DM, während die Differenz zu <strong>de</strong>m noch steileren Dach mit<br />
35 Grad sogar rund 28.800 DM beträgt.<br />
Aus Abbildung 39 geht auch noch einmal <strong>de</strong>utlich hervor, daß eine Voll Iso<br />
1ier unq <strong>de</strong>r Dachfl ächen erhebI i ehe Aufwendungen verursacht, di e zumi n<strong>de</strong>st<br />
teilweise durch die Auslegung eines Stalles als "Kal t st.al l " eingespart<br />
wer<strong>de</strong>n können. Derartige Lösungen erfor<strong>de</strong>rn jedoch in <strong>de</strong>r Regel einen<br />
vol l ständig abgetrennten und mel st auch beheizten Raum für die Kälberauf<br />
zucht sowie ebenfalls eine Abtrennung, Isolation und oft auch Beheizung<br />
<strong>de</strong>s Melkstan<strong>de</strong>s, wenn auch im Winter erträgl che Arbeitsplatzbedingungen<br />
gewährleistet sein sollen. Diese zusätzlichen Einbauten wiegen somit einen<br />
Tei l <strong>de</strong>r möglichen Einsparungen durch <strong>de</strong>n Verzicht auf Wärmedämmung wie<strong>de</strong>r<br />
auf.
6.3.2 Einfluß <strong>de</strong>r Materialpr-else<br />
- 151 -<br />
Die tatsächlich vom Investor zu entrichten<strong>de</strong>n Zahlungen für Baumaterialien<br />
hängen sehr stark von <strong>de</strong>r regionalen und auch <strong>de</strong>r Gesamtmarktsituation,<br />
<strong>de</strong>m Bauvolumen, <strong>de</strong>r Materialqualität sowie nicht zuletzt vom persönlichen<br />
Verhandlungsgeschick <strong>de</strong>s Bauherrn ab. Bei Vorauskalkulationen erhalten<br />
schließlich vor allem auch die Preisän<strong>de</strong>rungen zwischen <strong>de</strong>m Kalkulationszeitpunkt<br />
und <strong>de</strong>m Zeitpunkt <strong>de</strong>s Vertragsabschlusses ein erhebliches Gewicht.<br />
Die AufschlUsselung <strong>de</strong>r Kalkulationsergebnisse nach <strong>de</strong>m naturalen<br />
Aufwand an Materialien und Arbeitszeit und <strong>de</strong>n Preisen pro Einheit im Mengen-<br />
und PreisgerUst erlaubt hier eine Abschätzung möglicher Verän<strong>de</strong>rungen<br />
im Kapitalbedarf. Die Auswirkungen einzelner Preisän<strong>de</strong>rungen sollen anhand<br />
<strong>de</strong>r wichtigsten Materialgruppen, wie sie bereits in Abbildung 38 auf Seite<br />
145 dargestellt wur<strong>de</strong>n, beispielhaft untersucht wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Marktpreis für Transportbeton, <strong>de</strong>r insgesamt über alle Materialgruppen<br />
<strong>de</strong>n höchsten prozentualen Anteil am Ge semtt nvest t t t onsbeda rf einnimmt, ist<br />
gleichzeitig auch vergleichsweise starken regionalen Schwankungen unterworfen.<br />
So sind allein im südbayer t schen Raum interregional Preisunter<br />
schie<strong>de</strong> von über 20 % keine Seltenheit, während innerhalb einer Region in<br />
<strong>de</strong>r Regel relativ feste Preise vorherrschen. Auch bei Ziegelerzeugnissen<br />
und Dämmstoffen sind erhebliche Differenzen je nach Absatzlage <strong>de</strong>r Unternehmen<br />
zu ver ze t chnen. Der Prei s für Bauho 1z ri chtet si ch stark nach <strong>de</strong>n<br />
Schwankungen im Angebot an die Sägewerke und zeigt daher gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n<br />
letzten Jahren eine fallen<strong>de</strong> Ten<strong>de</strong>nz. Preisschwankungen bei einzelnen Materialgruppen<br />
haben auf <strong>de</strong>n Gesamtinvestitionsbedarf trotz<strong>de</strong>m nur verhält<br />
nismäßig geringe Auswirkungen, So ergibt sich beim dreireihigen Laufstal<br />
flir 40 Kühe selbst bei einer erheblichen Verbilligung <strong>de</strong>s Betons um 25 %<br />
ei n Einsparungseffekt im Gesamtinvestitionsbedarf von 2.0 %. während di e<br />
gleiche Preismin<strong>de</strong>rung bei <strong>de</strong>n Bausteinen nur 1,0 %erbringt.<br />
Für einen Großteil <strong>de</strong>r realen Bausituationen kann jedoch sogar davon ausgegangen<br />
wer<strong>de</strong>n, daß es <strong>de</strong>m Bauherrn gel t nqt., bei fast allen Baumateria<br />
1i en einen gewissen Preisnachlaß von <strong>de</strong>n Listenpreisen zu erzielen. Wird<br />
unter ste11t , daß genere 11 et ne Prei sm i n<strong>de</strong>rung von 10 % errei cht wird , so<br />
resultiert daraus eine Gesamteinsparung von ca. 4 % und selbst bei 15 %<br />
Nachlaß ergeben sich für das gewählte Beispiel nur ca , 6 %. Wer<strong>de</strong>n jedoch<br />
auch bei Stalleinrichtungen, also <strong>de</strong>r Aufstallung, <strong>de</strong>r Melk- und FUtte-
- 152 -<br />
runq s t.echn i k 15 % Nachlaß gewährt, so summiert sich dieser Betrag doch auf<br />
über 40.000 DM o<strong>de</strong>r rund 10 %<strong>de</strong>s Gesamtinvestitionsbedarfes.<br />
Neben diesen Chancen, <strong>de</strong>n Kapitalbedarf einer Investition zu senken,<br />
welche wohl je<strong>de</strong>r Bauherr soweit möglich nutzt, wird jedoch insbeson<strong>de</strong>re<br />
im Sektor Landwirtschaft sehr stark auf Verbilligungsmöglichkeiten durch<br />
<strong>de</strong>n Einsatz verfügbarer eigener Arbeitskapazitäten zurückgegriffen.<br />
6.4 Aussagefähigkeit <strong>de</strong>r Kalkulationen in Bezug<br />
keiten durch bauliche Selbsthilfemaßnahmen<br />
Einsparungsmöglich -<br />
Wie in kaum einem an<strong>de</strong>ren Berufszweig gehört handwerkliche Selbsthilfe in<br />
<strong>de</strong>r Landwirtschaft zu <strong>de</strong>n alltäglichen Aufgaben im Betriebsgeschehen. Vor<br />
allem bei Instandsetzungsarbeiten an Maschinen, Geräten und baulichen An<br />
lagen versuchen die Landwirte nach Möglichkeit die Inanspruchnahme von<br />
Fachkräften zu vermei<strong>de</strong>n und so vor allem die hohen Lohnkosten von Fachar<br />
beitern einzusparen (PIRKELMANN 1974 /98/). 1m baulichen Sektor beschränkt<br />
sich diese Selbsthilfe nicht allein auf kleinere Umbaumaßnahmen, son<strong>de</strong>rn<br />
auch bei kompletten Neubauten wird versucht, soweit möglich auf eine voll<br />
ständige Auftragsvergabe an Fachfirmen zu verzichten.<br />
6.4. Ergebnisse A rbartszeftka Ik u lationan<br />
Die <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit zugrun<strong>de</strong>liegen<strong>de</strong>n Baulösungen für die Milch<br />
viehhaltung wur<strong>de</strong>n gezielt so ausgelegt, daß sich nur wenige Teilbereiche<br />
nicht in handwerklicher Selbsthilfe erstellen lassen und ein möglichst ge<br />
ringer Anteil an stärker vorgefertigten 8auteilen eingesetzt wird. Dies<br />
gil vor lem für die hier verwen<strong>de</strong>te Kantholzbin<strong>de</strong>rkonstruktion, die<br />
speziell für Eigenleistungsbauten entwickelt wur<strong>de</strong> /85/, während aber auch<br />
die Erstellung <strong>de</strong>r Wän<strong>de</strong> in Ziegelmauerwerk durchaus als selbsthilfe<br />
freundlich eingestuft wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Der <strong>de</strong>rzeitige Entwicklungsstand <strong>de</strong>r angewandten Kalkulationsmetho<strong>de</strong> er<br />
laubt es, für <strong>de</strong>n überwiegen<strong>de</strong>n Teil <strong>de</strong>r Arbeiten zur Erstellung <strong>de</strong>r Ge<br />
bäu<strong>de</strong> auch <strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rlichen Arbeitszeitbedarf zu berechnen Lediglich 1m
- 153 -<br />
Beretch <strong>de</strong>r Einrichtungen für die Elektro- und Wasserinstallation, die<br />
Spenglerarbeiten und die Aufstallung mußte ei firmenseitiger Einbau mangels<br />
verfügbarer Arbeitszeitdaten unterstellt wer<strong>de</strong>n, obwohl auch ei Tei<br />
dieser Arbeiten oftmals bauseitig erledigt Für die Milchgewinnungsund<br />
Kraftfütterungstechnik wur<strong>de</strong> ebenfalls ein Pauschalpreis für Material<br />
und Montage nach Firmenangeboten in die Berechnungen einbezogen. Abbildung<br />
40 gibt einen überblick über die auf Grundlage dieser Dreiteilung Ar<br />
beitszeitbedarf, Materialbedarf und pauschal bewerteter Einrichtung resultieren<strong>de</strong><br />
Zusammensetzung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes <strong>de</strong>r zehn Planungsläsun<br />
gen. Die erfor<strong>de</strong>rliche Arbeitszeit wur<strong>de</strong> dabei mit Ausnahme <strong>de</strong>r Fliesenlegerarbeiten<br />
durchgehend mit einem Lohnansatz von 37,60 bewertet.<br />
Abbildung 40, Investitionsbedarf <strong>de</strong>r zehn<br />
seIt nach Baumaterialien, Löhnen<br />
r·icht.unq<br />
Aus <strong>de</strong>n Berechnungsergebnissen geht hervor, daß unter <strong>de</strong>n gegebenen<br />
gungen allein für Löhne je nach Stallgröße zwischen rund 60.000 DM und<br />
200.000 DM gezahlt wer<strong>de</strong>n müssen. Der Arbeitsaufwand schwankt dabei zwischen<br />
ca. 1.700 und .300 Stun<strong>de</strong>n. Der Lohnanteil am GesamtInvestItionsbedarf<br />
liegt mit 25,1 % im Anbin<strong>de</strong>stall für 40 Kühe am niedrigsten, während<br />
<strong>de</strong>n bel<strong>de</strong>n Laufställen für diese Her<strong>de</strong>ngröße mit jeweils 28,3 % die<br />
höchsten Anteile erreicht wer<strong>de</strong>n. Die bei<strong>de</strong>n Anbin<strong>de</strong>ställe sind jedoch
- 156 -<br />
wer<strong>de</strong>n, die sogar oftmals sehr erheblich ist, da die Betriebe vor <strong>de</strong>r In<br />
vestition arbeitswirtschaftlich suboptimal organisiert s i nd . Hinzu kommen<br />
die in hren Zeitansprüchen je nach Anbauverhältnissen stark schwanken<strong>de</strong>n<br />
Ansprüche <strong>de</strong>r Außenwirtschaft, die ebenfalls stark termingebun<strong>de</strong>n sindo<br />
Sicherlich sind die meisten Landwirte bereit, während <strong>de</strong>r Bauzeit gewisse<br />
Mehrbelastungen in Kauf zu nehmen, doch st dies in vielen Fällen kaum<br />
noch mögl t ch . So betrugen nach <strong>de</strong>n Erhebungen <strong>de</strong>s Mikrozensus die durch<br />
schnittlich geleisteten Arbeitsstun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r selbstständigen Männer in <strong>de</strong>r<br />
landwirtschaft 1981 noch 63,9 Stun<strong>de</strong>n/Woche /30/ (Abbo 42)0 Da sich dieses<br />
Ergebnis nur auf eine bestimmte Berichtswoche im Mai bezieht, kann es kaum<br />
verallgemeinert wer<strong>de</strong>no<br />
Quelle Stct. Jchrbucher uber E ,L und F.und Stot Jahrbücher <strong>de</strong>r Brc-Deurscbtcnc<br />
Abbildung 42: Wöchentliche Arbeitszeit <strong>de</strong>r selbständigen Landwirte<br />
Gewerbebetriebsleiter und <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r ik Deutschland ab 1957<br />
Doch auch PASCHER 1981 /96/ ermittelte in einer Erhebung über 10531 Haupt<br />
erwerbsbetriebe eine durchschni iche jahresarbei <strong>de</strong>s Ehemanns von<br />
30450 Stun<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r Ehefrau von 10950 Stun<strong>de</strong>n 0 Ei ne Untersuchung über<br />
die Tätigkeit von Landfrauen i Westfalen-lippe kam sogar zu <strong>de</strong>m Ergebnis,<br />
daß die 677 befragten Bäuerinnen im Durchschnitt pro Woche 77 Stun<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r<br />
über 40000 Stun<strong>de</strong>n pro .Jahr im Haushalt und Betrieb arbeiten /56/ Diese<br />
Ergebnisse lassen <strong>de</strong>n Schluß zu, daß <strong>de</strong>r verfügbare Rahmen für eine Mobi<br />
lisierung zusätzlicher Arbeitskapazität häufig gering i Wer<strong>de</strong>n<br />
diese Grenzen ignoriert, so besteht einerseits die Gefahr ei persönli-<br />
chen gesundhei ichen Schädigung und an<strong>de</strong>rersei muß gerechnet
- 157 ..<br />
<strong>de</strong>n, daß mitunter erhebli che Versch Iechterungen <strong>de</strong> s Bet r t ebsergebni sses<br />
während <strong>de</strong>r Bauphase aufgrund mangeln<strong>de</strong>r Sorgfalt, Kontrolle und termingerechter<br />
Arbeitserledigung eintreten, die die möglichen Einsparungen durch<br />
Eigenleistung durchaus kompensieren können.<br />
Je nach <strong>de</strong>r Arbeitskräfteausstattung eines Betriebes resultiert somit bei<br />
entsprechen<strong>de</strong>r Anpassung <strong>de</strong>s fUr die BauausfUhrung aufgewen<strong>de</strong>ten Anteiles<br />
an verfUgbarer Arbeitskapazität eventuell eine sehr langen Bauzeit. Eine<br />
lange Bauzelt be<strong>de</strong>utet aber zunächst eine unproduktive Festlegung von Kapital<br />
für die Zeitspanne zwischen <strong>de</strong>n jeweiligen Auszahlungen im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r Bauerrichtung und <strong>de</strong>r Erstbelegung <strong>de</strong>s Investitionsobjektes. DarUberhinaus<br />
fUhrt eine Bauzeltverlangerung zu einem Gewinnentgang, <strong>de</strong>r erhebliche<br />
Be<strong>de</strong>utung er Iangen kann. So errechnet sieh bei ei nem angenommenen<br />
Deckungsbeitrag von 2.000 DM pro Kuh und Jahr und einer Bestan<strong>de</strong>sgröße von<br />
40 Tieren theoretisch ein entgangener Deckungsbeitrag von ca. 220 DM pro<br />
Tag Bauzeitverl ängerung. Dieser Betrag entspricht nat.ürl i ch in<strong>de</strong>r RegeI<br />
nicht <strong>de</strong>m t atsäch l ich entgangenen Deckungsbeitrag, da die im Betrieb vor<br />
han<strong>de</strong>nen Produktionsfaktoren meist nicht brach liegen, son<strong>de</strong>rn an<strong>de</strong>rweitig<br />
genutzt wer<strong>de</strong>n. Es zeigt sich aber doch, daß es durchaus rationale GrUn<strong>de</strong><br />
fUr eine zumin<strong>de</strong>st teilweise Vergabe von Bauaufträgen an Unternehmer geben<br />
kann.<br />
Tatsächlich ist die BauausfUhrung in <strong>de</strong>r Landwirtschaft heute meist so organisiert,<br />
daß auf die Inanspruchnahme von Lohnarbeitskriften nicht vollständig.verzichtet<br />
wird. Die Arbeitskräfte rekrutieren sich jedoch häufig<br />
aus <strong>de</strong>m Nachbarschafts- o<strong>de</strong>r verwandschaftlichen Bereich, wodurch meist<br />
ein Teil <strong>de</strong>r Lohnaufwendungen eingespart wer<strong>de</strong>n kann. Die Auftragsvergabe<br />
an Unternehmer erfolgt hingegen oftmals nur für Teilbereiche eines Bauvorhabens,<br />
wobei selbst hier meist auf Regiestun<strong>de</strong>nbasis abgerechnet wird und<br />
die Leitung <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>m Bauherrn unterliegt.<br />
Die tatsächlichen Einsparungsmöglichkeiten durch betriebliche Eigenlej<br />
stungen sind somit sehr stark abhängig von <strong>de</strong>r individuellen betrieblichen<br />
Situation, und es kann hier nur die Ten<strong>de</strong>nz und die ungefähre Größenordnung<br />
abgeschätzt wer<strong>de</strong>n.
- 159 -<br />
<strong>de</strong>n, so resultiert daraus eine theoretische Einsparung an Lohnaufwendungen<br />
VDn über 70.000 DM. Die Situation bei diesem Bullenmaststall ist jedoch<br />
kaum auf einen Milchviehstall übertragbar und wür<strong>de</strong> zu<strong>de</strong>m rund 2.000 Stun<br />
<strong>de</strong>n Eigenleistung erfor<strong>de</strong>rn, die von einem Betrieb normalerweise nicht<br />
aufgebracht wer<strong>de</strong>n können. Daher sollen im folgen<strong>de</strong>n die Einsparungsmöglichkeiten<br />
anhand einer fiktiven Bauorganisation beispielhaft für die Erstellung<br />
<strong>de</strong>s dreireihigen Laufstalles für 40 Kühe aufgezeigt wer<strong>de</strong>n.<br />
1. Oie Erdarbeiten wer<strong>de</strong>n von ei ner Firma ausgeführt, da ei ne Arbei t mit<br />
Schlepper und Frontla<strong>de</strong>r unverhältnismäßig lange dauern wür<strong>de</strong>. Nachund<br />
Nebenarbeiten führt <strong>de</strong>r Betrieb aus.<br />
2. Die Schal-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten wer<strong>de</strong>n bauseitig durch<br />
geführt, wobei vier zusätzliche Lohnarbeitskräfte eingestellt wer<strong>de</strong>n<br />
und <strong>de</strong>r Betrieb eine Arbeitskraft stellt.<br />
3. In gleicher Form sind die Arbeiten zur Erstellung <strong>de</strong>s Mauerwerks or<br />
ganisiert.<br />
4. Die Putzarbeiten wer<strong>de</strong>n komplett vergeben; die Estricharbeiten wer<strong>de</strong>n<br />
von einer betriebseigenen und einer Fremdarbeitskraft durchgeführt.<br />
5. Türen, Tore und Fenster wer<strong>de</strong>n in Eigenleistung eingebaut.<br />
6. Alle Anstricharbeiten wer<strong>de</strong>n selbst durchgeführt, während die Fliesenlegerarbeiten<br />
und das Setzen <strong>de</strong>r Futterkrippen an Unternehmer vergeben<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Spaltenbö<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Anlieferfirma direkt<br />
auf die Kanäle aufgelegt; Nacharbeiten erfolgen bauseitig.<br />
7. Oie Zimmermannsarbeiten und die Dachein<strong>de</strong>ckung wird wie<strong>de</strong>r von vier<br />
Lohnarbeitskräften und einer betriebseigenen Arbeitskraft durchgeführt.<br />
Den Einbau <strong>de</strong>r Lüftung und Isolierung übernehmen eine Lohnar<br />
beitskraft und eine betriebseigene Arbeitskraft.<br />
Auf Basis einer <strong>de</strong>rartigen Bauorganisation ergibt sich eine betriebliche<br />
Eigenleistung von 756 Stun<strong>de</strong>n und ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 1571<br />
Stun<strong>de</strong>n, die durch Lohnarbeitskräfte zu <strong>de</strong>cken sind. Die restlichen 809<br />
Arbeitsstun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n durch Unternehmer übernommen, die dafür einen Ge<br />
samtbetrag von 31.324 DM in Rechnung stellen. Je nach Bewertung <strong>de</strong>r Eigenleistung<br />
und <strong>de</strong>s Lohnansatzes für die vom Bauherrn auf Stun<strong>de</strong>nlohnbasis<br />
einzustellen<strong>de</strong>n Arbeitskräfte ergeben sicn nun unterschiedliche Auswirkun-
- 160 ..<br />
gen gegenüber <strong>de</strong>r Ausgangssituation, die in Tabel e 27 als Alternative I<br />
abgetragen ist. Als l.ohnansatz für die Fremdarbeitskräfte wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n<br />
fünf berechneten Szenarios zunächst <strong>de</strong>r auch sonst unterstellte Regiestun<strong>de</strong>nsatz<br />
von 37,60 DM angesetzt und daneben ein Betrag von 17,50 DM, <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Richtpreissammlung <strong>de</strong>r Al.B-Hessen für die Erstellung landwirtschaftlicher<br />
Betri ebsgebäu<strong>de</strong> entnommen wur<strong>de</strong> und dort als l.ohnansatz ei nes Iandwirtschaftlichen<br />
Betriebsleiters ausgewiesen ist /135/. Als weitere Alter<br />
native wur<strong>de</strong> ein l.ohn von 11,- DM unterstellt, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Empfehlungen für<br />
die Verrechnungssätze <strong>de</strong>r Maschinen- und Betriebshilfsringe in Bayern /83/<br />
entnommen ist. Die Eigenleistung <strong>de</strong>s Bauherrn fällt zwar nicht direkt als<br />
Auszahlung im Rahmen <strong>de</strong>s Bauvorhabens an, doch wur<strong>de</strong> als Fakorentlohnung<br />
<strong>de</strong>r eigenen Arbeitsleistung in <strong>de</strong>n Alternativen 11 und IV ebenfalls ein<br />
Satz von 17,50 DM angesetzt.<br />
Tabelle 27: l.ohnaufwendungen zur Erstellung <strong>de</strong>s 3reihigen l.aufstalles für<br />
40 Kühe bei unterschiedlichem l.ohnansatz<br />
Alternative I II III IV V VI<br />
l.ohnansatz in DM/APh<br />
Unternehmer 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6 37,6/40,6<br />
Fremdarbeitskräfte 37,6 37,6 37,6 17,5 17,5 11,0<br />
Eigenleistung 37,6 17 ,5 - 17,5 I - -<br />
Unternehmerleistunq<br />
APh<br />
809 31.324<br />
Lohnsummen<br />
31.324 31.324<br />
in DM<br />
31.324-'--;-r 31.324 31.324<br />
Fremdarbeits- 1571<br />
kräfte<br />
Eigenleistung 756<br />
59.070<br />
28.427<br />
59.070<br />
13.230<br />
59.070<br />
-<br />
27.475<br />
13.230<br />
27.475<br />
-<br />
17.463<br />
-<br />
Summe 3136 118.821 103.624 90.394 72. 029 58. 799 48. 787<br />
Abweichung zu -15.197 -28.427 -46. 792 -60.022 -70. 034<br />
Alternative I<br />
Unter diesen Prämissen ergeben sich durch die Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Bauorganisation<br />
je nach l.ohnansatz Differenzbeträge zur Ausgangssituation zwischen 15.200<br />
und 7.000 DM. Einsparungsm6glichkeiten im l.ohnaufwand von ca. 60.000 DM<br />
o<strong>de</strong>r rund 50 % wie sie in Alternative V ausgewiesen sind, erscheinen dabei<br />
unter <strong>de</strong>m <strong>de</strong>rzeitigen l.ohnniveau durchaus realistisch Es ist aber zu be<br />
rücksichtigen, daß sich die gewählte Bauorganisation nicht beliebig auf<br />
die gr6ßeren Planungslösungen übertragen läßt, da in <strong>de</strong>n meisten Betrieben<br />
mit einer Eigenleistung von fast 800 Stun<strong>de</strong>n die absolute Obergrenze <strong>de</strong>r<br />
innerbetrieblich verfügbaren Arbeitskapazität erreicht sein dürfte.
- 161 -<br />
Anband di eser Bei spi e1srechnung über di e Auswi rkungen unterschi edl i eher<br />
Bauorganisationen wird <strong>de</strong>utlich, daß je nach <strong>de</strong>r arbeitswirtschaftlichen<br />
Situation eines Betriebes durch verstärkte Eigenleistung in erheblichem<br />
Umfang Kapital eingespart wer<strong>de</strong>n kann. Das bauliche Risiko steigt jedoch<br />
bei Selbsthilfemaßnahmen insofern an, als die Gewährleistungspflicht <strong>de</strong>s<br />
Unternehmers entfällt. Oie Planung von Eigenleistung sollte daher sorgfältig<br />
mit <strong>de</strong>r persönlichen Qualifikation <strong>de</strong>r potentiell Ausführen<strong>de</strong>n abge<br />
stimmt wer<strong>de</strong>n. Zu<strong>de</strong>m ist bei <strong>de</strong>r Planung <strong>de</strong>r Bauabwicklung und <strong>de</strong>s Anteils<br />
eigener Arbeitsleistung primär zu gewährleisten, daß <strong>de</strong>r normale Betrieb<br />
sablauf nicht nachhaltig gestört wird, da Einsparungen bei Gebäu<strong>de</strong>investitionen<br />
schnell durch Verluste im Restbetrieb überkompensiert wer<strong>de</strong>n kön<br />
nen.<br />
Neben <strong>de</strong>n Einsparungsmöglichkeiten durch Eigenleistung st als letzter wesentlicher<br />
Bestimmungsfaktor noch <strong>de</strong>r Einfluß <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>abmessungen auf<br />
<strong>de</strong>n Investitionsbedarf zu untersuchen. Eine Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>abmessungen<br />
ergab sich bei allen bisherigen Planungsalternativen ausschließlich<br />
durch die Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Aufst al l unqs for'm und
- 162 -<br />
Eines <strong>de</strong>r ausschlaggebendsten Kriterien für <strong>de</strong>n Flächenanspruch <strong>de</strong>r<br />
bisherigen Planungen bestand in <strong>de</strong>r For<strong>de</strong>rung, je<strong>de</strong>r Kuh einen eige<br />
nen Freßplat z von min<strong>de</strong>stens ca. 65 cm zur Verfügung zu stellen. Wird<br />
von dieser For<strong>de</strong>rung abgerückt und zu einer Vorratsfütterung überge<br />
gangen, so kann in einem dreireihigen Laufstall <strong>de</strong>r Melkst.nd um 90<br />
Grad gedreht wer<strong>de</strong>n. Wenn gleichzeitig VOn <strong>de</strong>m ursprünglichen Melk<br />
stand für 2x5 Tiere auf die nächst kleinere und durchaus ausreichen<strong>de</strong><br />
Lösung für 2x4 Tiere übergegangen wird, ergibt sich eine zwar gerin<br />
gere, aber durchaus ausreichen<strong>de</strong> Fläche für die Nebenräume. Dies gilt<br />
insbeson<strong>de</strong>re, wenn die WärmeY'ückgewinnung eingespart wird o<strong>de</strong>r die<br />
Vakuumpumpe über <strong>de</strong>m Milchraum angeordnet wird.<br />
2 In <strong>de</strong>r ursprünglichen Lösung wur<strong>de</strong> für die Liegeboxen durchwegs eine<br />
Tiefe von 2,20 m eingeplant. Bei gegenständigen Boxen kann hier auf<br />
2,10 mTiefe verkürzt wer<strong>de</strong>n (KOLLER 1979/77/). Die Größe <strong>de</strong>s Warte<br />
raumes vor <strong>de</strong>m Melkstand kann ebenfalls ohne wesentliche Nachteile<br />
von 3,45 m auf 2,30 m Tiefe reduziert wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Futterkrippen erleichtern zwar die Futtervorlage, doch wird in <strong>de</strong>r<br />
Praxis auch in vielen Ställen mit Erfolg ein nur planbefestigter Fut<br />
teetisch eingesetzt mit <strong>de</strong>r Konsequenz, daß das Futter in gewissen<br />
Zeitabstän<strong>de</strong>n nachgeschoben wer<strong>de</strong>n muß (JONGEBREUR 1982 /68/).<br />
4. Oie Futtertischbreite selbst ist in <strong>de</strong>r ursprünglichen Planung mit.<br />
4,50 m relativ großzügig ausgelegt. FUr eine Fut.terversorgung mit <strong>de</strong>m<br />
La<strong>de</strong>wagen be<strong>de</strong>utet eine Breite von 3,50 m zwar eine Einschränkung;<br />
sie kann aber durchaus als akzeptabel gelten (WITT 1980/128/).<br />
5. Kraftfutterabrufautomaten bieten vor allem in Hochleistungsher<strong>de</strong>n<br />
Vorteile, da die geWährten Kraftfuttermengen von <strong>de</strong>n KUhen im Melk<br />
stand teilweise nicht in <strong>de</strong>r gegebenen Zeit aufgenommen wer<strong>de</strong>n kön<br />
nen. Der überwiegen<strong>de</strong> Teil aller Laufställe wird jedoch nach wie vor<br />
mit <strong>de</strong>r let.zteren Fütterungsart betrieben (PIRKELMANN u. 8öHM 1982<br />
/100/), was bei einer entsprechen<strong>de</strong>n Gestaltung <strong>de</strong>r Futterration auch<br />
gerechtfertigt ist (ZÄHRES 1980/132/). Gleichzeitig kann auch <strong>de</strong>r<br />
Raum fUr die Steuerungs- und Uberwaohungseinheit eingespart. wer<strong>de</strong>n.
- 166 -<br />
Auffallend gering fäl t die Abweichung bei <strong>de</strong>r Melktechnik aus. Dieser<br />
Komplex wird zwar durch <strong>de</strong>n Übergang auf einen Doppel-Vierer-Melkstand und<br />
<strong>de</strong>n Verzicht auf eine Wärmerückgewinnungsanlage erheblich billiger, doch<br />
enthält <strong>de</strong>r Betrag von rund 43.000 DM zusätzlich <strong>de</strong>n Preis für die Ein<br />
ri chtungen zur Kraftfutterzutei 1ung imMe1kstand. Di e son sti gen Ei nspa t-un-:<br />
gen liegen mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r im erwarteten Rahmen und solien daher hier<br />
nicht weiter erläutert wer<strong>de</strong>n.<br />
Insgesamt zeigen die im Abschnitt 6.3 nur beispielshaft diskutierten Va<br />
rianten <strong>de</strong>r ursprünglichen Berechnungsansätze, daß <strong>de</strong>r Gesamtinvestitions<br />
bedarf für ein landwirtschaftliches Betriebsgebäu<strong>de</strong> durch eine von einem<br />
o<strong>de</strong>r nur wenigen Parametern abhängige Kennzahl kaum hinreichend genau zu<br />
erfassen ist. Es ist vielmehr festzustellen, daß eine Vielzahl von Ein<br />
fl ußfaktoren z. L erheb1i chen Verän<strong>de</strong>rungen in<strong>de</strong>r Höhe und Zusammenset<br />
zung <strong>de</strong>s Aufwan<strong>de</strong>s bewirken kann. Vor diesem Hintergrund ist anschließend<br />
zu diskutieren, inwieweit das vorgestellte, stärker differenzieren<strong>de</strong> Kal<br />
kulationsverfahren <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen an ein umfassend einsetzbares System<br />
genügt, und welche Verbesserungsansätze sich aus eventuellen Kritikpunkten<br />
ergeben.
- 167 -<br />
7. Diskussion und Einordnung <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong><br />
Mit <strong>de</strong>r Erste1i ung <strong>de</strong>s vorstehend beschri ebenen Ka1kul ationssystems wur<strong>de</strong><br />
das Ziel verfolgt, eine mögl ichst weitgehen<strong>de</strong> und fundierte Planungs- und<br />
Entscheidungshilfe für die verschie<strong>de</strong>nen Phasen einer baulichen Investi<br />
tion zu schaffen (s.S. 5). Dabei stand thematisch nicht <strong>de</strong>r architektoni<br />
sche Entwurf o<strong>de</strong>r die statische Auslegung, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Investitionsbedarf<br />
und die ihn beeinflussen<strong>de</strong>n Faktoren im Vor<strong>de</strong>rgrund <strong>de</strong>s Interesses. Bei<br />
<strong>de</strong>r Konzept i on <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> war dabei zu berücksi chti gen, daß in<strong>de</strong>n ver<br />
schie<strong>de</strong>nen Phasen und von <strong>de</strong>n potentiellen Anwen<strong>de</strong>rgruppen sehr unter<br />
schiedl iche Anfor<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>n Inhalt, <strong>de</strong>n Umfang und die Genauigkeit<br />
<strong>de</strong>r Informationen gestellt wer<strong>de</strong>n, sowie auch an <strong>de</strong>n Zeitaufwand, <strong>de</strong>r zur<br />
Gewinnung dieser Informationen erfor<strong>de</strong>rl ich ist. Es bleibt abschließend zu<br />
fragen, inwieweit diese Ansprüche auch tatsächlich realisiert wer<strong>de</strong>n konn<br />
ten.<br />
7.1 Allgemeine Aussagefähigkeit<br />
Für allgemeine und mehr grundsätzlichere Aussagen zu unterschiedlichen<br />
Stallbaulösungen wird zunächst eine wenig zeitaufwendige und übersichtli<br />
che Ausweisung überschlägiger Investitionskennzahlen benötigt. Dies ist<br />
aufgrund <strong>de</strong>r geWählten methodischen Vorgehensweise bislang nicht ganz so<br />
benutzerfreundlich gelöst wie man es von an<strong>de</strong>ren Metho<strong>de</strong>n gewohnt ist. Si<br />
cherlich sind bei <strong>de</strong>m vorliegen<strong>de</strong>m System von <strong>de</strong>r Konzeption her ebenfalls<br />
<strong>de</strong>rartige relativ undifferenzierte Berechnungen möglich, in<strong>de</strong>m die hoch<br />
aggregierten Mo<strong>de</strong>lle ohne Än<strong>de</strong>rung von Einflußgrößen kalkuliert wer<strong>de</strong>n,<br />
doch ist dieses Verfahren vergleichsweise zeitaufwendig, während sich hier<br />
die Veröffentl ichung graphisch und tabellarisch dargestellter Ergebnisse,<br />
beispielsweise in einem Handbuch, zweifellos besser eignet. Diese Unzu<br />
länglichkeit ist jedoch weniger ein grundsätzlicher Kritikpunkt an einer<br />
Kalkulation mit Hilfe <strong>de</strong>r EDV als vielmehr ein Hinweis darauf, daß für<br />
<strong>de</strong>rartige allgemeine Vergleichsaussagen zukünftig ebenfalls eine Art Hand<br />
buch erstellt wer<strong>de</strong>n sollte. Gleichzeitig bietet sich für dieses Handbuch<br />
über das System eine problemlose Fortschreibung an.
- 169 -<br />
berechnen<strong>de</strong>n Gebäu<strong>de</strong>umfanges und <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>auslegung erfolgt hier auf Ba<br />
sis variabler Einfluß9rößen, die vom Anwen<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n seinen Vorstellungen<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Werten belegt wer<strong>de</strong>n können. Für eine weniger <strong>de</strong>taillierte<br />
Kalkulation, wie sie in <strong>de</strong>r Vorplanungsphase oft ausreichend sein wird,<br />
genügt hier meist bereits die Berechnung eines einzelnen Mo<strong>de</strong>lls, um hin<br />
reichen<strong>de</strong> Informationen über eine Verfahrensalternative zu erhalten.<br />
Derartige, sehr hochaggregierte Mo<strong>de</strong>lle, die alle erfor<strong>de</strong>rlichen Anfor<strong>de</strong><br />
rungen für ein komplettes Gebäu<strong>de</strong> einer bestimmten Konstruktionsart o<strong>de</strong>r<br />
für alle baulichen Anlagen eines Produktionsverfahrens berechnen können,<br />
sind jedoch zum <strong>de</strong>rzeitigen Stand <strong>de</strong>s Systemaufbaues noch nicht vorhan<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>r in Zukunft folglich noch erfor<strong>de</strong>rlichen weiteren Aggregation <strong>de</strong>r<br />
bereits bestehen<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>lle für die verschie<strong>de</strong>nen Bauteilgruppen wird<br />
zwangsläufig eine relativ große Zahl von EinflußgrBßen in <strong>de</strong>n neuen Mo<strong>de</strong>l<br />
len anfallen. Für die hier angesprochenen, zunächst nur überschlägigen<br />
Kalkulationen erscheint es jedoch nicht in je<strong>de</strong>m Falle sinnvoll, <strong>de</strong>n An<br />
wen<strong>de</strong>r im kalkulatorischen Ablauf zu einer Überprüfung und eventuellen<br />
Überschreibung a l l dieser Einflußgrößen zu zwingen. Vielmehr wird es oft<br />
mals ausreichen, nur die wichtigsten Einflußgrößen zu überprüfen, d.h.<br />
diejenigen Variablen, die das Ergebnis <strong>de</strong>r Kalkulation am stärksten beein<br />
flussen. Zu diesem Zweck sollte zukUnftig eine Wichtung <strong>de</strong>r Einflußgrößen<br />
durchgefUhrt wer<strong>de</strong>n ähnlich wie sie von HAMMER 1983 /55/, BAUER 1981 /13/<br />
und 8AUER 1982 /14/ fUr einen Teilbereich <strong>de</strong>r Arbeitszeitkalkulation in<br />
<strong>de</strong>r Tierhaltung durchgeführt wur<strong>de</strong>n. Ei ne entsprechen<strong>de</strong> Kennzei chnung <strong>de</strong>r<br />
Variablen mit <strong>de</strong>m hBchsten Gewicht könnte hier zu einer weiteren Verringe<br />
rung <strong>de</strong>s erfor<strong>de</strong>rlichen Zeitaufwan<strong>de</strong>s für allgemeine Kalkulationen führen.<br />
Ähnliche Ansätze führten bei einem nach gleichen Grundsätzen erstellten<br />
Kalkulationsverfahren zur Berechnung <strong>de</strong>r Wirtschaftlichkeit von Biogasan<br />
lagen zu einer Eingrenzung auf nur 12 Einflußgrößen, durch die ca. 90 %<br />
<strong>de</strong>r insgesamt erreichbaren Genaui gkeit best immt wer<strong>de</strong>n /107/.
Aussagekraft<br />
schränkt w i rd<br />
- 171 -<br />
<strong>de</strong>r Berechnungen in Anlehnung an DIN 276 stark einge-<br />
Hierfür sind insbeson<strong>de</strong>re zwei Grün<strong>de</strong> maßgebend:<br />
1. In <strong>de</strong>r Landwirtschaft wird in vielen Fällen ein Teil Leistungen<br />
über bauliche Selbsthilfernaßnahmen durchgeführt, so daß hier Berech<br />
nungen auf Basis von Einheitspreisen für komplette Bauleistungen<br />
icht zu <strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n Bauherrn relevanten Preisen führen<br />
Auch die an Unternenmen vergebenen Aufträge wer<strong>de</strong>n oftmals nicht auf<br />
Basis von Ausschreibungsangeboten für die Gesamtieistung, son<strong>de</strong>rn i<br />
vielen Fällen auf Nachweis von Arbeitszeit- und Materialverbrauch ab<br />
gerechnet.<br />
Eine Planungsmetho<strong>de</strong>, die unt e r diesen Bedingungen auch nur ansatzweise<br />
eine Optimierung erlauben soll, muß zwingend neben <strong>de</strong>n monetären Fak<br />
toren auch eine möglichst exakte Berechnungsmöglichkeit <strong>de</strong>s Arbeitszeitbe<br />
darfes und <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rlichen Materialien enthalten. Eine <strong>de</strong>rartige Auf<br />
schlüsse!ung ist zu<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Hauptansatzpunkt für ssenschaftliche Untersu-<br />
chungen an unterschiedlichen Verfahrens16sungen. Die ung di e ser Da-<br />
ten wur<strong>de</strong> daher in <strong>de</strong>m vorliegen<strong>de</strong>n System Grundlage je<strong>de</strong>r<br />
tären Bewertung. Vor allem bei <strong>de</strong>r Berechnung <strong>de</strong>s Materialbedarfes kann<br />
dabei eine sehr hohe Genauigkei erz t el t wer<strong>de</strong>n , nen Berech<br />
nungen auf Basis <strong>de</strong>r tatsächlichen Abmessungen<br />
f akto ren <strong>de</strong>s konkreten Pianungsobjektes Ei<br />
s pez t sehen Wertes je<strong>de</strong>r ei nz e lnen<br />
er'für'<strong>de</strong>,rlich, 1e Einflußgrößen bereits<br />
Voreinstellwerten belegt wur<strong>de</strong>n, die unter<br />
Gültigkeit besitzen.<br />
ist dabei jedoch neswegs<br />
ichen Bedl<br />
grundsätzlich ähnlicher Weise wer<strong>de</strong>n die benöt gter Arbeitszeiten be<br />
r e chne t , wobei hier Ar-oe t t sz e t t funkt t onen vom methoclischen Ansatz her<br />
ebenfalls eine im Verhältnis hohe KaIku l at i onsoenau i qke t t ermöglichen 1 da<br />
alle signifikanten Einf1ußfaktoren problemlos berücksichtigt wer<strong>de</strong>n kön-<br />
Die Gewinnur,g <strong>de</strong>s größten Teils <strong>de</strong>r Arbeitszeitfunktionen aus<br />
be i t sz e i beinhaltet hingegen cherl ei<br />
cherhei da diese Richtwerte nicht auf<br />
.tel en gewonnen wur<strong>de</strong>n. Die Oberprüfung <strong>de</strong>r Daten<br />
Vergl jedoch Teil<br />
gewissen<br />
mit<br />
I ehen Bau<br />
l-Ist-
- 172 -<br />
durchaus befriedigen<strong>de</strong> Übereinstimmung. In <strong>de</strong>njenigen Bereichen hingegen,<br />
in <strong>de</strong>nen große Abweichungen auftraten, wur<strong>de</strong>n neue Funktionen anhand ge<br />
ner Messungen erstellt.<br />
Auch zukünftig erscheint es jedoch für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Arbeitszeitanalyse<br />
dringend erfor<strong>de</strong>rlich, weltere Soll-Ist-Vergleiche durchzuführen und die<br />
Funktionen gegebenenfalls weiter an die spezifischen Bedingungen <strong>de</strong>s land-<br />
wirtschaftlichen Baugeschehens anzupassen. Darüberhinaus stehen in ni<br />
Bereichen bisher noch keinerlei Arbeltszeltdaten zur Verfügung, so daß<br />
hier weitere Messungen erfor<strong>de</strong>rlich sind. Gewisse Abweichungen<br />
sächlich benötigten Arbeitszeit von <strong>de</strong>n Uber die Mo<strong>de</strong>llkalkulan errech<br />
neten Werten wer<strong>de</strong>n sich jedoch nie ausschalten l a s se n , nicht alle bei<br />
<strong>de</strong>r tatsächlichen Bauausführung auftreten<strong>de</strong>n Einflüsse im vorhinein exakt<br />
zu erfassen und in Funktionen zu berücksichtigen si<br />
Die Berechnung <strong>de</strong>s finanziellen Aufwan<strong>de</strong>s f ür ein Bauobjekt erfolgt erst<br />
im Anschluß an die reine Mengenberechnung durch eine Bewertung <strong>de</strong>r ver<br />
schie<strong>de</strong>nen Aufwandsfaktoren Die erfor<strong>de</strong>rliche Arbeitszeit und die<br />
alien wer<strong>de</strong>n dabei mit <strong>de</strong>n Einzelpreisen pro Einheit multipliziert. Ent<br />
schei<strong>de</strong>nd für die potentielle Genauigkei <strong>de</strong>r Berechnungen ist<br />
zwar für alle Löhne und Preise be re i durchsc hni t tl i ch zu erwarten<strong>de</strong> An<br />
sätze vorgegeben sind, diese jedoch individuell für ein einzel Bauvor<br />
haben mi <strong>de</strong>n tatsächlich relevanten Preisen überschrieben wer<strong>de</strong>n können.<br />
Die im methodischen Aufbau begrün<strong>de</strong>te vollständige Trennung <strong>de</strong>r<br />
von <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>lldatei ermöglicht hier sogar, beliebig viele, beispielsweise<br />
auch regional differenz i er te Prei ssamm l unqen zu erstellen, und diese je<br />
weils <strong>de</strong>n speziellen Kalkulationen zuzuordnen. An<strong>de</strong>rerseits kann so bei<br />
einem einzelnen Bauvorhaben mi zunehmen<strong>de</strong>m Informationsstand über die<br />
tatsächlichen, für <strong>de</strong>n Bauherrn<br />
kulation sukzessive erhöht wer<strong>de</strong>n.<br />
evanten Preise die Genauigkeit <strong>de</strong>r Kal<br />
Für wissenschaftliche Zwecke erlaubt<br />
diese Trennung zu<strong>de</strong>m über Simulationsrechnungen eine Untersuchung <strong>de</strong>r<br />
Wettbewerbsfähigkeit unterschiedlicher Stallbaulösungen unter verschie<strong>de</strong><br />
nen Lohn- und Preisverhältnissen o<strong>de</strong>r unterschiedlichen organisatorischen<br />
Rahmenbedingungen.<br />
Im kalkulatorischen Ablauf <strong>de</strong>s Systems erfolgt die Berechnung Mengen<br />
und darauf aufbauend auch <strong>de</strong>r Preise grundsätzlich getrennt für je<strong>de</strong> ein<br />
zelne Tell1eistung. Aufgrund <strong>de</strong>r Möglichkei , alle aufwandsbestimmen<strong>de</strong>n
- 173 -<br />
Parameter nach Maßgabe <strong>de</strong>r spezifischen Bauplanung zu verän<strong>de</strong>rn, ist <strong>de</strong>r<br />
Anwen<strong>de</strong>r in<strong>de</strong>r Lage, di e genaue Aufwandszusammensetzung sei nes Bauvorha<br />
bens bis hin zum Arbeitszeit- und Materialbedarf für je<strong>de</strong> Position aus <strong>de</strong>m<br />
Ergebni s abzul esen und so auch die Auswi rkungen geri ngfügi ger Än<strong>de</strong>rungen<br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Oetai Iplanung zu analysieren. Da gleichzeitig auch alle<br />
Preis- und Lohnvorgaben 'individuell variiert wer<strong>de</strong>n können, sind somit die<br />
wesent I i ehen Grundvoraussetzungen für di wei tgehen<strong>de</strong> Opt imi erung ei ner<br />
Baulösung und auch <strong>de</strong>r Bauausführung gegeben. Diese Optimierung kann eben<br />
fal s über Simulationsrechnungen erfolgen Die bei<strong>de</strong>n Teilbereiche "Men<br />
gen" und "Preise" stehen dabei in einer engen Wechselbeziehung zueinan<strong>de</strong>r,<br />
da die Planung <strong>de</strong>r möglichen Bauausführung insbeson<strong>de</strong>re bei baulichen<br />
Selbsthilfemaßnahmen nur unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r jeweiligen Ansprüche<br />
unterschiedlicher Konstruktionen o<strong>de</strong>r Material en erfolgen kann<br />
Derartige Optimierungen eines speziellen Bauvorhabens können dabei ver<br />
schie<strong>de</strong>ne Ansatzpunkte haben. Hier ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß<br />
<strong>de</strong>rzeitig als monetäres Kriterium nur <strong>de</strong>r Investitionsbedarf, nicht aber<br />
die Jahreskosten berechnet wer<strong>de</strong>n können. Doch auch unter dieser Ein<br />
schränkung ergeben sich bereits sehr vielseitige Aussagemöglichkeiten <strong>de</strong>s<br />
Mo<strong>de</strong>llkalkulationssystems.<br />
Zunächst kann durch die vergleichen<strong>de</strong> Kal kul on unterschiedl icher kon<br />
struktiver Auslegungen baulicher Details eine Analyse <strong>de</strong>r rein naturalen<br />
Faktoransprüche erfo 1gen. Durch di e Bewertung mit eventue ',1 bereits be<br />
kannten Angebotspreisen kann so die Auswahl <strong>de</strong>r im speziellen Fall gün<br />
stigsten Bauform erfolgen. Da jedoch auch jeweils die erfor<strong>de</strong>rliche Ar<br />
beitszeit ausgewiesen wird, ergibt sich darliberhinaus die Möglichkeit,<br />
beispielsweise eine gezielte Entscheidung sehen kompletten Firmenange<br />
boten für eine bestimmte Leistung und <strong>de</strong>r Erstellung dieser Leistung in<br />
baulicher Selbsthilfe zu treffen. Einsparungen durch Eigenleistung ergeben<br />
s ich dabei vornehml ich aufgrund unterschi edl i eher Lohnansätze s di e im Sy<br />
stem bei je<strong>de</strong>r Kalkulation geson<strong>de</strong>rt festgelegt wer<strong>de</strong>n können. Unter Um<br />
kehrung <strong>de</strong>r Fragestellung ergibt sich folglich auch die Möglichkeit, die<br />
Faktorverwertung <strong>de</strong>r eigenen Arbeitskraft aus <strong>de</strong>n Ergebnissen abzulesen<br />
und so eine optimale Einsatzstrategie für die eigene Arbeitskraft abzulei<br />
ten.
- 175 -<br />
analysieren, wie es im Abschnitt 6. dieser Arbeit an einigen Beispielen<br />
dargelegt wur<strong>de</strong>. Daraus ergeben sich wichtige Ansatzpunkte zur Minimierung<br />
<strong>de</strong>s Invest i ti onsbedarfes o<strong>de</strong>r in Zusammenhang mi an<strong>de</strong>ren Planungskennzah<br />
len zur Optimierung von Verfahrenslösungen.<br />
Zweife11os erfor<strong>de</strong>rt e i ne Ausnutzung aller Mögl i chkeiten <strong>de</strong>s Systems je<br />
doch trotz <strong>de</strong>s Einsatzes <strong>de</strong>r EDV einen erheblichen Zeitaufwand. Hier er<br />
weist es sich als vorteilhaft, daß die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Anwen<strong>de</strong>r erlaubt, auf<br />
Mo<strong>de</strong>lle unterschiedlichen Aggregationsgra<strong>de</strong>s zurUckzugreifen und so <strong>de</strong>n<br />
Zeitaufwand, aber auch die Genauigkeit <strong>de</strong>r Kal kula t t on zu steuern. Zukünf <br />
tige Uberlegungen einer Verbesserung <strong>de</strong>s Systems sollten jedoch auch hier<br />
ansetzen und beispielsweise durch die bereits angesprochene Einflußgrößen<br />
gewichtung eine weitere Zeitersparnis bei <strong>de</strong>r Kalkulation ermöglichen.<br />
Hinblick auf zukünftige Arbeiten an <strong>de</strong>m Berechnungsverfahren darf zu<strong>de</strong>m<br />
n'j Ubersehen wer<strong>de</strong>n, das hi er vorgeste11te System zum <strong>de</strong>rzei ti gen<br />
Stand auch dann nicht als vollständig angesehen wer<strong>de</strong>n kann, wenn nur die<br />
Ermittlung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes als Ziel angesehen wird. Vielmehr si<br />
fUr eine Reihe von Tellleistungen noch keine Mo<strong>de</strong>lle vorhan<strong>de</strong>n, wobei<br />
beson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Bereich <strong>de</strong>r Stalleinrichtung und die gesamten sonstigen<br />
lichen Anlagen sind, die neben <strong>de</strong>m reinen Stall gebäu<strong>de</strong><br />
li einen Produktionszweig benötigt wer<strong>de</strong>n. Zu<strong>de</strong>m das<br />
zeit auf die Berechnung von Gebäu<strong>de</strong>n fUr die Milchviehhaltung beschränkt,<br />
so daß die zukünftige Arhei auch in einer Einbeziehung an<strong>de</strong>rer Produk-<br />
tionszweige bestehen rd. jedoch aufgrund <strong>de</strong>s methodischen Aufbaus<br />
alle Berechnungen immer auf die Einzelpositionen zurückgefüh-rt wercen , die<br />
bei <strong>de</strong>n sonstigen baulichen Anlagen oftmals grundsätzlich gleiche Merkmale<br />
aufweisen, dür f t e die weitere Vervollständigung Mo<strong>de</strong>llbasis nur einen<br />
erhebl geringeren zeitlichen Aufwand erfor<strong>de</strong>rn.<br />
Während die Berechnung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes fUr die Finanzierungs- und<br />
Liquiditätsplanung 'im Rahmen <strong>de</strong>r InvestItionsplanung dringend erfor<strong>de</strong>rlich<br />
ist, sollte die eigentliche Entscheidung über das Objekt jedoch auf Basis<br />
<strong>de</strong>r Jahreskosten erfolgen. Eine vordringliche Aufgabe in Hinbl ck auf die<br />
Erweiterung <strong>de</strong>r Systems besteht somit dari n , das <strong>de</strong> r z e i t i ge En<strong>de</strong>rgebni s<br />
"Investitionsbedarf" durch <strong>de</strong>n Ansatz von Abschreibungen, Verzinsung, Ver<br />
sicherungen, Reparaturen und Betriebskosten zu <strong>de</strong>n Jahreskosten zu erwei<br />
tern, Die Architektur <strong>de</strong>s gesamten Mo<strong>de</strong>llkalkulationssystems läßt genügend<br />
Raum fUr <strong>de</strong>rartige Erweiterungen, so daß von <strong>de</strong>r Methodik her kaum größere
Probleme zu erwarten sind"<br />
- 176 -<br />
Während somit zum <strong>de</strong>rzeitigen Entwicklungsstand <strong>de</strong>s Kalkulationssystems<br />
noch eine Reihe von Arbeiten zur Vervollständigung und Erweiterung anste<br />
hen, ist in Hinblick auf zukünftige Verwendungsmbglichkeiten noch ein wei<br />
terer Aspekt von entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utJng" Durch di e methodi sehe Trennung<br />
<strong>de</strong>r reinen Mengenberechnung von <strong>de</strong>r finanziellen Bewertung ergeben sich<br />
erheblich vereinfachte Mbglichkeiten zukünftiger Datenfortsehreibung. Wäh<br />
rend Lbhne und Materialpreise mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r einer ständigen Verän<strong>de</strong>rung<br />
unterliegen, ist bei <strong>de</strong>n Verfahren <strong>de</strong>r Bauerstellung und bei <strong>de</strong>n verwen<strong>de</strong><br />
ten Material i e n nur ein vergleichsweise geringer Wan<strong>de</strong>l im Zeitablauf<br />
verzeichnen. Somit kann für die einmal erstellten Mo<strong>de</strong>lle Berechnung<br />
<strong>de</strong>s Material- und Arbeitszeitaufwan<strong>de</strong>s eine relativ lange Gültigkeitsdaue"<br />
erwartet wer<strong>de</strong>n, wodurch sich das Problem <strong>de</strong>r Datenfortschreibung Uberwie<br />
gend auf die Anpassung <strong>de</strong>r Preisdatei an die aktuelle Marktsituation redu<br />
ziert. Dies ist jedoch mit verhältnismäßig geringem zeitlichen Aufwand<br />
durchführbar, so daß das allgemein sehr große Problem <strong>de</strong>r Datenpflege übe r<br />
einen längeren Zeitraum hinweg zum ersten Male lösbar erscheint.
Zusammenfassung<br />
- 177 -<br />
Investitionen in Betriebsgebäu<strong>de</strong> und bauliche Anlagen erfor<strong>de</strong>rn heute sehr<br />
hohe Kapitalaufwendungen und gehören somit zu <strong>de</strong>n risikoträchtigsten Ent<br />
scheidungen, die Im Rahmen <strong>de</strong>s landwirtschaftlichen Betriebsmanagements<br />
anfallen. Gleichzeitig ist die Spannweite <strong>de</strong>s erfor<strong>de</strong>rlichen Investitions<br />
bedarfs infolge unterschiedlicher Baugestaltungs- und Ausführungsmöglich<br />
keiten sehr groß, wobei Preisdjfferenzen bis zu 100 % durchaus realistisch<br />
sind.<br />
Von Seiten <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen Praxis, <strong>de</strong>r Beratung und <strong>de</strong>r Wissen<br />
schaft besteht daher eine starke Nachfrage nach Kalkulationsverfahren, die<br />
nicht nur eine mehr überschlägi ge, son<strong>de</strong>rn auch ei ne mög 1i chst exakte Vor<br />
ausschatzung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes Von Planungslösungen für landwirt<br />
schaft I i ehe Bet r i ebsgebäu<strong>de</strong> ermögl i ehen. Oie <strong>de</strong>rze i verfügba ren Metho<strong>de</strong>n<br />
können jedoch diese Nachfrage nur mit Einschränkungen befriedigen, da sie<br />
entwe<strong>de</strong>r aufgrund fehlen<strong>de</strong>r Datenfortschreibung zum heutigen Zeitpunkt<br />
keine aktuellen Aussagen mehr zulassen o<strong>de</strong>r vom methodischen Ansatz her zu<br />
zeitaufwendig sind. In Deutschland steht <strong>de</strong>rzeit nur ein praktikables Kal<br />
kulationsverfahren auf Basis aktueller Daten zur Verfügung, welches jedoch<br />
nur eine Uberschlägige Kalkulation alternativer Lbsungen fUr verschie<strong>de</strong>ne<br />
P1'oduktionszweige erlaubt, wobei sich die spezifische Anpassungsmöglich<br />
keit auf das Kriterium <strong>de</strong>r' Bestan<strong>de</strong>sgröße und auf die Auswahl unter fix<br />
vorgegebenen "Kostenblöcken" für <strong>de</strong>n Bereich St a l , Futter, Gülle und<br />
Milch beschränkt.<br />
Vor diesem Hintergrund wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit zunächst das Ziel<br />
<strong>de</strong>r Entwicklung einer Ka l kul at ton smet.hods verfolgt, welche es erlaubt,<br />
nach Maßgabe <strong>de</strong>r spezifischen Bedingungen eines konkreten Bauvorhabens <strong>de</strong>n<br />
voraussichtlichen Investitionsbedarf und die natur a l en Faktoransprüche<br />
möglichst exakt zu berechnen und <strong>de</strong>tailliert auszuweisen. Die For<strong>de</strong>rung<br />
nach Berücksichtigung spezifischer Bedingungen umfaßte dabei nicht allein<br />
das Teilzie! <strong>de</strong>r Kalku!ationsmöglichkeit nach individuellen Maßen und<br />
terialien, son<strong>de</strong>rn darüberhinaus auch das Ziel, die <strong>de</strong>r Landwirtschaft<br />
sehr stark genutzten Einsparungsmöglichkeiten durch bauliche Selbsthil<br />
im Berechnungsverfahren zu berücksichtigen. Zu<strong>de</strong>m sollte das Verfahren<br />
cht nur Kalkulationen für komplette Neubaulösungen zulassen, son<strong>de</strong>rn<br />
auch möglichst exakte Planungsdaten für Tei!neubau- und Umbaulösungen 1ie-
fern,<br />
- 178 -<br />
Nach Maßgabe <strong>de</strong>r gegebenen Anfor<strong>de</strong>rungen wur<strong>de</strong> ein EDV-gestütztes Kalkula<br />
ti onssystem entwi cke 1 we1ehes nachstehen<strong>de</strong> wesen tl i ehen Merkma 1e euf<br />
weist:<br />
Grundlage <strong>de</strong>s gesamten Verfahrens stellt die Berechnung <strong>de</strong>s erfor<strong>de</strong>r-<br />
1i ehen Arbeitszeit- und Materialbedarfes je<strong>de</strong> Position (Te t l l e i<br />
stung) eines Gebäu<strong>de</strong>s dar, Die Ermittlung <strong>de</strong>s Arbeitszeitbedarfes er<br />
folgt auf Basis von Ar-bertszeitfunktionen , wobei di Dimensionen <strong>de</strong>r<br />
Variablen nach Maßgabe je<strong>de</strong>r Teilleistung festgelegt wer<strong>de</strong>n können<br />
Die zu<strong>de</strong>m für eine Position notwendigen Materialarten und -mengen<br />
wer<strong>de</strong>n ebenfalls auf Basis beliebig än<strong>de</strong>rbarer Einflußgrößen be<br />
stimmt,<br />
2 Die Berechnung <strong>de</strong>s nvestttionsbedarfes einer Te t ll e i st.unq erfoigt<br />
durch Multiplikation <strong>de</strong>c erfor<strong>de</strong>rlichen Arbeitszeitstun<strong>de</strong>n und Matecialmengen<br />
mit <strong>de</strong>n Ei preisen pro Einheit,<br />
Für die unterschiedlichen Teilleistungen, die bei <strong>de</strong>r Einrichtung ei<br />
nes Gebäu<strong>de</strong>s anfallen, wur<strong>de</strong>n jeweils genständige Mo<strong>de</strong>lle erstell s<br />
welche alle zur ein<strong>de</strong>utigen Bestimmung <strong>de</strong>r Leistung erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Einflußgrößen, die Berechnungsanweisungen für e Materialmengen so<br />
wie die Auswahl- und Verknüpfungsparameter fUr die Materialarten und<br />
die Arbeitszeitfunktionen enthalten, Zusätzliche Aufwandsposten, die<br />
<strong>de</strong>n Gesamtinvestitionsbedarf beeinflussen, wur<strong>de</strong>n ebenfalls Uber ent<br />
sprechen<strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>l e berUcksichtigt,<br />
4, Da <strong>de</strong>r Zeitaufwand die Kalkulation aller Teil leistungen eines Ge-<br />
bäu<strong>de</strong>s sehr hoch ist, wur<strong>de</strong>n weiterhi n aggregierte Mo<strong>de</strong>lle für Bau<br />
teile und aauteilgruppen erstellt, die ebenfall sEinflußgrößen zur<br />
Festlegung <strong>de</strong>s Berechnungsumfanges enthalten, Je<strong>de</strong>s Bauteilmo<strong>de</strong>ll um<br />
faßt dabei diejenigen Teilleistungen, die zur Erstellung <strong>de</strong>s speZiel<br />
len Bautei s erfor<strong>de</strong>rlich sein können und qr etft auch im kalkulatori<br />
schen Ablauf auf die entsprechen<strong>de</strong>n Teilleistungsmo<strong>de</strong>lle zurUck, Ana<br />
log wird bei <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen für Bauteilgruppen verfahren, die folglich<br />
auf die Bauteilmo<strong>de</strong>ll zurückgreifen, Im Zuge <strong>de</strong>s weiteren Systemauf<br />
baues wer<strong>de</strong>n die Mo<strong>de</strong>lle fUr Bauteilgruppen aggregiert Mo<strong>de</strong>llen
- 179 -<br />
für gesamte Gebäu<strong>de</strong> unterschiedl icher Konstruktionsarten und diese<br />
wie<strong>de</strong>rum zu Mo<strong>de</strong>llen für alle baulichen Anlagen, die für ein gesamtes<br />
Produktionsvedah ren benöti gt wer<strong>de</strong>n.<br />
5. Sämtliche Einflußgrößen sind mit Voreinstellwerten belegt, die unter<br />
durchschnittlichen Bedingungen Gültigkeit besitzen, jedoch vom Anwen<strong>de</strong>r<br />
nach Maßgabe seiner speziellen Planungsvorgaben überschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n können. In die aggregierten Mo<strong>de</strong>lle wur<strong>de</strong>n dabei nur die wichtigsten<br />
Einflußgrößen <strong>de</strong>r Submo<strong>de</strong>lle übernommen, auf die bei <strong>de</strong>r Be<br />
rechnung zurückgegriffen wird. Durch di e gez i e He Auswahl <strong>de</strong>r Aggregationsstufe<br />
läßt sich somit <strong>de</strong>r Zeitaufwand für die Kalkulation,<br />
aber auch die Genauigkeit <strong>de</strong>r Berechnungen steuern. Neben <strong>de</strong>n Ein-<br />
f l ußgrößen können auch a l l e vorgegebenen Preise und Löhne vom Anwen<strong>de</strong>r<br />
bei je<strong>de</strong>m Kalkulationslauf bel iebig geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
6. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in einem <strong>de</strong>taillierten Mengen- und.,<br />
Preisgerüst, in <strong>de</strong>m alle für das kalkulierte Objekt benötigten Arbeitszeiten<br />
und Materialien aufgelistet sind. Neben <strong>de</strong>n Mengenangaben<br />
wer<strong>de</strong>n die unterstellten Preise pro Einheit, <strong>de</strong>r Gesamtpreis für je<strong>de</strong>n<br />
Posten und <strong>de</strong>r prozentuale Anteil am Gesamtergebnis ausgewiesen.<br />
Darüberhi naus we<strong>de</strong>n di e Einze lergebni sse <strong>de</strong>r monetären Berechnung<br />
wie<strong>de</strong>r aggregier't zu <strong>de</strong>m jeweiligen Investitionsbedarf <strong>de</strong>r berechneten<br />
Teilleistungen, Bauteile, Bautei1gruppen etc., so daß <strong>de</strong>r Gesamt<br />
aufwand getrennt nach <strong>de</strong>n einzelnen baulichen Einheiten analysiert<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Sämtliche Mo<strong>de</strong>lle wur<strong>de</strong>n nach einem einheitlichen Schema in Form sogenannter<br />
Dokumente abgespeichert, die zusätzl ich noch ergänzen<strong>de</strong><br />
Hinweise zur Anwendung sowie interne Parameter zur Steuerung <strong>de</strong>s Kalkulationsablaufes<br />
enthalten.<br />
In einem zweiten Teil <strong>de</strong>r Arbeit wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s skizzierten Mo<strong>de</strong>llkalkulationssystems<br />
ein Vergleich von insgesamt zehn unterschiedlichen<br />
Sta 11 baul ösungen für Bestan<strong>de</strong>sgrößen zwischen 20 und 100 Milchkühen<br />
durchgeführt. Die Planungen beruhten dabei auf <strong>de</strong>r Prämisse vol wärmege<br />
dämmter Lösungen in Mauerwerkausführung und Dachein<strong>de</strong>ckung aus Betondachsteinen.<br />
Die Berechnungen umfaßten al e für ein "funktionsfähiges Stallgebäu<strong>de</strong>"<br />
notwendigen Einrichtungen, nicht jedoch die Nebenanlagen, die<br />
Futterberge-
- 180 -<br />
hallen o<strong>de</strong>r Güllebehälter. Auszugsweise sollen die Ergebnisse kurz zusam<br />
mengefaßt wer<strong>de</strong>n:<br />
1. Bei <strong>de</strong>n Anbin<strong>de</strong>stallen schwankt <strong>de</strong>r Investitionsbedarf sehen Be-<br />
stan<strong>de</strong>sgrößen von 20 und 41 Milchkühen mit weiblicher Nachzucht im<br />
Bereich von 232.400 DM und 369.900 DM. Pro KUhplatz ergibt sich eine<br />
Degression <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes von 11.621 DM auf 8.974 DM.<br />
2. Die liegeboxenlaufställe für 40 Kühe mit Nachzucht wei sen in Relation<br />
zum vergleichbaren Anbin<strong>de</strong>stall einen um mehr als 50.000 DM höheren<br />
Investitionsbedarf auf. Dabei fällt <strong>de</strong>r Unterschied zwischen <strong>de</strong>r<br />
2reihigen und higen Aufstallungslösung mit 424.]00 DM und 420.400<br />
DM nur sehr gering aus. Bei einer weiteren Aus<strong>de</strong>hnung <strong>de</strong>r Bestan<strong>de</strong>s<br />
größe auf 60 Milchkühe nimmt <strong>de</strong>r Investitionsbedarf in <strong>de</strong>r 3reihigen<br />
Aufstallungsversion um rund ]00.000 DM zu. Pro Kuhplatz verringert<br />
sich hingegen <strong>de</strong>r mone t s re Aufwand von 10.5]0 DM auf 8.658 DM. Eine<br />
kammartige Aufstallung <strong>de</strong>r Kühe führt in dieser Bestan<strong>de</strong>sgrößenord<br />
nung zu einet' Erhöhung <strong>de</strong>s Aufwan<strong>de</strong>s auf 9.373 DM pro Kuhp l a t z . Im<br />
Bereich <strong>de</strong>r Bestan<strong>de</strong>sgrößen zwischen 80 und 100 Kühen wur<strong>de</strong>n außer<br />
für die Kalbinnen keine weiteren Nachzuchtplätze ngepl Hier<br />
sind für 80 Kühe ca. 550.000 DM erfor<strong>de</strong>rlich, während in <strong>de</strong>r<br />
ßenordnung von 100 KUhen je nach Aufstallungsart sehen rund<br />
670.000 und 722.000 DM benötigt wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Bezogen auf die Stallgrundfläche sinkt <strong>de</strong>r Investitionsbedarf von<br />
745 DM/m 2<br />
beim Anbin<strong>de</strong>stall für 20 Kühe auf 547 DM/m' beim higen<br />
Laufstal für 40 Kühe (jeweils ohne Nachzucht) und schließlich auf<br />
602 DM!m 3 beim Laufstal mit Queraufstallung für Kühe ohne<br />
Nachzucht. In Hinblick auf <strong>de</strong>n !nvestitionsbedarf pro Kubikmeter um<br />
bauten Raumes ergeben sich bei <strong>de</strong>n drei Lösungen 166DM/rn3,<br />
137 DM/mx'09' '38' und letzIich lID DM/mx'09'3x'38'.<br />
Anhand <strong>de</strong>s 3reihigen Laufstalls für 40 Kühe, <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>n zunächst<br />
vorgegebenen Bedingungen einen Investitionsbedarf 420.400 DM er<br />
for<strong>de</strong>rt, wur<strong>de</strong> zu<strong>de</strong>m beispielhaft eine Analyse von Einsparungsmög<br />
lichkeiten durchgeführt Gegenüber <strong>de</strong>n ursprünglich angesetzten Li<br />
stenpreisen für alle Materialien läßt sich eine Einsparung von ca.<br />
40.000 DM erzielen, wenn es gelingt, durchgehend über alle Baumate-
- 181 -<br />
rialien einen Preisnachlaß VOn 10 %zu erwirken. Die Verwendung von<br />
Bausteinen mit einer rund 15 % niedrigeren Wärmedammeigenschaft ver<br />
ringert <strong>de</strong>n Investitionsbedarf um ca. .500 DM, wahrend eine Dachein<br />
<strong>de</strong>ckung mit Bi<strong>tum</strong>enwellplatten statt Betondachsteinen Einsparungen<br />
von über 10.000 DM erlaubt. Wird daneben auch die Dachneigung von 25<br />
Grad auf 15 Grad verringert, so können insgesamt sogar über 20.000 DM<br />
eingespart wer<strong>de</strong>n.<br />
5. Extreme Unterschie<strong>de</strong> ergeben sich, wenn von elnlgen Prämissen <strong>de</strong>r ur<br />
sprüngl i ehen Grundrißl ösung abgegangen wird. Durch <strong>de</strong>n Verzicht auf<br />
ein Freßplatz-Tier-Verhältnis von 1 ; 1, Verkleinerung <strong>de</strong>s Melkstan<br />
<strong>de</strong>s von 2 5 auf 2 x 4 Kuhplätze und Verringerung <strong>de</strong>r Größe sonsti<br />
ger Funktionsflächen läßt sich eine Einsparung an Stallgrundrißfläche<br />
von 160 Quadratmetern erzielen. Bei gleichzeitigem Verzicht auf die<br />
Wärmerückgewinnungsanlage und die Kraftfutterabrufautomaten können<br />
rund 100.000 DM eingespart wer<strong>de</strong>n.<br />
6. Der Arbeitszeitaufwand zur Erstellung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Lösungen er·<br />
höht sich von ca. 1.700 Stun<strong>de</strong>n beim Anbin<strong>de</strong>stall für 20 Kühe auf<br />
3.100 Stun<strong>de</strong>n beim 3reihigen Laufstall für 40 Kühe schließlich<br />
5.300 Stun<strong>de</strong>n beim Laufstall für 103 Kühe. Der Lohnanteil am Gesamt<br />
investitionsbedarf beträgt zwischen 25, % und 28,3 %. Eine Bei<br />
spielskalkulation zur Analyse <strong>de</strong>r Einsparungsmöglichkeiten durch bau<br />
liche Selbsthilfemaßnahmen ergab eine Verringerung <strong>de</strong>s Finanzierungs<br />
bedarfs von 60.000 DM gegenüber <strong>de</strong>r ursprüngl i ehen Vers ion, bei <strong>de</strong>r<br />
eine Gesamterstellung <strong>de</strong>s Stalles als Unternehmerleistung unterstellt<br />
wur<strong>de</strong>. Hier wur<strong>de</strong>n hingegen als nicht bewer t.et.e Eigenleistung 756<br />
Stun<strong>de</strong>n angesetzt, sowie eine Gesamtarbeitszeit von Fremdarbeitskräf<br />
ten in Höhe von 1571 Stun<strong>de</strong>n zu ei nem Lohnansatz von 17,50 DM pro<br />
Stun<strong>de</strong>. Lediglich die restliche Arbeitszeit von 809 Stun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong><br />
hingegen voll als Unternehmerleistung zu <strong>de</strong>m ursrpUnglichen Lohnan<br />
satz von 37,60 DM angesetzt.<br />
Mit dieser Beispielskalkulation konnte aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, daß die erarbei<br />
tete Metho<strong>de</strong> di e <strong>de</strong>r Zie1ste11ung vorgegebenen Anfor<strong>de</strong>rungen an di e<br />
Aussagefähigkeit grundsätzlich er fü l l t . In einigen Teilbereichen sind je<br />
doch noch einige Verbesserungen und Ergänzungen vorzunehmen. Künftig sol<br />
te das System zu<strong>de</strong>m um die Berechnung <strong>de</strong>r jahreskosten erweitert wer<strong>de</strong>n.
Liter-atur-ver-zeich nis<br />
- 182 -<br />
I. Adam, M., Hogh-Bin<strong>de</strong>r, R. u. K.J. v. Oy: Kalkulationsdaten zur Berechnung<br />
von Baupreisen und Gebäu<strong>de</strong>kosten für Zwecke <strong>de</strong>r<br />
Vorentwurfsplanung.<br />
Agrartechnische Berichte Nr. 9, Hohenheim, 1979.<br />
2. Albaeh, H. : Investitionstheorie.<br />
epen heuer 11. Witsch, 1975.<br />
3. nschaft zur Verbesserung <strong>de</strong>r Agrarstruktur in Hessen'<br />
rtschaftliche Bauplanung.<br />
Wiesba<strong>de</strong>n 1975.<br />
4. Amen<strong>de</strong>, H.v. Hillendahl, W. HUffmeier, H., Meier, G. u. S. Schirz:<br />
Ri ehställe in agen.<br />
KTBL-Schrift 283. Münster: Landwirtschaftsverlag, 1982<br />
5. Auernhammer, H.: Eine integrierte Metho<strong>de</strong> zur Arbei<br />
KTBL-Schrift 203, Münster: Landwirschaftsverlag,<br />
6. Auernhammer H.: Aufbau und Struktur eines Kalkulationssystems fUr<br />
Arbeitszeitbedarfsermittl landwirtschaftlicher Arbeiten<br />
In: Auernhammer H. u. E. ( Arbeitszeitkalkulation<br />
in <strong>de</strong>r Landwirtschaft mit alogfähigen<br />
EDV-Programmen an Groß- und Kleinrechnern,<br />
Tagungsband, Sehriftenreihe <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstephan<br />
Nr. 8, . 3-45, Freising 1981.<br />
7. Auernhammer, H.; Landtechnische Daten im Bereich neuer Informationstechnologien.<br />
sehes Landwirtschaftliches jahrbuch 59(1982), H<br />
8. Landwirtschaftliches Informationssystem<br />
( - Teilbereich "Arbeitszeitanalyse".<br />
In: In f ormet i onsvera rbe t t.unq Agrarwissenschaft,<br />
281-292. Stuttgart: Ulmer, 1982.<br />
9. Auernhammer, H.: Verfahrenswerte für die MilchviehhaI<br />
Schriftenreihe <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstephan,<br />
S. 106-122, Freisin9 1982.<br />
Landtechnik<br />
Bd 3,<br />
1982,
- 183 -<br />
10. Baasen, E.: Kostenvergleich von Konstruktionselementen im Stallbau.<br />
Bauen auf <strong>de</strong>m Lan<strong>de</strong> 11(1960) H. 9, S. 185-190.<br />
11. Bartussek, H.: Standplatzkosten für Rin<strong>de</strong>r und Schweineställe.<br />
Landtechnische Schriftenreihe, Heft 22 <strong>de</strong>s Österreichischen<br />
Kuratoriums für Landtechnik, Wien 1976.<br />
12. Bates, D.W.: Much should he done before you start to build (Dairy<br />
farm building costs).<br />
Howard's Dairyman 123(1978), H. 12, S. 775.<br />
13. Bauer, R.: Methodische Ansätze zur Einflußgrbßengewichtung für die<br />
Ermittlung <strong>de</strong>s Arbeitszeitbedarfes <strong>de</strong>r Milchviehhaltung im<br />
Anbin<strong>de</strong>sta11.<br />
Diplomarbeit: Institut für Landtechnik Weihenstephan, Freisirg<br />
1982.<br />
14. Bauer, A.: Ermittlun9 <strong>de</strong>r Einflußgrbßengewichte auf <strong>de</strong>n Arbeitsbedarf<br />
<strong>de</strong>r spezialisierten Färsenhaltung im Anbin<strong>de</strong>st.ll.<br />
Diplomarbeit: Institut für Landtechnik Weihenstephan, Freising<br />
1981.<br />
15. Benninger, D.: Raum- und Funktionsprogramme für die Ver- und Entsorgungseinrichtungen<br />
im Milchvieh-Laufstall.<br />
Landteehnik 35(1980), H. 7, S. 323-326.<br />
16. Berger, V.' Die Neufassung <strong>de</strong>r DIN 276 - Baukostenplanung mit Gebau<strong>de</strong>elementen.<br />
In: Hutzelmeyer,H. (Hrsg.): Planung und Kontroll von<br />
Bauinvestitienskosten. Grafenau/WUrtt: Expert-Verlag, 1980,<br />
S. 38-66.<br />
17. 8erner, F.: Randarbeiten<br />
REFA-Naehrichten<br />
erfaßt wer<strong>de</strong>n.<br />
18. Bisehoff, T.· Der Einfluß von Stallgebäu<strong>de</strong>n auf die Wirtschaftlichkeit<br />
<strong>de</strong>r Tierproduktion.<br />
DLG Archiv 1978) H. 61, S. 7-35.<br />
19. 8l.sehke 0.: Optimierung von Stallplanung und Arbeitsverfahren in<br />
Milehviehhaltung.<br />
Dissertation, Kiel 1967
- 184 -<br />
20. Bauman-Sweers, M.J.M: Neue Mbglichkeiten fUr Liegeboxenställe?<br />
Landbouwmechanisatie 29(1978), H. 4, S. 401-404.<br />
21. Boxberger J.: AUfstallungsformen fUr Milchvieh.<br />
ftenreihe <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstephan H. I,<br />
S. 11-31, Freising 1982.<br />
22. Boxberger, J .. Wichtige Verhaltensparometer von KUhen als Grundlage<br />
Zur Verbesserung <strong>de</strong>r Stalleinrichtung.<br />
Forschungsbericht k <strong>de</strong>r Max-Eyth-Gesellschaft<br />
Nr. 80, Freising: k Weihenstephan 1983<br />
23. Bran<strong>de</strong>s, W. u. H.-J. Bud<strong>de</strong>: COMPRI - Eine computergestUtzte Planung<br />
risikobehafteter Investitionen.<br />
Gbttinger Schriften zur Agrarbkonomie H.47, 1982.<br />
24. Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
(Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für Ernährung Landwirtschaft<br />
und Forsten <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik DeutschI<br />
Münster: Landwirtschaftsverlag, versch. Jg.<br />
25. Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
(Hrsg.): BMELF - Informationen Nr. 23, Bonn 1983.<br />
26. Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
(Hrsg. BMELF - Informationen Nr. 3D, Bonn 1983<br />
27. Burkhardt, G.: Koscenor-obl eme <strong>de</strong>r Bauproduktion .<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, in: Bauverlag, 1963.<br />
28. Oe<br />
29. Detwiler, E.: Die Investitions<strong>de</strong>ckung - Ein neuer Begriff und seine<br />
mbgliche Be<strong>de</strong>utung.<br />
Schriftenreihe <strong>de</strong>r fUr<br />
Betriebswirtschaft S.<br />
121-140.<br />
30. Deutscher Bun<strong>de</strong>stag (Hrsg.): Agrarberieht.<br />
Bann Verlag Heger, verseh. Jg.
- 185 -<br />
31 Drees, G. u. G. Haag: Ermittlung von HochbauKosten nach <strong>de</strong>r Elementmetho<strong>de</strong>.<br />
Deutsche Bauzeitung 11(1975).<br />
32. Drees, G. u. D. Hirsch: Die Kalkulationsmetho<strong>de</strong>n<br />
st r i e .<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, Berlin: Bauverlag, 1968.<br />
33. Drees, G. u. D. Spranz: Arbeitszeiten im Baubetrieb.<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, Berlin: Bauverlag, ]975.<br />
<strong>de</strong>r Bauindu-<br />
34. Dressel, G.: Die Arbeitsstudie im Baubetrieb. Schriftenreihe <strong>de</strong>s<br />
REFA-Fachausschusses Bauwesen.<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, Berlin: Bauverlag, 1961.<br />
35. Dr-esse l , G.: Auswertung <strong>de</strong>r Nachkalkulation für die Vorkalkulation<br />
im Baubetrieb.<br />
Baupraxis (1963), H. 9, S. 971-974.<br />
36. Duic, Z. u. F.C. Trapp: Handbuch fur die Kalkulation von Bauleis<br />
t unqen. Bd. 1-6.<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, Berlin: Bauverlag, 1974.<br />
37. Dumstorf, H.: Die Scheingewinnermittlung in landwirtschaftlichen<br />
Betrieben.<br />
Agrarwirtschaft, Son<strong>de</strong>rheft 78(1979).<br />
38 Eidgenössische Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft<br />
technik: Prei sbaukasten für l andwtr-t.schaf t ' iche<br />
bäu<strong>de</strong><br />
Tänikon 1968, 1978.<br />
und Land<br />
Betriebsge-<br />
39. Englert, G.· Wirtschaftliche Optimierung <strong>de</strong>r Wärmedämmung von Ställen.<br />
Grundlagen <strong>de</strong>r Landtechnik 3](1981) H. 4, S. 109-144.<br />
40. Fleischmann, H.D.: Kalkulationswerte für Standardleistungen. Richtwerte<br />
für Rohbauarbeiten <strong>de</strong>s Hoch- und Ingenieurbaus.<br />
Düsseldorf: Werner-Verlag, 1975.
- 186 -<br />
41. Fleischhauer, E. u. M. Heeren: Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Bestandsgröße und<br />
Aufstallung für die Wirtschaftlichkeit <strong>de</strong>r Milchviehhaltung.<br />
Agrarwirtschaft 14(1965) H. 3, S. 165-176.<br />
42. Fr i t z , R.: anung, Maßordnung, Elementierun9 landwirtschaftlicher<br />
ebsgebäu<strong>de</strong>.<br />
München-Wolfratshausen: Neureuther, 197<br />
43. Fritz, R., Klett,H. u. Zellnsr: Beurteilungen von Betriebsplanungen.<br />
KTBl-Schrt f t 163, Münster: l.andw t rtschaftsverl ag, 1973.<br />
44. Fronza, M.:<br />
Zei t schri f t für<br />
S. 41-54.<br />
mittels EDV für das industrielle Bauen.<br />
Führungskräfte, Darmstadt 1/2(1970),<br />
45. Fronza, M. Auswertung <strong>de</strong>r Nachkalkulation für di Vorkalkulation im<br />
Hochbau.<br />
IFA-Nachrichten in Baupraxis (1963),<br />
46. Gaensslen, H. u. W. Schubö: Einfache und komplexe statisische Analyse.<br />
München, Basel: E. Reinhardt, 1976,<br />
47. Ge rcunq , J., Krentier, J.-G. u. H.-G. Sievers: Systematisi<br />
Feststell von Bauleistungen zur Berechnung von<br />
stendaten Hilfe von Kostenblöcken.<br />
5. Zwischenbericht zum Forschungsauftrag <strong>de</strong>s KTBl. Institut<br />
für landwirtschaftliche Bauforschung, Braunschweig 1981.<br />
48. Gartung, J., Krentier, J,-G. u. H.-G. Sievers: Systematisi<br />
Feststell von Baulei zur Berechnung von<br />
stendaten t Hilfe von öcken.<br />
Abschlußbericht zum Forschungsauftrag <strong>de</strong>s KTBl. Institut<br />
landwirtschaftliche Bauforschun9, Braunschweig 1983.<br />
49. Gekle, l.: Metho<strong>de</strong> ZUr Planun9 von Rindviehproduktionslagen.<br />
KTBl-Schrift 232, Münster: landwirtschaftsverlag, 1979.<br />
50. Grochla, E. u. W. Wittmann<br />
wirtschaft, 3d, 2<br />
Hrsg.): Handwörterbuch <strong>de</strong>r Betriebs<br />
.HIWI.D"n, 1974.
- 187 -<br />
51. Groffmann, H.: Wrtschaftliche Einsatzbereiche arbeitssparen<strong>de</strong>r<br />
Verfahren n <strong>de</strong>r Milchviehhaltung.<br />
KTL-Berich e über Landtechnik, Nr. 98. Wolfratshausen 1966.<br />
52. Gurtner, 0.: Methodische Grundlagen <strong>de</strong>r Investitions- und Finanzierungsplanung<br />
im landwirtschaftlichen Betrieb.<br />
Bo<strong>de</strong>nkultur, Wien 24(1973) H. 3, S. 284-311.<br />
53. Haller-We<strong>de</strong>l. E.: Das Multimomentverfahren in Theorie und Praxis.<br />
München: earl Hauser Verlag, 1969.<br />
54. Haller-We<strong>de</strong>l, E.: Die Einflußgrößenrechnung in Theorie und Praxis.<br />
München: earl Hauser Verlag, 1973.<br />
55. Hammer, W.: Zur Bestimmung <strong>de</strong>r Rangfolge von Einflußgrößen in Ar"<br />
beitszeitfunktionen. Dokumentation zum 6. Arbeitswissenschaftlichen<br />
Seminar <strong>de</strong>r GAL. Tänikon 1983, im Druck.<br />
56. Heitmann, G.: Arbeitszeitaufwand <strong>de</strong>r weiblichen Arbeitskräfte im<br />
Haupterwerbsbetrieb.<br />
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Gruppe Berufsbildung<br />
und Landfrauenberatung. Münster 1980.<br />
57. Helminger, J.: Interpretation <strong>de</strong>s Programms BMDPZR zur schrittweise<br />
aufbauen<strong>de</strong>n Regression.<br />
Manuskriptdruck, Datenverarbeitungsstelle Weihenstephan.<br />
Freising 1976.<br />
58. Henriksson, R.: Die wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Gebäu<strong>de</strong>typen<br />
in <strong>de</strong>r Milchwirtschaft.<br />
Bauen auf <strong>de</strong>m Lan<strong>de</strong> 15(1964) H. 2, S. 23-25.<br />
59 Hil1endahl, W., Meier G.: Boxerstän<strong>de</strong>rställe für Milchvieh.<br />
Die Milchpraxis 20 1 (1982) H. 2, S. BO-84.<br />
60. Hirsch, K,: Pr-e i se und Kosten landwirtschaftlicher Gebäu<strong>de</strong>.<br />
KTL-Berichte über Landtechnik, Nr. 75, Wolfratshausen 1962.<br />
61. Hoffmann, H., Kraxner, H. u. H. Steinhauser: Wirtschaftlichkeit <strong>de</strong>r<br />
Milchleistungssteigerung.<br />
Berichte über Landwirtschaft 58, (1980) Nr.4, S. 598-626.
- 189 -<br />
72. Kassel, H. u. F. Sprenger; Arbeitszeit-Richtwerte in <strong>de</strong>r baubetrieblichen<br />
Praxis.<br />
Refa-Nachrichten 31/78 H. 6, S. 323-332 u. Refa-Nachrichten<br />
32/79 H. 1, S. 11-22.<br />
73. Kähne,M.: Zur Frage <strong>de</strong>s durchschnittlich zu verzinsen<strong>de</strong>n Anlagewertes<br />
in <strong>de</strong>r Kalkulation <strong>de</strong>r Kosten landwirtschaftlicher Gebäu<strong>de</strong>.<br />
Agrarwirtschaft 15(1966) S. 265-272.<br />
74. Kähne, M.: Zum Scheingewinnproblem bei Inflation<br />
Agrarwirtschaft 24(1975) H.l1, S. 293-304.<br />
75. Kähne, M.: Theorie <strong>de</strong>r Investition in <strong>de</strong>r Landwirtschaft<br />
Berichte über Landwirtschaft (1966), Son<strong>de</strong>rheft 182,<br />
S. 100-101.<br />
76. Kähne, M. u. R. Wesche: Oie Besteuerung <strong>de</strong>r Landwirtschaft.<br />
Stuttgart: Ulmer, 1882.<br />
77. Koller, G.• Hammer, K., Mittrach, B. u M. Süss: Rindviehställe.<br />
München: BLV-Verlag, 1979.<br />
73. Koordinierungsausschuß zur Vereinheitlichung betriebswirtschaftl.<br />
Begriffe: Begriffs-Systematik rür die landwirtschaftliche<br />
und gartenbauliche Betriebslehre,<br />
Schriftenreihe d. HLBS - Hauptverban<strong>de</strong>s d. landw. 8uchstellen<br />
u. Sachverständigen e.V. Bann, Nr.14 (1973).<br />
79. Krabbe,H.: Computerized Building Cast Calculatlon: Working Progress.<br />
Danish Bullding Research Institute, Noersholm, 1979.<br />
80. Kreyszlg, E.: Statistische Metho<strong>de</strong>n und Ihre Anwendungen.<br />
Göttingen: Van<strong>de</strong>nhoeck und Rupprecht, 1965.<br />
81. Krlnner, L.: Ein Vorschlag zur Ermittlung u. Aggregation von landwirtschaftlicher<br />
Baudaten für die Baupreisermittlung.<br />
Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch 54, (1977) SN 2,<br />
S.122-132.
82.<br />
Krinner, L.: Ermittl<br />
Baudaten für<br />
190 -<br />
für die Landwirt'
- 191 -<br />
91. Mittag, M.: Richtwerte für Gebäu<strong>de</strong>kosten und Baumassenbedarf, Kosten<br />
ausgeführter Bauten, Baukostenanalysen, Wägungsanteile,<br />
Preisin<strong>de</strong>x. Detmold, 1981.<br />
92. Mölbert, H.: Kubikmeter-Metho<strong>de</strong>.<br />
KTL-Kalkulationsunterlagen, S. 17/1-17/2, Darmstadt 1963.<br />
93. Nacke, E.: Ermittlung <strong>de</strong>s<br />
Betriebsgebäu<strong>de</strong>.<br />
schaft, Bd. 6, S.<br />
Stuttgart: Ulmer,<br />
Investitionsbedarfes landwirtschaftlicher<br />
In: Informationsverarbeitung Agrarwissen<br />
155-162.<br />
1982.<br />
94. Nacke, E.: Metho<strong>de</strong> zur Analyse und Minimierung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfes<br />
landwirtschaftlicher Betriebsgebau<strong>de</strong>.<br />
In: Kostengünstige Gebäu<strong>de</strong> für die Landwirtschaft. Dokumentation<br />
zur Arbeitstagung <strong>de</strong>r Sektion 11 <strong>de</strong>s CIGR. Braunschweig<br />
1982, S. 601-614. Stuttgart: Ulmer, 1981.<br />
95. Olesen, G.: Kalkulationstabellen Hochbau.<br />
In: Levsen, P. (Hrsg.): Kalkulation im Bauwesen, Bd. 2.<br />
Berlin: Verlag Schön, 8. Auflage 1978.<br />
96. Pascher, P.: Entwicklungschancen landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe.<br />
Dissertation: Institut für landw. Betriebslehre, Bonn 1981.<br />
97. Piotrowski, J. u. J. Gartung: Zur Frage <strong>de</strong>r Ermittlung von Investitionsbedarf<br />
und Jahreskosten landwirtschaftlicher Betriebsgebäu<strong>de</strong>systeme.<br />
Landbauforschung Völkenro<strong>de</strong>(Braunschweig) 28(1978) H. 2, S.<br />
63-69.<br />
98. Pirkelmann, H.: Bauliche Selbsthilfe in <strong>de</strong>r Landwirtschaft.<br />
KTBL-Schrift 178. Münster: Landwirtschaftsverlag, 1974.<br />
99. Pirkelmann, H.: Heuere FUtterungsverfahren und ihre Konsequenzen<br />
auf Tierverhalten und Aufstallungsformen.<br />
Landtechnik 34(1979) H. 2, S. 87-90.<br />
100. Pirkelmann, H. u. W. Böhm: AbruffUtterung in <strong>de</strong>r Milchviehhaltung.<br />
RKL-Schriftenreihe, H. 3(1982), S. 746-801.
- 192 -<br />
101. Platz, H.: Aufwandswerte und Aufwandsfunktionen für Rohbauarbeiten<br />
im Hochbau.<br />
In: Schub/Mayran Praxiskompendium Baubetrieb. Berlin:<br />
Bauvarlaq ,<br />
102. Plümecke K. Preisermittl<br />
n : Verlagsgesell<br />
für Bauarbeiten .<br />
Müller, 1973.<br />
103. Kostengünstiges Bauen erfor<strong>de</strong>rt "Kal kul<br />
104.<br />
Ritte 1 1<br />
37(1982), H 4, S. 177-180.<br />
: Vergleichen<strong>de</strong> Untersuchungen<br />
hilfefreundlichen Holztragwerken<br />
Bau landwirtschaftlicher BetrieosgE,Dclucle<br />
on und<br />
ten. selbsteinsparung<br />
beim<br />
Forschungsbericht Agrartechnik Max-Eyth-Gesellschaft<br />
(MEG) Nr. 37, Freis'ing: Landtechnik Weihenstephan, 1979<br />
Ri L.· Mit Eigenlei<br />
DLG-Mitteilungen 1982),<br />
baut<br />
10, S.<br />
106. , H.· Arbeitswirtschaftliehe Untersuchungen u. Metho<strong>de</strong>nüberdurch<br />
Mo<strong>de</strong>llkalkulation in <strong>de</strong>r Milchviehhaltung.<br />
ssertation: Institut für Landteehnik, Freising 1981<br />
107 Schäfer, R Beurteilung <strong>de</strong>s Kino",vprt,'h"pns anhand von Mo<strong>de</strong>ll<br />
KTBL-Schr t ft Ne. 284,<br />
Landwirtschaftsverlag 1982.<br />
108. Schaefer-Kehnert<br />
KTL -KaI<br />
W. u. G. Steffen: Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong>planung.<br />
ationsunterlagen S. IV/I.<br />
109. Schaefer-Kehnert, W.· Die Kosten <strong>de</strong>s Landmaschineneinsatzes.<br />
KTL-Berichte über Landteehnik 74(1963).<br />
1l0. Schön, H. u. H. Auernhammer: Grundsätzliche Überl<br />
Ererbei <strong>de</strong>r neuen Terminologie für die<br />
schaft <strong>de</strong>s<br />
Bayerisches landw. Jahrbuch 54(1977), SH.<br />
111. Spranz, 0.: Arbeitszeiten im Baubetrieb.<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, Berlin: Bauverlag, 1975.<br />
S. 5-10.<br />
bei <strong>de</strong>r<br />
tswissen-
- 193 -<br />
112. Steffen, G. u. D. Born: Zur Gestaltung von Informations- und Entscheidungssystemen<br />
für die nehmensführung in <strong>de</strong>r landwirtscha<br />
ft.<br />
Berichte über landwirtschaft 53(1975), S. I1B-136.<br />
113. Steffen, G. u. Förster, A.E. u. P. Muss: Der Kapitalbedarf für Gebäu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Rindviehhaltung bei verschie<strong>de</strong>nen Aufstallungsformen<br />
und Bestandsgrößen.<br />
Berichte über landwirtschaft 45(1967) H. 2, S. 203-222.<br />
114. Stuber, A.: Der Preisbaukasten für landwirtschaftliche Betriebsgebäu<strong>de</strong>.<br />
In: Planungsunterlagen für die Landwirtschaft.<br />
Dokumentation <strong>de</strong>s Symposiums <strong>de</strong>r Sektion V <strong>de</strong>s CIGR, Darmstadt:<br />
KTBl, 1979, S. 102-131.<br />
115. Verband für Arbeitsstudien -REFA- e.V. (Hrsg.): Metho<strong>de</strong>nlehre <strong>de</strong>s<br />
Arbeitsstudiums. Teil 1 "Grundlagen", Teil 2 "Datenermittlung".<br />
München: Carl Hauser Verlag, 1972.<br />
116. Vogt, C.: <strong>Tec</strong>hnik im Milchviehstall.<br />
Frankfurt: DlG-Verlag, 1982.<br />
117. Völkl, J.: Vergleich <strong>de</strong>s Material- und Kapitalaufwan<strong>de</strong>s bei realen<br />
Baumaßnahmen mit kalkulatorisch ermittelten Bedarfswerten<br />
aus <strong>de</strong>m Kalkulationssystem KALBAU.<br />
Diplomarbeit: Institut für landtechnik, Freising 1983.<br />
118. Wan<strong>de</strong>r, J.F.: Vergleichen<strong>de</strong> Beurteilung <strong>de</strong>r Stallsysteme in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen<br />
Milchviehhaltung.<br />
Der Tierzüchter, Hil<strong>de</strong>sheim 32(1980), H. 3, S. 93-95.<br />
119. Weilbier, R.: Preisbuch für Arbeiten am Bau.<br />
Gütersloh: Bertelsmann Fachverlag, 3. Auflage, 1968.<br />
120. Wehland, W.: Mit Kontingenten die Milchflut stoppen?<br />
top agrar H. 10/1983, S. 24-29.<br />
121. Wenner, H.-L. u. H. Schön: Notwendi9keiten zur Baukostensenkung.<br />
Bauen lan<strong>de</strong> 24(1973), H. 1, S. 5-9.<br />
122. Wenner, H.-L. u. Mitarbeiter: Landtechnik, Bauwesen, Teil B.<br />
München: BLV Verlagsgesellschaft, 7. Aufl. 1980.
- 194 -<br />
123. Wight, H.J. u.Clark, J.J.: Farm Building Cast Gui<strong>de</strong>. Aber<strong>de</strong>en,<br />
1983.<br />
124. Wight, H.J.: The use and sources of farm bui1di<br />
Farm Building Progress 62(1980),<br />
cast information.<br />
125 Wilmsen-Himmes, M.: Metho<strong>de</strong> zur Baukostenanalyse bei landwirtschaftlichen<br />
Betriebsgebäu<strong>de</strong>n.<br />
Bayer. Landwirtsch. Jahrb. (980) H. 57(7), S. 857-861.<br />
126. Winkler, W.: Hochbaukoste, Flächen, Rauminhalte.<br />
Kommentar zu DIN 276, 277 283, 1896.<br />
8raunschweig: Verlag Fri eh Vieweg und Sohn, 1982.<br />
127. Wissenschaftlicher Beirat beim Bun<strong>de</strong>sministerium fUr Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Forsten (Hrsg. Grundsätze und Probleme<br />
landwirtschaftlicher Ei itik.<br />
Agr. Europe 52/1982, , S. ]-18.<br />
128. Witt, E.: Bauliche Entwickl<br />
Echem Nr. 22 S.<br />
Hannover:<br />
fUr die FUtterung.<br />
aq , 1980,<br />
Baubri efe<br />
129. Witte, E.· Phasentheorien und Organisation komplexer Entscheidun9sabläufe.<br />
Zeitschrift fUr betriebswirtsehaftliche Forschung<br />
20(1968), S 625-647.<br />
130. Wohlfahrt, L. u. I. Miller Einführung in das Informationssystem<br />
Bauwesen-ISBAU.<br />
sches Landwirtschaftliches Jahrbuch 52(1975) H. 4.<br />
131. Wohlfahrt, L.· Gewi von Baupl und Kostenrichtwerten für<br />
die Landwi mit Hilfe Informationssystems Bauwesen<br />
(lSBAU),<br />
In: Planungsunterl fUr die Landwirtschaft. Dokumentation<br />
zum Symposium Sektion V <strong>de</strong>s CIGR, Darmstadt 1979,<br />
S.65-85.<br />
132. Zähres, W.· Verfahrestechnik bei <strong>de</strong>r VerfUtterung von Kraftfutter.<br />
In: Baubriefe Eehem Nt. 22, S. 55-57.<br />
Hannover: Landbuch-Ver1ag, 1980.
- 195 -<br />
133. Zapf, R.: Zur Anwendung <strong>de</strong>r linearen Optimierung in <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen<br />
Betriebsplanung.<br />
Berichte über Landwirtschaft 179 (1965).<br />
Normen, Gesetze, Arbeitsblätter r Tabellen<br />
134. Arbeitsgemeinschaft landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern e.V.<br />
(Hrsg.): Grub<br />
Arbeitsblätter Nr.:<br />
Nr. 02.14.02: Mo<strong>de</strong>rne Melkverfahren und ihre Zuordnung,<br />
1976.<br />
Nr. 02.09.01: Rin<strong>de</strong>rkri ppen, 1977.<br />
Nr. 02.18.01: Selbsttränken für Rin<strong>de</strong>r, 1977.<br />
Nr. 02.02.06: Grundrißbeispiele für Anbin<strong>de</strong>ställe, 1978.<br />
Nr. 02.02.05: Kurzstän<strong>de</strong> für Milchvieh, 1978.<br />
Nr. 02.03.16: Laufstä11e mit Liegeboxen, 1978.<br />
Nr. 02.01.01: Planungsdaten: Milchviehhaltung und Bullenmast,<br />
1978.<br />
Nr. 02.14.01: Fischgrätenmelkstand, 1979.<br />
Nr. 10.15.04: Lagerung von Flüsigmist, 1980.<br />
Nr. 02.03.15: Liegeboxen für Milchvieh, 1980.<br />
Nr. 02.15.01: Milchräume, Einrichtung und Zuordnung, 1980.<br />
Nr. 02.04.11: Spaltenbo<strong>de</strong>nbucht für Jung- und Mastrin<strong>de</strong>r,<br />
1980.<br />
Nr. 14.01.08: Trauf-First-Lüftung, 1981.<br />
Nr. 15.22.05: Flüssigentmistung, Flüssigmistableitung,<br />
1983.<br />
135. Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Bauwesen Hessen e.V.(Hrsg.):<br />
Richtpreise für <strong>de</strong>n Neubau und Umbau landwirtschaftlicher<br />
Wirtschaftsgebäu<strong>de</strong>.<br />
Kassel, 1982.<br />
136. Deutscher Normenausschuß (Hrsg.): VOB-Verdingungsordnung für Bauleistungen.<br />
Berlin, Köln, Frankfurt: Beuth-Verlag, 1973.<br />
137. Gemeinsamer Ausschuß Elektronik im Bauwesen (Hrsg.): Standardleistungsbuch<br />
- StLB.<br />
Berlin, Köln, Frankfurt: Beuth-Verlag.<br />
138. N.N.: 1. Ausführungsverordnung (1976) zum Milchgesetz v. 15.5.1931.<br />
In: Loos-Nebe (Hrsg.): Das Recht <strong>de</strong>r Milchwirtschaft.<br />
Bonn, Brüssel 1976.
- 196 -<br />
139. N.N.: 11. Berechnungsverordnung (11. BV) zum zweiten Wohnungsbaugesetz<br />
vom 21.2.1975.<br />
Bun<strong>de</strong>sgesetzblatt (BGBl), Teil I, S. 1719.<br />
140. N.N.: Cost of Buildings Handbook.<br />
Maff Publications Unit, Reading 1982,<br />
141. N.N.: Normenausschuß Bauwesen im Deutschen Institut für Normung:<br />
DIN 276 - Kosten von Hochbauten.<br />
Berlin: Beuth-Verlag, 1981.<br />
142. N.N,: Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure,<br />
Stuttart: Verlag W, Kohlhammer, 1981.<br />
143. Statistisches Bun<strong>de</strong>samt (Hrsg.): Meßzahlen für Bauleistungspreise<br />
und Preisindizes für Bauwerke.<br />
Fachserie 17, Reihe 4. Stuttgart, Mainz: Verlag W. Kohlhammer.<br />
144. Statistisches Bun<strong>de</strong>samt (Hrsg.): Preise und Preisindizes für gewerbliche<br />
Produkte (Erzeugerprei<br />
Fachserie 17, Reihe 2, Stuttgart, nz : Verlag W. Kohlhammer,<br />
145. Baugewerbeverband Westfalen (Hrsg. Richtwerte Arbeitszeitbedarf<br />
Hochbau RAH.<br />
Baugewerbeverband Westfalen 1970.<br />
146. Zentral verband <strong>de</strong>s Deutschen Baugewerbes; Hauptverband <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Bauindustrie; Industriegemeinschaft Bau-Steine-Er<strong>de</strong>n:<br />
ARH Arbeitszeit-Richtwerte-Tabellen<br />
Wiesba<strong>de</strong>n: Zeittechnik-Verlag; verseh. Jg.<br />
EDV- Programme<br />
147. Auernhammer, H.: TEZAEL (Teilzeitanalyse für Arbeitselemente).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstephan 1976.<br />
148. Auernhammer, H.: STAP (Stapelbildung zur Planzeiterstellung).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r landtechnik Weihenstephan 1976.
- 197 -<br />
149. Auernhammer, H.: PESK (Programm zur Erstellung statistischer Kenngräßen).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstephan 1976.<br />
150. Auernhammer. H.: ABMUR (Abbauen<strong>de</strong> multiple Regression).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstephan 1976<br />
151. Auernhammer, H.: AUFMUR (Aufbauen<strong>de</strong> multiple Regression).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstpehan 1976.<br />
152. Auernhammer. H.: KALDOK (Kalkulation mit Dokumenten).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstephan 1982.<br />
153. Auernhammer, H : UPDATE (Dokumentdatei erstellen und pflegen).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r Landtechnik Weihenstpehan 1979.<br />
154. Auernhammer, H.: lAUF (leitaufnahmedaten-Aufbereitung).<br />
In: Programmbibliothek <strong>de</strong>r candtechnik Weihenstephan 1979.
Anhang
- 201 -<br />
Tabene 31: Beispiel für ein Dokument <strong>de</strong>r Ebene "Bautei l e''<br />
PO 40000<br />
Anfang ...<br />
En<strong>de</strong>.<br />
Erste f t :<br />
Geä n<strong>de</strong> r t<br />
Dokument Nr. 40000<br />
St.ü t ze nkon s t r-uk t i on e Ringanker einbauen<br />
Hot z für Ringanker a b l anqen und sägen<br />
Ringanker befestigen<br />
15. 2.83 von E. Nacke<br />
02.03.83 von E. Nac ke<br />
St-MZ 13/75/25)<br />
I nha I t :<br />
5Teses-Ho<strong>de</strong>l f wur<strong>de</strong> erste! t t nach Arbeitszeitmessungen von Rittel {Df s s . I.<br />
Die Voreinstel lwe r t e sind mit <strong>de</strong>n Maßen für einen S't ü t ze n s t.al ! mit Mauerwerk<br />
und Ziege I bedachung be legt St.-MZ/13 p 00/75/25<br />
Der Plan ist einzusehen bei <strong>de</strong>r Bayerischen Lan<strong>de</strong>sanstalt für landtechnik<br />
(Dr. Rittetl<br />
Fo Igen<strong>de</strong> Ei nf J ußg ronen s j nd versch l ü sse I t :<br />
Ef 10: 1:= Ankerschraube 12 X 340 mit Mutter und Bei t aqache i be<br />
2:= Ankerschraube 12 X 350 mit etut t e r und Bei lagscheibe<br />
Ef 15: Mit Hilfe <strong>de</strong>s Arbe l t szei t f akt o r s können Zuschläge zur normalen<br />
Arbeitszeit gemacht we r-oen , zi B, für ungeübte Arbeitskräfte o<strong>de</strong>r<br />
erschwerte Ar-bei t sbedi nqunqen . Der Faktor 1.13 z.B be<strong>de</strong>utet,<br />
daß zur normalen Arbeitszeit ein Zuschlag von 13 % berechnet wird.<br />
Bei <strong>de</strong>r Berechnung <strong>de</strong>s Holzbedarfes woi rd ein Verschnitt von 5 % eingerechnet<br />
Än<strong>de</strong>r'bare EinflUßgrößen == 15 und Texte fÜr 6. errechnete H! t r sva rlab t e<br />
U1!.f.JJJ..§..9..Tößen Voreinst"ellung Dimension HVNR DR<br />
Häufigkeit {Anza h l gleicher Dächer}<br />
Länge <strong>de</strong>s Stalls insgesamt {Achsmaß}<br />
Wandart (1 »Naue rwe r-k : 2.=Holz)<br />
Länge einer Ringankerschwelle<br />
Breite <strong>de</strong>r Schwelle<br />
Höhe <strong>de</strong> r Schwel I e<br />
Zahl d . Verschraubungen Schwel l e-Ha ue rw.<br />
Schraubenart (so Inhalt)<br />
Ni t tt . Entfernung Sägeplatz-Einbaustelle<br />
Mittl. En t fe r-nunq Saqept a t z e Ho t z l aqe r<br />
Arbeitszeitfaktor (s. Inh.; 1.0 normal)<br />
18. <br />
19.<br />
20. Holzmenge für Ringanker bei Mauerwerk<br />
21. Zahl <strong>de</strong>r Ringankerschwel Jen<br />
1. 00<br />
36.80<br />
1. 00<br />
4.60<br />
14.00<br />
14.00<br />
4.00<br />
1. 00<br />
28.00<br />
12.00<br />
LOO<br />
runke t on wird o';lggregiert aus _1 UmfQJJngLlJQQ.Q...... und<br />
Hf t r s.va ri a bl ene r-ze uqunq<br />
20 9 9 81 1. 82<br />
9 9 85 5. 86<br />
9 9 91 100. 92<br />
I) 20 20 93 20 20<br />
11 21 21 21<br />
13 5 81 3 20<br />
13 10 81 3 21<br />
13 10 82 3 21<br />
1 21 9 2 11)<br />
6 8 3 1 15
Tabe11e 32: Bei<br />
s ,<br />
- 202 -<br />
für ein Verweismo<strong>de</strong>ll zum Mo<strong>de</strong>ll Nr. 40000<br />
le 31)<br />
Dokument Nr. 40003<br />
PO 40003 Ringanker einbauen St-MZ 18/75/25 40000<br />
Anfang .<br />
En<strong>de</strong> .<br />
Erstellt:<br />
Geän<strong>de</strong>rt:<br />
Holz für Ringanker ablängen und sägen<br />
Ringanker befesti<br />
15. 2.83 von E.<br />
02.03.83 von E. Nacke<br />
l nha lt:<br />
Dieses Mo<strong>de</strong>ll wur<strong>de</strong> erstellt nach Arbeitszeitmessungen von Rittel ss.).<br />
Die Voreinstellwerte sind mit <strong>de</strong>n Maßen für einen Stutzenstall mit<br />
werk und Ziegel bedachung belegt St-MZ/18,00/75/25<br />
Der Plan ist einzusehen bei <strong>de</strong>r Bayerischen Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landtechnik<br />
(Herrn Rittel<br />
Folgen<strong>de</strong> Ei ußgrößen sind verschlüsselt:<br />
Ef 10: 1 = Ankerschraube 12 X 340 mit Mutter und Beilagscheibe<br />
Ef 15: Mit Hilfe <strong>de</strong>s Arbeitszeitfaktors können Zuschläge zur normalen<br />
Arbeitszeit gemacht wer<strong>de</strong>n, .B. für ungeübte Arbeitskräfte o<strong>de</strong>r<br />
erschwerte Arbeitsbedingungen. Der Faktor 1.13 z.B be<strong>de</strong>utet,<br />
daß zur normalen Arbeitszeit ein Zuschlag von 13 % berechnet wird.<br />
Än<strong>de</strong>rbare Einflußgrößen = 15<br />
Einflußgröße<br />
1. Häufigkeit 1. 00 Dach 0<br />
2. Länge <strong>de</strong>s 48.00 Meter 0<br />
3. - 10<br />
4. - 10<br />
5. Wandart 1.=Mauerwerk; 2.=Holz) 1. 00 Nummer 0<br />
6. Länge ei ner Ri 1e 4.80 Meter 0<br />
7. Breite <strong>de</strong>r le 18.00 Zentimeter 0<br />
8. Höhe <strong>de</strong>r Schwelle 12.00 Zentimeter 0<br />
9. Zahl <strong>de</strong>r Verschraubungen Schwelle-Mauerwerk 3.00 Schrauben 51<br />
10. Schraubenart s. Inhalt) 2.00 Nummer 51<br />
11. - 10<br />
12. - 10<br />
13. Mittlere z-Einbaustelle 28.00 Meter 0<br />
14. Mittlere z-Holzlager 12.00 Meter 0<br />
15. Arbeitszeitfaktor .0 = normal) 1. 00 Faktor 0<br />
16.<br />
17. -<br />
18. -<br />
19. -<br />
20. Holzmenge für Ringanker bei Mauerwerk Kubikmeter<br />
21. Zahl <strong>de</strong>r Ringankerschwellen Schwellen
- 210 -<br />
Abbildung 48: Bullenmaststail, 56 Plätze<br />
Betrieb 3 <strong>de</strong>r Ist-Zeitermittlung<br />
crc<br />
-y OSI
Betrieb 3<br />
- 212 -<br />
Bauabschnitt Ist-Zeit So11-Zeit relative Abweichung<br />
Sol Ist<br />
APh %<br />
Erdaushub<br />
su '11 egrube 15 + 200,0<br />
Erdaushub<br />
Sta 11 7,5 20 + 166<br />
Fundamente und Kanäle<br />
schalen, bewehren,<br />
betonieren 299 233 22,1<br />
Nebenraum<br />
17 29 70,6<br />
203 284 39,9<br />
118 59 + 34,7<br />
121 153 + 26,4<br />
28 39 39,3<br />
30 + ,1<br />
112 120 + 7,1<br />
347 215 38,0
Tabelle 38: t t eqeboxen t a u r s t at t für 40 Kühe mit Nachzucht (3-reihig) Gesamtkaikulationsprotoko! I<br />
Ka ! ku I a t. i onas t r-uk t u r- (KA;;;Konstruktionsart, Büe.Bau t e t l.gr, B'TeBaute t I, Püe Pos i t l on , AM=Arbeit+Mat.)<br />
üooe I 1ko<strong>de</strong><br />
numme r Mo<strong>de</strong>llbezeichnung mit Häufigkeit<br />
BG 100 E r-da rbe i t e n Fundamente 1. 00<br />
BT 1020 Er-dau s hub , H nterfüllung, Auffüllen 1.00<br />
PO 10200 Baug rubena ushub 2.00 2339.7<br />
PO 10300 Hinterfüllen 1. 00 362.4<br />
PO 10301 Auffü I I en 1. 00 1257.0<br />
1040 Ei nze I f undamen t e Fuß 12.00<br />
20001 Ei nze I fundament scha I en 12.00 402. "1<br />
21005 Ei nze I f undamen t e-Beweh rung 12.00 190.3<br />
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 12.00 88.6<br />
PO 22003 E inze I fundament beton te r-en 12.00 1029.2<br />
B r i 01+0 Ei I f unda men t> Fuß 6.00<br />
PO 20001 E nze I fundament sc ha I e n 6.00 176.7<br />
PO 21005 E nz eltundamen t e Bewe h r-unq mit Mattenstahl 6.00 145.7<br />
PO 22002 Sauberkeitsschicht betonieren 6.00 37.8<br />
PO 22003 Ef nz el f undamen t betonieren 6.00 416.4<br />
BI 1041 Ei nze I t unda men t> Socke 1 12.00<br />
PO 20001 Ei nze 1t und amen t scha 1en 12.00 298.3<br />
PO 21105 Einzelfundament-Bewehrung mit s t ab s cant 12.00 259.8<br />
PO 22003 Ei nze I fundament beton i eren 12.00 192.1<br />
BI 1041 Ei nze I t undamcnt r Soc ke ! 6.00<br />
PO 20001 Ei nze 1fundament scha len 6.00 149.2<br />
PO 21105 Einzelfundament-Bewehrung mit Stabstahl 6.00 294.2<br />
PO 22003 Ei nze J fundament beton i eren 6.00 99.5<br />
BT 1041 Ei nze I f unda men t 24.00<br />
PO 20001 Ei nze 1f undamen t scna I en 24.00 1709.3<br />
PO 22003 Ei nze I fundament beton i e ren 24.00 1633.0<br />
Investitionsbedarf in (DM) für'<br />
AM PO BT BG<br />
3959.1<br />
1710. "1<br />
776.5<br />
750.2<br />
542.9<br />
3342.3<br />
BT 105 r Stre i f enfund amen t 1. 00<br />
PO 20002 Streifenfundament schalen 1. 00 5806.5<br />
PO 211 02 Streifenfundament-Bewehrung mit Stabstahl 1. 00 3116.0<br />
PO 22004 St re j fenfundament beton f er-an 1. 00 8163.2<br />
13969.7<br />
N<br />
""'