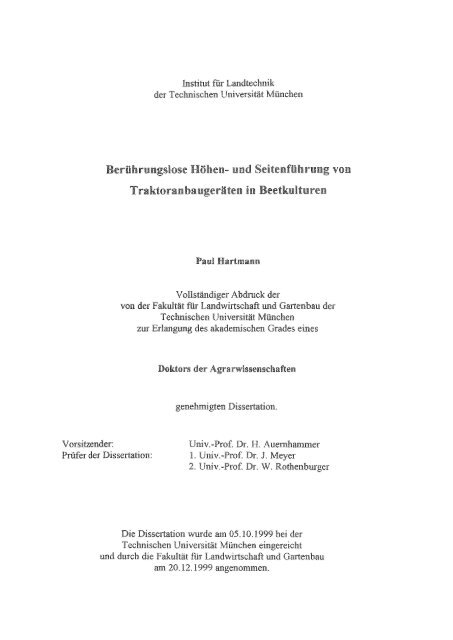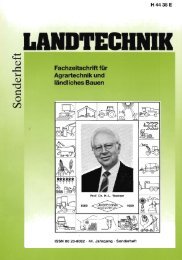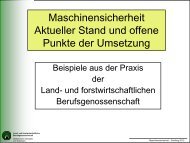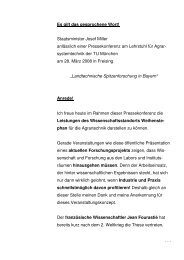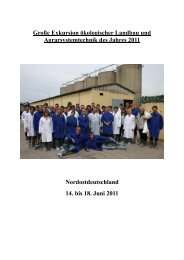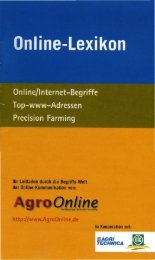Seitenführung von Traktoranbaugeräten in ... - Tec.wzw.tum.de
Seitenführung von Traktoranbaugeräten in ... - Tec.wzw.tum.de
Seitenführung von Traktoranbaugeräten in ... - Tec.wzw.tum.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorsitzen<strong>de</strong>r:<br />
Prüfer <strong>de</strong>r Dissertation:<br />
Institut für Landtechnik<br />
<strong>de</strong>r <strong>Tec</strong>hnischen Universität München<br />
<strong>Seitenführung</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Traktoranbaugeräten</strong> <strong>in</strong> Beetkulturen<br />
Pani Hartmann<br />
Vollständiger Abdruck <strong>de</strong>r<br />
<strong>von</strong> <strong>de</strong>r Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau <strong>de</strong>r<br />
<strong>Tec</strong>hnischen Universität München<br />
zur <strong>de</strong>s aka<strong>de</strong>mischen Gra<strong>de</strong>s e<strong>in</strong>es<br />
Doktors <strong>de</strong>r Agrarwissenschaften<br />
genehmigten Dissertation.<br />
Univ-Prof Dr. Auernhammer<br />
1. Univ.-Prof. Dr. 1.<br />
2. Univ.-Prof Dr. W. Rothenburger<br />
Die Dissertation wur<strong>de</strong> am 05.10.1999 bei <strong>de</strong>r<br />
<strong>Tec</strong>hnischen Universität München e<strong>in</strong>gereicht<br />
und durch die Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau<br />
am 20.12.1999 angenommen.
vorliegen<strong>de</strong> Arbeit<br />
Forsten geför<strong>de</strong>rt.<br />
© 2000 Landtechnik Weihenstephan<br />
ISSN-Nr. 093 ]·6264<br />
vom Bun<strong>de</strong>sm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, L
Vorwort<br />
Die Rückführung <strong>de</strong>r Aufwandmengen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r vollständige Verzicht auf <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>-<br />
satz <strong>von</strong> Herbizi<strong>de</strong>n ist mit erheblichen Kosten und Risi-<br />
ken für <strong>de</strong>n verbun<strong>de</strong>n, Für <strong>de</strong>n Anbau ist e<strong>in</strong>e chemische<br />
Unkrautregulierung ohne die Alternativen nicht zulässig und<br />
ist die Verfügbarkeit <strong>von</strong> Herbizi<strong>de</strong>n wegen fehlen<strong>de</strong>r unzurei-<br />
chend; <strong>de</strong>r Anbau nach ökologischen Richtl<strong>in</strong>ien schließt <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz synthetischer<br />
Herbizi<strong>de</strong> aus. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund haben Arbeiten zur <strong>von</strong> Ge-<br />
räten und Verfahren zur mit Maßnahmen erheb-<br />
lich an Be<strong>de</strong>utung gewonnen. Wesentliche Probleme diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d<br />
die <strong>von</strong> Arbeitskräften und die Kosten für die Durchführung <strong>von</strong><br />
Hackarbeiten <strong>in</strong> Beetkulturen. E<strong>in</strong>e Automatisierung ist allen Se-<br />
reichen unerlässlich, <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re wird Bedarf <strong>de</strong>r automatischen Geräteführung<br />
In <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit die Ziele <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Erarbeitung <strong>von</strong> Grundlagen<br />
e<strong>in</strong> Regelungsverfahren zur automatischen Führung <strong>von</strong> Pflan-<br />
zenreihen. Dieses Problem umfasst Teilbereiche: und Erfas-<br />
sung <strong>de</strong>r Pflanzenreihe,<br />
sowie mechanische <strong>de</strong>s Die Arbeit ist mit e<strong>in</strong>em<br />
hohen experimentellen Aufwand sehr und mit <strong>de</strong>m Bau<br />
und <strong>de</strong>r Erprobung e<strong>in</strong>es abgeschlossen wor<strong>de</strong>n. Zur ökono-<br />
mischen <strong>von</strong> automatischen Geräteführungen dient Simulations<br />
programm mit <strong>de</strong>m beispielhaft für Gemüsebaubetriebe unterschiedlicher Größe und<br />
kulturtechnischer Ausrichtung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utlich gemacht wird. Die<br />
Ergebnisse <strong>de</strong>r Arbeit s<strong>in</strong>d <strong>von</strong> außeror<strong>de</strong>ntlich und wer<strong>de</strong>n auch E<strong>in</strong>-<br />
gang <strong>in</strong> die Praxis f<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />
<strong>de</strong>n 1.2.2000 Prof. Dr. habil. J.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen herzlich zu danken, die<br />
zum Gel<strong>in</strong>gen dieser Arbeit beigetragen haben :<br />
Me<strong>in</strong> ganz beson<strong>de</strong>rer Dank gilt Herrn Prof. Dr. J. Meyer für die überlassung <strong>de</strong>s<br />
Themas und für se<strong>in</strong>e Unterstützung und För<strong>de</strong>rung bei <strong>de</strong>r Durchführung dieser<br />
Arbeit.<br />
Bei Herrn Prof. Dr. W. Rothenburger möchte ich mich für die übernahme <strong>de</strong>s Kore<br />
ferates bedanken sowie bei Herrn Prof. Dr. H. Auernharnmer für die übernahme <strong>de</strong>s<br />
Prüfungsvorsitzes.<br />
Danken möchte ich Herrn Prof. Dr. Feucht für die überlassung <strong>de</strong>s Gewächshauses<br />
mit <strong>de</strong>r Versuchsstrecke.<br />
Bei me<strong>in</strong>en Kollegen Dr. A. Bertram und H.P. Römer sowie <strong>de</strong>m Diplomphysiker<br />
W. Krötz bedanke ich mich für die anregen<strong>de</strong>n Diskussionen und die konstruktive<br />
Kritik.<br />
Me<strong>in</strong> Dank gilt allen, die an <strong>de</strong>r Konstruktion und <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Versuchsgeräte und<br />
-e<strong>in</strong>richtungen beteiligt waren . Nennen möchte ich an dieser Stelle Herrn H. Stadler,<br />
die Mitarbeiter <strong>de</strong>r Werktstatt sowie Dr. H. Stanzei , Herrn F. Bauer und <strong>de</strong>n Elek<br />
tro<strong>in</strong>genieur <strong>de</strong>r Landtechnik J. Dall<strong>in</strong>ger.<br />
Bei Herrn H. Keller möchte ich mich für die technischen Zeichnungen, die mit viel<br />
Liebe zum Detail angefertigt wur<strong>de</strong>n , bedanken.<br />
Für ihre Unterstützung und dafür, daß sie mich während me<strong>in</strong>er Promotionszeit stets<br />
aufs Neue motiviert haben, möchte ich mich schließlich ganz beson<strong>de</strong>rs bei me<strong>in</strong>en<br />
Eltern und me<strong>in</strong>er Freund<strong>in</strong> Kathr<strong>in</strong> bedanken.<br />
Weihenstephan, im Januar 2000 Paul Hartmann
Inhaltsverzeichnis<br />
1<br />
2<br />
2.2<br />
2.3<br />
2.3.1<br />
2.3.2<br />
2.3.2.1<br />
2.3.2.2<br />
2.4<br />
2.5<br />
2.6<br />
2.7<br />
2.8<br />
2.8.1<br />
2.8.2<br />
2.8.3<br />
2.8.4<br />
3<br />
4<br />
4.1<br />
4.1.<br />
Inhaltsverzeichnis 5<br />
Abbildungsverzeichnis " 8<br />
Tabellenverzeichnis 12<br />
Verzeichnis<br />
Verzeichnis<br />
Formelzeichen 13<br />
Abkürzengen 15<br />
E<strong>in</strong>leitueg und Problemstellang 16<br />
Stand <strong>de</strong>s Wissens 19<br />
Automatische Gerätesteuerungen 20<br />
Automatische Gerätesteuerungen 20<br />
Sensoren zur <strong>de</strong>r Landwirtschaft 22<br />
Mit Tastern 25<br />
Berührungslos arbeiten<strong>de</strong> 28<br />
Optische Verfahren 28<br />
Akustische Verfahren 30<br />
Bildverarbeitung 32<br />
Angaben zu Pflanzenpositionen und Reihenverläufe 35<br />
Bo<strong>de</strong>noberflächen und 36<br />
Regelung und <strong>in</strong> <strong>de</strong>r automatischen 37<br />
Regelungstechnische Metho<strong>de</strong>n zur <strong>de</strong>r 39<br />
Prädiktion 40<br />
Vermaschung 40<br />
Adantion 43<br />
Koord<strong>in</strong>ation 46<br />
Zielseuung 48<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n 50<br />
voroahen für e<strong>in</strong>e 50<br />
Pflanzenpositionen und Reihenverlauf.. 50
4.1<br />
41.1.2<br />
4.1.3<br />
4.2.J<br />
4.2.2<br />
4.2.2.1<br />
4.2.2.2<br />
4.2.2.3<br />
4.2.3<br />
4.3<br />
4.31<br />
4.3.2<br />
4.3.3<br />
4.3.4<br />
4.3.5<br />
4.3.6<br />
4.3.6.1<br />
4.3.6.2<br />
4.3.6.3<br />
4.3.7<br />
4.4<br />
4.4.1<br />
4.4.2<br />
5<br />
5.1<br />
5.2<br />
5.3.l<br />
5.3.1.1<br />
5.3.1.2<br />
5.3.1.3<br />
5.3.<br />
5.3.2<br />
5.4<br />
Versuchsdurchführung und Meßaufbau Richtschnur. Maßband<br />
und W<strong>in</strong>kel................................................................................... 5<br />
Versuchsdurchführung und Meßaufbau mittels 52<br />
Höhenprofile Beetoberflächen und Pflanzenbestän<strong>de</strong> , 53<br />
Versuchsdurchführung und Meßaufbau , 54<br />
Sensoruntersuchungen 57<br />
Statische und 58<br />
Ultraschallsensoren 58<br />
Die· Mo<strong>de</strong>llkörper 59<br />
Versuchsaufbau für statische !<br />
Versuchsaufbau für dynamische Untersuchungen ..<br />
Lasersensoren 62<br />
Gerätetechnische 65<br />
Versuchsstand und Meßaufbau 65<br />
Versuchsgerät <strong>Seitenführung</strong> 6<br />
Versuchsgerät Höhenführung 68<br />
SPS-Steuerung 70<br />
Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik 70<br />
Regelungsentwicklung für automatische Geräteführung ..<br />
E<strong>in</strong>fache Reglerstrukturen 73<br />
Fahrversuche zur Höhen- und <strong>Seitenführung</strong> 82<br />
Mo<strong>de</strong>llkalkulation zur ökonomischen automatischen<br />
Geräteführung 83<br />
Fixkosten '" 84<br />
Variable Kosten 87<br />
Beschreibung <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llannahmen 88<br />
Ergebnisse zu <strong>de</strong>n Vorgaben automatisehen<br />
<strong>Seitenführung</strong> - Pflanzenreihen 92<br />
Ergebnisse zu <strong>de</strong>n Untersuchungen e<strong>in</strong>er automatischen<br />
Höhenführung - Bo<strong>de</strong>noberflächen / Pflanzenbestän<strong>de</strong> 102<br />
Ergebnisse zu <strong>de</strong>n Sensoruntersuchungen ..<br />
Ultraschallsensoren .<br />
Statische Untersuchungen ..<br />
Untersuchungen zum Reflexionsverhalten .<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Lasersensor .<br />
Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik <strong>Seitenführung</strong><br />
16
5.4.<br />
5.4.2<br />
5.4.3<br />
5.4.3.1<br />
5.4.3.2<br />
5.4.4<br />
5.4.5<br />
5.4.6<br />
5.5<br />
5.5.1<br />
5.5.2<br />
5.5.3<br />
6<br />
6.1<br />
6.2<br />
6.3<br />
6.4<br />
7<br />
HI<br />
Inhaltsverzeichnis 7<br />
Wie<strong>de</strong>rholungsgenauigkeit <strong>de</strong>s im Versuchsstand<br />
Blumenstraße 117<br />
Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeitse<strong>in</strong>fluß aufdie Versuchsfahrten 121<br />
Untersuchungen an e<strong>in</strong>fachen Reglerstrukturen 125<br />
Fahrverlaufbei unterschiedlichen Verstellzeiten <strong>de</strong>r Scheibenseche 126<br />
Fahrverlaufbei unterschiedlichen Geschw<strong>in</strong>digkeiten 128<br />
Proportionalregler 130<br />
Mo<strong>de</strong>llregler 135<br />
Fahrversuche zur Höhen- und <strong>Seitenführung</strong> 140<br />
Ökonomische Betrachtung <strong>de</strong>r automatischen Geräteführung 145<br />
Kostenkalkulation Mo<strong>de</strong>llbetrieb I 146<br />
Kostenkalkulation Mo<strong>de</strong>llbetrieb Il 147<br />
Kostenvergleich <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llbetriebe 148<br />
Diskussion und Schlußfolgerungen 150<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen 151<br />
Sensoruntersuchungen 153<br />
Gerätetechnische Überprüfung 155<br />
Ökonomische Betrachtung 158<br />
Weiterführen<strong>de</strong> Arbeiten 162<br />
Zusammeufassung , , 164<br />
Summary 167<br />
Literaturverzeichnis 169<br />
Anhang 175
8 Abbildungsverzeic/ulis<br />
Bestandskanten<br />
Rollentaster zum Antasten <strong>von</strong><br />
Mähdrescher E. 1986] .26<br />
Abb. 2: aufe<strong>in</strong>en lasergeführten Gantrytraktor (verän<strong>de</strong>rt<br />
P. van ZUYDAM und C. SONNEVELD<br />
Abb.3: Bildverarbeitung zur Reihenverfolgung KEICHER<br />
et al, 1995) 34<br />
Abb, Störgrößenaufschaltung (verän<strong>de</strong>rt nach und<br />
SCHMIDT 1994) .41<br />
Abb. Störgrößenvorregehmg (verän<strong>de</strong>rt nach PARLITZ . 42<br />
Abb.6: Darstellung e<strong>in</strong>er adaptiven nach SCHMlDT<br />
1994) .45<br />
Meßaufbau Vegetationspunkte <strong>von</strong><br />
W<strong>in</strong>kel 51<br />
Abb.8: Meßaufbau mit Totalstation zur <strong>von</strong><br />
Abb.9: nach 1996) 63<br />
Abb. 10: Versuchsstrecke mit angetriebenen Gerätetragrahmen 66<br />
Abb.ll:<br />
Meßaufbau " vo<br />
Abb. 12: Versuchsmechanik Arbeitsgeräten " V7<br />
Abb. Fahrverlaufund Sechstellurig für e<strong>in</strong> fest vorgegebenes<br />
Programmablauf<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Reglerentwicklung e<strong>in</strong>gesetzten<br />
e<strong>in</strong>es Proprotionalreglers " .
Abb, 15: Geometrischer Zusammenhang <strong>de</strong>r seitlichen Position<br />
Abb, 16:<br />
Abb,17:<br />
Abhängigkeit vom Sechw<strong>in</strong>kel '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''' """"''''''''''''''''''<br />
Zusammenhang <strong>de</strong>r seitlichen Position während <strong>de</strong>s<br />
Drehvorganges..",,"""""''''''''''"",,,"",""""""."".""",,,."".,,,,,,,, ,""",,",," 81<br />
Verlauf e<strong>in</strong>er gesäten Pflanzenreihe. Rettich iRaphanus sativus L),<br />
aufetwa 10 cm <strong>in</strong><br />
"",,,,,.,,,,,.,,,,,, "",,,,,,,,,,,,94<br />
Abb, 18: Verlaufe<strong>in</strong>er Pflanzenreihe;<br />
Abstand <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Reihe 35 cm ,,,',,""",,"<br />
(Lactuca sativa L),<br />
"""""""".,,,,,,,,,,,96<br />
Abb, 9: Relative <strong>de</strong>r seitlichen Abweichung<br />
aufe<strong>in</strong>an<strong>de</strong>rfolgen<strong>de</strong>r Pflanzen; arn e<strong>in</strong>er gesäten (rechts)<br />
und e<strong>in</strong>er Kultur "","<br />
Abb. 20: Gleiten<strong>de</strong> Mittelwertbildung als e<strong>in</strong>er Möglichkeit, um<br />
aus <strong>de</strong>n e<strong>in</strong> Steuersignal zu generieren<br />
Abb. 21: Fahrverlaufe<strong>in</strong>es Pflanzenschutztunnels über e<strong>in</strong>e vorgegebene<br />
Pflanzenreihe 1 m, Tunnelbreite 6 cm) "",,,,,,,,,,,,,,<br />
,,97<br />
"",99<br />
, 100<br />
Abb. 22: Oberflächenprofil <strong>von</strong> zwei unterschiedlichen Bo<strong>de</strong>nproben<br />
(Probe 1: fe<strong>in</strong>er Humus; Probe Ir: Sand),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """"'"'' 102<br />
Abb. 23: Höhenprofil <strong>von</strong> drei unterschiedlichen Pflanzenbestän<strong>de</strong>n<br />
(Mungbohne, Radies und """".""",,,,, ''''''',''"'''''''','''''',,,'' "," lO4<br />
Abb. 24: Oberflächenprofil und Höhenverlauf als E<strong>in</strong>gangssignal e<strong>in</strong>er<br />
automatischen (Meßstrecke 10 und e<strong>in</strong><br />
Meßstreckenausschnitt <strong>de</strong>r ersten 600 mm)"""" """,",,"""""" """""." 105<br />
Abb. 25: Radius <strong>de</strong>s Erfassungsbereiches <strong>de</strong>r untersuchten<br />
Ultraschallsensoren ."",,,,,,,,,,,,, """""."""""""""", ".""",,,,,,,,, "."""",108<br />
Abb, 26: <strong>de</strong>r untersuchten Sensoren beim<br />
<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstrecke 0 Hz, = 50 llU.H!"J",.",,,,,,,,",,"'"''''''''''''''<br />
Abb. 27: Eichkurve und Meßpunkte für <strong>de</strong>n untersuchten Laser-
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. I. <strong>de</strong>r Landtechnik e<strong>in</strong>gesetzte Leitl<strong>in</strong>ien und mögliche<br />
Tab. 3:<br />
2: Bezeichmmgen und Abmessungen e<strong>in</strong>gesetzten Mo<strong>de</strong>llkörper 60<br />
4:<br />
Tab. 5:<br />
Tab.<br />
Tab.<br />
Tab.<br />
Summen <strong>de</strong>r Flächen, auf<strong>de</strong>nen Unkrautregulierungsrnaßnahmen<br />
durchgeführtwer<strong>de</strong>n müssen (verän<strong>de</strong>rt nach WEBER<br />
Varianten für die Mo<strong>de</strong>llkalkulation<br />
zwischen <strong>de</strong>n 90<br />
Flächenleistungen <strong>de</strong>r Gerätekomb<strong>in</strong>ationen<br />
Mo<strong>de</strong>llbetriebe 91<br />
Fixe (Kr) und variable Kosten Geräte zur<br />
Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n Reihen " 145<br />
Jährliche Gesamtkosten <strong>von</strong> Betrieb für die mechanische<br />
Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n 146<br />
Jährliche Gesamtkosten Betrieb II mechanische<br />
Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n Kulturpflanzenreihen<br />
Flächenbezogener Verfahrenskostenanteil <strong>de</strong>r mechanischen<br />
Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n Kulturpflanzenreihen<br />
....... 147<br />
luevU.'W·,,'I 149
14 Verzeichnis <strong>de</strong>r FarmelzeiC",h",e",n__<br />
YH<br />
a<br />
Po<br />
(0<br />
seitliche<br />
seitlicher Versatz auf<strong>de</strong>m Führungsholm beim Drehen<br />
seitlicher Versatz beim<br />
Auslenkw<strong>in</strong>kel <strong>de</strong>r<br />
Dichte <strong>de</strong>r Po =<br />
Drehzeit<br />
Summe<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Fahrtrichtung<br />
=0
Verzeichnis <strong>de</strong>r Abkärzungen<br />
Abb. Abbildung<br />
AK Arbeitskraft<br />
Aufl. Auflage<br />
Verzeichnis <strong>de</strong>r Abkürzungen<br />
bzw. beziehungsweise<br />
ca, circa<br />
DM Deutsche Mark<br />
et al. et alies<br />
ff. folgen<strong>de</strong>n Seite(n)<br />
Hrsg. Herausgeber<br />
ha Hektar<br />
Kap. Kapitel<br />
Max, Maximum<br />
M<strong>in</strong>. M<strong>in</strong>imum<br />
o.g, oben genannten<br />
S. Seite<br />
Tab. Tabelle<br />
u. und<br />
usw. und so weiter<br />
v.Chr, vor Christus<br />
vergl. vergleiche<br />
zR zum<br />
z.r. zum Teil<br />
zZt. zur Zeit
Seit <strong>de</strong>r vor<br />
nützliche Pflanzen anzubauen, versucht<br />
Die<br />
<strong>de</strong>n<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt begonnen hat, erfährt zur Zeit<br />
begonnen hat, systematisch bestimmte,<br />
auch<br />
weiteren Höhepunkt, Komplexe Steuerungs-<br />
Im und heute<br />
leichtert o<strong>de</strong>r ganz übernommen. Der Bereich Automatisierung<br />
und<br />
Landwirtschaft, die<br />
die automatische und ist e<strong>in</strong> bisher weitgehend<br />
Aufgabenfeld Iür die Elektronik und Gegenstand<br />
dieser<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re<br />
Die angespannte <strong>de</strong>utschen Arbeitsmarkt daß<br />
Verfügbarkelt <strong>von</strong><br />
heimischen aus sehr unterschiedlichen Grün<strong>de</strong>n<br />
die Teil- bzw,<br />
Betriebe Das<br />
<strong>de</strong>r Arbeitskräfte<br />
das vorhan<strong>de</strong>ne<br />
<strong>von</strong> Kulturpflanzenreihen<br />
hier e<strong>in</strong>en wesentlichen<br />
Arbeitskräfte zur Erleichterung<br />
Neben <strong>de</strong>r Schonung<br />
gesamten SPicktru<strong>in</strong><br />
beitsverfahren bei<br />
Bo<strong>de</strong>nstruktur ist<br />
Unkräutern<br />
Arbeitsgängen für das Fortbestellen<br />
E<strong>in</strong>-<br />
sicherer Regulierungserfolg gegenüber<br />
Hauptfor<strong>de</strong>rung an das e<strong>in</strong>gesetzte Ar-<br />
außer<strong>de</strong>m zusätzlich e<strong>in</strong>e Schlagkraft bei gleicbzeitig
E<strong>in</strong>leitung und Problemstellung<br />
ger<strong>in</strong>gen Arbeits- und Gerätekosten gefor<strong>de</strong>rt 1989, PAR!SH 1990 und<br />
WEBER Die Schlagkraft e<strong>in</strong>es Verfahrens resultiert aus <strong>de</strong>r Arbeitsbreite<br />
<strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit und wird bei vielen Geräten die Wirkunzs-<br />
weise <strong>de</strong>s e<strong>in</strong>gesetzten Gerätes als durch das Reaktionsverhalten Arbeitskraft beim<br />
Führen entlang <strong>de</strong>r Pflanzenreihe begrenzt. Die mit <strong>de</strong>r e<strong>in</strong> Arbeitsgerät<br />
an emer Pflanzenreihe entlang wird, nimmt dabei bei steigen<strong>de</strong>r<br />
schw<strong>in</strong>digkeit ab. Durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automatischen könnte die<br />
Geschw<strong>in</strong>digkeit und somit die Schlagkraft gesteigert wer<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>rerseits ist e<strong>in</strong>e<br />
höhere bei unverän<strong>de</strong>rter Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit möglich. Bei höheren Ar<br />
beitsgenauigkeiten läßt sich <strong>de</strong>r Sicherheitsabstand zu <strong>de</strong>n Pflanzen verr<strong>in</strong>gern, so daß<br />
sich <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r bearbeiteten Fläche erhöht. Diese <strong>de</strong>r bearbeiteten Flä-<br />
che be<strong>de</strong>utet e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Verfahrensaufwand bei <strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
Pflanzenreihe.<br />
Der Regulierungserfolg bei vielen Arbeitsgeräten wie z. B. bei <strong>de</strong>r Reihenhack-<br />
bürste eng mit <strong>de</strong>r Bearbeitungstiefe zusammen Nur bei e<strong>in</strong>er exakten<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong>r gerätespezifisch richtigen Arbeitstiefe können Geräte<br />
optimale Ergebnisse liefern. Starre mechanische Höhenführungen s<strong>in</strong>d zum<br />
mit erheblichen Nachteilen, wie z.B, e<strong>in</strong>er starken Stoß- und Schlagempf<strong>in</strong>dlich<br />
keit, behaftet. E<strong>in</strong>e Erfassung <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>noberfläche br<strong>in</strong>gt <strong>in</strong> diesem<br />
Bereich Vorteile, da kle<strong>in</strong>e Bo<strong>de</strong>nunebenheiten wie Ste<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne Erd-<br />
kluten durch die Vorverrechnung <strong>de</strong>r brauchbaren aus-<br />
geschaltet wer<strong>de</strong>n können,<br />
Steuerungen lassen sich <strong>in</strong> zwei Hauptkomponenten unterteilen. Die erste<br />
Komponente ist das Ortungssystem. Se<strong>in</strong>e Aufgabe ist die Positionserrnittlung<br />
stems, Als können im landwirtschaftlichen Bereich sehr unterschiedli-<br />
che Leitl<strong>in</strong>ien dienen. Die zweite Komponente e<strong>in</strong>es ist das<br />
stem, Die Aufgabe <strong>de</strong>s ist das Steuern <strong>de</strong>r Leitl<strong>in</strong>ie und <strong>de</strong>r Aus-
18<br />
<strong>de</strong>r vom Ortungssystem erfaßten Abweichungen. Bei zur auf <strong>de</strong>m<br />
Markt han<strong>de</strong>lt es sich um e<strong>in</strong>fache Regler,<br />
mit zuvor fest e<strong>in</strong>gestellten Parametern arbeiten sehr spezifisch e<strong>in</strong>zusetzen<br />
s<strong>in</strong>d. nach e<strong>in</strong>em universellen großes Spektrum<br />
Steuerungsaufgaben kann mit <strong>de</strong>n Geräten nur teil-<br />
weise erfüllt wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Ziel <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit ist es, e<strong>in</strong>en zur Entwickluna e<strong>in</strong>es univer<br />
seilen leisten um damit für Produzenten e<strong>in</strong>e zu schaffen,<br />
Arbeitskräfte zu entlasten und die Verfahrenskosten zu senken.<br />
E<strong>in</strong> <strong>in</strong> dieser Arbeit <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>in</strong>dustriell vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Sensoren und <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Uberprüfung ihrer Eignung für <strong>de</strong>n landwirtschaftlichen und<br />
gartenhauliehen E<strong>in</strong>satz. weiterer Schwerpunkt ist e<strong>in</strong>es<br />
neten Regelkreises, <strong>de</strong>r sich auf verän<strong>de</strong>rlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
e<strong>in</strong>stellen
2 Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
Stand <strong>de</strong>s Wissens 19<br />
In <strong>de</strong>r Vergangenheit hat sich e<strong>in</strong>e Reihe sehr unterschiedlicher Personen mit <strong>de</strong>r au<br />
tomatischen Geräteführung beschäftigt. Dabei kamen diverse differieren<strong>de</strong> methodi<br />
sche Ansätze und Versuchsanstellungen zum E<strong>in</strong>satz. Die erzielten Ergebnisse s<strong>in</strong>d<br />
daher nur bed<strong>in</strong>gt untere<strong>in</strong>an<strong>de</strong>r vergleichbar. Bei <strong>de</strong>n Angaben zu <strong>de</strong>n beschriebenen<br />
Geräten und Arbeitsweisen han<strong>de</strong>lt es sich meist um Herstellerangaben. die häufig<br />
unzureichend dokumentiert s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong> E<strong>in</strong>satzschwerpunkt e<strong>in</strong>er automatischen Höhen- und <strong>Seitenführung</strong> <strong>von</strong> Arbeits<br />
geräten <strong>in</strong> Beetkulturen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r physikalischen Unkrautbekämpfung. Hier treten<br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re Probleme durch die Witterungsabhängigkeit <strong>de</strong>s Bekämpfungserfolges<br />
und die ger<strong>in</strong>ge Schlagkraft <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Verfahren auf. MEYER und WEBER<br />
(1996) formulieren allgeme<strong>in</strong>e Anfor<strong>de</strong>rungen für die Tiefen- und <strong>Seitenführung</strong> <strong>von</strong><br />
Hackgeräten zur Unkrautregulierung <strong>in</strong> Reihenkulturen.<br />
L. KOLLAR (1992) gibt e<strong>in</strong>en Überblick über theoretische und technische Ansätze für<br />
die Spurführung mobiler Aggregate. Die bestehen<strong>de</strong>n Forschungsarbeiten wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />
Konzepte mit e<strong>in</strong>em Fahrer als Hauptoperator und Ansätze, die ohne e<strong>in</strong>en Fahrer<br />
auskommen, unterteilt. Es wer<strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen an automatische Lenke<strong>in</strong>richtungen<br />
und die Eigenschaften ausgewählter Mess- und Ortungsverfahren dargestellt.<br />
Die stark variieren<strong>de</strong>n Ausgangsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen und gärtne<br />
rischen Praxis sowie die hohen Anfor<strong>de</strong>rungen an die Arbeitsqualität und Effektivität<br />
stellt das Hauptproblem für <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz technischer Lösungen aus <strong>de</strong>r Industrie <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
Landwirtschaft dar IHOFFMANN
Bei <strong>de</strong>r seitlichen <strong>von</strong> wird zwischen automatischen Lenke<strong>in</strong>-<br />
richtungen und unterschie<strong>de</strong>n. Automatische Lenke<strong>in</strong>richtungen<br />
fuhren die ganze Arbeitsmasch<strong>in</strong>e mit Die<br />
funktion <strong>de</strong>s Fahrers wird hier <strong>von</strong> übernommen,<br />
wodurch <strong>de</strong>m Fahrer mehr zur an<strong>de</strong>ren Arbeitsabläufe ver-<br />
bleibt. wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rzeit <strong>von</strong> Herstellern<br />
vor allem für Mähdrescher, Häcksler und selbstfahren<strong>de</strong> Rübenro<strong>de</strong>r ange-<br />
boten. Als Sensoren zur <strong>de</strong>r Leitl<strong>in</strong>ien kommen <strong>in</strong> mechanische<br />
Taster, sie im 2.3.I wer<strong>de</strong>n, zum E<strong>in</strong>satz.<br />
übertragen, ausgleichen. Die<br />
<strong>Seitenführung</strong> <strong>von</strong> Anbaugeräten stellt e<strong>in</strong> <strong>de</strong>rartiges<br />
Arbeitsgerät unabhängig vom Schlepper<br />
2.2 Automatische Gerätesteuerungen<br />
wer<strong>de</strong>n soll,<br />
E<strong>in</strong> E<strong>in</strong>satzschwerpunkt automatischen Höhenführung ist<br />
Sämasch<strong>in</strong>en. AUERNHAMMER<br />
automati-<br />
<strong>de</strong>r automatischen .r-uru urnz<br />
Schleppers muß<br />
Fahrer<br />
Uberwachung <strong>de</strong>r
Stand <strong>de</strong>s Wissens 21<br />
Schartiefenüberwachung und mittels Ultraschall. Von e<strong>in</strong>er au-<br />
tomatischen Kontrolle kann jedoch nur bei <strong>de</strong>r wer-<br />
<strong>de</strong>n, da hier das Sensorsignal <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em direkt <strong>de</strong>s Schar-<br />
drucks verwen<strong>de</strong>t wird. Als Vorteil wird die Entlastung <strong>de</strong>s auch bei<br />
Arbeitsdauer Nachteilig wird <strong>de</strong>r hohe Aufwand für die e<strong>in</strong>gesetzte<br />
Elektronik und e<strong>in</strong>e Falschregelung durch die auf e<strong>in</strong>en<br />
fensensor beurteilt. Der Ultraschallsensor stellt dabei hohe Anfor<strong>de</strong>rungen an die ab<br />
getastete Bo<strong>de</strong>noberfläche. Diese sollte gleichmäßig se<strong>in</strong>, da ungleiche Krümelgrößen<br />
zu großen Streuurigen bei <strong>de</strong>n Meßwerten führen,<br />
In <strong>de</strong>r Kf'ßl.-Presse-Inforrnation 1/1986 wird <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er automatischen Saattiefen<br />
kontrolle auf Ultraschallbasis berichtet. Es han<strong>de</strong>lt sich um e<strong>in</strong> <strong>in</strong> Australien<br />
setztes Gerät, das außer zur Saat auch zur Bo<strong>de</strong>nbearbeitung e<strong>in</strong>gesetzt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
E<strong>in</strong>e <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nfeuchte Saattiefenregelung wird <strong>von</strong> WEATHERLV und<br />
BOWERS vorgestellt. Das besteht aus e<strong>in</strong>em Feuchtesensor. mit <strong>de</strong>m<br />
die Bo<strong>de</strong>nfeuchte durch elektrische Leitfähigkeitsmessung bestimmt wird und e<strong>in</strong>er<br />
Sämasch<strong>in</strong>e, <strong>de</strong>ren Ablagetiefe durch e<strong>in</strong>en verstellt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Komponenten und das Reaktionsverhalten <strong>de</strong>s Systems<br />
wur<strong>de</strong>n zuerst parametrisiert und anschließend anhand <strong>von</strong> und<br />
mo<strong>de</strong>llbasieren<strong>de</strong>n Simulationen optimiert.<br />
BRUNS und GÖHLICH erläutern die Problematik <strong>de</strong>r kontaktlosen Feldoberflä-<br />
chenerfassung durch Sensoren anhand e<strong>in</strong>es Ultraschallsensors. Die Autoren stellen<br />
Überlegungen zu e<strong>in</strong>er rechnergestützten <strong>von</strong> an. Han<strong>de</strong>lsüb-<br />
liche Sensoren konnten nur nach e<strong>in</strong>er an die Arbeitsaufgabe e<strong>in</strong>gesetzt<br />
wer<strong>de</strong>n. Als Anwendungsbeispiel wird die e<strong>in</strong>es Feldspritz<br />
gestänges vorgestellt.<br />
DVCK et al. beschreiben unter an<strong>de</strong>rem e<strong>in</strong> Verfahren zur automatischen
22 Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
Tiefenführung <strong>von</strong> Bo<strong>de</strong>nbearbeitungsgeräten und e<strong>in</strong>er pneumatischen Sämasch<strong>in</strong>e<br />
<strong>de</strong>n Untersuchungen wur<strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong> Ergebnisse erzielt:<br />
Automatische Tiefensteuerungen konnten das Arbeitsergebnis vor allem bei unter<br />
schiedlichen Bo<strong>de</strong>nbed<strong>in</strong>gungen auffallend verbessern. Bei konstanten Bo<strong>de</strong>nbe-<br />
kaum Unterschied <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Ablagegenauigkeit bei pneumatischen<br />
Sämasch<strong>in</strong>en ohne automatischer Tiefenführung zu erkennen.<br />
2. Bei Unebenheiten zur Fahrtrichtung wur<strong>de</strong> ke<strong>in</strong>e befriedigen<strong>de</strong> Bearbei-<br />
tungstiefe erreicht, wenn e<strong>in</strong>er o<strong>de</strong>r mehrere <strong>de</strong>r vier Sensoren auf diesen Uneben<br />
heiten gemessen haben.<br />
Das Tiefenführungssystem konnte auf sehr unebenem Bo<strong>de</strong>n ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche<br />
Tiefe halten. Dies wur<strong>de</strong> auf die Verteilung <strong>de</strong>r Sensoren am Geräterahmen ZlI-<br />
rückgeführt. Die e<strong>in</strong>zelnen Unebenheiten konnten somit nicht genau ausgesteuert<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Außer<strong>de</strong>m wird auf <strong>de</strong>n technischen Entwicklungsbedarf bei Schlepper- und<br />
Geräteherstellern h<strong>in</strong>gewiesen. Die Autoren versprachen sich <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Komb<strong>in</strong>ation<br />
Elektronik und Schlepperhydraulik wirtschaftliche für die Zukunft.<br />
2.3 Sensoren zur Gerätesteuerung <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Landwirtschaft<br />
e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
unterschiedlicher Sensoren Je nach Ortungssystem können<br />
unterschiedliche Leitl<strong>in</strong>ien genutzt wer<strong>de</strong>n. HOFMANN (1995) gibt e<strong>in</strong>en syste-<br />
matischen Überblick <strong>de</strong>r Landwirtschaft e<strong>in</strong>gesetzten Leitl<strong>in</strong>ienarten. Der Autor<br />
Leitl<strong>in</strong>ien "durch landwirtschaftliche Bearbeitung" und "mit
Stand <strong>de</strong>s Wissens 23<br />
zusätzlichen Mitteln geschaffene Leitl<strong>in</strong>ien" e<strong>in</strong>. Außer<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n noch "virtuelle<br />
Leitl<strong>in</strong>ien" beschrieben, bei <strong>de</strong>nen e<strong>in</strong> vorgegebener Fahrverlaufmit <strong>de</strong>r momentanen<br />
Position verglichen wird. Zur Positionsermittlung können im landwirtschaftlichen<br />
Bereich ortsgebun<strong>de</strong>ne Ortungsverfahren o<strong>de</strong>r Satellitenortungssysteme (GPS) e<strong>in</strong><br />
gesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
E<strong>in</strong>en Überblick <strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Landtechnik Leitl<strong>in</strong>ien und <strong>de</strong>ren meßtechni<br />
sehe Erfassung wird <strong>in</strong> <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Tabelle (Tab. I) gegeben. E<strong>in</strong>e genaue Darstel<br />
lung <strong>de</strong>r technischen und physikalischen Funktionsweise <strong>de</strong>r <strong>in</strong> dieser Arbeit unter<br />
suchten Ultraschall- und Triangulationsensoren wird <strong>in</strong> <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Kapiteln aufge<br />
zeigt. Auf e<strong>in</strong>e <strong>de</strong>taillierte Darstellung aller angegebenen Abtastpr<strong>in</strong>zipien wird an<br />
dieser Stelle verzichtet.
24<br />
Tab. 1:<br />
Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
In <strong>de</strong>r Landtechnik e<strong>in</strong>gesetzte Leitl<strong>in</strong>ien und mögliche physikalische Erfassungspr<strong>in</strong>zipien<br />
-_._-_._--<br />
X X<br />
Pflanzenreihe X X<br />
Dämme X X<br />
Schwa<strong>de</strong> X<br />
Bo<strong>de</strong>nrillen.<br />
X X<br />
Fahrspur X X<br />
I elektrisch<br />
Dammzwischenraum X<br />
X X X<br />
-_-:==mit<br />
zusätzlichen Mitteln geschaffene Leitl<strong>in</strong>ien<br />
------<br />
Bo<strong>de</strong>nrillen:<br />
X X<br />
X<br />
Erhebungen:<br />
X<br />
Leitsaat X X<br />
Kontrastmittel X<br />
Bo<strong>de</strong>nkabel X<br />
X<br />
virtuelle Leitl<strong>in</strong>ien X
26 Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
Unterschied zu landwirtschaftlichen Kulturen Beschädigungen nicht toleriert wer<strong>de</strong>n.<br />
E<strong>in</strong>e weite Verbreitung <strong>von</strong> abtasten<strong>de</strong>n wird zu<strong>de</strong>m noch häufig<br />
durch e<strong>in</strong>e mangeln<strong>de</strong> Funktionssicherheit bei Fehlstellen <strong>de</strong>r re-<br />
lativ hohen Investitionen dürften jedoch auch ökonomische Faktoren <strong>de</strong>n ","'IHle;"'!!<br />
E<strong>in</strong>satz dieser e<strong>in</strong>e entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle<br />
Rollentaster mit<br />
Tastqestänqe<br />
Mähwerk<br />
Abb. I: Lenkregele<strong>in</strong>richtung mit Rollentaster zum Abtasten <strong>von</strong> Bestandskanten<br />
an e<strong>in</strong>em Mähdrescher [GRAEBER, E.<br />
WULF beschreibt unterschiedliche automatische Seitensteuerungen für Pt1cge-<br />
geräte und Erntemasch<strong>in</strong>en im Kartoffelanbau. Seitlich bewegliche Schleif- o<strong>de</strong>r<br />
Rollentastern wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er speziellen Leitfurche o<strong>de</strong>r im Furchenbereich zwischen<br />
zwei Dämmen geführt, Die Taster wirken auf mechanische Schalter o<strong>de</strong>r <strong>in</strong>duktive<br />
Sensoren. Diese betätigen das elektromagnetische Ventil e<strong>in</strong>es doppeltwirken<strong>de</strong>n Hy<br />
das angehängte Azzreaat seitlich verschiebt. Die seitliche Ab-<br />
I
weichung unterschiedlicher Pflegegeräte im Kartoffelanbau mit automatischer<br />
LW'UcLH·'6"'-'6' zwischen 0,6 und 2,6 cm 1998).<br />
E<strong>in</strong>e Beson<strong>de</strong>rheit unter <strong>de</strong>n tasten<strong>de</strong>n Verfahren zur automatischen Geräteführung<br />
stellt die elektrische dar. Hier dient <strong>de</strong>r elektrische Wi<strong>de</strong>rstand<br />
zwischen Taster, Pflanze und Bo<strong>de</strong>n als E<strong>in</strong>gangssignal für <strong>de</strong>n Zum Abtasten<br />
<strong>de</strong>r Pflanzenreihe wer<strong>de</strong>n mehrere Taster, die sich über o<strong>de</strong>r neben <strong>de</strong>n Pflanzen be-<br />
f<strong>in</strong><strong>de</strong>n, und e<strong>in</strong> Erdleiter. <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Kontakt zum Bo<strong>de</strong>n erzeugt, Berührt nun<br />
e<strong>in</strong> Taster e<strong>in</strong>e Pflanze, so schließt sich über die Pflanze und Bo<strong>de</strong>n e<strong>in</strong> Strom-<br />
kreis und es wird e<strong>in</strong> Signal für <strong>de</strong>n erzeugt. Der Wi<strong>de</strong>rstand zwischen Taster,<br />
Pflanze und Er<strong>de</strong> hängt <strong>von</strong> vielen Faktoren ab. Er wird durch die <strong>de</strong>s<br />
Bo<strong>de</strong>ns und <strong>de</strong>r Pflanze und die Intensität <strong>de</strong>r zwischen Taster und Pflanze<br />
bee<strong>in</strong>flußt. Nach v. ZABELTITZ <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstand zwischen 15 und 20<br />
Megaohm, was bei <strong>de</strong>n e<strong>in</strong>gesetzten sehr ger<strong>in</strong>gen Strömen e<strong>in</strong>e hohe Verstärkung<br />
notwendig macht.<br />
E<strong>in</strong>e auf <strong>de</strong>r Leitfähigkeitsmessung basieren<strong>de</strong> automatische für<br />
Hackgeräte wird <strong>von</strong> JAKOB und SCHWALENBERG Bei diesem<br />
stem bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t sich e<strong>in</strong> Taster seitlich <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Pflanzenreihe. Die <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Tastern<br />
erzeugten wer<strong>de</strong>n elektronisch verstärkt und zum Ansteuern e<strong>in</strong>es Hydrau-<br />
likzyl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs, <strong>de</strong>r das seitlich verschiebt, Beim Rübenhacken<br />
sollen sich mit diesem Gerät bis kmJh erreichen lassen.<br />
E<strong>in</strong> serienmäßiger E<strong>in</strong>satz dieser Lenke<strong>in</strong>richtung ist nicht bekannt.<br />
Bei allen mit Tastern muß e<strong>in</strong>e durchgehen<strong>de</strong> vorhan<strong>de</strong>ne<br />
nie wer<strong>de</strong>n. Fehlstellen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r abgetasteten führen<br />
sonst zu falschen Steuersignalen. wodurch bei Hackarbeiten über gesamte<br />
Arbeitsbreite <strong>de</strong>r Pflanzenbestand vernichtet wer<strong>de</strong>n kann,
Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
Lichtquelle zum E<strong>in</strong>satz. Die sehr hohe Anfälligkeit für Verschmutzungen<br />
Hauptnachteil <strong>de</strong>r Verfahren angesehen.<br />
Auf die <strong>von</strong> optischen Sensoren zur Bestimmung <strong>von</strong> Bewe-<br />
gungen und Positionen <strong>von</strong> PAUL, W. und H. SPECKMANN (1983) e<strong>in</strong>gegangen.<br />
Die Autoren beschreiben <strong>in</strong> ihrem nur die Eignung <strong>de</strong>r<br />
Sensoren für die Landtechnik, aber ke<strong>in</strong> konkretes Beispiel aus <strong>de</strong>m landwirt-<br />
schaftlichen Bereich an.<br />
E<strong>in</strong>e Möglichkeit zur automatischen <strong>von</strong> landwirtschaftlichen Geräten<br />
durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong> Verfahren ist die Laserleitl<strong>in</strong>ie.<br />
E<strong>in</strong> <strong>de</strong>rartiges wird <strong>von</strong> R. P. van ZUYDAM und C. SONNEVELO (1994) be-<br />
schrieben 2). Die Leitl<strong>in</strong>ie wird hier <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em arn Feldrand positionierten Ro-<br />
tationslaser aus <strong>de</strong>m Bauwesen erzeugt. Der auf e<strong>in</strong>em Führungsgestell an e<strong>in</strong>em<br />
Schlepper) montierte Empfänger steuert hydraulisch die Position<br />
<strong>de</strong>s Gerätes. Die Genauigkeit <strong>de</strong>s Steuerungssystems wird mit e<strong>in</strong>er maximalen Ab<br />
weichung
empfänger<br />
"Totes Band"<br />
Photozelle<br />
Abb. 2: Aufsicht aufe<strong>in</strong>en lasergeführten Gantrvtraktor (verän<strong>de</strong>rt<br />
ZUYDAM und C. SONNEVELD<br />
2.3.2.2 Akustische Verfahren<br />
P. van<br />
Unter akustischen Verfahren wesentlichen <strong>von</strong><br />
Ultraschallsensoren zu verstehen. An<strong>de</strong>re akustische Sensoren wer<strong>de</strong>n<br />
schaftliehen<br />
nutzt.<br />
gartenbauliehen Bereich für diesen E<strong>in</strong>satzzweck ge-<br />
Die beson<strong>de</strong>re <strong>von</strong> Ultraschallsensoren ist zum relativ<br />
Preis und an<strong>de</strong>rerseits die Robustheit und <strong>de</strong>r Sensoren<br />
begrün<strong>de</strong>t, Unter Laborbed<strong>in</strong>gungen untersuchte (1978) Ultraschallsensoren<br />
berührungslosen Nachweis <strong>von</strong> natürlichen Leruuuon. diesem Zweck<br />
bei Kartoffeldämmen e<strong>in</strong>e
Stand <strong>de</strong>s Wissens 31<br />
geköpfte Rübenreihe und e<strong>in</strong>e Halmreihe <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Bo<strong>de</strong>nr<strong>in</strong>ne E<strong>in</strong><br />
Nachweis <strong>de</strong>r Meßobjekte mit e<strong>in</strong>er <strong>von</strong> rund 20 mm emer<br />
mittleren Abweichung <strong>von</strong> ±15 mm und e<strong>in</strong>em Abstand zwischen Objekt und Sensor<br />
<strong>von</strong> 500 mm,<br />
Die vielseitigen und E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten <strong>von</strong> Ultraschall im Bereich<br />
Landwirtschaft und Gartenbau wer<strong>de</strong>n <strong>von</strong> TILLET (1991) ausführlich erläutert. Der<br />
Autor beschreibt unter an<strong>de</strong>rem zur Pflugfurchenerfassung bei e<strong>in</strong>em<br />
Pflugroboter, zum Erkennen <strong>von</strong> an e<strong>in</strong>er automatischen Erntemaschi-<br />
ne und zur e<strong>in</strong>er Pflanzmasch<strong>in</strong>e.<br />
E<strong>in</strong>ige Anwendungen akustischer Verfahren zur Abstandsmessung bei <strong>de</strong>r Höhenfüh<br />
rung wur<strong>de</strong>n bereits im Kapitel 2.2 beschrieben. Daher soll an dieser Stelle <strong>in</strong>sbeson-<br />
<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong> Ultraschallsensoren zur beschrieben wer<strong>de</strong>n.<br />
WARNER und HARRIES experimentierten bereits 1972 mit e<strong>in</strong>em ultraschallgesteuerten<br />
System zur das sich an <strong>de</strong>r Pflugfurche orientiert. E<strong>in</strong> ähnlich arbei<br />
ten<strong>de</strong>s System wird auch <strong>von</strong> KOLLAR für die Spurführung mobiler Aggregate<br />
behan<strong>de</strong>lt.<br />
Möglichkeiten und Grenzen <strong>de</strong>r akustischen Meßwertgew<strong>in</strong>nung an Pflugfurchen<br />
wer<strong>de</strong>n <strong>von</strong> AHRENS behan<strong>de</strong>lt. Der Autor beschreibt e<strong>in</strong>e automatische<br />
Traktorlenkung, die mit zwei Ultraschallsensoren ausgerüstet ist. Bei <strong>de</strong>r praktischen<br />
Fel<strong>de</strong>rprobung <strong>de</strong>s stellte sich jedoch heraus, daß unter <strong>de</strong>n gegebenen Be-<br />
d<strong>in</strong>gungen (trockener, Bo<strong>de</strong>n, unebene Fahrbahn, starke W<strong>in</strong>dbee<strong>in</strong>flussung)<br />
ke<strong>in</strong>e sichere Meßwertgew<strong>in</strong>nung mit <strong>de</strong>n e<strong>in</strong>gesetzten Sensoren möglich war. Die<br />
Voraussetzungen und Anfor<strong>de</strong>rungen zum Erfassen <strong>von</strong> landwirtschaftlichen Bear<br />
beitungsgrenzer, mit Hilfe <strong>von</strong> Ultraschallsensoren wur<strong>de</strong>n <strong>von</strong> AHRENS (1980) e<strong>in</strong><br />
gehend beschrieben. Es stellte sich heraus, daß noch erhebliches Potential zur<br />
<strong>de</strong>s Systems h<strong>in</strong>sichtlich Meß- und Übertragungsgenauigkeiten besteht.
Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
zu e<strong>in</strong>er automatischen <strong>von</strong><br />
schwa<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n <strong>von</strong> HOFMANN durchgelührt. Neben statischen<br />
sehen Sensoruntersuchungen wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong> Algorithmus zur Berechnung Flächen<strong>in</strong>-<br />
e<strong>in</strong>es Senwadquerschnittes entwickelt. Schwerpunkt dieser dient<br />
verrechneter Form als E<strong>in</strong>gangssignal e<strong>in</strong>e vorhan<strong>de</strong>ne automatische Lenke<strong>in</strong>-<br />
richtung. Bei praktischen Versuchen wur<strong>de</strong>n 7 Sensoren e<strong>in</strong>gesetzt, die, <strong>in</strong> zwei<br />
Gruppen geschaltet, abwechselnd Messungen vornahmen.<br />
die pr<strong>in</strong>zipielle Eignung <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Sensorik bis zu Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeiten <strong>von</strong><br />
H"'AHlWl 15.5 km/h nachgewiesen<br />
diesen hohen Geschw<strong>in</strong>digkeiten wer<strong>de</strong>n vom<br />
Der Schwerpunkt Auswertung lag vielmehr<br />
schw<strong>in</strong>digkeitsgrenze, bei<br />
2,4<br />
wird <strong>de</strong>rzeit <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er<br />
die Lenke<strong>in</strong>richtung <strong>de</strong>m Schwad noch<br />
Genauigkeit <strong>de</strong>r Spurführung bei<br />
ke<strong>in</strong>e Angaben gt::lHi;It::lll.<br />
Fahrge<br />
kann.<br />
Die Bildverarbeitung als Möglichkeit zur Pflanzen- o<strong>de</strong>r Reihenerkennung<br />
Anzahl unterschiedlicher Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
tensiv bearbeitet. Die <strong>de</strong>rzeit diskutierten zur<br />
schaftliehet Fahrzeuge o<strong>de</strong>r Aggregate mit <strong>de</strong>r Bildverarbeitung lassen<br />
zwei Bereiche unterteilen. Zum e<strong>in</strong>en die Ptlanzenerkennung zur Positionsermittlung<br />
und an<strong>de</strong>rerseits die Reihenerfassung. Im zur o<strong>de</strong>r<br />
I<strong>de</strong>ntifikation <strong>de</strong>r Reihenerfassung nicht die e<strong>in</strong>zelne son<strong>de</strong>rn die<br />
ganze Pflanzenreihe <strong>de</strong>tektiert und e<strong>in</strong>e Leitl<strong>in</strong>ie berechnet.<br />
Bei e<strong>in</strong>er I<strong>de</strong>ntifikation <strong>de</strong>r Pflanze e<strong>in</strong>e Unterscheidung zwischen Kultur<br />
Unkraut autgrund morphologischer Parameter vorgenommen wer<strong>de</strong>n. Derartige<br />
zur I<strong>de</strong>ntifikation<br />
Pflanzen wer<strong>de</strong>n <strong>von</strong>
Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
z.B, nE. GUYERet al. D. M. WEOBBECKE al. (1995) und H. GEORG et al.<br />
beschrieben. Wird neben <strong>de</strong>r Pflanzeni<strong>de</strong>ntifikation noch e<strong>in</strong>e Positionsbe-<br />
stimmung so lassen sich mit <strong>de</strong>n Positionen <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>zelnen Kulturpflan-<br />
zen auch die <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieren.<br />
E<strong>in</strong> Vorteil <strong>de</strong>r Bildverarbeitung gegenüber <strong>de</strong>n bisher beschriebenen Sensor<br />
systemen ist die Möglichkeit <strong>de</strong>s vorausschauen<strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satzes. Insbeson<strong>de</strong>re bei <strong>de</strong>r<br />
Reihenerkennung kann <strong>de</strong>r Fahrverlauf<strong>de</strong>s Arbeitsgerätes schon im Voraus berechnet<br />
wer<strong>de</strong>n. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n meisten Sensoren, die <strong>de</strong>n Verlauf <strong>de</strong>r Pflanzenreihe<br />
immer nur an e<strong>in</strong>em Punkt können, bietet die digitale Bildverarbeitung<br />
darüber h<strong>in</strong>aus die Chance bei <strong>de</strong>r Generierung e<strong>in</strong>es Steuersi-<br />
zu elim<strong>in</strong>ieren o<strong>de</strong>r Fehlstellen zu überbrücken. Die bei <strong>de</strong>n bisher realisierten<br />
Systeme auftreten<strong>de</strong>n Instabilitäten und Schw<strong>in</strong>gungen um die Sollposition ist häufig<br />
durch das Abtasten <strong>de</strong>r Sensoren begrün<strong>de</strong>t.<br />
Die hohen die bei <strong>de</strong>r Bildanalyse anfallen, müssen zur Steuersignal<br />
generierung erheblich reduziert wer<strong>de</strong>n. Diese Datenreduktion verbun<strong>de</strong>n mit zum<br />
Teil sehr aufwendigen zur Positions- und Pflanzeni<strong>de</strong>ntifikation<br />
führen zu relativ hohen Verarbeitungszeiten. Dies wirkt sich beson<strong>de</strong>rs nachteilig für<br />
<strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz zur bei <strong>de</strong>n gefor<strong>de</strong>rten hohen Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeiten aus,<br />
und dürfte e<strong>in</strong> wesentlicher Grund für die mangeln<strong>de</strong> Verbreitung solcher Systeme im<br />
landwirtschaftlichen Bereich se<strong>in</strong>.<br />
Von KElCHER et al, (1995) wird e<strong>in</strong> Bildverarbeitungssystem zur Reihenverfolgung<br />
vorgestellt. Der Aufbau e<strong>in</strong>es solchen sowie die unterschiedlichen Prozesse<br />
<strong>de</strong>r wird <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Darstellung 3) schematisch aufge-<br />
zeigt.
Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
Angaben zu und Reibenverläufe<br />
über und Reihenverläufe nur sehr wenige Angaben aus <strong>de</strong>r<br />
Literaturvor. f<strong>in</strong><strong>de</strong>n sich Aussagen zur Komablage bei <strong>de</strong>r Saat.<br />
Die zur Ablagegenauigkeit bei Sämasch<strong>in</strong>en beschränken -'-"J--"'"<br />
meist auf e<strong>in</strong>e Beurteilung <strong>de</strong>r Längsverteilung <strong>de</strong>r Körnerablage <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Pflanzenreihe<br />
GRlEPENTROG 1992 und H. et al. 1993). In <strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n zu<strong>de</strong>m<br />
nur die Genauigkeiten <strong>von</strong> landwirtschaftlichen Feldfrüchten wie Getrei<strong>de</strong>, Rüben<br />
o<strong>de</strong>r Ackerbohnen beurteilt.<br />
Die <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Reihe ist nach H.-W. GRIEPENTROG (1992) bei E<strong>in</strong>zel<br />
komsämasch<strong>in</strong>en wesentlich gleichmäßiger, als bei <strong>de</strong>r Drillsaat. Zur Beurteilung <strong>de</strong>r<br />
Arbeitsqualtität <strong>von</strong> verschie<strong>de</strong>nen Sägeräten wur<strong>de</strong>n bestimmte Maßstäbe festgelegt.<br />
Diese beziehen sich sowohl auf Labor- als auch auf Feldunter<br />
suchungen (W. BRlNKMA.NN et al. 1985). Angaben über die Aussaatbreite verschie<strong>de</strong><br />
ner Säscharformenwer<strong>de</strong>n <strong>von</strong> M. ESTLER (1998) gemacht.<br />
Aussagen zum Verlauf <strong>von</strong> Pflanzenreihen als e<strong>in</strong> notwendiger E<strong>in</strong>gangsparameter<br />
zur Entwicklung e<strong>in</strong>er automatische lassen sich aus <strong>de</strong>n Literaturan-<br />
gaben zur Ablagegenauigkeit nicht gew<strong>in</strong>nen. E<strong>in</strong>e Untersuchung <strong>de</strong>r we-<br />
sentlich durch die Verfahrenstechnik bed<strong>in</strong>gten h<strong>in</strong>sichtlich Pflanzenpositi-<br />
on und Reihenverlauf gartenbaulicher Kulturen ist daher Bestandteil dieser Arbeit.<br />
35
36 Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
Bo<strong>de</strong>noberflächen und Oberflächenprofile<br />
Die zu Bo<strong>de</strong>noberflächen und Oberflächenprofilen aus <strong>de</strong>r Literatur s<strong>in</strong>d,<br />
ähnlich <strong>de</strong>n Angaben zu Reihenverläufen und Pflanzenposition, für die Entwicklung<br />
automatischen verwertbar. Ihr Versuchs ansatz be-<br />
sich <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Regel auf an<strong>de</strong>re wer<strong>de</strong>n hierfür nur relativ<br />
kle<strong>in</strong>e Parzellen untersucht, um Aussagen über Saatbettbeschaffenheit o<strong>de</strong>r<br />
Witterungse<strong>in</strong>flüsse machen zu können.<br />
Pr<strong>in</strong>zipiell wer<strong>de</strong>n zwei unterschiedliche zum Abtasten<br />
<strong>von</strong> Bei <strong>de</strong>n taktilen Verfahren besteht e<strong>in</strong> Kontakt <strong>de</strong>s<br />
Meß<strong>in</strong>strumentes mit <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>noberfläche. wird dabei das Oberflächenprofil<br />
mit Stäben und anschließen<strong>de</strong> Auswertung<br />
kann manuell, elektronisch o<strong>de</strong>r Bei dieser Metho<strong>de</strong> kommt es aber<br />
unter Umstän<strong>de</strong>n zu e<strong>in</strong>er <strong>de</strong>r Meßwerte. E<strong>in</strong>e solche Be-<br />
e<strong>in</strong>flussung <strong>de</strong>r Meßwerte ist bei kontaktlosen die o<strong>de</strong>r mit Laser-,<br />
Infrarot- o<strong>de</strong>r Ultraschallsensoren arbeiten, In Zeit wer<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>shalb vermehrt berührungs los arbeiten<strong>de</strong> Meßverfahren e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
E<strong>in</strong> taktil mit Taststäben arbeiten<strong>de</strong>s Gerät, das mit e<strong>in</strong>er elektronischen Datenauf<br />
zeichnung ausgestattet <strong>von</strong> RADKE et al, (1981) Der vertikale<br />
Meßbereich dieses Meß<strong>in</strong>strumentes 25 cm bei e<strong>in</strong>er relativen Auflösung <strong>von</strong><br />
1 mrn. Da <strong>de</strong>r Abstand zwischen zwei Meßstäben rnm kann horizontal nur<br />
erfassen.<br />
Mit <strong>de</strong>m lassen sich nebene<strong>in</strong>an-<br />
e<strong>in</strong>dimensionale Oberflächenprofile mit <strong>von</strong> m, gleichzeitig<br />
FLANAGAN et al, (1995) entwickelten e<strong>in</strong>en Laser-Scanner zur e<strong>in</strong>es<br />
x 3 Dieses e<strong>in</strong>- o<strong>de</strong>r zweidimensional arbei-
Stand <strong>de</strong>s Wissens 37<br />
ten<strong>de</strong> Gerät wur<strong>de</strong> zur Beurteilung <strong>von</strong> Bo<strong>de</strong>nerosionen entwickelt. Es läßt sich aber<br />
auch für e<strong>in</strong>e Vielzahl an<strong>de</strong>rer Aufgaben e<strong>in</strong>setzen. Mit e<strong>in</strong>em auf e<strong>in</strong>er L<strong>in</strong>earfüh<br />
rung befestigten Lasertriangulationssensor kann die Bo<strong>de</strong>noberfläche mit e<strong>in</strong>er Auflö<br />
sung <strong>von</strong> 0.5 abgetastet wer<strong>de</strong>n. Aus <strong>de</strong>n Untersuchungen mit diesem Laser<br />
Scanner lassen sich aber, aufgrund <strong>de</strong>r Versuchsanstellung, ke<strong>in</strong>e direkten Anfor<strong>de</strong><br />
rungen für die Regelung e<strong>in</strong>er automatischen Höhenführung erstellen.<br />
E<strong>in</strong> auf e<strong>in</strong>em Ultraschallsensor basieren<strong>de</strong>s Verfahren wird <strong>von</strong> ROBICHAUD und<br />
MOLNAU (1990) vorgestellt. Mit <strong>de</strong>m e<strong>in</strong>gesetzten Sensor läßt sich <strong>de</strong>r Höhenverlauf<br />
<strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>noberfläche mit e<strong>in</strong>er vertikalen Genauigkeit <strong>von</strong> 3 mm erfassen. Die hori<br />
zontale Auflösung beträgt jedoch nur 30 rum und ist durch das verursacht.<br />
Da sich die Untersuchungen auf die Oberflächenbeschaffenheit e<strong>in</strong>er sehr kle<strong>in</strong>en<br />
Fläche <strong>von</strong> nur 1 beschränken, s<strong>in</strong>d die Ergebnisse nicht als E<strong>in</strong>gangsparameter für<br />
e<strong>in</strong>e Geräteführung verwertbar.<br />
2.7 Regelung und Steuerung <strong>in</strong> <strong>de</strong>r automatischen Geräteführung<br />
Die Literaturangaben zur regelungstechnischen Betrachtung <strong>de</strong>r automatischen Gerä<br />
teführung beschränken sich meist auf Untersuchungen bei automatischen Lenke<strong>in</strong><br />
richtungen an unterschiedlichen selbstfahren<strong>de</strong>n Fahrzeugen. Von verschie<strong>de</strong>nen<br />
Autoren wird auch das Verhalten <strong>von</strong> fest mit <strong>de</strong>m Zugaggregat verbun<strong>de</strong>nen Werk<br />
zeugen dargestellt.<br />
Die Regelalgorithmen für das Fahrverhalten <strong>von</strong> drei verschie<strong>de</strong>ne Komb<strong>in</strong>ationen<br />
aus Arbeitsgerät und Zugfahrzeug wur<strong>de</strong>n <strong>von</strong> SMJTH et al. (1985) entwickelt und<br />
aufgestellt. Mittels k<strong>in</strong>ematischer Simulationsberechnungen wur<strong>de</strong>n die Fahrstabilität<br />
dieser Algorithmen anschließend getestet. E<strong>in</strong>e Validierung <strong>de</strong>r Rechenmo<strong>de</strong>lle unter
Stand <strong>de</strong>s Wissens 39<br />
CHOI et al. (1990) wird, als e<strong>in</strong>gesetzt. Bei <strong>de</strong>m<br />
rithmus wur<strong>de</strong>n festgelegte Rahmenbed<strong>in</strong>gungen wie Fahrgeschw<strong>in</strong>-<br />
digkeit, e<strong>in</strong> konstantes Lenkverhalten und schlupfloses Fahren unterstellt. In Simula<br />
tionen konnten beim Nachfahren e<strong>in</strong>es fest vorgegebenen Pfa<strong>de</strong>s <strong>von</strong><br />
5 cm erreicht wer<strong>de</strong>n.<br />
E<strong>in</strong>e ähnliche die sich zum Teil automatisch auf Verän<strong>de</strong>rungen e<strong>in</strong>stellen<br />
kann, wird auch <strong>von</strong> NOH und ERBACH (1993) beschrieben. E<strong>in</strong> Mo<strong>de</strong>ll mit zwei<br />
Freiheitsgra<strong>de</strong>n wird als Regelalgorithmus für die Fahrzeugführung e<strong>in</strong>gesetzt. Mit<br />
<strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r kle<strong>in</strong>sten quadratischen Abweichung (Lx-Metho<strong>de</strong>) <strong>von</strong> <strong>de</strong>r vorge<br />
gebenen Fahrfunktion kann sich die selbständig anpassen. Anhand <strong>von</strong><br />
Computersimulationen wur<strong>de</strong> die Regelung h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Funktionssicherheit<br />
überprüft.<br />
Die Mo<strong>de</strong>llbildung ist im Bereich <strong>de</strong>r autonomen Fahrzeugführung schon sehr weit<br />
fortgeschritten. Dies ist <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re auch darauf daß zum Teil auf<br />
sehr weitreichen<strong>de</strong> Forschungsergebnisse aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Kraftfahrzeugent<br />
wicklung zurückgegriffen wer<strong>de</strong>n kann. H<strong>in</strong>sichtlich beweglich Arbeitsge<br />
räte ist <strong>de</strong>r Stand <strong>de</strong>r Forschung weitaus kritischer zu beurteilen. Hier f<strong>in</strong><strong>de</strong>n sich<br />
kaum zur Regelung und Steuerung <strong>von</strong> Arbeitsgeräten.<br />
2.8 Regelungstechnische Metho<strong>de</strong>n zur Verbesserung <strong>de</strong>r Regelgüte<br />
Im Bereich <strong>de</strong>r Regelungstechnik gibt es e<strong>in</strong>e Vielzahl unterschiedlicher Möglichkei<br />
ten, die zur Verbesserung <strong>de</strong>r Regelgüte e<strong>in</strong>gesetzt wer<strong>de</strong>n können. An dieser Stelle<br />
sollen daher nur vier <strong>de</strong>r wichtigsten Metho<strong>de</strong>n näher betrachtet wer<strong>de</strong>n:<br />
1. Die Prädiktion,
40 Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
Metho<strong>de</strong>n können aus <strong>de</strong>r<br />
Die Vermaschung,<br />
3. Die Auapuon,<br />
4. Die Koord<strong>in</strong>ation.<br />
v ,n.Lm'-'L
Stand <strong>de</strong>s Wissens 41<br />
setzt, um die Regelsituation transparenter zu machen. PARLlTZ (1986)<br />
lichkeiten zur Vermaschung auf:<br />
I. Die Störgrößenaufschaltung,<br />
2. Die Störgrößenvorregelung,<br />
3. Die Hilfsgrößenaufschaltung,<br />
4. Die Kaska<strong>de</strong>nregelung.<br />
Die Störgrößenaufschaltung (Abb. 4) erfaßt neben <strong>de</strong>n Steuer- o<strong>de</strong>r Stell größen auch<br />
Zustandsgrößen, die <strong>de</strong>n zu regeln<strong>de</strong>n Prozeß bee<strong>in</strong>flussen.<br />
w<br />
z = Störgröße<br />
w =Führungsgröße<br />
z e = Regeldifferenz<br />
u = Reglerausgangsgr6ße<br />
x = Regelgröße<br />
e : Regler I u - I Prozeß I x<br />
+ - I + I<br />
Abb.4: nach PARLlTZ 1986 und SCHMIDT<br />
1994)<br />
Die Störgröße z wird durch e<strong>in</strong>en eigenen Meßwertgeber ermittelt und <strong>de</strong>r Regelung<br />
zugeführt, Da das Auftreten <strong>de</strong>r Störung schon bevor es zu e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>fluß auf die Re<br />
geIgröße x kommt ermittelt wird, können ausgleichen<strong>de</strong> Maßnahmen sofort emaetei<br />
tet wer<strong>de</strong>n.
Stand <strong>de</strong>s Wissens ___________ 43<br />
Die Hilfsgrößenaufschaltung kann als <strong>in</strong>terne Erweiterung e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>fachen Regel<br />
schleife angesehen wer<strong>de</strong>n. Es wer<strong>de</strong>n Hilfsregelgrößen XH nahe <strong>de</strong>m Angriffspunkt<br />
<strong>de</strong>r Störgrößen erfaßt und gezielt mit <strong>in</strong> die Regelung Regelungen mit<br />
Hilfsgrößenaufschaltung reagieren schneller auf e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluß <strong>von</strong> Störgrößen. da die<br />
Verän<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>r Hilfsgröße bereits e<strong>in</strong>e Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Führungswertes bewir<br />
ken.<br />
Bei <strong>de</strong>r Kaska<strong>de</strong>nregelung han<strong>de</strong>lt es sich um mehrere <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>de</strong>r geschaltete Regel<br />
kreise. Je<strong>de</strong> e<strong>in</strong>zelne Regelung verfügt über e<strong>in</strong>en eigenen Regler, <strong>de</strong>r mit entspre<br />
chen<strong>de</strong>n Fühlern ausgestattet se<strong>in</strong> muß. Es kann bei <strong>de</strong>r Kaska<strong>de</strong>nregelung zwischen<br />
zwei Regelkreisen, e<strong>in</strong>em äußeren Hauptregelkreis und m<strong>in</strong><strong>de</strong>stens e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>ternen<br />
Hilfsregelkreis unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Der <strong>in</strong>terne Regler se<strong>in</strong>e Regelgröße <strong>in</strong><br />
nerhalb <strong>de</strong>r Gesamtregelstrecke ab. Störgrößen. die <strong>in</strong> diesem Bereich e<strong>in</strong>greifen,<br />
wer<strong>de</strong>n schneller ausgeregelt. da sie nicht die gesamte Regelstrecke durchlaufen müs<br />
sen.<br />
2.8.3 Adaption<br />
Unter Adaption versteht man die Anpassung an wechseln<strong>de</strong> Umgebungse<strong>in</strong>flüsse,<br />
dies be<strong>de</strong>utet, daß sich e<strong>in</strong> selbständig auf die es umgeben<strong>de</strong>n Bed<strong>in</strong>gungen<br />
und E<strong>in</strong>wirkungen e<strong>in</strong>stellt. Im Bereich <strong>de</strong>r Regelungstechnik versteht man unter ad<br />
aptiven Reglern solche, bei <strong>de</strong>nen sich die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n aktiven Elemente <strong>de</strong>r Re<br />
gelung automatisch an die Regelstrecke und die umgeben<strong>de</strong>n Betriebsbed<strong>in</strong>gungen<br />
anpassen. Die Verfahren, mit <strong>de</strong>nen sich die Regelung anpaßt, können dabei sehr un<br />
terschiedlich se<strong>in</strong>. FÖLLlNGER (1992) beschreibt z.B. das "Self-Tun<strong>in</strong>g- Verfahren"<br />
und das .Mo<strong>de</strong>ll-Referenz-Verfahren", wobei er ausdrücklich auf weitere Möglich<br />
keiten h<strong>in</strong>weist.
44 Stand <strong>de</strong>s Wissens<br />
SCHMlDT unterschei<strong>de</strong>t zwischen<br />
adaptiven" Wer<strong>de</strong>n die Regelparameter<br />
Parametern <strong>de</strong>r angepaßt, so<br />
adantiven'' Regelung. Die automatische Anpassung<br />
"struktur<br />
die sich zeitlich än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Autor <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er "parameter<br />
Reglerstruktur an sich än<strong>de</strong>rn-<br />
<strong>de</strong> Streckenverhältnisse wird analog hierzu als "stru1ctulrad.aptive" Regelung bezeich<br />
net. An dieser Stelle wird entsprechend<br />
Regelung behan<strong>de</strong>lt. Für die Abstimmung<br />
s<strong>in</strong>d drei verschie<strong>de</strong>ne Teilaufgaben zu bewältigen:<br />
. Die I<strong>de</strong>ntifikation<br />
2. Die Entscheidung<br />
3. Die Modifikation.<br />
E<strong>in</strong> Blockschaltbild e<strong>in</strong>er Regelung mit<br />
folgen<strong>de</strong>n Grafik (Abb, 6) schematisch dargestellt.<br />
Regelparameter auf die Regelstrecke<br />
Teilaufgaben <strong>de</strong>r
Stand <strong>de</strong>s Wissens 45<br />
w u x<br />
Abb. 6: Darstellung e<strong>in</strong>er adaptiven Regelung (verän<strong>de</strong>rt nach SCHMIDT<br />
-------,<br />
Unter I<strong>de</strong>ntifikation wird die fortlaufen<strong>de</strong> automatische Erfassung <strong>de</strong>r sich än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n<br />
Streckeneigenschaften verstan<strong>de</strong>n. Sie kann daher auch mit .Erkennung <strong>de</strong>r Prozeß-<br />
parameter" beschrieben wer<strong>de</strong>n (PARLlTZ 1986). Zu diesen Prozeßparametern zählen<br />
die Stell- und Regelgrößen am Prozeße<strong>in</strong>gang und -ausgang. Es wird bei <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntifi<br />
kation nicht <strong>de</strong>r Sollwert, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Stellwert mit <strong>de</strong>r Regelgröße "verglichen". Die<br />
ser Vergleich kann entwe<strong>de</strong>r durch statische Rechenverfahren o<strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz<br />
<strong>von</strong> physikalischen Mo<strong>de</strong>llen durchgeführt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Entscheidung als zweiter Schritt <strong>de</strong>r Adaption wird nicht <strong>von</strong> allen Autoren als<br />
eigenständige Teilaufgabe zwischen I<strong>de</strong>ntifikation und Modifikation angesehen und<br />
beschrieben. E<strong>in</strong>e genaue Unterscheidung und Abgrenzung zwischen <strong>de</strong>n e<strong>in</strong>zelnen<br />
drei Teilschritten <strong>de</strong>r Adaption ist auch nicht immer e<strong>in</strong><strong>de</strong>utig durchzuführen. Im Ent-<br />
scheidungsprozeß wer<strong>de</strong>n abhängig <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Ergebnissen, die bei <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntifikation<br />
gewonnen wer<strong>de</strong>n, die geeigneten Regelparameter ermittelt.<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I
___________--'Stand <strong>de</strong>s Wissens 47<br />
Die Plausibilitätskontrolle überprüft, ob die gewonnenen Meßdaten verständlich und<br />
annehmbar s<strong>in</strong>d. Falls die gemessenen o<strong>de</strong>r berechneten Daten nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em zuvor<br />
festgelegten Bereich liegen, wer<strong>de</strong>n sie durch die Plausibilitätskontrolle ausgeschlos<br />
sen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Maßnahmen e<strong>in</strong>geleitet. Zu diesen Maßnahmen zählt z.B. die Ausga-<br />
be e<strong>in</strong>er Fehlermeldung bzw. die <strong>von</strong> zuvor Werten. Häufig<br />
dient e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache bei <strong>de</strong>r Maximal- und M<strong>in</strong>i-<br />
malwerte vorgegeben s<strong>in</strong>d, als Kontrollmechanismus.<br />
Unter e<strong>in</strong>er Hysterese wird im Allgeme<strong>in</strong>en das Zurückbleiben e<strong>in</strong>er Wirkung h<strong>in</strong>ter<br />
<strong>de</strong>r sie verursachen<strong>de</strong>n verän<strong>de</strong>rlichen physikalischen Größe verstan<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r Re<br />
gelungstechnik wird zwischen Schalt- und Stellhysterese unterschie<strong>de</strong>n. Schalthyste<br />
resen s<strong>in</strong>d bei unstetigen Reglern wie etwa bei Zweipunkt-Reglern zu f<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Sie ver<br />
h<strong>in</strong><strong>de</strong>rn e<strong>in</strong> ständiges An- o<strong>de</strong>r Ausschalten <strong>de</strong>r Stellglie<strong>de</strong>r wodurch <strong>de</strong>r Verschleiß<br />
erheblich verm<strong>in</strong><strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n kann. Stellhysteresen f<strong>in</strong><strong>de</strong>n sich bei stetigen Reglern,<br />
die mit kont<strong>in</strong>uierlichen Stellverän<strong>de</strong>rungen arbeiten. Der verän<strong>de</strong>rt bei <strong>de</strong>r<br />
Stellhysterese die Stellgröße nicht, solange sich die Regelgröße <strong>de</strong>m Führungswert<br />
annähert. Erst wenn die Differenz zwischen Führungswert und Regelgröße konstant<br />
bleibt, o<strong>de</strong>r sich vergrößert, än<strong>de</strong>rt e<strong>in</strong>e Regelung mit Stellhysterese ihre Stellgröße.
son<strong>de</strong>re Anfor<strong>de</strong>rungen an die Sensoren gestellt. E<strong>in</strong> Teil dieser Arbeit befaßt sich<br />
<strong>de</strong>shalb mit <strong>de</strong>n <strong>von</strong> aus <strong>de</strong>r Landwirtschaft auf das<br />
Sensorverhalten. Die Sensoren sollen sowohl im statischen, als auch im dynamischen<br />
Betrieb untersucht wer<strong>de</strong>n.<br />
Da die <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Sensoren gelieferten Rohmeßwerte häufig noch ke<strong>in</strong>e brauchbaren<br />
Stellgrößen für e<strong>in</strong>e externe Regelung o<strong>de</strong>r Steuerung liefern, soll <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren<br />
Abschnitt dieser Arbeit die <strong>de</strong>r Datenverarbeitung (Grenzwerterkennung<br />
und Elim<strong>in</strong>ation o<strong>de</strong>r Mittelwertbildung) zur Generierung <strong>von</strong> brauchbaren<br />
Regelvorgaben analysiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Entwicklung <strong>von</strong> geeigneten Regel- und Steuerprogrammen für e<strong>in</strong>e berührungs<br />
lose Höhen- und <strong>Seitenführung</strong> ist e<strong>in</strong> weiteres Teilziel <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit. Die<br />
Programmentwicklung umfaßt mehrere Bereiche:<br />
Nach <strong>de</strong>r Auswahl e<strong>in</strong>er Versuchsmechanik für die Seiten- und Höhen<br />
führung wird <strong>de</strong>ren Reaktionsverhalten unter genau reproduzierbaren Bed<strong>in</strong>gungen<br />
untersucht, und mit e<strong>in</strong>em entwickelten Rechenmo<strong>de</strong>ll zum Fahrver<br />
halten verglichen.<br />
.. Als letzter Schritt wird e<strong>in</strong> robustes für die Geräteführung aufgestellt.<br />
das sich schnell auf die sich än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Rahmenbed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>stellen karm. Un<br />
terschiedliche und Steuerstrategien wer<strong>de</strong>n mit e<strong>in</strong>fachen Reglervorgaben<br />
verglichen und h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Eignung bewertet.<br />
Die Erhöhung <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz <strong>de</strong>r automatischen ist<br />
<strong>von</strong> ausschlaggeben<strong>de</strong>r ökonomischer und soll daher geson<strong>de</strong>rt betrachtet<br />
wer<strong>de</strong>n,
Es wur<strong>de</strong> mit dieser Metho<strong>de</strong> e<strong>in</strong>e etwa e<strong>in</strong>e Woche <strong>de</strong>r<br />
e<strong>in</strong>er herkömmlichen Pflanzmasch<strong>in</strong>e untersucht. beim<br />
e<strong>in</strong>gestellte Abstand <strong>in</strong> Reihe 35 Salat im Beet-<br />
anbau 150 cm) angebaut. Es<br />
<strong>de</strong>n Randreihen ermittelt.<br />
4.1.1.2<br />
Bei <strong>de</strong>r zweiten wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong>e Totalstation<br />
Pflanzenpositionen e<strong>in</strong>er <strong>de</strong>r bei-<br />
Bei diesem e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>stallierte Totalstation e<strong>in</strong><br />
Glasprisma, das an <strong>de</strong>n Pflanze wur<strong>de</strong>.<br />
Gerät ermittelt mit e<strong>in</strong>er <strong>von</strong> mm die x, y und z-Position <strong>de</strong>r<br />
suchten Pflanzen. Die Koord<strong>in</strong>aten wer<strong>de</strong>n nun-Werte<br />
tensystem angegeben.<br />
Da die <strong>von</strong> Totalstation ermittelten Koord<strong>in</strong>aten sich emen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
Mitte <strong>de</strong>s Prismas beziehen und nicht am Gestell, kam es zu<br />
konstanten <strong>in</strong> <strong>de</strong>r zwischen <strong>de</strong>r<br />
sächlichen und <strong>de</strong>r gemessenen Koord<strong>in</strong>ate <strong>in</strong> z-Richtung<br />
90 mm, das be<strong>de</strong>utet die Pflanzen befan<strong>de</strong>n sich tatsächlich 90 unterhalb<br />
<strong>de</strong>r ermittelten Meßwerte. Die <strong>in</strong> x wer<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n<br />
Standort <strong>de</strong>s GEODHv1ETERS, <strong>de</strong>ssen und W<strong>in</strong>kel zwischen Pris-<br />
maoberfläche und <strong>de</strong>s geodätischen Koord<strong>in</strong>atensystems bestimmt.<br />
Oberfläche <strong>de</strong>s Prismas wur<strong>de</strong> während zur<br />
Daher sich <strong>de</strong>s <strong>de</strong>m<br />
Meßpunkt nur Abweichung <strong>in</strong> x-Richtung <strong>von</strong> 10 mm.
54 Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
pflanzenpositionen exakt bestimmen können, ist bei <strong>de</strong>r Höhenführung <strong>de</strong>r E<strong>in</strong>satz<br />
<strong>von</strong> Meßverfahren zur geeignet. Hierfür s<strong>in</strong>d mehre-<br />
re Meßverfahren, wie die mittels Ultraschall o<strong>de</strong>r die Laser-<br />
e<strong>in</strong>en zur Höhenführung ist das vom e<strong>in</strong>gesetzten Sen-<br />
sor übermittelte entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r vom e<strong>in</strong>gesetz-<br />
Sensor und kann dieses sehr unterschiedlich ausgeprägt<br />
se<strong>in</strong>. ke<strong>in</strong>e genauen über beim Abtasten <strong>von</strong> Beetoberflä-<br />
o<strong>de</strong>r Pflanzenbestän<strong>de</strong>n zur Verfügung stan<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n diese zu Beg<strong>in</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Untersuchungen genauer analysiert.<br />
Versuchsdurchführung und Meßaufbau<br />
Bei <strong>de</strong>n zu <strong>de</strong>n und Beetoberflächen wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong>er <strong>de</strong>r<br />
bei<strong>de</strong>n Ultraschallsensoren verwen<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r auch bei <strong>de</strong>n Sensoruntersuchungen (vergl.<br />
zum E<strong>in</strong>satz kam. Insofern s<strong>in</strong>d hier Ergebnisse auch als Sen-<br />
sorergebnisse zu werten. wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r als Sensor II bezeichneten Sensor <strong>de</strong>r<br />
Die wur<strong>de</strong>n über e<strong>in</strong>e <strong>von</strong> 60 cm Dieser kurze<br />
Bereich war durch die Schalen, <strong>in</strong> <strong>de</strong>nen die Versuchspflanzen angezo-<br />
gen wur<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n Schalen wur<strong>de</strong>n auch die Bo<strong>de</strong>nfraktionen für die Versu-<br />
che um <strong>de</strong>n Unterschied zwischen Oberflächenprofil und e<strong>in</strong>er Verän<strong>de</strong>-<br />
rung im Höhenverlaufermitteln zu können. Die relativ kurze Strecke <strong>von</strong> 60 cm ist für<br />
das Erarbeiten e<strong>in</strong>es zur <strong>de</strong>n Vorgaben e<strong>in</strong>er Höhenführung<br />
ausreichend.
Material und Metho<strong>de</strong>n 55<br />
Da das Reflexionsverhalten <strong>von</strong> gekörnten Oberflächen, wie aus <strong>de</strong>r Literatur zu ent<br />
nehmen ist (MICHALSKI und BERGER 1984), e<strong>in</strong>en starken E<strong>in</strong>fluß auf das Ultra<br />
schallecho und somit auf das Meßergebnis ausübt, wur<strong>de</strong>n zwei stark unterschiedliche<br />
Bo<strong>de</strong>narten für die Untersuchung ausgewählt.<br />
Bo<strong>de</strong>n I kann als fe<strong>in</strong>krümeliger Humus beschrieben wer<strong>de</strong>n. Dieser Bo<strong>de</strong>n war fast<br />
ste<strong>in</strong>frei und hatte e<strong>in</strong>e sehr fe<strong>in</strong>e Struktur. Der maximale Durchmesser <strong>de</strong>r größten<br />
Bo<strong>de</strong>nfraktionen lag bei ca. 10 mm. Bo<strong>de</strong>n Il läßt sich als lehmiger Sand am besten<br />
beschreiben. Dieser Bo<strong>de</strong>n war stark mit Ste<strong>in</strong>en durchsetzt und besaß e<strong>in</strong>e grobkör<br />
nige Krümelung. Der maximale Durchmesser <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nkluten und Ste<strong>in</strong>e bei ca.<br />
50 mm. Die Oberfläche dieses Bo<strong>de</strong>ns war im Gegensatz zu Bo<strong>de</strong>n I sehr rauh. Bei<strong>de</strong><br />
Bö<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n zuerst im trockenen, später im nassen Zustand untersucht, da neben<br />
<strong>de</strong>n untersuchten Oberflächenprofilen auch geklärt wer<strong>de</strong>n sollte, ob e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>fluß <strong>de</strong>r<br />
Bo<strong>de</strong>nfeuchte festzustellen ist.<br />
Neben <strong>de</strong>n genannten Bo<strong>de</strong>narten wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Verlauf <strong>de</strong>s Meßsignals beim Abtasten<br />
<strong>von</strong> unterschiedlichen Pflanzenbestän<strong>de</strong>n untersucht. Mit diesen Untersuchungen<br />
sollte geklärt wer<strong>de</strong>n, <strong>in</strong>wieweit vorhan<strong>de</strong>ne Pflanzen die Vorgaben zur Generierung<br />
e<strong>in</strong>es Steuersignalszur Höhenführung stören können.<br />
Als Pflanzenbestand wur<strong>de</strong>n drei Pflanzenarten ausgewählt: Radies iRaphanus sativus<br />
L. var. sattvusi; Weizen (Triticum L.) und Mungbohnen mungo L.). Aufgrund<br />
ihrer Morphologie stehen sie stellvertretend für unterschiedliche Kultur- und Un<br />
krautpflanzen. Zum Zeitpunkt <strong>de</strong>r Versuchsdurchführung hatten die Pflanzen e<strong>in</strong> Al-<br />
ter <strong>von</strong> 8 Der Weizen zeigte <strong>de</strong>n <strong>in</strong>sgesamt lichtesten Bestand. e<strong>in</strong>zelnen<br />
Pflanzen hatten e<strong>in</strong>e durchschnittliche Höhe <strong>von</strong> ca. 15 cm, wobei durchaus<br />
auch Exemplare bis zu 20 cm Höhe erreichten. Der dichteste Pflanzenbestand wur<strong>de</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>de</strong>r Mungbohne gebil<strong>de</strong>t. Diese wur<strong>de</strong>n durchschnittlich 14 cm hoch, Ex-<br />
emplare erreichten jedoch die Maximalhöhe <strong>von</strong> ca, 16 cm. bil<strong>de</strong>ten die<br />
Mungbohnen e<strong>in</strong>en sehr <strong>in</strong>homogenen Bestand. Die Bohnen <strong>von</strong> allen unter-
4.2 Sensoruntersucbungen<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
Die Anfor<strong>de</strong>rungen, die <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er berührungslosen Höhenführung an e<strong>in</strong>en Sensor zur<br />
Meßwerterfassung gestellt wer<strong>de</strong>n, unterschei<strong>de</strong>n sich wesentlich <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong><br />
rungen <strong>de</strong>r <strong>Seitenführung</strong>. Bei <strong>de</strong>r Höhenführung han<strong>de</strong>lt es sich um e<strong>in</strong>e Abstands<br />
messung zur Bo<strong>de</strong>noberfläche. Hierfür können unterschiedliche Meßpr<strong>in</strong>zipien, wie<br />
etwa Ultraschallsensoren, Triangulationstaster o<strong>de</strong>r Lasersensoren, die nach <strong>de</strong>m Im<br />
puls o<strong>de</strong>r Phasenlaufzeitverfahren arbeiten, wer<strong>de</strong>n. Der Meßbereich, <strong>de</strong>n<br />
e<strong>in</strong> Sensor zur Höhenführung ab<strong>de</strong>cken sollte, ist abhängig vom Anbauort und liegt<br />
zwischen 50 mm und 1000 mm.<br />
Sensoren zur <strong>Seitenführung</strong> müssen die Position <strong>de</strong>s Arbeitsgerätes gegenüber <strong>de</strong>r<br />
Pflanzenreihe, die Pflanzenposition o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Reihenverlauf ermitteln. Zur Zeit kom<br />
men für diese Aufgabe sehr unterschiedliche Meßpr<strong>in</strong>zipien zum E<strong>in</strong>satz. Als aus<br />
sichtsreichste Möglichkeit zur Positionsermittlung <strong>von</strong> wird <strong>de</strong>rzeit die<br />
Bildverarbeitung an verschie<strong>de</strong>nen Forschungse<strong>in</strong>richtungen untersucht. Diese Unter<br />
suchungen s<strong>in</strong>d wegen <strong>de</strong>r Komplexität <strong>de</strong>r Bildverarbeitung eigenständige Entwick<br />
lungen und aufgrund ihres Umfanges als eigene Themen zu betrachten. Zum Zeit<br />
punkt dieser Untersuchungen stand ke<strong>in</strong> auf <strong>de</strong>r Bildverarbeitung basieren<strong>de</strong>s System<br />
zur Verfügung, welches als Sensor zur <strong>Seitenführung</strong> e<strong>in</strong>zusetzen gewesen wäre.<br />
Aufgrund dieser Vorgaben beschränken sich die hier durchgeführten Untersuchungen<br />
auf Sensoren zur mit <strong>de</strong>nen die Position gegenüber <strong>de</strong>r Bo<br />
<strong>de</strong>noberfläche o<strong>de</strong>r e<strong>in</strong>em geschlossenen Pflanzenbestand ermittelt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
57
Material und Metho<strong>de</strong>n 59<br />
Die Ultraschallwellen wer<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>n elektrostatischen Sensoren durch e<strong>in</strong>e spezielle<br />
Folie, die über e<strong>in</strong>e gespannt ist, erzeugt. Die Folie ist auf <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>m Seite mit Gold beschichtet und auf <strong>de</strong>r gegenüberlie-<br />
gen<strong>de</strong>n Seite isoliert. Sie ist und wan<strong>de</strong>lt die elektrische <strong>in</strong> Ultra-<br />
schallwellen um. Folie und Metallplatte stellen e<strong>in</strong>en Wi<strong>de</strong>rstand dar, wo-<br />
bei die Folie bei e<strong>in</strong>er Berührung mit <strong>de</strong>r Platte elektrostatisch wird. Bei<br />
e<strong>in</strong>er mit e<strong>in</strong>er bestimmten Frequenz an <strong>de</strong>r Wechselstrom-<br />
spannung schw<strong>in</strong>gt die Folie und erzeugt dabei Ultraschallwellen mit genau dieser<br />
Frequenz.<br />
Die Sensoren dienen sowohl zum Sen<strong>de</strong>n als auch zum <strong>de</strong>r Schallwellen.<br />
Beim Empfang <strong>von</strong> Schallwellen schw<strong>in</strong>gt die Folie und baut entsprechend e<strong>in</strong>e<br />
Spannung auf, die an die Steuerplat<strong>in</strong>e übertragen wird.<br />
E<strong>in</strong>e genaue Charakterisierung <strong>de</strong>r Sensoren bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t sich im Anhang. Die Steuerpla-<br />
t<strong>in</strong>e führt ke<strong>in</strong>e automatische durch. Diese kann jedoch im<br />
Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> durch e<strong>in</strong>e Verrechnung <strong>de</strong>r Meßsignale Bei <strong>de</strong>n hier vorge-<br />
stellten Untersuchungen konnte auf e<strong>in</strong>e Temperaturkompensation verzichtet wer<strong>de</strong>n,<br />
da die Umgebungsparameter zwischen <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>zelmessungen annähernd konstant ge<br />
halten wer<strong>de</strong>n konnten.<br />
4.2.2.1 Die Mo<strong>de</strong>llkörper<br />
Um das Meßverhalten <strong>de</strong>r Sensoren zu untersuchen, wur<strong>de</strong>n für die jeweilige<br />
Fragestellung verschie<strong>de</strong>nartige Mo<strong>de</strong>llkörper e<strong>in</strong>gesetzt. Die untersuchten Körper<br />
wur<strong>de</strong>n aus Holz Holz reflektiert <strong>de</strong>n ausgesen<strong>de</strong>ten Ultraschall relativ gut<br />
und läßt sich außer<strong>de</strong>m e<strong>in</strong>fach bearbeiten. Die Anordnung <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llkörper konnte,
60 Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Versuchsfrage entsprechend, e<strong>in</strong>fach variiert wer<strong>de</strong>n. Die <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>zelnen Mo-<br />
<strong>de</strong>llkörper gegenüber <strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> ebenfalls für die jeweilige Untersuchung<br />
Die e<strong>in</strong>fache Geometrie <strong>de</strong>r wur<strong>de</strong> die Meßergebnisse besser <strong>in</strong>-<br />
terpretieren zu <strong>de</strong>r Auswertung <strong>de</strong>r Untersuchungen konnte somit e<strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>fluß durch undcf<strong>in</strong>ierte Bed<strong>in</strong>gungen ausgeschaltet<br />
mensionierung <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Mo<strong>de</strong>llkörper dargestellt.<br />
Tab. 2:<br />
In 1 ist Di-<br />
Höhe Breite Länge<br />
[rum] [rnm] [nun]<br />
Qua<strong>de</strong>r I 10 10 50<br />
Qua<strong>de</strong>rn 20 20 50<br />
Qua<strong>de</strong>r Ill -- ._-<br />
50 50 50<br />
Qua<strong>de</strong>r IV 10 10 100<br />
Qua<strong>de</strong>r V 20 20 100<br />
I<br />
Qua<strong>de</strong>r VI 50 50 100<br />
Stufe I 50 50 200<br />
Stufe n 20 20 200<br />
Stufe m 10 10 200<br />
Trapez 50 200 (oben) 200<br />
I 250 (unten)<br />
Der Mo<strong>de</strong>llkörper<br />
pez, mit e<strong>in</strong>er rechtw<strong>in</strong>kligen und<br />
Kante<br />
W<strong>in</strong>kel wur<strong>de</strong><br />
nicht wie<strong>de</strong>r zum Sensor zurück reflektiert wer<strong>de</strong>n.<br />
se<strong>in</strong>em Querschnitt e<strong>in</strong>em ungleichförmigen Tra<br />
schrägen Kante. Der W<strong>in</strong>kel an <strong>de</strong>r schrägen<br />
daß<br />
e<strong>in</strong>treffen<strong>de</strong>n Schallwellen
4.2.2.2<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
Versuchsaufbau für statische Untersuchungen<br />
Bei <strong>de</strong>n statischen Untersuchungen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Erfassungsbereich <strong>de</strong>r Sensoren über-<br />
Unter <strong>de</strong>m Erfassungsbereich <strong>de</strong>r Sensoren wird hier <strong>de</strong>r Ausschnitt aus <strong>de</strong>r<br />
Schallkeule verstan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Sensor zur Abstandsmessung dient. Er ist außer <strong>von</strong><br />
<strong>de</strong>r Schallcharakteristik <strong>de</strong>s Sensors auch vom Material und <strong>de</strong>r Beschaffenheit <strong>de</strong>r<br />
schallreflektieren<strong>de</strong>n Fläche abhängig. Die reflektierte Ultraschallwelle muß ausrei<br />
chend stark se<strong>in</strong>, um empfangen wer<strong>de</strong>n zu können und e<strong>in</strong>e Auswertung<br />
zu ermöglichen. Die Bewertung <strong>de</strong>r Reflexionsfläche ist nicht überall gleich. Der<br />
Ausschnitt, <strong>de</strong>r sich im Mittelpunkt gegenüber <strong>de</strong>m Sensor bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t, wird stärker be<br />
wertet, als Randbereiche.<br />
Außer <strong>de</strong>m Erfassungsbereich wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n statischen auch die Re<br />
aktion <strong>de</strong>r Sensoren auf Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Software festgelegten Parame<br />
tere<strong>in</strong>stellungen untersucht.<br />
Zur Ermittlung <strong>de</strong>s Erfassungsbereiches wur<strong>de</strong>n die Sensoren horizontal auf e<strong>in</strong>em<br />
Justiertisch Mit Hilfe e<strong>in</strong>es Lotes wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Mittelpunkt <strong>de</strong>s Sensors so aus<br />
gerichtet, daß er sich unter <strong>de</strong>r Kante <strong>de</strong>s Meßobjektes befand. Als Meßobjekt diente<br />
e<strong>in</strong> Holzbrett. das <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Höhe beweglich aufe<strong>in</strong>em Stativ befestigt war. Die Sensoren<br />
wur<strong>de</strong>n nun <strong>in</strong> Millimeterschritten mit <strong>de</strong>m Justiertisch solange horizontal gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Meßbrett verschoben, bis <strong>de</strong>r Abstand zum Meßobjekt nicht mehr angezeigt<br />
wur<strong>de</strong>. Die Entfernung <strong>de</strong>s Sensors vom ursprünglichen Mittelpunkt wur<strong>de</strong> nun für<br />
die Höhe als Radius <strong>de</strong>s Erfassungsbereiches auf e<strong>in</strong>en Millimeter genau<br />
notiert.<br />
Nach <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Erfassungsbereiches <strong>de</strong>r Sensoren wur<strong>de</strong> untersucht, <strong>in</strong><br />
wieweit sich die Form <strong>de</strong>s Schallfel<strong>de</strong>s durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong> akustischen L<strong>in</strong>sen<br />
o<strong>de</strong>r Konustrichtern bee<strong>in</strong>flussen läßt. Die e<strong>in</strong>gesetzten Trichter sollen die ausgesen-<br />
61
62 Material und Metho<strong>de</strong>"''n'---- _<br />
zu optischen<br />
Bei <strong>de</strong>n zur wur<strong>de</strong>n die Sensoren<br />
mehr <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em starren Versuchsaufbau. son<strong>de</strong>rn e<strong>in</strong>em sich System<br />
untersucht. Zu diesem wur<strong>de</strong>n die Sensoren an e<strong>in</strong>em Dreifußstativ über e<strong>in</strong>em<br />
L<strong>in</strong>eartisch Auf <strong>de</strong>m L<strong>in</strong>eartisch wur<strong>de</strong>n unterschiedlichen Mo<strong>de</strong>llkör-<br />
per <strong>de</strong>r Im Gegensatz zu e<strong>in</strong>er Anwendung an<br />
e<strong>in</strong>em Fahrzeug, sich diesem Fall <strong>de</strong>r Sensor, son<strong>de</strong>rn die Versuchs-<br />
strecke, diese es und Vibra-<br />
tionen, wie sie an e<strong>in</strong>em können, auszuschließen, Die maximale<br />
die Versuchsstrecke unten Sensor wer<strong>de</strong>n<br />
mm/s. E<strong>in</strong>e direkte auf mit höhe"<br />
ren wie etwa am Schlepper, sich daher schwierig,<br />
Lasersensoren<br />
Als zweites untersuchtes zur kam neben <strong>de</strong>n beschrie-<br />
benen Ultraschallsensoren zum Das Grund-<br />
dieses Meßverfahrens wur<strong>de</strong> als Verfahren <strong>de</strong>s Vorwärtsschnei<strong>de</strong>ns bereits<br />
600 v.Chr zur (SCHLEMMER I
Dieses Meßpr<strong>in</strong>zip<br />
und starke Abhängigkeit<br />
zu<br />
räteführung ist <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re<br />
Da die<br />
nur<br />
teile dieses Meßverfahrens<br />
nen Bauformen<br />
600 mm. Innerhalb<br />
nicht l<strong>in</strong>ear ist,<br />
automatischen Ge-<br />
Schnelligkeit dieses Meßverfahrens b"'''b'l'''.<br />
elektronischen Signalauswertung. Weitere<br />
<strong>de</strong>r Zusammenhang <strong>von</strong> ermittelter Entfernung<br />
rechnung <strong>von</strong> ausgegebener Spannung<br />
<strong>de</strong>r<br />
E<strong>in</strong>satz.<br />
als <strong>de</strong>r Erfassungsbereich<br />
Meßtleck ca.<br />
und<br />
200<br />
10
Sensor auch im dynamischen E<strong>in</strong>satz getestet. Für diese Versuche wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sensor<br />
mit verschie<strong>de</strong>nen über das Bo<strong>de</strong>nbeet <strong>de</strong>r <strong>in</strong> 4.3.1 be<br />
schriebenen Versuchsanlage<br />
4.3 Cerätetechntsche Uberprüfung<br />
Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Uberprüfung geeigneter Regelparameter für<br />
e<strong>in</strong>e berührungslose Höhen- und Daher wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong>e Versuchsmechanik<br />
zur Seiten- und zur entwickelt und <strong>de</strong>ren Reaktionsverhalten unter ge-<br />
nau <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ierten überprüft und untersucht.<br />
4.3.1 Versuchsstand und Meßaufbau<br />
Die Untersuchungen zum Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r <strong>Seitenführung</strong> wur<strong>de</strong>n auf e<strong>in</strong>er<br />
Versuchsstrecke mit angetriebenen Gerätetragrahmen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gewächshaus durch<br />
geführt (Abb. 10).
Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
En<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Versuchsstrecke, liefern die Endstellung für <strong>de</strong>n Tragrahmen.<br />
Nach e<strong>in</strong>er Beschleunigungsphase. die je nach e<strong>in</strong>gestellter Geschw<strong>in</strong>digkeit unter<br />
schiedlich lang ist, bleibt die Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit konstant, bis durch das Überfahren<br />
<strong>de</strong>r <strong>in</strong>duktiven Näherungsschalter (5) <strong>de</strong>r Bremsvorgang ausgelöst wird. In <strong>de</strong>r Zone<br />
konstanter Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t sich die Meßstrecke, die für die Untersu-<br />
chungen <strong>de</strong>s Versuchsgerätes wur<strong>de</strong>.<br />
Die für <strong>de</strong>n Meß-PC und das Versuchsgerät notwendige Stromversorgung erfolgt über<br />
e<strong>in</strong>e Energiekette (4) zum Tragrahrnen.<br />
4.3.2 Versuchsgerät <strong>Seitenführung</strong><br />
Um das Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r <strong>Seitenführung</strong> untersuchen zu können wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong> Ver<br />
suchsgerät zur <strong>Seitenführung</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Tragrahrnen montiert. Das Grundmodul <strong>de</strong>s Ge<br />
rätes ist für <strong>de</strong>n Heckanbau an e<strong>in</strong>e herkömmliche Dreipunktaufhängung konzi<br />
piert und konnte zugekauft wer<strong>de</strong>n. Verschie<strong>de</strong>ne Arbeitsgeräte können an e<strong>in</strong>em<br />
seitlich auf Rollen beweglichen Führungsholm angebracht wer<strong>de</strong>n.<br />
Mit e<strong>in</strong>em Stellmotor (6) können die Anstellw<strong>in</strong>kel <strong>von</strong> zwei seitlich am Führungs<br />
holm angebrachten Scheibenseche (5) verstellt wer<strong>de</strong>n. Diese Seche bef<strong>in</strong><strong>de</strong>n sich<br />
weils fe<strong>de</strong>rnd gelagert an e<strong>in</strong>em Stellarm Durch die fe<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Lagerung <strong>de</strong>r Seche<br />
ist e<strong>in</strong> Ausweichen bei größeren H<strong>in</strong><strong>de</strong>rnissen Ste<strong>in</strong>e) Die vertikale Po<br />
sition <strong>de</strong>r Stellarme gegenüber <strong>de</strong>m Führungsholm läßt sich variieren. Dadurch kann<br />
die E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gtiefe <strong>de</strong>r Scheibenseche und damit die im Bo<strong>de</strong>n wirksame Sechfläche<br />
verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Entsprechend <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s e<strong>in</strong>gestellten Sechw<strong>in</strong>kels wird <strong>de</strong>r<br />
Führungsholm bei <strong>de</strong>r Fahrt seitlich verschoben. Der mögliche seitliche Verschiebe-<br />
weg ist durch zwei an <strong>de</strong>r bef<strong>in</strong>dliche Anschläge auf280 mm begrenzt.<br />
67
Abb, ! 1: <strong>Seitenführung</strong> <strong>von</strong> Arbeitsgeräten mit Meßaufbau<br />
Die Position auf <strong>de</strong>m Führungsholm<br />
und <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em pe<br />
<strong>de</strong>r aktuelle Sechw<strong>in</strong>kel<br />
Meßkarte erfaßt und aufgezeichnet,<br />
e<strong>in</strong>er<br />
die<br />
zur Höhenführung<br />
Positions-Sensor (8) bestimmt<br />
entsprechen<strong>de</strong>r Meßkarte aufgezeichnet, Außer<strong>de</strong>m<br />
Sechmotors dieser<br />
Reaktionsverhaltens bei <strong>de</strong>r Höhenführung wur<strong>de</strong>n<br />
entwickelten Versuchsmechanik durchgerührt. Da e<strong>in</strong> komb<strong>in</strong>iertes<br />
<strong>Seitenführung</strong> entwickelt wer<strong>de</strong>n sollte, wur<strong>de</strong> die Mechanik<br />
an die Versuchsmechanik
vorgenommen.<br />
Erfassung <strong>de</strong>r aktuellen Gerätestellung<br />
zeichnung <strong>de</strong>r<br />
durchgeführten Stellbewegungen.<br />
<strong>de</strong>r<br />
Zur praktischen Umsetzung <strong>de</strong>r Geräteführung wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong>e speicherprogrammierbare<br />
Steuerung mir <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Software e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
rung kann modularen Aufbau entsprechend<br />
Versuchsaufgabe angepaßt wer<strong>de</strong>n. Von<br />
E<strong>in</strong>- und Ausgänge betrieben<br />
Steuerung programmiert<br />
herstellerunspezifisch.<br />
Steuerung können sowohl<br />
basiert auf <strong>de</strong>m<br />
E<strong>in</strong> Vorteil dieser Steuerungen, <strong>in</strong>dustriellen Bereich<br />
stcuerung e<strong>in</strong>gesetzt wer<strong>de</strong>n, liegt <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />
wesentliche für <strong>de</strong>n Echtzeitbetrieb<br />
Reaktionsverhalten<br />
Steue-<br />
Masch<strong>in</strong>en<br />
Reaktionszeiten. Diese s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e<br />
Untersuchungen zum Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r soll<br />
sich äußere E<strong>in</strong>flüsse bemerkbar machen.<br />
Ergebnisse dieser Versuche Vor<strong>in</strong>formation bei <strong>de</strong>r Reglerentwicklung.
72 Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
Der erste allen mit <strong>de</strong>r vorgegebenen ! cuu U!u-<br />
grammen war "Gera<strong>de</strong>steIlen" <strong>de</strong>r Scheibenseche. be<strong>de</strong>utet,<br />
Seche<br />
zur gestellt wer<strong>de</strong>n. Hierdurch wird <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Beschleunigungspha-<br />
se seitliche <strong>de</strong>s m<strong>in</strong>imiert. ausschalten läßt sich<br />
diese, folgen<strong>de</strong>n als "seitliche Trift" bezeichnete nicht.<br />
macht sich <strong>in</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r durch unterschiedliche<br />
fangspositionen <strong>de</strong>s Versuchsgerätes bemerkbar. Nach <strong>de</strong>r Beschleunigungsphase<br />
wird durch e<strong>in</strong>en Kippschalter das eigentliche Fahrprogramm ausgelöst, Durch diese<br />
Verzögerung wird das Erreichen e<strong>in</strong>gestellten Die<br />
bei <strong>de</strong>n Untersuchungen zum Reaktionsverhalten Fahrprogramme<br />
<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r untersuchten variiert. Im Wesentlichen besteht<br />
Programmablaufaus e<strong>in</strong>er Dreh- und Haltezeiten für <strong>de</strong>n Stellmo-<br />
tor <strong>de</strong>r Scheibenseche.<br />
E<strong>in</strong>e genaue bei <strong>de</strong>n vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
bungsparameter und Programmvorgaben bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t sich am Anfang <strong>de</strong>s Ka-<br />
Im Ergebnisteil.<br />
4.3.6 Regelungseutwieklung für e<strong>in</strong>e automatische Geräteführung<br />
Ausgehend <strong>von</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Untersuchungen zum Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Versuchsmechanik. wird <strong>in</strong> mehreren Schritten e<strong>in</strong>e Regelung zur auto-<br />
matischen entwickelt Als erster Schritt wird untersucht ob es<br />
ist, mittels e<strong>in</strong>facher e<strong>in</strong>e bestimmte Position <strong>de</strong>s Füh-<br />
rungsholmes gegenüber <strong>de</strong>m Anbaurahmen e<strong>in</strong>zuhalten. Für diese Untersuchungen<br />
wur<strong>de</strong>n e<strong>in</strong>fache Der zweite Schritt <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Entwickluna<br />
führt zum Beim P-Regler wird Anstellw<strong>in</strong>kel <strong>de</strong>r Scheibense-
___________Material undMetho<strong>de</strong>n 73<br />
ehe gegenüber <strong>de</strong>r Fahrtrichtung <strong>in</strong> Abhängigkeit <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Abweichung zur Sollpositi<br />
on festgelegt. Der letzte Schritt ist <strong>de</strong>r E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es Mo<strong>de</strong>llreglers, <strong>de</strong>r die Abwei<br />
chung anhand e<strong>in</strong>es Reaktionsmo<strong>de</strong>lls <strong>de</strong>s Versuchsgerätes ausgleicht.<br />
Die Programmierung <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>zelnen Regler erfolgte am PC. Anschließend wur<strong>de</strong>n die<br />
Programme <strong>in</strong> die Steuerung übertragen und entsprechend <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r jeweili<br />
gen Untersuchung angepaßt.<br />
E<strong>in</strong>e genaue Beschreibung <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>n Untersuchungen e<strong>in</strong>gesetzten Regler und <strong>de</strong>r<br />
vorgegebenen Reglere<strong>in</strong>stellung erfolgt <strong>in</strong> <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Unterkapiteln.<br />
4.3.6.1 E<strong>in</strong>fache Reglerstrukturen<br />
Der Zwei- bzw. <strong>de</strong>r Dreipunktregler stellen e<strong>in</strong>fache Reglerstrukturen dar. Der Zwei<br />
punktregler löst beim Über- o<strong>de</strong>r Unterschreiten e<strong>in</strong>es festgelegten Wertes (z.B. Ab<br />
stand <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er Pflanze) e<strong>in</strong>en Regelvorgang aus. Dieser feste Wert ist bei e<strong>in</strong>em<br />
Dreipunktregler ke<strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelwert, son<strong>de</strong>rn e<strong>in</strong> Wertebereich (totes Band) <strong>in</strong> <strong>de</strong>m ke<strong>in</strong>e<br />
Aktion ausgeführt wird.<br />
Um das Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik bei e<strong>in</strong>fachen Reglerstrukturen zu<br />
überprüfen, wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong> Dreipunktregler als Regelvorgabe programmiert. Die Aufgabe<br />
<strong>de</strong>s Reglers ist das E<strong>in</strong>halten e<strong>in</strong>es festgelegten Soll-Bereiches <strong>de</strong>s Führungsholmes<br />
gegenüber <strong>de</strong>m Dreipunkt-Anbaurahmen. Beim Verlassen dieses Bereiches wird <strong>von</strong><br />
<strong>de</strong>r Steuerung e<strong>in</strong>e Positionskorrektur durch das Verstellen <strong>de</strong>r Seche e<strong>in</strong>geleitet.<br />
Beim Erreichen <strong>de</strong>s Sollbereiches erfolgte das automatische Zurückstellen <strong>de</strong>r Schei<br />
benseche <strong>in</strong> die O-Posititon parallel zur Fahrtrichtung. Sowohl die Breite <strong>de</strong>s e<strong>in</strong>zu<br />
halten<strong>de</strong>n Soll-Bereiches als auch die Verstellzeit <strong>de</strong>r Seche können frei festgelegt<br />
wer<strong>de</strong>n.
nalregler veranschaulicht.<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n 75<br />
Nach <strong>de</strong>m E<strong>in</strong>schalten <strong>de</strong>r Steuerung wird <strong>de</strong>r aktuelle E<strong>in</strong>schlagw<strong>in</strong>kel <strong>de</strong>r Schei<br />
benseche am W<strong>in</strong>kelsensor (Potentiometer) abgefragt. Stehen die Seche nicht parallel<br />
zur Fahrtrichtung, so wird e<strong>in</strong> Unterprogramm ausgelöst, das diese so verstellt,<br />
bis sie entsprechend ausgerichtet s<strong>in</strong>d. Anschließend wird <strong>de</strong>r nächste Programmab<br />
schnitt, <strong>de</strong>r als E<strong>in</strong>gangsbed<strong>in</strong>gung das Auslösen <strong>de</strong>s Kippschalters benötigt, aufgeru<br />
fen. Hier wird die Position auf <strong>de</strong>m Führungsholm abgefragt (Potentiometer o<strong>de</strong>r La<br />
sersensor). Wird <strong>de</strong>r vorgegebene Sollbereich e<strong>in</strong>gehalten, so erfolgt erneut e<strong>in</strong>e wei<br />
tere Abfrage. Beim Über- o<strong>de</strong>r Unterschreiten <strong>de</strong>s Sollbereiches wird die aktuelle<br />
Abweichung bestimmt und das Unterprogramm Proportionalregler ausgelöst.
Sechw<strong>in</strong>kel<br />
abfragen<br />
Schaltbed<strong>in</strong>gung<br />
>Kippschalter<<br />
Position<br />
bestimmen<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
ne<strong>in</strong><br />
Seche gera<strong>de</strong><br />
stellen<br />
ne<strong>in</strong> Abweichung<br />
bestimmen<br />
>Proportionalregler<<br />
Seche verstellen<br />
Abb.14: Programmablauf <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Reglerentwicklung e<strong>in</strong>gesetzten Programme<br />
e<strong>in</strong>es Proorotionalrezlers
4.3.6.3<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
Regelungsmo<strong>de</strong>ll <strong>Seitenführung</strong><br />
Die seitliche Verschiebung <strong>de</strong>s Gerätetragholms ist <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er großen Anzahl unter<br />
schiedlicher Faktoren abhängig. E<strong>in</strong>e wesentliche E<strong>in</strong>flußgröße ist <strong>de</strong>r Auslenkw<strong>in</strong>kel.<br />
mit <strong>de</strong>m die Scheibenseche <strong>de</strong>r Fahrtrichtung <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n e<strong>in</strong>greifen. Der<br />
Sechw<strong>in</strong>kel kann sowohl konstant bleiben o<strong>de</strong>r sich im dynamischen Betrieb abhängig<br />
<strong>von</strong> <strong>de</strong>r Sechdrehgeschw<strong>in</strong>digkeit verän<strong>de</strong>rn. Ausgehend <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em mathematischen<br />
Mo<strong>de</strong>ll zum Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n Untersuchun<br />
gen zum »Regelungsrno<strong>de</strong>ll <strong>Seitenführung</strong>'< <strong>de</strong>r Regler entworfen.<br />
E<strong>in</strong>e Voraussetzung bei <strong>de</strong>r Programmierung <strong>de</strong>r Steuerung ist die genaue Kenntnis<br />
<strong>de</strong>s Aktionsverhaltens <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Versuchsmechanik. Um dieses Verhalten ge<br />
nauer zu spezifizieren, können sowohl Untersuchungen am Versuchsgerät, als auch<br />
theoretische Überlegungen angestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>r theoretischen Fahrverlaufsbestimmung wird <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em Fahrverhalten ohne<br />
Schlupf, Trift, Tot- und Rechenzeiten ausgegangen. Der durch das Mo<strong>de</strong>ll berechnete<br />
Verlauf<strong>de</strong>s Systems stellt <strong>in</strong>sofern e<strong>in</strong>e »i<strong>de</strong>ale Fahrt< dar. Das Versuchsgerät verhält<br />
sich bei dieser Fahrt so, als ob es wie auf Schienen <strong>de</strong>n mathematischen Vorgaben<br />
folgt. Im folgen<strong>de</strong>n wird <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> gelegte mathematische Zusammenhang <strong>de</strong>s<br />
Fahrverlaufes beim Halte- und Drehvorgang <strong>de</strong>r Scheibenseche näher betrachtet:<br />
Fahrverlauf beim Halten <strong>de</strong>s Seches mit e<strong>in</strong>em konstanten W<strong>in</strong>kel<br />
Wird <strong>de</strong>r Anstellw<strong>in</strong>kel <strong>de</strong>r Scheibenseche während <strong>de</strong>r Fahrt nicht verän<strong>de</strong>rt, ist die<br />
Positionsän<strong>de</strong>rung auf <strong>de</strong>m Führungsholm vom Auslenkw<strong>in</strong>kel <strong>de</strong>r Scheibenseche<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Fahrtrichtung und vom zurückgelegten Weg abhängig. Der zurückge<br />
legte Weg hängt <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit und <strong>de</strong>r Haltezeit. das ist die Zeit, <strong>in</strong><br />
<strong>de</strong>r ke<strong>in</strong>e weitere W<strong>in</strong>kelän<strong>de</strong>rung mehr stattf<strong>in</strong><strong>de</strong>t, ab. Er ergibt sich als geornetri-<br />
77
scher Zusammenhang<br />
Dar<strong>in</strong> ist:<br />
seitlicher<br />
Auslenkw<strong>in</strong>kel<br />
Haltezeit<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Fahrtrichtung<br />
Bei <strong>de</strong>r mathematischen seitlichen Versatzes wird hier <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er kon<br />
stanten Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit während <strong>de</strong>s Haltevorganges ausgegangen, Durch die<br />
Konstruktion <strong>de</strong>s auf<br />
280 mm beschränkt<br />
Die gratisehe Darstellung<br />
eher Position ist <strong>in</strong> <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Abbildung<br />
Zusammenhanges zwischen Auslenkw<strong>in</strong>kel und seitli<br />
5
Die Geschw<strong>in</strong>digkeitskomponente vy<strong>de</strong>r seitlichen Auslenkung<br />
Um nun die seitliche Auslenkung<br />
Drehzeit zu <strong>in</strong>tegrieren:<br />
.tan«<br />
Yo = -tan c dt<br />
nach:<br />
Drehvorganz YD zu erhalten ist über die<br />
Unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r W<strong>in</strong>kelgeschw<strong>in</strong>digkeit, mit <strong>de</strong>r das Sech<br />
sich:<br />
Yo =<br />
wird,<br />
Nach <strong>de</strong>m Aufläsen <strong>de</strong>s Integrals läßt sich die seitliche Verschiebung beim Drehen Yo<br />
<strong>de</strong>r Seche wie berechnen:<br />
(4)<br />
1<br />
Yo = -vo .-.Incos(oJ'<br />
(j) , (5)
Dar<strong>in</strong> ist:<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n<br />
YD seitlicher Versatz auf<strong>de</strong>m Führungsholm beim Drehen [m]<br />
VD Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit beim Drehvorgang<br />
(0 W<strong>in</strong>kelgeschw<strong>in</strong>digkeit <strong>de</strong>r Seche<br />
tu Drehzeit<br />
In <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Darstellung (Abb. 16) ist <strong>de</strong>r Zusammenhang <strong>de</strong>r seitlichen Position<br />
während <strong>de</strong>s Drehvorganges grafisch wie<strong>de</strong>rgegeben.<br />
y<br />
y = seitliche Position<br />
y D '" seitlicher Versatz auf <strong>de</strong>m Führungsholm<br />
s = Weg <strong>in</strong> Fahrtrichtung<br />
S[\, v J'" zurückgelegter Weg <strong>in</strong> Fahrtrichtung<br />
1------- S [t, v I<br />
Abb. 16: Zusammenhang <strong>de</strong>r seitlichen Position während <strong>de</strong>s Drehvorganges<br />
Ausgehend <strong>von</strong> <strong>de</strong>n hier beschriebenen theoretischen Überlegungen zum Fahrverlauf<br />
<strong>de</strong>r Versuchsmechanik wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong> Mo<strong>de</strong>llregler entwickelt und programmiert.<br />
yD<br />
s<br />
81
Um e<strong>in</strong>e vorhan<strong>de</strong>ne Regelabweichung auszugleichen s<strong>in</strong>d unterschiedliche An-<br />
<strong>de</strong>nkbar. Zum e<strong>in</strong>en <strong>de</strong>r für die Schei-<br />
benseche, zum zweiten die Haltezeit Verdrehen und Zurück-<br />
o<strong>de</strong>r das sowohl <strong>de</strong>r Dreh- als <strong>de</strong>r<br />
durch die Versuchsmechanik vorgegebenen möglichen Regelabweichunz kann<br />
Aufteilung <strong>de</strong>s <strong>in</strong> die Teilmo<strong>de</strong>lle und<br />
Scheibenseche verzichtet wer<strong>de</strong>n. entworfene Regler<br />
zum e<strong>in</strong>er die Strategie "Drehen-Zurückdrehen",<br />
dazwischen e<strong>in</strong> Haltezeitglied e<strong>in</strong>zufügen,<br />
Als E<strong>in</strong>gangsgrößen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llregler dienen die aktuelle Fahrgeschw<strong>in</strong>-<br />
E<strong>in</strong>e genaue <strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>llprogrammes<br />
sowie se<strong>in</strong>er Entwicklung bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t Beg<strong>in</strong>n <strong>de</strong>s Kapitels<br />
4.3.7 Fahrversuche Höhen- <strong>Seitenführung</strong><br />
Die Fahrversuche zur Höhen- und <strong>Seitenführung</strong> dienen zur Überprüfung und De<br />
Erkenntnisse aus <strong>de</strong>r Regelungsentwicklung.<br />
Da zum ke<strong>in</strong> <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Verlauf<br />
Pflanzenreihe wer<strong>de</strong>n kann, zur stand, wur<strong>de</strong><br />
ner Mo<strong>de</strong>llstrecke e<strong>in</strong> künstlicher Reihenverlauf Dabei kam für die<br />
gleiche Mo<strong>de</strong>llstrecke bei Fahrversuchen zur Höhenführung.<br />
<strong>de</strong>m Unterschied, daß diese e<strong>in</strong>mal und e<strong>in</strong>mal auf-<br />
zum E<strong>in</strong>satz. Bei <strong>de</strong>r senkrecht montierten Mo<strong>de</strong>llstrecke <strong>de</strong>r<br />
e<strong>in</strong>er Pflanzenreihe Die dieser Mo<strong>de</strong>llstrek-<br />
ke <strong>de</strong>r am Führungsholm angebracht
Arbeitskraftkosten zusammen. Die Arbeitskraftkosten enthalten<br />
Arbeitsgänge sowie die Anzahl<br />
E<strong>in</strong>satzkosten e<strong>in</strong>es Arbeitsgerätes pro errechnen sich aus:<br />
Dar<strong>in</strong> ist:<br />
K1ahr : jährliche E<strong>in</strong>satzkosten pro Gerät<br />
A<br />
Fixkosten<br />
Fixkosten Gerät<br />
+<br />
variable Kosten Gerät<br />
jährliche E<strong>in</strong>satzfläche<br />
Traktorkosten<br />
Kosten für Arbeitskraft<br />
Zeit für die Bearbeitung<br />
+<br />
jährlichen E<strong>in</strong>satzfläche<br />
[DM/ha]<br />
[ha]<br />
[DMIh]<br />
[DMJAkh]<br />
Die Fixkosten pro Jahr errechnen sich aus <strong>de</strong>r l<strong>in</strong>earen Abschreibung <strong>de</strong>s Anschaf-<br />
fungspreises auf die Es <strong>in</strong> Höhe <strong>von</strong> 8 %<br />
halben Anfallen<strong>de</strong> Versicherungskosten (z. B. für<br />
<strong>de</strong>n Schlepper wur<strong>de</strong>n addiert, Unterbr<strong>in</strong>gungskosten nicht berücksichtigt):<br />
Fixkosten (Gerät,<br />
Investition für das<br />
- !cL+ I<br />
- 'G 0,04<br />
(7)<br />
[DM]
nach WEBER e<strong>in</strong>er Nutzungsdauer 10 Jahren ausgegangen. Die Nut-<br />
zungsdauer e<strong>in</strong>er automatischen Geräteführung wird veran-<br />
schlagt<br />
Das e<strong>in</strong>gesetzte<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Geräte, nach<br />
Anschaffungspreises verz<strong>in</strong>st.<br />
Die Fixkosten für <strong>de</strong>n Pflegeschlepper (Geräteträger,<br />
fungspreis <strong>von</strong> 70.000 DM<br />
KTBL (1996):<br />
jährliche Abschreibung<br />
Z<strong>in</strong>sansatz <strong>von</strong> 8 % <strong>de</strong>s halben Anschaffungspreises<br />
Versicherungskosten<br />
automatische Geräteführung und<br />
Z<strong>in</strong>ssatz <strong>de</strong>s halben<br />
mit e<strong>in</strong>em Anschaf-<br />
e<strong>in</strong>er Nutzungsdauer <strong>von</strong> 12 nach<br />
5.833 DM<br />
+ 2.800 DM<br />
+ 229DM<br />
Für <strong>de</strong>n Standardtraktor bei <strong>de</strong>m Geräte im o<strong>de</strong>r Frontantrieb e<strong>in</strong>gesetzt<br />
wer<strong>de</strong>n (Traktor mit H<strong>in</strong>terradantrieb, 30 - 40 kW) sich bei An-<br />
schaffungskosten <strong>von</strong> 41.000 DM e<strong>in</strong>er Nutzungsdauer <strong>von</strong> 12 Jahren<br />
KTBL Fixkosten Höhe <strong>von</strong>:<br />
Z<strong>in</strong>sansatz <strong>von</strong> 8 % <strong>de</strong>s halben Anschaffungspreises<br />
Bei e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>satzzeit <strong>von</strong> 800<br />
setzten Traktoren Stun<strong>de</strong>:<br />
3.417 DM<br />
+ 1.640<br />
betragen die festen Kosten für die<br />
+ 229DM<br />
8.862 : 800 DM/h
Material und Metho<strong>de</strong>n 87<br />
Standardtraktor - 40 kW) 5.286 DM/a: 800 hJa = 6,60 DM/h<br />
Die Fixkosten die sich pro Jahr für e<strong>in</strong>e automatische mit veran-<br />
schlagten Anschaffungskosten <strong>in</strong> Höhe <strong>von</strong> 10.000 DM belaufen sich auf<br />
1.400 DMJa. Da e<strong>in</strong>e automatische Geräteführung nicht an e<strong>in</strong> bestimmtes Arbeitsge<br />
rät ist, wer<strong>de</strong>n die Fixkosten bei <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llkalkulation auf die Geräte ent<br />
sprechend <strong>de</strong>r jeweiligen E<strong>in</strong>satzfläche aufgeteilt.<br />
4.4.2 Variable Kosten<br />
Die verän<strong>de</strong>rlichen o<strong>de</strong>r variablen Kosten setzen sich aus <strong>de</strong>n und Be<br />
triebsstoffkosten. sowie aus <strong>de</strong>n Verschleißkosten auf die Gesamte<strong>in</strong>satzflä<br />
ehe und <strong>de</strong>n Gesamte<strong>in</strong>satzzeiten zusammen. H<strong>in</strong>zu kommen noch die Arbeitskosten<br />
entsprechend <strong>de</strong>r Anzahl und <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Arbeitskräfte.<br />
Die verän<strong>de</strong>rlichen Kosten <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Traktoren betragen nach KTBL (1996)<br />
für <strong>de</strong>n:<br />
Pflegeschlepper<br />
Standardtraktor mit H<strong>in</strong>terradantrieb (34 - 40 kW)<br />
7,94 DMJh<br />
9,45 DM/h<br />
Die Betriebsstun<strong>de</strong>nkosten sich aus <strong>de</strong>n fixen Kosten pro Stun<strong>de</strong> und <strong>de</strong>n<br />
verän<strong>de</strong>rlichen Kosten für <strong>de</strong>n jeweiligen Schlepper:<br />
Pf1egeschlepper<br />
Standardtraktor - 40 kW)<br />
11,- DM/h + 7,94 DMJh = 18.94 DM/h<br />
6,60 DM/h + 9,45 DM/h = 16.05 DMJh<br />
Als Kosten für e<strong>in</strong>e Arbeitsstun<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n nach WEBER und <strong>de</strong>n Sätzen <strong>de</strong>r<br />
Masch<strong>in</strong>enr<strong>in</strong>ge (KBMB 1995) 18 DM/AKh für <strong>de</strong>n Schlepperfahrer angenommen.
88 Materiai und Metho<strong>de</strong>n<br />
Falls zweite Arbeitskraft zur Fe<strong>in</strong>steuerung notwendig wird, fallen<br />
stun<strong>de</strong> Kosten <strong>von</strong> DM!AKh an. Dies WEBER (<br />
Befragung ermittelten Kosten Arbeiten, die nur gar<br />
<strong>de</strong>r Arbeitskraft erfor<strong>de</strong>rn.<br />
Bei <strong>de</strong>n variablen <strong>de</strong>r Arbeitsgeräte wer<strong>de</strong>n <strong>von</strong> WEBER und KTBL<br />
angegebenen die ökonomischen Sie betra-<br />
gen für Reihenhackbürste und für die Reihenhacke 3,60 DMJha. Für die<br />
automatische wer<strong>de</strong>n Kosten <strong>von</strong> DM/ha angenommen.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r arbeiten<strong>de</strong>n Sensorik mit ger<strong>in</strong>gem zu<br />
rechnen. Die variablen Kosten hauptsächlich auf Abnutzung <strong>de</strong>r für e<strong>in</strong>e<br />
tornatische Geräteführung Mechanik zurückzuführen.<br />
Mo<strong>de</strong>llannahmen<br />
Für <strong>de</strong>n Kostenverzleich e<strong>in</strong>er automatischen Geräteführung zur Unkrautregulierung<br />
zwischen <strong>de</strong>n mit herkömmlichen Verfahren wer<strong>de</strong>n 2<br />
Mo<strong>de</strong>llbetriebe mit unterschiedlichen Anbauflächen Intensitätsstufen herangezo-<br />
gen. Diese Mo<strong>de</strong>llbetriebe wur<strong>de</strong>n <strong>von</strong> Weber (1997) für die e<strong>in</strong>es<br />
mierten zur mechanischen konstruiert. Die<br />
Struktur <strong>de</strong>r Betriebe basiert. auf <strong>de</strong>r <strong>von</strong> 54 ökologisch<br />
wirtschaften<strong>de</strong>n und E<strong>in</strong>teilung <strong>in</strong> verschie<strong>de</strong>ne Betriebsformen nach<br />
FRlTZ<br />
Betrieb kann als landwirtschaftlicher Betrieb, <strong>de</strong>r auf e<strong>in</strong>er Fläche 30 ha<br />
gemüsebau betreibt, beschrieben wer<strong>de</strong>n. durchschnittliche Schlaggröße dieses<br />
Betriebes beträgt 2 ha, Betrieb ist mehr gärtnerisch orientierter Freilandgemüse-
5).<br />
Tab. 5: Flächenleistungen <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>llbetriebe<br />
Material und Metho<strong>de</strong>n 91<br />
Gerätekomb<strong>in</strong>ationen für die<br />
Variante automatische Heckanbau Frontanbau Geräteträger<br />
Geräte- mit Fe<strong>in</strong>führung<br />
steuerung<br />
Betriebstyp I n I n I II I n<br />
Reihenhackbürste 0,23 0,18 0,23 0,18 0,14 0,11 0,18 0,14<br />
[ha/h]<br />
Reihenhacke [ha/h] 0,50 0,38 0,50 0,38 0,30 0,23 0,40 0,30<br />
Für die Betrachtung <strong>de</strong>r Verfahrenskosten wird angenommen, daß die Wirkung <strong>de</strong>r<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Geräte unabhängig <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit und damit <strong>de</strong>r Flächen<br />
leistung ist.
92<br />
5<br />
Ergebnisse<br />
Der <strong>de</strong>r <strong>in</strong> mehrere Abschnitte. Im<br />
ersten Abschnitt wer<strong>de</strong>n die zu <strong>de</strong>n über die Vorgaben<br />
und Die Untersuchungen<br />
an vorhan<strong>de</strong>nen Pflanzenreihen und <strong>de</strong>r Höhenverlauf verschie<strong>de</strong>ner Bo<strong>de</strong>noberflä-<br />
chen stehen dabei im Aus <strong>de</strong>n dieser Voruntersuchungen<br />
wer<strong>de</strong>n anschließend allgeme<strong>in</strong>e an die Sensoren und Akteren zur<br />
automatischen Geräteführung aufgestellt. Das nächste befaßt sich mit <strong>de</strong>r<br />
Untersuchung <strong>von</strong> Sensoren für e<strong>in</strong>e automatische Geräteführung. Hierbei wird so<br />
wohl auf statische als auch auf die Sensoruntersuchungen e<strong>in</strong>gegangen.<br />
Es folgt die Darstellung <strong>de</strong>r Ergebnisse aus <strong>de</strong>r gerätetechnischen Überprüfung zur<br />
Höhen- und <strong>Seitenführung</strong> sowie <strong>de</strong>r Reglerentwicklung. Abschließend wer<strong>de</strong>n die<br />
Ergebnisse aus <strong>de</strong>r ökonomischen behan<strong>de</strong>lt.<br />
5.1 Ergebnisse zu <strong>de</strong>n Untersuchungen <strong>de</strong>r Vorgaben e<strong>in</strong>e,' automatischen<br />
<strong>Seitenführung</strong> - Pflanzenreihen<br />
Als E<strong>in</strong>gangsgröße für e<strong>in</strong>e automatische ist <strong>de</strong>r Verlauf <strong>de</strong>r Pflanzen<br />
reihe entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Dieser Reihenverlauf eng mit <strong>de</strong>n vora.n-<br />
gegangenen Arbeitsschritten und <strong>de</strong>r Anbaumetho<strong>de</strong> ab. Das Erfassen<br />
und Parametrisieren <strong>von</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Praxis auftreten<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Reihenver-<br />
läufen ist<br />
räteführung" .<br />
<strong>de</strong>r E<strong>in</strong>gangsvoraussetzungen zur Entwicklung e<strong>in</strong>er "<strong>in</strong>ltellig(;nt,;n Ge-<br />
Zur Beurteilung und Bewertunz <strong>de</strong>r Reihenverläufe und Schwankungen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n
Ergebnisse 93<br />
Reihen ist e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitlicher notwendig. Als Bezugspunkt für die Position<br />
<strong>de</strong>r e<strong>in</strong>zelnen Pflanze zur Reihe ist die Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r bzw.<br />
<strong>de</strong>r Pflanze <strong>de</strong>nkbar. Außer<strong>de</strong>m kann auch mit <strong>de</strong>r Position gegenüber<br />
e<strong>in</strong>er Mittell<strong>in</strong>ie o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m gearbeitet wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r<br />
Darstellung dient die Position <strong>de</strong>r ersten Pflanze <strong>in</strong> <strong>de</strong>r untersuchten Reihe als Be-<br />
zugspunkt. Der Verlauf <strong>de</strong>r sich nicht als da sich diese<br />
<strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>s Kulturverlaufes än<strong>de</strong>rn kann. So führen nach e<strong>in</strong>em<br />
starken Regen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Maßnahmen, wie etwa das Aufhacken zur Unkrautregulie<br />
rung, zu ständigen Verän<strong>de</strong>rungen am Verlauf <strong>de</strong>r Auch durch das mehr<br />
malig Befahren <strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>r Kulturdauer wird die Fahrspur verbreitert, da e<strong>in</strong> exak-<br />
tes Nachfahren e<strong>in</strong>er vorhan<strong>de</strong>nen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Praxis nicht möglich ist.<br />
Der E<strong>in</strong>fluß <strong>de</strong>r Grundbo<strong>de</strong>nbearbeitung auf <strong>de</strong>n späteren Verlauf <strong>de</strong>r Kulturpflanzen<br />
reihe ist bei <strong>de</strong>r Gesamtbetrachtung <strong>de</strong>r Anbaumetho<strong>de</strong> nicht zu vernachlässigen. E<strong>in</strong>e<br />
gleichmäßige Bo<strong>de</strong>nstruktur trägt entschei<strong>de</strong>nd zu <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong>n<br />
Arbeiten <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Verfahrenskette bei. E<strong>in</strong>e unzureichen<strong>de</strong> Grundbo<strong>de</strong>nbearbeitung<br />
kann durch die folgen<strong>de</strong>n Arbeitsschritte nicht mehr ausgeglichen wer<strong>de</strong>n. Das<br />
ungenügen<strong>de</strong>E<strong>in</strong>arbeiten <strong>von</strong> Ernterückstän<strong>de</strong>n führt beispielsweise oft zum Verstop<br />
fen <strong>de</strong>s Säaggregates und somit zu Fehlstellen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Pflanzenreihe. Diese Fehlstellen<br />
müssen <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er automatischen Geräteführung, die sich an <strong>de</strong>r Pflanzenreihe orien<br />
tiert, erkannt und ausgeglichen wer<strong>de</strong>n. Bei sehr Lücken im Pflanzenbestand<br />
kann die Orientierung an e<strong>in</strong>er Reihe als Vorgabe für die Geräteführung nicht mehr<br />
ausreichend se<strong>in</strong>. Wer<strong>de</strong>n jedoch mehrere Pflanzenreihen gleichzeitig als Bezugs<br />
signal erfaßt, so lassen sich Fehlstellen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Reihen leichter ausgleichen.<br />
Von <strong>de</strong>n untersuchten Pflanzenreihen soll an dieser Stelle exemplarisch e<strong>in</strong>e gesäte<br />
und e<strong>in</strong>e gepflanzte Kultur vorgestellt wer<strong>de</strong>n. Bei <strong>de</strong>r Pflanzenreihe <strong>in</strong> <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n<br />
Darstellung(Abb. 17) ist die gesäte Kultur Dabei han<strong>de</strong>lt es sich um Ret<br />
tich <strong>de</strong>r Sorte Rex (Raphanus sativus L.), <strong>de</strong>r <strong>in</strong> schmale Saatfurchen mit e<strong>in</strong>er Drill-
Ergebnisse 95<br />
Ermitteln <strong>de</strong>s Vegetationspunktes erheblich erleichterte. Die Koord<strong>in</strong>aten <strong>de</strong>s Vegeta<br />
tionspunktes <strong>de</strong>r ersten Pflanze <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Reihe wur<strong>de</strong>n um e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>heitlichen Bezugs-<br />
zu erhalten auf die Position 0 ; 0 Die Koord<strong>in</strong>aten aller weiteren<br />
Pflanzen beziehen sich ebenfalls auf diesen Ursprung. Die dargestellte Pflanzenreihe<br />
verläuft <strong>in</strong> X-Richtung, wobei e<strong>in</strong>e leichte Verschiebung <strong>von</strong> maximal 10 cm <strong>in</strong> Y<br />
Richtung festzustellen ist.<br />
Bei <strong>de</strong>r dargestellten Pflanzenreihe kann <strong>de</strong>utlich zwischen <strong>de</strong>n Streuurigen aufe<strong>in</strong>an<br />
<strong>de</strong>rfolgen<strong>de</strong>r Pflanzen und <strong>de</strong>m Verlauf<strong>de</strong>r Reihe unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Der Verlauf<br />
<strong>de</strong>r Reihe wird wesentlich durch die Fahrbewegung bei <strong>de</strong>r Aussaat bestimmt. Die<br />
Abweichungen <strong>von</strong> aufe<strong>in</strong>an<strong>de</strong>rfolgen<strong>de</strong>n Pflanzen resultiert aus <strong>de</strong>r Ablagegenauig<br />
keit <strong>de</strong>s Säaggregates.<br />
Als Beispiel e<strong>in</strong>er gepflanzten Kultur ist <strong>in</strong> <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Darstellung <strong>de</strong>r<br />
Verlauf e<strong>in</strong>er Salatpflanzenreihe (Lactuca sativa L.) wie<strong>de</strong>rgegeben. Die Positionser<br />
rmmung erroigte etwa e<strong>in</strong>e Woche nach <strong>de</strong>r Pflanzung. Der Salat wur<strong>de</strong> auf<br />
e<strong>in</strong>em Beet angebaut und masch<strong>in</strong>ell mit e<strong>in</strong>em Abstand <strong>von</strong> 35 cm <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Reihe ge-<br />
Zum Ermitteln <strong>de</strong>r Koord<strong>in</strong>aten wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r im Kapitel 4.1.1 beschriebene<br />
Meßaufbau mit Richtschnur, Maßband und W<strong>in</strong>kel e<strong>in</strong>gesetzt. Die Koord<strong>in</strong>aten <strong>de</strong>s<br />
Vegetationspunktes <strong>de</strong>r ersten Pflanze wur<strong>de</strong>n analog zur gesäten Reihe auf die Posi<br />
tion 0 ; 0 gelegt.
nen Pflanzen, breiten<br />
heitsbereiches bewirkt aber gleichzeitig<br />
Kulturtläche,<br />
rung, son<strong>de</strong>rn auch<br />
<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rolle.<br />
ausgeglichen wer<strong>de</strong>n. Dieses Erhöhen <strong>de</strong>s Sicher-<br />
e<strong>in</strong>en größeren Anteil unbearbeiteten<br />
Reihen spielt daher nicht nur für die Gerätefüh-<br />
<strong>de</strong>r Verfahrenstechnik e<strong>in</strong>e entschei-<br />
Um s<strong>in</strong>nvolle Stellgrößen für die Aktaren erhalten reicht es nicht aus, nur die Posi-<br />
tion exakt zu bestimmen. Die alle<strong>in</strong>e stellt noch<br />
brauchbare E<strong>in</strong>gangsgröße zur <strong>von</strong> dar. E<strong>in</strong>e Mög-<br />
um aus <strong>de</strong>n ermittelten Werten e<strong>in</strong>e zu erhalten bietet hier die<br />
ten<strong>de</strong> Mittelwertbildung.<br />
Als Beispiel wie aus <strong>de</strong>n Positionen <strong>de</strong>r E<strong>in</strong>zelpflanzen durch die Mittel-<br />
wertbildung e<strong>in</strong>e für die ermittelt wer<strong>de</strong>n kann, dient <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
folgen<strong>de</strong>n die Kultur. Es s<strong>in</strong>d die Mittelwertfunk-<br />
tionen aus 3, 5 und Pflanzen abgebil<strong>de</strong>t.
<strong>de</strong>r Pflanzen. die bei <strong>de</strong>r gleiten<strong>de</strong>n Mittelwertbildung<br />
richtet hauptsächlich nach <strong>de</strong>r<br />
mechanische Unkrautregulierung bei<br />
arbeitung möglichst ke<strong>in</strong>e zerstören beschädigen. Die wirksame<br />
Pflanzenschutztunnels kann daher bei Ermittlung<br />
<strong>de</strong>r notwendigen Pflanzenanzahl herangezogen wer<strong>de</strong>n. Wird e<strong>in</strong>er Tunnellänge<br />
<strong>von</strong> e<strong>in</strong>em ausgegangen, so bei <strong>de</strong>r<br />
generierung m<strong>in</strong><strong>de</strong>stens Pflanzenpositionen zu berücksichtigen.<br />
<strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Darstellung ist Fahrverlauf e<strong>in</strong>es Pflanzenschutztunnels unter <strong>de</strong>r<br />
Berücksichtigung <strong>von</strong> drei Pflanzenpositionen dargestellt (Abb. 21).<br />
Pflanzenschutztunnels über<br />
(Tunnellänge ] Tunnelbreite 6 C111)<br />
Pflan-
Ergebnisse<br />
Beim Verlauf wird unterstellt, daß ke<strong>in</strong>e Abweichung zwischen <strong>de</strong>r zu<br />
fahren<strong>de</strong>n und e<strong>in</strong>em realen Fahrverlauf besteht. Der Verlauf <strong>de</strong>r Reihe<br />
mit <strong>de</strong>m Ansatz <strong>de</strong>r Mittelwertbildung gut nachgefahren<br />
wer<strong>de</strong>n. Problematisch s<strong>in</strong>d die seitlichen Abweichungen aufe<strong>in</strong>an<strong>de</strong>rfol<br />
gen<strong>de</strong>n Pflanzen. Nur die Pflanzen, die sich zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Tunnelrän<strong>de</strong>rn be<br />
f<strong>in</strong><strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n nicht Solche, die <strong>in</strong>nerhalb o<strong>de</strong>r außerhalb <strong>de</strong>r als Tunnel-<br />
markierten Fläche liegen, wer<strong>de</strong>n entwe<strong>de</strong>r vom Bearbeitungsgerät o<strong>de</strong>r vom<br />
Pflanzenschutztunnel <strong>in</strong> Mitlei<strong>de</strong>nschaft gezogen. Im vorliegen<strong>de</strong>n Beispiel ist dies<br />
bei I Pflanzen <strong>de</strong>r Fall. Durch die Auswahl e<strong>in</strong>es breiteren Schutztunnels ist es<br />
diese Anzahl zu reduzieren, gleichzeitig erhöht sich dadurch<br />
<strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r unbearbeiteten Fläche.<br />
E<strong>in</strong> Problem bei <strong>de</strong>r gleiten<strong>de</strong>n Mittelwertbildung ist, daß Pflanzen, die große seitliche<br />
Abweichungen gegenüber <strong>de</strong>n restlichen Pflanzen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Reihe aufweisen, <strong>de</strong>n Ver<br />
lauf Mittelwertfunktion stark bee<strong>in</strong>flussen. Diese Pflanzen mit großen seitlichen<br />
Abweichungen wer<strong>de</strong>n im Folgen<strong>de</strong>n als "Ausreißer" bezeichnet.<br />
Bei <strong>de</strong>r hier Salatpflanzenreihe beträgt die Abweichung <strong>von</strong> 95 % aller<br />
Pflanzen, <strong>de</strong>r Mittelwertkennl<strong>in</strong>ie aus 3 Werten, als 27 mm. Nur<br />
zwei Pflanzen weichen mehr als 35 mm <strong>von</strong> dieser L<strong>in</strong>ie ab. Bei e<strong>in</strong>em optimierten<br />
wer<strong>de</strong>n solche Pflanzen nicht mehr als E<strong>in</strong>gangsgröße für die Steuersignalge<br />
nerierung zur herangezogen. Dies bietet e<strong>in</strong>e Möglichkeit Pflanzen, die<br />
aufgrund ihrer Position gegenüber <strong>de</strong>r Reihe nicht mehr durch das aus<br />
LUJ.
Untersuchungen <strong>de</strong>r Vorzaben<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n automatischen Sei-<br />
ist<br />
Grundsätzlich <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n<br />
auch anwen<strong>de</strong>n.<br />
<strong>de</strong>r die bei<strong>de</strong>n untersuchten<br />
<strong>de</strong>nfraktionen Der Meßwert auf<br />
Abb.22:<br />
0:0) um erhalten.<br />
fe<strong>in</strong>er
Ergebnisse 103<br />
Die <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Abbildung zeigen die verschie<strong>de</strong>nen Bo<br />
<strong>de</strong>nproben jeweils im angefeuchteten Zustand. Der Höhenverlauf konnte bei <strong>de</strong>n trok-<br />
kenen Bö<strong>de</strong>n nicht exakt ermittelt wer<strong>de</strong>n, da Fehlstellen im Verlauf<strong>de</strong>s Meß-<br />
auftraten. Dies wird auf das Reflexionsverhalten <strong>de</strong>r bei trockenen<br />
Bö<strong>de</strong>n sehr Oberfläche zurückgeführt, Feuchte Bö<strong>de</strong>n können dage<br />
gen ausreichend und ohne Fehlstellen <strong>de</strong>tektiert wer<strong>de</strong>n, was auf e<strong>in</strong>e verän<strong>de</strong>rte<br />
Oberflächenstruktur durch das Befeuchten zurückgeführt wird.<br />
Anband <strong>de</strong>r aufgezeichneten läßt sich ke<strong>in</strong> großer Unterschied<br />
zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n untersuchten Bo<strong>de</strong>nfraktionen erkennen. Die fe<strong>in</strong>e Struktur <strong>de</strong>r<br />
Bo<strong>de</strong>nprobe I (fe<strong>in</strong>krümeliger Humus) wird durch <strong>de</strong>n Verlauf <strong>de</strong>s aufgezeichneten<br />
Meßsignal nicht wie<strong>de</strong>rgegeben. Der Höhenverlauf ähnelt stark <strong>de</strong>m<br />
<strong>von</strong> Il. Die sehr Struktur <strong>de</strong>r zweiten Probe o<strong>de</strong>r e<strong>in</strong>zelne<br />
Ste<strong>in</strong>e lassen sich anband <strong>de</strong>s Oberflächenprofils ebenfalls nicht bestimmen. Der<br />
Verlaufdieser, als sandiger Lehm beschriebenen Bo<strong>de</strong>nprobe, ist im Vergleich<br />
zur ersten Probe etwas unruhiger und es s<strong>in</strong>d teilweise auch größere Sprünge <strong>in</strong>ner<br />
halb <strong>de</strong>r Meßreihe erkennbar.<br />
Die Schwankungen o<strong>de</strong>r Sprünge im Oberflächenprofil bei<strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nproben liegen<br />
meist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bereich <strong>von</strong> ± 1 crn. die<br />
mehrmals <strong>in</strong>nerhalb Zentimeter auftreten, müssen bei <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>es<br />
E<strong>in</strong>gangssignals zur Höhenführung unberücksichtigt bleiben. Sie treten, da sie durch<br />
e<strong>in</strong>zelne Ste<strong>in</strong>e o<strong>de</strong>r Erdkluten verursacht wer<strong>de</strong>n, nur unmittelbar unter <strong>de</strong>m Meßort<br />
und nicht über die gesamte Arbeitsbreite <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Geräte auf. E<strong>in</strong> Mittel, um<br />
solche Schwankungen bei <strong>de</strong>r Höhenführung gleich <strong>von</strong> an auszuschließen, ist<br />
<strong>de</strong>r E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong> mehreren Sensoren, die über die zu Breite verteilt s<strong>in</strong>d.<br />
Durch das Verrechnen e<strong>in</strong>er größeren Anzahl <strong>von</strong> lassen sich die e<strong>in</strong>zel-<br />
nen Schwankungen E<strong>in</strong> weiterer Vorteil beim E<strong>in</strong>satz mehrerer Sensoren<br />
ist es, Hangneigungen zu erkennen und bei <strong>de</strong>r Höhenführung <strong>de</strong>s zu
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Höhenverlauf e<strong>in</strong>er Bo<strong>de</strong>noberfläche über e<strong>in</strong>e länge-<br />
re Streckenabschnitt sowie e<strong>in</strong> cm Teilausschnitt Das<br />
Bo<strong>de</strong>nbeet wur<strong>de</strong> zuvor e<strong>in</strong>em Rechen manuell daß<br />
Schwankungen als bei Schalen untersuchten Bo<strong>de</strong>nfraktionen erkennen<br />
Über e<strong>in</strong>e <strong>von</strong> Meter schwankt Höhenverlauf e<strong>in</strong>em<br />
Bereich <strong>von</strong> ± cm. E<strong>in</strong>zelne die <strong>de</strong>r relativ ebenen Fläche herausra-<br />
lassen gut wie<strong>de</strong>rf<strong>in</strong><strong>de</strong>n. "Ausreißer" dürfen zu nezativen<br />
<strong>de</strong>r e<strong>in</strong>es führen. Dies läßt sich<br />
<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>n Pflanzenreihen e<strong>in</strong>e mittels<br />
gleiten<strong>de</strong>r Mittelwertbildung über erreichen.<br />
<strong>de</strong>n Sensoruntersuchungen<br />
Die Ergebnisse zu <strong>de</strong>n Sensoruntersuchungen<br />
sich entsprechend <strong>de</strong>n unter-<br />
suchten Sensoren m Bereiche .Llltraschall" und "Laser". sehr unter-<br />
schiedlichen Meßpr<strong>in</strong>zipien s<strong>in</strong>d die Versuche <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n nicht direkt<br />
<strong>de</strong>n Ultraschallsensoren konnten <strong>de</strong>r variablen<br />
Programmierung <strong>de</strong>r<br />
Sensoren e<strong>in</strong>e Vielzahl unterschiedlicher Parameter berücksichtigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Ergebnisteil dieser Versuche <strong>de</strong>n Laseruntersuchungen.
5.3.1 Ultraschallsensoren<br />
Ergebnisse 107<br />
Bei <strong>de</strong>n Voruntersuchungen <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Ultraschallsensoren wur<strong>de</strong> festgestellt,<br />
daß bei<strong>de</strong> Sensoren e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Abstand als die tatsächliche Entfernung zwi<br />
schen Sensor und Meßobjekt anzeigen. Die Differenz zwischen Istabstand und ange-<br />
Abstand verän<strong>de</strong>rte sich nicht über <strong>de</strong>n Meßbereich und betrug bei Sensor I<br />
etwa cm und bei Sensor Il ca. 1,5 cm. Diese Differenz spielte für die Verrechnung<br />
und Darstellung <strong>de</strong>r Meßdaten ke<strong>in</strong>e Rolle, da <strong>de</strong>r Fehler durch e<strong>in</strong>e entsprechen<strong>de</strong><br />
O-Punkt-Korrekturausgeglichen wur<strong>de</strong>.<br />
5.3.1.1 Statische Untersuchungen<br />
Wie sich bei <strong>de</strong>n statischen Untersuchungen herausstellte unterliegt <strong>de</strong>r Erfassungsbe<br />
reich <strong>de</strong>r untersuchten Sensoren Schwankungen im Millimeterbereich. Im Randbe<br />
reich ist e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong><strong>de</strong>utige Erfassung <strong>de</strong>s Meßobjektes nicht immer gewährleistet. Für<br />
die Darstellung <strong>de</strong>s Erfassungsbereiches wur<strong>de</strong> immer <strong>de</strong>r Meßwert aufgenommen,<br />
bei <strong>de</strong>m das Objekt noch sicher erfaßt wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Abbildung ist <strong>de</strong>r Ra<br />
dius <strong>de</strong>r Erfassungsbereiche <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n untersuchten Ultraschallsensoren <strong>in</strong> Abhän<br />
gigkeit <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Entfernung Sensor/Meßobjekt dargestellt (Abb.
Ergebnisse<br />
Zusammenhang nachgewiesen wer<strong>de</strong>n konnte. Die <strong>de</strong>s Erfassungsbe<br />
reiches variierte e<strong>in</strong>erseits abhängig vom jeweils untersuchten Sensor und an<strong>de</strong>rerseits<br />
noch über <strong>de</strong>n Abstand im Meßbereich, Die Auskleidung <strong>de</strong>r Schallhörner mit schall<br />
absorbieren<strong>de</strong>m Material hatte ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluß auf das und <strong>de</strong>n Er<br />
fassungsbereich <strong>de</strong>r Sensoren.<br />
5.3.1.2 Auflösungsvermögen<br />
Unter <strong>de</strong>m Begriff Auflösungsvermögen wird hier die <strong>de</strong>s Sensors ver-<br />
stan<strong>de</strong>n, e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten M<strong>in</strong><strong>de</strong>stgröße sicher zu <strong>de</strong>tektieren, Ob e<strong>in</strong> Sen-<br />
sor e<strong>in</strong> wahrnimmt und anzeigt, hängt <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Intensität <strong>de</strong>s empfangenen<br />
Echos ab. Diese Intensität ist <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er Reihe unterschiedlicher Faktoren wie Ultra<br />
schallfrequenz, Objektgröße. Neigungsw<strong>in</strong>kel und Abstand<br />
Sensor/Objekt abhängig. Für die Ermittlung <strong>de</strong>s Auflösungsverhaltens wur<strong>de</strong>n die<br />
verschie<strong>de</strong>nen Mo<strong>de</strong>llkörper <strong>in</strong> unterschiedlichen Entfemungen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Ertassungsbe<br />
reich <strong>de</strong>r Sensoren gebracht. Zeigte sich ke<strong>in</strong>e Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>m zuvor<br />
e<strong>in</strong>gestellten Grundabstand, so wur<strong>de</strong> da<strong>von</strong> ausgegangen, daß <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong><br />
Meßkörper nicht mehr wahrgenommen wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
Es stellte sich bei diesen Untersuchungen heraus, daß e<strong>in</strong> fließen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
Auflösungsverhaltens <strong>de</strong>r Sensoren Es gab ke<strong>in</strong>e scharfe Grenze für e<strong>in</strong> ex<br />
aktes Wahrnehmen <strong>de</strong>r untersuchten Objekte. Abhängig <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Größe <strong>de</strong>r Refle<br />
xionsfläche und <strong>de</strong>r zum Sensor wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Abstand zum Meßobjekt un<br />
genau ermittelt. Es wur<strong>de</strong>, beson<strong>de</strong>rs bei kle<strong>in</strong>en Oberflächen, e<strong>in</strong>e Entfer<br />
nung angezeigt als tatsächlich Zu<strong>de</strong>m ist das Auflösungsverhalten am Rand<br />
<strong>de</strong>s Erfassungsraumes ger<strong>in</strong>ger als im zentralen Bereich. Durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong><br />
Schallhörnern konnte ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong><strong>de</strong>utige Verbesserung <strong>de</strong>s Auflösungsverhaltens.
sehen <strong>de</strong>r Begrenzung <strong>de</strong>s Erfassungsraumes. festgestellt Von <strong>de</strong>n unter<br />
suchten Sensoren hatte Sensor I e<strong>in</strong> besseres Auflösungsvermögen als Dies<br />
ist <strong>in</strong>sofern erstaunlich, da dieser Sensor auch<br />
Durch die <strong>de</strong>r<br />
konnte ke<strong>in</strong>e Verbesserung <strong>de</strong>s Auflösungsverhaltens<br />
<strong>de</strong>n, Das bei<br />
die <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n gesamten Erfassungsbereich<br />
5.3.1.3 Untersuchungen zum Reflexionsverhalten<br />
<strong>de</strong>n QTößen:n Erfassungsbereich<br />
<strong>de</strong>r<br />
Sensoren beobachtet<br />
Rolle, da für<br />
Das Reflexionsverhalten <strong>de</strong>r Meßobjektoberfläche wirkte sich sehr unterschiedlich<br />
auf die bei<strong>de</strong>n untersuchten Sensoren aus. Die <strong>von</strong> Sensor war<br />
wesentlich als die <strong>von</strong> Sensor Il. Sensor Reihe <strong>von</strong><br />
Versuchen ke<strong>in</strong>e Meßergebnisse liefern. mit<br />
<strong>de</strong>m die Objektoberfläche gegenüber <strong>de</strong>m Sensor entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Rolle für die Funktion <strong>de</strong>s Wird Schall nicht wie<strong>de</strong>r zum Sensor zu<br />
rück reflektiert, kann auch ke<strong>in</strong> Abstand ermittelt wer<strong>de</strong>n. Ob das Ultraschallecho<br />
beim Empfänger ankommt, <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Oberfläche, <strong>de</strong>r und Ent-<br />
fernung ab. Die schräge Kante <strong>de</strong>s wur<strong>de</strong> <strong>von</strong> ke<strong>in</strong>em <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n Sensoren bei <strong>de</strong>n untersuchten Abstän<strong>de</strong> erfaßt,<br />
5.3.1.4<br />
Als Versuchsautbau zur Ermittlung <strong>de</strong>s Abbildungsverhaltens <strong>de</strong>r Sensoren wur<strong>de</strong><br />
Standartversuchsstrecke die aus drei Qua-
Ergebnisse 113<br />
So wird die Oberflächenkontur <strong>de</strong>r Meßstrecke mit steigen<strong>de</strong>r Taktrate "genauer"<br />
dargestellt. Bei <strong>de</strong>m untersuchten Meßsystem ist die Taktrate auf 20 Hz beschränkt.<br />
Dies be<strong>de</strong>utet, daß bei e<strong>in</strong>er Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit <strong>von</strong> 50 mm/s ca. 400 Meßwerte<br />
beim Abtasten <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstrecke aufgenommen wer<strong>de</strong>n. Die Variation <strong>de</strong>r Taktrate<br />
verursachte bei ke<strong>in</strong>em <strong>de</strong>r untersuchten Sensoren Probleme h<strong>in</strong>sichtlich ihres Meß<br />
verhaltens.<br />
5.3.2 Untersuchungsergebnisse zu <strong>de</strong>m e<strong>in</strong>gesetzten Lasersensor<br />
Der e<strong>in</strong>gesetzte Laser-Triangulationstaster gibt <strong>in</strong> Abhängigkeit vom Abstand zum<br />
Meßobjekt e<strong>in</strong>e Spannung zwischen 0 und 10 V ab. Das Verhältnis <strong>de</strong>r Entfernung<br />
zur Ausgangsspannung ist bei <strong>de</strong>m hier untersuchten Lasersensor ke<strong>in</strong>e l<strong>in</strong>eare Funk<br />
tion. Die Eichfunktion zur Umrechnung vom Spannungssignal <strong>in</strong> mußte<br />
aufgrund <strong>von</strong> bauartbed<strong>in</strong>gten Schwankungen experimentell ermittelt wer<strong>de</strong>n. Auch<br />
die Sensorunterlagen und die entsprechen<strong>de</strong> Dokumentation konnten nur unzurei<br />
chend <strong>de</strong>n sensorspezifischen Zusammenhang zwischen Spannung und Abstand klä<br />
ren. In <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Abbildung ist die anhand <strong>von</strong> 40 Meßwerten experimentell er<br />
mittelte Eichkurve <strong>de</strong>s e<strong>in</strong>gesetzten Sensors dargestellt (Abb.
!I6 Ergebnisse<br />
wegt aufgezeichnet. Nach dieser<br />
50 Sekun<strong>de</strong>n mit Raugiergeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
verschoben.<br />
Das Reaktionsverhalten<br />
wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sensor für weitere<br />
ruhiger Lauf) gegenüber <strong>de</strong>r Platte<br />
Außer diesem Versuch wur<strong>de</strong>n noch unterschiedlichen Fahrgeschw<strong>in</strong>dig-<br />
keiten l<strong>in</strong>d Alle diese führten zu<br />
<strong>de</strong>m gleichen unbefriedigen<strong>de</strong>n so daß auf die <strong>de</strong>r Ergebnisse<br />
und <strong>de</strong>n weiteren E<strong>in</strong>satz <strong>de</strong>s Lasersenseres zur Abstandsmessung gegenüber<br />
ten verzichtet wer<strong>de</strong>n mußte, Der Sensor konnte bei <strong>de</strong>n<br />
weiteren als Meßsystern zur <strong>de</strong>s Positionssensors auf<br />
<strong>de</strong>m Führungsholm wer<strong>de</strong>n. In diesem wird <strong>de</strong>r festen Mon-<br />
tage gegenüber <strong>de</strong>r Meßfläche e<strong>in</strong> Meßergebnis erzielt.<br />
Die Ursache für die hohe <strong>de</strong>s Sensors gegenüber <strong>de</strong>n Fahrbewegun-<br />
gen wird <strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>r Optik vermutet, nach <strong>in</strong> Bezug auf die<br />
Fahrtrichtung unterschiedlich Effekte zu beobachten<br />
5.4 Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik <strong>Seitenführung</strong><br />
Systems, das Versuchsmechanik zur Seitenfüh-<br />
rung im Bo<strong>de</strong>n wird, ist <strong>von</strong> großen Anzahl <strong>von</strong> sehr unterschiedlichen<br />
Faktoren abhängig, E<strong>in</strong>e Reihe dieser E<strong>in</strong>flußfaktoren außer<strong>de</strong>m noch stän-<br />
Schwankungen, was eme Reaktionsverhaltens Me-<br />
chanik erschwert In <strong>de</strong>r Praxis kommt es z.B. zu großen Schwan-<br />
kungen Bo<strong>de</strong>nart und <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Diese bestimmen aber<br />
entschei<strong>de</strong>nd, wie tief die Scheibenseche <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n und somit welche<br />
Kraft über die wirksame Sechfläche auf das übertragen wird. Die auf die Se-
Ergebnisse<br />
ehe e<strong>in</strong>wirken<strong>de</strong>n seitlichen Schiebekräfte bestimmten jedoch wesentlich,<br />
Gesamtsystemverhält.<br />
Die Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit, das Gewicht <strong>de</strong>s angehängten und Fahrver-<br />
halten <strong>de</strong>r s<strong>in</strong>d weitere Parameter, die sich entschei<strong>de</strong>nd das Reakti-<br />
onsverhalten auswirken. Das Erstellen e<strong>in</strong>es Simulationsmo<strong>de</strong>lls zur Vorhersage <strong>de</strong>s<br />
Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r <strong>Seitenführung</strong> wird zusätzlich durch die zeitgleiche gegensei<br />
tige Bee<strong>in</strong>flussung <strong>de</strong>r o. g. Faktoren erschwert. Um <strong>in</strong> diesem variablen Umfeld ei<br />
nen e<strong>in</strong>zusetzen ist es notwendig, daß dieser alle E<strong>in</strong>flußfaktoren zusammen<br />
faßt und eigenständig aufVerän<strong>de</strong>rungen reagiert.<br />
Im Kapitel 4.3.6.3 wur<strong>de</strong> bereits <strong>de</strong>r theoretische mathematische Fahrverlauf beim<br />
Halten und während e<strong>in</strong>es Drehvorganges <strong>de</strong>r Seche beschrieben. Das tatsächliche<br />
Reaktionsverhalten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik zur <strong>Seitenführung</strong> unter Bed<strong>in</strong>gungen<br />
ist zunächst <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Untersuchungen. Anschließend<br />
wird das Verhalten <strong>de</strong>r Mechanik bei unterschiedlichen näher betrachtet.<br />
5.4.1<br />
Blumenstraße<br />
Versuchsstand<br />
Bei e<strong>in</strong>em durch so viele unterschiedliche Faktoren bee<strong>in</strong>flußten System, wie es die<br />
Versuchsmechanik zur Geräteführung darstellt, variieren die <strong>de</strong>r<br />
suchsfahrtenauch unter optimalen Bed<strong>in</strong>gungen erheblich. Das Bestimmen <strong>de</strong>r Bandbreite<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong>r sich das Reaktionsverhalten <strong>de</strong>s Systems ist e<strong>in</strong>e notwendige<br />
Voraussetzung, um e<strong>in</strong>e genaue E<strong>in</strong>ordnung <strong>de</strong>r Versuchsergebnisse durchfuhren zu<br />
können.<br />
117<br />
das
li8 Ergebnisse<br />
Die Untersuchung <strong>de</strong>s Versuchsgerätes<br />
suchsgerät zur <strong>Seitenführung</strong> im Versuchsstand Blumenstraße durchgeführt.<br />
4.3.2 vorgestellte Versuchsgerät e<strong>in</strong>gesetzt<br />
SPS-S;tellenmg vorgegebene Fahrprogramm die Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit <strong>de</strong>s<br />
Ver<br />
tetragrahmens wur<strong>de</strong>n bei allen Wie<strong>de</strong>rholungen konstant Der Bo<strong>de</strong>n <strong>in</strong>ner-<br />
halb<br />
Versuchsstrecke wur<strong>de</strong> nach je<strong>de</strong>m Durchgang<br />
möglichst homogene schaffen. Während<br />
ke<strong>in</strong>e Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nfeuchte auf. An <strong>de</strong>r Geschw<strong>in</strong>digkeitssteuerung<br />
rätetragrahrnens wur<strong>de</strong>n 20 e<strong>in</strong>gestellt,<br />
m1s Die Reproduzierbarkeit<br />
digkeit ist mittels Lichtschranke<br />
Darstellung <strong>de</strong>s Zusammenhanges zwischen e<strong>in</strong>gestelltem<br />
Geschw<strong>in</strong>digkeit <strong>in</strong> m/s bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t im Anhang.<br />
da<br />
die<br />
am Tragrahmen e<strong>in</strong>gestellten Geschw<strong>in</strong>-<br />
Zeitmessung untersucht wor<strong>de</strong>n. E<strong>in</strong>e<br />
Insgesamt wur<strong>de</strong>n 25 untersucht und ausgewertet,<br />
und erreichter<br />
Fahrten befand sich <strong>de</strong>r Teil <strong>de</strong>s am rechten Anschlag<br />
und die Seche zur Fahrtrichtung. Nach löste e<strong>in</strong><br />
<strong>de</strong>r Versuchsstrecke Kippschalter<br />
Steuerung aus. Daraufh<strong>in</strong> Sechstellmotor Seche<br />
für 500 ms nach l<strong>in</strong>ks. Es anschließend e<strong>in</strong>e Haltezeit <strong>von</strong> 500 und<br />
danach wur<strong>de</strong>n die Scheibenseche Parallele zur Fahrtrichtung zurückge<br />
steltt.<br />
<strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Darstellung ist <strong>von</strong><br />
Wie<strong>de</strong>rholungsfahrten <strong>de</strong>s Ver-<br />
suchsgerätes für das beschriebene Fahrprogramm wie<strong>de</strong>rgegeben.
über an<strong>de</strong>ren Wie<strong>de</strong>rholungsfahrten gleichmäßig<br />
zwischen diesen UlIOHL,C". Die Standardabweichung 25<br />
0.396. Sie ist <strong>in</strong> <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Abbildung zusammen mit <strong>de</strong>r Verteilung<br />
30).<br />
5 1------.----'-----------1 1--.--.-.'''-...--]<br />
Wie<strong>de</strong>rholung - 25<br />
seitlichen<br />
I<br />
M<strong>in</strong>., Max. I'<br />
arith, Mittel<br />
Staudartab-<br />
Abb.30: Verteilung statistische Kenngrößen <strong>de</strong>r seitlichen Verschiebung <strong>von</strong><br />
25 Wie<strong>de</strong>rholungen unter Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
Die dargestellte Grundstreuung <strong>de</strong>s läßt sich auch unter normierten Bed<strong>in</strong>-<br />
gungen nicht vermei<strong>de</strong>n, Unter ihrem E<strong>in</strong>fluß stehen alle Ulp·itp·cpn Untersuchungen<br />
zum Reaktionsverhalten<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Versuchsmechanik, Bei e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>satz au-<br />
ßerhalb <strong>de</strong>r Versuchsstrecke wirken zusätzlich noch weitere Faktoren, wie Fahr-<br />
bewegungen <strong>de</strong>s Zugfahrzeuges auf das<br />
weiteren Erhöhung <strong>de</strong>r Grundstreuung.<br />
e<strong>in</strong>. Dies führt zusätzl ich zu e<strong>in</strong>er
Ergebnisse 121<br />
Mit festen für die Aktoren läßt sich ohne e<strong>in</strong>e Rückmel-<br />
über die genaue Position auf <strong>de</strong>m Verschiebeholm, e<strong>in</strong> Verlauf<br />
nur unzureichend nachfahren. Insbeson<strong>de</strong>re wenn, wie beim Nachfahren e<strong>in</strong>er Pflan<br />
zenreihe, mehrere Positionswechsel h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>an<strong>de</strong>r vorgenommen wer<strong>de</strong>n müssen, ist<br />
die Rückmeldung an das System Diese fuhrt zu<br />
e<strong>in</strong>em geschlossenem Regelkreis für die automatische Geräteführung.<br />
5.4.2 Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeitse<strong>in</strong>fluß auf die Versuchsfahrten<br />
Die zum E<strong>in</strong>fluß <strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit auf das Reaktionsverhal-<br />
ten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik zur wur<strong>de</strong>n weitgehend analog zu <strong>de</strong>n Ver-<br />
suchen zur <strong>de</strong>r Anlage durchgeführt.<br />
Die durch das zwischen <strong>de</strong>m Verdrehen und<br />
Zurückdrehen <strong>de</strong>s Seches wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>s großen seitlichen Versatzes bei hohen<br />
Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeiten auf 300 rns verkürzt. Die Drehzeit <strong>de</strong>r Seche wur<strong>de</strong> mit<br />
500 ms Verdrehen und 500 ms Zurückdrehen nicht verän<strong>de</strong>rt. Die Fahrgeschw<strong>in</strong>dig<br />
keit wur<strong>de</strong> kont<strong>in</strong>uierlich <strong>in</strong> Schritten <strong>von</strong> 0.083 mJs zwischen 0.08 und 1,49 mJs ge<br />
steigert. Der die Gerätee<strong>in</strong>stellung und <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />
5.4.1 beschriebenen Vorgaben.<br />
In <strong>de</strong>r Darstellung ist <strong>de</strong>r Fahrverlauf <strong>de</strong>r Versuchsmechanik für drei unter-<br />
schiedliche Geschw<strong>in</strong>digkeiten abgebil<strong>de</strong>t.
Ergebnisse 125<br />
betrachtet nimmt <strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>r Abweichung mit steigen<strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit zu.<br />
Die Abweichung zwischen tatsächlicher und theoretischer ist <strong>von</strong> sehr<br />
vielen unterschiedlichen Faktoren, wie etwa <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nart. <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>nzustand und <strong>de</strong>r<br />
wirksamen Sechfläche Diese Faktoren s<strong>in</strong>d nicht konstant, son<strong>de</strong>rn<br />
sehr variabel. Während <strong>de</strong>r Fahrt lassen sich diese auftreten<strong>de</strong>n nur sehr<br />
schlecht erfassen. Daher kann auch die Abweichung nicht durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>-<br />
fache Aufschaltung o<strong>de</strong>r feste Vore<strong>in</strong>stellung wer<strong>de</strong>n. E<strong>in</strong>e Möglichkeit,<br />
um auf die Verän<strong>de</strong>rungen zu ist <strong>de</strong>r E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es adaptiven<br />
stems, das sich selbständig anhand e<strong>in</strong>es h<strong>in</strong>terlegten Mo<strong>de</strong>lls an die variablen<br />
benheiten anpaßt.<br />
5.4.3 Untersuchungen an e<strong>in</strong>fachen Reglerstrukturen<br />
Die bisher vorgestellten Untersuchungen das Reaktionsverhalten<br />
<strong>de</strong>r Versuchsmechanik bei fest vorgegebenen Es erfolgte während<br />
und nach <strong>de</strong>r Programmausführung ke<strong>in</strong>e Rückmeldung <strong>de</strong>r Sensoren an die Steue<br />
rung. Das Nachfahren e<strong>in</strong>er sich verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Pflanzenreihe ist ohne<br />
Rückmeldungund Kontrolle <strong>de</strong>r Sollposition nicht o<strong>de</strong>r nur für e<strong>in</strong>en kurzen Zeitraum<br />
möglich. Wird nun nach e<strong>in</strong>er vorgegebenen Steuerungsmaßnahme die aktuelle Posi<br />
tion an die Steuere<strong>in</strong>heit zur Kontrolle so kann diese e<strong>in</strong>e Korrektur vor<br />
nehmen. Durch die Rückmeldung <strong>de</strong>r "IST-Situation" wird aus <strong>de</strong>r offenen Steuerung<br />
e<strong>in</strong> geschlossenerRegelkreis (Abb. 34).
Meßort:<br />
34:<br />
Abstand<br />
Bo<strong>de</strong>nart und -zustand,<br />
Erdkluten. Ste<strong>in</strong>e,<br />
5.4.3.1 Fahrverlauf bei unterschiedlichen Verstellzeiten Scheibenseche<br />
In <strong>de</strong>r rotgen<strong>de</strong>n Abbildung ist <strong>de</strong>r Fahrverlauf bei zwei unterschiedlichen z.eirvorga-<br />
ben zum Verstellen <strong>de</strong>r Seche dargestellt Die Breite <strong>de</strong>s e<strong>in</strong>zuhalten<strong>de</strong>n<br />
Sollbereiches<br />
vorgegeben. Zu<br />
ches,<br />
bei I cm. Bei allen Fahrten wur<strong>de</strong> als Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit 0,83 rnls<br />
rechten Anschlag,<br />
Fahrt befand<br />
<strong>in</strong> Mitte <strong>de</strong>s beweglichen Berei-
128 Ergebnisse<br />
beschriebene Verhalten zu vermei<strong>de</strong>n, ist das Verr<strong>in</strong>gern <strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
Neben bei<strong>de</strong>n Fahrten wur<strong>de</strong>n noch weitere ms Verstellzeit<br />
durchgeführt. Mit <strong>de</strong>m Anstellw<strong>in</strong>kel, <strong>de</strong>r sich aus dieser Verstellzeit konnte<br />
<strong>de</strong>r seitlich nicht so stark verschoben wer<strong>de</strong>n, daß <strong>de</strong>r Sollbereich<br />
<strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>r Versuchsstrecke erreicht wur<strong>de</strong>. Bei sehr kle<strong>in</strong>en W<strong>in</strong>keln zwischen <strong>de</strong>n<br />
Sechen und <strong>de</strong>r Fahrtrichtung war z.T. die auf <strong>de</strong>n so ge-<br />
r<strong>in</strong>g, daß ke<strong>in</strong>e seitliche Verschiebung wur<strong>de</strong>.<br />
5.4.3.2 Fahrverlauf bei unterschiedlichen Ge,sdlwi<strong>in</strong>dliglieilten<br />
Analog zu <strong>de</strong>n Versuchen mit unterschiedlichen Verstellzeiten wur<strong>de</strong> das Verhalten<br />
<strong>de</strong>r Versuchsmechanik beim E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es fest programmierten Reglers und unter-<br />
schiedlichen untersucht. Bei diesen Untersuchungen wur<strong>de</strong><br />
die <strong>de</strong>s <strong>von</strong> 10 auf35 Hz <strong>in</strong> Schritten <strong>von</strong> 5 Hz er-<br />
höht. Dies e<strong>in</strong>em zwischen 0,4 und 1,45 m/s. Die<br />
Verstellzeit <strong>de</strong>r Scheibenseche wur<strong>de</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Versuchsreihe mit 200 ms und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
weiteren Reihe mit 300 ms vorgegeben,<br />
In <strong>de</strong>r s<strong>in</strong>d Fahrten bei unterschiedlichen<br />
Bei diesen Fahrten wur<strong>de</strong> die Seche außer-<br />
halb <strong>de</strong>s Sollbereiches so verstellt, daß sich <strong>de</strong>s<br />
auszurcgeln<strong>de</strong>n Bereiches Beim E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Sollbereich genau<br />
wie bei <strong>de</strong>n zu unterschiedlichen Verstellzeiten. das automatische<br />
Zurückstellen <strong>de</strong>r Seche. Die unterschiedlichen Startpositionen auf <strong>de</strong>m Rahmen s<strong>in</strong>d<br />
durch die Drift während <strong>de</strong>r Beschleunigungsphase verursacht,
Regelstrukturen nicht e<strong>in</strong>gehalten<br />
e<strong>in</strong>zuhalten, kann hier beschriebenen e<strong>in</strong>fachen<br />
elim<strong>in</strong>ieren, müßte<br />
Verstell zeit wer<strong>de</strong>n.<br />
beim <strong>de</strong>r Scheibenseche Sollbereich schon verlassen wird.<br />
Um<br />
e<strong>in</strong>e<br />
das Problem <strong>de</strong>s Zurückstollens beim Erreichen <strong>de</strong>s Sollberei-<br />
zu <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>es je nach Regelabweichung<br />
Scheibenseche unterschiedlich stark<br />
<strong>de</strong>n bisher es e<strong>in</strong>em Proportionalregler<br />
fest vorgegebenen Stellzeiten. nach vorhan<strong>de</strong>ner <strong>de</strong>r<br />
unterschiedliche Drehzeiten <strong>de</strong>n Sechmotor vor. Aus dieser vorgegebenen<br />
Drehzeit resultiert das Erreichen e<strong>in</strong>es bestimmten Seche ge-<br />
<strong>de</strong>r Fahrtrichtung.<br />
37) abgebil<strong>de</strong>t.<br />
Proportionalreglers ist
Der eigentliche Sollbereich (ct I cm) wird<br />
obwohl die Seche bis zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Versuchsfahrt gegenüber<br />
ausgelenkt bleiben, Durch das<br />
y orceben e<strong>in</strong>er Grundauslenkung außerhalb Sollbereiches läßt<br />
<strong>de</strong>rartiges Verhalten pr<strong>in</strong>zipiell verh<strong>in</strong><strong>de</strong>rn.<br />
festen Vorzaben und Parametern<br />
solches verän<strong>de</strong>rliche Rahmenbed<strong>in</strong>-<br />
schw<strong>in</strong>digkeiten ist <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Darstellung<br />
2<br />
o<br />
-2<br />
-6<br />
-8<br />
.r<br />
Abb, F ahrvertanf <strong>de</strong>s Versuchsgerätes<br />
Sollbereich wird bei <strong>de</strong>r höchsten Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
schw<strong>in</strong>zt aber, bevor sich die Seche<br />
\<br />
verschie<strong>de</strong>nenFahrge- .........<br />
v1'" 0.4 m/s :-------<br />
v2'" 0.8 m/s<br />
c------<br />
--- 1.2 m/s i-<br />
Sollbereichsgrenzen<br />
I<br />
1'-
Ergebnisse 133<br />
<strong>de</strong>r aus diesem Bereich heraus. Der Grund für dieses Verhalten ist die fest vorgegebe<br />
ne Drehgeschw<strong>in</strong>digkeit mit <strong>de</strong>r die Seche verstellt wer<strong>de</strong>n. Das Annähern an <strong>de</strong>n<br />
Sollbereich erfolgt so schnell, daß ke<strong>in</strong> ausreichen<strong>de</strong>r Zeitraum zum Zurückdrehen<br />
<strong>de</strong>r Seche vorhan<strong>de</strong>n ist.<br />
Bei <strong>de</strong>r Fahrt mit <strong>de</strong>r langsamsten Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit wird <strong>de</strong>r Sollbereich erst nach<br />
fast zwei Metern erreicht. Hier tritt <strong>de</strong>r gegenteilige Effekt zur schnellen Fahrt auf.<br />
Die Seche wer<strong>de</strong>n schon beim Annähern wie<strong>de</strong>r langsam zurückgedreht, was e<strong>in</strong><br />
späteres E<strong>in</strong>treten zur Folge hat. Der W<strong>in</strong>kel, <strong>de</strong>n die Seche beim Erreichen <strong>de</strong>s Soll<br />
bereiches gegenüber <strong>de</strong>r Fahrtrichtung aufweisen, ist im Vergleich zu <strong>de</strong>n Fahrten mit<br />
höheren Geschw<strong>in</strong>digkeiten sehr flach. Die vorgegebene Regelabweichung wird bei<br />
<strong>de</strong>r Fahrt mit 0.8 m/s am schnellsten ausgeglichen.<br />
In <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Abbildung s<strong>in</strong>d die Auslenkurigen <strong>de</strong>r Seche bei unterschiedlichen<br />
Geschw<strong>in</strong>digkeiten dargestellt (Abb. 39). Im oberen Diagramm ist das Zeitverhalten<br />
wie<strong>de</strong>rgegeben, im unteren <strong>de</strong>r Sechw<strong>in</strong>kel gegenüber <strong>de</strong>m Weg. Zur<br />
besseren Vergleichbarkeit <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Geschw<strong>in</strong>digkeiten wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Beg<strong>in</strong>n<br />
<strong>de</strong>r W<strong>in</strong>kelän<strong>de</strong>rung bei allen Versuchsläufen rechnerisch auf<strong>de</strong>n Zeitpunkt 0 gelegt.
Ergebnisse 135<br />
gen, Bei niedrigen Geschw<strong>in</strong>digkeiten macht sich das <strong>de</strong>r Ab-<br />
weichurig negativ bemerkbar. E<strong>in</strong>e dieses zu vermei<strong>de</strong>n,<br />
ist das Aufschalten <strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit als Mit Hilfe dieser<br />
ßenaufschaltung müßte <strong>de</strong>r und die Grundauslenkung beim Ver-<br />
lassen <strong>de</strong>s Sollbereiches <strong>in</strong> <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit angepaßt wer-<br />
<strong>de</strong>n.<br />
Das Problem <strong>de</strong>r vorgegebenen Stellgeschw<strong>in</strong>digkeit mit <strong>de</strong>r die Scheibenseche ver-<br />
dreht wer<strong>de</strong>n können, läßt sich jedoch durch e<strong>in</strong>e nicht lösen.<br />
Unter Bed<strong>in</strong>gungen kann mit Hilfe e<strong>in</strong>es jedoch für ei-<br />
nen relativ weiten Bereich e<strong>in</strong>e befriedigen<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n. Der Vorteil<br />
liegt hier vor allem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er sehr e<strong>in</strong>fachen die zu reali-<br />
sieren ist.Nachteilig das Verhalten <strong>de</strong>s die Seche beim<br />
Annähern langsam zurückzudrehen.<br />
E<strong>in</strong>e Möglichkeit, um die Nachteile e<strong>in</strong>es Porportionalreglers zu ist mo<br />
<strong>de</strong>llorientierter <strong>de</strong>r nicht anband fester Regelpararneter, son<strong>de</strong>rn entsprechend<br />
<strong>de</strong>m Fahrverhalten <strong>de</strong>r Versuchsmechanik die Stellgrößen ermittelt. E<strong>in</strong> solches<br />
stem bietet die Möglichkeit durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>e Regelabweichung<br />
schnellstmöglich auszugleichen.<br />
5.4.5<br />
Der hier vorgestellte Mo<strong>de</strong>llregler basiert im wesentlichen auf <strong>de</strong>m im<br />
behan<strong>de</strong>lten zur <strong>Seitenführung</strong>.<br />
4.3.6.3<br />
Die für das Ausgleichen <strong>de</strong>r Abweichung notwendige Drehzeit wird nicht durch e<strong>in</strong>e<br />
feste son<strong>de</strong>rn durch e<strong>in</strong> Reaktionsmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r Versuchsmechanik ermittelt.
Als E<strong>in</strong>gangsparameter dieses Mo<strong>de</strong>ll dienen lc;ULl19"AI die Regelabweichune und<br />
aktuelle Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit. verän<strong>de</strong>rliche Parameter wie etwa die Bo-<br />
<strong>de</strong>nkbar,<br />
o<strong>de</strong>r<br />
während<br />
das Regelmo<strong>de</strong>ll wur<strong>de</strong> daher verzichtet,<br />
als<br />
ermitteln. Auf E<strong>in</strong>b<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />
Der pr<strong>in</strong>zipielle Aufbau <strong>de</strong>s Regelungsmo<strong>de</strong>lls soll anhand <strong>de</strong>s Fahrverlaufs beim<br />
..<br />
I<br />
I<br />
vorgegebenen Abweichung erläutert wer<strong>de</strong>n (Abb .<br />
Starteunkt<br />
verdrehen<br />
Wen<strong>de</strong>punkt<br />
drehen<br />
beim emer gegebenen<br />
Nach <strong>de</strong>m Auslösen Programmstart (Startpunkt) wird die<br />
aktuelle Abweichuns Mitte Sollbereiches vom Positionssensor ermittelt.<br />
E<strong>in</strong>beziehung <strong>de</strong>r aktuellen Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit wird anschließend <strong>de</strong>n<br />
Mo<strong>de</strong>llregler die notwendige Drehzeit berechnet. die notwendige
halten, bekannt Mit steigen<strong>de</strong>r Geschw<strong>in</strong>digkeit<br />
Bei °/s bei e<strong>in</strong>er <strong>von</strong> mehr<br />
gegen<br />
Anschlaz gedrückt, Daher durch Steue-<br />
maximal Wert Neben Maxi-<br />
maldrehzeit durch die Verlassen <strong>de</strong>s Sollbereiches e<strong>in</strong>e<br />
0.15 s vorgegeben, Diese Zeit seitlichen<br />
Seche,<br />
Da die e<strong>in</strong>gesetzte SPS-Steuerung über alle notwendigen Rechenfunktionen, zur<br />
<strong>de</strong>U<br />
Bereich<br />
<strong>in</strong><br />
43.6.3 beschriebene Mo-<br />
vere<strong>in</strong>fachte Berechnung unter Verwendung l<strong>in</strong>earer überführt<br />
vere<strong>in</strong>fachte Berechnung diente Funktion<br />
Mo<strong>de</strong>llfunktion zwischen M<strong>in</strong>imal-<br />
In <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Darstellung ist Fahrverlauf <strong>de</strong>r Versuchsmechanik<br />
bei unterschiedlichen<br />
Regelvorgang ausgeglichen, Anschlie-<br />
<strong>de</strong>r vorgegebene Sollbereich restlichen Streckenverlauf<br />
Startpunkt zwei verschie<strong>de</strong>ne Positionen<br />
und <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llregler aktuelle Abweichung<br />
auch<br />
<strong>de</strong>s Regelprozesses betrachtet,<br />
er
Stellmechanik.<br />
direkt<br />
gesetzt,<br />
Für die Fahrversuche<br />
satz. E<strong>in</strong> Fahrverlauf<br />
<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n beim Rezelvorzans<br />
E<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung dieser<br />
vorhan<strong>de</strong>ne <strong>de</strong>r Pflanzenreihe besser<br />
Dies ist bei <strong>de</strong>m entwickelten<br />
schnelleren Steuerung o<strong>de</strong>r durch<br />
Scheibenseche H"'!"UvU,<br />
<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Regelungsemwicklung gewonnenen Ergebnisse<br />
vom Ultraschallsensor aufgezeichnete E<strong>in</strong>gangssignal<br />
chung<br />
enthalten,<br />
Höhenführung anwen<strong>de</strong>n,<br />
die Höhenverstellung<br />
Mocellregler e<strong>in</strong>-<br />
E<strong>in</strong><br />
Mo<strong>de</strong>llstrecke und das<br />
101<br />
Abwei<br />
Abbil-
Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeiten konnte<br />
zu<br />
Problematisch ist <strong>in</strong><br />
kann<br />
Mo<strong>de</strong>llstrecke besser nachgefahren<br />
<strong>de</strong>r<br />
vorausschauend auf e<strong>in</strong>e Verän<strong>de</strong>rung<br />
wer<strong>de</strong>n, Mit steigen<strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit verschiebt<br />
chen<strong>de</strong> Anpassung durchführen, E<strong>in</strong>e<br />
sich e<strong>in</strong>es Stellmotors<br />
wer<strong>de</strong>n kann erreichen.<br />
Pflanzenreihe<br />
I Meter<br />
ten Meßstrecke<br />
Fahrversuchen<br />
autgest eilt und<br />
Als Programmvorgabe für<br />
<strong>de</strong>m Fahrverlauf<br />
Abstand<br />
<strong>de</strong>m Stellrahmen<br />
die Fahrbewegung immer<br />
Mo<strong>de</strong>llstrecke. Um e<strong>in</strong>e fahrgeschw<strong>in</strong>digkeitsunabhängige Re<br />
Sensor entsprechend weit vor<br />
Verbesserung <strong>de</strong>s Regelverhaltens<br />
<strong>Seitenführung</strong><br />
maximale Abweichung<br />
Drehgeschw<strong>in</strong>digkeit variiert<br />
Mo<strong>de</strong>llstrecke<br />
am beweglichen Führungsholm befestigt,<br />
untersuchten Versuchsmechanik<br />
Vorbeifahren an <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstrecke. die e<strong>in</strong>en Bogen<br />
Ultraschallsensor erfaßte E<strong>in</strong>gangssignal<br />
betrug 0.4 m/s.<br />
hatte e<strong>in</strong>e<br />
Die gesam-<br />
die ersten 5 Meter ausgewertet wur<strong>de</strong>n.<br />
e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>facher Proportionalregler ge<br />
<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstrecke<br />
Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit beim Vorbeifahren<br />
mittleren Teildiagramm <strong>de</strong>r Abbil<br />
<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llstrecke
E o<br />
8<br />
6<br />
Fahrverlauf Nachfahren e<strong>in</strong>es mit unterschiedlichen<br />
0,4 V2= 0,6 m/s, V3= 0,8 m/s, V4= 1.0 m/s)<br />
Bei sehr stark zum Überschw<strong>in</strong>gen. da die<br />
Seche nicht<br />
genug zurückgestellt<br />
bei <strong>de</strong>n Untersuchungen zum Proportionalregler<br />
Dieses Verhalten sich bereits<br />
4.3.6.2). Insofern be-<br />
das Reaktionsverhalten Versuchsmechanik <strong>de</strong>n Fahrversuchen zur Hö-<br />
und <strong>Seitenführung</strong>,<br />
wonnenen Ergebnisse.<br />
Regelungsentwicklung ge-
Ergebnisse<br />
5.5 Ökonomische Betrachtung <strong>de</strong>r automatischen Geräreführung<br />
Für die ökonomische E<strong>in</strong>ordnung <strong>de</strong>r <strong>in</strong> Kapitel 4.4.3 beschriebenen Kalkulationsbei<br />
spiele wer<strong>de</strong>n die entstehen<strong>de</strong>n Kosten für die Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n Rei<br />
hen verglichen. Bei diesem Vergleich wer<strong>de</strong>n die 8 Varianten <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llkalkulation<br />
und die unterschiedliche Flächenleistung <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Gerätekomb<strong>in</strong>ationen be<br />
rücksichtigt.<br />
Die jährlichen E<strong>in</strong>satzkosten für die dargestellten Varianten setzen sich aus <strong>de</strong>n fixen<br />
und variablen Kosten <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Geräte, <strong>de</strong>r Größe <strong>de</strong>r zu bearbeiten<strong>de</strong>n Fläche,<br />
<strong>de</strong>n Kosten <strong>de</strong>r für die Bearbeitung notwendigen Arbeitskraftstun<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Trak<br />
torstun<strong>de</strong>n zusammen.<br />
Die fixen und variablen Kosten <strong>de</strong>r Arbeitsgeräte s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Tabelle darge-<br />
stellt 6). Bei <strong>de</strong>n Kosten <strong>de</strong>r Variante automatische Geräteführung wird da<strong>von</strong><br />
ausgegangen, daß die Führungse<strong>in</strong>richtung für bei<strong>de</strong> Geräte e<strong>in</strong>gesetzt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Die zusätzlichen Kosten, die für e<strong>in</strong>e Geräteführung entstehen, wer<strong>de</strong>n zu <strong>de</strong>n Geräte<br />
kosten addiert.<br />
Tab. 6: Fixe und variable (Kv) Kosten <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>gesetzten Geräte zur Unkrautregulierung<br />
zwischen <strong>de</strong>n Reihen<br />
Variante . automatische Heckanbau Frontanbau Geräteträger<br />
Geräte- mit Fe<strong>in</strong>fiihrung<br />
steuerung<br />
K F Bürste [DM] 1788 1456 1120 1120<br />
Ky Bürste (DM/ha] 25 20 20 20<br />
K F Hacke (DM] 1558 1162 826 826<br />
Ky Hacke (DM/ha] 8,60 3,60 3,60 3,60<br />
145
Ergebnisse 147<br />
Betriebsstun<strong>de</strong>nkosten s<strong>in</strong>d beim Pflegeschlepper entschei<strong>de</strong>nd für die anfallen<strong>de</strong>n<br />
Kosten verantwortlich. Die Variante Fe<strong>in</strong>steuerung schnei<strong>de</strong>t, wegen <strong>de</strong>r hohen Ar<br />
beitszeitkosten, die durch die zusätzliche Arbeitskraft entstehen, schlechter als die Va<br />
riante mit automatischer Geräteführung ab.<br />
5.5.2 Kostenkalkulation Mo<strong>de</strong>llbetrieb Il<br />
Der Vorteil e<strong>in</strong>er hohen Flächenleistung e<strong>in</strong>er automatischen Geräteführung wirkt<br />
sich bei <strong>de</strong>n fast doppelt so großen jährlich zu bearbeiten<strong>de</strong>n Flächen <strong>von</strong> Mo<strong>de</strong>llbe<br />
trieb I, gegenüber Mo<strong>de</strong>llbetrieb H, stark aus. In <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Tabelle s<strong>in</strong>d die Ge<br />
samtkosten, die auf <strong>de</strong>m mehr gärtnerisch orientierten Freilandgemüsebaubetrieb<br />
(Mo<strong>de</strong>llbetrieb II) entstehen, aufgeführt (Tab.<br />
Tab. 8: Jährliche Gesamtkosten <strong>von</strong> Betrieb Il für die mechanische<br />
Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n Kulturpflanzenreihen<br />
Betrieb II (10 ha) automatische Heckanbau Frontanbau Geräteträger<br />
Geräte- mit Fe<strong>in</strong>führung<br />
steuerung<br />
Bürste [DM/al 5.523 6.081 6.876 6.092<br />
tHacke [DM/a] 3.476 3.490 3.779 3.301<br />
I Kosten [DM/al 8.999 9.571 10.655 9.393 I<br />
Die Variante Standardtraktor-Frontanbau verursacht auch bei Betrieb Il die höchsten<br />
jährlichen E<strong>in</strong>satzkosten. Die Kosten, die für die Unkrautregulierung beim E<strong>in</strong>satz <strong>de</strong>r<br />
Komb<strong>in</strong>ation Standardtraktor/automatische Führung entstehen, s<strong>in</strong>d auch bei Be<br />
trieb Il im Vergleich am niedrigsten. Die E<strong>in</strong>satzkosten <strong>de</strong>r Varianten Heckan<br />
bau/Fe<strong>in</strong>steuerung und Geräteträger liegen zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Werten.<br />
Die durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz <strong>de</strong>r Reihenhackbürste verursachten Kosten tragen bei Mo<strong>de</strong>ll-<br />
I
Gesamtbetrag <strong>de</strong>r jährlich entstehen<strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satzkosten<br />
Neben <strong>de</strong>r Arbeitsgeschw<strong>in</strong>digkeit s<strong>in</strong>d hierfür die hohen fixen und<br />
Kosten dieses Gerätes verantwortlich.<br />
Kostenvergleich <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Mn<strong>de</strong>llbetriebe<br />
Beim <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n zeigt sich, daß unab-<br />
<strong>von</strong> <strong>de</strong>r Betriebsgröße. Variante mit automatischer Geräteführung die nied-<br />
rigsten jährlichen E<strong>in</strong>satzkosten Die höchsten Kosten entstehen bei bei<strong>de</strong>n<br />
Betrieben beim E<strong>in</strong>satz <strong>de</strong>r Komb<strong>in</strong>ation Standardtraktor/Frontanbau. Bei Betrieb I ist<br />
Variante Standardtraktor/Heckanbau als die Variante Ge-<br />
räteträger, sich dieser <strong>in</strong> umgekehrter Reihenfolge<br />
dar.<br />
Kosten<br />
besser vergleichen<br />
größeren E<strong>in</strong>satzfläche fallen für Betrieb absoluten<br />
Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n Reihen an. Um bei<strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>llbetriebe<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Tabelle daher die E<strong>in</strong>satzkosten<br />
9).
Diskussion und SchlußfOlgerungen 151<br />
" Im letzten Abschnitt erfolgt die <strong>de</strong>r ökonomischen Betrachtung e<strong>in</strong>er<br />
automatischen Es wer<strong>de</strong>n anhand <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>m ange-<br />
wen<strong>de</strong>ten Mo<strong>de</strong>ll die für <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automatischen Gerätefüh-<br />
rung dargestellt. E<strong>in</strong> Schwerpunkt <strong>de</strong>r Darstellung liegt <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>r Mög<br />
lichkeiten und Grenzen <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llkalkulation.<br />
Nach <strong>de</strong>r Diskussion wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Ausblick auf weiterführen<strong>de</strong> Arbeiten <strong>de</strong>r not<br />
wendige Handlungsbedarf, <strong>de</strong>r sich aus <strong>de</strong>n Ergebnissen und Schlußfolgerungen die<br />
ser Arbeit ergibt, aufgezeigt.<br />
6.1 Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
Um e<strong>in</strong>e Vorstellung <strong>de</strong>r Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und Vorgaben für e<strong>in</strong>e automatische<br />
Höhen- und <strong>Seitenführung</strong> zu bekommen, wur<strong>de</strong> exemplarisch zu Beg<strong>in</strong>n <strong>de</strong>r Unter<br />
suchungen e<strong>in</strong>e Auswahl unterschiedlicher Pflanzenreihen und Bo<strong>de</strong>narten analysiert.<br />
Die Ergebnissedieser Analyse daß die erreichbare Qualität <strong>de</strong>r Geräteführung<br />
entschei<strong>de</strong>nd<strong>von</strong> <strong>de</strong>n verfahrenstechnischen Vorarbeiten bee<strong>in</strong>flußt wird.<br />
Bei <strong>de</strong>r <strong>Seitenführung</strong> bestimmt die Streubreite, die beim Anlegen <strong>de</strong>r Pflanzenbe<br />
stän<strong>de</strong> festgelegt wird, später die Effizienz aller weiteren Maßnahmen. Um e<strong>in</strong>e au<br />
tomatische Führung effektiv nutzen zu können, ist es <strong>von</strong> entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung,<br />
die Vorgaben möglichst uniform zu gestalten. Der E<strong>in</strong>satz mo<strong>de</strong>rner Pflanz- und<br />
Saattechnik mit optimal Aggregaten bietet die Voraussetzungen,<br />
mäßige Bestän<strong>de</strong> zu schaffen und dadurch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automatischen Seitenfüh<br />
rung entschei<strong>de</strong>nd zu vere<strong>in</strong>fachen. E<strong>in</strong> zusätzlicher Nebeneffekt <strong>von</strong> exakt<br />
angelegten Reihen ist bei <strong>de</strong>r mechanischen Unkrautregulierung die M<strong>in</strong>imierung <strong>de</strong>r<br />
unbearbeitetenFläche, die sich aus <strong>de</strong>r Breite <strong>de</strong>s e<strong>in</strong>gesetzten Pflanzenschutztunnels
weisen. E<strong>in</strong>e<br />
Probleme, die beim auftreten,<br />
direkt o<strong>de</strong>r <strong>in</strong>direkt <strong>von</strong> <strong>de</strong>n vorgegebenen E<strong>in</strong>satzbed<strong>in</strong>gungen ab. Durch die<br />
sie entstehen, wer<strong>de</strong>n.<br />
dieser Probleme,<br />
unterschiedlicher <strong>de</strong>r relativen Häufigkeit<br />
seitlichen Abweichung aufe<strong>in</strong>an<strong>de</strong>rfolgen<strong>de</strong>r Pflanzen beurteilt. Dabei stellte<br />
heraus, daß Reihen die ger<strong>in</strong>geren auf-<br />
dieser Arbeit<br />
nete Geräteauswahl anzustreben.<br />
unterschiedlicher Saat- o<strong>de</strong>r Pflanzverfahren wur<strong>de</strong> im Rahmen<br />
ist jedoch auch im H<strong>in</strong>blick auf<br />
Soll die Geräteführung universell e<strong>in</strong>gesetzt UHue""ll, auch e<strong>in</strong> Stan<br />
dartanbausystem, das festgelegten anzuwen<strong>de</strong>n. Die<br />
Beschränkung aufe<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum unterschiedlicher Abstän<strong>de</strong> <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Betriebes<br />
o<strong>de</strong>r e<strong>in</strong>es Zusammenschlusses zur auch bei <strong>de</strong>r<br />
Verr<strong>in</strong>gerung und Elim<strong>in</strong>ation unnötiger Rüst- und Umrüstzeiten.<br />
gleiten<strong>de</strong> Mittelwertbildune wur<strong>de</strong> als Metho<strong>de</strong> Generierung e<strong>in</strong>es geeigneten<br />
he mögliche Signalvorgaben berechnet.<br />
nes Pflanzenschutztunnels<br />
auch die Anzahl<br />
Als Vorgaben<br />
flächen und<br />
dieser Metho<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> anhand e<strong>in</strong>er realen Pflanzenrei<br />
Die<br />
<strong>de</strong>n Haupte<strong>in</strong>fluß<br />
sich auch bei <strong>de</strong>r Höhenführung.<br />
die Anzahl <strong>de</strong>r Pflanzen <strong>in</strong>nerhalb ei<br />
Wirkbereiches vorn Arbeitsgerät<br />
automatischen Höhenführung wur<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne Bo<strong>de</strong>nober<br />
exakte<br />
daß e<strong>in</strong>e<br />
Möglichkeiten zur Auto<br />
V oroahen <strong>de</strong>r Bo
Diskussion und SchlußfOlgerungen 153<br />
<strong>de</strong>nbearbeitung und Beetvorbereitung bestimmen wesentlich die Effizienz <strong>de</strong>r auto<br />
matischen Höhenführung.<br />
Problematisch ist <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re beim E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es Meßsystems zur Abstandsmessung.<br />
daß ke<strong>in</strong>e Unterscheidung zwischen Bo<strong>de</strong>n- und Pflanzenoberfläche getroffen<br />
kann. Bei e<strong>in</strong>em dichten Pflanzenbestand ist <strong>de</strong>shalb e<strong>in</strong>e bo<strong>de</strong>norientierte Höhenfüh<br />
rung nicht ohne weiteres möglich. WEISPFENNIG (1993) diesen Umstand<br />
durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es Schleifschuhes, <strong>de</strong>r kle<strong>in</strong>e Bo<strong>de</strong>nunebenheiten und Unkraut<br />
pflanzen unterhalb <strong>de</strong>s Meßpunktes elim<strong>in</strong>iert. Ob eventuell bei <strong>de</strong>m E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er<br />
<strong>de</strong>rartigen mechanischen Vorrichtung ganz auf e<strong>in</strong>e berührungslose Siznater-<br />
verzichtet wer<strong>de</strong>n kann, sollte jedoch wer<strong>de</strong>n.<br />
6.2 Senseruntersuchungen<br />
Aus e<strong>in</strong>er Vielzahl sehr unterschiedlicher Meßsysteme wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Wissens-<br />
stan<strong>de</strong>s die Sensorarten Ultraschall- und Lasertriangulation und näher<br />
analysiert. Die ihrer Eignung für <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er landwirtschaftli-<br />
ehen Umgebung war dieses Teiles <strong>de</strong>r Untersuchungen. Bed<strong>in</strong>gt durch<br />
die stark unterschiedlichen Meßpr<strong>in</strong>zipien lassen sich bei<strong>de</strong> Sensorgruppen nur<br />
schlecht mite<strong>in</strong>an<strong>de</strong>r vergleichen. Im Folgen<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n daher bei<strong>de</strong> Gruppen unab-<br />
<strong>von</strong>e<strong>in</strong>an<strong>de</strong>r diskutiert.<br />
Der Erfassungsbereich <strong>de</strong>r untersuchten Ultraschallsensoren unterschei<strong>de</strong>t sich nicht<br />
nur h<strong>in</strong>sichtlich <strong>de</strong>r Form, son<strong>de</strong>rn auch <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Größe erheblich. Zur Bee<strong>in</strong>flussung<br />
<strong>de</strong>s bieten sich sogenannte akustische L<strong>in</strong>sen 00. Anhand ver<br />
schie<strong>de</strong>ner Schallhörner wur<strong>de</strong> die pr<strong>in</strong>zipielle ihres E<strong>in</strong>satzes <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er land<br />
wirtschaftlichen Umgebung Aufbauend auf diesen Wissensstand wäre
Diskussion und Schlußfolgerungen<br />
zur kont<strong>in</strong>uierlichen Erfassung <strong>von</strong> Halmgutschwa<strong>de</strong>n. Durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er grö<br />
ßeren Sensoranzahl und e<strong>in</strong>e gegenseitige <strong>de</strong>r Meßwerte läßt sich bei-<br />
spielsweise die seitliche Hangneigung o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Verlauf<strong>de</strong>r erfassen.<br />
Die Untersuchungsergebnisse <strong>de</strong>s Lasertriangulationstasters fielen lei<strong>de</strong>r nicht so viel-<br />
schichtig und wie beim Ultraschall aus. Der Sensor<br />
sehen Betrieb beim Abtasten e<strong>in</strong>er Bo<strong>de</strong>noberfläche e<strong>in</strong>e extreme Störanfälligkeit <strong>de</strong>s<br />
aufgezeichneten Meßsignals, Der Vorteil, daß <strong>de</strong>r Sensor e<strong>in</strong> nahezu kont<strong>in</strong>uierliches<br />
bereitstellt, konnte somit nicht im praktischen E<strong>in</strong>satz genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Ergebnisse aus <strong>de</strong>n Untersuchungen zu <strong>de</strong>n Sensoren stellt somit e<strong>in</strong>e gute Basis<br />
dar, um unter E<strong>in</strong>beziehung <strong>de</strong>r gerätetechnischen Voraussetzungen e<strong>in</strong> exaktes Anfor<strong>de</strong>rungsprofil<br />
für die Auswahl e<strong>in</strong>er geeigneten Sensorik aufzustellen.<br />
Nach wie vor bef<strong>in</strong><strong>de</strong>t sich jedoch <strong>de</strong>rzeit ke<strong>in</strong> zur Positionserfassung<br />
<strong>von</strong> Reihen o<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m Markt, das die ganze Bandbreite <strong>de</strong>r gartenbaulichen<br />
und landwirtschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen ab<strong>de</strong>ckt. Die Anstrengungen<br />
verschie<strong>de</strong>ner Forschungse<strong>in</strong>richtungen auf <strong>de</strong>m Sektor <strong>de</strong>r digitalen Bildverarbeitung<br />
lassen jedoch <strong>in</strong> naher Zukunft auch auf e<strong>in</strong> solches universelles System hoffen. Vor<br />
allem aufgrund <strong>de</strong>r noch immer mangeln<strong>de</strong>n Sensorik bleibt die Generierung <strong>de</strong>s<br />
E<strong>in</strong>gangssignals zur <strong>Seitenführung</strong> das Haupth<strong>in</strong><strong>de</strong>rnis für e<strong>in</strong>en universellen<br />
sehen E<strong>in</strong>satz.<br />
6.3 Cerätetechnisehe Überprüfung<br />
Im ersten Teilabschnitt <strong>de</strong>r gerätetechnischen Überprüfung wur<strong>de</strong> das Reaktionsverhalten<br />
<strong>de</strong>r Versuchsmechanik untersucht. In diesem Zusammenhang wur<strong>de</strong>n die Parameter<br />
Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit <strong>de</strong>s Wie<strong>de</strong>rholungsgenauigkeit und Bo-
Diskussion und Schlußfolgerungen 157<br />
immer e<strong>in</strong>e vorhan<strong>de</strong>n. Um diesen E<strong>in</strong>fluß möglichst weit zu<br />
reduzieren sogar teilweise ganz zu elim<strong>in</strong>ieren s<strong>in</strong>d konstante Vorgaben zw<strong>in</strong>-<br />
erfor<strong>de</strong>rlich. Solche Voraussetzungen lassen sich nur durch ei-<br />
ne Anbautechnik unter und <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an-<br />
<strong>de</strong>rgreifen<strong>de</strong>n Verfahrenskette erreichen.<br />
E<strong>in</strong>fache etwa o<strong>de</strong>r 3-Punktregler, die<br />
ten Zeitschritten s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e automatische Geräteführung<br />
nicht gut <strong>de</strong>r<br />
auf <strong>de</strong>r Rahmenparameter wie z.B. <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>stel-<br />
len. Als weiterer Nachteil muß das Reaktionsverhalten<br />
beim E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong> fest vorgegebenen Stellzeiten betrachtet wer<strong>de</strong>n.<br />
Von <strong>de</strong>n e<strong>in</strong>fachen Reglern lieferte <strong>de</strong>r besten Ins-<br />
beson<strong>de</strong>re bei kle<strong>in</strong>en Regelabweichungen wirkt sich ange-<br />
Regelverhalten positiv auf das Reaktionsverhalten e<strong>in</strong> an die<br />
Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit angepaßter Proportionalregler beim fest pro-<br />
granunierten P-Regler e<strong>in</strong> starker Geschw<strong>in</strong>digkeitse<strong>in</strong>fluß auf das Fahrverhalten fest<br />
zustellen ist.<br />
Bei <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong> neuer Ansatz im Bereich <strong>de</strong>r auto-<br />
matischen landwirtschaftlicher Aufbauend auf e<strong>in</strong> Fahr-<br />
rno<strong>de</strong>ll, <strong>in</strong> <strong>de</strong>m das Reaktionsverhalten untersuchten Versuchsmechanik mathe-<br />
matisch beschrieben wird, wur<strong>de</strong> e<strong>in</strong> entwickelt, <strong>de</strong>r <strong>in</strong> Abhängig-<br />
keit <strong>von</strong> <strong>de</strong>r und die vorhan<strong>de</strong>nen Abwei-<br />
ausgleicht, Insbeson<strong>de</strong>re bei ist <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llregler<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren untersuchten <strong>de</strong>utlich die Abweichung mit e<strong>in</strong>er<br />
In zur Höhen-<br />
Höhen- und <strong>de</strong>s fest vorgegebenen<br />
gungsortes <strong>de</strong>s Sensors <strong>de</strong>r Versuchsmechanik<br />
Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit ist, bietet<br />
riables das abhängig<br />
Akteren auslöst,<br />
Da <strong>de</strong>r auf die<br />
E<strong>in</strong>fluß auszugleichen.<br />
an<strong>de</strong>rer Anbr<strong>in</strong>gungsort<br />
<strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
hier Abhilfe 3"""U"".<br />
Auf Durchführung <strong>von</strong> Praxistests <strong>de</strong>r entwickelten Mechanik<br />
ses mußte <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re wegen <strong>de</strong>r mangeln<strong>de</strong>n Sensorik<br />
nicht vorhan<strong>de</strong>nen verzichtet wer<strong>de</strong>n.<br />
6.4<br />
Für die untersuchten Mo<strong>de</strong>llannahmen<br />
Mo<strong>de</strong>llbetriebe zurückgegriffen.<br />
lieh und<br />
auf die<br />
gärtnerisch orientierten Gemüsebaubetrieb.<br />
sehr unterschiedlichen Betriebsgrößen<br />
stehen stellvertretend<br />
Sensoren ke<strong>in</strong>e<br />
Regelprogramm <strong>in</strong>tegriertes va-<br />
WEBER<br />
daß e<strong>in</strong>e automatische Geräteführung im Vp"olpwh<br />
fahren ökonomische Vorteile br<strong>in</strong>gt.<br />
größeren E<strong>in</strong>satzfläche jedoch<br />
Es wird da<strong>von</strong> ausgegangen,<br />
Flächenleistung wie bei<br />
kann. Die E<strong>in</strong>sparung<br />
chen Arbeitskraft be<strong>de</strong>utet hier e<strong>in</strong>en wesentlichen<br />
sich<br />
<strong>de</strong>s Regclkrei-<br />
damit verbun<strong>de</strong>n<br />
herkömmlichen<br />
Mo<strong>de</strong>llbetrieb<br />
kle<strong>in</strong>eren Betrieb aus.<br />
e<strong>in</strong>er automatischen Geräteführung<br />
zusätzlicher Fe<strong>in</strong>steuerung er-<br />
Fe<strong>in</strong>steuerung notwendigen zusätzli
ung beim dieser Varianten. Diese Arbeitskraft steht für <strong>de</strong>n entsprechen<br />
<strong>de</strong>n Zeitraum für an<strong>de</strong>re auf <strong>de</strong>m Betrieb anfallen<strong>de</strong> Arbeiten zur Verfügung. Außer<br />
<strong>de</strong>m wird die <strong>de</strong>s Betriebsleiters <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er Ar<br />
beitskraft erleichtert.<br />
Die Komb<strong>in</strong>ation Standardtraktor-Frontanbau und die Variante liegen<br />
h<strong>in</strong>sichtlich ihrer unter <strong>de</strong>r Variante automatische Bei<br />
<strong>de</strong>m Mo<strong>de</strong>llbetrieb mit <strong>de</strong>r kle<strong>in</strong>eren zu bearbeiten<strong>de</strong>n Fläche wirkt sich die<br />
niedrige dieser Varianten nicht so wie beim größeren<br />
Mo<strong>de</strong>llbetrieb aus. Die aufdie Gesamtkosten höheren Fixkosten <strong>de</strong>r automa-<br />
tischen führen beL'TI kle<strong>in</strong>eren Betrieb zu e<strong>in</strong>er weitgehen<strong>de</strong>n Annäherung<br />
<strong>de</strong>r Kosten für die mechanische Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n Pflanzenreihen.<br />
Die Ergebnisse <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llkalkulation stellen für zwei unterschiedlich<br />
große Betriebe die zu erwarten<strong>de</strong>n Kosten für die Unkrautregulierung zwischen <strong>de</strong>n<br />
für vier unterschiedliche mit zwei<br />
häufig verbreiteten dar. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht realisier-<br />
bar, alle die durch die Variation <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llannahmen für e<strong>in</strong>e Kosten-<br />
kalkulation entstehen, darzustellen. Daher s<strong>in</strong>d die Annahmen eng an das <strong>von</strong> WEBER<br />
(1997) beschriebene Mo<strong>de</strong>ll zur zwischen <strong>de</strong>n Reihen angelehnt.<br />
Bei <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llannahmen wur<strong>de</strong> nicht <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er zusätzlichen Steigerung <strong>de</strong>r<br />
schw<strong>in</strong>digkeit durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automatischen ausgegangen.<br />
Trotz<strong>de</strong>m sich, daß ökonomisch betrachtet die automatische im Ver-<br />
gleich zu <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Varianten, Vorteile Die Erhöhung<br />
ist <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Praxis primär durch die und das schnelle Ermü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
steuern<strong>de</strong>n Arbeitskraft sowie zusätzlich durch das Arbeitspr<strong>in</strong>zip <strong>de</strong>s e<strong>in</strong>gesetzten<br />
Gerätes beschränkt. E<strong>in</strong>e Steigerung <strong>de</strong>r Fahrgeschw<strong>in</strong>digkeit und damit <strong>de</strong>r Flächen<br />
leistung ist aufgrund <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automatischen Geräteführung<br />
geren physischen <strong>de</strong>r Arbeitskräfte anzunehmen. Der ökonomische Vorteil,
sehe 1 UHH"'"<br />
o<strong>de</strong>r Mißerfolg<br />
Dies<br />
te,<br />
E<strong>in</strong>satz<br />
darüber<br />
die vorhan<strong>de</strong>nen Witterungsfenster<br />
noch<br />
trieben beson<strong>de</strong>ren Schwierigkeiten<br />
Rahmen<br />
gulierung zwischen <strong>de</strong>n Kulturpflanzenreihen<br />
ausgegangen. Es<br />
satz e<strong>in</strong>es<br />
gängen<br />
E<strong>in</strong>satz<br />
Kostenkalkulation<br />
automatischen Geräteführung
Diskussion und SChlußfOlgerungjjn. _ 161<br />
Pflanzen wer<strong>de</strong>n. kann e<strong>in</strong> Pflanzenschutztunnel mit ger<strong>in</strong>gerer<br />
TU!lnelbreite e<strong>in</strong>gesetzt wer<strong>de</strong>n, wodurch sich <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r unbearbeiteten Fläche<br />
verr<strong>in</strong>gert. Bei Betrieben, die nach Richtl<strong>in</strong>ien <strong>de</strong>r Anbauverbän<strong>de</strong><br />
muß unbearbeitete Fläche Handarbeit unkrautfrei<br />
wer<strong>de</strong>n. Dies kann erhebliche Kosten verursachen. Die <strong>de</strong>r M<strong>in</strong>imierung<br />
unbearbeiteter Fläche durch <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automatischen kann<br />
diesem Bereich erheblich zur Kostenreduktion Auf e<strong>in</strong>e genaue Spezifizie-<br />
rung bei Handhacke entstehen<strong>de</strong>n Kosten 'wur<strong>de</strong> im Rahmen dieser Arbeit<br />
verzichtet, ke<strong>in</strong>e exakte für die Mo<strong>de</strong>llkalkulation<br />
E<strong>in</strong> weiterer Punkt, <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Kostenkalkulation unberücksichtigt bleibt, ist <strong>de</strong>r Re-<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Geräte. Die Wirksamkeit <strong>de</strong>r Geräte ist<br />
<strong>von</strong> e<strong>in</strong>er Reihe sehr unterschiedlicher E<strong>in</strong>flußfaktoren abhängig. Neben <strong>de</strong>m Klima,<br />
<strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m vorhan<strong>de</strong>nen Unkraut bee<strong>in</strong>flußt die angewen<strong>de</strong>te Geräte- und<br />
Verfahrenstechnik entschei<strong>de</strong>nd. Der <strong>de</strong>r<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Reihenhackbürste und Reihenhacke hängt unter an<strong>de</strong>rem<br />
<strong>von</strong> e<strong>in</strong>er exakten ab und KOUWENHOVEN 1981 und<br />
WEBER 1994). Die automatische dieser Geräte <strong>in</strong> <strong>de</strong>r optimalen Arbeitstiefe<br />
führt zu e<strong>in</strong>er <strong>de</strong>s erreichten Regulierungserfolges bei <strong>de</strong>r Unkrautregulie-<br />
rung. Diese läßt schwer auf die hier durchgeführte Kostenkai-<br />
kulation da <strong>de</strong>r E<strong>in</strong>flußfaktoren ke<strong>in</strong>e exakten An-<br />
nahmen für Mo<strong>de</strong>llkalkulation wer<strong>de</strong>n können.
gen,<br />
wenn<br />
durchgeführten Untersuchungen zu<br />
E<strong>in</strong>satz automatischen Geräteführung<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und Vorsrahen zei<br />
vieles erleichtert wird,<br />
Verfahrenskette auf<br />
abgestimmt<br />
automatischen Geräteführung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne Kultur bzw.<br />
<strong>von</strong> Praxisuntersuchungen,<br />
die gesamte Kulturführung aufgestellt<br />
Im Gegensatz zur Höhenfühnmg steht für die automatische <strong>Seitenführung</strong> ke<strong>in</strong> geeig-<br />
sehr<strong>in</strong>s im<br />
ses Problems zugetraut,<br />
<strong>de</strong>r<br />
bleibt<br />
auch überprüft wer<strong>de</strong>n, ob<br />
im<br />
Verfügung, das als die exakte Position <strong>von</strong><br />
Pflanzenreihen ermitteln kann. <strong>de</strong>s rasanten Fort-<br />
digitaten Bildverarbeitung wird ihr die<br />
Komb<strong>in</strong>ation<br />
Versuchsmechanik<br />
zur Positionserkennung mit<br />
Pflanzen Komponenten im Steuerprogramm<br />
Neben<br />
die Ergebnisse<br />
ist das entwickelte Versuchsgerät<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong>r Komb<strong>in</strong>ation mit angehängten Geräten
Weiterführen<strong>de</strong> Arbeiten 163<br />
Die <strong>de</strong>r Rahmenbed<strong>in</strong>gungen Fahrspurverän<strong>de</strong>rung, und Trak-<br />
torbewegung war nicht Gegenstand <strong>de</strong>r Arbeit. Im E<strong>in</strong>satz<br />
ist jedoch e<strong>in</strong> erheblicher E<strong>in</strong>fluß auch dieser Faktoren auf e<strong>in</strong>e automatische Geräte-<br />
zu erwarten. E<strong>in</strong>e exakte dieser Parameter führt zu e<strong>in</strong>er weiteren<br />
Präzisierung<strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungen an e<strong>in</strong> zur automatischen Geräteführung.<br />
Die Ergebnisse <strong>de</strong>r ökonomischen Betrachtung daß <strong>de</strong>r E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automa<br />
tischen Geräteführung durchaus e<strong>in</strong>en f<strong>in</strong>anziellen Vorteil gegenüber <strong>de</strong>r <strong>de</strong>rzeitigen<br />
Verfahrenstechnik br<strong>in</strong>gt. Die Annahmen und Ergebnisse <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llkalkulation s<strong>in</strong>d<br />
jedoch noch anband <strong>von</strong> Untersuchungen <strong>in</strong> Praxisbetrieben zu untermauern.
eichte<br />
mo<strong>de</strong>rnen Landwirtschaft zur Zeit<br />
durch <strong>de</strong>n Mikroelektronik, die mittlerweile fester Bestandteil zahlreicher<br />
Aggregate und landwirtschaftli-<br />
Masch<strong>in</strong>en wer<strong>de</strong>n komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben durch Elek-<br />
tronike<strong>in</strong>satz erheblich erleichtert auf<br />
<strong>de</strong>m landwirtschaftlichen Sektor zur Effizi-<br />
enzsteigenmg <strong>in</strong> automatische Fahrzeuz- und<br />
Geräteführung ist e<strong>in</strong>e Möglichkeit sowohl Arbeitskräfte entlasten auch die er<br />
Für die<br />
und<br />
wur<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Pflanzenproduktion zu erhalten<br />
zu<br />
<strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Anwendcrs<br />
automatischen Geräteführung müssen die Anfor<strong>de</strong>-<br />
für <strong>de</strong>ren E<strong>in</strong>satz umfassend<br />
Verlauf unterschiedlicher Pflanzenreihen<br />
Geräteentwicklung näher untersucht, Bei <strong>de</strong>n<br />
Untersuchungen zum Reihenverlauf wur<strong>de</strong> zwischen gepflanzten und gesäten Kultu-<br />
ren unterschie<strong>de</strong>n, wobei ten<strong>de</strong>nziell höhere Schwan-<br />
<strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>s wur<strong>de</strong>n. Höhenverlauf unter-<br />
schiedlicher Bo<strong>de</strong>noberflächen wird kle<strong>in</strong>en Oberflächen-<br />
e<strong>in</strong>em <strong>von</strong> ±1 und Im die<br />
<strong>von</strong> e<strong>in</strong>er automatischen Höhenführung ausgeglichen sollen, unterschie<strong>de</strong>n.<br />
tatsächlich<br />
immer<br />
Metho<strong>de</strong> zur für e<strong>in</strong><br />
automatischen Geräteführung vorgestellt. Welches Verfahren<br />
Steuersignalberechnung e<strong>in</strong>gesetzt richtet sich<br />
kulturtechnischen und gerä-<br />
anschließend allgeme<strong>in</strong>e Zusammenhänge sowie Anfor<strong>de</strong>rungen das E<strong>in</strong>-
166 Zusammenfassung<br />
und gartenbauliehen Gemüsebaubetrieb. In <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llbetrachtung wer<strong>de</strong>n zwei<br />
unterschiedliche Geräte vier Anbauformen berücksichtigt. Die Betrachtung be<br />
sich nur auf <strong>de</strong>n E<strong>in</strong>satz im Rahmen <strong>de</strong>r mechanischen Unkrautregulierung. An<br />
E<strong>in</strong>satzfel<strong>de</strong>r, zusätzlich noch für e<strong>in</strong>e automatische Geräteführung er-<br />
könnten, wer<strong>de</strong>n nicht Bei bei<strong>de</strong>n sich. daß<br />
<strong>de</strong>r E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er automatischen unter <strong>de</strong>n getroffenen Mo<strong>de</strong>llannah-<br />
men im zu herkömmlichen Verfahren ökonomische Vorteile
I)<br />
Summary 167<br />
The <strong>in</strong>tensify<strong>in</strong>g and rationalisation of mo<strong>de</strong>rn agriculture is experienc<strong>in</strong>g a<br />
further through the of micro electronics, which has become a<br />
firm part aggregates and systems. control and steer<strong>in</strong>g functions<br />
<strong>in</strong> mach<strong>in</strong>es are ma<strong>de</strong> easier or even controlled by the use of<br />
electronics, The present situation on the agricultural sector is forc<strong>in</strong>g the to<br />
fully exhaust an to efficiency, The use of automated mach<strong>in</strong>es<br />
and vehicles is a way of as well as keep<strong>in</strong>g the required quality <strong>in</strong> the pro-<br />
duction of'plants.<br />
In or<strong>de</strong>r to <strong>de</strong>velop the correct automated equipment, the <strong>de</strong>mands and conditions for<br />
their use must be <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ed, The <strong>in</strong>itial <strong>de</strong>velopment ofthe equipment,<br />
therefore, should be <strong>in</strong>vestigated closely <strong>in</strong> connection with the process of the diffe<br />
rent types and rows. The difference between and see<strong>de</strong>d crops were ex<br />
am<strong>in</strong>ed by the row process, ten<strong>de</strong>ntially higher variations by the pianted cul<br />
tures were observed, Different types of soils were divi<strong>de</strong>d between small differences<br />
ofsurface the of± 1 and greater variations <strong>in</strong> height, which were<br />
to be levelled out from an automated height control, the height process,<br />
A method to <strong>de</strong>term<strong>in</strong>e the average level was used to generate a control signal for an<br />
automated mach<strong>in</strong>e. The method, which is to be used <strong>in</strong> the practice, is always <strong>de</strong>ter<br />
m<strong>in</strong>ed by the users <strong>de</strong>mands, the crops, technical and mach<strong>in</strong>e allowances.<br />
A laser sensor as weil as two different ultrasonic sensors have been tested <strong>in</strong> static and<br />
dynarme studies. Contrary to laser sensors, which <strong>de</strong>liver an almost permanent signal,<br />
the uitrasonic sensors provi<strong>de</strong> <strong>in</strong>termittant test values. This makes a direct com<br />
parison difficult. The laser sensor was so prone to fault <strong>in</strong> the dynamic that it<br />
was not used on a test <strong>de</strong>vice.
168 Summary<br />
The characteristics ofthe test were the of the<br />
control ma<strong>in</strong> factor effects the behaviour of an automated si<strong>de</strong> dri-<br />
ve proves Other parameters, for the type of soi! or its condi-<br />
tion, a role. A mo<strong>de</strong>l was on the basis<br />
control structures. A mathematical drive mo<strong>de</strong>l, which <strong>de</strong>scribes the theore-<br />
tical drive run test <strong>de</strong>vice, used as the for the mo<strong>de</strong>l controller. The<br />
<strong>de</strong>velopment controller is a <strong>in</strong> a test <strong>in</strong>stallation with<br />
both and si<strong>de</strong> trail runs,<br />
The economical exam<strong>in</strong>ation of the of an automated drive <strong>de</strong>vice is<br />
realised with mo<strong>de</strong>l calculation with two different farm sizes. The two mo<strong>de</strong>l farms<br />
represent an and a horticultural farm. Two different mach<strong>in</strong>es<br />
and four different crops were taken <strong>in</strong>to account <strong>in</strong> the mo<strong>de</strong>l trial. The trial co<br />
vers the implementation <strong>in</strong> the automated weed control. Other areas <strong>in</strong> which an au-<br />
tomated controller be were not both of activity,<br />
the implernentation ofan automated <strong>de</strong>vice proved to economical advantages <strong>in</strong><br />
comparison to traditional methods.
1(I Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
AUERNHAMMER, H. 1989: Elektronik <strong>in</strong> Traktoren und Landmasch<strong>in</strong>en. E<strong>in</strong>satzgebiete,<br />
Funktion, Verlagsunion Agrar, München, Wien,<br />
Zürich.<br />
AHRENS, F. 1980: Übertragungsverhalten e<strong>in</strong>er Meße<strong>in</strong>richtung zum Erfassen landwirtschaftlicher<br />
Bearbeitungsgrenzen mit Hilfe <strong>von</strong> Ultraschall,<br />
landtechnische Zeitschrift <strong>de</strong>r DDR 30, Heft 3, 104-106.<br />
AHRENS, F. 1984: Möglichkeiten und Grenzen <strong>de</strong>r akustischen Meßwertgew<strong>in</strong>nung<br />
1h'1 Pflugfurchen zum automatischen Lenken mobiler Aggregate. Agrartechnik,<br />
landtechnische Zeitschrift <strong>de</strong>r DDR 34, Heft 10, 443-446.<br />
BRINKMANN, W., HEEGE, H. und F. TEBRÜGGE 1985: <strong>Tec</strong>hnik und Verfahren <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
Pflanzenproduktion. In: H. EICHHORN (Hrsg.): Landtechnik. Landwirtschaftliches<br />
Lehrbuch 4, 6. Aufl., Ulmer, Stuttgart,<br />
BRUNS, H. und H. GÖHLICH 1987: E<strong>in</strong>satz <strong>von</strong> arbeiten<strong>de</strong>n Sensoren<br />
unter Zuhilfenahme <strong>von</strong> Kle<strong>in</strong>strechnem. Mikroelektronik <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Agrartechnik<br />
<strong>de</strong>n Umweltschutz, DüsseldorfVDI 1987, 125-137.<br />
eHO!, C. H., ERBACH, D. C. und R. J. SMITH 1990: Navigational Tractor Guidance<br />
System. Transäetions of'the ASAE 33, 699-705.<br />
DÖRRSCHEIDT, F. und W. LATZEL 1993: Grundlagen <strong>de</strong>r Regelungstechnik. 2. Aufl.,<br />
Verlag B. G. Teubner, Stuttgart.<br />
DYCK, F. B., Wu, W. K. und R. LESKO 1986: Automatie <strong>de</strong>ph control for cultivators<br />
and air see<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>veloped un<strong>de</strong>r the AERD program. ofthe Mation<br />
1, Conference and exposition 25. - 28.02.1985, Chicago, Ill<strong>in</strong>ois, 265-276.<br />
ESTLER, M. 1998: Verfahrenstechnik <strong>de</strong>s Pflanzenbaues. In: SCHÖN Landtechnik<br />
Bauwesen. Die Landwirtschaft, Reihe 3, 9. Aufl., BLV, München.<br />
FLANAGAN, D. C., HUANG, C., NORTON, L. D. und S. C. PARKER 1995: Laser Scanner<br />
für Erosion Plot Measurements. Transactions ofthe ASAE 38, 703-710.<br />
169
170 Literaturverzeichnis<br />
FÖLUNGER, 1992: Regelungstechnik. E<strong>in</strong>führung<br />
wendung.Y, Hüthig Buch<br />
die Metho<strong>de</strong>n An-<br />
FRlTZ, D. 1989: Gemüsebau. Handbuch <strong>de</strong>s Erwerbsgärtners. Ulrner, Stuttgart.<br />
GAWENDOWlCZ, M. 1980: Zur automatischen Lenkung mobiler landwirtschaftlicher<br />
mit Arbeitsbreiten und<br />
landtechnische Zeitschrift <strong>de</strong>r DDR 30, Heft 3, 101-103.<br />
GEORG, H., BOCKlSCH, FJ. und A. Knete 1992: Automatische Unkrauterkennung.<br />
Landtechnik 47, Heft 3, 113-115.<br />
GRAEBER, E. 1986: Auszug aus 17 82 863: Lenkregele<strong>in</strong>richtung<br />
zum selbsttätigen Führen <strong>von</strong> landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Grundlagen<br />
<strong>de</strong>r Landtechnik 36, Heft 3, 94.<br />
GRIEPENTROG, H.-W. 1992: <strong>von</strong> Längsverteilungen bei E<strong>in</strong>zelkornsämasch<strong>in</strong>en.<br />
Landtechnik 47, Heft 3,123-125.<br />
GUYER, D. E., MILES,G. E. und M. M. SCHREIBER 1984: Computer Vision<br />
Process<strong>in</strong>g for Plant I<strong>de</strong>ntification, No. 84-1632, e>L••IUSl:pl1,<br />
gan.<br />
HEEGE, H., KLÜVER, BEATRIX und H.-H. VOßHENRICH 1993: Ablagegenauigkeit bei<br />
<strong>de</strong>r E<strong>in</strong>zelkornsaat <strong>von</strong> Ackerbohnen. Landtechnik 48, Helft 1 14.<br />
HESSE, H. und CHR. v, ZABELTITZ 1968: <strong>von</strong> optischen und elektrischen<br />
Fühlern für automatische Vere<strong>in</strong>zelungs- und Nachführungssysteme.<br />
Grundlagen <strong>de</strong>r Landtechnik 18, Heft 3, 107-112.<br />
HESSE, H. 1974: An Automatie Controlled Implement Control System für<br />
Plant Rows. Journal ofAgricultural Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g Research 19, 101-109.<br />
HOFFMANN, M. 1994: Sensorgesteuerte Unkrautbekämpfung. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten<br />
und Pflanzenschutz, Son<strong>de</strong>rheft XIV, zur 17. Deutschen<br />
Arbeitsbesprechung zur und 22. - 24. Februar<br />
1994, Hohenheim, Ulmer, 289-294.
J72 Literaturverzeichnis<br />
KTBL - KURATORJUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDW1RTSCHAFT e. V<br />
1986: mittels Ultraschall. KTBL-Presse<strong>in</strong>formation Nr. 1/186.<br />
KTBL - KURATORIUM FÜR TECHNIK u]','!) BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT e. V.<br />
1994: KTBL-Taschenbuch Gartenbau. Daten für die Betriebskalkulation im Gartenbau<br />
4. K'Fßf.-Schriften-Vertrieb im Münster-<br />
KTBL - KURA TORJUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT e. V.<br />
1996: K'lBl-Tascbcnbuch Landwirtschaft. Daten für die Betriebskalkulation <strong>in</strong><br />
Landwirtschaft 18. Aufl., K'Fßl.-Schriften-Vertrieb im Landwirtschaftsverlag,<br />
KTBL - KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT e. V.<br />
1998: Versuchsstation Dethl<strong>in</strong>gen Jahresbericht 1996/97, KTBL.<br />
Darmstadt.<br />
MEYER, J. WEBER 1996: Automatische Führung Hackgeräten. Zeitschrift<br />
für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Son<strong>de</strong>rheft XV, Beiträge zur 18.<br />
Deutschen Arbeitsbesprechung über Fragen <strong>de</strong>r und -bekäm-<br />
Stuttgart-Hohenheim, Ulmer, 417-422<br />
MICHALSKI, B. und BERGER 1984: Füllstandsmessung mittels Laufzeit <strong>von</strong> Ultraschall.<br />
<strong>Tec</strong>hnisches Messen (tm) 51, 306-312.<br />
NOH, K-M. und D.C. ERBACH 1993: Self-tun<strong>in</strong>g Controller for Farm Tractor Guidance.<br />
Transactions ofthe ASAE 1583- I594.<br />
OPPELT, 1954: Kle<strong>in</strong>es Handbuch technischer Regelvorgänge.<br />
We<strong>in</strong>heim / Bergstraße.<br />
Chemie,<br />
A Review of Non-Chemical Weed Control <strong>Tec</strong>hniques. Biological<br />
Agriculture and Horticulture 7, 117-137.<br />
PARUTZ, M. Adaptive ruf<br />
häusern, Gartenbautechnische Informationen, Heft<br />
<strong>Tec</strong>hnik <strong>in</strong> Gartenbau und Landwirtschaft, Hannover,<br />
Gewächs<br />
Institut für
Literaturverzeichnis 173<br />
PAUL, W. und H. SPECKMANN 1983: Überblick über grundsätzliche E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten<br />
<strong>von</strong> Mikroelektronik-Sensoren <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Landwirtschaft. Grundlagen <strong>de</strong>r<br />
Landtechnik 33, Heft 5,153-159.<br />
RADKE, J. K., OTTERBY, M. A, YOUNG, R. A und C. A ONSTAD 1981: A Microprocessor<br />
Automated Rillmeter, Transäetions ofthe ASAE 24,401-404,408.<br />
ROBICHAUD, P. R. und M. MOLNAU 1990: Soil Changes with<br />
an Ultrasonic Profiler. Transactions ofthe ASAE 33, 1851-1858.<br />
SCHLEMMER, H. 1996: <strong>de</strong>r Sensorik. E<strong>in</strong>e Instrumentenkun<strong>de</strong> für Vermessungs<strong>in</strong>genieure.<br />
Verlag Wichmann, Hei<strong>de</strong>lberg,<br />
SCHMIDT, G. 1994: Grundlagen <strong>de</strong>r Regelungstechnik. Analyse und Entwurf l<strong>in</strong>earer<br />
und e<strong>in</strong>facher nichtl<strong>in</strong>earer Regelungen sowie diskreter 2. Aufl.<br />
Spr<strong>in</strong>ger Berl<strong>in</strong>, Hei<strong>de</strong>lberg, New York.<br />
SMlTH, A, SCHAFER, R. L. und R. E. YOUNG 1985: Control Algorithrns for Tractor-Implement<br />
Guidance, Transactions ofthe ASAE 28, 4 I 5-419.<br />
SMITH,L SCHAFER, und A BAILEY 1987: Verification ofTractor Guidance<br />
Algorithmus. Transactions ofthe ASAE 30, 305-310.<br />
TERPSTRA, R. und J. K. KOUWENHOVEN 1981: Inter-row and Intra-row Weed Control<br />
with a Journal ofAgricultural Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g Research 26, 127-134.<br />
TILLETT, N. D. 1991: Automatie Guidance Sensors for Agricultural Field Mach<strong>in</strong>es:<br />
A Review. Journal ofAgricultural Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g Research 50, 167-187.<br />
UHLlG, T. 1987: Berührungsloser Nachweis natürlicher Leitl<strong>in</strong>ien <strong>de</strong>r Pflanzenproduktion<br />
mit Hilfe <strong>von</strong> Ultraschall. Agrartechnik, landtechnische Zeitschrift <strong>de</strong>r<br />
DDR 28, Heft ]2,563-565.<br />
WARNER, M. G. R. und G. O. HARRIES 1972: An Ultrasonic Guidance System for<br />
Driverless Tractors. Journal Engcneer<strong>in</strong>g Research 17,<br />
WEATHERLY, E. T. und C. G. BOWERS JR. 1997: Automatie Depth Control of a Seed<br />
Planter Based on Soil Dry<strong>in</strong>g Front Sens<strong>in</strong>g. Transactions of the ASAE 295-<br />
305.
H. 1994: Unkrautbekämpfung mit Reihenhackbürsten - Bekämpfungserfolg<br />
Bo<strong>de</strong>nschonung? Zeitschrift Pflanzenkrankheiten Pflanzenschutz, Son<strong>de</strong>r<br />
Deutschen Arbeitsbesprechung zur Unkrautbiologie<br />
Stuttgart lIohenheim,<br />
U11d verfahrenstechnische Optimierung <strong>de</strong>r mechanischen<br />
Beetkulturen. Agrartechnik <strong>de</strong>s Arbeits-<br />
Lehre <strong>de</strong>r Agrartechnik im<br />
Dissertation, Institut für Landtechnik. Weihenstephan,<br />
WEISPFENNIG, PETRA 1993: Berührungslose Tiefenführung e<strong>in</strong>er Reihenhackbürste<br />
e<strong>in</strong>em Ultraschallgerät. Institut für Landtechnik. München-<br />
WOEBBECKE, D. M., MEVER, G. E., VON BARGEN, K. und D. A. MORTENSEN 1995:<br />
Features for Weeds Transactions<br />
oftheASAE<br />
nen. Landtechnik 1.<br />
ZUYDAM, P. v und C. SONNEVELD<br />
for Cultivation Implements.<br />
Pflegegeräten und Erntemaschi-<br />
<strong>de</strong>r Automatisierung<br />
Landtechnik 18, Heft 1,21-27.<br />
ofan Automatie Guidance<br />
Engng Res. 59,239-243.
Herstetteraneaben zu Sensor I:<br />
Bezeichnung:<br />
Folienmaterial.<br />
Herstellerangaben zu Sensor<br />
Gehäuse:<br />
Folienmaterial:<br />
kle<strong>in</strong>ste Ubenragungsempf<strong>in</strong>dlichkeit:<br />
7000 Series transducer<br />
elektrostatischer Wandler<br />
Gold<br />
-43.4 dB (bei<br />
0..,+60 oe<br />
environmental<br />
elektrostatischer Wandler<br />
rostfreier<br />
24 Goldfolie<br />
-42 50<br />
-30, ..+60 "C<br />
50 kHz)