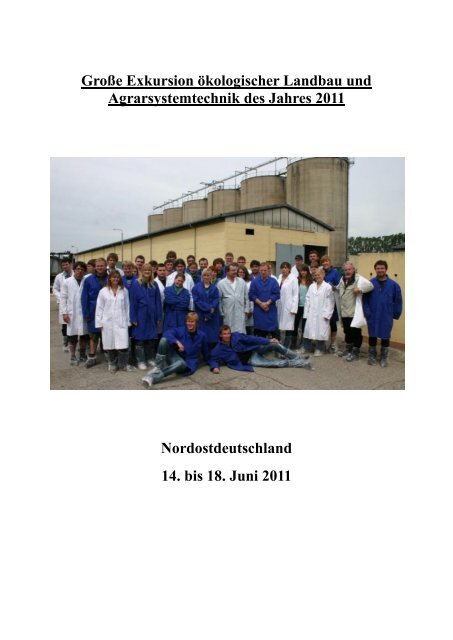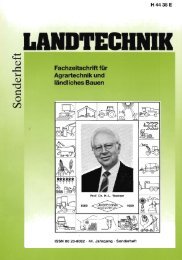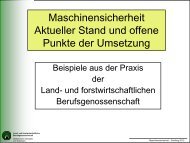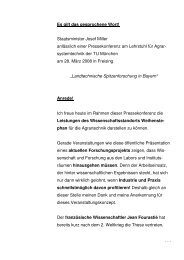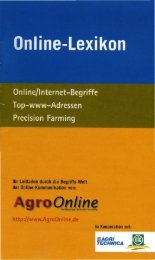Große Exkursion ökologischer Landbau und ... - Tec.wzw.tum.de
Große Exkursion ökologischer Landbau und ... - Tec.wzw.tum.de
Große Exkursion ökologischer Landbau und ... - Tec.wzw.tum.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Große</strong> <strong>Exkursion</strong> <strong>ökologischer</strong> <strong>Landbau</strong> <strong>und</strong><br />
Agrarsystemtechnik <strong>de</strong>s Jahres 2011<br />
Nordost<strong>de</strong>utschland<br />
14. bis 18. Juni 2011
<strong>Große</strong> <strong>Exkursion</strong> <strong>ökologischer</strong> <strong>Landbau</strong> <strong>und</strong><br />
Agrarsystemtechnik <strong>de</strong>s Jahres 2011<br />
Erste Station: Wasserwerk Thallwitz am 14.06.2011<br />
Das Wasserwerk Thallwitz befin<strong>de</strong>t sich zwischen Wurzen <strong>und</strong> Eilenburg in <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>s Mul<strong>de</strong>tales. Mit drei an<strong>de</strong>ren Großwasserwerken för<strong>de</strong>rt es aufbereitetes Wasser zur Behältunteranlage<br />
Leipzig-Probstheida. Gleichzeitig versorgt das Thallwitz Werk die Gemein<strong>de</strong>n<br />
Thallwitz <strong>und</strong> Kollan.<br />
Zur Wassergewinnung <strong>de</strong>s Werkes dienen ca.140 Bohrbrunnen. Die Gewinnung erfolgt durch<br />
Heberprinzip. Das heißt, die Brunnen sind an eine Heberleitung angeschlossen, die durch <strong>de</strong>n<br />
Unterdruck <strong>de</strong>r Vakuumpumpe das Wasser in einen Sammelbrunnen beför<strong>de</strong>rt.<br />
Dann wird das Wasser mit drei Rohwasserpumpen zur Aufbereitungsanlage geför<strong>de</strong>rt. Im ersten<br />
Schritt wird das Wasser verdüst, damit das Wasser eine sehr große Oberfläche besitzt.<br />
Darüber hinaus wird das im Wasser gelöste CO2 freigesetzt <strong>und</strong> O2 wird darin gelöst. Durch<br />
diesen Prozess erhöht sich <strong>de</strong>r PH-Wert.<br />
Danach gelangt das belüftete <strong>und</strong> entsäuerte Wasser zur Enteisung <strong>und</strong> Entmanganisierung.<br />
Dann wird Wasser mit Hilfe von Kiessand in offenen Schnellfiltern filtriert. Nach <strong>de</strong>r Filtration<br />
wird das Wasser als Reinwasser bezeichnet.<br />
Der Durchschnittliche PH-Wert <strong>de</strong>s Reinwassers ist 7,7<strong>und</strong> die durchschnittliche Gesamthärte<br />
ist 10,5. Liang Peng <strong>und</strong> Hao Xia<br />
Besichtigung <strong>de</strong>r Agrargenossenschaft Nischwitz<br />
Am ersten Tag unserer <strong>Exkursion</strong> besichtigten wir die Agrargenossenschaft Nischwitz e.G. in<br />
Tahlwitz. Der Betrieb liegt im Einzugsgebiet <strong>de</strong>r Großwasserwerke Thalwitz, Naunhof <strong>und</strong><br />
Canitz <strong>und</strong> arbeitet daher mit einer gezielt umweltschonen<strong>de</strong>n Bewirtschaftung zum Schutz<br />
<strong>de</strong>r Trinkwasserressourcen. So wird sichergestellt, dass keine Verunreinigungen in das Trinkwasser<br />
gelangen. Die Nitratwerte im Gr<strong>und</strong>wasser konnten dadurch inzwischen erheblich<br />
gesenkt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Agrargenossenschaft Nischwitz bewirtschaftet <strong>de</strong>rzeit 918 ha landwirtschaftliche Nutzfläche,<br />
wovon 98 ha Grünland sind. Fast die gesamte Fläche liegt im Wasserschutzgebiet, weswegen<br />
auf circa 10 % <strong>de</strong>s Ertrags verzichtet wer<strong>de</strong>n muss, um <strong>de</strong>n Trinkwasserschutz zu gewähren.<br />
Die Hauptbetriebszweige <strong>de</strong>r Agrargenossenschaft sind Milchproduktion <strong>und</strong><br />
Schweinemast. Zum Betrieb gehören u. a. 410 Milchkühe mit Nachzucht <strong>und</strong> Mastschweine.<br />
Die Genossenschaft baut hauptsächlich Getrei<strong>de</strong> an (Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen<br />
<strong>und</strong> Triticale), aber auch Hackfrüchte (Zuckerrübe <strong>und</strong> Silomais) <strong>und</strong> Ölfrüchte (Winterraps).<br />
Das meiste wird als Kraftfutter für die Rin<strong>de</strong>r <strong>und</strong> Schweine <strong>de</strong>s Betriebes genutzt, ein<br />
Teil wird aber auch verkauft.<br />
Der Betrieb verfügt über einen 2008 neu angeschafften 2×12 er Fischgrätenmelkstand mit<br />
Schnellaustrieb, Platzspülung <strong>und</strong> höhenverstellbaren Melkstandbo<strong>de</strong>n. Die Melkzeiten sind<br />
von 4:30 – 8:00 Uhr <strong>und</strong> von 15:30 – 20:00; hierfür wer<strong>de</strong>n immer 2 Melker eingesetzt, die<br />
vier Tage arbeiten <strong>und</strong> danach zwei Tage frei haben. Gelagert wird die Milch in zwei Tanks,<br />
die 8 000 <strong>und</strong> 5 000 Liter fassen.<br />
Die Kälber sind in Einzel- <strong>und</strong> Gruppeniglus untergebracht <strong>und</strong> wer<strong>de</strong>n zweimal am Tag, um
halb sechs <strong>und</strong> um ein Uhr, getränkt. Für diese Arbeit sind zwei Mitarbeiter <strong>de</strong>r Genossenschaft<br />
zuständig. Nach 14 Tagen wer<strong>de</strong>n die männlichen Kälber verkauft, die weiblichen verbleiben<br />
alle im eigenen Betrieb <strong>und</strong> wer<strong>de</strong>n nach 8 Wochen abgesetzt.<br />
Von 2004 bis 2006 wur<strong>de</strong>n zwei alte Michviehställe zu Offenfrontställen umgebaut <strong>und</strong> sind<br />
nun mit Hochliegeboxen ausgestattet. Lichtbän<strong>de</strong>r, transparente Dachplatten <strong>und</strong> Lichtkuppelfirste<br />
sorgen für eine große Lichteintrittsfläche. Eingestreut wird einmal täglich mit Stroh,<br />
zweimal am Tag wird gemistet.<br />
Die Milchkühe sind in 3 Leistungsgruppen unterteilt. Außer<strong>de</strong>m experimentiert die Genossenschaft<br />
mit einer Dreirassenkreuzung: hier sollen Holsteiner eine hohe Milchleistung bringen,<br />
Schwe<strong>de</strong>n das Euter sowie eine niedrige Zellzahl <strong>und</strong> die Rasse Montbéliar<strong>de</strong> ein gutes F<strong>und</strong>ament.<br />
Betriebsbesichtigung Wassergut Canitz<br />
Allgemeines<br />
Am Dienstag, <strong>de</strong>n 14.06.2011, um 16.00 Uhr besichtigten wir das Wassergut Canitz. Der<br />
1994 gegrün<strong>de</strong>te Betrieb verfügt über 622 ha Ackerland <strong>und</strong> 120 ha Grünland. Die Flächen<br />
sind vom Wasserwerk gepachtet <strong>und</strong> wer<strong>de</strong>n ökologisch bewirtschaftet. Die mittlere<br />
Schlaggröße <strong>de</strong>s Betriebs liegt bei r<strong>und</strong> 11 ha. Da das Wassergut im Trinkwassereinzugsgebiet<br />
<strong>de</strong>s Wasserwerks Canitz liegt, gelten für die Bewirtschaftung beson<strong>de</strong>re Vorschriften. Um<br />
beispielsweise die Nitratbelastung <strong>de</strong>s Trinkwassers möglichst gering zu halten, darf <strong>de</strong>r jährliche<br />
N-Saldo 20 kg/ha nicht überschreiten. Normalerweise darf er durchschnittlich 60 kg/ha<br />
<strong>und</strong> Jahr betragen. Eine weitere Erschwernis <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen Produktion ist die Trockenheit<br />
in diesem Gebiet, welche im Jahr 2011 beson<strong>de</strong>rs stark ausfällt. So fielen seit Januar<br />
2011 weniger als 100mm Nie<strong>de</strong>rschlag, was zu enormen Ertragseinbußen v.a. beim Getrei<strong>de</strong><br />
führen wird. Die Möglichkeit zur Beregnung (280 ha) stellt somit ein wichtiges Instrument<br />
zur Ertragssicherung dar. Beregnet wird mit Rohwasser aus <strong>de</strong>m Wasserwerk.<br />
Produktion<br />
Der Betriebsleiter, <strong>de</strong>r bereits bei seinem Studium in Halle Erfahrungen im Ökolandbau sammeln<br />
konnte, legt großen Wert auf eine breite Produktpalette, um Schwankungen bei Ertrag<br />
<strong>und</strong> Verkaufspreis ausgleichen zu können. So wer<strong>de</strong>n neben Getrei<strong>de</strong> (Winterweizen, Triticale,<br />
Dinkel <strong>und</strong> Braugerste), Kartoffeln <strong>und</strong> Zuckerrüben auch Son<strong>de</strong>rkulturen wie Seezwiebeln<br />
<strong>und</strong> Buschbohnen angebaut. Auf ca. 40% <strong>de</strong>r Ackerfläche wird Luzerne als Zwischenfrucht<br />
angebaut. Diese wird 3 mal jährlich gemäht <strong>und</strong> sauber abgefahren, um das Aufkommen<br />
von Unkräutern zu vermei<strong>de</strong>n. Dadurch kann anschließend 2 Jahre lang ohne eine große<br />
Verunkrautung Getrei<strong>de</strong> angebaut wer<strong>de</strong>n. Die Luzerne dient z.T. als Futter für die eigene<br />
Mutterkuhher<strong>de</strong> (90 Tiere), <strong>de</strong>r Rest wird an umliegen<strong>de</strong> Betriebe verkauft.<br />
Die Seezwiebeln wer<strong>de</strong>n auf r<strong>und</strong> 16 ha angebaut. Die Unkrautbekämpfung erfolgt 1-2 Mal<br />
durch hacken mit einer mechanischen Hacke <strong>und</strong> durch zupfen. Das Zupfen übernimmt eine<br />
Gruppe polnischer Frauen, die je<strong>de</strong>s Jahr zum Betrieb kommen <strong>und</strong> selbständig die Fel<strong>de</strong>r<br />
pflegen. Die Ernte erfolgt mit einer Art Mulcher. Die Zwiebeln wer<strong>de</strong>n gero<strong>de</strong>t <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Mitte abgelegt <strong>und</strong> müssen dann abtrocknen, bevor sie aufgesammelt wer<strong>de</strong>n. Während <strong>de</strong>m<br />
Abtrocknen wer<strong>de</strong>n die Fel<strong>de</strong>r eingezäunt <strong>und</strong> ein Graben gepflügt, um Diebstahl zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
Die Vermarktung <strong>de</strong>r r<strong>und</strong> 20 ha Kartoffeln erfolgt im Raum Leipzig. Der Betrieb wirbt v.a.<br />
mit Qualität <strong>und</strong> Geschmack, weniger mit <strong>de</strong>m ökologischen Anbau. Um bei <strong>de</strong>n Kartoffeln<br />
Schädlinge zu vermei<strong>de</strong>n, wird <strong>de</strong>r Erntetermin auf Anfang bis spätestens Mitte August ange-
setzt. Zu diesem Zeitpunkt hat z.B. <strong>de</strong>r Kartoffelkäfer erst sehr geringen Scha<strong>de</strong>n angerichtet.<br />
Der Ertrag bei <strong>de</strong>n Frühkartoffeln (Sorten „Princess“ <strong>und</strong> „Ballerina“) beträgt ca. 500 dt/ha.<br />
Maschinen<br />
Der Maschinenbestand <strong>de</strong>s Betriebes setzt sich aus 9 Traktoren zwischen 45 <strong>und</strong> 180 PS, Bo<strong>de</strong>nbearbeitungsgeräte,<br />
Sätechnik <strong>und</strong> einige Spezialmaschinen wie z.B. Gurkenflieger zur<br />
manuellen Unkrautbekämpfung. Sie sind insgesamt in einem guten Zustand. Der Betrieb besitzt<br />
keinerlei eigene Erntetechnik, wodurch <strong>de</strong>r Maschinenbestand insgesamt relativ klein<br />
ausfällt.<br />
Getrei<strong>de</strong>lager<br />
Das Wassergut Canitz verfügt außer<strong>de</strong>m über ein eigenes Getrei<strong>de</strong>lager zur Lagerung von<br />
Speise- <strong>und</strong> Saatgetrei<strong>de</strong>. Dieses wur<strong>de</strong> noch zu DM-Zeiten für 1 Mio. DM gebaut <strong>und</strong> hat<br />
eine Lagerkapazität von 1000t Getrei<strong>de</strong>. Der Bau war unter <strong>de</strong>r Voraussetzung, dass einige<br />
Jahre Getrei<strong>de</strong> für an<strong>de</strong>re Ökobetriebe aufbereitet wur<strong>de</strong>, vom Staat subventioniert wor<strong>de</strong>n.<br />
Mittlerweile wird aber nur noch eigenes Getrei<strong>de</strong> gelagert <strong>und</strong> aufbereitet.<br />
Zur Ernte wird das Getrei<strong>de</strong> angeliefert <strong>und</strong> läuft durch die Reinigung ins Lager. Sollte die<br />
Temperatur im Getrei<strong>de</strong> zu hoch wer<strong>de</strong>n, kann das Getrei<strong>de</strong> belüftet wer<strong>de</strong>n. Außer<strong>de</strong>m ist ein<br />
Saatgutbereiter vorhan<strong>de</strong>n, mit welchem das Getrei<strong>de</strong> zu Saatgetrei<strong>de</strong> aufgewertet wer<strong>de</strong>n<br />
kann.<br />
Stadtr<strong>und</strong>fahrt <strong>und</strong> R<strong>und</strong>gang durch Leipzig<br />
An unserem ersten <strong>Exkursion</strong>stag besuchten wir gegen Abend<br />
die Stadt Leipzig. Nach<strong>de</strong>m wir unser Hotel bezogen hatten,<br />
begann unsere Stadtr<strong>und</strong>fahrt mit <strong>de</strong>m Bus.<br />
Leipzig ist eine <strong>de</strong>r flächengrößten Städte Deutschlands. Um<br />
1165 wur<strong>de</strong> ihr das Stadtrecht <strong>und</strong> Marktprivilegien verliehen<br />
<strong>und</strong> erreichte vor <strong>de</strong>m zweiten Weltkrieg das Einwohnermaximum<br />
von mehr als 700.000 Einwohnern. Heute aber leben dort<br />
gut eine halbe Million Menschen.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>r R<strong>und</strong>fahrt passierten wir zuerst <strong>de</strong>n Leipziger<br />
Hauptbahnhof - <strong>de</strong>r größte Kopfbahnhof Europas. Anschließend sahen wir <strong>de</strong>n Leipziger Zoo,<br />
<strong>de</strong>r seit über 130 Jahre besteht <strong>und</strong> bekannt für seine Löwenzucht ist. Nach<strong>de</strong>m wir u.a. an <strong>de</strong>r<br />
Michaeliskirche, <strong>de</strong>m Nobelviertel Gohlis – zu DDR-Zeiten von sowjetischen Offizieren bewohnt<br />
- <strong>und</strong> durch <strong>de</strong>n Auenwald fuhren, schauten wir kurz am Fußballstadion von Leipzig<br />
vorbei. Außer<strong>de</strong>m fuhr uns <strong>de</strong>r Bus durch die Karl-Liebknecht-Straße, diese ist Die Kneipenmeile<br />
<strong>de</strong>r Stadt <strong>und</strong> bekannt für ihre vielen internationalen Bars <strong>und</strong> Restaurants.<br />
Darauf folgend machten wir eine kurze Pause<br />
am Völkerschlacht<strong>de</strong>nkmal, <strong>de</strong>m größten<br />
Denkmal Europas. Es wur<strong>de</strong> in Erinnerung an<br />
die Völkerschlacht bei Leipzig gebaut <strong>und</strong><br />
1913 eingeweiht. Vom 16. bis 19. Oktober<br />
1813 fand vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt Leipzig die<br />
sog. Völkerschlacht statt: sie führte im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r Befreiungskriege zu einer Nie<strong>de</strong>rlage<br />
Napoleons gegen die Truppen <strong>de</strong>r Österreicher,<br />
Preußen, Russen <strong>und</strong> Schwe<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r<br />
Schlacht, die bis zum Ersten Weltkrieg als die<br />
größte <strong>de</strong>r Geschichte galt, mussten Deutsche
auf bei<strong>de</strong>n Seiten mitkämpfen. Im Anschluss ging es mit <strong>de</strong>m Bus<br />
weiter <strong>und</strong> wir sahen u.a. das Buchviertel, in <strong>de</strong>m viele Buchverlage<br />
ansässig sind, <strong>de</strong>n botanischen Garten <strong>und</strong> die Leipziger<br />
Messe. Dort fand die erste Mustermesse Deutschlands statt <strong>und</strong><br />
hat sich bis heute zu einer <strong>de</strong>r größten Messen Deutschlands entwickelt.<br />
Schließlich ging unsere Stadtr<strong>und</strong>fahrt zu Fuß weiter. Unter an<strong>de</strong>rem<br />
kamen wir am Rathaus <strong>und</strong> am Auerbachs Keller vorbei, <strong>de</strong>r<br />
als Schauplatz eines Kapitels von Goethes „Faust“ einen hohen<br />
Bekanntheitsgrad erlangt hat. Zuletzt besichtigten wir die Nikolaikirche<br />
in <strong>de</strong>r ab ca. 1980 die Montagsgebete gegen das DDR-<br />
Regime stattfan<strong>de</strong>n, aus <strong>de</strong>nen sich die Montags<strong>de</strong>monstrationen<br />
hervorgingen, die einen großen Beitrag zur Auflösung <strong>de</strong>r DDR<br />
leisteten.<br />
Ewiger Roggenanbau 15.06.2011<br />
Am nächsten Morgen fuhren wir weiter zu <strong>de</strong>m nach seinem Begrün<strong>de</strong>r benannten Julius-<br />
Kühn-Feld am östlichen Rand von Halle (Sachsen-Anhalt). Dieses dient als Lehr- <strong>und</strong> Versuchsstation<br />
<strong>de</strong>s Institutes für Agrar- <strong>und</strong> Ernährungswissenschaften <strong>de</strong>r Martin-Luther-<br />
Universität Halle-Wittenberg.<br />
Dort befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Versuch „ewiger Roggen“, 1878 von Julius Kühn gegrün<strong>de</strong>t. Hier wird<br />
auf 6000m² Roggen in Monokultur angebaut. Er ist damit Weltweit <strong>de</strong>r zweitälteste Dauerdüngungsversuch.<br />
Seit 2007 steht er unter Denkmalschutz, <strong>und</strong> wird nur aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
noch fortgeführt. Ansonsten wäre er längst aus wirtschaftlichen Grün<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Forschungsvorhaben<br />
zum Opfer gefallen. Der Bo<strong>de</strong>ntyp ist eine lessivierte Schwarzer<strong>de</strong> bis Griser<strong>de</strong><br />
(Parabrauner<strong>de</strong>-Tschernosem) aus Sandlöss (48-75% S). Der Jahresnie<strong>de</strong>rschlag beträgt<br />
im Mittel 494mm, die Jahresdurchschnittstemperatur 9,2°C.<br />
Im Versuch sollen <strong>de</strong>r Langzeiteffekt unterschiedlicher mineralischer <strong>und</strong> organischer Düngung<br />
auf Ertrag <strong>und</strong> Bo<strong>de</strong>n geprüft wer<strong>de</strong>n. Durch <strong>de</strong>n kontinuierlichen Anbau wird auch <strong>de</strong>r<br />
Einfluss <strong>de</strong>r Witterung, speziell <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rschlags, sichtbar.<br />
Es wer<strong>de</strong>n 6 Düngevarianten untersucht:<br />
- Stallmistdüngung (8t/ha), seit 1952 ungedüngt<br />
- Ungedüngt<br />
- Ausschließlich N-Düngung (40 kg N/ha), 1990 durch Stallmist + NPK ersetzt (120kg<br />
N/ha)<br />
- NPK (40kg N/ha, 24kg P/ha, 75 kg K/ha)<br />
- PK (24kg P/ha, 75 kg K/ha)<br />
- Stallmist (12t/ha = 60kg N)<br />
1961 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Versuch von Karl Schmalfuß,<br />
einem renommierten Professor für Pflanzenernährung,<br />
dreigeteilt. Das Schachtelhalmfreie Drittel<br />
wur<strong>de</strong> mit Roggenmonokultur fortgesetzt, ein<br />
Drittel mit Kartoffel-Roggen-Fruchtwechsel <strong>und</strong><br />
ein Drittel mit Mais-Monokultur. Ein Gr<strong>und</strong> dafür<br />
war ein auftreten<strong>de</strong>s Problem mit Ackerschachtelhalm.<br />
Ein weiterer Gr<strong>und</strong> war dass man die Einstellung<br />
<strong>de</strong>r Humusgehalte auf solche Gegebenheiten<br />
mit an<strong>de</strong>ren Ernterückstän<strong>de</strong>n verfolgen<br />
Stallmistparzelle im Versuch Ewiger Roggen
konnte. Die Düngung blieb unverän<strong>de</strong>rt. Man konnte erkennen, dass die gedüngten Varianten<br />
erheblich besser aussahen als die ungedüngten. Noch <strong>de</strong>utlicher war <strong>de</strong>r Effekt <strong>de</strong>s Fruchtwechsels<br />
Kartoffel – Roggen. Es war <strong>de</strong>utlich zu erkennen, dass ein Fruchtwechsel wichtiger<br />
ist als eine höhere Düngung. Die Varianten mit Fruchtwechsel waren <strong>de</strong>utlich besser als die<br />
Roggenmonokultur.<br />
Eines <strong>de</strong>r wichtigsten Ergebnisse <strong>de</strong>s Versuchs war, dass <strong>de</strong>r Nährstoffbedarf <strong>de</strong>r Pflanzen auf<br />
Dauer ohne Ertragseinbußen durch Mineraldüngung ge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n kann. Man kann aber<br />
auch erkennen, dass auf Dauer eine Stallmistdüngung einer Mineraldüngung gleichwertig ist.<br />
Parzellen mit ‚Ewigem Mais‘<br />
Betriebsbesichtigung Landgut Krosigk GmbH<br />
<strong>Exkursion</strong>sbericht: Patricia Braun, Peter Wilhelm , Maria Rimpfl<br />
Der Betriebsleiter Björn Küstermann stellt <strong>de</strong>n Betrieb vor.<br />
Betriebsschwerpunkte sind <strong>de</strong>r auf ca. 3000 Hektar betriebene Ackerbau, <strong>de</strong>r 95% <strong>de</strong>s Umsatzes<br />
bestreitet, die auf 300 Hektar Grünland betriebene Schafhaltung, mit drei Schafher<strong>de</strong>n a<br />
500 Tieren <strong>und</strong> die Pensionspfer<strong>de</strong>haltung mit ca. 40 Boxen, einer dazugehörigen Reithalle,<br />
einem Dressur- <strong>und</strong> Springplatz <strong>und</strong> <strong>de</strong>r seit 2010 neugegrün<strong>de</strong>ten Reitschule. 270 Hektar<br />
sind Betriebseigen<strong>tum</strong>, <strong>de</strong>r Rest ist gepachtet. Der Betrieb beschäftigt 15 feste Mitarbeiter <strong>und</strong><br />
3 Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, plus 1 -2 Aushilfen zur Erntezeit.<br />
Die Betriebsgemeinschaft selbst setzt sich aus <strong>de</strong>n vier Betrieben Landgut Krosigk GmbH,<br />
<strong>de</strong>m Gut Krosigk, <strong>de</strong>r Ackerbau u. Landschaftsschutz GmbH <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Gut Ostrau zusammen.<br />
1991 bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>stock <strong>de</strong>r Betriebsgemeinschaft Krosigk die ehemalige LPG Plötz.<br />
1994 wird die bis dahin betriebene Legehennenhaltung aufgegeben. 1997 erfolgt dann die<br />
Ausgründung <strong>de</strong>s Gutes Krosigk. 2003 kommt <strong>de</strong>r Bewirtschaftungsvertrag mit <strong>de</strong>m Gut Ostrau<br />
hinzu. Im gleichen Jahr entsteht <strong>de</strong>r Pensionspfer<strong>de</strong>stall. Durch die Übernahme <strong>de</strong>r<br />
Ackerbau- <strong>und</strong> Landschaftsschutz GmbH 2005 vergrößert sich die Betriebsgemeinschaft.
2005 wird die Milchviehhaltung aufgegeben <strong>und</strong> 2006 <strong>de</strong>r Bauplan einer 500 KW Biogasanlage<br />
in die Wege geleitet. Um die Schafhaltung zu intensivieren wer<strong>de</strong>n die Rin<strong>de</strong>rställe<br />
umgebaut. Die Betriebsgemeinschaft ist zertifiziert nach BQM Drusch/ Hackfrucht, QS<br />
Ackerbau <strong>und</strong> Nachhaltigkeit Oecefox GmbH. Um die Getrei<strong>de</strong>lagerung für 6000 to zu ermöglichen<br />
wird 2009 neu gebaut.<br />
Standortbedingungen:<br />
Schläge: 235, Ackerbau: 153, Bö<strong>de</strong>n: sL bis L, kiesunterlagerte (ab 40cm) Schwarzer<strong>de</strong>n,<br />
Braunschwarzer<strong>de</strong>n, Parabrauner<strong>de</strong>n<br />
Die mittleren Schlaggrößen reichen von ca. 19ha bis 9 ha. Die Betriebsgemeinschaft hat eine<br />
Flächenaus<strong>de</strong>hnung von Nord nach Süd über 25 km, von West nach Ost über 15 km mit einem<br />
Radius von 10km.<br />
Die Anbaustruktur folgt einer festen Fruchtfolge mit Raps/Winterweizen/W/S-Gerste <strong>und</strong><br />
Zuckerrüben/Durum/Winterweizen.<br />
Als Betriebsfazit <strong>und</strong> Zukunftsaussicht fasste Herr Küstermann für uns zusammen, dass sich<br />
die Betriebsgemeinschaft Krosigk weiter auf <strong>de</strong>n Ackerbau konzentrieren wolle (70-80dt/ha).<br />
Das Betriebsziel sind nachhaltig hohe Erträge bei angepasster Intensität. N-Sensortechnik <strong>und</strong><br />
Mapping beim Flächenmanagement sollen genauso zur Optimierung <strong>de</strong>r Produktion beitragen<br />
wie ein angestrebtes Flächenwachs<strong>tum</strong>. Letzteres allerdings nicht um je<strong>de</strong>n Pacht-Preis.<br />
Außer<strong>de</strong>m sollen die Schaf- <strong>und</strong> Pfer<strong>de</strong>haltung weiter ausgebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
Fahrt nach Tangermün<strong>de</strong> mit Übernachtung <strong>und</strong> Stadtr<strong>und</strong>gang<br />
Josephine Freese <strong>und</strong> Martin Hanauer<br />
Am Mittwoch trafen wir gegen 18.00 Uhr in Tangermün<strong>de</strong> ein. Der erste Eindruck von diesem<br />
beschaulichen Städtchen im Nor<strong>de</strong>n Sachsen- Anhalts war zugegebenermaßen eher mäßig.<br />
Die Straßen in dieser Altmarkgegend wirkten nicht gera<strong>de</strong> liebevoll gestaltet <strong>und</strong> dazu<br />
ziemlich verlassen.<br />
Nach <strong>de</strong>m schicken Hotel in Leipzig war unsere Unterkunft hier <strong>de</strong>utlich einfacher gehalten,<br />
erfüllte aber genauso ihren Zweck. Auch das Frühstück am nächsten Tag ließ keine hungrigen<br />
Mäuler zurück.<br />
Nach <strong>de</strong>m wir die Info erhielten, dass es keine Stadtführung gibt, machten wir uns in kleineren<br />
Grüppchen auf eigene Faust auf <strong>de</strong>n Weg. Ein guter Anlaufpunkt ist immer die Kirche,<br />
also steuerten wir in diese Richtung los. Und schon bald konnten wir unseren ersten Eindruck<br />
von Tangermün<strong>de</strong> korrigieren; das Städtchen im Landkreis Stendal entpuppte sich als Ort mit<br />
toller Altstadt entlang <strong>de</strong>s linken Elbufers. Der Name rührt übrigens daher, dass hier <strong>de</strong>r Tanger<br />
in die Elbe mün<strong>de</strong>t.<br />
Urige, schiefe Fachwerkhäuschen wechselten mit schicken Backsteinbauten <strong>und</strong> begleiteten<br />
uns auf unserem abendlichen Stadtbummel durch die historische Altstadt. Nach einem gemütlichen<br />
Aben<strong>de</strong>ssen machte wir uns langsam auf <strong>de</strong>n Weg gen Hotel <strong>und</strong> flanierten bei dieser<br />
Gelegenheit an <strong>de</strong>r massiven Stadtbefestigung zwischen Stadt <strong>und</strong> Fluss entlang. Den Abschluss<br />
bil<strong>de</strong>te ein Feierabendbier auf einer gemütlichen Dachterrasse mit Elbblick.
Betriebsbesichtigung Agrar GmbH „Kalbischer Wer<strong>de</strong>r“ Jeetze 16.06.2011<br />
Aus einer ehemaligen LPG entwickelte sich nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> 1989 eine GmbH, <strong>de</strong>ren Standort<br />
im Land Sachsen-Anhalt, Raum Altmarkkreis Salzwe<strong>de</strong>l liegt. Im allgemeinen Produktionsbetrieb<br />
wer<strong>de</strong>n 30 Angestellte beschäftigt, davon 21 in <strong>de</strong>r Milchproduktion <strong>und</strong> 9 im Pflanzenbau.<br />
Der Betrieb verfügt über 1170 ha Landwirtschaftlicher<br />
Nutzfläche, dass sich in 810 ha<br />
Ackerland <strong>und</strong> 360 ha Grünland aufteilt.<br />
Ebenso steht <strong>de</strong>m Betrieb eine 500 kW Biogasanlage<br />
zur Verfügung, die zu 90 % mit<br />
Gülle gefahren wird. Die Abwärme wird<br />
kaum genutzt, ausgenommen <strong>de</strong>r Warmwasserversorgung<br />
<strong>de</strong>r Wirtschaftsräume. Alle 3<br />
Tage wird 5 bis 6 t Gärrest als organischer<br />
Dünger auf die landwirtschaftliche Fläche<br />
ausgebracht.<br />
DeLaval 22er Innenmelkkarussell<br />
Die zu liefern<strong>de</strong> Quote beträgt r<strong>und</strong> 8 Millionen Kilogramm Milch bei einem Viehbesatz von<br />
870 Holstein Frisian Milchkühen <strong>und</strong> einer jährlichen Milchleistung von 10.500 kg Milch pro<br />
Kuh. Der Laktationsdurchschnitt pro Kuh beträgt 3,7 <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Betrieb brachte als Erster eine<br />
100.000 Literkuh in Sachsen-Anhalt hervor. Es kommt ebenso häufiger vor, dass eine Kuh auf<br />
bis zu 12 Abkalbungen kommt. Diese Fakten sind teilweise verw<strong>und</strong>erlich, da <strong>de</strong>r Stall in<br />
Ausstattung <strong>und</strong> Abmessungen nicht <strong>de</strong>n heutigen Richtlinien entspricht. Gemolken wird in<br />
zwei 22er Innen-Melkkarussellen <strong>de</strong>r Firma DeLaval. Diese verfügen über eine automatische
Anrüstung <strong>und</strong> Melkabnahme, die Karusselllaufzeit wird automatisch je nach Melkdauer <strong>de</strong>r<br />
am längsten zu melken<strong>de</strong>n Kuh eingestellt. Weiterhin wer<strong>de</strong>n die Zellzahlen per PC erfasst<br />
<strong>und</strong> bei Überschreitung <strong>de</strong>m Melker angezeigt. Die Generalreinigung fin<strong>de</strong>t einmal pro Woche<br />
statt, ansonsten wer<strong>de</strong>n nach je<strong>de</strong>m Melkgang die üblichen Reinigungsarbeiten durchgeführt.<br />
Einmal jährlich erfolgt eine Material- <strong>und</strong> <strong>Tec</strong>hniküberprüfung. Die täglichen Melkzeiten<br />
fin<strong>de</strong>n morgens von 04:00 Uhr bis 09:30 Uhr <strong>und</strong> abends von 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr<br />
statt. Der Arbeitsaufwand beläuft sich hierbei auf einen Melker pro Karussell <strong>und</strong> zusätzlich<br />
einen Treiber.<br />
Die Futterration setzt sich aus Maissilage, Grassilage,<br />
Luzernesilage, Stroh, Roggen-GPS <strong>und</strong> Kraftfutter zusammen.<br />
Diese wird in Portionen über eine Bandfutterför<strong>de</strong>ranlage<br />
7 - 10 mal an die unterschiedlichen Leistungsgruppen<br />
verteilt. Eine Beson<strong>de</strong>rheit in <strong>de</strong>r Rationsgestaltung<br />
ist <strong>de</strong>r Einsatz von Futterhefen, die die Futteraufnahme<br />
erhöhen, Hitzestress vorbeugen <strong>und</strong> die<br />
Leistung steigern.<br />
Die neugeborenen Kälber wer<strong>de</strong>n direkt nach <strong>de</strong>r Kalbung in Kälberhäusern in Einzelboxen<br />
untergebracht <strong>und</strong> mit 4 x 1l Kolostrum versorgt. Ab <strong>de</strong>m zweiten Tag wird Kolostrum mit<br />
Milchaustauscher gefüttert (Menge nach Kalbgröße). Die Kälber wer<strong>de</strong>n nach circa 10 Tagen<br />
in Gemeinschaftsabteile für 22 Kälber pro Gruppe untergebracht (siehe Abbildung links).<br />
Dort erhalten sie Heu, Stroh <strong>und</strong> Kälberkraftfutter ad libi<strong>tum</strong> zusätzlich zur Milchaustauschergabe<br />
am Automaten. Männliche Kälber wer<strong>de</strong>n in Mastbetriebe abgegeben, weibliche<br />
Kälber wer<strong>de</strong>n aufgezogen <strong>und</strong> ca. 15 bis 20 Färsen pro Monat verkauft.<br />
Besuch <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, Forst <strong>und</strong> Gartenbau am Standort I<strong>de</strong>n<br />
Gegen Donnerstag Mittag trafen wir am Zentrum für Tierhaltung <strong>und</strong> <strong>Tec</strong>hnik <strong>de</strong>r LLFG<br />
Sachsen Anhalt in I<strong>de</strong>n ein. Nach kurzer Stärkung referierte <strong>de</strong>r Standortleiter Herr Dr. Weber<br />
in einer Präsentation über aktuelle Kennzahlen <strong>de</strong>r Landwirtschaft in Sachsen Anhalt <strong>und</strong> <strong>de</strong>n<br />
Lan<strong>de</strong>sbetrieb in I<strong>de</strong>n. Der Betrieb wur<strong>de</strong> 1447 am heutigen Standort erbaut. Bis zum 2.<br />
Weltkrieg belieferte <strong>de</strong>r Betrieb die Zuckerfabrik Goldbeck <strong>und</strong> verfügt über eine eigene<br />
Kleinbahn zur Fabrik. 1945 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Betrieb, wie viele an<strong>de</strong>re, enteignet <strong>und</strong> vorerst durch<br />
das Militär geführt. Von 1948 bis 1962 war <strong>de</strong>r Hof ein Versuchsgut <strong>de</strong>r Universität Halle, bis<br />
er 1962 zur Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Landwirtschaftswissenschaften <strong>de</strong>r DDR umgestaltet wur<strong>de</strong>. Nach<br />
<strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong>, genauer 1992, entstand daraus die Lehr- <strong>und</strong> Versuchsanstalt für Tierhaltung <strong>und</strong><br />
<strong>Tec</strong>hnik. Im Jahr 2001 fand die Gründung <strong>de</strong>r LLG statt, erst seit <strong>de</strong>m Jahr 2006 steht <strong>de</strong>r<br />
Betrieb unter <strong>de</strong>m Namen LLFG.<br />
Am Standort I<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n im Rahmen <strong>de</strong>r überbetrieblichen landwirtschaftlichen Ausbildung<br />
für 3 B<strong>und</strong>eslän<strong>de</strong>r Kenntnisse aus <strong>de</strong>m Pflanzen-, Tier-, <strong>und</strong> <strong>Tec</strong>hnikbereich vermittelt. Ähnlich<br />
wie bei <strong>de</strong>r DEULA können Azubis hier 4 – 6-wöchige Speziallehrgänge besuchen. Folglich<br />
ist <strong>de</strong>r Betrieb ein Gemischtbetrieb mit ca. 1200 Ha Größe, 400 Kühen inkl. weiblicher<br />
Nachzucht, diversen Schweineställen (120 Sauen, 300 Mastplätze in <strong>de</strong>r Lehrwerkstatt, 580<br />
im Versuchswesen), 550 Mutterschafen die in Koppel- <strong>und</strong> Hütehaltung gehalten wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Tec</strong>hnikgebäu<strong>de</strong>n inklusive einer neuen Bo<strong>de</strong>nhalle. Außer<strong>de</strong>m ist am Standort <strong>de</strong>r Milchviehanlage,<br />
die etwas außerhalb <strong>de</strong>s Verwaltungs- <strong>und</strong> <strong>Tec</strong>hnikstandorts liegt ein eigenes<br />
Schlachthaus angesie<strong>de</strong>lt, in <strong>de</strong>m neben ein paar Rin<strong>de</strong>rn <strong>und</strong> Schafen hauptsächlich Schweineschlachtungen<br />
zu Versuchszwecken durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Als Beson<strong>de</strong>rheit pflegt <strong>de</strong>r Betrieb<br />
die Haltung von ca. 250 Dam- <strong>und</strong> Sikawildtieren.<br />
Die Flächen, wie auch die größten Teile <strong>de</strong>r Rin<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Schweineanlage, wer<strong>de</strong>n als norma-
ler landwirtschaftlicher Betrieb geführt <strong>und</strong> müssen auch <strong>de</strong>mentsprechend wirtschaften.<br />
In <strong>de</strong>n Anlagen für die Schweine wer<strong>de</strong>n ebenso zu Demonstrations- <strong>und</strong> Versuchszwecken<br />
verschie<strong>de</strong>ne Aufstallungstypen propagiert.<br />
Ausbildungsbedingt sind die Bereiche Schweinemast <strong>und</strong> die Sauen getrennt gehalten. Die<br />
Sauen wer<strong>de</strong>n im Wochenrhythmus umgestallt. Im Schlachthaus wer<strong>de</strong>n schwerpunktmäßig<br />
die Schweine <strong>de</strong>s 600er Stalls nach Fleisch- <strong>und</strong> Mastleistungen geprüft.<br />
Die Milchviehanlage ist ein umgebauter 1000er Stall aus DDR-Zeiten <strong>und</strong> wirt mit einem<br />
si<strong>de</strong>-by-si<strong>de</strong>-Melkstand betrieben. Hier arbeiten neben Angestellten <strong>und</strong> Lehrlingen im<br />
Schichtbetrieb auch Azubis in <strong>de</strong>r überbetrieblichen Melkausbildung. Gemolken wird in 3<br />
Schichten, sodass eine fast ganztätige Tierkontrolle möglich wird. Darüber hinaus hat dieser<br />
Umstand auch <strong>de</strong>n praktischen Vorteil, dass in <strong>de</strong>r Nacht ungebetene Besucher vom Betrieb<br />
ferngehalten wer<strong>de</strong>n. Die Milchleistung lag in <strong>de</strong>n letzten Jahren immer über 11000 kg pro<br />
Jahr. Für das Prüf- <strong>und</strong> Versuchswesen ist ein Teil <strong>de</strong>s Stalls abgetrennt <strong>und</strong> u.a. mit Einzelplatz-<br />
Wiegetrögen ausgestattet. Er umfasst 72 Plätze für Milchkühe, hinzu kommen noch<br />
Kälberplätze.<br />
Auf <strong>de</strong>m <strong>Tec</strong>hnikstandort stehen wer<strong>de</strong>n neben <strong>de</strong>n alten, rustikalen <strong>und</strong> sehr schönen Backsteinbauten<br />
die neuen <strong>und</strong> in <strong>de</strong>r Bauweise <strong>de</strong>n alten angepassten Hallen zur überbetrieblichen<br />
<strong>Tec</strong>hnikausbildung genutzt.<br />
Bei Gesprächen während <strong>de</strong>r Führung wur<strong>de</strong> die zukünftige Anspannung am landwirtschaftlichen<br />
Arbeitsmarkt <strong>de</strong>utlich. Die Verantwortlichen berichteten von seit Jahren trotz Bedarf am<br />
Arbeitsmarkt sinken<strong>de</strong>n Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nzahlen, was gera<strong>de</strong> kostspielige Investitionen wie die<br />
Bo<strong>de</strong>nhalle zu nicht kalkulierbaren Ausgaben machen.<br />
Während <strong>de</strong>s Vortrags von Herrn Weber wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, dass trotz viel größerer Strukturen als<br />
z.B. in Süd<strong>de</strong>utschland ein beträchtlicher Teil <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen Fläche in Sachsen-<br />
Anhalt von kleinen <strong>und</strong> mittleren Betrieben mit Größen bis ca. 250ha bewirtschaftet wird.<br />
Die aktuellen Betriebsspiegel zeigen, dass die Schweinehaltung, die seit 1990 stetig zurückgegangen<br />
ist, neuerdings einen leichten Aufschwung erlebt. Dies ist vor Allem auf die Investition<br />
holländischer Firmen zurückzuführen.<br />
Im Bereich <strong>de</strong>s Ökolandbaues ist ebenfalls ein starker Anstieg in <strong>de</strong>n letzten Jahren zu verzeichnen.<br />
Nach etwa 4 St<strong>und</strong>en Aufenthalt verabschie<strong>de</strong>ten wir uns dann <strong>und</strong> setzen unsere Reise mit<br />
einer sehr interessanten Elbüberquerung in Richtung Werbellinsee/ Bran<strong>de</strong>nburg fort.<br />
Fahrt nach Joachimsthal mit Übernachtung am Werbellinsee<br />
Ökodorf Brodowin- Schorfhei<strong>de</strong> Bran<strong>de</strong>nburg am<br />
17.06.2011<br />
Vor 20 Jahren wur<strong>de</strong> eine ehemalige LPG in <strong>de</strong>n heutigen biologisch<br />
dynamischen Demeter-Betrieb mit 1250 ha landwirtschaftliche<br />
Fläche <strong>und</strong> 100 ha Wald, sowie Milchviehhaltung mit <strong>de</strong>rzeit<br />
550 Rin<strong>de</strong>rn, davon 250 Milchkühe, umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
1994 wur<strong>de</strong> mit Gemüseanbau begonnen, <strong>de</strong>r heute 25 ha umfasst<br />
(z.B. Möhren, Zwiebeln, Porree, Rosenkohl). Diese wer<strong>de</strong>n<br />
im Fruchtwechsel mit <strong>de</strong>n landwirtschaftlichen Kulturen<br />
Kleegras, Roggen (Lichtkorn- <strong>und</strong> Bergroggen), Weizen, Dinkel,<br />
Kartoffeln, Mais, Sommergerste <strong>und</strong> Sonnenblumen angebaut.<br />
Ein Teil <strong>de</strong>s Getrei<strong>de</strong>s dient als Tierfutter, <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />
wird zu Mehl o<strong>de</strong>r Brot verarbeitet.
Der ehemalige LPG-Schweinestall wur<strong>de</strong> 2009 umgebaut für die Haltung von 200 Milchziegen.<br />
Seit Mai 2011 ergänzen zwei Hühnermobile mit je 200 Hennen <strong>de</strong>n Tierbestand. Diese<br />
Mobile befin<strong>de</strong>n sich auf Streuobstwiesen, auf <strong>de</strong>nen die Hühner ihren Auslauf fin<strong>de</strong>n.<br />
Derzeit sind 77 Mitarbeiter auf <strong>de</strong>m Betrieb beschäftigt.<br />
Rin<strong>de</strong>rhaltung: Die Färsen wer<strong>de</strong>n von einem Bullen auf <strong>de</strong>r Wei<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>ckt <strong>und</strong> kommen<br />
kurz vor <strong>de</strong>r Kalbung in <strong>de</strong>n Stall. Die Kühe wer<strong>de</strong>n ab <strong>de</strong>m ersten Tag nach <strong>de</strong>r Geburt gemolken<br />
(mobile Melkmaschine). Die Kälber verbleiben die ersten drei Tage bei <strong>de</strong>r Mutter<br />
<strong>und</strong> erhalten Kolostralmilch, anschließend kommen sie in Kälberiglus. Die Milchkühe sind in<br />
Gruppen im Stall mit Auslauf eingeteilt, bei <strong>de</strong>nen je ein Bulle zur Deckung mitläuft.<br />
Die Milch wird hauptsächlich unverarbeitet, nur pasteurisiert, in Flaschen o<strong>de</strong>r Beutel verkauft<br />
<strong>und</strong> teilweise zu Käse verarbeitet (Mozzarella, Frischkäse). Seit März 2011 gibt es eine<br />
neue Meierei, in <strong>de</strong>r auch die Ziegenmilch verarbeitet wird.<br />
Die Demeter-Richtlinien sehen vor, dass die Rin<strong>de</strong>r nicht<br />
enthornt wer<strong>de</strong>n. Dies ist u. a. wichtig für die Herstellung <strong>de</strong>s<br />
Hornmistpräparats, bei <strong>de</strong>m die Rin<strong>de</strong>rhörner mit Mist gefüllt,<br />
im Herbst in <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> vergraben <strong>und</strong> im Frühjahr <strong>de</strong>r ausgegrabene<br />
Mist mit Wasser verdünnt <strong>und</strong> gefiltert wird. Anschließend<br />
wird das gewonnene Filtrat flächen<strong>de</strong>ckend ausgebracht<br />
(30l/ha). Weitere <strong>de</strong>metertypische Präparate sind Fla<strong>de</strong>n-<br />
<strong>und</strong> Hornkieselpräparat.<br />
Das Ökodorf bietet eine Abokiste an, die mittlerweile über Internet bestellt wer<strong>de</strong>n kann <strong>und</strong><br />
von ca. 1500 Haushalten bezogen wird. Daher wird an 6 Tagen pro Woche ausgeliefert. Die<br />
Kiste kann individuell aus Produkten <strong>de</strong>s Hofes <strong>und</strong> teils aus zugekauften Bioprodukten, ab<br />
einem Wert von 25 Euro zusammengestellt wer<strong>de</strong>n. Zusätzlich können die Produkte im eigenen<br />
Hofla<strong>de</strong>n gekauft wer<strong>de</strong>n.<br />
Brodowin befin<strong>de</strong>t sich innerhalb <strong>de</strong>s Biosphärenreservates<br />
Schorfhei<strong>de</strong>-Chorin. Über sechs Jahre beteiligte sich Brodowin<br />
an Untersuchungen zu Naturschutzmaßnahmen <strong>und</strong> hat<br />
diesbezüglich mehrere Projekte beibehalten z.B. Blühstreifen.<br />
Außer<strong>de</strong>m entstan<strong>de</strong>n als Ergebnis dieser Untersuchungen<br />
Bo<strong>de</strong>nschätzungskarten, die <strong>de</strong>n Landwirt darüber informieren<br />
sollen, welche Fläche sich für welche Maßnahme eignet.<br />
Weitere Infos: www.brodowin.<strong>de</strong><br />
Fahrt nach Cottbus +Tagebau Besichtigung +Agroforst<br />
Am Nachmittag <strong>de</strong>s Donnerstages stand als weiterer Programmpunkt die Besichtigung <strong>de</strong>s<br />
Tagebaus Welzow Süd an.<br />
Als wir <strong>de</strong>n Reisebus verließen begaben wir uns in kleinen VW-Transportern an <strong>de</strong>n Ort <strong>de</strong>s<br />
Geschehens. Die Fahrer dieser Kleinbusse versuchten es eindringlich auf <strong>de</strong>r ca. 2km langen<br />
Fahrtstrecke unsere halbstündige Verspätung wie<strong>de</strong>r wettzumachen.
Nach<strong>de</strong>m sich nun <strong>de</strong>r aufgewirbelte Staub gelegt hatte, staunte die Gruppe nicht schlecht, als<br />
sie sich mitten in einem Weinberg (<strong>und</strong> nicht im Tagebau) befand.<br />
Unsere kurzzeitige Verwirrung wur<strong>de</strong> aber bald aufgeklärt. Denn bereits 2005 hatte die Universität<br />
Cottbus, gemeinsam mit <strong>de</strong>r Vattenfall Europe Mining AG, einen 0,5 ha großen Versuchsweinberg<br />
auf <strong>de</strong>r Rekultivierungsfläche <strong>de</strong>s Tagebaus angelegt.<br />
Mit <strong>de</strong>r Versuchsanlage sollten erstmalig Erfahrungen mit <strong>de</strong>m Weinanbau im ehemaligen<br />
Tagebaugelän<strong>de</strong> gesammelt wer<strong>de</strong>n. Die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s Weinbaues kam nicht von ungefähr. Bereits<br />
vor Beginn <strong>de</strong>s Braunkohleabbaus war in dieser Region ein Weinberg angesie<strong>de</strong>lt.<br />
Nach<strong>de</strong>m die Versuche mit <strong>de</strong>n Weinrebsorten Merzling, Ortega <strong>und</strong> Rondo sehr gute Ergebnisse<br />
<strong>de</strong>r Weinqualiät zeigten, wur<strong>de</strong> ein Schritt <strong>de</strong>r Vergrößerung unternommen.<br />
Seit 2010 umfasst <strong>de</strong>r Weinberg „Wolkenberg“ nun eine Fläche von 6 ha. Um <strong>de</strong>n anfallen<strong>de</strong>n<br />
Wein auch verwerten zu dürfen, mussten entsprechen<strong>de</strong> Rebrechte erworben wer<strong>de</strong>n.<br />
Im Jahr 2011 wird ein Ertrag von ca. 500-1000 l Wein erwartet. Wenn die Reben in einigen<br />
Jahren ausgewachsen sind, sollte aber ein Ertrag von ca. 6000 l/ha erreicht wer<strong>de</strong>n können.<br />
Dies ist im Allgemeinen kein schlechter Ertragskennwert für die Trauben. Trotz sehr sandigem<br />
Bo<strong>de</strong>n (170 m über NN) <strong>und</strong> relativ geringen Nie<strong>de</strong>rschlägen, welche aber durch Bewässerung<br />
ausgeglichen wer<strong>de</strong>n, ist <strong>de</strong>r Weinbau auf Rekultivierungsbö<strong>de</strong>n durchaus eine Überlegung<br />
wert.<br />
Wir staunten nicht schlecht als wir anschließend noch zur Weinverkostung unter freiem Himmel<br />
gela<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n. Durch die Verköstigung <strong>de</strong>r Weine schien sich die Stimmung <strong>de</strong>utlich zu<br />
heben, auch wenn <strong>de</strong>r Wein nicht je<strong>de</strong>rmanns Geschmack war.<br />
Zitat Herr Heizinger: „Ja <strong>de</strong>r schmeckt scho no a bissl nach Kohle…“<br />
Nach Abschluss <strong>de</strong>r Weinprobe fuhren wir mit <strong>de</strong>m Bus entlang <strong>de</strong>m Tagebau zum Aussichtspunkt<br />
Gut Geisendorf. Auf <strong>de</strong>r Fahrt dorthin kamen wir schon an kilometerlangen För<strong>de</strong>rbän<strong>de</strong>rn<br />
vorbei. Am Aussichtspunkt angekommen bot sich uns <strong>de</strong>r Anblick <strong>de</strong>r Abraumför<strong>de</strong>rbrücke<br />
F60. Dort erklärte uns Dr. Freese <strong>de</strong>n Tagebau Welzow Süd <strong>de</strong>r 1966 begonnen wur<strong>de</strong><br />
<strong>und</strong> sich über eine Fläche von etwa 8000 ha erstreckt.<br />
Die Braunkohle wird aus einem r<strong>und</strong> 15 Meter mächtigen Flöz, <strong>de</strong>r r<strong>und</strong> 110 Meter unter <strong>de</strong>r<br />
Erdoberfläche liegt, gewonnen. Bevor man diese för<strong>de</strong>rn kann, wird <strong>de</strong>r darüber liegen<strong>de</strong> Abraum<br />
von einem Vorschnittbagger <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Abraumför<strong>de</strong>rbrücke, die 600 Meter lang <strong>und</strong> 70<br />
Meter hoch ist zur Kippe bewegt <strong>und</strong> dort abgelagert. Von <strong>de</strong>r eigentlichen Kohleför<strong>de</strong>rung<br />
bekamen wir lei<strong>de</strong>r nichts zu Gesicht, da sie nicht im Sichtfeld <strong>de</strong>r Aussichtsplattform lag. Sie<br />
befin<strong>de</strong>t sich am Fuße <strong>de</strong>r Abraumbrücke, dort laufen auch die Kohlebän<strong>de</strong>r. Im Tagebau<br />
wer<strong>de</strong>n tagtäglich circa 90.000 Tonnen Braunkohle geför<strong>de</strong>rt. Die Kohle wird anschließend<br />
über die Bahn zu <strong>de</strong>m nahe gelegenen Kraftwerk „Schwarze Pumpe“, welches eine Leistung<br />
von 1600 Megawatt besitzt, transportiert <strong>und</strong> dort verstromt.<br />
Der Tagebau ist hoch technisiert <strong>und</strong> benötigt pro Schicht nur etwa 20 Mann, was bei <strong>de</strong>r immensen<br />
Maschinengröße nur schwer vorstellbar ist. Insgesamt bieten <strong>de</strong>r Tagebau, das Kraftwerk<br />
<strong>und</strong> die Begleitindustrie für ungefähr 3000 Menschen Arbeit.
Zum Abschluss <strong>de</strong>s Tagebaus wur<strong>de</strong> noch die CO2 Problematik <strong>de</strong>r Kohleverbrennung angerissen.<br />
Der CO2 Ausstoß ist beson<strong>de</strong>rs bei Braunkohle Kraftwerken sehr hoch, da die Braunkohle<br />
einen niedrigeren Heizwert besitzt, als an<strong>de</strong>re Energieträger. Im Kraftwerk „Schwarze<br />
Pumpe“ wird CO2 schon separiert <strong>und</strong> gelagert. Nur über die Weiterbehandlung <strong>de</strong>s Gases<br />
gibt es noch kein praktikables Verfahren.<br />
Martin Eberl <strong>und</strong> Simon Ra<strong>de</strong>ck<br />
Agroforst Cottbus – Rekultivierung von Marginalstandorten (Braunkohletagebau)<br />
Lucie Chmelikova, Julia Huber<br />
Versuchsanlage im Rahmen <strong>de</strong>r Rekultivierung von Schüttsubstraten im ehemaligen Braunkohle-Tagebau<br />
in <strong>de</strong>r Lausitz (Welzow-Süd).<br />
Fragestellung:<br />
- Eignung <strong>de</strong>r Agrarholzproduktion für die Aufwertung marginaler Rekultivierungsstandorte<br />
- Positive Auswirkung auf Bo<strong>de</strong>nqualität (Humus, Nährstoffe) <strong>und</strong> Ertragsstabilität<br />
- Wirtschaftlichkeit<br />
Problemstandort:<br />
Der Standort ist durch eine strukturarme <strong>und</strong> weitflächige Landschaft gekennzeichnet. Aufgr<strong>und</strong><br />
von Wind sind die Evapotranspirationsraten hoch. Die unregelmäßige Verteilung <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rschläge (Jahresnie<strong>de</strong>rschlagssumme von ca. 560 mm), <strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong> Anschluss zu<br />
Gr<strong>und</strong>wasser (Gr<strong>und</strong>wasserspiegel unter 30 m) <strong>und</strong> die geringe Wasserspeicherkapazität -<br />
verursacht durch die geringe Gefügestabilität <strong>de</strong>s Bo<strong>de</strong>ns (Bo<strong>de</strong>n im Initialstadium) <strong>und</strong> das<br />
Fehlen organischer Substanz - führen zu Trockenstress für die Pflanzen. Die Verschüttungstechnologie<br />
(große Fallhöhe) führte zu einer Verdichtung <strong>de</strong>s Bo<strong>de</strong>ns (TRD bei 1,4 – 1,6 g<br />
cm -3 ). Der pH liegt aufgr<strong>und</strong> Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>ntextur bei 2,5 – 3; <strong>de</strong>r P-Gehalt bei 1,6<br />
– 19,3 mg kg -1 .<br />
Versuchsanlage:<br />
2005 wur<strong>de</strong>n auf einer Fläche von 8 ha Gehölzstreifen aus Robinien (9200 Stück/ ha) in Form<br />
von 11 m breiten Doppelreihen in Nord- Süd- Richtung angelegt. Zuvor erfolgte eine Flächenplanierung<br />
<strong>und</strong> Bo<strong>de</strong>nlockerung mit anschließen<strong>de</strong>r Kalkung durch Brandkalk (Ziel- pH<br />
= 7; Aufwandmenge: 80 – 90 dt ha -1 ). Nach <strong>de</strong>r Saatbettbereitung wur<strong>de</strong> gepflanzt. Pappel<br />
<strong>und</strong> Wei<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Standortverhältnisse ausgeschlossen. Umtriebszeit <strong>de</strong>r Gehölzstreifen<br />
liegt bei 4 Jahren (Ernte mit Feldmähhäcksler)<br />
Auf <strong>de</strong>n 24 m breiten Ackerstreifen wuchsen 3 Jahre die bo<strong>de</strong>nverbessern<strong>de</strong> Leguminose Luzerne,<br />
mit anschließen<strong>de</strong>r Gründüngung zur Humusanreicherung. Die Fruchtfolge ist 7-jährig.<br />
Untersuchungsparameter:<br />
Ertragsstruktur, Bo<strong>de</strong>n, Mikroklima.<br />
Erste Ergebnisse:<br />
Die Feldfruchterträge sind in Nähe <strong>de</strong>r Gehölzstreifen erhöht. Zurückgeführt wird das auf die<br />
erhöhte Bo<strong>de</strong>nfeuchte (reduzierte Windgeschwindigkeit) <strong>und</strong> Win<strong>de</strong>rosion. Der Ertrag hängt<br />
zu<strong>de</strong>m stark von <strong>de</strong>r Substratqualität ab. Mit steigen<strong>de</strong>m pH steigt <strong>de</strong>r Ertrag. Mit steigen<strong>de</strong>m<br />
P- Gehalt in <strong>de</strong>n Blättern, steigt <strong>de</strong>r Ertrag.<br />
Holzertrag: 3 t ha -1 a -1 nach <strong>de</strong>r ersten Rotation, 7 t ha -1 a -1 wer<strong>de</strong>n in Folgerotation erwartet.<br />
Humusanreicherung durch Luzerne (gemulcht), weniger durch Laubstreu <strong>de</strong>r Robinie.
Fahrt nach Lübbenau + Kanufahrt Spree<br />
Nach<strong>de</strong>m wir unsere Zimmer im Plattenbau in Lübbenau bezogen hatten, gingen wir zu Fuß<br />
die etwa 2 km zum „<strong>Große</strong>n Spreewaldhafen“. Dort empfingen uns zwei Kahnfahrer mit ihren<br />
Kähnen. Wir fuhren mit jeweils etwa zwanzig Personen pro Kahn auf <strong>de</strong>n sogenannten „Fließen“<br />
zu einer Gaststätte in Burg <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>r zurück. Während <strong>de</strong>r Fahrt versorgte uns unser<br />
Kahnfahrer neben diversen Erfrischungsgetränken auch mit zahlreichen Informationen über<br />
<strong>de</strong>n Spreewald.<br />
Der Sage nach sei <strong>de</strong>r Spreewald durch <strong>de</strong>n Teufel entstan<strong>de</strong>n. Dieser habe <strong>de</strong>n fruchtbaren<br />
Bo<strong>de</strong>n um die Spree pflügen wollen. Da er aus Wut über die vielen Mücken <strong>und</strong> das schlechte<br />
Wetter seine riesigen Ochsen schlug seien ihm diese durchgegangen <strong>und</strong> mit <strong>de</strong>m Pflug kreuz<br />
<strong>und</strong> quer über die Landschaft gerannt. Die hierdurch entstan<strong>de</strong>nen Gräben füllten sich mit<br />
Wasser <strong>und</strong> es entstand eine einmalige Flußlandschaft im Spreewald.<br />
In Wirklichkeit aber haben sich die Gräben durch das abfließen<strong>de</strong> Wasser <strong>de</strong>r riesigen Gletscher<br />
nach <strong>de</strong>r Eiszeit vor 10.000 Jahren gebil<strong>de</strong>t. Das Wasser konnte durch die „Letteschicht“,<br />
eine wasser<strong>und</strong>urchlässige Schicht im Bo<strong>de</strong>n, nicht versickern <strong>und</strong> lief somit oberflächig<br />
ab.<br />
Da diese Schicht in maximal zwei bis drei Meter unter <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>noberfläche war sind auch die<br />
Gräben <strong>de</strong>s Spreewal<strong>de</strong>s nicht tief. An <strong>de</strong>n meisten Stellen ist das Wasser nicht tiefer als eineinhalb<br />
Meter.<br />
Unser Kahnfahrer sagte uns: „Wer im Spreewald ertrinke, sei nur zu faul zum Aufstehen gewesen.“<br />
Durch das gesamte Gebiet <strong>de</strong>s Oberspreewal<strong>de</strong>s, welches sich über einen Raum von 35 km<br />
Länge <strong>und</strong> 15 km Breite erstreckt vernetzt sich eine Wasserstraße von 520 km. Diese setzt<br />
sich aus Wasserläufen in <strong>de</strong>nen das Wasser fliest, <strong>de</strong>n sogenannten Fließen <strong>und</strong> <strong>de</strong>n sogenannten<br />
Gräben in <strong>de</strong>nen das Wasser steht zusammen. Die Gräben en<strong>de</strong>n blind, doch auf <strong>de</strong>n Fließen<br />
könne man theoretisch aus diesem System von Wasserstraßen über die Spree auch nach<br />
Berlin <strong>und</strong> noch weiter fahren.<br />
Die Kahnfahrt im Spreewald wird seit über 1000 Jahren betrieben. Früher reisten die Menschen<br />
über zwei Tage auf Kähnen mit zwei bis sechs Personen durch das weitläufige Gebiet.<br />
Sehr viele Gr<strong>und</strong>stücke sind nur über das Wasser zu erreichen. Alles was auf <strong>de</strong>n Gr<strong>und</strong>stücken<br />
ist, also Baumaterial, Einrichtung <strong>und</strong> sogar die Kühe müssen mit Kähnen transportiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Häuser zeichnen sich durch ihre spezielle Bauweise mit Holz <strong>und</strong> Schilfdächern<br />
aus. Abgesehen von einigen Gebäu<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r DDR muss je<strong>de</strong>s Haus diesem Baustil<br />
entsprechen. Sehr typisch für diese Bauweise sind die Zeichen an <strong>de</strong>n Hausgiebeln, welche<br />
zwei Schlangen symbolisieren. Die Schlangen sollen nach altem Brauch die Häuser <strong>und</strong> ihre<br />
Einwohner vor Naturgewalten schützen.<br />
Das Trinkwasser wur<strong>de</strong> früher aus <strong>de</strong>n „Fließen“ genommen, da es durch <strong>de</strong>n hohen Wasserstand<br />
kein richtiges Gr<strong>und</strong>wasser gibt. Heutzutage wer<strong>de</strong>n die Bewohner durch ein aufwendiges<br />
Netz von Wasserleitungen mit Trinkwasser versorgt.<br />
Die Post wird abgesehen von sehr wenigen Tagen im Winter, an <strong>de</strong>nen die Wasserläufe mit<br />
Eis be<strong>de</strong>ckt sind, mit <strong>de</strong>m Kahn verteilt.
An sehr vielen Gr<strong>und</strong>stücken kann man die typischen Spreewaldgurken, die in dieser Gegend<br />
erzeugt wer<strong>de</strong>n, kaufen o<strong>de</strong>r in einer Gaststätte einkehren.<br />
Die Artenvielfalt im Spreewald ist sehr hoch <strong>und</strong> somit auch als Biosphärenreservat geschützt.<br />
Neben vielen Fischarten (keine Forellen) sind hier auch Ringelnattern, Fischotter <strong>und</strong> Bisamratten<br />
zu fin<strong>de</strong>n.<br />
Die Fahrt auf <strong>de</strong>n Wasserläufen mit motorisierten Booten ist nur für Lasttransporte, die Post<br />
<strong>und</strong> die Feuerwehr erlaubt. Der Kahnfahrer, <strong>de</strong>r uns durch diese idyllische Landschaft fährt<br />
schiebt unseren etwa 10 Meter langen Kahn mit einem vier Meter langen Stab lautlos über das<br />
Wasser. Er hat hierfür eine Art Führerschein <strong>und</strong> einen Personenbeför<strong>de</strong>rungsschein gemacht.<br />
Auch sein Kahn muss alle 2 Jahre zu einer Hauptuntersuchung.<br />
Als wir durch Leh<strong>de</strong>, einem kleinen Dorf mit 150 Einwohnern fahren, zeigt uns unser Kahnfahrer<br />
an einem 300 Jahre alten Beispiel, wie die Häuser aus mit <strong>de</strong>m Handbeil gehauenen<br />
Balken auf Pfählen gebaut sind. Die Zwischenräume <strong>de</strong>r Balken wur<strong>de</strong>n mit Stroh <strong>und</strong> Lehm<br />
abgedichtet. Dies ist aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stabilität auf diesem Untergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> als Schutz vor<br />
<strong>de</strong>m Wasser die beste Möglichkeit hier zu bauen. Die Häuser wer<strong>de</strong>n wegen sehr hoher Umweltauflagen<br />
mit Holz geheizt.<br />
Der Wasserstand schwankt dank <strong>de</strong>r 100 Schleusen fast nicht. Durch diese Schleusen können<br />
nur Boote bis 10 Meter Läge fahren. Der Höhenunterschied <strong>de</strong>n man dabei überwin<strong>de</strong>t beträgt<br />
meist nur einen Meter. Am Rand vieler Gr<strong>und</strong>stücke sind versenkte Kähne zu sehen. Dies<br />
wird gemacht, damit das Holz <strong>de</strong>r Kähne quellen kann <strong>und</strong> diese somit abdichten. Außer<strong>de</strong>m<br />
sind am Rand auch sehr viele Fischkästen mit gefangenem Fisch zu sehen aus <strong>de</strong>nen sich die<br />
Bewohner mit frischem Fisch versorgen können. Nach einer knappen St<strong>und</strong>e Kahnfahrt auf<br />
<strong>de</strong>r ruhigen Spree legten wir gegen 20.30 Uhr bei einem Gasthaus an <strong>und</strong> aßen zu Abend. Wir<br />
hatten das Glück, dass die Gerichte zwischen 17 <strong>und</strong> 21 Uhr nur die Hälfte kosteten <strong>und</strong> so<br />
schlugen wir uns nach einem langen Tag die hungrigen Bäuche voll.<br />
Als wir die Rückfahrt angingen <strong>und</strong> bei einbrechen<strong>de</strong>r Dunkelheit über die ruhige Spree zurückgefahren<br />
wur<strong>de</strong>n erblickten wir am Himmel ein Feuerwerk. Als wir wie<strong>de</strong>r am „<strong>Große</strong>n<br />
Spreewaldhafen“ angekommen sind bekamen unsere bei<strong>de</strong>n Kahnfahrer noch einen Applaus.
Budissa AG Nie<strong>de</strong>rkaina 18.06.2011<br />
Die landwirtschaftliche Produktion <strong>de</strong>r Budissa AG ist auf sieben zusammenhängen<strong>de</strong> Betriebe<br />
aufgeteilt. Bewirtschaftet wer<strong>de</strong>n insgesamt 8400 ha Ackerland <strong>und</strong> 1000 ha Grünland. Die<br />
durchschnittliche Bo<strong>de</strong>nzahl beträgt 48, wobei es sich überwiegend um Lössbö<strong>de</strong>n han<strong>de</strong>lt.<br />
Im Schnitt <strong>de</strong>r Jahre regnet es etwa 600 mm. Das größte Problem im Pflanzenbau stellt die<br />
mehr o<strong>de</strong>r weniger ausgeprägte Vorsommertrockenheit dar, welche die Ernteerträge entschei<strong>de</strong>nd<br />
beeinflusst. Neben <strong>de</strong>r Haltung von mehr als 6000 Rin<strong>de</strong>rn (Milchvieh, Aufzucht, Mast)<br />
<strong>und</strong> 10000 Schweinen steht auf zwei <strong>de</strong>r sieben Betriebe eine Biogasanlage mit einer elektrischen<br />
Leistung von 365 kW bzw. 500 kW, die zu 70 % mit Gülle <strong>und</strong> etwa 30 % mit Reststoffen<br />
aus <strong>de</strong>r Futterproduktion betrieben wer<strong>de</strong>n. Die überschüssige Abwärme aus <strong>de</strong>r Stromproduktion<br />
mit Biogas wird vollständig in <strong>de</strong>n LPGs genutzt. Für einen weiteren Betrieb ist<br />
<strong>de</strong>r Bau einer Biogasanlage geplant. Die Ausbringung <strong>de</strong>r immensen jährlichen Gülle- <strong>und</strong><br />
Gärrestmengen erfolgt mit selbstfahren<strong>de</strong>n Ausbringern, die über festinstallierte Güllepipelines<br />
auf <strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>rn mit Gülle befüllt wer<strong>de</strong>n.<br />
Angebaut wer<strong>de</strong>n jährlich etwa 2500 ha Winterweizen, 1000 ha Wintergerste, 1000 ha Winterraps,<br />
700 ha Triticale <strong>und</strong> 1000 ha Silomais. Auf <strong>de</strong>n übrigen Ackerflächen wer<strong>de</strong>n Zuckerrüben<br />
<strong>und</strong> Kartoffeln angebaut.<br />
Zum Bereich Dienstleistung <strong>und</strong> Han<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Budissa AG gehören vier Unternehmen, darunter<br />
eine Getrei<strong>de</strong>han<strong>de</strong>ls- <strong>und</strong> Dienstleistungs- GmbH sowie die Budissa Agroservice GmbH,<br />
welche die Folienschlauchsilagegeräte produziert <strong>und</strong> vertreibt. Der weltweite Umsatz aus <strong>de</strong>r<br />
Produktion <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Vertrieb <strong>de</strong>r Folienschlauchsilagegeräte beträgt jährlich etwa 15.000.000<br />
€. Entwickelt wur<strong>de</strong>n die Schlauchsilagegeräte ursprünglich zur Konservierung von Pressschnitzeln,<br />
die in herkömmlichen Fahrsilos nur schlecht gelagert wer<strong>de</strong>n können. Mittlerweile<br />
wer<strong>de</strong>n in Folienschlauchen neben Pressschnitzeln auch Mais, Gras, Getrei<strong>de</strong>, Biertreber <strong>und</strong><br />
ganze Zuckerrüben luftdicht konserviert.<br />
Gabriel Streicher, Franz Sedlmeier
18.06.2011 Stadtbesichtigung Bautzen<br />
Als Abschluss unserer großen <strong>Exkursion</strong> statteten wir noch <strong>de</strong>r<br />
Altstadt von Bautzen einen Besuch ab. Hier war unser<br />
Hauptziel vor allem uns vor <strong>de</strong>r bevorstehen<strong>de</strong>n langen<br />
Heimfahrt in einer <strong>de</strong>r zahlreichen Lokalitäten ein gutes<br />
Mittagessen zu organisieren <strong>und</strong> die Innenstadt zu bestaunen.<br />
Auch wennLletzteres zwecks einer späteren Heimfahrt etwas<br />
kurz kam.<br />
Urk<strong>und</strong>lich wur<strong>de</strong> die Stadt erstmals im Jahre 1002 unter <strong>de</strong>m<br />
Namen Budusin erwähnt. Dieser Name ist in Form von Budyšin<br />
neben Bautzen auch heute noch gebräuchlich. Dieser ist jedoch<br />
nicht das einzige Zeugnis <strong>de</strong>r sorbischen Sprache <strong>und</strong> Kultur in<br />
Bautzen. So bil<strong>de</strong>t Bautzen mit Einrichtung en wie <strong>de</strong>m<br />
Sorbischen Institut <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Deutsch sorbischen Volkstheater<br />
ein kulturelles Zentrum für die r<strong>und</strong> 40.000 in <strong>de</strong>r Oberlausitz<br />
beheimateten Sorben.<br />
Eher berüchtigt war Bautzen für seine bei<strong>de</strong>n Strafvollzugsanstalt Bautzen I <strong>und</strong> Bautzen II,<br />
die direkt nach 1945 zuerst von <strong>de</strong>n russischen Besatzern <strong>und</strong><br />
später unter <strong>de</strong>r SED-Regierung vom Ministerium für<br />
Staatssicherheit benutzt wur<strong>de</strong>n, um unliebsame o<strong>de</strong>r potenziell<br />
gefährliche Personen zu internieren. Heute erinnert eine<br />
Ge<strong>de</strong>nkstätte an diejenigen, die unter Haftbedingungen ihr<br />
Leben verloren<br />
Später entwickelte sich Bautzen in <strong>de</strong>r DDR zu einem<br />
Wissenschafts- <strong>und</strong> Industriestandort. So produzierte<br />
„Waggonbau Bautzen“ Eisenbahnwaggons <strong>und</strong> Straßenbahnen<br />
<strong>und</strong> tut dies auch heute noch unter <strong>de</strong>m Namen „ Bombardier<br />
Transportation“.<br />
Die Altstadt, die in <strong>de</strong>n letzten Monaten <strong>de</strong>s Weltkrieges<br />
schwere Beschädigungen hatte hinnehmen müssen, <strong>und</strong> während<br />
<strong>de</strong>r DDR-Zeit mehr <strong>und</strong> mehr verfallen<br />
war, wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> unter<br />
großem finanziellen <strong>und</strong><br />
arbeitstechnischen Aufwand nahezu<br />
komplett restauriert <strong>und</strong> ist heute mit<br />
seinen vielen historischen Gebäu<strong>de</strong>n zu<br />
einem echten Blickfang gewor<strong>de</strong>n. Zu<br />
<strong>de</strong>n Bekanntesten von diesen<br />
Sehenswürdigkeiten zählt neben <strong>de</strong>r<br />
Ortenburg, <strong>de</strong>m Petridom <strong>und</strong> vielen<br />
an<strong>de</strong>ren auch <strong>de</strong>r Reichenturm, ein<br />
Teilgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ehemaligen Stadtbefestigung, von <strong>de</strong>ssen augenscheinlicher Schräglage wir<br />
uns selbst überzeugen konnten.Neben seinen Bauten ist Bautzen vor allem für seinen Senf<br />
berühmt, <strong>de</strong>r neben <strong>de</strong>n traditionellen kunstvoll bemalt <strong>und</strong> geritzten sorbischen Ostereiern<br />
dasbeliebtesten Souvenir für Touristen ist.<br />
Nach<strong>de</strong>m nach ungefähr zwei St<strong>und</strong>en alle mit An<strong>de</strong>nken <strong>und</strong> Reiseproviant einge<strong>de</strong>ckt wie<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n Bus bestiegen hatten, starteten wir Richtung Freising <strong>und</strong> verabschie<strong>de</strong>ten uns von<br />
Bautzen, welches trotz <strong>de</strong>r kurzen Zeit, die wir dort verbracht hatten, <strong>de</strong>nnoch ein schöner<br />
Ausklang für unsere große <strong>Exkursion</strong> gewesen war.