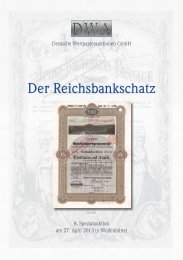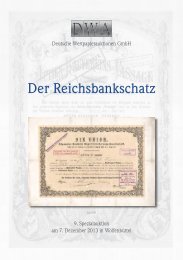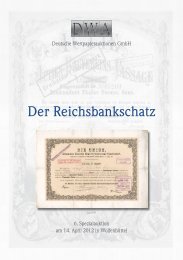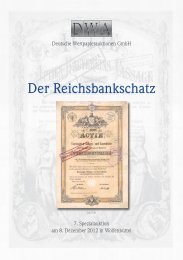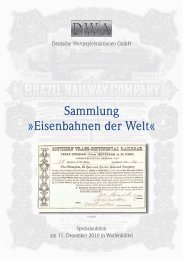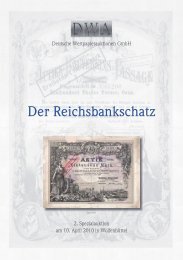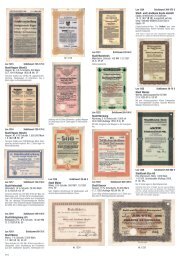suppes-special - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH
suppes-special - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH
suppes-special - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Deutsche</strong> <strong>Wertpapierauktionen</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Der Reichsbankschatz<br />
Los 1336<br />
7. Spezialauktion<br />
am 8. Dezember 2012 in Wolfenbüttel
Ein unenTbehrliches<br />
Nachschlagewerk<br />
Die endgültige Übersicht aller im<br />
Reichsbank-Schatz vorhandenen<br />
Papiere!<br />
15.000 Listungen*<br />
mit nützlichen, noch nie<br />
veröffentlichten Detail-Angaben!<br />
49,– €<br />
Best.-Nr. 187887<br />
Dieses Kennzeichen sagt, ob auch<br />
nicht entwertete Stücke bekannt<br />
* außer Pfandbriefe u.ä.<br />
<strong>suppes</strong>-<strong>special</strong><br />
„Der Reichsbank-Schatz“<br />
Firmenname Ausgabeort Art Nennwert Datum Aufl age Schatz Erh. Jahr<br />
A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 2.1.1913 550 9 III/IV 2009<br />
A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 1.1.1922 1.000 9 III/IV 2009<br />
A. Busse & Co. AG Berlin Aktie 1.000 Mark 1.4.1900 6.000 6 III 2009<br />
A. Doehner AG Chemnitz Aktie 100 RM 25.4.1925 2.000 1.250 II 2003<br />
A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 100 RM 28.6.1929 90 20 II/III 2009<br />
� A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 1.000 RM 28.6.1929 91 90 II 2008<br />
� A. Frohmuth Holzwaren- und Holzstoff-Fabrik AG Mellenbach Aktie 1.000 Mark 15.12.1923 10.000 165 II/III 2006<br />
A. Glaser Nachfl . AG Penig Aktie 100 RM 1.6.1932 1.920 1.500 II 2003<br />
A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 20.7.1923 5.000 30 II/III 2008<br />
A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 10.8.1923 5.000 13 II/III 2009<br />
� A. Hagedorn & Co. Celluloid- und Korkwaren-Fabrik AG Osnabrück Aktie 1.000 Mark 28.2.2007 1.000 58 III 2008<br />
A. Ludwig Steinmetz AG Remscheid Aktie 100 RM März 1938 2 III/IV 2009<br />
� A. Prang Dampf- und Wassermühlenwerke AG Gumbinnen Aktie 100 RM Sept. 1927 8.000 3 III/IV 2009<br />
� A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Jan. 1899 2.000 1 IV 2009<br />
� A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Febr. 1909 3.000 1 IV 2009<br />
� A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1911 7.000 3 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1912 6.500 1 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. 4,5 % Schuldv. 1.000 Mark Okt. 1920 5 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 200 RM Aug. 1943 2.760 900 II/III 2006<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 1000 RM Aug. 1943 73.620 5.000 II/III 2006<br />
A. Th. Meiflner AG Stadtilm Aktie 100 RM 26.2.1925 6.400 33 III 2008<br />
. Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. A 100 RM 3.12.1925 1.700 44 III 2008<br />
. Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. C 100 RM 30.9.1940 1.960 8 III 2009<br />
chener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Actie 1.200 Mark 5.6.1896 1.500 500 III/IV 2005<br />
chener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 4.6.1907 1.000 600 III 2005<br />
hener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 1.10.1912 500 400 II/III 2005<br />
ener Lederfabrik AG Aachen Aktie 200 RM 3.6.1929 1.740 210 III 2006<br />
ener Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 400 Thaler 28.5.1853 3.000 600 IV 2006<br />
ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 1.200 Mark 15.11.1895 3.000 750 III 2006<br />
ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 1.1.1921 4.000 1.050 III/IV 2006<br />
er Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 6.3.1923 15.000 3.000 III/IV 2006<br />
er Stahlwaarenfabrik Fafnir-Werke AG Aachen Aktie 1.000 Mark 1.4.1912 800 3 IV 2009<br />
r Thermalwasser Kaiserbrunnen AG Aachen Aktie 100 RM März 1929 250 8 II/III 2009<br />
Diese Stückzahl lag im Reichsbank-Schatz<br />
Erhaltung<br />
Auktion im Jahr<br />
Benecke &<br />
Rehse<br />
Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere<br />
– Wertpapierantiquariat –<br />
Salzbergstraße 2 · 38302 Wolfenbüttel<br />
Telefon 05331.975521 · Telefax 05331.975555
Programm Anreise<br />
Auktionsort<br />
Zentrum für Historische Wertpapiere<br />
Salzbergstraße 2<br />
D-38302 Wolfenbüttel<br />
Programm<br />
Freitag, 7. Dezember 2012<br />
9 - 18 Uhr Tag der offenen Tür beim<br />
Benecke und Rehse Wertpapierantiquariat<br />
18.30 Uhr Sammlertreffen in der Gaststätte<br />
»Zum Eichenwald«<br />
Braunschweig-Mascherode<br />
Salzdahlumer Straße 313<br />
Sonnabend, 8. Dezember 2012<br />
8 - 11 Uhr Vorbesichtigung der<br />
Auktionslose<br />
11.00 Uhr 7. Spezial-Auktion<br />
»Der Reichsbankschatz«<br />
Übernachtungen<br />
Arcadia Hotel (4 Sterne)<br />
ehemals PLAY OFF<br />
Salzdahlumer Straße 137<br />
38126 Braunschweig-Südstadt<br />
(ca. 5 km vom Veranstaltungsort entfernt)<br />
Telefon 05 31 - 2 63 10<br />
Fax 05 31 - 6 71 19<br />
eMail info.braunschweig@ahmm.de<br />
Web www.arcardia-hotel.de<br />
Sonderpreis für unsere Auktionsbesucher:<br />
50 E pro Zimmer/Nacht<br />
(EZ oder DZ, plus Frühstück p.P. 15 E)<br />
kostenfrei: Parkplatz sowie Nutzung<br />
von Sauna und Fitnessräumen<br />
Die Reservierung machen wir gern für<br />
Sie, bitte rufen Sie uns an!<br />
… von der A 2 kommend:<br />
am Kreuz Braunschweig-Nord auf die<br />
A 391 Richtung Salzgitter/Kassel<br />
… von der A 7 kommend:<br />
am Salzgitter-Dreieck auf die A 39<br />
Richtung Braunschweig/Berlin<br />
in beiden Fällen dann weiter:<br />
– am Dreieck Braunschweig-Südwest<br />
einordnen auf die A 39 Richtung Berlin<br />
– am Kreuz Braunschweig-Süd rechts<br />
ausfahren auf die A 395 Richtung<br />
Wolfenbüttel/Bad Harzburg/Goslar<br />
– 3. Ausfahrt Stöckheim/Mascherode<br />
(nach dem Lärmschutzwall auf der<br />
rechten Seite) ausfahren, am Ende der<br />
Ausfahrtrampe links fahren Richtung<br />
Mascherode<br />
Fragen zur<br />
Auktion?<br />
Michael Weingarten, Tel. 05331-9755-33<br />
Kurt Arendts, Tel. 05331-9755-22<br />
Michael Rösler, Tel. 05331-9755-21<br />
Immer einen Besuch wert:<br />
Der Harz<br />
wenn Sie jetzt erst zum Hotel wollen:<br />
– in Mascherode am Kreisverkehr<br />
3. Abbie gung ausfahren Richtung<br />
Braunschweig-Heidberg (nach 30 m<br />
kommen Sie jetzt am »Eichenwald«<br />
vorbei, wo Freitag Sammlertreffen ist)<br />
– aus Mascherode herausfahren, die<br />
Straße schlängelt sich durch ein Wäldchen,<br />
nach ca. 1,5 km ist links das<br />
Hotel (rechts liegt eine Star-Tankstelle,<br />
hat meist sehr günstige Spritpreise)<br />
wenn Sie jetzt direkt zu unserem<br />
Firmensitz wollen:<br />
– in Mascherode am Kreisverkehr<br />
1. Abbiegung rechts fahren Richtung<br />
Salzdahlum<br />
– in Salzdahlum 100 m nach dem Ortseingangsschild<br />
links abbiegen Richtung<br />
Sickte<br />
– nach ca. 700 m auf der Landstraße<br />
fahren Sie geradeaus direkt auf unser<br />
Firmengelände<br />
wenn Sie vom Hotel zu unserem<br />
Firmensitz wollen:<br />
zurückfahren Richtung Mascherode, dort<br />
geradeaus durchfahren, in Salzdahlum<br />
s.o.<br />
wenn Sie mit der Bahn anreisen:<br />
Zielbahnhof: Braunschweig-Hbf., von dort<br />
mit dem Taxi (zum Hotel ca. 8 Min., zu<br />
unserem Firmensitz ca. 15 Min.)<br />
Mindestgebot: 80 % vom unteren Schätzpreis
Los 1 Schätzwert 500-625 €<br />
A. Busse & Co. AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 1.4.1900.<br />
Gründeraktie (Auflage 6000, R 9) VF+<br />
Ein grosser Teil der Aktien war im Besitz der Allg.<br />
<strong>Deutsche</strong>n Credit-Anstalt in Leipzig.<br />
Gründung 1898. Die Gesellschaft übernahm das Bankhaus A.<br />
Busse & Co. für 1.502.926 Mark. Betrieb von Bankgeschäften<br />
aller Art, insbesondere die Förderung der Handelsbeziehungen<br />
zwischen Deutschland und Nordamerika und den übrigen überseeischen<br />
Ländern. Im Jahr 1924 gelang es der Gesellschaft,<br />
ihre im Jahr 1904 aufgegebenen Bankrechte zurückzuerwerben<br />
und die Banktätigkeit wieder aufzunehmen. Firmensitz<br />
war in der Behrenstraße, nach 1949 am Kurfürstendamm.<br />
1951 im Handelsregister gelöscht.<br />
Los 2 Schätzwert 125-200 €<br />
A. Erlenwein & Cremer AG<br />
Uerdingen, Aktie 100 RM 28.6.1929<br />
(Auflage nur 90 Stück, R 8) EF<br />
Gründung 1922 als Uerdinger Likörfabrik und Weinbrennerei<br />
AG. Die heute in Düsseldorf ansässige Fa. ist mit der Verwaltung<br />
des vorhandenen Grundvermögens und Immobiliengeschäften<br />
befasst.<br />
Los 3 Schätzwert 125-200 €<br />
A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG<br />
Potsdam, Aktie 1.000 Mark 20.7.1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 5000, R 7) EF<br />
Gründung im Mai 1923, eingetragen im Juli. Übernahme und<br />
Fortführung der Firma A. Grubitz Dampfseifenfabrik zu Potsdam.<br />
1926 wurde das Konkursverfahren eröffnet, 1929 ist die<br />
Firma erloschen.<br />
2<br />
Nr. 1 Nr. 5<br />
Los 4 Schätzwert 150-250 €<br />
A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG<br />
Potsdam, Aktie 1.000 Mark 10.8.1923<br />
(Auflage 5000, R 8) EF<br />
Los 5 Schätzwert 300-375 €<br />
A. Ludwig Steinmetz AG<br />
Remscheid, Aktie 100 RM März 1938<br />
(Auflage 160, R 11) EF<br />
Gründung 1920. Herstellung und Vertrieb von Eisen- und<br />
Stahlwaren aller Art, insbesondere von Maschinen und Präzisions-Werkzeugen.<br />
1948 umbenannt in Alstrem-Werk AG Präzisionswerkzeug-<br />
und Maschinenfabrik. 1957 wurde die Gesellschaft<br />
aufgelöst.<br />
Los 6 Schätzwert 300-375 €<br />
A. Prang Dampf- und<br />
Wassermühlenwerke AG<br />
Gumbinnen, Aktie 100 RM Sept. 1927<br />
(Auflage 8000, R 8) VF+<br />
Nur 3 Stück wurden im Reichsbankschatz gefunden,<br />
dies ist das letzte noch verfügbare.<br />
Die Anfänge gehen auf einen Erbkaufkontrakt zurück, der zwischen<br />
der Preußisch-Litauischen Kriegs- und Domänenkammer<br />
und dem Mühlenmeister Michael Frank geschlossen und 1753<br />
von Friedrich dem Großen signiert wurde. Nach vielen Besitzerwechseln<br />
ging die Mühle 1877 an den Stadtrat Arthur Prang über,<br />
der sie weiter ausbaute. 1909 Umwandlung in die “A. Prang<br />
Dampf- und Wassermühlenwerke AG”. 1922 an der Berliner Börse<br />
eingeführt, die große 1923er Kapitalerhöhung übernahm dann<br />
ein Konsortium unter Führung der <strong>Deutsche</strong>n Bank, Fil. Königsberg.<br />
1938 umbenannt in Prangmühlen AG. In den 1940er Jahren<br />
der größte Mühlenbetrieb in Ost- und Westpreußen. Heute<br />
wird in der früheren Mühle ein Mischfutterwerk betrieben.<br />
Los 7 Schätzwert 600-750 €<br />
A. Riebeck’sche Montanwerke AG<br />
Halle a/S., Aktie 1.000 Mark April 1911<br />
(Auflage 7000, R 10) VF<br />
Der größte Teil dieser Aktien diente der Abfindung<br />
der Aktionäre der durch Verschmelzung aufgenommenen<br />
„Sächsisch-Thüringischen AG für<br />
Braunkohlenverwertung“ zu Halle a/S. und der<br />
„Naumburger Baunkohlen-AG“ zu Naumburg a/S.<br />
Schöner G&D-Druck mit einer drucktechnischen<br />
Besonderheit: Für den Vorstand trägt die Aktie eine<br />
Faksimile- und eine Original-Unterschrift. Nur 3<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Das von Kommerzienrat Riebeck begründete Unternehmen wurde<br />
1883 im Zuge der Auseinandersetzung unter seinen Erben eine<br />
AG, 1888 übernahm ein Bankenkonsortium alle Aktien.<br />
Grundlage des Unternehmens waren Dutzende von Braunkohlengruben<br />
(teils Tiefbau, teils Tagebau) im Oberröblinger, Zeitz-Weissenfelser<br />
und im Halle’schen Bezirk. Ein weiterer wichtiger Geschäftszweig<br />
war die Verarbeitung des in Schwelereien gewonnenen<br />
Teers auf Mineralöle und Paraffin. Im Laufe der Jahre wurden<br />
eine Reihe benachbarter Bergwerksunternehmen übernommen.<br />
1923 weitere Ausdehnung des Bergwerksbesitzes mit dem<br />
Erwerb der Gewerkschaft Messel bei Darmstadt (1954 als “Pa-<br />
Nr. 6 Nr. 7<br />
raffin- und Mineralölwerk Messel” ausgegliedert, 1959 an die<br />
schwedische Ytong AB verkauft; der ehemalige Braunkohlentagebau<br />
Grube Messel gehört heute übrigens als überragender<br />
Fossilien-Fundort zum Weltkulturerbe). Ebenfalls 1923 Übernahme<br />
wesentlicher Mineralöl-Interessen aus dem Stinnes-Einflussbereich,<br />
in diesem Zusammenhang für kurze Zeit Umfirmierung<br />
in „Hugo Stinnes-Riebeck Montan- und Oelwerke AG“. 1926 Abschluss<br />
eines Interessenvertrages mit der I.G. Farbenindustrie<br />
AG, wonach jeder Aktionär seine Aktien 2:1 in I.G. Farben-Aktien<br />
tauschen konnte (diese Klausel war übrigens noch bis Ende der<br />
80er Jahre Gegenstand vielbeachteter Prozesse zwischen beiden<br />
Gesellschaften). 1931 übernahmen die Rheinischen Stahlwerke<br />
ein großes Paket Riebeck-Aktien von der I. G. Farben und waren<br />
dann mit 87 % Mehrheitsaktionär. 1945 zu Gunsten des Landes<br />
Sachsen-Anhalt enteignet. Nach dem Krieg lagen neben geringfügigem<br />
Streubesitz die Riebeck-Aktien wieder bei I. G. Farben<br />
(rd. 50 %) und Rheinstahl (rd. 40 %). 1966 Sitzverlegung von<br />
Halle (Saale) nach Frankfurt (Main),<br />
Los 8 Schätzwert 200-250 €<br />
A. Zalewski AG<br />
Honnef am Rhein, Aktie Lit. C 100 RM<br />
30.9.1940 (Auflage 260, R 9) UNC-EF<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt.<br />
Gründung 1923. Herstellung und Vertrieb chemisch-pharmazeutischer<br />
Erzeugnisse. Spezialität: Erzeugung von Lebertran-<br />
Emulsion für human-arzneiliche Zwecke (“Zalewski” Marke<br />
Dorschkopf) und Trenn-Emulsion für das Brot- und Backgewerbe.<br />
1953 Umwandlung in eine <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 9 Schätzwert 150-250 €<br />
Accumulatoren-Fabrik AG<br />
Berlin, 4 % Sammelschuldv. 1.300.000<br />
RM Aug. 1943 (R 8) EF<br />
Teil einer Anleihe von 46 Mio. RM. Faksimile-Unterschrift<br />
Quandt, für die <strong>Deutsche</strong> Bank Faksimile<br />
Abs.<br />
Die Gründung erfolgte als oHG Accumulatoren-Fabrik Tudorschen<br />
Systems Büsche & Müller 1887. Ab 1890 AG. Anlage<br />
und Betrieb von Fabriken zur Herstellung von Accumulatoren,<br />
zunächst nach dem Tudor’schen System und den dazu gehörigen<br />
Nebenapparaten. 1904 wird die AFA-Tochter VARTA (Vertrieb,<br />
Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren) gegründet.<br />
1923 wird Dr. Günther Quandt Aufsichtsratsvorsitzender<br />
der AFA, er und später seine Kinder bringen den interna-<br />
A. Riebeck'sche Montanwerke AG Werksansicht auf einer Postkarte<br />
tionalen Ausbau des Unternehmens entscheidend voran. 1935<br />
ist der Luftschiffriese “Hindenburg” ausschließlich mit Varta-<br />
Batterien ausgestattet. Besitz der Gesellschaft: Werke in Hagen<br />
i.W., Berlin-Oberschöneweide, Krautscheid i. Westerwald, Hirschwang<br />
i. N.-Österreich sowie das Fabrikgrundstück der früheren<br />
Accumulatorenwerke Oberspree AG in Oberschöneweide.<br />
1947 Sitzverlegung von Berlin nach Hagen. 1962 Änderung<br />
des Firmennamens in Varta AG (der Automobil-Boom der<br />
1960er machte Autobatterien von Varta populär), 1965 Verlegung<br />
des Firmensitzes nach Frankfurt. Noch heute einer der<br />
bedeutendsten Batteriehersteller der Welt.<br />
Los 10 Schätzwert 75-125 €<br />
ACLA Rheinische Maschinenlederund<br />
Riemenfabrik AG<br />
Köln-Mülheim, Aktie Lit. A 1.000 RM Okt.<br />
1934 (Auflage 250, R 6) EF<br />
Gründung bereits 1829, AG seit 1916. Herstellung und Vertrieb<br />
von Leder, Riemen, technischen Leder- und Rohhautartikeln, Erzeugnissen<br />
aus Kunstharz und anderen Kunststoffen. Zweigniederlassungen<br />
in Gleiwitz und Königsberg. Heute ist die ACLA-<br />
Werke <strong>GmbH</strong>, Köln einer der führenden europäischen Hersteller<br />
von technischen Artikeln aus Polyurethan-Elastomeren.<br />
Los 11 Schätzwert 500-625 €<br />
Actien-Bau-Gesellschaft Ostend<br />
Berlin, Aktie 1.200 Mark 18.11.1905<br />
(Auflage 3125, R 9) EF-VF<br />
Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1872. Die in Oberschöneweide bei Cöpenick domizilierende<br />
„Ostend“ ist eine der wenigen Terraingesellschaften,<br />
die nach schweren Blessuren (tiefster Kurs 4%) den Gründerk-
ach doch überlebte. Sie parzellierte zuerst ein Villenterrain bei<br />
Köpenick (bis Ende des 19. Jh. erfolgreich abverkauft) und betrieb<br />
eine Ringofenziegelei in Fürstenwalde. Kurz nach der<br />
Jahrhundertwende wurde von der “Terrain-Ges. Stahnsdorf<br />
<strong>GmbH</strong>” in zwei Schritten eine an den Teltowkanal, den Centralfriedhof<br />
Südwest und die Kgl. Parforce-Jagdhaide angrenzende<br />
Fläche von 270 ha (fast die Hälfte der Fläche des heutigen<br />
Ortes Stahnsdorf!) erworben, 1907 Umfirmierung in „Stahnsdorfer<br />
Terrain-AG am Teltowkanal“. Die vollständige Eröffnung<br />
des Teltowkanals 1906 sowie die projektierte Bahn Wannsee-<br />
Centralfriedhof und die Verlängerung der Straßenbahn Gr.-<br />
Lichterfelde-Ost-Kl.-Machnow zum Centralfriedhof schuf die<br />
perfekte Verkehrsanbindung an Berlin, die Grundstücke verkauften<br />
sich deshalb gut und waren 1923 restlos verwertet.<br />
1925 scheiterte ein Antrag auf Auflösung der AG am Widerstand<br />
des Großaktionärs (Michael-Konzern). Eine Ende der<br />
1920er Jahre geplante Kapitalerhöhung zum Erwerb neuer<br />
Terrains in Stahnsdorf kam im Strudel der Weltwirtschaftskrise<br />
nicht mehr zur Durchführung, Ende der 1930er Jahre verliert<br />
sich die Spur in den Börsenhandbüchern.<br />
Los 12 Schätzwert 225-375 €<br />
Actien-Baugesellschaft<br />
Werderscher Markt<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM von 1886.<br />
Gründeraktie (Auflage 1750, R 7) VF+<br />
Großformatiges Papier.<br />
Der 1886 gegründeten Gesellschaft gehörten die Grundstücke<br />
Werderscher Markt 10 und Werderstr. 7 in Berlin. Das von der<br />
Gesellschaft 1886/88 erbaute Werderhaus war das erste vom<br />
damaligen Star-Architekten Messel entworfene Geschäftshaus<br />
(zugleich war Messel auch Vorstand dieser AG). Als Messels<br />
Hauptwerk gilt das Warenhaus Wertheim an der Leipziger Straße,<br />
das er zwischen 1896 und 1906 ausführte. Aber auch<br />
Wohnanlagen und Bankgebäude (so das Hauptgebäude der<br />
Berliner Handelsgesellschaft) gehörten zu seinen Werken. Die<br />
Grundstücke Werderscher Markt und Werderstr. 7 in Berlin<br />
wurden Anfang 1935 verkauft, danach besaß die AG nur noch<br />
das Grundstück Waisenhausstr. 19 in Dresden (1935 übernahm<br />
die Dresdner Bank die sächsischen Geschäfte des Bankhauses<br />
Gebr. Arnhold, dies Geschäft wurde als selbständige<br />
Abteilung “Waisenhausstraße” weitergeführt). Wenig später<br />
wurde die Gesellschaft auf ihren Großaktionär, die Dresdner<br />
Bank, verschmolzen.<br />
Los 13 Schätzwert 225-375 €<br />
Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />
Essen, Prior.-St.-Actie 2.000 Mark<br />
31.1.1896 (Auflage nur 60 Stück, R 7) VF<br />
Mit Originalunterschriften (u.a. Carl Funke).<br />
Gründung 1872. Übernommen wurden später die Phönix-<br />
Brauerei <strong>GmbH</strong> in Essen (1931), die Kronen-Brauerei AG in Essen-Borbeck<br />
(1932), die Dortmunder Stifts-Brauerei Carl Funke<br />
AG (1936). 1939 Erwerb der Aktienmehrheit bei der Dom-<br />
Brauerei Carl Funke AG und der Hitdorfer Brauerei AG in Köln-<br />
Hitdorf, gleichzeitig Umfirmierung in Essener Aktien-Brauerei<br />
Nr. 11 Nr. 12<br />
Carl Funke AG. 1963 erneute Umfirmierung in Stern-Brauerei<br />
Carl Funke AG. 1969 Erwerb der Brauerei zum Schiff J. Peter<br />
Wahl <strong>GmbH</strong> in Kaufbeuren. 1998 Sitzverlegung nach Köln, umfirmiert<br />
in Dom-Brauerei AG, Spezialitäten sind DOM Kölsch<br />
und Rats Kölsch. Bis 1934 in Essen, danach in Düsseldorf börsennotiert.<br />
Seit 2008 nach Insolvenz als <strong>GmbH</strong> weitergeführt.<br />
Nr. 14<br />
Werderscher Markt, Aquatinta von Friedrich August Calau um 1810<br />
Los 14 Schätzwert 100-200 €<br />
Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />
Essen, Aktie 1.000 Mark Juni 1914<br />
(Auflage 500, R 5) EF-VF<br />
Los 15 Schätzwert 150-250 €<br />
Actien-Malzfabrik Cönnern<br />
Cönnern, Actie IV. Emission 1.200 Mark<br />
15.5.1889 (Auflage 200, R 7) EF-VF<br />
Großformatiges Papier. Originalunterschriften.<br />
Gegründet 1872. Die Malzfabrik hat eine überraschend interessante<br />
Baugeschichte: Einst ein mächtiges Kloster, das von<br />
Otto II. (955-983) sogar zum Reichskloster erhoben wurde,<br />
kam die Anlage 1563 an die Fürsten von Anhalt-Köthen, die die<br />
Klausurgebäude in ein Schloß umbauten. Später Witwensitz,<br />
1871 an einen Industriellen verkauft, der das direkt am Bahnhof<br />
der wichtigen Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahn<br />
liegende Gebäude zu einer Malzfabrik umbaute. 1917<br />
kaufte die Gesellschaft die Eisengiesserei Saalhütte in Könnern,<br />
1918 die Aktien-Malzfabrik Niemberg und erwarb 1918<br />
sämtliche Hausgrundstücke, Fabrikanlagen und Inventar der<br />
Schlossmälzerei AG von Th. Schmidt & Co. in Nienburg (Saale).<br />
1931/32 Umwandlung einer großen Forderung an die Bierbrauerei<br />
Gebr. Müser AG in Bochum-Langendreer in eine maßgebliche<br />
Beteiligung. Börsennotiz in Halle (Saale), seit 1934 im<br />
Freiverkehr Leipzig. Die AG wurde 1961 zwecks Abwicklung<br />
verlagert nach Hamburg, 1962 aufgelöst, 1971 im Handelsregister<br />
gelöscht. Das Werk in Könnern wurde 1948 enteignet<br />
und als VEB Malzfabrik Könnern weitergeführt, nach der Wende<br />
1993 stillgelegt. Die Ruine, für deren Abriss sich die Stadt<br />
Könnern aktuell um Fördergelder bemüht, ist heute ein<br />
Schandfleck im Stadtzentrum, der zudem den Zugang zum historisch<br />
bedeutenden alten Klosterhof versperrt.<br />
Los 16 Schätzwert 50-125 €<br />
Actien-Malzfabrik Sangerhausen<br />
Sangerhausen, Aktie 1.500 Mark Mai<br />
1922 (Auflage 1200, R 3) EF<br />
Gründung 1872. Die guten Dividenden von über 10 % der<br />
hochrentablen Gesellschaft fanden ein jähes Ende, als die Fabrik<br />
1911 völlig abbrannte. Sie wurde aber wiederaufgebaut.<br />
1952 Zusammenschluss mit der Mammut-Bräu zur Brauereiund<br />
Malzfabrik Sangerhausen, heute immer noch als Mammut<br />
Getränke <strong>GmbH</strong> existent.<br />
Los 17 Schätzwert 25-100 €<br />
Actien-Malzfabrik Sangerhausen<br />
Sangerhausen, Aktie 1.500 Mark Sept.<br />
1923 (Auflage 1400, R 3) EF<br />
Los 18 Schätzwert 250-500 €<br />
Actien-Zucker-Fabrik Wetterau<br />
Friedberg, Aktie Lit. C 300 Mark<br />
1.6.1884. Gründeraktie (Auflage<br />
insgesamt 2784 verteilt auf die Litera A,<br />
B und C, R 5). VF+<br />
Äußerst dekorativ mit Fabrikansicht und Eisenbahn<br />
im Hintergrund. Originalunterschriften.<br />
Gegründet 1882 mit einem Kapital von 835.200 M (eingeteilt<br />
in zusammen 2.784 Aktien Lit. A, B und C). Eingerichtet wurde<br />
die Fabrik durch das Fürstl. Stolberg. Hüttenamt in Ilsenburg<br />
(Harz). Namhafte Erweiterungen 1894 und 1910-14, wodurch<br />
die Verarbeitungskapazität auf mehr als 1 Mio. Ztr. Rüben im<br />
Jahr mehr als verdoppelt wurde. 1938 Angliederung einer Kartoffelflockenfabrik.<br />
1944/45 wurde das Werk bei Bombenangriffen<br />
zu 60 % zerstört (Wiederaufbau 1948 abgeschlossen).<br />
Bis 1966 wurde die Verarbeitungskapazität erneut verdoppelt.<br />
1982 - genau 100 Jahre nach der Gründung - mit der Südzucker<br />
verschmolzen, die inzwischen alle Aktien erworben hatte.<br />
Die Zuckerfabrik in Friedberg wurde danach abgerissen.<br />
Los 19 Schätzwert 300-375 €<br />
Actien-Zuckerfabrik Alleringersleben<br />
Alleringersleben, Aktie 1.500 Mark<br />
31.12.1921 (Auflage nur 30 Stück, R 8),<br />
ausgestellt auf den Gutspächter Werner<br />
Bethge in Morsleben EF-VF<br />
Großes Hochformat, Originalunterschriften.<br />
Gründung 1889. Herstellung von Zucker und Sirup, Trocknung<br />
von landwirtschaftlichen Produkten sowie Herstellung von Ziegeleifabrikaten.<br />
1922/23 Umstellung auf Weißzucker-Produktion.<br />
Die Fabrik hatte Eisenbahnanschluß an die Marienborn-<br />
Beendorfer Kleinbahn. Ihr Ende war 1961 die Schließung der<br />
innerdeutschen Grenze, als der Ort nahe dem Grenzübergang<br />
Helmstedt-Marienborn im Sperrgebiet zu liegen kam.<br />
3
Los 20 Schätzwert 75-150 €<br />
Actien-Zuckerfabrik Niederndodeleben<br />
Niederndodeleben, Aktie 500 RM<br />
20.11.1929 (Auflage 900, R 5),<br />
ausgestellt auf Moritz Schmidt,<br />
Niederndodeleben EF+<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesener Jahrgang.<br />
Erbaut wurde die bei Magdeburg gelegene Fabrik 1872 von<br />
der Fürstl. Stolberg’schen Maschinen-Fabrik. 1943 beteiligt an<br />
der Zuckerfabrik Magdeburg AG, Magdeburg-Sudenburg. Diese<br />
nahm die Gesellschaft 1945 neben 8 weiteren Zuckerfabriken<br />
auf, 1950/51 Zusammenschluss zur VVB Zuckerraffinerie<br />
Magdeburg. Die letzte Kampagne in Niederdodeleben fand im<br />
Herbst 1956 statt. Danach diente das Betriebsgelände als Wirtschaftshof<br />
der LPG Clement Gottwald, seit 1990 Agro Bördegrün<br />
<strong>GmbH</strong> und Co. KG.<br />
Los 21 Schätzwert 200-250 €<br />
Ada-Ada-Schuh AG<br />
Frankfurt am Main-Hoechst, Aktie 100<br />
RM Dez. 1941 (Auflage 600, R 9) EF<br />
Gründung 1900 als „R. & W. Nathan oHG“, AG seit 1937. In der<br />
Fabrik Leverkuser Str. 31 und Ludwigshafener Str. 59 wurden<br />
(wörtlich:) Kinder-, Backfisch- und Damenschuhe hergestellt.<br />
Börsennotiz Frankfurt. 1945 beschäftigte die Fabrik 200 Mitarbeiter<br />
und produzierte reine Gebrauchsware. Ende der 1950er<br />
galt Ada-Ada als einer der führenden Schuhhersteller Deutschlands.<br />
Das Unternehmen existierte bis 1966, anstelle des Firmengebäudes<br />
steht heute ein Wohnkomplex.<br />
Los 22 Schätzwert 300-750 €<br />
Adam Opel AG<br />
Rüsselsheim, Aktie 10.000 RM 20.8.1941<br />
(Auflage 2000, R 7) VF<br />
Mit zwei Opel-Firmenzeichen in der Umrahmung,<br />
Faksimile-Unterschrift Wilhelm von Opel als AR-Vorsitzender.<br />
Von den 250 Aktien aus dem Reichsbank-<br />
Schatz waren nur 28 Stück fachgerecht zu restaurieren,<br />
der Rest weist irreparable Schäden auf.<br />
Adam Opel (1837-1895) gründete nach seinen Lehr- und Wanderjahren<br />
1862 in Rüsselsheim eine Nähmaschinenfabrik. 1887<br />
Beginn der Fahrradproduktion - 40 Jahre später ist Opel eine der<br />
größten Fahrradfabriken der Welt (Opel produzierte über 2,5 Mio.<br />
Fahrräder, 1937 wird die Fahrradproduktion eingestellt). 1899<br />
wird in Rüsselsheim das erste Auto hergestellt, ein Opel Patent-<br />
Motorwagen System Lutzmann mit 4 PS. 1911 wird die Fabrik<br />
durch einen Großbrand fast völlig zerstört; nach Herstellung von 1<br />
Mio. Einheiten wird danach die Nähmaschinenproduktion nicht<br />
wieder aufgenommen. 1924 Beginn der Großserienproduktion von<br />
4<br />
Automobilen und Einführung von Fließbändern. 1928 Umwandlung<br />
der Adam Opel KG in eine Aktiengesellschaft; das für die damalige<br />
Zeit hohe Kapital von 60 (später 80) Mio. RM war ausschließlich<br />
in Aktien zu 10.000 RM eingeteilt, die an keiner Börse<br />
notiert waren. 1929 Übernahme durch General Motors. 1935 führt<br />
Opel als erster deutscher Hersteller die selbsttragende Ganzstahlkarosserie<br />
ein (“Olympia”). 1945 ist über die Hälfte der Werksanlagen<br />
zerstört, trotzdem läuft ein Jahr darauf der Automobilbau<br />
wieder an (Opel Blitz Lastwagen, Olympia). 1962 nimmt das Werk<br />
Bochum mit dem Opel Kadett die Produktion auf. 1981 Inbetriebnahme<br />
eines Motorenwerkes in Kaiserslautern. 1983 wird der 20millionste<br />
Opel gebaut. Nach der Wende Errichtung eines ganz<br />
neuen Werkes in Eisenach (wo zu DDR-Zeiten der “Wartburg” gebaut<br />
wurde). Nach vielen goldenen Jahren kämpfen die deutschen<br />
Opel-Werke, auch wegen der immensen Schwierigkeiten der Mutter<br />
General Motors, heute um ihre Existenz.<br />
Los 23 Schätzwert 50-125 €<br />
Adler- und Hirsch-Brauerei AG<br />
Köln, Aktie 100 RM 24.7.1931 (Auflage<br />
1415, R 4) EF<br />
Kapitalerhöhung zum Zwecke der Übernahme der<br />
Adler-Brauerei.<br />
Bei der Gründung im Jahr 1900 brachte die Hirschbrauerei<br />
Gebr. Steingroever in Köln-Bayenthal 14 Grundstücke mit aufstehenden<br />
Brauereigebäuden und alles Inventar ein. Die Brauerei<br />
hatte eine Leistungsfähigkeit von 100.000 hl im Jahr. 1918<br />
Übernahme des Malzkontingents der Rhein. Brauerei-Gesellschaft<br />
in Cöln-Alteburg. 1931 Fusion mit der Adler-Brauerei AG<br />
und Umfirmierung in Adler- und Hirsch-Brauerei AG. Gelegentlich<br />
der Übernahme der Aktienmehrheit durch die Essener Aktien-Brauerei<br />
Carl Funke AG (die spätere Stern-Brauerei Carl<br />
Funke AG, die 1998 schließlich in Dom-Brauerei AG umfirmierte<br />
und den Sitz nach Köln verlegte) 1938/39 Umfirmierung in<br />
Dom-Brauerei Carl Funke AG. Obwohl die Mälzerei in Köln-Ehrenfeld<br />
1943/44 total zerstört wurde, war die Dom-Brauerei<br />
schon in den 60er Jahren wieder die größte Brauerei in Köln.<br />
1972 völlig in die Essener Stern-Brauerei eingegliedert.<br />
Los 24 Schätzwert 10-50 €<br />
Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG<br />
Frankfurt a.M., Aktie 100 RM Jan. 1935<br />
(Auflage 7640, R 2, kpl. Neudruck der<br />
100-RM-Aktien) EF<br />
Firmensignet (stilisiertes Speichenrad mit flügelschwingendem<br />
Adler) im Unterdruck.<br />
Gegründet 1880 als Maschinen- und Velociped-Handlung von<br />
Kommerzienrat Dr.-Ing. h.c. Heinrich Kleyer, AG seit 1895. Die ab<br />
1896 von Kleyer produzierten Schreibmaschinen waren gegenüber<br />
den bis dahin erhältlichen amerikanischen Modellen so weit<br />
verbessert, daß sie die Büros im Sturm eroberten. 1900 wurde<br />
mit dem Bau von Automobilen begonnen. Auch hier sind die Adlerwerke<br />
so erfolgreich, daß am Vorabend des 1. Weltkrieges jeder<br />
fünfte Motorwagen in Deutschland ein Adler war. In den 30er<br />
Jahren waren die Adlerwerke Pionier bei der Entwicklung strömungsgünstiger<br />
Karosserien (lange bevor es den cw-Wert gab).<br />
Noch in den 50er Jahren, als Adler groß in den Motorradbau eingestiegen<br />
war, gelangen Konstruktionen von solcher Qualität und<br />
Reife, daß sie von den Japanern noch 10 Jahre später detailgetreu<br />
kopiert wurden. 1980 Unternehmenspachtvertrag mit der<br />
Triumph Werke Nürnberg AG (die dabei in TRIUMPH-ADLER AG<br />
für Büro- und Informationstechnik umfirmierte; sie war 1896 als<br />
“<strong>Deutsche</strong> Triumph-Fahrradwerke” durch die englische Triumph<br />
Cycle Company Ltd. in Coventry gegründet worden, 1957 verkaufte<br />
die Dresdner Bank ihre Triumph-Aktienmehrheit an Max<br />
Nr. 22 Nr. 27<br />
Grundig, seit 1985 TA Triumph-Adler AG, später eine reine Beteiligungsholding<br />
mit dem Puppenhersteller Zapf Creation AG als<br />
bekanntester Tochter). Die immer noch börsennotierte Adlerwerke<br />
vorm. Heinrich Kleyer AG, deren Großaktionäre erst zu über 90<br />
% die Philipp Holzmann AG und später die HBAG Real Estate AG<br />
in Hamburg (heute nach Verschmelzung AGIV Real Estate AG;<br />
50,29 %) und der schillernde Heidelberger Immobilienunternehmer<br />
Roland Ernst (48 %) waren, wurde 1999 umbenannt in “Adler<br />
Real Estate AG”. Aus dem stillgelegten Werk auf dem fast<br />
200.000 qm großen Areal neben dem Frankfurter Hauptbahnhof<br />
wurde ein Gewerbepark.<br />
Los 25 Schätzwert 75-150 €<br />
Adolf Döbel & Co. Mechanische<br />
Woll- und Wirkwaren Fabrik AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 17.5.1923<br />
(Auflage 76000, R 7) EF<br />
Gründung im März 1923. Fortführung der oHG Adolf Döbel &<br />
Co. Sehr kurzlebiges Berliner Unternehmen, bereits im Aug.<br />
1924 Konkursverfahreneröffnung.<br />
Los 26 Schätzwert 50-150 €<br />
AG Actien-Bau-Verein Unter den Linden<br />
Berlin, 4 % Teilschuldv. Lit. B. 2.000 Mark<br />
April 1906 (Auflage 1500, R 3) EF<br />
Gründung 1872. Die Gesellschaft besaß die Grundstücke Unter<br />
den Linden 17/18 (früher ein Hotel, dann vermietet an die<br />
Z.E.G und vermietete Läden), Behrenstr. 55/57 (Metropol-The-<br />
ater, Geschäftslokale, Privatwohnungen) Leipziger Strasse<br />
75/67 (Geschäftshaus, die Hälfte hatte Wertheim inne), Leipziger<br />
Strasse 77 und Jerusalemer Strasse 21 (Restaurant, Geschäftsräume<br />
und das Reichshallentheater) sowie Behrensstr.<br />
53/54 (Läden, Restaurants, das Palais de danse, Pavillon Mascotte,<br />
Metropol-Cabaret). 1919 trat die Gesellschaft in Liquidation,<br />
1923 erlosch sie. Rechtsnachfolgerin war die “Leipzigerstr.<br />
75/76 Grundstücks-<strong>GmbH</strong>”, die die noch in Umlauf befindlichen<br />
Teilschuldv. von 1906 einlöste.<br />
Los 27 Schätzwert 600-750 €<br />
AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor<br />
München, Actie 500 Gulden 1.1.1862.<br />
Gründeraktie (Auflage geplant 3000,<br />
begeben aber nur 1271, R 8) VF-<br />
Hochdekorativ mit Fabrikansicht und zwei alten<br />
Produktionsgeräten in der floralen Umrandung. Mit<br />
Originalunterschriften. Eine der wichtigsten deutschen<br />
Gründeraktien.<br />
Gründung 1862 als AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor. Wie<br />
viele andere Textilbetriebe dieser Zeit wurde das Werk auf der<br />
grünen Wiese errichtet. Arbeitskräfte waren in der armen, sonst<br />
kaum industrialisierten Gegend leicht zu erhalten. Nach und<br />
nach entwickelte sich der Kolbermoor-Konzern zu einer der<br />
größten Textilgruppen in Deutschland, deren Blütezeit in den<br />
20er/30er Jahren des 20. Jahrhunderts lag: In diese Zeit fällt<br />
auch der Kauf der wertvollen Töchter (Baumwollspinnerei Unterhausen,<br />
Spinnerei und Weberei Kempten, Spinnerei und Weberei<br />
Momm/Kaufbeuren und Spinnerei und Weberei Pfersee in<br />
Augsburg). Den ersten Textilkrisen noch ohne Rückgriff auf stille<br />
Reserven trotzend, wurde die vor allem auf Handstrickgarn<br />
spezialisierte Spinnerei Anfang der 80er Jahre langsam ein Sanierungsfall<br />
- was die Firmenleitung dank excellenter Erträge<br />
der viel größeren Tochtergesellschaften lange kaschierte und<br />
der Großaktionär Bayerische Vereinsbank nicht wahrhaben<br />
wollte. Die 1987 als Rettungsversuch unternommene Fusion<br />
mit der bedeutendsten Tochter zur Pfersee-Kolbermoor AG und<br />
eine komplette Betriebsumstellung wurde ein Fiasko: Der gerade<br />
erst für zig Millionen völlig neu eingerichtete und noch um<br />
eine Weberei erweiterte Betrieb in Kolbermoor mußte nach<br />
kaum mehr als einem Jahr Betriebszeit stillgelegt werden. Die<br />
BV verkaufte bald darauf ihre Aktienmehrheit an die Frankfurter<br />
Wisser-Dienstleistungsgruppe, die ein Auge auf den immens<br />
wertvollen Grundbesitz von Pfersee-Kolbermoor geworfen<br />
hatte. Außerdem konnte man noch für viel Geld die Wasserkraftwerke<br />
versilbern: Aus historischen Gründen war die<br />
Spinnerei Kolbermoor nämlich auch Energieversorgungsunternehmen<br />
für die ganze Stadt Kolbermoor, und auf die Gelegenheit<br />
hatten die Isar-Amperwerke schon lange gewartet. Heute<br />
eine reine Vermögensverwaltungs-, Immobilien- und Dienstleistungsholding.<br />
AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor: Werksansicht der Spinnerei um 1947<br />
Los 28 Schätzwert 500-625 €<br />
AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor<br />
München, Aktie 1.000 Mark 15.2.1910<br />
(Auflage 500, R 8) VF<br />
Hochdekorativ mit zwei Fabrikansichten; barocke<br />
Zierumrandung mit floralen Motiven.<br />
Los 29 Schätzwert 150-250 €<br />
Baumwollspinnerei Kolbermoor<br />
München/Kolbermoor, Aktie 1.000 Mark<br />
28.12.1920 (Auflage 4000, R 8) EF-VF<br />
Äußerst dekoratives, großformatiges Stück mit<br />
zwei Vignetten, die Werksansichten von 1862 und<br />
1910 zeigen. Fleckig.<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.
Los 30 Schätzwert 300-400 €<br />
AG Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt<br />
Ingolstadt, Aktie 100 RM 1.3.1943<br />
(Auflage 1300, R 9) VF+<br />
Identische Gestaltung wie folgendes Los. Gründung 1882 zur<br />
Fortführung der Brauerei von Jakob Engl. 1899 Erwerb der Kritschenbrauerei<br />
in Ingolstadt und der Aktienbrauerei Ingolstadt.<br />
1934/35 wurden das Anwesen “Schutterwirt” in Ingolstadt,<br />
1935/36 ein großes Bierdepot und zwei Gastwirtschaften in Regensburg<br />
sowie der “Fränk. Hof” in Ingolstadt erworben. Nach<br />
dem 1. Weltkrieg wurde die einzige Ingolstädter Weizenbierbrauerei,<br />
das Weißbräuhaus, übernommen. Das Absatzgebiet der<br />
Brauerei mit den Marken Herrnbräu und Bernadett Brunnen (Mineralwasser)<br />
umfaßt hauptsächlich den mittelbayerischen Raum.<br />
Seit 1948 in München amtlich börsennotiert. Lange Zeit war die<br />
Bayerische Landesbank Mehrheitsaktionär. 2006 dann Verkauf an<br />
Immobilien-Investoren. Das Brauereigeschäft (Herrnbräu) wurde<br />
2003 abgespalten, die AG 2006 umbenannt in BBI Bürgerliches<br />
Brauhaus Immobilien AG. Tätigkeitsschwerpunkt ist heute neben<br />
dem Brauereigeschäft die Verwaltung eines hauptsächlich aus<br />
Einkaufsmärkten bestehenden Immobilien-Portfolios.<br />
Los 31 Schätzwert 400-500 €<br />
AG Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt<br />
Ingolstadt, Aktie 1.000 RM 1.3.1943<br />
(Auflage 410, R 10) VF<br />
Bis dahin völlig unbekannt gewesen, nur 5 Stück<br />
wurden im Reichsbankschatz gefunden.<br />
Nr. 32<br />
Nr. 31 Nr. 37<br />
Los 32 Schätzwert 50-125 €<br />
AG der Chemischen Produkten-<br />
Fabriken Pommerensdorf-Milch<br />
Stettin, Aktie 100 RM 15.11.1932<br />
(Auflage 9400, R 5) EF<br />
Gründung 1857 als „AG der chemischen Produkten-Fabrik Pommerensdorf“.<br />
Hergestellt wurden Schwefel- und Salzsäure, Glaubersalz,<br />
Soda, Antichlor, Sulfat und Futternährsalze sowie Kunstdünger.<br />
Die Gesellschaft war an der Kleinbahn Kasekow - Pekun<br />
(Oder) beteiligt, welche an Pommerensdorf vorbeiführt. Zweigniederlassung<br />
in Wolgast. Nach der Jahrhundertwende entwikkelte<br />
sich die Produktion von Superphosphat zum Hauptgeschäft.<br />
Mit Übernahme der „Chemische Fabrik Milch AG“ in Berlin-Oranienburg<br />
im Jahr 1927 konnte für diesen Produktionszweig Ersatz<br />
für die verlorengegangene Fabrik in Posen geschaffen werden.<br />
1936 übernahm die Gesellschaft ein größeres Aktienpaket<br />
der „Guano-Werke AG“ in Hamburg, das aber 1938 wieder abgestoßen<br />
wurde. 1941 Übernahme einer 50 %igen Beteiligung<br />
an der „Chemische Werke Lobau-Wartheland <strong>GmbH</strong>“ bei Posen,<br />
außerdem bestand schon länger eine Beteiligung an der 1913<br />
gegründeten „Chemische Industrie AG“ in Danzig. Die Aktien waren<br />
in Stettin (bis 1934), Berlin und Frankfurt/Main börsennotiert.<br />
Großaktionäre waren bei Kriegsende die WASAG und die Metallgesellschaft.<br />
Nach 1945 Nationalisierung des Unternehmens. Ab<br />
1994 wieder eigenständige AG polnischen Rechts, 2002 von der<br />
Lubon Management Sp. z.o.o. übernommen worden.<br />
Los 33 Schätzwert 500-625 €<br />
AG der vereinigten Kleinbahnen der<br />
Kreise Köslin-Bublitz-Belgard<br />
Köslin, Aktie 1.000 Mark 1.4.1909<br />
(Auflage nur 28 Stück, R 8) VF<br />
Mit Originalunterschriften.<br />
Bereits seit 1859 waren die beiden hinterpommerschen Kreisstädte<br />
Belgard und Köslin untereinander sowie mit der Provinzhauptstadt<br />
Stettin durch die Strecke Stargard-Danzig der Berlin-<br />
Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft verbunden. Der Nachbarkreis<br />
Bublitz dagegen erhielt erst 1896 Anschluß an die Preußische<br />
Staatsbahn, und in der Fläche mangelte es weiterhin an Eisenbahnverbindungen<br />
So gründete man 1898 die “AG Kleinbahn<br />
Köslin-Natzlaff” zum Bau der noch im gleichen Jahr eröffneten 32<br />
km langen 750-mm-Schmalspurbahn Köslin-Manow-Viverow-<br />
Nr. 33 Nr. 36<br />
Natzlaff. Generalbauunternehmer war die Lokomotivfabrik Krauss<br />
aus München. 1904 Erweiterung des Unternehmens durch den<br />
Bau der Kleinbahnen Manow-Bublitz (34 km), Schwellin-Belgard<br />
(32 km) sowie 1908/09 Belgard-Rarfin (20 km). 1905 wurde die<br />
AG wie oben umbenannt, um das erweiterte Tätigkeitsgebiet zum<br />
Ausdruck zu bringen. Einschließlich der von der Kreiseisenbahn<br />
Schlawe gepachteten Strecke Natzlaff-Jatzingen-Pollnow (12 km)<br />
betrug die Betriebslänge aller Strecken nun 130 km. Außerdem<br />
betrieb die Ges. die von Köslin ausgehenden Kraftomnibuslinien<br />
nach Pollnow (37 km), Bublitz (40 km), Warnin (30 km) und Jamund<br />
(7 km). 1932 erneute Umfirmierung in “Köslin-Bublitz, Belgarder<br />
Kleinbahn AG”. Ab 1937 Betriebsführung durch die Landesbahndirektion<br />
Pommern, 1940 verlor die AG ihre Selbständigkeit<br />
und wurde Teil der Pommerschen Landesbahnen. Nach<br />
Kriegsende wurden die Strecken der Polnischen Staatsbahn PKP<br />
unterstellt, aber noch 1945 wurde das gesamte Oberbaumaterial<br />
von den Sowjets abgebaut und abtransportiert. Die PKP baute die<br />
Strecken danach in Meterspur wieder auf und nahm sie ab 1948<br />
schrittweise wieder in Betrieb. Zugleich entstand in Köslin das<br />
dritte Bahnbetriebswerk des pommerschen Schmalspurnetzes.<br />
Wie alle anderen öffentlichen Schmalspurbahnen in Polen auch<br />
wurde auch das pommersche Netz von der PKP 2001 stillgelegt.<br />
Seit 2005 bemüht sich der “Verein der Freunde der Koszaliner<br />
Schmalspurbahn” um eine Wiederinbetriebnahme.<br />
Los 34 Schätzwert 30-75 €<br />
AG Electricitäts-Werke<br />
Liegnitz, Aktie 1.000 RM Okt. 1941<br />
(Auflage 900, R 3) EF<br />
Gründung 1898. Stromversorger für Mittelschlesien. Großaktionär<br />
(1943): Elektro-Werke AG, Berlin bzw. Viag (56,6%).<br />
1986 verlagert nach Bad Homburg v.d.H.<br />
Los 35 Schätzwert 300-375 €<br />
AG Elektricitätswerke<br />
(vorm. O. L. Kummer & Co.)<br />
Dresden, Actie 1.000 Mark 28.5.1896<br />
(Auflage 1000, R 10) VF+<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1894 zur Übernahme der Kummer’schen Fabrik für<br />
Elektrotechnik, Mechanik und Maschinenbau in Niedersedlitz.<br />
Außerdem baute und betrieb die Gesellschaft die normalspurigen<br />
elektrischen Bahnen Murnau-Oberammergau und Aibling-Jenbach-Wendelstein<br />
(Eröffnung 1897), jeweils an die<br />
Kgl. Bayr. Staatsbahn anschließend. Kurz nach der Jahrhundertwende<br />
ging die AG spektakulär pleite. Als Auffanggesellschaft<br />
gründeten die Gläubigerbanken die Sachsenwerk Lichtund<br />
Kraft-AG, die sich zu einem sehr bedeutenden, elektrotechnischen<br />
Betrieb entwickelte und später Teil des AEG-Konzerns<br />
wurde.<br />
Los 36 Schätzwert 500-625 €<br />
AG „Ems“<br />
Emden, Actie 1.000 Mark 1.6.1900<br />
(Auflage 150, R 8) VF<br />
Originalunterschriften.<br />
Gründung 1843 als Dampfschiffsgesellschaft Concordia, 1889<br />
Umwandlung in die Actien-Gesellschaft “Ems”. Fährverbindungen<br />
Emden-Borkum, Borkum-Helgoland, Borkum-Norderney,<br />
Borkum-Delzijl, Norderney-Helgoland. 2 der 5 Personendampfer<br />
gingen im 2. Weltkrieg verloren. 1949 Neubau einer Großgarage<br />
bei der Abfahrtstelle in Emden-Außenhafen, nachdem<br />
sich der Fährverkehr nach Borkum immer mehr zum wirtschaftlichen<br />
Rückgrat der AG entwickelte. Außerdem besitzt die<br />
AG „Ems“ die „Borkumer Kleinbahn- und Dampfschiffahrt AG“<br />
(heute eine <strong>GmbH</strong>), das Inselhotel VierJahresZeiten auf Borkum<br />
sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Ostfriesische Lufttransport<br />
<strong>GmbH</strong> (22 Flugzeuge) und der Ostsee-Flug Rügen <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 37 Schätzwert 225-300 €<br />
AG “Erholung”<br />
Krefeld, Aktie 100 RM 1.1.1930 (Auflage<br />
1600, R 9), ausgestellt auf Weihbischof<br />
Dr. Hermann Sträter, Aachen EF-VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, nur 6 Stück wurden<br />
jetzt im Reichsbankschatz gefunden.<br />
Schon 1832 taucht der Name in Zusammenhang mit Statuten<br />
einer auf dem Drießenhof gegründeten Gesellschaft auf, über<br />
deren Schicksal aber so gut wie nichts bekannt ist. 1862 ist zu<br />
erfahren, dass 70 Mitglieder eines katholischen Lesevereins<br />
sich im Hantenschen Weinhaus (heute Schwambornplatz) treffen.<br />
1874 dann kommt es zu Gründung der Aktien-Gesellschaft<br />
“Erholung” zwecks Betrieb eines Gesellschaftshauses und einer<br />
Weinkellerei nebst Groß- und Kleinvertrieb von Weinen und<br />
sonstigen Getränken. Nach der völligen Zerstörung des Gesellschaftshauses<br />
im Zweiten Weltkrieg dauerte es lange, bis man<br />
ernsthaft an einen Wiederaufbau herangehen konnte. Ende<br />
1949 entstand auf dem Grundstück Dionysiusplatz 22 ein eingeschossiger<br />
Neubau. 1952 kam es zu einer umfangreichen<br />
Renovierung. Die Gaststätte “Am Kamin” wurde von vielen Krefeldern<br />
gern besucht und bestand bis 1968. Die 1950er und<br />
60er Jahre ließen das Gesellschaftleben wieder aufblühen:<br />
Vorträge, Ausflüge, Tanztees, Kostümfeste, Spargelessen,<br />
Weinverkostung u.ä. standen auf dem Programm. 1982 wurde<br />
die Erholung-Weinhandlung aus dem Handelsregister gelöscht.<br />
Heute hat der Verein kein Gesellschaftshaus mehr, aber 1999<br />
wurde noch einmal groß das 125jährige Bestehen gefeiert.<br />
Los 38 Schätzwert 100-125 €<br />
AG für Bergbau und Industrieverkehr<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Juni 1923<br />
(Auflage 30000, R 10) VF+<br />
Rechter Rand unegal durch Kuponabriß.<br />
Gründung 1919 als „AG für Internationalen Warenverkehr“ in<br />
Berlin-Neukölln. Beteiligungen bestanden an der „Westkohle“<br />
Westerwalder Braunkohlenwerke AG in Hergenroth (mit Gewerkschaften<br />
Gustavshall und Wilhelmsfund) und an der Sanag-Sanitäts-AG<br />
in Berlin. Im April 1926 in Liquidation, am<br />
7.11.1929 erloschen.<br />
5
Los 39 Schätzwert 25-100 €<br />
AG für Biervertrieb<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark März 1923<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Die 1900 gegründete AG übernahm die Berliner Generalvertretung<br />
der Pilsener Genossenschaftsbrauerei. Über vier Töchter-<br />
<strong>GmbH</strong>’s, Bierimport und Biervertrieb in Kannen und Flaschen.<br />
Als Alleinaktionär ist 1950 ein Mr. Arthur Kallman aus New York<br />
angegeben. 1953 nach Abschluß der Abwicklung gelöscht.<br />
Los 40 Schätzwert 200-250 €<br />
AG für Chemische Erzeugnisse<br />
Berlin, Aktie Lit. A 5.000 Mark 20.9.1923<br />
(Auflage 23260, R 8) EF-VF<br />
Sehr schöne kunstvolle Umrahmung.<br />
Gründung 1922. Erwerb der Chemischen Fabrik Sila <strong>GmbH</strong> in<br />
Oranienburg, 1923 der Seifenfabrik Ernst Helfert in Friedrichsfelde.<br />
1925 Eröffnung des Konkursverfahrens.<br />
6<br />
Nr. 38<br />
Nr. 41<br />
Los 41 Schätzwert 50-150 €<br />
AG für chemische Industrie<br />
Gelsenkirchen, Aktie 1.000 Mark<br />
1.6.1906 (Auflage 2000, R 3) VF<br />
Faksimile-Unterschrift des Bankiers Eltzbacher.<br />
Gründung 1872 in Köln. Zu den Gründern gehörten u.a. Friedrich<br />
Grillo, der A. Schaafhausen’sche Bankverein, Rudolph Poensgen<br />
und J.L. Eltzbacher. 1876 Sitzverlegung nach Gelsenkirchen-Schalke.<br />
Herstellung von Salzsäure, Schwefelsäure,<br />
Sulfat. 1970 wurde die Auflösung und 1976 die Fortsetzung<br />
der Gesellschaft beschlossen. Tätigkeitsgebiet ist nunmehr Erwerb<br />
und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere<br />
aus der Chemie, Bio- und Genforschung, Kosmetik,<br />
Elektronik und Kommunikation. Verwaltung des eigenen Vermögens,<br />
Erwerb und Veräußerung bzw. Verpachtung von<br />
Grundstücken und Gebäuden. 1983 Sitzverlegung nach Saarlouis<br />
und 1991 nach Hameln. Bis heute börsennotierte Gesellschaft,<br />
zuletzt eher ein Objekt aller möglichen Spekulationen.<br />
Los 42 Schätzwert 50-150 €<br />
AG für chemische Industrie<br />
Gelsenkirchen, Aktie 1.000 Mark<br />
15.4.1914 (Auflage 1000, R 5) EF-VF<br />
Faksimile-Unterschrift des Bankiers Eltzbacher. Identische<br />
Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 43 Schätzwert 200-400 €<br />
AG für Eisen-Industrie u. Brückenbau<br />
(vorm. Johann Caspar Harkort)<br />
Duisburg, Actie 400 Mark 1.6.1903<br />
(Auflage 3750, R 8) EF-VF<br />
“Vorliegende Actie dient als Ersatz für die gleichwerthige<br />
und gleichberechtigte Actie, die am<br />
9.7.1874 ausgestellt war und dieselbe Numerirung<br />
trug. Die alte Actie wurde vernichtet.”<br />
In der Familie tat sich um die Wende vom 18. zum 19. Jh. zunächst<br />
Friedrich Harkort mit einer mechanischen Werkstätte in<br />
Wetter hervor. Ein großer Teil der allerersten im Ruhrbergbau überhaupt<br />
eingesetzten Dampfmaschinen kam von ihm, und<br />
auch sonst betätigte er sich auf allen Gebieten des technischen<br />
Fortschritts. Bis zurück in das 17. Jh. reichen die Ursprünge<br />
der Eisenwaren- und Maschinenfabrik von Johann Caspar<br />
Harkort in Harkorten bei Haspe. 1846 wurde dann auf einem<br />
großen Gelände in Duisburg direkt am Rhein ein großartiges<br />
Brückenbau- und Eisenfabrikationsgeschäft errichtet, das<br />
1872 in eine AG umgewandelt wurde. Neben Schwimmdocks,<br />
Leuchttürmen, Silos, Fördergerüsten, Kränen wurden später<br />
auch Eisenbahnwagen aller Art gefertigt. Die Rotunde zur Weltausstellung<br />
in Wien 1873 verschaffte weltweite Anerkennung,<br />
wie auch bekannte Brückenbauwerke in Krefeld, Witten-Bommern,<br />
die Rheinbrücke bei Worms und die Glienicker Brücke in<br />
Berlin. 1928 beteiligte sich die Ges. am Bau der Rheinbrücke<br />
bei Köln-Mülheim. Dennoch waren die Kapazitäten in der Weltwirtschaftskrise<br />
nur zu einem Bruchteil ausgelastet, deshalb<br />
1931 Zahlungseinstellung und Vergleich. Die Werksanlagen<br />
wurden 1933 an die DEMAG (später Teil des Mannesmann-<br />
Konzerns) verkauft.<br />
Los 44 Schätzwert 200-250 €<br />
AG für Fuhrwesen<br />
Leipzig, Aktie 5.000 Mark 1.4.1923<br />
(Auflage 400, R 8) EF-VF<br />
Großes Querformat, hübsche Rosetten-Umrahmung.<br />
Aktien dieser kuriosen Ges. waren zuvor<br />
völlig unbekannt.<br />
Gründung 1889 zwecks Zusammenschluß und Fortbetrieb der<br />
Firmen ”Beerdigungsanstalt und Bazar für Fuhrwesen M. Ritter”<br />
und “Centralbasar für Fuhrwesen und Beerdigungsanstalt Pietät,<br />
vorm. A. A. Ritter”, außerdem Transport von Personen, Gütern,<br />
Paketen sowie Gegenständen jeder Art. Geschäftsansässig<br />
in Leipzig, Matthäikirchhof 32. Zudem 1921 Angliederung der<br />
Fuhrwerksbetriebe von Berger & Meyer und Robert Hellmann,<br />
Leipzig. Das Geschäft mit dem Tod florierte: Selbst in der Weltwirtschaftskrise<br />
wurden Dividenden bis zu 16 % erwirtschaftet.<br />
1934 umgewandelt in eine Kommanditgesellschaft (Beerdigungs-Anstalt<br />
und Bazar für Fuhrwesen M. Ritter KG).<br />
Los 45 Schätzwert 50-125 €<br />
AG für Kunstdruck<br />
Niedersedlitz, Aktie 100 RM Aug. 1933<br />
(Auflage 3700, R 5) UNC-EF<br />
Gründung 1896 als AG für Kunstdruck vorm. Willner & Pick, ab<br />
1900 AG für Kunstdruck. Erzeugung und Vertrieb photolithographischer<br />
und sonstiger auf graphischem Wege hergestellter<br />
Artikel. Erzeugt wurden: Reklamedruckarbeiten aller Art: Plakate,<br />
Affichen, Kalender, Reklamekarten, Katalogumschläge,<br />
Postkarten sowie Faltschachteln und Verkaufskästen.<br />
Los 46 Schätzwert 75-125 €<br />
AG für Lithoponefabrikation<br />
Triebes, Aktie 500 RM Juli 1926 (Auflage<br />
1600, R 8) UNC-EF<br />
Gründung 1901 als „Triebeser Farbenwerke“ zur Weiterführung<br />
einer gleichnamigen <strong>GmbH</strong> mit Werken in Triebes und<br />
Wünschendorf, 1905 Umfirmierung wie oben. Herstellung von<br />
Lithopone (das weiß deckende Pigment Zinksulfidweiß) und als<br />
Nebenprodukte Blanc-fixe und Glaubersalz. Der als Grundstoff<br />
benötigte Schwerspat wurde in einer eigenen Grube in Rothenkirchen<br />
gewonnen. Ab 1925 Interessengemeinschaft mit der<br />
Gewerkschaft Sachtleben. Nachdem die I.G. Farbenindustrie<br />
die Aktienmehrheit erworben hatte, wurde die Notiz an den<br />
Börsen Berlin und München 1926 eingestellt. 1947 enteignet<br />
und als landeseigener Betrieb fortgeführt.<br />
Los 47 Schätzwert 30-75 €<br />
AG für Seilindustrie<br />
vormals Ferdinand Wolff<br />
Mannheim, Aktie Lit. A 600 RM Juni 1928<br />
(Auflage 3800, R 3) EF-VF<br />
Wie auch das folgende Los vorher nicht bekannt<br />
gewesen.<br />
Gegründet 1890 unter Übernahme der seit 1830 bestehenden<br />
Firma Ferdinand Wolff, Mech. Hanf- und Drahtseilerei vorm.<br />
Joh. Jakob Wolff. Herstellung von Garnen und Seilen. Seit 1988<br />
als A.A.A. AG Allgemeine Anlageverwaltung vorm. Seilwolff AG<br />
von 1890, Frankfurt a.M. Entwicklung von Industrie- und Büroimmobilien.<br />
Nr. 48<br />
Los 48 Schätzwert 30-75 €<br />
AG für Seilindustrie<br />
vormals Ferdinand Wolff<br />
Mannheim, Aktie Lit. B 100 RM Aug. 1942<br />
(Auflage 3000, R 3) EF<br />
Los 49 Schätzwert 25-100 €<br />
AG für Verkehrswesen<br />
Berlin, Aktie Reihe A 1.000 Mark<br />
1.8.1906 (Gründeremission, Auflage<br />
2000, R 2) EF-VF<br />
Schöner G&D-Druck, Flügelrad-Vignette. Faksimile-Unterschrift<br />
Fürstenberg.<br />
Gründung 1901 durch die BHG unter Carl Fürstenberg (als<br />
BHF-Bank noch bis 1999 Großaktionär der AGIV) und die Privatbanken<br />
Rob. Warschauer & Co. (Berlin) sowie den A. Schaafhausen’schen<br />
Bankverein (Köln). Grundlegende Idee war, die<br />
im einzelnen eher unverkäuflichen Kleinbahnaktien in eine Holding<br />
einzubringen, für die man das anlagesuchende Publikum<br />
leichter interessieren konnte. Immerhin wurden ab 1892 bis<br />
zum 1. Weltkrieg ca. 300 Kleinbahnen gegründet. 1/3 davon<br />
baute die Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>, deren Hausbank die BHG war.<br />
Nach Fusionen mit der Allg. <strong>Deutsche</strong>n Eisenbahn-Ges. (1927),<br />
der Westdeutschen Eisenbahn-Ged. (1928) und der <strong>Deutsche</strong>n<br />
Eisenbahn-Ges. AG (1929) gehörten 102 Bahnen mit 4.100<br />
km Gesamtlänge über Betriebsführungsverträge zum Konzern,<br />
außerdem war die AGV Aktionärin dutzender weiterer Kleinbahnen.<br />
1949 Sitzverlegung nach Hamburg, 1954 nach Frankfurt.<br />
1973 Fusion mit der ALOKA Allgemeine Organisations- und<br />
Kapitalbeteiligungs-AG (früher: Allgemeine Lokal- und Straßenbahn<br />
AG) zur AG für Industrie und Verkehrswesen, kurz AGIV.<br />
Mit der BHF-Bank als Großaktionär jahrzehntelang eine Holding<br />
mit Beteiligungen im Maschinenbau-, Eisenbahn-, Verkehrs-,<br />
Energie- und Immobilienbereich. Ab 2000 Verkauf aller übrigen<br />
Aktivitäten und 2003 Verschmelzung mit der HBAG Real Estate<br />
AG (ehemals Kühltransit AG) zur “neuen” AGIV, danach ausschließlich<br />
im Immobiliengeschäft tätig. Ende 2004 endet die<br />
einst glorreiche Firmengeschichte mit dem Insolvenzantrag.<br />
Los 50 Schätzwert 500-625 €<br />
AG für Verwertung<br />
von Kartoffelfabrikaten<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 15.8.1918<br />
(Auflage 500, R 11) VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, nur 2 Stück wurden<br />
im Reichsbankschatz gefunden.<br />
Gründung 1912 zwecks Übernahme und Fortführung der Geschäftsbetriebe<br />
der “Verwertungsstelle für Kartoffelfabrikate<br />
mbH” in Berlin und der “Fabriken für Kartoffelfabrikate Frankfurt<br />
a.O. und Wronke <strong>GmbH</strong> i.L.”. Herstellung und Verwertung<br />
von Kartoffelmehl, Stärke, Sirup, Bonbonzucker, Dextrin und<br />
anderen Kartoffelfabrikaten. Fabriken zuletzt in Frankfurt a.O.,<br />
Zörbig und Rosenig, während die Fabriken in Wronke, Bronislaw<br />
und Birnbaum als Folge des 1. Weltkrieges 1919/20 an eine<br />
zu diesem Zweck neu gegründete poln. AG abgegeben werden<br />
mussten. Ab 1921 in Berlin börsennotiert. Ende 1925 nach<br />
erheblichen Verlusten in Liquidation gegangen.<br />
Los 51 Schätzwert 200-250 €<br />
AG für Zellstoff- und<br />
Papierfabrikation Memel<br />
Memel, Aktie 1.000 RM 1.5.1941<br />
(Auflage 6000, R 8) EF<br />
Gründung Dez. 1919. Hervorgegangen aus der 1898 gegründeten<br />
Cellulosefabrik Memel AG, die 1905 mit der AG für Maschinenpapier-<br />
(Zellstoff-) Fabrikation zur Aschaffenburger<br />
Zellstoffwerke AG fusionierte. Aufgrund des Versailler Vertrages,<br />
der die Abtrennung des Memelgebietes von Deutschland<br />
zur Folge hatte, wurde das Memeler Werk 1919/20 wieder in<br />
eine selbständige AG umgewandelt.<br />
Los 52 Schätzwert 200-400 €<br />
AG für Zink-Industrie<br />
vormals Wilhelm Grillo<br />
Oberhausen (Rhld.), Namens-Actie 1.000<br />
Mark 1.1.1894. Gründeraktie (Auflage<br />
2000, R 5) EF-VF<br />
Originalunterschrift Julius und August Grillo, rükkseitig<br />
bei der Übertragung 1896 nochmals von<br />
Julius Grillo.<br />
Schon vor Umwandlung in eine AG (1893/94) wurden seit<br />
1848 Werke in Oberhausen (Zinkwalzwerk, Zinkweissfabrik)<br />
und Duisburg-Hamborn (Zinkhütte, Schwefelsäurefabrik) betrieben.<br />
Noch heute als Grillo-Werke mit Sitz in Duisburg bestehende<br />
AG mit Werken in Hamborn, Goslar und Voerde. Die<br />
Aktionärsfamilie ist vor allem durch Erfolge in der Dressur-Reiterei<br />
bekannt.
Los 53 Schätzwert 300-375 €<br />
AG für Zink-Industrie<br />
vormals Wilhelm Grillo<br />
Oberhausen (Rhld.), Namensaktie 1.000<br />
Mark 1.7.1913 (Auflage 2000, R 8, zur<br />
Verbriefung zweier bereits aus 1905 resp.<br />
1908 datierenden Kapitalerhöhungen),<br />
ausgestellt auf Frau Ww. Julius Reinhard,<br />
Forsthaus Morp b. Erkrath EF<br />
Das allerletzte noch verfügbare der 13 Stücke aus<br />
dem Reichsbankschatz.<br />
Los 54 Schätzwert 50-175 €<br />
AG Gesellschaft für<br />
Markt- & Kühlhallen<br />
München, Aktie 1.000 Mark 27.7.1900<br />
(Auflage 1000, R 4) VF<br />
Für den Aufsichtsrat unterschrieb die Aktie original<br />
der seinerzeitige Vorsitzende Dr. Carl von Linde<br />
(*1842 in Berndorf/Oberfranken, +1934 in München).<br />
Linde entwickelte 1873-76 die Ammoniak-<br />
Nr. 50 Nr. 58<br />
Kompressionskältemaschine und gründete 1879<br />
die „Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen“, die<br />
heutige Linde AG. 1895 gelang es ihm, Luft in<br />
kontinuierlichem Betrieb zu verflüssigen, woraus<br />
die weitere bedeutende Sparte „Technische Gase“<br />
seiner Firma entstand. Ein wichtiger Industrie-Autograph.<br />
Gründung 1890 in Berlin, dann 1895-1909 in München ansässig,<br />
1909 Sitzverlegung nach Hamburg. An der Gründung war<br />
Dr. Carl von Linde maßgeblich beteiligt. Die Gesellschaft besaß<br />
zunächst Kühlhäuser und Eisfabriken in Hamburg und Berlin,<br />
heute ist sie der größte deutsche Kühlhausbetreiber und Marktführer<br />
im Bereich der Tiefkühllogistik. Neben der Zentrale im<br />
Norden von München gibt es heute 26 MUK-Niederlassungen.<br />
Los 55 Schätzwert 25-125 €<br />
AG Gesellschaft für<br />
Markt- & Kühlhallen<br />
Hamburg, Aktie 1.000 Mark 15.11.1921<br />
(Auflage 6000, R 9) EF-VF<br />
Ebenfalls miit Originalunterschriften, für den Aufsichtsrat:<br />
Prof. Dr. Carl von Linde.<br />
Los 56 Schätzwert 10-50 €<br />
AG Glashüttenwerke „Adlerhütten“<br />
Penzig bei Görlitz, Aktie 1.000 Mark Mai<br />
1920 (Auflage 1750, R 2) VF<br />
Großformatig, schöne Umrahmung im Historismus-Stil.<br />
Nach Inbetriebnahme der Eisenbahn Kohlfurt-Görlitz im Jahr<br />
1846 siedelte sich 1858 in Penzig (13 km nördlich von Görlitz am<br />
Nr. 51 Nr. 52<br />
Ostufer der Lausitzer Neisse, aber stadtrechtlich zu Görlitz gehörend,<br />
heute Piensk) die erste von später insgesamt 8 Glashütten<br />
an, begünstigt durch die nahe gelegenen Rohstoffvorkommen<br />
(Sand aus der Görlitzer Heide und reichlich Braunkohle). Die Einwohnerzahl<br />
des einstigen Bauerndorfes Penzig verzehnfachte<br />
sich dadurch bis zur Jahrhundertwende auf ca. 7.000. Die größte<br />
Penziger Glashütte war die 1887 gegründete und 1896 in eine<br />
AG umgewandelte “Adlerhütte”, mit 1200 Beschäftigten genauso<br />
gross wie Osram im benachbarten Weißwasser. Sie stellte<br />
zunächst Medizingläser her, ab 1900 auch Hohl-, Press- und<br />
Schleifglas. Eine besondere Spezialität waren Konservengläser,<br />
von denen riesige Mengen die Fabrik verließen (der Schlüssel<br />
zum späteren Interesse der Fa. Weck). Börsennotiz in Berlin und<br />
Breslau, Großaktionär waren die von Poncet Glashüttenwerke AG,<br />
Friedrichshain N.L. Beteiligt an der <strong>Deutsche</strong>n Luxor Prismen Ges.<br />
mbH, Berlin-Weisensee und der Adler Glashüttenwerke Verkaufsgesellschaft<br />
in Oeflingen (Baden). 1944 wurde in der Adlerhütte<br />
der erste Tonfilm über die Glasherstellung gedreht (der heute im<br />
Hessischen Glasmuseum in Immenhausen bei Kassel aufbewahrt<br />
wird). Gegen Ende des 2. Weltkrieges wurde Penzig weitgehend<br />
zerstört. Nach Vertreibung der deutschen Bewohner bauten die<br />
Polen drei der zerstörten Glashütten wieder auf. Piensk wurde erneut<br />
ein bedeutender Standort der Glasproduktion. Die AG selbst,<br />
ihres Werkes in Penzig verlustig gegangen, verlegte 1949 ihren<br />
Sitz nach Fürstenhagen bei Kassel. 1951 Umwandlung in <strong>GmbH</strong>.<br />
1958 in der Fa. J. Weck u. Co. KG aufgegangen, die mit ihren Einmachgläsern<br />
(“Einwecken”) eine heute verloren gegangene Haushaltstradition<br />
mit ihrem Namen prägte.<br />
Los 57 Schätzwert 30-75 €<br />
AG Johannes Jeserich<br />
Berlin-Charlottenburg, Aktie 1.000 RM<br />
Okt. 1936 (Auflage 600, R 4, kpl. Aktien-<br />
Neudruck) EF<br />
Gründung 1862, Umwandlung 1888 in die “AG für Asphaltierung<br />
und Dachbedeckung vorm. Johannes Jeserich”, seit 1913<br />
kurz “AG Johannes Jeserich”. Straßen- und Straßendeckenbau<br />
(Niederlassungen in Berlin-Charlottenburg, Königsberg i.Pr.,<br />
Breslau, Stettin und Posen), Herstellung von Rostschutz- und Anstrichfarben,<br />
Dichtungsmitteln und Dachpappen (Werk HH-Eidelstedt,<br />
Ottensener Str. 2-4) sowie von Nähr-, Stärkungs- und Entfettungsmitteln,<br />
insbesondere Kindernährzucker in der Nährmittelfabrik<br />
München <strong>GmbH</strong>, Berlin-Spandau. 1951 Auflösungsbeschluß,<br />
1952 Vergleich, 1956 Fortsetzungsbeschluß. Sitzverlegungen<br />
1959 nach Hamburg und 1975 nach Köln. Ebenfalls<br />
1975 Produktionseinstellung, fortan nur noch Verwaltung des Fabrikareals<br />
in Hamburg sowie von Gewerbeimmobilien in Köln,<br />
Berlin und Wuppertal. Seit 1990 fokussierte sich die immer noch<br />
börsennotierte Jeserich AG auf Logistikimmobilien und Gewerbeparks.<br />
Nach größeren Mietausfällen 2004 insolvent geworden.<br />
Los 58 Schätzwert 400-500 €<br />
AG Neptun Schiffswerft<br />
und Maschinenfabrik<br />
Rostock, Aktie 20 RM 31.8.1927 (Auflage<br />
1250, R 8) EF+<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesene Emission dieser<br />
bedeutenden Werft. Kpl. Kuponbogen anhängend.<br />
Gegründet bereits 1850 als “Maschinenbauanstalt und Schiffswerft,<br />
1890 Umwandlung in eine AG. Schon 1851 lief auf der<br />
Werft am linken Ufer der Warnow unmittelbar am Westende der<br />
Stadt Rostock mit der “Erbgroßherzog Friedrich Franz” das erste<br />
Schiff vom Stapel, einer von zwei Schraubendampfern für<br />
den Linienverkehr zwischen Rostock und St. Petersburg. Bis<br />
zur Wende lieferte die Neptunwerft über 1500 Schiffe ab, die<br />
Beschäftigtenzahl lag zeitweise über 2000. Nach 1990 konzentrierte<br />
sich die nun zur Meyer Neptun Gruppe gehörende<br />
Werft auf Reparatur und Modernisierung von Schiffen. Seit<br />
2001 verlassen auch wieder Neubauten die Werft, die sich jetzt<br />
vor allem auf Flusskreuzfahrtschiffe spezialisiert hat.<br />
Los 59 Schätzwert 225-375 €<br />
AG Norddeutsche Steingutfabrik<br />
Grohn bei Vegesack, Actie 1.000 Mark<br />
1.10.1903 (Auflage 134, R 7) VF<br />
Gründung 1869 in Lesum. Auf dem 120.000 qm großen<br />
Werksgelände zwischen dem Bahnhof Grohn-Vegesack und<br />
der Lesummündung werden glasierte Wand- und Bodenfliesen<br />
hergestellt, bis 1890 auch Haushaltsgeschirr. 1920 Übernahme<br />
der benachbarten Mitbewerber Steingutfabrik Witteberg AG<br />
in Farge und Grohner Wandplattenfabrik AG. Die in Bremen,<br />
Berlin und Hamburg börsennotierte AG ist noch heute eines der<br />
erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche.<br />
Los 60 Schätzwert 30-75 €<br />
AG Osthavelländische Kreisbahnen<br />
Nauen, Aktie 500 RM 1.4.1924 (Auflage<br />
3800, R 5) EF<br />
Gründung 1892. Strecken Nauen-Röthehof-Ketzin (16 km), Nauen-Bötzow-Velten<br />
(26 km) und Bötzow-Spandau West (17 km).<br />
Die Gesellschaft wurde 1946 von der Sowjetischen Besatzungsmacht<br />
enteignet und die Bahnen zunächst den Landesbahnen<br />
Brandenburg, dann der <strong>Deutsche</strong>n Reichsbahn unterstellt. Die<br />
Personenzüge von Nauen nach Ketzin fuhren bis zum 22.5.1963.<br />
Der Güterverkehr auf diesem Abschnitt wurde am 15.9.1997 zwischen<br />
der Mülldeponie Ketzin und Ketzin eingestellt, am 1.7.2000<br />
zwischen dem Anschluß Mosolf und der Mülldeponie.<br />
Los 61 Schätzwert 50-100 €<br />
AG Paulanerbräu<br />
Salvatorbrauerei und Thomasbräu<br />
München, Aktie 100 RM Febr. 1942<br />
(Auflage 4000, R 5) EF<br />
Gegründet 1651 als Klosterbrauerei der Paulanermönche, seit<br />
1813 in Privatbesitz, 1886 übernahm die Gebr. Schmederer<br />
7
Actienbrauerei (umfirmiert 1899 in AG Paulanerbäru (zum Salvatorkeller)<br />
und 1907 in AG Paulanerbräu Salvatorbrauerei).<br />
1928 Umfirmierung wie oben anläßlich der Fusion mit dem<br />
Thomasbräu. Mitte der 20er Jahre wurden außerdem Mehrheitsbeteiligungen<br />
an der Hofbrauhaus Coburg AG, der Auerbräu<br />
AG in Rosenheim und der Waitzingerbräu AG Miesbach<br />
erworben. 1999 Umfirmierung in Bayerische BrauHolding AG<br />
(Großaktionär: Schörghuber), zur Gruppe gehören jetzt u.a.<br />
auch die Kulmbacher Brauerei AG (EKU, Mönchshof) und die<br />
Hacker-Pschorr-Bräu.<br />
Los 62 Schätzwert 400-500 €<br />
AG Paulshöhe, Edelpilzkulturen<br />
und Konservenfabrik<br />
Schwerin, Aktie 5.000 Mark 1.11.1923<br />
(Auflage 2200, nach Kapitalherabsetzung<br />
1926 nur noch 220, R 11) VF<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt,<br />
nur 2 Stücke wurden im Reichsbankschatz gefunden,<br />
dies ist das allerletzte noch verfügbare.<br />
Gegründet 1921 zwecks Betrieb von Edelpilzzuchten, Konservierung<br />
dieser Edelpilze und sonstiger Lebensmittel sowie Handel<br />
mit Edelpilzen, Edelpilzkonserven und Konserven aller Art.<br />
Nach der Goldmark-Umstellung 1924 im Verhältnis 50:1 erzwangen<br />
hohe Bewertungsverluste 1926 einen weiteren Kapitalschnitt<br />
10:1, gegen den aber Anfechtungsklage erhoben<br />
wurde. 1928 wurde die Auflösung der AG beschlossen - die<br />
einzige deutsche Aktiengesellschaft, die sich je mit Edelpilzen<br />
beschäftigt hatte.<br />
Los 63 Schätzwert 500-625 €<br />
AG Porzellanfabrik Weiden<br />
Gebrüder Bauscher<br />
Weiden, Aktie 1.000 Mark 1.4.1911.<br />
Gründeraktie (Auflage 3000, R 8) EF<br />
Aktien dieser bis heute bedeutenden Porzellanfabrik<br />
waren bislang völlig unbekannt!<br />
1881 begannen die Brüder August und Conrad Bauscher in<br />
Weiden in Bahnhofsnähe mit 70 Mitarbeitern mit der Porzellanherstellung.<br />
Von Anfang an spezialisierten sie sich dabei auf<br />
robuste, funktionelle und langlebige Erzeugnisse für das Hotelund<br />
Gaststättengewerbe. Ab 1887 werden alle Schiffe des<br />
Norddeutschen Lloyd mit Bauscher-Porzellan ausgestatten.<br />
Bereits 1895 eröffnete Bauscher seine erste Filiale in New<br />
York, 1900 zwei weitere in London und Luzern (heute exportiert<br />
Bauscher die Hälfte seiner Gesamtproduktion in über 120 Länder).<br />
Das zunächst als Einzelfirma, dann als oHG betriebene<br />
Unternehmen wurde 1907 in eine <strong>GmbH</strong> und 1911 in eine AG<br />
umgewandelt. Ebenfalls 1911 Gründung einer Porzellan-<br />
Kunstmanufaktur und (bis 1920) Aufnahme der Produktion von<br />
Telegraphenglocken und Isolatoren. Die Firmengründer sterben<br />
1910 (Conrad) bzw. 1917 (August), die AG-Mehrheit landet<br />
dann beim Strupp-Konzern, Meiningen (zurückgehend auf das<br />
1742 gegründete Bankhaus B. M. Strupp, ab 1905 Bank für<br />
Thüringen). Über 1.200 Beschäftigte fertigen nun für illustre<br />
Kunden wie “Auerbachs Keller” in Leipzig und das “Waldorf Astoria”<br />
in New York. Bausch steht für 98 % aller Hotelporzellan-<br />
Einfuhren in die USA (u.a. auch an die acht größten Eisenbahngesellschaften).<br />
Nach Zerfall des Strupp-Konzerns 1927<br />
per Fusion Zusammenschluß mit der Porzellanfabrik Lorenz<br />
Hutschenreuther, Selb (heute BHS tabletop, innerhalb der Firma<br />
wird Bauscher bis heute als eigenständige Spezialmarke<br />
für Hotel- und Gastronomie-Porzellan geführt). Das 1959 auf<br />
den Markt gebrachte System B1100, tauglich für die modernen<br />
Formen der Betriebs- und Systemverpflegung, wird das meistgekaufte<br />
Geschirrsystem der Welt. Auf der anderen Seite stattet<br />
auch Maitre Bocuse 1963 sein Restaurant mit Bauscher-<br />
Geschirr aus. 2008/09 werden auf einen Schlag AIDA Cruises,<br />
TUI-Cruises (Mein Schiff) und Costa Crociere als Kunden gewonnen.<br />
8<br />
Los 64 Schätzwert 400-500 €<br />
AG Porzellanfabrik Weiden<br />
Gebrüder Bauscher<br />
Weiden, Aktie 1.000 Mark 15.4.1922<br />
(Auflage 5000, R 9) EF-VF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los. Von nur 8<br />
im Reichsbankschatz gefundenen Stücken das<br />
letzte noch verfügbare Exemplar!<br />
AG Porzellanfabrik Weiden Gebrüder Bauscher<br />
Werbeanzeige um 1906 für das feuerfeste<br />
Koch- und Backporzellan "Luzifer"<br />
Nr. 62 Nr. 63<br />
Nr. 65 Nr. 75<br />
Los 65 Schätzwert 800-1000 €<br />
AG Reederei “Norden-Frisia”<br />
Norderney, Namensaktie 200 Mark<br />
1.12.1917 (Auflage 360, R 9) VF<br />
1871 Gründung der Dampfschiffs-Reederei “Norden” als Partenreederei,<br />
1872 Eröffnung des Sommerverkehrs auf der Linie<br />
Norddeich-Norderney, ab 1888 auch fahrplanmäßige Verbindung<br />
Norddeich-Juist. Die Hotels “Fährhaus” und “Norddeich” in Norddeich<br />
gehörten ebenfalls der Reederei. 1898 Bau einer Pferdeeisenbahn<br />
zwischen der Juister Landungsbrücke und dem Inselbahnhof,<br />
1899 wird die Bahn motorisiert. 1906 erscheint mit der<br />
Dampfschiffs-Reederei “Frisia” ein Konkurrent auf der Linie<br />
Norddeich-Norderney, 1917 fusionieren beide Linien zur “AG<br />
Reederei Norden-Frisia”, nachdem die Reederei “Norden” 1910<br />
in eine AG umgewandelt worden war. 1920 Fusion mit der AG<br />
Reederei “Juist”, die erst 1908 aus der Reederei “Norden” ausgegliedert<br />
worden war. 1931 Inbetriebnahme der ersten Großgarage<br />
in Norddeich. 1969 Gründung der FRISIA Luftverkehr <strong>GmbH</strong><br />
für Flüge zwischen dem Festland und den Nordseeinseln.<br />
Nr. 66<br />
Los 66 Schätzwert 225-300 €<br />
AG Reederei Norden-Frisia<br />
Norderney, Aktie 100 Goldmark Juni 1933<br />
(R 8) EF-<br />
Für die Zeit unübliches großes Hochformat!<br />
Los 67 Schätzwert 300-375 €<br />
AG Thonwerke Kandern<br />
Kandern, Actie 1.000 Mark 10.2.1889.<br />
Gründeraktie (Auflage 238, R 8), ausgestellt<br />
auf Herrn L. Ganter, Freiburg VF+<br />
Umrahmung im Historismus-Stil.<br />
Gründung 1889, hervorgegangen aus der schon seit 1837 im<br />
badischen Kandern bestehenden Firma Wolman, Dewitz & Co. In<br />
zwei Werken in Kandern mit rd. 150 Mann Belegschaft wurden in<br />
drei Brennöfen Dachziegel aller Art und Backsteine hergestellt.<br />
Großaktionär war mit zuletzt über 80 % die Badische Bank,<br />
Karlsruhe. 1954 Umwandlung in die Tonwerke Kandern Georg<br />
Gott <strong>GmbH</strong>. 1998 schließlich wurde der Betrieb stillgelegt.<br />
Los 68 Schätzwert 500-625 €<br />
AG vorm. H. Gladenbeck<br />
& Sohn Bildgießerei<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 15.12.1908<br />
(Auflage 350, R 10) VF-<br />
Einzelstück aus dem Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1888 unter Übernahme der Bildgießerei H. Gladenbeck<br />
& Sohn in Friedrichshagen und deren Bronce- und Zinkgußwarenfabrik<br />
sowie des Geschäfts der Firma Alfred Gladenbeck<br />
in Berlin. Herstellung von Denkmälern, monumentalen<br />
Guss- und Treibarbeiten für Bauten und von Plastiken aus Bronze<br />
und Marmor. 1926 Eröffnung des Konkursverfahrens, 1932
von Amts wegen gelöscht. Aus der Bronzegießerei Gladenbecks<br />
stammen zahlreiche bedeutende Standbilder und Denkmale, so<br />
das von Christian Daniel Rauch entworfene Denkmal des Immanuel<br />
Kant für Königsberg oder die Viktoria der Berliner Siegessäule<br />
nach dem Entwurf von Friedrich Drake.<br />
Los 69 Schätzwert 50-100 €<br />
AG vorm. H. Gladenbeck<br />
& Sohn Bildgießerei<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Mai 1922<br />
(Auflage 7500, R 6) EF-VF<br />
Los 70 Schätzwert 30-75 €<br />
AG Wilh. Kramer & Co.<br />
Schlesische Granitwerke<br />
Jauer Bez. Liegnitz, Aktie 100 RM Aug.<br />
1933 (Auflage 1950, R 3) EF<br />
Gegründet 1923 als Schlesische Granitwerke AG, 1933 umbenannt<br />
wie oben. Gewinnung von Granit-Straßenbaumaterialien.<br />
Los 71 Schätzwert 10-50 €<br />
AG Zuckerfabrik Haynau<br />
Haynau, Aktie 100 RM 1.1.1928 (Auflage<br />
6600, R 2) EF<br />
Gründung 1882. Neben der Zuckerfabrik bestimmte das Leben<br />
im niederschlesischen Haynau übrigens als zweiter wichtiger<br />
Arbeitgeber der Stadt die größte deutsche Raubtierfallenfabrik.<br />
Mehrheitsaktionär der in Breslau börsennotierten AG war die<br />
Süddeutsche Zucker AG in Mannheim. Nach dem Ende des<br />
Kommunismus in Polen ist die Südzucker heute in Schlesien<br />
wieder ähnlich stark engagiert wie damals schon einmal.<br />
Nr. 72<br />
Nr. 68 Nr. 81<br />
Los 72 Schätzwert 100-125 €<br />
Ahrtalbank AG<br />
Ahrweiler, Aktie 100 Goldmark Jan. 1924<br />
(Auflage 1350, R 7) VF-<br />
Gegründet 1871 als Ahrweiler Credit-Verein e<strong>GmbH</strong>, Ende<br />
1923 Umwandlung in eine AG. Filialen in Altenahr, Mayschoß,<br />
Rech, Dernau, Holzweiler und Bad Neuenahr. 1972 Fusion zur<br />
Volksbank Bad Neuenahr-Ahrweiler e<strong>GmbH</strong>.<br />
Los 73 Schätzwert 50-100 €<br />
Aktien Brauerei in Staab<br />
Staab, Aktie 400 RM Juni 1941 (Auflage<br />
3025, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1872. Hinzuerworben wurden die Brauerei Chotieschau<br />
(1904), die Bürgerliche Brauerei in Staab (1912), die Hohenzollersche<br />
Brauerei in Deschenitz (1925) sowie die Schloßbrauerei<br />
in Wilkischen und die Schloßbrauerei in Kladrau<br />
(1928). Kurz vor Kriegsende wurden in Staab rd. 43.000 hl und<br />
in Deschenitz gerade einmal 5.500 hl Bier im Jahr gebraut.<br />
Los 74 Schätzwert 25-100 €<br />
Aktien-Brauerei Cöthen AG<br />
Köthen, Aktie 100 RM 27.7.1928 (Auflage<br />
4000, R 4) EF<br />
Gründung 1861, AG 1883 (ABC). In der Brauerei in der Stiftstr.<br />
7 wurden untergärige Biere (Cöthener Pilsener und Cöthener<br />
Meisterbräu), obergäriges Cöthener Malzbier, alkoholfreie Getränke,<br />
Eis und Futtermittel produziert. Großaktionär war die<br />
Engelhardt-Brauerei AG, Berlin. 2003 zog die Köthener Brauerei<br />
<strong>GmbH</strong>, die im Jahr 1992 aus der ehemaligen Brauerei Köthen<br />
entstand, aus den historischen Gemäuern um, in ein modernes,<br />
neu gebautes Logistikzentrum. Neben dem Köthener<br />
und dem Hubertus Sortiment vertreibt die Köthener Brauerei<br />
auch das neue Köthener Brauhaus Premium Pils.<br />
Los 75 Schätzwert 400-500 €<br />
Aktien-Brauerei Feldschlösschen<br />
Minden, Aktie Lit. A 1.000 Mark 5.6.1922<br />
(Auflage 1500, R 9) EF-<br />
Nur 3 Stück waren im Reichsbankschaft gefunden<br />
worden, dies ist jetzt das letzte noch verfügbare.<br />
1865 Gründung der Brauerei Brettholz & Denkmann. AG seit<br />
1888. 1918 Ankauf der Mindener Stiftsbrauerei, 1922 Erwerb<br />
des Braukontingents der Kronenbrauerei Bückeburg. 1924 Ankauf<br />
der Städt. Brauerei Hempel & Co. in Stadthagen. Neben<br />
verschiedenen Wirtschaftsanwesen gehörte der Gesellschaft<br />
auch die Tonhalle in Minden. Die Aktien notierten seit 1890 bei<br />
äußerst sporadischen Umsätzen an der Börse Hannover, später<br />
im ungeregelten Freiverkehr Düsseldorf. Großaktionär war zuletzt<br />
mit über 98 % die Berliner Schultheiss-Brauerei AG. 1978<br />
auf die Dortmunder Union-Schultheiss-Brauerei AG (1988 umbenannt<br />
in Brau und Brunnen AG, seit 2004 Teil der Radeberger<br />
Gruppe) verschmolzen.<br />
Los 76 Schätzwert 225-300 €<br />
Aktien-Brauerei Feldschlösschen<br />
Minden, Aktie Lit. C 1.000 RM 4.4.1927<br />
(Auflage 400, R 9) VF-<br />
Für die Zeit ganz ungewöhnliches großes Hochformat,<br />
schöne Umrahmung im Historismus-Stil.<br />
Stockfleckig.<br />
Los 77 Schätzwert 75-150 €<br />
Aktien-Färberei Münchberg<br />
vorm. Knab & Linhardt<br />
Münchberg, VZ-Aktie 1.000 Mark<br />
22.12.1920 (Auflage 500, R 7) EF<br />
Das 1868 gegründete Stammwerk der Fa. Knab & Linhardt lag<br />
im Stadtkern von Münchberg auf einem über 50.000 m◊ großen<br />
Grundstück zwischen der Bahnstrecke Bamberg-Hof und<br />
der Pulschnitz. Es war eine der größten Garnfärbereien<br />
Deutschlands. 1889 Umwandlung in eine AG. 1925 Erwerb der<br />
Färberei Alb. Römer <strong>GmbH</strong> in Opladen, die 1937 als Zweigwerk<br />
Leichlingen eingegliedert wurde. 1930 wurde das Stammwerk<br />
von der seit alters her betriebenen Türkischrot-Garnfärberei auf<br />
das rationellere Naphtol- und Indanthren-Färben umgestellt.<br />
Gleichzeitig Einrichtung einer Zwirnerei, Effektzwirnerei und<br />
Spulerei, so daß die Garne webfertig an die Webereien geliefert<br />
werden konnten (u.a. die ebenfalls in Münchberg ansässige<br />
Mech. Buntweberei J. Sim Fleißner AG). Als Ersatz für die östlich<br />
der Zonengrenze ausgefallenen Abnehmer 1947 Einrichtung<br />
einer Stückfärberei und Appretur. Großaktionär war jahrzehntelang<br />
die Bayerische Vereinsbank. 1962 übernahmen die<br />
Faserwerke Hüls in Marl die Aktienmehrheit, die 1973 an die<br />
Spinnerei Forchheim weiterging. Mit dieser 1977 fusioniert und<br />
deshalb ebenso wie sie 1999 im Konkurs untergegangen.<br />
Los 78 Schätzwert 50-125 €<br />
Aktien-Malzfabrik Könnern<br />
Könnern, Aktie 1.200 Mark 14.12.1921<br />
(Auflage 940, R 4) EF<br />
Originalunterschriften.<br />
Gegründet 1872. Die Malzfabrik hat eine überraschend interessante<br />
Baugeschichte: Einst ein mächtiges Kloster, das von<br />
Otto II. (955-983) sogar zum Reichskloster erhoben wurde,<br />
kam die Anlage 1563 an die Fürsten von Anhalt-Köthen, die die<br />
Klausurgebäude in ein Schloß umbauten. Später Witwensitz,<br />
1871 an einen Industriellen verkauft, der das direkt am Bahnhof<br />
der wichtigen Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahn<br />
liegende Gebäude zu einer Malzfabrik umbaute. 1917<br />
kaufte die Gesellschaft die Eisengiesserei Saalhütte in Könnern,<br />
1918 die Aktien-Malzfabrik Niemberg und erwarb 1918<br />
sämtliche Hausgrundstücke, Fabrikanlagen und Inventar der<br />
Schlossmälzerei AG von Th. Schmidt & Co. in Nienburg (Saale).<br />
1931/32 Umwandlung einer großen Forderung an die Bierbrauerei<br />
Gebr. Müser AG in Bochum-Langendreer in eine maßgebliche<br />
Beteiligung. Börsennotiz in Halle (Saale), seit 1934 im<br />
Freiverkehr Leipzig. Die AG wurde 1961 zwecks Abwicklung<br />
verlagert nach Hamburg, 1962 aufgelöst, 1971 im Handelsregister<br />
gelöscht. Das Werk in Könnern wurde 1948 enteignet<br />
und als VEB Malzfabrik Könnern weitergeführt, nach der Wende<br />
1993 stillgelegt. Die Ruine, für deren Abriss sich die Stadt<br />
Könnern aktuell um Fördergelder bemüht, ist heute ein<br />
Schandfleck im Stadtzentrum, der zudem den Zugang zum historisch<br />
bedeutenden alten Klosterhof versperrt.<br />
Los 79 Schätzwert 125-200 €<br />
Aktien-Ziegelei Langensalza AG<br />
Langensalza, Aktie 5.000 Mark 4.6.1923<br />
(Auflage nur 100 Stück, R 7) EF-<br />
Umgestellt auf 500 Goldmark. Sehr dekorative<br />
Umrahmung im Historismus-Stil.<br />
Über ein halbes Jahrhundert lang backte der Betrieb im Tal der<br />
Unstrut (knapp 30 km nordwestlich von Erfurt) tagein, tagaus<br />
nichts als Ziegel. Besonderen Ehrgeiz kann der Chronist dem Vorstand<br />
Kurt Petersilie nicht bescheinigen: 100.000 Mark Jahresumsatz<br />
durfte man schon als Spitzenwert betrachten. Meist reichte<br />
es dennoch zu einer Dividende. Nach 1945 dann enteignet.<br />
Los 80 Schätzwert 75-175 €<br />
Aktienbierbrauerei Wittenberg AG<br />
Wittenberg, Namens-VZ-Aktie 1.000 Mark<br />
29.12.1922 (Auflage 750, R 3) EF<br />
Gründung 1902 als Nachfolgegesellschaft der 1875 gegründeten<br />
Dominialbrauerei Rothemark, Gustav Kehl. Produktion<br />
untergäriger Lagerbiere sowie obergäriges Malz- und Weißbier,<br />
Eis und alkoholfreie Getränke. Firma nicht verlagert, aber enteignet,<br />
als VEB Brauerei Rothemark weitergeführt. 1959 geschlossen.<br />
9
Los 81 Schätzwert 400-500 €<br />
Aktienbrauerei Dormagen<br />
vorm. Becker & Cie.<br />
Dormagen, Aktie 1.000 Mark 20.11.1898.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 8) VF<br />
Zwei kleinere Rostflecken.<br />
Bei ihrer Gründung 1898 übernahm die AG für 900.000 M die<br />
Brauerei von Becker & Co. im rheinländischen Dormagen.<br />
1922 erwarb die Dortmunder Actien-Brauerei die Aktienmehrheit.<br />
1967 Verkauf des Betriebes an die Fa. Harzheim aus Köln,<br />
fortan hieß die Marke nicht mehr ABD-Kölsch, sondern Kess-<br />
Kölsch. 1979 abermaliger Namenswechsel, die Braustätte in<br />
Dormagen hieß nun “Brauhaus zur Garde”. 1998 waren noch<br />
35 Mitarbeiter tätig. Bald darauf wurde die Produktion eingestellt,<br />
die Brauerei abgerissen.<br />
Los 82 Schätzwert 125-250 €<br />
Aktienbrauerei Greussen<br />
Greussen i.Th., Aktie 1.000 Mark<br />
5.8.1907 (Auflage 150, R 5) VF+<br />
Die 1883 gegründete AG übernahm die schon seit 1847 betriebene<br />
Brauerei der Gebr. Stöckius. Neben Erzeugung von oberund<br />
untergärigen Bieren auch Betrieb einer Mineralwasserfabrik.<br />
Letzter Großaktionär: Riebeck-Brauerei, Leipzig. 1952 VEB<br />
Brauerei Greußen, 1974 VEB Getränkekombinat Erfurt Werk<br />
Brauerei Greußen. Ab 1990 privatisiert als Brauerei Greußen.<br />
Los 83 Schätzwert 20-75 €<br />
Aktienbrauerei zum Hasen<br />
Augsburg, Aktie 100 RM 14.3.1935<br />
(Auflage 9000, R 2, kompletter Neudruck<br />
wegen Sanierung und Kapitalherabsetzung<br />
5:2) EF<br />
Die Brauerei zum Hasen ist aus einer schon im Jahre 1464 bestehenden<br />
Braustätte in der Augsburger Bäckergasse hervorgegangen,<br />
die sich erst “drey Glaß” und später “Zum Hasen”<br />
nannte. Seit 1890 AG als “Aktienbrauerei zum Hasen vorm. J.<br />
M. Rösch”. 1920 Fusion mit der Brauerei Lorenz Stötter AG in<br />
Augsburg zur “Aktienbrauerei zum Hasen und Lorenz Stötter”,<br />
1921 Fusion mit der AG Kronenbräu vorm. M. Wahl zur “Aktienbrauerei<br />
zum Hasen Lorenz Stötter und Kronenbräu”, 1924<br />
Fusion mit der Aktienbrauerei Augsburg vorm. J. M. Vogtherr<br />
und Umfirmierung in “Aktienbrauerei zum Hasen”. 1942 wurde<br />
die gesamte Bierherstellung in der Betriebsstätte Hasenbräu in<br />
der Armenhaus-Gasse konzentriert. 1980 Umfirmierung in Hasen-Bräu<br />
AG. 1996 verkaufte die Bayerische Vereinsbank die<br />
Aktienmehrheit an der noch heute in München börsennotierten<br />
AG an den Brauerei-Magnaten Inselkammer (im Jahr darauf<br />
wurden die Hasen-Bräu-Betriebsrechte der ihm gehörenden<br />
Tucher-Bräu übertragen).<br />
Los 84 Schätzwert 300-375 €<br />
Aktienzuckerfabrik Trendelbusch<br />
Trendelbusch, Namensaktie 1.500 Mark<br />
16.4.1923 (R 8), ausgestellt auf die Fürstl.<br />
Puttbus’sche Rittergutsverwaltung Harbke EF<br />
Großes Hochformat, dekorative Ornament-Umrahmung.<br />
Die Gründung erfolgte 1857 als Zuckerfabrik Carl Salomon &<br />
Co, errichtet durch die Fürstlich Stolbergsche Maschinen-Fabrik.<br />
Der Standort war ca. 4 km westlich von Harbke in der Nähe<br />
der Grube Trendelbusch. 1858 wurde das Unternehmen in<br />
die AG Actienzuckerfabrik Trendelbusch umgewandelt. Das Anbaugebiet<br />
hatte eine Fläche von ca. 1200 Morgen. Das Unternehmen<br />
erwirtschaftete sehr gute Gewinne, die Aktionäre erhielten<br />
ungewöhnlich hohe Dividenden von 60%. Nach 25 Jahren<br />
hatte sich die Zahl der Aktionäre auf 64 erhöht. Zu diesem<br />
Zeitpunkt waren erst knapp 90% des Grundkapitals gezeich-<br />
10<br />
net. Die Zuckerschwemme Ende der 1880er Jahre machte<br />
auch der Actienzuckerfabrik Trendelbusch zu schaffen. Rationalisierungsmaßnahmen<br />
waren die Folge. 1901/02 wurden<br />
wieder Rekordverarbeitungen gemeldet. Die Zeit der Inflation<br />
allerdings führte zu einer Verschuldung der Landwirtschaft allgemein,<br />
die Zuckerfabrik musste nach 67jähriger Tätigkeit ihre<br />
Produktion einstellen.<br />
Los 85 Schätzwert 1000-1250 €<br />
Albert-Theater-AG<br />
Dresden, Aktie 1.000 Mark 30.12.1911.<br />
Gründeraktie (Auflage 800, R 9) VF<br />
Nur 6 Stück dieses bis dahin ganz unbekannten<br />
Titels lagen im Reichsbankschatz. Fehlstellen<br />
fachgerecht restauriert.<br />
Das Albert-Theater am Albertplatz, benannt nach dem sächischen<br />
König Albert, gehörte neben dem Residenztheater und der<br />
Semperoper zu den repräsentativen Bauten des alten Dresden.<br />
Auf einem von der Stadt Dresden unentgeltlich zur Verfügung<br />
gestellten Grundstück wurde es erbaut 1871-73 von Bernhard<br />
Schreiber im frühen Neorenaissance-Stil der Semper-Nicolai-<br />
Schule für eine Aktiengesellschaft Neustädter Bürger und am<br />
20.9.1873 mit Goethes “Iphigenie auf Tauris” eröffnet. Bis 1910<br />
(in dem Jahr wurde das Schauspielhaus Dresden an der Ostraallee<br />
eröffnet) war das Albert-Theater an den königlichen Hof<br />
verpachtet. Dann ging es an eine 1911 neu gegründete AG über,<br />
die das Theater modernisieren und umbauen ließ. 1913<br />
wurde das Albert-Theater wieder eröffnet. Es spielte nun sowohl<br />
Albert-Theater (Neustädter Hoftheater) um 1905<br />
Nr. 85<br />
moderne progressive Stücke z.B. von Gerhart Hauptmann und<br />
Maxim Gorki wie auch Volkstümliches. Premierenfeiern fanden<br />
oft in der benachbarten Vila Eschebach statt. In der Zeit wirkten<br />
bekannte Schauspieler und Künstler wie z.B. Sarah Bernhardt<br />
und Heinrich George am Albert-Theater, das 1921 umbenannt<br />
wurde in “Neustädter Schauspielhaus”. Ab 1936 wurde es durch<br />
die Stadt Dresden verwaltet, im Programm den Zeitströmungen<br />
gleichgeschaltet und hieß zuletzt “Theater des Volkes”. Beim<br />
großen Luftangriff auf Dresden am 13.2.1945 brannte das Theater<br />
aus. Obwohl die Außenmauern gut erhalten geblieben waren<br />
und die Dresdner Theaterkünstler eine Wiederherstellung<br />
befürworteten wurden Bühnenhaus und Zuschauerraum im<br />
Sept. 1950 von der Stadt Dresden abgebrochen.<br />
Los 86 Schätzwert 10-50 €<br />
Alexanderwerk A. von der Nahmer AG<br />
Remscheid, Aktie 1.000 RM Aug. 1937<br />
(Auflage 3500, R 2, kpl. Aktien-Neudruck)<br />
EF-VF<br />
Gründung 1885 als <strong>GmbH</strong>, AG seit 1899. Hergestellt wurden mit<br />
bis zu 2.000 Beschäftigten Haushaltsmaschinen, Küchenmaschinen,<br />
Großküchen, Fleischverarbeitungs- und Aufschnittschneidemaschinen.<br />
1917/18 Übernahme der Schneidemaschinenfabrik<br />
Graff &Stein <strong>GmbH</strong> in Witten a.d.Ruhr und Weiterführung als<br />
Zweigwerk. 1926 Einführung der Fließbandproduktion. Ab 1927<br />
Zusammenarbeit mit Siemens-Schuckert bei elektrischen Haushaltsmaschinen.<br />
1931 Fusion mit der Ernst Alb. Steffens <strong>GmbH</strong> in<br />
Burg a.d.Wupper, 1941 Übernahme des Konkurrenten Eschebach-Werke<br />
AG in Radeberg bei Dresden. Nach dem Wiederaufbau<br />
der am 31.7.1943 bei einem Luftangriff fast vollständig zerstörten<br />
Remscheider Fabrik wieder der führende Hersteller auf<br />
seinem Spezialgebiet. Noch heute börsennotierte AG.<br />
Los 87 Schätzwert 50-125 €<br />
Alfred Gutmann<br />
AG für Maschinenbau<br />
Hamburg, Aktie 100 RM März 1937<br />
(Auflage 1280, R 5) EF<br />
Gründung 1898 unter Übernahme der 1885 gegründeten Firma<br />
Alfred Gutman, Altona-Ottensen. Erzeugnisse: Sandstrahl-<br />
gebläse für alle Zweige der Industrie, Formmaschinen, Kupolöfen,<br />
Misch- und Mahlmühlen, Begichtungsanlagen, Aufzüge,<br />
Hebezeuge, Schmelzöfen, Zerkleinerungsmaschinen, Wasserfilter.<br />
Ab 1998 mehrfacher Besitzerwechsel, zuletzt, 2004 an<br />
die Wheelabrator mit Sitz in Köln. Die letzten Produktionsstandorte<br />
der vormaligen Alfred Gutmann Ges. für Maschinenbau<br />
<strong>GmbH</strong> wurden 2006 geschlossen.<br />
Los 88 Schätzwert 200-250 €<br />
Alfred Krebs & Co. AG<br />
Arnstadt, Aktie 20 RM 1.8.1924 (Auflage<br />
4000, R 11) VF<br />
Nur 2 Stücke lagen im Reichsbankschatz, vorher<br />
nicht bekannt gewesen. Minimale Randschäden<br />
fachgerecht restauriert.<br />
Gründung im Dez. 1921 zur Herstellung und zum Vertrieb von<br />
Wäsche und Schürzen. 1926 Konkurs.<br />
Los 89 Schätzwert 20-60 €<br />
ALLBA Allgemeine<br />
Lebensversicherungs-Bank AG<br />
Berlin, Namens-Aktie 1.000 Mark<br />
11.11.1922. Gründeraktie (Auflage<br />
20000, R 1) EF<br />
Gründung 1866 als Nordstern-Lebensversicherungs-AG in<br />
Berlin. 1878 Fusion mit der Schlesischen Lebensversicherung,<br />
gegr. 1872 in Breslau. 1906 Übernahme der Vaterländische<br />
Lebensversicherungs-AG, gegr. 1872 in Elberfeld. 1920 Fusion<br />
mit der “Teutonia” Versicherungs-AG, gegr. 1852 in Leipzig.<br />
1922 Bestandsübertragung auf die ALLBA Allgemeine Lebensversicherungs-Bank<br />
AG. 1925 Umfirmierung in Allba-Nordstern<br />
Lebensversicherungs-AG, 1936 in Nordstern Lebensversicherungs-AG.<br />
1996 wurde der Sitz in Berlin aufgehoben. 1999<br />
Verschmelzung auf die AXA Colonia Lebensversicherung AG.<br />
Los 90 Schätzwert 20-75 €<br />
Allgemeine Baugesellschaft<br />
Lenz & Co. (Kolonial-Gesellschaft)<br />
Berlin, Anteil 1.000 RM Mai 1929<br />
(Auflage 3750, R 2) EF<br />
1881 Gründung der Baufirma Friedrich Lenz. Ausführung von<br />
Hoch- und Tiefbauarbeiten, insbesondere Ausbau des deutschen<br />
Eisenbahnnetzes, vor allem in Pommern und Mecklenburg.<br />
1892 Umwandlung in Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>. 1901 Gründung<br />
der AG für Verkehrswesen in Berlin als Finanzierungsgesell-
schaft der Firma Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>, gleichzeitig Sitzverlegung<br />
von Stettin nach Berlin. Als 1904 große Tiefbauten, vorwiegend<br />
Eisenbahnbauten in den deutschen Kolonien in Afrika, begonnen<br />
wurden, gründete die AG für Verkehrswesen 1905 die<br />
<strong>Deutsche</strong> Kolonial-Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft.<br />
Diese teilte sich mit der Lenz & Co. <strong>GmbH</strong> die Tätigkeit in den<br />
Kolonien. Von den insgesamt 4.348 km fertiggestellten afrikanischen<br />
Bahnen wurden allein 1.702 km von diesen beiden<br />
Gesellschaften erstellt. Mit dem Ende der Kolonialtätigkeit<br />
durch den 1. Weltkrieg verlagerten sich die Interessen wieder<br />
nach Deutschland. 1927 änderte die <strong>Deutsche</strong> Kolonial-Eisenbahnbau<br />
ihren Namen in Allgemeine Baugesellschaft Lenz &<br />
Co. (Kolonial-Gesellschaft) und übernahm das Personal sowie<br />
den gesamten Bestand an Bauaufträgen der Lenz & Co <strong>GmbH</strong>.<br />
1947 Umwandlung in Allgemeine Baugesellschaft Lenz & Co.<br />
AG. 1948 Sitzverlegung nach Hamburg. 1952 Umbenennung<br />
in Lenz-Bau AG. 1976 in Konkurs.<br />
Los 91 Schätzwert 60-80 €<br />
Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Eisenbahn-AG<br />
Berlin, Genußrechtsurkunde 30 RM Dez.<br />
1925 (R 10) EF<br />
Gründung 1893 als Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Kleinbahn-Gesellschaft,<br />
1923 umfirmiert wie oben. Die ADEA hatte rd. 800 km<br />
Bahnen in Betrieb, u.a. die Riesengebirgsbahn, die Nassauische<br />
Kleinbahn, die Breslau-Trebnitz-Prausnitzer KB, die Westpreussische<br />
KB, die Niederlausitzer EB, die Teutoburger Wald-<br />
Eisenbahn, die Rinteln-Stadthagener EB. 1927 Verschmelzung<br />
mit der AG für Verkehrswesen zur heutigen AGIV.<br />
Los 92 Schätzwert 225-375 €<br />
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft<br />
Berlin, Sammelaktie 1.000 x 100 RM<br />
März 1943 (R 7) UNC<br />
Gründung 1883 durch Emil Rathenau als „<strong>Deutsche</strong> Edison-Gesellschaft<br />
für angewandte Elektricität“, 1887 Umfirmierung in<br />
AEG. Beim Besuch der Weltausstellung in Philadelphia lernte Emil<br />
Rathenau die epochemachenden Erfindungen von Thomas<br />
A. Edison kennen. Es gelang ihm, die Patente für Deutschland<br />
zu erwerben. Zu Recht wird Rathenau als der Begründer der elektrischen<br />
Großindustrie in Deutschland bezeichnet. Was mit<br />
der Herstellung von Glühlampen begann, entwickelte sich bald<br />
zu einem Unternehmen, das auf allen Gebieten der Elektrotechnik<br />
eine führende Rolle spielte - lange blieb der Wettstreit mit<br />
Siemens & Halske um den ersten Platz unentschieden. Der Niedergang<br />
nach dem 2. Weltkrieg mündete schließlich 1985 in<br />
der Mehrheitsübernahme durch den Daimler-Benz-Konzern, der<br />
unter dem Vorstandsvorsitzenden Edzard Reuter (Sohn des legendären<br />
Berliner Nachkriegs-OB) vom Aufbau eines umfassenden<br />
Technologiekonzerns als Welt-AG träumte. Als auch dieser<br />
Traum ausgeträumt war, löste Daimler-Benz (nun unter Reuters<br />
Nachfolger Jürgen Schrempp) die AEG 1996 auf.<br />
Los 93 Schätzwert 50-150 €<br />
Allgemeine Gold-<br />
& Silber-Scheide-Anstalt<br />
Pforzheim, Actie 500 Mark 10.5.1912<br />
(Auflage 1000, R 5), ausgestellt auf Herrn<br />
Carl Mondon, Pforzheim EF<br />
Hübsche breite Umrahmung aus fein gearbeitetem<br />
Blumen-Rankwerk. Originalsignaturen.<br />
Gründung 1891 in Pforzheim, bis heute das Zentrum der deutschen<br />
Schmuck- und Uhrenindustrie. Das Werk in der Kanzlerstrasse<br />
wurde im Laufe der Zeit zu einer der führenden Scheideanstalten<br />
in Europa ausgebaut. Neben der Scheidung von<br />
gold- und silberhaltigen Barren und dem Verkauf von Feingold<br />
und Feinsilber sind auch die für die Schmuckwarenfabrikation<br />
erforderlichen Chemikalien und Edelmetall-Legierungen im<br />
Lieferprogramm. Bis hin nach Thailand werden vor allem Goldschmiedewerkstätten<br />
beliefert. Daneben auch eigene Kupfer-<br />
Elektrolyse sowie Aufbereitung von und Handel mit Basismetallen<br />
aller Art. In den 60er Jahren begann der Frankfurter Konkurrent<br />
Degussa die im Frankfurter Telefonverkehr notierten Agosi-Aktien<br />
aufzukaufen und besaß zuletzt über 90 %. 2002<br />
ging das Aktienpaket an die belgische Umicore-Gruppe.<br />
Los 94 Schätzwert 25-100 €<br />
Allgemeine Gold-<br />
& Silberscheideanstalt<br />
Pforzheim, Aktie 500 Mark 25.6.1921<br />
(Auflage 2400, R 3), ausgestellt auf Herrn<br />
Carl Eisenmenger, Pforzheim EF<br />
Sehr hübsche Umrahmung aus fein gearbeiteten<br />
Schmuckkettengliedern.<br />
Los 95 Schätzwert 25-80 €<br />
Allgemeine Hoch-<br />
und Ingenieurbau-AG<br />
Düsseldorf, Aktie 1.000 RM Jan. 1939<br />
(Auflage max. 500, R 5) EF<br />
Gründung 1904 als “Allgemeine Hochbau-<strong>GmbH</strong>”, seit 1921<br />
AG. 1933 Umbenennung in Allgemeine Hoch- und Tiefbau AG,<br />
1935 in Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-AG, ab 1953<br />
A.H.I.-BAU Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-AG. Am Ausbau<br />
der Häfen von Montevideo (Uruguay) und Rotterdam hatte die A-<br />
HI schon vor Beginn des 1. Weltkrieges großen Anteil. Niederlassungen<br />
bestanden in Köln, Hamburg, Halle/Saale (1945 enteignet)<br />
und Den Haag, später auch in Berlin, Mannheim und<br />
Wien (1945 unter Sequester gestellt). 1951 wurde eine schwedische<br />
Lizenz für ein neuartiges Gleitschnellbauverfahren für<br />
Silos, Bunker, Fernsehtürme und Hochhäuser erworben. Niederlassungen<br />
gab es wegen der erfolgreichen Entwicklung nun in<br />
Berlin, Bochum, Braunschweig, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt<br />
(Main), Hamburg, Hannover, Köln, Mainz, Mannheim, München,<br />
Saarbrücken und Siegen. In Düsseldorf und Berlin börsennotiert.<br />
1969 Abschluss eines Beherrschungsvertrages mit der<br />
Strabag Bau-AG, die inzwischen über 90 % der Aktien besaß.<br />
Los 96 Schätzwert 20-50 €<br />
Allgemeine Hoch-<br />
und Ingenieurbau-AG<br />
Düsseldorf, Aktie 1.000 RM Dez. 1941<br />
(Auflage 749, R 4) EF<br />
Los 97 Schätzwert 75-150 €<br />
Allgemeine Rentenanstalt<br />
Lebens- und Rentenversicherungs-AG<br />
Stuttgart, Namens-Stammaktie 100 RM<br />
8.3.1928 (Auflage 20000, R 5) EF<br />
Ausgestellt auf Dr. Simon Wertheimer, Direktor in<br />
München.<br />
Gründung bereits 1833 als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,<br />
1923 Umwandlung in eine AG. 1991 Umfirmierung in<br />
Württembergische Lebensversicherung AG, 2000 Fusion mit<br />
der Wüstenrot Lebensversicherungs-AG.<br />
Los 98 Schätzwert 125-200 €<br />
Allgemeine Speditions-Gesellschaft AG<br />
Duisburg, Aktie 1.000 Mark 16.4.1910.<br />
Gründeraktie (Auflage 500, R 6) EF-<br />
Großformatiges Papier, sehr dekorativ gestaltet mit<br />
Reederei-Flagge.<br />
Gründung 1910 unter Übernahme der Firma Aug. Heuser<br />
<strong>GmbH</strong>, Duisburg. Schifffahrt sowie Spedition und Lagereibetrieb.<br />
Gehörte zur Bayerischen Rheinschiffahrtsgruppe (Rhenania-Konzern).<br />
Heute gehört Rhenania zur Wicaton Gruppe.<br />
Los 99 Schätzwert 100-200 €<br />
Allgemeine Strassenbaugesellschaft<br />
und Kunststeinwerke<br />
vormals Paul Schuffelhauer AG<br />
Gross-Lichterfelde, Aktie 1.000 Mark April<br />
1906. Gründeraktie (Auflage 700, R 5)<br />
UNC-EF<br />
Schöne Umrahmung aus Blumen- und Früchtegirlanden,<br />
zwei Vignetten mit von einem “S” umschlungener<br />
Spitzhacke.<br />
Die Erschliessung des Industriegeländes Ruhlsdorfer Straße in<br />
Teltow folgte der Eröffnung der Dampfstrassenbahnlinie Berlin<br />
Teltow (im Volksmund “Lahme Ente”) im Jahr 1888. Die größte<br />
Ansiedlung war 1904 die Fa. Paul Schuffelhauer Steinsetzerei<br />
und Kunstfabrik, die Granitwaren, Pflastermaterialien und<br />
Bausteine jeder Art herstellte. Mit der 1906 erfolgten Umwandlung<br />
in eine AG wurde das Tätigkeitsgebiet auf den Strassen-<br />
und Kanalbau sowie Beton- und Asphaltarbeiten ausgedehnt.<br />
Ab 1909 Werksanschluß an die neue Teltower Industriebahn.<br />
Nach Einstellung des Betriebes 1926 umbenannt in<br />
“Grundstücksgesellschaft Schiffbauerdamm AG”. Zuletzt besaß<br />
die Ges. die Häuser Schiffbauerdamm 26 und 28. Auf diesem<br />
Grundstück steht heute das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des<br />
<strong>Deutsche</strong>n Bundestages.<br />
Los 100 Schätzwert 225-450 €<br />
Allgemeiner Bauverein Essen AG<br />
Essen, Namensaktie 1.000 Mark<br />
1.6.1919. Gründeraktie (Auflage 2000, R<br />
8, nach Kapitalumstellung 1924 noch<br />
1040) EF<br />
Faksimile für den Aufsichtsrat: Oberbürgermeister<br />
Dr. Hans Luther, der spätere Reichskanzler. Mit 8<br />
kleinen Vignetten in der Umrandung.<br />
Gründung im Juni 1919 zum Bau und zur Betreuung von Kleinwohnungen.<br />
Aus Gründen der Gemeinnützigkeit strukturierte<br />
sich der Bauverein bereits Ende der 20er Jahre um. Die gewerblichen<br />
Einrichtungen wie Ziegeleien und ähnliches wurden<br />
in die Altsstadt Baugesellschaft mbH übertragen. Der Vorstand<br />
amtiert bis heute in Personalunion für beide Gesellschaften.<br />
Bereits um 1930 betrug der Wohnungsbestand der Gesellschaft<br />
knapp 2000 Wohnungen. Heute Allbau AG. Der Allbau<br />
hatte am Wiederaufbau von Wohnungen in Essen im Zeitraum<br />
von 1945 bis 1967 einen maßgeblichen Anteil von über 7 %.<br />
In dieser Zeit stieg der Wohnungsbestand von 4.150 auf<br />
13.775. 1997 ging die Mehrheit der Aktien aus dem Besitz der<br />
Stadt in das Eigentum einer städtischen Holding aus EVAG und<br />
Stadtwerken sowie der Stadtsparkasse Essen über. Heute<br />
(2009) bewirtschaftet die Gesellschaft 17.795 Mietwohnungen<br />
und ist ein wichtiger Akteur für die Stadtentwicklung in Essen.<br />
Nr. 92 Nr. 107 Nr. 101<br />
11
Los 101 Schätzwert 50-125 €<br />
Altenaer gemeinnützige<br />
Baugesellschaft<br />
Altena, Namensaktie 1.000 RM<br />
10.5.1940 (Auflage 225, R 5) UNC-EF<br />
Gründung am 14.2.1870 als Altenaer Baugesellschaft mit einem<br />
Kapital von 20.000 Thalern, eingetragen am 25.3.1871.<br />
Später als Altenaer gemeinnützige Baugesellschaft AG firmierend.<br />
1941 wurden im Zuge der Neuorganisation der gemeinnützigen<br />
Wohnungsunternehmen die Spar- und Bauverein<br />
<strong>GmbH</strong> sowie die Gemeinnützige Baugesellschaft Nachrodt-Wiblingwerde<br />
<strong>GmbH</strong> übernommen. Bis 1942 baute die Gesellschaft<br />
364 Häuser mit 1.320 Wohnungen. 1990 Umbenennung<br />
in Altenaer Baugesellschaft AG. Großaktionär ist die Stadt<br />
Altena mit 40,5 %, 12 Industriebetriebe und 2 Kreditinstitute<br />
halten zusammen 59,5 %.<br />
Los 102 Schätzwert 75-125 €<br />
Altenburger Glashütte AG<br />
Altenburg, Aktie 1.000 Mark Sept. 1921.<br />
Gründeraktie (Auflage 1500, R 7) EF-VF<br />
Hermann Hirsch führte zunächst zusammen mit zwei Brüdern<br />
und dem Schwager die Glasfabrik W. Rönsch, Hirsch & Co. in Radeberg.<br />
Die Wege trennten sich 1869, da sich Hermann Hirsch<br />
mehr dem Hohlglas verbunden fühlte, seine Brüder und der<br />
Schwager dagegen dem Tafelglas. Hermann Hirsch erwarb im<br />
damals noch thüringischen Altenburg ein Grundstück am Kauerndorfer<br />
Weg (heute Fabrikstraße, vis-á-vis vom Bahnhof) und<br />
errichtete dort eine Glashütte. Nach seinem Tod 1871 übernahm<br />
sein Sohn Carl Adolph Otto Hirsch die Fabrik, besaß aber als<br />
Buchhalter nicht die nötige Kompetenz, 1876 kam die Fabrik<br />
zum Stillstand. 1880 versuchte Franz Zahn aus Böhmen die Fabrik<br />
wieder in Gang zu setzen, doch schon 1893 stand sie erneut<br />
zum Verkauf. 1921 kam es dann zur Gründung der Altenburger<br />
Glashütte AG an der Zeitzer Str. 33, die an einem Hafenofen Kolben<br />
für Isolierflaschen herstellte. Auch diese Fabrik überlebte nur<br />
bis zur Weltwirtschaftskrise, im März 1931 ging sie in Konkurs.<br />
Los 103 Schätzwert 20-60 €<br />
Altenburger Land-Kraftwerke AG<br />
Altenburg, Thür., Aktie Lit. A 1.000 RM<br />
21.4.1925 (Auflage 600, R 4) UNC-EF<br />
Gedruckt von der Spielkartenfabrik AG Altenburg.<br />
Die Gesellschaft übernahm 1912 bei ihrer Gründung das Kraftwerk<br />
Rositz der Rositzer Braunkohlenwerke AG und die Stromverteilungsanlagen<br />
der Elektrizitätsgenossenschaft Langenleuba-Altenburg,<br />
gleich darauf auch die Ortsnetze von Meuselwitz<br />
(mit dem Thalacker’schen Elektrizitätswerk) und Rositz sowie<br />
1913 das Elektrizitätswerk Lucka. Das Versorgungsgebiet umfaßte<br />
damit den Ostkreis des ehemaligen Herzogtums Altenburg<br />
nach der Eisenbahn Leipzig-Hof zu mit 102 Städten und<br />
Gemeinden. 1931 Fusion mit der schon zuvor in Personalunion<br />
geführten Stromversorgung Altenburg AG (gegr. 1923 als<br />
Strassenbahn und Elektrizitätswerk Altenburg AG). 1939/40 Übernahme<br />
der Versorgung der Gemeinden Prößdorf, Bünaurode<br />
und Falkenhain von der Reichswerke AG „Hermann Göring“<br />
Abt. Braunkohlenwerk Phönix. Großaktionär war die Thüringer<br />
Gasgesellschaft, Börsennotiz Leipzig.<br />
Los 104 Schätzwert 20-50 €<br />
Altenburger Land-Kraftwerke AG<br />
Altenburg, Aktie 1.000 RM Febr. 1942<br />
(Auflage 1200, R 3) EF<br />
12<br />
Los 105 Schätzwert 75-125 €<br />
Altmärkische Bergwerks-AG<br />
Braunschweig, Aktie 20 Goldmark Okt.<br />
1924 (Auflage 2400, R 7) EF<br />
Sehr dekorative Umrandung mit Bergmann und<br />
Merkur.<br />
Gründung 1923. Börsennotiz Freiverkehr Braunschweig. 1928<br />
Beschluß der Änderung in Vereinigte Braunkohlenbergwerks-<br />
AG und Verlegung des Sitzes nach Gardelegen.<br />
Los 106 Schätzwert 30-75 €<br />
Amag-Hilpert-Pegnitzhütte AG<br />
Nürnberg, Aktie 1.000 RM 27.11.1941<br />
(Auflage 439, R 4) EF<br />
Gründung 1889 zur Übernahme der seit 1857 bestehenden<br />
Fa. J. A. Hilpert in Nürnberg als “Armaturen- und Maschinenfabrik<br />
AG vorm. J. A. Hilpert”, 1939 Umfirmierung wie oben.<br />
1891 Errichtung einer Gießerei in Pegnitz, 1896 Ankauf der<br />
Kelsenschen Armaturenfabriken in Wien und Pest (1918 mit<br />
der Wiener Niederlassung der Fa. Bopp & Reuther, Mannheim,<br />
in einer eigenen AG verselbständigt). Produziert wurden im<br />
Werk Nürnberg Kreiselpumpen, Säurepumpen und Säurearmaturen,<br />
im Werk Pegnitz Armaturen aller Art. 1959 Umwandlung<br />
auf die Großaktionärin Klein, Schanzlin & Becker AG in Frankenthal<br />
(KSB).<br />
Los 107 Schätzwert 300-375 €<br />
Ambrosius Marthaus<br />
Filz- und Filzwarenfabriken AG<br />
Oschatz, Aktie 100 RM 19.9.1933<br />
(Auflage 525, R 11) VF-<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, nur 2 Stück lagen<br />
im Reichsbankschatz, dies ist das letzte verfügbare.<br />
Fleckig.<br />
Gründung im Sept. 1930 zum Fortbetrieb des von der KG Ambrosius<br />
Marthaus in Oschatz geführten Fabrikations- und Handelsgeschäfts.<br />
Herstellung und Vertrieb von Filzen und Filzwaren<br />
sowie Schuhwaren aller Art. 1946 enteignet und im Handelsregister<br />
gelöscht.<br />
Los 108 Schätzwert 75-200 €<br />
Amperwerke Elektricitäts-AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark 30.7.1909<br />
(Auflage 1000, R 4) EF<br />
Gründung 1908 unter Übernahme der “Industrielle Unternehmungen<br />
<strong>GmbH</strong>” und der “Süddeutsche Wasserwerke AG”. Zwei<br />
Wasserkraftwerke und ein Dampfkraftwerk versorgten damals<br />
24 Ortschaften mit rd. 3.000 Stromkunden. 1909/10 Inbetriebnahme<br />
der Wasserkraftwerke Unterbruck und Kranzberg,<br />
1923 Gründung der “Neue Amperkraftwerke AG, München”<br />
zum Bau des Wasserkraftwerks Haag. Diese AG ging 1932 ebenso<br />
wie die “Bayerische Überlandzentrale AG, München”<br />
durch Fusion in den Amperwerken auf, deren Großaktionär die<br />
Gesellschaft für elektrische Unternehmungen (Gesfürel) in Ber-<br />
lin war. 1955 Fusion mit der Isarwerke AG (gegr. 1921) zur Isar-Amperwerke<br />
AG. 1954-56 Ausbau der Dampfkraftwerke<br />
Höllriegelskreuth und Zolling-Anglberg. Ferner gingen in Betrieb<br />
das Dampfkraftwerk Irsching (1969), das Kernkraftwerk<br />
Essenbach bei Landshut (1977, mit Partner Bayernwerk) das<br />
Kernkraftwerk Isar I (1979) und das Kernkraftwerk Isar II<br />
(1988). Zunächst über 3/4, später noch knapp 50 % des Kapitals<br />
der Isar-Amperwerke hielten die Isarwerke <strong>GmbH</strong> (die wiederum<br />
zu 45 % dem Bankhaus Merck, Finck & Co. in München,<br />
zu 25 % dem RWE und zu 10 % der Allianz-Versicherung<br />
gehörten). Im Jahr 2000 fusionierten das Bayernwerk und die<br />
PreußenElektra zur E.ON Energie AG. Diese besaß nun direkt<br />
und indirekt eine Dreiviertelmehrheit der Isar-Amperwerke AG,<br />
die 2001 in E.ON Bayern AG umbenannt wurde. Gleichzeitig<br />
wurden die bisherigen großen Bayernwerk-Beteiligungen (u.a.<br />
Überlandwerk Unterfranken, Energieversorgung Ostbayern, Energieversorgung<br />
Oberfranken, Großkraftwerk Nürnberg u.a.)<br />
in die E.ON Bayern AG eingebracht.<br />
Los 109 Schätzwert 75-200 €<br />
Amperwerke Elektricitäts-AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark 1.1.1911<br />
(Auflage 1000, R 4) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 110 Schätzwert 100-150 €<br />
AMSTEA American Steel Engineering<br />
and Automotive Products AG<br />
Berlin, Aktie 500 RM 18.12.1924 (Auflage<br />
400, R 8), ausgestellt auf Leo Leites,<br />
Berlin VF+<br />
Gegründet 1920 in Berlin (Bellevuestr. 14, später Unter den<br />
Linden 50/51) zwecks Einfuhr von Rohmaterialien, Halb- und<br />
Ganzfabrikaten der Stahl-, Automobil- und Maschinenindustrie<br />
(Werkzeuge, Bestecke usw.) aus dem Ausland, vor allem aus<br />
den USA, sowie Ausfuhr von deutschen Industrieerzeugnissen.<br />
Auch Lizenznehmer und Importeur der amerikanischen Evans-<br />
Motorräder (bis zum Konkurs von Evans 1925). Schwesterfirmen<br />
bestanden unter gleichem bzw. ähnlichen Namen in Hamburg,<br />
Düsseldorf (“Amstea” Stahlhandels-AG) und Paris. 1925<br />
umbenannt in “Amstea” Amerikanische AG für Stahl-, Maschinen-<br />
und Automobilerzeugnisse. 1929 Sitzverlegung nach<br />
Düsseldorf. 1929 Sitzverlegung nach Düsseldorf, 1933 inaktiv<br />
und von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 111 Schätzwert 200-250 €<br />
AMSTEA American Steel Engineering<br />
and Automotive Products AG<br />
Berlin, Aktie 500 RM 7.5.1925 (Auflage<br />
nur 100 Stück, R 9), ausgestellt auf Leo<br />
Leites, Berlin VF+<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt.<br />
Los 112 Schätzwert 30-75 €<br />
Andreae-Noris Zahn AG<br />
Frankfurt a.M., Aktie 1.000 RM Nov. 1941<br />
(Auflage 3950, R 3) EF<br />
Die 1923 gegründete J.M. Andreae AG geht auf eine vor über<br />
150 Jahren in der Frankfurter Innenstadt von Johann Matthias<br />
Andreae eröffnete „Material- und Farbwaaren-Handlung“ zurück.<br />
Sein Geschäftshaus kaufte er von der Dame Melber, einer<br />
Tante von Johann Wolfgang von Goethe. Aus der Fusion mit der<br />
Nürnberger Handelsgesellschaft Noris Zahn & Cie. entstand<br />
dann das noch heute als ANZAG börsennotierte Pharmagroßhandels-Unternehmen.<br />
Los 113 Schätzwert 75-125 €<br />
Andreas Haassengier <strong>GmbH</strong><br />
Armaturen-Fabrik und Eisengiesserei<br />
Halle, Anteilschein 10.000 Mark<br />
11.1.1923 (R 7) EF<br />
Die 1841 gegründete Armaturen-Fabrik und Metallgießerei firmierte<br />
in der Hordorfer Straße in Halle.<br />
Nr. 113<br />
Los 114 Schätzwert 75-150 €<br />
Anhaltische Kohlenwerke<br />
Frose in Anhalt, Aktie 1.000 Mark<br />
3.4.1906 (Auflage 1000, R 7) VF+<br />
1867 wurden die Abbaurechte für die Froser Kohlenfelder durch<br />
das Bergamt zu Bernburg verliehen, es folgte die Gründung der<br />
Froser Braunkohlen-Bergbau AG mit der Braunkohlengrube Ludwig<br />
(später Umwandlung in Zeche Anhalt). 1881 Umwandlung<br />
der Gewerkschaft Zeche Anhalt in eine AG (Anhaltische Kohlenwerke).<br />
1908 Sitzverlegung von Frose nach Halle a.S. und 1940<br />
nach Berlin. Die Betriebe in der Sowjetzone wurden nach 1945<br />
entschädigungslos enteignet. 1950 verlagert nach Berlin (West),<br />
1983 umgewandelt in AK-Vermögensverwaltungs-<strong>GmbH</strong>, Berlin<br />
(West), heute mit Geschäftssitz in Düsseldorf.<br />
Los 115 Schätzwert 25-100 €<br />
Anhaltische Kohlenwerke<br />
Halle (Saale), Aktie 1.000 Mark 1.7.1920<br />
(Auflage 5000, R 3) EF<br />
Los 116 Schätzwert 75-125 €<br />
Anhaltische Kohlenwerke<br />
Halle (Saale), Sammelaktie 100 x 1.000<br />
RM Aug. 1943 (R 6) EF<br />
Maschinenschriftlich ausgefertigt.
Los 117 Schätzwert 50-125 €<br />
Anton Reiche AG<br />
Dresden, Namensaktie 1.000 Mark<br />
11.6.1921 (Auflage 2750, R 4) EF<br />
Gründung Dez. 1912 zur Weiterführung der gleichnamigen<br />
Schokoladenformen-, Blechemballagen- und Blechplakatfabrik.<br />
Ferner Vertrieb von Kunstharzgegenständen und Maschinen.<br />
Die Ges. besaß Grundstücke in Dresden, Plauen und Dölzschen<br />
und war zu 100 % im Familienbesitz. Die europaweit<br />
größte Fabrik für Gebäck- und Schokoladenformen aus Weißblech<br />
beschäftigte bis zu 900 Arbeiter. Das Werk wurde in der<br />
DDR vom Kombinat NAGEMA übernommen (nach 1990 geschlossen).<br />
Los 118 Schätzwert 20-60 €<br />
APAG Apollowerk AG<br />
Gößnitz (Kr. Altenburg), Aktie 100 RM<br />
2.1.1939 (Auflage 1080, R 3) EF<br />
Die Fabrik besteht bereits seit 1863. Hergestellt werden Pumpen<br />
und Kompressoren sowie Gußerzeugnisse aller Art. 1922<br />
Umwandlung der <strong>GmbH</strong> in die APAG Apollo-Plantectorwerk AG,<br />
ab 1938 APAG Apollowerk AG. Nach dem 2. Weltkrieg enteignet,<br />
1993 als Apollowerk Gößnitz <strong>GmbH</strong> reprivatisiert.<br />
Los 119 Schätzwert 50-175 €<br />
Arno & Moritz Meister AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 2.1.1893.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 4) VF<br />
Einzige jemals begebene Aktienemission dieser<br />
Gesellschaft, 1942 Heraufsetzung des Nennwertes<br />
auf 1.200 RM.<br />
Ursprünglich 1865 gegründete Spinnerei und Zwirnerei, Verbandwattefabrik.<br />
AG seit 1.10.1892. Spinnerei und Zwirnerei<br />
mit etwa 60.000 Spindeln einschl. 5.000 Zwirnspindeln<br />
(1943). In den 1950er Jahren in Konkurs getrieben, wurde<br />
volkseigen und gehörte seit 1961 zum VEB Baumwollspinnerei<br />
Flöha. 1991 liquidiert.<br />
Los 120 Schätzwert 75-150 €<br />
Arterner Elektrizitätswerke AG<br />
Artern, Aktie 1.000 Mark 1.1.1921<br />
(Auflage 400, R 5) EF<br />
Großformatiges Papier, dekorativ gestaltet.<br />
Bis zur Schiffbarmachung im 18. Jh. floss die Unstrut ungehindert<br />
durch die Stadt Artern. Dann wurde sie aufgestaut und mit<br />
einer 1791-93 erbauten Schleuse versehen (2007 rekonstru-<br />
iert). Die Wasserkraft der Unstrut trieb nicht nur die Mühlräder<br />
der grossen Wassermühle an, sondern später auch die Wasserturbine<br />
des 1893 gegründeten Elektrizitätswerkes. Später<br />
wurde das Werk um drei Dampfkolbenmaschinen ergänzt.<br />
Nach dem 1908 abgeschlossenen neuen Konzessionsvertrag<br />
konnte die Stadtgemeinde Artern das E-Werk und das Versorgungsnetz<br />
jederzeit zum Taxwert erwerben - was aber nicht so<br />
dringlich war, denn die Stadt war gleichzeitig sowieso der<br />
Großaktionär des E-Werkes. 1941 umbenannt in Städtische Elektrizitätswerke<br />
Artern AG. Nach 1945 enteignet, seit der Wende<br />
ein Standort der Mitteldeutsche Energie AG.<br />
Los 121 Schätzwert 75-125 €<br />
Arterner Elektrizitätswerke AG<br />
Artern, Aktie 1.000 RM 1.1.1928 (Auflage<br />
nur 100 Stück, R 6) EF<br />
Los 122 Schätzwert 75-125 €<br />
Arthur Trägner & Co.<br />
Maschinenbau-AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 12.1.1924<br />
(Auflage 10000, R 7) EF-<br />
Gründung als AG 1921 zur Fortführung der Werkzeugmaschinenfabrik<br />
der Firma Trägner & Co.; Interessengemeinschaft mit<br />
der Werkzeugmaschinenfabrik Union (vorm. Diehl). 1925 in Liquidation.<br />
Los 123 Schätzwert 200-250 €<br />
Ascherslebener<br />
Bergwerksgesellschaft mbH<br />
Aschersleben, Anteilschein Lit. B<br />
(Unterdruck altrosa) 2.500 Mark<br />
31.5.1905 (R 11), ausgestellt auf die<br />
Ascherslebener Bank VF<br />
Dekorative Umrahmung aus Laubgirlanden, Originalunterschriften.<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die Gründung initiierte 1904 die seinerzeit in der Branche sehr<br />
bekannte Heinrich Lapp AG für Tiefbohrungen, Aschersleben,<br />
im Verein mit der Ascherslebener Bank, Gerson, Kohen & Co.<br />
KG. Gründungskapital 250.000 M (Lit. A), 1905 auf 500.000 M<br />
verdoppelt (Lit. B). Schon 1865 hatte mit der Eröffnung der<br />
Bahnstrecke Dessau-Aschersleben-Halberstadt der Kali- und<br />
Salzbergbau sowie der Braunkohlenbergbau (vor allem im benachbarten<br />
Nachterstedt) einen großen Aufschwung genommen.<br />
Wer aber annimmt, diese Ges. habe sich mit den direkt<br />
vor ihrer Haustür liegenden Möglichkeiten begnügt, der irrt:<br />
Man nutzte nur das hier vorhandene bergbauliche Know-How<br />
und Kapital, aber Unternehmenszweck waren Petrol-, Kali- und<br />
Steinkohlenbohrungen bei Targowiska und Lezany im fernen<br />
Galizien. Mit dem für die Achsenmächte verlorenen 1. Weltkrieg<br />
endete mit dem Zerfall der Donaumonarchie auch dieses Abenteuer<br />
in deren vormals östlichstem Zipfel.<br />
Los 124 Schätzwert 20-50 €<br />
Aschinger AG<br />
Berlin, Genuss-Schein 500 RM Okt. 1938<br />
(R 3) EF<br />
1892 gegründet, ab 1900 AG. 1904 erwarb die Ges. die ersten<br />
Grundstücke, auf denen 1905 das Hotel Fürstenhof und das<br />
Weinhaus Reingold begonnen wurden. 1913 Erwerb des Palast-Hotels<br />
und 1924 der Mehrheit des Grundkapitals der Geka,<br />
Geschäfts- und Kontorhaus AG (Besitzerin des Pschorrhauses,<br />
gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche). Im<br />
gleichen Jahr erwarb die Ges. die Mehrheit des Grundkapitals<br />
der Berliner Hotel-Gesellschaft (Kaiserhof und Baltic) und im<br />
Jahr 1926 der Hotelbetriebs-AG (Bristol und Centralhotel). Traditionsreiches<br />
Gaststätten- und Hotel-Unternehmen. Aschinger<br />
war die bekannteste und größte Fa. in der Berliner Gastronomie<br />
und erlangte später vor allem durch die kostenlosen<br />
Schrippen Berühmtheit. 1947 übernimmt die <strong>Deutsche</strong> Treuhandstelle<br />
die im sowjetischen Sektor liegende Zentrale sowie<br />
die dazugehörenden Gaststätten. Die Teilgesellschaft West:<br />
1950 Berliner Wertpapierbereinigung. 1971 Umwandlung in<br />
die noch heute existierende Einzelfirma Aschinger Gasthausbrauerei<br />
am Kurfürstendamm.<br />
Los 125 Schätzwert 50-125 €<br />
Asphaltfabrik Rudow<br />
Dr.-Ing. Wilhelm Schliemann AG<br />
Rudow b. Berlin, Aktie 1.000 Mark Febr.<br />
1922. Gründeraktie (Auflage 770, R 5) EF<br />
Gegründet 1922. Verarbeitung und Vertrieb von Teer und Teerprodukten<br />
(Asphalt). 1932 wurde ein Zwangsvergleichsverfahren<br />
abgeschlossen.<br />
Los 126 Schätzwert 30-75 €<br />
Astrawerke AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 RM 1.6.1937<br />
(Auflage 905, R 3) EF<br />
Gründung 1921. Hergestellt wurden Präzisionsmaschinen, vor<br />
allem Addier-, Buchungs-, Rechen- und Schreibmaschinen.<br />
Börsennotiz im Freiverkehr Leipzig. Nach 1945 wurde das<br />
Werk von den Sowjets vollständig demontiert. Leitende Ange-<br />
stellte gründeten daraufhin in Köln die Exacta Büromaschinen<br />
<strong>GmbH</strong> (später Exacta-Continental <strong>GmbH</strong>), die 1960 von der<br />
Wanderer Werke AG übernommen wurde. 1968 Verkauf an den<br />
Paderborner Unternehmer Heinz Nixdorf, der aus der Firma die<br />
NIXDORF COMPUTER AG formte.<br />
Los 127 Schätzwert 350-450 €<br />
Atlas Rückversicherungs-AG<br />
Berlin-Schöneberg, Namensaktie 1.000 Mark<br />
5.4.1922 (R 10), ausgestellt auf Direktor<br />
Heinrich Fahlbusch, Brandenburg a.H. (der<br />
zu der Zeit AR-Vorsitzender war) EF<br />
Zuvor unbekannt gewesene Emission, nur 5 Stück<br />
wurden im Reichsbankschatz gefunden.<br />
Gründung im März 1920. Zweck der Gesellschaft waren Rükkversicherungen<br />
im In- und Ausland sowie Transportversicherung.<br />
1928 von Amts wegen gelöscht. Das Büroanwesen der<br />
Atlas Rückversicherung in Berlin-Schöneberg fand sich 1932<br />
dann im Besitz der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG,<br />
zu der eine entsprechende Verbindung bestand.<br />
Los 128 Schätzwert 500-625 €<br />
Atlas Rückversicherungs-AG<br />
Berlin-Schöneberg, Namensaktie 5.000<br />
Mark 1.4.1923 (Auflage 1000, R 10),<br />
ausgestellt auf Direktor Heinrich<br />
Fahlbusch, Brandenburg a.H. (der zu der<br />
Zeit AR-Vorsitzender war) VF<br />
Auch diese Ausgabe war zuvor völlig unbekannt,<br />
nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 129 Schätzwert 50-125 €<br />
Auerbacher Stadtbank AG<br />
Auerbach (Vogtl.), Aktie 1.000 RM März<br />
1926 (Auflage 140, R 5) EF<br />
Gründung 1925 als Auerbacher Stadtbank, ab 1927: Göltzschtalbank<br />
AG. Betrieb von Bankgeschäften jeder Art. Die Führung<br />
der Konten der Gesellschaft besorgte eines Vertrages die Girozentrale<br />
Sachsen, Zweiganstalt Auerbach. 1935 erfolgte die Überleitung<br />
der Geschäfte der Niederlassung Auerbach i.Vogt.<br />
der Landesbank Westsachsen AG auf die mit der Gesellschaft<br />
im Vertragsverhältnis stehende Girozentrale Sachsen -öffentliche<br />
Bankanstalt- Zweiganstalt Auerbach.<br />
13
Los 130 Schätzwert 75-125 €<br />
Auerswald & Sauerbrunn AG<br />
Lössnitz (Erzgeb.), Aktie 20 RM<br />
17.12.1934 (R 8) EF-VF<br />
Gegründet 1921 zum Betrieb einer Schuhfabrik. 1930 wurde<br />
die Schuhfabrikation aufgegeben und die AG als Grundstücksgesellschaft<br />
weitergeführt. 1941 sollte über Auflösung beschlossen<br />
werden.<br />
Los 131 Schätzwert 300-375 €<br />
Augsburger Kammgarn-Spinnerei<br />
Augsburg, Aktie 5.000 Mark 23.10.1920<br />
(Auflage 428, R 9), ausgestellt auf die<br />
<strong>Deutsche</strong> Bank Filiale Augsburg EF-<br />
Großformatiges Papier, original signiert. Zuvor<br />
ganz unbekannt gewesener Jahrgang, nur 8 Stück<br />
lagen im Reichsbankschatz.<br />
Ursprünglich betrieb der Kaufmann J. Fr. Merz in Nürnberg eine<br />
Schafwollgroßhandlung, aus der eine Kammgarnspinnerei<br />
mit Pferdebetrieb hervorging. Wegen der viel günstigeren Wasserkraft<br />
ging Merz 1836 nach Augsburg und errichtete hier an<br />
der Schäfflerbachstraße die mit 3.000 Spindeln damals größte<br />
Kammgarn-Spinnerei im Gebiet des <strong>Deutsche</strong>n Zollvereins.<br />
1845 Umwandlung in eine AG. 1925 Übernahme der Werdener<br />
Feintuchwerke AG in Essen-Werden (1963 wieder abgestoßen).<br />
Die größte deutsche Kammgarnspinnerei kämpfte sehr<br />
lange, wurde aber Ende 2001 dann doch eines der letzten Opfer<br />
der Krise der deutschen Textilindustrie.<br />
Los 132 Schätzwert 75-125 €<br />
Augsburger Kammgarn-Spinnerei<br />
Augsburg, Aktie (Zwischenschein) 500<br />
RM März 1934 (Auflage 2668, R 6),<br />
ausgestellt auf die Dresdner Bank Filiale<br />
Augsburg EF<br />
Los 133 Schätzwert 75-125 €<br />
Augsburger Kammgarn-Spinnerei<br />
Augsburg, Namensaktie 1.000 RM<br />
24.11.1941 (Auflage 2337, R 6),<br />
ausgestellt auf die <strong>Deutsche</strong> Bank Filiale<br />
München UNC-<br />
Auch diese Ausgabe war zuvor ganz unbekannt.<br />
14<br />
Nr. 133<br />
Los 134 Schätzwert 25-80 €<br />
August Enders AG<br />
Oberrahmede i.W., Aktie 200 RM<br />
17.12.1929 (Auflage 2500, R 6) EF<br />
Gegründet bereits 1883 als <strong>GmbH</strong>, 1923 Umwandlung in eine<br />
AG. Firmenzweck war die umformende Verarbeitung von Eisen,<br />
Metall und anderen Werkstoffen. 2004 Verschmelzung mit der<br />
Colsmann & Co <strong>GmbH</strong> in Werdohl zur Enders Colsmann AG.<br />
Unter der Marke “Enders” werden heute Terrassenheizstrahler,<br />
Grillgeräte, Campingkocher und Alu-Boxen produziert.<br />
Los 135 Schätzwert 100-125 €<br />
August Thyssen-Hütte AG<br />
Duisburg-Hamborn, 4,5 % Teilschuldv. 500<br />
RM Dez. 1937 (Auflage 9000, R 10) EF<br />
Originalunterschriften. Für diese Anleihe hatten die<br />
Vereinigten Stahlwerke eine Bürgschaft übernommen,<br />
dort mit Faksimile-Unterschrift Poensgen.<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Begründer des Thyssen-Konzerns war August Thyssen. Sein Vater<br />
Friedrich Thyssen betrieb in Eschweiler zunächst ein Drahtwalzwerk,<br />
dann ein Bankgeschäft. 1871 gründete August Thyssen<br />
in Mülheim (Ruhr) mit der KG Thyssen & Co. ein Puddel- und<br />
Walzwerk. 1885 begann er, mit dem Aufkauf von Kuxen der Gewerkschaft<br />
<strong>Deutsche</strong>r Kaiser eine eigene Kohlengrundlage zu<br />
schaffen (1888 wurde er dort Vorsitzender des Grubenvorstands).<br />
Seine spätere Struktur erlangte der Thyssen-Konzern<br />
1919, als die Gewerkschaft <strong>Deutsche</strong>r Kaiser unter Übernahme<br />
der gesamten Thyssen’schen Unternehmungen ihren Namen in<br />
Gewerkschaft August Thyssen-Hütte änderte. Der Bergwerksbesitz<br />
wurde dann in die Gewerkschaft Friedrich Thyssen ausgegliedert.<br />
Am 5.5.1926, kurz vor seinem Tod, unterzeichnete August<br />
Thyssen noch den Vertrag zur Einbringung dieser Unternehmen<br />
in die Vereinigte Stahlwerke AG. AG wurde die August Thyssen-Hütte<br />
erst 1933, als die Vereinigten Stahlwerke die Thyssen-<br />
Betriebe in eine eigene AG ausgliederten. Unter gleichem Namen<br />
entstand 1953 die AG neu, als letzte der Nachfolgegesellschaften<br />
der von den Alliierten zerschlagenen Vereinigte Stahlwerke<br />
AG. 1977 Umfirmierung in Thyssen AG, heute ThyssenKrupp.<br />
Nr. 131 Nr. 138<br />
Passagier- und Transportflugzeug Junkers "Ju 52/3m" (Spitzname "Tante Ju") -<br />
produziert von 1932 bis 1952<br />
Los 136 Schätzwert 125-200 €<br />
Autogen Gasaccumulator AG<br />
Berlin, Sammelaktie 10 x 100 RM Nov.<br />
1941 (R 8) EF<br />
Kleine Vignette mit Leuchtturm.<br />
Gründung 1915. Herstellung und Vertrieb von autogenen<br />
Schweiss- und Schneidanlagen, Acetylen-Stahlflaschen. Besonderheiten:<br />
Automobil-, Waggon-, Signal- und See-Beleuchtung.<br />
Fabrikbetriebe in Berlin, Johanniterstr. 6, Berlin-Adlershof,<br />
Rothenstein bei Königsberg, Oberlichtenau bei Chemnitz,<br />
Gross-Mochbern bei Breslau und Gelsenkirchen. Zweigniederlassungen<br />
(Verkaufsbüros) in Breslau, Dresden, Düsseldorf,<br />
Hannover, Hamburg, Königsberg und Nürnberg. Entwickelt<br />
wurde unter der Leitung von Nobelpreisträger Gustaf Dalen ein<br />
Beleuchtungssystem für Leuchttürme (AGA-Fryen), das auf<br />
Gas basierte. Dalen entwickelte auch einen Gasherd, den AGA-<br />
Herd. Der Schwede wirkte in der schwedischen Aktiebolaget<br />
Gas-Accumulator, die seit 2000 zum Linde-Konzern gehört.<br />
Los 137 Schätzwert 50-175 €<br />
Autoräder- und Felgenfabrik<br />
Max Hering AG<br />
Ronneburg (Thür.), Aktie 1.000 Mark<br />
1.1.1915. Gründeraktie (Auflage 500, R 5) EF<br />
Faksimile-Unterschrift Max Hering.<br />
1888 gründete der gelernte Schmied und Wagenbauer Friedrich<br />
Hering in Gera eine Firma zur Produktion von Fahrradteilen. Um<br />
die Jahrhundertwende Erweiterung der Fertigungsprogramms<br />
um Fahrgestelle, Kugellager, Achsen und Holzspeichenräder für<br />
die aufstrebende Automobilindustrie, aus diesem Anlaß Umfirmierung<br />
in “<strong>Deutsche</strong> Automobilindustrie Friedrich Hering”.<br />
Nach dem Tod des Firmengründers verlagerten seine Söhne Alfred<br />
und Karl Max Hering 1902 die Fabrik, deren Kapazitäts-<br />
grenze in Gera erreicht war, ins nahegelegene Ronneburg. Produziert<br />
wurde hier ein über die Grenzen bekanntes Automobil,<br />
der Rex Simplex (damals u.a. mit Motoren von Fafnir aus Aachen).<br />
Für die weitere Expansion wurde frisches Kapital benötigt.<br />
So wurde 1904 der Berliner Kaufmann Carl Richard als Teilhaber<br />
gewonnen, welches die Umfirmierung in <strong>Deutsche</strong> Automobilindustrie<br />
Richard & Hering bewirkte. 1906 wurden bereits<br />
rund 600 Fahrzeuge hergestellt. 1907 ging man an die Konstruktion<br />
eigener Motoren. Die notwendigen investiven Mittel,<br />
die mit der Konstruktion verbunden waren, wurden 1908 durch<br />
die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft besorgt. Mit dem<br />
Eintritt des Automobil-Ingenieurs Dr. Ernst Valentin (brachte später<br />
bei Russo-Balt in Riga die Automobilproduktion in Gang) als<br />
Chefingenieur wurden die Fahrzeuge sowie die Motoren grundlegend<br />
verbessert und besaßen europaweit einen ausgezeichneten<br />
Ruf. Der Rex-Simplex wurde ins Baltikum, nach Russland,<br />
Skandinavien, England, Portugal und sogar Südafrika exportiert.<br />
1913 wurde die Automobil- und die Zuliefererteile-Produktion<br />
getrennt. Dabei schied Max Hering aus dem Unternehmen aus<br />
und gründete 1914 seine eigene Autoräder & Felgenfabrik Max<br />
Hering. Hergestellt wurden Auto-Räder, Felgen und Holzrädern<br />
für Gespannfahrzeuge. Bereits 1917 belieferte Max Hering namhafte<br />
Automobilproduzenten wie das Eisenacher Dixi-Werk (später<br />
BMW), ferner Adler, Audi, Benz, Daimler, Horch, Opel und<br />
Stoewer, später auch BMW, Maybach, Fiat, Hansa-Lloyd, Ford<br />
und Chevrolet. 1918 Umfirmierung in Fabrik für Fahrzeugbestandteile<br />
AG, 1926 wurde aber wieder der alte Firmenname angenommen.Ende<br />
der 30er Jahre standen gut 1300 Mitarbeiter<br />
in Lohn und Brot. Aktionäre waren zuletzt je zur Hälfte die Vorstände<br />
Max und Alfred Hering. Nach dem Krieg erfolgte die Enteignung<br />
beider Ronneburger Werke. Innerhalb der VVB Automobilbau<br />
(Vereinigung Volkseigener Betriebe) und später im Kombinat<br />
Personenkraftwagen produzierten dann beide Unternehmen<br />
als VEB IFA Fahrzeugzubehörwerke Felgen und Scheibenräder<br />
für Wartburg und Trabant. 1991 reprivatisiert und neugegründet<br />
als MEFRO Räderwerk Ronneburg <strong>GmbH</strong>. Hergestellt<br />
werden heute Räder für Traktoren, Land- und Baumaschinen,<br />
PKW-Anhänger und Caravans, aber auch Schubkarren.<br />
Los 138 Schätzwert 500-625 €<br />
Badisch-Pfälzische Luft-Hansa AG<br />
Mannheim, Aktie (Interimsschein) 1.000<br />
RM 31.12.1927 (Auflage max. 820, R 8)<br />
EF-VF<br />
Das Unternehmen hat zwei Wurzeln: 1919 wird die Badische<br />
Luftverkehrsgesellschaft mbH in Karlsruhe gegründet. Sie eröffnet<br />
1920 den Flugpostdienst Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe-<br />
Lörrach. 1925 wird zur Förderung der badischen und pfälzischen<br />
Luftverkehrsinteressen die Badisch-Pfälzische Luftverkehrs-AG<br />
gegründet. Sie eröffnet noch im Gründungsjahr eine<br />
Flugverbindung Mannheim-Berlin vom gerade eingeweihten<br />
Flugplatz Mannheim-Sandhofen. Weitere Linienflüge von dort<br />
führen täglich nach Baden-Baden, Dortmund, Frankfurt/Main,<br />
Hamburg, Konstanz, Kopenhagen, München, Stuttgart, Villingen<br />
und Zürich. Beide Unternehmen fusionieren im Mai 1926 zur<br />
Badisch-Pfälzische Luft-Hansa AG. Im gleichen Jahr wird in<br />
Neuostheim der Flughafen Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen<br />
eröffnet, den die Luft-Hansa nunmehr mit ihren Linienflügen<br />
bedient. 1933 Zusammenschluß mit der Luftverkehrsgesellschaft<br />
Konstanz <strong>GmbH</strong>. 1937 umfirmiert in Badisch-Pfälzische<br />
Flugbetrieb-AG, zugleich Ausgliederung der Flugzeugwerft in<br />
die Badisch-Pfälzische Flugzeugreparaturwerft <strong>GmbH</strong>, Karlsruhe.<br />
Die Ges. war nunmehr Betreiber der Verkehrsflughäfen<br />
Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Konstanz, Villingen und Baden<br />
Baden. Zuvor war schon 1926 auf Forderung der damaligen<br />
Reichsregierung nach einer Einheitsluftverkehrsgesellschaft<br />
durch Zusammenschluß der <strong>Deutsche</strong> Aero-Lloyd AG und der<br />
Junkers Luftverkehrs-AG die “<strong>Deutsche</strong> Lufthansa” entstanden.<br />
Die Flughäfen der Ges. erlitten im 2. Weltkrieg schwere Bombenschäden.<br />
Ab 1945 waren sie überwiegend von der amerikanischen<br />
Besatzungsmacht beschlagnahmt. Der Neubeginn ist<br />
mühselig: 1960 nimmt die Taxi-Flug <strong>GmbH</strong> Mannheim auf dem<br />
Flughafen Neuostheim ihren Sitz, der 1957 vom Baden-Württ.<br />
Innenministerium wieder zum Landeplatz 1. Ordnung erklärt<br />
worden war. Großaktionäre waren zuletzt der Bund (als Rechtsnachfolger<br />
des Reichsluftfahrtministeriums, 22,5 %), die Stadt<br />
Mannheim (39,3 %) und das Land Baden-Württemberg (9,5<br />
%). 1962 Umwandlung in die Rhein-Neckar Flugplatz <strong>GmbH</strong>. Ab<br />
1977 gibt es erstmals wieder Linienflüge ab Mannheim: Die Firma<br />
Air-Supply startet am 24.5.1977 einen Zubringerdienst zum<br />
Flughafen Frankfurt Rhein-Main, der allerdings schon nach acht<br />
Wochen mangels Passagieren wieder eingestellt wird. Am<br />
25.4.1984 wird vom Flugdienst Pegasus eine Linienverbindung<br />
Mannheim-München eröffnet, der Nachfolger Arcus Air Logistic<br />
(ab 1997: Cosmos Air) startet am 10.11.1988 außerdem eine<br />
Linienverbindung Mannheim-Hamburg. Seit Nov. 1991 gibt es<br />
auch Linienflüge nach Leipzig und Dresden. Weitere Linienflüge<br />
nach Prag und Bern werden 1994/95 nur kurzzeitig angeboten.<br />
Im Mai 1997 stellt Cosmos Air eine Dornier 328 in Dienst, mit<br />
der dreimal täglich (so hatte es in Mannheim 1925 mal angefangen!)<br />
die Route Mannheim-Berlin bedient wird. 1999 wird
Cosmos von der Cirrus Airline (Saarbrücken) übernommen, im<br />
gleichen Jahr geht am Flughafen Mannheim-Neuostheim das<br />
lange geforderte Instrumentenanflugsystem in Betrieb. Seit dem<br />
26.3.2000 gehört Cirrus zum Team Lufthansa: Auch hier<br />
schließt sich damit der Kreis.<br />
Los 139 Schätzwert 300-375 €<br />
Badische Landesgewerbebank AG<br />
Karlsruhe, Aktie 500 RM Okt. 1924<br />
(Auflage 900, R 9) EF-VF<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1923 als Zentralbank sämtlicher im unter- und oberbadischen<br />
Verband vereinigten Genossenschaftsbanken.<br />
Gründer waren die Landeswirtschaftsstelle für das badische<br />
Handwerk AG, die Handwerkswirtschaftsges. mbH, die Karlsruher<br />
Lebensversicherungsbank AG (alle Karlsruhe) und die<br />
Frankfurter Allgemeine Versicherungs-AG. Diese heute merkwürdig<br />
anmutende Zusammensetzung hatte historische Ursachen:<br />
Im Bereich der Genossenschaftsbanken kam die Bildung<br />
von Zentralkassen spät und unsystematisch in Gang. In Baden<br />
beispielsweise hatte bis dahin die Karlsruher Lebensversicherungsbank<br />
AG als Hinterlegungskasse der Genossenschaftsbanken<br />
fungiert. 1924 Angliederung der “Fiducia” Revisionsund<br />
Treuhandinstitut AG, im gleichen Jahr wurde auch eine<br />
Versicherungsabteilung eingerichtet. 1939 umbenannt in Zentralkasse<br />
Südwestdeutscher Volksbanken AG. 1971 Verschmelzung<br />
mit der Raiffeisen-Zentralbank Baden AG zur<br />
„Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG“.<br />
Schließlich in der heutigen DZ-Bank in Frankfurt/M. als genossenschaftlichem<br />
Spitzeninstitut aufgegangen (deren erst 1959<br />
rechtlich verselbständigte Frankfurter Keimzelle übrigens 1925<br />
einmal als Zweigniederlassung für Hessen der “Südwestdeutschen”<br />
gegründet worden war).<br />
Los 140 Schätzwert 50-80 €<br />
Badische Lokal-Eisenbahnen AG<br />
Karlsruhe, 4,5 % Genussrechts-Urkunde<br />
100 RM 31.7.1926 (R 7) EF<br />
Gründung 1898 als Betriebsführungsgesellschaft für die Badischen<br />
Bahnen der Westdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft. Betrieben<br />
wurden 5 nicht miteinander verbundene Strecken: die<br />
schmalspurige Albtalbahn, die Bühlertalbahn sowie die Strekken<br />
Bruchsal-Hilsbach-Menzingen, Neckarbischofsheim-Hüffenhardt,<br />
Wiesloch-Meckesheim-Waldangelloch (zus. 153 km).<br />
Später erwarb der Kreis Karlsruhe die Aktienmehrheit. In der<br />
Weltwirtschaftskrise 1931 in Konkurs gegangen, die Bahnbetriebe<br />
wurden an die <strong>Deutsche</strong> Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft<br />
verkauft.<br />
Los 141 Schätzwert 50-125 €<br />
Badische Maschinenfabrik und<br />
Eisengießerei vormals G. Sebold etc.<br />
Durlach, Aktie 1.000 Mark 15.2.1912<br />
(Auflage 500, R 4) EF-VF<br />
Gründung 1885. Spezialität: Maschinen und Einrichtungen für<br />
Eisen-, Stahl-, Temper- und Metallgiessereien, Sandstrahlgebläse<br />
für verschiedene Zwecke, Maschinen und Einrichtungen<br />
für Zündholzfabriken, Gerbereien und Lederfabriken. Mit eigenem<br />
Eisenbahnanschluss. Ab 1949 Badische Maschinenfabrik<br />
AG Seboldwerke, Karlsruhe. Die BMD Badische Maschinenfabrik<br />
Durlach <strong>GmbH</strong> stellte 2002 ihre Produktion ein.<br />
Nr. 139 Nr. 151<br />
Nr. 141<br />
Los 142 Schätzwert 25-100 €<br />
Baltische Mineralöl-AG<br />
Danzig, Aktie 1.000 RM Juni 1943<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Gegründet 1921 als “Baltoil, Mineralölhandels- und Tankanlagen<br />
AG”, 1943 umbenannt wie oben. Neben Großtanklagern in<br />
Danzig-Strohdeich und Danzig-Weichselmünde betrieb die<br />
Ges. in Danzig und dem Umland 45 Tankstellen.<br />
Los 143 Schätzwert 150-250 €<br />
Bank für Handel und Grundbesitz AG<br />
Leipzig, Aktie Reihe B 10.000 Mark<br />
30.7.1923 (Auflage nach<br />
Kapitalumstellung 1100, R 8) VF+<br />
Sehr schöne Jugendstilgestaltung.<br />
Gründung 1902 als „Spar- und Darlehnskasse der Hausbesitzer<br />
e<strong>GmbH</strong>“, 1910 Umbenennung in Leipziger Hausbesitzer-<br />
Bank, AG seit 1923. Die Bank hielt Anteile am Leipziger Hypothekenverein,<br />
an der Wechsel- und Kreditgenossenschaft für<br />
Handwerk und Mittelstand e<strong>GmbH</strong> und der Gesellschaft für<br />
Haus und Boden mbH. Zwischen der Bank und diesen Unternehmen<br />
bestand Personalunion. Auf Grund der Verordnung über<br />
die Gründung der Sächsischen Landesbank und die Abwicklung<br />
der bisher bestehenden Banken und Geldinstitute<br />
vom 14.8.1945 erlosch die Bank am 29.5.1947.<br />
Los 144 Schätzwert 50-100 €<br />
Bank für Handel und Grundbesitz AG<br />
Leipzig, VZ-Aktie 1.000 RM Aug. 1941<br />
(Auflage 220, R 6) EF<br />
Los 145 Schätzwert 75-125 €<br />
Bank für Kommunal-<br />
und Grundkredit AG<br />
Mülheim-Ruhr, Namensaktie Lit. A 10.000<br />
Mark 1.7.1921 (Auflage nur 90 Stück,<br />
R 7) EF-VF<br />
Gründung am 20.11.1920, eingetragen am 15.1.1921. Im<br />
Nov. 1923 Sitzverlegung nach Berlin. 1936 Übernahme der<br />
„Grund und Boden AG für Realwerte“, seit 1937 in Liquidation.<br />
Nr. 146<br />
Los 146 Schätzwert 200-250 €<br />
Bank für Mittelsachsen AG<br />
Mittweida, Aktie 1.000 Mark 21.12.1922<br />
(Auflage 40000, R 10) VF+<br />
Einzelstück aus dem Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1879 als Spar- und Kredit-Bank Mittweida, 1920 umbenannt<br />
in Bank für Mittelsachsen. Filialen in Chemnitz, Frankenberg<br />
und Waldheim. Zuletzt eng an die Sächsische Staatsbank<br />
angelehnt. Börsennotiz: Chemnitz, später Leipzig. 1945 auf<br />
Grund eines SMAD-Befehls geschlossen. Die Liquidation der<br />
Bank für Mittelsachsen führte die Sächsische Landesbank durch.<br />
Los 147 Schätzwert 20-50 €<br />
Bank für Mittelsachsen AG<br />
Mittweida, Aktie 100 RM 15.4.1929<br />
(Auflage 1000, R 3) EF-<br />
Los 148 Schätzwert 30-75 €<br />
Bank für Mittelsachsen AG<br />
Mittweida, Aktie 1.000 RM 15.4.1929<br />
(Auflage 300, R 4) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 149 Schätzwert 50-100 €<br />
Bank für Mittelsachsen AG<br />
Mittweida, Aktie 100 RM 2.1.1938<br />
(Auflage 1500, R 5) EF<br />
Los 150 Schätzwert 10-40 €<br />
Bank für Realbesitz AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Sept. 1937 (Auflage<br />
10000, R 3) UNC<br />
Gründung 1909 als „Neufinkenkrug AG“, 1923 Umfirmierung<br />
in “Neue Realbesitz AG”. Die eigenen Terrains wurden 1922/23<br />
verkauft, danach Verwaltung der 37 Berliner Grundstücke der<br />
<strong>Deutsche</strong> Immobilien-Verkehrs-AG nebst Tochterfirmen (1931<br />
wurde dieser Grundbesitz fusionsweise direkt der Bank für Realbesitz<br />
übertragen). Ebenfalls 1931 Verschmelzung mit der<br />
Leipziger Central-Theater AG (diese gegründet 1900; auf dem<br />
4.386 qm großen Areal Thomasring/Bosestraße/Gottschedstraße<br />
wurde ein prachtvolles Theater mit grossen Sälen, Gesellschafts-<br />
und Restaurationsräumen sowie Läden im Erdgeschoß<br />
erbaut und 1902 eröffnet. Der Wirtschafts- und Theaterbetrieb<br />
war verpachtet, die Läden im Erdgeschoß wurden<br />
vermietet. Mitglied des Aufsichtsrates war später u.a. der sächsische<br />
Finanzminister Dr. Dehne). In diesem Zusammenhang<br />
Umfirmierung in Bank für Realbesitz AG. 1932 Mitgründung<br />
der “Leipziger Neues Operetten-Theater <strong>GmbH</strong>”. Ein weiteres<br />
Juwel im Portfolio war die Maschinenfabrik Kießling AG: Nicht<br />
so sehr wegen des kränkelnden Holzbearbeitungsmaschinenbaus,<br />
sondern als Eigentümer des großen, immens wertvollen<br />
KAUFMANNSHAUS in HAMBURG (1937 dann auch in “Kaufmannshaus”<br />
Hamburg Grundstücks-AG umfirmiert). 1948 Umfirmierung<br />
in Neue Realbesitz AG und 1951 Sitzverlegung von<br />
Berlin nach Hamburg. 1956-60 Umschichtung des Immobilienbesitzes<br />
durch Erwerb von zwei Grundstücken, Verkauf von<br />
acht Ruinengrundstücken und Beteiligung am Bau eines Hochhauses.<br />
1962 wurde der Leipziger Grundbesitz auch formell<br />
enteignet. Bis zuletzt börsennotiert im Freiverkehr Berlin, obwohl<br />
es die AG fertigbrachte, mehr als ein halbes Jahrhundert<br />
lang keine Dividende zu zahlen. Großaktionär war das Bankgeschäft<br />
Mertz & Co. in Hamburg, seit den 1980er Jahren dann<br />
die Hanseatische Finanzierungsgesellschaft mbH zur Vermittlung<br />
von Real- und Industriekrediten. 1993/94 in Nachtragsliquidation<br />
(Liquidator: Rainer Salb, Hamburg).<br />
Los 151 Schätzwert 200-250 €<br />
Bank für Realbesitz AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Sept. 1937<br />
(Auflage 2000, R 10) EF<br />
Nur 4 Stück lagen im Reichsbankschatz, dieses ist<br />
das allerletzte noch verfügbare. Identische Gestaltung<br />
wie voriges Los.<br />
Mindestgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
15
Los 152 Schätzwert 200-250 €<br />
Bank für Textilindustrie AG<br />
Berlin, VZ-Aktie Lit. C 1.000 Mark<br />
30.12.1921 (Auflage 25000, sog.<br />
“Schutzaktien” gegen Überfremdung,<br />
übernommen von einem von S. Bleichröder<br />
angeführten Bankenkonsortium, dem ferner<br />
die Disconto-Gesellschaft Berlin, die<br />
Rheinische Creditbank und die Süddeutsche<br />
Disconto-Ges. in Mannheim sowie<br />
E. Heimann in Breslau angehörten; R 9) VF<br />
Großes Hochformat, hübsche Ornament-Umrahmung.<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1919 durch den Blumenberg-Konzern als “Textilverwaltung<br />
AG”, 1921 umbenannt in Bank für Textilindustrie,<br />
Sitz war Berlin W 9, Vosstr. 11. Die im Freiverkehr Mannheim<br />
börsennotierte Bank, deren AR in besseren Zeiten auch der<br />
<strong>Deutsche</strong>-Bank-Vorstand Paul Millington-Herrmann angehörte,<br />
nahm 1926 in London eine Anleihe von 1 Mio. £ auf und reichte<br />
diese an die 11 über die Bank vom Blumenberg-Konzern beherrschten<br />
Textilfirmen weiter (u.a. Ges. für Spinnerei und Weberei<br />
in Ettlingen, Spinnerei Lauffenmühle in Tiengen, Viersener<br />
AG für Spinnerei und Weberei, Ver. Vigogne-Spinnereien AG in<br />
Chemnitz). Als in der Weltwirtschaftskrise der Blumenberg-<br />
Konzern kippte, kam auch die Bank für Textilindustrie in<br />
Schwierigkeiten, stellte im Sept. 1931 die Bedienung der £-Anleihe<br />
ein und ging 1933 in Liquidation. Ein deutsches Bankenkonsortium<br />
fand die englischen Anleihegläubiger zu 25 % ab.<br />
Los 153 Schätzwert 30-75 €<br />
Bankverein Artern,<br />
Spröngerts, Büchner & Co. KGaA<br />
Artern, Aktie 100 RM 30.4.1927 (R 3) EF<br />
Gründung 1862 als Arterner Darlehns-Verein, ab 1895 Bankverein<br />
Artern, Spröngerts, Büchner & Co. KGaA. Abteilungen in<br />
Rossleben a.U., Rossla a.Harz, Nebra a.Unstrut, Allstedt i.Thür.<br />
und Sangerhausen. 1940 wurde die bisherige KGaA in eine reine<br />
AG umgewandelt. 1950-1986 treuhändische Verwaltung<br />
und Abwicklung des Westvermögens in Mülheim a.d.R.<br />
Los 154 Schätzwert 30-75 €<br />
Barmer Bau-Gesellschaft<br />
für Arbeiter-Wohnungen AG<br />
Wuppertal-Barmen, Namensaktie 200 RM<br />
1.9.1932 (Auflage 2500, R 3) EF<br />
Gründung 1872. Zweck der Gesellschaft war die Beschaffung<br />
billiger und gesunder Wohnungen für Arbeiter, der An- und Ver-<br />
16<br />
kauf von Grundeigentum, die Gewinnung, der Kauf- und Verkauf<br />
von Baumaterialien aller Art, das Bauen in eigener Regie und<br />
der Kauf oder die Vermietung von Häusern. Schon an der<br />
Schwelle zum 20. Jh. besaß die AG fast 200 Wohnhäuser, weitere<br />
300 Baustellen zeugten von boomender Aktivität. 1977<br />
Umfirmierung in Barmer Wohnungsbaugesellschaft AG. Die immer<br />
noch bestehende AG besitzt heute über 1.400 Wohnungen.<br />
Los 155 Schätzwert 50-125 €<br />
Basbecker Portland<br />
Zement- und Tonwerke AG<br />
Basbeck, Kreis Neuhaus a. Oste, Aktie<br />
1.000 RM Juli 1929 (Auflage 740, R 5) EF<br />
Gründung 1922 im heutigen Landkreis Cuxhaven als Basbekker<br />
Tonwerke, 1929 umbenannt wie oben. Herstellung und Vertrieb<br />
von Tonwaren aller Art (Mauersteine, Dachziegel, Drainröhren<br />
u.dergl.). 1938 Verschmelzung mit der 1905 gegr. Beton-<br />
und Tiefbaugesellschaft Mast mbH in Berlin. Heute Betonund<br />
Tiefbau Mast Hermann Hein AG, Berlin. Der Ursprungsbetrieb<br />
in Basbeck nahm seine Tätigkeit 1948 unter dem Namen<br />
“Basbecker Baustoffindustrie, Zweigniederlassung der Betonund<br />
Tiefbau Mast AG” wieder auf, in den 1960er Jahren Stilllegung.<br />
Heute ist das Areal ein Wohngebiet.<br />
Los 156 Schätzwert 10-50 €<br />
Bast AG<br />
Nürnberg, Aktie 1.000 RM Jan. 1942<br />
(Auflage 3200, R 2) EF<br />
Blindprägesiegel mit Brezel.<br />
Gründung 1855, AG seit 1896 als „Preßhefen- und Spiritusfabrik<br />
AG vorm. J. M. Bast” mit Sitz in Buch. Fusioniert 1901 mit<br />
der Nürnberger Spritfabrik und 1908 mit weiteren Wettbewerbern<br />
in Berlin-Lichtenberg und Breslau zur “Vereinigte Nordund<br />
Süddeutsche Spritwerke und Preßhefefabrik AG”, seit<br />
1922 dann kurz “Bast AG”. 1937/38 Bau moderner Werkstätten,<br />
einer Werksiedlung, eines Schwimmbades und eines<br />
Sportplatzes, deshalb ab 1938 fünf Jahre in Folge als “nationalsozialistischer<br />
Musterbetrieb” ausgezeichnet. Bis 1941 in<br />
Berlin, dann in München börsennotiert. Das Werk Nürnberg-<br />
Buch erlitt nur geringe Kriegsschäden und konnte nach nur<br />
wenigen Wochen Stillstand im April 1945 die Produktion von<br />
Preßhefe und Spiritus wieder aufnehmen. 1965 in die “Bast<br />
Hefe- und Spirituswerke <strong>GmbH</strong>” umgewandelt.<br />
Los 157 Schätzwert 30-75 €<br />
Bastfaserkontor AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM 15.10.1930 (Auflage<br />
4500, R 3) EF<br />
Mit dem Firmenlogo, einem Segelschiff und<br />
Schriftzug BASTAKO.<br />
Gegründet 1941. Versorgung der deutschen Textilindustrie,<br />
insbesondre Bastfaserindustrie, mit Roh- und Hilfsstoffen sowie<br />
Halberzeugnissen. 1964 Übernahme der Leinengarn-Abrechnungstelle<br />
AG, Berlin. Heute betreibt die Gesellschaft Immobilienmanagement.<br />
Los 158 Schätzwert 50-125 €<br />
Bau- und Finanz-AG des<br />
Schlesischen Handwerks<br />
Breslau, Namensaktie 1.000 RM Dez.<br />
1943 (Auflage 250, R 5) EF<br />
1933 gegründet zum Bau und zur Betreuung von Kleinwohnungen.<br />
1943 Umfirmierung in Schlesische Wohnstätten AG.<br />
Nr. 158<br />
Los 159 Schätzwert 100-125 €<br />
Baugenossenschaft des<br />
Leipziger Mietervereins e<strong>GmbH</strong><br />
Leipzig, 4,5 % Na.-Teilschuldv. 200 RM<br />
1.7.1940 (Auflage 300, R 9) EF<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1899. Gehört heute zur Baugenossenschaft Leipzig eG.<br />
Los 160 Schätzwert 10-50 €<br />
Baugesellschaft für die<br />
Residenzstadt Dresden AG<br />
Dresden, Aktie 100 RM Okt. 1941 (Auflage<br />
3000, kpl. Aktienneudruck, R 2) EF<br />
Gründung 1885 als „Baubank für die Residenzstadt Dresden“,<br />
1935 Umfirmierung wie oben. Umfangreicher innerstädtischer<br />
Grundbesitz u.a. an der König-Johann-Straße (13 Grundstükke),<br />
der Schießgasse (7 Grundstücke), der Moritzstraße (6<br />
Grundstücke) und am Altmarkt (2 Grundstücke). Bis 1934 in<br />
Dresden, dann in Leipzig börsennotiert.<br />
Nr. 161<br />
Ansicht des Germania Epe Werks 2 im Jahr 2007<br />
Los 161 Schätzwert 150-200 €<br />
Baumwollspinnerei am Stadtbach<br />
Augsburg, Aktie 400 RM 1.6.1932<br />
(Auflage 9500, R 8) EF<br />
Nur 12 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1851. Herstellung von rohen einfachen Garnen:<br />
Baumwollgarne, Zellwollgarne, Baumwollmischgarne und<br />
Flockenbastmischgarne. Werke Stadtbach, Wertach und Senkelbach.<br />
Großaktionär war seit 1929 die Christian Dierig AG<br />
im schlesischen Langenbielau, die nach dem Krieg ihren Sitz<br />
nach Augsburg verlegte (heute: Dierig Holding AG) und sich<br />
die Baumwollspinnerei am Stadtbach 1951 vollständig eingliederte.<br />
Los 162 Schätzwert 10-50 €<br />
Baumwollspinnerei Erlangen<br />
Erlangen, Aktie 1.000 Mark Jan. 1923<br />
(Auflage 5000, R 2) EF-<br />
Gründung 1880 als „Spinnerei und Weberei Erlangen“. Herstellung<br />
von Garnen, Zwirnen und Geweben aus Baumwolle,<br />
Zellwolle und Kunstseide. 1927 Fusion mit der „Oberfränkisches<br />
Textilwerk AG“ und der „Mech. Baumwoll-Spinnerei und<br />
Weberei Bamberg AG“ zur Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg<br />
AG. Spinnereien und Webereien in Erlangen, Wangen (mit<br />
Ausrüstungsbetrieb) und Bamberg, außerdem Webereien in<br />
Schwarzenbach (Saale) und Zeil (Main). Zuletzt als ERBA firmierend<br />
und erst vor wenigen Jahren in Konkurs gegangen.<br />
Los 163 Schätzwert 150-250 €<br />
Baumwollspinnerei Germania<br />
Epe i. Westfalen, Aktie 1.000 Mark<br />
1.7.1906 (Auflage 135, R 7) EF-VF<br />
Hochdekorativ verzierter G&D-Druck. Mit holländischem<br />
Steuerstempel.<br />
Gründung 1897 unter der Firma Baumwollspinnerei Germania.<br />
Vollstufiger Betrieb, neben zwei Baumwollspinnereien waren<br />
auch Zwirnerei, Weberei, Färberei, Bleicherei und Schlichterei<br />
vorhanden. 1992 Einstellung des operativen Geschäftes, ab<br />
1993 Vermögensverwaltung. Neben der Vermietung der Gewerbeimmobilien<br />
(ehemalige Textilfabrik) in Gronau plante man<br />
auch Investments in “Sozialimmobilien” für Senioren. Darlehensverluste<br />
in Millionenhöhe und reihenweise Insolvenzen<br />
größerer Mieter machten die noch heute in Düsseldorf börsennotierte<br />
Germania-Epe AG zum Pennystock.
Nr. 164<br />
Los 164 Schätzwert 600-750 €<br />
Baumwollspinnerei Gronau<br />
Kirchspiel Epe, Aktie 5.000 Mark 23.3.1892<br />
(Auflage nur 70 STÜCK, R 8) VF<br />
Für die damalige Zeit ganz außergewöhnlich hoher<br />
Nennwert. Sehr dekoratives und ungewöhnlich<br />
großformatiges Stück (46 x 38 cm!), mit Originalunterschriften.<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesener<br />
Jahrgang, nur 14 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Eine Gründung holländischer Geschäftsleute (1890). 1898 Errichtung<br />
eines zweiten und 1911 eines dritten Werkes. 1947<br />
Fusion mit der benachbarten „Westfälische Baumwollspinnerei“.<br />
1987 Übernahme der „Textilwerke Ahaus AG“. Der Dauerkrise<br />
der deutschen Textilindustrie hat dieses Unternehmen<br />
noch mit am längsten getrotzt - doch im Mai 1999 kam auch<br />
hier das Insolvenzverfahren.<br />
Los 165 Schätzwert 600-750 €<br />
Baumwollspinnerei Gronau<br />
Kirchspiel Epe bei Gronau i. W., Aktie<br />
1.000 Mark 15.4.1904 (Auflage 350, R 11)<br />
VF<br />
Originalunterschriften. Auch diese Emission zuvor<br />
vollkommen unbekannt gewesen, das letzte der<br />
nur zwei im Reichsbankschatz gefundenen Stücke.<br />
Los 166 Schätzwert 50-100 €<br />
Baumwollspinnerei Gückelsberg<br />
William Schulz AG<br />
Flöha (Sa.), Aktie 1.000 RM 6.9.1927.<br />
Gründeraktie (Auflage 800, R 5) EF<br />
Die Baumwollspinnerei Flöha, gegründet bereits 1819 von G. F.<br />
Heymann, ist die älteste Spinnerei Sachsens gewesen. 1927 wandelte<br />
sie ihr Besitzer William Johannes Schulz in eine AG um. Nach<br />
der Enteignung bis 1990 als VEB VBSZ Baumwollspinnerei Flöha<br />
betrieben, danach gehörte sie als Treuhandbetrieb zur Sächsische<br />
Baumwollspinnerei und Zwirnerei AG. 1995 stillgelegt.<br />
Los 167 Schätzwert 500-625 €<br />
Baumwollspinnerei Mittweida<br />
Mittweida, Actie 2.000 Mark 15.11.1886<br />
(Auflage 500, R 8) VF<br />
Ungewöhnlich: Mit Auszug aus den Statuten aufgedruckt<br />
auf der Vorderseite der Aktie. Originalunterschriften.<br />
Zuvor unbekannt gewesen!<br />
Gründung 1884. Zuletzt besaß die Gesellschaft 5 Spinnereien<br />
mit etwa 160.000 Spinn- und Zwirnspindeln, 3 Wasserkraftturbinen<br />
und Dampfanlagen sowie eine Mehrheitsbeteiligung<br />
an der Baumwollweberei Mittweida. Im 2. Weltkrieg wurde die<br />
Hälfte des Werkes demontiert, auf der freigewordenen Fläche<br />
wurde eine Kriegsproduktion der Lorenzwerke AG Berlin (Funkgeräte)<br />
eingerichtet. In Leipzig börsennotiert. Nach 1945 als<br />
VEB Baumwollspinnerei weitergeführt, angegliedert wurden<br />
1951 Weißthaler Spinnerei als Werk 2 und 1964 die Baumwollspinnerei<br />
Riesa als Werk 3. Zur Wende waren etwa 1.000<br />
Mitarbeiter beschäftigt. 1995 als Sächsische Baumwollspinnerei<br />
<strong>GmbH</strong> reprivatisiert, mit Werken in Mittweida, Venusberg<br />
und Hohenfichte einer der letzten heute noch produzierenden<br />
Textilbetriebe der Region.<br />
Nr. 166 Nr. 168<br />
Die Baumwollspinnerei Mittweida im Zschopautal<br />
Nr. 167<br />
Los 168 Schätzwert 75-150 €<br />
Bauverein Kriegerfamilien-Heim mbH<br />
Dresden, Namens-Anteilschein 500 Mark<br />
31.12.1916 (R 5) EF<br />
Zwischen Schützenhof-, Stephan-, Platanen- und Böttgerstraße<br />
wurden nach dem 1. Weltkrieg 121 Wohnungen für Kriegerfamilien<br />
gebaut. In den 1930er Jahren umbenannt in Baugesellschaft<br />
Familien-Heim <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 169 Schätzwert 30-60 €<br />
Bayer. Landeshauptstadt München<br />
München, 7 % Schuldv. 5.000 RM<br />
1.4.1928 (Auflage 480, R 7) EF<br />
Kleine Vignette mit Wappen, dem Mönch mit Buch.<br />
Los 170 Schätzwert 25-100 €<br />
Bayerisch-Österreichische<br />
Holzunion AG<br />
München, Aktie 10.000 Mark 16.2.1923.<br />
Gründeraktie (R 4) UNC-EF<br />
Gegründet im Febr. 1923 als Holzunion AG. Bereits 1924 Löschungsbeschluss<br />
durch das Amtsgericht München.<br />
Los 171 Schätzwert 400-500 €<br />
Bayerische Brauerei-<br />
Schuck-Jaenisch AG<br />
Kaiserslautern, Aktie 1.000 RM März<br />
1942 (Auflage 500, R 9) UNC-EF<br />
Schönes blau-weißes Wappen der Bayerischen<br />
Brauereigesellschaft Kaiserslautern in der oberen<br />
Umrahmung. Zuvor ganz unbekannt gewesene<br />
Ausgabe!<br />
Die Brauerei in Kaiserslautern (Kantstr. 7) besteht bereits seit<br />
1857. 1873 wurde dann die Aktienbrauerei Kaiserslautern gegründet<br />
(Barbarossa Bräu), aus der 1883 die Bayerische Brauereigesellschaft<br />
hervorging. 1920/21 Umfirmierung wie oben<br />
nach Übernahme der Brauerei Jaenisch AG sowie der Kundschaft<br />
der Brauerei C. Schuck <strong>GmbH</strong>. Hergestellt wurden untergärige<br />
Biere, Spezial- und Exportbiere, Bockbiere, ferner Eis,<br />
z.T. Natureis auf eigenem Weiher. Zuletzt vor allem für das Kaiser<br />
Pilsener bekannt. Bierniederlagen in Winnweiler, Alsenz,<br />
Waldmohr, Bad Dürkheim, Odernheim, Schifferstadt, Ludwigshafen,<br />
Mannheim, Mainz sowie diverse Eigentumswirtschaften.<br />
Ab 1955 in Frankfurt börsennotiert. Seit 2006 (dann in eine<br />
<strong>GmbH</strong> umgewandelt) eine 100%-Tochter der Radeberger-<br />
Gruppe.<br />
Los 172 Schätzwert 10-50 €<br />
Bayerische Elektricitäts-<br />
Lieferungs-Gesellschaft AG<br />
Bayreuth, Aktie 100 RM Juni 1927<br />
(Auflage 46000, R 2) EF<br />
Gründung 1900 als “Solinger Kleinbahn AG” zur Übernahme<br />
der Solinger elektrischen Kreisbahn von der Union Elektrizitäts-<br />
Gesellschaft mit den beiden 22 km langen meterspurigen<br />
Strecken Solingen-Merscheid-Ohligs-Wald-Central-Solingen<br />
und Central-Gräfrath-Vohwinkel. Ab 1903 auch Betrieb der<br />
Straßenbahn der Stadt Solingen. 1905 dann noch Erwerb der<br />
Elektrischen Straßenbahn Elberfeld-Cronenberg-Remscheid<br />
(schon 1909 wieder an die Barmer Bergbahn AG verkauft). Für<br />
den eigentlich bis 1943 laufenden Konzessionsvertrag nahmen<br />
die konzessionsgebenden Gemeinden zum 31.12.1911 ein<br />
Sonderkündigungsrecht mit Rückkauf der Bahn wahr. Die damit<br />
ihrer Aktivitäten entblößte AG brauchte eine neue Betätigung,<br />
und fand sie auch: 1914 Sitzverlegung nach Bayreuth<br />
und Umfirmierung wie oben. 1983 Fusion mit dem Überlandwerk<br />
Oberfranken AG in Bamberg zur “Energieversorgung Oberfranken<br />
AG”, Sitz blieb Bayreuth. Stromerzeugung im Kraftwerk<br />
Arzberg und in 7 kleineren Laufwasserkraftwerken. Versorgungsgebiet:<br />
Oberfranken und Teile der nördlichen Oberpfalz.<br />
Großaktionär war das Bayernwerk (2000 mit der PreußenElektra<br />
zur E.ON Energie AG verschmolzen). 2001 in der<br />
E.ON Bayern AG aufgegangen.<br />
Los 173 Schätzwert 75-125 €<br />
Bayerische Elektrizitäts-Werke<br />
München, Aktie 1.000 RM Nov. 1941<br />
(Auflage 1349, R 6) UNC-EF<br />
Gründung 1898. Die Gesellschaft übernahm die der AG für Elektricitäts-Anlagen<br />
in Köln erteilten Konzessionen und die bereits<br />
errichteten Anlagen für die Versorgung mit elektrischer Energie<br />
in einem Teil des Bezirksverbandes Schwaben und Neuburg.<br />
1899 wurde die Konzession zur Versorgung der Stadt<br />
Neu-Ulm (Donau) erworben und ein Kraftwerk an der Iller errichtet.<br />
1902 übernahm dei Gesellschaft das Vermögen der<br />
Bayerischen Elektricitäts-Gesellschaft Helios. Die Städte Freising,<br />
Tauberbischofsheim, Ochsenfurt wurden versorgt. Außerdem<br />
Grundbesitz in Landshut, wo zeitweilig das Zentralbüro<br />
war. Großaktionär 1943: Elektrische Licht- und Kraftanlagen<br />
AG, Berlin. Börsennotiz Berlin und München.<br />
Los 174 Schätzwert 250-325 €<br />
Bayerische Handelsbank<br />
München, Aktie 100 RM 1.12.1929<br />
(Auflage 32500, R 8) EF+<br />
Vorkriegsaktien dieser bedeutenden Bank waren<br />
zuvor (wie also auch das folgende Los) vollkommen<br />
unbekannt gewesen!<br />
1869 Gründung der Bayerischen Handelsbank als Kreditbank.<br />
1871 Angliederung einer Bodencreditanstalt. 1921 Übertragung<br />
der Geschäftsbank auf die Bayerische Vereinsbank, seitdem<br />
reine Hypothekenbank. Börsennotiert bis 2002, als die<br />
Bayerische Handelsbank mit den anderen Realkredit-Töchtern<br />
der HypoVereinsbank fusioniert wurde. Letztlich Teil der heute<br />
skandalumwitterten Hypo Real Estate geworden.<br />
Mindestgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
17
Los 175 Schätzwert 300-375 €<br />
Bayerische Handelsbank<br />
München, Aktie 1.000 RM 1.6.1938<br />
(Auflage 13950, R 8) VF<br />
Los 176 Schätzwert 150-200 €<br />
Bayerische Metallwerke AG<br />
Landshut, Aktie 1.000 RM Dez. 1928<br />
(Auflage nur 75 Stück, R 8) EF<br />
Nur 11 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1923 in Landshut u.a. durch die Radiologie AG und<br />
dem Physiker Dr. Robert Fürstenau zur Herstellung von Wolfram-<br />
und Molybdän-Fabrikaten. 1926 außerdem Errichtung<br />
eines Werks für technische Gase (Wasser- und Sauerstoff).<br />
1929 Sitzverlegung nach Dachau (Leitenweg 1). 1969 in eine<br />
<strong>GmbH</strong> umgewandelt. 1990 Erwerb durch Marion Frfr. von Cetto,<br />
der auch der Mitbewerber “Gesellschaft für Wolfram Industrie<br />
mbH” in Traunstein gehört, womit die beiden vormaligen<br />
Konkurrenten unter ein Dach kommen.<br />
18<br />
Nr. 171<br />
Nr. 175<br />
Nr. 177<br />
Los 177 Schätzwert 1000-1250 €<br />
Bayerische Motoren Werke AG<br />
München, Sammelaktie 1.000 x 100 RM<br />
Dez. 1943 (Auflage nur 9 Stück, R 9) EF+<br />
Mit BMW-Emblem im Trockensiegel. Die kpl. Auflage<br />
von 9 Stück lag im Reichsbankschatz.<br />
Ursprung sind die “Gustav Otto Flugmaschinenwerke”, deren<br />
Gründer ein Sohn des Erfinders des Viertaktmotors Nicolaus<br />
August Otto war. Seit 1916 AG als „Bayerische Flugmotorenwerke<br />
AG“. Nach dem verlorenen Weltkrieg gab es keine Nachfrage<br />
nach Flugmotoren mehr, weshalb die BFM anderweitige<br />
Betätigung suchten: 1922 Erwerb der Motorenbau-Sparte von<br />
der Firma Knorr-Bremse und Umfirmierung in „Bayerische Motoren<br />
Werke AG“. 1925/1926 gehörte BMW zu den Gründern<br />
der <strong>Deutsche</strong>n Luft Hansa. 1928 erwarb BMW von der Gothaer<br />
Waggonfabrik die Fahrzeugfabrik Eisenach (Dixi-Werke, gebaut<br />
wurde der 3/15-PS-Dixi-Wagen nach einer Lizenz der Austin<br />
Motor Co.) Der im 2. Weltkrieg erneut boomende Bau von Flugmotoren<br />
brachte die Auto- und Motorrad-Sparte ins Hintertreffen,<br />
mit andauernden Folgen nach dem Krieg: 1959 stand<br />
BMW vor der Pleite, der Konkurrent Daimler-Benz legte ein Übernahmeangebot<br />
vor. Als “Weißer Ritter” stieg damals die Industriellenfamilie<br />
Quandt ein. In den folgenden Jahrzehnten<br />
blühte BMW zu einem weltweit führenden Premium-Hersteller<br />
auf.<br />
Los 178 Schätzwert 450-750 €<br />
Bayerische Motoren Werke AG<br />
München, Sammelaktie 1.000 x 1.000<br />
RM Juni 1944 (Auflage nur 28 Stück,<br />
R 7) EF<br />
Mit BMW-Emblem im Trockensiegel. Die kpl. Auflage<br />
von 28 Stück lag im Reichsbankschatz.<br />
Nr. 174<br />
Los 179 Schätzwert 200-250 €<br />
Bayerische Warenkreditbank AG<br />
München, Aktie 10.000 Mark 7.4.1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 10000, R 12) EF<br />
Ein Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />
Gegründet am 13.2.1923 u.a. durch die Warenkreditbank-AG<br />
in Berlin, v. Schirach & Co. KG, Konsul Carl A. Luederitz u.v.m.<br />
zwecks Beleihung und Bevorschussung von Waren. Trotz der illustren<br />
Beteiligten (AR-Vorsitzender Heinrich Königbauer war<br />
Präsident des Bayerischen Landtags, AR-Mitglied Fr. Warschauer<br />
war einer der bekanntesten Berliner Privatbankiers,<br />
Mitgründer und AR-Mitglied Friedrich v. Schirach war der Vater<br />
des späteren “Reichsjugendführers” Baldur von Schirach) reüssierte<br />
die Bank nicht und ging bereits im Juli 1924 wieder in<br />
Liquidation.<br />
Nr. 179<br />
Nr. 180<br />
Gustav Otto mit einem Argus Flugzeugmotor<br />
Los 180 Schätzwert 10-25 €<br />
Bayerische Wasserkraftwerke AG<br />
München, 4 % Teilschuldv. 1.000 RM Nov.<br />
1943 (Auflage 40000, R 3) EF<br />
Gründung 1940, Aktionäre zu je 1/3 waren das Land Bayern,<br />
die VIAG und das RWE. Zwischen 1941 und 1954 wurden 9<br />
Laufwasserkraftwerke am Lech sowie das Speicherkraftwerk<br />
Roßhaupten gebaut. Seit 1997 liegt die Betriebsführung auch<br />
der BAWAG-Kraftwerke bei der E.ON Wasserkraft <strong>GmbH</strong> in<br />
Landshut, dem in Deutschland führenden privaten Wasserkraft-Dienstleister.<br />
Los 181 Schätzwert 30-75 €<br />
Beil & Voss Musik-Instrumenten-AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM 1.1.1926 (Auflage<br />
500, R 5) UNC<br />
Gegründet 1923 zwecks Handel mit Musikinstrumenten aller<br />
Art. Geschäftsansässig Berlin C 25, Prenzlauerstrasse 52.<br />
1930 Konkurseröffnung, 1931 erloschen.<br />
Los 182 Schätzwert 125-200 €<br />
Bellevue Warenhandels-AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Jan. 1922.<br />
Gründeraktie (Auflage nur 50 Stück, R 8)<br />
EF-VF<br />
Äußerst interessante Gestaltung.<br />
Gründung im Dez. 1921 zum Betrieb von Warengeschäften, vor<br />
allem Import und Export. Ab 1935 Bürohaus Bellevue AG, Erwerb,<br />
Verwaltung und Verwertung von Grundstücken.<br />
Los 183 Schätzwert 50-125 €<br />
Benno Schilde Maschinenbau-AG<br />
Hersfeld, Aktie 1.000 RM März 1927<br />
(Auflage 1100, R 6) VF<br />
Die Gesellschaft ging aus der 1874 gegründeten Maschinenund<br />
Apparatebauanstalt von Benno Schilde hervor, die sich bis<br />
zum Ableben des Begründers in dessen Privatbesitz befand
und dann als Familien-<strong>GmbH</strong> weitergeführt wurde. Am<br />
12.4.1922 erfolgte die Gründung der AG. Fabrikation von Ventilatoren,<br />
Schlackenaufbereitungsanlagen, Heizungs- und Lüftungsanlagen<br />
sowie Waschmaschinen, Lackieranlagen und Industrieöfen.<br />
Übernommen wurden 1922 die Maschinenfabrik<br />
Imperial in Meissen, die Imperial-Förster-Werke in Magdeburg<br />
sowie Gelände und Anlagen der Reichsflugzeugwerke Schwerin-Görries.<br />
1969 verschmolzen mit der Friedrich Haas <strong>GmbH</strong><br />
und der Rheinische Dampfkesselfabrik Büttner & Cie. in Krefeld<br />
zur Büttner-Schilde-Haas AG (BSH). Ab 1977: Babcock-BSH<br />
AG, ab 1995 Turbo Lufttechnik. Anfang 2003 Übernahme<br />
durch den Frankenthaler Maschinenbaukonzern AG Kühnle,<br />
Kopp & Kausch. Firmierung als eigenständge Gesellschaft unter<br />
dem Namen TLT-Turbo <strong>GmbH</strong>, Zweibrücken.<br />
Los 184 Schätzwert 150-250 €<br />
Benteler-Werke AG<br />
Bielefeld, Aktie 10.000 Mark 19.1.1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 500, R 6) EF-<br />
Kleine Vignette mit Eisenbahn und “BEWAG”- Signet.<br />
1876 Eröffnung eines Eisenwarenhandels In Bielefeld. 1922<br />
Gründung der AG und Fertigungsbeginn von nahtlosen und geschweißten<br />
Rohren in Paderborn. Ab 1935 Aufbau eines Automobil-Zulieferer-Betriebes.<br />
1952 Produktion eines eigenen<br />
Kleinwagens: Champion. 1974 Eröffnung eines Elektrostahlwerkes<br />
in Lingen. 1980 Expansion in die USA. Heute mit den<br />
Teilbereichen Automobiltechnik, Hersteller von Stahl und Rohren<br />
sowie einer Firmenholding an 150 Standorten in 34 Ländern<br />
mit 22.000 Mitarbeitern vertreten. Standorte sind heute<br />
u.a. Paderborn, Bielefeld, Lingen, Dinslaken, Bottrop, Düsseldorf,<br />
Köln, Eisenach, Siegen, Saarlouis, Rothrist, Lichtenau,<br />
Warburg.<br />
Los 185 Schätzwert 300-375 €<br />
Bergbahn AG Kitzbühel<br />
Kitzbühel, Aktie 1.000 RM 31.8.1939<br />
(Auflage 500, R 10) EF-VF<br />
Stadtwappen von Kitzbühel im Unterdruck. Zuvor<br />
vollkommen unbekannt gewesen, nur 5 Stück lagen<br />
im Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1928 mit der Stadt Kitzbühel (Tirol) als Großaktionär<br />
zum Bau und Betrieb einer 2,4 km langen Personen- und Güter-Seilschwebebahn<br />
auf den durch das gleichnamige Skirennen<br />
bis heute weltbekannten Hahnenkamm. 1935 Inbetriebnahme<br />
eines Schlittenaufzuges auf der Skiübungswiese von<br />
Kitzbühel. 1948 wurde am Hahnenkamm der erste “Skizirkus”<br />
der Welt eröffnet. Weiter eröffnet wurden 1952 der Schräglift<br />
Hochegg, 1953 der Sessellift vom Ehrenbachgraben auf den<br />
Steinbergkogel, 1955 die 4 km lange Seilschwebebahn von<br />
Kitzbühel über die Pletzeralm auf den Gipfel des Kitzbüheler<br />
Horns, 1957 der Trattalmlift und 1959 die Seilschwebebahn<br />
Pletzeralm-Alpenhaus. 1964 wurden erstmals über 1 Mio. Personen<br />
jährlich befördert.<br />
Los 186 Schätzwert 75-150 €<br />
Bergbaugesellschaft Teutonia<br />
Hannover, Aktie 1.000 Mark 9.4.1908<br />
(Auflage 1000, nach Sanierung 1935 nur<br />
noch ca. 500, R 5) EF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesener Jahrgang.<br />
Gründung 1898 mit Kali-Schürfrechten auf einer Fläche von<br />
300.000 Morgen in verschiedenen Gemeinden der Provinz<br />
Hannover. 16 Tiefbohrungen wurden niedergebracht. Die nahe<br />
Schreyahn (bei Wustrow, Prov. Hannover) angesetzte Bohrung<br />
traf ein 19 m mächtiges Hartsalzlager und darunter ein nahezu<br />
500 m mächtiges Carnallitlager. Ab der 200-m-Teufe stand<br />
der Schacht andauernd in Kalisalz. Füllörter wurden bei 360<br />
und 460 m angesetzt. Über Tage wurde ein Chlorkaliumfabrik<br />
mit einer Tagesleistung von 10.000 dz sowie eine Kainitmühle<br />
betrieben. Die Abwässer wurden über eine 26 km lange Endlaugenleitung<br />
in die Elbe geleitet. 1912 ging auch die Sulfatund<br />
Bromfabrik in Betrieb. 1909 bzw. 1910 wurden Teile des<br />
Kalifelderbesitzes in die Gewerkschaften Ilsenburg und Wartburg<br />
mit Sitz in Wustrow abgespalten, 1911 außerdem Gründung<br />
der Bergbaugesellschaft Lüchow <strong>GmbH</strong>, deren Felder im<br />
Kreise Lüchow mit Ilsenburg, Wendland, Teutonia und Wartburg<br />
markscheideten. Unter Tage wurden die Bergwerke miteinander<br />
verbunden. Das unrentable eigene Kaliwerk wurde 1926<br />
stillgelegt und die Übertageanlagen auf Abbruch verkauft. Die<br />
Kaliquote fiel an den später in der Kali-Chemie AG aufgegangenen<br />
Neustaßfurt-Friedrichshall-Konzern. Zuletzt war die heute<br />
zur belgischen Solvay-Gruppe gehörende Kali-Chemie AG,<br />
Berlin/Hannover mit über 95 % Großaktionär, die Aktien notierten<br />
im Freiverkehr Hannover. 1951 in eine <strong>GmbH</strong> umgewandelt.<br />
Aufmerksamkeit erregten die Salzstöcke im Kreis Lüchow-<br />
Dannenberg dann später durch die Auseinandersetzungen um<br />
das geplante Atommüll-Endlager Gorleben.<br />
Los 187 Schätzwert 150-200 €<br />
Bergbaugesellschaft Teutonia AG in<br />
Schreyahn bei Wustrow i. Hann.<br />
Sehnde, Genußrechtsurkunde 100 RM<br />
1.10.1926 (R 11) VF<br />
Auch die Genussrechtsurkunde war zuvor völlig<br />
unbekannt. Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz!<br />
Los 188 Schätzwert 50-175 €<br />
Bergbrauerei Riesa AG<br />
Riesa, Aktie 1.000 Mark Juli 1921<br />
(Auflage 350, R 5) EF<br />
Gegründet 1872, 1892 von den Brüdern Arno und Otto Friede<br />
gekauft und als Lagerbierbrauerei ausgebaut, AG seit 1904.<br />
1936 Übernahme des Kundenbestandes der Riebeck-Stadtbrauerei<br />
AG. Großaktionär (1943): Riebeck-Brauerei AG Leipzig<br />
(73,9%). In den 50er Jahren gehörte die Brauerei zur Vereinigung<br />
Volkseigener Betriebe Brau- und Malzindustrie Dresden<br />
(VVB). 1979 wurde die Brauerei geschlossen.<br />
Los 189 Schätzwert 300-400 €<br />
Bergmann-Elektricitäts-Werke AG<br />
Berlin, 4,5 % Teilschuldv. 1.000 Mark<br />
März 1920 (Auflage 20000, R 9) EF-VF<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Sigmund Bergmann (geb. 1851 im thüringischen Tennstedt)<br />
wanderte mit 18 Jahren in die USA aus. In New York wurde ca.<br />
1875 THOMAS ALVA EDISON wegen seines Geschicks und Arbeitseifers<br />
auf ihn aufmerksam. Mit Neuentwicklungen machte<br />
Bergmann schnell viel Geld und konnte schon 1876 in New<br />
York die erste eigene Werkstätte eröffnen, wo er für Edison die<br />
ersten zum Verkauf bestimmten Phonographen herstellte. Bald<br />
produzierte er auch Telephonübertragungseinrichtungen für<br />
Western Union und richtete für Edison ein Testlabor für Glühlampen<br />
ein. 1879 wurden die ersten von Edison und Bergmann<br />
gemeinsam entwickelten Glühlampen der Öffentlichkeit vorgestellt,<br />
die 1881 auf der Pariser Elektrizitätsausstellung eine “epochale<br />
Sensation” waren. Anlässlich dieser Ausstellung kam<br />
Bergmann nach 16 Jahren auch erstmals wieder nach<br />
Deutschland und erkannte die Bedeutung Berlins für die junge,<br />
aber sich schon kräftig entwickelnde Elektroindustrie. Wenig<br />
später stieg Thomas Alva Edison als Teilhaber in die S. Bergmann<br />
& Company ein. Man errichtete eine neue Fabrik Eckene<br />
Avenue B und East 17th Street, die bald auf 1500 Beschäftigte<br />
anwuchs. 1889 beschloß Edison, alle Firmen in seinem Einflußbereich<br />
in der Edison GENERAL ELECTRIC Co. zusammenzufassen,<br />
also auch die Bergmann-Fabrik. Die General-Electric-Anteile,<br />
die Bergmann nun erhielt, verkaufte er, ging zurück<br />
nach Deutschland und gründete 1891 an der Fennstraße in<br />
Berlin-Moabit erneut ein Unternehmen, das seinem vorherigen<br />
New Yorker Betrieb sehr ähnlich war. Aus diesem Betrieb entstand<br />
1893 die “S. Bergmann & Co. AG Fabrik für Isolir-Leitungsrohre<br />
u. Special-Installations-Artikel für elektr. Anlagen”<br />
bzw. 1897 die “Bergmann Elektromotoren- und Dynamo-Werke<br />
AG”. Bergmann, der bis dahin noch zwischen New York und<br />
Berlin hin- und hergependelt war, verlegte 1899 seinen Wohnsitz<br />
endgültig nach Berlin und begann im Berliner Wedding mit<br />
dem Bau neuer Fabrikanlagen an der Seestraße. Die beiden<br />
Fabriken der zwei selbständigen AG’s waren nur durch die Oudenarderstraße<br />
getrennt und grenzten ansonsten direkt aneinander<br />
an. 1900 fusionierten beide Ges. zur “Bergmann-Elektricitäts-Werke<br />
AG”. Das Berliner Werk hatte vier Fabrikationsabteilungen<br />
und produzierte a) Isolierrohre und Installationsartikel,<br />
b) Dynamos, Elektromotoren, elektrische Lokomotiven und<br />
Accumulatorenwagen, Spezialmotoren für Vollbahnen, Straßenbahnen,<br />
Hoch- und Untergrundbahnen, c) Kohlenfadenund<br />
Metallfadenlampen (Produktionsbeginn 1904, 1928 gegen<br />
Gewährung von Anteilen in die OSRAM <strong>GmbH</strong> KG eingebracht),<br />
d) Zähler und Messinstrumente. Ein weiteres Werk in Rosenthal<br />
bei Berlin produzierte e) Messing- und Kupferfabrikate, f)<br />
Starkstrom- und Telephonkabel, g) Benzin-Luxus- und Lastfahrzeuge<br />
(benzingetriebene Autos wurden von 1907 bis 1922<br />
gebaut, danach nur noch elektrische Lastfahrzeuge), h) stationäre<br />
und Schiffs-Dampfturbinen, i) Grossmaschinenbau, u.a.<br />
Dampfturbinen-Generatoren. Beschäftigt waren zeitweise mehr<br />
als 10.000 Beamte und Arbeiter. Börsennotiert in Berlin, Dresden,<br />
Frankfurt a.M. und München. 1912 finanzielle Reorganisation<br />
mit Hilfe der <strong>Deutsche</strong>n Bank, dabei bekamen über eine<br />
Kapitalerhöhung die Siemens-Schuckertwerke mit einem 16<br />
%igen Anteil bei ihrem Konkurrenten den Fuß in die Tür. Sigmund<br />
Bergmann behielt nur noch die technische Leitung, kaufmännisch<br />
wurde die Ges. seitdem von Siemens-Schuckert geführt.<br />
1918 erwarb Bergmann das Schloss Hohenfels in Coburg<br />
als Ruhesitz; 1927 starb er. In der Weltwirtschaftskrise<br />
wurde Bergmann erneut ein Sanierungsfall. Die Siemens-<br />
Schuckertwerke und die A.E.G., die jetzt bereits über 80 % der<br />
Bergmann-Aktien besaßen, nutzten dies, um zum Kurs von lediglich<br />
24 % fast alle Aktien der verbliebenen freien Aktionäre<br />
zu übernehmen. Lediglich 0,6 % blieben danach im Streubesitz.<br />
1936 Straffung des Fertigungsprogramms und Konzentration<br />
der Produktion im Werk Berlin-Wilhelmsruh (Rosenthal).<br />
Bergmann-Elektricitäts-Werke AG<br />
Ansicht einer der OSRAM-Höfe in Berlin-Wedding<br />
1949 teilten sich die Wege von Betrieb und AG: Das Werk wurde<br />
enteignet und als VEB Bergmann-Borsig weitergeführt. Es<br />
war das wahrscheinlich bestbewachte Fabrikgelände in ganz<br />
Europa: Das Areal hatte die Form eines Dreiecks, von dem die<br />
zwei langen Schenkel die Grenze zu Westberlin bildeten. Nach<br />
der Wende wurde daraus die ABB Bergmann-Borsig <strong>GmbH</strong> und<br />
dann die Alstom Power Service <strong>GmbH</strong>. Von ehemals 3.500 Beschäftigten<br />
sind heute nur noch 320 geblieben, ansonsten enstand<br />
auf dem früheren Bergmann-Areal der PankowPark, wo<br />
sich inzwischen ca. 80 weitere Betriebe angesiedelt haben. Die<br />
AG selbst nahm nach 1949 im Westen keinen eigenen Fabrikbetrieb<br />
mehr auf, sondern hielt nur noch diverse Beteiligungen,<br />
deren wichtigste Schorch in Mönchengladbach, Heliowatt in<br />
Berlin, die <strong>Deutsche</strong> Telephonwerke und Kabelindustrie AG in<br />
Berlin (DeTeWe) und die Bergmann Kabelwerke AG in Berlin/Wipperfürth<br />
waren. Großaktionäre waren bis in die 1970er<br />
Jahre mit jeweils über 25 % die Siemens AG, die <strong>Deutsche</strong><br />
Bank und die Bayerische Vereinsbank. Danach übernahm Siemens<br />
die Mehrheit und verkaufte die anschließend mit DeTe-<br />
We zusammengelegte Bergmann an die saarländische Gebr.<br />
Röchling KG. 2005 Übernahme durch die kanadische Aastra<br />
Technologies Ltd.<br />
Los 190 Schätzwert 200-400 €<br />
Bergwerks-AG Juno<br />
Düsseldorf, Actie 1.000 Mark 9.12.1896.<br />
Gründeraktie (Auflage 3500, davon nur<br />
826 nicht in VZ-Aktien gewandelt, R 8)<br />
EF-VF<br />
Faksimileunterschriften vom Bankier Max Trinkaus<br />
und Fritz Daber vom Bankhaus C.G. Trinkaus. Sehr<br />
dekorativ, mit Hammer und Schlegel. Nur 15 Stück<br />
lagen im Reichsbankschatz.<br />
Übernahme und Weiterbetrieb der von der Gewerkschaft Juno<br />
betriebenen Blei- und Zinkerzgrube bei Ramsbeck in der Gemeinde<br />
Gewelinkhausen, Kreis Meschede. Dieses Bergwerk<br />
hat eine ganz schillernde Vorgeschichte: 1853 verkaufte es der<br />
Rheinisch-Westfälische Bergwerksverein für 1 Mio. Thaler (das<br />
Doppelte des wirklichen Wertes) an den Glücksritter und Bankrotteur<br />
Marquis Henri Etienne Bernard de Sassenay, der gerade<br />
die Kontrolle über die Metallurgische Gesellschaft in Aachen<br />
gewonnen hatte und das Unternehmen nun in „Aktiengesellschaft<br />
für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und in<br />
Westfalen“ umbenannte (bis in unsere Tage als “Stolberger<br />
Zink” bekannt gewesen). Man plante in der stillen Ramsbecker<br />
Landschaft nicht weniger als das größte Industriezentrum Europas,<br />
ferner sollten bei Dortmund Steinkohlegerechtsame erworben<br />
und eine große Zinkhütte errichtet werden. Für das<br />
vielversprechende Unternehmen bewilligten Verwaltungsrat<br />
und Banken widerspruchslos jeden gewünschten Betrag. Im<br />
August 1854 übernahm es de Sasseney, Mitgliedern des Verwaltungsrates<br />
den Ramsbecker Betrieb zu zeigen. Es wurde ein<br />
vielbesprochenes gesellschaftliches Ereignis, die Gäste erschienen<br />
mit Damen und zahlreicher Dienerschaft und wurden<br />
prächtig bewirtet. Den Höhepunkt des Festes bildete die Veranstaltung<br />
„der Silberblick“. De Sasseney behauptete einen<br />
hohen Silberanteil in den in Ramsbeck gewonnenen Bleierzen<br />
und ließ zum Beweis einen Schmelzprozeß vorführen, bei dem<br />
geläutertes Silber in Erscheinung trat. Es wurde das Tagesgespräch<br />
in den Pariser Salons und der Aktienkurs entwickelte<br />
sich kometenhaft. Nur de Sasseney und die Werkmeister wußten,<br />
daß „der Silberblick“ nicht dem gewonnenen Erz zu verdanken<br />
war, sondern daß dem Bleiguß heimlich eingeschmolzene<br />
Silbermünzen beigefügt worden waren. Vier Wochen später,<br />
am 29.3.1855, mußte das Unternehmen seine Zahlungsunfähigkeit<br />
erklären und wurde dann vom späteren preußischen<br />
Handelsminister von der Heydt saniert. Die Gründer haben<br />
als alleinige Gewerken der in Kuxe eingeteilten Gewerkschaft<br />
die ihnen zustehenden 1000 Kuxe in die AG eingeworfen<br />
und dafür Aktien erhalten.<br />
19
Los 191 Schätzwert 10-50 €<br />
Bergwerks-Gesellschaft Dahlbusch<br />
Rotthausen, Aktie 1.200 Mark Juli 1920<br />
(Auflage 20000, R 2) EF-<br />
Dekorative Umrandung, rückseitig auch in französisch.<br />
Ursprung ist die 1847 gegründete „Englisch-Belgische Gesellschaft<br />
der Rheinischen Bergwerke“. 1848 weigerten sich, wegen<br />
der Revolution in Deutschland, die ausländischen Investoren,<br />
weitere Einzahlungen zu leisten: der Mutungsschacht König<br />
Leopold musste aus Geldmangel eingestellt werden. Das<br />
Festhalten belgischer Aktionäre (allen voran Joseph Chaudron,<br />
bis zu seinem Tod 1905 AR-Vorsitzender von Dahlbusch) an<br />
dem Unternehmen führte 1849 zur Neugründung als „S.A. der<br />
Belgisch-Rheinischen Kohlenbergwerke an der Ruhr“. Statt des<br />
bis dahin üblichen Abteufens von Hand wurde erstmals das<br />
Kind-Chaudron-Schachtbohrverfahren angewandt, 1857 wurde<br />
das oberste Gaskohlenflöz erreicht. Die Mittelbeschaffung<br />
zur Errichtung einer dringend nötigen Doppelschachtanlage<br />
scheiterte am Einspruch der Anleihegläubiger, die in manchen<br />
Jahren nicht einmal Zinsen bekommen hatten. Man entledigte<br />
sich der Gläubiger durch Verkauf aller Aktiva an die 1873 neugegründete<br />
Bergwerks-Gesellschaft Dahlbusch. Der Kreis der<br />
Kapitaleigner blieb dabei unverändert, die Schulden war man<br />
los. 1925 gründete Dahlbusch die „<strong>Deutsche</strong> Libbey-Owens-<br />
Gesellschaft für maschinelle Glasherstellung AG“ (Delog), die<br />
heutige Flachglas AG. Diese Beteiligung sicherte der börsennotierten<br />
Dahlbusch weit über die Zeit der Steinkohle hinaus die<br />
Existenz, zuletzt als deutsche Zwischenholding des englischen<br />
Pilkington-Glaskonzerns. Der starke belgische Einfluss zeigt<br />
sich auch darin, dass alle Aktien, sogar noch die 1951 ausgegebenen<br />
DM-Papiere, als Doppelblätter mit deutschem und<br />
französischem Text gedruckt wurden. Eine der bekanntesten<br />
Gesellschaften des Reviers und die einzige, die heute noch börsennotiert<br />
ist. Übrigens: Hermann J. Abs gehörte ihrem Aufsichtsrat<br />
über 50 Jahre lang an.<br />
Los 192 Schätzwert 50-125 €<br />
Bergwerksgesellschaft Habighorst<br />
Habighorst, Kreis Celle, Namens-<br />
Anteilschein 30.1.1918 (Auflage 1000,<br />
R 3) EF<br />
Original signiert.<br />
Hervorgegangen aus der Gewerkschaft Fallersleben zu Thal.<br />
Förderung von Steinsalz in einer von zwei Schachtanlagen im<br />
Steinsalzwerk Mariaglück, 12 km nördlich von Celle, in den<br />
1990er Jahren das kleinste der Steinsalzwerke der Kali und<br />
Salz AG.<br />
Los 193 Schätzwert 75-125 €<br />
Berlin (City of Berlin)<br />
Berlin, 6,5 % Gold Bond 500 $ 1.4.1925<br />
(R 4) VF+<br />
Durch Speyer & Co. in New York plazierte Anleihe<br />
von 15 Mio. $. Grün/schwarzer Stahlstich, tolle<br />
Vignette mit zwei Mädchen und Berliner Bär. Identische<br />
Gestaltung wie folgendes Stück.<br />
20<br />
Los 194 Schätzwert 30-50 €<br />
Berlin (City of Berlin)<br />
Berlin, 6,5 % Gold Bond 1.000 $<br />
1.4.1925 (R 2) VF+<br />
Durch Speyer & Co. in New York plazierte Anleihe<br />
von 15 Mio. $. Orange/schwarzer Stahlstich.<br />
Los 195 Schätzwert 75-150 €<br />
Berlin (City of Berlin)<br />
Berlin, 6 % Bond 100 £ 2.7.1927 (Auflage<br />
17500, R 6) VF<br />
Teil einer von J. Henry Schroder & Co. in London<br />
untergebrachten Anleihe von 3,5 Mio. £. Sehr<br />
großformatig und dekorativ, mit Foto-Vignette “Rotes<br />
Rathaus” (seit der Wiedervereinigung wieder<br />
Sitz des Berliner Regierenden Bürgermeisters).<br />
Los 196 Schätzwert 150-250 €<br />
Berlin (City of Berlin)<br />
Berlin, 6 % Bond 1.000 £ 2.7.1927<br />
(Auflage 750, R 7) EF-VF<br />
Teil einer von J. Henry Schroder & Co. in London<br />
untergebrachten Anleihe von 3,5 Mio. £. Identische<br />
Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 197 Schätzwert 75-125 €<br />
Berlin-Blankenburger<br />
Rahmenfabrik und Sägewerk AG<br />
Berlin-Blankenburg, Aktie 10.000 Mark<br />
Aug. 1923. Gründeraktie (Auflage 3000,<br />
R 6) EF<br />
Gründung 1923 zur Herstellung und zum Vertrieb von Holzwaren,<br />
insbesondere von Rahmen. Bereits 1927 erloschen.<br />
Los 198 Schätzwert 30-75 €<br />
Berlin-Borsigwalder<br />
Metallwerke Löwenberg AG<br />
Berlin, Aktie 5.000 Mark 3.9.1923<br />
(Auflage 8000, R 5) EF<br />
Gründung 1916. Herstellung und Verkauf von Kupfer- und<br />
Messingfabrikaten, u.a. für Schiff- und Lokomotivbau. 1925<br />
Vergleich, Liquidation bis Anfang der 30er Jahre.<br />
Nr. 198<br />
Los 199 Schätzwert 400-500 €<br />
Berlin-Burger Eisenwerk AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 11.1.1918<br />
(Auflage 1300, R 12) VF+<br />
Jugendstilelemente im Unterdruck. Einzelstück<br />
aus dem Reichsbankschatz, vorher nicht bekannt<br />
gewesen.<br />
Gründung 1913 als Herdkessel-Industrie AG, 1916 umbenannt<br />
wie oben anläßlich der Übernahme des Burger Eisenwerks von<br />
F. Angrick. Neben Erzeugnissen der Eisen-, Stahl- und Metallindustrie<br />
wurden von 1923-1927 unter der Marke Be-Be auch<br />
Motorräder hergestellt. Unterstützt durch nicht weniger als 8<br />
Kapitalerhöhungen in nur 7 Jahren fuhr die in Berlin börsennotierte<br />
AG (Mehrheitsaktionär: J. Roth AG Eisengiesserei und Maschinen-Fabriken,<br />
Berlin-Tempelhof) einen beispiellosen Expansionskurs<br />
und entwickelte sich zu einer umfassenden Holding<br />
der Eisen-, Stahl und Metallindustrie. Werke: a) Eisen-, Stahlund<br />
Walzwerk sowie Maschinenfabrik in Burg bei Magdeburg,<br />
b) Metallwaren- und Blechemballagenfabrik in Heidenau bei<br />
Dresden (früher L. Georg Bierling & Co. AG), c) Maschinen- und<br />
Werkzeugfabrik in Rostock, d) Metallwaren-, Armaturen- und<br />
Badeöfenfabrik in Leipzig-Eutritzsch (früher vereinigte Jaeger,<br />
Rothe & Siemens-Werke AG, e) Ronomit <strong>GmbH</strong> Isolierrohrfabrik<br />
in Dresden-Leuben, f) Spezialmaschinenfabrik S. Aston AG in<br />
Burg bei Magdeburg. Ferner beteiligt bei der Bayerische Eisenhandels-Ges.<br />
Ehmer & Co. KG in München, Eisengroßhandlung<br />
Hermann Kramer & Co. KG in Danzig-Langfuhr, Eisengroßhandlung<br />
Gebr. Noether KG in Bruchsal i. Baden, Eisenhandel-AG in<br />
Duisburg, R. Dolberg Maschinen- und Feldbahnfabrik AG in Berlin,<br />
Autosafe AG in Berlin, Steyr-Automobile <strong>Deutsche</strong> Verkaufs-<br />
AG in Berlin, Automat-Industrie <strong>GmbH</strong> in Wien, Dajac Deutsch-<br />
Amerikanische Automobil-Industrie AG in Berlin, Braunkohlenbergwerk<br />
“Luise” AG in Altenweddingen b. Magdeburg, Stahlund<br />
Eisen-AG in Königsberg i. Pr., “Momentag” Moment-Büro-<br />
Bedarfs-AG in Berlin, Gebr. Voss <strong>GmbH</strong> Heizungsanlagen in<br />
Stendal. Das hastig zusammengezimmerte Firmenimperium<br />
war stark fremdfinanziert und zerbrach Anfang 1925, als die<br />
Gläubiger nervös wurden. In Folge der schlechten Konjunktur<br />
fand der Konkursverwalter für keines der Werke einen Käufer;<br />
lediglich die Radiatoren-Gießerei in Burg wurde zur Beschäftigungssicherung<br />
von einer stadteigenen <strong>GmbH</strong> übernommen.<br />
Die Werke Burg und Leipzig waren 1929 aus der Konkursmasse<br />
entlassen, die Werke Rostock und Heidenau zwangsversteigert.<br />
Das Konkursverfahren dauerte länger als die kurze, aber<br />
intensive Scheinblüte dieses Industriekonglomerats: Erst 1936<br />
war es nach über 10 Jahren Dauer beendet.<br />
Los 200 Schätzwert 40-75 €<br />
Berlin-Burger Eisenwerk AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 8.11.1921<br />
(Auflage 30000, R 6) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 201 Schätzwert 25-100 €<br />
Berlin-Neuroder Kunstanstalten AG<br />
Berlin, VZ-Aktie 1.000 Mark 21.4.1906<br />
(Auflage 1756, R 3) VF<br />
Großformatiges Papier, recht dekorativ gestaltet.<br />
Umgestellt auf Actie 100 RM.<br />
Gründung 1888 im schlesischen Neurode als „Neuroder<br />
Kunstanstalten AG vorm. Treutler, Conrad & Taube“. 1900 Übernahme<br />
der Berliner Kunstdruck- und Verlagsanstalt. Betriebe<br />
in Berlin, Brandenburg (Havel), Braunau (Böhmen) und Neurode<br />
in Schlesien. Herstellung von Reliefs, Emulsion für Fotopapiere<br />
und von Offseterzeugnissen. 1947/48 Sitzverlegung<br />
nach München, die Werke in Schlesien und der ehemaligen<br />
Ostzone wurden enteignet. Börsennotiz Berlin.<br />
Nr. 202<br />
Nr. 201<br />
Los 202 Schätzwert 1000-1250 €<br />
Berlin-Spandauer Terrain-AG<br />
Spandau, Aktie 1.000 Mark 20.4.1906<br />
(Auflage 2100, R 10) VF<br />
Wappen von Berlin und Spandau in der Umrandung.<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Randschäden fachgerecht restauriert.<br />
Gegründet 1905 zwecks Erwerb, Verwaltung und Verwertung<br />
von Grundstücken, insbesondere in Spandau. Ab 1914 in Liquidation.<br />
Die Ges. verkaufte ihren restlichen Gründstücksbesitz<br />
an die Stadt Berlin.<br />
Los 203 Schätzwert 75-125 €<br />
Berlin-Westen Grundstücks-AG<br />
Berlin, Aktie 200 RM Okt. 1938 (Auflage<br />
1000, R 7) EF<br />
Gründung 1928 zum Bau und Betrieb von Kaufhäusern im Stile<br />
des berühmten Pariser Kaufhauses Galeries Lafayette. Gründer<br />
waren zu 80 % deutsche Investoren, vor allem jüdische<br />
Bankiers, und zu 20 % Geschäftsfreunde aus Holland und<br />
Frankreich. Über die Märkische Bau- und Handels-AG besaß<br />
man die Grundstücke Tauentzien-/Ecke Nürnberger Straße.<br />
Nachdem sich die Baupläne für das Kaufhaus zerschlugen,<br />
wurde im Okt. 1930 mit der Errichtung eines Bürohauses zwischen<br />
Tauentzienpalast und Feminahaus begonnen, zugleich<br />
wurde über die Mehrheitsbeteiligung “Bellevue Immobilien AG”<br />
ein Bürohaus am Potsdamer Platz (das “Columbushaus”) errichtet.<br />
Der angepachtete Tauentzienpalast wurde 1938 an die<br />
F. W. Woolworth & Co. <strong>GmbH</strong> verkauft. Umbenannt 1931 in Berlin-Westen<br />
Grundstücks-AG, 1942 in Berliner AG für Industriebeteiligungen.<br />
Unter diesem Namen bis heute als Exot in Berlin<br />
börsennotiert, Großaktionär war lange das Kölner Bankhaus<br />
Delbrück & Co. bzw. seit dessen Verkauf an die ABN-AMRO-<br />
Bank im Jahr 2003 die Bankiersfamilie von der Heydt, die den<br />
Börsenmantel 2007 an einen Privatinvestor verkaufte (der hier<br />
seine aus dem Babcock-Insolvenz erworbene Mehrheitsbeteiligung<br />
an der Aachener Maschinenfabrik Schumag AG einbrachte).<br />
60 Jahre nach den ersten Plänen war dann nach der<br />
Wende das neu errichtete “Lafayette” eines der Renommierprojekte<br />
an der Friedrichstraße in Berlin, aber damit hatte diese<br />
AG gar nichts mehr zu tun.<br />
Los 204 Schätzwert 75-125 €<br />
Berliner Bank<br />
für Handel und Grundbesitz AG<br />
Berlin, Aktie 20 RM Dez. 1925 (R 6) EF-VF<br />
Gründung 1912 als Genossenschaftsbank Berliner Hausbesitzer<br />
e<strong>GmbH</strong>, 1923 Umwandlung in eine AG. Die Bank stand<br />
dem Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzer e.V. nahe. Sie<br />
besaß die repräsentative Hauptstelle Berlin C 2, Kaiser-Wilhelm-Str.<br />
56 sowie weitere 14 Zweigstellen im Stadtgebiet. Im<br />
Bankenkrach in Folge der Weltwirtschaftskrise stellte sie am<br />
19.11.1931 ihre Zahlungen ein und ging in Liquidationsver-
gleich mit einer von der Reichsregierung garantierten Mindestquote<br />
von 30 %.<br />
Los 205 Schätzwert 50-125 €<br />
Berliner Dampfmühlen-AG<br />
Berlin, Aktie 20 RM Jan. 1930 (Auflage<br />
500, R 5) UNC-EF<br />
Schöner Titel mit Berliner Bär.<br />
Gründung 1888 zum Erwerb, Errichtung und Betrieb von Getreidemühlen.<br />
1921 Aufstellung der aus dem Cöpenicker Betrieb<br />
ausgebauten Müllereimaschinen in der Berliner Mühle.<br />
Besitz: Dampfmühle Berlin SO 16, Michaelkirchstr. 22/23 (Getreide-Wäscherei<br />
und Trockenanlage, Getreide-Silos) und Getreidespeicher<br />
Berlin-Cöpenick (Mechanische Förderanlagen).<br />
Lediglich für ein Jahr (1926-27) Zusammenschluß mit der Berliner<br />
Victoriamühle, der Humboldtmühle und der Weizenmühle<br />
Karl Salomon AG in Berlin zu einer “Betriebsgesellschaft Berliner<br />
Mühlen mbH & Co., Berlin”. Börsen-Notiz: Berlin und Köln.<br />
Los 206 Schätzwert 600-750 €<br />
Berliner Lombardkasse AG<br />
Berlin, Aktie (Zwischenschein) 230 x<br />
1.000 RM 27.2.1939 (R 12), ausgestellt<br />
auf die <strong>Deutsche</strong> Bank, Berlin. Entsprach<br />
23 % des gesamten Kapitals,<br />
ausgegeben unter Zusammenfassung von<br />
17 kleineren ursprünglich von 1931<br />
datierenden Zwischenscheinen VF<br />
Hektographierte Ausfertigung auf hellblauem Karton,<br />
Originalunterschriften. Rückseitig Dividendenstempel<br />
bis 1942. In der Form ein Einzelstück aus<br />
dem Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1923 als Berliner Makler-Verein AG durch Mitglieder<br />
der Vereinigung von Berliner Banken und Bankiers (Stempelvereinigung)<br />
und der Interessengemeinschaft der Berliner Privatbankfirmen.<br />
Die Gründung erfolgte zunächst lediglich zum<br />
Zwecke des Namensschutzes, nachdem der “alte” 1877 als<br />
zweitälteste deutsche Maklerbank gegründete Berliner Makler-<br />
Verein 1923 in eine normale Geschäftsbank umgewandelt und<br />
in Berliner Bankverein AG umbenannt worden war. Im Juli 1931<br />
äußerte die Interessengemeinschaft der Berliner Privatbankfirmen<br />
den Wunsch, eine Lombardstelle zu schaffen, bei der ihre<br />
Mitglieder gegen Hinterlegung von Wertpapieren Lombardkredit<br />
erhalten konnten. Damit sollte der Abzug von Kundengeldern auf<br />
dem Höhepunkt der damaligen Bankenkrise kompensiert werden<br />
können. Am 31.7.1931 beschloß eine außerordentliche<br />
Hauptversammlung zu diesem Zweck die Erhöhung des Grundkapitals<br />
von 6.000 RM auf 1 Mio. RM, gleichzeitig umbenannt<br />
wie oben. Mit der technischen Durchführung der Geschäfte der<br />
Berliner Lombardkasse AG wurde zunächst die Bank des Berliner<br />
Kassen-Vereins, später die Liquidationskasse AG betraut. Ab<br />
1.5.1938 erfolgte die Geschäftsbesorgung wieder durch Angestellte<br />
der Bank des Berliner Kassen-Vereins (ab 1943: <strong>Deutsche</strong><br />
Reichsbank Wertpapiersammelbank) in der Oberwallstraße.<br />
Damit im Ostsektor Berlins verblieben, wo nach Angaben der<br />
Banken-Kommission sämtliche Geschäftsunterlagen abhanden<br />
kamen. 1951 wurde in Wilmersdorf in der Privatwohnung des<br />
Vorstands Rudolf Kastner eine Verwaltungsstelle eingerichtet.<br />
1959 entsprach die Bankenaufsicht dem Antrag auf Neuzulassung.<br />
1961 Verlegung des Verwaltungssitzes nach<br />
Frankfurt/Main und Umfirmierung in “Lombardkasse AG”. Seitdem<br />
stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden die <strong>Deutsche</strong> Bank, die<br />
bis heute wie eh und je mit 17,32 % größter Aktionär ist. Gründung<br />
von Niederlassungen in Düsseldorf (1970), Berlin und Hannover<br />
(1985) sowie München und Stuttgart (1988). 1990 fusionsweise<br />
Übernahme der Liquidations-Casse in Hamburg AG.<br />
Los 207 Schätzwert 500-625 €<br />
Berliner Lombardkasse AG<br />
Berlin, Aktie (Zwischenschein) 148 x<br />
1.000 RM 4.3.1939 (R 12), ausgestellt<br />
auf die Commerz- und Privat-Bank AG,<br />
Berlin. Entsprach 14,8 % des gesamten<br />
Kapitals, ausgegeben unter<br />
Zusammenfassung von sechs kleineren<br />
ursprünglich von 1931 datierenden<br />
Zwischenscheinen F<br />
Hektographierte Ausfertigung (identisch wie voriges<br />
Stück) auf hellblauem Karton, Originalunterschriften.<br />
Rückseitig Dividendenstempel bis 1942.<br />
In der Form ein Einzelstück aus dem Reichsbankschatz.<br />
Fehlstelle links durch Rostbruch.<br />
Los 208 Schätzwert 1400-1750 €<br />
Berliner Makler-Verein<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 20.1.1877.<br />
Gründeraktie (Auflage 1500, R 11) VF<br />
Originalsignaturen für den Aufsichtsrat und den Vorstand.<br />
Original signiert von Meyer Cohn, einem der<br />
grössten Financiers der Gründerzeit. Die Liste seiner<br />
Beteiligungen ist lang: Berliner Molkerei, Gumbinnen<br />
Brauerei, Tiergarten-Bauverein, Reichsbank<br />
(Mitglied im Zentralausschuß der Anteilseigner).<br />
Meyer Cohn war in der ersten Hälfte des 19. Jh. aus<br />
einfachen Verhältnissen in Posen nach Berlin gekommen<br />
und hatte hier mit Unterstützung märkischer<br />
Adliger eine Privatbank gegründet. Er erwarb<br />
den bei Bankiers, Fabrikanten und Kaufleuten sehr<br />
begehrten Titel eines “Commerzienraths” und hinterließ<br />
ein beträchtliches Vermögen. Seine zwei<br />
Nr. 199 Nr. 206<br />
Söhne Heinrich und Alexander (bedeutender Autographensammler,<br />
seine herausragende Sammlung<br />
wurde von Stargardt versteigert) übernahmen die<br />
Leitung der Bank und führten sie bis zu ihrem Tod<br />
1905 bzw. 1904. Der Sitz der Meyer Cohn’schen<br />
Bank befand sich viele Jahre Unter den Linden 11.<br />
Die Bank wurde 1906 (nach anderen Quellen 1908)<br />
von der Diskonto-Gesellschaft erworben, die später<br />
in die <strong>Deutsche</strong> Bank eingegliedert wurde. Wichtiger,<br />
zuvor völlig unbekannt gewesener Bank- und<br />
Börsenwert. Von den nur zwei im Reichsbankschatz<br />
gefundenen Stücken ist dies das letzte.<br />
Gegründet 1877 als zweitälteste deutsche Maklerbank zwecks<br />
Betrieb und Vermittlung von Börsengeschäften. 1891 außerdem<br />
Nr. 208<br />
namhafte Beteiligung an dem Prämien-Vermittlungsgeschäft von<br />
Alex. Löwenherz Nachf. in Berlin. Ferner bis 1917 beim Bankhaus<br />
Veit, Selberg & Co. in Berlin beteiligt. 1904 außerdem Übernahme<br />
des Geschäftsbetriebs des in Liquidation getretenen Börsen-Handels-Vereins,<br />
wobei auch der größte Teil der zuvor dort organisierten<br />
Händler übertrat. Dabei wurde auch der renommierte<br />
“Hertelsche Kursbericht” übernommen, den der Börsen-Handels-<br />
Verein schon bei seiner Gründung 1872 erworben hatte. Verluste<br />
bei Börsenengagements, bei Händlerkrediten und bei den Beteiligungen<br />
zehrten zu Beginn des 1. Weltkrieges Reserven und Kapital<br />
auf. Im Verlauf des Krieges, als sich die Situation nicht besserte,<br />
kam es dann zu einer stillen Liquidation. Im März 1923 erfolgte,<br />
nachdem 90 % des Aktienkapitals in andere Hände übergegangen<br />
waren, die Umwandlung von einer Maklerbank in eine<br />
normale Geschäftsbank. In dem Zusammenhang 1923 Umfirmierung<br />
in “Berliner Bankverein AG”. (Gleichzeitig gründeten 1923<br />
die früheren Aktionäre zunächst nur aus Gründen des Namensschutzes<br />
eine neue AG namens Berliner Makler-Verein). Der nunmehrige<br />
Berliner Bankverein übernahm 1926 im Wege der Fusion<br />
noch die Dünger-Kreditbank AG. Bald darauf zwangen ihn aber<br />
immense Kreditverluste in die 1928 dann beschlossene Liquidation.<br />
1929 auch Einstellung der Börsennotiz in Berlin.<br />
Los 209 Schätzwert 400-500 €<br />
Berliner Revisions-AG<br />
Berlin, Aktie (Interimsschein) 125 x 100 RM<br />
30.9.1937 (R 12), ausgestellt auf Eduard<br />
Schlüter, Berlin-Frohnau, Vorstandsmitglied<br />
der Ges. Das Stück verbrieft 25 % der<br />
1937er Kapitalerhöhung VF<br />
Maschinenschriftliche Ausfertigung mit Originalunterschriften<br />
von AR-Vorsitzendem und Vorstand.<br />
Ein Unikat aus dem Reichsbankschatz. Fleckig.<br />
Gründung 1927. Übernahme und Ausführung von Bücher- und<br />
Steuerrevisionen, die Erledigung aller Steuerangelegenheiten,<br />
Überprüfung und Beglaubigung von Bilanzen und Gesellschafts-<br />
21
gründungen, auch treuhänderische Funktionen. 1950 Berliner<br />
Wertpapierbereinigung, 1968 umfirmiert in Berliner Revisions-<br />
AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft.<br />
Los 210 Schätzwert 300-375 €<br />
Berliner Schlossbrauerei AG<br />
Berlin-Schöneberg, Global-Aktie 100 x<br />
1.000 RM 28.5.1934 (Auflage nur 4<br />
Stück, R 10) EF-<br />
Maschinenschriftlich ausgeführt. Originalunterschriften<br />
Erich Niemann für den Aufsichtsrat und<br />
Richard Müller für den Vorstand. Die gesamte Auflage<br />
von nur 4 Stück lag im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1871. Produktion: Helles Bier nach Pilsener Art, dunkles<br />
Bier nach Münchner Art, obergäriges Karamelbier, Exportbier.<br />
1921 durch Fusion auf die Lindener Aktien-Brauerei in<br />
Hannover-Linden übergegangen. Seit 1926 als Schloßbrauerei<br />
AG wieder eine eigenständige AG. 1934 umfirmiert in “Berliner<br />
Schloßbrauerei AG”. Zu dem umfangreichen Gaststätten- und<br />
Hotelbesitz zählten u.a. das Restaurant „Zum Prälaten“ in 9<br />
Stadtbahnbogen am Alexanderplatz, das „Prälaten am Zoo“, das<br />
„Cafe Corso“, das Golf-Hotel Berlin-Charlottenburg (Hardenbergstraße<br />
27a/28 und Kantstraße 2 und 2a), das „Prälaten in<br />
Schöneberg“ sowie die Goldener Schlüssel Restaurant-Betriebsges.<br />
mbH, die Gaststätten-Gesellschaft Zentrum mbH und die<br />
Friedrichstadt Gaststätten <strong>GmbH</strong> mit dem Spezialausschank<br />
“Bärenschänke” in der Friedrichstr. 124 sowie die Kronprinzengarten<br />
Bornstedt bei Potsdam <strong>GmbH</strong>. 1960 Übernahme durch<br />
die Berliner Kindl Brauerei AG und Weiterführung als Bärenbier-<br />
Brauerei mit 300.000 hl Absatz. 1975 Schließung der Braustätte,<br />
Weiterführung der Marke Bärenpils durch die Kindl-Brauerei.<br />
Los 211 Schätzwert 30-50 €<br />
Berliner Städtische<br />
Elektrizitätswerke AG (BEWAG)<br />
Berlin, 7 % Obl. 1.000 Fr. 13.11.1925<br />
(Auflage 22000, R 2) VF+<br />
Teil einer in der Schweiz und Holland platzierten<br />
Anleihe von 30 Mio. Sfr. (unter Führung der<br />
Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich und von<br />
Pierson & Co. in Amsterdam) unter der Garantie<br />
der Stadt Berlin.<br />
Gründung 1923 zur Versorgung Berlins mit Elektrizität und<br />
Wärme. Kraftwerke: Klingenberg, West, Charlottenburg, Moabit,<br />
Rummelsburg, Oberspree, Spandau, Steglitz und Weißensee.<br />
1931 - die Stadt Berlin hatte gerade wieder einmal riesige<br />
Haushaltslöcher zu stopfen - ging die Konzession an die von<br />
der Privatwirtschaft getragene und finanzierte Berliner Kraftund<br />
Licht-AG (Bekula) über. Die Betriebsführung behielt die BE-<br />
WAG. 2001 übernahm der schwedische Energiekonzern Vattenfeld<br />
die Aktienmehrheit. 2002 Zusammenschluss mit der<br />
hamburgischen HEW, der Lausitzer LAUBAG und der mitteldeutschen<br />
VEAG zur Vattenfall Europe AG, die sich damit als<br />
“vierte Kraft” in der deutschen Stromversorgung etablierte.<br />
2005 squeeze-out der letzten Kleinaktionäre der bis dahin börsennotierten<br />
früheren Bewag.<br />
22<br />
Los 212 Schätzwert 40-75 €<br />
Berliner Städtische<br />
Elektrizitätswerke AG (BEWAG)<br />
Berlin, 7 % Obl. 2.000 Fr. 13.11.1925<br />
(Auflage 4000, R 4) VF<br />
Genau wie voriges Los.<br />
Los 213 Schätzwert 30-50 €<br />
Berliner Städtische<br />
Elektrizitätswerke AG (BEWAG)<br />
Berlin, 6,5 % Debenture 1.000 $<br />
1.12.1926 (R 2) EF-VF<br />
Blau/schwarzer Stahlstich mit allegorischer Vignette.<br />
Los 214 Schätzwert 20-40 €<br />
Berliner Städtische<br />
Elektrizitätswerke AG (BEWAG)<br />
Berlin, 6 % Debenture 1.000 $ 1.4.1930<br />
(R 2) EF-VF<br />
Grün/schwarzer Stahlstich mit allegorischer Vignette.<br />
Los 215 Schätzwert 75-125 €<br />
Berliner Velvetfabrik<br />
M. Mengers & Söhne AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Dez. 1924<br />
(Blankette, R 7) EF<br />
Gegründet 1923 unter Übernahme des Aktienmantels der<br />
1905 gegründeten AG für überseeische Bauunternehmungen.<br />
Die Gesellschaft ist hervorgegenagen aus der 1873 gegründeten<br />
KG Berliner Velvetfabrik M. Mengers & Söhne. Betrieb von<br />
industriellen Unternehmungen jeder Art, insbesondere auf dem<br />
Gebiete der Textilbranche. Sitz war Berlin SO 33, Köpenicker<br />
Str. 18-20. Großaktionär war die Mech. Weberei Linden. 1933<br />
wurde der Betrieb stillgelegt und außergerichtlich abgewickelt.<br />
Los 216 Schätzwert 100-200 €<br />
Berliner Viehcommissions-<br />
und Wechsel-Bank<br />
Berlin, Namens-Actie 1.000 Mark<br />
1.7.1895 (Auflage 500, R 5) EF-VF<br />
Initiatoren waren führende Leute des Berliner Fleischergewerbes.<br />
Neben dem insbesondere für diese Berufsgruppe betriebenen<br />
Bankgeschäft (in der Königstraße und auf dem Städt.<br />
Vieh- und Schlachthof) besaß die Bank eine Viehagentur-Abteilung,<br />
die 1922 als „Berliner Viehverkehrs-Bank AG“ verselbständigt<br />
wurde. 1919/1922 Umfirmierung in „Handelsbank AG in<br />
Berlin“. Großaktionär war zuletzt die Bayerische Hypothekenund<br />
Wechselbank. 1932 in der großen Bankenkrise Zahlungseinstellung,<br />
Zwangsvergleich und Auflösung der Gesellschaft.<br />
Los 217 Schätzwert 50-125 €<br />
Berliner Viehcommissionsund<br />
Wechsel-Bank<br />
Berlin, Namens-Actie 1.000 Mark<br />
15.5.1906 (Blankette, R 11) EF<br />
Nur zwei dieser Blanketten wurden im Reichsbankschatz<br />
gefunden.<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 218 Schätzwert 30-75 €<br />
Bernh. Dietel AG<br />
Reichenbach i. V., Aktie 5.000 Mark<br />
17.5.1923 (Auflage 2000, nach<br />
Umstellung noch 200, R 5) EF<br />
1933 Nennwertherabsetzung auf 3.500 RM.<br />
Gründung 1872, 1893 Erwerb eines größeren Fabriksanwesens<br />
in Unterheinsdorf bei Reichenbach, das nach und nach zu einer<br />
großen Baumwollstückfärberei ausgebaut wurde. Im Mai 1923<br />
Umwandlung in eine AG. Handel mit Textilstoffen, Bleicherei, Färberei<br />
und Appretur von wollenen, baumwollenen und kunstseidenen<br />
Geweben jeder Art. 1946 zugunsten des Landes Sachsen<br />
enteignet. Von 1948-1953 Firmierung als VEB Ausrüstungs- und<br />
Kunststoffverarbeitungswerk Reichenbach. Nach 1952 gehörte<br />
der Betrieb als Werk 4 Unterheinsdorf zum VEB Buntweberei und<br />
Färberei Neugersdorf, von 1969-1971 als Werk Unterheinsdorf<br />
zum VEB Buntspecht Neugersdorf und von 1971-1990 als Werk<br />
4 , Unterheinsdorf zum VEB Oberlausitzer Textilbetriebe Neugersdorf.<br />
1992 wurde die Lautex AG als Rechtsnachfolger eingetragen.<br />
Ihr folgte die TGO Textil <strong>GmbH</strong> Ostsachsen Zittau infolge<br />
Aufspaltung zur Neugründung gemäß Spaltungsbeschluß vom<br />
22.2.1993 und Handelsregistereintragung vom 1.9.1993.<br />
Los 219 Schätzwert 30-75 €<br />
Bernhard Dalichow AG<br />
Glauchau, Aktie 1.000 RM 13.9.1929.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 5) UNC-EF<br />
Gegründet 1929 nach Übernahme der Firmen Bernhard Dalichow<br />
in Glauchau und W. Kelling in Bautzen. Färberei und chemische<br />
Reinigung, Erzeugung von Textilmaschinen, Herstellung<br />
und Ausrüstung von Textilwaren. Heute Bernhard Dalichow<br />
<strong>GmbH</strong>, Glauchau.<br />
Los 220 Schätzwert 100-125 €<br />
Bezirksverband für den<br />
Regierungsbezirk Kassel<br />
Kassel, 7 % Goldschuldv. 500 RM<br />
1.4.1931 (R 9) EF<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 221 Schätzwert 75-125 €<br />
Bezirksverband Oberschwäbische<br />
Elektrizitätswerke<br />
Biberach a.d. Riß, 7 % Gold Bond 500 $<br />
15.1.1926 (R 6) VF<br />
Orange/schwarzer Stahlstich, große Vignette mit<br />
rauchenden Schloten, Wasserfall, Generator und<br />
unbekleidetem Merkur.<br />
Gemeinsame Anleihe der öffentlichen Stromversorgungsunternehmen<br />
der Städte/Landkreise Balingen, Biberach, Blaubeuren,<br />
Ehingen, Laupheim, Leutkirch, Münsingen, Ravensburg,<br />
Reutlingen, Rietlingen, Saulgau, Tettnang, Urach, Waldsee und<br />
Wangen.<br />
Los 222 Schätzwert 200-400 €<br />
Bielefelder AG<br />
für Mechanische Weberei<br />
Bielefeld, Actie 200 Thaler 1.1.1865.<br />
Gründeraktie (Auflage 1500, R 5) VF-<br />
Ausgesprochen dekorativ mit Abb. der Weberei,<br />
drei Neben-Vignetten.<br />
Gründung 1864. Herstellung von rohen und gebleichten Leinen,<br />
Baumwollgeweben, Handtüchern. Werk in Bielefeld mit<br />
650 Webstühlen, seit 1908 Zweigwerk in Spenge (Kreis Herford)<br />
mit 350 Webstühlen. 1961 Fusion mit der Mechanische<br />
Weberei Ravensberg in Bielefeld-Schildesche und Umfirmierung<br />
in Bielefelder Webereien AG. 1970 Ausgliederung des<br />
Werkes Schildesche, 1973 Ausgliederung des ganzen restlichen<br />
Textilbereiches in Tochtergesellschaften, die dann verkauft<br />
wurden. 1974 Umfirmierung in BIEWAG Investions-AG,<br />
später BIEWAG Finanzierungsgesellschaft AG mit Sitz in Königstein/Taunus.<br />
1983 Konkurs.<br />
Los 223 Schätzwert 75-125 €<br />
Bierbrauerei Durlacher Hof AG<br />
vorm. Hagen<br />
Mannheim, Aktie 1.000 Mark 5.8.1920<br />
(Auflage 250, R 6) VF<br />
Gründung 1894 unter Erwerb und Fortbetrieb der 1880 von<br />
Hch. Ph. Hagen errichteten Hagen’schen Brauerei sowie des<br />
Durlacher Hof in Mannheim. Braubetrieb: Käfertaler 168/172.<br />
1919/20 Erwerb des Kontingents und der Brauerei-Grundstükke<br />
der Brauerei H. J. Rau in Mannheim. Auch Mineralwässer<br />
und Limonaden wurden produziert. Im 2. Weltkrieg starke<br />
Kriegsschäden, 1945 Beschlagnahme des Betriebes durch die<br />
amerikanische Besatzungsmacht, erst 1948 konnte der Brauereibetrieb<br />
mit ca. 120 Mitarbeitern wieder aufgenommen werden.<br />
1951 umbenannt in “Brauerei Durlacher Hof AG”. Börsen-
notiz in Mannheim, später Frankfurt. Mehrheitsaktionär war<br />
das Bankhaus Anton Hafner, Augsburg. 1973 auf die Eichbaum-Brauereien<br />
AG, Worms, verschmolzen.<br />
Los 224 Schätzwert 50-100 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, 4,5 % Teilschuldv. 500 Mark<br />
31.12.1919 (Auflage 2000, R 6) UNC-EF<br />
Gegründet 1860 in Nürnberg durch die Brüder Adolf und Ignaz<br />
Bing als Großhandlung für Haushaltswaren und Spielzeug, welches<br />
im damals bettelarmen ländlichen Franken in Heimarbeit<br />
hergestellt wurde. 1879 begannen die Gebrüder Bing selbst mit<br />
der Produktion, 1895 Umwandlung in die „Nürnberger Metallund<br />
Lackierwarenfabrik AG“. In drei Fabriken in Nürnberg und<br />
zwei Fabriken im sächsischen Grünhain wurden Haus- und Küchengeräte,<br />
Badeöfen, Eisschränke, Korbmöbel, Porzellan, Büromaschinen<br />
(insbesondere Schreibmaschinen, 1921 ausgegliedert<br />
in die in Berlin gegründete und 1949 nach Nürnberg verlegte<br />
Tochterfirma Orga AG), optische, mechanische und elektrische<br />
Spielwaren, Modelleisenbahnen, Puppen (u.a. offene Imitationen<br />
der Käthe-Kruse-Puppen) sowie Kinderfilme hergestellt. Vor dem<br />
1. Weltkrieg waren die in Berlin, Frankfurt a.M. und München<br />
börsennotierten Bing-Werke mit bis zu 5.000 Mitarbeitern der<br />
größte Spielzeughersteller der Welt, die Bing-Modelleisenbahnen<br />
rangierten bis zur Produktionseinstellung 1932 noch vor Märklin.<br />
In der Weltwirtschaftskrise geriet Bing - frühes Opfer der “Globalisierung”<br />
- nach Problemen bei der US-amerikanischen Vertriebstochter<br />
selbst in Zahlungsschwierigkeiten, 1932 kam es zu einem<br />
Zwangsvergleich. Die Spielzeugproduktion wurde eingestellt,<br />
um andere Firmenteile zu retten, sie lebt heute nur noch im<br />
Spielzeugmuseum in Nürnberg fort. Die beiden Werke im sächsischen<br />
Grünhain wurden 1933 in der von österreichischen Industriellen<br />
gegründeten “Bing-Emaillier-Werke AG” verselbständigt.<br />
Die Nürnberger Spielwarenhersteller Karl Bub und Kraus erwarben<br />
Maschinen und Werkzeuge und fertigten Teile der Bing-Eisenbahn<br />
weiter, die dann von 1932 bis 1937 als Karl Bub Miniatur<br />
Eisenbahn vertrieben wurde. Der frühere Bing-Konstrukteur<br />
Hermann Müller erlangte Weltruf mit den Modellautos seiner Firma<br />
Schuco. Stephan Bing, Sohn des Firmengründers, wurde<br />
1932 Mitbegründer der Modelleisenbahnfirma Trix (musste aber<br />
als Jude 1938 nach England emigrieren). Andere Teile der Bing-<br />
Werke wurden von Fritz Hintermayr erworben, der von 1932 bis<br />
1945 Sättel, Werkzeugtaschen für Motorräder und Gasboiler in<br />
den Bingwerken herstellen ließ. 1937 wurde die Produktion des<br />
Bing-Vergasers aufgenommen. Die Fritz Hintermayr <strong>GmbH</strong> Bing-<br />
Vergaser-Fabrik wurde 2001 in “Bing Power Systems <strong>GmbH</strong>”<br />
umbenannt, sie fertigt heute u.a. die Vergaser für die gerade von<br />
AUDI übernommene Motorrad-Kultmarke Ducati, für BMW und<br />
Horex. Die AG selbst hatte drei Monate nach dem Zwangsvergleich<br />
im Aug. 1932 Konkurs anmelden müssen. Sie wurde von<br />
neuen Aktionären 1934/35 mit Reichsmitteln saniert und fortgesetzt,<br />
1936 wurde in verkleinerten Fabrikräumen in der Adam-<br />
Klein-Str. 141 auch wieder eine Spielwarenabteilung eröffnet, die<br />
aber die frühere Bedeutung nie wieder auch nur annähernd erreichte.<br />
1941 umfirmiert in “Nowag” Noris-Werke AG, kurz nach<br />
1945 erneut in Konkurs. Im großen früheren Bing-Gebäudekomplex<br />
in der Stephanstraße befindet sich heute die Hauptverwaltung<br />
der bekannten Rüstungs- und Elektronikfirma Diehl.<br />
Los 225 Schätzwert 100-150 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, 4,5 % Teilschuldv. 1.000 Mark<br />
31.12.1919 (Auflage 4500, R 8) EF<br />
Gestaltet wie folgendes Los.<br />
Los 226 Schätzwert 200-250 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, 4,5 % Teilschuldv. 2.000 Mark<br />
31.12.1919 (Auflage 2250, R 10) VF<br />
Dieser höchste Nennwert der 1919er Anleihe war<br />
bislang völlig unbekannt, nur 3 Stück lagen im<br />
Reichsbankschatz.<br />
Los 227 Schätzwert 200-250 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, Aktie 1.000 Mark Okt. 1922<br />
(Auflage 100000, R 8) EF<br />
Faksimile Dr. Siegmund Bing (1878-1961) für den<br />
Aufsichtsrat, Stephan Bing als Generaldirektor der<br />
Bingwerke für den Vorstand. Älteste bekannte Aktie<br />
der Bing-Werke.<br />
Los 228 Schätzwert 30-60 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, 4,5 % Genußrechtsurkunde 50<br />
RM 30.6.1926 (R 7) UNC-<br />
Gestaltet wie folgende Lose.<br />
Los 229 Schätzwert 30-60 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, 4,5 % Genußrechtsurkunde<br />
100 RM 30.6.1926 (R 7) UNC-<br />
Nr. 222 Nr. 235<br />
Los 230 Schätzwert 60-75 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, 4,5 % Genußrechtsurkunde<br />
200 RM 30.6.1926 (R 8) UNC-<br />
Los 231 Schätzwert 150-200 €<br />
Bing Werke vorm. Gebrüder Bing AG<br />
Nürnberg, Aktie Lit. A 1.000 RM Juni<br />
1927 (Auflage 5000, R 9) UNC<br />
Nur 4 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 232 Schätzwert 75-125 €<br />
Biochemische Industrie AG<br />
Hamburg, Aktie 20 RM 30.12.1924 (R 7) VF<br />
Gründung 1923 zwecks Erwerb und Ausbeutung von Braunkohlenlagern,<br />
Mooren und anderen zellulosehaltigen Vorkommen.<br />
Ab 10.2.1926 Chemische Industrie AG. 1934 gelöscht.<br />
Los 233 Schätzwert 300-375 €<br />
Bitterfelder Actien-Bierbrauerei<br />
vormals A. Brömme<br />
Bitterfeld, Aktie 1.000 Mark 10.12.1906<br />
(Auflage 200, R 10) VF<br />
Originalunterschriften von Vorstand (Dr. Brömme)<br />
und Aufsichtsrat.<br />
Gründung 1880 durch den Brauereibesitzer Albert Brömme,<br />
seit 1891 AG. Die Brauerei lag an der Inn. Zörbiger Straße 25,<br />
auch eigene Mälzerei. 1920 Erwerb der Uhlemann’schen<br />
Dampfbierbrauerei in Delitzsch. Ab 1946 Aktienbrauerei, 1972<br />
als Werk Brauerei Bitterfeld zum VEB Getränkekombinat Dessau<br />
gekommen. 1990 als Brauerei Bitterfeld reprivatisiert, aber<br />
ohne anhaltenden Erfolg: 1995 Einstellung der Produktion, wenig<br />
später wurde die Brauerei abgerissen.<br />
Los 234 Schätzwert 30-75 €<br />
Blödner & Vierschrodt Gummiwarenfabrik<br />
u. Hanfschlauchweberei AG<br />
Gotha, Aktie 1.000 RM Dez. 1941<br />
(Auflage 388, R 4) EF<br />
Gegründet am 16.3.1878 als oHG, 1922 umgewandelt in eine<br />
AG. Betrieb einer Gummiwarenfabrik und Hanfschlauchweberei.<br />
Haupterzeugnisse Wasser-, Bier-, Weinschläuche, Maschinenschläuche,<br />
Konservenringe, sämtliche technische Gummiwaren<br />
in Natur- und Kunstkautschuk, außerdem Feuerwehrschläuche.<br />
Nach 1945 neben mehreren anderen Firmen in der<br />
VEB Gummiwerke (“Kowalit”) aufgegangen. Nach 1990 von der<br />
Phoenix AG übernommen.<br />
Los 235 Schätzwert 200-400 €<br />
Bochum-Gelsenkirchener<br />
Strassenbahnen<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 18.1.1896.<br />
Gründeraktie (Auflage 5000, R 5) VF+<br />
Gründung 1896. Sitzverlegung 1906 nach Essen (zugleich Übernahme<br />
der Aktienmehrheit durch das RWE), 1908 nach Bochum.<br />
Streckennetz von 120-150 km Länge, noch heute das<br />
größte Nahverkehrsunternehmen im Ruhrgebiet.<br />
23
Los 236 Schätzwert 80-160 €<br />
Bochumer Verein für Bergbau<br />
und Gussstahlfabrikation<br />
Bochum, Aktie 20 RM Febr. 1925 (Auflage<br />
150000, R 6) EF<br />
Gegründet 1842 als Mayer & Kühne von dem Schwaben Jacob<br />
Mayer, dem Erfinder des Stahlformgusses. 1854 Umwandlung<br />
in den Bochumer Verein. 1920 Verbund mit Deutsch-Lux, Gelsenberg,<br />
Siemens und Schuckert zur Rheinelbe-Union. 1926<br />
Einbringung der Grundstücke und Werksanlagen in die Vereinigte<br />
Stahlwerke AG. Nach Zerschlagung der Vereinigte Stahlwerke<br />
AG 1951 Wiedergründung als Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation<br />
AG. 1965 Fusion mit der Hütten- und Bergwerke<br />
AG Rheinhausen zur Fried. Krupp Hüttenwerke AG. 1980<br />
vollständige Integration in die Krupp Stahl AG.<br />
Los 237 Schätzwert 100-200 €<br />
Bochumer Verein für Bergbau<br />
und Gussstahlfabrikation<br />
Bochum, Aktie 50 RM Febr. 1925 (Auflage<br />
78000, R 8) EF<br />
Nur 21 Stück lagen im Reichsbankschatz. Identische<br />
Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 238 Schätzwert 500-625 €<br />
Boden-AG am Amtsgericht Pankow<br />
Berlin, Aktie Lit. A 2.000 Mark 6.4.1905.<br />
Gründeraktie (Auflage 1650, R 9) VF<br />
Bei der Gründung 1905 (mit Aktieneinführung an der Berliner<br />
Börse) wurden die bis dahin der Immobilien-Verkehsbank zu<br />
Berlin gehörenden sog. Wollankschen Grundstücke in Größe<br />
von 443.656 qm übernommen, belegen zwischen den Bahnhöfen<br />
Niederschönhausen und Heinersdorf, eingegrenzt von<br />
der Berliner Straße, der Prenzlauer Chaussee und der Berlin-<br />
Stettiner Eisenbahn. Auf einem nicht mitverkauften Baublock<br />
mitten in dem Areal war zuvor schon das königl. Amtsgericht<br />
Pankow errichtet worden. Zwei weitere Grundstücke trat die<br />
Ges. für den Bau einer Schule und einer Kirche unentgeltlich<br />
ab. Nach umfangreichen Grundstückstäuschen mit der Gemeinde<br />
für Strassenbauzwecke wurde die Straßen-Regulierung<br />
1908 zum Abschluß gebracht. Wenige Jahre danach verschlechterte<br />
sich die Lage am Grundstücksmarkt und es liefen<br />
immer höhere Verluste auf, die am Ende des 1. Weltkrieges<br />
1918 zur Verhängung der Geschäftsaufsicht führten. Durch<br />
den Bau eines Industriegleisanschlusses an der Ostseite hoffte<br />
man dann den größeren Teil des Areals in Industriegelände umwandeln<br />
zu können. 1924 waren alle Grundstücke verkauft, die<br />
AG trat in Liquidation. 1927 wurde eine Resthypothek der Berliner<br />
Hypothekenbank zu einem Bruchteil des Nennwertes abgelöst.<br />
1928 nach Beendigung der Liquidation und Ausschüttung<br />
von 26 RM je VZ-Aktie im Handelsregister gelöscht.<br />
Los 239 Schätzwert 500-625 €<br />
Boden-AG Berlin-Heinersdorf<br />
Berlin, Aktie 1.200 Mark 17.7.1916.<br />
Gründeraktie (Auflage nur 8 Stück, R 9) VF<br />
Am 28.11.1924 handschriftlich umgestellt auf<br />
7.500 Goldmark. Zuvor völlig unbekannt gewesener<br />
Berliner Terrainwert!<br />
Gegründet zum Erwerb und zur Verwertung und Verwaltung von<br />
Grundstücken in Berlin-Heinersdorf. Das Kapital in Höhe von<br />
9.600 Mark, eingeteilt in 8 Aktien à 1.200 Mark wurde von den<br />
Gründern übernommen. 1937 wurde die Gesellschaft aufgelöst.<br />
24<br />
Nr. 238<br />
Nr. 239<br />
Los 240 Schätzwert 75-150 €<br />
Bohrgesellschaft Bergfrei<br />
Berlin, Namens-Anteil 1/1.000 3.3.1906<br />
(Auflage 1000, R 6) EF-VF<br />
Gründung 1905. Bohrungen auf Kali bei Lauterbach in Hessen<br />
blieben ohne Erfolg.<br />
Los 241 Schätzwert 100-125 €<br />
Bohrgesellschaft Heinrichshall<br />
Berlin, Namens-Anteil 1/1.000<br />
16.11.1908 (R 8) VF<br />
Nur 11 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1905. Sitz in Magdeburg. Gerechtsame: 15000<br />
Morgen in den Gemeinden Brome, Zicherie, Croya und Voitze<br />
Provinz Hannover, benachbart mit Bismarckhall und Centrum.<br />
Die Bohrungen auf Kali in Brome (südl. Lüneburger Heide bei<br />
Wittingen) blieben ohne Erfolg.<br />
Los 242 Schätzwert 400-500 €<br />
Bohrgesellschaft “Ostenhall”<br />
Wapno, Provinz Posen / Berlin,<br />
Anteilschein 5.5.1900 (Auflage 1000, R 9),<br />
ausgestellt auf Herrn J. Sanders, Paris VF<br />
Schöne Rosetten-Umrahmung, Originalunterschriften.<br />
Wertpapiere dieses bedeutenden Bergwerks<br />
waren bislang vollkommen unbekannt; lediglich<br />
6 Stück wurden im Reichsbankschatz gefunden.<br />
Bergbau-Berechtsame bei Wapno, Provinz Posen, Kreis Wongrowitz.<br />
Das 1299 erstsmals urkundlich erwähnte Wapno<br />
(deutsch 1944-45 Salzhof) kam auf Grund der polnischen Teilung<br />
an Preußen und 1920 auf Grund des Versailler Vertrages<br />
zum wiederentstandenen Polen. Unter dem Ort wurde im 19.<br />
Jh. eine Gipslagerstätte entdeckt und ab 1828 abgebaut. 1877<br />
stieß man auf ein Steinsalzvorkommen, zu dessen Erschließung<br />
später die Bohrgesellschaft “Ostenhall” gegründet wurde.<br />
1907 begann die Förderung. 1911 erwarb der belgische SOL-<br />
VAY-Konzern das Bergwerk, ab 1919 “Zaklady Solvay w Polsce<br />
S.z.oo.” 1940-44 wurde das Bergwerk stark ausgebaut zum<br />
bedeutendsten Steinsalzwerk auf polnischem Territorium. Zum<br />
Schutz des Salzstockes wurde der Abbau des darüberliegenden<br />
Gipsvorkommens eingestellt. Nach Rekordförderung in den<br />
Jahren 1950-65 wurde der Bergbau 1966 wegen Erschöpfung<br />
der Lagerstätte eingestellt. Die ungenügende Sicherung des<br />
Bergwerks führte 1977 zu verheerenden Wassereinbrüchen<br />
mit Ausspülung des Gipslagers. Es folgte eine Serie von Tagebrüchen,<br />
die Einwohner von Wapno wurden evakuiert, und am<br />
29.9.1977 versank schließlich fast das gesamte Ortszentrum<br />
in dem eingestürzten Bergwerk.<br />
Los 243 Schätzwert 25-100 €<br />
Bonner Portland-Zementwerk AG<br />
Oberkassel (Siegkreis), Aktie 100 RM<br />
Febr. 1944 (Auflage 890, R 5) EF<br />
Gründung 1856 als Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein AG,<br />
1938 Umbenennung in Bonner Portland-Zementwerk AG, seit<br />
Nr. 247<br />
Nr. 242<br />
1966 Bonner Zementwerk AG. Mehrheitsaktionär waren die<br />
Dyckerhoff-Zementwerke in Wiesbaden; 1985 mit Dyckerhoff<br />
verschmolzen.<br />
Los 244 Schätzwert 40-80 €<br />
BRAMARCO Export- und Import-AG<br />
Berlin, Namensaktie 1.000 RM Juli 1926.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 4) EF<br />
Sitz: Berlin C 2, Spandauer Str. 39. Im- und Export von sowie<br />
Großhandel mit Waren aller Art, insbesondere Holzwaren,<br />
Haus- und Küchengeräte, Spielwaren. 1952 in Konkurs gegangen.<br />
Los 245 Schätzwert 20-50 €<br />
Brandenburgische Elektricitäts-,<br />
Gas- und Wasserwerke AG<br />
Berlin, Aktie 300 RM März 1929 (Auflage<br />
800, R 4) UNC<br />
Bis zur Öffnung des Reichsbankschatzes war dieser<br />
Nennwert ganz unbekannt!<br />
Gründung 1909 durch Fusion der Brandenburgischen Carbidwerk<br />
<strong>GmbH</strong> und der Ostdeutschen Wasserkraft-<strong>GmbH</strong> zur<br />
“Brandenburgische Carbid- und Elektricitätswerke AG”. 1929<br />
Umfirmierung wie oben anläßlich der Fusion mit der “Continentale<br />
Wasser- und Gaswerke AG zu Berlin”. Betrieb von 7 E-<br />
Werken, 1 Gaswerk und 4 Wasserwerken. 1930 Verschmel-
zung mit der AG Körting’s Electricitäts-Werke. Börsennotiz Berlin,<br />
letzter Großaktionär war die Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschaft,<br />
München (auf die diese AG 1964 übertragen wurde).<br />
Los 246 Schätzwert 30-75 €<br />
Brandenburgische Elektricitäts-,<br />
Gas- und Wasserwerke AG<br />
Berlin, Aktie 500 RM März 1929 (Auflage<br />
600, R 4) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 247 Schätzwert 300-500 €<br />
Brandenburgische Städtebahn AG<br />
Berlin, Aktie Lit. B 1.000 Mark 1.4.1904.<br />
Gründeraktie (Auflage 8954, R 8) EF<br />
Sehr dekorativ mit Flügelrad. Die Lit. B der Gründeraktie<br />
war zuvor vollkommen unbekannt!<br />
Die Bahn wurde bereits im 19. Jh. als Teil eines aus militärstrategischen<br />
Gründen den Großraum Berlin großzügig umrundenden<br />
Eisenbahnringes konzipiert. Gegründet am 2.3.1901 in<br />
Berlin durch die Vereinigte Eisenbahnbau- und Betriebs-Gesellschaft,<br />
den Königlich Preussischen Fiskus, die Provinz Brandenburg,<br />
die Kreise Zauch-Belzig, Westhavelland, Ruppin und<br />
die Stadtgemeinde Brandenburg. Sitz ab 1914 in Brandenburg<br />
a.H., seit 1921 wieder in Berlin. Normalspurige 125 km lange<br />
Nebenbahn von Treuenbrietzen über Belzig, Brandenburg, Rathenow<br />
nach Neustadt a.D., Betriebseröffnung am 1.4.1904.<br />
Betriebsführung zunächst durch die Vereinigte Eisenbahnbauund<br />
Betriebs-Gesellschaft, ab 1.4.1914 führte die Gesellschaft<br />
den Betrieb selbst. Die Bahn verband die von Berlin ausgehenden<br />
Hauptstrecken nach Hamburg, Stendal, Magdeburg und<br />
Dessau miteinander und war eine der bedeutendsten deutschen<br />
Privatbahnen. Obwohl sich bei Ende des 2. Weltkrieges<br />
ohnehin über 95 % der Aktien im Besitz der öffentlichen Hand<br />
befanden, wurde die Bahn enteignet und ging 1949 in die Verwaltung<br />
der <strong>Deutsche</strong>n Reichsbahn über. In den 1960er Jahren<br />
forderte die UdSSR von der DDR einen weiteren Ausbau,<br />
um der Tschechoslowakei für den Güterverkehr einen Berlin<br />
umfahrenden Zugang zum Rostocker Hafen zu verschaffen. Ab<br />
1998 wurde die Bahn abschnittsweise stillgelegt, bis auf den<br />
37 km langen Abschnitt Brandenburg-Rathenow, der 2003-05<br />
für 55 Mio. Euro aufwändig saniert wurde und heute von Regionalzügen<br />
der Ostseeland Verkehr <strong>GmbH</strong> befahren wird. Dabei<br />
kam es zu einem bemerkenswerten Schildbürgerstreich der<br />
Bürokratie: Auch der Abschnitt Rathenow-Neustadt wurde, einschließlich<br />
der Neubauten der Brücken, für zig Millionen saniert,<br />
aber schon am 31.5.2006 nach nur 11-monatiger Betriebszeit<br />
wieder stillgelegt. Die AG selbst war übrigens schon<br />
1959 als vermögenslose Gesellschaft vom Amtsgericht Berlin-<br />
Charlottenburg gelöscht worden.<br />
„Vitaborn"-Etikett von 1925,<br />
Brauerei Bodenstein AG<br />
Los 248 Schätzwert 400-500 €<br />
Brauerei Bodenstein AG<br />
Magdeburg (Neustadt), Aktie 1.000 Mark<br />
1.7.1886. Gründeraktie (Auflage 1200,<br />
R 7) VF+<br />
Besonders hübsche Ornament-Umrahmung.<br />
Gründung bereits 1823, seit 1886 AG. 1918 Erwerb der Bukkauer<br />
Dampfbierbrauerei Reichardt & Schneidewin. Mit zuletzt<br />
rd. 300 Mitarbeitern stand die Brauerei Bodenstein (Sieverstorstr.<br />
10) dem Lokalrivalen, der Actien-Brauerei Neustadt-<br />
Magdeburg, an Größe nicht viel nach. 1946 enteignet, ab 1952<br />
VEB Börde Brauerei. 1950 beschloß eine Hauptversammlung<br />
zwecks Liquidation der AG die Sitzverlegung ein kleines Stück<br />
Richtung Westen, nach Schöningen (1953 ist die AG dann erloschen).<br />
Die Brauerei selbst wurde nach der Wende 1990 als<br />
“Börde Brauerei” reprivatisiert, wenige Jahre später dann stillgelegt.<br />
Die Gebäude der ältesten Magdeburger Brauerei wurden,<br />
obwohl unter Denkmalschutz stehend, 2005/06 weitgehend<br />
abgerissen, was anschließend zu einem heftigen politischen<br />
Schlagabtausch führte.<br />
Los 249 Schätzwert 400-500 €<br />
Brauerei Bodenstein AG<br />
Magdeburg (Neustadt), Aktie 1.000 Mark<br />
1.7.1919 (Auflage 600, davon 500 an die<br />
Altaktionäre der Buckauer<br />
Dampfbierbrauerei, R 8) EF+<br />
Los 250 Schätzwert 50-125 €<br />
Brauerei Feldschlößchen AG<br />
Braunschweig, Aktie 1.000 RM Jan. 1942<br />
(Auflage 1250, R 5) EF<br />
Gründung 1888 als “Bierbrauerei zum Feldschlößchen” unter<br />
Übernahme der „Brauerei zum Feldschlößchen von Noetzel &<br />
Otto“ an der Salzdahlumer Straße. Dazu wurden 1919 die<br />
„Braunschweiger Löwenbrauerei e<strong>GmbH</strong>“ und 1920 die<br />
„Braunschweiger Aktien-Bierbrauerei Streitberg“ übernommen,<br />
in diesem Zusammenhang Umfirmierung in Brauerei<br />
Feldschlößchen-Streitberg AG (der Zusatz Streitberg fiel 1939<br />
fort). Börsennotiz Braunschweig, ab 1934 Hannover. Später übernahm<br />
die Holsten-Brauerei die Aktienmehrheit und gliederte<br />
sich Feldschlößchen als eine ihrer größten Braustätten ein.<br />
Mit der Übernahme von Holsten durch Carlsberg schließlich<br />
zum dänischen Carlsberg-Konzern gekommen. 2009 Verkauf<br />
der Braustätte an den Billigbier-Giganten Oettinger.<br />
Los 251 Schätzwert 50-125 €<br />
Brauerei Hack AG<br />
Meiningen, Aktie 1.000 Mark 1.4.1923<br />
(Auflage 1000, R 4) EF<br />
Gegründet 1922. Produktion von ober- und untergärigem Bier<br />
und von alkoholfreien Getränken. Konzernverbindung (1943):<br />
Riebeck-Brauerei AG, Leipzig. 1947 aufgegangen in dem VEB<br />
Vereinigte Brauereien, Meiningen, nach 1971 Teil des Getränkekombinats<br />
Rennsteig. Nach der Privatisierung seit 1992 fortgeführt<br />
als Brauhaus Meiningen <strong>GmbH</strong> + Co. KG als Tochtergesellschaft<br />
der Patrizierbräu, Nürnberg. 1995 verkauft an den<br />
Koblenzer Investor Dr. Roland Müller. 1999 übernommen von<br />
Klaus Weydringer, nun Meininger Privatbrauerei <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 252 Schätzwert 50-100 €<br />
Brauerei Sacrau <strong>GmbH</strong><br />
Sacrau, Namens-Anteil 500 RM 1.9.1943<br />
(R 4) EF<br />
Die Brauerei in Niederschlesien wurde 1888 als Dampfbrauerei<br />
Max Fulde gegründet, 1896 umbenannt wie oben. Nach<br />
Nr. 248 Nr. 249<br />
1945 Zakrzow Browar. Heute sind die Gebäude abgerissen, nur<br />
der Schornstein steht noch.<br />
Los 253 Schätzwert 100-250 €<br />
Brauerei Schwartz-Storchen AG<br />
Speyer, Aktie 1.000 Mark 1.10.1914<br />
(Auflage 1200, R 4) EF<br />
Ausgegeben anlässlich der Fusion der Bayerischen<br />
Bierbrauerei-Ges. vorm. H. Schwartz mit der<br />
Brauerei zum Storchen AG.<br />
Gründung 1886 als Bayerische Bierbrauerei-Gesellschaft<br />
vorm. H. Schwartz in Speyer. 1914 fusionsweise Übernahme<br />
der Brauerei zum Storchen AG und Umfirmierung in “Brauerei<br />
Schwartz-Storchen AG”. Die beiden Braustätten wurden daraufhin<br />
durch einen unterirdischen Gang verbunden. 1922 Fusion<br />
mit der Brauereigesellschaft zur Sonne vorm. H. Weitz<br />
(diese hatte 1908 schon die AG Speyerer Brauhaus vorm.<br />
Schultz und 1921 die Löwenbrauerei vorm. I. Busch in Annweiler<br />
übernommen). Börsennotiz Mannheim und Frankfurt.<br />
1970 wird die Brauerei stillgelegt und die Produktion der weiter<br />
vertriebenen Marke “Storchen” in drei Braustätten der Eichbaum-Gruppe<br />
verlagert. 1971 durch Fusion in der Eichbaum-<br />
Werger-Brauereien AG aufgegangen.<br />
Nr. 254<br />
Los 254 Schätzwert 10-50 €<br />
Brauerei Schwartz-Storchen AG<br />
Speyer, Aktie 100 RM Juni 1942 (Auflage<br />
6650, R 2) EF<br />
Los 255 Schätzwert 300-375 €<br />
Brauerei Schwechat AG<br />
Wien, Sammelaktie 100.000 RM Dez.<br />
1942 (Auflage nur 20 Stück, R 9) UNC-EF<br />
Löwen im Unterdruck mit Spruchband: Hopfen und<br />
Malz, Gott erhalts. Extrem hoher Nennwert, zuvor<br />
vollkommen unbekannt gewesen!<br />
Das Brauhaus Schwechat wurde schon 1632 gegründet. 1796<br />
übernahm es die Familie Dreher. Unter Anton Dreher wurde das<br />
Brauhaus Schwechat Mitte des 19. Jh. die GRÖßTE BRAUEREI<br />
DES EUROPÄISCHEN FESTLANDES. 1905 Umwandlung in eine<br />
AG unter Einbringung der Brauereien Schwechat, Steinbruch<br />
bei Budapest, Michelob und Triest. 1913 Aufnahme der Brauereien<br />
St. Marx und Simmering, ferner Hütteldorf (1926), Floridsdorf-Jedlesee<br />
(1928) und Waidhofen a.d. Thaya (1928).<br />
1936 Fusion mit der Mautner Markhof Brauerei St. Georg AG.<br />
1960 Übernahme der Mälzerei aus dem stillgelegten Brauhaus<br />
der Stadt Wien in Rannersdorf.<br />
Los 256 Schätzwert 300-375 €<br />
Brauerei Wulle AG<br />
Stuttgart, Aktie 500 RM Jan. 1930<br />
(Auflage 1600, R 9) EF+<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesener Jahrgang, von<br />
diesem Nennwert wurden lediglich 7 Stück im<br />
Reichsbankschatz gefunden.<br />
Gründung 1896 als “Aktienbrauerei Wulle” unter Übernahme<br />
der Brauerei und Branntweinbrennerei von Ernst Wulle (gegr.<br />
1861). 1926 Umfirmierung wie oben. Bereits um die Jahrhundertwende<br />
wurde die Brauerei an der Neckarstraße bedeutend<br />
vergrößert und auf eine für damalige Verhältnisse unglaubliche<br />
Produktionsfähigkeit von 400.000 hl im Jahr ausgelegt. 1937<br />
Übernahme des Vermögens der Tochterges. Immobilien-Verein<br />
AG in Stuttgart, der u.a. der im Krieg später zerstörte Friedrichsbau<br />
gehörte. Außerdem an der 1907 gegründeten Wilhelmsbau<br />
AG beteiligt. 1971 Fusion mit der Brauerei Dinkelakker<br />
(gegr. 1888) zur Dinkelacker-Wulle AG. Umfirmiert 1980 in<br />
Dinkelacker Brauerei AG und 1996 in Dinkelacker AG. Großaktionär<br />
der bis heute in Stuttgart und Frankfurt börsennotierten<br />
AG ist die Gabriel Sedlmayr Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA,<br />
München.<br />
Los 257 Schätzwert 400-500 €<br />
Brauerei zum Felsenkeller<br />
Dresden-Plauen, Sammelaktie 100 x<br />
1.000 RM Febr. 1943 (Auflage nur 40<br />
Stück, R 9) EF-VF<br />
Gründung 1857. Im Laufe der Jahre wurde die Brauerei auf<br />
dem 300.000 qm großen Grundstück in Dresden-Plauen vielfach<br />
erweitert und hatte schließlich mit 400.000 hl die 6-fache<br />
Kapazität wie bei der Gründung. 1905 Angliederung der Malzfabrik<br />
Pirna. Mehrheitsbeteiligungen bestanden an der Schloß-<br />
Brauerei Chemnitz AG, der Sächsische Union-Brauerei AG in<br />
Zwickau, der Feldschlößchen-Brauerei AG in Chemnitz-Kappel,<br />
der Actien-Bierbrauerei zu Reisewitz, der Brauerei zum Felsenkeller<br />
Pirna AG und der Brauerei “Glückauf” Richard Hübsch<br />
<strong>GmbH</strong> in Gersdorf. Börsennotiz Berlin und Dresden/Leipzig.<br />
1952 als “VEB Dresdener Felsenkellerbrauerei” in Volkseigentum<br />
überführt, 1991 reprivatisiert (Sächsische Brau Union AG<br />
Felsenkellerbrauerei).<br />
25
Los 258 Schätzwert 200-250 €<br />
Braunkohle-Benzin AG<br />
Berlin, Zwischenschein für nom. 118.000<br />
RM Aktien 30.1.1945 (R 12), ausgegeben<br />
für die Bitterfelder Louisen-Grube<br />
Kohlenwerk u.Ziegelei AG, Sandersdorf EF<br />
Stück aus der Kapitalerhöhung von 100 Mio. auf<br />
150 Mio. RM. Maschinenschriftliche Ausführung<br />
mit Originalunterschriften. Einzelstück aus dem<br />
Reichsbankschatz. Abheftlochung.<br />
Gründung 1934 als Autarkie-Betrieb zur Herstellung von Treibstoffen<br />
und Schmierölen durch Braunkohle-Verflüssigung. Hydrierwerke<br />
in Böhlen, Zeitz und Schwarzheide (nach Enteignung<br />
in der DDR als volkseigene Betriebe weitergeführt) und Magdeburg<br />
(1945 demontiert). 1949 Sitzverlegung nach Westberlin<br />
und teilweise Schuldenregulierung mit dem verbliebenen Westvermögen;<br />
für die Ost-Ansprüche erhielten die Anleihegläubiger<br />
1963 Besserungsscheine. 1971 Übernahme der Böco Mineralölgesellschaft<br />
mbH in Regensburg, damit Wiederaufnahme der<br />
aktiven Geschäftstätigkeit, welche sich allerdings auf die Vermietung<br />
von 16 Kesselwagen beschränkte. Mit 38 % größter<br />
Aktionär war indirekt das RWE, aber auch die I.G. Farben, die<br />
<strong>Deutsche</strong> Texaco und Kali + Salz hielten größere Anteile.<br />
Los 259 Schätzwert 100-175 €<br />
Braunkohlen- und Briket-Industrie AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 15.11.1908<br />
(Auflage 1000, R 6) EF-VF<br />
Gründung 1900. In kurzer Zeit entwickelte sich die „Bubiag“ zu<br />
einem der bedeutendsten Bergbaubetriebe der Niederlausitz.<br />
Großaktionär war die Schaffgotsch Bergwerksges. in Gleiwitz.<br />
1947 wurden die Tagebaue und Brikettfabriken Marie-Anne bei<br />
Kleinleipisch (heute ein Stadtteil von Lauchhammer) und Karl Büren<br />
entschädigungslos enteignet. Es verblieb der Gesellschaft<br />
das Braunkohlenbergwerk der 1923 erworbenen Gewerkschaft<br />
Frielendorf im Bezirk Kassel. 1947 Sitzverlegung nach München,<br />
Verwaltung in Hannoversch-Münden. 1951 wurde die Majorität<br />
an der traditionsreichen „Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG“<br />
übernommen. 1970 Verschmelzung der Bubiag mit der Elikraft.<br />
Los 260 Schätzwert 25-100 €<br />
Braunkohlen- und Briket-Industrie AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Dez. 1917<br />
(Auflage 6000, R 4) EF<br />
26<br />
Nr. 256 Nr. 257<br />
Los 261 Schätzwert 30-75 €<br />
Braunkohlen-Industrie-AG Zukunft<br />
Weisweiler, Aktie 600 RM April 1928<br />
(Auflage 4166, R 5) EF-<br />
Gründung 1913 mit Sitz in Köln durch den A. Schaafhausen’schen<br />
Bankverein und die Gewerken der Gewerkschaft Zukunft<br />
in Köln, deren Kuxe sich bald zu 99,9 % in den Händen der AG<br />
befanden. Neben dem Braunkohlentagebau mit Brikettfabrik<br />
1913 auch an der Gründung der Kraftwerk Zukunft AG in Weisweiler<br />
b. Eschweiler beteiligt. 1915 Sitzverlegung nach Weisweiler.<br />
1926 Übernahme der Gewerkschaften Zukunft, Dürwiß<br />
und Lucherberg sowie der Braunkohlengewerkschaft Eschweiler.<br />
Zuletzt in Betrieb die Braunkohlentagebaue Zukunft-West in<br />
Weisweiler, Lucherberg/Düren und Maria Theresia in Herzogenrath<br />
(ruht seit 1948) sowie das Kraftwerk Zukunft in Eschweiler<br />
und die Wasserkraftwerke Schwammenauel und<br />
Heimbach. Großaktionär war mit zuletzt ca. 98 % das RWE,<br />
1959 auf die RWE-Tochter Rheinische Braunkohlenwerke AG<br />
verschmolzen.<br />
Los 262 Schätzwert 300-400 €<br />
Braunkohlenabbau-Verein<br />
zum Fortschritt<br />
Meuselwitz, Aktie 1.000 RM 11.12.1924<br />
(Auflage 1200, R 11) VF<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz. Minimale<br />
Schäden fachgerecht restauriert.<br />
Gründung 1858. Betrieb von Braunkohlenbergbau im Heinrichund<br />
Wilhelmschacht sowie im Germania-Bergwerk. Neben den<br />
Tief- und Tagebauen auch Betrieb von Brikettfabriken und Ziegeleien<br />
sowie einer Landwirtschaft. Ab 1899 in großem Stil<br />
Hinzuerwerb weiterer Kohlenfelder. Die Gesellschaft gehörte<br />
der Mitteldeutschen Braunkohlen-Syndikat <strong>GmbH</strong> in Leipzig<br />
sowie der Kohlenhandelsgesellschaft Riebeck-Meuselwitz an.<br />
Börsennotiz Leipzig, mit meist zweistelligen Dividenden hoch<br />
rentabel. 1947 Enteignung durch das Land Thüringen, weshalb<br />
der Firmensitz 1949 nach Rheine (Westf.) und 1958 nach Kassel<br />
(zur mit 95 % beteiligten Wintershall AG) verlegt wurde. Seit<br />
1968 in Liquidation.<br />
Los 263 Schätzwert 20-50 €<br />
Braunkohlenbergwerk Luise AG<br />
Altenweddingen, Aktie 1.000 Mark<br />
10.3.1923 (Auflage 20000, R 5) EF<br />
Gegründet 1922. Das Bergwerk förderte Braunkohle im Tiefbau<br />
(unter dem 25 m mächtigen Deckgebirge) aus der fiskalischen<br />
Braunkohlengrube „Pachtfeld Altenweddingen“ ca. 10 km südwestlich<br />
von Magdeburg. Am 15.8.1925 Eröffnung des Konkursverfahrens.<br />
Nr. 263<br />
Los 264 Schätzwert 50-125 €<br />
Braunkohlenbergwerk Pallas<br />
Erkelenz / Berlin, Kux-Schein 1/1000<br />
11.6.1912 (Auflage 1000, R 3) EF<br />
Originalsignaturen.<br />
Dieses geplante Braunkohlenbergwerk sollte in der damaligen<br />
preussischen Provinz Westpreussen in der Gemeinde Orlowo in<br />
der Nähe der Stadt Hohensalza im Weichseldelta errichtet werden.<br />
Die Vorkommen erwiesen sich jedoch als wenig ergiebig,<br />
daher ist davon auszugehen, dass auch die Tätigkeit der Gewerkschaft<br />
Pallas nicht erfolgreich war.<br />
Los 265 Schätzwert 225-300 €<br />
Braunkohlenwerke Bruckdorf AG<br />
Halle a. S., Aktie 100 RM Febr. 1934.<br />
Gründeraktie (Auflage 10000, R 10) VF<br />
Einzelstück aus dem Reichsbankschatz.<br />
Nr. 262 Nr. 265<br />
Gründung 1934 durch die Dresdner Bank, übernommen wurden<br />
die Bergwerke der Gewerkschaft des Bruckdorf-Nietlebener<br />
Bergbau-Vereins i.L. (Neuglücker Verein bei Nietleben, Alwiner<br />
Verein bei Bruckdorf, Gewerkschaften Voß und Anna in<br />
Bitterfeld und Delitzsch, Gewerkschaft Wolf in Calbe a.S.). Die<br />
Lagerstätten bargen Vorräte in der immensen Größenordnung<br />
von 300 Mio. Tonnen, abgebaut wurden 0,85 Mio. Tonnen jährlich.<br />
Die sowohl im Tage- wie auch Tiefbau betriebenen Gruben<br />
wurden ab 1936 eine nach der anderen geschlossen. Mit der<br />
Stilllegung des Tagebaus Bruckdorf 1966 endete die Braunkohlengewinnung<br />
im Stadtgebiet von Halle.<br />
Los 266 Schätzwert 75-200 €<br />
Braunschweigische AG<br />
für Jute- und Flachs-Industrie<br />
Braunschweig, Aktie 1.000 Mark<br />
1.11.1889 (Auflage 2517, R 3) EF-VF<br />
Gründung 1868 als erste Jute-Spinnerei und Weberei auf dem<br />
europäischen Kontinent, außerdem bedeutende Sacknäherei.<br />
Bereits 1874 beschäftigte der Betrieb 400 Leute. 1920 wurde<br />
die riesige Fabrik an der Spinnerstraße (von der heute nur noch<br />
das imponierende, fast 15 m hohe Eingangsportal steht) durch<br />
einen Brand völlig zerstört: 2400 Braunschweiger wurden von<br />
heute auf morgen arbeitslos. Auch die Zweigwerke Potsdam-<br />
Babelsberg und Vechelde mußten 1926 wegen Arbeitsmangel<br />
stillgelegt werden. 1932 Verschmelzung mit der „<strong>Deutsche</strong> Jute-Spinnerei<br />
und -Weberei“ in Meißen, deren Aktien aus dem<br />
Besitz der Darmstädter und National-Bank übernommen wurden.<br />
1944 wurden die Braunschweiger Werksanlagen bei einem<br />
Bombenangriff erneut schwer beschädigt, nur ein ganz<br />
bescheidener Neubeginn gelang nach dem Krieg; über die<br />
bauliche Nutzung des Trümmergeländes wird in Braunschweig<br />
bis heute diskutiert. Das Werk Meißen, in seiner Größe Braunschweig<br />
ebenbürtig, wurde nach 1945 enteignet. 1990 erwarben<br />
die Brüder Rothenberger aus Frankfurt die Aktienmehrheit,<br />
danach Umbenennung in „Rothenberger AG“ und Sitzverlegung<br />
nach Frankfurt/Main. Noch heute börsennotiert.<br />
Los 267 Schätzwert 30-75 €<br />
Braunschweigische AG<br />
für Jute- und Flachs-Industrie<br />
Braunschweig, Aktie 200 RM 26.5.1932<br />
(Auflage 750, R 3) EF<br />
Los 268 Schätzwert 10-50 €<br />
Braunschweigische<br />
Kohlen-Bergwerke<br />
Helmstedt, Aktie 1.200 Mark 19.5.1922<br />
(Auflage 28332, R 1) EF<br />
Im Unterdruck Hammerschlegelabb. mit Eichenlaubumrandung<br />
sowie “Glück Auf”. Mit Faksimile-<br />
Unterschrift des bedeutenden Industriellen Hugo<br />
Stinnes, der dem AR der BKB 1920-23 vorsaß.<br />
Gründung 1873 zum Erwerb der früher braunschweigisch-fiskalischen<br />
Braunkohlengruben „Prinz Wilhelm“, „Trendelbusch“<br />
und „Treue“. 1895/96 wurden die Kohlenfelder „Jo-
seph“ und „Otto“ sowie „Glück auf“ und „Friedrich“ hinzuerworben.<br />
Langfristige Verträge mit der „Ueberland-Zentrale<br />
Helmstedt AG“ (ÜZH) führten 1913 zum Erwerb des gesamten<br />
ÜZH-Aktienkapitals durch die BKB. 1928 Erwerb der Kuxe der<br />
Jacobsgrube bei Stassfurt. Zunächst als Pächterin betrieben<br />
die BKB auch die Gruben- und Brikettfabrikbetriebe der Harbker<br />
Kohlenwerke AG und der Norddeutschen Braunkohlenwerke;<br />
1936 wurden diese Gesellschaften auf die BKB verschmolzen.<br />
Mitten durch diese Grubenfelder hindurch ging nach 1945<br />
die Zonengrenze und führte später zu so kuriosen Dingen wie<br />
einer zwischenstaatlichen deutsch-deutschen Vereinbarung über<br />
den Abbau der “Grenzpfeilerkohle”. 1954 wurde das Kraftwerk<br />
Offleben in Betrieb genommen und immer weiter ausgebaut,<br />
ab 1963 der Tagebau Alversdorf aufgeschlossen, stillgelegt<br />
wurden die Tagebaue Wulfersdorf und Victoria (1952), die<br />
Brikettfabrik Trendelbusch (1959), das Schwelwerk Offleben<br />
(1967) und die Ziegelei Alversdorf (1968). In eine existenzbedrohende<br />
Krise geriet das Unternehmen in den 80er Jahren<br />
durch die Auseinandersetzungen um das neue Kraftwerk<br />
Buschhaus. Heute ist das Auslaufen der Braunkohleförderung<br />
absehbar, statt dessen suchen die BKB neben der Stromversorgung<br />
neue Standbeine in der Entsorgungswirtschaft (Müllverbrennung)<br />
etc. Aufgrund historisch gewachsener Strukturen<br />
lagen jahrzehntelang je 49,86 % des Kapitals bei der PreußenElektra<br />
(später VEBA) und der Elektrowerke AG (später VI-<br />
AG). Heute ist die e.on AG Alleinaktionärin, nachdem die letzte<br />
Handvoll freier Aktionäre 2002 per squeeze-out herausgedrängt<br />
wurde.<br />
Los 269 Schätzwert 50-125 €<br />
Bremen-Besigheimer Oelfabriken<br />
Bremen, Aktie 100 RM Dez. 1940<br />
(Auflage 500, R 5) EF<br />
Gründung 1889 unter der Firma Oelfabrik Besigheim vorm. Fr.<br />
Kollmar in Besigheim, ab 1895 Bremen-Besigheimer Oelfabriken<br />
AG. Die Fabrikanlage befand sich in Bremen am Holz- und<br />
Fabrikhafen, Zweigniederlassung in Harburg-Wilhelmsburg.<br />
1929 I.-G.-Vertrag mit der F. Thörl’s Vereinigte Harburger Oelfabriken<br />
AG, Hamburg-Harburg. 1937 Beteiligung an dem im<br />
Rahmen des Vierjahresplanes gegründeten “Oelmühlen-Walfang-Konsortium”<br />
zur Ausübung des Walfanges und Verarbeitung<br />
der gewonnenen Produkte. 1954 Verschmelzung mit der<br />
Schwesterfirma F. Thörl’s Vereinigte Harburger Oelfabriken AG.<br />
1959 Übertragung des Vermögens unter Ausschluss der Abwicklung<br />
auf die Hauptgesellschafterin „Margarine-Union<br />
<strong>GmbH</strong>“ in Hamburg. Die AG erlosch.<br />
Los 270 Schätzwert 20-60 €<br />
Bremer Strassenbahn<br />
Bremen, Actie 1.000 Mark 8.7.1899<br />
(Auflage 2500, R 2) EF-VF<br />
Ausgegeben an die „Tramway`s Union Company<br />
Ltd., London“ zwecks Übernahme der Großen Bremer<br />
Pferdebahn. Sehr dekorative Jugendstil-Umrahmung<br />
mit geflügelten Rädern.<br />
Eröffnung der Bremer Pferdebahn 1876, elektrischer Betrieb<br />
ab 1.5.1892. Normalspurige Strecken von zusammen 67 km<br />
Länge. Noch heute als Bremer Strassenbahn AG börsennotiert.<br />
Die M/S Moltkefels der <strong>Deutsche</strong>n Dampfschifffahrtsgesellschaft „Hansa“<br />
gebaut von der Bremer Vulkan Schiffbau & Maschinenfabrik unter der Bau-Nr. 747<br />
Los 271 Schätzwert 25-100 €<br />
Bremer Strassenbahn<br />
Bremen, Aktie 1.000 Mark 15.12.1904<br />
(Auflage 1100, R 3) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriger Titel.<br />
Los 272 Schätzwert 400-625 €<br />
Bremer Vulkan<br />
Schiffbau und Maschinenfabrik<br />
Grohn, Actie 1.000 Mark April 1897<br />
(Auflage 500, R 8) VF+<br />
Gründung 1893 unter Übernahme der Fa. Johann Lange in Grohn<br />
bei Vegesack. 1898 Verlegung der Werft auf ein 33 ha großes Gelände<br />
am rechten Weserufer in den Bezirken Vegesack und Fähr-<br />
Lobbendorf mit 1,3 km Wasserfront. Bis zur Jahrhundertwende erfolgte<br />
fast jedes Jahr eine Kapitalerhöhung - zunächst ohne großen<br />
Effekt, doch später wurden Dividenden bis zu 20 % verdient. Der<br />
Glanz verblaßte in der Werftenkrise der 1970er Jahre: Zuletzt wurde<br />
der Bremer Vulkan das Instrument der Werftenpolitik des Bremer<br />
Senats unter der hochqualifizierten Führung eines vormaligen<br />
Senatsdirektor als Vorstandsvorsitzendem - trotzdem (oder gerade<br />
deswegen?) ein krachender Zusammenbruch mit Milliardenverlusten.<br />
Auch die immensen Fördergelder für die nach der Wende zusätzlich<br />
noch übernommenen ostdeutschen Werften wurden in<br />
Bremen noch “verzockt”, ehe man das Schiff sinken ließ.<br />
Los 273 Schätzwert 200-375 €<br />
Bremer Vulkan<br />
Schiffbau und Maschinenfabrik<br />
Vegesack, Actie 1.000 Mark 29.12.1905<br />
(Auflage 1500, R 6) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 274 Schätzwert 10-50 €<br />
Bremer Woll-Kämmerei<br />
Bremen / Blumenthal, Aktie 1.000 Mark<br />
27.3.1920 (Auflage 3400, R 2) EF<br />
Gründung 1883. Werk in Bremen-Blumenthal, außerdem 1932<br />
Übernahme einer 45-%-Beteiligung bei der Gründung der<br />
Hamburger Wollkämmerei <strong>GmbH</strong> in Hamburg-Wilhelmsburg.<br />
Das Werk erlitt so gut wie keine Kriegsschäden, wurde allerdings<br />
nach dem Einmarsch der Alliierten größtenteils von der<br />
US-Besatzung genutzt und erst im März 1947 wieder freigegeben.<br />
Nachdem im Laufe der Jahrzehnte alle deutschen Konkurrenten<br />
(Nordwolle, Bremer Wollwäscherei, Kämmerei Döh-<br />
ren) aufgeben mussten, ist die noch heute börsennotierte Bremer<br />
Woll-Kämmerei das größe Unternehmen seiner Branche in<br />
ganz Europa. Kürzlich auch erhebliche Investitionen in Australien,<br />
mit denen man den Woll-Erzeugern räumlich näherrückte<br />
- im Gegenzug beteiligte sich ein australischer Wollkonzern mit<br />
einem größeren Anteil an der Bremer Wolle.<br />
Los 275 Schätzwert 50-125 €<br />
Bremisch-Hannoversche Kleinbahn<br />
Frankfurt a.M., Aktie 1.000 Mark<br />
28.2.1899. Gründeraktie (Auflage 1750,<br />
R 4) EF<br />
Originalunterschriften. Mit Flügelrad im Unterdruck.<br />
Nr. 272 Nr. 286<br />
Gründung 1898 als Bremisch-Hannoversche Kleinbahn, 1958<br />
Umfirmierung in Bremisch-Hannoversche Eisenbahn-AG.<br />
Strecken: Huchting-Thedinghausen (26 km Normalspur, ab<br />
1955 nur noch Güterverkehr) und Bremen-Tarmstedt (26 km<br />
Schmalspur, 1954/56 stillgelegt und abgebrochen, Ersatz<br />
durch die Kraftomnibuslinie Bremen-Tarmstedt-Zeven). Betriebsführung<br />
durch die <strong>Deutsche</strong> Eisenbahn-Ges. (später A-<br />
GIV). Eine der letzten noch börsennotiert gewesenen Privatbahnen,<br />
2001 nach Übernahme der Aktienmehrheit durch die<br />
WCM in BHE Beteiliungs-AG umfirmiert.<br />
Los 276 Schätzwert 400-500 €<br />
Breslauer Actien-Malzfabrik<br />
Breslau, Aktie 300 RM Dez. 1933 (Auflage<br />
240, R 10) VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, von den nur drei<br />
im Reichsbankschatz gefundenen Stücken ist dies<br />
das letzte verfügbare.<br />
Gründung 1872 zwecks Erwerb und Fortführung der Malzfabrik<br />
von Theodor Gaebel (Alte Sandstr. 11). 1891 wurde eine große<br />
neue Mälzerei an der Hundsfelder Chaussee errichtet.<br />
1906/07 Aufnahme der Malzkaffeefabrikation. 1926 erwarb im<br />
Zuge einer Kapitalerhöhung die Kathreiners Malzkaffee-Fabriken<br />
<strong>GmbH</strong> in Berlin eine Schachtelbeteiligung. Zuletzt befand<br />
sich das Aktienkapital (Börsennotiz in Breslau 1934/35 eingestellt)<br />
fast vollständig im Besitz der Berliner Schultheiss-Brauerei,<br />
die den Breslauer Betrieb als Lohnmälzerei ausschließlich<br />
für den eigenen Bedarf führte.<br />
Los 277 Schätzwert 75-150 €<br />
Breslauer Hallenschwimmbad AG<br />
Breslau, Aktie 500 RM 22.5.1943<br />
(Auflage unter 100 Stück, R 8) EF<br />
Gründung 1895 als gemeinnütziges Unternehmen zum Bau<br />
und Betrieb eines Hallenschwimmbades. Mit seinem Hallenschwimmbad<br />
an der Zwingerstr. 10/12 (ul. Teatralna 10-12)<br />
besaß Breslau eines der schönsten und stilvollsten Hallenbäder<br />
Deutschland, im reinsten Jugendstil erbaut zwischen 1895 und<br />
1897. Das Schwimmbad hat den Festungskampf 1945 nahezu<br />
schadlos überdauert und ist inzwischen stilvoll renoviert<br />
worden.<br />
Los 278 Schätzwert 75-150 €<br />
Brieger Stadtbrauerei AG<br />
Brieg, Aktie 1.000 Mark 19.6.1895.<br />
Gründeraktie (Auflage 1100, R 5) EF-VF<br />
Gründung 1895 zwecks Übernahme der Brieger Aktien-Dampfbrauerei<br />
Thiel, Güttler & Co. 1897 Kapazitätsverdoppelung<br />
durch Errichtung einer völlig neuen Brauerei in Tichau/Oberschlesien.<br />
1920 Umfirmierung in „Bürgerliches Brauhaus AG“<br />
und Sitzverlegung nach Tichau.<br />
27
Los 279 Schätzwert 75-150 €<br />
Bronzefarbenwerke AG<br />
vorm. Carl Schlenk<br />
Barnsdorf bei Nürnberg, Aktie 1.000 RM<br />
30.3.1939 (Auflage 460, R 6) EF<br />
Gründung 1879, AG seit 1897. Sitz der Gesellschaft bis 1907<br />
in Roth, dann in Barnstorf bei Nürnberg. Herstellung von Metallpulvern,<br />
Metallfolien, Christbaumschmuck. 1957 Carl-<br />
Schlenk-AG. Heute Zulieferer der weiterverarbeitenden Industrie<br />
mit Aluminium- und Goldbronzepulver, Pasten, Granulaten<br />
und Suspensionen, Metallfolien.<br />
Los 280 Schätzwert 50-125 €<br />
Brunsviga-Maschinenwerke<br />
Grimme, Natalis & Co. AG<br />
Braunschweig, Aktie 1.000 RM Juni 1939<br />
(Auflage 560, R 4) EF<br />
Gegründet 1871 als KGaA , AG seit 1921. Die Firma lautete bis<br />
1927 Grimme, Natalis und Co. AG. Zweck: Herstellung von Maschinen<br />
und Apparaten oder Teilen derselben und der Handel<br />
damit. Erzeugnisse waren die noch heute bekannten Rechenund<br />
Addiermaschinen “Brunsviga”. Im Jan. 1959 erfolgte die<br />
Umwandlung auf die Olympia Werke AG.<br />
Los 281 Schätzwert 75-150 €<br />
Bülow-Haus-Verwaltung AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 15.10.1922.<br />
Gründeraktie (Auflage 300, R 5) EF<br />
Gründung 1922 zur Verwaltung, Verwertung und zum Betrieb<br />
des Hauses Plauensche Strasse 13 in Leipzig. Vorstand 1933<br />
28<br />
Nr. 278<br />
Nr. 276<br />
war Abraham Assuschkewitz. Bis 1936 lautete die Firma Bülowhausverwaltung<br />
AG, danach Gebr. Assuschkewitz AG. 1940<br />
wurde Mitteilung nach § 83 Akt.-Gesetz gemacht (Verlust hat<br />
die Hälfte des Grundkapitals überschritten).<br />
Los 282 Schätzwert 75-125 €<br />
Gebr. Assuschkewitz AG<br />
Leipzig, Aktie 10.000 RM 15.11.1924<br />
(Auflage 500, R 7) EF-VF<br />
Datum überstempelt mit 1.2.1938, Nennwert herabgesetzt<br />
auf 500 RM.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 283 Schätzwert 150-250 €<br />
Bürgerliches Brauhaus<br />
Bonn, Aktie 1.000 Mark 30.9.1905<br />
(Auflage 400, R 8) VF+<br />
Die Ges. wurde mit einem Kapital von 1,6 Mio.<br />
Mark gegründet, eingeteilt in 1.600 Aktien à<br />
1.000 Mark. Das Aktienkapital wurde zwar voll<br />
passiviert, ausgegeben waren jedoch nur 1.200<br />
Aktien, da nicht mehr Kapital benötigt wurde. Für<br />
400.000 Mark gab es Interimsscheine, die zunächst<br />
mit 25 % eingezahlt wurden. Erst als diese<br />
Aktien voll bezahlt wurden, erfolgte der Druck von<br />
Aktien mit dem Datum von 1905, nummeriert zwischen<br />
1201 und 1600.<br />
In der 1897 gegründeten AG gingen die Brauerei zum Bären<br />
Franz Josef Gervers Nachf., die Adler-Brauerei Otto Wolter und<br />
die Brauerei Herm. Aug. Wirts auf. Die Braustätte lag in der<br />
Bornheimer Straße 42. 1950 Umfirmierung in Kurfürsten-Bräu<br />
AG. Nach und nach erwarb die Dortmunder Union-Brauerei über<br />
98 % der Aktien. 1990 im Großaktionär Brau und Brunnen<br />
AG aufgegangen und noch für ganz kurze Zeit unter dem alten<br />
Namen als Grundstücksgesellschaft fortgeführt.<br />
Los 284 Schätzwert 25-100 €<br />
Bürgerliches Brauhaus AG<br />
Insterburg, Aktie 100 RM März 1929<br />
(Auflage 4400, R 3) EF<br />
Gründung 1895. Übernommen wurden weiterhin die örtlichen<br />
Konkurrenten <strong>Deutsche</strong>s Brauhaus Bruhn & Froese (1917) und<br />
AG Böhmisches Brauhaus vorm. J. H. Bernecker (1918). Spezialitäten:<br />
Doppelpils, Schloßbräu und Insterburger Münchner.<br />
Gehörte zuletzt zum Rückforth-Konzern, Börsennotiz Königsberg,<br />
ab 1935 Berlin.<br />
Los 285 Schätzwert 50-125 €<br />
Bürgerliches Brauhaus AG<br />
Insterburg, Aktie 1.000 RM 28.2.1942<br />
(Auflage 900, R 4) EF<br />
Ansicht des Verwaltungsgebäudes der<br />
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg AG<br />
Los 286 Schätzwert 500-625 €<br />
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg AG<br />
Ravensburg, Aktie 5.000 Mark Sept. 1923<br />
(Auflage 800, R 10) VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, von den nur vier<br />
im Reichsbankschatz gefundenen Stücken ist dies<br />
nun das letzte noch verfügbare.<br />
Gründung 1903 zum Erwerb und Fortbetrieb der früher im Besitz<br />
der Firma Mogger & Ruile in Ravensburg befindlich gewesenen<br />
Bierbrauerei. Hinzuerworben wurden die Brauerei des<br />
Johann Schuler (1904), die Brauerei nebst Mälzerei „Zur Räuberhöhle“<br />
in Ravensburg (1907), die Bergbrauerei bei Friedrichshafen<br />
(1909), die Brauerei “Zum Schützen” in Meersburg<br />
(1927) und die Gambrinusbrauerei in Weingarten (1930). Vom<br />
Mehrheitsaktionär Inselbrauerei Lindau AG wurde 1972 deren<br />
Brauereibetrieb übernommen, zugleich Umfirmierung in “Bürgerliches<br />
Brauhaus Ravensburg-Lindau AG”. Die noch heute<br />
börsennotierte AG machte bis zur Stilllegung der Brauerei Ende<br />
2000 mit ca. 70 Mitarbeitern rd. 10 Mio. € Jahresumsatz,<br />
davon fast 1/3 aus Vermietung und Verpachtung. Heute werden<br />
die meisten Umsätze mit der Aufstellung von Geldspiel- und<br />
Unterhaltungsgeräten sowie dem Betrieb von Spielhallen erzielt.<br />
Los 287 Schätzwert 30-60 €<br />
Büttner-Werke AG<br />
Uerdingen am Rhein, Aktie 100 RM Juli<br />
1929 (Auflage 5500, R 4) EF<br />
Gründung 1874 als „Rheinische Dampfkessel- und Maschinenfabrik<br />
Büttner <strong>GmbH</strong>“, AG unter obigem Namen seit 1920.<br />
Herstellung von Maschinen und Anlagen zum Trocknen, Kühlen,<br />
Zerkleinern, Sichten, Mischen und Entstauben. 1929 Ab-<br />
Nr. 293<br />
tretung des Dampfkesselbaus an L. & C. Steinmüller in Gummersbach.<br />
Börsennotiz: Berlin und Freiverkehr Düsseldorf.<br />
1969 verschmolzen auf die Büttner-Schilde-Haas AG (BSH).<br />
Umfirmiert 1977 in BABCOCK-BSH AG, 1995 Umwandlung in<br />
die BABCOCK-BSH <strong>GmbH</strong>. Nach dem Zusammenbruch des<br />
Babcock-Konzerns 2002 übernommen durch die Firma Grenzebach,<br />
danach Grenzebach BSH <strong>GmbH</strong>, Bad Hersfeld.<br />
Los 288 Schätzwert 20-60 €<br />
Busch-Jaeger<br />
Lüdenscheider Metallwerke AG<br />
Lüdenscheid, Aktie 1.000 RM Nov. 1936<br />
(Auflage 1000, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1911 als F. W. Busch AG unter Übernahme der seit<br />
1892 betriebenen Busch’schen Fabrik. 1926 Fusion mit der<br />
Gebr. Jaeger in Schalksmühle zur “Vereinigte elektrotechnische<br />
Fabriken F.W. Busch und Gebr. Jaeger AG”. 1932 Fusion mit<br />
der Lüdenscheider Metallwerke AG vorm. Jul. Fischer & Basse<br />
zur “Busch-Jaeger Lüdenscheider Metallwerke AG”. Neben Elektro-Installationsmaterial<br />
aller Art (Werke Lüdenscheid und<br />
Schalksmühle i.W.) auch (im Werk Aue i.W.) Herstellung von<br />
Porzellan für technische Zwecke und von Kunstharz-Erzeugnissen.1953<br />
mit der Dürener Metallwerke AG (gegr. 1885 als “Dürener<br />
Phosphorbronce-Fabrik & Metallgießerei Hupertz et Banning”,<br />
AG seit 1901) zur “Busch-Jaeger Dürener Metallwerke<br />
AG” fusionert. Neben der Rheinmetall-Borsig AG war jahrzehntelang<br />
der Industrielle Günther Quandt beteiligt (zuletzt über die<br />
Altana). 1974 wurden die inzwischen in Tochter-<strong>GmbH</strong>’s eingebrachten<br />
Metallwerke in Lüdenscheid und Düren veräußert und<br />
die Ges. in Busch-Jaeger Gesellschaft für Industriebeteiligungen<br />
AG umbenannt (als Zwischenholding u.a. für die Beteiligungen<br />
an der Milupa AG, der Byk Gulden Lomberg Chem. Fabrik<br />
<strong>GmbH</strong> und der Mouson Cosmetic <strong>GmbH</strong>). Gleichzeitig Sitzverlegung<br />
nach Frankfurt/M. und in die VARTA AG (ab 1977 in<br />
die Altana) eingegliedert.<br />
Los 289 Schätzwert 75-100 €<br />
Buttella-Werk AG<br />
Hannover, Aktie 1.000 Mark 24.6.1923<br />
(Auflage 6000, R 10) EF<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1921. Herstellung von Pflanzenbutter und anderen<br />
Margarinefabrikaten (die Fabrik war in der Dreyerstr. 8-10). Bereits<br />
1924 wieder in Konkurs gegangen.