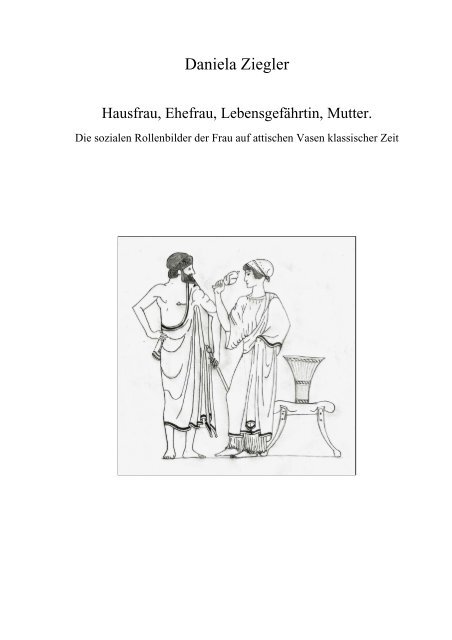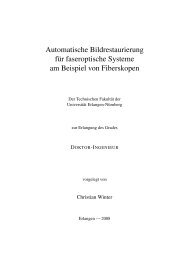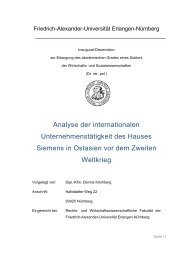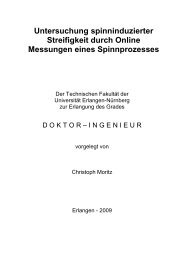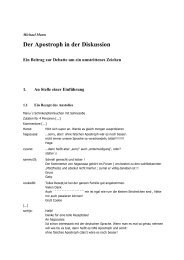Daniela Ziegler - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Daniela Ziegler - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Daniela Ziegler - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Daniela</strong> <strong>Ziegler</strong><br />
Hausfrau, Ehefrau, Lebensgefährtin, Mutter.<br />
Die sozialen Rollenbilder der Frau auf attischen Vasen klassischer Zeit
Hausfrau, Ehefrau, Lebensgefährtin, Mutter.<br />
Die sozialen Rollenbilder der Frau auf attischen Vasen klassischer Zeit<br />
Inaugural-Dissertation<br />
in der Philosophischen Fakultät I<br />
(Philosophie, Geschichte und Sozialwissenschaften)<br />
der <strong>Friedrich</strong>-<strong>Alexander</strong>-<strong>Universität</strong><br />
<strong>Erlangen</strong>-<strong>Nürnberg</strong><br />
vorgelegt von<br />
<strong>Daniela</strong> S. <strong>Ziegler</strong><br />
aus<br />
Neuendettelsau
Tag der mündlichen Prüfung: 23.02.2007<br />
Dekan: Prof. Dr. R. Sturm<br />
Erstgutachter: Prof. Dr. P. Kranz<br />
Zweitgutachter: PD Dr. U. Kreilinger
Danksagung<br />
Mein nachdrücklicher Dank gilt Prof. Dr. Peter Kranz und PD Dr. Ulla Kreilinger, dafür dass sie mich<br />
an dieses Thema herangeführt haben. Sie haben mich in zahllosen Gesprächen hinterfragt und meinen<br />
eigenen Gedanken immer wieder neue Ansätze hinzugefügt. Für Ihre Geduld und Ihr Vertrauen<br />
während der Überarbeitungsphase sei Ihnen herzlich gedankt.<br />
Gerne erinnere ich mich auch der vielen Kommilitonen und Kommilitoninnen im Erlanger Institut. Ihr<br />
habt all diese Jahre zu etwas ganz Besonderem gemacht und ich werde Euch nie vergessen.<br />
Ein ganz großes Dankeschön gilt meiner Familie und vor allem meinen Eltern, die mich ohne<br />
Kompromisse unterstützt haben.<br />
Von der Abgabe bis zur Publikation dieser Dissertation sind lange vier Jahre ins Land gegangen und<br />
ich muss gestehen, dass ich zwischenzeitlich selbst daran gezweifelt habe, ob sie jemals veröffentlicht<br />
wird. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran haben deshalb – neben oben genannten Personen, all<br />
die Personen, die mit harmlos klingenden Fragen wie „Und wie weit bist du mit deiner Diss?“ mein<br />
Gewissen traktiert haben. Ihr bekommt alle ein Geschenkexemplar!<br />
Die Umzeichnung der Schale aus Hannover, die das Titelblatt schmückt, verdanke ich M. Glasner, der<br />
mit seinem unglaublichen zeichnerischen Talent mal eben so ein kleines Kunstwerk geschaffen hat.
Inhaltsverzeichnis<br />
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................................ 8<br />
Einleitung ............................................................................................................................................... 11<br />
1. Die Braut ............................................................................................................................................ 15<br />
1. 1. Das Heiratsalter ..............................................................................................................................15<br />
1. 2. Der Zweck der Ehe .........................................................................................................................17<br />
1. 3. Die Wahl des Partners ....................................................................................................................18<br />
1. 4. Die Hochzeitsfeierlichkeiten ..........................................................................................................20<br />
1. 5. Die Hochzeit in der Bildkunst der attisch rotfigurigen Keramik ...................................................21<br />
1. 5. 1. Hochzeitsprozessionen ...............................................................................................................21<br />
1. 5. 2. Die Schmückung der Braut ........................................................................................................22<br />
1. 5. 3. Die hochzeitliche Ikonographie..................................................................................................23<br />
2. Die Frau in der Familie: Hausfrau, Ehefrau und Mutter .................................................................... 27<br />
2. 1. Vorstellungen zur Ehe in den antiken Schriftquellen .....................................................................27<br />
2. 1. 1. Die Ehe aus Sicht des Mannes ...................................................................................................27<br />
2. 1. 2. Die ideale Ehefrau ......................................................................................................................28<br />
2. 1. 3. Die Ehe aus Sicht der Frau .........................................................................................................31<br />
2. 1. 4. Der ideale Ehemann ...................................................................................................................33<br />
2. 1. 5. Zusammenfassung ......................................................................................................................37<br />
2. 2. Die ideale Haus- und Ehefrau in Xenophons „Oikonomikos“ .......................................................39<br />
2. 3. Die Bewegungsfreiheit der verheirateten Frau ...............................................................................42<br />
2. 3. 1. Geschlechterspezifische Lebensräume .......................................................................................44<br />
2. 3. 2. Sittliches Verhalten ....................................................................................................................46<br />
2. 3. 3. Zwischengeschlechtliche Kontakte ............................................................................................50<br />
2. 4. Das Haus. Räumliche Gestaltung und Organisation ......................................................................52<br />
2. 4. 1. Die Quellen ................................................................................................................................52<br />
2. 4. 1. 1. Xenophon: Das Haus des Ischomachos ..................................................................................52<br />
2. 4. 1. 2. Lysias: Das Haus des Euphiletos............................................................................................53<br />
2. 4. 1. 3. Vereinzelte Textstellen zur antiken Wohnkultur ....................................................................55<br />
2. 4. 2. Der archäologische Befund: Pastas- und Single-Entrance-Courtyard-House ...........................57<br />
2. 4. 2. 1. Olynth .....................................................................................................................................58<br />
2. 4. 2. 2. Piraeus ....................................................................................................................................58<br />
2. 4. 2. 3. Athen ......................................................................................................................................59<br />
2. 4. 2. 4. Der Bau Z im Kerameikos .....................................................................................................60<br />
2. 4. 3. Das Sozialleben im Oikos ..........................................................................................................62<br />
2. 5. Der Oikos in der Bildkunst der attisch rotfigurigen Keramik ........................................................68<br />
2. 5. 1. Der Mann im Frauengemach ......................................................................................................69<br />
2. 5. 2. Familienbilder ............................................................................................................................70<br />
2. 5. 3. Der Mann im Oikos ....................................................................................................................80<br />
S e i t e | 5
2. 5. 4. Paardarstellungen ...................................................................................................................... 83<br />
2. 6. Zusammenfassung ......................................................................................................................... 88<br />
3. Werben und Schenken in der Antike ................................................................................................. 92<br />
3. 1. Liebes- und Werbegeschenke ........................................................................................................ 92<br />
3. 2. Die Werbeszenen auf den attisch-rotfigurigen Vasen und ihre Ikonographie ............................... 96<br />
3. 3. Werbe- oder Oikosszenen? ............................................................................................................ 98<br />
3. 3. 1. Kränze, Bänder, Kästchen und Co. ............................................................................................ 98<br />
3. 3. 2. Fleisch...................................................................................................................................... 103<br />
3. 3. 3. Tiere ......................................................................................................................................... 105<br />
3. 4. Werben mit Geld ......................................................................................................................... 107<br />
3. 4. 1. Der Geldbeutel als Instrument der Werbung? ......................................................................... 110<br />
3. 4. 1. 1. Textilarbeit und Geld ........................................................................................................... 112<br />
3. 4. 1. 2. Die 'spinnende Hetäre' ......................................................................................................... 117<br />
3. 4. 1. 3. Die Semiotik des Spinnens .................................................................................................. 119<br />
3. 4. 2. Geldbeutelsszenen ohne Textilkontext .................................................................................... 122<br />
3. 4. 3. Der Geldbeutel in weiblicher Hand – ein antikes Paradoxon? ................................................ 127<br />
3. 5. Zusammenfassung ....................................................................................................................... 129<br />
4. Die Ehefrau als Sexualpartnerin und Gefährtin ............................................................................... 132<br />
4. 1. Sexualsymbole und Sexualerziehung in der athenischen Gesellschaft ....................................... 133<br />
4. 2. Die Ehefrau, das asexuelle Wesen ............................................................................................... 137<br />
4. 2. 1. Zwischen Ehefrauen, Hetären und schönen Knaben ............................................................... 138<br />
4. 2. 2. Die Antithese Ehefrau – Hetäre in den schriftlichen Quellen ................................................. 140<br />
4. 2. 3. Das Verhältnis der Ehepartner ................................................................................................. 143<br />
4. 2. 4. Das Verhältnis von Liebhaber und Hetäre............................................................................... 145<br />
4. 3. Der Geschlechtsverkehr ............................................................................................................... 148<br />
4. 3. 1. Eheliche Sexualität in den Schriftquellen ................................................................................ 149<br />
4. 3. 2. Sexzoten in der aristophanischen Komödie ............................................................................. 154<br />
4. 3. 2. 1. Die „Ekklesiazusen“ ............................................................................................................ 155<br />
4. 3. 2. 2. Die „Thesmophoriazusen“ ................................................................................................... 157<br />
4. 3. 2. 3. Die „Lysistrate“ ................................................................................................................... 158<br />
4. 4. Sexualität und Intimität in der Bildkunst der attisch-rotfigurigen Keramik ................................ 160<br />
4. 4. 1. Szenen der Verbundenheit und Annäherung ........................................................................... 160<br />
4. 4. 1. 1. Cheir epi karpo und dexiosis ............................................................................................... 161<br />
4. 4. 1. 2. Die Hand auf der Schulter ................................................................................................... 162<br />
4. 4. 1. 3. Umarmungen ....................................................................................................................... 163<br />
4. 4. 1. 4. Küsse ................................................................................................................................... 166<br />
4. 4. 1. 5. Das An- bzw. Entkleiden ..................................................................................................... 167<br />
4. 4. 2. Die Kline und der Geschlechtsakt ........................................................................................... 169<br />
4. 4. 2. 1. Sexualität im hochzeitlichen Kontext .................................................................................. 169<br />
4. 4. 2. 2. Die Kline in nicht-hochzeitlichen Darstellungen ................................................................ 171<br />
4. 4. 2. 3. Das (Ehe-?) Paar im Thalamos ............................................................................................ 172<br />
4. 4. 2. 4. Die Hochzeitskline in mythischen Bildern .......................................................................... 174<br />
S e i t e | 6
4. 4. 3. Unzensierte Sexualität ..............................................................................................................175<br />
4. 4. 4. Zusammenfassung ....................................................................................................................177<br />
5. Zur Figur des Eros ............................................................................................................................ 180<br />
5. 1. Eros im literarischen Diskurs .......................................................................................................181<br />
5. 2. Eros in der Bildkunst der attisch-rotfigurigen Keramik ...............................................................184<br />
5. 2. 1. Eros in den Hochzeitsbildern ...................................................................................................188<br />
5. 2. 2. Eros in den Oikosszenen ..........................................................................................................191<br />
5. 2. 3. Eros und der Mann im Oikos ...................................................................................................192<br />
5. 2. 4. Der musische Eros und der Oikos ............................................................................................195<br />
5. 3. Die chronologische Entwicklung des Eros-Motivs ......................................................................198<br />
5. 4. Zusammenfassung ........................................................................................................................202<br />
6. Zusammenfassung der Ergebnisse ................................................................................................... 204<br />
Katalog ................................................................................................................................................. 213<br />
Abbildungsnachweis ............................................................................................................................ 232<br />
Literaturliste ......................................................................................................................................... 238<br />
Tafeln<br />
S e i t e | 7
S e i t e | 8<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
Abkürzungsverzeichnis der häufiger zitierten Literatur:<br />
BADINOU 2003 P. Badinou, La laine et le parfum. Épinetra et alabastres. Forme,<br />
iconographie et fonction. Recherche de céramique attique féminine<br />
(Louvain 2003).<br />
BUNDRICK 2008 S. D. Bundrick, The Fabrik of the City. Imaging Textile Production<br />
in Classical Athens, Hesperia 77, 2008, 283–334.<br />
CAHILL 2003 N. Cahill, Household and City Organization at Olynthus (New<br />
Haven 2002).<br />
CALAME 1992 C. Calame, I Greci e l´Eros. Simboli, pratiche e luoghi (Rom 1992).<br />
DAVIDSON 1999 J. N. Davidson, Kurtisanen und Meeresfrüchte. Die verzehrenden<br />
Leidenschaften im klassischen Athen (Darmstadt 1999).<br />
DIERICHS 1993 A. Dierichs, Erotik in der Kunst Griechenlands (Mainz 1993).<br />
FANTHAM 1994 E. Fantham – H. P. Foley – N. Boymel Kampen – S. B. Pomeroy –<br />
H. A. Shapiro (Hrsg.), Women in the Classical World. Image and<br />
Text (New York 1994).<br />
FISCHER – MORAW 2005 G. Fischer – S. Moraw (Hrsg.), Die andere Seite der Klassik.<br />
Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Kulturgeschichtliches<br />
Kolloquium Bonn 11.–13.7.2002 (Stuttgart 2005).<br />
GÖTTE 1957 E. Götte, Frauengemachbilder in den Vasenbildern des 5. Jhs. (Diss.<br />
Ludwig-Maximilians-<strong>Universität</strong> München 1957).<br />
HARTMANN 2002 E. Hartmann, Heirat, Hetärentum und Konkubinat im klassischen<br />
Athen (Frankfurt a. M. 2002).<br />
HEINRICH 2006 F. Heinrich, Das Epinetron. Aspekte der weiblichen Lebenswelt im<br />
Spiegel eines Arbeitsgeräts (Rahden 2006).<br />
HOEPFNER 1999 W. Hoepfner (Hrsg.), Geschichte des Wohnens 1. 5000 v. Chr.–500<br />
v. Chr.: Vorgeschichte, Frühgeschichte, Antike (Stuttgart 1999).<br />
JUST 1989 R. Just, Women in Athenian Law and Life (London 1989).<br />
KEULS 1985 E. C. Keuls, The Reign of the Phallus. Sexual Politics in Ancient<br />
Athens (New York 1985).<br />
KILLET 1994 H. Killet, Zur Ikonographie der Frau auf attischen Vasen<br />
archaischer und klassischer Zeit (Berlin 1994).<br />
KNIGGE 2005 U. Knigge, Der Bau Z, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen<br />
17 (München 2005).<br />
KILMER 1993 M. F. Kilmer, Greek Erotica on Attic Red-Figure Vases (London<br />
1993).<br />
KREILINGER 2007 U. Kreilinger, Anständige Nacktheit. Körperpflege, Reinigungsriten<br />
und das Phänomen weiblicher Nacktheit im klassischen Athen.<br />
Tübinger Archäologische Forschungen 2 (Tübingen 2007).<br />
KUNISCH 1997 N. Kunisch, Makron (Mainz 1997).<br />
LACEY 1983 W. K. Lacey, Die Familie im antiken Griechenland (Mainz 1983).<br />
LEWIS 2002 S. Lewis, The Athenian Woman. An Iconographic Handbook<br />
(London 2002).
LLEWELLYN-JONES 2003 L. Llewellyn-Jones, Aphrodites Tortoise. The Veiled Woman of<br />
Ancient Greece (Swansea 2003).<br />
MEYER 1988 M. Meyer, Männer mit Geld, JdI 103, 1988, 87–125.<br />
MERCATI 2003 C. Mercati, Epinetron. Storia di una forma ceramica fra archeologia<br />
e cultura (Città di Castello 2003).<br />
MÖSCH-KLINGELE 2006 R. Mösch-Klingele, Die loutrophoros im Hochzeits- und<br />
Begräbnisritual des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Athen (Bern 2006).<br />
MOSSÉ 1983 C. Mossé, La femme dans la Grèce antique (Paris 1983).<br />
NEVETT 1995 L. C. Nevett, Gender Relations in the Classical Greek World, BSA<br />
90, 1995, 36–381.<br />
NEVETT 1999 L. C. Nevett, House and Society in the Ancient Greek World<br />
(Cambridge 1999).<br />
NEILS – OAKLEY 2003 J. Neils – J. H. Oakley (Hrsg.), Coming of Age in Ancient Greece.<br />
Images of Childhood from the Classical Past. Ausstellungskatalog<br />
Hanover (New Haven 2003).<br />
OAKLEY – SINOS 1993 J. H. Oakley – R. H. Sinos, The Wedding in Ancient Athens<br />
(Madison 1993).<br />
PATTERSON 1998 C. B. Patterson, The Family in Greek History (Cambridge 1998).<br />
PESCHEL 1987 I. Peschel, Die Hetäre bei Symposium und Komos in der attisch-<br />
rotfigurigen Malerei des 6.–4. Jhs. v. Chr. (Frankfurt a. M. 1987).<br />
POMEROY 1985 S. B. Pomeroy, Frauenleben im Klassischen Altertum (Stuttgart<br />
1985).<br />
POMEROY 1994 S. B. Pomeroy, Xenophon. Oeconomikus. A Social and Historical<br />
Commentary (Oxford 1994).<br />
REEDER 1995 E. D. Reeder (Hrsg.), Pandora. Frauen im klassischen Griechenland.<br />
Ausstellungskatalog Baltimore – Dallas – Basel (Baltimore 1995).<br />
REINSBERG 1993 C. Reinsberg, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken<br />
Griechenland ²(München 1993).<br />
REUTHNER 2005 R. Reuthner, Wer webte Athenes Gewänder? Die Arbeit von Frauen<br />
im antiken Griechenland (Frankfurt a. M. 2006).<br />
SCHNURR-REDFORD 1996 C. Schnurr-Redford, Frauen im klassischen Athen. Sozialer Raum<br />
und reale Bewegungsfreiheit (Berlin 1996).<br />
SOJC 2005 N. Sojc, Trauer auf attischen Grabreliefs. Frauendarstellung<br />
zwischen Ideal und Wirklichkeit (Berlin 2005).<br />
SUTTON 1981 R. F. Sutton Jr., The Interaction between Men and Women<br />
portrayed on Attic red-figured Pottery (Chapel Hill 1981).<br />
SUTTON 1997 R. F. Sutton Jr., Nuptial Eros: The Visual Discourse of Marriage in<br />
Classical Athens, JWaltersArtGal 55/56, 1997/98, 27–48.<br />
SUTTON 2004 R. F. Sutton Jr., The Oikos on Attic Red-Figure Pottery, in: A. P.<br />
Chapin (Hrsg.), Charis. Essays in Honor of Sara A. Immerwahr,<br />
Hesperia Suppl. 33 (Athen 2004) 327–350.<br />
TAAFFE 1993 L. K. Taaffe, Aristophanes and Women (London 1993).<br />
VAZAKI 2003 A. Vazaki, Mousike Gyne. Die musisch-literarische Erziehung und<br />
Bildung von Frauen im Athen der klassischen Zeit (Möhnesee<br />
2003).<br />
WIEMER 2005 H.- U. Wiemer, Die gute Ehefrau im Wandel der Zeiten. Von<br />
Xenophon zu Plutarch, Hermes 133, 2005, 424–446.<br />
S e i t e | 9
S e i t e | 10
Einleitung<br />
Über die Frau in der Antike ist besonders seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so viel<br />
geschrieben worden, dass sich dieses Thema regelrecht zu einem Modethema entwickelt hat. Mancher<br />
wird – quasi übersättigt – meinen, dass inzwischen alles gesagt sein dürfte, was es zu diesem Thema<br />
zu sagen gibt.<br />
Das Frauenbild vor allem der althistorischen Forschung wurde in den letzten zwanzig Jahren in vielen<br />
Punkten modifiziert, so dass eine Neubetrachtung des archäologischen Materials zum Thema „Frauen<br />
in der Antike“ gerechtfertigt, ja gar dringend notwendig erscheint. Insgesamt ist allerdings zu<br />
beobachten, dass die archäologischen Disziplinen sich den neuen Erkenntnissen der althistorischen<br />
Forschung nur zögernd öffnen. Die archäologische Forschung gab sich lange damit zufrieden, das<br />
etablierte, jedoch antiquierte Frauenbild oft einseitig herausgegriffener, antiker literarischer Quellen<br />
und ihre dezidierten Ansichten zum weiblichen Ideal zur Erklärung der Vasenbilder heranzuziehen<br />
und Eins zu Eins auf diese zu übertragen. Frauen waren jenen Idealvorstellungen gemäß im<br />
öffentlichen Leben unsichtbar, verbrachten die meiste Zeit im Haus, dem Hort ihrer Tugend und Ort<br />
ihrer Pflichten. In Erscheinung traten sie außerhalb der eigenen vier Wände nur bei besonderen<br />
Anlässen wie Hochzeiten, Todesfällen oder kultischen Feiern. Die Vasenmalerei scheint, da sie den<br />
Schwerpunkt der Frauenbilder auf die athenische Bürgerin als Braut, fleißige Hausfrau, Trauernde und<br />
als Kultteilnehmerin legt, diese Sichtweise zunächst weitgehend zu bestätigen. 1 Bilder umstrittener<br />
Deutung jedoch, die nicht zur herkömmlichen Vorstellung der idealen, griechischen Haus- und<br />
Ehefrau passen, werden bei der Rekonstruktion des Bürgerinnenbildes generell von der Betrachtung<br />
ausgeschlossen. Dies sind im Wesentlichen Paardarstellungen von Männern und Frauen, die keinen<br />
erkennbaren hochzeitlichen Kontext aufweisen. Sich auf einschlägige Quellenzitate stützend war es<br />
bequemer, all jene Bilder, in denen Frauen gemeinsam mit Männern abgebildet sind, als Darstellungen<br />
von Hetären zu deklarieren.<br />
Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag zum Themenkreis „Interaktion der Geschlechter“, der<br />
bereits zahlreiche Untersuchungen vorzuweisen hat. 2 Was meine Vorgehensweise allerdings von<br />
vielen anderen bisher erschienenen Veröffentlichungen unterscheidet, ist, dass ich von Beginn an<br />
gezielt das Sozialleben der Ehefrau und Bürgerin in den Mittelpunkt stelle. Besondere<br />
Aufmerksamkeit gilt dabei, wie bereits angedeutet, den Szenen, die diese in Interaktion mit der Welt<br />
der Männer treten lassen. Da die gesellschaftlichen Freiheiten, die einer Bürgerin erlaubt waren, eng<br />
definiert waren, kann es sich bei den betreffenden männlichen Personen eigentlich nur um Angehörige<br />
der Familie, zumeist wahrscheinlich um den eigenen Ehemann handeln.<br />
Das Verhältnis der Eheleute zueinander war bisher als kaum lohnenswerter Gegenstand der<br />
Untersuchung empfunden worden, so überwältigend war der Eindruck von der Dominanz des Mannes<br />
1 Lewis 2002, 58: “Women become visible in art only in certain roles, as brides, mothers, celebrants of religion, or the<br />
grotesquely aged.”<br />
2 z. B. T. Scheer, Forschungen über die Frau in der Antike. Ziele, Methoden, Perspektiven, Gymnasium 107, 2000, 143–<br />
172; für einen detaillierten, forschungsgeschichtlichen Überblick, s. auch Sutton 1981; Schnurr-Redford 1996, 13–56.<br />
S e i t e | 11
und der fehlenden Nähe zwischen den Ehepartnern. Vielerorts wirkt hier zudem noch die<br />
Überzeugung nach, das Alltagsleben der Griechen habe sich innerhalb geschlechtsspezifisch strikt<br />
definierter Bereiche abgespielt. Die Begegnung eines athenischen Bürgers mit einer Frau könne<br />
deshalb nur eine bestimmte Sorte von Frau meinen, die nicht dem gängigen Moralkodex der<br />
griechischen Gesellschaft unterworfen ist wie die Hetären oder Prostituierte im Allgemeinen. Wie<br />
unsinnig eine solche Auffassung ist, macht ein Blick auf die sog. Frauengemachsszenen der attischen<br />
Vasenmalerei deutlich. Jene wurden stets als Ausdruck gelebter Geschlechtertrennung verstanden,<br />
zeigen jedoch tatsächlich nicht ausschließlich das Leben der Frauen unter Geschlechtsgenossinnen. In<br />
einer Reihe von Vasenbildern mischen sich nämlich männliche Personen unter die Frauen. Für diese in<br />
der Forschung bisher als Freier bezeichneten Männer findet sich im Rahmen des griechischen<br />
Oikoslebens durchaus eine einleuchtende Erklärung. In diesem Zusammenhang spielt die Definition<br />
des Frauengemachs, der Gynaikonitis, eine entscheidende Rolle. Obwohl die Existenz der<br />
Gynaikonitis durch das Schrifttum belegt ist, ist dies auf archäologischem Gebiet bisher nicht<br />
gelungen. Um eine bessere Vorstellung vom Sozialleben im Oikos und von der Position der Ehe- und<br />
Hausfrau im Familien- und Oikosverband zu gewinnen, sollen unter Heranziehung archäologischer<br />
Befunde und schriftlicher Quellen Überlegungen zur Arbeits- und Rollenverteilung im athenischen<br />
Oikos angestellt werden, wobei auch die Frage der Geschlechterseparation anzusprechen sein wird.<br />
Die Untersuchung der Geschlechterrollen im Rahmen des Oikos stellt den Forscher vor eine weitere<br />
Schwierigkeit: die problematische Unterscheidung von Ehefrau und Hetäre in der antiken Bildkunst.<br />
So eindringlich manche Autoren auch votieren, eine Unterscheidung sei letztlich weder<br />
ikonographisch zu untermauern noch überhaupt beabsichtigt, 3 so möchte ich dennoch im Folgenden<br />
darauf hinweisen, dass eine soziale Einordnung der dargestellten weiblichen Figuren aus dem Kontext<br />
heraus oftmals möglich oder zumindest umgekehrt nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist.<br />
Trotz der erzielten Fortschritte der historischen Forschung ist das wesentliche<br />
Unterscheidungskriterium nach wie vor, ob die betreffende Frau gemeinschaftlich mit Frauen oder mit<br />
Männern abgebildet ist. Geblendet von normativen Eindrücken aus der Literatur, die man ohne<br />
Überlegung auf die Vasenbilder quasi als Illustrationen des griechischen Alltagslebens übertrug, hat<br />
man es als undenkbar erachtet, dass die zwischengeschlechtlichen Begegnungen einen nicht-sexuellen<br />
Hintergrund haben könnten. Besonders stark davon betroffen ist das Phänomen der sog. spinnenden<br />
Hetäre. Spinnerinnen wurden in Anwesenheit von Männern und vor allem dann, wenn sie wie z. B. auf<br />
einer Hydria in Heidelberg III/26 (Taf. 15 Abb. 2) oder auf einem Alabastron in Berlin III/24 (Taf. 14<br />
Abb. 6. 7) mit einem Geldbeutel konfrontiert werden, als spinnende Hetären gedeutet. Dass die<br />
umworbene, angebliche Hetäre beim Spinnen wiedergegeben ist, störte nicht. Längst hat man sich mit<br />
der Erklärung abgefunden, das Weben und Spinnen sei keine ausschließlich den Hausfrauen<br />
vorbehaltene Tätigkeit, sondern würde als eher geschlechtsspezifische denn als statusspezifische<br />
Arbeit auch von Hetären praktiziert, die sich an bürgerlichen Tugendmodellen orientierten, um ihren<br />
Kunden einen speziellen Anreiz zu bieten. Für den Geldbeutel wie für Attribute im Allgemeinen gilt<br />
aber, dass sie in der Bildsprache der griechischen Vasenmalerei oft formelhaft verwendet werden und<br />
somit nicht so sehr aussagekräftig sind für die Bewertung von Interaktionen, sondern vielmehr der<br />
3 z. B. Paul-Zinserling 1994, 112 f.; Pomeroy 1985, 132–135, Sutton 1981, 99; Bundrick 2008, 297.<br />
S e i t e | 12
Charakterisierung einer Person dienen. Zu den typisch weiblichen Attributen zählen Kästchen, Truhen,<br />
Spiegel, Bänder, Wollkorb und Spindel, zu den Gegenständen der männlichen Lebenswelt dagegen<br />
vor allem der Bürgerstock, Athletenutensilien und der Geldbeutel. Nicht selten nahm die Forschung<br />
aus dem Drang heraus, Szenen situativ deuten zu wollen, Widersprüche in Kauf, die daraus<br />
resultierten, erklären zu müssen, weshalb eine Hetäre mit Attributen ausgestattet sein sollte, die in die<br />
ureigene Sphäre der Hausfrau und Bürgerin weisen. So hat man bei dem Berliner Alabastron III/24<br />
trotz der Webutensilien, vor allem aber auch trotz des transparenten Schleiers allein aufgrund des ihr<br />
angebotenen Geldbeutels an der Deutung der sitzenden Spinnerin als Hetäre festgehalten.<br />
Ein Genre, welches sich ausführlich den Interaktionen der Geschlechter widmet, sind die zumeist<br />
kategorisch unter dem Begriff der Werbeszenen zusammengefassten Darstellungen. Zu den sog.<br />
Werbe- oder Liebesgeschenken gehören neben dem Geldbeutel ferner so unterschiedliche Objekte wie<br />
Blüten, Kränze, Alabastra oder Fleischstücke. Inwieweit eine Werbung, also folglich auch eine<br />
Übergabe von Geschenken, tatsächlich gemeint ist, muss in vielen Fällen erneut zur Diskussion<br />
gestellt werden. Es erscheint nämlich vielfach plausibel, jene Gegenstände erneut nicht so sehr nach<br />
ihrer Funktion als Liebesgeschenk zu bewerten, sondern als Attribut, welches den jeweiligen Träger<br />
charakterisiert. Gerechtfertigt ist ein Umdenken vor allem dann, wenn das Ambiente den Oikosszenen<br />
entlehnt zu sein scheint. Hat man sich nämlich erst einmal vom Vorurteil gelöst, dass allein die<br />
Begleitung eines Mannes den Status einer Frau suspekt macht, dann rückt dies manche 'Werbeszene'<br />
in ein völlig neues Licht. Während man also bisher das Werben um die Gunst einer Frau stets auf die<br />
Prostituierte bezog, die bezahlt oder durch Gaben überzeugt werden musste, eröffnet sich nun die<br />
Möglichkeit, zumindest in manchen Werbeszenen Darstellungen der Ehefrau und Bürgerin zu<br />
erkennen, deren Verhältnis zum Mann hier unter neuen Aspekten beleuchtet wird.<br />
Das Umwerben von Ehefrauen war, so dachte man lange Zeit, ein Widerspruch in sich. Unsere<br />
Vorstellungen vom Leben der athenischen Ehefrau wurden vor allem durch die Oikosszenen geprägt,<br />
die diese als strebsame und funktionale Arbeiterin beschreiben. Eleganz, Schönheit und nicht zuletzt<br />
Erotik werden eher mit subtilen Mitteln zum Ausdruck gebracht, etwa durch aufwendige Gewänder,<br />
kunstvolle Frisuren, Schmuck, Spiegel, Alabastra oder durch einen Eros. Die Frage nach der<br />
Sexualität der Ehefrau wurde in den meisten Abhandlungen nur flüchtig gestreift, weil weder Schrift-<br />
noch Bildmaterial viel beizutragen wussten. Doch die sexuellen und erotischen Aspekte des<br />
Frauenbildes außer Acht zu lassen, hieße, dass ein wesentlicher Aspekt der griechischen Ehefrau<br />
unberücksichtigt bliebe. Es ist zweifellos wahr, dass die griechische Ikonographie der Klassik mit der<br />
Umsetzung der Erotik und Sexualität der Bürgerin weitaus vorsichtiger zu Werke ging als im Hinblick<br />
auf die Kopulationsszenen mit Prostituierten. Einen möglichen Ansatzpunkt bietet hier z. B. die<br />
Darstellung der Kline, die in Hochzeitsszenen, interessanterweise aber auch außerhalb des<br />
hochzeitlichen Kontexts mit dem Leben der Bürgerin verbunden wird. Daneben existieren einige,<br />
wenige Vasenbilder, deren emotionale Bekundungen sich durchaus mit den Vorstellungen vom<br />
Verhältnis der Eheleute in Einklang bringen lassen. Unter gewissen Vorbehalten ist demzufolge zu<br />
konstatieren, dass emotional-persönliche Komponenten der Ehe zumindest in der Vasenmalerei hier<br />
und da zum Ausdruck gebracht wurden, auch wenn sie anderweitig meist völlig verschwiegen oder<br />
übergangen wurden.<br />
S e i t e | 13
Ein weiterer, vielversprechender Ansatz bei der Klärung der Frage, ob zwischen der Darstellung einer<br />
Hetäre oder Ehefrau differenziert werden könne, sind im Übrigen die Bilder von Paaren in Begleitung<br />
eines Eros. Obgleich sich bisher offensichtlich niemand daran störte, auch Paare in Gemeinschaft mit<br />
Eros als Hetären mit ihren Kunden zu interpretieren, ist es doch so, dass Eros keineswegs wahllos<br />
hinzutritt. Im Gegenteil, die Verbindung eines Eros mit einer Hetäre wäre, wie eine entsprechende<br />
Untersuchung zeigen wird, für die klassische Vasenmalerei in der Tat höchst exzeptionell. In<br />
gewissem Sinn ist er fast attributiv zu verstehen, wenn auch nicht zwangsläufig geschlechtsspezifisch<br />
verwendet wie Wollkorb und Geldbeutel.<br />
Das Bild der Ehefrau auf Vasen ist, das dürfte schon dieser kurze Überblick verdeutlicht haben, weit<br />
vielschichtiger als dies von der Forschung bisher wahrgenommen wurde. Zu ihrer sozialen Einbindung<br />
in ihre Familie gehören ebenso ihre Beziehungen zum männlichen Geschlecht. Ziel der folgenden<br />
Untersuchung soll nun sein, deutlich zu machen, dass sich das Bild der Ehefrau nicht in dem der<br />
treuen Hausfrau erschöpft, sondern es in der attischen Vasenmalerei durchaus einen Bedarf an<br />
Darstellungen gab, die Mann und Frau als Ehemann und Ehefrau und nicht etwa als Freier und Hetäre<br />
wiedergeben.<br />
S e i t e | 14
1. Die Braut<br />
1. 1. Das Heiratsalter<br />
Um die Hochzeitsdarstellungen auf den attischen Vasen verstehen und bewerten zu können, ist es<br />
dienlich, zumindest einige Formalia, die im Umfeld der Hochzeit und hinsichtlich des Verhältnisses<br />
des Brautpaares wichtig sind, zu skizzieren.<br />
Das Heiratsalter junger Mädchen in der griechischen Antike beginnt für unsere modernen Begriffe<br />
bereits relativ früh, nämlich kurz nach <strong>Erlangen</strong> der Geschlechtsreife. Eine feste Regelung scheint<br />
jedoch nicht bestanden zu haben, da uns über die Jahrhunderte hinweg durchaus leicht variierende<br />
Aussagen und Meinungen überliefert sind. Um 700 v. Chr. gibt etwa Hesiod dem Bauern den klugen<br />
Rat, ein körperlich und sexuell voll entwickeltes Mädchen zur Frau zu nehmen. Aus seinen Angaben<br />
errechnet sich ein Alter von 15-17 Jahren. 4 Erst 14 Jahre zählt die Braut des Ischomachos in der<br />
Schilderung Xenophons, woraus sich ganz allgemein im 4. Jh. v. Chr. ein gebräuchliches Heiratsalter<br />
von 14-15 Jahren erschließen lässt. 5 Philosophen wie Platon und Aristoteles setzen das Heiratsalter<br />
etwa zur selben Zeit etwas höher an; sie tendieren zu einem Heiratsalter von 16-20 Jahren, nicht<br />
zuletzt weil man um die Gesundheit der jungen Mutter und des Neugeborenen besorgt war, da<br />
konfliktbehaftete Schwangerschaften besonders bei sehr jungen Frauen häufig waren. 6 Die jung<br />
verheiratete Frau ist dennoch nicht kategorisch als Kindfrau anzusprechen. Zu berücksichtigten ist<br />
neben dem faktischen Alter der Braut auch der Grad der sexuellen Reife pubertierender Mädchen, der<br />
in einer Gesellschaft, die ihre Parthenoi jung zu verheiraten pflegte, ein anderer gewesen sein kann als<br />
in unseren modernen Gesellschaften.<br />
Der Bräutigam war zum Zeitpunkt der Eheschließung in der Regel in den Dreißigern, so dass –<br />
unerheblich, ob die Braut nun 14 oder 18 Jahre alt war – ein beträchtlicher Altersunterschied<br />
bestanden haben dürfte. 7 Die unterschiedliche geistige und emotionale Reife der Brautleute wird<br />
gewöhnlich als Grund angeführt, weshalb das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau distanziert und<br />
unpersönlich blieb. „Der Altersunterschied zwischen Mann und Frau bedeutete, dass die kindliche<br />
Ehefrau in ihrer geistig-seelischen Entwicklung ihrem Mann gänzlich unterlegen war. Ganz<br />
unverhohlen wird dieses Defizit als Vorzug gewertet und die Formbarkeit der jungen Frau als Tugend<br />
herausgestrichen“, resümiert etwa C. Reinsberg. 8 Es finden sich in den Quellen durchaus<br />
4 Hes. erg. 697: „Aber die Frau sei vier Jahre mannbar, im fünften sei Hochzeit.“<br />
5 Xen. oik. 7, 5; Demosth. or. 28, 15 f.; 29, 43: In etwa dasselbe Alter war für die Verheiratung der Tochter des<br />
Demosthenes vorgesehen, die bereits mit 5 Jahren testamentarisch einem Mann versprochen wurde; s. auch Harrison<br />
1968, 6 f.<br />
6 Plat. Pol. 460e; ders. leg. 785b; Aristot. Pol. 7, 16.<br />
7 Sol. 27, 9 f. West = /19, 9 f. Diehl; P. E. Slater, The Greek Family in History and Myth, Arethusa 7, 1974, 10 f. 24 ff. 40:<br />
Die Psychoanalyse begründet diese Konstellation einerseits mit der Furcht des Mannes vor reifen Frauen, die ihn folglich<br />
veranlasst, sich für ihn weniger bedrohlichen und sexuell noch inaktiven Mädchen zuzuwenden, andererseits mit der<br />
Überlegenheit, die der Mann schon allein aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seiner reicheren Erfahrung auch in<br />
sexuellen Belangen auskosten kann.<br />
8 Reinsberg 1993, 41 f.; s. auch Pomeroy 1985, 112.<br />
S e i t e | 15
Bestätigungen, dass ein Mann einen Vorteil darin sah, seine jugendliche Gattin nach seinen Wünschen<br />
formen und erziehen zu können. 9 Auf der anderen Seite lernen wir etwa in den „Ekklesiazusen“ des<br />
Aristophanes in Person der Praxagora eine junge Frau kennen, die ihren älteren Ehemann fintenreich<br />
um den Finger wickelt. Und wie schon Xenophon im „Oikonomikos“ Ischomachos zu seiner Ehefrau<br />
sagen lässt, erarbeitet sich eine Frau durch Strebsamkeit und Fleiß ihren Platz im Oikos und die<br />
Achtung ihres Mannes, bis sie sich letzten Endes gar ihm selbst als überlegen erweist. 10<br />
Eine einleuchtende Erklärung für die späte Heirat der Männer liegt in ihrer langwierigen Erziehung.<br />
Militärisches Training und eine vielseitige Ausbildung in Rhetorik, Philosophie, Sport und Musik<br />
zielten auf einen universellen Polisbürger ab. Die politische Mündigkeit, d. h. die Berechtigung, ein<br />
Amt der Polis zu bekleiden, fiel zeitlich wohl in etwa mit der finanziellen Unabhängigkeit zusammen,<br />
die der junge Mann meist erst nach dem Tod seines Vaters erreichte oder dann, wenn dieser ob seines<br />
hohen Alters ihm freiwillig die Verwaltung des Oikos überließ. 11 Vorher war der athenische Sohn in<br />
der Regel nicht in der Lage, eine eigene Familie zu unterhalten.<br />
Die frühzeitige Verheiratung der athenischen Töchter erschien vor allem aus zwei Gründen ratsam.<br />
Junge Frauen wurden bis zu ihrer Heirat wohl unter strenger Aufsicht gehalten. 12 Das Erwachen der<br />
weiblichen Sexualität mit dem Beginn der Pubertät wurde als gefährlich empfunden. Ein Ehemann<br />
diente dazu, diese Sexualität gesellschaftlich zu sanktionieren, zu kontrollieren und sie durch das<br />
Zeugen von Kindern gleichzeitig in den Dienst von Staat und Familie zu stellen. 13 Ein weiterer Grund<br />
für die zeitige Verheiratung der Frau in der Antike könnte die niedrige Lebenserwartung der älteren<br />
Generation gewesen sein. Dem Vater einer erwachsenen Tochter dürfte daran gelegen gewesen sein,<br />
sie noch zu seinen Lebzeiten versorgt zu wissen. 14 Der Wunsch, noch die eigenen Enkel aufwachsen<br />
zu sehen, hatte Mantis veranlasst, seinen Sohn bereits mit 18 Jahren zu verheiraten, so dass aus<br />
bestimmten Gründen manchmal auch Männer ungewöhnlich früh in den Stand der Ehe traten. 15<br />
9 z. B. Hes. erg. 698; Aristot. oec. I, 1343a: „Das heißt aber, dass man die Frau zu dem Wesen formt, das sie sein muss.“<br />
Ebenda I, 1344a; Xen. oik. 3, 12; Demokr. fr. 110; Men. fr. 702 K; derartige Quellenaussagen wurden häufig<br />
herangezogen, um die These vom bewusstem dumm Halten der Frauen zu stützen, s. Keuls 1985, 104; Reuthner 2006,<br />
120–122.<br />
10 Xen. oik. 7, 41–43.<br />
11 Lacey 1983, 109; Hartmann 2002, 100 f.<br />
12 Xen. oik. 7, 5: Ischomachos´ Braut, die vor ihrer Heirat möglichst wenig gesehen und gehört hat; Peschel 1987, 12;<br />
Reinsberg 1993, 137.<br />
13 So auch schon J. L. Sebesta, Visions of Gleaming Textiles and a Clay Core: Textiles, Greek Women, and Pandora, in: H.<br />
P. Foley (Hrsg.), Reflections of Women in Antiquity (London 1981) 127.<br />
14 s. z. B. Demosth. or. 27, 4–5; Hartmann 2002, 83 erkennt darin auch den Grund, warum die Engye zwischen Vater und<br />
Bräutigam manchmal vereinbart wurde, obwohl die Tochter noch weit von der Pubertät entfernt war.<br />
15 Demosth. or. 40, 12.<br />
S e i t e | 16
1. 2. Der Zweck der Ehe<br />
“Marriage serves largely as an instrument for the extraction of the services normally rendered by<br />
female to male: sexual satisfaction, childbearing, and cheap labor.” 16 Dieses plakative Urteil von E.<br />
Keuls, das die antike griechische Ehefrau rein auf ihre Funktionalität reduziert, zeigt drastisch, wie<br />
fremd uns das Konzept der Zweckehe geworden ist und wie sehr sich mancherorts das Bild der<br />
benutzten und rechtlosen Frau festgesetzt hat. Wir sind heute kaum mehr in der Lage, die Vorteile und<br />
Gründe für eine arrangierte Heirat anzuerkennen. Welchen Nutzen sah die antike Gesellschaft in der<br />
Ehe, was war ihre Grundlage? Ist die Athenerin in klassischer Zeit tatsächlich nur Gebärerin und<br />
ausgebeutete Arbeitskraft im Haus ihres Ehemannes, wie uns E. Keuls suggerieren will? Obgleich<br />
auch C. Reinsberg zu einer äußerst nüchternen Definition der Institution Ehe gelangt, ist ihre<br />
Schlussfolgerung weitaus treffender, da sie ihre Erkenntnis aus dem Studium der Quellen bezieht,<br />
ohne sich zu subjektiven Bewertungen verleiten zu lassen. "Die Voraussetzungen und Ziele dieser<br />
Lebensgemeinschaft sind ökonomischer und sozialer Art. Es geht um den Fortbestand der Familie,<br />
nicht zuletzt wegen der Alterssicherung, und um die optimale Bewirtschaftung des Besitzes." 17 Die<br />
entsprechende antike Textpassage, die zur Frau und ihren Aufgaben im Haus Stellung nimmt, stammt<br />
aus dem „Oikonomikos“ des Xenophon:<br />
„Denn mir scheinen, Frau, habe er gesagt, die Götter dieses Paar, das Mann und Frau<br />
genannt wird, mit größter Umsicht zusammengefügt zu haben, damit es sich selbst<br />
möglichst nützlich sei bei seinem gemeinsamen Leben. Erstens nämlich ist dieses Paar dazu<br />
bestimmt, miteinander Kinder zu zeugen, damit die Gattungen nicht aussterben; sodann<br />
wird aus dieser Verbindung – wenigstens bei den Menschen – erreicht, Pfleger für das<br />
eigene Alter zu haben; schließlich leben die Menschen nicht wie das Vieh unter freiem<br />
Himmel, sondern brauchen offensichtlich Behausungen. Die Menschen, die etwas haben<br />
wollen, was sie unter Dach und Fach bringen können, brauchen natürlich Arbeitskräfte für<br />
die Arbeiten auf dem Felde. Denn Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflanzen und Viehhüten –<br />
all das sind Arbeiten im Freien, und aus ihnen entstehen die Mittel zum Leben. Wenn sie<br />
unter Dach und Fach gebracht sind, wird wieder jemand gebraucht, der sie aufbewahrt und<br />
der die Arbeiten verrichtet, die im Haus zu erledigen sind.“ (Xen. oik. 7, 18-21)<br />
Xenophons Erklärung für die Lebensgemeinschaft zweier Menschen ist eine nüchterne, auf Fakten<br />
reduzierte, rationale Annäherung, die versucht, vorgefundene Lebensverhältnisse auf philosophischem<br />
Wege zu ergründen. Seiner Meinung hat es die Natur so gefügt, dass Männer und Frauen jeweilige<br />
Fähigkeiten besitzen, einen Haushalt führen und eine Familie gründen. Ein Urteil über die Frau wird<br />
hierbei zunächst nicht gefällt.<br />
16 Keuls 1985, 98.<br />
17 Reinsberg 1993, 35; vgl. Plat. leg. 772d.<br />
S e i t e | 17
S e i t e | 18<br />
1. 3. Die Wahl des Partners<br />
Die Auswahlkriterien bei der Suche nach dem Lebenspartner orientierten sich mehrheitlich an<br />
praktischen Gesichtspunkten. Romantische Liebe dürfte kaum eine Rolle gespielt haben, da Braut und<br />
Bräutigam einander entweder nicht oder kaum kannten. Die Engye, die vorrangig dazu diente, dem<br />
Bräutigam die legitime Herkunft seiner Braut zu garantieren 18 und die Höhe der Mitgift 19<br />
festzusetzen, wurde zwischen dem Brautvater und dem Bräutigam vereinbart. Die Verheiratung und<br />
Versorgung der Tochter durch ihre Eltern oder einen nahen Verwandten war, wie uns die nächste<br />
Quelle zeigt, eine Angelegenheit, die gut bedacht werden wollte:<br />
"[...] we are dealing with no light affairs, but are entrusting the lives of our sister and<br />
daughters, for whom we seek the greatest possible security.” (Demosth. or. 30, 21)<br />
Vermögen, Stellung, Prestige, Herkunft und Charakter waren Kriterien, die bei der Entscheidung für<br />
den richtigen Lebenspartner abgewogen wurden. 20 Bei Platon heißt es, dass Charakter und<br />
Lebensführung des Bräutigams vom Vater der Braut sorgsam geprüft werden. 21 Und auch noch zu<br />
Beginn der hellenistischen Epoche verspricht Chaireas in Menanders „Menschenfeind“ dem verliebten<br />
Sostratos, Auskünfte bezüglich des familiären und sozialen Hintergrundes seiner auserkorenen Braut<br />
einzuholen:<br />
„Spricht mir nun wer von Heirat, edlem Mädchentum?<br />
Ich frag, im Gegensatz zu sonst, wer ist sie denn?<br />
Charakter? Lebenswandel?“ (Men. Dysk. 64-66)<br />
Gleichzeitig wird es jedoch ebenso wahr sein, dass von Seiten des Bräutigams die Brautwahl in vielen<br />
Fällen von den Lockungen einer stattlichen Mitgift diktiert wurde. Die Klagen der betroffenen<br />
Männer, die aufgrund einer königlichen Mitgift die unmöglichsten Frauen in Kauf nahmen, hallen zur<br />
Genüge in den antiken Quellen wider. 22 In den „Wolken“ des Aristophanes schimpft Strepsiades<br />
wortreich über seine hochnäsige Gattin, die als Abkömmling eines alten attischen Geschlechts dem<br />
18 Harrison 1968, 2–9; Mossé 1983, 51 f.; Just 1989, 45–50; C. B. Patterson, Marriage and the Married Woman in Athenian<br />
Law, in: S. Pomeroy (Hrsg.), Women´s History and Ancient History (1991) 49–52; Reinsberg 1993, 32 f. 37; Hartmann<br />
2002, 80–83; s. auch Plat. leg. 774e; Hdt. 6, 130; Men. Pk. 1012–1015.<br />
19 Harrison 1968, 45–60; Lacey 1983, 111 f.; Just 1989, 48. Die Übereinkunft bezüglich der Mitgift war zwar meist Teil der<br />
Vereinbarung der Engye, scheint jedoch kein gesetzlich festgeschriebener Bestandteil gewesen zu sein, wie uns der Fall<br />
Lys. 19, 14–15 zeigt. Andererseits scheint sie eine soziale Forderung gewesen zu sein, wenn man bedenkt, dass arme<br />
Töchter vom Staat mit einer Mitgift ausgestattet wurden; s. z. B. Mossé 1983, 53: “Doter largement sa fille était une<br />
preuve d´ honorabilité.” Es gehörte also zu den Pflichten eines Vaters oder Bruders, die Töchter mit einer Mitgift<br />
auszustatten; s. auch Demosth. or. 30, 12 f.; Plut. Arist. 27: Ausgerechnet Aristides, der große Staatsmann und Wohltäter,<br />
ließ nach seinem Tode seine beiden Töchter mittellos zurück.<br />
20 E. Cantarella, Pandora´ Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity (Baltimore 1987) 26;<br />
C. A. Cox, Household Interests (Princeton1998) 70.<br />
21 Plat. leg. 924d.<br />
22 Thgn. 183–192; Men. fr. 333 K.
Bauern aus einfachen Verhältnissen das Leben schwer macht. 23 In einer Gerichtsrede des Lysias<br />
betont der Sprecher ausdrücklich, dass auch schon sein Vater die Achtbarkeit der Familie und ihr<br />
politisches Prestige höher schätzte als die Summe der Mitgift. 24 Die Mitgift war jedoch nicht nur dazu<br />
angetan, den Wohlstand des Ehemannes zu mehren, sondern diente zuallererst der Versorgung der<br />
Ehefrau. 25 Wurde die Ehe beendet, musste sie an den nächsten Verwandten der Frau zurückerstattet<br />
werden. 26 Die Höhe der Mitgift mag sich durchaus auf die Stellung der Braut im neuen Oikos positiv<br />
ausgewirkt haben. 27 War ein Mann auf die Mitgift seiner Frau angewiesen, hatte er ein besonderes<br />
Interesse daran, die Ehe aufrechtzuerhalten. Umgekehrt war die finanzielle Liquidität des Bräutigams<br />
sicherlich auch der Familie der Braut nicht unwillkommen. Bereits Theognis beklagt, dass die edle<br />
Abkunft auf beiden Seiten zunehmend weniger zählt als der Besitz. 28 Es war natürlich im Interesse der<br />
Eltern gelegen, für ihre Tochter einen Ehemann zu finden, der über ausreichend Möglichkeiten<br />
verfügte, diese angemessen zu versorgen. In einem Komödienfragment des 4. Jhs. v. Chr. veranlasst<br />
die Verschuldung eines Ehemannes den Schwiegervater, sich nach einem besser situierten Ehemann<br />
für seine Tochter umzusehen. 29<br />
23 Aristoph. Nub. 41–55.<br />
24 Lys. 19, 13–17; im gleichen Sinne rät Plat. leg. 773a dem Mann, „einer Ehe mit Armen nicht aus dem Weg zu gehen und<br />
einer Heirat mit Reichen nicht besonders nachzujagen, sondern, falls im übrigen Gleichheit besteht, immer die ärmlichere<br />
Partie vorzuziehen, wenn du eine Verbindung eingehst.“<br />
25 Harrison 1968, 55–57; J.-P. Vernant, Mythos und Gesellschaft im alten Griechenland (Frankfurt a. M. 1987) 52; L.<br />
Foxhall, Household, Gender and Property in Classical Athens, ClQ 39, 1989, 29; Just 1989, 73 f.; Xen. oik. 7, 13: Die<br />
Bemerkung des Ischomachos zur Gütergemeinschaft ist etwas irreführend. Er möchte den Eindruck einer<br />
uneingeschränkten und gleichberechtigten Partnerschaft erwecken, der hier störende Gedanke an Zurückerstattung der<br />
Mitgift im Falle einer Scheidung wird unterdrückt.<br />
26 z. B. Mossé 1983, 53: Die Mitgift ging in den Besitz der Kinder über, wenn die geschiedene Frau nicht mehr im<br />
heiratsfähigen Alter war; Pomeroy 1985, 95. – Zur Verfügungsgewalt über die Frauen, z. B. V. J. Hunter, Policing<br />
Athens, Social Control in the Attic Lawsuits, 420–320 v. Chr. (Princeton 1994) 15–19; E. Hartmann,<br />
Geschlechterdefinitionen im attischen Recht. Bemerkungen zur kyrieia, in: E. Hartmann – K. Pietner – U. Hartmann<br />
(Hrsg.), Geschlechterdefinitionen und Geschlechtergrenzen in der Antike (Stuttgart 2007) 37–53. 74 f. zieht in Zweifel,<br />
das die kyrieia als Vormundschaft gedacht war, die der Vater, Ehemann etc. lebenslang über die Ehefrau, Tochter etc.<br />
ausübten. Zum kyrios, d. h. rechtlichen Vertreter, wurden männliche Personen für die Frauen bestellt, die keine<br />
männlichen Angehörigen mehr hatten.<br />
27 z. B. Just 1989, 74; L. Foxhall, Household, Gender and Property in Classical Athens, ClQ 39, 1989, 34; C. A. Cox,<br />
Household Interests (Princeton 1998) 70. Ein hervorragendes Beispiel liefert Aristoph. Nub. 41–55. 60–72: Neben der<br />
stattlichen Mitgift, die seine Frau, eine Städterin aus einer der ersten Familien Athens, mit in die Ehe bringt, ist es vor<br />
allem das soziale Gefälle oder auch ihre Dominanz, die dem Bauer Strepsiades eine ungleich schlechtere Position in<br />
seinem Haus verleihen; Aristot. eth. Nic. 1161a: “Zuweilen aber, wenn die Frauen Erbtöchter sind, herrschen sie. Da<br />
entscheidet denn nicht die Tugend über die Gewalt, sondern Reichtum und Macht.“<br />
28 Thgn. 185–188.<br />
29 Gk. Lit. Pap. 34.<br />
S e i t e | 19
S e i t e | 20<br />
1. 4. Die Hochzeitsfeierlichkeiten<br />
Diverse Monographien zur athenischen Hochzeit machen es unnötig, den Ablauf der dreitägigen<br />
Feierlichkeiten in aller Ausführlichkeit auszubreiten. 30<br />
Der Hochzeit voraus ging die Engye, bei der es sich nach E. Hartmann um die Bestätigung der<br />
legitimen Abstammung der Braut durch ihren Vater handelte, die für die Anerkennung der Ehe als<br />
Zusammenschluss zweier Bürger vonnöten war. 31 Die Engye selbst hat keine juristisch bindende<br />
Funktion, sie ist keine Garantie für den Vollzug der Verheiratung. 32<br />
Die Riten am Tag der eigentlichen Hochzeit, am Tag nach den Proaulia, begannen mit dem Einholen<br />
des Hochzeitswassers. In Loutrophoren wurde frisches Quellwasser aus der Eneakrounos geschöpft<br />
und zum Reinigen des Brautpaares verwendet. 33 Obwohl das Bad des Bräutigams uns nur ein einziges<br />
Mal auf einer Vasendarstellung erhalten ist 34 , war es für ihn wohl ebenso verpflichtend wie für die<br />
Braut, deren Waschung sicherlich nicht zufällig an Szenen der Aphrodite erinnert. Nach der<br />
Schmückung der Braut, die mit Sorgfalt und großem Aufwand exerziert wurde, fand das Bankett statt.<br />
Am Ende des Tages machte sich, wenn man den Vasenbildern Glauben schenken darf, ein von Musik<br />
begleiteter Prozessionszug daran, Bräutigam und Braut in ihr neues Heim zu geleiten. In ihrem neuen<br />
Zuhause angekommen wurde die Braut eventuell von den Eltern des Bräutigams willkommen<br />
geheißen. Riten wie das Umschreiten des Herdes und das Verstreuen von Nüssen, Datteln und Feigen<br />
waren Ausdruck ihrer neuen Stellung als Herrin des Haushaltes und der Hoffnung auf Fruchtbarkeit<br />
und Blüte des Hauses. 35 Die Hochzeitsnacht des Paares wurde begleitet von Hochzeits- und<br />
Spottgesängen. Am Tag danach, den Epaulia, empfingen Braut und Bräutigam Freunde und<br />
Verwandte und nahmen Geschenke entgegen.<br />
30 RE VIII (1913) 2129–2133 s. v. Hochzeit (Heckenbach); F. F. Fink, Hochzeitsszenen auf attischen schwarz- und<br />
rotfigurigen Vasen (Diss. Wien 1974); Oakley – Sinos 1993; C. Leduc, Heirat im antiken Griechenland (9.–4.<br />
Jahrhundert v. Chr.), in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 263–320; A.-<br />
M. Vérilhac – C. Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l´epoche d´Auguste (Athen 1998); Winkler 1999, 110–<br />
119; Hartmann 2002, 76–97.<br />
31 Hartmann 2002, 79–84.<br />
32 J.-P. Vernant, Mythos und Gesellschaft im antiken Griechenland (Frankfurt a. M. 1987) 51 f.<br />
33 z. B. Thuk. 2, 15, 5. Das antike Quellenmaterial in Zusammenstellung und Übersetzung bei Winkler 1999, 16–20; dies.<br />
21 f. 92–109 unterscheidet zwischen dem Brautbad, einem kultisches Bad am ersten Tag der Hochzeit, dessen Wasser<br />
aus einer Hydria gegossen wird, und dem Hochzeitsbad. Bei letzterem wird am zweiten Tag der Hochzeit eine rituelle<br />
Waschung oder Besprengung mit dem Wasser (im Thalamos?) vorgenommen, das in die Loutrophoros abgefüllt wurde. –<br />
Zur Bedeutung des rituellen Hochzeitsbades, s. Kreilinger 2007, 127 Anm. 801; 134f. 140–144.<br />
34 Hydria des Leningrad-Malers, Warschau, Nat. Mus. 142290: Winkler 1999, 94.<br />
35 Zum Brauch der Katachysmata, s. Sutton 1981, 197–200; A.-M. Vérilhac – C. Vial, Le mariage grec du VIe siècle av. J.-<br />
C. à l´epoche d´Auguste (Athen 1998) 335–348; Oakley – Sinos 1993, 34. – bildliche Umsetzung: vgl. Loutrophorosfrg.,<br />
Boston, Mus. of Fine Arts 10.223, hier V/10.
1. 5. Die Hochzeit in der Bildkunst der attisch rotfigurigen Keramik<br />
Die Hochzeit wird oft als das einschneidendste Ereignis im Leben der griechischen Frau<br />
herausgestellt. 36 So kann es kaum verwundern, dass uns heute noch eine derart große Menge an<br />
Hochzeitsdarstellungen auf Vasen überliefert ist, die uns mitsamt der dazu erhaltenen schriftlichen<br />
Quellen eine gute Vorstellung von den antiken Sitten und Gebräuchen geben können. 37<br />
Einen hohen Prozentsatz der Hochzeitsdarstellungen nehmen zunächst die Prozessionsszenen ein, in<br />
denen der Bräutigam seine junge Braut nach der Hochzeit in sein Heim überführt. Die früheste<br />
Darstellung einer solchen Hochzeitsprozession befindet sich auf dem Francois-Krater in Florenz 38 , der<br />
u. a. mit der Hochzeit des Peleus und der Thetis geschmückt ist. Die Ikonographie der mythischen<br />
Hochzeitsszenen wird später dann auch für die Feierlichkeiten der Sterblichen verbindlich. Von den<br />
vielen anderen rituellen Vorgängen, die zum Ablauf der dreitägigen Hochzeitsfeier gehörten, wurden<br />
neben den Hochzeitsprozessionen vorrangig das Schmücken der Braut und das Überreichen der<br />
Hochzeitsgeschenke, die Epaulia, ins Bild gesetzt, seltener das Einholen des Hochzeitswassers oder<br />
das Hochzeitsbad selbst. Die verwendeten Formeln sind früh standardisiert, so dass hier jeweils ein<br />
Beispiel genügen soll, um die Form- und Bildsprache der Hochzeitsdarstellungen zu erläutern. Wir<br />
werden im Laufe der Arbeit jedoch noch häufiger auf die hochzeitliche Ikonographie zurückgreifen.<br />
1. 5. 1. Hochzeitsprozessionen<br />
Eine Loutrophoros in Boston I/1 (Taf. 1 Abb. 1–4). ist eine der reizvollsten Umsetzungen einer<br />
Hochzeitsprozession. Der Bräutigam führt seine mit einem Schleier und einem Diadem festlich<br />
geschmückte Braut an der Hand heim; ihr Kopf wird von zwei kleinen Eroten umschwirrt. Das Paar ist<br />
umgeben von Festteilnehmern; eine Frau nestelt am Gewand der Braut, ein Gestus, wie er häufig mit<br />
der Nympheutria in Verbindung gebracht wird. Der Zielpunkt der Prozession ist durch eine<br />
zweiflügelige, halb geöffnete Tür angedeutet, die den Blick auf das dahinter befindliche Hochzeitsbett<br />
freigibt. Die Tür wird links flankiert von einer Fackelträgerin, die zum festen Repertoire der<br />
Hochzeitsszenen gehört, rechts von einer Frau, deren ausgebreitete erhobene Arme das Paar<br />
willkommen zu heißen scheinen oder doch zumindest kompositorisch auf das sich nähernde Brautpaar<br />
verweisen. Die Szenerie wird durch weitere Personen vor allem weiblichen Geschlechts<br />
vervollständigt, die ein Kästchen, ein Exaleiptron 39 und eine Schale bringen, die entweder Geschenke<br />
darstellen oder bei bestimmten rituellen Handlungen verwendet wurden. Die Handreichung eines<br />
bärtigen Mannes und eines Jünglings wird als die einzige bildliche Darstellung des Engye-Vertrages<br />
zwischen dem Brautvater und dem Bräutigam interpretiert (Taf. 1 Abb. 4). 40<br />
36 z. B. C. Bérard – J.-P. Vernant (Hrsg.), Die Bilderwelt der Griechen (Mainz 1985) 139.<br />
37 Sutton 1981, 147 ff.; Oakley – Sinos 1993; J. H. Oakley, Hochzeitliche Nuancen: Hochzeitliche Bildelemente in nicht-<br />
hochzeitlichen mythologischen Szenen, in: Reeder 1995, 63–73.<br />
38 Florenz, Mus. Arch. 4209: J. Boardman, Schwarzfigurige Vasen aus Athen 4 (Mainz 1994) Abb 46.5.<br />
39 Behälter für Duftöle oder Reinigungssubstanzen im Rahmen der Hochzeitsvorbereitung, s. Winkler 1999, 15.<br />
40 Mösch-Klingele 2006, 81 f. bevorzugt hier eine Deutung als „Kriegers Abschied“ und weist der Bostoner Loutrophoros<br />
eine sepulkrale Verwendung zu.<br />
S e i t e | 21
Das Vasenbild reiht mehrere Aspekte der Hochzeit in loser Ordnung aneinander. Ausgangspunkt ist<br />
die Ekdosis, die Übersiedlung der Ehefrau von ihrem väterlichen Oikos in den Haushalt ihres<br />
Ehemanns. 41 Die Engye-Szene, die zeitlich lange vor der eigentlichen Hochzeit stattgefunden hat,<br />
betont die Gesetzmäßigkeit der Heirat und die Legitimität der Nachkommenschaft, die für den<br />
Bürgerstatus notwendig sind. Durch die Darstellung der Kline bietet der Vasenmaler gleichzeitig einen<br />
Ausblick auf die Hochzeitsnacht, die den Vollzug der Hochzeit letztendlich besiegelt. Das<br />
gemeinsame Lager spielt daneben auch für die Ehe selbst eine Rolle, da das Zeugen von Kindern als<br />
konstituierend für eine gültige und glückliche Ehegemeinschaft angesehen wurde. 42 Die Attraktivität<br />
der Braut wird durch die Eroten akzentuiert.<br />
S e i t e | 22<br />
1. 5. 2. Die Schmückung der Braut<br />
Ein Lebes Gamikos in Athen I/2 (Taf. 1 Abb. 5) soll exemplarisch für die Gruppe der<br />
Brautschmückungsszenen stehen. Die Hauptperson ist eine im Zentrum sitzende Frau, die sich mit<br />
Hilfe eines Eros ein Haarband im Haar befestigt. Die hinter ihr stehende Frau hat den Ellbogen auf die<br />
Stuhllehne gestützt und begutachtet das Ergebnis, wobei sie nachdenklich ihre Hand an das Kinn führt.<br />
Die anderen anwesenden Frauen bringen Kästchen, Bänder und Gefäße, die entweder für die<br />
Prozeduren der Toilette herangezogen werden oder zugleich einen anderen Aspekt des attischen<br />
Hochzeitsfestes aufgreifen: die Epaulia. Der Vasenmaler bediente sich im Grunde des bekannten<br />
Ambientes des Frauengemaches. Nur die Form des bemalten Gefäßes, ein Lebes Gamikos, die<br />
Loutrophoros in den Händen einer Helferin und die assistierenden Eroten setzen die Darstellung in<br />
einen hochzeitlichen Kontext.<br />
Es ist bezeichnend, dass im Laufe der Klassik die Frauengemachsszenen mit denen der<br />
Brautschmückung zu verschmelzen beginnen. 43 In vielen Fällen ist eine sichere Unterscheidung<br />
letztlich unmöglich. Denn während sich die Frauen Anfang des 5. Jhs. v. Chr. noch mit konkreten<br />
Tätigkeiten des Haushalts beschäftigen wie dem Verarbeiten von Wolle, geht die Tendenz schließlich<br />
schrittweise dahin, Werkzeuge bzw. Geräte des Alltags den Frauen rein attributiv beizugeben. 44 Dies<br />
geht einher mit der Entwicklung, die Frauen als genießerische und schöne Wesen bei der<br />
41 Hartmann 2002, 88 macht darauf aufmerksam, dass der Begriff der Ekdosis für die Heimführungsszenen nicht korrekt ist.<br />
„Denn das Substantiv ekdosis und das entsprechende Verb ekdidomi bezeichnen lediglich die Bereitschaft des jeweiligen<br />
Vormundes einer Frau, diese an einen anderen Mann zu übergeben, mit der Option, die Frau wieder zurückzunehmen,<br />
falls es ihr Vormund für notwendig hält." Da er sich in der archäologischen Literatur etabliert hat, wird er hier weiterhin<br />
verwendet.<br />
42 Wenn das telos der Ehe, das Zeugen von Kindern, nicht erfüllt wurde, hatte der Ehemann das Recht sich von seiner Frau<br />
zu trennen. Die Ehe galt dann trotz des Sexualakts als nicht ordnungsgemäß vollzogen, s. auch Kreilinger 2007, 56 f. zum<br />
Begriff der Nymphe. Kinderlosigkeit war in der an Besitz orientierten Gesellschaft Athens mit ihren kompromisslosen<br />
Erbgesetzen durchaus ein gewichtiges Problem, das viele kinderlose Männer bewogen haben dürfte, sich nach einer<br />
neuen Ehefrau umzutun. Dabei wurde die Schuld am Nachwuchsmangel zumeist den Frauen und ihrer biologischen<br />
Dysfunktion zugeschoben. Eine Ausnahme wird bei Is. 2, 6–9 geschildert: hier ist die Zeugungsunfähigkeit des Menekles<br />
der Trennungsgrund.<br />
43 z. B. Götte 1957, 35–37.<br />
44 Vidale 2002, 480–485.
Schönheitspflege darzustellen, wobei Attribute wie der Wollkorb nur noch vage an ihren<br />
Aufenthaltsort und ihre Rolle als Hausfrau erinnern. Dieses Konzept veranschaulicht ein<br />
Lekanisdeckel in St. Petersburg I/3 (Taf. 1 Abb. 6) auf nachdrückliche Weise. Im Oikos herrscht<br />
emsige Betriebsamkeit; Frauen hantieren mit Objekten wie Kästchen, Bändern, Spiegeln und Gefäßen,<br />
sind umringt von Möbelstücken und Vögeln. Da sich unter den Gefäßen auch eine Loutrophoros<br />
befindet, die zusammen mit dem vor einer Frau mit nacktem Oberkörper knieenden Eros einen<br />
hochzeitlichen Rahmen vermuten lässt, handelt es sich wohl nicht um eine einfache Oikosszene. 45<br />
1. 5. 3. Die hochzeitliche Ikonographie<br />
Anhand beider diskutierter Beispiele wird deutlich, dass die Hochzeitsdarstellungen zwar im Kern auf<br />
realistischen, rituellen Prozeduren basieren, die Vorstellung von der Ehe, die dabei vermittelt wird,<br />
aber stark von ideologisierenden Tendenzen beeinflusst wird. 46 Die Schönheit der Braut wird ebenso<br />
betont wie die harmonische Verbindung von Mann und Frau in der Ehe, die in der Zeugung von<br />
Nachkommen ihre Erfüllung finden soll. 47<br />
Eine solche positive Auswertung der hochzeitlichen Ikonographie wird allerdings nicht von allen<br />
geteilt. Noch in jüngster Zeit wurde z. T. im Sinne eines männlichen aktiven und eines weiblichen<br />
passiven Rollenverständnisses behauptet: “Throughout the wedding the Greek bride was pulled, led,<br />
carried, covered, and exposed in a series of rites that rendered her little more than an object to be<br />
controlled and viewed.” 48 Diese postulierte Passivität und Objekthaftigkeit der Braut wurde von L.<br />
Llewellyn-Jones auf die Vasendarstellungen übertragen (Taf. 2 Abb. 1). 49 Auch der Schleier, vom<br />
selben Autor anfänglich noch als Zeichen von Aidos und Sophrosyne verstanden und positiv<br />
45 Mösch-Klingele 2006, 69 f. Nr. 82 Abb. 36.<br />
46 Als eine Art bewusste Schönfärberei interpretiert sie S. Moraw, Bilder, die lügen: Hochzeit, Tieropfer und Sklaverei in<br />
der klassischen Kunst, in: Fischer – Moraw 2005, 84: „Thematisiert werden auf diesen Hochzeitsbildern also die<br />
angenehmen Aspekte von Hochzeit und Eheleben: Geschenke, Schönheitspflege, Schmuck, die Braut als Herrin des<br />
Oikos, Mutterglück und ein jugendlich anmutiger Bräutigam. Die weniger erfreulichen Seiten werden hingegen<br />
ausgeklammert.“; Heinrich 2006, 77.<br />
47 So auch Sutton 1981, 173.<br />
48 Llewellyn-Jones 2003, 243 f.; s. auch Reinsberg 1993, 72: „Die Frau ist hier stets – und dies gilt nicht generell für<br />
Frauenbilder – das passive, geführte, angeleitete oder in sonst einer Weise manipulierte Objekt des Mannes.“<br />
49 Als Veranschaulichungsbeispiel dient Llewellyn-Jones die Loutrophoros, Berlin, Antikensammlung F 2372 auf der der<br />
Bräutigam seine Braut auf den Wagen hebt, hier Kat. Nr. I/4; Reeder 1995, 172 findet für die „Leblosigkeit und<br />
Passivität“ der Braut jedoch eine plausible Erklärung im Bildinhalt selbst, so dass diese gestalterische Eigenheit<br />
keinesfalls als Merkmal der gesamten Hochzeitsikonographie gelten darf. In erster Linie hat die bärtige Gestalt mit<br />
Zepter, die ihrer Aussage nach ein königliches Erscheinungsbild besitzt, die Autorin bewogen, die Szene als mythische<br />
Begebenheit, nämlich als Hochzeit des Epimetheus mit Pandora zu deuten. Die „Brettartigkeit“ der Braut wäre dann ein<br />
Zugeständnis an ihre „künstliche“ Erschaffung aus Ton und Wasser. Bei dem Motiv des in-den-Wagen-Hebens handelt<br />
es sich m. M. um eine standardisierte ikonographische Formel. Gewisse künstlerische Defizite, die man hier vielleicht<br />
hinsichtlich einer naturalistischen Darstellung postulieren möchte, müssen keineswegs eine Auswirkung auf die<br />
inhaltliche Bildaussage haben.<br />
S e i t e | 23
konnotiert 50 , wird plötzlich zum Symbol der Unterlegenheit und Passivität. „The inability of control<br />
access to her own face was perhaps the most degrading (and possibly frightening) event of the<br />
marriage ritual because a woman´s capacity to veil herself gave her some modicum of personal<br />
expression and control.” 51 Die kulturellen Ursprünge des Ver- und Entschleierns während der<br />
Hochzeit seien dahingestellt, es ist jedoch kaum sinnvoll, diese Interpretation der unterdrückten und<br />
gedemütigten Braut auf die Vasenbilder zu übertragen! Man muss bedenken, dass Gefäße mit solchen<br />
Hochzeitsszenen dem Brautpaar zuweilen geschenkt wurden. 52 Eine Sichtweise, wie sie L. Llewellyn-<br />
Jones vorschlägt, wäre in dieser Situation höchst unpassend.<br />
Als Beleg für die Objekthaftigkeit der Braut wird des Weiteren zumeist auch der Cheir epi karpo-<br />
Gestus angeführt, der in der Regel als Besitzergreifungsgestus gedeutet wird, der die<br />
Verfügungsgewalt des Ehemannes als Kyrios über seine junge Frau symbolisiert. 53 Dieses<br />
soziologisch-rechtliche Resümee der antiken Ehe mag durchaus mit dem übereinstimmen, was wir<br />
über die Geschlechterhierarchie in Griechenland im Allgemeinen wissen, dennoch ist es der<br />
ikonographischen Tradition unübersehbar daran gelegen, eine ideale Sicht auf die Eheschließung zu<br />
propagieren. Das Umblicken des Bräutigams, keinesfalls eine kompositorische Notwendigkeit, stellt<br />
persönlichen Kontakt her und drückt ein gewisses Maß an Verbundenheit aus, das die harsche Geste<br />
des cheir epi karpo bedeutsam abmildert. 54 F. Lissarague sieht darin das Walten der Peitho angedeutet,<br />
durch welches der Bräutigam für seine Braut empfänglich gestimmt wird. 55 Auf einigen Vasenbildern<br />
ist zu beobachten, dass der dominant anmutende Griff um das Handgelenk der Braut abgewandelt<br />
wird. Auf einer Loutrophoros in Oxford V/8 (Taf. 24 Abb. 1) etwa scheint der Bräutigam eher die<br />
Hand seiner Braut halten.<br />
Es dürfte schon nach dieser knappen Betrachtung deutlich geworden sein, dass archäologische Bilder<br />
und literarische Quellen unterschiedliche Tendenzen aufweisen. 56 Die Schriftquellen legen die<br />
Betonung sachlich auf die Gründung einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die den Kern jedes<br />
Oikos bildet, ferner auf die Fortpflanzung, die zur langfristigen Etablierung einer Familie nötig ist.<br />
Beide Ziele werden in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Die Darstellungen der Eheschließung auf<br />
50 Llewellyn-Jones 2003, 156 ff. – Zur Verschleierung der Braut als einer Art Übergangsritus, s. D. L. Cairns, The Meaning<br />
of the Veil in Ancient Greek Culture, in: L. Llewellyn-Jones (Hrsg.), Women´s Dress in the Ancient Greek World<br />
(London 2002) 76: “the bride´s veiling certainly conveys messages (first) about her adherence to cultural norms and<br />
(second) about her subjective emotional experience that can be immediately understood in terms of honour, aidos, and<br />
sophrosyne, but it is equally clear that it also constitutes a ritualized enactment of her separation from her old status prior<br />
to the assumption of her new.“<br />
51 Llewellyn-Jones 2003, 247.<br />
52 Lewis 2002, 36: Gefäße mit Hochzeitsszenen werden auch in Heiligtümer geweiht oder funerativ verwendet. All dies<br />
macht eine pejorative Darstellung der Braut unwahrscheinlich.<br />
53 Zur Tradition des Gestus und mit weiterer Literatur, s. Reeder 1995, 127; Sutton 1997, 29. – Zur kyrieia, z. B. V. J.<br />
Hunter, Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420–320 v. Chr. (Princeton 1994) 9–42; E. Hartmann,<br />
Geschlechterdefinitionen im attischen Recht. Bemerkungen zur kyrieia, in: E. Hartmann – K. Pietner – U. Hartmann<br />
(Hrsg.), Geschlechterdefinitionen und Geschlechtergrenzen in der Antike (Stuttgart 2007) 37–53.<br />
54 Sutton, 1997, 29 f.: “warmer atmosphere with a glance of desire, love, and reassurance”.<br />
55 Sutton 1981, 184; F. Lissarrague, Intrusioni nel gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague – F. Frontisi-Ducroux (Hrsg.), I<br />
misteri del gineceo (Bari 2000) 204.<br />
56 Sutton 1997, 27.<br />
S e i t e | 24
den griechischen Vasen sind Szenen unbeschwerter Festlichkeit, in deren Mittelpunkt das Brautpaar<br />
steht. Die soziale und kultische Bedeutung der Hochzeit, die Ausführung der Riten und die Gründung<br />
einer neuen Oikosgemeinschaft bleiben stets gegenwärtig. Die hochzeitliche Ikonographie verwendet<br />
daneben jedoch auch viel Mühe darauf, etwa durch den Blick des Bräutigams, den cheir epi karpo-<br />
Gestus oder die Anwesenheit des Eros eine persönliche und emotionale Bindung des Brautpaares zu<br />
implizieren. Insgesamt zielt das Bildprogramm darauf ab, die Attraktivität und das Glück der jungen<br />
Frau zu überhöhen und dadurch ihre Stellung und ihre Rolle als Braut zu romantisieren. 57 Auch das<br />
oftmals durch die Haustür sichtbare Hochzeitslager gehört in diesen Zusammenhang, wenngleich es<br />
nicht unbedingt Ausdruck sexueller Befriedigung und Leidenschaft ist, sondern wohl mehr auf die<br />
Einigkeit des Ehepaares hindeutet und an die Verantwortung erinnert, den Oikos mit Nachwuchs zu<br />
versorgen. 58 Jeder Eindruck erzwungener sexueller Verfügbarkeit oder Hinweis auf die Rechtlosigkeit<br />
der Ehefrau und ihre untergeordnete Rolle wird sorgfältig vermieden.<br />
Eine romantische Verklärung des Hochzeitsfestes wird ab dem späten 5. Jh. v. Chr. nicht nur durch die<br />
Figur des Eros, sondern auch durch weitere Personifikationen und Allegorien erzielt. 59 Das bekannte<br />
Epinetron des Eretria-Malers in Athen I/5 zeigt beispielhaft, welche Kräfte am Vorabend der Hochzeit<br />
am Werke sind. Als Braut erscheint, vor der Tür ihres Schlafgemaches auf ihre Kline gestützt, keine<br />
andere als die tugendsame Alkestis, die von Euripides als Paradebeispiel der aufopferungsvollen<br />
Gattin 60 inszeniert wird (Taf. 2 Abb. 2). Die Hochzeitsvorbereitungen der Harmonia werden begleitet<br />
von Personifikationen und Allegorien wie Eros und Aphrodite, Himeros und Peitho (Taf. 2 Abb. 3). 61<br />
Es handelt sich dabei vor allem um Mächte, die die Anziehungskraft, die Schönheit und nicht zuletzt<br />
die erotische Ausstrahlung der Braut betonen. Wie Eros scheinen sie ihre zerstörerische wilde Kraft<br />
verloren zu haben und sind quasi gebändigt und ehetauglich gemacht. 62 Die Bedeutung des Eros v. a.<br />
im Rahmen zwischenmenschlicher Beziehungen verdient zu einem späteren Zeitpunkt weitere<br />
Aufmerksamkeit.<br />
Im 4. Jh. v. Chr. wird als Resultat der sozialen und politischen Veränderungen in Folge des<br />
Peloponnesischen Krieges eine allgemeine Aufwertung der Stellung der attischen Frau vermutet, die<br />
sich auch auf die Ehe auswirkte. Sie wandelte sich vom „Wirtschaftsbund“ und „Zeugungsinstitut“<br />
nun hin zur partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft. 63 Tatsächlich wurden zunächst vereinzelt, dann<br />
vermehrt Stimmen laut, die wie z. B. Aristoteles gegenseitige Treue in der Ehe forderten. 64 In<br />
Menanders Komödien sind Liebesheiraten an der Tagesordnung, verzehren sich Liebende, gegen<br />
deren Heirat der Vater opponiert, oder leiden wegen angeblicher Untreue des Partners. In der<br />
57 Sutton 2004, 329; Kreilinger 2007, 14.<br />
58 Diesem Zweck dient auch der pais amphitales, s. Calame 1992, 94 f.<br />
59 Götte 1957, 42 f.; Fantham 1994, 101: “quiet intimacy”; Vidale 2002, 375.<br />
60 Eur. Alk. 150 f. 181 f. 328–333.<br />
61 z. B. Mercati 2003, 60–62.<br />
62 Zu Eros und Himeros gesellen sich in der Vasenmalerei des Reichen Stils nicht selten Allegorien wie Eunomia und<br />
Eukleia, die dafür sorgen, dass die Gemütsäußerungen in geregelten Bahnen verlaufen, s. B. Borg, Der Logos des<br />
Mythos. Allegorien und Personifikationen in der frühen griechischen Kunst (München 2002) 200–203.<br />
63 Sutton 1981, 232 f.; Reinsberg 1993, 45.<br />
64 Aristot. oec. I, 1344a; III, 144; Isokr. 3, 40.<br />
S e i t e | 25
Vasenmalerei dagegen findet diese Einstellung offensichtlich bereits in der zweiten Hälfte des 5. Jhs v.<br />
Chr. ihren Niederschlag.<br />
S e i t e | 26
2. Die Frau in der Familie: Hausfrau, Ehefrau und Mutter<br />
2. 1. Vorstellungen zur Ehe in den antiken Schriftquellen<br />
2. 1. 1. Die Ehe aus Sicht des Mannes<br />
Es wurde im ersten Kapitel bereits kurz angesprochen, welche Kriterien für die Auswahl des<br />
Ehepartners von Bedeutung waren. Hier soll nun im Folgenden intensiver die Frage beschäftigen, wie<br />
Ehemann und Ehefrau beschaffen sein sollten und was uns die Quellen im Bezug auf die realen<br />
Verhältnisse tatsächlich verraten. Erst dann werden zum Vergleich die Vasenbilder herangezogen.<br />
Die Ehe ist ein Schicksal, dem die jungen athenischen Töchter in der Regel nicht entkommen konnten.<br />
Dabei wird gerne übersehen, dass die griechische Gesellschaft die Ehe nicht nur der Frau, sondern<br />
auch dem Mann auferlegt hat. Dementsprechend ertönt in den antiken Quellen die Klage über das<br />
Übel des Ehestandes nicht nur aus dem Munde der Frauen, sondern auch aus dem der Männer:<br />
„Ein Übel sind die Weiber! Doch ihr alle wisst,<br />
Mitbürger, dass ohn´ Übel niemand hausen kann.<br />
Heiraten ist von Übel, nicht heiraten auch.“ (Susarion fr. 1) 65<br />
In Hesiods äußerst sachlicher Analyse zu den Vor- und Nachteilen der Ehe sprechen letztendlich vor<br />
allem zwei Argumente für die Ehe: eine Ehefrau übernimmt die Pflege ihres Mannes im Alter und<br />
gebärt Kinder, denen der Hausherr seinen Besitz hinterlassen kann, und die nach seinem Tod sein<br />
Andenken ehren. 66 In „Werke und Tage“ gehört das Weib – verschärft formuliert – zum bäuerlichen<br />
Betrieb wie der Viehbestand, 67 die Ehe zum Lebenszyklus des Mannes wie das Bestellen der Äcker.<br />
Immerhin gesteht Hesiod zu, dass die Tatsache, ob sich die Frau letztlich als Segen oder als Fluch<br />
entpuppt, nicht allein von ihrem Geschlecht, sondern individuell vom Charakter der betreffenden<br />
Person abhängig ist:<br />
„Nimmer kann ja der Mann etwas Besseres als eine gute<br />
Frau sich erbeuten, doch auch nichts Schlimmeres als eine böse,<br />
die aufs Essen nur lauert. Denn ohne Fackel versengt sie<br />
auch noch den stärksten Mann und macht ihn vorzeitig altern.“ (Hes. erg. 701–704)<br />
Einen äußerst lebendigen Eindruck vom Dilemma der Männer verschafft uns Semonides in seinem<br />
„Weiber-Jambus“ über die verschiedenen Arten von Frauen. 68 Wenig schmeichelhaft werden ihre<br />
65 Besonders Athenaios bietet seitenweise Exzerpte ehefeindlicher Aussprüche, so z. B. Athen. XIII 559b. d, wo derjenige<br />
verspottet wird, der so dumm war, ein zweites Mal zu heiraten. Im Übrigen kann man derartige Aphorismen auch bei<br />
Menander lesen, der ansonsten eher die Tendenz zur Romantisierung menschlicher Beziehungen hat, z. B. Men. fr. 40.<br />
66 Hes. theog. 603–607. – Zur Rolle der Frau bei Hesiod, s. Mossé 1983, 96 f.<br />
67 Hes. erg. 405–406.<br />
68 Sem. fr. 7 West. – Zur Einordnung des literarischen Genus´, s. auch P. Kranz, Die Frau in der Bildkunst der griechischen<br />
Klassik, in: P. Neukam (Hrsg.), Antike Literatur – Mensch, Sprache, Welt, Klassische Sprachen und Literaturen 34<br />
(München 2000) 59 f. – Zur rituellen Beschimpfung anlässlich der Hochzeit, s. L. Schear, Semonides Frg. 9: Wives and<br />
their Husbands, EchosCl N. S. 3, 1984, 39–49.<br />
S e i t e | 27
Wesensarten mit Tieren und den Elementen Erde und Wasser verglichen, wobei die Frauen allesamt<br />
mit Ausnahme der Bienenkönigin für die Männer ein unerträgliches Übel sind. Sie sind entweder<br />
hässlich, schmutzig, über alle Maßen neugierig, faul, launisch, eitel, verfressen, diebisch oder<br />
verschlagen.<br />
Gar nicht gut ergeht es z. B. Strepsiades, der – selber nur ein Bauer – allen Statusgrenzen zum Trotz<br />
eine Frau aus einer alteingesessenen, athenischen Adelsfamilie geehelicht hat. In dieser<br />
unglückseligen Heirat, wie er sie selbst nennt, machen ihm der gehobene Lebensstandard und das<br />
selbstbewusste Auftreten seiner Frau schwer zu schaffen:<br />
S e i t e | 28<br />
„Da nahm ich, Bauer, aus dem Haus Megakles<br />
Megakles´ Nichte, städtisch, üppig, stolz<br />
Und flott, die eingefleischte Koisyra:<br />
Als ich mit der das Hochzeitsbett bestieg,<br />
Roch ich nach Hefe, Käs und schmutz´ger Wolle,<br />
Sie nach Pomade, Schmink´ und Zungenküsschen,<br />
Hoffart, Verschwendung, Schlemmerei und Buhlschaft.“ (Aristoph. Nub. 45–51)<br />
Die frauenfeindlichen Äußerungen, von denen die antike Literatur unzählige überliefert, haben jedoch<br />
auch eine Kehrseite. Vielerorts schimmert ein anderes Frauenbild hervor: die Vorstellung von der<br />
idealen Frau.<br />
2. 1. 2. Die ideale Ehefrau<br />
Was stellen sich Männer unter einer idealen Ehefrau vor? Trotz massiver Vorbehalte des Semonides<br />
gegen das Frauengeschlecht scheint zumindest seine Bienenkönigin eine für den Mann vertretbare<br />
Spezies von Frau darzustellen:<br />
„Und eine nach der Biene. Wer die kriegt, hat Glück –<br />
Weil ja auf ihr allein kein Tadel sitzen bleibt:<br />
Es blüht, wo sie regiert, und mehrt sich der Besitz,<br />
Sie wird, dem Mann gut, der sie gern hat, mit ihm alt,<br />
Und schön und namhaft ist der Stamm, den sie gebar.<br />
Und deutlich sichtbar ragt sie aus den Frau´n hervor –<br />
Aus allen (göttlich ist der Reiz, der sie umgibt),<br />
Und dort bei Frau´n zu sitzen macht ihr keinen Spaß,<br />
Wo man von seinen Liebessachen sich erzählt.<br />
Ja, solche Frauen macht den Männern zum Geschenk<br />
Zeus als die besten und verständigsten zugleich!” (Semonides, frg. 7 West, 83–93)<br />
Nur eine ideale Haus- und Ehefrau mit tugendhaftem Wesen kann also den Ehemann mit dem<br />
‛Notstand‛ versöhnen und eine erfolgreiche und harmonische Ehe führen. Semonides verrät uns,<br />
welche Eigenschaften an Frauen geschätzt bzw. verabscheut werden. Die perfekte Ehefrau ist schön,<br />
jedem Geschwätz abgeneigt, ihrem Mann ergeben. Sie trägt zum Wohlergehen des Oikos bei und<br />
gebärt hübsche Kinder. Dieser Tugendkatalog kehrt in ähnlicher Form in den antiken Quellen stets
wieder, so z. B. in der Figur der Andromache bei Euripides. Sein gleichnamiges Werk befasst sich<br />
ausgiebig und sehr variantenreich mit dem Thema „Ehe und Liebe“. Es sind sich gleich mehrere<br />
Eheverbindungen gegenübergestellt, die allerdings fast ausnahmslos ein unglückliches Ende fanden. 69<br />
Andromache klärt die eifersüchtige Hermione darüber auf, weshalb deren Ehemann eine andere Frau<br />
bevorzugt:<br />
„Nicht meine Gifte trennen dich vom Mann,<br />
Du bist die Frau nicht, die sich in ihn schickt.<br />
Auch dies bezaubert: nicht nur schöner Leib,<br />
Der Seele Adel fesselt den Gemahl.<br />
[...]<br />
Die Gattin selbst des schlechteren Gemahls<br />
Ist gut zu ihm und fügt sich seinem Sinn. “ (Eur. Andr. 205–214)<br />
In vielerlei Hinsicht wird uns Andromache als ideale Ehefrau präsentiert. In den "Troerinnen" verrät<br />
uns Andromache, welche Zugeständnisse sie an ihre Ehe gemacht hat, um ihrem Ehemann eine<br />
tadellose Ehefrau zu sein:<br />
„Was alle Welt an edlen Frauen rühmt,<br />
Hab ich in Hektors Hallen stets geübt.<br />
Ob eine Frau im bösen Leumund steht,<br />
Ob nicht, so wird ihr dieses schon verargt,<br />
Wenn sie sich außer Haus hält: ich blieb,<br />
Auch wenn das Draußen lockte, im Gemach.<br />
Auch ließ ich Winkelwort der Nachbarfraun<br />
Niemals ins Haus, gebrauchte den Verstand,<br />
Den Gott mir gab, und war mir selbst genug.<br />
Schweigsamen Mund und stilles Auge bot<br />
Ich Hektor, wusste, wo er herrschen muss<br />
Und wo er mir das Herrschen überließ.“ (Eur. Tro. 645–656)<br />
Andromache stellt ausgesprochen hohe Ansprüche an sich selbst. Eine gute Ehefrau dient ihrem Mann<br />
und ihrer Familie; sie demonstriert Scham, indem sie sich vom alltäglichen Geschwätz fernhält,<br />
bevorzugt den Aufenthalt im Haus, um keinen Anlass zu bösem Gerede zu geben. 70 Beinahe könnte<br />
man den Eindruck gewinnen, Andromache stehe nicht höher als eine gehorsame Dienerin. Doch die<br />
letzten beiden Verse zeigen, dass auch sie Einfluss besitzt. Von welcher Art ihre Kompetenzen sind,<br />
verschweigt sie. Die Betonung liegt eher auf ihrer Ergebenheit und auf ihrem Wissen, wie sich eine<br />
69 I. C. Storey, Domestic Disharmony in Euripides´ Andromache, GaR 36, 1989, 16–27. Daneben werden im Hintergrund<br />
auch Anspielungen auf die Ehen von Peleus und Thetis, Menelaos und Helena, Klytemnästra und Agamemnon gemacht,<br />
von denen keine unter die Rubrik „vorbildhaft“ fällt; die eine kam unter Gewaltanwendung zustande, eine scheiterte an<br />
Untreue und die letzte wurde durch einen Mord beendet.<br />
70 M. Lefkowitz, Wives and Husbands, in: I. McAuslan, P. Walcot (Hrsg.), Women in Antiquity (Oxford 1996) 68.<br />
S e i t e | 29
ideale Ehefrau zu verhalten hat. 71 Andromaches Willfährigkeit findet ihren Höhepunkt in Versen, die<br />
I. C. Storey als „bizarre passage“ 72 bezeichnet:<br />
S e i t e | 30<br />
„Du liebster Hektor, wenn dich Kypris je<br />
Betrog, so nahm ichs deinethalb auf mich,<br />
Bot auch den Nebenkindern meine Brust,<br />
Und nie erweckt ich deine Bitterkeit!“ (Eur. Andr. 222–225)<br />
Während sich die Athenerin des 5. Jhs. v. Chr. soweit mit dem Tugendmodell „Andromache“<br />
durchaus identifizieren durfte, empfahl sich die Aufnahme von Bastarden in den Oikos und somit in<br />
die Familie sicherlich nicht als nachahmenswert. 73 Im Gegenteil, im Athen der Klassik war die<br />
Reinhaltung des Oikos heiliges Gebot. Das Gesetz stand eindeutig auf Seiten der legitimen Ehefrauen<br />
und ihrer Kinder. Besonders nach der Perikleischen Gesetzgebung von 451/50 v. Chr. wurde der<br />
Unterschied zwischen legitimer und illegitimer Nachkommenschaft verschärft, eine Anmaßung des<br />
Bürgerrechts unter Vorspiegelung falscher Herkunft streng geahndet. 74 Letztlich zwingt sich die Frage<br />
auf, ob nicht Euripides die extremen Haltungen beider Frauen, Hermiones und Andromaches, als<br />
falsch verurteilt, insofern, als Andromaches Definition weiblicher Arete 75 mit zeitgenössischen<br />
Moralvorstellungen kollidiert.<br />
Schon Semonides war der unerschütterlichen Überzeugung, dass eine gute Ehefrau im Interesse des<br />
Oikos handeln müsse. 76 Auch Xenophon und Aristoteles verstehen die Ehe als Arbeitsgemeinschaft<br />
mit dem einen Ziel, den Besitz des Oikos zu mehren. Xenophon legt der ehelichen Gemeinschaft im<br />
„Oikonomikos“ eine naturgegebene Rollenverteilung zugrunde, die die Arbeiten im Haus der<br />
Verantwortung der Frau, die Angelegenheiten außerhalb des Hauses der Verantwortung des Mannes<br />
unterstellt. Die Ansprüche des Ischomachos an seine Ehefrau werden klar definiert: sie verlangen<br />
einerseits nach einer loyalen und fleißigen Hausfrau, die im Interesse des Oikos handelt, vernünftig<br />
delegieren kann, selbst tatkräftig mit anpackt, Kinder gebärt, die Familie mit Nahrung und Pflege<br />
versorgt und die körperlichen und seelischen Bedürfnisse des Hausherrn erfüllt. Andererseits wünscht<br />
er sich eine offene und ungekünstelte Ehefrau, die keine Gedanken an modische Eitelkeiten<br />
verschwendet, sondern sich so gibt, wie sie ist. 77<br />
Während das Modell der ehelichen Gemeinschaft, wie sie Xenophon entwirft, auf Gleichrangigkeit<br />
beruht, ist das Verhältnis der Geschlechter in den „Oikonomika“ des Aristoteles vor allem hierarchisch<br />
71 Vgl. Aristot. oec. III, 141, wo es auch heißt, dass eine Frau das Haus mit Leichtigkeit regiert, wenn sie sich an einige<br />
Grundregeln hält, wie etwa die, die Überlegenheit ihres Mannes nicht in Frage zu stellen. Beides schließt sich also<br />
offenbar nicht aus.<br />
72 Storey a. O. (Anm. 69) 18.<br />
73 G. Wickert-Micknat, Die Frau, in: F. Matz – H. Buchholz (Hrsg.), Archaeologia Homerica. Die Denkmäler und das<br />
frühgriechische Epos 3 (Göttingen 1988) R 83–86: Die Aufzucht von illegitimen Kindern war in der griechischen<br />
Bronzezeit eine Selbstverständlichkeit. Eine große Nachkommenschaft erhöhte das Prestige.<br />
74 z. B. Lacey 1983, 194 f.; Hartmann 2002, 52–57.<br />
75 Eur. Andr. 222–227.<br />
76 Sem. fr. 7 West, 85–87.<br />
77 Xen. oik. 10, 2–8.
aufgebaut. 78 Die Beziehung des Mannes zu seiner Frau soll zwar von Achtung geprägt sein, die<br />
Unterordnung der Frau unter den Mann könnte jedoch kaum deutlicher gefordert werden: sie muss<br />
gehorsam sein, ohne jemals die Meinung ihres Mannes in Frage zu stellen. Die Frau, deren<br />
Hauptaufgabe auch hier die Besorgung der hausinternen Angelegenheiten ist, wird daran erinnert, dass<br />
Bescheidenheit und eine ehrenvolle Lebensführung ihr besser zu Gesicht stehen als teure Kleidung<br />
und Schmuck. Mittels Charaktereigenschaften wie Geduld, Demut und Nachsicht sei es ihr ein<br />
leichtes, wie es Aristoteles ausdrückt, das Haus zu regieren. 79<br />
Auch Euphiletos erhofft sich von einer Ehefrau eine effektive Hausverwaltung, Loyalität seinem<br />
Oikos gegenüber und einen männlichen Erben. Seine Ehe nimmt einen durchaus Erfolg<br />
versprechenden Anfang, stellt sich seine Ehefrau doch als überaus geschickte Hausfrau heraus.<br />
“In der ersten Zeit nun, ihr Männer von Athen, war sie die beste Frau der Welt, den sie war<br />
überaus tüchtig und sparsam und verwaltete alles genau.” (Lys. 1, 7)<br />
2. 1. 3. Die Ehe aus Sicht der Frau<br />
In der archäologisch-historischen Forschung wird stets proklamiert, die Ehe sei im Athen klassischer<br />
Zeit der wichtigste Einschnitt im Leben einer Frau gewesen. Der Ehestand war sozusagen der<br />
natürliche Zustand einer jeden Frau. Während Demosthenes gar nicht auf den Gedanken kommt, eine<br />
verwitwete Frau könne einer Wiederverheiratung abgeneigt sein, solange sich ihre Familie die Mitgift<br />
leisten konnte 80 , stellen die Tragödien die Ehe dagegen kaum als segensreiche Institution für die<br />
Frauen dar. In Worten, die ihnen freilich Männer in den Mund gelegt haben, drücken die Frauen ihre<br />
negativen Einstellungen zum Ehestand aus. Prokne etwa kritisiert die Heiratspraktiken des<br />
patriarchalischen Griechenlands:<br />
„Doch macht das Mädchenalter uns verständiger, dann stößt man aus dem Haus uns und<br />
verhandelt uns.“ (Soph. Ter. Frg. 583)<br />
Wir haben bereits gesehen, dass sich nicht nur Frauen negativ über die Ehe äußern. 81 Von ihnen nimmt<br />
man jedoch in der Regel an, sie täten dies zu Recht, da sie in der Ehe ja eine untergeordnete Stellung<br />
bekleideten. Bevor man sich nun aber den entsprechenden Textstellen zuwendet, muss man sich klar<br />
machen, dass sie in ihrer Mehrheit der Tragödie entlehnt sind und somit einer Gattung, die in<br />
besonderem Maße dramatische Schicksale zum Inhalt hat.<br />
Vielerorts an erster Stelle zitiert wird, wenn es um die Benachteiligung und Unterdrückung der Frau in<br />
der griechischen Antike geht, der berühmte Monolog Medeas, der die Widrigkeiten weiblichen Lebens<br />
78 Die Ideologie bezüglich der Oikos-Hierarchie wird nicht nur von den Philosophen vertreten, sondern ist auch in der<br />
Komödie greifbar, s. C. Sourvinou-Inwood, Männlich und Weiblich, Öffentlich und Privat, Antik und Modern, in:<br />
Reeder 1995, 113.<br />
79 Aristot. oec. III, 141.<br />
80 Demosth. or. 30, 33; s. auch Hartmann 2007, 70.<br />
81 Gegenbeispiele sind etwa Deianeira oder die junge Klytemnästra, s. Fantham 1994, 71.<br />
S e i t e | 31
eklagt. Er ermöglicht zwar, Einsicht in die Stellung der Frau in der antiken Gesellschaft zu nehmen,<br />
sein Ton und seine Widersprüchlichkeiten gemahnen jedoch zur Vorsicht, nicht jede Aussage für bare<br />
Münze zu nehmen:<br />
S e i t e | 32<br />
„Ach, wir Frauen sind ja von allem Geschöpf,<br />
Das da atmet und fühlt, die unseligste Art:<br />
Wir kaufen mit schwerem Gold den Gemahl,<br />
Ja, schlimmer noch, kaufen den Herrn unsres Leibs<br />
Und er bleibt unser Schicksal, ob gut oder schlecht;<br />
Wir könnens nicht weigern, und Scheidung ist Schimpf.<br />
Was wir nirgends erlernten: In fremden Gebrauch<br />
Uns fügen, erraten die Wünsche des Manns –<br />
Wir müssen es üben. O glückliche Frau,<br />
Die den Mann ohne Zwang zum Gefährten gewann!<br />
Alles andre ist schlimmer als Tod: Was der Mann<br />
Im Hause entbehrt, sucht er außer Haus –<br />
Wir schauen auf ihn als den einzigen Trost.<br />
Man preist unsern Frieden, so fern von der Schlacht:<br />
Lieber dreimal am Feind als einmal Geburt!<br />
Ihr tragt es ja leichter, habt Heimat und Haus,<br />
Verwandte und Güter; ich stehe allein,<br />
Vom Verräter erbeutet im fernen Land,<br />
Ohne Mutter und Bruder, von niemand beschützt. (Eur. Med. 230–258)<br />
Ist dies tatsächlich ein aufrüttelndes Zeugnis für die Verzweiflung der Ehefrauen, die in den Worten<br />
Medeas stellvertretend für all die stummen Frauen Athens zum Ausdruck gebracht wird? 82 Man darf<br />
dem Tragiker Euripides ein außerordentlich feines Gespür für menschliche Emotionen zugestehen, der<br />
Text ist aber nur zum Teil eine sozialhistorische Analyse. Die Rede – wenn auch in Abschnitten<br />
verallgemeinernd – ist zunächst die subjektive Stellungnahme einer mythischen Figur, die vor dem<br />
Hintergrund ihres Erfahrungshorizontes betrachtet werden muss: Die ablehnende und anklagende<br />
Haltung der Institution Ehe gegenüber verbindet sich nun mit einem Resümee zur allgemeinen<br />
Determiniertheit und Abhängigkeit der griechischen Frau. Viele der vorgebrachten Kritikpunkte lassen<br />
sich jedoch entweder nicht auf Medea oder nicht auf die athenische Durchschnittsehefrau übertragen!<br />
Durch die Häufung von Anklagepunkten wird die Lage der Frau weitaus düsterer gezeichnet, als es<br />
wohl der Fall gewesen sein dürfte. Greifen wir uns einige der Vorwürfe heraus und prüfen ihren<br />
Wahrheitsgehalt:<br />
Medea setzt sich durch ihre Wesensart und ihre nichtgriechische Herkunft von Anfang an vom<br />
Prototyp der zeitgenössischen athenischen Frau ab. 83 Medeas Ehe kam denn auch nicht auf dem<br />
üblichen Weg zustande, d. h. sie wurde nicht wie die der Athenerinnen durch den Vater oder Bruder<br />
82 So z. B. E. Cantarella, Pandora´s Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity (Baltimore<br />
1987) 71. – Euripides als Frauenrechtler?, s. Mossé 1983, 110; Pomeroy 1985, 160 f.<br />
83 Fantham 1994, 69: “Medea has maintained the modesty and retirement appropriate to the life of a proper Athenian wife.”
gestiftet. 84 Infolge dessen wurde folglich auch nicht nach griechischer Sitte eine Mitgift ausgesetzt,<br />
durch die ihr Unterhalt während und auch nach der Ehe hätte bestritten werden können. 85 Während es<br />
des Weiteren im Falle athenischer Bürgerstöchter vermutlich zutrifft, dass sie kaum etwas über das<br />
Wesen ihres zukünftigen Ehemanns wussten, hat Medea ihre Entscheidung, Iason nach Griechenland<br />
zu folgen, aus Liebe getroffen 86 , und stellte den Fremden damit über ihre eigene Familie und Heimat. 87<br />
Medeas soziale Desintegration erklärt sich z. T. über ihre exogene Abstammung, denn, wie sie selbst<br />
betont, lebte die verheiratete Frau in ihrer Ehe keineswegs isoliert. Aus vielen anderen Schriftquellen<br />
wissen wir, dass die Ehefrauen in der Regel rege Kontakte mit befreundeten und benachbarten Frauen<br />
pflegten. 88 Medeas prekäre Situation ohne familiären Rückhalt, soziale Kontakte und ohne<br />
persönlichen Besitz, wäre auf das Athen klassischer Zeit übertragen, zumindest was die bürgerliche<br />
Schicht anbelangt, aber wohl eher als Sonderfall zu betrachten.<br />
2. 1. 4. Der ideale Ehemann<br />
Mit der Frage, was sich die antiken griechischen Frauen selbst von der Ehe erhofften, hat sich bereits<br />
M. R. Lefkowitz 89 ausgiebig beschäftigt. Sie kam zu wegweisenden Schlussfolgerungen, die<br />
bestätigen, dass die Griechen ein von Grund auf anderes Bild der Ehe besaßen, dass sich dies aber<br />
keinesfalls nachteilig auf die Stellung der Ehefrau auswirkte. Weshalb hält Penelope so lange an der<br />
Rückkehr ihres Mannes fest, wo sie doch ohne weiteres eine gute Partie hätte machen können?<br />
Weshalb erklärt sich Alkestis bereit, für ihren Mann in den Tod zu gehen? Worin sieht sich Medea<br />
getäuscht und verraten, als sie von Iason verlassen wird? Nicht selten spielen für diese Frauen<br />
persönliche Gefühle eine große Rolle. Die Charakterisierung des idealen Ehemanns gestaltet sich nicht<br />
ganz einfach, kommen die athenischen Ehefrauen doch in der antiken Literatur selbst nicht zu Wort.<br />
Und die antiken Autoren gaben sich mit der Frage, was ihre Ehefrauen von ihnen erwarteten, im<br />
Allgemeinen nicht ab. Wir sind folglich gezwungen, die Untersuchung auf indirektem Wege<br />
anzugehen: Was bringen wir über Männer in Erfahrung, von denen wir wissen, dass ihnen ihre<br />
Gattinnen zugetan waren? Gerade die Tragödien des Euripides bergen viele Informationen zum<br />
Verhältnis zwischen den Geschlechtern, zur emotionalen Bindung innerhalb der Familie und zu den an<br />
die Ehe geknüpften Erwartungen und Verpflichtungen. Obwohl man zum Teil dieser Gattung –<br />
ähnlich wie der Komödie – nur eine geringe objektive Aussagekraft zu den tatsächlichen<br />
84 So auch A. Klöckner, Mordende Mütter. Medea, Prokne und das Motiv der furchtbaren Rachen im klassischen Athen, in:<br />
Fischer – Moraw 2005, 256: Frauen wie Medea und ihr autonomes Verhalten bei der Suche nach einem Lebenspartner<br />
„untergraben den Sinn der Ehe, die eigentlich als Kontrakt zwischen Männern ausgehandelt wird“; Medeas Urteil der<br />
verkauften Braut wird auch vertreten von Keuls 1985, 100 f.<br />
85 C. A. Cox, Household Interests (Princeton 1998) 70 betont die stabilisierende Wirkung der Mitgift auf die Ehe.<br />
86 Eur. Med. 8.<br />
87 Klöckner a. O. (Anm. 84) 260 vertritt die interessante These, Medea erweise sich zwangsläufig als schlechte Ehefrau und<br />
Mutter, nachdem sie sich auch als schlechte Tochter und Schwester herausgestellt hat.<br />
88 Zu weiblicher Schwatzhaftigkeit und gegenseitigen Besuchen, z. B. Eur. Troer. 651 f.; s. auch Kap. 2. 3. 2.<br />
89 M. Lefkowitz, Wives and Husbands, in: I. McAuslan – P. Walcot (Hrsg.), Women in Antiquity (Oxford 1996) 67–82.<br />
S e i t e | 33
Lebensbedingungen und Ansichten der Frauen zugesteht 90 , sind doch die zeitgenössischen<br />
literarischen Werke für uns heute fast die einzige Möglichkeit, die Kultur- und Geistesgeschichte des<br />
klassischen Athen zu rekonstruieren.<br />
Die Figur der Alkestis aus dem gleichnamigen Werk des Euripides ist das Exempel der treuen Gattin<br />
schlechthin. Sie gibt ihr Leben freiwillig hin, um das ihres Mannes zu retten. Doch warum ist sie zu<br />
diesem Opfer bereit? Ihre Liebe zu Admet gründet sich auf seine Zuneigung, Treue und positive<br />
Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Fürsorge. 91 In der Formulierung „am Ehebett hängen“ treffen<br />
wir auf ein Phänomen, das in der griechischen Literatur häufiger begegnet. Das Ehebett, also der<br />
sexuelle Aspekt in der Ehe, wird mit der Ehe selbst gleichsetzt. 92 Die Tragik der Geschichte ist, dass<br />
Admet trotz all seiner guten Eigenschaften letztlich den wahren Liebesbeweis nicht anzutreten im<br />
Stande ist; ihm fehlt der Mut, seinen eigenen Tod zu akzeptieren; er ist bereit, an seiner Statt seine<br />
Ehefrau zu opfern und erweist sich somit als alles andere als ein idealer Ehemann. Dennoch muss man<br />
einräumen, dass er seiner Frau über den Tod hinaus durch den Schwur die Treue hält, sich nie wieder<br />
zu verheiraten.<br />
Der Mythos um Medea dient ebenso dazu zu zeigen, wie ein Ehemann nicht sein sollte. Die Ehe<br />
zwischen Medea und Iason – im Grunde durchaus erfolgreich und mit zwei Söhnen gesegnet – findet<br />
ein abruptes Ende, als Iason sie verstößt, um eine neue Verbindung mit einer Königstochter<br />
einzugehen, von der er sich eine stattliche Mitgift und einen ansehnlichen Prestigezuwachs verspricht:<br />
S e i t e | 34<br />
„All das tat ich für dich, doch du Schurke verrietst,<br />
Mich an neueres Bett, trotz der Söhne; denn wärst<br />
Du noch kinderlos, bliebe die Tat dir verziehn.<br />
Gelten Eide noch? Glaubst du, die Götter von einst<br />
Sind vom Thron gestoßen durch neues Gesetz,<br />
Das den Meineid erlaubt, den du offen begingst? (Eur. Med. 488–495)<br />
Scheidungen waren im zeitgenössischen Athen, wenn auch nicht an der Tagesordnung, so doch<br />
zumindest keine Seltenheit. Die Trennung konnte von der Braut selbst 93 , vom Vater der Braut 94 oder<br />
auf Betreiben des Ehemannes hin initiiert werden, etwa dann wenn die Untreue 95 oder die<br />
90 E. Keuls, The Hetaira and the Housewife. The Splitting of the Female Psyche in Greek Art, MededRom N.S. 9/10, 1983,<br />
25.<br />
91 Dabei ist das Charakterbild, das Euripides von Admetos entwirft, tatsächlich nicht gerade positiv. S. Moraw, Schönheit<br />
und Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher Nacktheit und bürgerlichem Status in der attischen Vasenmalerei, JdI<br />
118, 2003, 37 nennt ihn treffsicher einen „Feigling, Jammerlappen und Schwätzer“. – Für die Liebe sterben, s. F. I.<br />
Zeitlin, Eros, in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia, cultura, arte, società I. Noi e i Greci (Turin 1996) 420 f.<br />
92 Lefkowitz a. O. (Anm. 89) 72.<br />
93 Demosth. or. 30, 26. Zustande kam eine Trennung nur im Einvernehmen mit dem Ehemann, es sei denn sie konnte auf<br />
die Unterstützung ihres Vaters zählen. Es ist ferner nicht ganz auszuschließen, dass die Scheidung in den Augen des<br />
Ehemannes einem Ehrverlust gleichkam, s. z. B. Mossé 1983, 53 f.<br />
94 Demosth. or. 49, 4: Hier beendet ein Streit zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn die Ehe; Harrison 1968, 30 f.<br />
95 Zu moicheia, s. z. B. Patterson 1998, 114–125 mit Quellendiskussion.
Unfruchtbarkeit seiner Ehefrau 96 erwiesen war oder wenn er selbst wie Iason eine bessere Partie in<br />
Aussicht hatte. In den „Gesetzen“ Platons kann die Scheidung auch auf Wunsch beider Seiten<br />
vollzogen werden, wenn sich beide aufgrund einer zu unterschiedlichen Wesensart nicht miteinander<br />
vertragen. 97 Gründe für eine Trennung waren also in großer Anzahl gegeben und durch das athenische<br />
Recht anerkannt. Obwohl wir aus der athenischen Geschichte einige Beispiele kennen, die zeigen, dass<br />
es nichts Ungewöhnliches war, wenn ein Mann sich von seiner ersten Frau trennte, um eine andere zu<br />
heiraten 98 , gewinnt der Leser doch den Eindruck, dass die Schuld für die Auflösung der Haus- und<br />
Ehegemeinschaft eindeutig auf Seiten Iasons liegt. 99 Euripides ist durchaus daran gelegen, Medeas<br />
Verzweiflung und Hass in seinem ganzen Ausmaß und in all seinen Konsequenzen fühlbar zu machen<br />
und als berechtigt zu schildern. 100 Geschickt werden von ihm Medeas Loyalität und Selbstaufopferung<br />
mit der Heimlichtuerei und der Untreue Iasons kontrastiert. 101 Die Tragödie ist in dieser Hinsicht ein<br />
leidenschaftliches Plädoyer für faires Verhalten, Loyalität und Treue in der Ehe.<br />
Xenophons „Oikonomikos“ erweist sich bezüglich der idealen Ehefrau als ergiebige Quelle. Da das<br />
philosophische Lehrgespräch jedoch aus der männlichen Perspektive heraus geführt wird, dürfen wir<br />
auf die Frage, was sich die Frau von der Ehe erhofft und was in ihren Augen einen guten Ehemann<br />
ausmacht, keine sehr ausführliche Antwort erwarten. Auf die Frage des Ischomachos, ob ihr ein<br />
ehrlicher Mann oder ein Heuchler und Gaukler lieber wäre, antwortet sie mit Nachdruck, sie ziehe<br />
einen aufrichtigen Mann vor, denn nur den könne sie „von Herzen gern haben“. 102 Dies ist im Grunde<br />
die einzige persönliche Äußerung von Seiten der Ehefrau, die zumeist nur zustimmende Antworten<br />
von sich gibt. Dennoch wird aus der Passage ersichtlich, dass das Ehearrangement nicht nur zu<br />
96 Kinderlosigkeit war in der besitzorientierten Gesellschaft Athens mit ihren kompromisslosen Erbgesetzen durchaus ein<br />
gewichtiges Problem, das viele kinderlose Männer bewogen haben dürfte, sich nach einer neuen Ehefrau umzutun. Nur<br />
vereinzelt werden persönliche Gefühle stärker gewesen sein als soziales oder politisches Kalkül. Nach Is. 2, 6–9 trennt<br />
sich Menekles uneigennützig und erst nach einigem Zögern von seiner Frau, weil er ihr noch eine Chance auf eine<br />
kinderreiche Familie geben möchte.<br />
97 Plat. leg. 929e–930a; Harrison 1968, 39. 134 f.: Ein Sonderfall war die Epikleros, die zum Zwecke der Verheiratung mit<br />
ihrem nächsten männlichen Verwandten von ihrem Ehemann geschieden wurde, wenn sie bis dato noch keine Kinder<br />
geboren hatte, auf die ihr väterliches Erbe dann übergehen konnte<br />
98 z. B. Demosth. or. 55, 28: Pasio verfügt testamentarisch die Wiederverheiratung seiner Ehefrau mit Phormio. In vielen<br />
Fällen wurde die geschiedene Frau gar nicht erst in den Schoß ihrer Familie zurückgeschickt, sondern durch ihren<br />
Ehemann mit einem passenden Kandidaten, der nicht selten aus der Verwandtschaft ihres Ex-Ehemannes stammte,<br />
verheiratet, vgl. Plut. Per. 24; Demosth. or. 57, 41ff.; s. auch C. A. Cox, Household Interests (Princeton 1998) 72.<br />
99 Sutton 2004, 328: Die antike Ehe basierte auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Medea spricht mehrfach z B. in Eur.<br />
Med. 160–165. 465–468. 492–495 davon, dass Iasons Eidbruch wider die Götter sei.<br />
100 Reinsberg 1993, 45 f.<br />
101 Z. B. Eur. Med. 586 f.: „Wärst du ehrlich, du hättest den neueren Bund mit der Gattin beraten, nicht vor ihr versteckt.“<br />
Iason wird von A. Klöckner, Mordende Mütter. Medea, Prokne und das Motiv der furchtbaren Rachen im klassischen<br />
Athen, in: Fischer – Moraw 2005, 257 als „wortbrüchiger Opportunist, der für sein schändliches Verhalten Verachtung“<br />
verdient, umschrieben; ähnlich S. Moraw, Schönheit und Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher Nacktheit und<br />
bürgerlichem Status in der attischen Vasenmalerei, JdI 118, 2003, 37 f.<br />
102 Xen. oik. 10, 4. Das Lexikon gibt eine große Bandbreite an Bedeutungen des Wortes aspasasthai wieder, die dennoch<br />
sehr aufschlussreich sind: sie reicht von freundlich willkommen heißen bis zu umarmen, küssen, liebkosen und gern<br />
haben.<br />
S e i t e | 35
eiderseitiger Zufriedenheit geregelt ist, sondern auch Liebe oder Zuneigung miteinkalkuliert wird,<br />
eine willkommene Nebenerscheinung dieses nützlichen Arrangements!<br />
Das dritte Buch der „Oikonomika“ des Pseudo-Aristoteles widmet sich der Definition der weiblichen<br />
und männlichen Rollen im Oikos und beleuchtet auch das Verhältnis von Mann und Frau zueinander.<br />
Nachdem die an die Ehefrau gestellten Ansprüche erläutert wurden, wendet sich Aristoteles der<br />
Gegenseite zu. Denn obwohl eine strikte hierarchische Ordnung die Frau dem Mann unterordnet 103 , ist<br />
die Beziehung der Eheleute nicht vorrangig durch die Unterwürfigkeit der Frau geprägt. Treue,<br />
Fürsorge, Vertrauen, Achtung, Freundschaft und Zuverlässigkeit sind die Gegenleistungen des<br />
Mannes. 104 Er wird ermahnt, stets Respekt und Schamgefühl zu wahren, Zurückhaltung gegenüber<br />
kleinen Fehlern zu üben und die „Teilhaberin an Elternschaft und Leben“ mehr als alles andere – mit<br />
Ausnahme seiner eigenen Eltern – zu ehren. Sein Anliegen solle sein, sie so zu unterweisen, dass er<br />
die beste und wertvollste Ehefrau sein eigen nennen könne, um dann mit der besten und wertvollsten<br />
Frau Kinder zu zeugen. 105<br />
Zum Teil stellen die Frauen jedoch auch weitreichendere Ansprüche an ihren Ehemann. Ein Auszug<br />
aus Platons „Staat“ zeigt, dass nicht nur die Polis Forderungen nach Beteiligung an den<br />
Staatsgeschäften, Gerichtsprozessen und militärischen Aktionen an den athenischen Bürger stellt.<br />
Nein, manche Ehefrau bestärkt ihren Gatten in seinen politischen Ambitionen, um nicht ganz<br />
uneigennützig den eigenen sozialen Status im Freundes- und Frauenkreis aufzubessern. Geht es nach<br />
Platon, geschieht dies bisweilen mit großem Nachdruck:<br />
S e i t e | 36<br />
“Zuerst, sagte ich, hört er von seiner Mutter, wie sie darüber klagt, dass ihr Mann nicht zu<br />
den Regenten gehört und dass sie deswegen von den übrigen Frauen zurückgesetzt wird.<br />
Und sie sehe auch, dass er sich nicht besonders um sein Vermögen kümmere und dass er<br />
nicht mit Taten und nicht mit Worten zu streiten wisse, weder in eigenen Angelegenheiten<br />
vor Gericht, noch in öffentlichen Dingen, sondern all dem gleichgültig gegenüberstehe.“<br />
(Plat. Pol. 549c–d)<br />
Gleichzeitig besteht sie auch auf Aufmerksamkeit und Respektsbezeugung. Obwohl in diesem Text<br />
der durch Xanthippe wohlbekannte Typus der „nagging housewife“ durchklingt, die selten zufrieden<br />
zu stellen ist und sich vehement beklagt, so beweist dies doch, dass zwischen Ehepartnern eine<br />
persönliche Beziehung bestand, die von beidseitigen Ansprüchen geprägt war, und dass hier von<br />
Gleichgültigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung nicht die Rede sein kann. Während in unseren ersten<br />
Beispielen die Ansprüche der Ehefrau abstrakten Wert besaßen, beziehen sich die anderer Frauen auf<br />
weit Handfesteres, nämlich auf das Geld. Xanthippos, ein Sohn des Perikles, besaß in seiner Gattin<br />
eine Frau, die hohe Anforderungen an ihren Lebensstandard stellte:<br />
103 Aristot. oec. III, 141.<br />
„Xanthippos, der ältere seiner vollbürtigen Söhne, neigte von Natur zur Verschwendung,<br />
und da auch seine junge Frau – es war eine Tochter des Teisandros, eine Enkelin des<br />
Epilykos – große Ansprüche stellte, konnte er sich mit der peinlichen Genauigkeit seines<br />
104 Aristot. oec. III, 144; Reinsberg 1993, 46.<br />
105 Aristot. oec. III, 142–143.
Vaters, der ihm das Geld in kleinen Summen kärglich zuzählte, nur schwer abfinden.“<br />
(Plut. Per. 36)<br />
Auch der herzliche Empfang des Philokleon durch die weiblichen Mitglieder seines Haushaltes ist<br />
eigentlich mehr ein geheucheltes Umschmeicheln und dient in erster Linie dazu, ihm seinen Tagessold<br />
abzuluchsen:<br />
„Ich komme nach Haus, mit der Löhnung im Maul, da umringen mich alle begrüßend<br />
Und tun mir gar schön von wegen des Gelds, und mein Töchterchen wischt gar behende<br />
jedes Stäubchen mir ab und salbt mir die Füß´ und umhalst mich und drückt mich und<br />
hätschelt<br />
Und küsst mich: „Mein Papachen!“ und fischt die drei Obolen ´raus mit der Zunge!<br />
Mein Weibchen auch kommt und liebkost mich und bringt mir gebackene Küchlein<br />
Und setzt sich zu mir und nötigt mich, ach, und wie freundlich: "Mein Alterchen, iss doch,<br />
Greif zu. “ (Aristoph. Vesp. 606–612)<br />
2. 1. 5. Zusammenfassung<br />
Die eheliche Gemeinschaft war in der griechischen Klassik auf ein übergeordnetes, klar definiertes<br />
Ziel hin ausgerichtet: die Blüte des Oikos, die Mehrung des Besitzes und das Zeugen von<br />
Nachkommen. Das Rollenmodell der griechischen Frau orientiert sich deshalb an ihrer sozialen<br />
Funktion als Ehefrau und Hausverwalterin. Als Ehefrau durfte sie keine hervorstechenden<br />
menschlichen Schwächen aufweisen, die sie zu einer unangenehmen Lebensgefährtin machen. Ihre<br />
größten Tugenden waren ihr Gehorsam und ihr Gefühl für Anstand. Als Hausverwalterin war es nötig,<br />
dass sie über ausreichend Sachverstand verfügte, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Charakterschwächen<br />
wie Eitelkeit, Faulheit, Verschwendungssucht waren Gift für das Wohlergehen des Oikos. Als<br />
weibliches Wesen musste sie ihrer biologischen Vorbestimmung gerecht werden und fruchtbar sein.<br />
Trotz vieler weiblicher Hauptakteure in den Tragödien und Komödien bleibt das Bild der Frau in der<br />
antiken Literatur als solches eher stereotyp. Die Frau als agierendes Individuum in der griechischen<br />
Gesellschaft wird von der weiblichen Rollenideologie verdeckt. Das Interesse der antiken Autoren war<br />
in erster Linie auf die Bedeutung der Frauen für den Oikos gerichtet, da diese zum einen durch Arbeit<br />
und Tugend die Produktivität und das öffentliche Ansehen des Oikos steigerten, und durch ihre<br />
Fähigkeit, neues Leben zu schenken, es den Männern außerdem ermöglichten, das durch eigene<br />
Leistung oder Erbe Erwirtschaftete an die nächste Generation weiterzugeben. Die bürgerliche und in<br />
der Regel verheiratete Frau definierte sich und wurde definiert durch ihre Funktion als Ehefrau,<br />
Hausfrau und Mutter.<br />
Ungeachtet all jener Wunschvorstellungen zum idealen Ehepartner war es damals wie heute<br />
vermutlich unabsehbar, ob eine Ehe glücklich sein oder scheitern würde. Es ging vorrangig auch nicht<br />
um persönliches Glück, sondern um ein allen zum Nutzen gereichendes Arrangement. Natürlich<br />
berichten die Quellen von Ehebrüchen, Affären, von Männern, die ihren Frauen eben nicht den<br />
gebührenden Respekt entgegenbringen, den Xenophon für eine Ehe in Eintracht als unabdingbar<br />
S e i t e | 37
erachtet. So beleidigte Alkibiades seine Frau nicht nur durch seine diversen Frauengeschichten,<br />
sondern verwehrte ihr auch die Scheidung. 106 Mancher Mann mag strengere Moralansichten gehabt<br />
haben als ein anderer und seiner Frau untersagt haben, das Haus zu verlassen. In der "Lysistrate" wird<br />
auf Schläge hingewiesen, und bei Einmischung in politische Angelegenheiten wird ihnen grob<br />
Schweigen geboten 107 . Mancher mag mit seiner Frau nur selten ein Wort gewechselt 108 , mancher das<br />
Joch der Ehe verflucht haben 109 . Es gab schwierige Frauen wie Xanthippe, die mit ihrem Geifer und<br />
Gekeife ihre männliche Umwelt tyrannisierten 110 , und wahrscheinlich auch Frauen, die ihren Männern<br />
falsche Kinder unterschoben, die Vorratskammer plünderten und alles in allem eben nicht so<br />
vorbildliche Führungspersonen waren, wie sie uns Xenophon vorführt.<br />
Auf Seiten der Männer gab es Feiglinge, Männer ohne politische Ambitionen oder feine Bildung,<br />
Geizhälse und Grobiane. Männer, die ihre Frauen eifersüchtig bewachten, ihnen das Wort verboten<br />
oder sie ignorierten. Solche, die ihren Frauen Selbständigkeit zugestanden, die sie achteten und ihnen<br />
Zuneigung bekundeten, andere, die unter ihrem Pantoffel standen, ebenso wie Männer, die lieber ins<br />
Bordell gingen oder mit Knaben in der Palästra flirteten.<br />
106 Athen. XIII 574d–e; Plut. Alk. 8. In der Sekundärliteratur ist des häufigeren zu lesen, dass Hipparete erbost darüber war,<br />
dass Alkibiades Hetären in ihrem gemeinsamen Haus einquartiert habe. Das entsprechende Verb syneinai bei Plutarch ist<br />
jedoch kein Synonym für synoikein. – Zum Wortgebrauch von synoikein, s. z. B. J.-P. Vernant, Mythos und Gesellschaft<br />
im antiken Griechenland (Frankfurt a. M. 1987) 53 f.; Hartmann 2002, 57 f.<br />
107 Sem. Fr. 7 West, 16–18; Aristoph. Lys. 160–166. 507–520. – Gewalt gegen Frauen, s. z. B. N. Fisher, Violence,<br />
Masculinity and the Law in Classical Athens, in: L. Foxhall – J. Salomon (Hrsg.), When Men were Men. Masculinity,<br />
Power and Identity in Classical Antiquity (London 1998) 77; W. Schmitz, Gewalt in Haus und Familie, in: Fischer –<br />
Moraw 2005, 120–122.<br />
108 Xen. oik. 3, 12.<br />
109 Sem. fr. 7 West; Hes. theog. 702–705; Eur. Med. 233–249; Susarion fr. 1.<br />
110 Xen. mem. 1, 2, 7: „[...] so dürfte doch niemand imstande sein, ihre Heftigkeit zu ertragen.“ und 1, 2, 8: „[...] sie sagt<br />
einem Dinge, die man nicht ums ganze Leben hören möchte“; s. auch Xen. symp. 2, 10; Plat. Phaid. 60a: dazu B.<br />
Pomeroy 1985, 119: „Die Grobheit, mit der Sokrates seine Frau Xanthippe vor seinem Tod fortschickte, um im Kreise<br />
seiner männlichen Gefährten zu sterben, weist in eindringlicher, wenn auch übertriebener Weise auf den emotionalen<br />
Abgrund hin, der zwischen dem Ehemann und seiner Frau klaffte.“ – Eine Zitatensammlung zu Xanthippe jüngst<br />
vorgelegt von K. Bartels, Xanthippe, wie sie leibt und lebt, AW 2006, 112.<br />
S e i t e | 38
2. 2. Die ideale Haus- und Ehefrau in Xenophons „Oikonomikos“<br />
Dass die gute Ehefrau in der griechischen Antike an ihrer Tüchtigkeit gemessen wurde, dürfte<br />
ausreichend deutlich geworden sein. 111 Das Führen des gemeinsamen Oikos war ein wesentliches<br />
Charakteristikum der antiken griechischen Ehe. Eine nützliche Frau war eine gute Frau. Erwies sich<br />
eine Frau im Haushalt als geschickt, fleißig und tugendsam machte sie ihrem Mann Freude. Aus<br />
Zufriedenheit resultierte dann im Idealfall Wertschätzung, Vertrauen und Respekt, die in der Antike<br />
für wertvoller erachtet wurde als die romantische Liebe, die wir heute für den Ehebund als<br />
unverzichtbar erachten. 112<br />
Die beiden ergiebigsten Quellen für den Aufgabenkatalog der Hausfrau und die Position der Frau in<br />
der ehelichen Gemeinschaft sind der „Oikonomikos“ Xenophons 113 und die „Oikonomika“ des<br />
Pseudo-Aristoteles 114 . Wir wollen uns v. a. ausführlich ersterem zuwenden. Das Gespräch mit<br />
Ischomachos ist im „Oikokonomikos“ Teil eines übergeordneten Diskurses, in dem Sokrates die<br />
Hypothese aufstellt, Kunstfertigkeit erziele man in jedwedem Bereich allein durch Anwendung<br />
fachspezifischen Wissens. Ein Bauer muss wissen, wie er seine Erde fruchtbar macht, welche Saat am<br />
besten gedeiht und wann die Zeit zur Aussaat und zur Ernte gekommen ist. Auch der Haushalt ist eine<br />
ökonomische Institution, deren Wohlergehen von einer fachkundigen Verwaltung abhängig ist.<br />
Ischomachos, ein Mann aus gutem Haus, scheint angesichts seines florierenden Oikos genau der<br />
richtige Ansprechpartner für Sokrates zu sein, um in Erfahrung zu bringen, welches Wissen hier<br />
vonnöten ist. Es ist generell problematisch zu entscheiden, wer in der Antike als Adressat solcher<br />
philosophischen Gespräche in Frage kam. Ganz offensichtlich konnte dies in der Regel aber nur eine<br />
kleine Oberschicht sein, die das Interesse dafür aufbrachte und die erforderliche Bildung besaß, auch<br />
wenn das Thema an sich für jeden athenischen Haushalt relevant war. 115 Offenbar hält Xenophon seine<br />
männlichen Leser dazu an, ebenso wie Ischomachos der eigenen Ehefrau Ratschläge zur vorteilhaften<br />
Organisation und Verwaltung der Hausangelegenheiten mit auf den Weg zu geben, um so dafür zu<br />
sorgen, dass der Oikos bestmöglich verwaltet wird. 116<br />
111 Vgl. Grabepigramme, die auf häusliche Tugenden Bezug nehmen: Melite wird mehrfach als gute, ja sogar als beste Frau<br />
bezeichnet, die ihren Mann liebte und von ihm wiedergeliebt wurde und der nun ihren Tod aufrichtig betrauert (IG II/III²,<br />
12067). Phainippe wird in ihrem Grabepigramm ihrer Arete und ihrer Sophrosyne wegen gelobt (Peek 1654). Dionysia,<br />
eine junge Frau von großer Schönheit, hat sich zu Lebzeiten durch ihre Sophrosyne und die Liebe zu ihrem Mann<br />
ausgezeichnet. (IG II², 11162) Von Archestrate heißt es, dass ihr Ehemann sie, die gut und besonnen war, im Tode<br />
schmerzlich vermisst (IG II², 10864). Zu gerühmten weiblichen Tugenden, s. auch Humphreys 1983, 107–110; C.<br />
Sourvinou-Inwood, Männlich und Weiblich, Öffentlich und Privat, Antik und Modern, in: Reeder 1995, 117 f.<br />
112 s. auch Sutton 2004, 328.<br />
113 Allg. Pomeroy 1994.<br />
114 Aristoteles, Oikonomika. Schriften zu Hauswirtschaft und Finanzwesen, übers. und erl. von R. Zoepffel (Berlin 2006).<br />
115 Wiemer 2005, 429; Kreilinger 2007, 21. Ebenso wird es sich nur die Oberschicht leisten haben können, auf die Mitarbeit<br />
der Frauen außerhalb des Hauses zu verzichten, s. z. B. W. Scheidel, Frau und Landarbeit in der Alten Geschichte, in: E.<br />
Specht (Hrsg.), Nachrichten aus der Zeit. Ein Streifzug durch die Frauengeschichte des Altertums (Wien 1992) 198.<br />
116 Reuthner 2006, 117 f. fragt sich aufgrund bestimmter Anspielungen in der Komödie, ob nicht auch im 5. Jh. v. Chr.<br />
Unterweisungen in der Haushaltsführung durch Lehrer üblich waren.<br />
S e i t e | 39
Bei der Lektüre des „Oikonomikos“ wird schnell offensichtlich, dass sich der Begriff „Oikos“ nicht<br />
nur auf die Geschehnisse innerhalb des Hauses bezieht. 117 Eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung<br />
sieht die Besorgung der Angelegenheiten des Hauses als Domäne der Frau, die der Geschäfte<br />
außerhalb des Hauses als Domäne des Mannes an:<br />
S e i t e | 40<br />
„Da aber die Arbeiten drinnen und draußen beide der Ausführung und der Aufsicht<br />
bedürfen, hat der Gott, so habe er gesagt, von vorneherein die Natur entsprechend<br />
eingerichtet, und zwar, wie es mir scheint, die der Frau für die Arbeiten und<br />
Beschäftigungen im Inneren des Hauses, die des Mannes für die Arbeiten und<br />
Beschäftigungen im Freien.“ (Xen. oik. 7, 22) 118<br />
Während der Mann sich um seinen Landbesitz kümmert, an Volksversammlungen teilnimmt, auf der<br />
Agora Freunde trifft und Geschäfte erledigt, Beziehungen knüpft und Einkäufe tätigt, wie es seiner<br />
robusteren Natur zukommt, beaufsichtigt die Frau im Haus ihre Kinder und Sklaven, hält letztere zur<br />
Arbeit an, webt, kocht, putzt und pflegt Kranke. Sie tut also das, was noch heute mancher verächtlich<br />
als „Hausarbeit“ bezeichnet. Die Aufgaben der Ehefrau werden aufgelistet, doch nur eine einzige wird<br />
im Detail erörtert: das optimale Aufbewahren und Verstauen von Gütern und Gegenständen. Objekte<br />
sollen dort abgelegt werden, wo sie gebraucht werden, sie sollen gemäß ihren besonderen<br />
Anforderungen aufbewahrt werden – Nahrungsmittel sollen kühl oder trocken gelagert werden – und<br />
Dinge, die jeden Tag benutzt werden, sollen griffbereit sein, während andere Dinge, die nur zu<br />
speziellen Gelegenheiten oder saisonal bedingt hervorgeholt werden, gut verstaut werden sollen. 119<br />
So wenig dies Feministinnen in unserem Zeitalter der Gleichberechtigung und Selbstdefinierung der<br />
Frau gefallen mag, die oben angesprochene Rollenverteilung hat eine Jahrtausende lange Tradition,<br />
deren Berechtigung oder Richtigkeit erst in den letzten Jahrzehnten hinterfragt und außer Kraft gesetzt<br />
wurde. 120 Dieses Rollenschema wird von Xenophon als natürliche Fügung begründet, keineswegs dazu<br />
gedacht, der Frau im Oikos eine niedrigere Stellung zuzuweisen. 121 Ischomachos erklärt die<br />
Ehegemeinschaft vielmehr zur gleichberechtigten Partnerschaft, koinonia, zu der jeder und jede nach<br />
bestem Können beitrage. 122 Mann und Frau haben gleichen Anteil am "Besitz" des anderen, ihn zu<br />
117 Zu Begriff und Definition von Oikos, s. allg. C. A. Cox, Household Interests (Princeton 1998) 130–167.<br />
118 Dasselbe Prinzip der Arbeitsteilung findet sich in ähnlicher Form dann ungefähr eine Generation später in den<br />
„Oikonomika“ des Pseudo-Aristoteles wieder, Aristot. oec. I, 1343b: „Denn sie (die Natur) hat eine Unterscheidung<br />
zwischen ihnen dadurch gemacht, dass Mann und Frau nicht auf den gleichen Gebieten in jeder Beziehung nützliche<br />
Kräfte besitzen, sondern zum Teil sogar solche, die einander zwar entgegengesetzt, aber auf das gleiche Ziel hin gerichtet<br />
sind.“<br />
119 Xen. oik. 8, 9–23.<br />
120 Pomeroy 1994, 88 ff. Die Autorin widmet der Sache ein eigenes Kapitel mit dem Titel „Feminism and the<br />
Oeconomicus". – Zur Neuevaluierung der weiblichen Arbeit in der Antike, s. jüngst Reuthner 2006.<br />
121 Reuthner 2006, 91–96. 106 f.: im Vergleich zu Platons zeitgleichen Werken zeichnet sich der „Oikonomikos“ des<br />
Xenophon durch eine Wertschätzung der weiblichen Produktivität aus; Bundrick 2008, 310 f.<br />
122 Xen. oik. 7, 11; Just 1989, 114 umschreibt Ischomachos als “free-thinking liberal in his treatment of his wife”; Pomeroy<br />
1994, 37; Schnurr-Redford 1996, 74 f.; Hartmann 2002, 126; dies., Geschlechterdefinitionen im attischen Recht.<br />
Bemerkungen zur kyrieia, in: E. Hartmann – K. Pietner – U. Hartmann (Hrsg.), Geschlechterdefinitionen und<br />
Geschlechtergrenzen in der Antike (Stuttgart 2007) 71 f.
ewahren und zu mehren liegt in beider Interesse. 123 „Rather than polarizing husband and wife, he<br />
views their familial and economic roles as complementary; therefore they never cease to need one<br />
another” 124 , kommentiert S. Pomeroy.<br />
Wir halten also fest, dass die Verwaltung des Haushaltes zum großen Teil der Frau oblag. Bereits mit<br />
14 Jahren verheiratet, hat die junge Ehefrau des Ischomachos von der Welt um sich herum wenig<br />
gesehen und gehört. Sie beherrscht die Kunst des Webens von Textilien und hat gelernt, wie es<br />
wörtlich heißt, „ihren Appetit zu kontrollieren“. 125 Der Besitz von Sophrosyne, die Fähigkeit zur<br />
Maßhaltung und Selbstkontrolle, kann als Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Führen eines<br />
Haushaltes angesehen werden. Von der Haushaltslehre selbst hat die junge Frau aber offenbar keine<br />
Ahnung. Nicht ganz kritiklos wurde die Art und Weise hingenommen, in der die junge Frau als<br />
Neuankömmling im Haus ihres Ehemanns von diesem instruiert wird. 126 Das Bild vom geduldigen<br />
Lehrer und der gelehrigen Schülerin wirft ein deutliches Licht auf das Verhältnis der Geschlechter in<br />
dieser von Männern dominierten Gesellschaft und unterstreicht insbesondere die unterschiedlichen<br />
Reifestadien von Ehemann und Ehefrau zum Zeitpunkt ihrer Verheiratung. Eine reale Gleichstellung<br />
von Mann und Frau wird also auch in Xenophons „Oikonomikos“ nur sehr bedingt erreicht.<br />
Eine Einführung in die Kunst des Haushaltens dürfte in der Regel vermutlich nicht erst in der Ehe<br />
durch den Ehemann oder die Schwiegermutter, sondern schon früher durch die Mutter erfolgt sein, um<br />
die Tochter auf ihr späteres Leben als Ehefrau vorzubereiten. 127 Ansatzweise finden wir durchaus<br />
Hinweise, dass von den Töchtern des Hauses neben dem obligatorischen Weben auch Hilfe beim<br />
Hüten der kleineren Geschwister und bei kleineren Haushaltsarbeiten erwartet wurde. 128 Wie hoch die<br />
Inanspruchnahme solch kleiner familiärer Pflichten letztlich war, hing mit Sicherheit vom Reichtum<br />
des Familienoberhauptes und von der Anzahl der Sklaven ab. All die genannten, der Ehefrau<br />
zugewiesenen Tätigkeiten sind Bestandteil des Alltags und eines reibungslos funktionierenden Oikos,<br />
die auf die Erfüllung täglicher Bedürfnisse, das Wohlergehen der Familie und auf den Erhalt der<br />
Ordnung ausgerichtet waren. Die Aufgaben der idealen Hausfrau, die im Verlauf des Gesprächs<br />
zwischen Sokrates und Ischomachos aufgezählt werden, erfordern mehr gesunden Menschenverstand,<br />
Veranlagung und Übung als erlerntes fachspezifisches Wissen, wie es dagegen etwa das Spinnen und<br />
Weben erfordert. 129 Dass ein 14jähriges Mädchen, das erstmals auf eigene Verantwortung einen<br />
123 Xen. oik. 7, 15; Just 1989, 117; L. Foxhall, Household, Gender and Property in Classical Athens, ClQ 39, 1989, 23;<br />
Pomeroy 1994, 60 f.; Reuthner 2006, 96 erkennt im „Oikonomikos“ ein agonales Prinzip, das die Eheleute anspornen<br />
soll, effektiv zu wirtschaften.<br />
124 Pomeroy 1994, 36.<br />
125 Xen. oik. 7, 5–6.<br />
126 D. C. Richter, The Position of Women in Classical Athens, ClJ 67, 1971, 4 spricht von einer überlegenen Erfahrung und<br />
gleichzeitigem Stolz auf die Gelehrsamkeit der Ehefrau; W. Schuller, Haushalt, in: Hoepfner 1999, 546.<br />
127 Zum Grundwissen junger Frauen, s. Reuthner 2006, 117f. 124–126; H. Foley, Mothers and Daughters, in: Neils – Oakley<br />
2003, 120 setzt der Gattin des Ischomachos die Gattin des Euphiletos entgegen.<br />
128 M. Golden, Children and Childhood in Classical Athens (Baltimore 1990) 33–35. 128: Die Mithilfe von Jugendlichen in<br />
armen Familien nimmt eher die Form von Kinderarbeit an und ist von gelegentlicher Hilfeleistung in wohlhabenden<br />
Familien zu trennen.<br />
129 Mossé 1983, 36 f.; S. Moraw, Was sind Frauen? Bilder bürgerlicher Frauen im klassischen Athen, in: W. D. Heilmeyer –<br />
M. Maischberger (Hrsg.), Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Ausstellungskatalog Berlin – Bonn (Berlin<br />
2002) 303; Wiemer 2005, 432.<br />
S e i t e | 41
Haushalt verwaltet, über keine diesbezügliche Erfahrung verfügen kann, steht außer Diskussion. Auf<br />
der anderen Seite stellt sich die Frage, inwieweit der Bräutigam selbst, der in der Regel erst mit der<br />
Hochzeit Herr seines eigenen Oikos bzw. des Oikos seines Vaters wurde, im Metier der<br />
Haushaltsführung geschult sein kann, um wie Ischomachos seiner Frau überhaupt Ratschläge erteilen<br />
zu können? Pragmatismus scheint den Männern offensichtlich angeboren!<br />
Es handelt sich bei Xenophons Werk um ein Schriftstück mit didaktischem Anspruch, in dem die<br />
betreffenden Personen mustergültig agieren. Besonders die noch kindliche Ehefrau ist nach einem<br />
Tugendkatalog entworfen, der stellvertretend für die zeitgenössische Gesellschaft des 4. Jhs. v. Chr.<br />
steht: sie ist jung, hübsch, zurückhaltend, gehorsam, aber auch klug und ambitioniert, alle Ratschläge<br />
in die Tat umzusetzen. 130<br />
S e i t e | 42<br />
2. 3. Die Bewegungsfreiheit der verheirateten Frau<br />
Die Vielschichtigkeit der Quellengattungen und ihre z. T. doch recht widersprüchlichen Aussagen<br />
ließen Raum für subjektive Bewertungen der sozialen Stellung der Frau und deren Möglichkeiten im<br />
öffentlichen Bereich. 131 Die Frau erfüllte im antiken Griechenland ebenso wie in späteren<br />
Generationen im Wesentlichen die Rolle der Hausfrau und Mutter. Was das Urteil über die antike Frau<br />
nachhaltig verdüsterte, waren nicht ihre häuslichen Pflichten an sich, sondern die feste Überzeugung,<br />
dass sie zudem kaum jemals das Haus verließ 132 und dem Manne als rechtloses Objekt auf Gedeih und<br />
Verderb ausgeliefert war. In diesem Sinn schreibt etwa D. Lübke: „Die frauenunfreundliche<br />
athenische Demokratie eliminierte die Frauen aus dem öffentlichen Leben, wies ihnen das Haus und,<br />
es kommt noch ärger, im Haus die Küche, das Kinderzimmer und das Gynaikeion (Frauengemach) als<br />
Betätigungsfeld zu. Rechtlich stand die Bürger-Frau, wie jeder andere zum oikos gehörende tote oder<br />
lebende Hausrat, unter der Verfügungsgewalt des Hausvaters.“ 133 In der benachteiligten juristischen<br />
Stellung der griechischen Frauen und ihrem Ausschluss aus dem politischen Leben sieht auch C.<br />
Reinsberg die Ursache für ihre Abhängigkeit und Unterlegenheit: „Die rechtliche Unmündigkeit und<br />
Abhängigkeit griechischer Ehefrauen spiegelt sich wider in ihrer sozialen Situation, der Enge ihres<br />
bürgerlichen Existenzraumes und der Ausgrenzung von jeder Öffentlichkeit. Die mangelhafte<br />
130 Durch glückliche Umstände haben wir Kenntnis vom weiteren Schicksal Chrysillas, der im “Oikonomikos” noch<br />
anonymen Ehefrau des Ischomachos. Vom Bild der perfekten Ehefrau lässt die Realität nicht viel übrig, s. And. 1, 124<br />
ff.: Nach dem Tod des Ischomachos beginnt sie eine Affäre mit ihrem Schwiegersohn. Ihre Tochter ist darüber so<br />
unglücklich, dass sie sich zu erhängen versucht; s. z. B. H. Foley, Mothers and Daughters, in: Neils – Oakley 2003, 129<br />
f.; Hartmann 2007, 64–67. 76 f.<br />
131 Wegweisend z. B. A. W. Gomme, The Position of Women in Athens in the fifth and fourth Centuries, CP 20, 1925, 1–25;<br />
s. auch B. Wagner-Hasel, Women´s Life in Oriental Seclusion? On the History and Use of a Topos, in: M. Golden – P.<br />
Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 241–252.<br />
132 Nach Plat. leg. 781c sind es Frauen “gewohnt, im Verborgenen (dedykos) und im Dunkeln (skoteinon) zu leben”; Peschel<br />
1987, 12; Fantham 1994, 103.<br />
133 D. Lübke, Platon über Frauen, Liebe und Ehe, in: M. Kunze (Hrsg.), Die Frau in der Antike. Kolloquium der<br />
Winckelmann-Gesellschaft Stendal 1985 (Stendal 1988) 51.
Ausbildung in ihrer Kindheit und die allzu frühe Verheiratung führen auf die Eingeschränktheit ihres<br />
späteren Daseins zu.“ 134<br />
Die Verachtung der athenischen Haus- und Ehefrau, so wie sie von Wissenschaftlern lange bewertet<br />
wurde, rührt außerdem von ihrem geringen juristischen Stellenwert her. Der rechtliche Status der<br />
athenischen Bürgerin vor 2500 Jahren kann selbstredend nicht dem einer Frau im heutigen Europa<br />
entsprechen. Dennoch werden stets Vergleiche mit modernen Rechtssystemen bemüht. Die rechtliche<br />
Abhängigkeit der Frau von ihren männlichen Verwandten oder vom Ehepartner wird mit einer<br />
Geringschätzung der Frau in rechtlichen Belangen gleichgesetzt und gleichermaßen auf ihre soziale<br />
Stellung übertragen.<br />
Die Vorstellungen der Gelehrten hinsichtlich der sozialen Stellung der athenischen Frau variierten von<br />
Anfang an vor allem deshalb stark, da den verschiedenen Quellengattungen nicht die gleiche<br />
historische Aussagekraft zugestanden wurde. Inzwischen ist man immerhin zu der Einsicht gelangt,<br />
dass eine Selektion der Quellen unvollständige Eindrücke oder gar Fehlinterpretationen zur Folge<br />
hat. 135 Eine Neubewertung der Bewegungsfreiheit der athenischen Ehefrau erfolgte durch C. Schnurr-<br />
Redford. 136 Anhand einer erschöpfenden Anzahl an Quellen, die sowohl der Tragödie, Komödie als<br />
auch den Gerichtsreden entnommen wurden, zeigte sie, wie vielschichtig das Bild der Frau in der<br />
Antike war, und wie sehr sich die Quellenrezeption von vorherrschenden Vorurteilen gegenüber der<br />
antiken Frau leiten ließ. Quellen wurden vielfach außerhalb ihres Kontextes zitiert, oftmals als<br />
Ausdruck der Realität missverstanden, ohne die Situation und den Sprecher zu berücksichtigen oder<br />
das Geäußerte als subjektive Meinung zu erkennen. 137<br />
Es unterliegt nach wie vor keinem Zweifel, dass strenge Moralvorschriften das Leben der Frauen<br />
reglementierten und das Ausgehen der Frauen mitunter ungern gesehen wurde. Längst ist aber klar,<br />
dass man solche Aussagen nicht bedenkenlos als Ausdruck der Realität verstehen kann. Viele<br />
Textstellen antiker Quellen, die lange Zeit als Beleg für die Eingeschlossenheit der Frau herangezogen<br />
wurden, drücken meist sehr bestimmt aus, wie das Verhalten einer verheirateten Frau auszusehen<br />
hatte. Nicht selten sind einschlägige Stellen aber als Ermahnungen formuliert, die zeigen, dass Ideal<br />
und Wirklichkeit nicht immer übereinstimmen.<br />
134 Reinsberg 1993, 41; s. auch C. Sourvinou-Inwood, Männlich und Weiblich, Öffentlich und Privat, Antik und Modern, in:<br />
Reeder 1995, 113.<br />
135 Gomme a. O. (Anm. 131) 1–25; J. Gould, Law, Custom and Myth: Aspects of the social Position of Women in Classical<br />
Athens, JHS 100, 1980, 40–42: “Discussion of the social position of women in antiquity has been characterised by over-<br />
simplification of the issues, by concentration on the part of different investigators on mutually exclusive sets of data, and<br />
by a tendency to false statement which the actual evidence is enough to rebut.”; Pomeroy 1985, 88 f. 141 f.<br />
136 Just 1989, 105–125; Schnurr-Redford 1996, 119–132.<br />
137 Gomme a. O. (Anm. 131) 12; C. Seltman, Women in Antiqutiy (London 1956) 111 f. – Zu den misogynen Äußerungen<br />
und Platitüden in den euripideischen Werken, s. auch Pomeroy 1985, 158–160.<br />
S e i t e | 43
S e i t e | 44<br />
2. 3. 1. Geschlechterspezifische Lebensräume<br />
Wenn Xenophon im „Oikonomikos“ das Haus als Wirkungsort der Frau benennt, so geschieht dies in<br />
keiner Weise in diskriminierender Absicht. Er umreißt vielmehr nüchtern die Aufgabenteilung eines<br />
Ehepaars, wie sie von der Natur begünstigt erscheint, damit ein jeder nach bestem Vermögen zum<br />
Gedeihen des Oikos und zur Mehrung des Besitzes beitrage. 138 Die Auffassung der Griechen von<br />
separaten Aufgaben- und Lebensbereichen von Mann und Frau wurde früher oft als Argument für die<br />
Geschlechterseparation herangezogen, die im Falle der Frau mit Eingeschlossenheit, Vernachlässigung<br />
und Verachtung gleichgesetzt wurde. 139 Man verstand die Aufgaben- und Raumaufteilung Xenophons<br />
als in alle Lebensbereiche übergreifendes und stringent befolgtes Gesetz: der Mann agiert außerhalb<br />
des Hauses, die Frau hält sich darin auf. 140 Man ging einst davon aus, dass der Frau nur zu Hochzeiten<br />
oder Kultfesten das Verlassen des Hauses erlaubt war, und ansonsten die Schwelle des Hauses die<br />
Grenze zwischen ihrer Lebenswelt und der der Männer bildete. 141 Durch Politik und Geschäfte von<br />
zuhause ferngehalten, genossen die Ehemänner stattdessen den Umgang mit den freizügigeren und<br />
amüsanteren Hetären 142 , die keine Sozialnorm ans Haus fesselte. Hetären und Prostituierte hatten im<br />
Gegensatz zu den Bürgerinnen uneingeschränkt Zutritt zu den Männerdomänen, ihre Wege kreuzten<br />
sich auf den Straßen, auf der Agora und natürlich bei den Symposien. 143 Die getrennten<br />
Lebensbereiche von Mann und Frau mussten sich folglich verheerend auf die ehelichen und familiären<br />
Beziehungen ausgewirkt haben.<br />
Die Frage nach der Bewegungsfreiheit der Frau schließt jedoch nicht nur das Verlassen des Hauses<br />
mit ein, sondern auch das sich frei Bewegen im Haus selbst. Lange Zeit hielt sich die Vorstellung, dass<br />
den Frauen in den athenischen Haushalten in Form der Gynaikonitis ein Rückzugsort eingeräumt<br />
worden war, in dem sie weitab von der feindlichen Außenwelt, aber auch von den Männern ihres<br />
eigenen Hauses, ihre Arbeiten versahen. 144 Der Kontakt des Ehepaares, so meinte man, beschränkte<br />
sich auf ein Minimum, Mann und Frau bewegten sich praktisch selbst im eigenen Haus in separierten<br />
Bereichen. Je nach Forschungsrichtung wurde diese häusliche Separierung teils sogar mit Isolierung<br />
und Eingeschlossenheit gleichgesetzt: „Closed off in the integral part of the house to which the men<br />
did not have access, the married woman had no chance to meet persons other than members of the<br />
household.” 145 Oder: „Während die verheirateten Frauen selten über die Schwelle der äußeren Tür<br />
138 Xen. oik. 7, 18–32.<br />
139 Seltman a. O. (Anm. 137) 111 f.; Just 1989, 118 f.<br />
140 J.-P. Vernant, Myth and Thoughts among the Greeks (London 1983) 132 f.: Das Innere wird mit dem Weiblichen, der<br />
äußere Raum mit dem Männlichen gleichgesetzt. – Zur Problematik der Kategorisierung „Öffentlich“ und „Privat“, s. C.<br />
Sourvinou-Inwood, Männlich und Weiblich, Öffentlich und Privat, Antik und Modern, in: Reeder 1995, 111–120;<br />
Hartmann 2002, 22.<br />
141 z. B. R. Flacelière, Griechenland. Leben und Kultur in klassischer Zeit (Stuttgart 1977) 81.<br />
142 Allg. RE VIII, 2 (1913) 1331–1372 s. v. Hetairai (K. Schneider); RAC III (1957) 1154–1187 s. v. Dirne (H. Herter).<br />
143 z. B. Mossé 1983, 63: Hetären “les seules femmes vraiment libres de l´Athènes classique.”<br />
144 Keuls 1985, 110: “As a result of the strict segregation of men and women, a man´s own women´s quarters must have<br />
been largely unknown territory to him.” Reinsberg 1993, 43; kritisch F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel<br />
(Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 223.<br />
145 E. Cantarella, Pandora´s Daughters, The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity (Baltimore 1987) 46.
ihres Hauses nach draußen schreiten, erscheinen die Mädchen kaum im Innenhof, da sie ja fern den<br />
Blicken, abseits selbst von den männlichen Angehörigen der Familie, leben müssen.“ 146<br />
Gestützt wurde diese Interpretation vermeintlich durch archäologische sowie durch literarische<br />
Überlieferungen. Die griechischen Vasenbilder zeigen in den sog. Frauengemachsszenen einen<br />
Ausschnitt aus dem Alltag der Frauen im Oikos. Der Umstand, dass die Frauen in diesen<br />
Darstellungen in der Regel unter sich sind, hat das Verständnis der Gynaikonitis, des Frauengemachs,<br />
nachhaltig geprägt. Daneben sind vereinzelte antike Textpassagen zu nennen, wie etwa die in den<br />
„Gesetzen“ Platons, der bezüglich der Lebensweise der Frauen schreibt, sie hätten ein schattenhaftes<br />
und zurückgezogenes Dasein geführt 147 , oder die Aussage bei Lysias, der behauptet, die weiblichen<br />
Mitglieder eines Haushaltes lebten so zurückgezogen, dass sie nicht einmal den Anblick der nahen<br />
männlichen Verwandten gewohnt seien 148 . Cornelios Nepos, freilich ein römischer Autor, der die<br />
griechischen Sitten bereits aus einer großen zeitlichen Distanz beurteilt, sagt in seiner Praefatio<br />
explizit, die Griechen hätten ihre Frauen in der Gynaikonitis eingesperrt. 149<br />
Inzwischen hat die Wissenschaft erkannt, dass die Trennung der Geschlechter, die in den antiken<br />
Schriftquellen eine starre Vorgabe der Gesellschaft zu sein scheint, im griechischen Alltagsleben<br />
vielerlei Gestalt annehmen kann. Separation ist nicht gleich Isolation. 150 Man sollte also nicht von<br />
einer faktischen räumlichen Absonderung oder Eingeschlossenheit der Bürgerinnen ausgehen, sondern<br />
zunächst von einer ideologischen Trennung der Lebensbereiche „Haus“ und „Öffentlichkeit“, die sich<br />
dann allerdings bis zum einem gewissen Grad auch im sozialen Miteinander des Wohnhauses<br />
widerspiegelt. Wenn wir uns in einem der nachfolgenden Kapitel mit der griechischen Wohnkultur<br />
und dem Sozialleben innerhalb des Oikos beschäftigen, soll auch die Institution der Gynaikonitis<br />
nochmals hinterfragt werden. 151<br />
146 R. Flacelière, Griechenland. Leben und Kultur in klassischer Zeit (Stuttgart 1977) 81.<br />
147 Plat. leg. 781c: Der Text benutzt das Gegensatzpaar Licht – Dunkel, das hier in etwa mit privat – öffentlich gleichgesetzt<br />
wurde. Sinngemäß bedeutet dies lediglich, dass die Frauen zurückgezogen lebten, der Begriff der Gynaikonitis fällt an<br />
dieser Stelle nicht.<br />
148 Lys. 3, 6.<br />
149 Nep. praef. 1,7: “Bei den Griechen ist das anders. Dort nämlich lässt man eine Frau zu derartigem (gemeint sind<br />
Gastmäler) nicht zu – es sei denn, die Einladung beschränkt sich auf die nächsten Verwandten –, und sie verlässt kaum je<br />
den innersten Teil des Hauses, Frauengemach genannt, den außer den nächsten Familienangehörigen niemand betreten<br />
darf.“ Z. T. ist sicherlich auch die direkte Gegenüberstellung von griechischen und römischen Sitten dafür verantwortlich,<br />
dass die kulturellen Unterschiede derart plakativ formuliert werden.<br />
150 z. B. D. Cohen, Seclusion, Separation, and the Status of Women in Classical Athens, GaR 36, 1989, 6 f.; Kreilinger 2007,<br />
47 Anm. 347.<br />
151 s. Kap. 2. 4.<br />
S e i t e | 45
S e i t e | 46<br />
2. 3. 2. Sittliches Verhalten<br />
Die Tragödien geben in besonderem Maße einen Eindruck, wie heikel und notwendig die Einhaltung<br />
gesellschaftlicher Normen zur Wahrung der politischen wie familiären Ordnung war. 152 Einige der<br />
Dramen scheinen so eindringlich an das weibliche Wohlverhalten zu appellieren, dass man die<br />
Anwesenheit von Frauen im Theaterrund fast voraussetzen möchte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass<br />
die Verhaltensideale der tragischen weiblichen Rollen die zeitgenössischen moralischen Ansprüche<br />
reflektieren. 153 Antigone, die tragische Heldin des Sophokles, wird von Euripides zunächst als<br />
unschuldiges und sittsam erzogenes Mädchen geschildert. Als sie vom Dachumgang des Hauses einen<br />
Blick auf das feindliche Lager vor den Toren der Stadt erhaschen will, trägt der sie begleitende<br />
Paidagogos Sorge, dass sie nicht von Passanten auf der Straße gesehen wird:<br />
„Antigone, des Hauses stolzes Reis,<br />
Da du das Heer von Argos schauen willst<br />
Und endlich dich die Mutter aus dem Saal<br />
Der Mädchen bis zum Söller steigen ließ,<br />
So will ich noch den Weg hinunter sehn,<br />
Ob sich kein Bürger auf den Straßen zeigt<br />
Und mich, den Diener, schelten kann wie dich,<br />
Die Herrin.<br />
[...]<br />
Kein Bürger streift das Haus, so steig getrost<br />
Die alte Zedertreppe ganz herauf!“ (Eur. Phoen. 88–100)<br />
Ein Muster an Tugend und Gehorsam verkörpert Andromache:<br />
„Ob eine Frau im bösen Leumund steht,<br />
Ob nicht, so wird ihr dieses schon verargt,<br />
Wenn sie sich außer Hauses hält: ich blieb,<br />
Auch wenn das Draußen lockte, im Gemach.“ (Eur. Tro. 647–650)<br />
Zu den Tugenden und Beschränkungen, die sich Andromache auferlegt hat, gehört auch das<br />
Ausgehen: sie hat es sich gänzlich versagt, um ihren guten Ruf nicht zu gefährden. Eine solche<br />
Willfährigkeit ist selbstverständlich überaus lobenswert. 154 Andromache scheint sich tatsächlich an<br />
einem Modell weiblicher Tugendhaftigkeit zu orientieren, das bis in die Zeit des Semonides 155<br />
zurückgeht und im 5. Jh. v. Chr. nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt hat.<br />
152 Fantham 1994, 74: [Die Tragödiendichter] “invented fantastic female characters to argue out difficult social conflicts and<br />
create women who act in ways not permitted to them in life, these striking pictures of the complex problems of a wife´s<br />
existence seem to express genuine contradictions in her role, if only in the male imagination.”<br />
153 Mossé 1983, 109 f. 112: Die traditionelle Stellung der Frau ist für die Dramen des Euripides weiterhin verbindlich. –<br />
Zum geschlechtsspezifischen Rollenverständnis in der Tragödie, z. B. Pomeroy 1985, 146–154. 166 f.; K. Dowden,<br />
Approaching Women through Myth: Vital Tool or Self-Delusion?, in: R. Hawley – B. Levick (Hrsg.), Women in<br />
Antiquity. New Assessments (London 1995) 44–57.<br />
154 M. Lefkowitz, Wives and Husbands, in: I. McAuslan – P. Walcot (Hrsg.), Women in Antiquity (Oxford 1996) 68.<br />
155 Sem. fr. 7, 83–93 West.
Die Frauengestalten der Komödie scheinen auf den ersten Blick eher dem realen Leben entlehnt zu<br />
sein als die mythischen Heroinen der Tragödie. Die Frauen des Aristophanes sind aber keineswegs<br />
brave Hausmütterchen oder ideale Ehefrauen. Auf einzigartige Weise setzt Aristophanes das Mittel<br />
der Überzeichnung ein, um ein um das andere Mal die charakterlichen Mängel der Frauen für seinen<br />
spitzzüngigen Humor zu gebrauchen. Dass in den Komödien ein Frauenbild entsteht, das dem der<br />
euripideischen Tragödie in der Regel diametral entgegensteht, überrascht nicht. Die Wahrheit mag<br />
irgendwo zwischen den frech-frivolen Weibern des Aristophanes und den hochgesinnten, mutigen<br />
Damen des Euripides liegen. 156 Doch obwohl die Gestaltung der agierenden Personen der Gattung der<br />
Komödie verpflichtet ist, handeln diese stets vor dem sozial-politischen Hintergrund des<br />
zeitgenössischen Athens, so dass manche grundlegende Aussage für die Rekonstruktion des<br />
Alltagslebens der athenischen Frauen durchaus berücksichtigt werden kann. 157 Wenn etwa Kalonike in<br />
der "Lysistrate" sagt:<br />
„Ein Ausgang macht bei Frauen<br />
Sich nicht so leicht: man muss den Mann bedienen,<br />
Die Knechte wecken, muss das Kind zurecht<br />
Erst legen, sauber waschen und es füttern.“ (Aristoph. Lys. 16–19)<br />
ist offensichtlich, dass das Ausgehen an sich nicht untersagt war, sondern vielmehr die zeitraubenden<br />
und mannigfaltigen Tätigkeiten die Frauen im Hause festhielten. 158 Die ungehaltenen Äußerungen des<br />
Blebyros in den „Ekklesiazusen“ des Aristophanes über seine Gattin, die frühmorgens unbemerkt das<br />
Haus verlassen hat, haben ihre Ursache in erster Linie in dem Umstand, dass sie seinen Mantel und<br />
seine Schuhe mitgenommen hat, und er sich, um auf den Abtritt zu gehen, mit ihren Frauenkleidern<br />
behelfen muss. Er ist von ihrer Abwesenheit wenig begeistert und legt ein mürrisches Misstrauen an<br />
den Tag, das häufig die männliche Einstellung den Frauen gegenüber prägt:<br />
„Denn Gutes kam noch nie heraus, so oft<br />
Sie ausging!“ (Aristoph. Eccl. 325–326)<br />
Er unterstellt ihr jedoch keine unmoralischen Motive. 159 Den Seitensprung, der ja zu den festen Topoi<br />
der Komödie gehört, bringt später Praxagora selbst ins Gespräch. Doch sowohl die Vermutung des<br />
Nachbarn, Praxagora könne das Frühstück bei einer ihrer Nachbarinnen einnehmen, als auch die<br />
Antwort Praxagoras, sie habe Geburtshilfe bei einer guten Freundin geleistet, geben akzeptable<br />
Gründe für eine Frau an, das Haus zu verlassen. 160<br />
Überhaupt hat man bei der Quellenlektüre stets den Eindruck, dass in erster Linie das unmotivierte<br />
Ausgehen oder Verlassen des Hauses auf Kritik stößt. Angesichts der Verletzlichkeit des guten Rufes<br />
und der Bedeutung von Anstand und sexueller Maßhaltung bzw. Keuschheit für die Reinhaltung des<br />
156 Zumal die Tragödie und die Komödie Frauen unterschiedlichen Standes auftreten lassen, s. Schnurr-Redford 1996, 71.<br />
157 Mossé 1983, 114.<br />
158 C. Seltman, Women in Antiquity (London 1956) 111; D. C. Richter, The Position of Women in Classical Athens, ClJ 67,<br />
1971, 6; Lacey 1983, 158.<br />
159 Aristoph. Eccl. 350.<br />
160 Aristoph. Eccl. 348–349. 528–529.<br />
S e i t e | 47
Oikos betrachtete man das Ausgehen bürgerlicher Frauen mit gemischten Gefühlen. 161 Die Begleitung<br />
einer Dienerin und eine züchtige Aufmachung, die möglicherweise auch die Verschleierung des<br />
Kopfes und/oder des Gesichtes beinhaltete, sorgten dafür, die Frau sozusagen unsichtbar und<br />
unangreifbar zu machen. 162 Theophrasts Charakterstudie des „Knausrigen“ bemängelt, dass diesem<br />
sogar der Ankauf einer Sklavin für seine Frau zu teuer kommt:<br />
S e i t e | 48<br />
„Seiner Frau, die ihm Mitgift mit in die Ehe gebracht hat, kauft er keine Dienerin, sondern<br />
mietet für ihre Besorgungen ein Mädchen vom Weibermarkt als Begleiterin.“<br />
(Theophr. char. 22, 10)<br />
Da eine Begleitung jedoch von der Etikette, vielleicht aber auch vom Geltungsbedürfnis gefordert<br />
wird, mietet er seiner Frau je nach Bedarf eine Begleiterin an. Dies beweist, dass eine Frau, wenn sie<br />
das Bedürfnis hatte, das Haus zu verlassen, nicht grundsätzlich davon abgehalten wurde.<br />
Obwohl die Komödie am ehesten dazu neigt, das Weibervolk in seiner ganzen Freizügigkeit und<br />
Keckheit bloßzustellen, gibt es auch hier Passagen, welche die Grenzen dieser ansonsten so zügellosen<br />
Frauen aufzeigen. In den "Thesmophoriazusen" findet sich folgender Kommentar des Chors:<br />
„Zwar schimpfen jetzt all´ auf das Frauengeschlecht und setzen es schmählich herunter:<br />
Wir seien, so lügt man, der Fluch der Welt und der Urquell alles Verderbens!<br />
Wir gebären nur Hass, Zank, Kummer und Not und Empörung und Krieg! – Nun wohlan<br />
denn!<br />
Wenn ein Fluch wir sind, was freit ihr uns denn, warum, wenn wir wirklich ein Fluch sind?<br />
Was verbietet ihr uns, auf die Straße zu gehen, ja, nur aus dem Fenster zu gucken?<br />
Was bemüht ihr euch denn so mit ängstlichem Fleiß, zu hüten den Fluch und zu halten?<br />
Und geht ein Weibchen mal irgendwohin, und ihr findet sie nicht in der Stube,<br />
So tobt ihr wie rasend, anstatt euch zu freuen und den Göttern zu opfern, dass endlich<br />
Ihr entschwunden ihn seht aus dem Hause, den Fluch, und ihr nimmer ihn trefft in der<br />
Stube;<br />
Und schläft man einmal in der Freundin Haus, wo man müd sich getanzt und gejubelt<br />
Da laufen sie denn um die Betten herum und suchen den Fluch zu erwischen.<br />
Kaum gucken wir einmal zum Fenster hinaus, will jeder den Fluch sich betrachten,<br />
Und zieht man verschämt sich ein bisschen zurück, da gaffen sie nur noch verrückter,<br />
Ob der Fluch nicht noch einmal am Fenster erscheint!“ (Aristoph. Thesm. 789–799)<br />
Diese Textpassage verdeutlicht in vollem Umfang, wieso es so schwierig ist, eine exakte Aussage über<br />
die Stellung der Frau in der Antike zu formulieren. Denn während es meist schon misslingt, Urteile<br />
verschiedener Gattungen auf einen Nenner zu bringen, so ist hier nicht einmal die Aussage weniger<br />
Zeilen in sich stimmig. Während da noch behauptet wird, das Verlassen des Hauses sei verboten, ja<br />
gar das Aus-dem-Fenster-Blicken ungern gesehen, wird einige Zeilen später konstatiert, dass dieselben<br />
161 J. F. Gardner, Aristophanes and Male Anxiety. The Defence of the Oikos, GaR 36, 1989, 52 f.<br />
162 Llewellyn-Jones 2003, 1–4 bezeichnet den Schleier als “portable form of seclusion that a woman is able to wear on her<br />
visits into the male public world.”; nach Richter a. O. (Anm. 158) 6 war es auch eine Frage der Sicherheit, nicht allein auf<br />
die Straßen Athens zu gehen; Schnurr-Redford 1996, 131 interpretiert Kopfbedeckungen als Sonnenschutz; D. L. Cairns,<br />
The Meaning of the Veil in Ancient Greek Culture, in: L. Llewellyn-Jones (Hrsg.), Women´s Dress in the Ancient Greek<br />
World (London 2002) 73–75. 80 f.
Frauen sich zum Feiern träfen und die Nächte bei Freundinnen verbrächten. Der Text offenbart die<br />
Diskrepanz zwischen der gestrengen Moralvorstellung der Öffentlichkeit und dem gelebten Alltag. 163<br />
Er deutet aber auch auf eine Auseinandersetzung der Frauen mit dem gemeinhin vorauszusetzenden<br />
Frauenbild hin. Das Verhalten der Männer ist dabei im Grunde ebenso wie das der Frauen ambivalent:<br />
Männer erhaschen ganz gerne mal einen Blick auf eine Frau, doch wenn jene Frau aus dem Fenster<br />
guckt, nennt man sie neugierig oder dreist. Die Frauen werden als Übel bezeichnet, das allerdings<br />
behütet wird. Halten sie sich außer Haus auf, ist Mann nicht etwa froh sie los zu sein, sondern tobt und<br />
zetert. Das Ausgehen ist ihnen nicht kategorisch verboten – immerhin feiern sie z. B. ausgelassen mit<br />
ihren Freundinnen –, es wird jedoch von ihren Ehemännern nicht immer gutgeheißen, besonders dann,<br />
wenn sie über Nacht abwesend sind oder ihr Verbleib unbekannt ist. D. Cohen bringt es mit seinem<br />
Resümee auf den Punkt: „Women should not leave the house but participation in their independent<br />
sphere of social, religious, and economic activities requires that they do so.” 164<br />
Es wurden nun schon einige Gelegenheiten benannt, die die Abwesenheit der Frau im Haus<br />
entschuldigen. Der nachbarschaftliche Kontakt machte einen großen Anteil des sozialen Lebens der<br />
Frau außerhalb des Oikos aus. 165 Die Ehefrau des Teisias war nach Aussage ihres Sohnes mit der<br />
Nachbarsfrau lange Zeit eng befreundet:<br />
"Before they undertook this malicious action against me, my mother and theirs were<br />
intimate friends and used to visit one another, as was natural, since both lived in the country<br />
and were neighbours, and since, furthermore, their husbands had been friends while they<br />
lived." (Demosth. or. 55, 23)<br />
Immer wieder erhaschen wir in den Quellen einen Blick auf die Selbstverständlichkeit, mit der der<br />
Gang nach nebenan unternommen wird, sei es um Kleinigkeiten des Alltags zu borgen, konkrete Hilfe<br />
zu leisten oder sei es um einfach ein Schwätzchen zu halten. Dem Kleinlichen aus Theophrasts<br />
„Charakteren“ geht nachbarschaftliches Entgegenkommen in Form von Borgen jedoch gegen den<br />
Strich:<br />
„Und seiner Frau verbietet er, Salz, Lampendocht, Kümmel, Majoran, Opferschrot, Binden,<br />
Opferteig zu verborgen, sondern sagt: „Diese Kleinigkeiten machen im Jahr viel aus."<br />
(Theophr. char. 10, 13)<br />
In den "Ekklesiazusen" honoriert Chremes die Bereitschaft und Ehrlichkeit der Frauen, die darüber<br />
hinaus auch Wertsachen verliehen und zwar ohne schriftlichen Vertrag:<br />
„Die Weiber, sagt´ er, leih´n einander Kleider,<br />
Juwelen, Vasen, Silbersachen, unter<br />
Vier Augen, ohne Zeugen: dennoch geben<br />
Sie alles treu und redlich wieder heim.“ (Aristoph. Eccl. 446–449)<br />
163 D. Cohen, Seclusion, Separation, and the Status of Women in Classical Athens, GaR 36, 1989, 5.<br />
164 Cohen a. O. (Anm. 163) 11.<br />
165 „Weibliche Gegenwelt“, s. Schnurr-Redford 1996, 132–140; anders dagegen Pomeroy 1985, 132, sie versteht die<br />
Isolation der Ehefrau als absolut: „[…] lebten in den meisten Fällen auch völlig isoliert in ihren Häusern und hatten daher<br />
auch keine Möglichkeit, mit Frauen außerhalb ihrer Familie Beziehungen zu unterhalten.“<br />
S e i t e | 49
Der Austausch von Neuigkeiten war sicherlich zusätzlich Zweck solch gegenseitiger Besuche und<br />
konnte mitunter die Form regelrechter Klatschsucht annehmen. Andromache mit ihren hohen Idealen<br />
distanziert sich bewusst vom üblen Geschwätz jener Frauen:<br />
S e i t e | 50<br />
Auch ließ ich Winkelwort der Nachbarfraun<br />
Niemals ins Haus, gebrauchte den Verstand,<br />
Den Gott mir gab, und war mir selbst genug. (Eur. Tro. 651–653)<br />
Auch Hermione sieht im Geschwätz eher eine Einmischung in fremde Angelegenheiten und gibt den<br />
Nachbarinnen schließlich die Schuld daran, sie mit übler Nachrede gegen Andromache indoktriniert<br />
zu haben 166 .<br />
Ganz andere Regeln als für die Frauen der Oberschicht galten natürlich für jene Frauen aus den<br />
niedrigeren Schichten, die beruflichen Tätigkeiten nachgingen. All die arbeitenden Frauen – seien es<br />
Verkäuferinnen von Kränzen, Textilien und Gemüse, Wirtinnen oder Geldverleiherinnen – konnten<br />
sich den Luxus vornehmer Zurückgezogenheit nicht leisten. 167 Geschlechterseparation wurde bei<br />
ärmeren Schichten oder verarmten Familien also zugunsten der ökonomischen Erhaltung des Oikos<br />
aufgegeben. Dies führte zu gemeinschaftlichem Arbeiten bzw. der Okkupation ansonsten weitgehend<br />
männlich dominierter Berufe. 168 Es würde aber nicht weiter verwundern, wenn auch die ärmeren<br />
Athener versuchten, gewissen moralischen Grundsätzen die Treue zu halten, selbst dann, wenn sie in<br />
unseren Augen mit den Anforderungen des Alltags unvereinbar scheinen. 169<br />
2. 3. 3. Zwischengeschlechtliche Kontakte<br />
Nähme man die Textpassage des Lysias wörtlich, dass nämlich die unverheirateten Nichten und<br />
Schwestern so zurückgezogen und behütet im Haus ihres Bruder lebten, dass sie sogar den Anblick<br />
ihrer nächsten männlichen Verwandten mieden 170 , ergäbe sich für die Lebenssituation der<br />
(unverheirateten) Frau in der Antike ein Bild der absoluten Isolierung, das tatsächlich an<br />
Eingeschlossenheit grenzt. Dass diese Textstelle jedoch nur eine mögliche Wirklichkeit von vielen<br />
wiedergibt und Frauen das Haus zu diversen Gelegenheiten sehr wohl verlassen haben, dürften die<br />
166 Eur. Andr. 930–933.<br />
167 Plat. leg. 918e; Schnurr-Redford 1996, 213–224.<br />
168 Z. B. R. Brock, The Labour of Women in Classical Athens, ClQ 44, 1994, 336–346; Schnurr-Redford 1996, 212–224.<br />
169 J. Gould, Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens, JHS 100, 1980, 48; Just<br />
1989, 113: „What the women of the poor were forced to do need not contradict a dominant ideology in terms of which<br />
female seclusion was desirable. And such an ideology can remain dominant, although perhaps it was only the well-to-do<br />
who could translate it into full practice.”<br />
170 Lys. 3, 6: Anlass für den Aufruhr und die häusliche Ruhestörung, die schließlich in einem Gerichtsverfahren mündeten,<br />
war jedoch wohlgemerkt ein Jüngling, den der Ankläger bei sich im Haus aufgenommen hatte, um ihn in seiner Nähe zu<br />
haben und ihm Schutz gegen den Angeklagten zu gewähren. Dass Hetären ins Haus geholt wurden, ist überliefert; dass<br />
jedoch ein Jüngling in einem Haus zusammen mit unverheirateten Mädchen untergebracht und eine Affäre in einer<br />
Gesellschaft, die Diskretion vor allem in homoerotischen Angelegenheiten so schätzte, so offen ausgelebt wurde, ist sehr<br />
ungewöhnlich.
angeführten Textbeispiele des vorhergehenden Kapitels ausreichend belegt habe. Außerhalb des Oikos<br />
mussten die Regeln des Anstands umso strikter eingehalten werden. Dies bedeutete v. a. für die<br />
gesellschaftliche Elite, nicht ohne Begleitung auszugehen, züchtig gekleidet und zurückhaltend<br />
aufzutreten und sich von fremden Männern fernzuhalten. 171 Inwieweit die Ehefrauen in und außerhalb<br />
des Hauses Kontakt zu Männern hatten, ist ein anderes Problem. Elektras Ehemann rügt seine Gattin,<br />
als er sie im Gespräch mit zwei vermeintlich Fremden vor der eigenen Haustür ertappt:<br />
„Was seh ich für Fremde vor meinem Gehöft?<br />
Was führt sie herauf zu dem einsamen Haus?<br />
Sie suchen doch mich? Nie hat es der Frau<br />
Bei fremden Männern zu stehen geziemt.“ (Eur. El. 341–344) 172<br />
Der Anforderung, Distanz zu Außenstehenden zu wahren, wurde im Grunde Folge geleistet, zu<br />
wichtig war das soziale Renommee, das auf dem Spiel stand. Das Prinzip der Geschlechtertrennung<br />
ließ Männern und Frauen jedoch genügend Gelegenheit, einander bei offiziellen Anlässen zu<br />
begegnen. Die Ehefrau des Euphiletos z. B. knüpfte erste zarte Band mit ihrem späteren Liebhaber<br />
ausgerechnet während der Bestattungszeremonie ihrer Schwiegermutter. 173 Sokrates beauftragt in<br />
Platons „Phaidon“ einen seiner Freunde und Schüler, Xanthippe und ihr Kind vom Gefängnis aus nach<br />
Hause zu begleiten. 174 Ob er dies tat, weil sich eine männliche Begleitung mehr ziemte als gar keine,<br />
oder ob er sie in ihrem desolaten Geisteszustand nicht allein wegschicken wollte, ist ungewiss.<br />
Dass ein Mann regen Umgang mit Freunden hatte und auch in deren Häusern verkehrte, ist<br />
selbstverständlich, ob und inwieweit diese allerdings auf trautem Fuße mit der Hausherrin standen,<br />
dagegen fraglich. Generell bevorzugt man die von S. Blundell vertretene These: “In her own home a<br />
wife would not be expected to have any contact with male visitors. She was not present when guests<br />
were entertained, even if the invitation had been an impromptu one.” 175 Einige Verse des Semonides<br />
widersprechen, indem sie konstatieren, dass der Frauentypus der Hündin mit einem derart argen<br />
Redefluss gesegnet ist, dass sie nicht einmal im Beisein von Gästen schweigt. 176 Nun schrieb<br />
Semonides allerdings seine Gedichte bereits im 7. Jh. v. Chr. Des Weiteren ist die Information zu<br />
unspezifisch, um auf irgendwelche sittliche Gepflogenheiten schließen zu können. Diverse Zeugnisse,<br />
die zeigen, wie groß die Skrupel gewöhnlich gewesen sind, ein fremdes Haus zu betreten, sprechen<br />
meiner Einschätzung nach nicht so sehr für die Abschirmung der Ehefrau als für die Einhaltung<br />
grundsätzlicher Regeln des Anstands, die besonders dann angebracht war, wenn der Besucher der<br />
Dame des Hauses nicht bekannt war. Die Privatsphäre wurde hochgehalten, berücksichtigt man, dass<br />
171 Schnurr-Redford 1996, 88.<br />
172 s. hierzu auch Schnur-Redford 1996, 154; Sojc 2005, 42–44 macht an der Begegnung von Klytemnästra und Achill im 3.<br />
Epeisodion von Eur. Iph. Aul. deutlich, dass einer Frau weder der Kontakt noch das Gespräch mit einem Mann verboten<br />
waren, solange die zu Gebote stehenden Verhaltensregeln von beiden Seiten beachtet wurden. Auch Nausikaa möchte<br />
nicht öffentlich in Gesellschaft des Fremden Odysseus gesehen werden, weil sie sich vor Nachrede fürchtet, s. Hom. Od.<br />
VI 255–287.<br />
173 Lys. 1, 7 f.<br />
174 Plat. Phaid. 60a.<br />
175 S. Blundell, Women in Classical Athens (London 1998) 135.<br />
176 Sem. Fr. 7 West, 17–20.<br />
S e i t e | 51
das Eindringen Fremder oder Unbefugter in den Gerichtsreden als Ungeheuerlichkeit geschildert wird.<br />
Gegen die Aussage bei Theophrast, dass sich eine Frau, die persönlich die Tür öffnete, böser Nachrede<br />
aussetzte, da dieser Usus in den Bordellen gang und gebe war, wo die Huren ihre Kunden von der<br />
Straße weg ins Haus zogen, 177 steht z. B. die Ausführung des Aristoteles, dass auch die Hausherrin<br />
Besucher einließ und empfing. 178 Es gibt reichlich Hinweise, dass die Frauen des Hauses durchaus in<br />
Kontakt mit fremden Männern kamen. So wirft in Aristophanes “Thesmophoriazusen” der Ehemann<br />
seiner Frau vor, als sie augenscheinlich in Gedanken Geschirr zerbricht, sich in den Gastfreund aus<br />
Korinth verliebt zu haben. 179 In einer Rede des Lysias tritt eine Witwe vor einer Gruppe von<br />
Verwandten und Freunden der Familie auf, um das Erbe ihrer Söhne einzuklagen. Und auch wenn sie<br />
ihre freie Rede vor Männern als Abweichung von ihrem gewöhnlichen Verhalten bezeichnet, so sind<br />
die Männer ihr als Freunde ihres verstorbenen Gatten doch keineswegs fremd. 180<br />
S e i t e | 52<br />
2. 4. Das Haus. Räumliche Gestaltung und Organisation<br />
2. 4. 1. Die Quellen<br />
2. 4. 1. 1. Xenophon: Das Haus des Ischomachos<br />
Einen Eindruck, wie das Haus der Antike organisiert war, vermitteln uns vor allem zwei Textstellen.<br />
Xenophons „Oikonomikos“ enthält eine Passage, die dem Leser den Hauskomplex des Ischomachos<br />
beschreibt. Es werden verschiedene Vorratsräume genannt, ein Thalamos, der Schlafraum, ein<br />
Aufenthaltsraum, die Gynaikonitis und Andronitis. Der Text erhebt keinen Anspruch auf<br />
Vollständigkeit; so fehlt der offene Hof in der Aufzählung ebenso wie Koch- und<br />
Waschgelegenheiten, die es mit Sicherheit in einem gut ausgestatteten Haus wie dem des Ischomachos<br />
gegeben hat. Dieser gehört zu einer der alten Familien Athens und, auch wenn er eingangs betont, dass<br />
sein Haus eher zweckmäßig eingerichtet sei 181 , so wird man mit Fug und Recht annehmen können,<br />
dass er vielleicht ein bescheidenes, aber sicherlich kein ärmliches Haus besessen hat.<br />
Ischomachos Ausführung gilt allein der Funktionalität des Hauses und seiner Räume, so dass auf ihre<br />
Anordnung, Größe und Zugänglichkeit nicht eingegangen wird. Der Thalamos, unter dem wir wohl<br />
hier das den Eheleuten gemeinsame Schlafzimmer verstehen dürfen, wird zudem als der sicherste<br />
Raum des Hauses geschildert, in dem die wertvollsten Möbel und Textilien untergebracht sind. 182 Dies<br />
kann zweierlei bedeuten: entweder ist er mit starken Mauern und einer stabilen Tür gesichert oder er<br />
ist tief im Inneren des Hauses angesiedelt, so dass zuerst eine Reihe von anderen Räumen durchquert<br />
177 Theophr. char. 28, 3.<br />
178 Aristot. oec. III, 140; nach Demosth. or. 47, 35 ist es eine Dienerin oder Sklavin, die dem Kläger die Tür öffnet.<br />
179 Aristoph. Thesm. 401–404.<br />
180 Lys. 32, 11.<br />
181 Xen. oik. 9, 2.<br />
182 Xen. oik. 9, 3; J.-P. Vernant, Myth and Thoughts among the Greeks (London 1983) 149; Schnurr-Redford 1996, 96 f.
werden muss, um ihn zu erreichen. Vielleicht befindet er sich in einem zweiten Stockwerk, von dem<br />
hier nicht die Rede ist, dessen Existenz aber in vielen Häusern archäologisch nachweisbar ist.<br />
Die Lokalisierung und Definition der Andronitis und Gynaikonitis haben in der Forschung für allerlei<br />
Verwirrung gesorgt. Generell hat man aufgrund ihrer Etymologie eine Aufteilung des Hauses in<br />
Bereiche angenommen, die entweder bevorzugt oder ausschließlich von Männern oder von Frauen<br />
beansprucht wurden. Die Erklärung des Xenophon ist verglichen mit dem Gebrauch in anderen Texten<br />
überraschend; in diesem Falle handelt es sich nämlich offensichtlich um Unterkünfte für Sklaven, die<br />
nach Geschlechtern getrennt und verschließbar sind, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern.<br />
„Ich zeigte ihr auch den Raum 183 für die Sklavinnen, der durch eine verriegelte Tür vom<br />
Raum der Sklaven getrennt ist, damit weder von drinnen herausgebracht wird, was nicht<br />
sein soll, noch die Sklaven ohne unseren Willen Kinder zeugen.“ (Xen. oik. 9, 5) 184<br />
Dennoch sollten wir uns keine reinen Sklavenunterkünfte darunter vorstellen, wird doch gleichzeitig<br />
erwähnt, dass die Verschließbarkeit der beiden Räumlichkeiten auch den Zweck des Schutzes der<br />
darin aufbewahrten Güter hatte. Ein Zusammenhang mit der Ehefrau ist also nicht ausgeschlossen.<br />
Nachts Schlafplatz für die Sklavinnen mag der Raum tagsüber als Arbeits- und Aufenthaltsraum<br />
benutzt worden sein. 185 Die ebenfalls aufgelisteten Aufenthaltsräume, diaiteteria, sind nicht näher<br />
spezifiziert. Sie scheinen offenbar allen Bewohnern des Hauses offen gestanden zu haben und dienten<br />
wohl in erster Linie als Ort häuslicher Arbeiten. Sie übernehmen somit eine Funktion, die<br />
üblicherweise mit dem sog. Oikos bzw. Oikos-Unit oder der Gynaikonitis selbst in Verbindung<br />
gebracht wird. N. Cahill kommt zu dem Schluss, dass es sich bei Xenophons Entwurf eines<br />
exemplarischen Oikos nicht nur um eine ideale Rollenverteilung und Geschlechterhierarchie handelt,<br />
sondern eben auch um einen utopischen Entwurf zur Hausverwaltung, der in archäologischen<br />
Befunden nur schwer Parallelen finden wird. 186<br />
2. 4. 1. 2. Lysias: Das Haus des Euphiletos<br />
Der zweite Text, der uns einige Informationen zum Erscheinungsbild des klassischen Hauses liefern<br />
kann, stammt aus einer Gerichtsrede des Lysias. Im Laufe des Berichts zu den Geschehnissen, die<br />
letztlich zum Mord an Eratosthenes führten, hält es Euphiletos für sinnvoll, seine Hörer mit dem<br />
Inneren seines Hauses vertraut zu machen. Sein Haus besitzt zwei Stockwerke, die prompt als Frauen-<br />
und als Männerbereiche, als Gynaikonitis und Andronitis, klassifiziert werden:<br />
183 Gynaikonitis wird hier einfach als „Raum“ übersetzt.<br />
184 Die Übersetzung ist etwas ungenau: als geschlechterspezifische Räume werden tatsächlich Gynaikonitis und Andronitis<br />
genannt, wobei der Begriff, der im Deutschen mit „Sklaven“ wiedergegeben ist, im Griechischen oiketai lautet. Im<br />
Originaltext sind Gynaikonitis und Andronitis zunächst keiner bestimmten Gruppe zugeordnet, erst im Nebensatz wird<br />
die Tatsache, dass beide Bereiche verschließbar sein sollen, damit begründet, die Fortpflanzung unter den oiketai zu<br />
kontrollieren.<br />
185 Cahill 2002, 149: „Slaves and free members of the household inhabit the same spaces in Ischomachos´s house, with<br />
female slaves in the women´s quarters and male in the men´s.”<br />
186 Cahill 2002, 150.<br />
S e i t e | 53
S e i t e | 54<br />
“Nun ist es so, ihr Herren, (den auch das muss ich euch darlegen), dass ich ein kleines<br />
zweistöckiges Haus habe, dessen Frauen- und Männergemächer oben und unten gleich groß<br />
sind.” (Lys. 1, 9)<br />
Ursprünglich residierte der Hausherr im unteren Stockwerk, wo auch die täglichen Pflichten der<br />
Kinderpflege verrichtet wurden, so dass die Mutter jedes Mal, wenn sie ihr Baby stillen, waschen oder<br />
beruhigen wollte, die Treppe von den Frauenräumen hinabsteigen musste. 187 Diesem ungünstigen<br />
Arrangement wurde durch einen Umzug des Ehemannes nach oben und der Frauen nach unten<br />
abgeholfen. 188 Die Ehefrau ist zunächst noch beiden Bereichen des Hauses verhaftet; erst nach und<br />
nach zieht sie sich aus dem gemeinsamen Schlafgemach zurück und verlegt ihren Schlafplatz in das<br />
Erdgeschoss. Mit der vollzogenen Trennung entzieht sich die Gattin der Aufsicht des Ehemannes. Die<br />
extensive Schilderung seiner Wohnverhältnisse dient Euphiletos letztlich dazu, jedes Eingeständnis<br />
von Schuld bzw. Pflichtvernachlässigung von sich weisen, indem er deutlich macht, dass es zum einen<br />
keinen Verdacht auf Untreue gab, zum anderen die Umquartierung der Frauen aus dem sicheren und<br />
vor allem besser überwachbaren Obergeschoss nachvollziehbare Gründe hatte. Eine strikte<br />
Geschlechtertrennung in Form eines Ober- und Untergeschosses war jedoch zu keinem Zeitpunkt<br />
gegeben. Denn anfänglich ist das Betreten des Erdgeschosses durch die Frauen auf die Erfordernisse<br />
der Kinderpflege und den Zugang zu Küche und Wasser zurückzuführen, nach dem Umzug teilt<br />
zumindest anfangs noch die Frau das Bett mit ihrem Ehemann, d. h. sie residiert mit ihm zusammen<br />
im Obergeschoss. 189<br />
Die leichte Anpassung und Umgestaltung der Räume und ihrer Nutzung legen nahe, dass jeder<br />
Haushalt nach den individuellen Vorstellungen des Hausherrn gestaltet war und es einen Prototyp des<br />
athenischen Hauses wahrscheinlich nicht gegeben hat. Wie wir gesehen haben, erforderte der<br />
Austausch der Wohnbereiche nur einen Austausch des ohnehin sehr spärlichen Mobiliars und der<br />
persönlichen Dinge. Eine Sache macht allerdings stutzig. Noch am Abend der Tat hat Euphiletos einen<br />
Gast geladen, mit dem er zusammen im oberen Stockwerk speist. 190 Nun sind die Andrones genau die<br />
Räume, die man in der Regel immer durch architektonische Merkmale, wie eine aus der Achse<br />
versetzte Eingangsschwelle, umlaufende erhöhte Plattformen für die Klinen und eine aufwendige<br />
Ausstattung mit Kieselfußboden oder Mosaik, bestimmen kann. 191 Im oberen Stockwerk gelegene<br />
Speiseräume sind uns allein aufgrund der mangelnden Befundsituation nicht überliefert, es ist aber<br />
doch eher davon auszugehen, dass sich diese gut zugänglich, d. h. ebenerdig, befunden haben, wie es<br />
auch einzelne archäologische Befunde bestätigen. Es bleibt nur zu überlegen, ob es sich vielleicht<br />
angesichts der geringen Zahl der Gäste um ein eher informelles Speisen außerhalb des dafür<br />
187 S. Walker, Women and Housing in Classical Greece, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.), Images of Women in Antiquity<br />
²(London 1993) 83 erklärt, dass für die ein Zugang zu frischem Wasser – also etwa ein Brunnen oder eine Zisterne –<br />
Kinderpflege vonnöten war; Nevett 1995, 363.<br />
188 Lys. 1, 9 f.<br />
189 Knigge 2005, 11 weist darauf hin, dass sowohl Vitr. 6, 7 als auch Lys. 1, 9–14 den gemeinsamen Schlafraum des<br />
Ehepaares innerhalb der Gynaikonitis verorten. Dass das aber nicht zwingend der Fall sein muss, zeigt die<br />
Umgestaltungsaktion im Haus des Euphiletos; s. auch Schnurr-Redford 1996, 94.<br />
190 Lys. 1, 22.<br />
191 z. B. Piraeus, Häuser 5–9: W. Hoepfner – E.-L. Schwandner (Hrsg.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland,<br />
Wohnen in der klassischen Polis I (München 1994) 40; Nevett 1995, 369.
vorgesehenen Andron gehandelt hat, so wie das Einnehmen der Mahlzeit ja offensichtlich auch im Hof<br />
vonstatten gehen konnte. 192<br />
2. 4. 1. 3. Vereinzelte Textstellen zur antiken Wohnkultur<br />
Ein einheitliches Verständnis des Begriffes Gynaikonitis liegt auch innerhalb der Gerichtsreden des<br />
Lysias offenbar nicht vor. Während in der ersten Rede des Lysias darunter ein komplettes Geschoss zu<br />
verstehen ist – in diesem Fall das Obergeschoss 193 , werden Frauenräume, wohlgemerkt im Plural,<br />
hingegen in seiner dritten Rede als Schlafräume der Schwester und Nichten des Anklägers genannt.<br />
Denn dort sind diese anzutreffen, als des Nachts Fremde in das Haus ein- und bis zu den<br />
Frauenräumen vordringen. 194 Wo diese Frauenräume zu lokalisieren sind und ob die Schlafräume<br />
darin integriert waren, ist dem Text nicht zu entnehmen. Es ist jedoch plausibler, sie in diesem Fall im<br />
Erdgeschoss zu vermuten, ansonsten hätten sich die fremden Männer nicht ungehindert und rasch dort<br />
Zutritt verschaffen können. 195 Da die Eindringlinge jedoch auf der Suche nach einem Jüngling waren,<br />
der zu diesem Zeitpunkt im Hause des Anklägers logierte, waren die Frauenräume kaum das<br />
eigentliche Ziel. Wenn diese nun nach stereotypem Vorbild immer an derselben Stelle innerhalb des<br />
Wohngefüges eingerichtet gewesen wären, hätten die fremden Männer damit rechnen müssen, Frauen<br />
und Parthenoi zu überraschen. Dass eine solche schändliche Tat nicht beabsichtigt war, zeigt jedoch<br />
der baldige einsichtige Rückzug.<br />
Interessant für die Debatte um die sozialen Kontakte innerhalb der Familie und den sozialen Umgang<br />
innerhalb des Oikos ist die Erwähnung des Parthenon, wörtlich übersetzt des Jungfrauengemachs, in<br />
den „Phönikerinnen“ des Euripides. Nachdem Antigone das vor der Stadt lagernde Heer gesehen hat,<br />
soll sie in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. 196 Der Begriff scheint der Gynaikonitis<br />
bedeutungsverwandt zu sein, wobei sich der Parthenon offensichtlich auf eine genau definierbare<br />
weibliche Gruppe innerhalb der Bewohner eines Oikos bezieht. Offenbar beschränkt sich der<br />
Gebrauch des Terminus auf die Tragödie, so dass eine zeitgenössische Einrichtung im klassischen<br />
Athen vielleicht nicht unbedingt vorauszusetzen ist. Das Raumkonzept der griechischen Häuser, das<br />
sei bereits vorweggenommen, zeichnet sich durch Multifunktionalität aus, selten ist ein Raum nur<br />
einer einzigen Tätigkeit oder Personengruppe zugeordnet. 197 Es lässt sich allerdings nicht leugnen,<br />
dass der Parthenon als passender Aufenthaltsort für ein junges Mädchen beschrieben wird. Der<br />
192 Demosth. or. 47, 56.<br />
193 Schnurr-Redford 1996, 92 führt diverse Stellen des Aristophanes – Aristoph. Thesm. 482 f.; Eccl. 962. 698 – an, in denen<br />
es heißt, Frauen stiegen von oben herab bzw. hinauf, um die Lage der Gynaikonitis im Obergeschoss zu belegen.<br />
194 Lys. 3, 6.<br />
195 Ähnlich auch Cahill 2002, 153: „The account in Lysias 3 quoted above, in which Simon „broke down the doors, and<br />
entered the women´s rooms” looking for Thedotus, makes no mention of climbing up to the second story.”<br />
196 Eur. Phoen. 193–195.<br />
197 Nevett 1999, 37. 68; s. auch Kap. 2. 4. 3.<br />
S e i t e | 55
Begriff scheint fast analog für Zurückgezogenheit verwendet zu werden. 198 Dies ist nun wiederum ein<br />
Ideal, das Eingang in die bürgerliche Ideologie Athens gefunden hat. Besonders unverheiratete Frauen<br />
wurden behütet, da ihre knospende Sexualität von mancherlei Gefahr bedroht war. 199<br />
Die Anklageschrift des Demosthenes gegen Euergos ist zwar für die Gynaikonitis-Problematik ohne<br />
Belang, wir erfahren dennoch interessante Einzelheiten über die Lebensgewohnheiten einer<br />
athenischen Familie. Die Angabe, der Ankläger lebe seit seiner Kindheit in der Nähe des<br />
Hippodroms 200 , verrät, dass sich die nachfolgende Beschreibung der Baulichkeiten nicht auf die<br />
Charakteristika eines Stadthauses, sondern eher auf die eines Land- oder Vorstadthauses beziehen. J.<br />
Travlos lokalisiert besagte Sportstätte im Bezirk Halipedon, etwa dort, wo die Langen Mauern auf den<br />
Piräus treffen. 201 Das Haus verfügt über einen Garten – kepos – und über einen Hof – aule 202 , wobei<br />
beide Begriffe meiner Einschätzung nach wohl synonym verwendet werden können. Als Gläubiger<br />
des Hausherrn die Haustür aufbrechen, finden sie die Hausherrin und ihre Kinder in Begleitung einer<br />
alten Amme beim Mittagsmahl im Hof vor. Die Mägde verbarrikadieren sich im pyrgos, einem Turm,<br />
der als Wohnraum bezeichnet wird. 203 Eine runde Struktur mit massiver Mauerung ist uns tatsächlich<br />
mehrfach aus Baubefunden überliefert und ist offenbar, da sie vor allem bei Häusern außerhalb<br />
städtischer Befestigungen begegnet, eine besondere Schutzvorrichtung. 204<br />
In Menanders „Samia“ wird am Rande auf die Gestaltung des Hauses verwiesen, als sich der Herr des<br />
Hauses, Demeas, während der Hochzeitsvorbereitungen für seinen Sohn aus Versehen in die<br />
Vorratskammer einschließt:<br />
S e i t e | 56<br />
„Ich selbst war auch nicht faul und raffte, was ich konnte, auf<br />
Und schleppt´ es hin. Dabei geschah es: ich betrat<br />
Von ungefähr die Vorratskammer, wollte allerlei<br />
Dort holen, fing ein bißchen an zu inspizieren – kam<br />
Nicht mehr heraus. Wie ich mich dort verweilte, schritt herab<br />
Vom Oberstock ein Weib und ging ins Vorgemach<br />
Der Vorratskammer, wo ein Webstuhl steht! Die Treppe führt<br />
Geradewegs dorthin.“ (Men. Sam. 228–236)<br />
Der Textausschnitt belegt, dass sich die Frauen des Haushalts frei im Haus bewegen, je nachdem,<br />
wohin ihre Pflichten sie führen. Es werden Vorräte und Nahrungsmittel herangeschafft und Feuer<br />
entzündet, um das Festmahl vorzubereiten. In der allgemeinen Hektik und Betriebsamkeit packt auch<br />
der Hausherr im Haus mit an. Vorratskammer und Arbeitsraum mit dem Webstuhl befinden sich hier<br />
in unmittelbarer Nachbarschaft im Erdgeschoss. Das Obergeschoss ist über den Webraum erreichbar.<br />
198 Schutz oder Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit?, z. B. F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. P. Schmitt-Pantel (Hrsg.),<br />
Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 223.<br />
199 Zu behüteten Frauen, z. B. Schnurr-Redford 1996, 160 f.<br />
200 Demosth. or. 47, 53.<br />
201 J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen (Tübingen 1971) 3. 164 Abb. 213.<br />
202 Demosth. or. 47, 53. 55 f.: kepos in Demosth. or. 50, 61 umschreibt einen Nutzgarten, in dem Gemüse gezogen wird.<br />
203 Demosth. or. 47, 56.<br />
204 z. B. W. Hoepfner – E.-L. Schwandner (Hrsg.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen<br />
Polis I (München 1994) 248–250 Abb.: Thorikos, Wohnhäuser mit Wehrtürmen, von den Autoren als Oikos identifiziert;<br />
s. auch J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Attika (Tübingen 1988) 475 Abb. 597: Kalampokas bei Voula.
Was die benannte Frau nun tatsächlich im Obergeschoss getan hat bzw. in welchem Raum sie sich<br />
aufgehalten hat, bleibt im Dunkeln.<br />
Vitruvs „De architectura“ wurde hier bewusst ausgeklammert, da inzwischen erwiesen ist, dass sich<br />
dessen Wohnkonzept nicht auf ein klassisches Stadthaus, sondern vielmehr auf einen herrschaftlichen<br />
Besitz bereits hellenistischer Zeit bezieht. 205<br />
2. 4. 2. Der archäologische Befund: Pastas- und Single-Entrance-Courtyard-House<br />
Die Vorstellung der Geschlechterseparation drang selbst bis in die Forschung zur athenischen<br />
Wohnkultur vor. Man war überzeugt, die Eheleute würden in geschlechterspezifischen Räumen oder<br />
Bereichen des Hauses leben, die sie faktisch voneinander separierten. 206 Die Rolle der Frau wurde eher<br />
als die einer Arbeitskraft im eigenen Haus gesehen, die durch den sozialen Druck von außen an ihren<br />
Wirkungsbereich gebunden war, als die einer gleichberechtigten Partnerin. 207 Auf drastische Art und<br />
Weise schien diese Hypothese durch den Befund eines frühklassischen Wohnhauses einer Insula am<br />
Nordabhang des Areopags gestützt zu werden, obgleich er für die klassische Zeit singulär bleibt. Der<br />
Andron, der aufgrund seines Kieselsteinbodens unangefochten als Bankettraum gelten darf, ist<br />
zusammen mit einem dazugehörigen, vorgelagerten Hof durch einen separaten Eingang vom Rest des<br />
Hauses abgesetzt, der als Wirkungsbereich der Frau interpretiert wird. 208<br />
Nachdem die Quellen, wie gesagt, nur bruchstückhaft das Wohnen in der Antike erhellen können,<br />
unternahm man den Versuch, das Problem durch Befragung der archäologischen Befunde zu klären.<br />
Theoretisch müssten uns diese zumindest einen Eindruck vermitteln können, wie ein Wohnhaus der<br />
Klassik gestaltet war, wie viele Räume es besaß und wie diese zueinander angeordnet waren. Das<br />
Interesse der Forscher war zunächst vordergründig auf eine Typologisierung der Wohnarchitektur<br />
ausgerichtet, die die Funktion der einzelnen Räume außen vor ließ.<br />
205 J. Raeder, Vitruv, de architectura VI 7 (aedificia Graecorum) und die hellenistische Wohnhaus- und Palastarchitektur,<br />
Gymnasium 95, 1988, 347. 368.<br />
206 vgl. Xen. oik. 9, 5, wo es heißt, dass Gynaikonitis und Andronitis durch eine verriegelbare Tür voneinander getrennt sind;<br />
s. hierzu auch S. I. Rotroff – R. D. Lamberton, Women in the Athenian Agora (Athen 2006) 28.<br />
207 z. B. Keuls 1985, 98.<br />
208 z. B. H. A. Thompson, Activities in the Athenian Agora, Hesperia 28, 1959, 100 f. Taf. 16. 17: Die Rekonstruktion der<br />
zusammengehörigen Raumeinheiten unterscheidet sich hier von dem von S. Walker verwendeten Grundrissplan; S.<br />
Walker, Women and Housing in Classical Greece, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.), Images of Women in Antiquity<br />
²(London 1993) 84. 86 f. Abb. 6, 1. 2; Fantham 1994, 104 Abb. 3, 17.<br />
S e i t e | 57
S e i t e | 58<br />
2. 4. 2. 1. Olynth<br />
W. Hoepfner bietet im ersten Band der „Geschichte des Wohnens“ erstmals einen Überblick über die<br />
gesamte geographische Bandbreite und chronologische Entwicklung der Wohnkultur im Mittelmeer.<br />
Er postuliert die Existenz eines Typenhauses 209 , das unter dem Einfluss des geplanten<br />
Städtebaukonzepts des Hippodamos von Milet im Laufe des 5. Jhs. v. Chr. in mehreren Städten<br />
exemplarisch verwirklicht wurde, wie etwa in Olynth oder im Piräus. Folgendes Bau- und<br />
Wohnkonzept, wie es großflächige Grabungen in Olynth ans Licht gebracht haben, kann<br />
stellvertretend für die Wohnkultur der Mittelschicht des 4. Jhs. v. Chr. gelten 210 : Ein Eingang führt<br />
selten direkt, meist über einen Korridor in einen weiten Innenhof mit einer Pastas, von dem radial<br />
Räume abgehen, zu denen der Andron und der Oikos-Bereich mit Herdstelle, separatem Rauchfang-<br />
und Bade-Kompartiment zählen. Der Andron befindet sich hierbei direkt im Eingangsbereich und<br />
besitzt meist einen Vorraum, so dass Gäste doch bis zu einem gewissen Grad von den privaten<br />
Angelegenheiten der Hausbewohner abgeschirmt waren. In manchen Fällen lässt sich über dem Oikos-<br />
Trakt ein zweites Stockwerk rekonstruieren, das Hoepfner mit der sogenannten Gynaikonitis<br />
gleichsetzt, wie es bei Lysias offensichtlich bezeugt ist. 211<br />
2. 4. 2. 2. Piraeus<br />
Ein ähnliches, wenn auch teilweise weniger komplex gestaltetes Konzept hat man in den<br />
Wohnhäusern im Piräus entdeckt. Die Grundzüge bleiben jedoch weiterhin die gleichen. Aus den<br />
insgesamt zwölf ergrabenen, in ihrer Ausdehnung und Einteilung einheitlichen, jedoch unterschiedlich<br />
gut erhaltenen Wohnkomplexen rekonstruiert W. Hoepfner ein Typenhaus, das sich zusammensetzt<br />
aus einem großen Hof mit zwei, zur Straße hin gelegenen Räumen und einem rückwärtigen,<br />
zweistöckigen Bereich mit Andron, Vorhalle und einem Oikos-Bereich. 212 Der Oikos, als Raum für die<br />
Mahlzeiten der Familie gedeutet, enthielt die Herdstelle und zumeist zwei kleine Nebenräume, von<br />
denen einer als Bad fungierte, dessen Wasser auf dem nahen Herd erhitzt werden konnte. Schlafraum<br />
und Gynaikonitis, die sich auf dem Grundrissplan bis dato nicht nachweisen lassen, weist W. Hoepfner<br />
dem Obergeschoss zu. Die beiden Räume, die den Eingangsbereich flankieren, könnten als<br />
Vorratsräume, Sklavenunterkünfte oder, ließe sich ein separater Eingang belegen, auch als Stall oder<br />
Laden genutzt worden sein.<br />
209 Cahill 2002, 82. 84 steht der Reduzierung der Wohnarchitektur Olynths auf das Typenhaus kritisch gegenüber: „To study<br />
only a single „type Hause“ flattens the richness and variety of this city. [...] But with more than a hundred excavated<br />
houses, Olynthus is one of the very few Greek cities where we can look at a range of alternative rather than a single<br />
standard, and put the scholarly construct of the “type house” to the test.”<br />
210 W. Hoepfner 1999, 272–274; Cahill 2002, 74–84.<br />
211 Lys. 1, 9; W. Hoepfner 1999, 274; Cahill 2002, 82 erwähnt Steinfundamente für Treppen.<br />
212 Zu Grabungsbefunden und der Rekonstruktion des Typenhauses, s. J. E. Jones, Town and Country Houses of Attica in<br />
Classical Times, MIGRA 1, 1975, 98 f. Abb. 11; K.-V. von Eickstedt, Beiträge zur Topographie des antiken Piräus<br />
(Athen 1991) 97–112; W. Hoepfner – E.-L. Schwandner (Hrsg.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen<br />
in der klassischen Polis I (München 1994) 38–43; W. Hoepfner 1999, 218–220.
2. 4. 2. 3. Athen<br />
Da viele antike Bauten der griechischen Hauptstadt im Laufe der Jahrhunderte zerstört oder überbaut<br />
wurden, sind die Befunde zur athenischen Wohnkultur nicht sehr zahlreich. Die Baudichte der<br />
modernen Stadt erschwert großflächige Grabungen, so dass nur hier und dort spärliche Reste des 5.<br />
Jhs. v. Chr., d. h. meist nur einzelne Wohnhäuser, seltener ganze Wohnkomplexe, zutage kamen. 213<br />
Die archäologischen Befunde zur athenischen Wohnkultur umfassen im Wesentlichen Häuser auf der<br />
Pnyx, dem Nymphenhügel und der Agora aus dem 5. Jh. v. Chr. mit Umbauphasen im 5. und. 4. Jh. 214<br />
Gesondert zu nennen sind Haus C und D am sog. Great Drain, und Häuser am Fuß des Areopag wie<br />
das sog. Omega-Haus.<br />
Das Haus vom Typ „Courtyard-House“ ist auch in Athen die dominierende Bauweise. Athen ist<br />
jedoch keine Planstadt, verwinkelte Straßenzüge bedingen oftmals einen unregelmäßigen Grundriss<br />
der Wohnhäuser. Die Größe der Häuser ist nicht normiert und generell bescheidener als man es<br />
angesichts des politischen Anspruches der Stadt und ihres Repräsentationsdranges im öffentlichen<br />
Sektor vermuten würde. 215 Angesichts der im Großen und Ganzen doch recht individuellen<br />
Wohnhäuser scheint es unangebracht, von einem athenischen Typenhaus zu sprechen. Anhand des<br />
selektiven und bruchstückhaften Materials eine Rekonstruktion der athenischen Wohnkultur<br />
entwickeln zu wollen, wäre mehr als fragwürdig. Lückenhafte Grabungsbefunde verleiten rasch zu<br />
spekulativen, funktionellen Raumzuweisungen, die sich auf die Größe, Form und die Lage der Räume<br />
innerhalb des gesamten Raumgefüges stützen. Vor dem Hintergrund der vielen anderen<br />
Grabungsergebnisse, vor allem denen Olynths, wird jedoch deutlich, dass sich auch Athen soweit in<br />
das bereits gewonnene Bild einfügt. 216 Die festgestellten, grundsätzlichen Charakterisika lassen sich<br />
auch für die athenische Bauweise konstatieren: Mittelpunkt des Hauses ist ein offener Hof, um den<br />
sich die Wohnräume gruppieren. In einigen Fällen besaß der Hof auf einer Seite eine Pastas, wie sie<br />
für die Häuser in Olynth typisch ist. Der Andron kann tatsächlich in der Regel aufgrund seiner<br />
bauspezifischen Eigenheiten identifiziert werden. 217 Er befindet sich – anders als etwa im Typenhaus<br />
in Piräus – in unmittelbarer Nachbarschaft des Eingangs.<br />
Die archäologischen Befunde konnten bisher im Falle von Athen leider nur sehr bedingt für unsere<br />
Fragestellung herangezogen werden. Zwar sind uns zum Teil verlässliche Grundrisse von<br />
Wohnkomplexen zugänglich, der Erhaltungszustand sowie eine ungenügende Funddokumentation<br />
lassen die tatsächliche Nutzung der Räume, die Geschlechtertrennung und die soziale Ordnung<br />
innerhalb des Oikos im Dunkeln. Eine Ausnahme bildet ein bescheidener Wohnkomplex einer Insula<br />
am Nordabhang der Akropolis. Der große Raum am Ende des Hofes, gegenüber dem Eingang, enthielt<br />
213 Nevett 1999, 85 f.<br />
214 J. E. Jones, Town and Country Houses of Attica in Classical Times, MIGRA 1, 1975, 67 Abb. 1, A zeigt anhand einer<br />
Zeichnung die Verteilung der nachgewiesenen, klassischen Wohnhäuser um Akropolis und Areopag.<br />
215 Pomeroy 1985, 119 f.: „ Im Gegensatz zu den so bewunderten öffentlichen Bauten, die meist den Aufenthaltsort der<br />
Männer bildeten, waren die Wohnquartiere des klassischen Athen düster, schmutzig und unhygienisch.“<br />
216 Literaturverweise zur ländlichen Wohnkultur u. a. in Attika, s. Kreilinger 2007, 47 Anm. 348.<br />
217 Nach Bundrick 2008, 313 Anm. 103 sind nur für zwei athenische Häuser Andrones nachgewiesen, für ein Haus am<br />
Nordabhang des Areopags und das sog. Haus des griechischen Mosaiks auf der Pnyx. In der Literatur werden weitere<br />
Häuser mit Andrones angeführt, nämlich Haus C und D im Industrieviertel, das Haus südlich der Süd-Stoa und das sog.<br />
Omega-Haus.<br />
S e i t e | 59
Einlassungen für Pithoi und war wohl der Vorratsraum. Im Raum gleich neben dem Eingang fand man<br />
Webgewichte, in einem anderen Kochaufsätze aus Ton, ein anderer, der vielleicht als Andron<br />
identifiziert werden kann, besaß einen Zementboden. 218<br />
S e i t e | 60<br />
2. 4. 2. 4. Der Bau Z im Kerameikos<br />
Mit dem Bau Z im Kerameikos liegt uns nun ein wahrer Glückstreffer vor. Nachdem er bisher<br />
aufgrund seiner Lage direkt an der Stadtmauer innerhalb des Töpferviertels, seiner kleinen<br />
Raumeinheiten und trotz bzw. wohl auch wegen der hohen Zahl entdeckter Webgewichte als Bordell<br />
gedeutet wurde 219 , ist nun endgültig geklärt, dass er zumindest in seinen ersten beiden Bauphasen, die<br />
die Jahre von ca. 430 v. Chr. bis zum Ende des 5. Jhs. umfassen, als Wohnhaus genutzt wurde. Eine<br />
beachtliche Anzahl von beweglichen Gegenständen – zum Teil noch in situ bzw. in Falllage – kann<br />
hilfreich sein, die Funktion der Räume und ihre spezifische Benutzung zu erhellen. Dennoch bleibt die<br />
Funktion vieler Räume aufgrund des Mangels bzw. der geringen Anzahl an Funden oder aufgrund des<br />
stark zerstörten Erhaltungszustandes unklar. Eine Rekonstruktion des Soziallebens für den Bau Z<br />
bleibt deshalb letztlich spekulativ.<br />
Eine Einteilung der Wohnfläche in Gynaikonitis, Andronitis und repräsentativen Bereich – im Übrigen<br />
nach dem Vorbild Vitruvs – wird für die Bauphase 1 um 430 v. Chr. von U. Knigge überzeugend<br />
dargelegt. Während der für Gäste gedachte Bereich, der unter anderem über eine Küche und zwei<br />
Banketträume 220 verfügte, leicht über einen Protyron-Komplex von außen erreichbar war, wurde der<br />
Zugang zu den privaten Räumen über einen zum Hof hin offenen Prostas kanalisiert. 221 Von dort<br />
waren sowohl der Oikos, als auch die voneinander getrennten Bereiche der Männer- und<br />
Frauengemächer zugänglich. Der Raum R, der nach U. Knigge in die Gynaikonitis integriert war,<br />
zeichnet sich durch den Fund von 106 Webgewichten aus, die tatsächlich auf eine Nutzung des<br />
Raumes durch Frauen hindeuten. 222 Die Identifikation der Andronitis im nördlichen Wohnbereich geht<br />
allerdings nicht auf Funde zurück 223 . Seine Existenz als Pendant zum Frauentrakt muss jedoch<br />
zwangsläufig zu einer Verortung im Wohntrakt führen. Seine Deutung als Unterbringungsort der<br />
männlichen Hausbewohner weicht von der herkömmlichen ab, die die Andronitis nicht als Teil des<br />
internen Hausbereichs, sondern als für die Öffentlichkeit zugänglichen Teil des Hauses begreift, zu<br />
dem vor allem der Andron gehört. Der Andron wird von U. Knigge dagegen in einem dritten,<br />
repräsentativen Teil lokalisiert. Für unsere Zwecke ist es wichtig festzuhalten, dass der bauliche<br />
Charakter des Baus Z in der ersten Phase offensichtlich eine Trennung der repräsentativen und der<br />
218 J. E. Jones, Town and Country Houses of Attica in Classical Times, MIGRA 1, 1975, 82 f. Abb. 6.<br />
219 z. B. Reinsberg 1993, 141 f. bezeichnet den Bau Z1–3 als Gaststätte, in denen auch Prostituierte ihr Unwesen trieben.<br />
Besonders die vielen Aphrodite-Darstellungen sind für sie ein Beweis, dass hier Prostituierte verkehrten.<br />
220 Es ist schwer vorstellbar, das ein Haus dieser Größe kein Andron besessen haben soll. In Frage kämen nur die beiden<br />
Räume O und P, die jedoch nach Knigge 2005, 17 f. keines der für Andrones üblichen Merkmale aufweisen.<br />
221 Knigge 2005, 15.<br />
222 Raum R wird von Knigge 2005, 10 als Arbeitsbereich der Hausfrau oder Schaffnerin angesprochen.<br />
223 Der Schminktopf und die drei Webgewichte aus Raum F sind nun nicht unbedingt geschlechtsspezifisch männliche<br />
Gegenstände, s. Knigge 2005, 16.
privaten Wohnbereiche beabsichtigt, wobei Andronitis und Gynaikonitis letzterem gemeinsam<br />
zugerechnet werden. Ob und inwiefern außerdem eine geschlechtsspezifische Trennung innerhalb der<br />
Privatgemächer vorliegt, bzw. welchen Charakter die Gynaikonitis tatsächlich hat, kann nur vermuten<br />
werden.<br />
Der kurzlebige, durch ein Erdbeben zerstörte Bau Z 1 wurde bereits um 420–410 v. Chr. durch seinen<br />
Nachfolgerbau Z 2 ersetzt. Obwohl beide Bauten in ihrer Entstehung nur etwa zehn bis zwanzig Jahre<br />
auseinanderliegen, wurde in Z 2 ein völlig anderes Wohnkonzept verwirklicht. Während in Phase 1<br />
jeder Trakt über einen eigenen, zumeist schmalen Hof verfügte, gruppieren sich nun die Mehrzahl der<br />
Räume um einen luftigen Hof mit großzügigen Ausmaßen. 224 Obgleich der Hof vom Eingangsbereich<br />
einsehbar war, war man nach wie vor bemüht, privat und öffentlich genutzten Raum getrennt zu<br />
halten. Mit einer der westlichen Raumreihe vorgeblendeten Pastas ist der Bau Z den Wohnhäusern<br />
Olynths vom Typus des „Pastas-Haus“ nachempfunden. Die meisten der um den zentralen Hof<br />
gelegenen Räume werden aufgrund ihrer exponierten Lage als Empfangs- und Bewirtungsräume<br />
betrachtet 225 , an die sich im Süden dann die einigermaßen gesichert identifizierbare sog. Oikos-Unit<br />
anschließt, die sich aus einer Art familiärem Aufenthaltsraum, Küche und Bad zusammensetzt. 226<br />
Besagter Oikos-Raum R scheint die einzige Zugangsmöglichkeit in den Südosttrakt gewesen zu sein,<br />
der seiner Abgelegenheit und Geschlossenheit wegen als Gynaikonitis gedeutet wird. 227 Die ohnehin<br />
sehr raren Funde lassen keinen Aufschluss über die Benutzer der Räume zu. Dass die weiblichen<br />
Mitglieder separat von den öffentlich nutzbaren Räumen untergebracht waren, ergibt Sinn. Wo in<br />
dieser Hypothese dagegen die männlichen Mitbewohner Platz finden, bleibt unklar. Die<br />
Beschädigungen im Südost-Trakt des Hauses sind derart groß, dass eine weitere Aufteilung, sollte es<br />
sie gegeben haben, sich nicht nachweisen lässt.<br />
Der erst im dritten Viertel des 4. Jhs. v. Chr. errichtete Bau Z 3 übernimmt im Großen und Ganzen den<br />
Grundriss seines Vorgängerbaus. Das Fehlen von deutlich abgrenzbaren Wohneinheiten, die in den<br />
Augen U. Knigges das hervorstechendste Charakteristikum des athenischen Wohnhauses sind, haben<br />
die Autorin letztlich zu dem Schluss geführt, im Bau des 4. Jhs. v. Chr. nun ein Wirtshaus mit<br />
integrierter Weberei erkennen zu wollen. 228 Eine auffällig hohe Funddichte an Trink- und<br />
Kochgeschirr, Webgewichten und Münzgeld scheint diese Annahme zu stützen. 229 Von den drei<br />
Zisternen sind zwei mit einer Art Auffangbecken für über einen Mosaikboden abfließendes Wasser<br />
ausgestattet. 230 Derartige Vorrichtungen, die wohl für die Reinigungsprozesse im Laufe der<br />
Gewebeherstellung vorgesehen waren, sind in einem gewöhnlichen Haushalt ebenso wenig zu<br />
erwarten wie das Speicherpotential an Wasser, das insgesamt ein Brunnen und drei Zisternen<br />
gewährleisten. Andererseits zeigt Xenophon in seinen „Memorabilia“, dass man sich im 4. Jh. v. Chr.<br />
aufgrund der allgemeinen schlechten ökonomischen Lage die handwerklichen Fähigkeiten der<br />
224 Knigge 2005, 47 f.<br />
225 Knigge 2005, 35 f.<br />
226 Knigge 2005, 28. 32–35.<br />
227 Knigge 2005, 41. Alternativ könne sich die Gynaikonitis auch im Obergeschoss, auf das sich allerdings keine Hinweise<br />
finden, befunden haben, so dass im Erdgeschoss Magazine und Personalunterkünfte untergebracht waren.<br />
228 Knigge 2005, 49. 52. 78 f.<br />
229 Knigge 2005, 71 f.<br />
230 Knigge 2005, 55 f. 63. 70 f.<br />
S e i t e | 61
weiblichen Hausangehörigen gerne zunutze machte 231 und die ursprüngliche, lediglich für den<br />
Eigenbedarf betriebene Textilproduktion im großen Maßstab aufzog. 232 Dass es sich also um ein<br />
athenisches Wohnhaus allerdings mit erweiterter gewerblicher Nutzung gehandelt haben könnte, kann<br />
nicht ausgeschlossen werden. Für die Kombination von Wohnhaus und Werkstatt haben wir im Haus<br />
C und D am Great Drain ein hervorragendes Beispiel, auch wenn es sich dort wohl um eine Werkstatt<br />
handelte, die mit den Werkstoffen Marmor, Bronze und Eisen arbeitete. 233<br />
S e i t e | 62<br />
2. 4. 3. Das Sozialleben im Oikos<br />
Die Identifizierung der Räume basiert nicht immer auf archäologischen oder schriftlichen Belegen,<br />
sondern muss sich aufgrund mangelhafter Überlieferung und zahlloser offener Fragen häufig auf<br />
Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten stützen. 234 Im Zuge ihrer Dissertation machte L. Nevett 235<br />
einen vielversprechenden Neuansatz: Was können uns die archäologischen Befunde von Wohnhäusern<br />
unter Miteinbeziehung ihrer Architektur und ihrer Funde über die Anordnung und Nutzung der Räume<br />
und das Sozialleben des Oikos verraten? Ihrem Beispiel folgte jüngst eine Publikation ähnlicher<br />
Zielsetzung von N. Cahill mit Spezialisierung auf die Fundsituation in Olynth. 236<br />
„The comparability of the features in these houses with aspects of the houses found at Olynthos<br />
suggests that similar patterns of social behaviour prevailed, with the house considered as a private<br />
environment and activity within subject to supervision from a single location.” 237 Offensichtlich<br />
postuliert L. Nevett ein für ganz Griechenland gültiges Wohnkonzept, das auf einer gemeinsamen<br />
gesellschaftlichen Norm basiert. Ist diese Prämisse richtig, müsste es uns erlaubt sein, Erkenntnisse,<br />
die aus den Grabungen in Olynth gewonnen wurden, auf athenische Verhältnisse zu übertragen.<br />
Gerade Athen lässt sich nun aber, wie wir gesehen haben, nur bedingt in das homogene Schema des<br />
Typenhauses, wie wir es in Reihenhausform im Piräus vorfinden, pressen. Unregelmäßige Grundrisse<br />
231 Xen. mem. 2, 7, 10–12.<br />
232 Reuthner 2006, 260–267.<br />
233 J. E. Jones, Town and Country Houses of Attica in Classical Times, MIGRA 1, 1975, 73 f. Abb. 3 A–C; Nevett 1999, 90.<br />
234 z. B. Cahill 2002, 78 f.<br />
235 Nevett 1999.<br />
236 Olynth eignet sich aus mehreren Gründen hervorragend für eine sozialhistorische Untersuchung. Die Stadt verfügt über<br />
eine großflächige Wohnbebauung, laut Cahill 2002, 73 f. sind insgesamt etwa 100 Wohnhäuser ausgegraben worden,<br />
deren Bearbeitung in zuverlässigen Grabungsdokumentationen vorliegt. Außerdem, und dies ist hinsichtlich der aktuellen<br />
Fragestellung der entscheidende Punkt, wurde die Stadt nach ihrer Zerstörung nur temporär und in geringem Ausmaß<br />
wiederbesiedelt, so dass sich, abgesehen von marginalen Eingriffen in den archäologischen Befund durch Plünderungen,<br />
natürliche Prozesse wie Bodenerosion oder moderne Zerstörungen etwa durch die landwirtschaftliche Bearbeitung, die<br />
Wohnhäuser uns heute noch so darbieten, wie sie verlassen wurden. Dies bedeutet, dass sich Gebrauchsgegenstände,<br />
wenn sie nicht nachträglich von ihren Besitzern geborgen wurden, da aufgefunden werden, wo sie aufbewahrt oder<br />
benutzt wurden, und uns Hinweise geben, welche Tätigkeiten in welchen Räumen von welchen Personen verrichtet<br />
wurden; s. auch Nevett 1995, 367; Cahill 2002, 45 ff.<br />
237 Nevett 1999, 87 nimmt Bezug auf die Wohnhäuser Athens z. B. an den Abhängen des Areopag, der Pnyx und der Agora,<br />
deren Erhaltungszustand eine einigermaßen verlässlich Rekonstruktion des Grundrisses gestatten.
und lückenhafte Grabungsbefunde 238 verleiten zu spekulativen funktionellen Raumzuweisungen, die<br />
sich auf die Größe, Form und die Lage der Räume innerhalb des gesamten Raumgefüges stützen.<br />
Dennoch lassen sich zumindest grundsätzliche Prinzipien griechischer Wohnkultur unter Vorbehalt<br />
verallgemeinern.<br />
Dem sog. „Single-Entrance-Courtyard-House“ bzw. „Pastas-House“ liegt zunächst einmal ein<br />
vollständig nach innen ausgerichtetes Raumkonzept zugrunde, das Ausdruck für das Verlangen nach<br />
Abgrenzung und Privatisierung ist und die Bedürfnisse der Olynther offenbar ebenso wie die der<br />
Athener befriedigt hat. Der zentral gelegene Hof reguliert den Zutritt in die angrenzenden Räume und<br />
ermöglicht den Überblick über die Vorgänge innerhalb des Hauses ebenso wie über in das Haus<br />
eintretende Gäste. 239 Dass hierbei die Frau nicht nur die Rolle einer passiven Zuschauerin spielt, verrät<br />
eine Passage in den „Oikonomika“ des Pseudo-Aristoteles. Dort ergeht der Auftrag an die Hausherrin,<br />
nicht uneingeschränkten Zugang zum Hausinneren zu gewähren, es sei denn, es geschieht auf<br />
ausdrücklichen Wunsch des Hausherrn. 240 Bei Theophrast ist es die Ehefrau des „Misstrauischen“, die<br />
nachts den Riegel vor die Haus- und Hoftür legt. 241<br />
Laut B. A. Ault war der Hof unter anderem ein Ort der Verrichtung häuslicher Arbeiten. In ihm<br />
wurden die "Vorbereitung von Nahrungsmitteln, das Kochen, die Bearbeitung von Wolle und das<br />
Weben sowie das Waschen und Trocknen von Kleidern" erledigt. 242 Das Vorhandensein eines<br />
schattigen Hofes und Funde wie Münzen, Vorrats- und Gebrauchskeramik, Lampen, Tafelgeschirr,<br />
Schmuck, Webgeräte, Toilettengefäße, Waffen, Schließen und Schlösser 243 lassen auf mannigfaltige<br />
Tätigkeiten in diesem Bereich schließen, an denen Frauen wesentlichen Anteil hatten. L. Nevett hat<br />
mit Recht darauf hingewiesen, dass viele Tätigkeiten ohne weitere Umstände von einem Raum in<br />
einen anderen verlegt werden konnten, so dass manche Räume grundsätzlich nicht nur einer Gruppe<br />
von Personen oder bestimmten Tätigkeiten vorbehalten waren. 244 Das gilt z. T. auch für Zimmer, die<br />
ihrer Funktion gemäß eingerichtet waren, wie etwa die Küche und der Andron. Es ist nachgewiesen,<br />
dass auch außerhalb der Küche mit Nahrungsmitteln hantiert 245 , ebenso wie außerhalb des Andron<br />
gespeist wurde. Die Ehefrau des Anklägers in der Prozessrede gegen Euergos speist mit ihren Kindern<br />
238 Dies gilt wohl vor allem für die z. T. recht kargen Befunde auf Pnyx, Nymphenhügel und Nordabhang des Areopag, z. B.<br />
H. Lauter-Bufe – H. Lauter, Wohnhäuser und Stadtviertel des klassischen Athen, AM 86, 1971, 109–124: Hier liegt der<br />
Bautypus des sog. Flügelhofhauses zugrunde, der vielleicht einen zeitgleiche Alternative zum athenischen Courtyard-<br />
House repräsentiert; s. auch Jones a. O. (Anm. 233) 88–91 Abb. 8, A. B.<br />
239 J. Gould, Law, Custom and Myth: Aspects of the social Position of Women in Classical Athens, JHS 100, 1980, 48.<br />
240 Aristot. oec. III, 140.<br />
241 Theophr. char. 18, 4.<br />
242 B. A. Ault, Die klassische "Aule“. Höfe und Freiraum, in: Hoepfner 1999, 540.<br />
243 Nevett 1999, 65. 69.<br />
244 Nevett 1999, 37. 68; Cahill 2002, 78.<br />
245 Zur Essenszubereitung und speziell zu Funden von Mahlsteinen, s. auch Cahill 2002, 161–168.<br />
S e i t e | 63
und einer alten Amme im Hof, als sich Euergos zusammen mit seinem Schwager gewaltsam Eintritt<br />
verschafft. 246<br />
Abgesehen vom Hof können nur der Andron, die „Oikos-Unit“ mit Koch- und Badegelegenheit und<br />
gegebenenfalls Vorratsräume durch ihre architektonischen Merkmale bzw. funktionsorientierte<br />
Ausstattung identifiziert werden. 247 Andere Räumlichkeiten, die uns heute für ein Wohnhaus<br />
unverzichtbar erscheinen, allen voran der Thalamos, das Schlafzimmer, lassen sich mittels der<br />
archäologischen Befunde nicht festmachen, weshalb auch hier der Leitsatz Nevett´s anzuwenden ist:<br />
„There is little evidence to support a notion that Greek household space may have been personalised to<br />
the same degree.“ 248 Der Thalamos war eben nicht nur für die Nachtruhe gedacht, sondern diente, wie<br />
uns die antiken Quellen unterrichten, als Stauraum für wertvolle und geschätzte Objekte und Textilien,<br />
die vermutlich oft einen Teil der bräutlichen Mitgift bildeten. 249<br />
Während die vorbereitenden Stadien zur Weiterverarbeitung von Wolle durch die Beweglichkeit der<br />
benötigten Utensilien wie Kalathos, Spinnrocken und Spindel in diversen Räumen oder auch im Hof<br />
vonstatten gehen konnten, benötigt der aufgestellte Webstuhl einen festen Standort. Größere<br />
Fundkomplexe von Webgewichten ermöglichen es, in einigen Häusern Olynths den Aufstellungsplatz<br />
des Webstuhls zu lokalisieren. 250 Vorurteile, die vor allem aus der misogynen Literatur ihre Nahrung<br />
erhielten, konnten dank der Befunde Olynths entkräftet werden: „The use of these rooms for weaving<br />
does not, however, seem to result from a desire to restrict this activity to a more private or secluded<br />
part of the house. Indeed, weaving areas were sometimes conspicuously close to the entrance of the<br />
house, hardly more removed than the court or Pastas.” 251 Das Arbeitszimmer der Hausherrin, das man<br />
gemeinhin als Gynaikonitis definierte, war also nicht ins abgelegenste und düsterste Eck des Hauses<br />
verbannt. 252 Im Falle Olynths fiel nun zunächst auf, dass häufig mehrere Bereiche des Hauses für die<br />
Textilherstellung genutzt wurden. Sie lagen häufig in unmittelbarer Nähe zu Hof, Pastas oder einer<br />
alternativen Lichtquelle und besaßen eine gute Ausleuchtung, wie sie für komplizierte Handarbeit von<br />
Vorteil ist. 253 Weben war jedoch kaum die einzige Tätigkeit, die im entsprechenden Raum ausgeführt<br />
wurde. Am Beispiel von Haus A v 9 in Olynth zeigt N. Cahill, dass in der Pastas neben dem Weben<br />
auch andere häusliche Tätigkeiten wie das Mahlen von Getreide oder das Kneten von Teig ausgeführt<br />
wurden. 254<br />
246 Laut Demosth. or. 47, 53 befindet sich das Landgut des Klägers in der Nähe des Hippodroms, d.h. im Bezirk Halipedon<br />
außerhalb Athens. – Zu Halipedon, s. J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen (Tübingen 1971) 164<br />
Abb. 213.<br />
247 Nevett 1999, 65–67.<br />
248 Nevett 1999, 37.<br />
249 Xen. oik. 9, 3; Lys. 12, 10: Eratosthenes bewahrt sein Barvermögen in einer Truhe in seinem Schlafzimmer auf. – Zu<br />
Mitgift und Aussteuer, s. Hartmann 2002, 120 f.<br />
250 Cahill 2002, 169–179 Abb. 38. Es muss hierbei unterschieden werden zwischen Webgewichten, deren Fundkontext<br />
darauf hindeutet, dass sie zum der Zeitpunkt der Zerstörung an einem Webrahmen befestigt waren, und Webgewichten,<br />
die lediglich in größerer Ansammlung aufbewahrt wurden.<br />
251 Cahill 2002, 178.<br />
252 Wie noch zu lesen z. B. bei Vidale 2002, 368.<br />
253 s. auch S. I. Rotroff – R. D. Lamberton, Women in the Athenian Agora (Athen 2006) 28f.; Bundrick 2008, 313.<br />
254 Cahill 2002, 166.<br />
S e i t e | 64
Für einen Großteil der Räume führt uns die Untersuchung der Übereinstimmung von Architektur und<br />
Fundkomplexen in die Aporie. Eine Verteilung von Funden quer durch das Haus spricht für ein hohes<br />
Maß an Multifunktionalität der einzelnen Raumeinheiten, die von mehreren Personen gleichzeitig oder<br />
zu unterschiedlichen Tageszeiten für verschiedene Aktivitäten genutzt wurden. Dies widerspricht<br />
wiederum völlig der Annahme, der Aufenthalt der Frau sei im Haus auf spezielle Frauengemächer<br />
beschränkt gewesen, eine Annahme, deren Wahrscheinlichkeitsgehalt schon durch die Pflichten der<br />
Ehefrau als Aufseherin und Delegiererin von Arbeit in Zweifel gezogen wird. 255 Eine strenge<br />
Trennung der männlichen und weiblichen Lebensbereiche scheint es also zumindest in dem Sinne<br />
nicht gegeben zu haben, dass die Frauen selbst im Haus auf die legendäre Gynaikonitis beschränkt ihr<br />
Dasein fristeten, vor den Blicken aller Männer, selbst ihrer Ehemänner, Söhne oder sonstiger<br />
Verwandter, geschützt. Schon D. Cohen riet zu einer sorgfältigen Differenzierung der<br />
Begrifflichkeiten „Separation“ und „Isolation“: „separation does not reduce the status of women to<br />
utter subordination in the way that complete isolation might.” 256<br />
Wie sind dann aber die literarisch überlieferten Begriffe von Andronitis und Gynaikonitis zu erklären?<br />
Auch hierfür wurde eine vernünftige Erklärung gefunden: es handle sich um eine Unterscheidung von<br />
Bereichen, die den Gästen zugänglich, und solchen, die täglichen und privaten Abläufen gewidmet<br />
seien. 257 Die Beantwortung der Frage, ob im athenischen Haus tatsächlich eine Separierung<br />
öffentlicher und privater Bereiche 258 angestrebt war, hängt vor allem von der Lokalisierung des<br />
Andron ab. Die Andrones in den Häusern 5–9 im Piräus lassen sich durch architektonische Details 259<br />
definitiv als Speiseräume benennen, liegen interessanterweise aber unmittelbar neben dem Oikos-<br />
Bereich im rückwärtigen Teil des Wohnhauses. 260 Zum selben Schluss kommt L. Nevett im Bezug auf<br />
die Raumsituation in olynthischen Wohnhäusern. 261 In der Nähe des Eingangs gelegene Andrones<br />
besitzen dagegen etwa das Haus südlich der Süd-Stoa oder die Häuser C und D im Industrieviertel<br />
Athens. 262 Am Eingang gelegen bedeutet jedoch nicht, dass der Bankettraum fernab vom Oikos<br />
gelegen sein bzw. dass der Hof nicht überquert oder zumindest betreten werden muss. 263 Nur der<br />
Andron in Haus C ist vom Hof durch eine Mauer abgetrennt. 264 Eine räumliche Separierung von<br />
255 So auch Patterson 1998, 126.<br />
256 D. Cohen, Seclusion, Separation, and the Status of Women in Classical Athens, GaR 36, 1989, 6.<br />
257 J. Raeder, Vitruv, de architectura VI 7 (aedificia Graecorum) und die hellenistische Wohnhaus- und Palastarchitektur,<br />
Gymnasium 95, 1988, 351; Nevett 1999, 71 f.; Bundrick 2008, 313.<br />
258 Sojc 2005, 41 f. äußert sich kritisch zur Verwendung der Termini „öffentlich“ und „privat“, da es ungewiss bleibt, ob<br />
diese Scheidung tatsächlich schon in der Antike vorgenommen wurde.<br />
259 Zu wasserdichtem Kalkmörtel und Stuckierungen auf Kalk- oder Gipsbasis, s. E.-L. Schwandner, Einzelprobleme, in:<br />
Hoepfner 1999, 529 f.<br />
260 W. Hoepfner – E.-L. Schwandner (Hrsg.), Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis<br />
I (München 1994) 30 Abb. 20; 40.<br />
261 Nevett 1995, 369. 372.<br />
262 Hoepfner – Schwandner a. O. (Anm. 260) 240–142 Abb.<br />
263 Nevett 1999, 70; Bundrick 2008, 313.<br />
264 Das Omega-Haus mit seinem prächtigen Mosaik verzierten Andron links des Eingangs, s. z. B. Hoepfner – Schwandner<br />
a. O. (Anm. 260) 244 f. Abb.; T. L. Shear, Jr., The Athenian Agora. Excavations of 1971, Hesperia 42, 1973, 148 Abb. 4;<br />
151–156, geht zwar auf das 5. Jh. v. Chr. zurück, zählt aber in vorliegender Rekonstruktion schon unter die Luxusbauten<br />
S e i t e | 65
Gästen und den häuslichen Aktivitäten zur Wahrung der Privatsphäre scheint also nicht immer<br />
angestrebt, ein Zusammentreffen von Hausbewohnern und Besuchern nicht immer unausweichlich<br />
gewesen zu sein. 265 Davon abgesehen könnten natürlich Vorkehrungen, die nicht automatisch<br />
baulicher Natur gewesen sein müssen, – so L. Nevett – dafür gesorgt haben, den Kontakt der<br />
Hausbewohner mit Gästen zu regulieren, ohne die Frauen zwangläufig in ihrer Bewegungsfreiheit zu<br />
behindern. M. Jameson vertritt die Annahme, dass eine räumliche Trennung von Männer- und<br />
Frauenbereichen mehr auf ein verschiedenartig konzeptionelles Verständnis ihrer Gewohnheiten und<br />
Aufgaben zurückzuführen sei. 266 Der Andron besitzt in Olynth in vielen Fällen einen Vorraum, des<br />
weiteren eine verschließbare und aus der Achse verschobene Tür, so dass eine gewisse private<br />
Atmosphäre geschaffen wird, da die Vorgänge im Haus vom Inneren des Andron aus nicht verfolgt<br />
werden können. 267 Ferner ist es einer Frau stets überlassen, sich beim Erscheinen eines Gastes<br />
zurückzuziehen. Auch wird im Regelfall nicht die Hausherrin höchstpersönlich die Haustür öffnen, so<br />
dass sich der Besucher vor dem Betreten des Hauses der Anwesenheit des Hausherrn versichern<br />
konnte. 268 Die schriftlichen Belege hierfür stammen zumeist aus den Gerichtsreden und werden von<br />
Männern vorgebracht, die ihren Sinn für Anstand und gute Manieren demonstrieren wollen. Auch<br />
wenn sie daher zum Teil vielleicht übertrieben sein mögen, so zeigen sie doch, dass ein gewisses<br />
Fingerspitzengefühl vonnöten war, um nicht gegen Moral und Anstand zu verstoßen.<br />
Im Fall der folgenden Demosthenes-Rede müssen allerdings wohl doch Abstriche hinsichtlich der<br />
Authentizität der Fakten gemacht werden. Der Ankläger will seinen Zuhörern allen Ernstes<br />
weismachen, dass der Passant Hagnophilos aufgrund der Abwesenheit des Hausherren davon absieht,<br />
den Frauen des Oikos zu Hilfe zu eilen, obgleich derweil munter geplündert wird, und es zu<br />
folgeschweren Handgreiflichkeiten kommt. 269 Es stellt sich aber doch die Frage, warum die<br />
inzwischen auf der Straße versammelte Menschenmenge auch dann nicht eingreift, als die<br />
Eindringlinge mit ihrem Diebesgut von dannen ziehen. Es ist zu vermuten, dass in der Person des<br />
ehrbaren Hagnophilos ein krasses Gegenbild zum Schurken Euergos geschaffen werden sollte, dessen<br />
Verwerflichkeit so umso klarer zutage tritt.<br />
Als Xanthippe in Platons „Phaidon“ bei ihrem letzten Besuch im Gefängnis auf die Freunde ihres<br />
Mannes trifft, wird ganz klar ausgesagt, dass sie diese bereits kennt. So wird es denn auch einem von<br />
hellenistischer Zeit. Auch das Haus des griechischen Mosaiks, s. z. B. J. E. Jones, Town and Country Houses of Attica in<br />
Classical Times, MIGRA 1, 1975, 77–79 Abb. 5, A. B, das über einen Andron mit Vorraum verfügt, die beide mit<br />
Kieselmosaiken ausgestattet waren, datiert bereits in den Hellenismus.<br />
265 Nevett 1995, 372; dies. 1999, 72: “[…] control over interaction between female household members and male visitors,<br />
although spatially this is achieved by restricting the movement of visitors, rather than by confining the women to their<br />
own area of the house […].”<br />
266 M. Jameson, Private Space and the Greek City, in: O. Murray – S. Price (Hrsg.), The Greek City. From Homer to<br />
<strong>Alexander</strong> (Oxford 1990) 192.<br />
267 A. Stähli, Die Konstruktion sozialer Räume von Frauen und Männern in Bildern, in: H. Harich-Schwarzbauer – T. Späth<br />
(Hrsg.), Gender Studies in den Altertumswissenschaften. Räume und Geschlechter in der Antike (Trier 2005) 85:<br />
„architektonische Blicklenkung“.<br />
268 In Demosth. or. 47, 35–38 öffnet eine Dienerin die Tür. Der Besucher hat sich bereits vorher erkundigt, ob der Hausherr<br />
verheiratet ist oder nicht. – s. auch die Debatte um die Deutung des Vasenbildes der Chous, New York, Metropolitan<br />
Mus. of Art 37.11.19, zusammengefasst bei Sutton 2004, 331–333 Abb. 17.3.<br />
269 Demosth. or. 47, 60.<br />
S e i t e | 66
ihnen gestattet, sie nach Hause zu begleiten. 270 Offenbar muss man unterscheiden, ob der Hausgast ein<br />
völlig Fremder ist oder zum engeren Freundeskreis des Hausherrn zählt. Als eine Gruppe von<br />
Fremden den auf der Straße ausgeraubten und geschundenen Ariston nach Hause bringt, sind seine<br />
Mutter und die Dienerinnen als erste zur Stelle, um das Unglück zu beklagen. 271 Auch die Klage des<br />
Mantitheus, man könne es ihm und seiner heiratsfähigen Tochter nicht zumuten, das Haus mit losem<br />
Pack wie seinen Stiefbrüdern zu teilen, die Leute ihres Schlages ins Haus brächten, suggeriert, dass<br />
eine völlige Abschirmung der Parthenoi auch im eigenen Haus nicht möglich war. 272<br />
Die verschiedenen Lebenssphären der Geschlechter, die sich sowohl im öffentlichen als auch<br />
ansatzweise im privaten Raum manifestierten, sind in der Tat eine Eigenheit der griechischen Kultur<br />
der Antike. Es ist in diesem Sinn zu verstehen, dass den Frauen in den Wohnhäusern möglicherweise<br />
Räume mit spezifisch weiblichen Funktionen zugeordnet waren. Es lässt sich jedoch auch mit großer<br />
Wahrscheinlichkeit behaupten, dass die Gynaikonitis – in welcher Form auch immer diese Einrichtung<br />
in den athenischen Wohnhäusern vorhanden war – die Ehefrauen eben nicht in ihrer<br />
Bewegungsfreiheit im Haus selbst einschränkte. Vielmehr waren die Aufgaben der Ehefrau so<br />
vielfältig, dass diese sich in allen Bereichen des Hauses aufgehalten haben dürfte. Eine strikte<br />
Geschlechterseparation, sei es von weiblichen und männlichen Hausbewohnern, sei es von<br />
Hausbewohnern und Hausgästen, lassen die Quellen nicht erkennen. Dennoch sprechen die<br />
archäologischen Befunde Olynths dafür, dass die herrschende Sozialnorm die Wohnkultur zumindest<br />
in der Hinsicht prägte, als sie den Kontakt zwischen den Frauen des Hauses und Besuchern von außen<br />
reglementierte. „Although there is no evidence that these houses were divided into different male und<br />
female areas, restrictions on access to the house as a whole and the way in which movement is<br />
channelled within do suggest that gender relationships probably exerted a major influence on the<br />
organisation of the household.” 273 A. Stähli weist zu Recht darauf hin, dass es Ausprägungen von<br />
Geschlechterseparation gibt, die in der Wohnarchitektur keinen Niederschlag gefunden haben. Sie<br />
wurden verschiedentlich zumindest ansatzweise angesprochen. So müssen wir z. B. damit rechnen,<br />
dass Räume zwar für diverse Aktivitäten und von beiden Geschlechtern genutzt wurden, gewohnte<br />
Bewegungsmuster und geschlechterspezifisches Sozialverhalten ein Zusammentreffen jedoch nicht<br />
erzwangen. 274<br />
Für die Vasenbilder haben diese Erkenntnisse erheblichen Wert. Szenen des Frauenalltags sollten nur<br />
mit äußerster Vorsicht als Szenen im Rahmen der Gynaikonitis bezeichnet werden. Die Frauen<br />
befinden sich im Oikos, dort wo sich der Aufenthalt für eine Frau nach der gültigen gesellschaftlichen<br />
Norm ziemte und wo ihre Hauptverantwortlichkeiten lagen. 275 Wenn auf einem Vasenbild ein Mann<br />
270 Plat. Phaid. 60a.<br />
271 Demosth. or. 54, 9. 20.<br />
272 Demosth. or. 40, 57.<br />
273 Nevett 1999, 79; s. auch P. Schmitt Pantel, Du symposion au sanctuaire, in: H. Harich-Schwarzbauer – T. Späth (Hrsg.),<br />
Gender Studies in den Altertumswissenschaften. Räume und Geschlechter in der Antike (Trier 2005) 6 f.<br />
274 Stähli a. O. (Anm. 267) 86; s. auch R. Just 1989, 118 f.; Nevett 1995, 372; S. I. Rotroff – R. D. Lamberton, Women in the<br />
Athenian Agora (Athen 2006) 29.<br />
275 Stähli a. O. (Anm. 267) 90–93: Die Vasenbilder reflektieren soziale Räume, eine Scheidung in Innen und Außen.; nach<br />
Götte 1961, 14 umfassen die sog. Frauengemachsszenen typische Tätigkeiten und Beschäftigungen der Frauen, die nicht<br />
S e i t e | 67
oder Jüngling inmitten von Frauen auftritt, bedeutet das aber keinesfalls, dass er in einen Bereich<br />
vordringt, der ihm üblicherweise verschlossen ist.<br />
S e i t e | 68<br />
2. 5. Der Oikos in der Bildkunst der attisch rotfigurigen Keramik<br />
Die Bilder, welche die Frau im Oikos bei handwerklichen Tätigkeiten oder bei ihrer Toilette zeigen,<br />
erhielten den Namen „Frauengemachsszenen“. Bevor man sich eingehender mit den Vasenbildern<br />
beschäftigt, muss man sich bewusst machen, dass sie eine Idealvorstellung der athenischen Ehefrau<br />
propagieren, die in der Praxis keinesfalls auf die gesamte Masse in Athen ansässiger Frauen<br />
angewendet werden kann. 276 Vornehme Zurückgezogenheit, das Spinnen und Weben im Kreise von<br />
Geschlechtsgenossinnen und die Muße für Schönheitspflege und Musik kennzeichnen in erster Linie<br />
die Frau gehobener Stellung. 277 Im Gegensatz zu ihr haben freie Frauen ärmerer Schichten oder aus<br />
verarmten Familien, bisweilen auf sich allein gestellte Witwen, weder Zeit noch Sinn für ausgiebige<br />
Schönheitspflege noch verfügen sie über Sklaven, an die sie die schweren Arbeiten delegieren können.<br />
Ihre Arbeitskraft war unverzichtbar; oftmals waren sie gezwungen, durch den Verkauf von Textilien,<br />
Gewinden, Nahrungsmitteln etc. Geld für den Erhalt der Angehörigen dazuzuverdienen. Dennoch ist<br />
anzunehmen, dass sie sich als Bürgerinnen mit dem idealisierenden Frauenbild der griechischen Kunst<br />
identifizieren konnten, auch wenn ihr tatsächlicher Lebensstandard kein Leben in Luxus und Muße<br />
erlaubte. Über Frauen im Status der Metökinnen ist wenig bekannt. Ob und inwieweit diese<br />
„Zugezogenen“ die athenischen Sitten und Moralvorstellungen adaptiert haben, bleibt der Spekulation<br />
überlassen. 278 Aus Inschriften an ihren Grabdenkmälern wird jedoch deutlich, dass sie sich die<br />
athenische Ideologie und Bildsprache der Kunst zu Eigen gemacht haben und ihre Toten auf die<br />
gleiche Weise ehrten und im Bild verewigten wie die athenischen Bürger selbst. 279 Daraus kann<br />
gefolgert werden, dass auch die Metöken sich zumindest bis zu einem gewissen Punkt mit dem Sozial-<br />
und Rollenverhalten der athenischen Bürgerschaft und folglich auch mit dem Bildprogramm der<br />
Vasen identifizierten. 280<br />
alle zwangsläufig im Haus anzusiedeln sind; auch Sojc 2005, 49 weist in diesem Sinn darauf hin, dass Mobiliar oder<br />
Gebrauchsgegenstände nicht als Einrichtung verstanden werden müssen, sondern Zuständigkeitsbereiche andeuten. Ich<br />
dagegen verstehe den Begriff tatsächlich als Ortsangabe, wobei ich den Begriff Oikos bevorzuge; Szenen am Grab<br />
gehören für mich nicht in die Gruppe der Frauengemachsszenen.<br />
276 Killet 1994, 218; Stähli a. O. (Anm. 267) 93.<br />
277 S. Walker, Women and Housing in Classical Greece: The Archeological Evidence, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.),<br />
Images of Women in Antiquity ²(London 1993) 81; F. Lissarrague, Vases Grecs. Les Athéniens et leurs images (Paris<br />
1999) 52; A. Strömberg, Private in life – Public in Death: The Presence of Women on Attic Classical Funerary<br />
Monuments, in: L. Larsson Lovén – A. Strömberg (Hrsg.), Gender, Cult, and Culture in the Ancient World from<br />
Mycenae to Byzantium. Proceedings of the Second Nordic Symposium on Gender and Women´s History in Antiquity,<br />
Helsinki 20.–22.10.2000 (Sävedalen 2003) 28; Heinrich 2006, 74–76; Bundrick 2008, 285 f.<br />
278 Mossé 1983, 62: “Ces femmes de métèques devaient avoir une vie assez proche de celle des femmes de citoyens, tenant<br />
leur maison, filant et tissant, dirigeant le travail des servantes.”<br />
279 Bergemann 1997, 142–150. – Zum Bild der Spinnerin auf den attischen Grabstelen, s. Heinrich 2006, 135–138.<br />
280 Bundrick 2008, 319 betont an diesen Bildern weniger ihre normative Funktion für die Frau, sondern mehr den Ausdruck<br />
von Wohlstand und Glück, nach denen auch die niedrigeren Schichten Athens strebten.
Im Folgenden soll nun untersucht werden, welches Frauenbild das archäologische Material<br />
widerspiegelt und inwieweit dieses mit den aus den literarischen Quellen gewonnen Eindrücken<br />
übereinstimmt. Die sog. Frauengemachsszenen sind, da sie eine der wesentlichen Darstellungsformen<br />
des Frauenlebens auf Vasen ausmachen, ohne Zweifel eine für das generelle Bild der Frau in der<br />
Vasenmalerei unerlässliche Informationsquelle. Sie sind erschöpfend behandelt worden 281 , weswegen<br />
ich sie hier vor allem unter dem Aspekte der Geschlechterbegegnung besprechen möchte, insofern als<br />
in ihnen in Ausnahmefällen auch Männer und Jünglinge auftreten.<br />
2. 5. 1. Der Mann im Frauengemach<br />
Es ist kaum zu leugnen, dass das Repertoire der Vasenbilder den Mann oder Jüngling hauptsächlich<br />
bei Aktivitäten außer Haus zeigt. Der Einwurf, der zum Thema „Frauenleben“ gemacht wird, nämlich<br />
dass die Vasen nur einen sehr ausschnitthaften Teil der historischen Realität zeigen, lässt sich auch für<br />
die Darstellungen der Männerwelt erhärten. Wir erleben Männer als Athleten, Symposiasten, Krieger,<br />
in Gesellschaft mit anderen Männern, bei Opfern und Kultfeiern, bei homo- und heteroerotischen<br />
Begegnungen mit Knaben und Prostituierten. Geschäftsszenen sind selten, Handwerkerberufe<br />
unterrepräsentiert, Szenen des politischen Lebens, die den Mann in der Ekklesia oder im Gericht<br />
zeigen, gänzlich unbekannt. 282 Die Bedeutung des Mannes in seiner Rolle als Versorger und Ehemann<br />
im Oikos wurde bislang kaum berücksichtigt. Er gilt in erster Linie als Bürger der Polis, sein<br />
Wirkungsbereich ist die Agora und das Symposion. So wie ein In-Erscheinung-Treten der Frauen im<br />
öffentlich-politischen Sektor von den Männern als Einmischung in ein maskulines Ressort beurteilt<br />
wurde, so ungeziemend galt es für den Mann, sich über Gebühr im Haus aufzuhalten. 283 Dennoch<br />
existiert neben dem „politischen“ auch stets der „soziale“, in seinen Oikos eingebundene Mann. Der<br />
athenische Bürger übt die Funktion des Hausherrn über alle unter seinem Dache lebenden Frauen,<br />
Kinder und Sklaven aus. 284 Das Haus ist auch der Ort, an dem er zu repräsentativen Zwecken des<br />
Abends seine Gäste bewirtet, der Ort, an dem er für seine Geschäftspartner, Freunde und Gläubiger<br />
erreichbar ist. Nicht zufällig oder auf gut Glück versuchen in den Gerichtsreden immer wieder Kläger<br />
oder Bekannte, den Betreffenden zuhause abzupassen. Dies wäre absurd, müsste man von vorneherein<br />
ausschließen, den Gesuchten dort anzutreffen.<br />
Es gibt nun tatsächlich einige Darstellungen auf Vasen des 5. Jhs. v. Chr., die einen Mann, teilweise<br />
auch mehrere Männer, im häuslichen Ambiente zeigen. Nun wird offensichtlich, wie unglücklich der<br />
281 Götte 1957; H. Kammerer-Grothaus, Frauenleben, Frauenalltag im antiken Griechenland (Berlin 1984); Killet 1994, 109<br />
ff. 203 ff.; F. Lissarrague, Intrusioni nel gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague – F. Frontisi-Ducroux (Hrsg.), I misteri del<br />
gineceo (Bari 2000) 149–190; Lewis 2002, 130 ff.; Bundrick 2008.<br />
282 s. auch A. Stähli, Die Konstruktion sozialer Räume von Frauen und Männern in Bildern, in: H. Harich-Schwarzbauer – T.<br />
Späth (Hrsg.), Gender Studies in den Altertumswissenschaften. Räume und Geschlechter in der Antike (Trier 2005) 89.<br />
283 Xen. oik. 7, 3; Schnurr-Redford 1996, 92.<br />
284 Zum Mann als Familienoberhaupt auf klassischen Weihreliefs, s. A. Klöckner, Habitus und Status. Geschlechtsspezifi-<br />
sches Rollenverhalten auf griechischen Weihreliefs, in: Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Ausstellungs-<br />
katalog Berlin (Mainz 2002) 321–330: Hier ist er allerdings fast durchgängig als reifer Mann mit Vollbart dargestellt.<br />
S e i t e | 69
Begriff der „Frauengemachsszene“ gewählt ist, suggeriert er doch, dass der Mann sich hier an einem<br />
Ort befindet, der eigentlich für die Frauen reserviert ist. Er wird zum Fremdkörper. Die Befremdung,<br />
die manche Archäologen beim Anblick des Mannes im „Frauengemaches“ befiel, wurde auf ganz<br />
simple Weise aus der Welt geschafft. Die anständige Frau – so die Forschung – lebte zurückgezogen<br />
von der Männerwelt. Eine Frau in Begleitung eines Mannes war bezüglich ihres Status mehr als<br />
suspekt: es konnte sich also um nichts anderes handeln als um eine Hetäre, die Männerbesuch<br />
empfing, sich umwerben ließ oder mit ihrem Freier verhandelte. Inzwischen wird in Einzelfällen<br />
eingeräumt, dass eine Begegnung von Mann und Frau nicht immer sexuell motiviert sein muss. 285<br />
Doch nach welchen Kriterien wird darüber entschieden? Welcher Kontext und welche Attribute<br />
rechtfertigen eine Entscheidung für eine Ehefrau oder eine Hetäre? Wenn die strikte räumliche<br />
Trennung männlicher und weiblicher Bereiche als Grundlage wegfällt, welche Begründung bleibt<br />
dann noch?<br />
S e i t e | 70<br />
2. 5. 2. Familienbilder<br />
Nähern wir uns dem Mann im Frauengemach also auf sehr behutsame Art und Weise. Eine<br />
Sondergruppe innerhalb der Bilder, die einen Mann im Frauengemach zeigen, stellen die Szenen dar,<br />
die auch Kinder abbilden. In diesen Fällen erscheint es mir gerechtfertigt, von einem familiären<br />
Kontext auszugehen 286 , auch wenn zu beobachten ist, dass Archäologen und Historiker den Begriff des<br />
Familienbildes für das klassische Athen bisher nur sehr widerwillig gebrauchen. 287<br />
Eines der bekanntesten mythischen Familienbilder ist die Darstellung der ihrem Knaben die Brust<br />
gebende Eriphyle auf einer Hydria in Berlin II/1 (Taf. 2 Abb. 4). Amphiaraos als Ehemann und Vater<br />
komplettiert die häusliche Szene. Ungeachtet des tragischen Ausgangs der Geschichte – höchstens die<br />
zwei Hähne deuten auf das kommende Unglück 288 – zeigt das Vasenbild die Familie noch intakt, jedes<br />
Mitglied erfüllt seine Rolle: der Mann als Kyrios, die Frau als Ehefrau und treu sorgende Mutter 289 , die<br />
Tochter Demonassa als Abbild häuslichen Fleißes und Gehorsams. Dieses Verständnis des Wesens der<br />
Familie und die Betonung der jeweiligen festgeschriebenen Rollen der einzelnen Oikosmitglieder<br />
begegnen in den folgenden Szenen menschlichen Lebens wieder.<br />
Eine Pyxis in Athen II/2 (Taf. 3 Abb. 1–4) gibt einen exemplarischen Einblick in den Alltag innerhalb<br />
285 z. B. Mercati 2003, 58 f. 66–69 ist etwa bereit, einen Mann oder Jüngling im Oikos, wenn es sich nur um einen einzigen<br />
handelt, als Ehemann in Betracht zu ziehen, da ihm der Zutritt in die „heiligen Gefilde der Gynaikonitis“ erlaubt war.<br />
286 Die Präsenz von Kindern ist nach Sutton 2004, 331 „the most reliable criterion for recognizing the oikos“.<br />
287 F. Lissarrague, Intrusioni nel gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague – F. Frontisi-Ducroux (Hrsg.), I misteri del gineceo<br />
(Bari 2000) 164. Dies gilt jedoch vorrangig für die griechische Keramik, im Bezug auf die griechische Grabkunst schien<br />
man lange keine derartigen Bedenken zu hegen, s. z. B. B. Schmaltz, Griechische Grabreliefs ²(Darmstadt 1993); B. Fehr,<br />
Rez. zu B. Schmaltz, Griechische Grabreliefs, Gnomon 58, 1986, 526 f. kritisiert, dass der neuzeitlich geprägte Begriff<br />
„Familie“ eine gefühlsbetonte Intimsphäre impliziert.<br />
288 F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 213<br />
Abb. 27; Sutton 2004, 345 f. Abb. 17. 14.<br />
289 L. Bonafante, Nursing Mothers in Classical Art, in: A. O. Koloski-Ostrow – C. L. Lyons (Hrsg.), Naked Truths. Women,<br />
Sexuality, and Gender in Classical Art and Archeology (London 1997) 174 f.
des Oikos. Die Frauen sind in einer streng geschlossenen und symmetrischen Komposition<br />
angeordnet. Die Szenerie wird gerahmt von zwei sitzenden Frauen 290 , von denen jene am linken Rand<br />
– einen Wollkorb neben sich – einen Wollfaden vom erhobenen Spinnrocken abwickelt. Sie hebt sich<br />
durch den über den Kopf gezogenen Schleier von den übrigen Frauen ab. 291 Ihr zugewendet sind eine<br />
Frau mit Wollkorb und eine mädchenhafte Gestalt im ungegürteten Chiton mit einem Kleinkind auf<br />
den Schultern. Daneben stehen zwei Frauen um einen Kalathos, dem soeben ein Ballen Wolle<br />
entnommen wurde; ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf die zweite sitzende Person, deren geöffneten<br />
Arme einem krabbelnden Kleinkind entgegengestreckt sind. Ganz außen hinter der Spinnerin steht ein<br />
Jüngling mit einem rundlichen Gegenstand in der ausgestreckten Hand. Der Form nach handelt es sich<br />
um einen Ball oder um eine Frucht. Passend wäre etwa ein Granatapfel, dessen symbolische<br />
Bedeutung die Fruchtbarkeit und den augenscheinlichen Kinderreichtum des abgebildeten Oikos<br />
betont. 292 Für die Interpretation ähnlicher sog. Geschenkübergabeszenen bedeutet dies, dass das<br />
Darbieten oder Überreichen eines Gegenstandes, besonders wenn es sich um ein stark symbolisch<br />
behaftetes Objekt handelt, nicht zwangsweise situativ zu verstehen ist, sondern die Darstellung um<br />
eine metaphorische Ebene bereichert. 293<br />
Auf einer Hydria in Cambridge II/3 (Taf. 3 Abb. 5) reicht eine sitzende Mutter ihren kleinen Sohn<br />
einer thrakischen Dienerin, deren kurze, hemdsartige Tunika mit gemusterter Borte sich von der<br />
griechischen Tracht unverkennbar unterscheidet. 294 Im Hintergrund verweist ein hoher, schmaler<br />
Webstuhl auf den tugendhaften Fleiß der Hausherrin. Das bereits gewebte Stück Stoff ziert ein dunkler<br />
Saum, der nach dem Vorbild des thrakischen Übergewandes hergestellt zu sein scheint. 295 Dies mag<br />
bedeuten, dass die Hausherrin entweder ein Gewand für ihre Dienerin herstellt oder aber dass sie nicht<br />
selbst als aktive Spinnerin dargestellt wird, sondern vielmehr als Souverän des Hauses Arbeiten<br />
verteilt und überwacht. Hinter ihr steht ein junger Mann mit Bürgerstock, der gelassen auf die Szene<br />
blickt. Gleichsam als Vervollständigung dieses Familienbildes ist hier also wohl auch der Ehemann<br />
und Vater in der Szene dargestellt. 296 Der Ehemann mit seinem Ausgehstock wird von E. Reeder als<br />
290 Zum Motiv des Sitzens, s. Reuthner 2006, 99 f.<br />
291 F. Lissarrague, Intrusioni nel gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague – F. Frontisi-Ducroux (Hrsg.), I misteri del gineceo<br />
(Bari 2000) 155.<br />
292 Sutton 1981, 320–326; F. Lissarrague, Intrusioni nel gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague – F. Frontisi-Ducroux (Hrsg.)<br />
I misteri del gineceo (Bari 2000) 156 spricht von einem “sguardo maschile associato al gioco del dono e della<br />
seduzione”. Der Begriff “Verführung” leitet hier angesichts des Brautschleiers und des kinderreichen Oikos fehl; Sutton<br />
2004, 342; S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v. Chr.<br />
(Berlin 2005) 114 f.<br />
293 Sutton 2004, 342; s. auch Kap. III. 3.<br />
294 H. Rühfel, Ammen und Kinderfrauen im klassischen Athen, AW 19, 1988, 45 f. Abb. 3.<br />
295 Rühfel a. O. (Anm. 294) 46.<br />
296 Sutton 1981, 340; Reeder 1995, 218 f. Nr. 51 deutet die Bartlosigkeit des Jünglings, bei dem sich in Form von Flaum der<br />
erste Bart ankündigt, als Versuch, den Altersunterschied zwischen den Eheleuten zu kaschieren; D. Williams, Women on<br />
Athenian Vases: Problems of Interpretation, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.), Images of Women in Antiquity (London<br />
1993) 94 sieht in ihm den ältesten Sohn der Familie. Wie die Marmorloutrophoros der Persia und des Euthippos, Athen,<br />
Nat. Mus. 953: CAT 2.855, deutlich macht, erzwingt die Darstellung einer Mutter mit Kind, die sich von einem<br />
jugendlichen Krieger verabschiedet, nicht die Deutung des Jünglings als Vater und Ehemann, man scheint im Gegenteil<br />
geradezu davor zurückzuschrecken. Männer im reiferen Alter wie auf der Loutrophoros des Polymnestos und der<br />
Aischylis, Athen, Nat. Mus. 3465: CAT 2.874a, sind leichter als Väter und Gatten zu akzeptieren.<br />
S e i t e | 71
Gast oder Eindringling beschrieben. Dies zeigt, wie sehr der Mann in der ikonographischen Tradition<br />
der Vasenmalerei nach dem Empfinden der Archäologen und Archäologinnen als Fremdkörper im<br />
Frauengemach betrachtet wird. 297 Gern wird zur Untermauerung der scheinbaren Deplaziertheit von<br />
Männern im Frauenkreis der Bürgerstock als Anzeichen dafür angeführt, dass diese quasi nur 'auf der<br />
Durchreise' seien. 298 Der Bürgerstock mag – neben seiner Bedeutung als Statussymbol – durchaus<br />
auch einen konkreten Hinweis auf die Mobilität der athenischen Männer beinhalten, die sich ja<br />
tatsächlich überwiegend in der Öffentlichkeit bewegen. Bilder wie auf der Hydria in Cambridge II/3,<br />
die den Mann nachweislich im eigenen Heim an der Seite der Ehefrau abbilden, zeigen jedoch, dass<br />
der Gebrauch dieses Attributs im eigenen Oikos ebenso selbstverständlich ist. Hier ist er der stets<br />
sichtbare und nicht ortsgebundene Beleg für den Status des Mannes als attischer Bürger. Es ist äußerst<br />
interessant, welch subjektive Eindrücke dieses Vasenbild, eben weil es aus der großen Masse<br />
heraussticht, hinterlassen hat. E. Reeder z. B. schreibt: „Obwohl er sich in dieser Umgebung, in der er<br />
eine untergeordnete Rolle spielt, anscheinend nicht sehr wohl fühlt, soll seine Präsenz wohl daran<br />
erinnern, dass der Mann doch wesentlich zur Harmonie der häuslichen weiblichen Welt beitrug, die<br />
durch den Knaben, den Webstuhl und eine fleißige, liebende Dienerin evoziert wird.“ 299 Mit ganz<br />
anderen Augen jedenfalls betrachtet H. Schulze die Szenerie, wenn er von einer „liebevoll<br />
ausgestalteten Familienszene“ spricht. 300<br />
Auf einer Hydria in München II/4 (Taf. 3 Abb. 6) finden wir ebenso alle Voraussetzungen für einen<br />
blühenden und glücklichen Oikos erfüllt. Die Hausfrau ist im Zentrum des Bildes in ihre Handarbeit<br />
versunken. Vor ihr steht ein Jüngling, wohl ebenfalls ihr Ehemann, hinter ihr ein nackter Knabe mit<br />
einem Schlagreifen, der zu einer sich nähernden Dienerin mit einem Kästchen aufblickt. Der Grundton<br />
des Gefäßes könnte wie folgt lauten: die Ehefrau, geschmückt mit einem Diadem und einem feinen<br />
Schleier, verrichtet eifrig ihre Webarbeit im Bemühen um die Leistungssteigerung ihrer Fähigkeiten<br />
und um den Wohlstand des Oikos. Der Knabe als künftiger Erbe des Oikos genießt sein Kind-Sein mit<br />
Spiel, die Dienerin steht für die Betriebsamkeit des Haushalts, und der Ehemann überblickt als Kyrios<br />
seines Hauses und seiner Familie souverän das Geschehen. 301<br />
Während jenes Bild eine ruhige und harmonische Atmosphäre vermittelt, erinnert die Geschäftigkeit<br />
auf einer Pyxis in Athen II/5 (Taf. 3 Abb. 7; Taf. 4 Abb. 1. 2) an den Aufbau der bereits betrachteten<br />
Pyxis in Athen II/2 (Taf. 3 Abb. 1–4). Die Architektur des Wohnhauses wird in verkürzter Form durch<br />
eine schwere, doppelflügelige Tür und eine einzelne Säule 302 angedeutet. Emsig eilen Frauen hin und<br />
her, die z. T. mit dem Wollkorb oder mit Geschirr beladen sind. Etwas abgesondert sitzt rechts der Tür<br />
297 z. B. H. A. Shapiro, Father and Sons, Men and Boys, in: Neils – Oakley 2003, 104.<br />
298 Reinsberg 1993, 121 f.; Badinou 2003, 30. – Zum Bürgerstock als Symbol für andreia und Geschäftstüchtigkeit, s.<br />
Bundrick 2008, 305.<br />
299 Reeder 1995, 219.<br />
300 H. Schulze, Ammen und Pädagogen. Sklavinnen und Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und Gesellschaft (Mainz<br />
1998) 22 f.; Lewis 2002, 17 gibt aufgrund des Fundkontextes in einem Grab in Vari eine funerative Interpretation zu<br />
bedenken; bei einer Hydria ist aber in erster Linie wohl eher eine Gebrauchsfunktion im Alltag vorauszusetzen.<br />
301 Keuls 1985, 244 f.: “A man, doubtless her husband, stands in front of her, like Xenophon´s Ischomachus, checking up on<br />
the progress of labor in the household.”; Sutton 2004, 340 f.: “a single image representing beauty, procreation, and<br />
household production”.<br />
302 Bundrick 2008, 314: Säule als möglicher Verweis auf die Pastas.<br />
S e i t e | 72
die Hausherrin, ihr Haar unter einem transparenten Schleier, vor einer geöffneten Truhe, der sie<br />
soeben offensichtlich ein Objekt entnommen hat. Ihre Gestik wiederholt sich bei dem vor ihr<br />
stehenden Jüngling, der ihr auf seinen ausgestreckten Armen wohl eine Tänie oder ähnliches reicht.<br />
Die Amme mit dem Kleinkind auf dem Arm räumt jeden Zweifel aus, dass die Vase einen Einblick in<br />
einen bürgerlichen Oikos gewährt. Kinderreichtum, der Besitz von Sklaven, eine aktive und sittsame<br />
Dame des Hauses und die vorbildliche Verrichtung aller anfallenden Arbeiten konstituieren den<br />
Prototyp des athenischen Haushalts. 303<br />
Auf einem Lebes Gamikos in Athen II/6 (Taf. 4 Abb. 3) bildet die Trias von Vater, Mutter und Kind<br />
eine eng aufeinander bezogene Gruppe, in der die Mutter ihren Sohn auf dem Schoß hält. 304 Wollkorb<br />
– hier im Übrigen in den Händen einer Nike –, Bänder und Kästchen sind Gegenstände, wie sie im<br />
privaten Ambiente häufig begegnen. Eine zweite weibliche Figur sitzt in der bekannten Haltung eines<br />
Aphrodite-Typus auf ihrem Klismos und sieht der entgegenkommenden Dienerin mit dem Kästchen<br />
entgegen. 305 Es ist meiner Ansicht nach gut möglich, dass ein und dieselbe Person, nämlich die<br />
Hausherrin, unter unterschiedlichen Aspekten geschildert wird: als aufsichtshabende Respektsperson<br />
des Hauses, deren von der Liebesgöttin abgeleiteter Habitus Eleganz und Erotik ausstrahlt, und als<br />
Ehefrau und Mutter, die an der Seite ihres Ehemanns stolz ihr Söhnchen präsentiert. 306<br />
Eine Pelike in London II/7 (Taf. 4 Abb. 4) trägt eine ungewöhnliche Darstellung, weil sie einen<br />
intimen und unserem Empfinden nach sehr lebensnahen Ausschnitt des Eltern-Kind-Verhältnisses<br />
zeigt, ohne die üblichen Anspielungen auf den Oikos und irgendwelche rollenspezifische Tugenden in<br />
den Vordergrund stellen. Mann und Frau blicken auf ein Kleinkind herab, das sich krabbelnd am<br />
Boden fortbewegt. Die Armhaltung der Mutter drückt Ermunterung und Zuneigung aus. In einem<br />
Ausstellungskatalog aus dem Jahre 1986 wird die Ansicht vertreten, es handle sich hier aus dem<br />
simplen Grunde nicht um eine anheimelnde Szene elterlicher Kinderliebe, da der athenische<br />
Durchschnittsbürger seinen Tag auf die Politik und seine Geschäfte verwende und keine Zeit für<br />
seinen Nachwuchs erübrigen könne. Die Figur verkörpere, wenn, dann den Großvater, der nun im<br />
Ruhestand endlich das Heranwachsen seines Enkels miterleben dürfe. 307 Hier hat offenkundig die<br />
Überzeugung, die Geschlechtertrennung verhindere die Entstehung einer Familiengemeinschaft, die<br />
Interpretation geprägt. Die antiken Quellen gehen nur vereinzelt auf das Thema der Kindererziehung<br />
und ihrer Einbindung in den familiären Verband ein. Es wird jedoch keineswegs der Eindruck<br />
vermittelt, dass das Aufziehen des Nachwuchses allein Frauensache war. In den bisher betrachteten<br />
Vasenbildern waren die Väter als junge Männer charakterisiert. 308 In diesem Fall haben wir allerdings<br />
einen bärtigen Mann mit schulterlangem Nackenhaar vor uns, wie es in der Regel von Heroen, auf<br />
303 Sutton 2004, 343 f. Abb. 17, 13.<br />
304 vgl. Herakles mit Deianeira und Hyllos, Glockenkrater des Pourtales-Malers aus dem 4. Jh. V. Chr., München,<br />
Antikensammlungen 2398: H. A. Shapiro, Fathers and Sons, Men and Boys, in: Neils – Oakley 2003, 84 Abb. 8.<br />
305 P. Kranz, die Frau in der Bildkunst der griechischen Klassik, in: P. Neukam (Hrsg.), Antike Literatur – Mensch, Sprache,<br />
Welt, Klassische Sprachen und Literaturen 34 (München 2000) 68–71; Sutton 2004, 338 bringt die Szene konkret mit der<br />
Brautschmückung in Verbindung.<br />
306 Sutton 2004, 338 sieht hier die beiden Stadien der Nymphe und der Gyne gegenübergestellt.<br />
307 I. Jenkins, Greek and Roman Life (London 1986) 30.<br />
308 Sutton 2004, 339: „[…] the artist of this scene may have preferred to show paternal maturity, rather than the romantic<br />
youthful image so popular in nuptial scenes.”<br />
S e i t e | 73
Grabstelen aber auch von alten Männern getragen wird. Ein mythischer Kontext, man denke etwa an<br />
Amphiaraos auf der Hydria in Berlin II/1 (Taf. 2 Abb. 4), ist nicht auszuschließen, durch den Mangel<br />
an weiteren Attributen aber auch nicht zwingend. Es mag also sowohl ein Vater in reiferen Jahren als<br />
auch durchaus der Großvater zusammen mit seinem Enkel dargestellt sein, die zur Untermauerung<br />
dieser Annahme angeführten Gründe sind jedoch als subjektiv zurückzuweisen. 309<br />
Ungewöhnlich ist auch die Darstellung eines Gefässes in Münster II/8 (Taf. 4 Abb. 5). Ein auf einem<br />
Klismos stehender Knabe streckt seine Arme der Mutter entgegen, die mit dem Gürten ihres Chitons<br />
beschäftigt ist. Das Motiv des Gürtens selbst lässt sich auf mehreren griechischen Vasen verfolgen,<br />
denen laut V. Sabetai zumeist eine hochzeitliche Konnotation innewohnt. 310 Ein Zipfel des Kolpos<br />
wird dabei zwischen den Zähnen gehalten, um so Blick und Hände für das Gürten frei zu haben.<br />
Tatsächlich ist der Gürtel bereits angelegt, die ins Gewand greifende Hand der Frau ist im Begriff, den<br />
Stoffüberfall gefällig zu arrangieren, um den Akt des Ankleidens zu beenden. Die Knabenfigur<br />
versteht K. Stähler als attributive Beifügung, die „auch inhaltlich als helfend aufgefasst werden“<br />
kann. 311 Gewöhnlich findet das Ankleiden im Kreise von Frauen statt, dass dies aber nicht immer so<br />
sein muss, zeigt das vorliegende Beispiel. Als Zuschauer hat sich nämlich ein junger Mann<br />
beigesellt. 312 Im Akt des An- oder Auskleidens schwingt in der griechischen Ikonographie, auch wenn<br />
dieser im Umfeld hochzeitlicher Themen auftritt, durchaus eine unterschwellige Erotik mit. Die<br />
Anwesenheit des Kindes und das passive Verhalten des Jünglings schließen eine narrative<br />
Interpretation der Szene aber wohl aus. Es geht eher um einen generellen erotischen Aspekt der<br />
Ehefrau, der ihre Attraktivität betont, gleichzeitig aber die eheliche Sexualität der Fortpflanzung<br />
unterordnet. Dass die erotische Ausstrahlung, die diesem Motiv anhaftet, auch ein Wesenszug der<br />
Mutter sein kann, bestätigt eine Darstellung auf einer Hydria aus dem Londoner Kunsthandel 313 , auf<br />
der eine junge Frau ihre Toilettenvorbereitungen, die das Anlegen und Gürten ihres Gewandes und das<br />
Schmücken beinhalten, vollzieht. Der kleine Knabe, der verlangend beide Ärmchen ausstreckt, weist<br />
sie als Ehefrau und Mutter aus.<br />
Die Ikonographie eines Alabastron in Providence II/9 ist vor allem aus dem Grunde interessant, weil<br />
die zwischengeschlechtliche Interaktion für sich genommen mit an Sicherheit grenzender<br />
Wahrscheinlichkeit als heterosexuelle Werbung zwischen einer Hetäre und einem Kunden interpretiert<br />
werden würde. Eine Frau mit Spiegel steht vor einem sitzenden Jüngling. Dessen ausgestreckter Arm,<br />
309 Sutton 2004, 339 interpretiert ihn als reifen Mann. Der Altersunterschied zwischen den Eheleuten war, besonders dann,<br />
wenn der Mann im Alter noch einmal heiratete, beträchtlich. – s. auch Kap. 1. 1.<br />
310 z. B. V. Sabetai, Aspects of Nuptial and Genre Imagery in Fifth-Century Athens: Issues of Interpretation and<br />
Methodology, in: J. H. Oakley – W. D. E. Coulson – O. Palagia (Hrsg.), Athenian Potters and Painters. The Conference<br />
Proceedings (Oxford 1997) 319–335; Bundrick 2008, 304.<br />
311 K. P. Stähler, Eine unbekannte Pelike des Eucharidesmalers im Archäologischen Museum der <strong>Universität</strong> Münster (Köln<br />
1967) 13: Er verweist ferner auf Parallelen in der Komposition von Vorder- und Rückseite des Gefäßes. Der diagonal<br />
nach oben gestreckte Arm, laut Vorzeichnung ursprünglich locker herabhängend gedacht, wiederholt die des Auleten von<br />
der anderen Seite des Gefäßes.<br />
312 Auch von B. Korzus (Hrsg.), Griechische Vasen aus westfälischen Sammlungen (Münster 1984) 59 f. Nr. 6 Abb. 6a. b<br />
als Familienszene bezeichnet; kritisch dagegen Sutton 2004, 337 Anm. 42. – vgl. z. B. Schale des Kalliope-Malers,<br />
Marzabotto, Mus. Naz. Etrusco „Pompeo Aria“ T2/6587: A. Lezzi-Hafter, Der Eretria-Maler. Werke und Weggefährten<br />
(Mainz 1988) Nr. 94 Taf. 73.<br />
313 Hydria des Metyhse-Malers, London, Sotheby´s: Badinou 2003, 65 f. 377 Taf. 137 Abb.1.<br />
S e i t e | 74
der in Richtung ihres Gewandes oder ihrer Scham zielt (Taf. 4 Abb. 6), rief Assoziationen an eine<br />
handfeste, sexuelle Annäherung wach. 314 Solche Gesten sind mit großer Vorsicht zu behandeln. Denn<br />
auf der Rückseite des Gefäßes hält eine Frau ein Kleinkind auf dem Arm, während ein zweites, schon<br />
etwas größeres Kind, in die Falten ihres Gewandes greift (Taf. 4 Abb. 7). Sind die beiden Szenen, die<br />
durch einen senkrechten Dekorstreifen voneinander getrennt sind, aufeinander zu beziehen? P.<br />
Badinou sieht hier eine Mutter mit zwei Söhnen einer Werbeszene gleichsam als zwei Aspekte des<br />
Frauenlebens gegenübergestellt. 315 Unklar bleibt, ob sie auch zwei Arten von Frauen, nämlich die<br />
Ehefrau und die Hetäre, polarisiert sehen möchte, oder ob sie die Werbung als Teil des Lebens der<br />
Bürgerin begreift. Die Blicke der Frau und des älteren Kindes sind jedenfalls auf die Szene nebenan<br />
gerichtet, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein inhaltlicher Zusammenhang besteht. Die<br />
Erwachsene hat ihre Handinnenfläche an ihre Wange gelegt. Der Gestus, der der Schlüssel zum<br />
Verständnis zu sein scheint, wird von P. Badinou in ihrer Interpretation nicht berücksichtigt. Er<br />
begegnet unter anderem auf Grabstelen und kann dort wohl als Ausdruck der Trauer verstanden<br />
werden. 316 J. Bergemann formuliert ihn allgemeiner als „Ausdruck von Emotionalität“, da er auf<br />
Vasenbildern in nicht-sepulkralem Kontext Entsetzen symbolisiert oder bevorstehende Schrecken<br />
ankündigt. 317 Während J. Neils und J. H. Oakley den Gestus als besorgte Reaktion einer Ehefrau auf<br />
die außerehelichen Affären ihres Ehemannes zu begründen suchen 318 , erscheint es mir sinnvoller, die<br />
Szene des Alabastrons in Providence vor einem funerären Hintergrund zu deuten. Die ausgestreckten<br />
Arme des Paares, die sich jedoch nicht berühren, finden ihre Entsprechung auf zahlreichen<br />
weißgrundigen Lekythen, wo sie eine Vorstufe der Dexiosis darstellen. 319 Ist der Jüngling z. B. als der<br />
Verstorbene zu betrachten, böte dies eine Erklärung für das im Falle eines Jüngling oder jungen<br />
Mannes unübliche Motiv des Sitzens. 320 Auf der anderen Seite des Gefäßes hätte dann eine<br />
314 Vidale 2002, 364; S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v.<br />
Chr. (Berlin 2005) 252 vergleicht die Darstellung mit dem Vasenbild der Hydria, Chicago, Art Institut 1911.456, hier<br />
IV/9: “Stärker als auf der Hydria in Rhodos wird hier vor allem durch die handgreifliche Annäherung des Mannes aus der<br />
Werbungsszene eine Darstellung von Prostitution und Bordellbetrieb gemacht.“<br />
315 Badinou 2003, 85 f. 340 Nr. A 257 Taf. 100.<br />
316 B. Schmaltz, Untersuchungen zu den attischen Marmorlekythen (Berlin 1970) 85; nach I. Huber, Die Ikonographie der<br />
Trauer in der griechischen Kunst (Mannheim 2001) 151–154 ist diese Art der Trauer besonders typisch für die Figur der<br />
Dienerin. Nicht selten sind auch hier Kinder mit dargestellt.<br />
317 Bergemann 1997, 56.<br />
318 Neils – Oakley 2003, 236 Nr. 36.<br />
319 Sojc 2005, 64. – Zum Dexiosis-Gestus, s. B. Schmaltz, Griechische Grabreliefs ²(Darmstadt 1993) 209–212; C. Breuer,<br />
Reliefs und Epigramme griechischer Privatgrabmäler vom vierten bis zweiten Jahrhundert. Zeugnisse bürgerlichen<br />
Selbstverständnisses vom 4. bis 2. Jahrhundert v. Chr. (Wien 1995) 15–22 erklärt sie abgeleitet aus den<br />
Kriegerabschiedsszenen und den Urkundereliefs als Ausdruck der Solidarität des Einzelnen mit der Polis; Bergemann<br />
1997, 61 f. Anm. 286 mit weiterführender Literatur; M. Meyer, Gesten der Zusammengehörigkeit und Zuwendung. Zum<br />
Sinngehalt attischer Grabreliefs in klassischer Zeit, Thetis 5/6, 1999, 120 f.; nach N. Himmelmann, Attische Grabreliefs.<br />
Vorträge der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissnschaften G 357 (Wiesbaden 1999) 114 signalisiert die<br />
Dexiosis Verbundenheit und „emotionale Nähe“; Sojc 2005, 120–124.<br />
320 Eine solche Konstellation auch in Verbindung mit der Trauergeste der Dienerin: vgl. Marmorlekythos, Kopenhagen, Ny<br />
Carlsberg Glyptothek 1407: CAT 3.325, der die Personen als Vater mit zwei Töchtern deutet. Es ist korrekt, dass der<br />
junge Mann auf dem Alabastron in Rhode Island nicht dem väterlichen Bürgertypus des Grabreliefs entspricht. So wie<br />
die offenkundige Altersdifferenz Clairmont davon abgebracht hat, den bärtigen sitzenden Mann als Ehemann zu deuten<br />
S e i t e | 75
ekümmerte Dienerin oder Mutter die nun vaterlosen Kinder in einer rührenden Szene um sich<br />
geschart.<br />
Parallelen finden sich ohne Schwierigkeiten auf Lekythen, die eigens für ihre Verwendung im<br />
Grabkult 321 produziert wurden und sich auch inhaltlich mit den Themenkreisen Tod und Abschied<br />
auseinandersetzen. 322 Auf einer marmornen Grablekythos in Cleveland II/10 (Taf. 5 Abb. 1) ist eine<br />
Abschiedsszene zwischen einem Paar, das inschriftlich als Lysistrate und Timophon benannt wird,<br />
dargestellt. 323 Der Dexiosis wohnen auch die gemeinsamen Kinder bei. Eine Amme hält das<br />
Wickelkind im Arm, ein bereits größeres Kind steht zwischen Vater und Mutter.<br />
Reproduktivität und Hausverwaltung waren, wie wir gesehen haben, zumindest den Schriftquellen<br />
nach die Hauptaufgaben der Ehefrau. Während nun zahlreiche Bilder die Arbeit der Frau, ihren Fleiß<br />
und ihre körperlichen Vorzüge ins rechte Licht rücken, scheint die Vasenmaler das Sujet des<br />
kinderreichen Oikos, nach Zahl der uns überlieferten Darstellungen zu urteilen, nur mäßig interessiert<br />
zu haben. 324<br />
Den dringenden Wunsch, allen Besitz einst den eigenen Kindern zu hinterlassen, hat schon Hesiod in<br />
Worte gefasst. In seiner „Theogonie“ gehört der legitime Nachwuchs zu den wenigen Vorteilen, die<br />
den Mann mit dem harten Schicksal der Ehe versöhnen. 325 Der Stellenwert der athenischen Erbfolge<br />
und seine gesetzlichen Regelung werden vor allem in den Gerichtsreden evident, die nicht selten von<br />
diesbezüglichen familiären Auseinandersetzungen berichten. Kinder waren der Garant für das<br />
Fortbestehen des Oikos. Besonders nach der Perikleischen Gesetzgebung von 451/50 v. Chr. erfuhr die<br />
Abgrenzung illegitimer und legitimer Kinder eine krasse Verschärfung. 326 Dies könnte unter anderem<br />
zur Folge gehabt haben, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familienangehörigen zu wecken und<br />
das Bewusstsein des Einzelnen für seine individuelle Rolle zu stärken. 327<br />
und ihn stattdessen als Vater vorgeschlagen hat, so lässt die Jugendlichkeit des Mannes auf dem Alabastron zögern, ihn<br />
als Ehemann zu benennen. Der Gestus, der einer dexiosis sehr nahe kommt, berechtigt aber eine Deutung der Figuren als<br />
Ehepaar, s. auch I. Huber a. O. (Anm. 316) 153.<br />
321 Zu den Loutra, s. z. B. Mösch-Klingele 2006, 22–24. 30–34 einschließlich einer kurzen Übersicht über die relevanten<br />
Forschungsansätze.<br />
322 Ab dem späten 5. Jh. v. Chr. betonen solche Bilder zunehmend den persönlichen Verlust und die zerbrochene Einheit der<br />
Familie, ein weiterer Beleg dafür, dass die Künstler dem Gefühl familiärer Verbundenheit mehr Gewicht verliehen.<br />
323 J. H. Oakley, Death and the Child, in: Neils – Oakley 2003, 187.<br />
324 Zur theoretischen Annäherung an das Thema „Kind in der Antike“, s. J.-A. Dickmann, Das Kind am Rande, in: R. von<br />
den Hoff – S. Schmidt (Hrsg.), Konstruktionen von Wirklichkeit. Bilder im Griechenland des 5. und 4. Jahrhunderts v.<br />
Chr. Interdisziplinäres Kolloquium vom 27.9.–1.10.1999 in Schloss Reisensburg bei Günzburg (Stuttgart 2001) 173–181.<br />
181: Der Autor verweist darauf, dass “sich die Vorstellungen der Erwachsenen von den Rollen der Kinder in<br />
unterschiedlichen sozialen Situationen erheblich veränderten”.<br />
325 Hes. theog. 606–612.<br />
326 Lacey 1983, 104–107; Just 1989, 60–62; Hartmann 2002, 51–56 mit Nennung der relevanten Schriftquellen in<br />
Übersetzung.<br />
327 So auch L. A. Beaumont, Changing Childhoods? The Representation of Children in Attic Figured Vase Painting, in: B.<br />
Schmaltz – M. Söldner (Hrsg.), Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-<br />
Symposions in Kiel vom 24.–28.9.2001 (Münster 2003) 108; R. Osborne, Law, the Democratic Citizen and the<br />
Representation of Women in Classical Athens, in: R. Osborne (Hrsg.), Studies in Ancient Greek and Roman Society<br />
(Cambridge 2004) 38–60.<br />
S e i t e | 76
Nach philosophischem Empfinden waren Kinder unfertig und noch unentwickelt, den Erwachsenen<br />
körperlich, moralisch und geistig unterlegen. 328 In der politisch geprägten Umwelt Athens waren<br />
Kinder ähnlich wie die Frauen nur sekundäre Bedeutungs- und Werteträger. 329 Kinderdarstellungen<br />
sind im Bildrepertoire des 6. Jhs. v. Chr. deshalb nur sehr begrenzt anzutreffen. 330 Mit der rotfigurigen<br />
Technik erweitert sich das Repertoire der Kinderdarstellungen in der attischen Vasenmalerei<br />
beträchtlich. Das Kind beginnt – wie es L. Beaumont formuliert – folgende Voraussetzung zu erfüllen:<br />
es wird zu einem „significant being in its own right“. 331 Ab dem zweiten Viertel des 5. Jhs. v. Chr.<br />
treffen wir auf Mutter und Kind im häuslichen Kontext. 332 Diese Darstellungen sind insofern eine<br />
realistische Wiedergabe antiker Verhältnisse, als die Kinder ihre ersten Lebensjahre tatsächlich<br />
inmitten einer vor allem weiblich geprägten Umgebung verbracht haben dürften. 333 Die neuartige<br />
Betonung der Mutterrolle und das Interesse am emotionalen Band zwischen Mutter und Kind zeugt<br />
nach L. A. Beaumont von einem tiefgreifenden sozialen Wandel, der eine Neudefinition der<br />
traditionellen Rollen in der Familie miteinschloss: “Mother and child are the chosen subject matter and<br />
together reflect a new found social significance and symbolism in the evolving Athenian democracy.<br />
[...] they themselves embody the social ideal of the human family unit upon which the democratic<br />
polis was founded and operated.“ 334 Ab dem dritten Viertel des 5. Jhs. wird auch die Rolle des Vaters<br />
in der griechischen Bilderwelt neu entdeckt. 335<br />
Innerhalb der Gattung der Keramik sind es vor allem die Choenkännchen, die sich<br />
Kinderdarstellungen widmen und sich mit dem Wesen der Kinder und ihrer spielerischen Interaktion<br />
mit anderen Kindern auseinandersetzen, also diese um ihrer selbst willen thematisieren. 336 Die Eltern<br />
selbst sind nur selten gemeinsam mit ihren Kindern dargestellt. Dennoch ist auffällig, dass die Zahl<br />
der Vasendarstellungen, die Kinder im Kreise ihrer beiden Eltern zeigen, anders als in der sepulkralen<br />
Kunst auf einige wenige Beispiele beschränkt ist. Das Ergebnis wird nur wenig entzerrt, nimmt man<br />
328 M. Golden, Children and Childhood in Classical Athens (Baltimore 1990) 5 ff. mit Quellenangaben.<br />
329 L. A. Beaumont, The Changing Face of Childhood, in: Neils – Oakley 2003, 61.<br />
330 V. Siurla-Theodoridou, Die Familie in der griechischen Kunst und Literatur des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. (München<br />
1989) 256–263: Bei den frühen Kinderdarstellungen handelt es sich meist um mythische Kontexte. Daneben gibt es in<br />
der Koroplastik den Typus der Kourotrophos. – Zum Kriegerabschied, s. A. B. Spieß, Der Kriegerabschied auf attischen<br />
Vasen der archaischen Zeit (Frankfurt a. M. 1992) 127 f.<br />
331 Beaumont a. O. (Anm. 327) 107.<br />
332 z. B. Lekythos, Oxford, Ashmolean Mus. 320: Keuls 1985, 110 f. Abb. 95; 113 Abb. 97. 98; Pyxis des/aus dem Kreis des<br />
Aberdeen-Malers, Dallas, Mus. of Art 1968.28: Reeder 1995, 204 f. Nr. 43; Schale, Brüssel, Musées Royaux du<br />
Cinquantenaire A 890: CVA Brüssel (1) III. Jb 1Taf. 1, A–B. Choenkanne, <strong>Erlangen</strong>, Antikensammlung I 321: Lewis<br />
2002, 156 Abb. 4, 18.<br />
333 Keuls 1985, 110; S. Houby-Nielsen, Grave Gifts, Women, and Conventional Values of the Hellenistic Greeks, in: P.<br />
Bilde et al. (Hrsg.), Conventional Values oft he Hellenistic Greeks (Aarhus1997) 234.<br />
334 Beaumont a. O. (Anm. 327) 109; Bundrick 2008, 328. – Sprunghafter Anstieg der Kinderbestattungen im Kerameikos<br />
nach 510 v. Chr., s. Houby-Nielsen a. O. (Anm. 333) 235.<br />
335 Beaumont a. O. (Anm. 327) 109: “We now occasionally also witness the entrance of the Athenian male in his roles of<br />
father and husband into the domestic arena of Athenian iconography.”<br />
336 z. B. G. van Hoorn, Choes and Anthesteria (Leiden 1951); Rühfel, Kinderdarstellungen im klassischen Athen (Mainz<br />
1984) 125–174; R. Hamilton, Choes and Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual (Ann Arbor 1992); J.-A.<br />
Dickmann, Bilder vom Kind im Klassischen Athen, in: W. D. Heilmeyer (Hrsg.), Die griechische Klassik. Idee oder<br />
Wirklichkeit. Ausstellungskatalog Berlin – Bonn (Berlin 2002) 311 f.<br />
S e i t e | 77
die Szenen von Kindern im Beisein nur eines Elternteils in die Untersuchung mit auf. 337<br />
Es ist bei den Familienszenen – wie in der attischen Vasenmalerei überhaupt – anzunehmen, dass dem<br />
antiken Betrachter nicht einfach nur ein Abbild der Realität, sondern bestimmte Ideal- und<br />
Wertvorstellungen vermittelt wurden. Somit haben auch die Familienszenen mit beiden Elternteilen<br />
vermutlich eine vorrangig programmatische Aussage: dem antiken Betrachter wurde ein Beispiel für<br />
eine ideale Hausgemeinschaft vor Augen geführt. 338<br />
Das griechische Familienleben in realiter rekonstruieren zu wollen, ist ein vergebliches Unterfangen.<br />
Dass die Griechen jedoch ihre Kinder geliebt haben, daran kann trotz der Praxis, überzählige,<br />
illegitime oder verkrüppelte Kinder auszusetzen, und trotz manch gängiger Abtreibungs- bzw.<br />
Verhütungsmethoden nicht bezweifelt werden. 339 Aristoteles etwa definiert das Lebensglück über den<br />
Besitz vieler und guter Kinder. 340 Auch die Komödie und die Tragödie sind beredte Zeugnisse für den<br />
verzweifelten Kinderwunsch bis dato kinderloser Frauen. Sie spiegeln die Trauer derer wider, die<br />
durch schicksalhafte Fügung ihre illegitimen Kinder aussetzen mussten und betonen gleichzeitig<br />
Freuden und Sorgen des Elterndaseins. 341 Da das Zeugen von Kindern zu den essentiellen Forderungen<br />
der Ehe erklärt worden war, ist es leicht einzusehen, weshalb Kinderlosigkeit ein akzeptabler Grund<br />
für eine Scheidung war. In der Regel wird diese auf eine biologische Dysfunktion der Frau<br />
zurückführt. Ein anders gelagerter Fall wird uns jedoch in einer Rede des Isaios vorgestellt. Dort<br />
erkennt Menekles die Ursache für die Kinderlosigkeit seiner Ehe in seiner eigenen Zeugungsimpotenz<br />
und drängt seine Frau zur Scheidung, um zumindest ihr in einer neuen Verbindung die Zeugung von<br />
Kindern zu ermöglichen. 342 In Platons Idealstaat ist für Unfruchtbarkeit kein Platz, die Unfähigkeit,<br />
Kinder zu zeugen oder zu gebären, muss gezwungenermaßen zur Auflösung der Paargemeinschaft<br />
führen. 343 Wie wir aus Thukydides erfahren, hatte der Staat reges Interesse an der Zeugungswilligkeit<br />
seiner Bürger, da sie die Grundlage für das Verteidigungs- und Angriffspotential jedes Stadtstaates<br />
bildete. 344 Dass die Familie zum Teil auch bewusst als Sympathieträger eingesetzt wurde, verraten<br />
zahlreiche Beispiele, wenn Angeklagte vor Gericht versuchen, durch Vorführen ihrer<br />
Familienangehörigen Mitleid zu erregen. Dieses Verhaltensmuster ist nur dann Erfolg versprechend,<br />
wenn sich die Entscheidungsträger mit den Werten der Familie identifizieren können. Die Art und<br />
Weise, wie ein Vater oder Ehemann die Seinen behandelte, wurde für die Öffentlichkeit zum<br />
337 Sutton 2004, 337.<br />
338 Die Präsentation des Oikos unter Miteinbeziehung der Kinder ist nach J.-A. Dickmann, Bilder vom Kind im Klassischen<br />
Athen, in: W. D. Heilmeyer (Hrsg.), Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Ausstellungskatalog Berlin – Bonn<br />
(Berlin 2002) 312 f. ein vorrangiges Anliegen der Weihreliefs. Eine auf die öffentliche Wirkung angelegte inhaltliche<br />
Aussage möchte ich auch für die Vasenbilder annehmen, wobei der Kontext der Verwendung natürlich ein anderer ist.<br />
339 Zur Eltern-Kind-Beziehnung, s. M.-T. Charlier – G. Raepset, Etude d´un comportement social. Les relations entre parents<br />
et enfants dans la societé athénienne à l´époche classique, AntCl 40, 1971, 589–606; V. Siurla-Theodoridou, Die Familie<br />
in der griechischen Kunst und Literatur des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. (München 1989) 362–365; M. Golden, Children<br />
and Childhood in Classical Athens (Baltimore 1990) 80–114.<br />
340 Aristot. Rh. 1361a4–6.<br />
341 z. B. Eur. Ion 471–491.<br />
342 Is. 2, 6–9.<br />
343 Plat. leg. 784b.<br />
344 Thuk. 2, 45: Nachschub an Kriegern.<br />
S e i t e | 78
Spiegelbild seiner politischen Integrität:<br />
"The man who hates children, the bad father, would never be a reliable leader of the<br />
people." (Aischin. 3, 77–78)<br />
Obgleich die Kinderpflege in den Händen der Mütter oder weiblicher Bediensteter lag 345 , dürfen wir<br />
nicht glauben, dass die Väter gar keinen Anteil an der Erziehung ihrer Kinder hatten bzw. ihre Söhne<br />
erst zur Kenntnis nahmen, wenn diese alt genug für die offizielle Einschreibung in die Phratrie- oder<br />
Demenliste waren. Auch wenn Xenophon die Kinderliebe als einen typischen Wesenszug der<br />
weiblichen Natur betrachtet, der die Frau für das Aufziehen ihrer Kinder prädestiniert 346 , wird dennoch<br />
im Laufe des Gesprächs auch deutlich, dass Ischomachos die Erziehung künftiger Kinder als<br />
gemeinschaftliches Projekt betrachtet. 347 Mantitheus umschreibt bei Demosthenes seine Beziehung zu<br />
seinem Vater folgendermaßen:<br />
„ And he brought me up and showed me a father´s affection such as you also all show to<br />
your children.“ (Demosth. or. 40, 8)<br />
Der „Taktlose“ aus Theophrasts „Charakteren“ dagegen taugt kaum als vorbildliche Vaterfigur; er<br />
übertreibt seine Fürsorge und ist so verrückt nach seinem Sohn, dass er ihn mit dem Mund füttert, ihn<br />
küsst und Kosenamen gibt. 348 Auch Strepsiades aus den „Wolken“ des Aristophanes, dessen<br />
Verhältnis zu seinem erwachsenen Sohn äußerst gespannt ist, schwelgt in süßen Erinnerungen an die<br />
Kindheit seines Sprösslings 349 :<br />
„[...] Ich tat<br />
Dir´s auch zulieb – du lalltest noch, sechs Jahr´ alt –<br />
Als für den ersten Richtsold ich dir<br />
Ein Wägelchen kaufte zum Diasienfest.“ (Aristoph. Nub. 861–864)<br />
„Als kleines Bübchen baut´ er schon daheim<br />
Sich Häuschen, schnitzte Schiffchen, macht´ aus Leder<br />
Sich Ross und Wagen, und aus Äpfelschalen<br />
Recht art´ge Frösche, ja, du kannst mir´s glauben!“ (Aristoph. Nub. 878–881)<br />
345 Siurla-Theodoridou a. O. (Anm. 339) 366–368.<br />
346 Xen. oik. 7, 24.<br />
347 Xen. oik. 7, 12.<br />
348 Theophr. char. 20, 5.<br />
349 Dieses harmonische Erinnerungsbild ist recht einseitig, denn am Ende droht der Sohn dem Vater Prügel an zum<br />
Ausgleich für die Schläge, die er selbst als Kind einstecken musste. – Zu häuslicher Gewalt gegenüber Kindern, s. W.<br />
Schmitz, Gewalt in Haus und Familie, in: Fischer – Moraw 2005, 113–118.<br />
S e i t e | 79
S e i t e | 80<br />
2. 5. 3. Der Mann im Oikos<br />
Die Familienbilder sind, auch wenn sie nur in kleiner Zahl vorhanden sind, Beleg für die Existenz<br />
eines gewissen Familienbewusstseins. Dabei wird deutlich, dass die Vasenmaler die Anwesenheit des<br />
Mannes in Bereichen des Hauses, die gewöhnlich der Arbeit und der Kindererziehung dienten, ganz<br />
im Gegensatz zu der Vorstellung, die uns die Literatur vermittelt, nicht als problematisch oder störend<br />
empfanden. Diese Erkenntnis hat Konsequenzen für die Auslegung ähnlicher Vasenbilder, die einen<br />
Jüngling oder Mann – in einigen Fällen sind es, wie wir sehen werden, auch mehrere – im häuslichen<br />
Kontext darstellen.<br />
Auf einer Hydria in London II/11 (Taf. 5 Abb. 2) sitzt eine junge Frau frontal zum Betrachter<br />
ausgerichtet. In ihren Händen hält sie gut sichtbar Spindel und Spinnrocken, zu ihren Füßen steht der<br />
obligatorische Kalathos. Ihr Blick ist auf eine von links kommende Dienerin mit einem Kästchen<br />
gerichtet. Rechts von ihr steht isoliert und nicht in das statische Geschehen miteinbezogen ein junger<br />
Mann. Eine weitere Hydria ebenfalls in London II/12 (Taf. 5 Abb. 3) trägt eine Szene des gleichen<br />
Themas mit leicht abgewandelter Komposition. Die Spinnerin ist nun in Seitenansicht wiedergegeben,<br />
wodurch sie dem bärtigen Mann zugewandt ist, der dem Jüngling des ersten Gefäßes entspricht. Die<br />
das Kästchen tragende Dienerin ist fast eins zu eins übernommen. Webutensilien der Hausherrin sind<br />
auch hier wieder Spinnrocken, Spindel und Wollkorb. Nach M. Beard ist die Londoner Hydria das<br />
Paradebeispiel eines sog. „normative image“. 350 Die Hausherrin als Mittelpunkt des Oikos sitzt<br />
komfortabel auf ihrem Klismos, wohlgemerkt jedoch nicht müßig, sondern fleißig spinnend. 351<br />
Die fleißige Spinnerin und Hausherrin ist auch Thema eines Epinetron in Athen II/13 (Taf. 5 Abb. 4.<br />
5). Während die Frau des Hauses auf der einen Seite inmitten ihrer Gefährtinnen spinnt, ist sie auf der<br />
anderen Seite Mittelpunkt häuslicher Aktivität. Ganz rechts am Rande fungiert ein bärtiger Mann 352 als<br />
Beobachter der Szenerie, wie er schon auf zahlreichen Vasenbildern begegnet ist. Besonders die<br />
Epinetra bieten unter dem Aspekt der zwischengeschlechtlichen Begegnung reiches Material. 353 Als<br />
Hilfswerkzeug im Prozess der Textilherstellung 354 ist das ikonographische Repertoire vermutlich im<br />
Großen und Ganzen auf die Besitzer abgestimmt, die damit hantieren. Angesichts des Stellenwertes<br />
der Heimproduktion von Stoffen und Gewändern waren dies sicherlich in erster Linie die weiblichen<br />
Mitglieder eines Oikos. Dass unter den Darstellungen ausgerechnet zwischengeschlechtliche<br />
Begegnungen einen so breiten Raum einnehmen, verunsicherte, da man sich nicht erklären konnte,<br />
350 M. Beard, Adopting an Approach II, in: N. Spivey – T. Rasmussen (Hrsg.), Looking at Greek Vases (Cambridge 1991)<br />
22 f.<br />
351 s. auch Vidale 2002, 424 f.<br />
352 Mercati 2003, 58 bezeichnet ihn als Jüngling, der Abbildung nach zu urteilen trägt er aber einen Bart.<br />
353 z. B. Mercati 2003, 43 f. 58 f.<br />
354 Zu Form und Funktion des Epinetron, s. Mercati 2003, 17 ff.; Heinrich 2006, 11 f. 21 f. 41. 69 f. Mangelnde Gebrauchs-<br />
und Abnutzungsspuren lassen vermuten, dass die fragilen und bemalten Ton-Epinetra nicht für den alltäglichen Gebrauch<br />
geschaffen worden waren. Tatsächlich stellt Heinrich fest, dass insbesondere die rotfigurigen Epinetra durch ihre<br />
geringen Ausmaße für die Arbeit untauglich waren. Fundkontexte belegen das Vorkommen der Epinetra vor allem als<br />
Votiv- oder Grabbeigaben, s. auch Mercati 2003, 29 ff.; Badinou 2003, 12 ff.
warum sich Athenerinnen mit Bildern von Hetären umgeben sollten. 355 Als Abnehmer blieben folglich<br />
nur die spinnenden Hetären übrig. Angesichts vergleichbarer Szenen wie etwa auf den beiden Hydrien<br />
II/ 11 und II/12 kann man den männlichen Zuschauer auf dem Athener Epinetron jedoch als<br />
Oberhaupt des Oikos benennen. Das Epinetron verbleibt weiterhin im Besitz der athenischen<br />
Wirtschafterin!<br />
Die Beschäftigung mit Wolle ist auf den meisten attischen Vasen kaum mehr wegzudenken. Wenn die<br />
Ehefrau nicht gerade spinnt, steht dennoch in der Regel der Wollkorb zu ihren Füßen, der den<br />
Betrachter an diese wichtige Hausfrauenpflicht erinnert. Auf einer Hydria in Karlsruhe II/14 (Taf. 6<br />
Abb. 1) steht ein Jüngling hinter einer sitzenden Frau, die ihre Hände mit der Handfläche nach oben<br />
der ankommenden Dienerin mit dem emporgereckten Kalathos entgegenstreckt. Es ist vorstellbar, dass<br />
die Hausherrin den Kalathos in Empfang nehmen will oder aber ursprünglich eine Tänie oder ein Band<br />
hielt. Der Jüngling steht diesmal nicht völlig unbeteiligt hinter der Sitzenden, mit erhobener Hand<br />
signalisiert er einen Sprech- oder Grußgestus. Auf einer Hydria in Palermo II/15 wiederholt sich das<br />
eingängige Schema. Zu Frauen, die sich mit Wollkorb und Kästchen beschäftigen, gesellt sich als<br />
Zuschauer ein Jüngling.<br />
Bisweilen hält sich sogar mehr als ein Vertreter des männlichen Geschlechts im Kreis der Frauen auf.<br />
Eine Pyxis in Gotha II/16 (Taf. 6 Abb. 2–4) zeigt inmitten einer Schar von Frauen mit Wollkörben<br />
und Spiegeln 356 zwei Jünglinge. Einer der beiden steht – wie häufig beobachtet – unbeteiligt und auf<br />
seinen Bürgerstock gestützt abseits, während der andere Adressat einer Handgeste einer sich auf ihrem<br />
Klismos umwendenden Frau ist. Wie zu einer Antwort hebt er seine Strigilis. Natürlich ist die<br />
Anwesenheit gleich mehrerer Jünglinge oder Männer in den Oikos- und Arbeitsszenen im Spiegel des<br />
antiken Frauenbildes schwerer plausibel zu machen, da eine Interpretation als Ehemann entfällt. Eine<br />
Deutung der Szene als Hetärenwerbung, die durch Kalathos, Spiegel und Alabastron in eine<br />
„häusliche und seriöse“ Atmosphäre eingebettet ist, ist nicht fundiert, da sie sich wiederum<br />
vorwiegend auf das Vorurteil der von Männern isolierten Bürgerin stützt und die genannten häuslichen<br />
Attribute beliebig umdeutet. 357 In dieser Bildabfolge eine narrative Aussage entdecken zu wollen, geht<br />
wohl zu weit. Jeder Figur ist ein geschlechtsspezifisches Attribut zugeteilt: Wollkorb und Spiegel 358<br />
entsprechen dem gängigen Muster zur Kennzeichnung weiblicher Merkmale, während die Strigilis 359<br />
355 Vor allem die schwarzfigurigen, oftmals handlungsarmen Vasenbilder geben Rätsel auf: Männer und Frauen sitzen bzw.<br />
stehen sich gegenüber, unterhalten sich gestikulierend, hin und wieder mit einem Attribut oder einer Gabe versehen;<br />
Attribute, die eine Differenzierung der Personen oder eine Verortung ermöglichen würden, sind in der Regel auf ein<br />
Minimum reduziert. s. Badinou 2003, E2. 4. 5. 8. 10. 17. 28 Taf. 2. 4–6. 11. 17.<br />
356 Hier scheint es sich tatsächlich um einen Spiegel und nicht um einen Spinnrocken zu handeln.<br />
357 E. Kotera-Feyer, Die Strigilis in der attisch-rotfigurigen Vasenmalerei: Bildformeln und ihre Deutung, Nikephoros 11,<br />
1998, 125. Die vermeintlich erotisch aufreizende Haltung der Mantelfigur mit Strigilis ist eine männliche Standpose, die<br />
bestimmt keine erotischen Absichten verfolgt. Die Bedeutung der Strigilis als Liebesgeschenk wird meiner Ansicht nach<br />
überbewertet.<br />
358 Badinou 2003, 31: „Le miroir constitue ainsi un élément associé à la parure de la femme avec une signification érotique<br />
évidente.”<br />
359 Strigilis als Zeichen des Ephebenstatus, s. S. Houby-Nielsen, Grave Gifts, Women, and Conventional Values of the<br />
Hellenistic Greeks, in: P. Bilde et al. (Hrsg.), Conventional Values oft he Hellenistic Greeks (Aahus 1997) 228. Daneben<br />
behält die Strigilis ihre Mehrdeutigkeit bei. Sie ist ein Reinigungsgerät, das gerade bei Männern auch an die körperliche<br />
Ertüchtigung in der Palästra denken lässt.<br />
S e i t e | 81
in den Händen des jungen Mannes Chiffre für seine sportliche Erziehung ist.<br />
Auch die Hydria in New York II/17 (Taf. 6 Abb. 5; Taf. 6 Abb. 1. 2) zeigt zwei junge Männer<br />
innerhalb des Oikos. Ganz links hält eine Frau einem Jüngling mit Bürgerstock ein Exaleiptron<br />
entgegen, während ein Stück weiter zwei Frauen mit der Wollarbeit beschäftigt sind. Die Sitzende<br />
zwirbelt den Wollfaden von einem vollen Spinnrocken ab, der zwischen den Fingern geformte feine<br />
Faden wird auf eine Spindel aufgewickelt, die knapp über dem Boden schwebt. Die rechte Frau ist<br />
schwer mit einem Kästchen und einem Wollkorb beladen. Eine zweite Gruppe setzt sich aus drei<br />
Personen zusammen. Eine bequem auf einem Klismos sitzende Frau wendet sich, den Arm auf die<br />
Stuhllehne gestützt, zu einem Jüngling um, der ihr in einem vertraulichen Gestus die Hand auf die<br />
Schulter legt. 360 Die Szene erhält durch den intensiven Blick, Eros und die Sitzhaltung, die an einen<br />
Statuentypus der Aphrodite erinnert, einen aphrodisischen Charakter. 361 Man hat erwogen, ob es sich<br />
vielleicht bei den Schuhen in den Händen des Eros um die Nymphides, die Brautschuhe, handeln<br />
könnte. 362 Im Bereich des Henkels folgen noch zwei weitere weibliche Personen: eine etwas kleiner<br />
gebildete Frau streckt einer Frau mit Diadem, deren Arme und Hände komplett von ihrem Himation<br />
verhüllt werden, ein Kästchen entgegen. Es sind hier also diverse Aspekte des Frauenlebens<br />
aneinandergereiht, die im Inneren des Hauses stattfinden und normative Werte und Tätigkeiten der<br />
Frauen schildern. 363 Neben der beliebten Thematik der Wollgewinnung und -verarbeitung geht es hier<br />
mehr als auf den bisherigen Exemplaren auch um das Verhältnis der Geschlechter. 364 Während auf der<br />
Pyxis II/2 und den Hydrien II/3 und II/14 der Mann statisch hinter seiner sitzenden Gattin steht, ist<br />
hier erstmals physischer Kontakt dargestellt. Eros – und eventuell die nymphides – stützen die<br />
Vermutung, es könne ein Braut- oder Ehepaar gemeint sein. In welchen Bildkontexten Eros besonders<br />
im Hinblick auf Paardarstellungen erscheint und welche Assoziationen er birgt, wird gesondert<br />
untersucht werden.<br />
Die Pyxis in Boston II/18 (Taf. 7 Abb. 3) kann das Aufgebot an Männern noch steigern. 365 Es ist nicht<br />
klar, ob die Hausherrin vor ihrem Kalathos mit Wolle hantiert oder nicht vielleicht eher einen heute<br />
verblassten Kranz in den Händen hält. Ihr gegenüber steht ein bärtiger Mann. In der Regel ist es<br />
leichter, die Anwesenheit eines Mannes anstelle gleich dreier Männer zu erklären. Da jedoch einer von<br />
360 Als Gestus des In-Besitz-Nehmens wird die Hand auf der Schulter von C. Benson, in: Reeder 1995, 399–401 Nr. 130<br />
hinsichtlich einer Verfolgungsszene von Eos und Tithonos, Baltimore, Walters Art Gallery 48.2034, gedeutet. Der<br />
Szenenzusammenhang ist bei der Hydria in New York jedoch ein ganz anderer. – Gestus im sepulkralen Kontext, s.<br />
Grabstele, Piräus, Mus. 2152: CAT 3.215.<br />
361 s. auch A. Delivorrias, Das Original der sitzenden „Aphrodite-Olympias“, AM 93, 1979, 1–23; P. Kranz, die Frau in der<br />
Bildkunst der griechischen Klassik, in: P. Neukam (Hrsg.), Antike Literatur – Mensch, Sprache, Welt, Klassische<br />
Sprachen und Literaturen 34 (München 2000) 70 f.<br />
362 G. M. A. Richter, Red-Figured Athenian Vases in the Metropolitan Museum of Art (New Haven 1936) 174; Keuls 1985,<br />
121 nennt hier die vorliegende Vase als einziges Beispiel für die Abbildung solcher Nymphides. – Das Anlegen von<br />
Sandalen als Zeichen für Übergang und Aufbruch in Verbindung mit der Hochzeit, s. C. Weiß, Zur Typologie und<br />
Bedeutung attischer Schuh- und Sandalengefäße, Nikephoros 8, 1995, 35–38; Sutton 1997, 36. 40.<br />
363 Keuls 1985, 121 will in den beiden sitzenden Frauen die Braut und ihre Mutter erkennen; Badinou 2003, 23.<br />
364 Bundrick 2008, 320–322 fasst das Spinnen und Weben als Metapher für ehelichen Sexualverkehr auf. Für beide Prozesse<br />
ist der griechische Ausdruck symploke belegt.<br />
365 Ich stütze mich hier auf die knappen Beschreibungen des Beazley-Archivs und auf S. R. Rutherford, The Attic Pyxis<br />
(Chicago 1978) 48 f. Nr. 12, da mir eine Abbildung der Gefäßrückseite nicht vorlag.<br />
S e i t e | 82
den beiden Jünglingen von einer Nike bekränzt wird, ist wohl kaum damit zu rechnen, dass sich die<br />
versammelten Männer bei einer Hetäre eingefunden haben. In diesen Zusammenhang gehört zudem<br />
eine Hydria in San Simeon II/19. Abgesehen von den beiden sitzenden Jünglingen, die das Bildfeld an<br />
beiden Seiten abschließen, ist die Szene eine typische Wiedergabe eines von Frauen bevölkerten<br />
Oikos. Eine Frau eilt mit einem eimerartigen Behältnis auf eine Gruppe von zwei Frauen zu, die sich<br />
auf ihren Klismoi gegenübersitzen. Die linke von ihnen hält eine Spindel. Während die linke<br />
männliche Figur das Geschehen überblickt, sitzt die rechte Figur mit dem Rücken zu den restlichen<br />
Personen und nimmt keinerlei Bezug auf ihre Umgebung. Welche Rolle die beiden Jünglinge in der<br />
Darstellung spielen, bleibt im Einzelnen unklar. Die Gliederung des Bildes durch Säulen soll vielleicht<br />
verschiedene Aufenthaltsräume des Hauses anzeigen.<br />
2. 5. 4. Paardarstellungen<br />
Die z. T. sehr erzählfreudigen Oikosbilder mit Männern gibt es auch in verkürzten Versionen, die auf<br />
Beifiguren verzichten. Hier bieten sich vor allem kleinformatige Gefäße wie Alabastra oder räumlich<br />
begrenzte Bildfelder wie die Tondi der Kylikes als Bildträger an. Unter den nachfolgenden Beispielen<br />
finden sich jedoch genauso großformatige Gefäße wie Hydrien oder Peliken.<br />
Die sitzende Frau auf dem Skyphos in Palermo II/20 (Taf. 7 Abb. 4. 5) stemmt ihr entblößtes rechtes<br />
Bein gegen die Konstruktion einer schiefen Ebene und ist mit dem Vorgang der Wollvorbereitung<br />
beschäftigt, zu dem üblicherweise ein Epinetron zu Hilfe genommen wird. Auf der anderen Seite des<br />
Gefäßes steht ein bekränzter Jüngling mit Bürgerstock mit dem Rücken zu einer massiven Tür. Die<br />
Ausstattung der jungen Frau mit Schleier und Diadem oder Kranz kennzeichnet sie deutlich als Braut.<br />
Auch bei Paardarstellungen muss demzufolge stets in Betracht gezogen werden, dass ein Ehe- oder<br />
Brautpaar gemeint ist.<br />
Das Alabastron in Würzburg II/21 (Taf. 7 Abb. 6–8) etwa ist repräsentativ für viele seiner Art. 366 Dort<br />
stehen sich ein bärtiger Mann mit Bürgerstock und eine züchtig verhüllte Frau mit Kalathos<br />
gegenüber. Der vertikale Dekorstreifen – in diesem Fall ein Mäanderband – ist eine Art<br />
Modeerscheinung der Alabastra des 5. Jhs. v. Chr. und offensichtlich wie die Säule eine<br />
raumgliedernde Architekturangabe, denn sowohl der Diphros als auch der Kalathos werden z. T.<br />
verdeckt. Da beide Personen jedoch in Blickkontakt stehen, ist eine kontinuierliche Lesung der beiden<br />
aneinanderstoßenden Szenen wohl intendiert. 367<br />
Fast exakt dieselben ikonographischen Elemente begegnen zur Charakterisierung von Mann und Frau<br />
im Tondo einer Schale in Hannover II/22 (Taf. 8 Abb. 1) wieder. Mann und Frau sind mit Attributen<br />
ihren sozialen Rollen gemäß ausgestattet: er als Bürger mit dem Bürgerstock, sie als Hausfrau mit<br />
Spindel. Das Ambiente ist durch die beiden Hocker – auf einem von beiden steht der Kalathos – als<br />
366 vgl. Alabastron des Aischines-Malers, Oxford, Ashmolean Mus. 327: CVA Oxford (1) III I 33 Taf. 41, 7. 8.<br />
367 z. B. S. Karouzou, Scènes de palestre, BCH 86, 1962, 439. – Ausnahme: z. B. Skyphos, Capua, Mus. Campano 220:<br />
CVA Capua (2) III. I 7 Taf. 14, 2. 3: auf der einen Seite eine Frau mit Kalathos, Alabastron und Diphros, auf der anderen<br />
ein bärtiger Mann mit Strigiles; der Pfeiler neben dem bärtigen Mann ist als Chiffre für Palästra oder Gymnasium zu<br />
verstehen; in diesem Fall handelt es sich also um zwei separat zu lesende Szenen, von denen die eine die Männer-, die<br />
andere die Frauenwelt zum Thema hat.<br />
S e i t e | 83
häuslich gekennzeichnet. Obgleich nichts in diesem Bild die Interpretation als Hetäre und Kunde<br />
erzwingt, wurde sie dennoch angesichts des eindeutigen erotischen Charakters der Werbeszenen der<br />
Außenseite als wahrscheinlich angesehen. 368 Da die Darstellung für sich selbst genommen keineswegs<br />
außergewöhnlich ist, gliedere ich sie hier mit der Option, dass ein Ehepaar abgebildet sein könnte, in<br />
die vorgestellte Gruppe von Oikosszenen ein. Der Mann gibt auf seinen Bürgerstock gestützt und die<br />
Rechte in die Hüfte gestemmt den Polisbürger par excellence ab 369 , die Palästrautensilien an der Wand<br />
versinnbildlichen den Wert der körperlichen Ertüchtigung und Körperpflege 370 . Auf die Webtätigkeit<br />
der Frau verweisen die demonstrativ in die Höhe gehaltene Spindel und der auf dem Diphros platzierte<br />
Kalathos.<br />
Die Szene auf einem Alabastron in Athen 371 II/23 (Taf. 8 Abb. 2) ist im Inneren eines Hauses<br />
angesiedelt, dessen Architektur durch eine einzelne Säule angedeutet ist. Eine junge Frau, durch den<br />
Wollkorb und die Spindel als Spinnerin gekennzeichnet, wendet sich zu einem Jüngling um, der sich<br />
lässig auf seinen Bürgerstock stützt. Welche Bewandtnis hat es nun aber mit dem „Stelzvogel“? Den<br />
Oikosszenen sind häufig Vögel aller Art beigefügt. Auch sie sind als Symbole zu verstehen, die in der<br />
Regel die betreffende Person beschreiben. Da den meisten Vögeln eine erotische Symbolik<br />
zugeschrieben wird, 372 ist man gern bereit, sie vor allem in Bildern mit heterogeschlechtlichen Paaren<br />
mit der Prostitution in Verbindung zu bringen. 373 Dazu besteht jedoch keine Notwendigkeit. Tugend,<br />
Erotik und Sexualität vereinigen sich auch in der Person der Bürgerin. Die biologische Unterscheidung<br />
von Reiher und Kranich in der wissenschaftlichen Literatur ist zumeist nicht exakt. Nach E. Böhr<br />
handelt es sich bei dem Tier mit dem s-förmigen Hals, den grazilen Beinen und dem Federschopf am<br />
368 Herauszulesen etwa aus D. Buitron-Oliver, Douris. A Master-Painter of Athenian Red-Figure Vases (Mainz 1995) 28. –<br />
Zur Frage, ob Außen- und Innenbilder eines Gefäßes thematisch aufeinander bezogen oder quasi als Antithese einander<br />
gegenübergestellt sind, s. z. B. Killet 1994, 63; Kreilinger 2007, 23 f. mit Bezugnahme auf weitere Autoren. Derartigen<br />
„neutralen“ Bildern muss eine gewisse allgemeine Verständlichkeit innewohnen, die nicht davon abhängig ist, welche<br />
Bilder daneben betrachtet und verglichen werden können. Die Schärfe, der Witz oder die Pointierung mag bei einigen<br />
Bildern erst durch ihren Kontrast mit anderen Bildern entstehen, aber es ist kaum davon auszugehen, dass Bilder ihren<br />
Bedeutungsgehalt nach Belieben wechseln können. Damit soll aber nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne<br />
Betrachter individuelle Dinge oder Situationen mit einem Bild assoziieren. Für eine flexible Lesung, die von Rezipient zu<br />
Rezipient variieren kann, tritt ein z. B. Kreilinger 2007, 10. 26 f.<br />
369 Parallelen in der Sepulkralkunst, s. P. Kranz, die Frau in der Bildkunst der griechischen Klassik, in: P. Neukam (Hrsg.),<br />
Antike Literatur – Mensch, Sprache, Welt, Klassische Sprachen und Literaturen 34 (München 2000) 71. 73.<br />
370 Zur Strigilis, s. E. Kotera-Feyer, Die Strigilis in der attisch-rotfigurigen Vasenmalerei: Bildformeln und ihre Deutung,<br />
Nikephoros 11, 1998, 107–136. bes. 123 f.: Die Autorin sieht die Strigilis als Zeichen eines hohen sozialen Ranges und<br />
bürgerlicher Arete, die sich stets auf den Mann beziehen; ihr widerspricht Kreilinger 2007, 160 f.: Die als<br />
Athletenutensilien bezeichneten Strigiles und Schwämme sind genau genommen Waschutensilien, die nicht<br />
ausschließlich von Männern verwendet werden. Im Rahmen von Reinigung und Körperpflege sind sie keineswegs<br />
Standesabzeichen; V. Paul-Zinserling, Der Jena-Maler und sein Kreis. Zur Ikonographie einer attischen Schalenwerkstatt<br />
um 400 v. Chr. (Mainz 1994) 60 f. möchte in ihnen gerne Symbole der Katharsis und Mystik sehen.<br />
371 Athen, M. Vlasto Coll. (ohne Inv.); vgl. weißgrundiges Alabastron des Malers von New York 21.131, Athen, Kerameikos<br />
Mus. HS 107: I. Wehgartner, Attische weißgrundige Keramik (Mainz 1983) Taf. 41, 1–3, das diese Ikonographie nur<br />
leicht abgewandelt aufgreift.<br />
372 Lewis 2002, 163–166; Badinou 2003, 28. 66.<br />
373 Im vorliegenden Fall z. B. E. Böhr, Mit Schopf an Brust und Kopf. Der Jungfernkranich, in: A. J. Clark – J. Gaunt – B.<br />
Gilman (Hrsg.), Essays in Honor of Dietrich von Bothmer (Amsterdam 2002) 42 f.: Kriterium für die Hetäre ist hier<br />
wiederum allein die Anwesenheit eines Mannes.<br />
S e i t e | 84
Kopf um eine Unterart des Kranichs, nämlich den Jungfernkranich. 374 Diese Gattung der Kraniche war<br />
als possierliches Haustier wohl besonders populär. Nicht immer wird man einwandfrei unterschieden<br />
können, ob der Jungfernkranich als gezähmtes Haustier gedacht werden muss oder ob er als bloßes<br />
Chiffre fungiert. Sein realistisches Agieren in Fütterungs- und Spielszenen lässt eine sorgfältige<br />
Beobachtungsgabe und naturalistische Detailfreude der Vasenmaler erahnen. In anderen Bildern ist er<br />
dagegen als stummes Beiwerk hinzugefügt. S. Lewis betont die Vielseitigkeit des Vogels in der<br />
griechischen Kunst: „The bird as companion to women thus seems to be one symbol which is truly<br />
polysemic, invoking simultaneoulsy the domestic, the divine and the erotic.“ 375 Der Reiher wurde<br />
versuchsweise mit Göttinnen wie Aphrodite oder Athena in Verbindung gebracht. 376 In Bezug auf den<br />
Jungfernkranich konnte bisher bestenfalls auf eine Verbindung zu Demeter verwiesen werden. 377 Eine<br />
mögliche symbolische Assoziation wäre sicherlich der Aspekt der Fruchtbarkeit, der Kultfesten der<br />
Demeter vielfach zugrunde lag.<br />
Derartige Bilder gibt es auf rotfigurigen Vasen mit kleinen Variationen in großer Anzahl. Im Tondo<br />
einer Schale in Basel 378 II/24 (Taf. 8 Abb. 3) hält eine sitzende Frau in den Händen einen Spiegel und<br />
eventuell eine heute verblasste Blüte. Auf einer Schale im Baseler Kunsthandel 379 ist die männliche<br />
Figur diesmal kein junger, sondern ein reiferer, bärtiger Mann. Anstelle eines Spiegels hält die Frau<br />
einen Kranz. Die beteiligten Parteien sind so nahe zusammengerückt, dass es aussieht, als würde sie<br />
ihm das „Geschenk“ über den Arm streifen. Auf einem Alabastron in Oxford 380 hält die Frau eine<br />
Frucht, möglicherweise einen Granatapfel in Händen. Auch das über ihre Gestik miteinander<br />
verbundene Paar auf der Nolanischen Amphora in <strong>Erlangen</strong> 381 II/25 (Taf. 8 Abb. 4) wird nur durch<br />
wenige Attribute wie den Festkranz des Jünglings näher charakterisiert. Die Schreibtafel, die an der<br />
Wand im Rücken der Sitzenden angebracht ist, ist Hinweis auf Bildung und Belesenheit. 382<br />
Auf einer Nolanischen Amphora in London 383 II/26 (Taf. 8 Abb. 5. 6) übt sich die Sitzende im<br />
Jonglieren von Bällen. Das Jonglieren mit Obst, Bällen oder Wollknäueln wird im 5. Jh. v. Chr. ein<br />
bei Frauen beliebtes Spiel. 384 Die Figuren sind hier einzeln auf Vorder- und Rückseite des<br />
374 Böhr a. O. (Anm. 373) 37–39. 41 f.<br />
375 Lewis 2002, 165.<br />
376 E. Bevan, Representations of Animals in Sanctuaries of Artemis and other Olympian Deities (Oxford 1986) 33. 55; Killet<br />
1994, 122 mit weiterer Lit.<br />
377 Böhr a. O. (Anm. 373) 47.<br />
378 Basel, Antikenmus. und Sammlung Ludwig BS 490: Die Außenseiten bevölkern Männer und Frauen mit Attributen wie<br />
Plemochoe, Pyxis, Kanne und Spendeschale.<br />
379 Basel, Cahn AG (ohne Inv.).<br />
380 Alabastron Euergides-Malers, Oxford, Ashmolean Mus. 1916.6: CVA Oxford (1) III I 32 Taf. 41, 3. 4.<br />
381 <strong>Erlangen</strong>, Antikensammlung I 303.<br />
382 Zur Schreibtafel, vgl. Schale des Douris, Berlin, Antikensammlung F 2285: CVA Berlin, Antiquarium (2) 29 f. Taf. 77,<br />
1. 2; 78, 1–4; Schale des Malers Bologna 417, New York, Metropolitan Mus. 06.1021.167: D. Harvey, Painted Ladies:<br />
Fact, Fiction and Fantasy, in: J. Christiansen – T. Melander (Hrsg.), Proceedings of the 3 rd Symposium on Ancient Greek<br />
and Related Pottery, Kopenhagen August 31 – September 4 1987 (Kopenhagen 1988) 250 Abb. 5, A. B.<br />
383 London, British Mus. E 339.<br />
384 S. Pfisterer-Haas, Mädchen und Frau im Obstgarten und beim Ballspiel. Untersuchungen zu zwei vorhochzeitlichen<br />
Motiven und zur Liebessymbolik des Apfels auf Vasen archaischer und klassischer Zeit, AM 118, 2003, bes. 168–177.<br />
Das Jonglieren steht manchmal in Zusammenhang mit der Braut. In den Händen von Männern wird die Frucht oder der<br />
S e i t e | 85
Gefäßkörpers verteilt. Auch in der Gewandung des Jünglings wählte der Vasenmaler eine Variante:<br />
der Mantel ist fest um den Körper gezurrt und bis über den Hinterkopf gezogen. Das Spiel mit Bällen<br />
ist auch auf der Schale in Boston 385 II/27 belegt. Hier wird der Verdacht, dass mit solchen<br />
Darstellungen durchaus auch Ehefrau und Ehemann gemeint sein könnten, durch den Brautschleier<br />
erhärtet. 386 Der Wollkorb wird gewissermaßen als ein seriöseres Element der spielerischen Anmut<br />
entgegengesetzt. Vielleicht soll er tatsächlich der mit dem Motiv des Jonglierens verbundenen,<br />
postulierten erotischen Wirkung 387 Einhalt gebieten und daran erinnern, dass das Leben der Ehefrau<br />
nicht nur aus amüsantem Zeitvertreib besteht. Vielleicht sind aber auch hier nur zwei Aspekte des<br />
Frauenlebens in einem Bild zusammengefasst, das heitere Spiel des Mädchens und die Wollarbeit, die<br />
auf die Pflichten der verheirateten Frau hinweist. Beides, Strebsamkeit und Spiel, erregen das Interesse<br />
des Betrachters. 388<br />
Auf der Pelike in Kopenhagen 389 II/28 (Taf. 9 Abb. 1) wurde das dargestellte Paar mit zwei eher<br />
unüblichen Gegenständen, nämlich mit Spendekanne und Phiale, ausgestattet. Sie deuten vielleicht auf<br />
ein gemeinsam vollzogenes kultisches Ritual hin. Gemeint ist wohl das gemeinschaftliche Versorgen<br />
des Kultes der Hausgötter. 390 Eine solche Handlung, die im Interesse des Oikos liegt, wird gewöhnlich<br />
von Eheleuten vollzogen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass sich diesmal der Jüngling in der<br />
sitzenden Position befindet; er hat sich auf einem exquisiten Diphros mit Löwenpranken<br />
niedergelassen.<br />
Das Paarmotiv wiederholt sich auffällig häufig in den Tondi der Kylikes. Da man in der Regel davon<br />
ausging, dass sich im Bildprogramm der vor allem im Rahmen von Symposien gebrauchten<br />
Trinkschalen das Umfeld ihrer Benutzung widerspiegle, galten die Paare bisher fast selbstverständlich<br />
als Mann mit Hetäre. 391 Befremdend ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass auf vielen dieser<br />
Darstellungen die Gewandung der Frauen, z. T. auch die der Männer, nachdrücklich als züchtig<br />
Ball zum Liebesgeschenk abgestempelt, das erste Annäherungsversuche einleitet. – Der Apfel als Liebesgeschenk Sutton<br />
1981, 320 ff.<br />
385 Boston, Mus. of Fine Arts 13.84.<br />
386 Kreilinger 2007, 40 Abb. 398.<br />
387 Zum erotischen Aspekt des Ballspiels, s. U. Mandel, Die ungleichen Spielerinnen, in: Hellenischtische Gruppen.<br />
Gedenkschrift für A. Linfert (1999) 218–222. Die Autorin verweist auch auf einschlägige Textzitate wie etwa Hom. Od.<br />
6, 99 f., wo sich Nausikaa vor der Begegnung mit Odysseus mit ihren Gefährtinnen beim Ballspiel vergnügt. – Der Ball<br />
spielende Eros, s. Anakr. 358 PMG = 302 LGS.<br />
388 Mandel a. O. (Anm. 387) 221 f.: Schwelle zwischen der körperlichen Reife und dem ersten Erwachen der Sexualität.<br />
389 Kopenhagen, Nat. Mus. VIII 810.<br />
390 Vgl. Xen. oik. 7, 8: Ischomachos und seine Frau opfern gemeinsam; V. Siurla-Theodoridou, Die Familie in der<br />
griechischen Kunst und Literatur des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. (München 1989) 386–389; S. B. Pomeroy, Women´s<br />
Identity and the Family in the Classical Polis, in: R. Hawley – B. Levick (Hrsg.), Women in Antiquity. New Assessments<br />
(London 1995) 115. – Vgl. Amphora, Boston, Mus. of Fine Arts 01.16: J. H. Oakley, The Phiale Painter (Mainz 1990) 72<br />
Nr. 36 Taf. 20, A: Der bärtige Mann wird von Oakley allerdings als König bezeichnet.<br />
391 z. B. C. Bérard, in: C. Bérard – J.-P. Vernant (Hrsg.), Die Bilderwelt der Griechen (Mainz 1985) 128; Bundrick 2008,<br />
288 f. Taf. 1 überrascht mit einer Statistik, die zeigt, dass ein hoher Prozentsatz der uns erhaltenen<br />
Textilherstellungsszenen der Spätarchaik und frühen Klassik ausgerechnet auf Kylikes zu finden ist. – Die Verwendung<br />
der Kylikes bei kultischen Frauenfesten, Funddepots und die Einrichtung von Klinenräumen in Heiligtümern z. B. der<br />
Demeter in Korinth und Bitalemi oder der Artemis Brauronia, s. Kreilinger 2007, 36–41.<br />
S e i t e | 86
charakterisiert wird. 392 Im Tondo der Schale in Berlin II/29 (Taf. 9 Abb. 2) stehen sich eine<br />
gestikulierende junge Frau und ein bekränzter Jüngling mit Bürgerstock gegenüber. Die linke Hand<br />
der weiblichen Figur ist von den Falten ihres Himation bedeckt, ein Motiv, das gewöhnlich als<br />
Ausdruck von Bescheidenheit und Zurückhaltung gewertet wird. 393 Ähnlich wie bei der Schale in<br />
Hannover II/22 wird die Deutung des Tondo von der szenischen Ausgestaltung der Schalenwände<br />
abhängig gemacht, deren paarweise Anordnung männlicher und weiblicher Figuren an den Aufbau der<br />
Werbeszenen erinnert. 394 Das Paar im Tondo ist bis auf die sittsam verhüllte Hand nicht differenziert.<br />
Dass dieser Darstellungsmodus mit Eigenschaften assoziiert wird, die für eine Hetäre gewiss nicht<br />
typisch sind, sollte genügen, um eine solche Deutung auszuschließen. Im Tondo einer Schale im<br />
Vatikan 395 II/30 (Taf. 9 Abb. 5) hat sich die weibliche Figur ein separates Stück Stoff umgelegt, das,<br />
da es sich im Nacken bauscht, über den Kopf gezogen werden kann. Indem sie einen Zipfel des Tuchs<br />
vor ihr Gesicht zieht, deutet sie entweder ihre Entschleierung, die im Zusammenhang mit der Hochzeit<br />
stehen könnte, oder aber ihre Verhüllung an, die wiederum Ausdruck von Schamgefühl und Anstand<br />
ist. Beides spricht deutlich gegen eine Hetäre. Im Tondo der Schale in Braunschweig 396 II/31 (Taf. 9<br />
Abb. 6) ist die Frau sogar von Kopf bis Fuß verhüllt. Der blockartige Ansatz am linken Bildrand<br />
könnte eventuell einen Altar meinen und einen kultisch-rituellen Hintergrund schaffen. 397 Doch auch<br />
hier schmücken die Außenseiten Darstellungen von Frauen, die von Männern flankiert sind. Auch<br />
wenn der Diaulos, der einer der Frauen als Attribut beigegeben ist, in den Symposionsbereich<br />
verweisen kann 398 , bleibt dennoch offen, ob der Tondo das Thema der restlichen Schale<br />
wiederaufgreift oder ein Konstrastprogramm zeigt. Die in ihren Mantel gewickelte Frau gemahnt eher<br />
an eine anständige Frau, auch wenn schon in der Antike Beschwerden laut wurden, dass sich die<br />
Hetären im Erscheinungsbild den Bürgerinnen zunehmend anglichen. 399 Die Schale in Florenz 400 II/32<br />
(Taf. 10 Abb. 1) zeigt wie die Schale II/31 eine im Beisein eines jungen Mannes streng verhüllte Frau.<br />
Mehr noch: sie hat sich – ebenso wie ihr Gegenüber – das Himation über den Kopf gezogen. Der<br />
durch das Mäanderband abgeschnittene Gegenstand ist für einen Diphros wohl zu massiv, vielleicht<br />
handelt es sich erneut um einen Altar. Das Geldsäckchen im Hintergrund wird nach Überzeugung<br />
vieler Archäologen und Archäologinnen eigentlich nur im Zusammenhang mit Frauen verwendet, die<br />
392 Zu aidos s. auch G. Ferrari, Figures of Speech. The Picture of aidos, Métis 5, 1990, 185–204.<br />
393 Llewellyn-Jones 2003, 98 ff.; Heinrich 2006, 92: Bescheidenheit und Zurückhaltung als Merkmal der idealen Frau – sei<br />
sie nun verheiratet oder eine Parthenos. – Das Bedecken der Hände ist auch auf der Hydria, New York II/17 zu sehen.<br />
394 Ohne Zögern hat man deshalb auch in der zentral platzierten und frontal dargestellten Figur der sitzenden Spinnerin nicht<br />
nur eine spinnende Hetäre, sondern sogar die Bordellaufseherin erkennen wollen. Die Schalenaußenseiten werden in Kap.<br />
3. 3. 1 erneut angesprochen.<br />
395 Vatikan, Mus. Gregoriano Etrusco 16581.<br />
396 Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Mus. AT.263: CVA Braunschweig 27 Taf. 18, 1–5; 19, 11.<br />
397 Solche blockartigen Altäre sind für die schwarzfigurige Vasenmalerei belegt, obwohl sie selbst hier in ihrer Einfachheit<br />
die Ausnahme darstellen. Die kursorische Strichangabe im oberen Bereich könnte vielleicht auf einen Volutenabschluss<br />
hindeuten. – Übersicht über die Typologie der Altäre, s. D. Aktseli, Altäre in der archaischen und klassischen Kunst.<br />
Untersuchungen zur Typologie und Ikonographie (Espelkamp 1996).<br />
398 G. Rodenwaldt, Spinnende Hetären AA 1931, 12: Flötenspiel wurde sowohl im häuslichen, als auch im symposiastischen<br />
Bereich geübt und ist daneben auch fester Bestandteil der musischen Knabenerziehung.<br />
399 Xen. Ath. Pol. 1, 10–12.<br />
400 Florenz, Mus. Arch. PD 266.<br />
S e i t e | 87
ihren Körper verkaufen. 401 Gewandung und Altar – falls er verifiziert werden kann – sprechen jedoch<br />
definitiv gegen eine Hetäre. Es deutet sich mit diesem Bildbeispiel bereits an, dass die Deutung des<br />
Geldbeutels revidiert und neu überdacht werden muss. Dies soll im folgenden Kapitel ausführlich<br />
geschehen. Die Darstellung gehört somit zu einer Gruppe ähnlicher Bilder, die ein Ehe- oder<br />
Liebespaar im Licht sittlicher oder religiöser Werte zeigen. Hetären sind in diesem Zusammenhang<br />
auszuschließen.<br />
S e i t e | 88<br />
2. 6. Zusammenfassung<br />
Der Wandel des antiken Frauenbildes in der historischen Forschung gab Anlass, auch in der<br />
archäologischen Nachbardisziplin die Darstellungen von Frauen und ihr Verhältnis zu den Männern<br />
nochmals genauer zu analysieren. Viele der untersuchten Bilder wurden, obwohl sie als neutral gelten<br />
müssen, in dem Sinne, dass sie keinen vordergründigen sexuellen Hintergrund erkennen lassen,<br />
aufgrund der angeblichen Unvereinbarkeit der weiblichen und männlichen bürgerlichen Sphäre 402 –<br />
von wenigen Ausnahmen abgesehen – als Hetärenbilder interpretiert. Dies führte dazu, dass wichtige<br />
Aspekte im Bild der antiken Athenerin ignoriert und umgedeutet wurden. Familienbilder und<br />
Oikosbilder beweisen aber, dass es offenbar ab der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. üblich wurde,<br />
den Hausherrn bzw. andere männliche Gestalten in die Darstellungen sog. Frauengemachsszenen mit<br />
einzubeziehen. Der Mann definierte sich fortan nicht nur über seine politische Rolle, sondern ebenso<br />
über seine Oikos-Zugehörigkeit. Das rollenkonforme Verhalten athenischer Männer erhielt auch eine<br />
sozial-familiäre Bedeutungsebene. 403 Schon J.-P. Vernant hatte die ambivalente Stellung des<br />
athenischen Mannes erkannt, der einerseits das „Politisch-Öffentliche“ repräsentiert, andererseits aber<br />
als Oberhaupt seines Oikos diesen mit der Außenwelt verbindet. 404 Die Vorstellung einer strikten,<br />
geschlechterspezifischen Trennung, wie sie in den literarischen Quellen durchaus als Ideal vertreten<br />
wird, spiegelt sich in den hier untersuchten Vasenbildern keinesfalls wider.<br />
Die Kennzeichnung der Ehefrau und Hausfrau durch Tätigkeiten und Attribute unterschiedet sich in<br />
den Szenen, in denen Männer hinzutreten, nicht von den Familienszenen oder den Oikosszenen, die<br />
nur Frauen zeigen. Es ist nach wie vor die Frau mit oder ohne Dienerin, spinnend oder sich im Spiegel<br />
betrachtend, mit Kalathos, Spindel, Salbölgefäß oder Stoffband, Kästchen oder Kranz, die uns auf<br />
401 Desweiteren in diesem Zusammenhang zu nennen die Schale des Splanchnopt-Malers, München, Antikensammlung J<br />
797: Abb. s. Beazley-Archiv, Schale des Wedding-Painter, Wien, Kunsthistorisches Mus. 2150: CVA Wien (1) 20 f. Taf.<br />
21, 1–3.<br />
402 S. Moraw, Schönheit und Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher Nacktheit und bürgerlichem Status in der attischen<br />
Vasenmalerei, JdI 118, 2003, 25.<br />
403 Bergemann 1997, 129 f.; s. auch R. E. Leader, In Death not divided: Gender, Family, and State on Classical Athenian<br />
Grave Stelae, AJA 101, 1997, 683–699; M. Meyer, Gesten der Zusammengehörigkeit und Zuwendung. Zum Sinngehalt<br />
attischer Grabreliefs in klassischer Zeit, Thetis 5/6, 1999, 115–132.<br />
404 J.-P. Vernant, Myth and Thought among the Greeks (London 1983) 133; Bergemann 1997, 129 kommt auch hinsichtlich<br />
der attischen Grabstelen zu dem Schluss, dass Oikos und Polis dort keineswegs als zwei getrennte und gegensätzliche<br />
Bereiche verstanden werden.
zahllosen Vasenbildern begegnet. Während Tätigkeiten, Attribute oder Beifiguren Auskunft über die<br />
Stellung der Frau im Hausverband, ihre Aufgaben und Pflichten geben, sagt das Hinzutreten eines<br />
Mannes, der zumindest in einigen Fällen sicher als Ehemann benannt werden kann, etwas über die<br />
Personalstruktur des Oikos und die Relation der zum Haushalt gehörenden Mitglieder aus. Dass der<br />
Mann zumeist nur als Zuschauer agiert, muss beinahe zwangsläufig der Fall sein, da er an den<br />
Organisationsabläufen des Haushaltswesens selbst keinen Anteil hat. 405 Was bedeutet seine<br />
Anwesenheit aber dann? Die Antwort auf diese Frage liefert uns vielleicht Xenophon. Dieser betont<br />
als wesentlichen Aspekt der Ehe die Arbeitsgemeinschaft, koinonia. Dieses Einstehen für ein<br />
gemeinsames Ziel und die Akzeptanz der geschlechterbedingten Rollenverteilung im Oikos scheinen<br />
die klassischen Vasenbilder zu illustrieren. Dabei mag auch der aus der Literatur bekannte Terminus<br />
philia 406 zum Tragen kommen, der die persönliche Beziehung der Eheleute zueinander beschreibt und<br />
der gleichermaßen das Fundament einer glücklichen Ehe und eines funktionierenden wirtschaftlichen<br />
Betriebs ist. Nur selten wird dagegen durch Wickel- oder Kleinkinder auch auf die<br />
Fortpflanzungsfähigkeit der Ehefrau und den Fortbestand des Oikos angespielt. Ein<br />
Familienverständnis im modernen Sinn kann also nur vereinzelt nachgewiesen werden. Der<br />
Hauptakzent liegt vielmehr auf der ehelichen Gemeinschaft und ihrer Produktivität.<br />
Neben den Oikosbildern, die durch ihr Umfeld und durch Beifiguren als solche klar zu identifizieren<br />
sind, gibt es Bilder von Paaren, die nur mit wenigen Attributen versehen sind und nicht viel mehr<br />
zeigen als die beiden Figuren selbst. Diese Darstellungen scheinen mehr auf eine repräsentative<br />
Funktion ausgerichtet zu sein, da in ihnen Aktion und Interaktion nur eine Nebenrolle spielen. Welche<br />
Art von Paaren gemeint sind, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Angesichts der Oikosszenen<br />
mit Männern und der Bedeutung ihres Auftretens kann auf jeden Fall nicht ausgeschlossen werden,<br />
dass auch hier Ehepaare abgebildet sind. Die züchtige Aufmachung vieler Frauen ist als eine bewusste<br />
Kennzeichnung zu verstehen, die ausdrücklich nach den Idealvorstellungen der sittsamen Bürgerin<br />
vorgenommen wurde. Nicht immer drehte sich das Leben der athenischen Männer um sexuelle<br />
Eroberungen. Die Ehe war im 5. Jh. v. Chr. eine wichtige staatliche Institution. Da viele der<br />
Gefäßtypen von (Ehe-) Frauen gehandhabt wurden, kann das Bildprogramm eigentlich nicht auf eine<br />
so begrenzte Zielgruppe wie Prostituierte oder Hetären ausgerichtet sein, sondern muss die<br />
bürgerlichen Frauen entweder tatsächlich direkt angesprochen haben oder so flexibel interpretierbar<br />
gewesen sein, dass diese sich problemlos mit der Bildaussage identifizieren konnten.<br />
Im Übrigen stehen die Vasenmalerei und ihre Ikonographie nicht isoliert. Die Bildsprache von<br />
Keramik und Grabkunst ist, obgleich beide einem völlig anderen Zweck dienen und auf einen anderen<br />
405 Bundrick 2008, 305: „These representations can have an iconic, tableau-like quality.“<br />
406 Just 1989, 158. – Tatsächlich unterscheidet der Grieche verschiedene Begrifflichkeiten und Nuancen zum Thema<br />
"lieben", von denen sich manche auch auf die ehelichen Beziehungen von Mann und Frau anwenden lassen; Calame<br />
1992, 17: „Con il verbo phileîn […] i Greci insistevano meno sulla componente di libido dell´ amore (che in questo caso<br />
può designare anche amore filiale o amicizia) che sul charattere fiduciario della relazione di reciprocità che s´ instaura.“;<br />
ebenda 30 f.: Paare wie Paris und Helena oder Odysseus und Penelope, für die der Terminus auch verwendet wird, haben<br />
aber natürlich darüber hinaus auch eine sexuelle Beziehung; M. Lefkowitz, Wives and Husbands, in: I. McAuslan, P.<br />
Walcot (Hrsg.), Women in Antiquity (Oxford 1996) 73 fächert auf in folgende Begriffe: eran = sexuelle Begierde;<br />
philein = Liebe für Familie und Freunde; agapan = Zuneigung.<br />
S e i t e | 89
Betrachterkreis zugeschnitten sind, doch ähnlich. 407 So wird die neuartige Wahrnehmung der Familie<br />
bzw. Oikosgemeinschaft, die sich für die Vasenmalerei konstatieren lässt, mit einer gewissen<br />
zeitlichen Verzögerung auch auf den attischen Grabdenkmälern sichtbar. 408 Während nach<br />
Wiedereinsetzen der Grabdenkmäler in Athen um ca. 430 v. Chr. zunächst die bescheideneren<br />
Zweiergruppen bevorzugt werden, findet in den mehrfigurigen und häufig vollplastischen Grabreliefs<br />
des fortgeschrittenen 4. Jhs. v. Chr. die Familie mitsamt dem Hausherrn Platz 409 . Die<br />
Selbstverständlichkeit, mit der durch das Nebeneinander von Familie, Ehepaaren oder Verwandten<br />
Zusammengehörigkeit demonstriert wurde, macht es kaum nachvollziehbar, weshalb man sich so<br />
schwer tat, den Mann in den Familien- oder Oikosbildern der Vasen als Familienangehörigen<br />
anzusehen.<br />
Das Grabrelief der Theano 410 ist mit der Darstellung auf der Amphora in <strong>Erlangen</strong> II/25 (Taf. 8 Abb.<br />
4) vergleichbar. Beide Male sind eine sitzende Frau und ein stehender Mann das Thema. Laut R.<br />
Lindner ist die sitzende Theano nach dem Vorbild der würdigen „Hausherrin und Familienmutter“<br />
gestaltet, während der ordentlich gefältelte Mantel und der unter die Achsel geklemmte Bürgerstock<br />
den „politisch-aktiven Vollbürger“ kennzeichnen. 411 Der Gestus Theanos, mit der sie ihr Himation mit<br />
spitzen Fingern vor das Gesicht zieht, kann sowohl auf ihre Wohlerzogenheit und ihre Zurückhaltung,<br />
als auch auf die Entschleierung der Braut Bezug nehmen. 412 Da dieser Gestus jedoch auch auf<br />
Grabreliefs ausgeführt wird, auf denen nur weibliche Personen begegnen 413 , muss er nicht zwangläufig<br />
als Hinweis auf ein Ehepaar verstanden werden. In welcher Beziehung die beiden Personen auf dem<br />
Grabrelief zueinander stehen, kann ebenso wenig wie für die Amphora in <strong>Erlangen</strong> mit Sicherheit<br />
festgestellt werden. Dem kurzen und sorgfältig getrimmten Bart des Mannes auf dem Grabrelief steht<br />
407 S. Houby-Nielsen, Grave Gifts, Women, and Conventional Values of the Hellenistic Greeks, in: P. Bilde et al. (Hrsg.),<br />
Conventional Values oft he Hellenistic Greeks (Aahus 1997) 225: “Time and again certain gender roles are stressed: for<br />
instance the good, the brave, the wise oikos-man and the dutiful, child-bearing wife.” Bergemann 1997, 92: “Es ging in<br />
den Reliefs also nicht allein um die Darstellung einer introvertierten, emotionalen Verbindung zwischen den<br />
Angehörigen der Oikoi, sonder sie boten sich zugleich mit ihren idealen Eigenschaften und Verhaltensweisen der<br />
Öffentlichkeit dar.” A. Strömberg, Private in life – Public in Death: The Presence of Women on Attic Classical Funerary<br />
Monuments, in: L. Larsson Lovén – A. Strömberg (Hrsg.), Gender, Cult, and Culture in the Ancient World from<br />
Mycenae to Byzantium. Proceedings of the Second Nordic Symposium on Gender and Women´s History in Antiquity,<br />
Helsinki 20.–22.10.2000 (Sävedalen 2003) 35: “The message is that husband and wife are working for the same goal: the<br />
idealizing unity of the family and the success of the household and, ultimately, the confirmation of the polis.” Sojc 2005,<br />
46–49 geht gar von einer durch die Vasenmalerei, genauer die Lekythen, beeinflussten Formgebung aus.<br />
408 Humphreys 1985, 110; Strömberg a. O. (Anm. 407) 28–37.<br />
409 B. Schmaltz, Griechische Grabreliefs ²(Darmstadt 1993) 214 f. 219; Bergemann 1997, 86–88. 91–93; S. Moraw,<br />
Schönheit und Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher Nacktheit und bürgerlichem Status in der attischen<br />
Vasenmalerei, JdI 118, 2003, 40. – Als beliebiges Beispiel der Grabkunst: Grabstele der Eukoline, Athen, Kerameikos<br />
Mus. 8754/P 388: CAT 4.420.<br />
410 Athen, Nat. Mus. 3472: CAT. 2.206.<br />
411 L. Jones Roccos, The Kanephoros and her Festival Mantle, AJA 99, 1995, 664 Abb. 24; R. Lindner, Im Tode gleich?<br />
Geschlechts- und altersspezifische Grabausstattungen im antiken Griechenland, in: E. Klinger et al. (Hrsg.), Der Körper<br />
und die Religion. Das Problem der Konstruktion von Geschlechterrollen (Würzburg 2000) 107.<br />
412 Für letzteres entscheidet sich I. Huber, Die Ikonographie der Trauer in der griechischen Kunst (Mannheim 2001) 151.<br />
413 z. B. Grabrelief der Mnesarete, München, Glyptothek 491: CAT 2.286; s. auch Sojc 2005, 73 Abb. 8; 131. Durch die<br />
Inschrift erfahren wir allerdings, dass die verstorbene Großmutter verheiratet war. Insofern mag der<br />
Verschleierungsgestus durchaus auch hier ein Statussymbol der verheirateten Frau sein.<br />
S e i t e | 90
das jugendlich und vor allem unbärtige Erscheinungsbild des Mannes auf der Amphora II/25<br />
gegenüber. Das Alter muss sich nicht grundsätzlich auf die Deutung der Person auswirken, da der<br />
Trend auf Vasen im Kontext mit Hochzeit und Ehe eher dem unbärtigen Mann zuneigt. 414<br />
414 Sutton 1981, 213 hat einen 82%-Anteil an bartlosen Männer in den Hochzeitsdarstellungen errechnet; laut Sutton 1997,<br />
39 f. geht der Trend im 4. Jh. v. Chr. zurück zu bärtigen, reiferen Männern.<br />
S e i t e | 91
S e i t e | 92<br />
3. Werben und Schenken in der Antike<br />
In den bisher untersuchten Vasenbildern kamen Attribute in den Händen der männlichen Personen,<br />
sieht man einmal vom Bürgerstock ab, nur sporadisch vor. Einer der jungen Männer auf der Pyxis in<br />
Gotha II/16 (Taf. 6 Abb. 2) hat eine Strigilis bei sich und auch der bärtige Mann auf der Schale in<br />
Hannover II/22 (Taf. 8 Abb. 1) wird durch seine Athletenutensilien charakterisiert, die zu einem<br />
Beutel verschnürt an der Wand hängen. In diesem Fall machen die Attribute also eine Aussage zur<br />
Person. Der kugelige Gegenstand auf der Pyxis II/2 (Taf. 3 Abb. 1), der versuchsweise als Granatapfel<br />
gedeutet wurde, hat dagegen keine attributive Bedeutung, sondern bezieht sich auf den Szenenkontext,<br />
indem er vermutlich den Kinderreichtum des Oikos unterstreicht. Körper- und Armhaltung des jungen<br />
Mannes auf der Pyxis in Athen II/5 (Taf. 3 Abb. 7) sprechen dafür, dass er der vor ihm sitzenden Frau<br />
ein zu ergänzendes Band oder einen Kranz überreicht. Die Darstellung wurde bedenkenlos gemeinsam<br />
mit den Oikosbildern aufgelistet, auf denen der (Ehe-) Mann innerhalb des Oikos auftritt, denn neben<br />
dem Schleier bürgt auch die Dienerin mit dem Kind auf dem Arm für den Status der abgebildeten Frau<br />
als Ehefrau. Solchen von Männern an Frauen überreichten Objekten wurde jedoch – wenn überhaupt –<br />
nur noch untergeordneter Attributcharakter zugebilligt. Sie fungieren nach aktuellem Forschungsstand<br />
als Geschenke im Rahmen der Werbung.<br />
Darstellungen dieses Themenkomplexes werden deshalb unter dem Begriff der Werbeszenen<br />
zusammengefasst. Sie wurden bisher ebenso wenig zur Rekonstruktion des Bürgerinnenbildes<br />
herangezogen, da die Werbung als striktes Ressort der Hetären eingeschätzt, die Bürgerin als Objekt<br />
der Werbung dagegen kategorisch abgelehnt wurde. “As a general motif of official and respectable<br />
courtship, gift-giving seems unlikely, even when supervised“, urteilt R. F. Sutton. 415<br />
Eine Frage soll hier vorrangig gestellt werden: ist die Bezeichnung der Darstellung als Werbeszene in<br />
den einzelnen Fällen gerechtfertigt oder können nicht doch aus manchen Bildern Eindrücke aus dem<br />
Leben der athenischen Bürgerinnen sprechen?<br />
3. 1. Liebes- und Werbegeschenke<br />
Das Schenken zieht in der Antike stets eine Gegengabe nach sich. Dieser gegenseitige Austausch von<br />
Geschenken, der in Form von materiellen Gütern oder auch Dienstleistungen bzw. Gefallen erfolgen<br />
kann, stiftet oder verstärkt eine bereits bestehende Bindung zwischen Geber und Empfänger. 416<br />
Schenken im weitesten Sinn ist in der Antike in vielen Kontexten üblich. Objekte werden den Toten<br />
mit ins Grab gegeben, den Göttern geweiht, dem Hochzeitspaar oder dem Gastfreund überreicht. 417 S.<br />
415 Sutton 1981, 281.<br />
416 Koch-Harnack 1983, 24 ff.; DNP 4 (1998) 984–988 s. v. Geschenke (B. Wagner-Hasel); Davidson 1999, 132–135.<br />
417 Lewis 2002, 186.
Lewis meint deshalb zurecht: „Gifts were means of contact and persuasion between individuals, not<br />
always erotically charged.“ 418<br />
Die Funktion des Geschenks als Instrument der Werbung um Knaben oder Hetären spielt in der<br />
antiken Literatur und den archäologischen Bildquellen der Archaik und Klassik eine wichtige Rolle.<br />
Die Kunst des Umwerbens wird von Sokrates in Xenophons „Memorabilia“ in all ihren Facetten und<br />
Ambivalenzen entlarvt. 419 Theodote, eine erfolgreiche Hetäre und Zeitgenossin des Sokrates,<br />
finanziert ihren aufwendigen Lebensstil durch die großzügigen Geschenke ihrer vielen Verehrer. Sie<br />
selbst umschreibt das Arbeitsverhältnis von Hetäre und Kunde in den Termini des Gabenaustausches,<br />
aufs Äußerste bemüht, den Eindruck einer bezahlten Dienstleistung gar nicht erst entstehen zu<br />
lassen 420 :<br />
„Wenn jemand, der mein Freund geworden ist, mir etwas zukommen lassen will, davon<br />
lebe ich.“ (Xen. mem. 3, 11, 4)<br />
Es ist das soziale Gebaren, das die Hetären letztlich von den gemeinen Pornai absetzt. Sie zeichnen<br />
sich dadurch aus, dass sie ihre Liebhaber anhand des Wertes ihrer Geschenke und ihrer finanziellen<br />
Potenz gegeneinander abwägen können:<br />
„Die Dirnen aus Korinth – wenn sich an sie<br />
Ein armer Schlucker macht – für diesen sind<br />
Sie taub: doch wenn ein Reicher kommt, da schwänzeln<br />
Sie mit dem Hintern gleich um ihn herum.“ (Aristoph. Plut. 149–152)<br />
Auch dem Werben um einen schönen Jüngling kann ein Geschenk zum rechten Zeitpunkt zuträglich<br />
sein 421 :<br />
„Manch reizenden Knaben, der kalt sich verschloss, hat nah an der Grenze der Jugend<br />
Durch unsre Gewalt der verliebte Freund noch gewonnen durch Vögelpräsente:<br />
Durch ein Perlhuhn oder ein Gänschen wohl auch, durch Wachteln und persische Vögel!“<br />
(Aristoph. Av. 705–707)<br />
Die Differenzierung von Geschenk und Bezahlung war bisweilen fließend. 422 Wer als freier Mann in<br />
den Ruf kam, sich gegen Bezahlung zu prostituieren, drohte seine Bürgerrechte zu verlieren. In der<br />
Anklagerede des Aischines gegen Timarchos wird dem Angeklagten neben Verschwendung und<br />
Korruption Unzucht angelastet, ein Vorwurf, der für einen erwachsenen Bürger, wie das noch aus<br />
solonischer Zeit stammende Gesetz zeigt, die Aberkennung seines Bürgerrechts zur Folge hatte. 423<br />
418 Lewis 2002, 187.<br />
419 Xen. mem. 3, 11, 1 ff.<br />
420 s. auch Davidson 1999, 143 f. 148; Hartmann 2002, 172 f.<br />
421 z. B. Reinsberg 1993, 180: Geschenke dienten offenbar nicht nur dazu, den Favoriten für sich zu gewinnen, sondern<br />
unterstützten auch die Fortführung der Beziehung.<br />
422 Reinsberg 1993, 182; Bezugnahme auf die folgende Aristophanes-Stelle, s. Davidson 1999, 132–13.<br />
423 Aischin. Tim. 10: „Wenn ein Athener sich zur Unzucht brauchen lässt, so soll ihm nicht gestattet sein, unter die neun<br />
Archonten zu treten, noch ein Priesteramt zu bekleiden, noch vor dem Volke als Anwalt aufzutreten, noch irgend eine<br />
S e i t e | 93
Aristophanes prangert auf gewohnt scharfsinnige Art die verlogene Moral mancher gieriger Knaben<br />
an, die, um nicht in Verruf zu geraten, sich ihre Gunst anstelle mit Geld in Form von Reitpferden oder<br />
Jagdhunden begleichen lassen:<br />
S e i t e | 94<br />
Karion: Die Buben, hör´ ich, machen´s ebenso<br />
Dem Liebsten nicht, oh, nur dem Geld zuliebe!<br />
Chremylos: Die Bessern nicht! Das tun nur Hurenbübchen!<br />
Karion: Was denn?<br />
Ein rechter Knabe nimmt kein Geld!<br />
Chremylos: Ein schönes Reitpferd, eine Koppel Hunde –<br />
Karion: Bar Geld zu fordern schämen sie sich, ja,<br />
Das Schändliche verdeckt ein schöner Name! (Aristoph. Plut. 153–159)<br />
Auch Xenophon verurteilt den Knaben oder Jüngling, der aus Gründen der Habgier in eine sexuelle<br />
Beziehung mit einem erwachsenen Mann einwilligt und so alle Ideale einer päderastischen Erziehung<br />
zugunsten eines gefüllten Geldbeutels in den Wind schlägt 424 :<br />
„Wer seine Schönheit dem ersten besten für Geld verkauft, heißt ein Hurenkerl; wer sich<br />
aber einem Mann, den er als guten und edlen Liebhaber erkannt hat, zum Freunde macht,<br />
der gilt als ehrbar.“ (Xen. symp. I 6, 18)<br />
Doch auch in anderen Beziehungskonstellationen lässt sich die Bedeutung des Schenkens verfolgen.<br />
Die Alte in Aristophanes „Ploutos“ kann ihren jungen Geliebten nur halten, indem sie praktisch für<br />
seinen gesamten Lebensunterhalt aufkommt. Sie selbst empfindet ihre materielle Ausgleichsleistung<br />
für seine Gunst als recht und billig:<br />
„Er achtete mich ungemein!<br />
Geld, etwa zwanzig Drachmen, heischt er wohl<br />
Zu einem Mantel, acht zu neuen Schuhen,<br />
Dann sollt´ ich seinen Schwestern etwas kaufen,<br />
Ein Kleid, ein Mäntelchen für seine Mutter,<br />
Vier Scheffel Weizen auch erbat er sich –“ (Aristoph. Plut. 981–986)<br />
Nicht immer ist ausdrücklich darauf verwiesen, dass es sich bei den Empfängerinnen von Liebesgaben<br />
um Prostituierte handelt. In der Regel ist es berechtigt, die in den Komödien des Aristophanes<br />
agierenden Frauen, soweit sie nicht anders bezeichnet werden, als Bürgerinnen zu benennen:<br />
andere Stelle zu verwalten, sei es im Lande oder außer dem Lande, durch das Los, oder durch die Wahl. Er soll auch<br />
nicht zum Heroldsamte gebraucht werden, noch einen Spruch tun, noch den Opfern des Staates beiwohnen, noch bei den<br />
gemeinsamen Kränzeszügen bekränzt sein, noch innerhalb der geweihten Schranken der Volksversammlung treten<br />
dürfen.“<br />
424 So auch z. B. Plat. symp. 184a. b; S. von Reden, Exchange in Ancient Greece (London 1995) 197 f.; A. Stähli, Der<br />
Körper, das Begehren, die Bilder, in: R. von denn Hoff – S. Schmidt (Hrsg.), Konstruktionen von Wirklichkeit. Bilder im<br />
Griechenland des 5. und 4. Jhs. v. Chr. Interdisziplinäres Kolloquium vom 27.9.–1.10.1999 in Schloss Reisensburg bei<br />
Günzburg (Stuttgart 2001) 199: „Nicht der ökonomische Aspekt des Tausches von sexuellen Dienstleistungen gegen<br />
Geld war moralisch verwerflich, sondern die Tatsache, dass man dadurch die Autarkie über den eigenen Körper aufgab.“
„[…], wenn ein Buhler<br />
Ein Weib belügt, nicht gibt, was er verspricht,<br />
Wenn einen Buhler mit Präsenten lockt<br />
Ein altes Weib, wenn, reichbeschenkt, die Dirne<br />
Den Freund verrät, […]“ (Aristoph. Thesm. 343–347)<br />
Nicht nur die Hetäre Neaira bekommt von ihrem Liebhaber Schmuck geschenkt 425 , auch die<br />
respektable Ehefrau trägt auf den Vasenbildern Halsketten und Ohrringe zur Schau, die wie<br />
selbstverständlich neben schönen Gewändern zum Erscheinungsbild der gut situierten Dame gehören.<br />
Auch wenn der Sprecher in der „Lysistrate“ seiner Überzeugung Nachdruck verleihen möchte, dass<br />
Ehemänner ihre Frauen zu gut behandeln und sie verwöhnen und die Geschichte mit allerlei<br />
anrüchigen Zweideutigkeiten ausschmückt, mag man die Tatsache, dass ein Ehemann seiner Frau<br />
Schmuck schenkt, für wahr erachten.<br />
„Goldschmied,<br />
Am Halsband, das du meiner Frau gefertigt,<br />
Ist leider gestern abend ihr beim Tanz<br />
Die Eichel aus dem Loch gefallen!“ (Aristoph. Lys. 407–410)<br />
Es steht zwar nicht explizit geschrieben, dass es sich bei der Halskette um ein Geschenk des<br />
Ehemannes handelt, wenn wir uns aber all die modischen Extravaganzen vor Augen führen, die<br />
Kalonike in der „Lysistrate“ aufzählt, dann können diese eigentlich nur vom Ehemann finanziert<br />
werden. 426 In der Ehe ist die Grenze zwischen Mitgift, Geschenk und Unterhalt offenbar nicht immer<br />
leicht zu ziehen.<br />
Eine Sache für sich sind wohl die Hochzeitsgeschenke, die dem Brautpaar an den Epaulia überreicht<br />
werden. Obwohl in den Schriftquellen hin und wieder auch von persönlichen Geschenken unter den<br />
Brautleuten die Rede ist 427 , widmen sich die Vasenbilder ausschließlich den Epaulia. Prozessionen,<br />
die sich stets nur aus Frauen zusammensetzen, bringen Objekte wie Kästchen, Boxen, Bänder und<br />
Gefäße.<br />
Wird eine Ehe einvernehmlich geschieden oder durch den Tod des Ehepartners vorzeitig beendet,<br />
kann eine Frau paradoxerweise auch zu diesem Anlass Geschenke erhalten, die in den Gerichtsreden<br />
nicht selten in einem Atemzug mit ihrer Mitgift genannt, jedoch klar von ihr unterschieden werden.<br />
Zumeist handelt es sich um Schmuck, Haushaltsgüter oder sogar Sklaven. 428<br />
425 Demosth. or. 59, 35.<br />
426 z. B. Aristoph. Lys. 43–45. – Hinweise auf die teure Ausstattung der Ehefrauen findet sich auch im sepulkralen Bereich,<br />
s. CAT. 1.417: Im Grabepigramm des Mannes an seine verstorbene Frau wird bedauert, dass der Hinterbliebene nun<br />
fortan anstelle seiner Frau nur noch ihren Grabstein schmücken darf.<br />
427 Sinos – Oakley 1993, 37. 39; E. D. Reeder, Frauenbilder. Die Hochzeit, in: Reeder 1995, 128 Anm. 13: chlanis; DNP 4<br />
(1998) 987–988 s. v. Geschenke (B. Wagner-Hasel); Bundrick 2008, 321 Anm. 147. – Bildbeispiel: Lekanis, St.<br />
Petersburg, Ermitage Mus. St 1791/LE 89, s. Winkler 1999, 11. 52.<br />
428 Is. 2, 9; Lys. 32, 6; Harrison 1968, 47.<br />
S e i t e | 95
3. 2. Die Werbeszenen auf den attisch-rotfigurigen Vasen und ihre Ikonographie<br />
Als Vorläufer der rotfigurigen heterosexuellen Werbeszenen gelten die Darstellungen der<br />
Knabenliebe, die in der schwarzfigurigen Malerei erstmals bereits um die Mitte des 6. Jhs. v. Chr.<br />
auftauchen. 429 Während dort die Tiergeschenke die verbreitetste Form der Werbung sind 430 , sind die<br />
Gaben im heterogeschlechtlichen Bereich weiter gestreut. Bereits R. F. Sutton hat eine Klassifizierung<br />
der Geschenke vorgenommen, indem er sie nach ihrem materiellen bzw. persönlichen Wert<br />
analysierte. Zu den Geschenken mit materiellem Wert zählen vor allem Geld, Fleischstücke oder<br />
Schmuck, wohingegen Kränze, Bänder, Früchte und Blüten Gaben persönlicher Natur mit abstraktem<br />
Wert sind. 431 Zwar wurde die Vermutung geäußert, die Wahl des Geschenks gebe Aufschluss über die<br />
Art der zu knüpfenden Beziehung, letztendlich werden Geschenkübergabeszenen ungeachtet der<br />
speziellen Gabe als Werbeszenen dennoch meist im Prostituiertenmilieu angesiedelt. 432<br />
Zunächst sollte man sich bewusst machen, dass unter dem Begriff „Werbeszene“ allerlei<br />
Darstellungen unterschiedlichen Inhaltes subsumiert werden. Sie umfassen Szenen des Gesprächs, der<br />
Geschenkübergabe ebenso wie des erotischen Kennenlernens, niemals aber – zumindest was die<br />
zwischengeschlechtliche Werbung anbelangt – eine Wiedergabe des Geschlechtsverkehrs. Die<br />
Interpretation als Werbeszenen beruht auf den vielfigurigen Darstellungen, die sich vor allem auf den<br />
Außenseiten der Trinkschalen befinden. Dort finden wir eine Gesamtschau der verschiedenen Stufen<br />
des Werbeprozesses, die nach R. F. Sutton den Verlauf der Verhandlungen mit den Prostituierten<br />
charakterisieren. 433 Während manche Paare sich nur anblicken oder miteinander in ein Gespräch<br />
vertieft sind, das der Überredung oder dem Regeln der Konditionen dient, sind andere schon bei der<br />
Werbung mit Geschenken angelangt oder ernten gar die Früchte ihrer Bemühung, umarmen und<br />
küssen das Objekt ihrer Begierde.<br />
Die Paare der vielfigurigen Werbeszenen folgen meist homogenen Schemata; sie variieren lediglich in<br />
der Wahl der Geschenke, in Gestik und Reaktion der umworbenen Frauen. Hinweise auf den Ort des<br />
Geschehens geben bestenfalls Sitzmöbel wie der Diphros oder der Klismos, die auf einen Innenraum<br />
hindeuten. Attribute wie Spiegel, Alabastra, Bänder oder Sandalen schmücken die Wände, wie es im<br />
Allgemeinen auch in den Oikosszenen üblich ist. 434 Ein Schalenbild in Toledo III/1 vereint viele<br />
429 H. A. Shapiro, Courtship Scenes in Attic Vase-Painting, AJA 85, 1981, 133–143; Koch-Harnack 1983; Reinsberg 1993,<br />
163–215. – Zur ikonographischen Entwicklung dieses Sujets in der schwarz- und rotfigurigen Vasenmalerei, s. Stähli a.<br />
O. (Anm. 424) 203 ff.; Meyer 1988, 119 f.; Hartmann 2002, 174 plädiert für ein gleichzeitiges Auftreten homo- und<br />
heterosexueller Werbeszenen um die Mitte des 6. Jhs. v. Chr.<br />
430 Daneben Kränze, Zweige, Bälle, Strigiles, Alabastra, Schreibtafeln, Leiern, Tiere v. a. Hahn, Hase, Fleisch, Geld, s. z. B.<br />
Koch-Harnack 1983, 154–161; Reinsberg 1993, 174–178.<br />
431 Sutton 1981, 289 f.; Killet 1994, 163 trifft eine Unterteilung in vier Gruppen: Wertgegenstände, Tiere,<br />
Gebrauchsgegenstände und Objekte ohne materiellen Wert.<br />
432 Bedenken hat z. B. Lewis 2002, 193: “But to define a few images as “official and respectable courtship” while reading<br />
the rest as seduction is unfounded when there are in fact no indications of status or relationship beyond the act of gift-<br />
giving itself.”<br />
433 Sutton 1981, 52 f.<br />
434 Peschel 1987, 42: Alabastra sind zwar in größerer Anzahl in den Oikosszenen vertreten, aber auch beim Gelage legte man<br />
Wert auf Parfümierung.<br />
S e i t e | 96
Merkmale einer Werbeszene in sich. In Flöte, Kranz und Geldbeutel begegnen einzelne Bildmotive,<br />
wie sie für die Werbeszenen typisch sind. Sowohl ein Jüngling als auch ein Mann umwerben<br />
weibliche Personen mit Geld (Taf. 10 Abb. 2) In beiden Fällen ist der Geldbeutel derart betont<br />
hervorgestreckt, dass er für die Interaktion der Paare in irgendeiner Weise von Belang sein muss. Die<br />
Reaktion beider Frauen ist jedoch nicht einfach einzuschätzen. Die sitzende Figur hat den Blick<br />
abgewandt und betrachtet abwesend die Blüte in ihrer Hand. Die Bandbreite der Reaktionen auf ein<br />
Geschenk reicht von einem Ausstrecken der Hand, über ein augenscheinliches Ignorieren bis hin zum<br />
sich Abwenden. Spekulationen darüber, ob die Frau hier sich nun ziere, um ihren Verehrer zu reizen,<br />
ob sie ihn tatsächlich verschmähe und das Geschenk als minderwertig erachte, sind müßig. Ihre rechte<br />
Hand ist zwar dem Jüngling entgegengestreckt, jedoch mit dem Handrücken nach oben, so dass kaum<br />
ein Greifen nach dem Geldbeutel intendiert ist. Vielmehr hält sie einen inzwischen verblassten<br />
Gegenstand in der ausgestreckten Rechten. Auch die Gestik der stehenden Frau vermittelt eher den<br />
Eindruck einer regen Unterhaltung. Die Gegenseite teilen sich zwei Paare, von denen eines eine<br />
sitzende Frau zeigt, die einem Bärtigen einen Kranz überreicht (Taf. 10 Abb 3). 435 Der Farbauftrag des<br />
Kranzes ist verblasst, die Handhaltung der Frau ist jedoch ein ausreichendes Indiz. Man hat<br />
ansatzweise versucht, die Geste des Mannes – eine erhobene Hand mit gespreizten Fingern – als eine<br />
Vereinbarung des zu zahlenden Preises zu deuten. 436 Ähnlich verhält es sich mit der Gestik der Frau<br />
am linken Rand, die Daumen, Mittelfinger und Zeigefinger aneinander reibt, wie um anzuzeigen, dass<br />
ohne Bezahlung keine Übereinkunft möglich ist. Bei genauem Hinsehen halten jedoch auch diese<br />
beiden eine Blüte zwischen ihren Fingern. E. Keuls will hier zwei qualitativ unterschiedliche Arten<br />
des Werbens erkennen: Männer mit Geld haben von Natur aus mehr Aussicht auf Erfolg, während die<br />
Männer ohne oder mit nur minderwertigen Geschenken all ihre Überredungskünste aufbieten müssen,<br />
um eine Zusage der Hetäre zu erhalten. 437 Das Thema des Tondo, eine Frau mit einem Kanoun vor<br />
einem entzündeten Altar, wurde als Kontrastprogramm aufgefasst, das die Spaßwelt des Symposions<br />
mitsamt seiner Hetären der sittlich-religiösen Lebenswelt der Bürgerin pointiert gegenüberstellt. 438<br />
Obwohl es an alternativen Vorschlägen zur Deutung solcher Szenen mangelt, bleibt ein Stück Zweifel<br />
bestehen, nicht zuletzt weil diese Interpretation z. T. erhebliche Widersprüche birgt und oftmals auf<br />
subjektiven Eindrücken fußt. Es soll im Folgenden jedoch nur am Rande um Darstellungen wie auf der<br />
Schale in Toledo gehen. Interessant sind im Rahmen dieser Untersuchung in erster Linie Bilder, die<br />
sich von den gezeigten Oikosbildern nur durch die Beifügung oder Übergabe von Gegenständen meist<br />
attributiven Charakters unterscheiden.<br />
435 Reeder 1995, 185 f. sieht im Kranz ein Geschenk des Bewerbers, das die Hetäre freudig in Empfang genommen hat.<br />
436 Reeder 1995, 342 f.; S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v.<br />
Chr. (Berlin 2005) 250 im Bezug auf eine Schale des Douris, London, British Mus. E 51/1843.11-3.94: CVA London,<br />
British Museum (9) 41 f. Taf. 37, A. B; 38, A. B.<br />
437 Keuls 1985, 167 f.<br />
438 M. Beard, Adopting an Approach II, in T. Rasmussen – N. Spivey (Hrsg.), Looking at Greek Vases (Cambridge 1991)<br />
28–30; S. von Reden, Exchange in Ancient Greece (London 1995) 208.<br />
S e i t e | 97
S e i t e | 98<br />
3. 3. Werbe- oder Oikosszenen?<br />
3. 3. 1. Kränze, Bänder, Kästchen und Co.<br />
Zunächst ist die Inhomogenität der als Geschenke bezeichneten Objekte verwunderlich. Kränze,<br />
Bänder oder Blüten werden mit dem Geldbeutel auf eine Stufe gestellt. Das subtile und<br />
unaufdringliche Umwerben mit Geschenken wie Kränzen und Blüten, die der Schönheit der Frau<br />
schmeicheln und ihre Aufmerksamkeit erregen wollen, stünde unserer Vorstellung von Werbung gar<br />
nicht so fern. Ob eine Interpretation dieses Aktes als Werbung und somit des jeweiligen Gegenstandes<br />
als Geschenk gerechtfertigt ist, muss sich allerdings erst noch erweisen. Der Mann im Oikosumfeld<br />
allein genügt jedenfalls nicht mehr, um der „umworbenen“ Frau den Status einer Bürgerin<br />
abzusprechen. Als Mitglied des Oikos konnte er in vielen Beispielen plausibel gemacht werden, auch<br />
wenn in einigen Fällen seine soziale Einordnung als Ehemann, Sohn etc. offen bleiben muss. 439<br />
Einen Beleg dafür, dass nicht nur Hetären mit Geschenken bedacht werden, liefert eine Darstellung<br />
auf einem Alabastron in Paris III/2 (Taf. 10 Abb. 4. 5). Die junge, ihre ganze Aufmerksamkeit auf den<br />
Kranz in ihren Händen richtende Frau ist der Inschrift zufolge: he nymphe kale. Timodemos, ihr<br />
Ehemann, der ebenfalls inschriftlich benannt ist, überreicht ihr ein gemustertes Band. Das Schenken,<br />
wenn es fürwahr so aufgefasst werden darf, ist also auch als Ausdruck innerfamiliärer Bindungen<br />
möglich. Vielleicht steht es im Zusammenhang mit dem Geschenk des Bräutigams an seine Braut.<br />
Wieso aber ausgerechnet ein Stoffband? 440 Von der Inschrift abgesehen gibt das Bild selbst keinerlei<br />
Hinweis auf die Hochzeit. Möglicherweise handelt es sich einfach um ein weibliches Kleidungs- oder<br />
Frisuraccessoire, das der hilfreiche Gatte seiner Frau reicht.<br />
Im gleichen Kontext ist eine Loutrophoros aus Würzburg III/3 (Taf. 10 Abb. 6) zu betrachten. Die<br />
spezifische Gefäßform 441 , benutzt um das Hochzeitswasser zu transportieren und wohl zumeist als<br />
Hochzeitsgeschenk in den Besitz des Brautpaares gelangt, lässt vermuten, dass auch der Dekor im<br />
hochzeitlichen Umfeld einzuordnen ist. Im Bild reicht der Bräutigam der jungen vor der Kline<br />
wartenden Braut ein großes Kästchen. Ob es sich tatsächlich um eine Geschenkübergabe handelt, oder<br />
ob das Kästchen stellvertretend für die Gesamtheit der Hochzeitspräsente steht, oder ob es nur generell<br />
wie etwa in den Toilettenszenen um das Schmücken und die Schönheit der Frau geht bzw. in diesem<br />
Kontext um das Ablegen von Schmuck als Vorbereitung auf die Hochzeitsnacht, bleibt offen. Mit dem<br />
Begriff des „Geschenkes“ muss man also auch hier vorsichtig umgehen.<br />
Nach geltender Definition wird auch die Darstellung auf einer weißgrundigen Lekythos in Berlin III/4<br />
(Taf. 11 Abb. 1) zunächst als Werbeszene kategorisiert. Dort treffen ein bärtiger, auf seinen<br />
Bürgerstock gestützter Mann und eine sitzende Frau im häuslichen Ambiente aufeinander. Sie<br />
präsentiert in exponierter Manier einen Kranz. Die Frau auf dem Berliner Exemplar ist ferner durch<br />
einen Wollkorb, ein Alabastron 442 , einen Spiegel und einen Vogel charakterisiert, Symbole, die wohl<br />
439 s. Kap. 2. 5. 3.<br />
440 Sutton 1997, 31 hält sowohl den Kranz als auch das Band („scarf of nuptial type“) für eine hochzeitliche Ausstattung.<br />
441 Winkler 1999, 104–109; Mösch-Klingele 2006.<br />
442 Das Alabastron als Behältnis von Duftölen und seine Benutzung bei der Körperpflege zur Steigerung des Wohlbefindens<br />
und der Attraktivität, s. allg. E. Paszthory, Salben, Schminken und Parfüme im Altertum, Sondernummer AW 21, 1990,<br />
bes. 37–51.
auf ihre häuslichen Tugenden und ihre körperlichen Vorzüge abzielen und in den Oikosszenen in<br />
großer Anzahl Verwendung finden. Der Vogel wird von A. Kauffmann-Samaras als Rebhuhn erkannt,<br />
das Assoziationen an die Schönheit und erotische Ausstrahlung wecken soll. 443 Nichts spricht dagegen,<br />
dieses Paar als Ehepaar zu interpretieren.<br />
Eine vergleichbare Komposition findet sich auch auf einem Gefäß in Cambridge III/5 (Taf. 11 Abb.<br />
2). Eine Frau, die hier wiederum durch den Kalathos charakterisiert ist, präsentiert einem bärtigen<br />
Mann einen Kranz. Anders als auf der Lekythos in Berlin III/4 tritt dieser nun in Interaktion. Er hat<br />
sich vorgebeugt und scheint auch seinerseits in der erhobenen rechten Hand einen Gegenstand<br />
vorzuzeigen. Die nach oben gerichteten, aneinander gelegten Finger mögen eine Blüte halten oder<br />
aber ihn als Sprechenden kenntlich machen. Sowohl auf der Lekythos in Berlin III/4 als auch auf dem<br />
Gefäß in Cambridge III/5 erscheint der Kalathos als Attribut der sitzenden Frau. Das Kränzeflechten<br />
scheint wie die Textilherstellung zu den produktiven und kreativen Fähigkeiten der Frauen zu<br />
gehören. 444 Kränze sind in fast allen Bereichen des griechischen Lebens anzutreffen: im Götterkult, im<br />
Grabkult, beim Symposion, bei der Hochzeit und im Sport. Daneben begegnen sie als schmückendes<br />
Attribut neben Spiegeln, Blüten oder Bändern in großer Zahl vor allem im Umkreis der<br />
Oikosszenen. 445 Seit der klassischen Zeit werden die Frauen beim Kränzeflechten abgebildet. Mit<br />
Einführung des Reichen Stils wird der Kranz zum Merkmal einer „entrückten aphrodisischen Welt“. 446<br />
Den Verkauf von Kränzen nennt Aristophanes in seinen „Thesmophoriazusen“ als Beitrag mancher<br />
Frauen zum Erhalt ihrer bedürftigen Familien. 447 Dass auf den Vasenbildern Kränze zur<br />
Unterhaltssicherung angefertigt werden, können wir eigentlich ausschließen, da die hier<br />
repräsentierten Frauen sicherlich einer höheren Schicht angehören. In den „Thesmophoriazusen“ des<br />
Aristophanes berichtet Mikka vor der Frauenversammlung von den durch Euripides geschürten<br />
Unterstellungen der Ehemänner:<br />
„Flicht ein Weib auch nur<br />
Ein Kränzchen, heißt´s: Die ist verliebt!“ (Aristoph. Thesm. 400–401)<br />
Mag sein, dass er in dieser Bedeutung, als „schmückende Auszeichnung des Geliebten“ 448 , auch in den<br />
sog. Werbeszenen verstanden werden will. Als selbst gefertigte und daher persönliche Gabe ist er von<br />
Seiten der Frau ein Zeichen der Hinwendung, vielleicht sogar Wertschätzung. Mit einem<br />
unmoralischen Angebot hat das aber nichts zu tun.<br />
Auf einem Alabastron in Paris III/6 (Taf. 11 Abb. 3) werden ebenfalls symbolbehaftete Geschenke<br />
ausgetauscht: der Jüngling reicht einer Frau in Chiton und Himation einen Kranz, sie streckt ihm auf<br />
ihrer Handfläche einen Granatapfel entgegen. Jungfernkranich und Hund dürfen als<br />
443 A. Kauffmann-Samaras, Des femmes et des oiseaux. La perdrix dans le gynécée, in: B. Schmaltz – M. Söldner (Hrsg.),<br />
Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom 24.–28.9.2001<br />
(Münster 2003) 91. Das Rebhuhn ist daher auch in vielen hochzeitlichen Szenen präsent.<br />
444 M. Blech Studien zum Kranz bei den Griechen (Berlin 1982) 345 f.<br />
445 Blech a. O. (Anm. 444) 337 f.; Heinrich 2006, 83: der Kranz als Gegenstand weiblicher Lebenswelt.<br />
446 Blech a. O. (Anm. 444) 344.<br />
447 Aristoph. Thesm. 443–458.<br />
448 Hdt. 6, 69; Blech a. O. (Anm. 444) 336.<br />
S e i t e | 99
geschlechtsspezifische Haustiere verstanden werden. Dass sie darüber hinaus Assoziationen an<br />
abstrakte Werte hervorrufen, ist gut möglich. So hat man versucht, den Jungfern- oder<br />
Nymphenkranich mit Hochzeit und Treue oder als Vogel der Demeter mit der Fruchtbarkeit zu<br />
verknüpfen 449 , während der Hund seit archaischer Zeit als treuer Begleiter seines Herrn und<br />
aristokratisches Statussymbol gilt. 450 Letztlich ist es wohl auch hier nicht angeraten, die Szene narrativ<br />
zu verstehen. Der Kranz ist entweder ein Zeichen der Wertschätzung, wie dies oben bereits konstatiert<br />
wurde, oder wird als tatsächlicher Schmuck für eine bestimmte Festivität überreicht. Der Granatapfel<br />
dagegen ist ein gebräuchliches Fruchtbarkeitssymbol, das vortrefflich in das Konzept der antiken<br />
athenischen Ehe passt. Interpretationen, die aufgrund des Zusammentreffens von Mann und Frau von<br />
Verhandlungen zwischen einer Hetäre und einem Freier sprechen, lassen all diese bedeutungsvollen<br />
Details außer Acht: Granatapfel und Kranz werden zu Liebesgeschenken zwischen Hetäre und Freier,<br />
der Kranich wird zur Reminiszenz an Häuslichkeit und Ehrbarkeit, die Hetären in ihrem Etablissement<br />
ihren Kunden vorzugaukeln pflegen. 451<br />
Sobald sich eine weibliche Person in Begleitung von mehr als einer männlichen Person befindet, fällt<br />
ihr, wie schon verschiedentlich angemerkt wurde, unweigerlich die Rolle des Begierdeobjekts zu. Auf<br />
einer Reihe von Schalen und Epinetra wird eine Frau von zwei Jünglingen flankiert. Über die Art der<br />
Attribute wird dabei gewöhnlich hinweggesehen. Auf einer Schale in Berkeley III/7 hält die angeblich<br />
bedrängte Frau ein riesiges Alabastron in die Höhe. Es ist auch hier unwahrscheinlich, dass die Frau<br />
das Alabastron als Liebesgeschenk erhalten hat, denn beide Jünglinge lehnen sich auf ihren<br />
Bürgerstock, den Arm in die Hüfte gestützt. Wiederum wäre also eine weibliche Person die Trägerin<br />
bzw. die Schenkende (Taf. 11 Abb. 4). Letztlich ist es jedoch abzulehnen, die Frau als Schenkende zu<br />
interpretieren. Zwar präsentiert sie das Ölgefäß auf ihrer prominent ausgestreckten Hand dem Jüngling<br />
zu ihrer Linken, sie bewegt sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung von ihm fort. Die Szene der<br />
Gegenseite ist leicht abgewandelt, dieses Mal kommt es zu einer tatsächlichen Interaktion. Die<br />
weibliche Figur im Zentrum, völlig von ihrem Himation verhüllt und mit einem Spiegel in der Hand,<br />
sieht sich mit einem Jüngling konfrontiert, der ihr wohl eine Blüte entgegenhält (Taf. 11 Abb. 5). Ihre<br />
züchtige Aufmachung passt zum Bild des Tondos, in dem eine Frau am Altar eine Blüte darbringt. Die<br />
Verwirrung ist perfekt: ist dies nun eine sog. anständige und fromme Bürgerin, die mit der käuflichen<br />
Prostituierten auf der Schalenaußenseite in Kontrast gesetzt wird, oder opfert eine Hetäre die Blüte,<br />
mit der ein eifriger Verehrer zuvor um ihre Gunst geworben hat? Ein Kontrastprogramm zwischen der<br />
Lebenswelt der respektablen Frau und der Hetäre wird für einige Stücke angenommen, allen voran für<br />
die bereits erwähnte Schale in Toledo III/1 (Taf. 10 Abb. 2. 3), deren Außenwände mit den sog.<br />
449 E. Böhr, Mit Schopf an Brust und Kopf. Der Jungfernkranich, in: A. J. Clark – J. Gaunt – B. Gilman (Hrsg.), Essays in<br />
Honor of Dietrich von Bothmer (Amsterdam 2002) 43 Abb. 1; 47.<br />
450 Zum Hund, s. z. B. C. Schneider, Herr und Hund auf archaischen Grabstelen, JdI 115, 2000, 17. 24. 31 f. 36; M. Giebel,<br />
Tiere in der Antike (Darmstadt 2003) 120–123.<br />
451 Böhr a. O. (Anm. 449) 43. Die symbolische Bedeutung des Kranichs mag theoretisch auch für die Hetäre denkbar sein.<br />
Die Argumentationskette für das Alabastron in Paris geht aber davon aus, dass keine Frau in Anwesenheit eines Mannes<br />
etwas anderes sein kann als eine Hetäre. Sämtliche Attribute müssen sich dieser Deutung beugen. Das Ergebnis klingt<br />
sehr konstruiert.<br />
S e i t e | 100
Werbeszenen geschmückt sind, während im Tondo eine Frau mit einem Kanoun vor einem Altar<br />
Gaben weiht. 452<br />
Die Liste derartiger Darstellungen lässt sich beliebig fortsetzen. Auf einer Schale in Florenz III/8 (Taf.<br />
11 Abb. 6) ist es ein Kalathos, den die junge Frau auf ihrer ausgestreckten Hand präsentiert. Der hinter<br />
ihr stehende Jüngling hält eine Blüte für die junge Frau bereit, die einerseits sein Interesse,<br />
andererseits aber auch ihre Schönheit widerspiegelt. Hier liegt der Gedanke nahe, dass diese nicht<br />
aufgrund ihrer sexuellen Verfügbarkeit, sondern tatsächlich aufgrund ihrer häuslichen Fähigkeiten für<br />
heiratsfähige Männer attraktiv ist. Ischomachos vertritt in Xenophons „Oikonomikos“ nämlich die<br />
Ansicht, Fleiß und körperliche Anstrengung seien dem guten Aussehen förderlich. 453 Begehrenswert<br />
macht der Wollkorb die Frauen noch aus einem anderen Grund: der Wollkorb hat sich nämlich zur<br />
festen Chiffre für Tugendhaftigkeit entwickelt, und welcher Mann wünscht sich nicht eine fleißige und<br />
tugendhafte Ehefrau für seinen Oikos? Die Typologie des Semonides zeigt auf eindringliche Weise,<br />
wie brave Ehemänner mit faulen oder verschwenderischen Ehefrauen geschlagen sind. 454 Die zweite<br />
Seite zeigt eine Frau mit einer Spindel oder einem Spiegel zwischen zwei Jünglingen, der Tondo einen<br />
Symposiasten mit Kylix. Man sollte den Symposiasten keinesfalls zum Anlass nehmen, auch die<br />
Szenen der Außenseiten der Schale in den Bereich des Gelages als Ort der Werbung und sexuellen<br />
Ausschweifung zu verlagern. Der Symposiast ist durch die demonstrativ präsentierte Kylix schlicht<br />
und einfach als Gelageteilnehmer gekennzeichnet, ebenso wie die besagte Frau durch den Kalathos als<br />
fleißige Hausfrau bzw. durch den Spiegel als hübsch charakterisiert wird.<br />
Solche Szenen waren in der Realität des klassischen Athen für eine anständige Frau<br />
zugegebenermaßen nicht denkbar. Eine unverheiratete Frau bewegte sich nicht mit solcher<br />
Selbstverständlichkeit unter (fremden) Männern und potentiellen Bewerbern. Doch als wörtliches Zitat<br />
muss man die Vasenbilder auch gar nicht verstehen. Das Schalenbild in Florenz III/8 stellt lobend<br />
Eigenschaften und Tugenden einer jungen Frau in den Vordergrund, die sie für eine Reihe von<br />
potentiellen Brautwerbern unter dem Aspekt der guten und nützlichen Ehefrau begehrenswert<br />
erscheinen lassen. In ähnlicher Weise lässt sich diese Hypothese vielleicht auch auf die Schale in<br />
Berkeley III/7 übertragen: an Frauen werden züchtiges Auftreten und die Fürsorge für den Körper<br />
geschätzt, die Schönheit und Ausstrahlung in gesteigerter Form zur Geltung bringt. Ausgedrückt wird<br />
letzteres durch den Spiegel und das Alabastron. 455 Körperliche Schönheit ebenso wie Sinn für<br />
Körperpflege sind keine Merkmale, die auschließlich für Hetären gelten, sondern ebenso für die<br />
Bürgerinnen und Ehefrauen.<br />
Auf einem Epinetron in Athen III/9 (Taf. 11 Abb. 7. 8) unterhalten sich zwei gemischte Paare. Die<br />
eine Frau hat ein Stoffband, die andere ein Alabastron bei sich. Auf der Gegenseite flankieren diesmal<br />
zwei Frauen einen Jüngling. Auch hier wird ein Alabastron in die Höhe gereckt. Da solche<br />
452 CVA Toledo (1) 34. 48 Abb. 13 Taf. 53, 1. 2; 54, 1. 2; M. Beard, Adopting an Approach II, in T. Rasmussen – N. Spivey<br />
(Hrsg.), Looking at Greek Vases (Cambridge 1991) 28–30 Abb. 7. 8.<br />
453 Xen. oik. 10, 9 f.; s. auch Sojc 2005, 89 f.<br />
454 Sem. fr. 7 West.<br />
455 Keuls 1985, 120: “The principal connotation of the alabastron is dutiful conjugal sex, not the purchased variety.”<br />
Heinrich 2006, 85 f. Das Alabastron gehört zusammen mit anderen Gegenständen wie dem Spiegel, dem Kästchen oder<br />
dem Wollkorb der weiblichen Sphäre an.<br />
S e i t e | 101
zwischengeschlechtlichen Begegnungen auf den Epinetra recht häufig sind 456 und deren Ikonographie<br />
angesichts ihrer Funktion eher einem bürgerlichen Benutzerkreis zugedacht waren, sah sich C. Mercati<br />
veranlasst, eine Erklärung zu suchen, die von der althergebrachten Deutung der Hetäre und ihren<br />
Kunden abrückt. In Übereinstimmung mit F. Heinrich, die ebenfalls erst vor kurzem eine Arbeit über<br />
die Epinetra veröffentlichte, ist sie der Ansicht, die Bilder seien Ausdruck einer Idealvorstellung<br />
zwischengeschlechtlichen Umgangs und Werbung für rollenkonformes Verhaltens. 457<br />
In denselben Zusammenhang gehört die Szene einer Schale in Berlin II/29. Sie greift mit dem<br />
Kästchen und dem Alabastron Attribute auf, die, wie es sich erwiesen hat, in den seltensten Fällen<br />
tatsächlich Geschenkcharakter zu besitzen scheinen. 458 Um eine frontal thronende Frau mit Spindel<br />
und Spinnrocken gruppieren sich meist jugendliche Paare. Links von ihr übergibt bzw. nimmt eine<br />
Frau ein Alabastron entgegen, während auf der rechten Seite eine Frau mit einem Kästchen von einem<br />
Jüngling angesprochen wird (Taf. 9 Abb. 3). Auf der Gegenseite wendet sich ein bärtiger Mann mit<br />
erhobener Hand an eine davongehende Frau. Diese Geste kehrt bei der Frau hinter ihm wieder, die –<br />
einen ovalen Gegenstand in der Hand – einem Jüngling zugeordnet ist (Taf. 9 Abb. 4) Ausgangspunkt<br />
für die szenische Interpretation ist in der Regel die Figur der thronenden Spinnerin, die als Zuhälterin<br />
und Kupplerin gedeutet wird, unter deren gestrengen Augen die Freier sich ihren Hetärenmädchen<br />
nähern. 459 P. Badinou hebt zwar ebenfalls die häusliche Reminiszenz der Spinnerin hervor, die<br />
Anwesenheit der beiden Jünglinge ist für sie aber ein indiskutables Zeichen für den Hetärenstatus der<br />
Frauen. Die zwei Jünglinge auf der Hydria in New York II/17 (Taf. 6 Abb. 5; Taf. 7 Abb. 1) sind<br />
keinesfalls Freier, obwohl auch hier die Frauen mit ähnlichen Gegenständen hantieren. Dass es<br />
niemand wagte, die Darstellung der New Yorker Hydria als Szene einer Hetärenwerbung<br />
anzusprechen, ist hier vor allem auf die Anwesenheit des Eros zurückzuführen. Bei den Attributen<br />
handelt es sich in beiden Fällen um schlichte Alltagsgegenstände, die im Frauengemach<br />
allgegenwärtig sind. Auch die Anwesenheit einer Frau mit Libationsgerät auf einer der Seiten der<br />
Berliner Schale II/29 (Taf. 12 Abb. 4) ist mit einer Werbeszene im Bordell nicht zu vereinbaren. 460<br />
Ferner sind es die Frauen, die die potentiellen Geschenkartikel halten, während die Jünglinge zwar<br />
456 z. B. Epinetron des Diosphos-Malers, Leiden, Rijksmuseum van Oudheden I 1955.1.2: CVA Leiden (2) 19 f. Taf. 68, 1–<br />
5; Frg. eines schwarzfigurigen Epinetron der Golonos- oder der Sappho-Diosphos-Gruppe, Palermo, Mus. Arch.<br />
Regionale 1910: Heinrich 2006, 79. 84. 86. 92. 100 Kat. Nr. Sf. 90 Taf. 12, 4; Badinou 2003, 35 f. Nr. E 10 Taf. 6.<br />
457 Mercati 2003, 44: „Attraverso una simbologia ridotta all´essenziale, tali immagini sugli epinetra esprimono una visione<br />
ideale del confronto maschile-femminile, svincolando il soggetto da steccati contingenti eccessivamente realistici.<br />
Bellezza, amore, reciprocità nel rispetto dei ruoli tratteggiano le coordinate di un´ armonia auspicabile soprattutto nell´<br />
oikos.” Heinrich 2006, 81: “Eine real stattfindende Begegnung zwischen jungen Athenerinnen und Athenern ist<br />
sicherlich nicht gemeint, sondern vielmehr eine imaginäre Interaktion bzw. Kommunikation zwischen idealisierten<br />
jungen Männern und Frauen. Nichts weist auf einen symposiastischen bzw. sexuellen Hintergrund der Bilder hin. Ebenso<br />
wenig sind Anzeichen dafür zu erkennen, dass es sich bei den Figuren um Ehepaare oder Verwandte anderer Art handeln<br />
könnte.“ – Zu Realität und Ideologie in den Vasenbilder, s. Bazant 1981, 13–22; F. Lissarague, Frauenbilder, in: P.<br />
Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 253; Kreilinger 2007, 10. 24–26.<br />
458 Badinou 2003, 72 bewertet das Alabastron als Geschenk des jungen Mannes.<br />
459 E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and<br />
Iconography (Wisconsin 1983) 228 f.; Dierichs 1993, 87; Reinsberg 1993, 122.<br />
460 Vgl. Schale des Kalliope-Malers, Aléria T 89: A. Lezzi-Hafter, Der Eretria-Maler. Werke und Weggefährten (Mainz<br />
1988) Nr. 95 Taf. 74: Wieder sind es die Frauen, die Gegenstände in den Händen halten, ein Alabastron und einen Kranz.<br />
Die beiden Frauen mit dem Spendegerät schließen nun eine Werbung definitiv aus. Kultischer Kontext?<br />
S e i t e | 102
offenbar durch Sprache und Gestik in Kontakt treten, aber Distanz und Anstand wahren. Dies<br />
unterscheidet die Darstellung von anderen Werbeszenen, die körperliche Annäherungen und sexuelle<br />
Intentionen deutlich zeigen. 461 Die unmittelbare Aktion und Miteinbeziehung der Jünglinge in die<br />
Szene unterscheidet diese Szene aber auch vom Gros der bisher betrachteten Szenen von Männern im<br />
Oikos, wo die Männer häufig an den Rand gedrängt waren und sich mit der Rolle des Zuschauers<br />
begnügten. Im Grunde widerspricht dies aber keineswegs einer häuslichen Deutung. 462 Die zentrale<br />
Platzierung und die Frontalwiedergabe der Spinnerin ist durch ihre Funktion innerhalb des<br />
Personengefüges zu erklären; sie nimmt einen gehobenen Rang ein und führt die Aufsicht über ihre<br />
Umgebung, ihre Webtätigkeit zählt traditionell zu den prestigeträchtigsten Arbeiten im Oikos und<br />
ziemt sich für die Hausherrin. Die Aufsicht und das Delegieren sind nach Xenophon das tägliche Brot<br />
der Hausfrau. Sie sorgt dafür, dass Gegenstände ihrer Bestimmung gemäß und ordentlich verwahrt<br />
werden, so dass sie nach Bedarf zur Verfügung stehen.<br />
3. 3. 2. Fleisch<br />
Zu den wichtigsten materiellen Gaben oder Mitbringseln gehört neben dem Geld das Fleischstück, das<br />
im Bild die Form eines Fleischlappens oder Tierschenkels annehmen kann. Eine Hydria auf Rhodos<br />
III/10 (Taf. 12 Abb. 1) zeigt eine Reihe von Frauen, die emsig mit der Wollarbeit beschäftigt sind.<br />
Man befindet sich noch in einem vorbereitenden Stadium der Verarbeitung, die beiden stehenden<br />
Frauen halten große Wollknäuel in den Händen, die zu handlichen Portionen auseinandergezupft<br />
werden. 463 Die Darstellung flankiert rechts ein mit dem Rücken aus dem Bildfeld herausgewandter<br />
Jüngling, der sich auf seinen Gehstock stützt, links ein Jüngling mit einem gewaltigen Fleischstück 464 ,<br />
das die Form eines Tierschenkels mit zugehörigem Huf hat. Das Fleischstück gehört nebst dem<br />
Geldbeutel laut R. F. Sutton in die Kategorie der materiellen und kostspieligen Liebesgeschenke 465 ,<br />
mit denen in der Regel Hetären von ihren Freiern günstig gestimmt werden sollen. In diesem Fall<br />
scheint es mir jedoch auffällig, dass das Geschehen der Mittelszene, die sich aus den vier Frauen<br />
zusammensetzt, kompositorisch in sich geschlossen ist. Relativierend muss eingeräumt werden, dass<br />
die rechts sitzende Frau sich zwar zu ihren Geschlechtsgenossinnen umwendet, in den Arbeitsprozess<br />
selbst aber nicht integriert ist. Sie gehört kompositorisch eigentlich zu dem am Rande stehenden<br />
Jüngling. Dennoch lässt sich beobachten, dass die Jünglinge nicht aktiv in das Geschehen eingreifen.<br />
Ganz belanglos ist der Fleischträger sicherlich nicht, aber ich halte für abwegig, eine so eindeutige<br />
Arbeitsszene aus dem bürgerlichen Alltag in das Prostituiertenmilieu zu transferieren allein aufgrund<br />
zweier Jünglinge, für deren Anwesenheit bisher keine zufrieden stellende Deutung gefunden wurde,<br />
461 Vgl. z. B. Schale des Makron, New York, Metropolitan Mus. 12.231.1: Kunisch 1997, Taf. 97, 301.<br />
462 Badinou 2003, 72; Bundrick 2008, 298: „Why could this scene not represent young men and women of a contemporary<br />
Athenian household going about their day?“<br />
463 Mercati 2003, 24.<br />
464 Vidale 2002, 446 bezeichnet das Fleischstück irrigerweise als rötlichen Beutel; dadurch wird auch der Interpretation, der<br />
Jüngling bringe die Wolle, in einen Sack verpackt, ins Haus, die dann auf den Boden geleert und sortiert wird, die<br />
Grundlage entzogen.<br />
465 Sutton 1981, 289. 300 f.<br />
S e i t e | 103
zumal nun schon eine Menge von Vasenbildern vorgestellt wurden, die den Mann im Oikos nicht als<br />
singuläre Erscheinung in der Vasenmalerei zeigen. Das jugendliche Alter der beiden Männer ist, so<br />
weit dies ikonographisch auf dem Medium der Keramik möglich ist, betont. Fleischstücke als<br />
Opferanteile waren das Privileg aller erwachsenen athenischen Bürger, 466 das darüber hinaus die<br />
Möglichkeit zur besonderen Auszeichnung verdienter Personen bot. 467 „Im Akt des Opferns<br />
konstituiert sich jene Gemeinschaft von Menschen und Göttern, die für das Wohlergehen einer Polis<br />
unabdingbar ist“, konstatiert S. Moraw. 468 So stehen die Fleischstücke einerseits symbolisch für die<br />
Integrierung in den sozialen Apparat der Polis bzw. in eine Opfergemeinschaft und andererseits,<br />
besonders wenn das Opfer nicht von der Polis gestellt, sondern aus privaten Mitteln bezahlt wurde, für<br />
Frömmigkeit und gutes Einvernehmen mit den Göttern. 469 Der Fleischanteil war eine willkommene<br />
Ergänzung des Familienmahls, da Fleisch meist nur im Rahmen von Kultfesten erhältlich war. Es mag<br />
gelegentlich auch als Gabe an eine favorisierte Hetäre gedient haben, um ihre Gunst zu gewinnen,<br />
doch stand die Versorgung der legitimen Familie wohl im Vordergrund. Das Vasenbild stellt<br />
verschiedene Mitglieder des Oikos mit ihrem jeweiligen Beitrag zum Gemeinwohl nebeneinander: die<br />
Frauen – seien es freie Frauen oder Sklavinnen – kümmern sich um die Textilherstellung, die Männer<br />
– seien es die Ehemänner oder Söhne – bringen den Fleischanteil nach Hause und versinnbildlichen<br />
somit ihren doppelten sozialen Status als Bürger der Polis und als Vorsteher bzw. Versorger der<br />
Familie. 470<br />
Der Einwand, die Szene der Hydria III/10 spiegele großbetrieblich angelegte Wollverarbeitungs-<br />
prozesse wider, die Bestandteil des ökonomischen Lebens der Prostituierten seien, gründet sich allein<br />
auf die Anwesenheit der beiden Jünglinge und lässt sich angesichts mannigfaltiger<br />
Textilverarbeitungsprozeduren in den Oikosszenen nicht halten. Gerade weil die Textilarbeit eine<br />
wichtige Pflicht der Hausfrau darstellt, sollte man die Möglichkeit eines häuslich-familiären Milieus<br />
ernstlich in Betracht ziehen. Dies bedeutet ferner, dass eine Identifikation des Fleischschenkels als<br />
Liebesgeschenk an eine Hetäre alles andere als zwingend ist.<br />
Auf einer Kylix in Chiusi III/11 streckt eine zwischen zwei Jünglingen stehende Frau dem einen ein<br />
Fleischstück entgegen (Taf. 12 Abb. 2). Es kann schwerlich behauptet werden, die Frau habe jenes<br />
Fleischstück gerade eben aus den Händen des Jünglings erhalten, der die eine Hand am Bürgerstock,<br />
die andere unter einem Gewandbausch verborgen und in die Seite gestützt hat. Die Komposition der<br />
Gegenseite entspricht dem beschriebenen Bild mit dem einen Unterschied, dass die weibliche Figur<br />
anstelle eines Fleischstücks einen Diaulos emporhält. Dieses Musikinstrument genügt vielen<br />
Wissenschaftlern, um in ihr eine für ein Gelage angeheuerte Musikantin zu erkennen, deren Status als<br />
Hetäre nicht in Frage zu stellen ist. 471 Aufgrund der homogenen Bildgestaltung und der Anwesenheit<br />
466 J. Gebauer, Pompe und Thysia. Attische Tieropferdarstellungen auf schwarz- und rotfigurigen Vasen (Münster 2002)<br />
170. 449 f. 483.<br />
467 Gebauer a. O. (Anm. 466) 335 f.<br />
468 S. Moraw, Bilder, die lügen: Hochzeit, Tieropfer und Sklaverei in der klassischen Kunst, in: Fischer – Moraw 2005, 74;<br />
s. auch P. Stengel, Die griechischen Kulturaltertümer. Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft V 3 (München<br />
1920) 116–121.<br />
469 Gebauer a. O. (Anm. 466) 200.<br />
470 Bundrick 2008, 307.<br />
471 Zum Gebrauchskontext des Aulos bzw. Diaulos, s. Bundrick 2005, 37-42.<br />
S e i t e | 104
von jungen Männern handle es sich also, so müsste man schließen, in beiden Fällen um Hetären. Die<br />
berechtigten Zweifel, warum eine Hetäre einem Jüngling einen Fleischschenkel schenken solle,<br />
werden in der Regel erfolgreich ignoriert. In jedem Fall ist eine Frau mit einem Fleischstück<br />
erklärungsbedürftig. Da in der Regel, wie dargelegt wurde, nur männliche Vollbürger Anrecht auf<br />
ihren Fleischanteil hatten, ist der Fleischschenkel im Besitz einer Frau unüblich. 472 Es wäre etwa<br />
vorstellbar, dass er im übertragenen Sinn die Zugehörigkeit zum wohlversorgten Oikos eines<br />
frommen, athenischen Vollbürgers veranschaulichen soll.<br />
Auf einer Pyxis in Mount Holyoke III/12 (Taf. 12 Abb. 3) bringt ein Jüngling einen Tierschenkel ins<br />
Haus. Die Hausherrin sitzt vor einem zum Bersten gefüllten Wollkorb, in ihrer Rechten einen weiß<br />
gefassten rundlichen Gegenstand, wie ihn ihr gleichzeitig auch der junge Mann entgegenhält. Da die<br />
Farbgebung mit dem Inhalt des Wollkorbs übereinstimmt, wird es sich in diesem Fall nicht wie auf der<br />
Pyxis II/2 um Früchte handeln, sondern eher um Wolle. 473 Durch eine Art Begutachtung wird der<br />
Hausherr in den Prozess um die Textilherstellung miteinbezogen. Die Tür ist aus den Oikos-Bildern<br />
gut bekannt und markiert entweder den Eingang zum hochzeitlichen Schlafgemach oder die<br />
Eingangstür des Wohnhauses. Zweifel an der Deutung des Fleischschenkels als Liebesgeschenk an<br />
eine Frau zweifelhaften Charakters mehren und bestätigen sich also auch hier. 474<br />
3. 3. 3. Tiere<br />
Neben Teilen von bereits geschlachteten Tieren in Form von Tierschenkeln werden auch vollständige<br />
Tiere wie Hahn, Henne oder Hasen dargeboten. Tiere, darunter vor allem der Hase, sind eigentlich<br />
Geschenke, die bevorzugt zwischen Männern und Knaben ausgetauscht werden. 475 Es gibt jedoch<br />
einige wenige Darstellungen, die in den Bereich der heterosexuellen Werbung gehören. Ein<br />
Alabastron in Athen III/13 (Taf. 12 Abb. 4–6) gilt als Paradebeispiel. Die sitzende Frau ist wie so oft<br />
mit Spinnwerkzeug ausgestattet. Der tote Hase in den Händen des sich nähernden Jünglings wurde in<br />
472 Zu Frauen im Besitz von Fleischstücken, vgl. Hydria der Polygnot-Gruppe, London, British Mus. 1921.7-10.2: CVA<br />
London, British Mus. (6) III Ic 3 Taf. 83, 1A–D gehört zu den wenigen Beispielen, wo tatsächlich eine Frau ein solches<br />
Fleischstück und zwar im Kontext des Hauses in den Händen hält. Inmitten der kultivierten Frauen, die Barbiton und<br />
Leier spielen, der Musik lauschen oder sich in ein aufgerolltes Stück Papyrus vertiefen, wirkt die Frau mit dem<br />
Fleischschenkel allerdings tatsächlich recht befremdlich. Dennoch glaube ich nicht, dass es sich dabei anstelle des<br />
Fleisches um ein Flötenetui handelt; s. z. B. Lewis 2002, 157. Flötenetuis, im Regelfall gemustert, haben keine derart<br />
sackartige Form; Größe und Form würden für den Sakkos passen, dafür ist aber der Umriss zu unregelmäßig.<br />
Vergleichbare Fleischstücke sind etwa zu finden auf der Hydria, Rhodos, Mus. Arch. 13261, hier III/10, und auf einer<br />
Schale des Makron, London, British Mus. E 62: CVA London, British Mus. (9) 51 f. Taf. 52, A. B; 53, A. B; vgl. auch<br />
Schale in Chiusi III/11; Schale des Oltos, Bologna, Mus. Civico Arch. 361: CVA Bologna (1) III Ic 4 Taf. 1, 3; 3, 1. 2; 4,<br />
4. 5, wo auch die Kombination Musikinstrument und Fleisch auch belegt ist.<br />
473 DNP IV (1989) 1203 s. v. Granatapfel, Granatapfelbaum (C. Hünemörder); Badinou 2003, 84. – Zum Apfel als<br />
Liebesgeschenk, s. Sutton 1981, 320 ff.<br />
474 Bundrick 2008, 306 f.<br />
475 Zu den Geschenken in den Werbeszenen, s. Koch-Harnack 1983, 63; K. Dover, Homosexualität in der griechischen<br />
Antike (München 1983) 87.<br />
S e i t e | 105
Anlehnung an entsprechende Szenen päderastischer Werbung stets als Liebesgeschenk interpretiert. 476<br />
Der Hase begegnet auch auf Grabstelen 477 ; vor sepulkralem Hintergrund wird er mit großer<br />
Wahrscheinlichkeit weder als Liebesgeschenk Verwendung finden noch wird er an eine Hetäre<br />
gereicht werden. Attribute sind häufig mehrdeutig und können je nach Bildkontext ihre Funktion oder<br />
Aussage wechseln. Auch wenn der Hase in manchen Werbeszenen unleugbar als Liebesgeschenk an<br />
den Eromenos dient, handelt es sich hier wohl eher um ein Attribut, das mit dem Jagdgeschick und der<br />
Schnelligkeit der Knaben einen Aspekt der Erziehung und Mannwerdung aufgreift. Auf dem<br />
Alabastron in Athen III/13 geht die Darstellung jedoch noch weiter: ein Paar umarmt sich, die Arme<br />
liebevoll um den Nacken des anderen geschlungen (Taf. 13 Abb. 6). Das Gewand der weiblichen<br />
Figur ist gelöst, das transparente Gewebe enthüllt die Körperkonturen. Wie sind beide Szenen<br />
zueinander in Beziehung zu setzen? Hat der Hase doch als Geschenk den Weg für kleine oder große<br />
Gefälligkeiten geebnet und beide Szenen geben dieselben Personen wieder und dies ist nun doch der<br />
lang ersehnte Nachweis für eine spinnende Hetäre? Oder wird die sittsame Spinnerin mit der<br />
bereitwilligen Verführerin kontrastiert?<br />
Der Verdacht, dass Tiere nicht unbedingt als Geschenke fungieren, wird im Übrigen durch die<br />
Tatsache bestätigt, dass nicht nur männlichen Personen die Rolle des Trägers übernehmen. Auf einem<br />
Alabastron in Palermo III/14 (Taf. 13 Abb. 1–3) sind die Rollen vertauscht. Hier hält eine junge Frau,<br />
deren Haar gebündelt über den Rücken fällt, in ihrer ausgestreckten Hand eine Henne. Der junge<br />
Mann, schwer vermummt in sein Himation, macht keine Anstalten, das Dargereichte zu ergreifen. So<br />
wie die Henne als Attribut der Frau zugeordnet ist, gilt dies für den Hund und den Jüngling. Ob das<br />
Huhn also als Geschenk intendiert ist, ist trotz der Geste unklar. Wenn die Übergabe eines<br />
„Geschenks“ mit Werbung gleichgesetzt wird, findet sich keine einleuchtende Erklärung dafür,<br />
weshalb eine Frau als Schenkende auftreten sollte.<br />
Ein Alabastron in Athen III/ 15 (Taf. 13 Abb. 4–6) trägt ebenfalls eine sog. Geschenkübergabeszene,<br />
die mit dem Bild der spinnenden Frau kombiniert ist. Zu einer vor einem Klismos stehenden Frau, die<br />
gerade im Begriff ist, einen Wollfaden auf eine rotierende Spindel aufzuwickeln, gesellen sich ein<br />
Jüngling mit einer Henne und ein nackter Knabe, beladen mit einem riesenhaften Oktopus und einem<br />
Rebhuhn. Laut Koch-Harnack handelt es sich hierbei um die Darbringung von Geschenken an eine<br />
Hetäre. 478 Der Oktopus im Kontext des Schenkens oder Werbens ist meines Wissens singulär. Die<br />
Vermutung, es handle sich um die Darstellung eines Freiers, der durch seine überwältigende<br />
Freigiebigkeit und die Anzahl seiner Geschenke beeindrucken will, überzeugt nicht. Der Vorschlag A.<br />
Brückners, die Frau spinne fleißig zuhause, während der Mann zusammen mit seinem Sohn oder<br />
Sklaven vom Markt komme, wird heute zugunsten der Hetärenwerbung im Allgemeinen abgelehnt,<br />
hat jedoch einiges für sich. 479 Die Argumente der Befürworter der Hetärenwerbung setzen das Athener<br />
476 U. Knigge, Ein rotfiguriges Alabastron, AM 79, 1964, 105–113; Koch-Harnack 1983, 129 f.<br />
477 z. B. Grabstele der Nikeboule und des Phyrkias in Athen, Nat. Mus. 2062: CAT 2.183.<br />
478 Koch-Harnack 1983, 130 f. 133 Abb. 65; Badinou 2003, 92 verweist auf die Ambivalenz der Ikonographie und lässt die<br />
Frage nach dem Status der Frau offen.<br />
479 A. Brückner, Lebensregeln auf athenischen Hochzeitsgeschenken, WPrBerl 62, 1902, 3–11; s. auch CVA Athen, Nat.<br />
Mus. (1) III Ic 3 Taf. 1, 3–5; J. D. Beazley, JHS 51, 1931, 121; Davidson 1999, 109 lehnt diese Deutung mit dem<br />
Verweis auf Carl Robert ab, der Anfang des 20. Jhs. in Neapel derartige Zustände miterlebte. Italien um 1919 ist mit<br />
S e i t e | 106
Alabastron in Beziehung zu Darstellungen der spinnenden Hetäre und damit zwangsweise zu<br />
Darstellungen des Geldbeutels. 480 Seitdem das Phänomen der spinnenden Hetäre in der<br />
archäologischen Forschung kursiert, ist man allzu bereitwillig geneigt, jedwede Spinnerin als Hetäre<br />
zu deklarieren. Der Vergleich mit Werbeszenen, in denen Geld dargeboten wird, dient lediglich dazu,<br />
die Anständigkeit der spinnenden Frau in Frage zu stellen, ist jedoch an dieser Stelle willkürlich, da<br />
Geld auf dem Athener Alabastron keine Rolle spielt. Ob dann der Geldbeutel tatsächlich ein Zeichen<br />
für die sexuelle Verfügbarkeit der umworbenen Frau ist, sei vorerst dahingestellt.<br />
Die Besorgungen vom Markt sind nicht beliebig gewählt: Meeresfrüchte etwa waren in der Antike ein<br />
Luxusartikel – J. N. Davidson nennt sie Instrumente der Verführung 481 –, und auch Fleisch war kein<br />
alltägliches Mahl. Ein Haushalt, der sich Derartiges leisten kann, demonstriert seinen Reichtum und<br />
seine Exklusivität. Daneben haben sicherlich auch die Vögel ihre symbolische Bewandtnis. Das<br />
Rebhuhn ist laut Athenaios eines der Tiere, dem ein starker Paarungstrieb bescheinigt wurde. 482 So<br />
stark die erotische Komponente anhand der Tiersymbolik hervortreten mag, Fruchtbarkeit ist dem<br />
griechischen Denken gemäß ganz gewiss ein Faktor der legitimen Ehe, während Hetären<br />
unerwünschter Nachwuchs kaum willkommen gewesen sein dürfte. Die Henne mag also durchaus ihre<br />
traditionelle Bedeutung als Liebesgeschenk behalten, muss jedoch hier – ebenso wie das Rebhuhn 483 –<br />
nicht bezeichnend für die Beziehung von Kunde und Hetäre sein, sondern kann ebenso auf eine<br />
Beziehung zwischen Angehörigen eines Oikos, zwischen Ehemann und Ehefrau, verweisen. Auch die<br />
Inschrift prosagoreuo ein Markenzeichen der Maler der Paidikos-Group, ist als Grußgestus zu<br />
verstehen und legt nicht fest, ob wir nun eine Hetäre oder eine Ehefrau vor uns haben. 484<br />
3. 4. Werben mit Geld<br />
„Zahlreich hingegen malte man die Geldbeutelwerbungen, die meines Erachtens durchgängig auf die<br />
käufliche Liebe im Haus der Hetäre bzw. im Bordell hinweisen. Es sind auch heute äußerst sinnfällige<br />
Bilder für Prostitution. Ein vordergründiger erotischer Reiz ist ihnen nicht eigen.“ 485 Dieses Resümee<br />
von A. Dierichs gibt im Wesentlichen den aktuellen Stand archäologischer Forschung wieder. Mehr<br />
als alle anderen sogenannten Geschenke ist der Geldbeutel mit dem Stigma der Hetärenwerbung<br />
behaftet. Es fällt schwer, für die Frauen oder Spinnerinnen, gerade wenn sie von Männern mit Geld<br />
′umworben′ werden, eine andere Erklärung zu finden als die der Prostituierten, die ihren Lohn<br />
Verlaub nicht mit Athen im 5. Jh. gleichzusetzen! Dem Knaben die Rolle des Kupplers zu geben, verbietet die<br />
Komposition, die ihn eindeutig als dem Manne zugehörig ausweist.<br />
480 Knigge a. O. (Anm. 476) 108.<br />
481 Davidson 1999, 25 ff. bes. 31.<br />
482 Athen. 9, 391d.<br />
483 A. Kauffmann-Samaras, Des femmes et des oiseaux. La perdrix dans le gynécée, in: B. Schmaltz – M. Söldner (Hrsg.),<br />
Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom 24.–28.9.2001<br />
(Münster 2003) 90–92; Heinrich 2006, 105.<br />
484 A. Brückner, Lebensregeln auf athenischen Hochzeitsgeschenken, WPrBerl 62, 1902, 6–11.<br />
485 Dierichs 1993, 86.<br />
S e i t e | 107
empfängt. 486 Dass hierbei der Geldbeutel nicht im eigentlichen Sinn als Bezahlung, sondern im Sinne<br />
des antiken Geschenkwesens als Gabe bzw. Gegengabe gedeutet werden kann, ist dem stilisierten Bild<br />
der Hetäre verpflichtet, die ihre sexuelle Gunst im Austausch mit Preziosen jedweder Art gewährt. 487<br />
Versuche, den Geldbeutel etwa als szenische Umsetzung der Versorgung mit Haushaltsgeld zu deuten,<br />
wurden eher belächelt und dann verworfen. 488<br />
Der Geldbeutel ist von all den dargebrachten Objekten nach Aussage der meisten Wissenschaftler das<br />
Geschenk, welches das Verhältnis von Geber und Empfänger am ungeschminktesten verrät. 489 Denn<br />
während Blüten, Bänder, Kränze oder Gefäße auf subtile Weise versuchten, das Herz und die Gunst<br />
der Angebeteten zu gewinnen und das Freier-Hetären-Verhältnis als romantische Liebesbeziehung zu<br />
tarnen, ließe der Geldbeutel keinen Zweifel daran, dass Sex als Ware gegen Bezahlung offeriert wird.<br />
Gerade diese Überlegung steht nun jedoch in krassem Widerspruch zum Hetärenbild der antiken<br />
Schriftquellen. Die Selbststilisierung der Hetären als „Gefährtinnen“ und „Freundinnen“ zielt in erster<br />
Linie darauf ab, sich eben nicht mit den käuflichen Pornai auf eine Stufe zu stellen, sondern ihre<br />
Beziehung zu ihren Kunden über mehr oder weniger freiwillige Gaben zu definieren. 490<br />
Entweder vertreten die bildenden Künste eine Sichtweise, die sich mehr an den realen Zuständen<br />
orientiert und subjektive Schönfärberei außen vor lässt, oder wir irren uns, was die Implikationen des<br />
Geldbeutels angehen. Oder aber wir gehen in einer dritten Möglichkeit davon aus, dass alle jene<br />
Frauen, denen Geld dargeboten wird, Pornai sind. Die Anzahl der billigen Prostituierten würde unter<br />
dieser Voraussetzung rapide steigen. Wäre es für die Klientel der Töpfer wirklich wünschenswert,<br />
Pornai auf ihrem feinen Geschirr thematisiert zu finden, Sklavinnen und Freigelassene, Angehörige<br />
des untersten sozialen Standes? 491 Wie weit würde sich ein athenischer Bürger repräsentiert sehen<br />
durch den Umgang mit einer Porne? Und wie steht es mit den Geschenken? Jene Art von<br />
Prostituierten wird definitiv nicht umworben. Sind sich Pornai und Hetären auf den<br />
Vasendarstellungen gegenübergestellt, so wie vorbildliche Knaben und Knaben, deren Verhalten den<br />
männlichen Pornai gefährlich nahe kommt? Eine Unterscheidung von Pornai und Hetären anhand der<br />
Geschenke und ihren Werts wird ad absurdum geführt angesichts solcher Darstellungen wie auf der<br />
Oinochoe in San Antonio 492 III/36 (Taf. 17 Abb. 3). Geldbeutel und Blüte, die der Jüngling in Händen<br />
486 z. B. Keuls 1985, 258 ff.<br />
487 Allg. M. Mauss, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften (Frankfurt a. M. 1968);<br />
Sutton 1981, 278 f.; S. von Reden, Exchange in Ancient Greece (London 1995); Davidson 1999, 134: „Das Wesen der<br />
Gabe hängt in der Praxis von etwas ab, was Pierre Bourdieu Verkennung nennt – eine bewusste Fehleinschätzung – das<br />
heißt davon, dass man so tut, als hätte das Geschenk keinerlei Wert und erfordere keine Erwiderung. Die Gefälligkeit, die<br />
dafür erwartet wird, muss als etwas erscheinen, was vollkommen im Ermessen des Empfängers liegt, der Wert auf seine<br />
Handlungsfreiheit legt, indem er Zeit und Art der Erwiderung bestimmt. [...] Erfolgt das Gegengeschenk zu schnell auf<br />
eine erwiesene Gefälligkeit, ist es kein Geschenk mehr, sondern Bezahlung für "geleistete Dienste"."<br />
488 Hartmann 2002, 174 f.<br />
489 z. B. Killet 1994, 127.<br />
490 s. auch G. Ferrari, Figures of Speech. Men and Maidens in Ancient Greece (Chicago 2002) 14: Sie fragt, weshalb sich<br />
eine Hetäre einen tugendhaften Anstrich geben sollte, wenn der Eindruck doch durch den Geldbeutel sofort zunichte<br />
gemacht würde.<br />
491 Zu den Pornai allg., s. Kreilinger 2007, 61f.<br />
492 San Antonio, San Antonio Mus. of Art, Coll. of Gilbert M. Denman, Jr. 86.134.59.<br />
S e i t e | 108
hält, scheinen hier bis zu einem gewissen Punkt austauschbar zu sein, denn dargereicht wird dem<br />
weiblichen Gegenüber nicht der Geldbeutel, sondern die Blüte.<br />
Die päderastischen Szenen, in denen der Geldbeutel ebenso, wenn auch seltener, zum Einsatz kommt,<br />
stellen uns vor dieselbe Schwierigkeit. Angesichts kritischer bis abfälliger Stimmen eines<br />
Aristophanes oder Xenophon erscheint es höchst abwegig, anzunehmen, die Vasenmalerei illustriere<br />
die Geschäftspraktiken von Knaben aus gutem Hause, die ihren Körper einer gemeinen Hure gleich<br />
dem Meistbietenden verkaufen. 493 Das Medium der Vasenmalerei dürfte generell für ein<br />
rollenkonformes Geschlechterverhalten geworben haben, wie wir es z. B. deutlich an den Oikos-<br />
Bildern gesehen haben, die weibliches Idealverhalten propagieren. 494 Um Sklaven, deren sexuelle<br />
Unterwerfung kein gesellschaftliches Tabu war, handelt es sich bei den umworbenen Knaben mit<br />
Sicherheit nicht. Aus Attributen ist ersichtlich, dass sich viele der Szenen in der Palästra und in ihrem<br />
Umfeld abspielen, deren Benutzung den Freien vorbehalten war. 495 Müssen die Bilder also als Kritik<br />
am ungebührlichen Verhalten der Geld akzeptierenden Knaben gelesen werden 496 oder geben sie<br />
einfach reale Zustände wider, wie sie ja offensichtlich existiert haben, wenn sie von antiken Autoren<br />
angeprangert wurden? Da die Bild- und Schriftquellen zu diesem Thema aus unterschiedlichen<br />
Jahrhunderten stammen, ist es möglich, anzunehmen, dass sich die Problematik vielleicht erst im 4. Jh.<br />
v. Chr. als solche herausgebildet hat, als das Verschenken von Geld zur üblichen Praxis wurde und<br />
überhandnahm. So schließt auch C. Reinsberg aus der Unbeschwertheit, mit der der Geldbeutel in die<br />
päderastischen Szenen auf den Vasen integriert wird, dass die Übergabe von Geld in der 1. Hälfte des<br />
5. Jhs. v. Chr. offenbar noch nicht als anstößig empfunden und mit Bezahlung gleichgesetzt wurde. 497<br />
S. von Reden führt den Umstand der Geld empfangenden Knaben darauf zurück, dass der Geldbeutel<br />
lediglich zur Kennzeichnung des finanziell gut gestellten und moralisch gefestigten Polisbürgers<br />
verwendet wird und eine Übergabe von Geld im eigentlichen Sinn nicht stattfindet. 498 Die Frage, ob<br />
der Geldbeutel in homo- und in hetereosexuellen Werbeszenen unterschiedlich interpretiert werden<br />
darf, wird damit jedoch nicht gelöst. 499<br />
493 So auch Hartmann 2002, 177; vgl. auch Aristoph. Plut. 153–159 und Xen. symp. I 6, 18.<br />
494 Kreilinger 2007, 28; s. auch Kap. 2. 5. 2.<br />
495 Koch-Harnack 1983, 163 f.; Reinsberg 1993, 184.<br />
496 von Reden a. O. (Anm. 487) 198 f.<br />
497 Reinsberg 1993, 183 f.<br />
498 von Reden a. O. (Anm. 487) 171. 195: „symbol of power and citizenship“; dies. 202. 204: “moderation and control of<br />
excess”; dies. 199: “We should conclude that money pouches are symbolic details describing the erastes and his attitude<br />
to the eromenos, not the social status of the boy.” Bundrick 2008, 300.<br />
499 Reinsberg 1993, 185 etwa vertritt die Meinung, Geld würde in Kaufszenen immer gemeinsam mit den zu erwerbenden<br />
Gütern, Öl, Wein, Hetären etc., abgebildet sein. Die päderastischen Szenen schließt sie jedoch aus. Zur Untermauerung<br />
führt sie Einzelszenen an, wobei mir der Zusammenhang mit päderastischer Werbung aber unklar bleibt.<br />
S e i t e | 109
S e i t e | 110<br />
3. 4. 1. Der Geldbeutel als Instrument der Werbung?<br />
Spätestens seit dem Aufsatz von M. Meyer hat die Debatte um die ikonographische Scheidung des<br />
Geldsäckchens vom Astragalbeutel ein Ende gefunden. 500 Dass es sich tatsächlich um einen<br />
Geldbeutel handelt, stellt sein Gebrauch in Kaufszenen sicher (Taf. 13 Abb. 7. 8; Taf. 14 Abb. 1–3). In<br />
Entsprechung zu den Kaufszenen geht M. Meyer davon aus, dass im Bild auch immer der Gegenwert<br />
des Geldes fassbar sein müsse. 501 So wie in Marktdarstellungen Gefäße, Öl oder Wein erworben<br />
werden 502 , stehe in hetero- und homosexuellen Werbeszenen die sexuelle Verfügbarkeit der Hetäre<br />
bzw. des Knaben zum Kauf. 503 Die Bedeutung des Geldbeutels wurde bisher zwar sowohl in hetero-<br />
als auch in homosexuellen Beziehungen, aber noch niemals im Gesamtkontext seiner Darstellung<br />
untersucht. Auch diese Arbeit kann die ausstehende Forderung leider nicht erfüllen. Es sollen nur<br />
Problemfelder und Widersprüche offen gelegt werden, die dazu anregen sollen, andere<br />
Interpretationsmöglichkeiten zumindest in Betracht zu ziehen. Wie sich zeigen wird, lassen sich einige<br />
Widersprüche durchaus aus der Welt schaffen.<br />
Ein erster Einwand lautet, dass keineswegs immer der Tauschwert des Geldes im Bild ersichtlich ist.<br />
In einfigurigen Szenen ohne narrativen Zusammenhang macht der Geldbeutel nur dann Sinn, wenn er<br />
auch kontextunabhängig als Symbol für finanzielle Potenz gelten darf. 504 Im Tondo einer Schale des<br />
Douris III/20 (Taf. 14 Abb. 4), die ehemals in Dresden zu sehen war, heute leider verloren ist, hält ein<br />
bärtiger Mann einen Geldbeutel in seiner ausgestreckten Hand. Das Mobiliar hinter ihm kennzeichnet<br />
den Ort als überdachtes Ambiente. Bürgerstock und Geld beschreiben den Dargestellten auf dieselbe<br />
Art und Weise wie die Athletenutensilien an der Wand, nämlich als wohlhabenden Bürger und<br />
Anhänger körperlicher Ertüchtigung, der sich dem Ideal der Kalokagathia verschrieben hat. Die<br />
Sportlerutensilien, bestehend aus Strigilis und Schwamm, sind fester Bestandteil des männlichen<br />
Alltagslebens und auch außerhalb der Palästra als typische Attribute des Mannes allgegenwärtig. Der<br />
Geldbeutel wird hier durch die leicht vorgestreckte Haltung dem Betrachter geradezu präsentiert. Der<br />
500 Meyer 1988, 87–125; s. auch Sutton 1981, 291 f.; G. Pinney, Money-Bags?, AJA 90, 1986, 218; zusammenfassendes<br />
Resümee jüngst von Badinou 2003, 32. – Die Gegenseite vertritt G. Ferrari, Figures of Speech. Men and Maidens in<br />
Ancient Greece (Chicago 2002) 14 f.: In Musik- und Schulszenen, in der Palästra, in der Gynaikonitis und in den<br />
Werbeszenen erscheint ihr ein Geldbeutel fehl am Platz; sie hält deshalb einen Astragalbeutel für wahrscheinlicher. Sie<br />
differenziert jedoch m. M. nicht gründlich genug zwischen dem großen, ovalen Astragalbeutel, der vorwiegend in<br />
Schulszenen vorkommt, und dem kleinen, meist rundlichen Geldbeutel, wie er in den Werbeszenen auftritt. Der Skyphos<br />
des Penthesileia-Malers, St. Petersburg, St. Ermitage Mus. 4224: R. F. Sutton Jr., Pornography and Persuasion on Attic<br />
Pottery, in: A. Richlin (Hrsg.), Pornography and Representation in Greece and Rome (Oxford 1992) 17 f. Abb. 1, 5 zeigt<br />
m. M. nach den Inhalt eines solchen Geldsäckchens, nämlich eine Münze.<br />
501 Meyer 1988, 116: “In den Verkaufsszenen kommt der Mann mit Geldbeutel nie, in den Liebeswerbungen so gut wie nie<br />
allein, d. h. ohne Gegenwert für seine Mittel, vor. Der Geldbeutel ist also kein kontextunabhängiges Attribut, das eine<br />
Aussage über die Eigenschaften des Trägers macht.“<br />
502 z. B. Baltimore, Johns Hopkins Univ. B4 III/16; Kopenhagen, Nat. Mus. Chr.VIII 320 III/17; Paris, Musée du Louvre<br />
CA1852 III/18; Oxford, Privatsammlung III/19; Pelike des Nikoxenos-Malers, Paris, Musée du Louvre F 376: Meyer<br />
1988, 113 f. Abb. 27.<br />
503 Sutton 1981, 289 f.; Dierichs 1993, 86.<br />
504 z. B. Florenz, Mus. Arch. Etrusco 75589: Kunisch 1997, Taf. 10, 15; London, Sotheby´s: Sotheby´s. Antiquities.<br />
Auktionskatalog 11. Dezember 1989 (London 1989) 74 Abb. 129; 87; St. Petersburg, St. Hermitage Mus. ST 1614 bzw.<br />
659: Kunisch 1997, Taf. 160, 493; München, Antikensammlungen 2656 und 8956: Kunisch 1997, Taf. 51, 144.
Schalenmaler hat diese Darstellungsweise dem ebenso gut bekannten Motiv des Am-Körper-Haltens<br />
vorgezogen, obgleich das direkte Gegenüber fehlt. Für eine Deutung des Mannes als Erastes und des<br />
Geldsacks als Liebesgeschenk 505 fehlen in der Szene selbst jegliche Anhaltspunkte, auch wenn die<br />
Außenseiten der Schale, wie so häufig zu dieser Zeit, mit päderastischen Werbeszenen geschmückt<br />
sind. J. Neils etwa deutet den Mann versuchsweise als Leitourgos eines Jugendagons in<br />
Korrespondenz mit der Darstellung des bekränzten Jünglings auf einer der Schalenaußenseiten, den sie<br />
über seine spezielle Kopfbedeckung mit der Euandria in Verbindung bringt. 506<br />
Unter den vielen Geldbeutelszenen lassen sich des Weiteren einige Darstellungen nennen, die eine<br />
Interpretation als Kauf sexueller Dienste abwegig erscheinen lassen. Neben den hetero- und<br />
homosexuellen Werbeszenen, die zugegebenermaßen das Gros der Geldbeuteldarstellungen<br />
einnehmen, tritt der Geldbeutel z. B. auch in reinen Knaben- oder Männerszenen auf. 507 Im Tondo<br />
einer Schale in Newcastle III/21 hängt er zwischen einer jungen Frau, die ihre Hände unter ihrem<br />
Himation verborgen hat, und einem Jüngling, der sich auf seinen Bürgerstock stützt. Am Rande ist ein<br />
Volutenaltar zu sehen. Mit dem Kauf sexueller Dienstleistungen hat dies nichts zu tun, es sei denn<br />
man will hier mit aller Gewalt Tempelprostitution hineinlesen! Im Tondo einer Schale in Rom III/22<br />
hält ein Jüngling mit Bürgerstock einen Geldbeutel über einen Altar, als ob er eine Opferspende<br />
darbrächte. Ein ausgebreitetes Tierfell hinter ihm ist vielleicht eine Anspielung auf ein Kultfest<br />
dionysischen Charakters. Möglicherweise hat sich der betreffende Bürger bei der Ausrichtung eines<br />
Festes durch Stiftung von Opfertieren oder Weihgaben oder durch eine großzügige Geldspende<br />
besonders hervorgetan. Auf einem Skyphos in Kopenhagen III/23 (Taf. 14 Abb. 5) erscheint der<br />
Geldbeutel zwischen einem Jüngling und einer fliehenden Frau. Er wird hier zwar nicht gehalten oder<br />
gereicht, ein Zeichen käuflicher Liebe hat in diesem Kontext jedoch ohnehin kaum etwas verloren,<br />
will man die Fliehende nicht als abgeneigte und leicht hysterisch reagierende Hetäre bezeichnen. 508<br />
Wenn der Geldbeutel als sichtbares Zeichen für den Kauf von Sex die geschäftliche Beziehung zur<br />
Prostituierten regelt, wieso scheint dann der Freier auf einer Oinochoe in San Antonio III/36 (Taf. 17<br />
Abb. 3) nicht den Inhalt seines Geldbeutels, sondern eher die Blüte zu offerieren? 509 Auch auf einer<br />
Pelike in Syrakus III/37 (Taf. 17 Abb. 4) hat sich der Mann entschieden, der vor ihm sitzenden Frau<br />
den Spiegel zu reichen und das Geldsäckchen für sich zu behalten. 510 Der Geldbeutel reiht sich<br />
505 Reinsberg 1993, 185.<br />
506 J. Neils, The Panathenaia and Kleisthenic Ideology, in: W. D. E. Coulson u.a. (Hrsg.), The Archaeology of Athens and<br />
Attica under the Democracy (Oxford 1994) 157 Abb. 10. 11.<br />
507 z. B. Schalenfrg. des Bologna-Malers 417, Malibu, The J. Paul Getty Mus. 86.AE.329: CVA Malibu (8) 58 Taf. 449, 7;<br />
Schale, Castellon, Museo Arqueologico; J. Barbera – E. Sanmarti, Arte Griego en Espana (Barcelona 1987) 124 Abb.<br />
157; vgl. E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art<br />
and Iconography (Wisconsin 1983) 226.<br />
508 M. Cristofani, Celeritas solis filia, in: H. Froning – T. Hölscher – H. Mielsch (Hrsg.) Kotinos. Festschrift für Erika Simon<br />
(Mainz 1995) 348f. deutet die dargestellte Frau anhand einer etruskischen Inschrift als „Tochter der Sonne“. Es handelt<br />
sich dabei um eine nachträgliche Uminterpretation durch den Besitzer.<br />
509 Es gibt allerdings auch den umgekehrten Fall, vgl. Toledo, Art Mus. 72.55; hier III/1: hier bieten die Männer mit Blüte<br />
und Geld tatsächlich den Geldbeutel.<br />
510 Dasselbe Phänomen ist auch in den päderastischen Szenen festzustellen; nach Reinsberg 1993, 187 zeigt dies, dass im<br />
Idealfall der Knabe seinen Mentor nicht nach dem Wert seiner Geschenke erwählt.<br />
S e i t e | 111
folglich in die vielen beliebigen männlichen Attribute ein, die selektiv ausgewählt werden und auch<br />
kontextunabhängig verständlich sind wie etwa Athletenutensilien oder Bürgerstock.<br />
Es muss also für den Geldbeutel eine alternative, vor allem weiter gefasste Interpretation geben, als<br />
dies M. Meyer vorgeschlagen hat. Attribute im Allgemeinen werden in der Bildsprache der<br />
griechischen Vasenmalerei oft formelhaft verwendet und sind somit nicht so sehr aussagekräftig für<br />
die Bewertung von Interaktionen, sondern dienen eher der Charakterisierung von Personen. Dies gilt<br />
offensichtlich auch für den Geldbeutel. Der Geldbeutel ist, wie im Nachfolgenden an weiteren<br />
Beispielen aufgezeigt werden soll, vor allem in der Bildkunst der 1. Hälfte des 5. Jhs. ein immer<br />
wieder anzutreffendes Statussymbol, das ebenso wie der Bürgerstock visuelles Zeichen des<br />
Bürgerstandes ist und darüber hinaus auch den finanziellen Handlungsspielraum ins Bild setzt, der<br />
sich der vermögenden Klasse in Athen zu Beginn der Demokratie mit Etablierung des Münzwesens<br />
eröffnete. Führt man den Gedanken fort, dann ermöglichte Geld die politische Profilierung durch<br />
Investitionen in Ämter, Bauprojekte oder Stiftungen, unterstützte ferner die Herstellung sozialer<br />
Beziehungen und Abhängigkeiten, die dem athenischen Bürger seinen Rang in der Gesellschaft<br />
garantierten. 511 Kapital und eine gefestigte Stellung als angesehener Bürger der Stadt waren nicht<br />
zuletzt auch Eigenschaften, die den Junggesellen gute Chancen bei einer vorteilhaften Brautwerbung<br />
einräumten.<br />
Der Geldbeutel darf nur dann als Liebesgeschenk bzw. Bezahlung beurteilt werden, wenn es der<br />
Bildkontext, d. h. das Fehlen einschlägiger Attribute aus dem Oikosbereich bzw. das Vorhandensein<br />
von Attributen etwa des Symposionsbereichs, gestattet, die Szene in einen Zusammenhang mit der<br />
käuflichen Frau zu stellen. Um eine meiner Ansicht unwiderruflich mit der häuslichen Sphäre<br />
verknüpfte Tätigkeit handelt es sich beim Spinnen und Weben. Da diese Überzeugung diametral dem<br />
widerspricht, was die archäologische Forschung – von einigen erst jüngst geäußerten kritischen<br />
Stimmen abgesehen – die letzten Jahrzehnte vertrat, muss die 'spinnende Hetäre' am Ausgangspunkt<br />
jeder weiteren Diskussion stehen. Eng mit dem Geldbeutel verbunden, soll gezeigt werden, dass sich<br />
die Figur der spinnenden Frau in vielen Fällen nachweislich nicht auf Hetären oder Prostituierten<br />
bezieht.<br />
S e i t e | 112<br />
3. 4. 1. 1. Textilarbeit und Geld<br />
Der dargebotene Geldbeutel auf einem Alabastron in Berlin III/24 (Taf. 14 Abb. 6. 7) war schon für<br />
G. Rodenwaldt der unwiderlegbare Beweis für die Existenz der spinnenden Hetäre. Im Grunde kamen<br />
Rodenwaldt und andere Forscher und Forscherinnen nach ihm zu einem nicht ganz abwegigen<br />
Schluss: eine Frau, der Geld angeboten wird, ist eine Hetäre. 512 Diese Überzeugung wurde fortan mit<br />
solcher Entschlossenheit vertreten, dass alle Versuche, den Geldbeutel als unabhängiges Attribut bzw.<br />
abhängig von den szenischen Zusammenhängen zu begründen, zum Scheitern verurteilt waren. Dabei<br />
511 E. Keuls, Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and<br />
Iconography (Wisconsin 1983) 229; S. von Reden, Exchange in Ancient Greece (London 1995) 82–84. 87; 206–211; C.<br />
Howgego, Geld in der antiken Welt (Darmstadt 2000) 5 f.; Shapiro, Fathers and Sons, in: Neils – Oakley 2003, 102;<br />
Bundrick 2008, 299 f.<br />
512 z. B. Reinsberg 1993, 121 f.; Sutton 2004, 333 f.
ist man bei anderen Attributen durchaus imstande, Bedeutungsnuancen einzuräumen und zu<br />
unterscheiden, die je nach Bildkontext variieren können. Auch im Hinblick auf die junge Frau auf dem<br />
Berliner Alabastron III/24 werden Bedenken laut, ob sie wirklich eine Hetäre sein muss. Aufrecht<br />
sitzend ist sie in ihre Arbeit vertieft 513 ; mit der Linken hält sie die Spindel in die Höhe, während sie<br />
zwischen den Fingern ihrer Rechten den Faden zurechtzupft. Ihr Haar bedeckt ein feiner, transparenter<br />
Schleier, der bis auf die Schulter herab reicht. Weder der Schleier noch das Motiv des Spinnens passen<br />
im Grunde zu einer Hetäre. 514 Aber auch hier gilt: was nicht passt, wird passend gemacht. Es handle<br />
sich eben um eine Hetäre, die so tut, als wäre sie eine anständige Bürgerin! Nachdem das Spinnen<br />
bereits seit G. Rodenwaldt nicht mehr als ausschließliches Charakteristikum der Ehefrau betrachtet<br />
wurde, ereilt das gleiche Schicksal nun auch den Schleier. Nach L. Llewellyn-Jones taugt auch er nicht<br />
mehr als statusgebundenes Merkmal der Ehefrau; er wird von Bürgerinnen gleichermaßen wie von<br />
Hetären getragen. 515 Das Verschleiern ist und bleibt meiner Meinung nach – wie auch heute noch – ein<br />
feierlicher Akt der Hochzeit, der Schleier eine Reminiszenz an ihren bräutlichen bzw. ehefraulichen<br />
Status.<br />
In einer Gegenüberstellung mit bereits angesprochenem Alabastron in Paris III/2 (Taf. 10 Abb. 4. 5),<br />
auf dem die junge Braut von ihrem Zukünftigen allerdings ein Fransenband und keinen Geldbeutel<br />
erhält, wird offenkundig, dass die Kennzeichnung der angeblichen Hetäre des Alabastron in Berlin<br />
III/24 noch mehr als das Mädchen auf dem Gefäß in Paris III/2 dem Idealbild der schönen, sittsamen<br />
Braut entspricht. Warum sollte man sich solche Umstände einer Hetäre wegen machen? Eine Hetäre in<br />
der „Verkleidung“ der Bürgerin ist nicht überzeugend. Auch der demütig nach unten gerichtete Blick<br />
und die Konzentration auf ihre Handarbeit entspringen nicht einer ausgefeilten Verführungstaktik. Die<br />
Versunkenheit ist echt und macht eine Interaktion mit dem sich nähernden Jüngling unmöglich. Das<br />
Spinnen und der (Braut-) Schleier als Ausdruck des häuslichen Fleißes und der Anständigkeit dürfen<br />
bei der Deutung der Szene nicht vernachlässigt werden, so dass es für den Geldbeutel zwangsläufig<br />
eine alternative Interpretation geben muss. Es liegt nahe, den Geldbeutel auch hier als Attribut des gut<br />
situierten und politisch engagierten Bürgers aufzufassen. 516 Somit fungiert auch in diesem Falle das<br />
513 G. Rodenwaldt, Spinnende Hetären AA 1931, 20 f.: Gerade ihre Versunkenheit wird als Argument für eine Hetäre<br />
angeführt, die spielt und sich unbeteiligt gibt, da sie umworben werden will. „Wenn es sich um Geschenke eines jungen<br />
Ehemanns handelte, so würde man mindestens ein dankbares Aufblicken der Gattin erwarten.“<br />
514 Nach J. F. Crome, Spinnende Hetären?, Gymnasium 73, 1966, 245–247 sei die Verführung anständiger Frauen<br />
thematisiert; A.-B. Follman, Der Pan-Maler (Bonn 1968) 67 überlegt, ob nicht vielleicht die Weberzeugnisse erworben<br />
werden.<br />
515 Llewellyn-Jones 2003, 56. 140–143. Die Beweisführung stützt sich auf nur drei Vasendarstellungen, von denen das<br />
Berliner Alabastron eines ist. Eines der zwei übrigen Stücke, auf denen der Autor eine Hetäre mit Schleier erkennen will,<br />
ist meiner Ansicht nach eine hochzeitliche Darstellung einer Braut auf einer Kline. – Zuvor schon Rodenwaldt 1932, 18:<br />
er verweist auf eine Hetäre mit Schleier beim Symposion, Glockenkrater des Nausikaa-Malers, Musée du Louvre G 345:<br />
CVA Paris, Musée du Louvre III Id 5 f. Taf. 8, 1. 4; 9, 1. 4. Das Bild wird heute als mythische Darstellung des Herakles<br />
zu Gast bei Dexamenos, dem König von Olenos, gedeutet. Dessen Tochter, dargestellt als Braut mit Kranz und Schleier,<br />
war dem Kentauren Eurytion zur Ehe versprochen.<br />
516 z. B. Hartmann 2002, 137 f.: Jedes politische Amt beinhaltete die Übernahme von Leiturgien, die ohne ein finanzielles<br />
Polster nicht übernommen werden konnten. Gesellschaftlicher Status und politischer Einfluss waren also von Geld<br />
abhängig.<br />
S e i t e | 113
Geld nicht im eigentlichen Sinn als Geschenk für die Braut, sondern wird als Bildchiffre in direkter<br />
Verbindung mit dem Brautschleier verwendet, um den Bräutigam als gute Partie in Szene zu setzen. 517<br />
Die Darstellung einer Pelike in Athen III/25 (Taf. 15 Abb. 1) vereint Bildelemente des Alabastron in<br />
Berlin III/24 als auch des Alabastron in Paris III/2. Wiederum streckt ein Jüngling einer sitzenden<br />
Frau einen Geldbeutel entgegen. Wie auf dem Alabastron in Paris III/2 hat der Vasenmaler der<br />
Hauptakteurin einen Kalathos und eine Dienerin mit einem Salbölgefäß beigegeben, mit dem<br />
Unterschied, dass jene auf der Pelike in Athen III/25 nicht als junges Mädchen in Erscheinung tritt<br />
und das Alabastron auf dem Pariser Alabastron III/2 durch ein Exaleiptron ersetzt ist. Die Sitzende ist<br />
zwar weder wie im Falle des Berliner Alabastron III/24 wie eine junge Braut oder Matrone mit einem<br />
feinen transparenten Schleier geschmückt, noch ist sie tugendhaft über ihre Handarbeit gebeugt.<br />
Nichtsdestoweniger ist die züchtig von oben bis unten verhüllte Frau ein Abbild an Anstand und<br />
Zurückhaltung.<br />
Die Spinnerin auf der Hydria in Heidelberg III/26 (Taf. 15 Abb. 2) hält einen mit Wolle bespannten<br />
Spinnrocken in die Höhe, Daumen, Zeige- und Mittelfinger ihrer rechten Hand scheinen ursprünglich<br />
den Wollfaden gezwirbelt zu haben. Ihr Blick ist auf eine Frau im Peplos gerichtet, die zwischen den<br />
ausgestreckten Armen ein Wollband hält, vielleicht ein Hinweis auf ein bereits fertig gestelltes<br />
Produkt. Der bärtige Mann ist attributiv hinter die Hausherrin gerückt, wie wir es auch auf anderen,<br />
bereits behandelten Darstellungen des Mannes innerhalb des Oikos vorgefunden haben. Eine<br />
Einzelheit zeichnet ihn jedoch aus und macht die Interpretation der Szene so umstritten; er hält ein<br />
kleines Säckchen, wahrscheinlich einen Geldbeutel, in den Falten seines Himations halb verborgen.<br />
Macht der Geldbeutel, der hier noch dazu weder präsentiert noch hingestreckt wird, aus dieser<br />
spinnenden Hausfrau tatsächlich eine spinnende Hetäre? Die Deutung auf eine Begegnung von Hetäre<br />
und Kunde erschien manchem so plausibel, dass bloße schmückende Details wie das Stoffband<br />
plötzlich zum Botschafter sexueller Bereitschaft und Hingabe wurden. 518 Der Szene, die man, wäre der<br />
Mann nicht anwesend, als einfache Arbeitsszene deuten würde 519 , haftet plötzlich angeblich sexuell<br />
aufgeladene Spannung an. Ich halte den „Gürtel“ jedoch schlicht für ein Band, wie es oftmals in<br />
Frauenszenen herumgereicht wird bzw. als Dekoration an den Wänden hängt. Das Bild ist nach wie<br />
vor eine Arbeitsszene, die die Rolle der Hausherrin und ihrer Dienerin paradigmatisch<br />
versinnbildlicht. Vom Grundgerüst der Komposition her lässt sich die Darstellung der Heidelberger<br />
Hydria hervorragend in Beziehung zu der bereits in einem früheren Zusammenhang besprochenen<br />
Oikosszene auf der Hydria in London II/12 (Taf. 5 Abb. 3) setzen. 520<br />
Die beiden folgenden Darstellungen auf Hydrien des Hephaistos-Malers spielen sich ebenfalls im<br />
häuslichen Ambiente ab. Auf dem Exemplar in Agrigent III/27 (Taf. 15 Abb. 3) beobachtet am linken<br />
Rand eine verhüllte Frau die Konversation zweiter Jünglinge, von denen einer mit einem Geldbeutel<br />
ausgestattet ist. Rechts davon unterhält sich ein auf seinen Bürgerstock gestützter Jüngling mit einer<br />
517 Bundrick 2008, 299 f.<br />
518 So vertritt Keuls 1985, 262 ff. die Ansicht: „The gesture of the loosened girdle is an iconographic stereotype implying<br />
sexual surrender.”; dies., “The Hetaira and the Housewife”. The Splitting of the Female Psyche in Greek Art, MededRom<br />
N.S. 9/10, 1983, 34: dargestellt seien “the different services which women render to their male masters”, d. h. die<br />
spinnende Ehefrau und die sexuell verfügbare Pallake oder Sklavin.<br />
519 z. B. V. Strocka, Alltag und Fest in Athen. Griechische Vasen zur Ausstellung (Freiburg 1987) 30.<br />
520 vgl. Kap. 2. 5. 3.<br />
S e i t e | 114
sitzenden Frau, die sich durch Kalathos und Handwebrahmen als Hausfrau zu erkennen gibt. Das<br />
häusliche Umfeld ebenso wie die Tatsache, dass der Geldbeutel innerhalb einer Gruppe von<br />
gleichaltrigen Geschlechtsgenossen gehandhabt wird, schließen aus, dass der Geldbeutel in einer<br />
anderen als attributiven Weise verwendet wird.<br />
Die in Krakau verwahrte Hydria des Hephaistos-Malers III/28 (Taf. 15 Abb. 4) zeigt ebenfalls eine<br />
Frau mit Kalathos in der Gegenwart eines Jünglings mit Geld. Hier wendet sich die Sitzende jedoch<br />
mit einer weitausholenden Armbewegung zum Besitzer des Geldbeutels um. In der Regel sind die<br />
weiblichen Personen im Oikos gegenüber den männlichen deutlich in der Mehrzahl, meist handelt sich<br />
nur um einen einzelnen Mann. Das Krakauer Vasenbild ist für eine Oikosszene nun sehr<br />
ungewöhnlich, da sich hier eine einzelne Frau unter drei Jünglingen aufhält. Die sitzende Frau mit<br />
Kalathos oder Spindel repräsentiert, wie wir gesehen haben, in der Mehrheit der Fälle trotz des<br />
Geldbeutels den Prototyp der arbeitenden Hausherrin. Eine detailliertere Interpretation der Oikosszene<br />
muss jedoch unterbleiben, da es an weiteren Anhaltspunkten mangelt, um die Tätigkeiten und sozialen<br />
Rollen der abgebildeten Personen genauer bestimmen oder eine Aussage darüber machen zu können,<br />
in welchem Personenverhältnis diese zueinander stehen.<br />
Ganz ähnlich verhält es sich mit einer Schale im Basler Kunsthandel III/29. Auch dort sind die<br />
Männer gegenüber den Frauen in der Überzahl. Die Hausarchitektur wird durch eine einzelne Säule<br />
mit Gebälk angedeutet, unter dem Henkel steht auf einem rechteckigen Podest ein Kalathos. Seine<br />
Besitzerin nimmt eben aus der ausgestreckten Rechten eines bärtigen Mannes einen Geldbeutel<br />
entgegen. Hinter ihrem Klismos steht ein Jüngling mit Bürgerstock (Taf. 16 Abb. 5). Auf der anderen<br />
Seite der Schale sitzt ein Mann auf einem Klismos, den wir uns aufgrund des langen Bartes und des<br />
Sitzmotivs als älteren bzw. alten Mann vorstellen dürfen. Eine vor einem Klismos stehende Frau bietet<br />
einem völlig verhüllten Jüngling mit Bürgerstock einen Skyphos von beeindruckender Größe an. An<br />
der Wand hängen ein Sakkos und ein kugeliger Korb (Taf. 16 Abb. 6). Letzterer begegnet zwar häufig<br />
in Symposionsszenen, in dem Korb hier werden jedoch Textilien verwahrt, von denen ein fransiges<br />
Stoffband über den Rand hinausragt.<br />
Auf einem Krater in Rom III/30 (Taf. 16 Abb. 1) sind sich in achsensymmetrischer Bildaufteilung,<br />
umflattert von zwei Eroten, ein Jüngling mit Geldbeutel und Hund 521 und eine Frau mit Blüte und<br />
Wollkorb gegenübergestellt. Es handelt sich hier zwar streng genommen um keine 'spinnende Hetäre',<br />
der Wollkorb mag aber als Rechtfertigung genügen, die Darstellung hier unter der Rubrik „Textilarbeit<br />
und Geld“ zu nennen. Man würde in den beiden bereitwillig ein Ehepaar sehen, hielte der junge Mann<br />
in seiner Hand nicht einen Geldbeutel. Sogleich wird aus der anständigen Hausfrau eine Hetäre, die<br />
ihren Körper für Geld verkauft. 522 Die beiden Eroten brachte man ohne Schwierigkeit in Einklang mit<br />
521 C. Schneider, Herr und Hund auf archaischen Grabstelen, JdI 115, 2000, 31–36. Neben den archaischen Grabstelen ist<br />
auch die Vasenkunst des 6. und frühen 5. Jhs. v. Chr. Gegenstand der Betrachtung. Auch wenn das Motiv des Mannes<br />
mit Hund gegen Ende des 6. Jhs. v. Chr. auf den Grabreliefs verschwindet, bleibt es dennoch in der rotfigurigen<br />
Vasenmalerei weiter in Gebrauch. Es steht zu vermuten, dass den Vasendarstellungen des 5. Jhs. keine andere inhaltliche<br />
Aussage innewohnt, wie denen des 6. Jhs. v. Chr. Symposion, Jagd und der Krieg sind als Aspekte aristokratischen<br />
Lebenswandels auch für die Demokratie adaptierbar.<br />
522 Meyer 1988, 109 Abb. 22 bezeichnet die Darstellung als romantische Version der Hetärenwerbung; Dierichs 1993, 87;<br />
Reinsberg 1993, 124:“ Auch diese beiden, die wie ein einträchtiges Ehepaar, versehen mit den gebührenden<br />
Tugendsymbolen, durch den göttlichen Eros zusammengeführt werden, entlarvt der Geldbeutel in der Hand des Mannes<br />
als eine Prostituierte mit ihrem Freier.“<br />
S e i t e | 115
dem Hetärenwesen. Dass Liebe und Liebesverlangen auch im Zusammenhang mit bezahltem Sex eine<br />
Rolle spielen, muss aber nicht bedeuten, dass Eros oder sein Alter Ego Himeros auch tatsächlich im<br />
Bild diese Verbindung eingehen. Eine Untersuchung des Eros-Motivs und seiner<br />
Verwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bildkontexten der Vasenmalerei wird im Rahmen<br />
des fünften Kapitels diese Hypothese bestätigen und soll hier bereits kurz vorweg genommen werden.<br />
Eros ist in der Vasenmalerei der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., also in der Zeitspanne, in welcher der<br />
fragliche Krater entstanden ist, eben nicht als Teilnehmer rauschender Feste und Befürworter der<br />
käuflichen Liebe verbürgt. Dagegen begegnet er eher bodenständig seit Beginn des 5. Jh. v. Chr.<br />
häufig im häuslichen, und seit der zweiten Hälfte des 5. Jhs. im hochzeitlichen Kontext. Das<br />
Bekränzen des Paares durch Eros, das auf dem Krater III/30 zu sehen ist, ist aus der hochzeitlichen<br />
Ikonographie entlehnt. Dies führt zu dem Schluss, dass sich hier nun doch ein Ehepaar in<br />
Vorbildfunktion und mit ihren geschlechtsspezifischen Attributen ausgestattet der Öffentlichkeit<br />
präsentiert. Die Blüte steht für natürliche Schönheit, der Wollkorb für häusliche Pflicht und Tugend.<br />
Der Geldbeutel, der hier im Übrigen auch nicht dargeboten, sondern nur gehalten wird, ist Chiffre für<br />
den Wohlstand des athenischen Bürgers und deutet keinesfalls auf den Kauf oder Verkauf von Sex<br />
hin.<br />
Auf den beiden Seiten einer Pelike in Adolphseck III/31 wird jeweils eine Frau von einem Mann mit<br />
Geld umworben. Wie auf dem Krater in Rom III/30 ist eine der beiden Frauen durch eine Blüte und<br />
Kalathos charaktersiert, während die andere sich nur durch eine Blüte auszeichnet. Die Forschung war<br />
bestrebt, die beiden Darstellungen in eine Beziehung zueinander zu setzen. Ein möglicher<br />
Interpretationsansatz erklärte die Frau mit dem Wollkorb zur anständigen Bürgerin (Taf. 17 Abb. 2),<br />
die sitzende Frau, die an ihrer Blüte riecht, zur Hetäre (Taf. 17 Abb. 3). 523 Eine solche Interpretation<br />
widerspricht dem üblichen Interpretationsschema insofern, als der Geldbeutel hier dann<br />
ausnahmsweise doch eine Rolle bei der Werbung um eine anständige Frau spielen würde. S. von<br />
Reden versucht den Akzent der Szene auf den Darstellungsmodus des Mannes zu legen. Ihrer Ansicht<br />
nach thematisiere die Szene das vorbildliche Verhalten des athenischen Bürgers, welches dieser<br />
einmal im Beisein einer Hetäre – also außerhalb –, und einmal im Beisein seiner Ehefrau – also<br />
innerhalb seines eigenen Oikos – unter Beweis stelle, wobei auch die Bedeutung des Geldbeutels je<br />
nach Darstellungskontext variiere. 524 Ob eine solch feinsinnige Unterscheidung der Ikonographie im<br />
Sinne des Vasenmalers und für den Betrachter zu verstehen war, ist nur zu vermuten, einen echten<br />
Beleg für die Interpretation der Dame mit Blume als käufliche Dirne bleibt S. von Reden uns aber<br />
schuldig. Es fehlen zumindest im Falle der Dame mit Blüte also – anders als im Falle des Berliner<br />
Alabastron III/24 oder der Hydria in Heidelberg III/26 – eindeutige, für uns heute nachvollziehbare<br />
Merkmale, die eine Deutung als Haus- oder Ehefrau plausibel machen würden. Eine Ambivalenz im<br />
Bild mag vom Vasenmaler beabsichtigt sein, so dass es dem Besitzer des Gefäßes überlassen blieb, ob<br />
523 E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and<br />
Iconography (Wisconsin 1983) 229; M. Beard, Adopting an Approach II, in: T. Rasmussen – N. Spivey (Hrsg.), Looking<br />
at Greek Vases (Cambridge 1991) 26–30. Das Sinnen über das Verschwimmen von Grenzen in der Ikonographie von<br />
Ehefrau und Hetäre ist für eine konkrete Interpretation wenig hilfreich.<br />
524 S. von Reden, Exchange in Ancient Greece (London 1995) 207 f.: „The money pouch, rather than defining unequivocally<br />
a specific type of relationship between man and woman, stands fort the various aspects of male life in the polis. In both<br />
images it defines normative behaviour, yet in a different context.” Die zwei Tugenden des Mannes benennt sie mit den<br />
griechischen Begriffen schole und arete.<br />
S e i t e | 116
er nun eine Bürgerin und/oder eine Hetäre darin erkannte. Festzuhalten bleibt, dass eine Interpretation<br />
der Frau bzw. Frauen als Hetäre auf Basis des Geldbeutels zumindest nicht zwingend ist. Aus dem<br />
zugegebermaßen begrenzten Fundus an weiblichen Attributen wurde mit dem Wollkorb ein Attribut<br />
gewählt, das den Arbeitsalltag der Frau und darüber hinaus auch die charakterliche Disposition<br />
beschreibt, während die Blüte die äußerlichen Vorzüge hervorhebt. Es werden also unterschiedliche<br />
Eigenschaften der Frau thematisiert, die das Interesse des Mannes wecken.<br />
Die Werbung mit Geld um eine 'spinnende Hetäre' ist, wie der Überblick gezeigt hat, ein keineswegs<br />
häufig auftretendes Motiv. Tatsächlich sind es nur vereinzelte Beispiele, die die Kombination von<br />
Geld und Spinnen illustrieren, und in den meisten Fällen sind berechtigte Einwände angebracht, die<br />
spinnende Person als Hetäre zu deklarieren. Die bisher auf breitem Konsens basierende Deutung, der<br />
Geldbeutel komme nur zum Zweck erotischer Werbung zum Einsatz, kann somit in dieser Form nicht<br />
aufrechterhalten werden. Obgleich also der Geldbeutel in keinster Weise als Signal für den Hetären-<br />
Status der umworbenen Frau verstanden werden darf, ist nicht völlig auszuschließen, dass er<br />
theoretisch auch im Kontext des Dienstleistungsgewerbes verwendet werden kann, d. h. bei der<br />
Begegnung mit einer Hetäre mitgeführt wird und hier dann auch auf die Möglichkeit des Erwerbs von<br />
sexuellen Dienstleistungen hinweist. Nicht alle Vasenbilder geben hilfreiche Hinweise auf den<br />
bürgerlichen Status oder häusliche Tugenden der dargestellten Frauen. Andererseits waren die<br />
entscheidenden Argumente der 'spinnenden Hetäre'-Theorie die Geschlechterseparation innerhalb der<br />
athenischen Gesellschaft und die Festlegung des Geldbeutels als Instrument bei der Werbung um<br />
Hetären. Beide Prämissen konnten weitestgehend entkräftet werden. Männer und Frauen treffen in der<br />
Vasenmalerei nicht nur in ihrer Funktion als Hetäre und Kunde aufeinander, wie die Oikosszenen<br />
deutlich gemacht haben. Und der Geldbeutel wird nicht nur vor einem erotisch-sexuellen Hintergrund<br />
verwendet, sondern ist Attribut des gut situierten Mannes.<br />
3. 4. 1. 2. Die 'spinnende Hetäre'<br />
Den Begriff der 'spinnenden Hetäre' hat G. Rodenwaldt bereits im Jahre 1932 geprägt. 525 Er<br />
widersprach damit J. Beazley, der die Ansicht vertrat, dass Hetären, auch wenn sie im realen Leben<br />
vielleicht tatsächlich gesponnen haben mögen, niemals als Spinnerinnen in die Bildkunst eingegangen<br />
wären: „The woman is spinning: therefore she is respectable; if she were not respectable, she might<br />
spin in her spare moments, but she could not be represented spinning.“ 526 Spinnende Frauen, nackt wie<br />
etwa auf der Hydria in Kopenhagen III/32 (Taf. 16 Abb. 4) oder im Beisein von Männern, hatten zur<br />
Folge, dass die spinnende Frau in den Augen der Forschung ihren Anspruch auf Anständigkeit<br />
mitsamt ihrem Bürgerstatus verlor. Besonders der Geldbeutel als Instrument männlicher Dominanz<br />
verzerrte das Bild der spinnenden Frau, die man bisher nur als fleißige Hausherrin auf zahllosen<br />
Bildern des Frauenlebens kannte: die „spinnende Hetäre“ war geboren. Dies bedeutete, dass das<br />
Spinnen, das ursprünglich als Beschäftigung der tugendhaften Ehefrau galt, nun zum Charakteristikum<br />
525 G. Rodenwaldt, Spinnende Hetären, AA 1932, 7–22.<br />
526 J. D. Beazley, JHS 51, 1931, 121.<br />
S e i t e | 117
der Hetären avancierte. Der offenkundige Widerspruch zwischen der häuslichen Tätigkeit des<br />
Spinnens und der käuflichen Natur der Spinnerinnen wurde mit der Aussage erklärt, Freier bemühten<br />
sich mittels Geld um die sexuelle Gunst von Prostituierten, die der erotischen Ausstrahlung willen<br />
durch die Tätigkeit des Spinnens den Vergleich mit den tugendsamen und biederen Bürgerinnen<br />
suchten. 527<br />
Rodenwaldts 'spinnende Hetären' haben in der Forschung breite Resonanz gefunden und wurden lange<br />
Zeit nicht in Frage gestellt. 528 Sie waren derart unangefochten, dass G. Ferrari noch im Jahre 2002<br />
schreiben konnte: „The seated spinner is a standard character not in domestic scenes but in scenes of<br />
courtship.“ 529 Rodenwaldts suggestive Herangehensweise und sein stark von seinem eigenen<br />
zeitgenössischen, gesellschaftlichen Hintergrund durchdrungenes Verständnis der griechischen Kultur-<br />
und Sozialgeschichte sind mit dem heutigen wissenschaftlichen Anspruch jedoch nicht mehr<br />
vereinbar. 530 Seine Argumentation gründet sich zum einen auf die Überzeugung einer in der<br />
griechischen Gesellschaft konsequent realisierten und infolge dessen auch auf die Vasenmalerei<br />
übertragenen Geschlechtertrennung, andererseits auf bestimmte Attribute wie das Flötenfutteral 531 und<br />
insbesondere den Geldbeutel, die es in seinen Augen leicht machen, die „getrennten Welten der<br />
Hausfrauen und der Hetären“ zu unterscheiden. 532 Schon seine Prämisse „Frauen in der Gynaikonitis<br />
pflegen in der Regel allein oder untereinander dargestellt zu werden, Hetären im Zusammensein mit<br />
Männern“ 533 kann in ihrer Absolutheit nicht mehr aufrechterhalten werden. Die vorgestellten Bilder<br />
zum Mann im Oikos entziehen ihr jede Grundlage. 534 Und auch was den Geldbeutel anbelangt, wurde<br />
versucht deutlich zu machen, dass man sich bisher viel zu sehr auf eine einzige Deutung versteift hat.<br />
In der Debatte um die 'spinnende Hetäre' kommt einer Schale aus einer Privatsammlung in München<br />
III/33 (Taf. 16 Abb. 5. 6) eine besondere Bedeutung zu. Zwei der Frauen in männlicher Begleitung,<br />
527 z. B. Dierichs 1993, 87 mit weiteren Literaturhinweisen; Reinsberg 1993, 123 f.; Reeder 1995, 217; Davidson 1999, 111<br />
f.: „Die Symbole einer tugendhaften Beschäftigung wurden zu etwas ganz und gar Anzüglichem, zu einem dichten<br />
Gestrüpp von Verführung und Verzauberung, zu Fäden von Wollknäueln und Spinnennetzen." Badinou 2003, 4–7. – Die<br />
Ansicht, es sei die Verführung im Grunde anständiger Frauen in Szene gesetzt, vertreten z. B. Keuls 1985, 260; J. F.<br />
Crome, Spinnende Hetären?, Gymnasium 73, 1966, 245–247.<br />
528 Überblick über die Diskussion, s. Sutton 1981, 347–349; Badinou 2003, 4–7; Heinrich 2006, 79–81 zieht die Existenz der<br />
'spinnenden Hetäre' in Zweifel.<br />
529 G. Ferrari, Figures of Speech. Men and Maidens in Ancient Greece (Chicago 2002) 33.<br />
530 Rodenwaldt a. O. (Anm. 525) 10: Dies wird etwa in der Formulierung der Frage offenkundig, ob das Motiv der jungen,<br />
harmonischen Familien in der Zeit der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. „überhaupt darstellenswert war, ob, anders<br />
ausgedrückt, ein kleinbürgerlich-sentimentales Sittenbild im Stil der siebziger und achtziger Jahre des vergangenen<br />
Jahrhunderts jener Zeit gemäß war.“ Es ist nicht ganz klar, ob er sich hierbei auf das vorab erwähnte Alabastron, Athen,<br />
Akropolis Mus. 2713, bezieht: dargestellt eine sitzende Spinnerin, der sich ein Jüngling mit einem Hasen nähert.<br />
531 Zur Flötenbegleitung bei den Symposien, s. Peschel 1987, 35–40.<br />
532 Obgleich das Flötenfutteral oft in Symposionsszenen zu finden ist, sollten die zahlreichen Darstellungen im Rahmen des<br />
Oikos musizierender Frauen genügen, um die Flöte bzw. den Diaulos nicht als ausschließliches Instrument der<br />
Unterhaltungsbranche abzutun. In Plat. symp. 176b wird die als Unterhalterin gemietete Flötenspielerin im Übrigen nach<br />
nebenan zu den Frauen geschickt, damit sich die anwesenden Herren ungestört ihren philosophischen Gesprächen<br />
widmen können.<br />
533 Rodenwaldt a. O. (Anm. 525) 8.<br />
534 vgl. v. a. Kap. 2. 5. 2 und 2. 5. 3.<br />
S e i t e | 118
die u. a. mit Wolle und Spindeln hantieren, sind nämlich durch Beischriften mit den Namen<br />
Aphrodisia und Obole versehen. 535 Die Namen, von denen der eine eine der Frauen als Liebesdienerin<br />
kennzeichnet und der andere einen konkreten Kaufpreis nennt, scheinen für Prostituierte treffend<br />
gewählt. 536 Als einziges Gefäß enthielte es so schwarz auf weiß den langersehnten Beweis für den<br />
direkten Zusammenhang von Prostitution und Wollarbeit und lieferte folglich die ersehnte Bestätigung<br />
für die 'spinnende Hetäre'. 537 Doch auch hier bleiben Fragen offen. Ein bis zwei Obolen sind als<br />
Standardpreis für eine Porne überliefert. Mit einem Blick auf den reichen Schmuck der abgebildeten<br />
Frauen lässt sich aber mit Sicherheit sagen, dass die Flötenspielerin trotz ihres Namens Obole einer<br />
gehobenen Stufe der Unterhaltungsbranche angehört und damit ebenso wenig eine Porne ist wie<br />
Aphrodisia, die in den bereits vollen Wollkorb einer weiteren Frau eine Spindel oder ein Wollknäuel<br />
legt. 538 In Ermangelung einer anderen Deutung lässt sich dieser Interpretation vorerst nichts<br />
entgegensetzen. Viele andere Geldbeutelszenen dagegen boten, wie gezeigt wurde, zahlreiche<br />
Argumentationsansätze, um die Identifikation der Spinnerin als Hetäre zu entkräften.<br />
3. 4. 1. 3. Die Semiotik des Spinnens<br />
Welchen Stellenwert nimmt das Spinnen in der antiken Literatur ein und welche reale Bedeutung hatte<br />
es im Alltagsleben? Erst vor wenigen Jahren wurden die Ikonographie der Webszenen und ihre<br />
Entwicklung in der Vasenmalerei von M. Vidale einer sorgfältigen Analyse unterzogen. Der Autor<br />
kam dabei zu dem überraschenden Schluss, diese Bilder seien Wiedergaben minderwertiger Arbeiten<br />
und keineswegs im Sinne einer positiven Evaluierung weiblicher Arbeit zu verstehen. 539 Dass Spindel<br />
oder Spinnrocken im Laufe der Klassik zu reinen Attributen degradiert werden, die Gerätschaften<br />
nicht mehr richtig gehandhabt oder teilweise Sinn entfremdet durch Blüten ersetzt werden, muss<br />
meiner Ansicht nach nicht heißen, dass die Arbeit der Frauen nun plötzlich negativ belegt wird,<br />
sondern dass nun andere Charaktereigenschaften oder Tätigkeiten in den Vordergrund rücken. 540 Der<br />
Wandel in den Darstellungskonventionen der Webszenen in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. geht<br />
einher mit einem generellen Wandel des Frauenbildes.<br />
535 Auflistung der Hetärennamen, s. RE VIII (1913) 1362–1372 s. v. Hetairai (K. Schneider); Peschel 1987, 74–79. 326 f. –<br />
Zu den Preisen im Prostituiertengewerbe, s. z. B. Reinsberg 1993, 144 f.<br />
536 H. R. Immerwahr, An Inscribed Cup by the Ambrosios Painter, AK 27, 1984, 11 hält “Obole” für einen Schreibfehler des<br />
Namensbestandteils „-boule“.<br />
537 Davidson 1999, 111; Sutton 2004, 334 f. ist diese Vase der ultimative Beweis dafür, dass Wollarbeit keine Metapher für<br />
Anständigkeit ist.<br />
538 D. Williams, Women on Athenian Vases: Problems of Interpretation, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.), Images of<br />
Women in Antiquity (London 1993) 97 benennt irrtümlicherweise die Frau neben Aphrodisia als Obole.<br />
539 Vidale 2002, 486: „non favorevole al ruolo e all´ immagine della componente femminile delle società greche del tempo“;<br />
ebenda 489: “visioni diminutive e peggiorative del lavoro femminile“.<br />
540 S. Moraw, Unvereinbare Gegensätze? Frauengemachbilder des 4. Jhs. v. Chr. und das Ideal der bürgerlichen Frau, in: R.<br />
von den Hoff – S. Schmidt (Hrsg.), Konstruktionen von Wirklichkeit. Bilder im Griechenland des 5. und 4. Jhs. v. Chr.<br />
Interdisziplinäres Kolloquium vom 27.9.–1.10.1999 in Schloss Reisensburg bei Günzburg (Stuttgart 2001) 217 f.<br />
S e i t e | 119
Die Literatur vermittelt uns eine völlig konträre Wertschätzung der handwerklichen Fähigkeiten der<br />
Frauen. Die Kunstfertigkeit des Webens und Spinnens wird seit Homer als herausragende Fähigkeit<br />
der Frauen gepriesen. In einer Gesellschaft, die auf keine Textilindustrie zurückgreifen kann, ist das<br />
Anfertigen von Kleidung und Stoffen für den eigenen Hausgebrauch eine wichtige wirtschaftliche<br />
Komponente. 541 An den Worten des Ischomachos bei Xenophon wird z. B. deutlich, dass das Wissen<br />
um die Textilherstellung bei einem jungen Mädchen, das das heiratsfähige Alter erreicht hatte, zwar<br />
gewissermaßen vorausgesetzt, nichtsdestoweniger aber geschätzt wurde. 542 Nicht zuletzt gehörte das<br />
Weben zu den wenigen erlernten Fähigkeiten, welche die athenische Frau gewerblich nutzen konnte.<br />
Wie man am Beispiel der Verwandten des Aristarchos sieht, war insbesondere das Weben eine sich für<br />
Frauen aus gutem Hause geziemende und vor allem nützliche Tätigkeit:<br />
S e i t e | 120<br />
Nun aber verstehen sie sich doch, wie es den Anschein hat, auf offenbar überaus schöne<br />
und für Frauen besonders passende Arbeiten. Eine jede aber leistet am leichtesten und<br />
schnellsten und schönsten und angenehmsten die Arbeiten, die sie versteht. Zögere also<br />
nicht, so sagte er, sie darin einzuführen, was dir und ihnen zugute kommen wird; und<br />
sicherlich werden sie dir gern Folge leisten. (Xen. mem. II, 7, 10)<br />
Allein aus der Vielzahl an Darstellungen, die diesem Sujet ab dem 5. Jh. v. Chr. gewidmet sind, ist<br />
wohl zu schließen, dass man das Weben und Spinnen der Frauen guthieß und anerkannte. 543 Das Bild<br />
der spinnenden Frau ist also zunächst durchaus ein historisch belegbarer Aspekt des Alltagslebens der<br />
athenischen Hausfrau. 544 Inwieweit die Hausfrau in der Realität ihre übergeordnete Stellung nutzte<br />
und das Spinnen und Weben im Ganzen bzw. die anstrengenderen Prozesse der Wollherstellung und -<br />
verarbeitung an die Dienerinnen und Sklavinnen delegierte, kann nur vermutet werden. 545 In<br />
Xenophons „Oikonomikos“ erhalten wir jedoch den Eindruck, dass dies, soweit es die Stellung der<br />
Familie erlaubte, tatsächlich so gehandhabt wurde. 546 Im Hinblick auf die Einbindung der Ehefrau in<br />
die Strukturen des athenischen Oikos ist das Weben und Spinnen nie nur Ausdruck einer typisch<br />
weiblichen Beschäftigung, sondern ist ihr produktiver Beitrag zum Wirtschaftskreislauf und zur<br />
Autarkie ihres Haushaltes. Das Weben ist die paradigmatische Arbeit schlechthin, um die Nützlichkeit<br />
der Ehefrau für den Oikos zu versinnbildlichen. „Tramite filatura e tessitura la donna può esprimere le<br />
541 Mercati 2003, 34. 37. – Die ökonomische Relevanz von Textilien, s. Reuthner 2006, 182–190; anders hingegen E. C.<br />
Keuls, Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and Iconography<br />
(Wisconsin 1983) 215–230; Keuls 1985, 99, die von der Ausbeutung der Hausfrau überzeugt ist: “Wives were<br />
condemned to a lifetime of labor at spindle and loom […].“<br />
542 Xen. oik. 7, 6.<br />
543 Bundrick 2008, 283. – E. Keuls, The Hetaira and the Housewife. The Splitting of The Female Psyche in Greek Art,<br />
MededRom N.S. 9/10, 1983, 29 verweist auf einen anderen Aspekt der Ikonographie der spinnenden Frau. Der Mythos<br />
gibt zahlreiche Beispiele, wo das Spinnen und Weben als Metapher für das Spinnen von Intrigen, für die Unaufrichtigkeit<br />
und Falschheit der Frauen steht. Im Rahmen der Oikosszenen kommt diese Perspektive aber sicherlich nicht zum Tragen.<br />
544 Reuthner 2006; Heinrich 2006, 138 vertritt die Ansicht, „dass das Bild der Frau, die im Oikos Garn und Kleidung für<br />
dessen Bewohner herstellt und nicht mit Geschäften außerhalb des Hauses zu tun hat, ein Ideal darstellte und nicht der<br />
Realität entsprach“.<br />
545 Mercati 2003, 38.<br />
546 Xen. oik. 7, 40 f.
sue capacità e mostrarsi socialmente utile“, schreibt etwa C. Mercati. 547 Auf einer assoziativen Ebene<br />
entwickelt sich das Spinnen in der Bildkunst schließlich zum festen Charakteristikum der tugendhaften<br />
und fleißigen Hausfrau und zum Sinnbild für einen guten Oikos und eine glückliche Ehe. 548 Es erhält,<br />
so F. Lissarague, einen „symbolischen Wert, der über den anekdotischen Charakter der Bilder weit<br />
hinausweist." 549<br />
Was aber kann oder soll nun eine spinnende Hetäre dem Betrachter mitteilen? Die Erklärung, Hetären<br />
ahmten bewusst bürgerliche Tugendhaftigkeit nach, um ihre erotische Wirkung auf den Kunden zu<br />
verstärken, wurde bald als unzureichend und subjektiv empfunden. Folglich argumentierte man, das<br />
Weben und Spinnen sei eine geschlechtsspezifische Arbeit und somit keine ausschließlich den<br />
Hausfrauen vorbehaltene Tätigkeit gewesen. So bekräftigte erst jüngst S. Schmidt: „Dass die<br />
Beschäftigung mit Wolle für eine Prostituierte nicht als unpassend oder untypisch angesehen wurde,<br />
lässt ermessen wie grundsätzlich für einen Athener und vermutlich auch für eine Athenerin die<br />
Verbindung dieser Tätigkeit mit dem Frausein war. Auf den Vasenbildern wurde mit ihnen weder<br />
exklusiv die Hausfrau noch die Hetäre in einem bestimmten Rollenbild charakterisiert, sondern die<br />
gute Frau im Allgemeinen.“ 550<br />
Vereinzelt wurde in der Tat davon ausgegangen, dass Prostituierte in ihrer 'Freizeit' die Produktion<br />
von Textilien als Zweiteinkommen nutzten. 551 Dass sie über das nötige Wissen verfügten, erfahren wir<br />
aus der Tatsache, dass viele von ihnen ihren Lebensunterhalt zuvor als professionelle Weberinnen<br />
verdient haben. Lag es aber tatsächlich in der Absicht der Vasenmalerei, eine Hetäre als gute Frau<br />
darzustellen? Ist es vorstellbar, dass in der Bildkunst im Falle der Hetäre dieselben Werte transportiert<br />
werden wie im Fall der Ehefrau und Hausfrau, nämlich Fleiß und Tugend? 552 Denn eben wurde ja<br />
konstatiert, dass der antike Betrachter eben diese Charaktereigenschaften mit dem Bild der spinnenden<br />
547 Mercati 2003, 37; s. auch F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike<br />
(Frankfurt a. M. 1993) 235: Spinnerin als „ergatis“ nach dem Vorbild der Penelope gestaltet; Bundrick 2008, 283. 286.<br />
316.<br />
548 G. Ferrari, Figures of Speech. Men and Maidens in Ancient Greece (Chicago 2002) 57 sieht das Spinnen dagegen als<br />
unbeschwerter Zeitvertreib der Parthenos neben dem Ball Spielen, Blumen Pflücken und dem Kränzeflechten. „It is<br />
apparent that the scenes of wool-working concern neither domestic husbandry nor, strictly speaking, the persona of the<br />
dutiful wife in the context of the family.” Badinou 2003, 3: „Aucun auteur ne parle en effet d´hetaires ou de prostituées<br />
qui travaillaient la laine. Tous les textes mentionennés cidessous donnent à la fileuse ou à la tisseuse le profil de l´epouse<br />
fidèle qui, enfermée dans la maison, s´occupe de la laine pour la prospérité de son foyer. Le travail de la laine démontre<br />
par conséquent les compétences de la femme et dèfinit la bonne épouse.” Trotz dieses deutlichen Statements bleibt der<br />
Glaube an die Existenz der spinnenden Hetären auf Darstellungen der attischen Vasenmalerei weiter bestehen; Heinrich<br />
2006, 134 f. schließt sich der Position Ferraris an, auch wenn sie eingestehen muss, dass die von ihr zu Rate gezogenen<br />
Schriftquellen das Spinnen eher mit den Ehefrauen verknüpfen; s. auch Bundrick 2008, 303 f.<br />
549 F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 238.<br />
550 Sutton 2004, 333. 335S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v.<br />
Chr. (Berlin 2005) 262.<br />
551 Davidson 1999, 109–113; S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5.<br />
Jahrhundert v. Chr. (Berlin 2005) 261 f.; Heinrich 2006, 81 bezweifelt aber, dass das auf den Vasen dargestellt wurde. –<br />
Zu professionellen Wollarbeiterinnen und Webern, s. Heinrich 2006, 139 f.; Reuthner 2006, 246–260.<br />
552 Ferrari a. O. (Anm. 548) 36: “It is hard to believe that these encounters are part of the everyday life of the Athenians, but<br />
it is just as difficult to believe that our figures represent hetairai making use of such strong connotations of virtue.”<br />
S e i t e | 121
Hausfrau assoziierte. Dieser Widerspruch lässt sich kaum mit dem konstruierten Einwand beheben, die<br />
Hetären umgäben sich mit einer Aura von biederer Bürgerlichkeit, um ihre erotische Wirkung auf die<br />
männliche Kundschaft zu verstärken. 553 Aus dem Fall der Neaira erfahren wir im Gegenteil, wie sehr<br />
sich die Bürgerinnen darüber entrüsteten, dass sich die Angeklagte das Leben einer respektablen Frau<br />
angemaßt habe. 554 Die postulierte erotische Ausstrahlung der Ehefrau gründet sich auf ein<br />
Sammelsurium bestimmter Charakter- wie Wesenseigenschaften, die sie für den athenischen Mann<br />
attraktiv machen. 555 Dazu gehört die Tugend ebenso wie Engagement für den Oikos und ein<br />
angenehmes Äußeres. Eine beabsichtigte Gleichsetzung von Textilverarbeitung und sexueller<br />
Attraktivität ist in den antiken Quellen jedoch grundsätzlich nicht nachweisbar. Die von J. F. Crome<br />
gesammelten Textpassagen zeigen lediglich, dass viele Frauen den mageren Verdienst der Handarbeit<br />
gegen den vermutlich etwas lukrativeren der Prostitution eintauschten. 556 Die wirtschaftlichen<br />
Möglichkeiten der Frauen in der Antike waren sehr beschränkt. Um sich aus der Armut zu befreien,<br />
stellten sie Kleidung her, verkauften handgemachte Produkte wie Kränze oder Bänder auf dem Markt<br />
oder schlugen eben den Weg der Prostitution ein. Bei den Spinnerinnen in der Vasenkunst handelt es<br />
sich jedoch kaum um die Art von Frauen, die sich ihr Zubrot durch beschwerliches Weben verdienen<br />
mussten! Im Nachhinein erscheint es vielmehr, als hätte der sexuelle Charakter des Webens und<br />
Spinnens nur deshalb Eingang in die Forschung gefunden, um eine plausible Erklärung für die<br />
Deutung der weiblichen Personen als 'spinnende Hetären' bieten zu können.<br />
S e i t e | 122<br />
3. 4. 2. Geldbeutelsszenen ohne Textilkontext<br />
Es gibt gerade aus dem Bereich der Geldbeutelszenen noch weitere Darstellungen, die es nicht<br />
geboten erscheinen lassen, auf einer Interpretation der Frau als Hetäre zu beharren, auch wenn wir hier<br />
keine Verweise auf die Hausarbeit oder den Arbeitsalltag der Frauen finden. Im Einzelnen sind es<br />
vielfach beigefügte Attribute, Gegenstände oder Tiere, die dem Bild Bedeutungsnuancen verleihen,<br />
die über eine Kategorisierung des Bildes als Werbeszene hinausreichen.<br />
Im Tondo einer Schale in Kopenhagen III/34 (Taf. 17 Abb. 1) Kopenhagen greift ein Jüngling nach<br />
der Hand der vor ihm stehenden jungen Frau. Diese Geste, die an den cheir epi karpo-Gestus erinnert,<br />
553 E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and<br />
Iconography (Wisconsin 1983) 229 dreht den Spieß um: “From what we can surmise about conjugal relations in Classical<br />
Athens, it would seem that a man would rather see his wife disguised as a hetaira than his companion for the evening<br />
masquerading as his wife.” s. auch Keuls 1985, 258.<br />
554 C. B. Patterson, The Case against Neaira and the Public Ideology of the Athenian Family, in: A. L. Boegehold – A. C.<br />
Scafuro (Hrsg.), Athenian Identity and Civic Ideology (Baltimore 1994) 199–216; Badinou 2003, 71 f.: “Une hétaire libre<br />
pouvait donc mener la même vie qu´une épouse, comme le confirme le cas de Nééra [...].” Angesichts des Protests, den<br />
der Ankläger den freien Frauen hinsichtlich der Anmaßung der Neaira in den Mund legt, halte ich diese These für<br />
unhaltbar.<br />
555 Nach Keuls 1985, 259 demonstrieren spinnende Frauen philergia “which men found sexually appealing in all women,<br />
whether they belonged to the category of citizen women or to that of prostitutes.” Reinsberg 1993, 123 f.; Badinou 2003,<br />
72.<br />
556 J. F. Crome, Spinnende Hetären?, Gymnasium 73, 1966, 245–247.
mit dem der Bräutigam während der Hochzeitsprozession seine Braut nach Hause führt 557 , steht im<br />
krassen Gegensatz zu dem Geldbeutel im Besitz des jungen Mannes. 558 Erst jüngst wurde erneut<br />
versucht den offensichtlichen Widerspruch zwischen dem cheir epi karpo-Gestus und dem Geldbeutel<br />
dadurch zu erklären, dass das Vasenbild dokumentiere, wie sich eine Hetäre als anständige Ehefrau<br />
ausgebe. P. Badinou glaubte sogar in Neaira einen historischen Beleg gefunden zu haben für die<br />
Praxis, dass sich manche Prostituierte den Rang einer Bürgerin anmaßte, indem sie vorgab, mit einem<br />
athenischen Bürger verheiratet zu sein. 559 Mit Biegen und Brechen werden Geldbeutel und<br />
Hochzeitsgestus in ein Formschema gepresst. Vielleicht sollte man sich einfach eingestehen, dass es<br />
den Geldbeutel als Attribut des Mannes auch außerhalb käuflicher Beziehungen gibt.<br />
Eine Geldübergabe oder Hetärenwerbung ist auf der weißgrundigen Lekythos in London III/35 (Taf.<br />
17 Abb. 2) schon allein deshalb auszuschließen, weil diese eine nachweislich im Grabkult verwendete<br />
Gefäßform ist. Es ist meines Wissen die einzige Abbildung eines Geldbeutels auf einer weißgrundigen<br />
Lekythos. Die weibliche Figur ist durch eine Blüte und einen Spiegel gekennzeichnet, beides<br />
wiederum Zeichen ihrer Schönheit, den Mann beschreiben Bürgerstock und Geldbeutel als finanziell<br />
gut situierten Bürger. Weder handelt es sich nachweislich um eine Werbung im eigentlichen Sinne<br />
noch um die Darstellung einer Hetäre.<br />
Auf der Oinochoe in San Antonio III/36 (Taf. 17 Abb. 3) reicht der Jüngling der sitzenden Frau die<br />
Blüte anstelle des Geldbeutels. Gewöhnlich entschuldigt man dieses zaghaftes Vorgehen mit seiner<br />
jugendlichen Unerfahrenheit: “He tries to ease the situation by offering her a fragrant flower first.“ 560<br />
E. Reeder erklärt den Geldbeutel als visuellen Reiz, der, sollte das eigentliche Geschenk, die Blüte,<br />
nicht die gewünschte Wirkung erzielen, als Lockmittel eingesetzt wird. Den sexuellen Inhalt des<br />
Bildes sieht sie durch den Gestus der „Hetäre“ bestätigt, die den unerfahrenen Kunden mit einem<br />
Blütenzweig in der Leistengegend stimuliert. 561 Solche Gesten sind meiner Ansicht nach mehr der<br />
Zweidimensionalität der Bildkunst geschuldet, die mitunter zu Überschneidungen und<br />
perspektivischen Unklarkeiten führen. Dass die Blüte quasi zum Mittler zwischen Mann und Frau<br />
wird, zeigt, dass der Geldbeutel eben nicht als vordergründiges Gestaltungsmerkmal für die Beziehung<br />
der dargestellten Figuren intendiert ist.<br />
Auf der bereits kurz angesprochenen Pelike in Syrakus III/37 (Taf. 17 Abb. 4) streckt ein auf seinen<br />
Stock gestützter Jüngling einer jungen Frau einen Spiegel entgegen. Wie auf dem Exemplar in San<br />
Antonio III/36 hat er zusätzlich einen Geldbeutel bei sich, der aber eher als Attribut gehalten wird und<br />
557 Obwohl mit dem cheir epi karpo-Gestus eigentlich das Festhalten des Handgelenks gemeint ist, ist es m. E. dennoch<br />
gerechtfertigt, hier von diesem Gestus zu sprechen, denn es ist auch die bildliche Version überliefert, nach der der<br />
Bräutigam während der Hochzeitsprozession seine Braut an der Hand und nicht am Handgelenk nach Hause führt. Auch<br />
Kreilinger 2007, 44 sieht den Status des Paares als Braut- oder Ehepaar als erwiesen an. Das „Händchen-Halten“ von<br />
Braut- und Ehepaaren, das fern der offiziellen Hochzeitszeremonie stattfindet, ist eventuell durch die Loutrophoros,<br />
Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum L 541, hier IV/10, verbürgt.<br />
558 Meyer 1988, 111 drückt sich etwas unklar aus, wenn sie sagt, der Geldbeutel habe hier „seine Wirkung eingebüßt”;<br />
Badinou 2003, 70 f. 385 Taf. 145.<br />
559 Badinou 2003, 71.<br />
560 H. A. Shapiro et al. (Hrsg.), Greek Vases in the San Antonio Museum of Art (San Antonio 1995) 138.<br />
561 Reeder 1995, 181 f. Nr. 36.<br />
S e i t e | 123
nicht andeuten soll, dass etwas – in der Regel Sex – zum Verkauf angeboten wird. 562 Das Sitzmotiv<br />
der weiblichen Person erinnert, wie so oft zuvor, mit dem auf die hohe Lehne gelegten Ellbogen an<br />
einen gängigen Aphroditetypus. 563 Der Spiegel als Geschenk unterstreicht zusätzlich ihre Schönheit.<br />
Vögel jeder Art finden sich in zahlreichen Oikosszenen und gehören folglich standardisiert in die<br />
weibliche Sphäre. Erotische oder sexuelle Konnotationen, die manchem Tiermotiv vielleicht<br />
innewohnen, sind durchaus positiv gewerteter Bestandteil des antiken Frauenbildes. Der hier<br />
abgebildete Stelzvogel, der in der Literatur zumeist als Reiher bezeichnet wird, wird von E. Böhr als<br />
Nymphen- bzw. Jungfernkranich gedeutet und als Hinweis auf einen hochzeitlichen Kontext<br />
verstanden. 564<br />
Die Darstellung eines Epinetron in Berlin III/38 (Taf. 17 Abb. 5) gehört zu einer Vielzahl an Bildern,<br />
auf denen sich zwei Männer bzw. Jünglinge um eine Frau scharen. Eine Schale in Berkeley III/7 (Taf.<br />
11 Abb. 5) und eine Schale in Florenz III/8 (Taf. 11 Abb. 6) wurden in einem anderen Zusammenhang<br />
bereits zur Diskussion gestellt. Auf dem Epinetron in Berlin III/37 ist die betreffende Frau wie schon<br />
auf der Schale in Berkeley mit einem Alabastron ausgestattet, wohingegen ihr einer der beiden<br />
Jünglinge einen prall gefüllten Geldbeutel entgegenstreckt. Eine inhaltliche Bezugnahme, die P.<br />
Badinou mit der offensichtlichen Gegenüberstellung von Alabastron und Geldbeutel begründet, erklärt<br />
diese etwa so, dass sich Männer mit Geld bevorzugt Hetären kaufen, die sich durch Attribute der<br />
Schönheit und Anmut, zu denen auch das Alabastron zählt, besonders empfehlen. 565 Nicht ganz<br />
schlüssig ist jedoch, weshalb das Alabastron trotz seiner Exponiertheit zum bloßen Attribut reduziert<br />
werden kann, während der Geldbeutel als Geschenk und Werbeträger – weit über seine Bedeutung als<br />
Attribut der Kaufkraft hinaus – gedeutet wird. Erst kürzlich bemühte sich auch C. Mercati, die<br />
Vorurteile gegen die mit Geld umworbenen Frauen abzubauen. Die Frau wird nach dem gängigen<br />
Rollenmodell dem Betrachter durch Attribute wie das Alabastron und den Spiegel bzw. die Spindel als<br />
„dispensatrice di grazie e di charme“ vorgestellt, während der Besitz des Geldbeutels die ökonomische<br />
Verantwortung für Familie, Oikos und Polis versinnbildlicht. 566<br />
Das Vasenbild der sog. Noble-Hydria in Tampa III/39 (Taf. 17 Abb. 6) wurde bislang als Besuch bei<br />
einer Hetäre interpretiert, durch den der jüngste Sohn unter der Anleitung des Vaters seine Sexualität<br />
entdecken darf. 567 Als Schlüssel für die Darstellung wird der bärtige Mann gewertet, der durch das<br />
Anbieten von Geld den Status der unter der Hausarchitektur sitzenden Frau definiert. Die<br />
Charakterisierung der Frau entspricht zunächst recht genau dem Bild, das die literarischen Quellen von<br />
der Haus- und Ehefrau entwerfen. Das Haus ist der Ort, an dem sich eine zurückgezogene und<br />
562 Meyer 1988, 111 spricht zwar von einer Entwertung des Geldbeutels, es ist aber kaum anzunehmen, dass sie deshalb von<br />
ihrer ursprünglichen Interpretation der Szene als Werbung um eine Hetäre abrückt.<br />
563 P. Kranz, Die Frau in der Bildkunst der griechischen Klassik, in: P. Neukam (Hrsg.), Antike Literatur – Mensch, Sprache,<br />
Welt, Klassische Sprachen und Literaturen 34 (München 2000) 68–71. – Vgl. Lebes Gamikos, Athen II/6; Hydria, New<br />
York II/17; Kelchkrater Agrigent V/17.<br />
564 E. Böhr, Mit Schopf an Brust und Kopf. Der Jungfernkranich, in: A. J. Clark – J. Gaunt – B. Gilman (Hrsg.), Essays in<br />
Honor of Dietrich von Bothmer (Amsterdam 2002) 37–47. – Vgl. Pyxis, Boston II/18; Alabastron, Paris III/6; Schale,<br />
Luzern IV/7. – vgl. Kap. 2. 5. 4.<br />
565 Badinou 2003, 33 mit Verweis auf Meyer 1988, 108.<br />
566 Mercati 2003, 42; Heinrich 2006, 81 f. erkennt darin eine Liebeswerbung um eine Parthenos.<br />
567 E. Kotera-Feyer, Die Strigilis in der attisch-rotfigurigen Vasenmalerei, Nikephoros 11, 1998, 124; in diesem Sinn auch J.<br />
H. Oakley, Fathers and Sons, Men and Boys, in: Neils – Oakley 2003, 98.<br />
S e i t e | 124
tugendhafte Ehefrau aufzuhalten hat. 568 Der Eindruck einer Trennung in Innen und Außen wird durch<br />
die aufwendige Architektur optisch verstärkt. Zusätzlich ist die Frau durch den ihren Körper komplett<br />
verhüllten Mantel als anständig kennzeichnet, der Spiegel huldigt ihrer Schönheit. Ihr kompositorisch<br />
zugeordnet ist der Knabe, der aufgrund seines zarten Alters noch nicht der Männerwelt zugerechnet<br />
wird. Außerhalb stehen ein Manteljüngling und ein bärtiger Mann mit Gehstock. Sie verkörpern zwei<br />
Altersstufen des männlichen Erwachsenen: den Epheben und den Polis-Bürger mit dem<br />
Bürgerstock. 569 Die Athletenutensilien können sich durchaus auf beide Männer beziehen, die sich dem<br />
Eingang des Hauses nähern. Dass sie mit dem geschilderten Geschehen nichts zu tun haben, sondern<br />
lediglich Assoziationen an Sport und Kalokagathia wecken, ist zweifellos richtig. 570 Anders als z. B.<br />
die Strigilis wird der Geldbeutel von M. Meyer nicht als rein charakterisierendes Attribut der<br />
Männerwelt gewertet, sondern avanciert zum Handlungsträger schlechthin. Sein Erscheinen macht aus<br />
der Frau eine Hetäre, aus dem Mann mit Geld einen Mann, der sich seine sexuellen Wünsche erfüllen<br />
kann. „Dargestellt ist nicht die sexuelle Beziehung, sondern der Mann, der über eine Frau verfügt.“ 571<br />
Jüngling und Knabe werden zu Zuschauern degradiert, die Inszenierung der Frau als tugendsames und<br />
schönes Wesen verblasst angesichts des Mannes mit Geld. 572 Im Gegensatz zu M. Meyer glaube ich<br />
nicht, dass der Geldbeutel ein Gegenüber braucht, um seine Aussage entfalten zu können. Wie die<br />
Athletenutensilien ist er ein Attribut des athenischen Bürgers, das die Kaufkraft symbolisiert, die unter<br />
anderem auch die Bezahlung Prostituierter einschließen kann, aber nicht muss. Somit hätten wir<br />
wiederum ein Beispiel für das exemplarische Rollenverständnis der griechischen Familie, die hier gar<br />
über zwei männliche Nachkommen verfügt. Die von einer Architektur beschirmte Frau und der von<br />
draußen hinzutretende Mann sind auch Thema eines Stamnos in Paris 573 . Der Mann ist diesmal jedoch<br />
ohne Geldbeutel unterwegs.<br />
Auf der einen Seite eines Stamnos in Kopenhagen III/40 steht ein Jüngling mit Geldbeutel zwischen<br />
zwei sitzenden weiblichen Figuren (Taf. 18 Abb. 1). Die eine hielt mit ziemlicher Sicherheit einen<br />
heute verblassten Kranz, während die Handhaltung der anderen Frau eher an Wollverarbeitung denken<br />
lässt, obwohl weit und breit weder Wollkorb noch Spindel zu sehen sind. Sie ist es auch, der von<br />
einem heranfliegenden Eros ein Band gebracht wird. Der an der Wand hängende, kugelige Korb, der<br />
zumeist im Symposionskontext beheimatet ist, kann jedoch auch, wie die Schale aus dem Basler<br />
Kunsthandel III/29 (Taf. 15 Abb. 6) einwandfrei erwiesen hat, Textilerzeugnisse enthalten. Auf der<br />
anderen Seite befindet sich im Zentrum ein sitzender Jüngling (Taf. 18 Abb. 2). An seiner<br />
ausgestreckten Rechten baumelt ein etwas klein geratener Geldbeutel, sein Blick ist in<br />
568 G. Ferrari, Figures of Speech. Men and Maidens in Ancient Greece (Chicago 2002) 41–43 identifiziert den Ort als<br />
Innenhof eines Hauses: “one of the few places in which a respectable female might be seen and even approached”.<br />
569 M. Meyer, Alte Männer auf attischen Grabdenkmälern, AM 104, 1989, 72 f. hat anhand von Grabreliefs gezeigt, dass die<br />
verschiedenen Altersstufen der dargestellten Männer die familiäre Hierarchie ausdrücken. Theoretisch ist dies auch für<br />
den Stamnos in Tampa möglich, obwohl im Gegensatz zu den Grabreliefs eine verwandtschaftliche Beziehung der<br />
männlichen Personen nicht vorausgesetzt werden kann.<br />
570 Meyer 1988, 102 f.<br />
571 Meyer 1988, 103.<br />
572 Meyer 1988, 100. 102 f.<br />
573 Stamnos aus dem Umkreis des Harrow-Malers, Paris, Musèe du Louvre G 191: CVA Paris, Musée du Louvre (2) III Ic<br />
12 Taf. 22, 1. 2.<br />
S e i t e | 125
entgegengesetzter Richtung auf seinen Hund gerichtet, der hinter ihm sitzt. Unbeachtet bleiben so<br />
auch die beiden ihn flankierenden Frauen. Eine von ihnen befestigt sich gerade das Haar mit einem<br />
breiten Band 574 , die Frau mit dem Spiegel steht entweder selbstständig oder ergänzt die<br />
Toilettenvorbereitung. Die auf Höhe der Henkelzone angebrachten Eroten (Taf. 18 Abb. 3)<br />
unterstreichen zusätzlich die erotische Ausdruckskraft der Frauen. 575 Das Flötenfutteral ist in der Tat<br />
dagegen eher ein Symposionsutensil. Denn obwohl auch in den Oikosszenen die Flöte gespielt wird 576 ,<br />
das Flötenetui selbst gehört in der Regel nicht zum Inventar. Es muss sich des Weiteren aber auch<br />
nicht zwangsläufig im Besitz einer der Frauen befinden, sondern kann auch dem jungen Mann<br />
zugeordnet werden.<br />
Die Natur der Interaktion ist schwer zu bestimmen. In beiden Fällen treten die Jünglinge als<br />
Beobachter auf. M. Meyer bemerkt: „Die Frauen, die ihn umgeben, „tun“ zwar auch etwas; sie sind in<br />
ihrem Tun aber nur mit sich beschäftigt; sie blicken nach unten, reagieren nicht auf den Mann. Sie<br />
sind wie Wunschbilder oder Erscheinungen; zwischen ihnen und dem Mann besteht kein<br />
Handlungszusammenhang.“ 577 Diese Beobachtung ist zweifellos richtig. Verschiedentlich wurde als<br />
Merkmal des Mannes im Oikos seine scheinbare Teilnahmslosigkeit angeführt, nur dass er dort<br />
zusätzlich auch meist eine Randposition einnimmt. Man sollte jedoch die Tätigkeiten der immerhin<br />
vier Frauen nicht als völlig nebensächlich oder nur als insofern bedeutsam einstufen, als sie als<br />
Attribute der Jünglinge fungieren. M. Meyers Auslegung zufolge zeigt das Vasenbild die<br />
Entscheidungsschwierigkeiten zweier Männer, die jeweils zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen<br />
sind. 578 Handelt es sich also in beiden Fällen um Kunden im Bordell, die sich ihre Gelagebegleitung<br />
auswählen und mit Nachdruck ihre Geldbeutel schwenken? Mit der Handarbeit auf der einen Seite,<br />
nämlich dem Kränzeflechten und eventuell dem Spinnen, und der Schönheitspflege auf der anderen<br />
Seite sind auf der Hydria in Kopenhagen die zwei elementaren Facetten weiblichen Lebens<br />
thematisiert, die das Frauenbild der Bildkunst in ihrer Gesamtheit bestimmen. Wir haben nun schon<br />
mehrere Beispiele gesehen, in denen ein Jüngling sich im Kreise von Frauen aufhält, sei es dass er ihr<br />
während der Arbeit mit Wolle oder beim Flechten von Kränzen Gesellschaft leistet, sei es dass er<br />
Zeuge ihres Ankleidens wird wie auf der Hydria in Münster II/8 (Taf. 4 Abb. 5). Hier gab es keine<br />
zwingenden Hinweise auf Prostitution. Selbiges gilt für den Geldbeutel. Analog zu verwandten<br />
Darstellungen kann man lediglich folgern, dass auf dem Stamnos in Kopenhagen III/40 ein Jüngling,<br />
dessen Geldbeutel seine gute Herkunft und finanzielle Potenz verrät, den alltäglichen Vorgängen<br />
seines Oikos beiwohnt. Dass hierbei u. a. die körperlichen Vorzüge der Frauen betont werden,<br />
widerspricht dieser Deutung nicht.<br />
574 Als erotisches Motiv beim Symposion, s. Peschel 1987, 39. z. B. Schale in Castle Ashby: CVA Castle Ashby, Taf. 36. –<br />
Als Brautschmückungsmotiv, s. Lebes Gamikos I/2.<br />
575 A. Schäfer, Unterhaltung beim griechischen Symposion. Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis in<br />
spätklassische Zeit (Mainz 1997) 70 ist sich der Problematik der Gegenwart von Eroten in Werbeszenen bewusst und<br />
erklärt sie sich folgendermaßen: „Die beiden Eroten, die oberhalb der Henkel frei im Raum schweben, unterstreichen die<br />
dezent erotische Atmosphäre der Werbeszene. Nicht der vordergründig sexuelle Reiz, sondern die weibliche<br />
Ausstrahlung der Hetären gilt als darstellungswert.“<br />
576 z. B. Chous des Polygnot, Florenz, Privatsammlung: G. van Hoorn, Choes and Anthesteria (Leiden 1951) Nr. 532 Abb. 164.<br />
577 Meyer 1988, 106 f.<br />
578 Meyer 1988, 106 f.<br />
S e i t e | 126
Zum Vergleich eignet sich etwa die Darstellung einer Hydria in Chicago III/41, die ebenfalls einen<br />
Mann mit Geld inmitten von Frauen zeigt. Im Unterschied zum Kopenhagener Stamnos III/40<br />
befindet sich nur auf der einen Seite ein Jüngling mit Geld, während die Gegenseite eine typische<br />
Oikosszene wiedergibt. Neben dem Spiegel als Schönheitsaccessoire heben besonders die Spindel und<br />
der Nymphenkranich die Tugenden der anständigen Frau hervor. Die beiden Frauen, die den jungen<br />
Mann flankieren, haben keine Attribute bei sich, soweit sich dies sagen lässt, denn die Frau, der der<br />
Geldbeutel angeboten wird, ist nur noch z. T. erhalten. Auch hier scheinen in gewisser Weise zwei<br />
Aspekte des weiblichen Rollenbildes gegenübergestellt: die Hausarbeit und der zwischenge-<br />
schlechtliche Kontakt. Daraus folgt jedoch nicht, dass Frauen mit unterschiedlichem Status gemeint<br />
sein müssen. Denn beide Bilder sind durch einen kompositorischen Kniff miteinander verbunden: die<br />
am rechten Bildrand positionierte Frau wirft einen Blick zurück über ihre Schulter auf die Interaktion<br />
des Paares und verbindet die Szene durch ihre Bewegungsrichtung gleichzeitig mit der Frauengruppe<br />
der Gegenseite.<br />
3. 4. 3. Der Geldbeutel in weiblicher Hand – ein antikes Paradoxon?<br />
Es ist richtig, dass sich der Geldbeutel in der Regel in den Händen des Mannes und nicht in den<br />
Händen des Eromenos oder der Frau befindet. Die einzigen mir bekannten Ausnahmen, auf denen sich<br />
der Geldbeutel im Besitz einer weiblichen Person befindet, sind eine Schale in San Antonio III/42<br />
(Taf. 18 Abb. 4) und eine Schale in Paris 579 . Auch wenn er an der Wand hängt, spricht man ihn immer<br />
als männliches Attribut an. 580 Im Allgemeinen hat diese Feststellung sicherlich Gültigkeit, nicht so<br />
jedoch auf einer weißgrundigen Pyxis in Berlin III/43 (Taf. 18 Abb. 5–7). Dort hängt ein kleiner<br />
Beutel, der trotz seiner schematischen Zeichnung als Geldbeutel erkennbar ist 581 , neben einer großen<br />
doppelflügeligen Tür, die entweder die Haustür selbst oder die Tür ins Schlafgemach kennzeichnet<br />
(Taf. 20 Abb. 6). Frauen mit Spiegel, Wollkorb und Kranz gehen ihren üblichen Tätigkeiten nach. Ein<br />
Mann ist jedoch weit und breit nicht zu sehen, so dass eine Beziehung des Geldbeutels zum Oikos und<br />
seinen weiblichen Bewohnern hergestellt werden muss. Möglicherweise bezieht das Geldsäckchen<br />
sich nicht auf die Frauen selbst, sondern auf den Ort, an dem sie sich aufhalten: das Haus eines reichen<br />
Mannes.<br />
Der rechtliche Status der Frauen im klassischen Athen und ihre geringen ökonomischen<br />
Möglichkeiten, die entsprechende Textzeugnisse bestätigen 582 , ließen die Aussage gerechtfertigt<br />
erscheinen, eine Frau verfüge nicht über eigenes Geld, es sei denn Haushaltsgeld. Auf jeden Fall hielt<br />
man es für unsinnig, sie könne als Inhaberin eines Geldbeutels bildlich dargestellt worden sein.<br />
Nachdem sich die Beurteilung der Stellung der Frau in der Antike neuen Eindrücken öffnete, unterzog<br />
579 Schale des Euaion-Malers, Paris, Cabinet des Medailles 817 wird im Beazley-Archiv ebenfalls unter den Stücken<br />
aufgelistet, auf denen eine Frau mit Geld abgebildet ist. Eine Abbildung stand mir leider nicht zur Verfügung.<br />
580 Meyer 1988, 116; Hartmann 2002, 177 f.<br />
581 Dass hier eventuell ein Alabastron gemeint ist, kann zuverlässig ausgeschlossen werden durch den direkten Vergleich mit<br />
dem Alabastron, das auf der Berliner Pyxis III/43 auf der anderen Seite der Tür an der Wand befestigt ist.<br />
582 z. B. Is. 10, 10.<br />
S e i t e | 127
man auch ihre ökonomische Abhängigkeit einer erneuten Prüfung und fragte sich, ob die Frau nicht<br />
doch selbständig über ihre Mitgift, Schmuck oder kleinere Barsummen verfügen konnte. 583<br />
Demosthenes etwa weiß zu berichten, dass ein gewisser Spudias sich von seiner Schwiegermutter<br />
wohl einen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag geliehen hat. 584 Auch die Komödien vermitteln eher den<br />
Eindruck, dass Frauen die Finanzverwalterinnen des Oikos waren. Sowohl Praxagora als auch<br />
Lysistrate legen davon Zeugnis ab. So sagt etwa Praxagora in den „Thesmophoriazusen“:<br />
Auch Lysistrate betont:<br />
S e i t e | 128<br />
„Den Weibern, rat´ ich, müssen wir den Staat<br />
Ganz überlassen! Führen sie zu Haus<br />
Doch auch die Wirtschaft als Verwalterinnen!“ (Aristoph. Eccl. 210–212)<br />
„Und verwalten wir denn nicht das Geld auch zu Haus, da ja<br />
alles durch unsere Hand geht?“ (Aristoph. Lys. 495)<br />
Immerhin scheinen Frau und Geld kein grundsätzliches Paradoxon gewesen zu sein, da Chremes die<br />
Frauen gemeinhin als „mit Weisheit vollgepfropft, geldschaffnerisch“ (Aristoph. Eccl. 440–441) bezeichnet.<br />
Plutarch können wir entnehmen, dass es wohl üblich gewesen war, den Frauen Haushaltsgeld zur<br />
Verfügung zu stellen. Wenn sich die Frauen des perikleischen Haushalts beklagen, sie würden zu kurz<br />
gehalten, mag man vermuten, dass Frauen gewöhnlich mehr Geld handhabten und damit auch eine<br />
gewisse Unabhängigkeit besaßen:<br />
„Auch den Frauen gegenüber war er keineswegs freigebig, und sie beklagten sich bitter,<br />
dass sie das Haushaltsgeld nur für einen Tag und aufs genaueste berechnet erhielten und<br />
nie, wie es einem großen und reichen Haus anstehe, aus dem vollen schöpfen könnten, weil<br />
jede Ausgabe und jede Einnahme peinlich genau abgezählt und abgemessen werde.“<br />
(Plut. Per. 16.)<br />
Aischines wenig schmeichelhafte Bemerkung zum verwalterischen Können der Frauen weicht von den<br />
oben gewonnenen Eindrücken ab:<br />
„For Demosthenes, when he had spent his own patrimony, went round the city hunting for<br />
young men whose fathers had died and whose mothers managed the property [...] For<br />
having discovered a rich household that was not well governed, of which the leader was a<br />
woman with big ideas, but not very sensible […]” (Aisch. 1, 170)<br />
Vermutlich ist es Aischines nicht vordergründig daran gelegen, die ökonomische Untauglichkeit des<br />
Frauengeschlechts als solche zu beklagen, sondern die Abgebrühtheit und Berechnung seines Geld<br />
liebenden, politischen Gegners zu akzentuieren. Immerhin können wir der Textstelle aber entnehmen,<br />
583 Zu Frauen und Besitztum, s. z. B. L. Foxhall, Household, Gender and Property in classical Athens, ClQ 39, 1989, 32–43;<br />
V. J. Hunter, Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420–320 v. Chr. (Princeton 1994) 28 f.; J. Blok,<br />
Recht und Ritus in der Polis. Zu Bürgerstatus und Geschlechterverhältnissen im Klassischen Athen, HZ 278, 2004, 1–26.<br />
584 Demosth. or. 41, 9.
dass die Verwaltung des Oikos nach dem Tod des Hausherrn im Falle der Unmündigkeit der Söhne<br />
durchaus in die Hände der Hausherrin gelegt wurde.<br />
Ob diese Beobachtungen es nun rechtfertigen, das der Frau in den Bildern überreichte oder<br />
dargebotene Geld – insofern es sich um ein Überreichen und nicht nur um ein Präsentieren handelt -<br />
als Haushaltsgeld oder Mitgift etc. zu klassifizieren? 585 Zumindest ist dem Argument, Frauen und Geld<br />
seien in der Antike ein Paradoxon gewesen, die Grundlage entzogen. Dennoch ändert dies nichts<br />
daran, dass in so gut wie allen Darstellungen der Mann und nicht die Frau über den Geldbeutel wacht.<br />
Rufen wir uns die antike Mentalität ins Gedächtnis, ist das im Grunde nicht anders zu erwarten. Der<br />
Geldbeutel ist auf den Bildern – egal in welchen Zusammenhang er gestellt wird – potentes Symbol<br />
für den Status des Bürgers und für das männliche Selbstverständnis. Der Mann, der Kyrios, ist der<br />
politische und ökonomische Macher, er zieht die Fäden in der Öffentlichkeit, repräsentiert sich als<br />
Oberhaupt seiner Familie und als Mitglied der Polis.<br />
3. 5. Zusammenfassung<br />
All die Darstellungen, in denen Männer Gegenstände als vermeintliche Geschenke halten bzw.<br />
reichen, ohne Differenzierung nach Art und materiellem Wert dieser Objekte als Werbeszenen<br />
einzustufen, erscheint mehr denn je als eine Art Notlösung, basierend auf dem Wunsch, mit einem<br />
einzigen Lösungsansatz allen Ungereimtheiten auf einen Streich beizukommen. Gerade Dinge wie<br />
Kränze, Kästchen oder Bänder besitzen jedoch, wie das vorgelegte Material nahe legt, vermutlich<br />
keinen ausgeprägten Geschenkcharakter. Macht man sich von Begriffen wie „Geschenk“ und<br />
„Werbung“ frei, die beide untrennbar mit den Hetären verbunden schienen, so ist es leichter, diese<br />
Bilder unvoreingenommen in den Blick zu nehmen. Wie bei den Oikosszenen beruht die bisherige<br />
Einschätzung vermutlich zu einem großen Teil auf jenem unzeitgemäßen Frauenbild, welches die<br />
weibliche und männliche Lebenswelt als zwei voneinander so gut wie völlig gelöste Sphären versteht.<br />
Diese Vorstellung speist sich jedoch allein aus den schriftlichen Überlieferungen und konnte für die<br />
archäologischen Bildquellen nicht erhärtet werden. 586<br />
Schwieriger dagegen ist es, Attributen bzw. Geschenken wie dem Fleisch und natürlich dem Geld<br />
ihren Werbezweck strittig zu machen. 587 Geld wurde gleichgesetzt mit Bezahlung und Bezahlung mit<br />
der Entlohnung käuflicher Freuden. Ikonographische Details wie den Kalathos oder den Brautschleier<br />
hat man kompromisslos dem Geldbeutel untergeordnet. Zur allseits befriedigenden Beseitigung<br />
solcher Widersprüchlichkeiten führte man die 'spinnende Hetäre' ins Feld, die sich durch Übernahme<br />
obiger Attribute dem Erscheinungsbild der prüden Bürgerin angepasst habe.<br />
Keinesfalls sollen nun alle Frauen auf den attischen Vasen in Gesellschaft von Männern als Ehefrauen<br />
deklariert werden, damit würde man nur in das andere Extrem verfallen. Der neutrale Beobachter<br />
kommt lediglich nicht umhin, gewisse Widersprüche zur Kenntnis zu nehmen und zu fragen, ob die<br />
585 Wie es z. B. im Fall des Alabastron in Athen, hier III/15, von A. Brückner, Lebensregeln auf athenischen<br />
Hochzeitsgeschenken, WPrBerl 62, 1902, 3–11 vorgeschlagen wurde; s. auch Alabastron in Berlin, hier III/24.<br />
586 vgl. Kap. 2. 5; 2.6.<br />
587 Sutton 1981, 354. 356 ff.<br />
S e i t e | 129
Festlegung des Geldbeutels auf ein im Wesentlichen sexuelles Umfeld nicht vielleicht doch übereilt<br />
ist. Zugegebenermaßen beinhalten nicht alle Vasenbilder Hinweise oder erklärende Details, die der<br />
Deutung der weiblichen Personen als Hetären widersprechen. Immerhin bleibt aber anzumerken, dass<br />
Musikinstrumente und Wein, auf die immer wieder als Anspielungen auf den Arbeitsplatz dieser<br />
Spinnerinnen, nämlich das Symposion, verwiesen wird, mit vereinzelten Ausnahmen – wie dem<br />
Flötenfutteral auf dem Stamnos in Kopenhagen III/40 (Taf. 18 Abb. 2) und der ohnehin aus dem<br />
Rahmen fallenden Schale in München III/33 (Taf. 16 Abb. 6) – eben nicht im Zusammenspiel mit<br />
dem Geldbeutel vorkommen. Umgekehrt fehlen also zumindest in den besprochenen Szenen auch<br />
Belege, die die Deutung der Hetäre zusätzlich untermauern würden. 588 Was die 'spinnenden Hetären'<br />
anbelangt, ist die Verknüpfung mit Geld oder Fleisch ohnehin kein sehr populäres Phänomen in der<br />
griechischen Vasenmalerei. Gerade bei den beiden Darstellungen in South Hadley III/12 (Taf. 12<br />
Abb. 3) und Rhodos III/10 (Taf. 12 Abb. 1), die beide eine Übergabe von Fleisch zeigen, ist meiner<br />
Ansicht nach eine Deutung auf Prostituierte alles andere als zwingend. Einer Neubewertung des<br />
Geldbeutels bereiteten vor allem Darstellungen wie die des Berliner Alabastron III/24 (Taf. 14 Abb. 6.<br />
7) oder die der Schale in Kopenhagen III/34 (Taf. 17 Abb. 1) den Weg. Der Geldbeutel kann im<br />
Umfeld der Hochzeit, die durch den Brautschleier und den cheir epi karpo-Gestus unmissverständlich<br />
angedeutet wird, unmöglich sexuelle Andeutungen machen. Ebenso wenig hat er in seiner veralteten<br />
Bedeutung etwas auf einer weißgrundigen Grablekythos zu suchen.<br />
Letztlich gelangt man auf diese Weise zurück zu dem bereits zitierten Grundsatz von J. D. Beazley,<br />
der im Zuge von G. Rodenwaldts Artikel eigentlich schon seit über 70 Jahren als widerlegt gilt. Würde<br />
man Hetären wirklich mit den gleichen ikonographischen Mitteln wiedergeben wie die Bürgerin,<br />
obwohl die sozial-politische Ideologie der Demokratie so großen Wert auf den Verhaltenskodex ihrer<br />
Ehefrauen und Töchter legte? 589 Eine Hetäre mag im realen Leben gewebt und gesponnen haben, als<br />
Spinnerin wäre sie deswegen in die Darstellungskunst noch lange nicht eingegangen.<br />
Die in der Forschung bislang geläufige Identifikation von Hetären oder Ehefrauen beruht oftmals auf<br />
Vorurteilen gegenüber der Stellung der Frau im klassischen Athen. Viele Kriterien, die für eine<br />
Interpretation der Frau als Hetäre herangezogen wurden, sind heute widerlegt oder lassen sich nicht als<br />
Allgemeingültigkeit formulieren. Der Umgang mit der 'spinnender Hetäre' ist paradigmatisch für den<br />
Umgang mit Hetärendarstellungen im Allgemeinen. Es ist an sich schon fast widersinnig, dass man bei<br />
dem momentanen Stand der archäologischen Forschung verpflichtet ist, zu widerlegen, dass all diese<br />
Frauen – sei es nun in Oikos- oder Werbeszenen – Hetären zeigen, wohingegen es als praktisch<br />
erwiesen vorausgesetzt wird, dass es keine Ehefrauen oder Bürgerinnen sind. In den archäologischen<br />
Disziplinen ist tatsächlich gelegentlich eine 'Hetärenmanie' zu beobachten, wenn etwa gerade die<br />
Tatsache, dass eine Frau spinnend abgebildet ist, als Argument dafür angeführt wird, es müsse eine<br />
Hetäre gemeint sein. Es geht entschieden zu weit, wie D. Williams eine Gruppe von Frauen auf einer<br />
Schale aus Florenz 590 , die mit Bändern und Girlanden hantieren, aufgrund des „general air of vanity“<br />
als Hetären abzustempeln, die sich auf ihren abendlichen Auftritt vorbereiten. 591 Und das, obwohl hier<br />
588 Anders dagegen in den so zahlreichen „Werbeszenen“ auf den Kylikes. Dort sind etwa Flötenfutterale recht häufig.<br />
589 J. D. Beazley, JHS 51, 1931, 121; C. Bérard – J.-P. Vernant (Hrsg.), Die Bilderwelt der Griechen (Mainz 1985) 127 f.<br />
590 Schale des Pistoxenos-Malers, Florenz, Arch. Mus. 75770: CVA Florenz (3) III I 16 f. Taf. 105, 1–3; 116, 23.<br />
591 D. Williams, Women on Athenian Vases: Problems of Interpretation, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.), Images of<br />
Women in Antiquity (London 1993) 99. 101 Abb. 7, 8.<br />
S e i t e | 130
nicht einmal ein Mann oder auch nur Geld abgebildet sind! Gleichermaßen wird mit Darstellungen<br />
lesender und musizierender Frauen auf einer Hydria in London 592 verfahren: „It is unlikely, however,<br />
that many show ordinary housewives, whose education can, at best, have risen little above the ability<br />
to make lists or keep accounts, for their education was chiefly in the hands of their husbands.” 593 Von<br />
dieser Meinung ausgehend müssen diese Frauen Hetären sein, da stört dann auch ein fliegender Eros<br />
nicht!<br />
592 Hydria der Polygnot-Gruppe, London, British Mus. 1921.7-10.2: CVA London, British Mus. (6) III Ic 3 Taf. 83, 1A–D.<br />
593 Williams a. O. (Anm. 591) 100. 102 f. Abb. 7, 9. 10.<br />
S e i t e | 131
S e i t e | 132<br />
4. Die Ehefrau als Sexualpartnerin und Gefährtin<br />
Obwohl in den antiken Schrift- und Bildquellen das stereotype Bild der gehorsamen und keuschen<br />
Frau parallel neben dem der treulosen Nymphomanin existiert, hat sich ersteres als derart einprägsam<br />
erwiesen, dass die sexuelle Identität und die körperlichen Bedürfnisse der Ehefrau in der Forschung<br />
lange Zeit entweder nur von marginalem Interesse waren oder schlichtweg negiert wurden. 594 Wie<br />
könnte eine Frau, die in allen sozialen und rechtlichen Belangen benachteiligt war, deren einzige<br />
Verwendung in der Hausarbeit und Reproduktion lag und deren größte Tugenden Gehorsam und<br />
Schweigsamkeit waren, eine attraktive Sexualpartnerin für den athenischen Bürger sein?<br />
Im vorherigen Kapitel wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die Kunst der Verführung von<br />
der Forschung nicht zu den üblichen Wesensmerkmalen der Ehefrau und Bürgerin gezählt wurde. Sie<br />
war das Geschäft der Hetäre. Dabei sollte man zunächst festhalten, dass auch die Schönheit der<br />
Ehefrau auf den griechischen Vasen einen nicht unbedeutenden Raum einnimmt. "Toilette und<br />
Wollarbeit definieren in den Augen der Männer die wesentlichen Bezugspunkte weiblicher<br />
Schönheit", heißt es bei F. Lissarague. 595 Der Spiegel kennzeichnet die Trägerin also zunächst als eine<br />
hübsche Frau; erst auf einer zweiten Ebene bedeutet Schönheit erotische Wirkung auf andere,<br />
bevorzugt natürlich auf das männliche Geschlecht. 596<br />
Eine Untersuchung der Hochzeitsikonographie hat bereits deutlich gemacht, dass die Sexualität als<br />
Charakterzug der Bürgerin durchaus wahrgenommen wurde. Anhand von Gefäßen wie der<br />
Loutrophoros aus Boston I/1 (Taf. 1 Abb. 1–3) lässt sich feststellen, dass hier zwei grundverschiedene<br />
Vorstellungen von Frau-Sein ineinander fließen: Ein Abbild von Anstand und Wohlerzogenheit ist die<br />
Braut jedoch zugleich die Verkörperung von aphrodisischer Schönheit und Verführung. Wenn die<br />
Vasenbilder auch eher indirekte Signale verwenden wie den Eros oder den Blick auf die<br />
Hochzeitskline, so zeigt dies doch immerhin, dass Sexualität in der Ehe existierte und erwünscht<br />
war. 597 Das Bild der keuschen und gehorsamen Ehefrau ist deshalb nicht erzwungenermaßen falsch, es<br />
ist aber bestimmt unvollständig.<br />
In diesem Kapitel soll untersucht werden, welche Symbole die Sexualität und Erotik der Ehefrau<br />
vermitteln. Es ist davon auszugehen, dass wir es vorrangig mit Symbolen zu tun haben werden. Der<br />
Sexualakt von Braut- oder Ehepaaren selbst wurde wohl nicht dargestellt, war vielmehr dem Verkehr<br />
594 Just 1989, 151: Die sexuelle Identität der Athenerin wurde durch die Festlegung der Ehefrau auf ihre Rolle als Mutter<br />
legitimer Kinder und Verwalterin des Haushalts in den Hintergrund gedrängt; Calame 1992, 87;<br />
595 F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 229; s.<br />
auch B. Borg, Der Logos des Mythos. Allegorien und Personifikationen in der frühen griechischen Kunst (München<br />
2002) 182; S. Moraw, Schönheit und Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher Nacktheit und bürgerlichem Status in<br />
der attischen Vasenmalerei, JdI 118, 2003, 25 f.<br />
596 Heinrich 2006, 86. Kreilinger 2007, 124 erinnert an Hera, die sich Zeus – Hom. Il. 14, 166–353 – mit allen Raffinessen<br />
der Verführung unterwirft.<br />
597 Hartmann 2002, 115: „Das Wirken der Aphrodite in der Ehe sollte allerdings auf die Brautzeit beschränkt bleiben;<br />
entfaltete die Göttin des Begehrens ihre Macht noch länger, wurde sie als beunruhigende Kraft wahrgenommen, welche<br />
die Ehe von innen her bedrohte." Wir erinnern uns, dass ein ausgeprägter sexueller Trieb ein Zeichen für die<br />
Unbeherrschtheit der Frau war und als beunruhigend empfunden wurde.
mit den Prostituierten des Gelages vorbehalten. 598 Daneben ist eine Reihe von Bildern dem Austausch<br />
von Zärtlichkeiten gewidmet, die das Bild ergänzen und uns ermöglichen, vor dem Hintergrund eines<br />
umfassenderen Bildprogramms den Stellenwert der ehelichen Liebe auf den attischen Vasen besser<br />
einschätzen zu lernen.<br />
4. 1. Sexualsymbole und Sexualerziehung in der athenischen Gesellschaft<br />
Gemessen an den Eindrücken, die man aus den antiken Quellen gewinnt, reglementierten hinsichtlich<br />
des Umgangs mit Männern strenge Vorschriften das Verhalten der Frauen im Allgemeinen und der<br />
unverheirateten Töchter im Besonderen. Da die griechische Gesellschaft darauf achtete, dass<br />
Parthenoi 599 nicht-verwandten Männern – und dies betrifft sicherlich v. a. die heiratsfähigen Mädchen<br />
aus gutem Hause – nur vor der Kulisse kultischer Feiern oder unter dem Schutz des familiären Oikos<br />
begegneten, ist es eher unwahrscheinlich, dass jenen jungen Frauen vor der Ehe Gelegenheit zu<br />
sexuellen Kontakten gegeben wurde. 600 Dagegen hatte der Bräutigam sicherlich genügend<br />
Möglichkeiten, sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Dies geschah entweder durch Besuche von<br />
Bordellen oder im Rahmen homosexueller Beziehungen, wobei der junge Mann je nach Alter bereits<br />
sowohl in die Rolle des Eromenos als auch in die des Erastes geschlüpft sein konnte. 601<br />
Wir wissen zwar, dass zur Erziehung der athenischen Töchter Lektionen im Spinnen, Kochen,<br />
Kinderhüten, in diversen anderen kleinen Haushaltstätigkeiten 602 und teilweise auch im Lesen und<br />
Schreiben 603 gehörten. Wie man es allerdings mit der Aufklärung zum Thema Sex und Fortpflanzung<br />
hielt, bleibt ungeklärt. Oftmals wird betont, welch Schrecken dem unbekannten Los der Ehe aus der<br />
598 z. B. Peschel 1987, 12. 27. 30<br />
599 Zum Begriff Parthenos, s. Kreilinger 2007, 50–54.<br />
600 Reinsberg 1993, 41; s. auch D. Konstan, Premarital Sex, Illegitimacy, and Male Anxiety in Menander and Athens, in: A.<br />
L. Boegehold – A. C. Scafuro (Hrsg.), Athenian Identity and Civic Ideology (Baltimore 1994) 217–233. – In diversen<br />
Komödien Menanders geschieht es, dass Bürgerstöchter premaritalen Geschlechtsverkehr haben, z. B. Men. Sam.; Men.<br />
Epitr. Es könnte sein, dass sich die Moralvorstellungen zum Hellenismus hin gelockert hatten.<br />
601 z. B. Ph. E. Slater, The Greek Family in History and Myth, Arethusa 7, 1974, 18 f.; Keuls 1985, 267 f. skizziert die<br />
“sexual career” eines jungen Atheners vom Erasten zum Komasten, der Sklavinnen zu Analverkehr zwingt und seine<br />
Aggressionen auslebt; dann zum Bordellgänger und Zuhälter. Seine unbefriedigende Ehe kompensiert er durch<br />
Verhältnisse zu Knaben und Halten einer Pallake.<br />
602 allg. zur Mutter-Tochter Beziehung, s. H. Foley, Mothers and Daughters, in: Neils – Oakley 2003, 113–137. – Zu den<br />
Arbeiten im Haus, s. M. Golden, Children and Childhood in Classical Athens (Baltimore 1990) 33. 128.<br />
603 F. A. G. Beck, Album of Greek Education. The Greeks at School and Play (Sydney 1975) 55 f.; S. Guettel Cole, Could<br />
Greek women read and write?, in: H. P. Foley (Hrsg.), Reflections of Women in Antiquity (New York 1981) 219–245;<br />
nach E. Cantarella, Pandora´s Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity (Baltimore<br />
1987) 44 f. beschränkte sich die Bildung der athenischen Mädchen auf “women´s work“; V. Siurla-Theodoridou, Die<br />
Familie in der griechischen Kunst und Literatur des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. (München 1989) 267 f. 374; S.<br />
Blundell, Women in Ancient Greece (Cambridge 1995) 133; A. Vazaki, Mousike Gyne. Die musisch-literarische<br />
Erziehung und Bildung von Frauen im Athen der klassischen Zeit (Möhnesee 2003) bes. 26–32.<br />
S e i t e | 133
Sicht eines unerfahrenen Mädchens anhaftete. 604 Die Gründe hierfür mögen vielfältig gewesen sein.<br />
Wie Medea bitter bemerkt, ist die Ehe ein Glücksspiel, man weiß nie, an welchen Mann man gerät. 605<br />
Die Eheschließung führt zu einem völligen Wandel der Lebenssituation, der miteinschloss, dass die<br />
Braut die gewohnte Umgebung ihres Elternhauses verließ, plötzlich die Verantwortung für einen<br />
Oikos schultern musste und nicht zuletzt in ein Abhängigkeitsverhältnis zu einem Mann geriet, der ihr<br />
fremd war, aber frei über ihren Körper verfügen konnte. 606<br />
Die athenische Polis war eine Gesellschaft mit strengen Verhaltensnormen, aber sie war gewiss nicht<br />
prüde. Fruchtbarkeitssymbole und -riten gehörten in ihrer apotropäischen Wirkkraft und kultischen<br />
Bedeutung zum Alltagsbild der Stadt. 607 An vielen Häusern und öffentlichen Plätzen standen Hermen,<br />
die Stadt war geschmückt mit Kunstwerken, welche die Schönheit des nackten männlichen Körpers<br />
priesen und spätestens seit dem Bau des Parthenon die Körper der Frauen in nie gekanntem Maß<br />
erotisierten. 608 Nachbildungen von Geschlechtsorganen begegnen als Votivweihungen in vielen<br />
Kulten, die auch von Frauen gepflegt wurden. 609 Besonders zu Beginn der Demokratie kamen gehäuft<br />
Gefäße mit erotischen Darstellungen in Umlauf, mit denen die Vasenmaler auf die Wünsche ihrer<br />
wohl hauptsächlich männlichen Kundschaft reagierten. Szenen sexuellen Verkehrs und orgiastischen<br />
Treibens v. a. auf Symposionskeramik waren Ausdruck eines neuen Lebensgefühls. 610 Es lässt sich<br />
heute schwer beurteilen, inwieweit Keramik mit erotischen Themen in den attischen Haushalten<br />
Verwendung fand, zumal viele dieser Gefäße nicht für den attischen Gebrauch gedacht waren, sondern<br />
nach Unteritalien und Etrurien exportiert wurden. Neben den eindeutig sexuellen Szenen gibt es<br />
solche, die mit erotischer Symbolik spielen, wie z. B. dem Phallusvogel. Das Hantieren mit Dildoi und<br />
die Selbstbefriedigung scheinen sich nahtlos in die Symposionsthematik einzufügen, welche dazu<br />
gedacht war, die Feiernden sexuell zu stimulieren. 611 In jüngster Zeit wurde jedoch vorgeschlagen,<br />
diese Darstellungen in einem kultischen Kontext als Art Fruchtbarkeitstanz zu betrachten. 612 Das<br />
hieße, dass die Abnehmer nicht nur männlichen Geschlechts gewesen sein müssen. Inwieweit nun<br />
junge Mädchen zuhause in Kontakt mit solchen Bildern kamen, lässt sich nur vermuten. Im Hause des<br />
Ischomachos wurde das Festgeschirr separat vom Gebrauchsgeschirr aufbewahrt und 613 Theophrast<br />
berichtet von der Existenz eines verschließbaren Schrankes, der eigens für Trinkschalen vorgesehenen<br />
604 z. B. Keuls 1985, 268.<br />
605 Eur. Med. 241–243.<br />
606 Eur. Med. 235–239.<br />
607 Zu den Thesmophoria, s. E. Simon, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary (Wisconsin 1983) 18 ff.<br />
608 Zum Wandel des Frauenbildes von der geometrischen bis in klassische Zeit, s. C. Reinsberg, Frauenbilder –<br />
Männerbilder. Zur Genese des Frauenbildes in der griechischen Kunst, in: B. Miemitz (Hrsg.), Blickpunkt: Frauen- und<br />
Geschlechterstudien (St. Ingbert 2004) 235.<br />
609 Simon a. O. (Anm. 607) 18 ff.<br />
610 z. B. Peschel 1987; Kilmer 1993; A. Schäfer, Unterhaltung beim griechischen Symposion. Darbietungen, Spiele und<br />
Wettkämpfe von homerischer bis in spätklassische Zeit (Mainz 1997).<br />
611 Reinsberg 1993, 44 interpretiert sie als Animierdamen auf Symposien oder als reine Männerphantasien.<br />
612 Hinweis von Kreilinger 2007, 163–169.<br />
613 Xen. oik. 9, 7. 10.<br />
S e i t e | 134
war 614 , die dann wahrscheinlich nur zum Gebrauch beim Symposion hervorgeholt wurden. Das<br />
Verstauen von Gebrauchsgegenständen in entsprechendem Mobiliar erfüllt jedoch primär vermutlich<br />
einen praktischen Zweck, und die Tatsache, dass manches Geschirr durch Riegel und Schlösser<br />
geschützt wurde, vermittelt uns einen Eindruck von der Wertschätzung und nicht zuletzt vom<br />
materiellen Wert derartiger Besitztümer. So ist es sehr wohl möglich, dass sich unter dem guten<br />
Geschirr nicht nur Ton-, sondern auch Metallobjekte befanden.<br />
Platons Statement, ältere Kinder sähen gerne Komödien 615 , ist angesichts der derben Späße, die oft<br />
sexueller Natur sind, nach heutigen Maßstäben doch einigermaßen überraschend. Es macht aber<br />
deutlich, dass man es in der Antike offenbar nicht für nötig hielt, die Jugend von derartigen Scherzen<br />
und Anzüglichkeiten fernzuhalten. 616 Nicht jeder konnte sich aber mit dieser sittlich nachlässigen<br />
Haltung anfreunden. Aristoteles ermahnt in seiner „Politik“, die Kinder nur mit kindgerechten Spielen<br />
und Erzählungen zu unterhalten und mit den Obszönitäten der Bildkunst und des Theaters zu<br />
verschonen. 617 Ob auch junge Mädchen Zutritt ins Theater hatten, ist kaum mehr zu beantworten.<br />
Noch heute ist es ein Streitpunkt, ob Frauen überhaupt das Theater besuchten. 618 Die Tatsache, dass<br />
sich der „Unverschämte“ bei Theophrast von seinen Söhnen ins Theater begleiten lässt 619 , hilft uns nur<br />
bedingt weiter, sind wir doch über die Familienzusammensetzung des Betreffenden nicht informiert.<br />
Wir können also nicht sagen, dass er seine Töchter vom Theaterbesuch ausschloss, solange wir nicht<br />
unterrichtet sind, ob er überhaupt Töchter besessen hat. Ebenso wenig bekannt ist, ob eine Tragödie<br />
oder eine Komödie aufgeführt wurde oder wie alt seine Söhne waren.<br />
Eine Gelegenheit, bei der sexuelle Aufklärung des Weiteren zur Sprache kommen könnte, ist die<br />
Ausübung von Frauen- und Mysterienkulten und ihren Initiationsriten. Leider sind wir über viele ihrer<br />
rituellen Vorgänge und deren Bedeutung nur mangelhaft informiert. 620 Auch was wir von Riten aus<br />
"öffentlichen" Kulten wissen, trägt nicht unbedingt zu einem besseren Verständnis des Begriffes<br />
"Initiationsritus" bei, der in der Antike gewöhnlich den Übergang von einer Alters- oder Reifestufe in<br />
eine andere markierte und gerade bei jungen Mädchen meist in Vorbereitung auf die Hochzeit<br />
begangen wurde. Die Brauronia etwa, deren Funktion als Initiationsritus in der Forschung wiederholt<br />
betont wurde, sahen zu Ehren der Artemis Wettläufe von Mädchen verschiedener Altersstufen vor, die<br />
614 Theophr. char. 18, 4 über den „Misstrauischen“: „Seine Frau fragt er während er schon im Bett liegt, ob sie die Geldtruhe<br />
verschlossen habe, ob der Becherschrank (kyliouchion) versiegelt und der Riegel vor das Hoftor gelegt sei [...].“<br />
615 Plat. leg. 658c. d.<br />
616 Einen ganz anderen Ton schlägt jedoch Aischin. Tim. 3–8 an, wenn er von Sittengesetzen für Knaben und Jünglinge<br />
spricht. Hier geht es in erster Linie darum, die in die Schule oder in die Palästra gehenden Knaben unter Aufsicht zu<br />
stellen und sie vor Nachstellungen zu schützen, ebenso aber ihre Prostitution durch nahe Verwandte zu unterbinden.<br />
617 Aristot. Pol. 1336b14–23.<br />
618 z. B. Plat. leg. 658d; C. Seltmann, Women in Antiquity (London 1956) 113; A. D. F. Kitto, Die Griechen. Von der<br />
Wirklichkeit eines geschichtlichen Vorbilds ²(Stuttgart 1959) 233 f.; R. Zoepffel, Aufgaben, Rollen und Räume von Frau<br />
und Mann im archaischen und klassischen Griechenland, in: J. Martin – R. Zoepffel (Hrsg.), Aufgaben, Rollen und<br />
Räume von Frau und Mann 2 (1989) 477; Schnurr-Redford 1996, 225–240.<br />
619 Theophr. char. 9, 5.<br />
620 Zu den Mysterien von Eleusis, s. L. Deubner, Attische Feste (Berlin 1956) 69 ff.<br />
S e i t e | 135
teils nackt, teils bekleidet antraten. 621 C. Sourvinou-Inwood bezeichnet die Arkteia als “rite of<br />
culturally controlled entrance into the socially determinded period characterized by the biological and<br />
social maturation process culminating in menarche”. 622 Die Auslegungen der kultischen Riten gehen<br />
weitgehend auf die Darstellungen der Krateriskoi zurück, die größtenteils nur sehr fragmentarisch<br />
erhalten und in ihrer Deutung keineswegs unumstritten sind. 623 Die verstreuten literarischen<br />
Kommentare sind zumeist sehr spät und werfen weitere Widersprüchlichkeiten auf. 624 Auch die<br />
Arrhephoria werden häufig als Übergangsritus bezeichnet und mit der Vorbereitung zur Hochzeit<br />
verknüpft. Das Mysterium der religiösen Bräuche und ein hohes Maß an kultureller Entfremdung<br />
erschweren es uns heute beträchtlich, die tatsächliche Bedeutung der kultischen Rituale zu erfassen,<br />
die das Weben des Peplos zu Ehren der Athena und den Transport geheimer Objekte, bei denen es sich<br />
nach einhelliger Meinung um Fruchtbarkeitssymbole gehandelt haben muss, beinhalteten. 625 Dass die<br />
Arrhephoria tatsächlich ein Initiationsritus mit hochzeitlichen Tendenzen gewesen sein soll, erscheint<br />
unwahrscheinlich, zumal die kleinen Mädchen gerade erst dem Kleinkindalter entwachsen waren. 626<br />
Zudem war der exklusive Dienst der Arktoi und der Arrhephoroi den Töchtern weniger, angesehener<br />
Familien vorbehalten. 627 Viel ergiebiger scheint es, in weiblichen Fruchtbarkeitskulten, die einer<br />
breiteren Masse zugänglich waren, nach Gelegenheiten zur Einführung junger Mädchen in die<br />
Sexualkunde zu suchen. Vielleicht wurde ihnen hier durch das Hantieren von Phalloi aus Teig oder<br />
Leder die eigene Sexualität bewusst gemacht, wie dies etwa im Rahmen der Thesmophoria 628 oder der<br />
Haloa 629 praktiziert wurde. Die aufwendige Inszenierung und das Zelebrieren der weiblichen<br />
621 E. Simon, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary (Wisconsin 1983) 18 ff. 83 ff.; D. Hoof, Opfer – Engel –<br />
Menschenkind. Studien zum Kindheitsverständnis in Altertum und früher Neuzeit (Bochum 1999) 131–267; K. Waldner,<br />
Kulträume von Frauen in Athen: Das Beispiel der Artemis Brauronia, in: T. Spät – B. Wagner-Hasel (Hrsg.),<br />
Frauenwelten in der Antike (Stuttgart 2000) 53–81.<br />
622 C. Sourvinou-Inwood, Studies in Girls Transitions. Aspects of the Arkteia and Age Representation in Attic Iconography<br />
(Athen 1988) 29.<br />
623 z. B. L. Kahil, AntK Beih. 1, 1963, 5–29; dies., AntK 8, 1965, 20–33; dies., AntK 20, 1977, 86–98.<br />
624 z. B. Scholion zu Aristoph. Lys. 645; Waldner a. O. (Anm. 621) 78.<br />
625 Deubner a. O. (Anm. 620) 9 ff. hebt u. a. den Aspekt der Arrhephoria als Fruchtbarkeitsritus hervor, indem er Parallelen<br />
zu den Thesmophoria aufdeckt; Simon a. O. (Anm. 621) 39 ff. spricht sich gegen die Auffassung der Arrhephoria als Rite<br />
de passage aus.<br />
626 Aristoph. Lys. 642–648 nennt die Dienstzeit der Arrhephoren noch vor der der Arktoi; E. Specht, Schön zu sein und gut<br />
zu sein. Mädchenbildung und Frauensozialisation im antiken Griechenland (Wien 1989) 40 nennt ein Alter zwischen<br />
sieben und zwölf; nach A. Dierichs, Pandora ist schuld, AW 3, 2006, 18 sind sie dagegen bereits 11–14jährig.<br />
627 Die Arhrephoroi waren nur zu zweit. Wie viele Mädchen als Arktoi in den Dienst der Artemis traten, ist unbekannt;<br />
aufgrund des Mangels an archäologisch nachweisbaren Unterbringungsmöglichkeiten im Heiligtum in Brauron dürfte die<br />
Zahl der Mädchen jedoch nicht sehr hoch gewesen sein. – Zu den Arktoi, s. z. B. E. Specht, Schön zu sein und gut zu<br />
sein. Mädchenbildung und Frauensozialisation im antiken Griechenland (Wien 1989) 37 ist der Ansicht, dass der<br />
ursprüngliche Charakter der Initiationsfeiern als „Altersklassenfeste“ nach und nach verloren ging; J. Mylonopoulos – F.<br />
Bubenheimer, Beiträge zur Topographie des Artemision von Brauron, AA 1996, 7–23; P. G. Themelis, Contribution to<br />
the Topography of the Sanctuary at Brauron, in: B. Gentili (Hrsg.), Le orse di Brauron. Un rituale di iniziazione<br />
femminile nel santuario di Artemide (Pisa 2002) 103–116.<br />
628 Man geht davon aus, dass das Fest verheirateten Frauen vorbehalten war, s. z. B. Deubner a. O. (Anm. 620) 53; Just<br />
1989, 24; Hartmann 2002, 94.<br />
629 Deubner a. O. (Anm. 620) 61 f. 65 f.; Fantham 1994, 90 f. – Genitalienweihungen wurden auch in attischen Aphrodite-<br />
Heiligtümern gefunden. Zum Aphrodite-Heiligtum am Nordhang der Akropolis, s. O. Broneer, Excavations on the North<br />
S e i t e | 136
Fruchtbarkeit zeigen deutlich, dass Sexualität bejaht und die Notwendigkeit zur Fortpflanzung als<br />
naturgegeben akzeptiert wurden.<br />
Vielleicht fanden die Aufklärung und die Entdeckung des weiblichen Körpers auch auf spielerischem<br />
Weg statt. Jungen Mädchen wurden unter ihren liebsten Spielsachen auch Puppen mit ins Grab<br />
gegeben, wie sie auch als Votivgaben von jungen Bräuten in Artemisheiligtümern überliefert sind. R.<br />
Lindner ist nun aufgefallen, dass diese Puppen keine niedlichen, jungen Mädchen darstellen, sondern<br />
erwachsene Frauen mit voll ausgebildeten Geschlechtsmerkmalen, an denen wohl „Erwachsenenrollen<br />
erprobt werden konnten“. 630<br />
Ich halte es nach diesem kurzen Überblick für sehr unwahrscheinlich, dass eine Gesellschaft wie die<br />
athenische, die eine stark ausgeprägte agrarische Orientierung besaß und Götter verehrte, die um der<br />
Fruchtbarkeit des Landes und ihrer Bewohner willen angebetet wurden, eine angemessene<br />
Vorbereitung ihrer heiratsfähigen Mädchen auf die sexuellen Aspekte der Ehe versäumt haben soll. Es<br />
handelt sich jedoch im Grunde um subjektive Schlussfolgerungen, da die Schriftquellen zu diesem<br />
Thema schweigen und die archäologischen Quellen oftmals ohne weitere kulturgeschichtliche<br />
Informationen nicht verständlich sind.<br />
4. 2. Die Ehefrau, das asexuelle Wesen<br />
Da die reproduktive Fähigkeit der Ehefrau in den Schriftquellen, wie wir gesehen haben, als<br />
konstituierendes Element für die Rechtsgültigkeit der Ehe vorgegeben ist, wird die Sexualität der<br />
Ehefrau in der Forschung gewöhnlich allein unter diesem funktionalen Aspekt betrachtet. Ein aktives<br />
Sexualleben, individuelle Wünsche und Leidenschaften werden der verheirateten Frau generell<br />
abgesprochen. Dabei werden die derben Späße der Komödie übersehen, die etwa das Vorurteil der<br />
sexuell unersättlichen Frau weidlich auskosten, oder auch die Nachrichten von Seitensprüngen<br />
verheirateter Frau in den Gerichtsreden und Komödien. 631<br />
Die moderne Forschung geht mit der antiken Frau bisweilen hart ins Gericht. Während E. Keuls den<br />
Begriff der sexuellen Frustration ins Spiel bringt 632 , sieht E. Slater den sexuellen Verkehr mit der<br />
Ehefrau als den Mann kaum tangierendes Pflichtprogramm, das sich hinter mannigfaltige<br />
Vergnügungen anderer Art einreiht. “The bride, then, is an ignorant and immature teenager, totally<br />
dependent upon a somewhat indifferent stranger for all her needs – stranger who regards marriage at<br />
best as a necessary evil, but certainly a tiresome, if only partial, interruption of a pleasant and well-<br />
Slope of the Acropolis in Athens, 1931–1932, Hesperia 2, 1933, 345 f. Abb. 18; ders., Excavations on the North Slope of<br />
the Acropolis in Athens, 1933–1934, Hesperia 4, 1935, 140 Abb. 30.<br />
630 R. Lindner, Im Tode gleich? Geschlechts- und altersspezifische Grabausstattungen im antiken Griechenland, in: E.<br />
Klinger u. a. (Hrsg.), Der Körper und die Religion. Das Problem der Konstruktion von Geschlechterrollen (Würzburg<br />
2000) 109.<br />
631 Lewis 2002, 121.<br />
632 Keuls 1985, 85. 99. 114.<br />
S e i t e | 137
established pattern of daily living, in which his social and sexual needs are already being satisfied, the<br />
latter through hetairai and young boys.” 633<br />
Es scheint ein verbreiteter Irrtum zu sein, zu folgern, die Funktion der Ehefrau erschöpfe sich in ihrer<br />
Fähigkeit zur Reproduktion, wogegen die sexuelle Befriedigung der Griechen vorrangig bis<br />
ausschließlich in homosexuellen Beziehungen und im Verkehr mit Prostituierten erfolgte. Es klingt<br />
bisweilen beinahe so, als hätten die attischen Männer in weiser Voraussicht Homosexualität und<br />
Prostitution eingerichtet, um sich angenehmere Alternativen zum öden ehelichen Verkehr offen zu<br />
halten. 634 Einige Gelehrten haben bezüglich der sexuellen Freiheiten der athenischen Männerwelt recht<br />
genaue Vorstellungen. So malt sich E. Keuls den „sexuellen Werdegang“ eines Atheners<br />
folgendermaßen aus: Während der Jüngling in seiner Jugend erste Erfahrung mit reiferen Männern<br />
sammelt, von den Hetären in die sexuellen Freuden des Symposions eingeweiht wird, genießt er als<br />
Erwachsener Sex à la carte, während seine frustrierte Gattin zuhause pflichtbewusst die Kinder hütet:<br />
„When no longer very young, our hero brought home a child bride whom he had not previously met.<br />
His new wife entered home, cowed and terrorized, both by the separation from her own family and the<br />
overdramatized prospect of defloration. If she survived the hazards of teenage motherhood, she<br />
probably developed, as a mature woman, feelings of frustration and hostility against her husband. By<br />
then our hero was a full-flegded member of the male community and was probably taking his turn as a<br />
lover of boys – getting even, in a way, for the humiliations of his own youth. With the onset of middle<br />
or old age he began to yearn for more tender attentions, regular companionship, and personal care; at<br />
that time, he would take a concubine (pallake).” 635<br />
S e i t e | 138<br />
4. 2. 1. Zwischen Ehefrauen, Hetären und schönen Knaben<br />
Es soll nicht bestritten werden, dass der athenische Mann in der Wahl seiner zwischengeschlechtlichen<br />
Beziehungen tatsächlich weitaus freier war als seine Ehefrau und dies auch gründlich ausgenutzt<br />
haben dürfte. Die Forderung nach Treue des Mannes in der Ehe wird erst im 4. Jh. v. Chr. hie und da<br />
laut. 636 Solange der Mann seinen bürgerlichen und familiären Pflichten nachkam, gab es keine<br />
moralischen Einwände gegen außereheliche Beziehungen. 637 Die Frage ist nur, ob deshalb für die<br />
Ehefrau ein verhärmtes und sexuell unbefriedigtes Dasein vorprogrammiert war. Die Koppelung der<br />
athenischen Bürgerrechte an eine legitime Herkunft verlangte eine straffe Regelung des<br />
Sexualverhaltens, die sich aufgrund ihrer Gebärfähigkeit hauptsächlich auf die Frau in Form von<br />
Verboten, Einschränkungen und Strafen auswirkte. 638 Der Mangel an Selbstbeherrschung und<br />
Kontrolle, eine konstatierte, beinahe schon chronische Krankheit des weiblichen Geschlechts, machte<br />
633 Ph. E. Slater, The Greek Family in History and Myth, Arethusa 7, 1973, 18 f.<br />
634 z. B. Just 1989, 145; Davidson 1999, 151 f.; K. J. Dover, Classical Greek Attitudes to Sexual Behavior, in: M. Golden –<br />
P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 114–128.<br />
635 Keuls 1985, 268.<br />
636 z. B. Isokr. 3, 40; Aristot. oec. I, 1344a; III, 144; s. auch Harrison 1968, 32; Just 1989, 141.<br />
637 Er durfte freilich keinen Ehebruch mit einer verheirateten Frau begehen, s. Harrison 1968, 33 ff.; Pomeroy 1985, 129.<br />
638 Zu Definition und straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen von moicheia, s. Harrison 1968, 32–38; Patterson 1998, 157–174.
in den Augen des Atheners gesetzliche Maßnahmen ausdrücklich notwendig, um die Ehre der Familie<br />
und des Mannes und letztlich die Stabilität des Oikos zu gewährleisten. 639 Die geforderte sexuelle<br />
Zurückhaltung und bedingungslose Treue der Frau wurden schnell zum Idealbild der keuschen, aber<br />
fruchtbaren Ehefrau stilisiert.<br />
Gleichzeitig muss man aber berücksichtigen, dass auch der Mann, obwohl Prostitution und<br />
Knabenliebe öffentlich gebilligt wurden, den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen musste. So<br />
wie es ein Idealbild der Ehefrau gab, gab es ein Idealbild des athenischen Bürgers. Die Erwartungen<br />
der Polis waren hoch. Nicht nur politische oder militärische Leistungen waren der Gradmesser für<br />
einen guten Athener, dieser musste sich auch in privaten Belangen als umsichtiger und<br />
verantwortungsbewusster Familienmensch erweisen. "Der Ledige galt als Prototyp des Asozialen, da<br />
er sich dem sozialen Netzwerk, das die Ordnung der Polis bedingte, entzog“, urteilt E. Hartmann. 640 In<br />
einer Gerichtsrede nimmt Kallistratos Anstoß daran, dass sich Olympiodor eine Hetäre hält, aber nicht<br />
daran denkt, zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen, sich also in gewisser Weise seiner sozialen<br />
Verantwortung zu entziehen versucht:<br />
„For you must know, men of the jury, that this fellow Olympiodorus has never married an<br />
Athenian woman in accordance with your laws; he has no children nor has ever had any,<br />
but he keeps in his house a mistress whose freedom he had purchased, and it is she who is<br />
the ruin of us all and who drives the man on to a higher pitch of madness. “<br />
(Demosth. or. 48, 53)<br />
Tatsächlich geht es dem Kläger also nicht um die Tatsache, ob sein Schwager verheiratet ist oder sich<br />
etwa eine Hetäre hält, sondern darum, dass dieser sie mit Luxusgütern überhäuft, während seine<br />
eigene Familie darbt. In einer weiteren Demosthenes-Rede wird das Freikaufen einer Hetäre durch den<br />
verheirateten Apollodoros als Anzeichen für dessen unbürgerlichen und aufwendigen Lebenswandel<br />
hingestellt. 641 Der Fall von Mantis zeigt, dass ein Athener seine Privatangelegenheiten nach<br />
Gutdünken regeln konnte, solange er seine Familie nicht vernachlässigte oder die Rechte seines<br />
legitimen Erben beschnitt. 642 Der inzwischen verstorbene Vater war ein Liebesverhältnis mit einer<br />
gewissen Plangon eingegangen, deren Status der einer Bürgerin gewesen sein dürfte, auch wenn<br />
Mantitheus, der legitime Sohn des Mantis aus der Ehe mit der Tochter des Polyaratos, sie als gynaika<br />
hetaira 643 und die Beziehung zu seinem Vater gehässig als nicht rechtsgültig bezeichnet. Mit Hilfe<br />
einer List bewegt Plangon Mantis dazu, ihre beiden Söhne als die seinen anzuerkennen, die so<br />
dasselbe Anrecht auf das väterliche Erbe haben wie Mantitheus. Angesichts der athenischen<br />
Gesetzeslage ist es erstaunlich, wie dies möglich gewesen sein kann, war Mantis doch, so zumindest<br />
stellt es Mantitheus dar, zu keiner Zeit mit Plangon, vorausgesetzt sie war überhaupt eine Bürgerin,<br />
kata tous nomous verheiratet.<br />
639 Reinsberg 1993, 43.<br />
640 Hartmann 2002, 109; ähnlich auch R. Flacelière, Griechenland. Leben und Kultur in klassischer Zeit (Stuttgart 1977) 84;<br />
Davidson 1999, 126.<br />
641 Demosth. or. 36, 45.<br />
642 Zu nothoi und gnesioi, s. Lacey 1983, 106 f. 114.<br />
643 Demosth. or. 39, 26.<br />
S e i t e | 139
Die Beziehungen zu Ehefrauen, Hetären und Jünglingen wurden vielfach in der Forschung bezüglich<br />
ihrer Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Welcher man nun letztlich den Vorzug geben<br />
mag, hängt dabei stark von der jeweiligen Fragestellung und nicht zuletzt von subjektiven Eindrücken<br />
ab. Obgleich z. B. R. Just keineswegs gefühlsmäßige Bindungen zu Ehefrauen oder Hetären<br />
ausschließt, sieht er doch in der homoerotischen Beziehung den größtmöglichen Nutzen für den<br />
Bürger begründet. Sie sei die einzige der drei Liebesbeziehungen, die von sozial Gleichgestellten und<br />
aus freien Stücken eingegangen, und deren erotische Erfahrungen nicht durch die Notwendigkeit der<br />
Fortpflanzung oder die Bezahlung sexueller Dienste belastet würde. 644 Inwieweit im reellen Leben die<br />
Ehefrau mit dem Jüngling konkurrieren musste, bleibt unsicher. Homosexualität wurde z. T. gar als<br />
Ausdruck der Zurückweisung alles Weiblichen verstanden. 645 Homosexuelle Vorlieben wurden zwar<br />
vermutlich eher vor der Eheschließung ausgelebt 646 , dennoch machen die philosophischen Gespräche<br />
im „Symposion“ Platons deutlich, wie sehr auch reife Männer noch den Reizen eines schönen<br />
Jünglingskörpers erlagen. Nach E. Cantarella finden Männer ihre sexuelle Stimulanz und Erfüllung<br />
dagegen eher bei Hetären. “This relationship was meant to be somehow gratifying for the man, even<br />
on the intellectual level, and was thus completely different from men´s relationships with either wives<br />
or prostitutes.” 647 Was derartige Untersuchungen trotz der unterschiedlichen Schlussfolgerungen im<br />
Allgemeinen gemein haben, ist die geringe Meinung von der sexuellen Attraktivität der Bürgerin.<br />
S e i t e | 140<br />
4. 2. 2. Die Antithese Ehefrau – Hetäre in den schriftlichen Quellen<br />
Die Polarisierung von Ehefrau und Hetäre 648 , die die moderne Forschung lange vertreten hat, geht<br />
genau genommen bereits auf antike Praxis zurück. In einem Fragment des Menander wird die Ehefrau<br />
in direkte Konkurrenz zur Hetäre gesetzt:<br />
„Schwer ist, o Pamphile, für eine freie Frau<br />
Der Kampf mit einer Dirne. Hat sie doch mehr List,<br />
Mehr Wissen, schämt sich nicht und schmeichelt mehr!“ (Men. fr. 54)<br />
Auch ein von Athenaios überliefertes Fragment der Mittleren Komödie weiß sehr genau um die<br />
Vorteile einer Hetäre im direkten Vergleich mit der Ehefrau:<br />
644 Just 1989, 147–151; s. auch Plat. symp. 192a: Die männliche Natur strebt dem Gleichen und Ebenbürtigen zu, d. h. edlen<br />
Männern und Knaben; in diesem Sinne auch Keuls 1985, 275: “Indeed, neither their cowed or vicious wifes at home nor<br />
the calculating hetaerai of their symposium nights can have been very satisfying sex partners in the long run.” Reinsberg<br />
1993, 163.<br />
645 Keuls 1985, 275.<br />
646 Just 1989, 145. 150; Athen. 13, 593a kennt eine Anekdote über den Redner Demosthenes, nach der jener sich einen<br />
Lustknaben ins Haus geholt haben soll; seine Ehefrau hat es ihm heimgezahlt, indem sie ihrerseits mit dem jungen Mann<br />
ein Verhältnis anfing.<br />
647 E. Cantarella, Pandora´ Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity (Baltimore 1987) 50;<br />
so auch Peschel 1987, 18.<br />
648 Kritik am sog. „Zwei-Typen-Modell“, s. Davidson 1999, 96 ff.; Hartmann 2002, 133.
„Ist die Hetäre nicht was Freundlicheres als die Ehefrau?<br />
Gewiss, viel freundlicher! Die Frau<br />
Sitzt stolz im Haus, pocht auf ihr Recht. Doch jene weiß,<br />
Mit feiner Lebensart als Köder angelt man<br />
Den Mann. Misslingt´s beim einen, beißt der nächste an. (Amphis fr. 1)<br />
Die antiken Quellen, wie vorab ausführlich dargelegt wurde 649 , geben den Zweck der ehelichen<br />
Gemeinschaft deutlich wieder: Ehen werden geschlossen, um Kinder zu zeugen und um dem Haus<br />
eine Verwalterin voranzustellen, die die Angelegenheiten im Inneren versieht, während ihr Mann<br />
Erträge erwirtschaftet und Politik betreibt. 650 Mit unseren heutigen Idealen der innigen Zweisamkeit<br />
und Liebesheirat verglichen, fällt dieses Urteil enttäuschend nüchtern aus. 651 Im direkten Vergleich mit<br />
der Hetäre konnte die Ehefrau angesichts des vorherrschenden Frauenbildes also nur verlieren. Kurz<br />
nach Einsetzen ihrer Pubertät bereits mit einem ihr fremden Mann verheiratet, taugt sie nach Meinung<br />
vieler hauptsächlich, einer Angestellten gleich, als Organisatorin des Haushaltes 652 , sexueller Kontakt<br />
wird allein zu dem Zweck der Fortpflanzung gepflegt. 653 Tagaus, tagein versieht sie treu, aber<br />
ungeliebt ihre Pflichten, ist an das Haus gebunden und kann nur zu seltenen Gelegenheiten wie<br />
Hochzeiten, Begräbnissen oder kultischen Feiern aus ihrer kleinen Welt ausbrechen. 654 Um wie viel<br />
aufregender erscheint dagegen die Hetäre! 655 Sie gilt, auch nachdem man inzwischen von der<br />
Vorstellung der strahlenden Lebefrau abgerückt ist und auch auf ihre ökonomische Abhängigkeit und<br />
ihre niedrige soziale Stellung aufmerksam wurde 656 , dennoch weiterhin als unterhaltsam, feinsinnig<br />
und kultivierter als die Ehefrau. Ihre Schönheit ist legendär und ihre Fähigkeiten, ihren Liebhaber mit<br />
Musik, Flirt und Sex zu umgarnen, sind von der prüden und ungebildeten Ehefrau meilenweit<br />
entfernt. 657 Die sexuelle Selbstbestimmung wurde oft als der große Unterschied zwischen Ehefrau und<br />
649 Vgl. Kap. 1. 2 und 2. 2<br />
650 z. B. Xen. oik. 7, 18–24; Xen. mem. II 2, 4; Demosth. or. 59, 122; s. auch Reinsberg 1993, 34 f.<br />
651 Für B. Borg, Der Logos des Mythos. Allegorien und Personifikationen in der frühen griechischen Kunst (München 2002)<br />
? eine typisch westliche Haltung, die Zweckehen als freudlos und den ehelichen Sex als Vergewaltigung verurteilt.<br />
652 E. Guhl – W. Koner (Hrsg.), Leben der Griechen und Römer 6 (Berlin 1893) 318; E. Keuls, The Hetaira and the<br />
Housewife. The Splitting of the Female Psyche in Greek Art, MededRom N. S. 9/10, 1983, 27.<br />
653 z. B. Reinsberg 1993, 78: "Die geringe Bedeutung, die der Geschlechtsverkehr in der Ehe hatte, war nur ein Grund dafür,<br />
dass eheliche Sexualität nicht dargestellt wurde. Darüber hinaus spielten Dezenz und Schamgefühl eine wesentliche<br />
Rolle, das eheliche Liebesleben fremdem Einblick zu entziehen und nicht ebenso unverblümt abzubilden wie<br />
Hetärenliebe." Eine extremere Position bezieht Keuls 1985, 85: "That Greek women of all classes suffered considerable<br />
sexual frustration is likely."<br />
654 Reinsberg 1993, 41. 43: Ihr Urteil erfährt eine weitere Verschärfung, indem sie vom Schicksal der Hausfrauen in<br />
"emotionaler Verkümmerung, geistiger Verarmung und Abstumpfung" spricht; positiver dagegen A. Vazaki, “Gute”<br />
Schülerinnen. Mädchenunterricht in attischen Vasenbildern der klassischen Zeit, in: B. Miemitz (Hrsg.), Blickpunkt:<br />
Frauen- und Geschlechterstudien (St. Ingbert 2004) 249.<br />
655 Allg. z. B. Peschel 1987; Calame 1992, 82–87; Reinsberg 1993, 80–162; Davidson 1999, 99 ff.; Hartmann 2002, 133–<br />
211. – Zur Etymologie des Begriffes „hetaira“, s. auch Athen. XIII 571d. e.<br />
656 z. B. Keuls 1985, 174 ff.<br />
657 E. Cantarella, Pandora´s Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity (Baltimore 1987)<br />
50: “This relationship (mit einer Hetäre) was meant to be somehow gratifying for the man, even on the intellectual level,<br />
and was thus completely different from men´ s relationships with either wives or prostitutes. “<br />
S e i t e | 141
Hetäre deklariert. Während die Hetäre die Freiheit hatte, zu entscheiden, mit wem, wann und wie oft<br />
sie verkehrte, gab es für die Ehefrau nur einen Partner, und er bestimmte, wann ihm seine Ehefrau<br />
gefügig zu sein hatte. 658<br />
Die Ehefrau des klassischen Athen wird in den antiken Quellen in der Regel nur am Rande fassbar.<br />
Die Verhaltensideale der Zurückgezogenheit und Bescheidenheit verdrängen sie weitgehend aus dem<br />
Blick der Öffentlichkeit. Sie geraten nur dann in den Blickpunkt des Interesses, wenn sie einen<br />
Skandal heraufbeschwören oder in einen Gerichtsfall verwickelt sind. Xenophons Diskurs über das<br />
rechte Haushalten ist eher eine Ausnahme. Und doch ist auch hier nicht zu übersehen, dass uns der<br />
Name der betreffenden Frau vorenthalten wird, und ihre Persönlichkeit nicht über ihr Rollen-<br />
verständnis als ideale Haus- und Ehefrau hinaus entwickelt ist. Die Sitte der Athener, ihre Ehefrauen<br />
abzuschirmen, führte die Forscher zu zwiespältigen Schlussfolgerungen bezüglich ihrer<br />
gesellschaftlichen Stellung: entweder waren deren Frauen geachtet und schützenswert oder aber<br />
isoliert lebende und vernachlässigte „Objekte“. 659 J. N. Davidson macht auf einen bisher kaum in<br />
Erwägung gezogenen Punkt aufmerksam. „Dass ein Ausschluss Begehren in Wirklichkeit<br />
hervorbringt, dass er Reize in besonderer Weise aktiviert, dass er sexuell stimulierend wirkt und nicht<br />
nur ein passiver Reflex bestehender Triebe ist, wird selten berücksichtigt.“ 660 Gerade die Tatsache<br />
also, dass Ehefrau oder Bürgerstochter vor neugierigen Blicken verborgen waren, mochte die<br />
Phantasie und das Begehren der Männer angeregt haben.<br />
Die Prostituierten Athens waren keine homogene Masse; neben den Hetären waren es vor allem die<br />
Pornai, die in den Bordellen und an Straßenecken in den einschlägigen Vierteln billig für eine Obole<br />
zu haben waren und die das Straßenbild Athens viel mehr geprägt haben dürften als die Hetären. Und<br />
nicht zuletzt lassen sich auch die Reihen der Hetären nochmals in zwei Kategorien unterteilen:<br />
einerseits die Frauen, die für Symposionsabende von Kupplern zu mieten waren, wie z. B. Neaira am<br />
Anfang ihrer ′Karriere′ 661 , und die sog. Megalomisthoi, von denen bekannt ist, dass sie sich mit Prunk<br />
umgaben und sündhaft teuere Weihgeschenke in Heiligtümer stifteten. Zu letzteren gehörte sicherlich<br />
Theodote, die ein eigenes Haus unterhielt und dank ihrer zahlreichen Verehrer in Luxus schwelgte. 662<br />
Entgegen dem ersten Eindruck und trotz des breit gefächerten Schriftmaterials erhalten wir keine<br />
weniger stilisierte Schilderung des Hetärentums in Athen als im Bezug auf die Stellung und die<br />
Tugenden der Ehefrau. Es sind die wenigen großen Hetären wie Phryne, Theodote, Aspasia oder<br />
Rhodopis, die entweder wunderschön, sagenhaft reich 663 waren oder durch ihre Beziehung zu<br />
berühmten Künstlern und Politikern von sich reden machten, und die letztendlich für lange Zeit die<br />
Vorstellung des Hetärentums prägten. Daneben erfahren wir lediglich hier und dort am Rande, wie<br />
658 Keuls a. O. (Anm. 652) 23–40.<br />
659 Einen knappen Überblick über die diesbezügliche Forschungsgeschichte bietet z. B. Pomeroy 1985, 86–89.<br />
660 Davidson 1999, 151.<br />
661 Demosth. or. 59, 26 ff.<br />
662 Xen. mem. 3, 11,1 ff.<br />
663 Athen. 13, 591b–d: So soll z. B. Phryne eine Erosstatue des Praxiteles in das Heiligtum von Thespiai geweiht haben;<br />
legendär ist ihr Angebot, die Stadtmauer Thebens nach ihrer Zerstörung durch <strong>Alexander</strong> aus eigenen Mitteln wieder zu<br />
errichten.<br />
S e i t e | 142
sich ein Mann wegen einer Hetäre zum Narren macht, in Streitereien und Handgreiflichkeiten<br />
verwickelt wird 664 , seinen gesamten Besitz verschleudert 665 oder seine Ehefrau verärgert, indem er<br />
seine Geliebte in sein Haus brachte 666 . In der klassischen Literatur ergeht es den Hetären im Grunde<br />
nicht viel anders als der Gesamtheit der Frauen: Das Urteil der Autoren schwankt zwischen<br />
Bewunderung und Lob, Kritik und Verachtung. 667 Nicht jeder war von dem kunstvollen, aber<br />
zwielichtigen Spiel der Hetären angetan, wie die umfangreiche Zitatensammlung des Athenaios<br />
belegt. Einen kleinen Vorgeschmack mag vielleicht folgende Passage geben:<br />
„Welcher Mensch sich in ein leichtes Mädchen hat verliebt –<br />
Keiner könnte wohl bestreiten, dass sich diese Art Geschöpf am meisten gegen das Gesetz<br />
vergeht<br />
Welches wahre Drachenweib, welch feuerschnaubende Chimäre<br />
Oder Charybdis, die Skylla mit drei Köpfen, dieses Hunde-Seegeschöpf,<br />
Welche Sphinx wie Hydra, Löwin oder Natter und geflügelte Harpyenbrut<br />
Hat denn einen schändlicheren Ruf als die verfluchte Zunft?<br />
Das gibt´s nicht; denn diese Frauen übertreffen alles Schlimme, was es gibt.“<br />
(Athen. 13, 558a–b)<br />
Die Faszination, die das Hetärenwesen von Beginn an auf die historische Forschung ausübte, dürfte<br />
wesentlich von Autoren römischer Zeit beeinflusst worden sein, als etwa Lukian in seinen<br />
„Hetärengesprächen“ oder Athenaios in seinem „Gelehrtenmahl“ den Hetären ein literarisches<br />
Denkmal setzten. 668 Die historische Forschung besonders des 20. Jhs. erlag dem Flair der griechischen<br />
Hetäre und stilisierte sie zur schönen und verführerischen Femme fatale. 669 Noch heute scheint sich<br />
dies auf die Wertschätzung der athenischen Ehefrau auszuwirken.<br />
4. 2. 3. Das Verhältnis der Ehepartner<br />
Tatsächlich scheint es zunächst berechtigt anzunehmen, dass Ehen, die unter praktischen<br />
Gesichtspunkten, d. h. aufgrund sozialer, politischer oder finanzieller Aspekte, geschlossen werden,<br />
weniger auf persönlicher Nähe oder Zuneigung beruhen. Unter günstigen Umständen mag sich ein<br />
zumindest freundschaftliches und auf Respekt und Vertrauen basierendes Verhältnis zwischen den<br />
Ehegatten entwickeln, wie dies etwa Xenophon in seinem „Oikonomikos“ schildert. Gegenseitige<br />
Achtung und Vertrauen scheinen in der Beschreibung griechischer Ehen Schlüsselbegriffe zu sein.<br />
Xenophons Konstrukt einer harmonischen Ehe fußt auf folgender simpler Gleichung: In einem<br />
664 z. B. Lys. 1, 43; 4, 8; Demosth. or. 54, 14.<br />
665 Is. 6, 21; Demosth. or. 48, 55; s. auch Davidson 1999, 227 ff.<br />
666 Plut. Alk. 8; Demosth. or. 59, 21 f.<br />
667 Athen. 13, 568a–d überliefert ein Frg. des Alexis, das die Hetären als geldgierig brandmarkt und vor ihren<br />
Umgarnungskünsten warnt; Men. Sam. 392–396; s. auch Pomeroy 1985, 136; Reinsberg 1993, 87. 156–158; Davidson<br />
1999, 143.<br />
668 L. K. McClure, Courtesans at Table. Gender and Greek Literary Culture in Athenaeus (New York 2003).<br />
669 Reinsberg 1993, 81 f.<br />
S e i t e | 143
Haushalt, in dem Mann und Frau ihren Pflichten nachkommen und die eheliche Gemeinschaft<br />
bereitwillig fördern, mündet dies zwangsläufig in gegenseitigem Respekt und Zuneigung. Eine<br />
derartige, persönlich-emotionale Beziehung beinhaltet auch einen körperlich-sexuellen Aspekt 670 , der<br />
zuallererst das Zeugen von Nachkommen zum Ziel hat und weder als lästig noch als oktroyiert<br />
empfunden wird. Sinn und Zweck einer Ehe beruhen allerdings, so sagt Ischomachos selbst, auf weit<br />
mehr als rein körperlicher Anziehung und Ausübung des Geschlechtsverkehrs. 671 Im Grunde gibt<br />
Xenophon damit den Inhalt der berühmten Demosthenes-Stelle 59, 122 wieder, die als Unterschied<br />
zwischen Hetäre und Ehefrau betont, dass erstere (nur) körperliche Lust stillt, während letzterer der<br />
Besitz und die legitimen Kinder anvertraut werden.<br />
Auch Euphiletos konstatiert vor Gericht, dass er mit seiner Frau ein Vertrauensverhältnis hatte. 672<br />
Dieses ist nach unseren Maßstäben allerdings nicht unbedingt mit Liebe gleichzusetzen: „Rather, their<br />
„intimacy“, as the Greek term oikeiotes implies, has to do with the joint establishment of a domestic<br />
unit and with the procreation of children.” 673 Sogar Aristoteles spricht in den „Oikonomika“ von<br />
Vertrauen, Achtung und Freundschaft, die der Ehegatte seiner Gattin entgegenbringen sollte, und<br />
schafft daraus die Grundlage für eine beidseitige, von Philia geprägte Beziehung. 674 Gleichzeitig<br />
befürchtet er als Pragmatiker jedoch, dass eine zu große emotionale Verbundenheit der Ehepartner das<br />
auf den praktischen Nutzen ausgerichtete Arrangement der ehelichen Gemeinschaft aus dem<br />
Gleichgewicht bringt: 675<br />
S e i t e | 144<br />
„Was aber den täglichen Umgang miteinander angeht, so soll man es weder an etwas fehlen<br />
lassen, noch ihn in dem Maße pflegen, dass im Fall einer Abwesenheit (beide) in Unruhe<br />
sind, sondern man soll die Frau so erziehen, dass sie sich angemessen verhält, ob der Mann<br />
nun anwesend ist oder abwesend ist.“ (Aristot. oec. I, 1344a)<br />
Während die Quellen für die klassische Zeit des 5. und frühen 4. Jhs. v. Chr. vor allem pragmatische<br />
Argumente für das Zustandekommen einer Ehe nennen, gibt es in der Folgezeit durchaus auch<br />
Beispiele, wo das liebenswerte Wesen der Ehefrau das Herz eines Mannes zu gewinnen vermag. In<br />
einem Fragment einer verlorenen Komödie hat sich ein Mann so sehr in seine junge Frau verliebt, dass<br />
er keine Nacht ohne sie sein kann. 676 In den Komödien des Menander hat sich dann die Liebe als<br />
Grundlage für den Ehebund durchgesetzt. 677 Als sich im „Menschenfeind“ Sostratos unsterblich in<br />
Myrrhine verliebt hat, unterstreicht er im Gespräch mit ihrem Bruder die Ehrbarkeit seiner Werbung ,<br />
indem er sagt, seine Liebe sei so stark, er würde sie auch ohne Mitgift ehelichen. Später gibt ihm sein<br />
Vater den weisen Rat:<br />
670 Sutton 2004, 328.<br />
671 Xen. oik. 7, 10 f.; Calame 1992, 91: “In Grecia l´ unione matrimoniale, compimento del desiderio amoroso, fonda sulla<br />
sesssualità una relazione di philotes.”<br />
672 Lys. 1, 6.<br />
673 Just 1989, 137.<br />
674 Aristot. oec. III, 143 f.; Reuthner 2006, 97 f.: Letztlich steht über allem aber dennoch die Überzeugung der Herrschaft des<br />
Mannes über die Frau.<br />
675 C. A. Cox, Household Interests (Princeton 1998) 72.<br />
676 P. Antinoop. 15.<br />
677 Mossé 1983, 121–125.
„Ich weiß doch, bei den Göttern, und ich sage dir:<br />
Für junge Menschen ist die Ehe von Bestand,<br />
Wo Liebe mit im Spiel ist und zur Ehe führt.“ (Men. Dysk. 788–790)<br />
4. 2. 4. Das Verhältnis von Liebhaber und Hetäre<br />
Beziehungen mit Hetären, die durch ihr gutes Aussehen, ihren schönen Körper, ihren<br />
Unterhaltungswert und ihre sexuelle Verfügbarkeit bestechen, werden unter ganz anderen<br />
Grundvoraussetzungen als eine Ehe eingegangen. In erster Linie geht es um das Stillen körperlicher<br />
Begierden. 678 Daneben mögen die Hetären es verstanden haben, durch feine Bildung, Schönheit und<br />
aufreizendes Benehmen so manchen Athener auch längerfristig zu betören und an sich zu binden. 679<br />
Eine Affäre mit einer Hetäre wurde zum regelrechten Statussymbol eines jeden Bonvivant. Ariston<br />
bemängelt den allgemeinen moralischen Verfall der athenischen Jugend, die das Flirten als sportlichen<br />
Wettkampf unter Gleichaltrigen betreiben, wobei Prügeleien und Handgreiflichkeiten an der<br />
Tagesordnung sind. 680 Nicht zufällig sind es oft politische Größen, Dichter oder Künstler, die sich mit<br />
der Eroberung stadtbekannter Hetären schmückten. Das prominenteste Paar der athenischen<br />
Geschichte ist sicherlich Perikles und Aspasia. Die Authentizität von Plutarchs Geschichten ist leider<br />
nicht garantiert, gehört der Biograph doch bereits zu den Autoren des zweiten nachchristlichen<br />
Jahrhunderts:<br />
„Die einen behaupten, Perikles habe Aspasia nur wegen ihrer Weisheit und politischen<br />
Einsicht umworben. Denn auch Sokrates besuchte sie zuweilen mit seinen Schülern, und<br />
ihre Freunde brachten oft die eigenen Gattinnen zu ihr, damit sie ihr zuhören könnten. […]<br />
Da sie [Perikles und seine erste Frau] aber nicht glücklich miteinander lebten, gab er sie mit<br />
ihrer Einwilligung einem andern zur Frau. Er selber nahm Aspasia, an der er in inniger<br />
Liebe hing; denn man erzählt, er habe sie jeden Tag, wenn er das Haus verließ und wenn er<br />
vom Markt heimkehrte, zärtlich geküsst.“ (Plut. Per. 24)<br />
Über den Status und den Charakter Aspasias wurde viel gerätselt. 681 Die Tatsache, dass sie sich im<br />
gleichen sozialen Umfeld wie viele politische oder philosophische Berühmtheiten bewegte, zeigt von<br />
Anfang an ihre Andersartigkeit. Ob die Skandalgeschichten, sie habe sich anfänglich in Athen als<br />
Hetäre verdingt und dann später sogar ein Bordell betrieben 682 , allein bösen Zungen und Neidern<br />
zuzuschreiben sind, sei dahingestellt. Man kann sich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass der<br />
Begriff „Hetäre“ bereits im klassischen Athen inflationär gebraucht wurde für jene Ausländerinnen,<br />
678 Peschel 1987, 19 verweist auf die Rede gegen Neaira 20, wo die Hetären definiert werden als Frauen, die „mit dem<br />
Körper arbeiten“.<br />
679 Peschel 1987, 18 sieht es als ein Verhältnis frei von sozialen Zwängen; Calame 1992, 86 hält auch philia für möglich.<br />
680 Demosth. or. 54, 14.<br />
681 z. B. L.-M. Günther, Aspasia und Perikles. Rufmord im klassischen Athen, in: M. H. Dettenhöfer (Hrsg.), Reine<br />
Männersache? Frauen in Männerdomänen der antiken Welt (München 1996) 41–67.<br />
682 z. B. Plut. Per. 24, der ihr insgesamt aber recht wohlgesonnen ist; dagegen Aristoph. Ach. 524–534; ders., Lys. 107–112;<br />
Athen. 13, 569f–570a. b.<br />
S e i t e | 145
die unkonventionelle Beziehungen mit populären Athenern unterhielten. 683 Aspasia war in jeder<br />
Hinsicht eine ungewöhnliche Frau, die auch unter den Hetären kaum Vergleiche findet. Sie darf zu<br />
den wenigen Frauen gezählt werden, die alle Merkmale der „idealen Hetäre“ in sich vereinen:<br />
Schönheit und Charme gepaart mit Weisheit, politischer Einsicht und Bildung. 684<br />
Ebenso wenig wie für eine legitime Ehe Zuneigung pauschal vorausgesetzt werden kann, gilt dies für<br />
Respekt und Liebe in einer auf Erotik und Genuss basierenden Beziehung. War eine Liebesaffäre<br />
dauerhaft in der Lage, die soziale Kluft zwischen Freier und Hetäre zu überbrücken und die Tatsache,<br />
dass die Grundlage ihrer Bindung stets eine geschäftliche war, vergessen zu lassen? 685 Erinnern wir<br />
uns an Neaira 686 , die am Beginn ihrer schillernden Laufbahn ihrer Kupplerin von zwei Liebhabern<br />
abgekauft wird. Nachdem Timanoridas und Eukrates ihr die Möglichkeit geboten haben, sich<br />
freizukaufen, gerät sie an Phrynion. Mit entrüsteten Worten beschreibt der Ankläger in der<br />
Gerichtsrede die Ausschweifungen der beiden, die sogar den auf Symposien erlaubten Rahmen der<br />
Freizügigkeit sprengen. Phrynion verkehrt mit ihr vor den Augen seiner Bekannten, und als alle<br />
besinnungslos betrunken sind, wird Neaira von einem Symposiasten zum nächsten gereicht. 687 Neaira<br />
beendet die für sie trotz der offensichtlichen Großzügigkeit Phrynions unbefriedigende Beziehung<br />
durch ihre Flucht nach Megara.<br />
S e i t e | 146<br />
„Since, then, she was treated with wanton outrage by Phrynion, and was not loved as she<br />
expected to be, and since her wishes were not granted by him, she packed up his household<br />
goods and all the clothing and jewelry with which he had adorned her person, and, taking<br />
with her two maid-servants, Thratta and Coccaline, ran off to Megara.“<br />
(Demosth. or. 59, 35)<br />
Der Fall der Neaira ist noch aus einem anderen Grund interessant: Als Ursache, warum ihre ersten<br />
beiden Besitzer sich ihrer Hetäre entledigen möchten, wird nämlich deren bevorstehende Verheiratung<br />
genannt. 688 Es ist kaum anzunehmen, dass grundsätzlich alle Männer ihre Hetärenliebschaften<br />
zugunsten einer Ehefrau aufgaben. 689 Erst in den Komödien des Menander erhält man den Eindruck,<br />
dass Liebesheiraten allmählich außereheliche Affären mit Hetären ersetzen. 690 Man kann nur<br />
vermuten, dass Neaira, da sie ja ihrer Kupplerin abgekauft worden war, in einem der Häuser ihrer<br />
Besitzer residierte, so dass sich im Falle einer Heirat Komplikationen ergaben. Es galt als beleidigend<br />
683 s. auch Davidson 1999, 96.<br />
684 Just 1989, 144.<br />
685 Just 1989, 146 f.<br />
686 Zur Neaira-Rede, s. C. B. Patterson, The Case against Neaira and the Public Ideology of the Athenian Family, in: A. L.<br />
Boegehold – A. C. Scafuro (Hrsg.), Athenian Identity and Civic Ideology (Baltimore 1994) 199–216; D. Hamel, Der Fall<br />
Neaira. Die wahre Geschichte einer Hetäre im antiken Griechenland (Darmstadt 2004).<br />
687 Demosth. or. 59, 33: „[…] he treated her without decency and restraint. […] many had intercourse with her when she was<br />
drunk, while Phrynion was asleep, among them even the serving-men of Chabrias.“<br />
688 Demosth. or. 59, 30.<br />
689 Wie der Fall des Alkibiades und der Hipparete belegt, s. Plut. Alk. 8.<br />
690 z. B. Men. Virtuose S. 226, der eine junge Frau – „ sie war ja frei und stammt aus einer Griechenstadt“ – einer Dirne<br />
vorzieht.
genug, wenn ein Mann im Verlauf seiner Ehe eine Hetäre in seinem Haus einquartierte 691 , die junge<br />
Braut unmittelbar nach der Hochzeitsnacht der Geliebten vorzustellen, wäre ein unverzeihlicher<br />
Fauxpas gewesen.<br />
Abrotonon, in Menanders Komödien der Stereotyp der Hetäre, ist geradezu empört, als ihre<br />
Liebesbekundungen und Zärtlichkeiten bei Charisios, der sich nach seiner Frau verzehrt, von der er<br />
glaubt, sie habe ihn betrogen, auf brutale Ablehnung stoßen:<br />
„Lasst mich, ich bitte dich, und kränkt mich nicht!<br />
Ich Arme hab mich selbst zum Spott gemacht<br />
Ganz unverhofft. Ich meint, er würd mich lieben,<br />
Doch unvorstellbar hasst mich dieser Mensch.<br />
Ich Arme darf mich nicht einmal an seine Seite,<br />
Nur abseits legen.“ (Men. Epitrep. 430–435)<br />
Obwohl es immer als Vorteil angerechnet wird, dass die Hetäre keinen sittlichen Normen verpflichtet<br />
ist, birgt ihre Stellung auch Nachteile. Im Gegensatz zu einer Ehefrau, die in der Regel in ihrem<br />
familiären Verband verankert ist, der sie nach dem Tod ihres Mannes bzw. der Scheidung von ihrem<br />
Ehemann wieder aufnimmt 692 , verliert die Hetäre mit ihrem Liebhaber Einkunftsquelle und finanzielle<br />
Absicherung. Während die Mitgift, der zwischen zwei Familien geschlossene Kontrakt der Engye oder<br />
die Furcht, öffentliches Aufsehen zu erregen, den Gatten davon abgehalten haben dürften, seine Frau<br />
ohne triftigen Grund zu ihrem Vater zurückzuschicken, hinderte ihn nichts daran, nach Mutwillen mit<br />
seiner Geliebten zu verfahren. Als eine Hetäre von ihrem Liebhaber ins Bordell abgeschoben zu<br />
werden droht, weil er ihrer überdrüssig ist, greift sie zu einer verzweifelten Maßnahme. Sie folgt dem<br />
Ratschlag der intrigierenden Ehefrau, dem Mann einen Liebestrank zu verabreichen, dem jedoch Gift<br />
beigemischt ist. 693 Der Spieß lässt sich jedoch auch umdrehen: Es ist keineswegs selbstverständlich,<br />
dass sich eine Hetäre leichter handhaben lässt als eine Ehefrau. Zitate, wie das oben angeführte<br />
Fragment aus einer Komödie des Amphis, vermögen eben doch ein nur sehr einseitiges Bild zu<br />
vermitteln. 694 Der Bewunderer einer Hetäre stand ständig unter dem Druck, ihre Gunst durch<br />
Geschenke erhalten und sich gegen Konkurrenten zur Wehr setzen zu müssen. 695 Der finanzielle<br />
Aufwand war zum Teil wohl gewaltig. So nennt auch Isokrates als Wesenszug der Hetären, dass sie<br />
zwar „zunächst zur Liebe anregen, dann aber diejenigen, die sich auf sie eingelassen haben, zugrunde<br />
richten.“ 696<br />
691 Lysias, so heißt es in Demosth. or. 59, 22, quartierte seine Hetäre Metaneira aus Rücksicht auf seine Ehefrau nicht bei<br />
sich zuhause ein, sondern bei einem unverheirateten Freund.<br />
692 Lacey 1983, 130.<br />
693 Antiph. 14–24.<br />
694 s. Kap. III. 2. 2.<br />
695 z. B. Athen. 13, 567d–e.<br />
696 Isokr. 8, 103.<br />
S e i t e | 147
S e i t e | 148<br />
4. 3. Der Geschlechtsverkehr<br />
Die Basis einer Beziehung eines Mannes zu einer Hetäre war vorrangig die Befriedigung seiner<br />
sexuellen Bedürfnisse, die er sich über Bezahlung oder Geschenke sicherte. Daneben war die<br />
Sexualität aber auch fester Bestandteil ehelicher wie päderastischer Verbindungen 697 . Das Bild der<br />
Knabenliebe war schon in der Antike ambivalent. Denn während auf der einen Seite die Bewunderung<br />
der Griechen für schöne Knaben und die entfachte Begierde kaum verhehlt wurden, bemühte man sich<br />
auf der anderen Seite, ihre Existenz über ihre sozialen und didaktischen Aspekte zu rechtfertigen. 698 Es<br />
wäre moderner Zynismus, würde man diesen Versuch als bloße Schönfärberei abtun. Die Mäßigung<br />
und Kontrolle der menschlichen Triebe war sichtbares Zeichen männlicher Kultiviertheit und<br />
Voraussetzung für jeden guten Polisbürger. 699<br />
Der Geschlechtsverkehr mit der Ehefrau war zwar eine soziale Prämisse, inwieweit er unfreiwillig<br />
oder gar erzwungen von statten ging, ist heute natürlich schwierig zu beantworten. 700 Man sollte sich<br />
jedoch keinesfalls verleiten lassen, das Gesetz, nach dem der Ehemann einer Epikleros dreimal im<br />
Monat mit ihr schlafen müsse 701 , auf eine normale athenische Durchschnittsehe zu übertragen. Denn<br />
zwischen beiden besteht ein gewichtiger Unterschied. Gleichwohl die Tochter – ob Erbtochter oder<br />
nicht – wahrscheinlich in keinem Fall an der Wahl ihres Bräutigams beteiligt wurde, erklärte sich der<br />
zukünftige Gatte bei einer nach festem Regelwerk vonstatten gehenden Hochzeit bei Schließung der<br />
Engye mit der Wahl seiner Ehefrau einverstanden. Im Falle der Erbtochter wurde der nächste<br />
Verwandte gesetzlich dazu verpflichtet, die Epikleros zu ehelichen. 702 Neben Beispielen, wo das<br />
Gericht, da mehrere Bewerber um die Hand einer Epikleroi anhielten, als Entscheidungsträger<br />
fungierten musste 703 , gab es offensichtlich auch Fälle, in denen die Einmischung der Polis in<br />
familieninterne Belange als Zwang empfunden wurde und der betroffene Verwandte versuchte, sich<br />
seiner Pflicht zu entziehen 704 . Die Versorgung der Epikleros und der Fortbestand des Oikos durch<br />
Sicherung der Nachkommenschaft standen an vorderster Stelle und legitimierten die<br />
Interessenvertretung der Polis. 705 Eine Ehe, die aus freien Stücken und ohne Einwirkung juristischer<br />
Urteilssprüche geschlossen wurde, hatte eine formelle Ermunterung nicht nötig, da es stets im<br />
Interesse des Ehepaars selbst lag, durch die Zeugung von Kindern Vorsorge für sich selbst und den<br />
Fortbestand des Oikos zu treffen.<br />
697 K. J. Dover, Homosexualität in der griechischen Antike (München 1983); G. Koch-Harnack, Knabenliebe und<br />
Tiergeschenke. Ihre Bedeutung im päderastischen Erziehungswesen Athens (Berlin 1983); Reinsberg 1993, 98–104. 189–<br />
199; K. J. Dover, Greek Attitudes to Sexual Behaviour, in: M. Golden – P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in<br />
Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 114–128.<br />
698 z. B. Just 1989, 147 f.; Reinsberg 1993, 163. 170–178.<br />
699 Koch-Harnack a. O. (Anm. 697) 34 ff.<br />
700 B. Borg, Der Logos des Mythos. Allegorien und Personifikationen in der frühen griechischen Kunst (München 2002) 180 f.<br />
701 Plut. Sol. 20, 3. – Zur Epikleros, s. Patterson 1998, 97–101; Lacey 1983, 94.<br />
702 z. B. Harrison 1968, 10–12.<br />
703 Harrison 1968, 10 f.: Epidikasia, Prüfung des Kandidaten durch den Archon, Diadikasia, Prüfung und Abwägung<br />
mehrerer potentieller Kandidaten.<br />
704 s. auch C. A. Cox, Household Interests (Princeton 1998) 98 f.<br />
705 Patterson 1998, 105.
Ferner schreibt z. B. eine Verfügung den Frauen vor, drei Tage vor Beginn des Thesmophorienfestes<br />
keusch zu leben. 706 Eine solche Regelung macht nur dann Sinn, wenn das Ehelager der Ehefrauen<br />
nicht die längste Zeit verwaist war, weil sich der Ehemann lieber in fremden Betten aufhielt. Plutarch,<br />
obgleich er, wie gesagt, aus großer zeitlicher Distanz schreibt, nennt den ehelichen Sexualverkehr<br />
einen Liebesbeweis und ein probates Mittel zur Tilgung oder Vorbeugung möglicher Differenzen:<br />
„Denn wenn auch keine Kinder geboren werden, so ist das doch eine Ehre und eine<br />
Aufmerksamkeit, die der Mann einer sittsamen Frau erweist und die viele der sich immer<br />
entwickelnden Misshelligkeiten beseitigt und es nicht dahin kommen lässt, dass sie sich<br />
durch ihre Streitigkeiten einander ganz entfremden.“ (Plut. Sol. 20)<br />
Im Übrigen ist Plutarch der Ansicht, dass „die Vereinigung von Mann und Frau zum Zweck der<br />
Kinderzeugung in Liebe und Zärtlichkeit geschehen sollte“. 707 Ob der Autor damit jedoch wirklich<br />
solonische oder immerhin klassische Zustände wiedergibt, ist fraglich. Ein bereits erwähntes Fragment<br />
einer verlorenen Komödie zeigt aber, dass manche Männer sich durchaus sexuell zu ihren Ehefrauen<br />
hingezogen fühlten und die Nächte lieber an der Seite ihrer Gattin verbrachten als außer Haus. 708<br />
Die weibliche Sexualität hatte jedoch bei Weitem nicht nur positive Aspekte. Unzureichende<br />
medizinische Kenntnisse machten in der Antike jede Schwangerschaft zum Risiko. Da das<br />
ökonomische Potential vieler Oikoi außerstande gewesen sein dürfte, eine große Familie zu<br />
unterhalten, war das Bestreben, Schwangerschaften zu verhindern oder Schwangerschaftsabbrüche<br />
herbeizuführen, stets präsent, wie das Corpus Hippokratikum belegt. 709 Inwieweit die Praxis,<br />
unerwünschte oder überzählige Kinder auszusetzen, tatsächlich als probates Mittel zur Regulierung<br />
der Kinderzahl betrachtet wurde, ist unklar. 710 Dass das Prostituiertenwesen in Athen in gewisser<br />
Weise die Funktion einer Geburtenkontrolle übernahm, kann nicht ganz ausgeschlossen werden. 711<br />
4. 3. 1. Eheliche Sexualität in den Schriftquellen<br />
Es ist an sich kaum zu erwarten, dass das Thema der körperlichen Intimität in der Ehe, das in der<br />
Bildkunst so bewusst auf Symbolik beschränkt bleibt, in den literarischen Quellen ausführlicher zur<br />
Sprache kommt. Ausnahme bleibt die Komödie, die sich nicht scheut, die Dinge beim Namen zu<br />
nennen. Außerhalb dieser Gattungen findet man in den antiken Quellen lediglich verstreute Hinweise,<br />
706 Pomeroy 1985, 117.<br />
707 Plut. Sol. 20.<br />
708 P. Antinoop. 15.<br />
709 S. Dickson, Abortion in Antiquity, Arethusa 6, 1973, 159–166; C. Schubert – U. Huttner (Hrsg.), Frauenmedizin in der<br />
Antike (Düsseldorf 1999) 48–63 mit Auszügen aus Platon, Aristoteles und dem Corpus Hippocraticum.<br />
710 z. B. R. Tolles, Untersuchungen zur Kindesaussetzung bei den Griechen (Breslau 1941); A. Cameron, The Exposure of<br />
Children and Greek Ethics, Classical Review 46, 1932, 105–114; V. Siurla-Theodoridou, Die Familie in der griechischen<br />
Kunst und Literatur des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. (München 1989) 362–365; s. auch Aristot. Pol. 7, 16.<br />
711 Die gleiche Wirkung haben die Homosexualität, der Analverkehr und die Abtreibungs- bzw. Verhütungspraktiken, s.<br />
Pomeroy 1985, 103.<br />
S e i t e | 149
die das Verhältnis der Eheleute zueinander beleuchten. Dabei ist stets zu beachten, dass wir uns mit<br />
einer männlichen Sicht auf die Frau begnügen müssen. 712<br />
Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die griechische Antike Monogamie bzw. Treue von Seiten<br />
des Mannes nicht kannte. Außereheliche sexuelle Aktivitäten waren also die Regel. 713 Die folgenden<br />
Zeilen aus der Neaira-Rede des Demosthenes bzw. Apollodor sind in jeder Abhandlung zum Thema<br />
der Frau in der Antike abgedruckt. Sie werden an den Anfang gestellt, weil sie eine Grundhaltung<br />
verschiedenen Typen von Frauen gegenüber verrät, die bezeichnend für die Geisteshaltung der<br />
griechischen Antike ist:<br />
S e i t e | 150<br />
„Hetaerae we keep for pleasure, concubines for daily attendance upon our person, but wives<br />
for the procreation of legitimate children and to be the faithful guardians of the<br />
households.“ (Demosth. or. 59, 122)<br />
Diese Passage hat man häufig herangezogen, um die Wertschätzung, die den Hetären und den Pallakai<br />
galt, der Verachtung der Ehefrau, die „nur“ zur Gebärerin und Haushälterin taugte, gegenüber<br />
zustellen. Eine solche Lesart ist allein schon deshalb unwahrscheinlich, weil sie einer diffamierenden<br />
Gerichtsrede gegen eine Prostituierte entnommen ist. 714 Die Grundaussage ist zwar nach wie vor<br />
folgende: Hetären braucht man für den Sex, Ehefrauen für Familie und Oikos. Man sollte aber nicht<br />
übersehen, dass der Dienstleistungsbereich der Hetären den Kompetenzen der Hausfrau untergeordnet<br />
wird. Weder wird eine abwertende Aussage bezüglich der Stellung der Ehefrauen gemacht noch wird<br />
behauptet, sie führten ein sexfreies Leben. Sex kann „Mann“ mit jedem haben, aber nur die legitime<br />
Ehefrau kann legitime Kinder in die Welt setzen und den Haushalt zuverlässig versorgen.<br />
Eine Passage aus den „Memorabilia“ hat einen der Demosthenes-Stelle ähnlichen Inhalt. So lässt<br />
Xenophon den Sokrates zu seinem Sohn Lamprokles sagen:<br />
„Und du nimmst doch nicht etwa an, dass die Menschen wegen des Liebesgenusses Kinder<br />
zeugen; denn an Gelegenheiten dazu fehlt es gewiss nicht auf den Straßen und nicht in den<br />
Häusern. Bekanntlich überlegen wir auch, welche Mutter uns die besten Kinder schenken<br />
wird; und mit dieser verbinden wir uns zur Zeugung von Kindern.“ (Xen. mem. II 2, 4)<br />
Man neigte dazu, die Stelle zu Ungunsten der Ehefrauen auszulegen. Es ist jedoch gewiss nicht<br />
herauszulesen, dass die Leidenschaften der athenischen Bürger nur in den Bordellen gestillt wurden.<br />
Die Athener zeugten Kinder als Erben ihres Oikos und als zukünftige Bürger der Polis und nicht aus<br />
reiner Lustbefriedigung. Der Liebesgenuss von Ehepartnern wird dabei aber keineswegs in Abrede<br />
gestellt.<br />
712 F. I. Zeitlin, Eros, in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia Cultura Arte Società. I. Noi e i Greci (Turin 1996) 378: „Non va<br />
pertanto dimenticato che le donne che “udiamo” e “vediamo” nella tradizione letteraria e pittorica non sono persone ma<br />
figure, poiché la loro immagine è filtrata attraverso le convenzioni della rappresentazione artistica e le norme del<br />
comportamento sociale”.<br />
713 z. B. Reinsberg 1993, 43.<br />
714 z. B. A. W. Gomme, The Position of Women in Athens in the fifth and fourth Centuries, CP 20, 1925, 16; D. C. Richter,<br />
The Position of Women in Classical Athens, ClJ 67, 1971, 5; Hartmann 2002, 11.
Mitunter das früheste Zeugnis zum Verhältnis der Frauen zur Sexualität liefert uns Semonides. Es<br />
handelt sich dabei um sehr stereotype Haltungen, die mit seiner Charakterisierung der weiblichen<br />
Mängel korrespondieren. Neben dem Frauentypus, der dem Esel gleich weder beim Essen noch in<br />
Liebesdingen Maß und Zurückhaltung zeigt 715 , gibt es den Wieseltypus, blasse, nichtssagende Frauen<br />
ohne Ausstrahlung und Feuer, die diesbezüglich beklagenswert wenig natürliche Begabung an den<br />
Tag legen.<br />
Und eine nach dem Wiesel – jämmerlicher Typ:<br />
An der ist gar nichts Schönes, nichts was lieblich ist,<br />
daran – nichts, was Vergnügen weckte, gar Begier!<br />
Vom Bett versteht sie nichts und Liebeslust,<br />
und wenn der Mann sie stößt, macht sie ihm Übelkeit. (Sem. Fr. 7 West, 50–54)<br />
Weder das eine noch das andere behagt dem Ehemann oder Liebhaber. Genauso wenig gefällt dem<br />
Mann das Luxuspferd. Die Frau dieses Typus verwendet viel Zeit auf Körperpflege und Putz und<br />
verkörpert damit die personifizierte Versuchung und Hinterlist, denen seit Pandora jeder Mann<br />
unterlegen ist. 716 Der sexuelle Aspekt bleibt bei der Biene nur scheinbar außen vor. Da sie insgesamt<br />
als äußerst besonnene und verständige Frau geschildert wird, ist davon auszugehen, dass sie diese<br />
Einstellung auch in Bezug auf den sexuellen Verkehr aufrechterhält. Frau und Mann verbindet darüber<br />
hinaus eine gegenseitige Beziehung – bereits hier fällt der Begriff phile bzw. philon, die, da aus ihr<br />
überragende Kinder hervorgehen, wohl auch im Schlafzimmer befriedigend verlaufen muss. 717<br />
Auch wenn sich die Frau des Euphiletos durch ihre außereheliche Affäre eher als Negativbeispiel für<br />
die gute Ehefrau eignet, gehört die erste Rede des Lysias doch zu einem der umfangreichsten<br />
Zeugnisse für das antike griechische Eheleben.<br />
„Als ich, ihr Männer von Athen, zu heiraten beschlossen hatte und eine Frau in mein Haus<br />
führte, war es eine Zeitlang so, dass ich zwar um ein gutes Einvernehmen bemüht war, es<br />
ihr aber auch nicht zu sehr überlassen wollte, was sie tat. Ich war wachsam soweit wie<br />
möglich und gab acht auf sie, wie es sich gehört. Nachdem ich aber ein Kind von ihr hatte,<br />
begann ich, ihr zu vertrauen und überließ ihr alle meine Angelegenheiten, weil ich glaubte,<br />
dass wir uns vollkommen aufeinander verlassen könnten. (Lys. 1, 6) 718<br />
Dieses Zitat zeigt, dass auch der frisch verheiratete Mann nicht frei von Sorgen war. Die Leitung des<br />
Oikos war eine große Verantwortung, die der Ehefrau erst dann vollständig überlassen wurde, wenn<br />
man sich ihrer Befähigung und ihrer Loyalität sicher war. Erst die Geburt des ersten Kindes band die<br />
Frau tatsächlich an den ihr fremden Oikos. Wenn sich eine verheiratete Frau mit einem anderen Mann<br />
715 Sem. fr. 7, 46–49 West; s. auch Calame 1992, 24.<br />
716 Sem. fr. 7, 62–70 West.<br />
717 Sem. fr. 7, 86–87 West; Calame 1992, 91: „In Grecia l´ unione matrimoniale, compimento del desiderio amoroso, fonda<br />
sulla sessualità una relazione di philotes.”<br />
718 Manche Übersetzungen geben diese Stelle etwas unglücklich wider: im Englischen z. B. „vex“, im Deutschen z. B.<br />
„nichts zu Leide tun“; Just 1989, 137 überlegt, ob vielleicht nicht auch ausgedrückt werden soll, dass zunächst keine<br />
sexuellen Ansprüche an die Gattin gestellt wurden; s. auch Pomeroy 1985, 122.<br />
S e i t e | 151
einließ, war dies gleichzeitig ein Verrat am und eine Gefährdung des Oikos. Die Begriffe, mit denen<br />
das Verhältnis der Ehepartner umschrieben wird, sind pisteuein und oikeiotes 719 Die Geburt des ersten<br />
Kindes enthebt beide zugleich der Pflicht, ständig das Bett miteinander zu teilen. Euphiletos erhebt<br />
keine Einwände, als seine Frau dazu übergeht, die Nächte in der Nähe ihres Kindes zu verbringen.<br />
Dies mag die Annahme untermauern, dass der sexuelle Verkehr zwischen Eheleuten in der Tat v. a.<br />
unter dem Aspekt der Fortpflanzung ausgeübt wurde, und Ischomachos darüber hinaus kein<br />
körperliches Verlangen nach seiner Ehefrau hatte. Der lapidar hervorgebrachte Vorwurf, er vergnüge<br />
sich mit der Haussklavin, mag andeuten, dass die Ehefrau die Eskapaden ihres Mannes im eigenen<br />
Haus dulden musste. 720 Andererseits ist eine Gerichtsrede nicht eben der Ort, sexuelle Vorlieben zu<br />
diskutieren. Das Ehepaar behält nach wie vor ein gemeinsames Schlafzimmer. Umso erstaunlicher ist<br />
die Leistung, in Anwesenheit des Gatten den Nebenbuhler ins Haus einzuschleusen. Da wir in den<br />
antiken Quellen immer wieder Anspielungen auf Ehebrüche 721 vorfinden, dürfen wir die athenische<br />
Bürgerin keinesfalls als frigide verurteilen, besonders dann nicht, wenn man bedenkt, welch großes<br />
Risiko zugunsten der Lustbefriedigung eingegangen wird. Der Usus eines gemeinsamen ehelichen<br />
Schlafzimmers wurde bisher meist stillschweigend in Abrede gestellt. Doch ebenso wie sich<br />
Euphiletos und seine Gattin teilen sich wohl auch die Eltern des „Übereifrigen“ in Theophrasts<br />
Charakteren ein Schlafzimmer:<br />
S e i t e | 152<br />
„Er geht zum Vater und sagt, die Mutter schlafe schon im Schlafzimmer 722 .“<br />
(Theophr. char. 13, 8)<br />
Das Thema 'ehelicher Sex' wird in Xenophons „Oikonomikos“ eher kursorisch abgehandelt, was bei<br />
einem im Kern philosophisch-ökonomischen Gespräch nicht anders zu erwarten ist. Folgende<br />
Aussagen implizieren, dass Sexualität ohne Zweifel zur Ehe gehörte, es wird aber auch klar, dass man<br />
eine Ehefrau nach dem Gesichtspunkt wählt, ob sie einen geeigneten Partner für Haus und Kinder<br />
darstellt.<br />
„Sag mir, Frau, hast du schon darüber nachgedacht, weshalb ich dich eigentlich genommen<br />
und deine Eltern dich mir gegeben haben? Denn dass es nicht an andern mangelte, mit<br />
denen wir hätten schlafen können, das ist, wie ich weiß, auch dir klar. Als ich für mich und<br />
deine Eltern für dich überlegten, wen wir als besten Partner für Haus und Kinder nähmen,<br />
habe ich dich, und deine Eltern, wie es scheint, aus den in Frage kommenden mich<br />
ausgewählt.“ (Xen. oik. 7, 10 f.)<br />
„Haben wir uns nun nicht miteinander verbunden, Frau, fragte ich, um auch einer des<br />
anderen Körper zu benutzen?“ (Xen. oik. 10, 4)<br />
719 Just 1989, 137: „The closeness of the relationship and the trust he places in her are not bound up with any feeling of<br />
growing affection toward her as a person. Rather, their “intimacy”, as the Greek term oikeiotes implies, has to do with the<br />
joint establishment of a domestic unit and with the procreation of children.” Sutton 2004, 328 f. legt dar, dass die antiken<br />
Texte durchaus den Eindruck vermitteln, dass eine emotionale Bindung zwischen den Eheleuten üblich war.<br />
720 Pomeroy 1985, 123.<br />
721 Zum Ehebruch allg., s. Harrison 1968, 32–38; Patterson 1998, 114–125 mit Quellendiskussion.<br />
722 s. auch Lys. 1, 24.
Derselbe Xenophon schildert in seinem „Symposion“ den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und<br />
Frau als lustvollen Akt, wobei hier allerdings nicht ausdrücklich von der Ehefrau die Rede ist. 723 Nach<br />
einer ergreifenden Darstellung der Romanze zwischen Dionysos und Ariadne werden die zechenden<br />
Männer aber in eine solche sehnsüchtige Stimmung versetzt, dass die Verheirateten unter ihnen<br />
augenblicklich nach Hause zu ihren Ehefrauen eilen. 724 Weitere Zeugnisse sexueller Anziehung und<br />
Treue zwischen Eheleuten sind zwar rar, fehlen jedoch nicht völlig. Aus einer verlorenen Komödie<br />
wohl des 4. Jhs. v. Chr. stammt folgendes Zitatenfragment:<br />
“Since the night I was married […] I have not been away from bed a single night, away<br />
from my wife [...] I wanted her, honestly [...] I was tied to her by her noble character and<br />
her unaffected ways; she loved me and I cared for her.” (P. Antinoop. 15)<br />
Das romantische Liebesverhältnis, das nun zwischen Ehemann und Ehefrau besteht, deutet bereits auf<br />
einen Wandel in der sozialen Mentalität der griechischen Welt hin, der dann im Verlauf der<br />
hellenistischen Epoche verstärkt greifbar wird. Auch der Ankläger in einer Rede des Demosthenes aus<br />
dem 4. Jh. v. Chr. zeichnet ein Bild ehelicher Zuneigung, indem er eine tiefe Verbundenheit<br />
heraufbeschwört. 725 Diese Aussage gehört allerdings zu einer stark tendenziösen Schilderung seiner<br />
beklagenswerten privaten Verhältnisse, die dazu gedacht war, dem Kläger als vom Schicksal<br />
gebeutelten, aber treuen und verantwortungsbewussten Familienmenschen die Sympathie der Richter<br />
zu sichern. 726<br />
Der Eindruck einer zunehmend engen Bindung der Eheleute wird auch durch die Grabdenkmäler des<br />
4. Jhs. v. Chr. bestätigt. Manche Bilder thematisieren die Trauer über den Verlust des Ehepartners, die<br />
Grabepigramme zeugen z. T. von aufrichtiger Verbundenheit. 727 Ob sich die Verhältnisse im 4. Jh. v.<br />
Chr. von denen des 5. Jhs. auf der Basis eines tiefgreifenden, gesellschaftlichen Wandels<br />
unterschieden haben, ist angesichts literarischer Gegenstimmen, die eher eine Kontinuität zum 5. Jh. v.<br />
Chr. nahe legen, fraglich. 728 Dennoch scheint sich nach und nach die Vorstellung von Liebe und<br />
Verbundenheit als Basis der Heirat durchgesetzt zu haben, die schließlich dann im Hellenismus zu<br />
mehr Absicherungen und Rechten der Frau innerhalb der Ehe geführt haben.<br />
Sexualität im weitesten Sinne ist in der Tragödie in der Regel nur sehr unterschwellig fassbar, etwa<br />
wenn Alkestis für ihren geliebten Mann freiwillig in den Tod geht oder Medea, von Eifersucht<br />
zerfressen, sich an ihrem untreuen Gatten rächt. Der „Hippolytos“ des Euripides zeigt die gefährliche<br />
Seite weiblicher Sexualität, die ins Verderben führt, sobald sie in Begierde umschlägt. Hippolytos hat<br />
sich gegen ein ziviles Leben und die Gründung einer Familie entschieden, geht in seiner Ablehnung<br />
723 Xen. symp. 8, 21; s. auch Wiemer 2005, 431 f.<br />
724 Xen. symp. 9, 7.<br />
725 Demosth. or. 50, 61; s. auch Just 1989, 129.<br />
726 Just 1989, 129.<br />
727 z. B. M. Meyer, Gesten der Zusammengehörigkeit und Zuwendung. Zum Sinngehalt attischer Grabreliefs in klassischer<br />
Zeit, Thetis 5/6, 1999, 115–132; Sojc 2005, 132–134. 137.<br />
728 so auch Mossé 1983, 124 mit Hinweis auf die Rolle der Frauen in den philosophischen Diskursen des Platon und<br />
Aristoteles.<br />
S e i t e | 153
sogar so weit, alles Weibliche von sich zu weisen. 729 Phaidra, seine Stiefmutter, die in Liebe zu<br />
Hippolytos entbrennt, wird ein Opfer göttlichen Rachedursts. Obwohl ihr Gefühl des Anstandes<br />
rebelliert, ist ihr Widerstand zwecklos, denn die Gefühle in ihr wurden durch Eros verursacht. 730 Die<br />
Einmischung der alten Amme, die zu einer direkten Konfrontation mit Hippolytos und zur<br />
Zurückweisung führen, verschlimmern Phaidras Lage, so dass sie nur noch den Ausweg sieht, ihre<br />
Ehre und die ihres Hauses zu retten, indem sie ihrem Leben ein Ende setzt. Verbotene Gedanken und<br />
Gefühle, die der gesellschaftlichen Ordnung zuwiderlaufen, weil sie die Familie von innen heraus<br />
zerstören, und die ausstehende, verurteilende Reaktion ihrer Umwelt werden der Protagonistin zum<br />
Verhängnis. 731<br />
S e i t e | 154<br />
4. 3. 2. Sexzoten in der aristophanischen Komödie<br />
Die Komödie bietet reichlich Material, um sich ein Bild von der Einstellung der Ehefrauen zum Sex<br />
zu machen, auch wenn dieses Thema z. T. im Rahmen recht derber Zoten verhandelt wird. Inwieweit<br />
uns die Hauptakteurinnen der Komödie allerdings eine Vorstellung von der realen Frau geben, ist<br />
umstritten. 732 Es handelt sich meist um Frauen mit klischeehaftem Charakter, die alle erdenklichen<br />
weiblichen Schwächen in sich vereinen, und die in abstrusen Situationen agieren, die nicht selten eine<br />
völlige Umkehr der gewohnten Verhältnisse sind. Diese Frauen befinden sich immer in<br />
Ausnahmesituationen, verstehen es auf außerordentliche Weise, ihre Fähigkeiten zu ihrem Vorteil zu<br />
nutzen und können deshalb schwerlich als Modell für das Leben der Durchschnittsbürgerin verwendet<br />
werden. 733 Dennoch spiegeln die Komödien eine gültige männliche Vorstellung der antiken Frau<br />
wider, die allerdings in übertrieben-karikierender Form Eingang in die Dichtung gefunden hat.<br />
Die Frauenfiguren, die Aristophanes in seinen Werken auftreten lässt, stammen aus unterschiedlichen<br />
Bevölkerungsschichten der Polis; neben Frauen, von denen wir annehmen können, dass sie<br />
Bürgerinnen sind, gibt es eine Reihe von Verkäuferinnen, die ihre Ware auf der Agora feilbieten. 734<br />
Doch gerade gegen Ende des 5. Jhs., als die wirtschaftliche Lage durch den Peloponnesischen Krieg<br />
verschärft wurde, waren viele Bürgerinnen gezwungen, Erwerbstätigkeiten zu ergreifen, die sie in<br />
729 Eur. Hipp. 616–668.<br />
730 Eur. Hipp. 239–249. 373–462; F. I. Zeitlin, Eros, in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia Cultura Arte Società I. Noi e i Greci<br />
(Turin 1996) 413 f.; Calame 1992, 3–5: Phaidra als Werkzeug der Aphrodite.<br />
731 Pomeroy 1985, 164 f.<br />
732 Der Quellenwert der aristophanischen Komödien wird von Taaffe 1993, 78 in Frage gestellt: “Like Lysistrata,<br />
Thesmophoriazusae is less about real women than it is about comic images of women.” Etwas weiter unten schreibt sie:<br />
„Thesmorphoriazusae succeeds no more than Lysistrata in presenting successful representations of women on the comic<br />
stage. It works, in fact, to misrepresent women and to make a joke of male actors´ attempts to portray female figures in<br />
tragedy and comedy.”<br />
733 Mossé 1983, 117.<br />
734 Mossé 1983, 59; R. Brock, The Labour of Women in Classical Athens, ClQ 44, 1994, 336–346; Schnurr-Redford 1996,<br />
213–224.
Friedenszeiten wohl als unter ihrer Würde angesehen hatten. 735 Euxitheus wehrt die Vorwürfe, seine<br />
Mutter wäre keine Bürgerin, weil sie als Amme und als Bänderverkäuferin tätig war, mit dem Hinweis<br />
auf die wirtschaftliche Krise und drohende Armut ab. 736<br />
4. 3. 2. 1. Die „Ekklesiazusen“<br />
Den Auftakt zu den „Ekklesiazusen“ bildet ein frühmorgendliches Treffen zwischen Praxagora und<br />
ihren Mitverschwörerinnen, die als Männer verkleidet einen umstürzlerischen Beschluss in der<br />
Volksversammlung vorbringen wollen, der vorsieht, alle Macht des Staates in die Hände der Frauen zu<br />
legen. Der erste Auftritt Praxagoras findet in Form eines Zwiegesprächs mit einer Lampe statt,<br />
nützliches Utensil zur Depilation 737 und verschwiegene Zeugin leidenschaftlicher Liebesspiele.<br />
Gleichzeitig, so L. Taaffe, porträtiert der Monolog die Frau als im Verborgenen agierendes und<br />
verschwörerisches Geschöpf. 738<br />
„Dir nur vertrauen wir, du bist uns nah<br />
Im Kämmerchen, wenn mit gewandter Kunst<br />
In Aphrodites Dienst wir uns bemühn.<br />
Wer scheuchte den verschwiegnen Augenzeugen<br />
Verliebter Kämpfe, dich, aus dem Gemach?“ (Aristoph. Eccl. 7–11)<br />
Kurz darauf entschuldigt sich die Nachbarin der Praxagora für ihr Zuspätkommen unter Nennung<br />
folgenden Grundes:<br />
„Ans Schlafen dacht´ ich nicht! Ach Liebe,<br />
Mein Mann, der Salaminier, ruderte<br />
Die ganze Nacht mit mir im Bett herum.“ (Aristoph. Eccl. 37–39)<br />
Beide Frauen scheinen ein durchweg zufriedenstellendes Sexualleben zu haben. Während Praxagora<br />
die Liebe als aphrodisische Erfahrung umschreibt, empfindet ihre Freundin das sexuelle Verlangen<br />
ihres Ehemannes als eine alltägliche Begleiterscheinung der Ehe. Ob sie ihre Sexualität ebenso genießt<br />
wie Praxagora, erfahren wir nicht, liegt die Betonung ihrer Aussage doch eher auf der Tatsache, dass<br />
das „Herumrudern“ die ganze Nacht fortdauerte und beinahe die Pläne der Verschwörerriege vereitelt<br />
hätte. Die intensive Geschlechtsbeziehung zwischen Praxagora und ihrem Mann ist für uns umso<br />
erstaunlicher, als wir später im Stück aus dem Munde des Blebyros, verstimmt über die Umstände, die<br />
die Abwesenheit seiner Frau und vor allem seines Mantels verursachen, erfahren, dass zwischen<br />
735 Just 1989, 107. 139; Fantham 1994, 109; A. Kosmopoulou, Female Professionals on Classical Attic Gravestones, BSA<br />
96, 2001, 284.<br />
736 Demosth. or. 57, 34–35. 42.<br />
737 Aristoph. Eccl. 12–13.<br />
738 Taaffe 1993, 107; s. z. B. Aristoph. Eccl. 14–16: Frauen schleichen sich gern des Nachts in die Vorratskammer und<br />
kosten vom Wein.<br />
S e i t e | 155
eiden wohl ein erheblicher Altersunterschied besteht. 739 Er fühlt sich von seiner jungen und<br />
eigensinnigen Frau etwas überfordert, ihr nächtliches Verschwinden erregt in ihm sofort den Verdacht<br />
auf Untreue, den er allerdings wieder verwirft und der zumindest in diesem Fall falsch ist. 740 Als dann<br />
die Konstituierung des Staates durch die Frauen tatsächlich ihren Lauf nimmt, werden die Defizite der<br />
alten Staatsordnung hinsichtlich der Gleichstellung von Mann und Frau vor allem durch zwei<br />
Neuerungen beglichen: die Elimination jeglichen Privateigentums und die sexuelle<br />
Gleichberechtigung der Geschlechter unter Abschaffung der Institution Ehe. 741 Die neu gewonnene<br />
sexuelle Freiheit stimmt die Männer allerdings eher nachdenklich. Während die weiblichen Personen<br />
den Geschlechtsverkehr bejahen, ihn zum Teil gar mit Obsession betreiben wollen, besteht für<br />
Blebyros die größte Furcht einer von Frauen regierten Polis darin, dass sie die Männer wider Willen<br />
zum Geschlechtsakt zwingen:<br />
S e i t e | 156<br />
Blebyros: „Nur eins ist schlimm für Leute unsres Alters:<br />
Chremes: „Wozu?“<br />
Wenn sie des Staates Zügel führen, können<br />
Sie mit Gewalt uns zwingen auch …“<br />
Blebyros: „Sie zu beschlafen.“<br />
Chremes: „Wenn wir nichts vermögen …?“<br />
Blebyros: „Dann ziehen sie uns das Frühstück ab.“ (Aristoph. Eccl. 465–469)<br />
Essensentzug als Strafe für Verweigerung des sexuellen Akts oder Impotenz ist völlig absurd.<br />
Interessanterweise schmerzt es die Männer offenbar nicht, alle Staatsgeschäfte in die Hände der<br />
Frauen zu übergeben. Von den anderen Reformen der Gynaikokratie 742 akzeptieren sie zunächst zwar<br />
nur widerstrebend, aber doch der Polis verpflichtet, auch die Aufteilung ihres Besitzes. Die<br />
Übernahme der politischen Initiative bedeutet für die Frauen gleichzeitig eine Umkehrung der<br />
Geschlechterhierarchie; von nun an spielt die Frau in der Geschlechterbeziehung die Rolle des aktiven<br />
Parts, bestimmt über das wann, wie und wie oft.<br />
Die neue Gesellschaftsordnung hat jedoch auch aus Sicht der Frauen, wie sich schnell herausstellt, den<br />
einen oder anderen Haken. Die Bemühung der Alten, sich einen Jüngling ins Bett zu zerren, scheitert<br />
kläglich. Es ist ein weiterer aristophanischer Streich, dass es den Frauen zwar gelingt, in die Rolle von<br />
Männern zu schlüpfen, dass aber kein Kostüm und keine Schminke der Welt aus einer „alten<br />
Schachtel“ eine begehrenswerte Frau zu machen vermögen. 743 Jede Form freier Liebe ist<br />
verschwendet, solange sich kein williger Liebhaber findet. Die Szene parodiert, so etwa L. Taaffe, die<br />
erotische Werbung, wie sie z. B. auch auf attischen Vasen thematisiert wird. Die unter dem<br />
Vorzeichen einer Gynaikokratie stattfindende Werbung stellt sich eben nicht als so unproblematisch<br />
dar, vor allem wenn es sich um alte Weiber handelt, die dem Tod näher stehen als dem Leben. 744<br />
739 Aristoph. Eccl. 323 f.<br />
740 Aristoph. Eccl. 520–527.<br />
741 Zum sozial-politischen Hintergrund der “Ekklesiazusen”, s. Taaffe 1993, 130 ff.<br />
742 Mossé 1983, 119: dem Staatsverfassung liegt die Oikosorganisation zugrunde.<br />
743 Taaffe 1993, 124. 126<br />
744 Taaffe 1993, 128.
4. 3. 2. 2. Die „Thesmophoriazusen“<br />
Anspielungen auf die unzügelbare Libido und die Untreue der Frauen sind in der Komödie sehr<br />
zahlreich. In den „Thesmophoriazusen“ nehmen die Athenerinnen das Fest der Demeter und Kore zum<br />
Anlass, unter Ausschluss männlicher Beteiligung im Rahmen einer nach dem Vorbild der Ekklesia<br />
einberufenen Frauengemeinschaft ihre Anliegen zu diskutieren. Dorn im Auge ist ihnen allen voran<br />
Euripides mit seinen das Frauengeschlecht verunglimpfenden, literarischen Machwerken. Als dem<br />
Dichter das Vorhaben der Frauen zu Ohren kommt, ist dies der Auftakt zu einem munteren<br />
Geschlechtertausch; er schleust seinen Verwandten in Frauenkleidern ein, damit dieser ihn vor dem<br />
Rat der Frauen verteidige. In der anschließenden, hitzigen Debatte zeigt sich, dass es den<br />
teilnehmenden Athenerinnen nicht daran gelegen ist, die Unterstellungen des Euripides als unwahr zu<br />
entlarven, vielmehr sind sie über die unangenehmen Begleiterscheinungen der Enthüllungen erbost.<br />
Ihre Schwächen, Liebeleien und delikaten Geheimnisse leugnen sie nicht – sie stibitzen, naschen,<br />
trinken gern. 745 Das Argument des Mnesilochos, es gäbe noch andere und weitaus dreistere Tricks 746 ,<br />
von denen Euripides nichts wisse, die aber ebenso auf der Wahrheit beruhten, soll einerseits ein<br />
Besänftigungsversuch gegenüber den Frauen sein, zeigt aber andererseits die Verworfenheit der<br />
Frauen in ihrem ganzen Ausmaß:<br />
„Frau war ich seit drei Tagen, neben mir<br />
Im Bett mein Mann! Nun hatt´ ich einen Liebsten,<br />
Der mich im siebten Jahre schon entjungfert!“ (Aristoph. Thesm. 478–480)<br />
Ein Frevel jagt den nächsten! Kaum verheiratet, hintergeht sie ihren Mann mit ihrem langjährigen<br />
Liebhaber. Von Keuschheit und Jungfräulichkeit keine Spur: Er hat sie bereits mit sieben Jahren<br />
entjungfert! Mit unübertroffener Dreistigkeit trifft sie sich des Nachts mit ihm vor der Haustür, ihrem<br />
Mann offen ins Gesicht lügend. Die detaillierte Schilderung, wie sie dann gegen einen Lorbeerbaum<br />
gelehnt von hinten penetriert wird, passt zur Vorstellung eines obszönen Luders. Eine Steigerung ist<br />
noch möglich: wie bei jeder billigen Porne kommen bei solchen Frauen auch Knechte und<br />
Maultiertreiber zum Zuge. 747 Die Verteidigung des Euripides und die Denunzierung der Frauen durch<br />
den in Frauenkleider steckenden Mnesilochos machen die „echten“ Frauen misstrauisch und initiieren<br />
eine Suchaktion, die beweisen soll, dass sich tatsächlich ein Mann in die Frauenversammlung<br />
eingeschlichen hat. 748<br />
745 Aristoph. Thesm. 383–431.<br />
746 Aristoph. Thesm. 466–519.<br />
747 Aristoph. Thesm. 490–495.<br />
748 Die Entlarvung des Mnesilochos, s. Taaffe 1993, 90.<br />
S e i t e | 157
S e i t e | 158<br />
4. 3. 2. 3. Die „Lysistrate“<br />
Dreh- und Angelpunkt der „Lysistrate“ des Aristophanes ist der ausgeklügelte Plan der athenischen<br />
Frauen, ihre Männer durch einen Sexstreik zur Beendigung des Kriegs mit Sparta zu zwingen. Die<br />
Forschung nahm die Komödie zum Teil zum Anlass, das bisher als bloßes Zweckbündnis postulierte<br />
Verhältnis der Eheleute in Frage zu stellen. 749 Das Intimverhältnis der Eheleute in der „Lysistrate“ ist<br />
jedoch zunächst einmal eine notwendige Voraussetzung, ohne die der Plan der Verschwörerinnen von<br />
vorneherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Offensichtlich wäre es im klassischen Athen zu<br />
keiner Zeit ein Problem gewesen, sich seine sexuelle Befriedigung im nächsten Bordell zu suchen. 750<br />
Doch wie R. Just korrekt bemerkt: “Comedy can stress or suppress certain facets of life to achieve its<br />
comic purposes”. 751<br />
Auch in der „Lysistrate“ benutzt Aristophanes das Spiel um die vertauschten Geschlechterrollen als<br />
Aufhänger für seine Komödie, in der sich die Frauen zu Lenkern der Polis berufen fühlen und die<br />
Männer Haus und Kinder hüten. 752 Am Anfang steht eine Betrachtung der Frauenwelt, in der alles<br />
noch seinen gewöhnlichen Gang nimmt. Kalonike etwa ist, wenngleich sie ihre Pflichten im Haus und<br />
gegenüber ihrer Familie zu erfüllen scheint, 753 nichtsdestoweniger dem Stereotyp der athenischen<br />
Ehefrau nachgebildet, der auch in der „Lysistrate“ das gängige Sammelsurium schlechter<br />
Eigenschaften anhängt, das dem weiblichen Geschlecht im Allgemeinen angelastet wird: es ist listig,<br />
schlau, faul, zudem oberflächlich, hat ein Faible für Schmuck und Kleidung, Engagement und<br />
Initiative sind ihm fremd. 754 Abgesehen von dieser pejorativen Schilderung akzeptieren die<br />
athenischen Bürgerinnen jedoch offenbar den ihnen auferlegten Verhaltenskodex, sie üben sich in<br />
Gehorsam und Schweigen und widmen sich tugendhaft ihrer Webarbeit:<br />
„Wir durften nicht mucksen, so hieltet ihr uns! Und ihr wart doch gewiss nicht zu loben!<br />
Wir durchschauten euch wohl, und wir ahnten nichts Guts, und da kam denn, wenn wir zu Hause<br />
Still saßen, zu Ohren uns oft, wie verkehrt ihr die wichtigsten Dinge behandelt!“<br />
(Aristoph. Lys. 509–511)<br />
Erst der fortdauernde Krieg und vor allem die ständige Abwesenheit ihrer Männer veranlassen die<br />
Frauen unter der Ägide Lysistrates 755 , die ursprüngliche Ordnung in Oikos und Polis samt ihrer klaren<br />
749 z. B. K. J. Dover, Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour, Arethusa 6, 1973, 71; Just 1989, 137; R. Osborne,<br />
Desiring women on Athenian Pottery, in: N. Boymel Kampen (Hrsg.), Sexuality in Ancient Art. Near East, Egypt,<br />
Greece, and Italy (Cambridge 1996) 65; B. Borg, Der Logos des Mythos. Allegorien und Personifikationen in der frühen<br />
griechischen Kunst (München 2002) 179 f.<br />
750 Eventuell kann die Beschränkung der Männer auf Geschlechtsverkehr im ehelichen Rahmen als natürliche Konsequenz<br />
des Rollentausches gewertet werden.<br />
751 Just 1989, 137; s. auch J. Henderson (Hrsg.), Aristophanes Lysistrata (Oxford 1987) xix f. xxxiii.<br />
752 Zum Wechselspiel der Geschlechterrollen, s. Taaffe 1993, 51 ff.: Ein zusätzliches und kontinuierlich komisches Element<br />
der aristophanischen Komödien allgemein sieht die Autorin in der Tatsache, dass die weiblichen Rollen ausschließlich<br />
mit männlichen Schauspielern besetzt waren, s. Taaffe 1993, 49 ff. 100.<br />
753 Aristoph. Lys. 16–19.<br />
754 Taaffe 1993, 54; Henderson a. O. (Anm. 751) xxxvi f.<br />
755 Zur androgynen Figur der Lysistrate, s. Taaffe 1993, 61 f. 64 f. 70 f.
Rollen- und Raumaufteilung zu sprengen. 756 Ihre wirksamste Waffe, die Verleugnung ihrer sexuellen<br />
Begierden, bringt sie ironischerweise dem Ideal der keuschen Ehefrau näher. Enthaltsamkeit entpuppt<br />
sich für das Frauengeschlecht, das nicht nur in den aristophanischen Komödien für triebgesteuert und<br />
sexuell unersättlich gehalten wird, als schwere Prüfung. Manch eine würde gar eher durchs Feuer<br />
gehen oder sich halbieren lassen, als auf Sex zu verzichten. 757 Aber Erfolg stellt sich bald ein. Die<br />
Ehemänner, in die weibliche Rolle gedrängt, sehen sich plötzlich mit häuslichen Pflichten und<br />
Kindererziehung konfrontiert, sind nunmehr, aus dem politischen Leben ausgeschlossen, selbst Opfer<br />
ihrer unkontrollierbaren, sexuellen Begierden. 758<br />
„Ich habe keine Freud´ am Leben mehr,<br />
Seitdem sie fort ist aus dem Haus: ich seufze,<br />
Sooft ich heimkomm; öde dünkt mich alles;<br />
Leer, ausgestorben; und die besten Bissen,<br />
Sie munden mir nicht mehr – ich leide Brunst!“ (Aristoph. Lys. 865–869)<br />
Die Episode zwischen Myrrhine und ihrem Ehemann Kinesias veranschaulicht die unmittelbaren<br />
Folgen von Lysistrates Plan. Und siehe da: Gerade die Tatsache, dass Myrrhine sich ihrem Mann<br />
entzieht, macht sie in seinen Augen umso begehrenswerter:<br />
„Mich dünkt, sie sieht viel jünger aus als sonst!<br />
Weiß Gott, so reizend kam sie nie mir vor!<br />
Und dass sie schmollt mit mir und spröde tut,<br />
Das macht nun gar, dass ich vergeh vor Liebe!“ (Aristoph. Lys. 885–888)<br />
Die trickreiche Verführungsaktion Myrrhines wird wirkungsvoll inszeniert, das Lager mittels Kissen,<br />
Matratze und Decke einladend aufgewertet, Salböl zur Steigerung der Lust verwendet. Sie reizt ihren<br />
Mann und spannt ihn auf die Folter, bevor sie ihn schließlich unbefriedigt sich selbst überlässt. 759<br />
„Certainly the scene enacts, ostensibly, the possibility of married, heterosexual sex“, folgert L. K.<br />
Taaffe 760 , jedoch nicht ohne sogleich diese Aussage zu relativieren. Ob letztlich aber nun die<br />
übertriebene Vorbereitung, Myrrhines spielerisch-aufreizende Bereitwilligkeit und Koketterie das<br />
Idealbild der keuschen Ehefrau ins Wanken bringen, ja gar an die Verfahrungsweise der Hetären 761<br />
erinnert, so zeigt uns dies doch, dass auch den verheirateten Frauen gewisse Kniffe und Tricks zur<br />
Verfügung standen, um ihr Eheleben im und um das Schlafzimmer herum in Schwung zu halten.<br />
Rollen- und Geschlechtertausch ist in den beschriebenen Komödien ein beliebter Handlungsrahmen.<br />
Nicht selten ist auch eine Anpassung des äußeren Erscheinungsbildes erforderlich. Die<br />
augenscheinliche Leichtigkeit, mit der aus Frauen Männer werden wie in den „Ekklesiazusen“ bzw.<br />
756 Henderson a. O. (Anm. 751) xxxii f. Sie tun dies jedoch vor allem deshalb, um die ursprüngliche häusliche Ordnung<br />
wiederherzustellen.<br />
757 Aristoph. Lys. 124–136.<br />
758 Taaffe 1993, 51 f.<br />
759 Aristoph. Lys. 916–952.<br />
760 Taaffe 1993, 68 f.<br />
761 Davidson 1999, 148–150; Hartmann 2002, 112.<br />
S e i t e | 159
ein Mann in die Rolle einer Frau schlüpft wie in den „Thesmophoriazusen“, spottet der Konstruktion<br />
von Männlichkeit und Weiblichkeit gleichermaßen, indem der Dichter davon ausgeht,<br />
Geschlechteridentität beruhe vordergründig auf Kleidung, Frisur, Körperbehaarung, der richtigen Art<br />
des Gehens und Sprechens und lasse sich nach Belieben verändern. 762 Es dürfte Aristophanes einige<br />
Lacher eingebracht haben, die Schwierigkeiten vorzuführen, die die Frauen unter Praxagora damit<br />
haben, ihre Rolle glaubwürdig zu spielen, ohne von sich als Frauen zu sprechen oder bei weiblichen<br />
Gottheiten zu schwören. 763<br />
Die aristophanischen Frauengestalten sind zwar zum Teil findige und gewitzte Personen, ihnen haften<br />
nichtsdestoweniger die typisch weiblichen Untugenden wie Faulheit, Untreue, Tücke, Gier,<br />
Unbesonnenheit und Unmäßigkeit an. 764 Zumeist wird der Witz der Komödie lediglich auf die<br />
Verulkung und Verunglimpfung auf Kosten der Frau zurückgeführt, es erscheint jedoch ebenso gut<br />
möglich, dass durch die fast schon übertriebene Bestätigung stereotyper weiblicher Schwächen und<br />
Untaten – wie etwa in den „Thesmophoriazusen“ – das allgemeine Frauenbild demontiert wird. Und<br />
werden nicht die Männer ebenso auf die Schippe genommen wie die Frauen, etwa wenn sie sich von<br />
Praxagora und den anderen verkleideten Frauen in der Ekklesia übertölpeln lassen? Oder wenn die<br />
Frauen unter Führung der Lysistrate die Akropolis besetzen und den Männern das politische Ruder aus<br />
der Hand reißen, oder wenn Mnesilochos sich nur mit Mühe und Not aus der grotesken Situation<br />
rettet, in die ihn Euripides gebracht hat? 765<br />
4. 4. Sexualität und Intimität in der Bildkunst der attisch-rotfigurigen Keramik<br />
S e i t e | 160<br />
4. 4. 1. Szenen der Verbundenheit und Annäherung<br />
„Die geringe Bedeutung, die der Geschlechtsverkehr in der Ehe hatte, war nur ein Grund dafür, dass<br />
eheliche Sexualität nicht dargestellt wurde“ 766 , urteilte C. Reinsberg. An erotischen Bildern besteht in<br />
der griechischen Kunst gewiss kein Mangel. Der Symposionskontext in den meisten dieser Bilder und<br />
die bekannte Tatsache, dass Ehefrauen keinesfalls Anteil an solchen Festivitäten hatten, stellen jedoch<br />
außer Frage, dass wir es mit einer nicht-ehelichen Zusammenkunft zu tun haben. Ganz richtig ist es<br />
dennoch nicht, dass eheliche Erotik und Sexualität auf den attischen Vasen der Klassik völlig fehlen.<br />
An die Stelle von konkreten Handlungen treten hier jedoch Symbole und Gesten. 767<br />
Neben Szenen, die den Sexualakt explizit abbilden, gibt es eine Reihe von Zeugnissen für erste<br />
physische Annäherung und Zärtlichkeitsbekundungen wie Umarmungen und Küsse. Ob solch intime<br />
762 Zur Konstruktion von Männlichkeit, s. Taaffe 1993, 104 f. 109 ff.<br />
763 Taaffe 1993, 115 ff.<br />
764 Pomeroy 1985, 169–172.<br />
765 Pomeroy 1985, 168.<br />
766 Reinsberg 1993, 78; so auch Badinou 2003, 94.<br />
767 Ikonographische Lösungen zur Steigerung „anständiger Erotik oder Nacktheit“, s. z. B. S. Moraw, Schönheit und<br />
Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher Nacktheit und bürgerlichem Status in der attischen Vasenmalerei, JdI 118,<br />
2003, 25–27.
Gesten auf die Hetäre oder nicht vielleicht doch auf die Ehefrau verweisen, stand in der Forschung<br />
nicht zur Diskussion und wurde eindeutig zugunsten der Hetäre beantwortet. Es ist in der Tat bei dem<br />
heutigen Stand der Wissenschaft und dem allgemeinen Frauenbild nur schwerlich vorstellbar, dass die<br />
ausschließlich ökonomischen Wertvorstellungen der Ehe, die sich in den Schriftquellen erschließen,<br />
dagegen in der Bildfassung gänzlich zugunsten einer liebevollen und gefühlsbetonten Paarbeziehung<br />
aufgegeben wurden. Und doch wurde bereits bei einem Vergleich der Hochzeitsbilder mit der<br />
entsprechenden literarischen Überlieferung festgestellt, dass in der Vasenmalerei ab der zweiten Hälfte<br />
des 5. Jhs. v. Chr. einer romantischen Version der Vorzug eingeräumt wird, die mit dem Bild der<br />
Quellen wenig gemein hat. 768 Viele Fragen zum Thema Liebe und Sexualität zwischen den Ehepaaren<br />
sind noch unbeantwortet, Unstimmigkeiten haben bisher kaum Beachtung gefunden. Es ist<br />
Bereitschaft und Unvoreingenommenheit erforderlich, am konservativen Bild, das die Wissenschaft<br />
lange Zeit von der bürgerlichen Frau hatte, zu rütteln, um dann vielleicht zu neuen Ergebnissen zu<br />
gelangen.<br />
4. 4. 1. 1. Cheir epi karpo und dexiosis<br />
Körperlicher Kontakt wird bei Paaren, bei denen es sich nachweislich um Ehepaare handelt, in zwei<br />
entgegengesetzten Bereichen hergestellt: Hochzeit und Tod. Der cheir epi karpo-Gestus wurde bereits<br />
verschiedentlich angesprochen und gehört zu den wenigen physischen Gesten, die für Ehe- bzw.<br />
Brautpaare verwendet wurden. 769 Als ein ritueller Gestus versinnbildlicht er nach Meinung vieler den<br />
Akt der Besitzergreifung, durch dessen Vollzug der Bräutigam die Aufnahme der Erwählten in seinen<br />
Oikos und somit auch in seine Verfügungsgewalt zum Ausdruck bringt. Die Geste schafft eine<br />
Verbindung zwischen den Ehepartnern, die für sich aber frei von Emotionen ist und aus einer<br />
einseitigen Initiative heraus entsteht, nämlich der des Mannes. 770 Es mag nicht ohne Bedeutung für die<br />
Wertung des Paarverhältnisses sein, wenn, wie bereits verschiedentlich aufmerksam gemacht wurde,<br />
das Umgreifen des Handgelenks durch ein tatsächliches An-der-Hand-Fassen ersetzt wird. 771 Es<br />
besteht allerdings die Gefahr, dass wir unsere eigenen Wertmaßstäbe dort ansetzen, wo uns die antiken<br />
Quellen im Stich lassen.<br />
Wie der cheir epi karpo-Gestus signalisiert die dexiosis (Taf. 5 Abb. 1) Verbundenheit 772 , wobei<br />
verschiedentlich angemahnt wird, sie nicht emotional überzubewerten. 773 Aus der Tatsache, dass die<br />
768 s. Kap. 1. 5. 3.<br />
769 Vgl. Loutrophoros, Athen V/9.<br />
770 Neumann 1965, 59–66: der Gestus wude zuerst als Entführungsgestus und erst sekundär dann auch als<br />
Heimführungsgestus verwendet; Reeder 1995, 127; Bergemann 1997, 62; Sutton 1997, 29.<br />
771 z. B. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 03.802, hier I/1; Oxford, Ashmolean Mus. 1966.888, hier V/8.<br />
772 Allg. z. B. B. Schmaltz, Griechische Grabreliefs ²(Darmstadt 1993) 209–212; C. Breuer, Reliefs und Epigramme<br />
griechischer Privatgrabmäler vom vierten bis zweiten Jahrhundert. Zeugnisse bürgerlichen Selbstverständnisses vom 4.<br />
bis 2. Jahrhundert v. Chr. (Wien 1995) 15–22; Bergemann 1997, 61 f. Anm. 286; N. Himmelmann, Attische Grabreliefs.<br />
Vorträge der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften G 357 (Wiesbaden 1999) 114; M. Meyer, Gesten<br />
der Zusammengehörigkeit und Zuwendung. Zum Sinngehalt attischer Grabreliefs in klassischer Zeit, Thetis 5/6, 1999,<br />
120 f.; Sojc 2005, 120–124.<br />
S e i t e | 161
dexiosis auf den Grabreliefs nicht ausschließlich für Ehepaare reserviert ist, können wir ersehen, dass<br />
sie eine allgemeine Formel für verwandtschaftliche oder freundschaftliche Nähe ist, die auch auf<br />
Männer bzw. Frauen unter sich oder auf Eltern und ihre Kinder anwendbar ist.<br />
Einen Ausdruck ehelicher Zuneigung finden wir vielleicht auf einer Loutrophoros in Buffalo IV/1<br />
(Taf. 19 Abb. 1) umgesetzt, auf der sich ein Paar über einen Diphros hinweg an der Hand hält. Der<br />
Grundtenor der Szene ist zurückhaltend. Bei dem Motiv des Handhaltens handelt es sich weder um<br />
den Handgreif-Gestus aus den Ekdosis-Szenen noch um den Dexiosis-Gestus der Grabreliefs. Ein<br />
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum Handschlag ist, dass sich die Personen jeweils ihre rechte<br />
Hand reichen, wohingegen der junge Mann auf der Loutrophoros in Buffalo mit der Rechten die Linke<br />
seiner Partnerin greift, sie sich also an der Hand halten. Die geflügelte weibliche Figur mit Fackel und<br />
Taenie, die kompositorisch der weiblichen Figur zugeordnet ist, lässt weniger einen rein häuslichen,<br />
als vielmehr einen rituellen Zusammenhang plausibel erscheinen. 774 Eingedenk der Gefäßform, eines<br />
im Hochzeitsritus verwendeten Gefäßes, möchte man gern ein sich in trauter Verbundenheit<br />
gegenüberstehendes Brautpaar erkennen. 775 Auch Ares ergreift Aphrodites Hand, bevor er sie mit<br />
schmeichelnden und wohlgesetzten Worten zum Hochzeitslager führt. 776 R. Mösch-Klingele macht<br />
allerdings nachdrücklich darauf aufmerksam, dass sowohl die Gefäßform als auch die geflügelte<br />
weibliche Figur ebenso gut im Funeralbereich verortbar sind. 777 Sollte die sepulkrale Verwendung des<br />
Gefäßes in der Tat zutreffend sein, dann muss man allerdings einräumen, dass theoretisch auch Bruder<br />
und Schwester, Mutter und Sohn, etc. dargestellt sein könnten. Das im Handschlag verbundene,<br />
stehende, jugendliche Paar wurde zwar nachweislich auch als Motiv für Grabloutrophoren<br />
verwendet 778 , da die Loutrophoros in Buffalo aber die dexiosis in einer markant abgewandelten Form<br />
zeigt, ist meiner Meinung nach eine hochzeitliche Auslegung gerade angesichts auch der Form des<br />
Bildträgers wohl wahrscheinlicher.<br />
S e i t e | 162<br />
4. 4. 1. 2. Die Hand auf der Schulter<br />
Eine Hydria in New York II/17 (Taf. 5 Abb. 5) zeigt einen jungen Mann, der einer sitzenden Frau in<br />
einer vertrauten Geste die Hand auf die Schulter legt. Der Rahmen der ganzen Szene ist durch die<br />
Gruppe auf der linken Seite, die sich um eine auf einem Klismos sitzende und spinnende Frau<br />
konzentriert, als ein häuslicher charakterisiert und wird durch den Eros unterstrichen, der hier<br />
773 Mit Verweis auf die Urkundenreliefs, s. Bergemann 1997, 62.<br />
774 vgl. Loutrophorosfrg., Nantes, Musée Dobrée D 974.2.30; Loutrophoros, München, Antikensammlungen 6572:<br />
Loutrophorosfrg., Oxford, Ashmolean Mus. 1966.888, hier V/8.<br />
775 So auch Oakley – Sinos 1993, 39.<br />
776 Hom. Od. 8, 290–292.<br />
777 Mösch-Klingele 2006, 52.<br />
778 z. B. Stelenfrg., Athen, Kerameikos Mus. P 280: CAT 2.154; Stele der Hagnostrate, Athen, Nat. Mus. 1863: CAT 1.431:<br />
Die junge Frau steht im Bildfeld neben einer fast mannshohen Loutrophoros-Hydria, die sie im Handschlag mit einem<br />
jungen Mann namens Theodoros verbunden zeigt. Ob Ehemann oder etwa Bruder, bleibt ungeklärt.
eventuell die Brautschuhe trägt. 779 Die Geste wird im Übrigen auch in der Grabkunst verwendet. Auf<br />
einer Marmorlekythos im Piräus 780 nehmen Eltern Abschied von ihrer Tochter; dabei steht der<br />
Ehemann hinter dem Klismos seiner Gattin und legt ihr die Hand auf die Schulter. Nach modernen und<br />
freilich subjektiven Eindrücken bedeutet sie im Kontext der Trauer möglicherweise nicht nur<br />
Zusammenhalt und Verbundenheit, sondern auch das Spenden von Trost. Hinsichtlich des New<br />
Yorker Bildes ist sicherlich eher eine allgemeine Deutung angebracht; hier ist die Geste vermutlich<br />
erneut ein Sinnbild ehelicher Verbundenheit und Vertrautheit.<br />
Das Motiv des Hand-auf-die-Schulter-Legens findet sich jedoch auch in einem ganz anderen<br />
Zusammenhang auf einer Hydria in München IV/2 (Taf. 19 Abb. 2). Dort legt eine junge Frau einem<br />
sitzenden Jüngling die Hand auf die Schulter. Durch die Art, wie sie sich vor ihm mit langen<br />
wallenden Haaren und gelüpftem Gewand präsentiert, macht sie in der Tat einen sehr verführerischen<br />
Eindruck. Auch bei dem zweiten Paar ist die erotische Spannung spürbar: Während der bärtige Mann<br />
einen Astragal als Geschenk darbietet, greift die sitzende Frau mit ihrer Hand nach seinem Oberarm.<br />
Die Werbeszenen kennen zwar vergleichbare, aber nicht identische Paare. Der Astragal als Geschenk<br />
ist ebenso ungewöhnlich wie die elegant das Gewand raffende Frau mit offenem Haar. Die kleine<br />
Dienerin mit dem Kalathos auf dem Kopf hebt die Szenen einmal mehr von den Werbeszenen ab. 781<br />
Es ist dies einer der seltenen bildlichen Belege, wo die Textilverarbeitung tatsächlich in<br />
Zusammenhang mit erotischer Werbung gebracht ist. Die auf die Schulter gelegte Hand hat hier eine<br />
ganz andere Bedeutung als auf der Hydria in New York II/17, wo das Motiv bei einem Ehe- oder<br />
Brautpaar begegnet. Auf der Münchner Hydria IV/2 wird die Geste von einer Frau ausgeführt, die<br />
dem sitzenden Mann unmittelbar zugewandt ist, wodurch sie im Bildkontext nahezu etwas<br />
Aufforderndes gewinnt. Inhaltlich ist sie in diesem Fall wohl mit dem offensiven Gestus der rechts<br />
sitzenden Frau gleichzusetzen, die ihren Galan oder Begleiter mit einem festen Griff um den Oberarm<br />
gepackt hat. 782<br />
4. 4. 1. 3. Umarmungen<br />
Gerade auf Kylikes, d. h. auf Symposionsgeschirr, sind zahlreiche Umarmungsszenen zu finden. Auch<br />
wenn im Rahmen dieses Kapitels vorrangig intime Gesten betrachtet werden sollen, die für die<br />
Darstellung von Ehepaaren geeignet sind, so muss man in einigen Fällen doch eingestehen, dass eine<br />
779 s. Kap. 2. 5. 3.<br />
780 Lekythos, Piräus, Mus. 2152: CAT 3.215; s. auch M. Meyer, Gesten der Zusammengehörigkeit und Zuwendung. Zum<br />
Sinngehalt attischer Grabreliefs in klassischer Zeit, Thetis 5/6, 1999, 121 Abb. 6; 122–125: Die Geste ist weder alters-<br />
noch geschlechtsspezifisch und betont nachdrücklich die Zusammengehörigkeit von Mitgliedern eines Oikos.<br />
781 Reinsberg 1993, 125 f.; N. Hoesch, Hetären, in: K. Vierneisel – B. Kaeser (Hrsg.), Kunst der Schale. Kultur des<br />
Trinkens. Ausstellungskatalog München (München 1990) halten den Inhalt des Korbes nicht für Wolle, sondern für<br />
Blüten oder Früchte.<br />
782 Der Griff um den Oberarm ist als Motiv aus den Werbeszenen bekannt. Besonders zahlreich in den päderastischen<br />
Szenen, signalisiert er wohl eine positive Reaktion des Eromenos auf die Annäherung des Erastes, z. B. Schale des<br />
Peithinos, Berlin, Antikensammlung F 2279: CVA Berlin (2) 16–18 Taf. 60, 1–4; 61, 1–4; CVA Berlin (3) 19 Taf. 122,<br />
2. 6; 134, 3.<br />
S e i t e | 163
sichere Aussage letztlich nicht möglich ist. Vorerst soll es genügen, das Bewusstsein dafür zu<br />
schärfen, dass nicht jede sexuell-erotische Handlung sofort auf die Hetäre hindeuten muss.<br />
Auf einer Schale in Paris IV/3 (Taf. 19 Abb. 3) etwa hat eine auf einem Diphros sitzende Frau ihre<br />
Hand in den Nacken des vor ihr stehenden Mannes gelegt und zieht ihn zu sich herab. Ihr Griff um<br />
seinen Unterarm, den er im Begriff ist, auf ihren Schenkel zu legen, signalisiert ihr Begehren und<br />
Einverständnis. 783 Die Hand am Nacken des Partners, die zumindest dem modernen Betrachter<br />
Zärtlichkeit suggeriert, findet sich auf Vasenbildern erstaunlich häufig gerade im Kontext mit Frauen,<br />
die als Hetären klassifiziert werden können. 784 Der Umgang zwischen Kunde und Sexualpartnerin<br />
wird also offensichtlich von einer rein körperlich-sexuellen auf eine emotional-persönliche Basis<br />
gehoben. Das Geschäftsverhältnis wird personalisiert und z. T. sicherlich auch beschönigt. Im Bezug<br />
auf die Schale in Paris ist nun besonders interessant, dass jegliche Elemente der Gelage-Ikonographie<br />
getilgt wurden, ja nicht einmal Objekte wie Musikinstrumente oder Flötenfutterale subtil in diese<br />
Richtung weisen. Die Darstellung konzentriert sich alleinig auf die Annäherung zweier Liebender,<br />
ohne Wert darauf zu legen, die beteiligte Frau in irgendeiner Form als Prostituierte zu kennzeichnen.<br />
Welche Art von Frau der antike Betrachter nun aber mit dem Bild assoziierte, ist nicht zu entscheiden.<br />
Innerhalb der Umarmungsszenen gibt es eine klar abgrenzbare Gruppe von Darstellungen, auf denen<br />
der Altersunterschied der Liebenden nun auffällig deutlich ausgeprägt ist. 785 So muss sich das kleine<br />
Mädchen auf einer Schale in Berlin IV/4 (Taf. 19 Abb. 4) strecken, um den Hals seines Partners zu<br />
umarmen. Versuche der Altersdifferenzierung gerade im Falle von Mädchen und jungen Frauen finden<br />
sich auf den klassischen Vasen nur ansatzweise umgesetzt. 786 Darstellungen wie die der mit den<br />
Brauronia verbundenen Krateriskoi zeigen aber immerhin, dass den Vasenmalern eine grobe<br />
Altersangabe möglich war. Gemessen an den Bildern, die etwa die Vorbereitungen zur Hochzeit<br />
thematisieren und dabei eine erwachsene und körperlich voll entwickelte junge Frau darstellen, muss<br />
es sich bei auf der Berliner Schale IV/4 um ein noch eher kindliches Mädchen handeln. In seiner<br />
Schmährede gibt der als Frau verkleidete Mnesilochos in den „Thesmophoriazusen“ des Aristophanes<br />
vor, bereits mit sieben Jahren entjungfert worden zu sein. 787 Dieses allzu junge Alter soll aber wohl<br />
eher Entsetzen und Empörung über die Verderbtheit und Geilheit des Frauengeschlechts hervorrufen,<br />
783 Zur standardisierten Formel des Umarmens gehört in der griechischen Kunst nach Dierichs 1993, 68 das Umfassen des<br />
Nackens und des Unterarms.<br />
784 z. B. Schale, New York, Metropolitan Mus. (ohne Inv.): Reinsberg 1993, 91 Abb. 32.<br />
785 Ähnliche Bilder sind im Übrigen auch im homoerotischen Bereich vertreten: z. B. Schale des Briseis-Malers, Paris,<br />
Musée du Louvre G 278: Kilmer 1993, Taf. 146 R 539; Amphora des Dikaios-Malers, Paris, Musée du Louvre G 45:<br />
CVA Paris, Musée du Louvre (5) III Ic 19 f. Taf. 30, 2–5; 31, 1. Der – allerdings nicht obligatorische –<br />
Größenunterschied ist hier durch einen reellen Altersunterschied begründet. Eine Schale in Malibu, J. P. Getty Mus.<br />
85.AE.25: Kilmer 1993, Taf. R 308 zeigt dagegen zwei Jünglinge in Umarmung, die angesichts ihrer körperlichen<br />
Entwicklung wohl gleichaltrig sind. – Zu jugendlichen Liebespaaren, s. Reinsberg 1993, 167.<br />
786 Es klafft eine Lücke zwischen Kleinkinddarstellungen, unter denen die Darstellungen von Töchtern generell<br />
beklagenswert rar sind, und heiratsfähigen Parthenoi im Alter um die 14 Jahre. Die Parthenoi sind in Gestalt und Wuchs<br />
in keiner Weise von älteren, bereits verheirateten Frauen unterschieden. Die einzige Gefäßform innerhalb der Gattung der<br />
Keramik, die bemüht ist, Mädchen mehrerer Altersstufen nebeneinander zu stellen, sind die Krateriskoi. Inwieweit sich<br />
das Alter der an den Brauronia teilnehmenden Arktoi aber letztlich bestimmen lässt, bleibt unbestimmt, s. L. Kahil, Le<br />
“craterisque” d´Artemis et le Brauronion de l´Acropole, Hesperia 1, 1981, 253–263; C. Sourvinou-Inwood, Studies in<br />
Girls Transitions. Aspects of the Arkteia and Age Representation in Attic Iconography (Athen 1988) 33–66.<br />
787 Aristoph. Thesm. 478–480.<br />
S e i t e | 164
so dass dieses Textzeugnis kaum als Beleg für frühreife Sexualpraktiken der antiken griechischen<br />
Jugend angesehen werden kann. Steht dieses junge sexuell aktive Mädchen vielleicht in<br />
Zusammenhang mit Kinderprostitution? So ist uns etwa durch die Gestalt der Nikarete aus der<br />
Demosthenes-Rede zu Neaira bekannt, dass Mädchen, kaum dass sie der gröbsten Kindheit<br />
entwachsen waren, zu Prostituierten ausgebildet wurden. 788 In der Vasenmalerei sind kindliche<br />
Prostituierte jedoch nicht belegt; sie sind in der Regel als makellose, aber erwachsene Frauen<br />
dargestellt. Der ausgeprägte Größenunterschied der Geschlechter scheint also ein singuläres Merkmal<br />
jener Umarmungsszenen zu sein.<br />
Die Bilder dieser Gruppe sind mal mehr, mal weniger explizit. Während sich das Paar auf einer Schale<br />
des Makron in Wien 789 in 'geschwisterlicher Zuneigung' lediglich gegenübersteht, drängt sich das<br />
junge Mädchen auf einem Schalenfragment in New York IV/5 (Taf. 19 Abb. 5) fordernd an den<br />
nackten Körper eines Jünglings, ihre Hände hat sie fest in seinem Nacken verschränkt. Der sexuelle<br />
Tenor ist bei der Umarmung dieses Paares kaum zu leugnen. Wenn eine junge Frau wie hier ohne<br />
Scham die Initiative ergreift, konnte das für viele Archäologen und Archäologinnen offenbar nur<br />
bedeuten, dass sie in dem Gewerbe ausgebildet wurde. So urteilt etwa E. Reeder: „Nur Hetären<br />
wurden dargestellt, während sie einen Mann umarmen und ihn direkt anblicken.“ Umso erstaunlicher<br />
ist der knappe Nachtrag zu eben jenem Katalogartikel von M. Schmidt: sie erwägt tatsächlich die<br />
bereitwillige Hingabe einer athenischen Bürgerin. 790<br />
Diese Lesart ist besonders hinsichtlich einer Schale aus dem Kunsthandel in Luzern IV/6 berechtigt,<br />
denn das sich innig umarmende Paar wird hier von einem Kranich begleitet. Der Kranich auf den<br />
attischen Vasenbildern wurde von E. Böhr, wie bereits verschiedentlich angemerkt wurde, als<br />
Jungfern- oder Nymphenkranich identifiziert. Bereits seine Namenszusammensetzung mit dem Begriff<br />
„nymphe“ erinnert an die Braut, die im Griechischen mit diesem Begriff belegt wird. 791 Sollte sich also<br />
der Bezug des Nymphenkranichs auf die Hochzeit bestätigen, würde dies für das Schaleninnenbild<br />
wegweisend sein. Dann hätten wir dieses Motiv tatsächlich für ein junges Brautpaar nachgewiesen.<br />
Die Darstellung einer Schale in Christchurch IV/16 (Taf. 21 Abb. 3) wird im Zusammenhang mit<br />
möglichen erotischen Hochzeitsdarstellungen ausführlicher besprochen werden. Der<br />
Größenunterschied ist nicht ganz so stark ausgeprägt, doch hat auch hier eine junge Frau ihre Arme<br />
um den Nacken eines Jünglings geschlungen. Das Motiv des sich umarmendes Paares gleicht soweit<br />
dem der Schalen in Berlin IV/5 und New York IV/6. Die Handbewegung des nur mit einem<br />
Schultermantel bekleideten Jünglings auf der Schale in Christchurch lenkt die Aufmerksamkeit auf<br />
eine prächtige Kline. Diese und auch die große, doppelflügelige Tür erinnern an Oikos- und<br />
Hochzeitsszenen. Eine entsprechende Deutung ist vielleicht auch für das sich umarmende Paar auf<br />
788 Demosth. or. 59, 18 f. Die Formulierungen “largest fees from those who wished to enjoy them” und “she reaped the<br />
profit of the youthful prime of each, [...]” geben durchaus Anlass zu der Vermutung, dass Kinderprostitution keine<br />
Erfindung der Neuzeit ist und die Mädchen bereits vor ihrer Menarche zur Prostitution gezwungen wurden.<br />
789 Eine Demonstration von eher geschwisterlicher Zuneigung wäre denkbar bei einer Schale des Makron, Wien,<br />
Kunsthistorisches Mus. 3698: CVA Wien (1) III I 16 f. Taf. 13, 3; 14, 1. 2, wo sich der Jüngling und das kleine Mädchen<br />
im Tondo lediglich gegenüberstehen.<br />
790 Reeder 1995, 192 Nr. 41.<br />
791 Zum Begriff „nymphe“, s. RE XVII (1936) 1528 s. v. Nymphai (F. Heichelheim); Winkler 1999, 11; Kreilinger 2007,<br />
55–57.<br />
S e i t e | 165
dem apulischen Glockenkrater in Sydney IV/17 (Taf. 21 Abb. 4) vertretbar, das von Eros<br />
höchstpersönlich zur Tür des Schlafgemachs geleitet wird.<br />
S e i t e | 166<br />
4. 4. 1. 4. Küsse<br />
Sich küssende Paare finden sich in der attischen Vasenmalerei nur gelegentlich, z. T. jedoch bereits<br />
schon in der schwarzfigurigen Vasenmalerei. 792 Das sich in den Armen liegende und sich küssende<br />
Paar auf einem schwarzfigurigen Alabastron in Athen IV/7 (Taf. 19 Abb. 6) bleibt mangels jeglicher<br />
Attribute anonym. Obgleich P. Badinou Zärtlichkeit und Zuneigung im Falle von Ehepaaren nicht<br />
ausschließt, veranlasst sie die Anwesenheit weiterer Personen, die 'Beinahe-Ehefrau' nun doch zur<br />
Hetäre zu erklären. 793<br />
Die einzigartige Kussszene auf einer Hydria in Chicago IV/8 (Taf. 20 Abb. 1) ruft widersprüchliche<br />
Assoziationen wach. Im Zentrum stehen sich umarmend und küssend ein Jüngling und ein junges<br />
Mädchen, das ihren Liebsten an den Ohren packt, um den sog. Henkelkuss zu vollziehen. 794 Die<br />
Position der schräg herabhängenden Arme, die der vorgebeugten Haltung des Jünglings folgen, ist<br />
zweideutig. Entweder ist dieser eben im Begriff, das Mädchen in die Arme zu schließen, oder aber<br />
seine Hand nähert sich in einer sexuell motivierten Geste ihrer Scham. 795 Das Berühren der Genitalien<br />
hat nach V. Siurla-Theodoridou eine lange ikonographische Tradition in Griechenland. Das Berühren<br />
von Brust und Scham nennt sie ebenso wie das Umfassen des Handgelenks und das Umarmen als<br />
Motive sog. Begegnungsbilder des 7. und 6. Jhs., die häufig in Zusammenhang stehen mit dem Hieros<br />
Gamos von Zeus und Hera. 796 Die Berührung weiblicher Geschlechtsmerkmale war also ursprünglich<br />
ein ritualisierter Akt der Hochzeit und Werbung. In den schwarz- und rotfigurigen Vasenbildern wird<br />
dieser Gestus im Rahmen der Knabenliebe und des sexuellen Verkehrs mit Hetären bei den Symposien<br />
Ausdruck der fleischlichen Begierde und erotischen Stimulanz. 797 In homoerotischen Szenen ist er<br />
792 Zur gestalterischen Problematik des Kussmotivs, s. Dierichs 1993, 71.<br />
793 Badinou 2003, 94.<br />
794 Dierichs 1993, 71.<br />
795 Letzteres vertritt z. B. Reeder 1995, 342 f.; derartige Handgesten können aufgrund des Erhaltungszustandes und der<br />
Qualität der zur Verfügung stehenden Bilder leicht missverstanden werden. Auf einer Schale des Briseus-Malers, Malibu,<br />
J. P. Getty Mus. 86.AE.293: Kilmer 1993, Taf. R 538 hält der Jüngling eine Blüte in der Hand seines gesenkten Armes<br />
und somit vor den Unterleib der vor ihm stehenden Frau. Ebenso ist ungewiss, ob der Jüngling auf einer Schale des<br />
Makron, London, British Mus. E 61: CVA London (9) 49–51 Nr. 37 Abb. 3, C. F; 9, D Taf. 50, A. B; 51, mit dem<br />
ausgestreckten Arm auf den Schambereich der vor ihm sitzenden Frau weist oder ob er nicht vielmehr den ihm<br />
hingereichten Kranz in Empfang nimmt. Mit dem gleichen Motiv wurde auch eine Pelike des Tyszkiewicz-Malers, Paris,<br />
Musée du Louvre G 237: CVA Paris, Musée du Louvre (6) III Ic 38 Taf. 50, 3–5 verziert, wobei man hier trotz der<br />
schlechten Qualität der Malerei den Eindruck hat, die Frau streife dem Jüngling den Kranz über den ausgestreckten Arm;<br />
vgl. auch Pelike, Providence, Rhode Island School of Design C 1479: CVA Providence (1) 28 Taf. 3, A. B.<br />
796 V. Siurla-Theodoridou, Die Familie in der griechischen Kunst und Literatur des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr. (München<br />
1989) 236 f.<br />
797 z. B. Stamnos des Smikros, Brüssel, Musées Royaux d´Art et d´Histoire A717: CVA Brüssel (2) III Ic 6 f. Taf. 12, 1A–<br />
D; 13, 1A–C; Schale, Malibu, J. Paul Getty Mus. 80.AE.322: Kilmer 1993, AT P. 146 Taf. R 1196; Schale des Makron,
nicht selten Vorspiel zum Schenkelverkehr. 798 Ob im 5. Jh. v. Chr. seine herkömmliche Konnotation<br />
bereits völlig vergessen war, ist ungewiss. Da uns der Gestus jedoch v. a. im Kontext des Gelages und<br />
der Päderastie bekannt ist, lag wohl auch für den antiken Betrachter näher, ihn dementsprechend zu<br />
lesen. Auf der anderen Seite wird zunehmend deutlich, dass viele Gesten ihre jeweilige Bedeutung erst<br />
im individuellen Bildkontext entfalten. Das Paar auf der Hydria IV/9 wird flankiert von einem<br />
Manteljüngling und zwei Frauen, von denen die rechte einen Handwebrahmen davonträgt. Der<br />
Manteljüngling, Paradigma für Züchtigkeit und Zurückhaltung, spricht nicht gegen einen erotischen<br />
Kontext, tritt er doch regelmäßig in homoerotischen Szenen auf. Der Webrahmen jedoch ist in einer<br />
Kussszene zwischen Hetäre und Kunde fehl am Platz, sondern ruft vielmehr Assoziationen mit<br />
bürgerlichen und häuslichen Tugenden wach. 799 Dennoch muss relativierend angemerkt werden, dass<br />
junge Frauen in den betrachteten Hochzeits- und Oikosszenen gewöhnlich nicht als Personen von<br />
deutlich kleinerer Statur, sondern immer als vollwertige Haus- und Ehefrauen dargestellt werden.<br />
4. 4. 1. 5. Das An- bzw. Entkleiden<br />
Mit der Pelike in Münster II/8 (Taf. 4 Abb. 5) verbindet sich, obwohl es sich aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach um eine Mutter-Kind-Darstellung handelt, ein weiteres erotisches Motiv: das An- oder Ablegen<br />
der Kleidung. Werden die entsprechenden Handgriffe im Frauenkreis ausgeübt, ist darin vermutlich<br />
ein Aspekt der weiblichen Toilette zu sehen. Während Utensilien wie Bänder, Spiegel oder Alabastra<br />
der Haut- und Haarpflege dienen, geht es bei der Auswahl des Gewandes und dem Legen der Falten<br />
um eine Modefrage, die für das weibliche Erscheinungsbild ebenso essentiell ist wie die richtige Frisur<br />
oder Kosmetik. Auf der Pelike in Münster findet das Ankleiden nun unter den Augen eines jungen<br />
Mannes statt. Der ebenfalls anwesende Knabe legt ein häuslich-familiäres Umfeld nahe, so dass der<br />
Akt des Ankleidens, insofern sich eine erotische Aussage damit verbindet, wohl nicht im<br />
voyeuristisch-stimulierenden Sinn gedacht ist.<br />
Die durchaus reizvolle Wirkung des An- und Auskleiden ist wider Erwarten für die Hetären- oder<br />
Prostituiertenikonographie nicht charakteristisch. Die Hetären, die sich während des Gelages zwischen<br />
den Symposiasten tummeln, sind entweder bekleidet, etwa wenn sie musizieren oder mit den Männern<br />
schäkern, oder aber nackt dargestellt, nämlich dann wenn sie gemeinsam mit den Männern auf den<br />
Speisesofas liegen oder bereits in den Geschlechtsakt involviert sind. Der sinnliche und sexuell<br />
Paris, Musée du Louvre G 143: Kunisch 1997, 201 f. Nr. 381 Taf. 131, 381; Schale des Makron, New York, Metropolitan<br />
Mus. 12.231.1: Kunisch 1997, 192 Nr. 301 Taf. 97, 301.<br />
798 z. B. Schale des Peithinos, Berlin, Antikensammlung 2279: vgl. Anm. 782; Schale des Brygos-Malers, Oxford,<br />
Ashmolean Mus. 1967.304: Reinsberg 1993, 166 Abb. 89.<br />
799 Vidale 2002, 364–366 vertritt wiederum die gängige Verschmelzung von Prostitution und Textilherstellung; die<br />
Ermahnung aus Plut. mor. 139e, es schicke sich für Eheleute nicht, sich in Gegenwart anderer zu umarmen und zu<br />
küssen, soll ein weiteres Argument liefern, weshalb es sich hier nicht um ein Ehepaar oder Liebespaar handelt kann.<br />
Plutarch schreibt aber ausschließlich über zeitgenössische Moralvorstellungen. Bundrick 2008, 298 f. schlägt eine völlig<br />
andere Lesung vor: die mit dem Handwebrahmen ausgestattete Ehefrau ertappt ihren Mann bei einer Tändelei mit einer<br />
Dienerin. – Zum Handwebrahmen, s. L. Clark, Notes on Small Textile Frames Pictured on Greek Vases, AJA 87, 1983,<br />
91-96.<br />
S e i t e | 167
stimulierende Moment des Entkleidens wird selten auf den Vasen thematisiert. 800 Eine der wenigen<br />
Ausnahmen in dieser Hinsicht ist eine Schale des Onesimos in London IV/9 (Taf. 20 Abb. 2), auf der<br />
eine Frau vor den Augen eines älteren Mannes den Gürtel ihres Chitons löst. Da der kugelige Korb<br />
und das Barbiton hier einen Symposionskontext implizieren, wurde die Szene einhellig als erotische<br />
Begegnung gedeutet. Dabei wurde auch gelegentlich auf die eigentümliche Kennzeichnung des<br />
Mannes aufmerksam gemacht. 801 Die in den Gelage- und Werbeszenen neben den Jünglingen<br />
agierenden bärtigen Männer sind nämlich mehrheitlich in der Blüte ihrer Jahre und im Vollbesitz ihrer<br />
körperlichen Kräfte als schöne und reife Männer wiedergegeben. Der Mann auf jener Schale in<br />
London jedoch gehört angesichts der Stirnglatze nicht mehr in diese Kategorie. 802 Sein breitbeiniges,<br />
dem Betrachter zugewandtes Sitzen auf dem niedrigen Hocker erinnert beinahe an die konventionelle<br />
Darstellung von Handwerkern oder Menschen niedriger Schichten, die auf der Erde hockend dem<br />
Betrachter ihre Genitalien darbieten. So weit geht es im Falle der Londoner Schale nicht, das Himation<br />
verdeckt seine Scham. I. Peschel glaubt, Onesimos setze hier die bemitleidenswerte, ökonomische<br />
Situation der Prostituierten ins Bild, die sich auch geilen Alten hingeben, solange der Preis stimmt. 803<br />
Wie subjektiv Bildeindrücke sind, zeigt das Urteil von E. Keuls, die die Darstellungsweise der Schale<br />
in London keineswegs als sozialkritisch empfindet. Die Kennzeichnung der weiblichen Figur schildert<br />
sie als “sympathetic picture of a rather homely hetaera.“ 804 Offenbar sollen die Alterszüge einfach<br />
einen Mann fortgeschrittenen Alters charakterisieren; eine moralische oder soziale Herabsetzung ist<br />
damit nicht unbedingt verbunden. Vom verräterischen Motiv des erwartungsvoll beobachteten<br />
Entkleidens abgesehen, sind zwar weder der kugelige Korb 805 noch das Musikinstrument 806<br />
800 Peschel 1987, 31 macht darauf aufmerksam, dass sich manche Hetären in einem fortgeschrittenem Stadium der<br />
Entkleidung befinden, hier ein verrutschtes, dort ein bereits abgelegtes Himation. Die Schale des Makron, Cambridge,<br />
Ashmolean Mus. 12.27: CVA Cambridge (1) III I 30 Taf. 25, 5; 28, 1 A. B zeigt das Entkleiden wohl als vorbereitenden<br />
Akt zum Geschlechtsverkehr. Die Darstellung im Tondo selbst ist stark fragmentiert, es fehlen etwa die Köpfe des<br />
Paares. Links am Rande wurde auf einem Diphros ein Gewandstück abgelegt. Das Paar liegt sich nicht, wie man<br />
aufgrund der Fehlstellen zunächst meinen könnte, in den Armen. Vielmehr ist die Frau gerade damit beschäftigt, ihrem<br />
Gegenüber das Himation abzunehmen. Die Außenseiten der Schale zeigen das bekannte Schema heterosexueller<br />
Werbeszenen.<br />
801 Peschel 1987, 170 f. Abb. 132 hebt neben Stirnglatze auch seine ausgemergelte physische Verfassung hervor, wobei ich<br />
bereit wäre, letzteres noch eher der Vorliebe der Pioniere für anatomische Muskeldetails zuzurechnen; Dierichs 1993, 66<br />
Abb. 115 deutet ihn wegen des schütteren Barts, der Stirnglatze und der runzeligen Stirn als alten Mann.<br />
802 Ganz ohne Parallelen ist die männliche Figur im Umfeld sexueller Thematik jedoch nicht: der Sexpartner auf der Schale<br />
des Triptolemos-Malers, Tarquinia, Mus. Naz. Tarquiniense (ohne Inv.): CVA Tarquinia (1) III I 7 Taf. 11, 1 hat<br />
ebenfalls eine Stirnglatze. Ansonsten unterscheidet sich seine Darstellung in nichts von ähnlichen, insgesamt sehr<br />
homogen gestalteten Kopulationsszenen, s. auch Kilmer 1993, Taf. R 507.<br />
803 Peschel 1987, 171.<br />
804 Keuls 1985, 190.<br />
805 Nach Peschel 1987, 39 diente der Korb beim Symposion zur Verwahrung von Speisen, die z. T. von den<br />
Gelageteilnehmern selbst mitgebracht wurden. Ein sf. Epinetron, Paris, Musée du Louvre MNC 624: Badinou 2003, Nr.<br />
E 19 Taf. 12 liefert einen bildlichen Beleg für die Präsenz eines solchen kugeligen Korbes in einer typischen Oikosszene,<br />
wo die Frauen mit dem Spinnen und der Toilette beschäftigt sind. – Vgl. auch Basel, Kunsthandel III/29, wo sich der<br />
Inhalt des Korbs als Textilien entpuppt, die kaum etwas mit dem Symposion zu tun haben.<br />
806 Auch das Barbiton ist sowohl im Frauengemach als auch im dionysischen Kontext des Symposions und des Komos<br />
nachgewiesen, s. auch Bundrick 2005, 21–23. – Das Barbiton beim Komos: Skyphos des Brygos-Malers, Paris, Musée du<br />
Louvre G 156: M. Wegner, Musikgeschichte in Bildern II. Griechenland (Leipzig 1963) 100 f. Abb. 64. – Das Barbiton<br />
S e i t e | 168
unanfechtbare Argumente für ein amouröses Abenteuer nach dem Symposion, insgesamt spricht aber<br />
vieles für eine Zuweisung der Szene in den Bereich des Symposions. Auf einer Schale in München 807<br />
sind dem Komasten bezeichnenderweise nicht nur ein Skyphos, sondern auch das Barbiton und der<br />
Speisekorb zugeordnet. Trotz seiner sexuellen Konnotation ist auch das Motiv des Gürtellösens nicht<br />
auf den Bereich des Umgangs mit Prostituierten beschränkt, sondern, wie wir gesehen haben, ebenfalls<br />
im Umfeld von Hochzeit und Ehepaaren bekannt. 808 Ob es sich nun letztlich um eine Hetäre oder um<br />
eine Ehefrau handelt, ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Zunächst ist interessant, dass Onesimos<br />
eben keine Sexszene mit einer klaren Aussage wählte, sondern den Moment erotischer Spannung 809 , in<br />
dem eine Frau, erwartungsvoll beobachtet, sich ihres Gewandes entledigt. Die vorliegende<br />
Ikonographie und ihr erotischer Gehalt sind demzufolge zumindest theoretisch sowohl auf die Ehefrau<br />
als auch auf die Hetäre anwendbar.<br />
Die vorgestellten Spielarten von Vertrautheit und Zärtlichkeit sind in der Regel weder auf die<br />
käuflichen noch die bürgerlichen Frauen festgelegt. Es kann keineswegs ausnahmslos vorausgesetzt<br />
werden kann, dass Intimitäten und Berührungen nur zwischen Männern und Prostituierten<br />
ausgetauscht wurden. In einzelnen Fällen gibt es durchaus Anhaltspunkte, die auf die Athenerin<br />
hinweisen.<br />
4. 4. 2. Die Kline und der Geschlechtsakt<br />
4. 4. 2. 1. Sexualität im hochzeitlichen Kontext<br />
Einen Ansatz für die Auswertung sexueller Symbole, die auch im Hinblick der Ehefrau Verwendung<br />
finden, bieten zunächst die Hochzeitsszenen. Während sich dort der Prozessionszug in den meisten<br />
Bildern auf eine Tür oder eine Säule zubewegt, die als pars pro toto das neue Heim der Braut<br />
repräsentieren, ist auf einigen Bildern der Thalamos des Brautpaares das Ziel. Auch auf der<br />
Loutrophoros in Boston I/1 (Taf. 1 Abb. 2), geben die geöffneten Türflügel den Blick in das<br />
Schlafgemach mit Kline frei. 810 Unmittelbar davor schwebt ein kleiner Eros, der laut J. H. Oakley und<br />
R. H. Sinos mit der linken Hand das Brautpaar heranzuwinken scheint. 811 Das Hochzeitslager als<br />
Bestandteil des Hochzeitszugs tritt auch in mythischen Zusammenhängen auf, wie der Hochzeit von<br />
beim Gelage: z. B. Kolonettenkrater des Tyskiewicz-Malers, Ferrara, Mus. Naz. 2812: A. Schäfer, Unterhaltung beim<br />
griechischen Symposion. Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis in spätklassische Zeit (Mainz 1997)<br />
Taf. 34, 2; Schale des Oltos, Berlin, Antikensammlungen F4221: Peschel 1987, 37. – Als Bsp. für die Verwendung jenes<br />
Instruments in häuslichen Szenen: z. B. Kassel, Antikensammlung der Staatl. Kunstsammlungen T 435, hier V/24.<br />
807 Schale des Makron, München, Antikensammlung 2643: F.-W. Hamdort, Musik und Symposion, in: K. Vierneisel – B.<br />
Kaeser (Hrsg.), Kunst der Schale. Kultur des Trinkens. Ausstellungskatalog München (München 1990) 246 Abb. 39. 12.<br />
808 Vgl. Kap. 2. 5. 2.<br />
809 Dierichs 1993, 66.<br />
810 s. auch Kap. I. 6. 1.<br />
811 Oakley – Sinos 1993, 36.<br />
S e i t e | 169
Herakles und Hebe auf einer schwarzfigurigen Pyxis in Warschau 812 oder der Hochzeit von Peleus und<br />
Thetis auf einer Amphora in New York. 813<br />
Die Kline als Hochzeitslager und Ort der Zeugung künftiger Erben des Oikos spielt nicht nur im<br />
Rahmen des Hochzeitszugs eine Rolle. Auf einer Pyxis in Würzburg IV/10 sitzt die Braut auf einer<br />
Kline mit gemusterten Kissen und Decken (Taf. 20 Abb. 3). Die von einer Frau in den Armen<br />
getragene Loutrophoros und auch der bei der Schönheitspflege assistierende kleine Eros deuten<br />
eindeutig auf eine Hochzeit hin. Dafür spräche auch der Anakalypteria-Gestus, den die Frau links<br />
neben der Kline in unmittelbarer Nachbarschaft zu Eros ausführt, und die aus diesem Grund für<br />
Aphrodite gehalten wird. 814 Der Betrachter des Bildes assoziiert, hat er erst einmal den<br />
Hochzeitskontext erkannt, die Kline sofort mit dem Brautlager, die er aus den Ekdosis-Szenen kennt.<br />
Da die Kline die Szene im Thalamos verortet, kann auf der Pyxis in Würzburg eigentlich nicht die<br />
Schmückung der Braut gemeint sein. Thematisiert ist wohl das Entkleiden der Braut vor der ersten<br />
gemeinsamen Hochzeitsnacht. Der Ringkampf zweier Eroten (Taf. 20 Abb. 4), der von einer sitzenden<br />
und einer stehenden Frau – jeweils mit Zepter – beobachtet wird, wurde von E. Simon als Metapher<br />
erklärt, die die widerstreitenden Gefühle des jungen Mädchens und der Braut versinnbildlicht. 815<br />
Auf dem Fragment einer Hydria in Athen IV/11 (Taf. 20 Abb. 5) sitzt eine Frau auf einer prächtigen<br />
Kline. Die Scherbe bricht leider auf Höhe ihrer Brust ab, so dass wir nicht wissen, ob sie eventuell<br />
einen Schleier oder ein Diadem trug. Von links eilen bruchstückhaft erhaltene, Bänder herantragende<br />
Frauen heran. Am Fußende der Kline sitzt eine im Maßstab etwas kleinere Frau, deren Himationfalten<br />
sich im Nacken bauschen, so dass wir zuverlässig daraus schließen können, dass sie ihren Mantel über<br />
ihren Kopf gezogen hatte. In Verbindung mit der Kline ist dies nun ganz augenscheinlich der Habitus<br />
einer Braut; die Person neben ihr ist wohl niemand anderes als die Göttin Aphrodite, deren geöffnete<br />
und selbstbewusste Haltung sich von der schüchternen und in sich geschlossenen Darstellung der<br />
Braut kaum mehr absetzen könnte. Die Hand nach dem Arm der Braut ausgestreckt hat es sich die<br />
Liebesgöttin persönlich zur Aufgabe gemacht, jene mit ihrem neuen Status als Ehefrau vertraut zu<br />
machen. 816<br />
812 Pyxis, Warschau, Nat. Mus. 142319: Oakley – Sinos 1993, 35 f. 106–108 Abb. 100–104.<br />
813 Amphora des Malers, New York, Levy Collection (ohne Inv.): Oakley – Sinos 1993, 36. 112–114 Abb. 108–111.<br />
814 nymphokomos nach Oakley – Sinos 1993, 17; s. auch Calame 1992, 90.<br />
815 E. Simon, Aphrodite und Adonis. Eine neuerworbene Pyxis in Würzburg, AntK 15, 25 f. – Zur Deutung der Figuren, s.<br />
auch A. Greifenhagen, Griechische Eroten (Berlin 1957) 43 f.: Das Ringerpaar nennt er Eros und Anteros.<br />
816 A. Brückner, Athenische Hochzeitsgeschenke, AM 32, 1907, 92–94 Abb. 5 Taf. 6 ergänzt in den Händen der Braut ein<br />
Iynx-Rädchen. In der Zeichnung selbst ist das Rädchen aber unkenntlich.<br />
S e i t e | 170
4. 4. 2. 2. Die Kline in nicht-hochzeitlichen Darstellungen<br />
Auf das Hochzeitsbett wird sowohl in der Literatur als auch in der Bildkunst regelmäßig Bezug<br />
genommen. Es avancierte zum standardisierten Symbol, das nicht nur im unmittelbaren Kontext der<br />
Hochzeit Verwendung findet, sondern den generellen sexuellen Aspekt der Ehe ausdrückt, und somit<br />
auch stellvertretend für die Ehe selbst stehen kann. 817 So betrauert Alkestis als Folge ihres selbst<br />
erwählten Schicksals das abrupte Ende ihrer Ehe und den Verlust ihres Ehebetts. 818 Die Kline wurde<br />
vor dem politischen Hintergrund des demokratischen Athen zunehmend zum Symbol für eine legitime<br />
Ehe, aus der wiederum legitime Kinder mit dem Anspruch auf das Bürgerrecht und den väterlichen<br />
Besitz hervorgingen. 819<br />
Auf welch selbstverständliche Art und Weise Sexualität und Häuslichkeit in der Person der Haus- und<br />
Ehefrau miteinander verbunden werden, zeigt ein Schalentondo in London IV/12 (Taf. 20 Abb. 6).<br />
Dort steht eine Frau zwischen einem Wollkorb und einer Kline. Attributiv zugeordnet sind ihr wie so<br />
oft Blüte und Spiegel. Die Kline selbst wird an dieser Stelle durchaus als Hinweis auf den<br />
Geschlechtsverkehr zu verstehen sein, wie es uns P. Badinou zu verstehen gibt 820 , die Kombination<br />
mit dem Wollkorb weist jedoch weg vom Gelagemobiliar. Weshalb sollte die Kline, nachdem sie im<br />
Rahmen der Hochzeit eingeführt wurde, in den Oikosszenen mit dem Bild der Athenerin kollidieren?<br />
Weder das Ensemble Wollkorb und Kline noch die Inschrift he pais kalos erzwingen auch nur<br />
annähernd eine Deutung der jungen Frau als Hetäre.<br />
Die Verbindung zwischen Kline und Wollarbeit wird auch auf einer Pyxis in Paris IV/13 (Taf. 20<br />
Abb. 7) fassbar. 821 Neben der sich im Spiegel bewundernden Hausherrin und ihrer Bediensteten oder<br />
Verwandten, die in diesem speziellen Fall einen Handwebrahmen heranträgt, gibt eine geöffnete Tür<br />
den Blick frei auf das Bett des ehelichen Schlafgemachs.<br />
Auf dem Fragment eines Epinetron in Athen IV/14 (Taf. 20 Abb. 8) ist die Hausherrin im Thalamos<br />
zu sehen. Sie sitzt neben einer Kline mit dicken, gemusterten Polstern auf einem Klismos, in ihrer<br />
Hand hält sie auch hier ein Alabastron. 822 Zwischen ihr und dem Bett ist noch der Rest einer<br />
weiblichen Figur erhalten. Es kann nicht oft genug betont werden: Die Schönheit und Erotik der<br />
Ehefrau sind auf den attischen Vasen klassischer Zeit kein Tabuthema. Das Genre der sog.<br />
Toilettenszenen stellt die anständige Bürgerin dar, wie sie ihre freie Zeit nach Belieben auf intensive<br />
Körperpflege verwendet. Dass solche Bemühungen generell nicht um ihrer selbst willen betrieben<br />
werden, sondern auch um ihrer Wirkung auf Männer wegen – in der Regel wohl ihr Ehemann –, kann<br />
vorausgesetzt werden.<br />
817 Hartmann 2002, 115.<br />
818 Eur. Alk. 175–188.<br />
819 Patterson 1998, 108.<br />
820 Badinou 2003, 67: „Le lit renvoie sans aucun doute aux jeux érotiques et la fleur à la séduction.” Die beiden Außenseiten<br />
der Schale interpretiert sie als erotisch motivierte Begegnungen mit Hetären.<br />
821 vgl. Pyxis des Phiale-Malers, Wien, Kunsthistorisches Mus. 3719: Bundrick 2008, 302 f. Abb. 8.<br />
822 Das Alabastron ist hier vielleicht konkret ein Hinweis darauf, dass es üblich war, sich vor dem Geschlechtsakt einzuölen,<br />
s. Kreilinger 2007, 125–128.<br />
S e i t e | 171
S e i t e | 172<br />
4. 4. 2. 3. Das (Ehe-?) Paar im Thalamos<br />
Die bisher betrachteten Bilder zeigen die Frau entweder allein auf der Kline bzw. in Gegenwart von<br />
Frauen. Ob die griechische Bildkunst so weit ginge, das Ehepaar im Thalamos darzustellen?<br />
Eine Loutrophoros aus Würzburg III/3 (Taf. 10 Abb. 6) zeigt eine noch relativ unverfängliche<br />
Darstellung eines Paares vor einer Kline. Der Bildträger, eine Loutrophoros, und die Fackelträgerin<br />
rechtfertigen die Annahme, es handle sich um ein Brautpaar und infolgedessen bei der mit bunt<br />
gemusterten Decken reich ausgestatteten Kline um das Hochzeitsbett. Die Darstellung wurde aufgrund<br />
des Kästchens hier im Rahmen der Werbeszenen kurz behandelt. 823 Im Wesentlichen wurde dabei der<br />
Frage nachgegangen, ob eine Geschenküberreichung gemeint ist und vor welchem Hintergrund sie<br />
stattfindet. An dieser Stelle steht dagegen im Vordergrund, dass sich die wie auch immer geartete<br />
Aktion offenbar im Thalamos abspielt, wobei Kline und Gefäßform womöglich den Zusammenhang<br />
mit der Hochzeit herstellen.<br />
Das Bildprogramm der Kalpis in Athen IV/15 (Taf. 21 Abb. 1. 2) steht als Ganzes im Zeichen der<br />
Hochzeit. Der Fries der Bauchzone, für sich betrachtet eine übliche Oikosszene, in deren Mittelpunkt<br />
jeweils eine junge Frau nach Art der Aphrodite lässig-elegant auf ihrem Klismos sitzt, wird wohl<br />
angesichts des hochzeitlichen Inhalts des Schulterfrieses ebenfalls in diesem Sinn zu betrachten sein.<br />
Während also der Bauchfries die Vorbereitungen auf die Hochzeit erläutert, gilt der Schulterfries der<br />
Repräsentation des Brautpaars und dem Darbringen von Geschenken. 824 Die Darstellung des<br />
Brautpaars, das sich anblickend einander gegenüber sitzt – er auf einem Klismos, sie auf einem<br />
Diphros, ist im Bestand erhaltener griechischer Vasen singulär. Die geöffneten Flügel einer Tür mit<br />
Ausblick auf eine Kline sind als Ankündigung der Hochzeitsnacht zu verstehen.<br />
Das Bild im Tondo einer Schale in Christchurch IV/16 (Taf. 21 Abb. 3) ist verglichen mit der<br />
Loutrophoros in Würzburg III/3 deutlich weniger zurückhaltend. Eine junge Frau hat einem nur mit<br />
einem über die Schultern geworfenen Mantel bekleideten Jüngling beide Arme um den Nacken<br />
geschlungen, beide blicken sich tief in die Augen. Des Handgestus des Jünglings, der auf die Kline<br />
weist, hätte es kaum bedurft. Angesichts der Form des Gefäßes und seiner Verwendung im Symposion<br />
würde man üblicherweise nicht zögern, diese so offenkundig sexuelle Begegnung als erotisches<br />
Abenteuer eines jungen Komasten mit einer Hetäre oder Musikerin zu deklarieren. So sieht etwa P.<br />
Badinou die Darstellung als Fortsetzung des Banketts auf der Außenseite der Schale. 825 Das<br />
Bildprogramm der Schale muss keinen übergreifenden, inhaltlichen Bezug haben, denn auf ein Gelage<br />
gibt es im Bild selbst nicht den geringsten Hinweis. 826 Wäre es eventuell vorstellbar, dass sich ein<br />
bürgerliches Ehepaar in diesem Bild wiedererkennt? Viele Vorurteile und theoretische Bedenken<br />
ließen sich bereits widerlegen und zeigten, dass Sexualität und Erotik durchaus in die antike<br />
Vorstellung von der Ehe passte. Bleibt nur die Frage, ob man so etwas auch darstellen würde? Die<br />
Kline an sich begünstigt weder die eine noch die andere Lösung. Die massive Tür dagegen, die das<br />
Paar bereits passiert hat, ist aus den Hochzeitsszenen, in denen sie meist einen Blick auf das Ehebett<br />
823 vgl. Kap. 3. 3. 1.<br />
824 CVA Athen, Benaki Mus. (1) 27.<br />
825 Badinou 2003, 67.<br />
826 So schon Lewis 2002, 121.
frei gibt 827 , und aus den Oikosszenen vertraut. Beide Bereiche verweisen in die bürgerliche Sphäre.<br />
Das Alabastron als Behältnis für Salböl wird bisweilen als Gebrauchsgegenstand für den Sexualakt<br />
verstanden 828 , da es jedoch auch in Hochzeitsszenen verwendet wird, bleibt es ein Produkt, das<br />
vielseitig und von jedermann benutzt werden kann. 829 Der Habitus des Jünglings – er ist nackt bis auf<br />
den über die Schultern gelegten Mantel – erweckt wiederum eher den Eindruck eines Komasten. Die<br />
junge Frau in ihrem weiten, stark bauschenden Chiton macht keineswegs den Eindruck einer frisch<br />
gebackenen Braut. Auch das symbolische Lösen des Gürtels, der zone, in der Hochzeitsnacht (d. h.<br />
also generell vor dem Sex mit ihrem Gatten) kann nicht in das Bild hineingelesen werden. 830 Auch die<br />
offenkundige Anhänglichkeit spricht eher gegen ein Ehepaar in der Hochzeitsnacht. Physischer<br />
Kontakt, d. h. Umarmungen, oft auch nur Berührungen, sind oftmals Bestandteil der Werbeszenen, die<br />
Hetären und ihre Freier zeigen. Im Exkurs zu den Umarmungsszenen konnte zumindest für die Schale<br />
in Luzern, Kunsthandel, eine Deutung als Ehepaar unter Vorbehalt begründet werden.<br />
Die Betrachtung eines apulischen Glockenkraters in Sydney IV/17 (Taf. 21 Abb. 4) mag helfen, die<br />
Frage, ob für eine Ehefrau eine derart kühne Präsentation denkbar gewesen wäre, zu entscheiden. 831<br />
Eros führt ein Paar auf eine geöffnete Tür zu, hinter der, obwohl die Kline selbst nicht abgebildet ist,<br />
wahrscheinlich das Schlafgemach liegt. Die Frau erwidert die Liebesbekundungen des nackten<br />
Jünglings, indem sie ihm den Arm um die Schulter legt. Wir haben bereits beobachtet, dass Eros, der<br />
in den Hochzeitsszenen zumeist wohl die eher abstrakt-geistige Verbundenheit des Brautpaares<br />
versinnbildlicht, auf der Bostoner Loutrophoros I/1 (Taf. 1 Abb. 2) in die Rolle des Verführers<br />
schlüpft. Er lädt sie ins Schlafgemach ein. Dieselbe Initiative spricht meiner Ansicht nach auch aus der<br />
Darstellung des Glockenkraters in Syndey IV/17. Die körperliche Vereinigung steht unter dem<br />
Einfluss und unter dem Schutz des Eros. Die angeblich für ein Ehepaar so unpassend intimen Gesten<br />
sind gemessen an den äußerst freizügigen Kopulationsszenen noch recht zurückhaltend.<br />
Vorausgesetzt, dass zwischen der Bildprogrammatik der attischen und apulischen Werkstätten keine<br />
allzu große Lücke klafft, sollte dieselbe Auslegung auch im Falle der Schale in Christchurch IV/16<br />
möglich sein. Zwingend ist eine Interpretation auf eheliche Zuneigung dennoch nicht. Es bleibt dem<br />
827 Zur Tür als Sinnbild für die Abgeschlossenheit des Brautgemachs im Hausinneren, s. S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf<br />
attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v. Chr. (Berlin 2005) 116; A. Stähli, Die Konstruktion<br />
sozialer Räume von Frauen und Männern in Bildern, in: H. Harich-Schwarzbauer – T. Späth (Hrsg.), Gender Studies in<br />
den Altertumswissenschaften. Räume und Geschlechter in der Antike (Trier 2005) 88 f.: „Türen geben dem<br />
Bildbetrachter zu erkennen, in welcher Lokalität sich eine Szene abspielt, vor allem aber gestatten sie den Blick auf<br />
etwas, das man eigentlich nicht sehen kann (oder darf): sie sind primär gar nicht räumliche Indikatoren, sondern<br />
Intimitätssignale – und Hilfsmittel des voyeuristischen Blicks.“ s. auch Heinrich 2006, 107 f.; Bundrick 2008, 314 f.<br />
828 Kilmer 1993, 83 f.; Badinou 2003, 67: „L´alabastre se trouve ici pour signaler la montée du désir chez les amants.“<br />
829 Badinou 2003, 68–70.<br />
830 Keuls 1985, 114. 116; Llewellyn-Jones 2003, 216. – Zur erotischen Wirkung des Gewand-Lösens bzw. der Himation-<br />
Übergabe, s. S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v. Chr.<br />
(Berlin 2005) 50 ff. 282. Die besagten Motive treten auch auf weißgrundigen Lekythen auf, deren funerativer Zweck<br />
unumstritten ist. Einer These des Autors zufolge bedienten sich die Vasenmaler gängiger Hetärenikonographien der 1.<br />
Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., um die erotische Wirkung der bürgerlichen Frauen zu steigern.<br />
831 Das Stück entstammt zwar nicht-attischer Produktion, seine Bildsprache und seinen Bedeutungsinhalt hat es aber m. M.<br />
mit den attischen Vasenbildern gemein.<br />
S e i t e | 173
Betrachter überlassen, einen gedanklichen Bogen zu den homosexuellen Werbungen der<br />
Schalenaußenseiten zu schlagen oder eben das Tondobild unabhängig davon zu lesen.<br />
Zeugnis für eine zunehmende Erotisierung solcher Szenen im 4. Jh. v. Chr. ist eine Hydria in<br />
London 832 . Die Braut hat sich vor auf der Hochzeitskline niedergelassen, ihr zugeordnet ist ein<br />
fliegender Eros. Das Gefäß ist stark beschädigt, am rechten Rand ist aber noch der Unterkörper einer<br />
offensichtlich nackten männlichen Person erhalten. Als Deutung wurde Helena vorgeschlagen 833 , es ist<br />
aber kein zwingender Grund erkennbar, eine solche Darstellung als mythisch aufzufassen.<br />
S e i t e | 174<br />
4. 4. 2. 4. Die Hochzeitskline in mythischen Bildern<br />
Solche doch recht freizügigen Bilder sind angesichts der Seriosität, mit der auf den attischen Vasen für<br />
das vorbildliche Rollenverhalten der bürgerlichen Frau üblicherweise geworben wird, als<br />
Identifikationsmodell für die Athenerin kaum vorstellbar. Es ist jedoch hilfreich zu sehen, dass das<br />
Motiv der Braut auf der Kline für mythische Figuren nicht nur verwendet wird, sondern dies z. T. auch<br />
unerwartet provokativ geschieht. Auf einer Kline sitzend, die als Ort der Vereinigung nun praktisch<br />
zum Hochzeitslager wird, empfängt Danae den Goldregen des Zeus. Die Darstellungskonventionen<br />
haben eine starke Tendenz zur Sexualisierung. 834 Während auf einem Kelchkrater in St. Petersburg<br />
IV/18 (Taf. 21 Abb. 5) des frühen 5. Jhs. v. Chr. Danae noch vollständig bekleidet auf der Kline<br />
ruht 835 , wird im Laufe des Jahrhunderts der sinnliche Aspekt des Liebesabenteuers zunehmend betont.<br />
Zunächst geschieht dies durch die Beifügung des Eros, wie auf einer Hydria in Adolphseck 836 . Die<br />
weitere Entwicklung des Bildtopos führt uns Danae dann als reife und sexuell aktive Frau vor. 837 Auf<br />
einem böotischen Glockenkrater in Paris IV/19 (Taf. 21 Abb. 6) liegt sie halb zurückgelehnt auf ihrem<br />
Lager, den Oberkörper entblößt, und demonstriert eine Bereitwilligkeit und Hingabe während des<br />
Sexualaktes, wie man sie eigentlich andernorts nur von Hetärendarstellungen kennt. Die Frau mit<br />
entblößten Brüsten kennen wir zwar aus Darstellungen der Braut, nie jedoch wird diese während des<br />
Sexualakts und lustvoll genießend dargestellt. Überdies kennt man Danae nicht eben als eine<br />
mythische Figur mit laszivem oder sexuell obsessivem Ruf.<br />
832 Hydria eines Malers der London E 230-Gruppe, London, British Mus. E 229<br />
833 LIMC IV (1988) 517 Nr. 87 s. v. Helene Taf. 307(L. Kahil); CVA London, British Mus. (6) III Ic 8 f. Taf. 97, 1.<br />
834 S. Böhm, Griechische Heroinnen. „Girl Power“ und andere Frauenideale im antiken Griechenland, in: E. Klinger – S.<br />
Böhm – T. Seidl (Hrsg.), Der Körper und die Religion. Das Problem der Konstruktion von Geschlechterrollen (Würzburg<br />
2000) 74 f. 84 f. Abb. 5. 6.<br />
835 Reeder 1995, 269 f. Nr. 74 spricht hier bereits von einer ungehemmten Danae.<br />
836 Adolphseck, Schloss Fasanerie 38: LIMC III (1986) 327 Nr. 5 Taf. 243, 5 s. v. Danae (J. J. Maffre); s. auch<br />
Deckelfragment einer Pyxis, Athen, Agora Mus. P20297: J. H. Oakley, Zwei alte Vasen – Zwei neue Danaebilder, AA<br />
1990, 69 f. Abb. 5. 6; Agora 30, Taf. 99, 1022.<br />
837 Glockenkrater, Athen, Nat. Mus. 12593: Dierichs 1992, 105 Abb. 187; Bauchlekythos, London, British Mus. E 711: M.<br />
d´Abruzzo, Una pasta vitrea da Altino e il mito di Danae. Osservazioni sull´ iconografia, RdA 17, 1993, 25 Nr. 15 Taf.<br />
D´ABRUZZO Abb. 5; LIMC III (1986) 327 Taf. 244, 7 s. v. Danae (J. J. Maffre).
Auch Ariadne präsentiert sich an der Seite von Dionysos auf einer Hochzeitskline. Ein apulischer<br />
Kelchkrater in Tarent 838 zeigt uns Ariadne noch tief schlafend auf einem Polster, an das ein<br />
jugendlicher Dionysos mit Thyrsos herantritt. Die mythische Heldin wird ebenso wie Danae im<br />
Schema der Halbnackten dargestellt. Der Griff an die Brust ist hier eindeutig eine ritualisierte<br />
Handlung, die in Bezug zur Hochzeit steht. Auf einem Kelchkrater in Sykrakus 839 wird die Runde<br />
durch einen Eros mit Kranz ergänzt. Die Anwesenheit des Eros am Hochzeitslager ist wiederum ein<br />
Element, das uns zum apulischen Glockenkraters in Sydney IV/17 (Taf. 21 Abb. 4) zurückführt. Was<br />
für eine Danae oder eine Ariadne vertretbar war, mag theoretisch auch für eine Ehefrau verfechtbar<br />
gewesen sein. Obwohl die zunehmende Erotisierung der Frauen in der Regel eher als Phänomen des 4.<br />
Jhs. v. Chr. zu werten ist, setzt sie bereits im 5. Jh. v. Chr. ein und kann deshalb zumindest für einige<br />
der Bilder, die in der Frage um eheliche Erotik und Sexualität zur Diskussion standen, in Anspruch<br />
genommen werden.<br />
4. 4. 3. Unzensierte Sexualität<br />
Neben den bisher gezeigten existieren noch die Bilder, die Sexualität und Erotik von einer ganz<br />
anderen Qualität zeigen. Explizit sexuelle Darstellungen werden in der Regel mit dem<br />
Prostituiertengewerbe assoziiert. In einem kursorischen Überblick über die orgiastischen Szenen wird<br />
die Diskrepanz zu den in den vorherigen Kapiteln besprochenen Bildern greifbar. 840 Vor allem die<br />
Vasenbilder des frühen 5. Jhs. v. Chr. sind Spiegel der großen Experimentierfreudigkeit, mit der die<br />
erotische Thematik in allerlei Spielarten in Szene gesetzt wurde. Auf einer Hydria in Brüssel IV/20<br />
(Taf. 21 Abb. 7) vergnügen sich zwei Komasten mit ihren Hetären. Der intensive Blick der<br />
Liebespaare beschwört ein hohes Maß an Intimität und Zärtlichkeit. Ein allgemeiner Abscheu den<br />
Frauen dieses Gewerbes gegenüber lässt sich für die Antike also generell nicht rekonstruieren. Dass<br />
das Beispiel aus Brüssel IV/20 eine positivere Bewertung der geschlechtlichen Vereinigung und somit<br />
auch der involvierten Prostituierten erahnen lässt als z. B. die Schale des Pedieus-Malers in Paris<br />
IV/21 (Taf. 22 Abb. 1), liegt wohl auch daran, dass der Vasenmaler der Hydria in Brüssel IV/20 eine<br />
klare Paaranordnung bevorzugt und zudem den Sexualakt in gewisser Weise verschleiert, indem die<br />
Genitalien durch die Rückenansicht der Hetäre dem Blick des Betrachters entzogen sind. 841<br />
Ein besonderes Phänomen der Epoche der Perserkriege war es, den Geschlechtsverkehr und mitunter<br />
auch den Missbrauch von Frauen in schonungsloser, nicht selten pornographischer Detailgenauigkeit<br />
zu zeigen. 842 Die Szenen bieten zumeist einen wahren Bilderrausch. Gruppen, die häufig aus mehr als<br />
838 Tarent, Mus. Naz. 52.230: LIMC III (1986) 1060 Nr. 96 s. v. Ariadne Taf. 732, 96 (W. A. Daszewksi).<br />
839 Kelchkrater des Kadmos-Malers, Syrakus, Mus. Arch. Reg. 17427: CVA Syrakus (1) III I 7 Taf. 10, 1-6.<br />
840 Keuls 1985, 153–203; Peschel 1987; Dierichs 1993; Kilmer 1993; Reinsberg 1993, 80–162; N. Boymel Kampen (Hrsg.),<br />
Sexuality in Ancient Art. Near East, Egypt, Greece, and Italy (Cambridge 1996); J. R. Clarke, Representations of Male-<br />
to-Female Lovemaking, in: M. Golden – P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh<br />
2003) 221–238.<br />
841 Ebenso Reinsberg 1993, 99.<br />
842 Das Material wurde u. a. geordnet nach den Stellungen des Geschlechtsaktes und untersucht hinsichtlich der<br />
Fragestellung, ob und inwieweit die Art des sexuellen Verkehrs einen Rückschluss auf den Status des weiblichen Partners<br />
S e i t e | 175
zwei Akteuren bestehen, vollziehen den vaginalen und analen Koitus, die Fellatio oder<br />
Selbstbefriedigung, sie stimulieren und drohen mit Sandalen, sengen mit Hilfe von Öllämpchen,<br />
Frauen kriechen, sitzen oder werden herumlaviert. 843 Es ist offensichtlich, dass das Thema der<br />
sexuellen Befriedigung die Phantasie der Vasenmaler besonders anregte. Zu den krassesten Beispielen<br />
gehört diesbezüglich die bereits genannte Schale in Paris IV/21 (Taf. 22 Abb. 1), auf der die fülligen<br />
Proportionen der Hetären im auffälligen Kontrast zu den straffen Körpern der Männer stehen. Die<br />
Darstellung gehört zu den wenigen Fällen, in denen der Cunnilingus Eingang in die Bildkunst<br />
gefunden hat. 844 Gleich drei Hetären werden in absurden und kriechenden Stellungen zur oralen<br />
Befriedigung aufgefordert, zeichnerische Details wie die Falten um ihre aufgerissenen Münder<br />
verleihen ihrem Aussehen einen hässlichen und ihrer Arbeit einen herabwürdigenden Zug. 845 Die<br />
wenigen Stücke mit derart schonungslosen Eindrücken sexueller Triebe und Gewalt sind ein streng<br />
zeitlich begrenztes Phänomen des frühen 5. Jhs. v. Chr. 846 Der Hintergrund solcher Bilder mag in der<br />
jüngsten sozial-politischen Entwicklung der noch jungen Demokratie zu sehen sein, die ohne rechtes<br />
Maß und Verständnis die überkommenden Lebens- und Genussideale der Adelsgesellschaft für sich in<br />
Anspruch nimmt und kopiert. 847 Die Vasenbilder wären somit ein Zeitzeugnis und vielleicht z. T. auch<br />
ein Medium der Kritik an den Ausschweifungen der politischen und gesellschaftlichen<br />
Emporkömmlinge, wobei das pejorative Hetärenbild der distanzierten bis verurteilenden Haltung<br />
zuzuschreiben ist. 848<br />
Der Sexualakt von Paaren ist ein beliebtes Motiv der Tondo-Bilder. Die in vorgebeugter Haltung von<br />
hinten penetrierte Frau wird überwiegend nach dem gleichen ikonographischen Schema gestaltet. 849<br />
Auf der Schale in Boston IV/22 (Taf. 22 Abb. 2) ragt auf der rechten Seite eine prunkvolle Kline mit<br />
einem gemütlichen Kissen ins Bildfeld. 850 Die Inschrift „eche hesychos“ – halt still! – kommentiert die<br />
erlaubt, z. B. Sutton 1981, 81 ff.; Keuls 1985, 174–182; Dierichs 1993, 73–84 führt gute Argumente an für die<br />
Erniedrigung der Sexpartnerin z. B. auf der Schale des Briseis-Malers, Oxford, Ashmolean Mus. 1967.305: Dierichs<br />
1993, 74 Abb. 131. Ihre Versuche, aus der Mimik der Frauen Gleichgültigkeit, Lust oder Widerwillen herauslesen zu<br />
wollen, sind dagegen fragwürdig.<br />
843 z. B. Athen, Nat. Mus. 2579: Dierichs 1993, 81 f. Abb.150.<br />
844 Sutton 1981, 90.<br />
845 Hartmann 2002, 155.<br />
846 Reinsberg 1993, 117–120 begründet den Wandel in der Ikonographie mit veränderten Wertvorstellungen an der Schwelle<br />
von der Archaik zur Klassik. s. auch A. Schäfer, Unterhaltung beim griechischen Symposion. Darbietungen, Spiele und<br />
Wettkämpfe von homerischer bis in spätklassische Zeit (Mainz 1997) 67 f.<br />
847 Peschel 1987, 356; Meyer 1988, 122 nennt es einen „unverhohlenen Hedonismus“; Reinsberg 1993, 108 bringt dieses<br />
Phänomen mit der veränderten Struktur des Gelages und seiner Teilnehmer in Verbindung, für die der sexuelle Rausch<br />
offenbar ein darstellenswerter Zug des Symposions war.<br />
848 Ähnlich auch Sutton 1981, 113 ff. Er trennt Pornographie von Obszönität und schreibt den Vasenbildern generell eine<br />
didaktische Tendenz zu, die die Werte von aidos und sophrosyne propagieren.<br />
849 Sutton 1981, 85 f. sieht in dieser Stellung die sexuelle Dominanz der Männer ausgedrückt; auch Dierichs 1993, 77 f. hält<br />
die gebeugte Haltung der Frau für unbequem und will in ihrem Gesichtsausdruck z. T. Ausdruckslosigkeit oder<br />
distanzierte Akzeptanz erkennen. – Der Analverkehr war in der päderastischen Liebe verpönt, s. z. B. Reinsberg 1993,<br />
192 f.<br />
850 Ob es sich in der Tat um eine Symposionskline handelt, bleibt unsicher. Die großartigen Klinen mit den geschnitzten<br />
Ornamenten begegnen zwar häufiger in den Hochzeitsszenen, ganz unbekannt sind sie in Gelageszenen jedoch nicht.<br />
S e i t e | 176
Szene beredt. 851 Die Frau im Tondo einer Schale in Malibu 852 stützt sich auf einen Diphros, den<br />
amüsanterweise anstelle eines Polsters ein Weinschlauch ziert, eine Anspielung auf das<br />
feuchtfröhliche Hintergrundgeschehen. Das Bild einer Schale in München IV/23 (Taf. 22 Abb. 3) soll<br />
gesondert hervorgehoben werden. Die Darstellung zeigt eine Penetration von hinten, wie wir sie<br />
bereits kennen. Durch den Geldbeutel an der Wand ist dies jedoch die einzige uns erhaltene attische<br />
Szene, die explizit Sex mit Bezahlung in Form von Bargeld in Verbindung bringt.<br />
Eine zweite Gruppe, die mehrere Exemplare umfasst, zeigt ein auf einer Kline liegendes Paar bei der<br />
Kopulation. 853 Im Tondo einer zweiten Schale in Malibu IV/24 (Taf. 22 Abb. 4) wird die sog.<br />
„Rennpferd“-Stellung vorgeführt. Die rittlings auf dem Schoß des Jünglings sitzende Hetäre spielt<br />
keck mit dem Bürgerstock ihres Kunden. Ihre Körperstellung öffnet sich dabei so, dass dem Betrachter<br />
der Intimbereich des Paares dargeboten wird. Eines der stimmungsvollsten Beispiele befindet sich auf<br />
einer Oinochoe in Berlin IV/25 (Taf. 22 Abb. 5), wo eine junge Frau im Begriff ist, auf den Schoss<br />
des Jünglings zu klettern, der zurückgelehnt und mit prominenter Erektion auf einem Klismos sitzt.<br />
Der Blickkontakt suggeriert eine persönliche Bindung des Paares und stellt die Frau als aktiven und<br />
gleichwertigen Partner dar. 854<br />
4. 4. 4. Zusammenfassung<br />
Das Thema der ehelichen Liebe und körperlichen Vereinigung wird in den hochzeitlichen Bildern<br />
zwar weder negiert noch verschwiegen, man geht jedoch üblicherweise sehr zurückhaltend damit um.<br />
In den deutlichsten Fällen verweist ein durch eine geöffnete Tür sichtbares Hochzeitslager auf die<br />
bevorstehende sexuelle Vereinigung. Zum Teil ist zu beobachten, dass sich das Symbol der Kline<br />
verselbständigt und dann außerhalb des hochzeitlichen Kontextes auftritt bzw. in einem Kontext, in<br />
dem sich ein hochzeitlicher Bezug nicht mehr nachweisen lässt. Die Ehefrau der Antike hat in der Tat<br />
zwei Gesichter: das der tugendhaften und strebsamen Hausfrau und das der sexuell aktiven und<br />
fruchtbaren Ehefrau.<br />
Dass der eheliche Geschlechtsakt selbst nicht in Szene gesetzt wird, zeigt eine bewusste<br />
Zurückhaltung, die das Medium der bemalten Gefäße bei den Prostituierten nicht an den Tag legt. 855<br />
Dieses Faktum ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf das Ideal der athenischen Bürgerin in der<br />
klassischen Polis zurückzuführen. Die Vasen spiegeln gemeinhin eine normierte Sichtweise der<br />
athenischen Gesellschaft wider, die vor allem die an Frauen gerne gesehene Sophrosyne, ihre Tugend<br />
und Tüchtigkeit propagieren, auch wenn das männliche Geschlecht in Athen dazu neigte, den Frauen –<br />
ungeachtet ihres Status – sexuelle Unersättlichkeit und eine starke Libido zu unterstellen.<br />
851 Kilmer 1993, 83 f. R 577 erinnert an das Salbgefäß, das für solche Übungen ein beinahe unverzichtbares Hilfsmittel<br />
darstellt; R. F. Sutton Jr., Pornography and Persuasion on Attic Pottery, in: A. Richlin (Hrsg.), Pornography and<br />
Representation in Greece and Rome (Oxford 1992) 11.<br />
852 Schale des Foundry-Maler, Malibu, The John Paul Getty Mus. 86.AE.294: CVA Malibu (8) 41 Abb. 18 Taf. 428, 1. 2.<br />
853 z. B. Schalen des Triptolemos-Malers, Tarquinia, Mus. Naz. Tarquiniense (ohne Inv.): CVA Tarquinia (1) III I 7 Taf. 11,<br />
1. 2.<br />
854 Sutton 1981, 86 f.<br />
855 Dierichs 1993, 93; Badinou 2003, 94.<br />
S e i t e | 177
Nichtsdestoweniger finden sich in den Vasenbildern zahllose Indizien für die erotische Ausstrahlung<br />
der Frauen und im Besonderen auch der verheirateten Frauen. Die Betrachtung der<br />
Hochzeitsikonographie hat gezeigt, dass die Reize und die Schönheit der Braut durch die Anwesenheit<br />
von einem Eros oder mehreren Eroten ausgedrückt werden. Die Angleichung des Bürgerinnenbildes<br />
an Aphrodite wie etwa auf dem Lebes Gamikos II/6 (Taf. 4 Abb. 3) oder auf der Hydria II/17 (Taf. 6<br />
Abb. 5) wirft ein bezeichnendes Licht auf das antike Frauenbild, das weibliche Anziehungskraft und<br />
Erotik auch in der Ehefrau und Mutter vereint. 856<br />
Der sexuelle Aspekt der griechischen Ehe bleibt also zumindest unterschwellig präsent. Allerdings<br />
legt der Vasenmaler die Betonung vorrangig auf die Rolle der Ehefrau als Partnerin und Mutter und<br />
bestätigt damit die Aussage der Quellen, die die Bedeutung der Ehefrau in erster Linie als<br />
Lebensgefährtin mit wichtigen sozialen Funktionen werten und diese dadurch von den reinen<br />
Sexgespielinnen, den Hetären und sonstigen Prostituierten, absetzen. Eine reine Reduzierung der Ehe<br />
auf den sexuellen Aspekt würde denn auch völlig an der Auffassung von Ehe in der Antike<br />
vorbeigehen. Das Resümee des Apollodor macht deutlich, dass sich eine Ehe im Athen des 4. Jhs. v.<br />
Chr. eben nicht über den Geschlechtsverkehr definierte. 857 Diese Einstellung wird ganz klar auch von<br />
den Vasenbildern des 5. Jhs. v. Chr. verfochten.<br />
Auf den attischen Vasen archaischer und klassischer Zeit lässt sich ferner eine Vielfalt von Regungen,<br />
Zärtlichkeitsbekundungen und Emotionen verfolgen. Diese Bilder nehmen quasi eine Mittlerstellung<br />
ein zwischen den Kopulationsszenen, die sich nicht selten während des Gelages abspielen und die mit<br />
ziemlicher Sicherheit Hetären involvieren, und den Szenen ehelich-bürgerlicher Interaktion, die sich<br />
auf Hochzeitsbilder und den Mann im Frauengemach beschränken. Letzere haben weniger persönliche<br />
oder gar intime Aspekte zum Inhalt, sondern transportieren sozial-ideologische Werte, die der<br />
legitimen Ehe, der Gründung von Oikoi und dem harmonischen, rollenkonformen Familienleben von<br />
den Zeitgenossen zugeschrieben wurden. Doch muss diese Feststellung das Faktum nach sich ziehen,<br />
dass jegliche Intimität oder Zuneigungsbekundung zwischen Ehepartnern auf Vasenbildern<br />
ausgeschlossen war? 858 Dennoch bleibt unsicher, ob es tatsächlich der griechischen Mentalität<br />
entspräche, Harmonie und Eintracht zwischen Ehepaaren durch Umarmungen und Küsse in Szene zu<br />
setzen. Dennoch scheinen gerade diese Varianten von Zuneigung und Leidenschaft auch nicht<br />
eindeutig auf die Hetärenikonographie beschränkt zu sein. Auf der Hydria in New York II/17 (Taf. 6<br />
Abb. 5) und der Schale in Christchurch IV/16 (Taf. 21 Abb. 3) plädieren der Eros, auf der Schale in<br />
Luzern IV/6 der Kranich, auf der Hydria in Chicago IV/8 (Taf. 20 Abb. 1) der Handwebrahmen für<br />
eine bürgerliche Sphäre. Ungeklärt bleibt das Phänomen des augenfälligen Größen- und<br />
Altersunterschieds der untersuchten Umarmungsszenen, die einen in sich geschlossenen Typus zu<br />
bilden scheinen. Obwohl es keine Parallelen zu Liebespaaren in Prostituiertenkreisen gibt, ist es wohl<br />
in vielen Fällen doch wahrscheinlicher, von Liebesbezeugungen zwischen Kunde und Hetäre<br />
auszugehen, obwohl man auch hier entgegensetzen kann, dass das Hetären-Kunden-Verhältnis<br />
vordergründig auf dem Konsum von Sex basiert, wie es zahllose Symposionsdarstellungen zeigen.<br />
856 P. Kranz, Die Frau in der Bildkunst der griechischen Klassik, in: P. Neukam (Hrsg.), Antike Literatur – Mensch, Sprache,<br />
Welt, Klassische Sprachen und Literaturen 34 (München 2000) 68–71.<br />
857 Demosth. or. 59, 122; s. auch Kap. 2. 1. 2; 2. 1. 5.<br />
858 J. Vogt, Von der Gleichwertigkeit der Geschlechter in der bürgerlichen Gesellschaft der Griechen, in: A. K. Siems,<br />
Sexualität und Erotik in der griechischen Antike (Darmstadt 1988) 123.<br />
S e i t e | 178
Die Bilder kopulierender Paare haben für C. Reinsberg stimulierenden Charakter, sind gleichzeitig<br />
jedoch Ersatz für sexuelle Phantasien, die ab dem zweiten Drittel des 5. Jhs. v. Chr. öffentlich<br />
auszuleben nicht mehr dem guten Geschmack entsprochen habe. Sie seien also Produkte, die den<br />
modifizierten Gelagesitten Rechnung trugen, indem sie das zeigen, „was in Wirklichkeit verwehrt<br />
war“. 859 Ich halte es für wahrscheinlich, dass das Verschwinden der derben Sexszenen in der Tat eine<br />
unmittelbare Folge der orgiastischen Exzesse war, die eine Forderung nach einem strengeren<br />
Verhaltenskodex laut werden ließen. So wissen wir, dass der öffentlich praktizierte Sexualakt verpönt<br />
war. Dass es dennoch bisweilen auf den Symposien auch später noch hoch herging, dokumentiert die<br />
Erfahrung der Neaira, die im betrunkenen Zustand während eines Gelages von einem Mann zum<br />
nächsten gereicht wurde. 860<br />
Es ist auffällig, dass viele der besprochenen Bilder Attribute, Möbel oder Gerätschaften, die sich mit<br />
dem Symposion assoziieren lassen, weitgehend ausblenden und den Sexualakt gewissermaßen<br />
privatisieren. 861 Auffällig ist zudem, dass die Außenseiten der genannten Schalen, in deren Tondi<br />
Kopulationsszenen prangen, vielfach unbemalt belassen sind und auf diese Weise eine Bezugnahme<br />
auf das Symposion nicht gesucht wird. Vielmehr fungieren die Vasenbilder beinahe als Katalog<br />
gängiger Sexualpraktiken, wie wir sie heute für die Antike nur noch sehr lückenhaft rekonstruieren<br />
können. Kybda bezeichnet die Penetration von hinten und lässt sich gut mit den Darstellungen etwa<br />
auf den Schalen in Boston IV/22 (Taf. 22 Abb. 2) und Malibu IV/24 (Taf. 22 Abb. 4) in Einklang<br />
bringen. Diese Stellung gehört wohl zu den billigsten Dienstleistungen des Genres, wogegen Keles,<br />
das „Rennpferd“, dem Kunden weit teurer kam. 862 Der Symposionskontext spielt hier offensichtlich<br />
keine Rolle mehr, thematisiert werden von den Vasenmalern vielmehr die nach Preis gestaffelten<br />
Dienstleistungen Prostituierter, bei denen es sich rein theoretisch um Hetären ebenso wie um einfache<br />
Pornai handeln kann. Andererseits ist auch zu erwägen, dass hier lediglich die Variationen des<br />
Sexualaktes vorgestellt werden, und der Status der beteiligten Frauen nur dann zur Debatte steht, wenn<br />
Attribute wie der Weinschlauch auf das Gelage oder besonders demütigende Stellungen auf die<br />
Verfügungsgewalt der Freier über die Prostituierten verweisen.<br />
859 Reinsberg 1993, 111 f.<br />
860 Demosth. or. 59, 33 nennt die Freizügigkeit des Phrynios ein Verhalten ohne Gespür für Anstand und Moral.<br />
861 Peschel 1987, 237 sieht den Gelagekontext durch die Bemalung der Gefäßaußenseiten jedoch als gegeben; Sutton 1981,<br />
100 stellt bei solchen Szenen gar die Überlegung an, ob nicht theoretisch respektable Ehepaare gemeint sein könnten;<br />
Dierichs 1993, 85 f. verlegt das Geschehen ins Bordell bzw. in das Privathaus der Hetäre.<br />
862 Davidson 1999, 141 f. erinnert an geläufige Prostituiertennamen wie Obole oder Didrachmon, die andeuten mögen, dass<br />
manche Hetären über ein breiter gefächertes Programm verfügten; s. auch Schale, München, Privatsammlung, hier III/33.<br />
S e i t e | 179
S e i t e | 180<br />
5. Zur Figur des Eros<br />
Es ist kaum verständlich, warum die Figur des geflügelten Knaben in der rotfigurigen Vasenmalerei<br />
bisher so wenig Beachtung gefunden hat. 863 Seit der bereits 1874 von A. Furtwängler 864 vorlegten<br />
Abhandlung über Eros in Kunst und Kultur der Antike wurde dieser in der archäologischen Forschung<br />
fast nur einseitig unter sexuellen Gesichtspunkten untersucht. Zu den wenigen Ausnahmen zählen<br />
etwa ein Bändchen von A. Greifenhagen, welches einzelne Wesensaspekte und ikonographische<br />
Motive des Eros herausgreift, und ein Artikel von R. F. Sutton Jr. mit dem Titel „Nuptial Eros“.<br />
Grundlegend für jede philologisch- kulturhistorische Beschäftigung mit Eros darf die Publikation von<br />
C. Calame gelten, die archäologische Zeugnisse jedoch leider weitgehend außen vor lässt. 865 Eine<br />
aktuelle Studie, die die materielle und literarische Überlieferung zu Eros berücksichtigt, ist aufgrund<br />
der unüberschaubaren Fülle an Texten und Darstellungen bisher nicht unternommen worden.<br />
Als Trabant der Aphrodite gilt er als Verkörperung des Liebesverlangens. Im nicht-mythischen<br />
Bereich wird durch seine Helferrolle in den Oikosszenen häufig die Schönheit und erotische<br />
Ausstrahlung der gewöhnlichen Bürgersfrauen betont. 866 Da Eros in so gegensätzlichen Bereichen wie<br />
hochzeitlichen aber auch dionysischen Umzügen begegnet, wurde er rasch zu einem Sinnbild von<br />
Lebenslust und Ausgelassenheit. Unter dieser Voraussetzung gab es kaum Bedenken, ihn mit der Welt<br />
der Hetäre zu verknüpfen. Im Gegenteil scheint diese Annahme aus mehr als einem Grund bestätigt,<br />
da Hetären nicht nur sinnliche und körperliche Begierden befriedigen, sondern darüber hinaus das<br />
Symposion auch ein Ort ist, an dem in besonderem Maße eine Genussphilosphie ausgelebt wird. 867<br />
Tatsächlich liegt hier aber ein Irrtum vor: nur in sehr vereinzelten Symposionsdarstellungen ist die<br />
Figur des Eros zugegen. Wie stichhaltig ist demzufolge die Begründung, das von Eroten bekränzte<br />
Paar auf dem Krater in der Villa Giulia III/30 (Taf. 16 Abb. 1) sei aufgrund des Geldbeutels eine<br />
Hetäre mit ihrem zahlungskräftigen Kunden? Nur vereinzelt äußerten Autoren bisher Zweifel, ob Eros<br />
sich überhaupt mit dem Begriff der käuflichen Liebe vereinbar sei. 868 Eine erneute Untersuchung der<br />
Eros-Bilder mag vor allem in Fällen wie dem Krater in Rom einen zusätzlichen Beweis liefern, dass<br />
der Geldbeutel nicht zwingend den Kauf sexueller Verfügbarkeit bedeuten muss. Des Weiteren mag<br />
863 allg. RE VI (1909) 484–508 s. v. Eros (Stengel); H. Metzger, Les Représentations dans la Céramique Attique du IV e<br />
Siècle (Paris 1951) 41–58; LIMC III 1 (1986) s. v. Eros 850–952 (C. Augé – P. Linant de Bellefonds); F. I. Zeitlin, Eros,<br />
in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia Cultura Arte Società I. Noi e i Greci (Turin 1996) 369–430.<br />
864 A. Furtwängler, Eros in der Vasenmalerei, in: J. Sieveking – L. Curtius (Hrsg.) Kleine Schriften von Adolf Furtwängler 1<br />
(München 1912) 1–59.<br />
865 A. Greifenhagen, Griechische Eroten (Berlin 1957); Calame 1992; Sutton 1994.<br />
866 F. Lissarrague, Intrusioni nel gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague – F. Frontisi-Ducroux (Hrsg.) I misteri del gineceo<br />
(Bari 2000) 167.<br />
867 Nach Hartmann 2002, 162 spricht von einem gehäuften Auftreten von Eroten beim Symposion seit dem 5. Jh. v. Chr. Es<br />
ist nicht erkenntlich, dass sie sich auf mythische Symposionsdarstellungen bezieht, nur mit diesem Zusatz jedoch korrekt.<br />
868 Sutton 1981, 75 kam zu dem Schluss, Eros erscheine nur in respektablen Treffen; Calame 1992, 85 f. hält ebenfalls<br />
käufliche Liebe und Eros für unvereinbar.
sie wertvolle Indizien geben, wie das Paarverhältnis, und hier besonders das von Ehepaaren, in der<br />
Bildkunst bewertet und dargestellt wurde.<br />
Eine umfassende Betrachtung der möglichen bildlichen Kontexte, die vonnöten wäre, um allen<br />
Bedeutungsnuancen des Eros gerecht zu werden, kann hier verständlicherweise nicht erfolgen. Der<br />
Fokus wird im Großen und Ganzen auf den hier diskutierten Themenfeldern von Hochzeit, Oikos und<br />
Ehe liegen, die, wie eine Auflistung sämtlicher Erosdarstellungen zeigt, nur einen Bruchteil seiner<br />
Ikonographie ausmachen. 869 Dennoch wird versucht, ein möglichst breites Spektrum an Bildern des<br />
geflügelten Liebesgottes zu beleuchten, um seinen Charakter, sein Wirken und seine Methoden zu<br />
illustrieren und so auch seine symbolischen Implikationen besser verstehen zu lernen.<br />
5. 1. Eros im literarischen Diskurs<br />
Die griechischen Bild- und Schriftmedien vermitteln uns von Eros den Eindruck einer äußerst<br />
vielseitigen Gestalt. Mehr als bei anderen antiken Phänomenen oder Personifikationen steht hier zu<br />
befürchten, dass Eros in Bildkunst und Literatur unterschiedliche Ausprägung erfahren hat. 870 Für<br />
Homer ist Eros in der „Ilias“ noch ein abstrakter Begriff und kein gestaltliches, göttliches Wesen. 871<br />
Seine erste richtige literarische Erwähnung als real handelnde Person hat Eros erst in der „Theogonie“<br />
des Hesiod:<br />
„[…] wie auch Eros, der Schönste im Kreis der unsterblichen Götter:<br />
Gliederlösend bezwingt er allen Göttern und allen<br />
Menschen den Sinn in der Brust und besonnen planendes Denken. (Hes. theog. 120–123)<br />
Zusammen mit Chaos und Gaia gehört Eros zu den sogenannten kosmogonischen Göttern und somit<br />
zu den potentiell gefährlichen und unkontrollierbaren Urgewalten, denen Gott und Mensch<br />
gleichermaßen hilflos ausgeliefert sind. 872 Hesiod hat das Zwiespältige in der Natur des Liebesgottes<br />
erkannt. Die Liebe hat zwei Gesichter: sie ist Glück und Rausch, doch gleichzeitig raubt sie den<br />
Verstand. Neben Eros wird hier bereits auch Himeros erwähnt, der im Wesentlichen als Synonym für<br />
Eros verwendet werden kann, sich als Teilaspekt des Eros, nämlich als Personifikation des<br />
Liebesverlangens, jedoch zu einer eigenständigen Figur entwickelt. 873 Auch die frühen Lyriker sind<br />
hin her gerissen in ihren Eindrücken zwischen dem zarten, süß schmeckenden Eros, der über<br />
869 LIMC III, 1 (1986) 850–952 s. v. Eros (C. Augé – P. Linant de Bellefonds).<br />
870 So auch W. Strobel, Eros. Versuch einer Geschichte seiner bildlichen Darstellung von ihren Anfängen bis zum Beginn<br />
des Hellenismus (Diss. FAU <strong>Erlangen</strong>-<strong>Nürnberg</strong> 1952) 3–5.<br />
871 Hom. Il. 3, 441 f.; Od. 18, 211 f.; EAA III (1960) 426 s. v. Eros (E. Speier).<br />
872 Das Bild des Eros als Bezwinger findet sich konstant bis in die Klassik hinein, s. z. B. Anakr. 357 PMG; Soph. Antig.<br />
781–799; s. auch S. Ritter, Eros und Gewalt: Menelaos und Helena in der attischen Vasenmalerei des 5. Jhs. v. Chr., in:<br />
Fischer – Moraw 2005, 267.<br />
873 Hes. theog. 64. 201 betont einmal seine Nähe zu den Musen und Chariten, an späterer Stelle reiht er ihn gemeinsam mit<br />
Eros in die Gefolgschaft der Aphrodite ein; RAC VI (1966) s. v. Eros I (literarisch) 306 (C. Schneider); ebenda s. v. Eros<br />
(Eroten) II (in der Kunst) 313f. (A. Rumpf): Pothos wird das erste Mal literarisch bei Aisch. Hiket. 1040 erwähnt, die<br />
Eroten im Plural Anf. 5. Jh. v. Chr. von Pindar fr. 122. Der vierte, aber am wenigsten populärste im Bund ist Hedylogos.<br />
S e i t e | 181
Blumenwiesen wandelt, und dem skrupellosen Eros, der Wahnsinn in den Herzen der Menschen und<br />
Götter sät, den Verstand vernebelt und die Qualen unerwiderter Liebe durchleiden lässt. 874<br />
Das Bild des literarischen Eros in der modernen Forschung ist sicherlich zu einem Großteil vom<br />
„Symposion“ Platons geprägt, das als das umfangreichste Zeugnis der Antike zu Eros gelten kann.<br />
Den Hintergrund für die fiktive Unterhaltung bildet das Jahr 416 v. Chr. und der Sieg einer der<br />
Tragödien des Agathon. Zu diesem Anlass findet sich abends im Hause des Agathon eine illustre<br />
Runde zusammen, darunter Sokrates, Alkibiades und der Komödiendichter Aristophanes. Unter<br />
gesteigertem philosophischem Anspruch machen es sich die Gäste zur Aufgabe, das Wesen und<br />
Wirken des Gottes Eros zu ergründen. In abwechslungsreichen und individuellen Vorträgen wird rasch<br />
offenkundig, dass es eine genormte Vorstellung von Eros nie gegeben hat. Eine umfassende und<br />
allgemeingültige Definition des antiken Eros wird allerdings auch gar nicht beabsichtigt, was<br />
einerseits an der klaren Vorgabe, nämlich Eros zu preisen, und zum anderen an den von<br />
philosophischem Denken geprägten Parametern zu ermessen ist. Schon vorab ist unter diesen<br />
Gegebenheiten zu vermuten, dass die Entstehung der Ikonographie des Eros, wie sie die Vasenmalerei<br />
in ihrer ganzen Variationsbreite vor Augen führt, wohl kaum in solch philosophisch-vergeistigten<br />
Definitionen wurzelt. Und doch kann eine Konkordanz mit den Vasenbildern gerade da nicht ganz<br />
ausgeschlossen werden, wo sehr bildhafte Überlegungen zu seinem Aussehen, seinem<br />
Wirkungsbereich und seiner Genealogie angestellt werden, die zumindest z. T. zum geistigen<br />
Allgemeingut der damaligen Zeit gezählt werden dürfen. 875<br />
Die Grundlage für die Wesensbestimmung des Eros ist zunächst sein Entstehungsmythos. Phaidros<br />
verweist auf Hesiod, der Eros neben Chaos und Gaia zu den ältesten unter den Göttern zählt. 876 Von<br />
keinen Eltern geboren, und im Grunde ohne eigenen Mythos ist er eher eine kosmische Urkraft als<br />
eine mythisch handelnde Person. 877 Als der Schönste unter den Göttern wird er bereits in Hesiod´s<br />
Theogonie bezeichnet. 878 Anders als Hesiod oder Phaidros hält Agathon Eros für den Jüngsten der<br />
Götter. 879 Diese Haltung orientiert sich wohl, obwohl es von Agathon nie ausdrücklich gesagt wird, an<br />
einer jüngeren Mythenvariante, die Aphrodite als Mutter des Eros benennt. 880 Sokrates, der als letzter<br />
der Anwesenden spricht, führt, wie man es kaum anders von ihm erwartet, alle vorangegangenen<br />
874 Archil. fr. 196 W.; Alk. fr. 3, 61; 58. 59a PMG; Anakr. fr. 376. 413 PGM; Sappho fr. 130, 1 f. V. = 238a LGS nennt ihn<br />
lysimeles, glykypikros und amachanos. Sappho fr. 47 V. = 204 LGS; fr. 31 V. beschreibt die physischen Reaktionen des<br />
Begehrens; s. auch Calame 1992, 8 f. 12 f.<br />
875 F. I. Zeitlin, Eros, in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia Cultura Arte Società I. Noi e i Greci (Turin 1996) 419: „compendio<br />
delle posizioni teoriche al tempo di Platone su natura e attività di Eros“.<br />
876 Plat. symp. 178a. b.<br />
877 Zur Abhängigkeit Hesiods von der orphischen Lehre und der Geburt des Eros aus dem Weltenei, s. RE VI (1909) 486 s.<br />
v. Eros (Stengel); C. T. Seltman, Eros: in early attic Legend and Art, BSA 26, 1923/25, 88.<br />
878 Hes. theog. 120–123.<br />
879 Plat. symp. 195b. c.<br />
880 z. B. Paus. IX 27, 2; RE VI (1909) 48? s. v. Eros (Stengel); EAA III (1960) 426 s. v. Eros (E. Speier): die literarische<br />
Überlieferung nennt verschiedene Mütter und Väter des Eros; Sappho fr. 198a. b V. nennt als Eltern einmal Ge und<br />
Uranos, einmal Aphrodite und Uranos; Alk. fr. 327 V. leitet seine Herkunft ab von Iris und Zepheros, Sim. 575 PMG von<br />
Aphrodite und Ares. – Zu weiteren Genealogien, s. auch F. H. Hamdorf, Griechische Kultpersonifikationen der<br />
vorhellenistischen Zeit (Mainz 1964) 7.<br />
S e i t e | 182
Behauptungen ad absurdum. In Anlehnung an ein Gespräch mit der Priesterin Diotima aus Mantineia<br />
leugnet Sokrates nicht nur die Schönheit, sondern auch die Göttlichkeit des Eros. Als Sohn von<br />
Reichtum und Armut, gezeugt auf der Feier zur Geburt der Aphrodite, ist er gewissermaßen ein<br />
Zwitterwesen, stets bedürftig wie seine Mutter, wie sein Vater liebt und strebt er nach dem Schönen.<br />
Die Mentalität des Vaters, auf Eros übertragen, lässt ihn die Gesellschaft der Aphrodite suchen. 881<br />
Eros ist die Liebe zum Schönen und zur Weisheit, dieser selbst, so folgert Sokrates, dagegen nur ein<br />
dämonischer Vermittler zwischen Menschen und Göttern. 882 Diese Version der Genealogie des Eros<br />
ist ansonsten nicht überliefert.<br />
Den Reden mangelt es oft an einer klaren Unterscheidung zwischen dem Wesen und dem Wirken des<br />
Eros. Die philosophische Wissenschaft, wie sie Platon und Sokrates verstehen, nämlich als Suche nach<br />
dem Guten und Schönen, betrachtet Eros vorrangig unter dem Aspekt seines moralischen Nutzens.<br />
Schönheit hat vielerorts in den Platonischen Dialogen einen ethischen Anspruch, so dass sich<br />
zwangsläufig mit Eros, der quasi als das Prinzip des Guten und Schönen gilt, auch ein moralischer<br />
Nutzen verbinden lassen muss. Pausanias, einer der Redner im „Symposion“, schlägt folglich eine<br />
Differenzierung des Eros in eine körperliche und eine geistige Liebe vor. In Analogie zu Aphrodite<br />
müsse es zwangsläufig auch zwei Arten von Eroten geben: Eros Pandemos und Eros Uranios. Ersterer<br />
bezeichnet die körperliche Liebe, die keinem anderen Zweck dient als der Lustbefriedigung. In<br />
philosophischer Hinsicht hat Eros einen wesentlich wichtigeren Nutzen: Eros Uranios verknüpft die<br />
Liebe mit dem Streben nach Weisheit und eigener Vervollkommnung. Ihre optimale Erscheinungs-<br />
form düngt Pausanias die Knabenliebe zu sein, die frei ist von Ausschweifungen und sich stattdessen<br />
der Stärkung des Körpers und der Förderung des Geistes verschrieben hat. 883 Ähnlich argumentiert<br />
auch Phaidros, dass nämlich der Liebe zu anderen Menschen das Streben nach Verbesserung, nach<br />
dem ewig Schönen und Guten innewohnt. 884 Der Wunsch, sich dem Geliebten von seiner besten Seite<br />
zu zeigen, ist Phaidros Ansicht nach in homoerotischen Verhältnissen besonders stark. Doch zeigt das<br />
Beispiel der Alkestis, dass die Liebe auch Frauen zu edlen Taten befähigt. 885 Strikt nach Vereinbarung<br />
beleuchtet auch Agathon nur die positiven Seiten des Eros: maßvoll genossen ist er für ihn der<br />
Bewahrer von Frieden, Freundschaft und Gerechtigkeit, der Ursprung allen Werdens und alles<br />
Schönen. 886<br />
881 Plat. symp. 203b–e.<br />
882 Plat. symp. 202d–e.<br />
883 Plat. symp. 181c–185b. – Zum sog. pädagogischen Eros, s. N. Hoesch, Die Schöne Frau, der schöne Knabe, in: K.<br />
Vierneisel – B. Kaeser (Hrsg.), Kunst der Schale. Kultur des Trinkens. Ausstellungskatalog München (München 1990)<br />
144; Reinsberg 1993, 170–178.<br />
884 Plat. symp. 178c–179b.<br />
885 Plat. symp. 179b–180b; F. I. Zeitlin, Eros, in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia Cultura Arte Società I. Noi e i Greci (Turin<br />
1996) 420 f. legt dar, dass Auswahl und Reihenfolge der Beispiele eine inhaltliche Wertung ausdrücken. Die Tat einer<br />
Frau aus Liebe zu einem Mann wird lobend anerkannt, höher geschätzt wird dennoch die Opferbereitschaft des Orpheus,<br />
obwohl dieser für seine Frau weder sein eigenes Leben aufs Spiel setzt noch sein Vorhaben zum guten Ende führt.<br />
Exemplarisches Verhalten zeigt Achill, der aus Liebe zu einem anderen Mann Rache übt und dabei in vollem<br />
Bewusstsein der Folgen sein Leben verliert. Sein Preis ist die ewige Glückseligkeit.<br />
886 Plat. symp. 196b–197b; RAC VI (1966) s. v. Eros I (literarisch) 307 (C. Schneider): Eros als Sotergestalt mit den vier<br />
platonischen Tugenden. Gerechtigkeit in Liebesdingen bedeutet, dass die Gefühle erwidert werden; vgl. Sappho 1 V. =<br />
S e i t e | 183
Aristophanes´ Ausführungen zu Eros kommen unseren modernen Glücksvorstellungen erstaunlich<br />
nahe.<br />
S e i t e | 184<br />
„Ich für mein Teil spreche aber ganz allgemein von den Männern und Weibern, dass nur so<br />
unser Geschlecht glückselig werden könne, wenn wir es in der Liebe zur Vollendung<br />
bringen und wenn ein jeder seinen wesenseigenen Geliebten gewinnt und so wieder zu<br />
seiner ursprünglichen Natur zurückkehrt.“ (Plat. symp. 193c)<br />
Liebe ist für ihn die Suche nach persönlichem Glück, die auch die Suche nach dem Menschen<br />
miteinschließt, der uns ganz macht. Ihm geht es um die Frage, weshalb sich Menschen zu<br />
unterschiedlichen Geschlechtern hingezogen fühlen. Seine Erklärung basiert auf einer mythischen<br />
Erzählung, nach der es neben Mann und Frau ein drittes Geschlecht gegeben habe, das beide<br />
Geschlechter in sich vereint habe. Jeder Mensch verfügte über eine runde Form bestehend aus zwei<br />
Körpern, vier Armen und Beinen und zwei Köpfen. Als Strafe für die Hybris der Menschen und um<br />
sie zu schwächen, wurden sie auf Ratschluss der Götter in zwei Hälften geteilt. Sie verzehrten sich<br />
nacheinander, suchten sich, hielten sich eng umschlungen, um wieder zusammenzuwachsen, und<br />
starben schließlich vor Hunger und Untätigkeit. In einem Akt des Erbarmens versetzte ihnen Zeus ihre<br />
Schamteile, die bisher nach hinten ausgerichtet waren, nach vorne und ermöglicht ihnen so die<br />
Zeugung bzw. die homoerotische Befriedigung. 887 Die Liebe und sexuelle Vorlieben sind aus der Sicht<br />
des Aristophanes also etwas Naturgegebenes und rühren von der Abstammung her. 888<br />
5. 2. Eros in der Bildkunst der attisch-rotfigurigen Keramik<br />
Physische Schönheit und Jugend scheinen von Anfang an ein unbestrittener Aspekt des<br />
Erscheinungsbildes des Eros gewesen zu sein. In Berufung auf Hesiods „Theogonie“ stellt sich<br />
Agathon im „Symposion“ des Platon Eros nicht nur als den Schönsten der Götter, den Glückseligsten<br />
und Besten vor, sondern des Weiteren als zarten Jüngling von geschmeidiger Gestalt und edler<br />
Haltung. 889 Eine Beschreibung seines Aussehens findet sich bei den frühen Lyrikern nur verstreut und<br />
in knappen Zügen. Anakreon und später Euripides bezeichnen ihn als chrysokomas, goldhaarig,<br />
Alkman nennt ihn takeros, zart, und an einer anderen Stelle pais. Sappho lässt ihn mit einer<br />
porphyrrnen Chlamys bekleidet aus dem Himmel herabsteigen. 890 Die Vorstellung des Agathon fußt<br />
also zumindest in einigen Punkten auf einem Erosbild, das seinen Ursprung bereits in der archaischen<br />
Lyrik hat. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass das Aussehen des Eros dem des hübschen<br />
athenischen Knaben angeglichen wurde, dessen körperliche Schönheit im Zeitalter der Knabenliebe<br />
191 LGS: hier ruft die Dichterin Aphrodite als Mitstreiterin an, weil sie, Sappho, in eine junge Frau verliebt ist, die sie<br />
nicht erhört; s. auch G. Tsomis, Zusammenschau der frühgriechischen monodischen Melik (Alkaios, Sappho, Anakreon),<br />
Palingenesia LXX (Stuttgart 2001) 108.<br />
887 Plat. symp. 189d–191d.<br />
888 Plat. symp. 191d. e; Zeitlin a. O. (Anm. 885) 424.<br />
889 Plat. symp. 195d–196b.<br />
890 Sappho fr. 54 V.
auf den durchschnittlichen Athener große erotische Anziehungskraft ausübte. 891 Die attischen<br />
Vasenbilder haben die Vorstellung des Eros als schönen Epheben durchaus aufgegriffen. Betrachtet<br />
man jedoch die Gesamtheit der Bilder, die Erosdarstellungen tragen, fällt auf, dass es diesen auch in<br />
einer knabenhaften und in einer kindlichen Variante gibt. Auch die Flügel sind nicht von Beginn an<br />
fester Bestandteil seines Erscheinungsbildes, sondern werden erst von Künstlern aus dem Umkreis des<br />
Oltos um 530 v. Chr. konsequent wiedergegeben. Ein schwarzfiguriges Pinax von der Akropolis in<br />
Athen stellt Aphrodite mit zwei ungeflügelten Knaben, Eros und Himeros, im Arm dar. 892 Trotz älterer<br />
literarischer Traditionen und Spekulationen über die Herkunft des Eros zeigt diese älteste uns<br />
erhaltene Bildfassung Eros und Himeros also als Söhne der Aphrodite. Im 6. Jh. sind die<br />
Bildfassungen des Eros noch eher unüblich 893 , erst die rotfigurige Vasenmalerei gliedert den Eros<br />
Schritt für Schritt in ihr Standardrepertoire ein.<br />
Zweige, Kränze, Binden, aber auch die Leier sind die bevorzugten Attribute des Eros. 894 Zweige und<br />
Kränze sind zwar ebenso im schwelgerischen, aphrodisischen Bereich zuhause, sie verweisen aber<br />
gleichzeitig auf einen ursprünglichen Wesensaspekt des Eros, der als Naturgott für das Wachsen und<br />
Werden allen Seins zuständig ist. 895 Das Schmücken mit Blumen, Kränzen oder Binden gehört zu den<br />
verbindlichen Dienstleistungen seines Gewerbes, welche er sowohl Göttern und Heroinen als auch<br />
Bräuten oder Hausfrauen zukommen lässt. Sie sind kleine Aufmerksamkeiten, die auch als Geschenke<br />
an die angebetete Person weitergegeben werden können. Die Leier verrät seine Liebe zur Musik. Bei<br />
Hesiod wurde Himeros in die Nähe zu den Musen und Chariten gerückt. 896 Man darf nicht vergessen,<br />
dass auch Musik Stimmungen schafft, die dem Zauber des Eros zuträglich sind.<br />
Im Grunde ein Gott ohne eigenen Mythos taucht er auf den Vasenbildern überall dort auf, wo Liebe<br />
oder Verlangen als Handlungsmotive in Kraft treten. 897 Die Vorstellung vom Pfeile verschießenden<br />
Liebesboten, der Liebesregungen wie Wunden zufügt, findet sich das erste Mal bei Euripides. 898 In der<br />
Vasenkunst ist das Tatwerkzeug des Eros eher die Phiale oder die Iynx. Wenn er auf einem<br />
Kraterfragment in Tübingen V/1 (Taf. 23 Abb. 1) Ariadne, die mit demütig gesenktem Blick auf ihrem<br />
Hochzeitslager ruht, mit dem Inhalt seiner Spendeschale übergießt, ist dies wohl dahingehend zu<br />
lesen, dass er ihr besondere Charis verleiht, der in diesem Fall auch der Gott Dionysos nicht<br />
891 “mellephebos”, s. C. T. Seltman, Eros: in early attic Legend and Art, BSA 26, 1923/25, 90 f.<br />
892 Athen, Nat. Mus.; Seltman a. O. (Anm. 891) 89 f.; W. Strobel, Eros. Versuch einer Geschichte seiner bildlichen<br />
Darstellung von ihren Anfängen bis zum Beginn des Hellenismus (Diss. FAU <strong>Erlangen</strong>-<strong>Nürnberg</strong> 1952) 9 f.<br />
893 EAA III (1960) 427 s. v. Eros (E. Speier): Die frühen Darstellungen des 6. Jhs. zeigen ihn offenbar stets in Gemeinschaft<br />
mit Aphrodite und Himeros; RAC VI (1966) s. v. Eros (Eroten) II (in der Kunst) 313 (A. Rumpf); Strobel a. O. (Anm.<br />
892) 6 f. 18.<br />
894 RE VI (1909) 498 s. v. Eros (Stengel).<br />
895 A. Greifenhagen, Griechische Eroten (Berlin 1957) 24.<br />
896 Hes. theog. 64.<br />
897 „Psychologische Motivierung durch erotisches Verlangen“, s. A. Furtwängler, Eros in der Vasenmalerei, in: J. Sieveking<br />
– L. Curtius (Hrsg.), Kleine Schriften von Adolf Furtwängler 1 (München 1912) 17–27.<br />
898 Eur. Hipp. 530–534; Med. 530 f.; RAC VI (1966) s. v. Eros (Eroten) II (in der Kunst) 314. 318 (A. Rumpf); G. Tsomis,<br />
Zusammenschau der frühgriechischen monodischen Melik (Alkaios, Sappho, Anakreon), Palingenesia LXX (Stuttgart<br />
2001) 140. – In der Vasenmalerei bereits früher nachgewiesen: Lekythos des Brygos-Malers, Fort Worth, Kombell Art<br />
Mus. AP 84.16: LIMC III (1986) 878 Nr. 332 s. v. Eros Taf. 626, 332; Hydria des Hippolytos-Malers, Berlin,<br />
Antikensammlung V.I. 3166: CVA Berlin (9) 71–73 Abb. 19 Taf. 46, 1–4; 47, 1–4; 59, 1; Beil. 10, 2.<br />
S e i t e | 185
widerstehen kann. 899 Vielleicht macht er ihren Geist aber auch empfänglich für eine neue Liebe, die<br />
sich bereits in Gestalt des Gottes nähert. Diese Vorgehensweise wird etwa im „Hippolytos“ des<br />
Euripides beschrieben:<br />
S e i t e | 186<br />
„Eros, Eros, der auf die Augen<br />
Sehnsucht träufelt, du bringst die süßen<br />
Freuden der Seele deinen Opfern.“ (Eur. Hipp. 525-527)<br />
Die bewusstseinsverändernde Wirkung des Eros wird auch auf einem Glockenkrater in Paris V/2 (Taf.<br />
23 Abb. 2) deutlich, wo Eros die Versöhnung von Menelaos und Helena herbeiführt, indem er dem<br />
nach Vergeltung strebenden Menelaos aus einer eben solchen Spendeschale Liebesverlangen durch die<br />
Augen einträufelt und so dessen Rachegelüste in andere, angenehmere Bahnen lenkt. 900 Eine<br />
Gartenidylle auf einer Hydria in Florenz V/3 (Taf. 23 Abb. 3) zeigt Eros/Himeros im Gefolge der<br />
Aphrodite. Umgeben von Allegorien wie Hygieia, Paideia und Eudaimonia hält die Göttin ihren<br />
Geliebten Adonis in den Armen. Eros, der hier durch die Namensbeischrift als Himeros, die<br />
Verkörperung der Liebessehnsucht, genauer definiert wird, hat am Liebesreigen und der entrückten<br />
Stimmung keinen unwesentlichen Anteil: mit einer Iynx wirkt er einen Liebeszauber für Adonis. 901<br />
Vielleicht ist nicht einmal Aphrodite selbst gegen die manipulative Macht des Eros gewappnet. 902<br />
Bereits das genannte Hesiod-Zitat 903 deutete die Polyvalenz im Wesen und Wirken des Eros an. Die<br />
Einflussnahme des Eros ist keine Garantie auf persönliches Liebesglück. Der unseligen Liebe des<br />
Paris zu Helena, nicht nur Auslöser eines langwierigen Krieges, ist keine Zukunft beschieden. Die<br />
Ehefrau kehrt reumütig zu ihrem legitimen Ehemann zurück. Auch bei Theseus und Ariadne hat Eros<br />
seine Finger im Spiel, was den Helden aber nicht davon abhält, seine Geliebte nach der<br />
Hochzeitsnacht auf Naxos zurückzulassen. Auf einer Schale in Tarquinia V/4 (Taf. 23 Abb. 4) folgt<br />
Theseus soeben dem Ruf des Hermes. Sein Schuhwerk auflesend wendet er sich ein letztes Mal der<br />
schlafenden Ariadne zu, die von einem knabenhaften Eros wie eine Braut mit Bändern geschmückt<br />
wird. Die Tatsache, dass sie ausgerechnet unter einem Weinstock ruht, kündigt ihre baldige<br />
899 Optische Wahrnehmung als Auslöser emotionaler Reaktionen bzw. die Augen als Spiegel der Gefühle, s. Calame 1992,<br />
13 f.; F. Frontisi-Ducroux, Eros, Desire and the Gaze, in: N. Boymel Kampen (Hrsg.) Sexuality in Ancient Art. Near<br />
East, Egypt, Greece, and Italy (Cambridge 1996) 81–100; Sutton 1997, 35 f.<br />
900 R. Misdrachi-Capon (Hrsg.), Eros Grec. Amour des Dieux et des Hommes. Ausstellungskatalog Paris – Athen (Athen<br />
1989) 90–92 Nr. 32; Sutton 1997, 35; S. Ritter, Eros und Gewalt: Menelaos und Helena in der attischen Vasenmalerei des<br />
5. Jhs. v. Chr., in: Fischer – Moraw 2005, 279.<br />
901 s. auch B. Borg, Der Logos des Mythos. Allegorien und Personifikationen in der frühen griechischen Kunst (München<br />
2002) 172–176. – Zur Iunx, s. RE X (1919) 1384–1386 s. v. ’´Ιυγξ (Gossen): Iunx war im Mythos eine Frau, die Zeus mit<br />
einem Liebeszauber belegen wollte und dafür von Hera in einen Wendehals verwandelt wurde. Ihm wurde deshalb eine<br />
magische Kraft zugeschrieben, die man sich zunutze machte, indem man den Vogel auf ein Rad band und dieses zu<br />
Gesängen drehte. Für das Rad selbst bürgerte sich ebenfalls der Begriff Iunx ein; s. auch E. Böhr, A Rare Bird on Greek<br />
Vases, in: J. H. Oakley (Hrsg.), Athenian Potters and Painters. The Conference Proceedings (Oxford 1997) 116: „In<br />
human love-magic the iynx attracted lovers and called back faithless lovers.”<br />
902 Nicht einmal Aphrodite ist gefeit gegen die Manipulation ihrer Gefühle; so lässt Zeus sie für Anchises entflammen, s.<br />
Hom. h. 5.<br />
903 Hes. theog. 120–123.
Entdeckung durch Dionysos an. Der Akt des Schmückens als Bestandteil der Hochzeitsvorbereitung<br />
mag somit sowohl retrospektiven als auch prospektiven Charakter haben.<br />
Neben der rein „platonischen“ Liebessehnsucht ist auch die Befriedigung sexueller Bedürfnisse stets<br />
Teil seines Wesens. Für F. Zeitlin ist Eros in erster Linie das personifizierte Liebesverlangen, während<br />
die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse mehr in das Ressort Aphrodites fällt. 904 Ganz zu trennen<br />
sind beide Bereiche aber nicht. Die griechischen Mythen sind voll von dramatischen Geschehnissen<br />
rund um die Liebschaften der Götter und Heroen. Von wildem Verlangen beseelt schrecken sie weder<br />
vor Entführung noch vor Gewaltanwendung zurück. Die Vasenbilder scheinen in vielen Fällen<br />
bewusst den maßvollen Eros zu propagieren, indem gewaltsame Aspekte, die den mythischen<br />
Erzählungen unleugbar anhaften, im Bild oft verschwiegen oder gar umgedeutet werden. Dies kann<br />
exemplarisch an einer Pelike in Rom V/5 (Taf. 23 Abb. 5) gezeigt werden, die eine harmlose Version<br />
der Entführung der Amymone durch Poseidon wiedergibt. Poseidon, eindeutig identifizierbar durch<br />
seinen Dreizack, hat begehrlich den Arm um die Schultern der Amymone gelegt. Ihr Blick ist indes<br />
wie der einer Braut scheu nach unten gerichtet. 905 Hinter Poseidon flattert Eros mit ausgestreckten<br />
Armen heran. 906 Dies ist keine Darstellung einer Verfolgung, wie sie die Dionysos-Ariadne-<br />
Darstellung auf einer Hydria in London 907 zeigt. Der Ton ist ein ganz anderer: Amymone ergibt sich in<br />
ihr Schicksal. Zusammen mit den sie umgebenden Menschen scheinen sie sogar eine Art Hochzeitszug<br />
zu bilden.<br />
Während manche Vasenbilder Eros in unschuldiges und kindliches Spiel vertieft sehen, wird er in<br />
anderen Bildern zum zielstrebigen Verfolger fliehender Jünglinge oder Frauen. Die entsprechenden<br />
Bilder sind jedoch in der Regel derart schablonenhaft, dass man sich fragen muss, ob sie nicht in<br />
übertragenem Sinn zu verstehen sind. Demnach geht es nicht darum zu zeigen, wie Eros,<br />
stellvertretend für sein Metier, die Erfüllung seiner eigenen sexuellen Wünsche anstrebt, vielmehr<br />
wird veranschaulicht, dass niemand sich dem Bannkreis des Liebesgottes zu entziehen vermag. Schon<br />
in der frühgriechischen Melik ist belegt, dass keineswegs jeder sich willfährig dem Eros ergibt. 908<br />
Vielleicht sind es mythisch verbrämte Bilder, die den Zeitpunkt männlicher und weiblicher<br />
904 F. I. Zeitlin, Eros, in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia Cultura Arte Società I. Noi e i Greci (Turin 1996) 395: „Tuttavia,<br />
Eros si riferisce più specificamente all´istinto del desiderio amoroso, mentre Afrodite è implicata nell´intero campo di<br />
azioni comprese tra l´esercizio del faschino sessuale e la concreta pratica dell´atto sessuale.“<br />
905 Reeder 1995, 359 will hier vor allem den sexuellen Aspekt der Begegnung in Szene gesetzt sehen; so richtet sich nach<br />
Reeder´s Meinung Amymones Blick nicht demütig nach unten, sondern auf die Genitalien des Gottes.<br />
906 Solche Darstellungen veranschaulichen nach Calame 1992, 93 die Zivilisierung und Zähmung der Frau durch die Ehe.<br />
907 Hydria aus dem Umfeld des Orestes-Malers, London, British Mus. E 184: CVA London (5) III Ic 14 Taf. 80, 3. Ähnlich<br />
verhält es sich mit Europa und dem Zeus-Stier, s. S. Böhm, Griechische Heroinnen. „Girl Power“ und andere<br />
Frauenideale im antiken Griechenland, in: E. Klinger u. a. (Hrsg.), Der Körper und die Religion. Das Problem der<br />
Konstruktion von Geschlechterrollen (Würzburg 2000) 73. Während die frühen Abbildungen die Entführung als solche<br />
thematisieren, liegt die Betonung später dann im persönlich empfundenen Liebesrausch und der sexuellen Erfüllung. Es<br />
ist nicht weiter verwunderlich, dass nun Eros ins Repertoire integriert wird.<br />
908 Anakr. fr. 396 PMG; 400 PMG; G. Tsomis, Zusammenschau der frühgriechischen monodischen Melik (Alkaios, Sappho,<br />
Anakreon), Palingenesia LXX (Stuttgart 2001) 124–126.<br />
S e i t e | 187
Geschlechtsreife signalisieren. Calame hat sogar den Vorschlag unterbreitet, die Verfolgung<br />
weiblicher Personen sei Metapher für die Absicht, sie unter das Joch der Ehe zu spannen. 909<br />
S e i t e | 188<br />
5. 2. 1. Eros in den Hochzeitsbildern<br />
In der menschlichen Sphäre sind es vor allem zwei Themenbereiche der Bildkunst, in denen Eros in<br />
der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. an Bedeutung gewinnt: die Hochzeit 910 und das sog.<br />
Frauengemach. Anhand der Loutrophoros in Boston I/1 wurde die Hochzeitsikonographie bereits<br />
ansatzweise besprochen. 911 Zwei Eroten umschweben den Kopf der jungen Braut und<br />
versinnbildlichen und idealisieren ihre Attraktivität. Eros ist hier sichtbares Zeichen der Macht, die<br />
Aphrodite den Frauen verliehen hat. Wie Pandora kann sie ihre Schönheit und Ausstrahlung zum<br />
Werkzeug der Verführung machen. 912 Die Geschlechterhierarchie bleibt davon aber unbeeinflusst,<br />
denn die Braut ist nie als Femme fatale dargestellt: mit demütig gesenktem Blick folgt sie gehorsam<br />
ihrem Gatten. Genügt in manchen Fällen dem Vasenmaler die bloße Anwesenheit des Eros nicht, lässt<br />
er ihn die Braut 913 (Taf. 2 Abb. 1; Taf. 23 Abb. 6) und wechselweise auch den Bräutigam 914 bekränzen.<br />
Da auch letzterer mit dieser Ehrung bedacht wird, muss sich mehr dahinter verbergen als eine lobende<br />
Anerkennung von Schönheit. 915 Es wird beiden eine Aufmerksamkeit zuteil, die eigentlich nur Siegern<br />
in Wettkämpfen zusteht. Die Eheschließung selbst wird zur Errungenschaft, interessanterweise nicht<br />
nur der Braut, sondern auch des Bräutigams. 916 In anderen Fällen ist Eros als Teilnehmer oder Helfer<br />
ins Festgeschehen miteinbezogen, trägt die Loutrophoros für das Brautwasser 917 (Taf. 24 Abb. 1) und<br />
die Fackeln 918 oder wird durch das Diaulos-Spiel 919 (Taf. 24 Abb. 2) zum Widerschein festlicher<br />
Stimmung.<br />
909 Calame 1992, 94.<br />
910 Calame 1992, 89: für seine Anwesenheit bei der Hochzeit gibt es aus der Literatur dagegen nur einen einzigen Beleg, die<br />
Hochzeit des Zeus mit Hera.<br />
911 s. auch Kap. 1. 5. 1.<br />
912 Calame 1992, 33–36. – Die Braut als „wilde, unkontrollierbare, erotische Kraft“, s. E. D. Reeder, Frauenbilder. Die<br />
Hochzeit, in: Reeder 1995, 128.<br />
913 z. B. Berlin, Antikensammlung F 2372, hier I/4; F 2373, hier V/6.<br />
914 London, British Mus. 96.12-17. 11, hier V/7; Loutrophoros des Washing-Painter, Nauplia, Arch. Mus. 309.<br />
915 W. Strobel, Eros. Versuch einer Geschichte seiner bildlichen Darstellung von ihren Anfängen bis zum Beginn des<br />
Hellenismus (Diss. FAU <strong>Erlangen</strong>-<strong>Nürnberg</strong> 1952) 20.<br />
916 Sutton 1997, 35: Eros als “optical force”.<br />
917 Oxford, Ashmolean Mus. 1966.888, hier V/8; nach M. S. Venit, Point and Cointerpoint. Painted Vases on Attic Painted<br />
Vases, AntK 49, 2006, 36 trägt Eros eine Loutrophoros-Hydria für das Badewasser der Braut und eine Loutrophoros-<br />
Amphora für das Badewasser des Bräutigams. – Der Loutrophoren tragende Eros als Hinweis auf die Fruchtbarkeit und<br />
die bevorstehende Defloration der Braut, s. Winkler 1999, 33f. 102. – Zur geschlechtsspezifischen Verwendung der<br />
Loutrophoros, s. Mösch-Klingele 2006, 43. 46.<br />
918 z. B. Loutrophoros in Oxford, Ashmolean Mus. 1927. 4066: CVA Ashmolean Mus. (2) III I Taf. 59, 1. 2.<br />
919 z. B. Athen, Nat. Mus. 16279, hier V/9.
Zahlreicher als in den Prozessionsszenen wird Eros in den Brautschmückungsszenen dargestellt.<br />
Zumeist konzentrieren sich die Bilder auf die Braut und ihre Vorbereitungen, zu denen der Bräutigam<br />
nicht hinzugezogen wird. 920 Umso interessanter sind deswegen die wenigen Bilder außerhalb der<br />
Ekdosis, die das Brautpaar gemeinsam abbilden wie etwa das Fragment einer Loutrophoros in Boston<br />
V/10 (Taf. 24 Abb. 3). 921 Da der Bräutigam an den Vorbereitungen der Braut keinen Anteil hatte, ist<br />
hier wohl eher die Entschleierung der Braut im Haus des Bräutigams als die Schmückung derselben<br />
im Haus ihrer Eltern illustriert. Die Nympheutria ist von hinten an die Braut herangetreten und nimmt<br />
ihr den Schleier vom Diadem bekrönten Haupt. Von oben nähert sich ein Eros, in den Händen eine<br />
Taenie oder ein Band. Der große flache Korb, der soeben über dem Bräutigam entleert wird, enthält<br />
vermutlich Feigen, Datteln und Nüsse, die dem neu gegründeten Hausstand Fertilität versprechen. 922<br />
Frauen mit Kästchen und Bändern sind Vertreter der Gabenbringer während der Epaulia. Es sind, wie<br />
es typisch für viele Hochzeitsdarstellungen ist, mehrere Episoden im Bild zusammengefasst: die<br />
Anakalypteria, Katachysmata und Epaulia. 923<br />
Die Epaulia sind wohl auch Thema einer fragmentarisch erhaltenen Loutrophoros in Oxford V/11<br />
(Taf. 24 Abb. 4). Dort empfängt das junge Brautpaar gemeinsam die Hochzeitsgaben. 924 Vom Zug der<br />
Frauen ist in diesem Fall jedoch aufgrund des bruchstückhaften Zustandes des Gefäßes nur eine<br />
einzige weibliche Person, beladen mit Exaleiptron, Kästchen und Band, übrig geblieben. Die Braut vor<br />
ihr zupft elegant an ihrem Gewand, auf ihrer Schulter hat sich ein Eros niedergelassen. Dieser hält den<br />
Blick des Bräutigams fest, der sich durch seine Reisekleidung wahrscheinlich als Paris zu erkennen<br />
gibt. 925 Es handelt es sich also genau genommen um eine mythologische Darstellung.<br />
Der Grundton der Hochzeitsbilder ist harmonisch. Eros tritt hier nicht als bewusstseinsverändernde,<br />
irrationale Macht auf. Er offenbart im Bild die Lieblichkeit der Braut und macht die zwischen den<br />
Eheleuten herrschende Philia sichtbar. 926 Hier ist er nicht Ausdruck von Willkür und Vergänglichkeit,<br />
er verkörpert vielmehr einen dauerhaften und harmonischen Zustand, ein gegenseitiges Einvernehmen<br />
mit stabilisierender Wirkung auf die Ehe ganz im Sinne von Polis und Familie. Es ist ein höchst<br />
verlockender Gedanke, dass den Griechen vielleicht doch nicht nur das pragmatische und<br />
zweckdienliche Verständnis der Ehe zueigen war, das uns die antiken Quellen vermitteln. Die<br />
Existenz des geflügelten Liebesboten in den Hochzeitsbildern könnte mit Einschränkung dahingehend<br />
920 Badinou 2003, 95.<br />
921 vgl. auch Pyxis, Athen, Nat. Mus. 569: Sutton 1997, 31 f. Abb. 6: Die Braut sitzt mit noch über den Kopf gezogenem<br />
Schleier auf einem leicht erhöhten Podium im Zentrum des Bildes. Von den beiden anwesenden Männern wird der linke<br />
Bärtige von Sutton als Brautvater identifiziert. Vom Bräutigam selbst sind nur doch die Füße und der Himationsaum<br />
erhalten. Die Darstellung zeigt keinen Eros.<br />
922 Zum Brauch der Katachysmata, s. Oakley – Sinos 1993, 34; A.-M. Vérilhac – C. Vial, Le mariage grec du VIe siècle av.<br />
J.-C. à l´epoche d´Auguste (Athen 1998) 335–348.<br />
923 Oakley – Sinos 1993, 25 f.; Reeder 1995, 169–171 Nr. 26.<br />
924 Oakley – Sinos 1993, 93.<br />
925 Sutton 1997, 38 f.<br />
926 Sutton 1981, 173; nach Calame 1992, 91 f. ist Aphrodite „garante del legame di philotes stabilito dal matrimonio“. Auf<br />
den Vasenbildern übernimmt Eros diese Rolle; F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der<br />
Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 196; S. Moraw, Schönheit und Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher<br />
Nacktheit und bürgerlichem Status in der attischen Vasenmalerei, JdI 118, 2003, 32 spricht von „sinnlicher Liebe“.<br />
S e i t e | 189
ausgelegt werden, dass eine emotionale Bindung der Eheleute, Philia, durchaus erwünscht war und als<br />
gute Basis für die Gründung eines erfolgreichen Haushalts angesehen wurde. Andererseits mag auch<br />
die Überlegung angestellt sein, dass Eros als eine Art Werbeträger das Bild einer romantischen Ehe<br />
heraufbeschwören sollte. 927 Adressaten dieser programmatischen Botschaft dürften jedoch nicht nur<br />
die jungen Mädchen gewesen sein, sondern gleichermaßen auch die Männer.<br />
Ganz ist dabei den Hochzeitsbildern jegliche Erotik nicht abzusprechen. Der Eros beinhaltet durchaus<br />
Anspielungen in Bezug auf die sexuelle Attraktivität der Braut und lässt zugleich niemals den<br />
eigentlichen Zweck der Ehe, nämlich die Zeugung legitimer Erben, aus den Augen. 928 Unsere<br />
Kenntnis von kultischen Einrichtungen und Festen zu Ehren des Eros erschöpfen sich für Athen im<br />
Wesentlichen in einem Altar, der von Charmes noch im 6. Jh. v. Chr. vor der Akademie aufgestellt<br />
wurde, und dem Aphrodite-Heiligtum am Nordabhang der Akropolis 929 , in dem auch Eros verehrt<br />
wurde. Aus einer Pausaniasstelle wissen wir allerdings, dass Eros in Parion in der Troas und in<br />
Thespiai im Besonderen als Naturgott und somit auch als Gott der Zeugungskraft verehrt wurde. 930 Ob<br />
Eros in dieser Funktion auch in Athen eine Kultstätte unterhielt, sei dahingestellt, das Bewusstsein um<br />
seine generative Macht, die nicht nur im Abstrakten für das Gedeihen der Natur sorgt, sondern im<br />
zwischenmenschlichen Bereich sehr konkret in der Zeugung gipfelt, war aber sicherlich vorhanden.<br />
Anders als im „Symposion“ Platons erschöpft sich in der Bildkunst der Eros zwischen Mann und Frau<br />
also nicht nur in der körperlichen Lustbefriedigung. Dort steht er ab der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v.<br />
Chr. vor allem für die Philia des Ehepaares, für Eintracht und Harmonie.<br />
Eine weitere Steigerung der Hochzeitsidylle wird etwa ab dem dritten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. durch<br />
die explosionsartige Vervielfältigung der Eroten erzielt. Die Jahre des Reichen Stils sind generell die<br />
Zeit der Allegorien und Personifikationen, die meist nur anhand von Beischriften zu identifizieren<br />
sind. Mit Himeros und Pothos treten nun zwei weitere personifizierte Liebesgötter an die Seite der<br />
Braut. Zumindest Himeros ist noch stärker als Eros der Leidenschaft und dem sexuellen Trieb<br />
verpflichtet, eine Vorstellung, die nicht so recht zum Verständnis der Griechen von der Ehe passen<br />
will. Dass Eros aber auch in den Hochzeitsbildern 931 Wesenszüge des Himeros und des Pothos in sich<br />
927 Sutton 1981, 146. 163 bezeichnet die Hochzeitsbilder wertfrei als romantisch und positiv konnotiert; nach S. Moraw,<br />
Bilder, die lügen: Hochzeit, Tieropfer und Sklaverei in der klassischen Kunst, in: Fischer – Moraw 2005, 84. 87 f.<br />
schildern sie die Hochzeit als etwas erstrebenswertes, da sie die Braut gewissermaßen zu „freiwilliger Kooperation“<br />
überzeugen müssen.<br />
928 Sutton 1981, 184: “look of sexual love and desire”; F. Lissarrague, Intrusioni nel gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague –<br />
F. Frontisi-Ducroux (Hrsg.), I misteri del gineceo (Bari 2000) 167: “Tutti questi elementi convergono nell´esprimere la<br />
bellezza del corpo femminile, il desiderio che esso ispira nel matrimonia e la fecondità che esso promette.” Calame<br />
1992, 95.<br />
929 O. Broneer, Eros and Aphrodite on the North Slope of the Acropolis, Hesperia 1, 1932, 31–55; ders., Excavations on the<br />
North Slope of the Acropolis in Athens, 1931–1932, Hesperia 2, 1933, 329–417; ders., Excavations on the North Slope<br />
of the Acropolis in Athens, 1933/1934, Hesperia 4, 1935, 109–188.<br />
930 Paus. IX 27, 1; RE VI (1909) 490 s. v. Eros (Stengel); W. Strobel, Eros. Versuch einer Geschichte seiner bildlichen<br />
Darstellung von ihren Anfängen bis zum Beginn des Hellenismus (Diss. FAU <strong>Erlangen</strong>-<strong>Nürnberg</strong> 1952) 19; EAA III<br />
(1960) 426 s. v. Eros (E. Speier).<br />
931 Sutton 1981, 186 stellt die Existenz von Himeros und Pothos in den Hochzeitsszenen zur Diskussion.<br />
S e i t e | 190
vereinigen kann, vermag vielleicht die bereits besprochene Loutrophore in Boston I/1 (Taf. 1 Abb. 1–<br />
4) zeigen. Dort lockt er mit einladendem Winken das Brautpaar in ihr Brautgemach. Auf dem<br />
Epinetron des Eretria-Malers in Athen I/5 (Taf. 2 Abb. 2. 3) wird die vereinte Kraft der Aphrodite, des<br />
Eros und des Himeros für die Hochzeitsvorbereitungen der Harmonia beansprucht. Gemeinsam mit<br />
Peitho bilden sie das Fundament der Hochzeitsideologie.<br />
5. 2. 2. Eros in den Oikosszenen<br />
Eros ist ab der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., vereinzelt jedoch auch schon früher, auch außerhalb<br />
der Brautschmückungsszenen im Oikos ein gern gesehener Gast. 932 Sein Metier ist üblicherweise die<br />
Schönheitspflege, seltener wird er dagegen direkt mit den Arbeitsvorgängen im Haus wie der<br />
Wollarbeit verknüpft, was aber den Wollkorb als Mobiliar nicht ausschließt. 933 Mal tritt er rein<br />
attributiv an die Seite einer schönen und jungen Frau, mal mischt er sich unter die geschäftige<br />
Frauenschar oder assistiert beim Ankleiden oder Herausputzen. Auf einer Pyxis in Berlin V/12 (Taf.<br />
24 Abb. 5) reicht er einer Frau, die inmitten eines emsigen Kreises von Frauen mit Spiegel, Bändern<br />
und Kästchen sitzt, eine imposante Halskette. Auf einer Lekythos in Giessen V/13 (Taf. 24 Abb. 6)<br />
sehen wir ihn mit einem Band an eine Sitzende mit einem Zweig in der Hand heranfliegen, die<br />
wahrscheinlich im Begriff ist, einen Kranz zu flechten. Auf einer Hydria in London V/14 (Taf. 25<br />
Abb. 1) ist zwischen den ausgestreckten Armen des Eros vermutlich ein Band oder eine Girlande zu<br />
ergänzen. Adressatin dieser Gabe ist eine auf einem Klismos sitzende Frau, deren Handhaltung wohl<br />
ebenfalls dahingehend zu deuten ist, dass sie einen Kranz hält. Der Wollkorb zu ihren Füßen erinnert<br />
an ihren tugendhaften Fleiß und die häusliche Umgebung. Wiederum wählt der Vasenmaler eine sehr<br />
subtile Art und Weise, um zwei gegensätzliche Aspekte der athenischen Hausfrau zum Ausdruck zu<br />
bringen. Arbeitssinn und Erotik werden keinesfalls als Widersprüche empfunden. Das<br />
Liebeswerben 934 , Umgarnen und Beschenken durch Eros machen die einfache Hausfrau zur<br />
begehrenswerten und umschwärmten Dame. Auf einer Hydria in Berlin V/15 (Taf. 25 Abb. 2)<br />
assistiert Eros einer Frau beim Ankleiden und beteiligt sich so aktiv daran, das attraktive Äußere zur<br />
Geltung zu bringen. In der üblichen Pose, den Kolpos raffend und mit dem Gewandzipfel zwischen<br />
den Zähnen, schnürt sich eine junge Frau einen Gürtel um die Hüfte. Eros hält einen Spiegel und das<br />
Himation bereit, das auf den Vasenbildern auch im Haus häufig über dem Chiton getragen wird. Es<br />
wurde bereits darauf hingewiesen, dass dieses Motiv des Gürtens häufig hochzeitliche Assoziationen<br />
birgt 935 , so dass hier das Ankleiden vielleicht nicht nur als ein simpler, alltäglicher Vorgang gezeigt ist,<br />
der die erotische Wirkung der Frau betonen soll.<br />
932 Moraw a. O. (Anm. 926) 30 sieht das Auftauchen der Eroten im Frauengemach gegen Ende des 5. Jhs. v. Chr. als Signal<br />
für eine „Transzendierung der realen bürgerlichen Sphäre“, die auch eine Angleichung der Bürgerinnenikonographie an<br />
das Aphrodite-Bild mit sich bringt.<br />
933 Pelike, California, Hanita and Aaron Dechter 25: K. Hamma (Hrsg.), The Dechter Collection of Greek Vaes (San<br />
Bernadino 1990) 46 Nr. 25; Hydria, Hobart, Univ. of Tasmania, J. Elliot Mus. 40: R. Hood (Hrsg.) Greek Vases in the<br />
University of Tasmania ³(Hobart 1982) Taf. 16, 40.<br />
934 Götte 1957, 44.<br />
935 s. Kap. 2. 5. 2; 4. 4. 1. 5.<br />
S e i t e | 191
Obgleich die Frau auf den attischen Vasen stets gut gekleidet, jugendlich und schön ist, bewirkt der<br />
Eros als Attribut eine zusätzliche, feine Nuancierung des generellen Frauenbildes. Eros in Verbindung<br />
mit einer weiblichen Figur versinnbildlicht Schönheit und Ausstrahlung. In gewisser Weise rückt nun<br />
die Hausherrin und Ehefrau an die Stelle Aphrodites, in deren Gesellschaft Eros sich üblicherweise<br />
befindet. 936 Unterschwellig wird damit sicherlich auch stets an die erotische Wirkung appelliert. Die<br />
Darstellung einer nackten Frau auf einer Pelike in Mississippi V/16 (Taf. 25 Abb. 3) zeigt dies sehr<br />
explizit. Mit dem Kästchen im Arm und dem Wollkorb zu ihren Füßen erinnert sie an die zahllosen<br />
dienenden weiblichen Figuren in den Oikosszenen. Die Nacktheit ist angesichts des Eros hier kein<br />
Merkmal ihrer Freizügigkeit. 937 Sie wird wohl eher in Kombination mit dem Eros als ein verstärkender<br />
Hinweis nicht nur auf ihre Schönheit, sondern auch speziell auf ihre sexuelle Attraktivität verstanden<br />
werden müssen. 938 Die rundlichen Gegenstände – zwei Früchte oder Bälle – in den Händen des Eros<br />
können unterschiedlich interpretiert werden. Das Ballspiel war ein beliebter Zeitvertreib der<br />
Parthenoi, ist aber auch als erotisches Motiv geläufig. Früchte im Sinne von Fruchtbarkeitssymbolen<br />
würden das Motiv des nackten Frauenkörpers aufgreifen und ebenfalls die dem Bild innewohnende<br />
Erotik betonen.<br />
Schönheit galt schon immer als Aspekt des weiblichen Ideals, und kann von erotischer Ausstrahlung<br />
kaum geschieden werden. Dass die Frau Leidenschaft erregte, war sicher auch den Vertretern des<br />
männlichen Geschlechts nicht unwillkommen und gerade im Hinblick auf das Fortbestehen des Oikos<br />
wünschenswert. Der Eindruck, den wir bisher aus den Vasenbildern gewonnen haben, steht dennoch<br />
nicht im Widerspruch zu den überlieferten Idealvorstellungen der keuschen und besonnenen Ehefrau.<br />
S e i t e | 192<br />
5. 2. 3. Eros und der Mann im Oikos<br />
Wir richten unser Augenmerk nun im Folgenden auf jene Gruppe von Vasenbildern, die neben Eros<br />
auch eine männliche Person im häuslichen Ambiente zeigt. Welche Konnotation der Eros hier trägt<br />
und ob diese Paardarstellungen etwa vor einem bürgerlichen Hintergrund zu lesen sind, wird dabei<br />
von besonderem Interesse sein. Der Mann ist als integraler Bestandteil der Oikosszenen zwar, wie in<br />
einem vorhergehenden Kapitel gezeigt wurde, eine Randerscheinung, er widerlegt aber einwandfrei<br />
das Vorurteil, jede Frau in männlicher Begleitung sei eine Frau zweifelhaften Rufs. 939<br />
In einigen Fällen ist uns auch der kleine Eros bereits begegnet. Die unter unterschiedlichen Aspekten<br />
untersuchte Hydria in New York II/17 (Taf. 6 Abb. 5) trägt eine Szene beschaulicher Zweisamkeit.<br />
Ein junger Mann ist hinter den Stuhl seiner Geliebten getreten und legt ihr die Hand auf die Schulter.<br />
Das augenscheinlich enge Verhältnis zur Hauptakteurin des Bildes wird des Weiteren durch Eros<br />
charakterisiert, der durch das Herantragen der Hochzeitsschuhe eine mögliche Verbindung zur<br />
936 S. Moraw, Schönheit und Sophrosyne. Zum Verhältnis von weiblicher Nacktheit und bürgerlichem Status in der attischen<br />
Vasenmalerei, JdI 118, 2003, 30 f.<br />
937 z. B. N. Himmelmann, Ideale Nacktheit in der griechischen Kunst, JdI, 26. Ergh., 1990, 47.<br />
938 Moraw a. O. (Anm. 936) 34. – Zuletzt zum Diskurs der Bedeutung weiblicher Nacktheit, s. Kreilinger 2007, 190–193.<br />
207 f. 216–219.<br />
939 s. Kap. 2. 5; 2. 6.
Hochzeit herstellt. Über dem Kopf des Eros ist an der Wand ein Strang Granatäpfel angebracht, die als<br />
Symbol für Fruchtbarkeit die enge Bindung des Paares unterstreichen. 940 In der Regel scheut man sich,<br />
die antike Ehe mit modernen Wert- und Emotionsbegriffen zu belegen 941 , in diesem Fall wie in einigen<br />
anderen vorgestellten Fällen ist es aber wohl gerechtfertigt zu sagen, dass das Paarverhältnis der<br />
Eheleute z. T. einer ähnlich romantischen Stilisierung unterliegt wie das der Brautleute in den<br />
Hochzeitsszenen. Auch wenn die Schuhe nicht mit den literarisch überlieferten Nymphides identisch<br />
sind, ist das Binden des Schuhwerks ein häufig im hochzeitlichen Kontext verwendeter Topos. 942 So<br />
kniet auf einem Kelchkrater in Agrigent V/17 (Taf. 25 Abb. 4) ein Eros vor einer Frau im Typus der<br />
Aphrodite Olympias, um ihr die Schuhe zu binden. 943 Der hinter ihr stehende Jüngling hat im Übrigen<br />
seinen linken Arm nach vorne weggestreckt, so dass man sich leicht vorstellen könnte, er beabsichtige,<br />
der Frau auch hier die Hand auf die Schulter zu legen.<br />
Ein Epinetron in Athen V/18 ist unglücklicherweise nur sehr fragmentarisch erhalten. Die<br />
Protagonistin sitzt, in ihre Arbeit vertieft, über ihr Epinetron gebeugt, das sie sich über den<br />
Oberschenkel gelegt hat. Hinter ihr wird anhand weniger Reste eine weitere weibliche Figur vor einem<br />
Webstuhl ergänzt. Genau über der sitzenden Figur schwebt ein Eros, der sie bekränzt oder schmückt<br />
(Taf. 25 Abb. 5). Nach P. Badinou schlüpft Eros gleichermaßen in die Rolle der Nike und ehrt die<br />
Betriebsamkeit der fleißigen Spinnerin. Gleichzeitig verleiht er der Szene eine erotische<br />
Konnotation. 944 Fleiß und Erotik können durchaus miteinander im Bild vereint werden, wenn auch<br />
nicht im Sinne der ′spinnende Hetäre′, bei der man argumentierte, Erotik werde durch das Spinnen<br />
zum Ausdruck gebracht. Spinnen macht eine Frau für einen Mann attraktiv, und wenn dann noch Eros<br />
höchstpersönlich ihre körperlichen Reize honoriert, welche Mann würde diese Frau als Ehefrau<br />
verschmähen! Am rechten Rand, zwischen einer Tür und einer weiteren Frauenfigur, wird ein<br />
Jüngling ergänzt, der einen mit kugeligen Gegenständen gefüllten Korb heranträgt, dessen Inhalt C.<br />
Mercati als Wolle identifiziert. 945 In Form und Muster ist der Korb jedenfalls dem Wollkorb der<br />
Hausherrin sehr ähnlich, wenngleich Kalathoi üblicherweise keine Henkel besitzen. In diesem Kontext<br />
kann der junge Mann eigentlich nur in seiner Funktion als Hausherr und Ehemann hinzutreten, auch<br />
wenn seine Beteiligung an den alltäglichen Pflichten durch das Tragen eines Kalathos eine singuläre<br />
Erscheinung bleibt. 946 Eros hat hier zweierlei Aufgaben: einerseits lobt er Schönheit und Fleiß der<br />
Hausherrin, andererseits werden durch ihn ebenso wie durch das gemeinsame Bewirtschaften des<br />
Oikos Gefühle ehelicher Verbundenheit ausgedrückt. 947<br />
940 Sutton 1997, 36; Bundrick 2008, 321 f.<br />
941 Die Geste der Hand auf der Schulter selbst ist nur unter Vorbehalt zu deuten, da sie in der griechischen Ikonographie nur<br />
vereinzelt – so z. B. auch in der Sepulkralkunst – nachgewiesen ist; s. auch Kap. 4. 4. 1. 2.<br />
942 Das Anlegen der Schuhe als Zeichen des Aufbruchs, s. Sutton 1997, 31.<br />
943 vgl. Schale, Oxford, Ashmolean Mus. V 552: CVA Oxford, Ashmolean Mus. (1) 9 f. Taf. 4, 5; 13, 3. 4.<br />
944 Badinou, 2003, 25.<br />
945 Mercati 2003, 26. 28; Sutton 2004, 336: “one of the few red-figure vase paintings showing textile work without children<br />
that can be accepted without reservation as a representation of the oikos.”<br />
946 Sutton 2004, 336 f. Abb. 17, 7; nach Bundrick 2008, 307 f. sei das Bild ein Beispiel für eine ideale Partnerschaft der<br />
Eheleute und ihre Rollenverteilung im Oikos: er beschaffe das Rohmaterial, sie verarbeitet es.<br />
947 Bundrick 2008, 308.<br />
S e i t e | 193
Auf einer Hydria in San Simeon V/19 (Taf. 26 Abb. 1) ist der Hinweis auf die häuslichen Aufgaben<br />
und Tugenden der Hausfrau durch einen Kalathos in den Händen einer Dienerin gegeben. Die Herrin<br />
selbst sitzt zugegebenermaßen lässig wippend, das Knie gegen die verschränkten Finger gespreizt, vor<br />
einem jungen Mann mit Bürgerstock. Der heran schwebende Eros, der sich anschickt, die Sitzende mit<br />
einem Band zu schmücken, plädiert für einen ehelichen Kontext, so dass es sich bei dem jungen Mann<br />
auch hier wohl nur um den Ehemann handeln kann. 948<br />
Der Kolonettenkrater in Rom III/30 (Taf. 16 Abb. 1) war hier schon einmal Gegenstand der<br />
Betrachtung, da die einträchtige Paardarstellung aufgrund des Geldbeutels bisher fast einhellig als<br />
Hetärenwerbung charakterisiert wurde. 949 Die Eroten sprechen jedoch dafür, dass es sich keinesfalls<br />
um eine als Romanze getarnte Hetärenwerbung handelt 950 , sondern um eine idealisierte, eheliche<br />
Verbindung. 951 „If we can have bride and groom with fruit, with hare and with sash, why not with<br />
money as sign of status and property?” 952 , fragt S. Lewis zurecht und verweist auf eine Passage aus<br />
den „Thesmophoriazusen“ des Aristophanes, die zeigt, dass das Vermögen bei der Auswahl des<br />
Ehemannes in den Augen der zukünftigen Braut kein unerhebliches Kriterium war. 953<br />
Eine ähnliche Darstellung befindet sich auf einer Hydria V/20 (Taf. 26 Abb. 2), die ehemals in<br />
Stettin 954 ausgestellt war, heute aber leider verloren ist. Auch dort sind eine Frau mit Kalathos und ein<br />
Jüngling mit Geldbeutel und Bürgerstock abgebildet. Der Eros mit Handwebrahmen und Flötenfutteral<br />
scheint zwei sehr gegensätzliche Aspekte des Frauenlebens anzusprechen. Der Handwebrahmen<br />
gesellt sich zu dem Kalathos und thematisiert im Rahmen der Wollarbeit die häusliche Seite der Frau.<br />
Das Flötenfutteral ist schwer einordbar, in der Regel gilt es als typisches Musikinstrument der<br />
Unterhalterinnen auf dem Symposion. Daneben wird der Diaulos jedoch auch von Frauen in den<br />
Oikosszenen gespielt und ist somit ein Symbol für die musische Bildung und den Zeitvertreib der<br />
Bürgersfrau. 955 Die verschiedenen Attribute stehen stellvertretend für unterschiedliche Bereiche der<br />
weiblichen Lebenswelt und addieren sich gemeinsam mit Eros zu einer idealen Vorstellung von einer<br />
häuslichen, gleichzeitig aber auch anziehenden und kultivierten Frau. Eros muss hier nicht nur<br />
attributiv verwendet sein, sondern kann darüber hinaus auch – in Analogie zu den<br />
Hochzeitsdarstellungen und der eben angesprochenen Darstellung des Kraters in Rom III/30 – die<br />
harmonische Beziehung des dargestellten Paares, bei dem es sich auch hier wohl um ein Ehepaar<br />
handelt, betonen. 956<br />
948 Bundrick 2008, 308 f.<br />
949 vgl. Kap. 3. 4. 2. 2.<br />
950 Meyer 1988, 108.<br />
951 A. Greifenhagen, Griechische Eroten (Berlin 1957) 40 f. benennt die beiden Eroten als Eros und Anteros.<br />
952 Lewis 2002, 198.<br />
953 Aristoph. Thesm. 289–290.<br />
954 Ehem. Stettin, Mus. (ohne Inv.).<br />
955 Bundrick 2008, 324: “On the Hephaistos Painters´ hydria, the aulos is probably intended as a positive comment on the<br />
woman´s education, desirability, and capacity for leisure, even as the hand loom reflects her domestic accomplishments.”<br />
– Vgl. z. B. Hydria in London, hier V/22.<br />
956 In den gleichen Kontext gehört auch ein Fragment in Boston (MA), Mus. of Fine Arts 10.205, hier V/21: ein auf seinen<br />
Bürgerstock gestützter Jüngling beugt sich weit vor, sein ausgestreckter Arm kreuzt sich mit dem einer Frau, die ihrem<br />
Gegenüber eine Spindel entgegenhält. Zwischen Daumen und Zeigefinger gleitet der mit roter Farbe gemalte Wollfaden<br />
S e i t e | 194
Den betrachteten Bildern liegt das gängige Schema des Mannes in den Oikosszenen zugrunde,<br />
welches die Frau in ihrer Rolle als Hausherrin und Hausfrau und den Mann als Zuschauer, Begleiter<br />
und Gefährten zeigt. Den üblichen sozialen Verhaltensmustern wird durch Eros eine emotionale<br />
Komponente hinzugefügt, die selbstverständlich auch auf die persönliche Beziehung des Ehepaars<br />
abzielen kann.<br />
5. 2. 4. Der musische Eros und der Oikos<br />
Eine gesonderte Gruppe zeigt uns nun Eros als Musikanten bzw. Zuhörer im Kreise musizierender<br />
Frauen. 957 Nach E. Götte ist er hier Ausdruck eines nach innen gerichteten Empfindens, einer<br />
Ergriffenheit, die durch den Zauber der Musik ausgelöst wird. 958 Durch den Akt des Bekränzens wird<br />
er bisweilen auch zur schiedsrichterlichen Instanz erhoben. Eros selbst besitzt ja eine ausgeprägte<br />
Affinität zur Musik. Eines seiner gängigen Attribute ist die Lyra, daneben spielt er auch die Flöte oder<br />
schlägt das Tamburin. 959 Eine Hydria in London V/22 (Taf. 26 Abb. 3) zeigt eine Gruppe von Frauen,<br />
die im Oikos gemeinsam Musik machen. Zu Flötenbegleitung zupft die sitzende Hausherrin das<br />
Barbiton und wird von Eros in Anerkennung ihrer Schönheit und feinen Bildung bekränzt. Rechts<br />
lauschen zwei Zuhörerinnen der Darbietung. Eine von ihnen hat ihr Lyra-Spiel abgebrochen und hält<br />
ein Kästchen bereit, in dem in diesem Zusammenhang vermutlich Papyrus-Rollen aufbewahrt wurden.<br />
Mit Einführung der musizierenden Frau in die griechische Vasenmalerei nähern sich die bürgerlichen<br />
Frauen in ihrem Wesen und ihrem Tun mehr und mehr den Musen an 960 , werden nun auch außerhalb<br />
ihrer starren, rollengebundenen Verhaltensmuster wahrgenommen. Ihr Dasein erhält eine gewisse<br />
neuartige Leichtigkeit des Seins, fern vom Alltag der fleißigen Arbeiterin, loyalen Oikosverwalterin<br />
und liebevollen Mutter.<br />
Lektionen in Musik und Tanz zogen allerdings dann, wenn sie unter den Augen eines männlichen<br />
Zuschauers stattfanden, den Argwohn der archäologischen Forschung auf sich. Der Unterhaltungswert<br />
von Musik und Tanz wurde bei den Symposien hoch geschätzt. Hier waren es Hetären und<br />
professionelle Musikantinnen, die die männlichen Zuhörer mit ihren Künsten begeisterten. Da die<br />
diesbezüglichen Fähigkeiten der Hetären stets in den höchsten Tönen gelobt wurden, geht man davon<br />
aus, dass solche Bilder Ausschnitte der Hetärenausbildung wiedergeben und es sich bei den Männern<br />
um Freier handelt, die sich von der Tauglichkeit und den Fähigkeiten der Prostituierten überzeugen. 961<br />
nach unten weg. Von der Frau selbst ist abgesehen von ihrem Arm nichts erhalten geblieben. Zwischen beiden ist knapp<br />
oberhalb der Bruchkante noch der Rest eines Flügels erkennbar, der nur einem Eros gehören kann.<br />
957 z. B. F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993)<br />
214–216. 232–234; C. Calame, Choruses of Young Women in Ancient Greece. Their Morphology, Religious Role, and<br />
Social Functions (Oxford 2001); Vazaki 2002; Bundrick 2005; dies., Expressions of Harmony: Representations of<br />
Female Musicians in Fifth-Century Athenian Vase-Painting (Diss. Emory Univ. 1998).<br />
958 Götte 1957, 47.<br />
959 Calame 1992, 28.<br />
960 Götte 1957, 49–51; Bundrick 2005, 22 f. 92–102; dies. 2008, 322 versteht diese Bilder als Ausdruck eines harmonischen<br />
Oikoslebens.<br />
961 Bundrick 2005, 89 f.<br />
S e i t e | 195
Tatsächlich gibt es jedoch Darstellungen, die eher dafür sprechen, dass wir es mit musizierenden<br />
Bürgerinnen zu tun haben. Für eventuell anwesende männliche Zuhörer bieten sich, nachdem das<br />
Argument der Geschlechterseparation entkräftet werden konnte, mehrere einleuchtende Erklärungen.<br />
Eine musikalische Schulung ließ man im klassischen Athen sowohl den Knaben als auch den Mädchen<br />
angedeihen. Musizieren und Gesang besaß wohl nicht zuletzt wegen seiner kultischen Einbindung<br />
einen hohen Stellenwert. Mußestunden mit Musik und Tanz zu verbringen, war sicherlich ein Privileg<br />
der aristokratischen Damen, und findet als allzu profane Beschäftigung in Xenophons<br />
Aufgabenkatalog der fleißigen Hausfrau soweit keine Erwähnung. Es gibt keinen Grund anzunehmen,<br />
dass das Musizieren nicht auch unter den Augen des Hausherrn oder sonstiger männlicher<br />
Mitbewohner stattgefunden haben kann.<br />
Eine Hydria in London V/23 (Taf. 26 Abb. 4) vereint eine Musikszene, wie sie häufig im häuslichen<br />
Ambiente stattfindet, mit der Präsenz eines junges Mannes und eines Eros. Die auf einem Klismos<br />
sitzende, Flöte spielende Frau und die Frau mit dem Kästchen sind dem Repertoire der häuslichen<br />
Welt entnommen. Während Eros einerseits durch die Chelys selbst am Musizieren teilnimmt 962 , wird<br />
er andererseits durch den Kranz, den er in der erhobenen Rechten hält und der nur noch als dünne<br />
Linie erkennbar ist, zum Schiedsrichter erbrachter Leistungen. Die Geste des Jünglings, der auf<br />
vertraute Art seine Hand auf die Schulter der sitzenden Person legt, ist in ähnlicher Form auf der<br />
bereits angesprochenen Hydria aus New York II/17 (Taf. 6 Abb. 5) wiederzufinden. Auch die Akteure<br />
der Londoner Hydria V/23 (Taf. 26 Abb. 4) stehen vermutlich ebenfalls in ehelicher Beziehung<br />
zueinander, wie die intime Geste und der anwesende Eros nahe legen. 963<br />
Auf einem Glockenkrater in Kassel V/24 (Taf. 26 Abb. 5) lauscht ein Eros dem Barbitonspiel einer<br />
sitzenden Frau. An der Wand befinden sich passend dazu eine Schreibtafel und ein länglicher, oval<br />
geformter Beutel, der gemeinhin als Astragalbeutel gedeutet wird und oftmals in Unterrichts- und<br />
Übungsszenen vertreten ist. 964 Man mag überlegen, ob der lange, dünne Stab einen Narthex darstellt<br />
und den jungen Mann so als Lehrer kennzeichnet. Anders als in vielen der vorangestellten Bilder<br />
würde der Eros dann nicht auf die Kennzeichnung einer einträchtigen, zwischengeschlechtlichen<br />
Beziehung abzielen, sonder wäre Indiz dafür, dass die Musikantin oder auch ihr Spiel als schön und<br />
kunstvoll verstanden werden sollen. Vazaki erwägt für die Darstellung in Analogie zu vielen Szenen,<br />
die das Musizieren im Brautgemach thematisieren, sogar einen hochzeitlichen Hintergrund. 965<br />
Im Mittelpunkt einer Hydria in Sorrent V/25 steht neben dem Musizieren der Tanz. Zur<br />
Flötenbegleitung einer am Rande sitzenden Frau tanzt ein offensichtlich noch sehr junges Mädchen<br />
unter den Augen eines Jünglings die Pyrriche 966 . Dieser stützt sich in altbekannter Haltung auf seinen<br />
962 Eros als “Freund der Musik”, s. Götte 1957, 56; Vazaki 2003, 115.<br />
963 Bundrick 2005, 92: „Eros can sometimes appear, as well as an occasional male figure, probably tob e identified as the<br />
husband.“ – Hartmann 2002, 158 hält ausgerechnet den Eros für beweiskräftig, dass es sich bei solchen Szenen „nicht um<br />
einen Hausmusikzirkel in einem bürgerlichen Oikos handelt, sondern um musizierende Animierdamen". Sie bezieht sich<br />
dabei konkret auf den Krater der Polygnot-Gruppe, Würzburg, Martin-von-Wagner Mus. 521: Bundrick 2005, 24 Abb.<br />
12.<br />
964 Ferrari 2002, 15f.<br />
965 Vazaki 2003, 116 rfV 69.<br />
966 Allg. M.-H. Delavaud-Roux, Les Danses Armees en Grece Antique (Aix-en-Provence 1993); P. Ceccarelli, La pirrica<br />
nell´antichità greco romana. Studi sulla danza armata (Pisa 1998).<br />
S e i t e | 196
Bürgerstock und betrachtet interessiert die Vorführung. Das Mädchen ist bis auf den Helm völlig<br />
nackt, langes lockiges Haar fällt ihr über die Brust. Sie hat, soweit sich dies sagen lässt, die Stufe der<br />
Menarche noch nicht erreicht, denn ihre Körperformen sind noch in keiner Weise weiblich ausgeprägt.<br />
Ein von oben herabgleitender Eros fliegt auf sie zu, um sie zu bekrönen oder zu bekränzen.<br />
Öffentliche Tanzvorführungen und auch der Chorreigen gaben den jungen unverheirateten Mädchen<br />
die Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und durch ihre Anmut und Schönheit<br />
potentielle Brautwerber zu begeistern. Angesichts des geringen Alters der Pyrrichetänzerin auf unserer<br />
Vase in Sorrent zielt die Darstellung aber wohl eher darauf ab, ihr Talent zu würdigen, und weniger,<br />
ihren sexuellen Reizen Lob zu zollen. Aus dem gleichen Grund halte ich eine Identifikation als junges<br />
Hetärenmädchen für unwahrscheinlich. Obgleich es bildliche Belege dafür gibt, dass die Pyrriche auch<br />
bei Symposien aufgeführt wurde 967 , handelt es sich in erster Linie um einen kultischen Ritus. 968 Ferner<br />
wissen wir zwar, etwa durch Nikarete, dass junge Mädchen bereits im zarten Alter aufgekauft wurden,<br />
um sie zu Hetären auszubilden 969 , welche Fertigkeiten ihnen jedoch in jungen Jahren beigebracht<br />
wurden, ist nicht bekannt. Theoretisch ist es nicht undenkbar, dass Eros, wenn er musikalische<br />
Fertigkeiten würdigt, über Statusunterschiede hinwegsieht und Hetären auf die gleiche Art und Weise<br />
auszeichnet wie Bürgerinnen oder Töchter aus guter Familie. Es wird sich bei folgender Betrachtung<br />
aber zeigen, dass die griechische Ikonographie Eros aus dem Bereich der Gelage- und Werbeszenen<br />
fast völlig ausklammert und ihn demzufolge gewöhnlich auch nicht mit Hetären und ihren käuflichen<br />
Reizen assoziiert. Das Bekränzen einer Prostituierten durch Eros hat keine Parallele. Auch die<br />
Nacktheit der Tänzerin ist ja nicht unbedingt eine realistische Wiedergabe. Demzufolge scheint die<br />
kühne Schlussfolgerung A. Vazakis auch in diesem Fall durchaus erwägenswert: „Oft sind mit den<br />
männlichen Zuschauern offenbar die Trainer der Tänzerinnen gemeint, wobei ihr genauer Status nicht<br />
immer leicht zu ermitteln ist. Entweder haben wir es mit Bediensteten athenischer Familien zu tun,<br />
welche mit der Ausbildung der jungen Töchter beauftragt sind, oder aber es handelt sich um freie<br />
Bürger, die den Beruf des Lehrers ausüben. Ebenfalls nicht abwegig erscheint die Meinung, in<br />
manchen männlichen Figuren Angehörige der Familie zu erkennen, die nach Auskunft der Bilder vom<br />
Frauengemach nicht ausgeschlossen sind.“ 970<br />
967 z. B. Glockenkrater des Lykaon-Malers um 440 v. Chr., Neapel, Mus. Naz. SA 281: A. Schäfer, Unterhaltung beim<br />
griechischen Symposion. Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis in spätklassische Zeit (Mainz 1997)<br />
Taf. 39, 2.<br />
968 z. B. Pyxis um 410 v. Chr., Neapel, Nat. Mus. 3010: Delavaud-Roux a. O. (Anm. 966) 112 f. Nr. 28; Vazaki 2003, 153:<br />
„Im Gegensatz dazu stellt die Mehrheit der Vasenbilder mit Waffentänzerinnen keine eindeutigen Bezüge zum<br />
Symposion her, sondern meint die innerhäusliche Betätigung von jungen attischen Frauen bürgerlicher Häuser.“ Anders<br />
Bundrick 2005, 89.<br />
969 Demosth. or. 59, 18.<br />
970 Vazaki 2003, 155.<br />
S e i t e | 197
S e i t e | 198<br />
5. 3. Die chronologische Entwicklung des Eros-Motivs<br />
Bei aktuell 1588 Einträgen zum Stichwort Eros im Beazley-Archiv ist es mehr als schwierig, eine<br />
thematische Einteilung und chronologische Entwicklung dieses Motivs vorzunehmen. Ein Versuch sei<br />
trotzdem gewagt. Eros wird Ende des 6. und Anfang des 5. Jhs. durch Einzeldarstellungen in die<br />
Vasenmalerei eingeführt. Neben Darstellungen, die ihn fliegend und ohne Beiwerk zeigen, wird er<br />
zunächst mit Zweigen, Blüten, mit Bändern oder Taenien versehen. Hähne und Hasen werden<br />
gewöhnlich als Liebesgeschenke klassifiziert, nehmen aber vielleicht eher auf das konkrete<br />
Amüsement der aristokratischen Jugend Bezug. Früh nachzuweisen ist auch seine Vergesellschaftung<br />
mit Nike, die wahrscheinlich auf ihrer Wesensverwandtschaft beruht. Das mehrfach belegte Motiv des<br />
Delphinreiters hat seinen Ursprung weder in der Etymologie noch im Mythos, erklärt sich aber<br />
möglicherweise durch die Geburt Aphrodites aus dem Meer. Im mythologischen Kontext ist Eros in<br />
Darstellungen des Parisurteils früh verbürgt, wo der jedoch hauptsächlich Anhängsel Aphrodites ist.<br />
Die für Aphrodite typischen, esoterisch-idyllischen Bilder, in denen Eros als Gefährte seiner Mutter<br />
auftritt, setzen erst nach der Mitte des 5. Jhs. ein.<br />
In der ersten Hälfte des 5. Jhs. wird sein Repertoire an Einzeldarstellungen erweitert: an Attributen<br />
kommen Leier, Phiale, Altar und Vogel neu hinzu, in einzelnen Fällen auch das Fleischstück. Rehe<br />
bzw. Hirsche, die sonst eher mit Artemis assoziiert werden, unterstreichen wohl seine<br />
Naturverbundenheit. Erstmals gesellt sich Eros nun zu mythischen Liebespaaren, wo er als Vermittler<br />
fungiert. Dies sind im Einzelnen Theseus und Ariadne, Menelaos und Helena 971 , Poseidon und<br />
Amymone 972 und als Vertreter gleichgeschlechtlicher Liebe Zeus und Ganymed. Zwei mythologische<br />
Hochzeitsprozessionen sind ebenfalls mit Eros geschmückt: Dionysos und Ariadne 973 , Paris und<br />
Helena. Die Entführung der Helena und die Hochzeit mit Paris sind auf dem Skyphos des Makron in<br />
Boston 974 zu einem Bild verschmolzen. Zahlreiche Personen begleiten den Prozessionszug, den der<br />
Bräutigam, seine Braut am Handgelenk fassend, anführt. Über ihnen schwebt Eros. Obwohl also die<br />
Vorstellung von Eros bei der Hochzeit bereits um 490 v. Chr. begegnet, dauert es unerklärlicherweise<br />
rund 40 Jahre, bis er dann auch für die nicht-mythischen Hochzeitsszenen übernommen wird.<br />
Beliebtes Motiv ist zur selben Zeit ferner die Verfolgung jugendlicher männlicher Personen durch<br />
Eros. Die Verfolgung von Frauen ist zwar insgesamt auf einer höheren Anzahl an Vasen belegt, diese<br />
setzen aber erst in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. ein. In der ersten Hälfte des 5. Jhs . werden Bilder<br />
geschaffen, die ihn gemeinsam mit Gleichaltrigen porträtieren. 975 Sie sind z. T. im Bereich der Palästra<br />
angesiedelt, die Akteure mit Alabastra und Strigiles ausgerüstet. Attribute wie Kästchen, Kränze,<br />
Musikinstrumente und Phialen geben den Szenen einen vagen häuslichen oder kultisch-festlichen<br />
Rahmen. Während die Verfolgungsszenen ihre Blütezeit in der ersten Hälfte des 5. Jhs. erleben,<br />
erstrecken sich die Knaben- und Jünglingsdarstellungen mit Eros bis in die zweite Hälfte des 5. Jhs.,<br />
971 Tarquinia, Mus. Naz. Tarquiniense RC 5291, hier V/4.<br />
972 Rom, Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia 20846, hier V/5.<br />
973 Glockenkrater des Mykonos-Malers, Reading (PA), Public Mus. 32.77.1: Reeder 1995, 63 Abb. 2.<br />
974 Boston, Mus. of Fine Arts 13.186: Oakley – Sinos 1993, 98 Abb. 86.<br />
975 H. A. Shapiro, Eros in Love: Pederasty and Pornography in Greece, in A. Richlin (Hrsg.) Pornography and<br />
Representation in Greece and Rome (Oxford 1992) 53–72; Sutton 1997, 32.
mit einigen Ausnahmen sogar bis ins 4. Jh. v. Chr. 976 Eine explizite sexuelle Intention oder gar Aktion<br />
ist den Knabenszenen in der Regel nicht eigen. Viel eher ist wahrscheinlich, dass durch die<br />
Gemeinschaft eine gewisse Wesensverwandtschaft zwischen Eros und den Jugendlichen zum<br />
Ausdruck gebracht wird. Die in voller Blüte und Schönheit stehenden Knaben erleben den Beginn<br />
ihrer erwachenden Sexualität, die in Gestalt des Eros sichtbar gemacht wird.<br />
An dieser Stelle ist es ergiebig festzustellen, in welchen Themenbereichen Eros ausgerechnet nicht<br />
anzutreffen ist. Der Definition des Eros als Verkörperung des Liebesverlangens zufolge stünde zu<br />
erwarten, ihn in den zahllosen, besonders zu Beginn des 5. Jhs. v. Chr. so populären sog. Werbeszenen<br />
anzutreffen, wo die Erotik eine vordergründige Rolle spielt. 977 Selbst in der Kunst der Verfolgung<br />
versiert, wäre Eros ohne Frage der ideale Schirmherr erotischer Werbung und sexuellen Begehrens.<br />
Platons Symposionsdialog, dessen Inhalt sich mit dem Wesen des Eros auseinandersetzt, beschäftigt<br />
sich im Wesentlichen mit dem „Eros dell´ amore maschile“ 978 . In den päderastischen Beziehungen<br />
war Eros als sexueller Trieb und aktive Empfindung strikt dem Erastes vorbehalten, wohingegen der<br />
Eromenos die Annäherungsversuche seines Mentors passiv über sich ergehen lassen musste. 979 Die<br />
Bildkunst spiegelt zwar dieses Normverhalten wider, in den Werbeszenen findet sich jedoch fast nie<br />
ein Hinweis auf Eros selbst. 980<br />
Die einzigen beiden Werbeszenen mit Eros, die mir bekannt sind, sind am Ausgang des<br />
schwarzfigurigen Stils entstanden. Auf einem fragmentarisch erhaltenen Alabastron in Brauron V/26<br />
(Taf. 27 Abb. 1) lassen sich noch die Figuren eines jungen Mannes und eines in seinen Mantel<br />
vermummten Jünglings erkennen. Letzterer scheint mit einem an ihm hochspringenden Hund zu<br />
spielen. Ein heranfliegender Eros bekränzt den Jüngling. Hase und Hahn sind typische Tiergeschenke<br />
in homoerotischen Werbeszenen. 981 Die mangelnde Altersdifferenzierung, wie sie im<br />
schwarzfigurigen Stil zumeist noch wiedergegeben wird, macht eine Deutung des Paares als Erastes<br />
und Eromenos jedoch nicht gänzlich sicher. Hahnenkampf und Hasenjagd gehörten zu beliebten<br />
Freizeitbeschäftigungen aristokratischer Kreise. Vielleicht wird lediglich eine Gemeinschaft<br />
976 Nach dem bisherigen Forschungsstand waren solche Bilder nur bis zur Mitte des 5. Jhs. v. Chr. gängig.<br />
977 J. Boardman – E. La Rocca (Hrsg.), Eros in Grecia (Mailand 1975): Beim Durchblättern des Bildbandes „Eros in Grecia“<br />
wird offensichtlich, dass die Herausgeber unter Eros im übertragenen Sinn vor allem den Geschlechtsakt verstanden.<br />
978 EAA III (1960) 426. 428 f. s. v. Eros (E. Speier); RE VI (1909) 484–542 s. v. Eros (Waser). – Aus archäologischen<br />
Befunden wissen wir, dass Eros in Sparta oder auf Kreta als Verkörperung der Männerliebe Verehrung genoss. Für<br />
Samos, Elis und Athen sind Altäre in Gymnasien bezeugt, wo neben Eros auch Herakles und Hermes geopfert wurde,<br />
und die wohl z. T. ebenfalls unter dem gleichen Aspekt der Männerliebe zu betrachten sind.<br />
979 K. Dover, Homosexualität in der griechischen Antike (München 1983) 54 differenziert zwischen dem Eros des Erasten<br />
und der Philia des Eromenos. Während der Eromenos seinem Lehrer Respekt erweist und körperlichen Genuss gewährt,<br />
führt ihn der Erast nach allen Regeln der Kunst in die Welt des Erwachsenendaseins ein, wird zu seinem Mentor und<br />
Liebhaber. Philia, die auf Seiten des Eromenos an die Stelle des „Eros“ tritt, mag nun zwar das Gewähren sexueller<br />
Gunst mit einschließen, der Akzent liegt aber auf einem freundschaftlichen Verhältnis, das auf Dankbarkeit und<br />
Hochachtung basiert. – Zur Debatte um den dikaios eros, s. ebenda 47 ff; Reinsberg 1993, 164 f.; s. auch Plat. symp.<br />
182c.<br />
980 F. Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993) 245; S.<br />
Houby-Nielsen, Grave Gifts, Women, and Conventional Values of the Hellenistic Greeks, in: P. Bilde et al. (Hrsg.),<br />
Conventional Values oft he Hellenistic Greeks (Aahus 1997) 227; Kreilinger 2007, 175.<br />
981 Zu Eros und Hähnen, s. C. T. Seltman, Eros: in early attic Legend and Art, BSA 26, 1923/25, 93–101.<br />
S e i t e | 199
Gleichaltriger und Gleichgesinnter mit ihren jeweiligen Charakteristika und Vorzügen wie der adligen<br />
Lebensweise und einem gesitteten Auftreten durch Eros ausgezeichnet, ohne auf eine direkte sexuelle<br />
Beziehung beider verweisen zu wollen. Eine schwarzfigurige Lekythos in Paris V/27 (Taf. 27 Abb. 2–<br />
4) ist mit zwei heterosexuellen Paaren bemalt. Während sich auf der linken Seite der Szene ein Paar so<br />
nahe gegenübersteht, dass sie einander berühren, hält auf der anderen Seite ein Jüngling die Hand<br />
einer vor ihm sitzenden Frau, die an einer Blüte riecht. Zu ihnen gehört der von links mit zwei üppigen<br />
Kränzen heranfliegende Eros.<br />
Als Erklärung, weshalb Eros in den rotfigurigen Werbeszenen nicht vorkommt, wird bisweilen<br />
angeführt, dass bis in die ersten Jahrzehnte des 5. Jhs. v. Chr. hinein weder sein Aussehen und seine<br />
Persönlichkeit klar umrissen waren, noch ein ausreichend hohes Abstraktionsvermögen in der Malerei<br />
erreicht war, um Eros gezielt und verständlich einzusetzen. Es ist nun äußerst aufschlussreich, dass die<br />
beiden vorgestellten Beispiele mit zu den frühesten Darstellungen des Eros in der Vasenmalerei<br />
gehören, offensichtlich aber ohne Einfluss auf die rotfigurigen Werbeszenen geblieben sind. Wenn die<br />
Werbeszenen Eros, den Platon als wesentlichen Bestandteil einer päderastischen Beziehung versteht,<br />
außen vor lassen, mag dies daran liegen, dass das platonische Bild der Knabenliebe nicht auf die<br />
Verhältnisse des 6. und frühen 5. Jhs. v. Chr. übertragen werden kann. Oder aber wir müssen erneut<br />
akzeptieren, dass die Aussagen von Schrift- und Bildquellen bisweilen voneinander abweichen.<br />
Die kultischen Wurzeln des Eros liegen, soweit dies heute noch archäologisch nachweisbar ist, in<br />
Athen in der Tat im Bereich sportlich-athletischer Tätigkeit. Die Platzierung von Altären in den<br />
Palästren und vor der Akademie zeigt, dass der Eros-Kult zunächst auf ein maskulines Publikum<br />
ausgerichtet war. Die Vasenmalerei trägt diesem Umstand Rechnung, darüber hinaus bleibt Eros aber<br />
nicht auf die männliche Sphäre beschränkt. Auch wenn ein Großteil der Oikosszenen mit Eros der<br />
zweiten Hälfte des 5. Jhs. und dem 4. Jh. zuzurechnen ist, gibt es doch auch frühere Beispiele. Für die<br />
Untersuchung der ehelichen Paarbeziehung ist dabei besonders von Belang, dass hier auch der<br />
Jüngling im Oikos gut vertreten ist. Die Darstellung auf dem Krater in der Villa Giulia III/30 datiert<br />
ca. 470 v. Chr. und ist somit etwa zeitgleich entstanden mit den Werbeszenen. Das Argument, die<br />
Figur des Eros wäre in der Phase, als die Werbeszenen ihre Blüte hatten, noch nicht vollständig<br />
ausgeprägt gewesen, erweist sich als haltlos. Umso mehr als sich herausgestellt hat, dass zumindest<br />
von einigen dieser Schalenmaler wie Makron, dem Penthesileia- und dem Brygos-Maler auch<br />
Erotendarstellungen erhalten sind. Parallel zu den Oikosszenen entwickeln sich die Musikszenen.<br />
Ihren Aufschwung haben sie ebenfalls in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. Sie bilden in gewisser Weise<br />
einen Gegenpol zu den Arbeitsszenen und akzentuieren Muse und Vergnügen. 982 Einen Widerspruch<br />
bilden sie nicht, denn es fällt den Vasenmalern leicht, beides im Bild zu vereinen und sei es auch nur,<br />
dass neben den musizierenden Frauen ein Wollkorb steht.<br />
Gegen Ende des 5. Jh. nähert sich Eros wieder mehr der mythischen Welt an. Im 4. Jh. ist er dann<br />
Mitglied einer dionysisch verfremdeten Jenseitswelt, wo er ausgelassen an der Seite von Satyrn und<br />
Mänaden das Tanzbein schwingt oder mit dem Tympanon den Takt angibt. Diese exotische Götterwelt<br />
nimmt auch Einfluss auf die Gestaltung der Oikosszenen. Zusehends verschwimmt die Grenze<br />
zwischen Mythos und Alltag, dionysische Elemente werden adaptiert. So taucht etwa zwischen den<br />
982 s. auch Bundrick 2005, 98.<br />
S e i t e | 200
Frauen mit ihren Körben und Bändern plötzlich ein Satyr auf. Im dionysischen Kontext nimmt Eros<br />
häufig an Symposien teil. Nachweislich nicht-mythische Symposien finden in der Regel ohne Eros<br />
statt. 983 Die wenigen Ausnahmen gehören mit Ausnahme einer Chous in Paris 984 , die eventuell noch in<br />
die letzten Jahrzehnte des 5. Jh. datiert, allesamt in das 4. Jh. v. Chr. Auf einem Krater in Paris V/28<br />
(Taf. 27 Abb. 5) schlägt Eros inmitten lagernder Männer das Tympanon. Ähnlich wie im Bezug auf<br />
die dionysischen Szenen, deren fester Bestandteil Eros im 4. Jh. v. Chr. ist, erklärt sich seine<br />
Anwesenheit beim Symposion vermutlich durch seine Assoziation mit Lebensfreude und Genuss.<br />
Doch anders als im Falle der dionysischen Ikonographie bleiben seine Auftritte beim Gelage die<br />
Ausnahme.<br />
Auf einem Glockenkrater in Neapel V/29 (Taf. 27 Abb. 6) hat sich eine Vielzahl von Eroten unter die<br />
Festteilnehmer gemischt. Drei Hetären lagern inmitten der Komasten, steuern musikalische<br />
Unterhaltung bei oder geben sich ihren Freiern hin. Die Eroten machen sich am Symposiumsinventar<br />
zu schaffen, schmücken und bekränzen die Festgesellschaft. Besonders durch ihre Vervielfältigung<br />
steigern sie den allgemeinen Eindruck ausschweifenden Genusses und verleihen der Szenerie eine<br />
klare erotische Note, indem sie die erotischen Triebkräfte des Gelages sichtbar machen. Auf einem<br />
Glockenkraters in Paris V/30 (Taf. 27 Abb. 7) ist Eros kompositorisch auf das Liebespaar im Zentrum<br />
der Szene bezogen und scheint so mehr die sexuell-emotionale Beziehung zwischen Komast und<br />
Hetäre in den Vordergrund zu rücken. Inmitten anderer Zecher hat ein Mann eine Frau mit entblößtem<br />
Oberkörper auf seinen Schoß gezogen. Sie umfassen einander mit der Hand die Hinterköpfe und<br />
tauschen einen intensiven Blick aus. Solche Gesten der Vertrautheit und Zärtlichkeit sind beim<br />
Symposion keineswegs unüblich. Gar nicht passt respektive meiner Prämisse jedoch der fliegende<br />
Eros ins Bild, der in seinen ausgebreiteten Armen ursprünglich wohl einen Kranz hielt. Wir halten also<br />
fest, dass es sich hierbei um das einzig fassbare Beispiel handeln würde, bei dem eine Hetäre einen<br />
Eros als Attribut bekommt. Andererseits sind die Weinranken und die dadurch bedingte dionysische<br />
Atmosphäre, die Bekränzung aller Gelageteilnehmer – die „Hetäre“ miteingeschlossen – und der Eros<br />
vielleicht Anzeichen dafür, dass die Szene kein alltägliches Symposion, sondern ein kultisches<br />
Weinfest wiedergibt. Zu denken wäre eventuell an ein mythisch verbrämtes Symposion mit der<br />
Darstellung der Ariadne oder an die rituelle Vereinigung der Basilinna mit Dionysos. 985 Auch auf<br />
einem fragmentierten Glockenkrater in St. Petersburg 986 kann ein kultischer oder mythischer Kontext<br />
nicht ausgeschlossen werden.<br />
Warum galt den Vasenmalern das Gelage trotz der Reize der vielen Unterhaltungs-künstlerinnen und<br />
Hetären primär nicht als Aufenthalts- und Wirkort des Eros? Obwohl auch die Werbeszenen scheinbar<br />
alle Voraussetzungen für eine sinnliche und erotische Beziehung erfüllen, werden sie im Gegensatz zu<br />
den Hochzeitsszenen oder Oikosszenen nicht mit Eros ausgeschmückt. Was unterscheidet die Lust<br />
983 s. auch Lissarague, Frauenbilder, in P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993)<br />
243 f.<br />
984 Chous, Paris, Kunsthandel: G. van Hoorn, Choes and Anthesteria (Leiden 1951) Nr. 880 Abb. 369: lagernde Jünglinge<br />
und ein Knöchel spielender Eros.<br />
985 E. Simon, Festivals of Attica. An Archeological Commentary (Madison 1983) 96-98: Bilder zu diesem Thema zeigen<br />
eher die Prozession zum Boukoleion; H. W. Parke, Athenische Feste (Mainz 1987) 168–173.<br />
986 St. Petersburg, Hermitage (o. Inv.): K. Schefold, Untersuchungen zu den Kertscher Vasen (Berlin 1934) 14. 83: lagernde<br />
Jüngling und Männer, Trauben bilden den Hintergrund.<br />
S e i t e | 201
erzeugende Hetäre oder den Eros erzeugenden Knaben bezüglich seiner Schönheit und<br />
Anziehungskraft etwa von der Braut? Dass Eros vor allem erst im Laufe des 5. Jhs. v. Chr. Stammgast<br />
in der griechischen Vasenmalerei wird, erklärt diese Beobachtung nur zum Teil. Eros muss eine<br />
bestimmte, qualitativ andere Art von Liebesbeziehung symbolisieren, die nichts mit den ungezügelten<br />
Trinkfesten, dem käuflichen Sex mit Hetären, aber auch nichts mit den päderastischen Verhältnissen<br />
der Athener Oberschicht zu tun hat.<br />
S e i t e | 202<br />
5. 4. Zusammenfassung<br />
Als Sohn der Aphrodite ist Eros die Verkörperung der Liebeslust, der Frauen unwiderstehliche Charis<br />
verleiht und amouröse Gefühle weckt. Neben diversen Körperpflegeartikeln, fließenden Gewänder aus<br />
dünnen Stoffen oder Möbeln wie der Kline stellt Eros eine weitere Möglichkeit dar, die Schönheit und<br />
Anziehungskraft der bürgerlichen Damen zu akzentuieren. Durch beinahe mythische Überhöhung<br />
wird die Frau mit unwiderstehlichem Charme und aphrodisischer Schönheit ausgestattet. Durch seine<br />
Anwesenheit in den Oikosszenen erhält das Frauenbild eine zusätzliche Facette, z. T. sogar eine völlig<br />
neue Gewichtung. Attribute, die auf die anfallenden Arbeiten im Oikos hinweisen, allen voran der<br />
Kalathos, werden im Verlauf des 5. Jhs. v. Chr. vielerorts zur Randerscheinung, vordergründiges<br />
Interesse gilt nun dem Ankleiden und Schmücken. Diese Tendenz spiegelt sich besonders in einer<br />
Gruppe von Vasenbildern des 5. Jhs. v. Chr. wider, die sich mit der musischen-literarischen Bildung<br />
der Frauen beschäftigen. Die Frauen erscheinen von allen häuslichen Pflichten entbunden als<br />
Anhängerinnen der musischen Künste, spielen die Lyra, das Barbiton oder die Doppelflöte. Jünglinge,<br />
die sich hier bisweilen einfinden und den Vorträgen und Vorstellungen lauschen bzw. zusehen,<br />
machen ihre Zugehörigkeit zur Musikantin deutlich, etwa wenn sie unmittelbar hinter deren Klismos<br />
stehen oder ihre Hand vertraulich auf deren Schulter legen.<br />
Diese Bilder setzen bereits in der 1. Hälfte des 5. Jhs. ein, zeitgleich oder sogar ein wenig früher als<br />
die Familienszenen. Bisher war es üblich, viele dieser Bilder als Ausschnitte der Hetärenschulung zu<br />
lesen, wobei Hetären ihre Fähigkeiten vor möglicher Kundschaft erproben. Diese Deutung kam vor<br />
allem zustande, weil man nach wie vor den Bildungsstand athenischer Frauen eher gering einschätzte.<br />
Hier ist festzuhalten, dass das Medium der Vasen ein Frauenideal schafft, das der Tüchtigkeit, der<br />
Schönheit und Eleganz der durchschnittlichen Frau auch musisches Talent hinzufügt. Natürlich lassen<br />
sich nicht bei allen Bildern die Zweifel ausräumen, die Interpretation und Verortung des Geschehens<br />
ist zwangsläufig vom Umfeld und den ausgeübten Tätigkeiten abhängig, die mal mehr mal weniger<br />
typisch für Bürgerinnen oder Prostituierte sind. Dennoch erinnern manche dieser Bilder an<br />
Oikosszenen, mit dem Unterschied, dass die Frauen hier in Anwesenheit des Mannes nicht spinnen,<br />
sondern musizieren oder tanzen. Ebenso wie die erotische Ausstrahlung sind Musik und Tanz Facetten<br />
eines durchaus variierbaren Rollenbildes der Frau, die neben dem Bild der keuschen, arbeitenden und<br />
den gesellschaftlichen Normen verpflichteten Hausfrau existieren.<br />
Auf dem Krater III/30 (Taf. 16 Abb. 1) umrahmen und schmücken Eroten ein sich anblickendes Paar.<br />
Um 470 v. Chr. entstanden gehört er zu den frühsten Darstellungen dieser Art. Die Darstellung wurde<br />
aufgrund des Geldbeutels in der Hand des Jünglings bisher als Begegnung eines Freiers und einer<br />
Hetäre gedeutet. Der Geldbeutel wurde in einem der vorangegangen Kapitel eingehend untersucht.
Den erzielten Ergebnissen zufolge deutet er nicht zwangsläufig auf eine Hetäre-Kunde Beziehung hin,<br />
sondern ist hier als geschlechtsspezifisches Pendant zum Wollkorb und zur Blüte der Frau eingesetzt.<br />
Die Eroten stützen diese Vermutung. Für die Vasenmalerei der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. ist Eros<br />
zwar im Oikosbereich – und hier, wie wir gesehen haben, auch in Verbindung mit dem Mann oder<br />
Jüngling – vertreten, nicht aber in Werbe- und Gelagekontexten. In den Werbeszenen fehlt er<br />
abgesehen von vereinzelten sehr frühen (Taf. 27 Abb. 1–4), in den Symposionsszenen abgesehen von<br />
sehr späten Beispielen (Taf. 27 Abb. 5–7) und somit in genau jenen Bildern, die ihn einwandfrei mit<br />
dem Hetärentum in Verbindung brächten. Ein eine Hetäre bekränzender Eros wäre folglich mehr als<br />
ungewöhnlich.<br />
Auf dem Krater in der Villa Giulia III/30 schließt ein zweiter Eros, der den jungen Mann bekränzt,<br />
das Paar kompositorisch eng zusammen und macht unmissverständlich deutlich, dass hier zwei<br />
Menschen in Liebe vereint sind. Parallelen zu den Hochzeitsszenen mit Eros, in denen er das<br />
Brautpaar begleitet, schmückt oder bekränzt, liegen auf der Hand. Dennoch muss auf die auffällige<br />
chronologische Divergenz zwischen dem Auftreten des Eros in der Oikosbildern einerseits und der<br />
Hochzeitsikonographie andererseits hingewiesen werden. Denn Eros wird erst in der zweiten Hälfte<br />
des 5. Jh. mit der „bürgerlichen“ Hochzeit in Berührung gebracht, obwohl er für mythische<br />
Hochzeitsprozessionen bereits in zwei Exemplaren aus dem frühen 5. Jh. v. Chr. belegt ist. Es ist sehr<br />
wahrscheinlich, dass Eros eine Art Liebesverhältnis symbolisiert, das als nicht notwendige, aber<br />
zweifellose ideale Voraussetzung für die Ehe betrachtet wurde. Der Begriff „Liebe“ will an dieser<br />
Stelle keine modernen Gefühlsbindungen implizieren, sondern meint übertragen auf reale<br />
Lebensverhältnisse schlichtweg, dass sowohl Braut als auch Bräutigam, Ehemann und Ehefrau in eine<br />
Lebensgemeinschaft einwilligen und bereits sind, die notwendigen Pflichten zu erfüllen, um den<br />
Erhalt des Oikos zu sichern.<br />
S e i t e | 203
S e i t e | 204<br />
6. Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
Die attisch-rotfigurigen Vasenbilder reflektieren das normative Sozialverhalten der athenischen<br />
Bürgerin. Zurückgezogenheit, Wohlverhalten, Fleiß, Kinderliebe und die Fähigkeit, Arbeit zu<br />
delegieren, werden vor allem in den Oikosszenen als bevorzugte und wünschenswerte häusliche<br />
Tugenden gepriesen. Der Aspekt der Geschlechterinteraktion – sei es in sexueller, sei es aber auch in<br />
nicht-sexueller Hinsicht – wird dabei überwiegend unter dem Blickwinkel von Prostitution und Gelage<br />
betrachtet und kaum in Zusammenhang mit der Person der Bürgerin bzw. verheirateten Frau gebracht.<br />
Die Vorstellung einer von Männern isolierten Frauenwelt, in der die 'anständigen' Frauen fern<br />
männlicher Präsenz in ihrer eigenen kleinen Welt leben, wird in der attischen Vasenmalerei jedoch<br />
durch zahlreiche Zeugnisse geschlechtlicher Interaktion widerlegt. Die vorliegenden Ergebnisse<br />
führten zu dem Schluss, dass ganze Bildgruppen, die bisher als erotisch eingestuft wurden, wohl<br />
ebenso vor häuslichem Hintergrund vorstellbar sind und nunmehr das Bildmaterial ergänzen, das<br />
Informationen zur Rekonstruktion von Lebensbildern jener Frauen liefert, die zum Kreis der<br />
verheirateten Frauen mit oder ohne offiziellen Bürgerstatus zu zählen sind.<br />
Mit der Eheschließung gewinnen in Athen die jungen Frauen an sozialer Relevanz. Sie treten<br />
gewissermaßen aus dem behüteten Schutz ihres Elternhauses heraus und übernehmen erstmals eine<br />
ernst zu nehmende Rolle in der athenischen Gesellschaft. Als Hausverwalterinnen,<br />
Lebensgefährtinnen und Mütter künftiger Generationen agieren sie zwar nach wie vor im streng<br />
privaten Rahmen, als Angehörige des Oikos haben sie dennoch in gewisser Weise Anteil an dem<br />
Organisations- und Wirtschaftsgefüge des athenischen Staates. Infolge der mehr und mehr betonten<br />
Stellung der Haus- und Ehefrauen wird im 5. Jh. v. Chr. der weibliche Blickwinkel bzw. was Mann als<br />
Idealbild einer Frau vor Augen hatte, auch in der Bildkunst zunehmend berücksichtigt. Männliche und<br />
weibliche Sichtweisen können hierbei durchaus kongruent sein.<br />
Wiederholt wurde betont, dass Vasenbilder, darunter auch die Bilder, die den Lebens- und<br />
Arbeitsalltag der Frauen widerspiegeln, niemals unmittelbare Abbilder der Realität sind. Sie fungieren<br />
vielmehr als Bestätigung, als Leitfaden, stärken das Bewusstsein für die Rolle und die damit<br />
einhergehende Verpflichtung, indem sie Bildformeln in stereotyper und einprägsamer Weise<br />
wiederholen. Damit definieren sie eine eindeutige Erwartungshaltung, die jedoch auf positive Art und<br />
Weise und nicht etwa durch Verbote vermittelt wird. Jenseits der Aufbereitung von Lerninhalten<br />
praktischer Art, fällt ins Auge, dass man sich eines höchst schmeichelhaften Frauenbildes bedient:<br />
ewig jung, hochgewachsen, schön, gut gekleidet, immer von Frauen umgeben, die Arbeit nie mühsam.<br />
Dass die Vasenbilder eine genormte und ideelle Sicht wiedergeben, kann kein Beispiel klarer zeigen<br />
als die Hochzeitsbilder. Die soziale und rechtliche Stellung der Frau in der Antike wird in der<br />
Forschung z. T. noch immer sehr negativ beurteilt. Im schlimmsten Fall, so meint man, würden die<br />
jungen Mädchen ohne jedes Mitspracherecht an den Meistbietenden verschachert, tauschten ein<br />
Abhängigkeitsverhältnis gegen ein anderes aus. Es fallen Begriffe wie "Schattendasein" und<br />
"Unterdrückung". Bestenfalls entpuppe sich die Ehe als ein Zweckbündnis, ein unpersönliches<br />
Verhältnis, in dem sich die Eheleute miteinander zu arrangieren lernen. Die Ikonographie der<br />
Hochzeitsbilder dagegen spricht eine andere Sprache und scheint diesbezüglich keinen einzigen
Berührungspunkt mit jener harten Wirklichkeit zu haben. Um dies exemplarisch vorzuführen, genügte<br />
ein sehr kursorischer Überblick über die Genreszenen der Ekdosis und der Brautschmückung, die die<br />
Inhalte der hochzeitlichen Ikonographie rotfiguriger Vasenbilder auf den Punkt bringen. Es sind<br />
insgesamt Bilder heiterer Unbeschwertheit, die besonders in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.<br />
durch die Figur des Eros den Akzent auf das liebevolle Verhältnis der Brautleute setzen. Das attische<br />
Bildprogramms weist hier also eine deutliche Tendenz zur 'Romantisierung' auf. Daraus ergeben sich<br />
zwei Konsequenzen. Entweder machen wir uns ein falsches Bild von der Wertschätzung der Frau in<br />
der antiken griechischen Gesellschaft oder aber die Vasenbilder vermitteln erstrebenswerte<br />
Phantasievorstellungen, die z. T. von der Realität erheblich abweichen. Möglicherweise liegt die<br />
Wahrheit irgendwo dazwischen.<br />
Um Vasenbilder akkurat interpretieren zu können, sind vordergründig zwei Dinge vonnöten: das<br />
Verständnis der Semantik und kulturelles Hintergrundwissen. Dass man bei Bildinterpretationen z. T.<br />
zu solch weit auseinanderklaffenden Lesungen gelangt, liegt meines Erachtens nach wie vor – und hier<br />
besonders stark in der Frauenforschung – daran, dass das antike Frauenbild so unterschiedliche<br />
Auswertungen erfahren hat und noch erfährt. Aus diesem Grund wurde in dieser Studie zum<br />
wiederholten Mal auf das facettenreiche historische Frauenbild eingegangen. Dabei stellt sich diese<br />
Arbeit in die Tradition jener Publikationen, die bereits erfolgreich zur Demontage jenes Frauenbildes<br />
beigetragen haben, welches den Fokus ausschließlich auf deren soziale Abhängigkeit und<br />
Rechtlosigkeit legte. Ziel war es durchaus nicht, die Lebensbedingungen der Frauen in ihrer<br />
Gesamtheit ins Positive zu verkehren, sondern zu relativieren und um neue Aspekte zu erweitern. Es<br />
bleibt immer ein gewisses Wagnis, verallgemeinernde Analysen für eine Gesellschaft zu erstellen, die<br />
so vielschichtig und inhomogen war wie die der athenischen Polis und die uns zwar eine beachtliche,<br />
aber eben auch widersprüchliche Menge an schriftlichen und materiellen Quellen hinterlassen hat.<br />
Insofern geht es auch nicht um eine Scheidung von Richtung und Falsch, sondern darum aufzuzeigen,<br />
dass es mehr als eine mögliche Lesart von Bildern gibt. Grundsätzlich ist jede Interpretation eines<br />
Bildes bis zu einem bestimmten Grad von der Person des Betrachters und seines individuellen<br />
Erfahrungs- oder Bildungshorizontes abhängig. Für den modernen Rezipienten gilt dies in verstärktem<br />
Maß, da er sich zudem durch zeitliche und kulturelle Distanz behindert sieht. Kein Bild kann aus dem<br />
Kontext seiner Entstehungszeit und seines spezifischen kulturellen Milieus herausgelöst interpretiert<br />
werden. Auf welch vielfältige Weise unser kulturhistorisches Verständnis in die Deutung der<br />
griechischen Bilderwelt mit einfließt, veranschaulichen etwa die Oikosbilder. Obschon nach recht<br />
stereotypem Schema gestaltet, bieten sie dennoch einen breiten Interpretationsspielraum. Man kann sie<br />
einerseits als Ausdruck der Wertschätzung lesen, die den täglichen Pflichten und der Stellung der Frau<br />
innerhalb des Oikos entgegengebracht wird, andererseits als Versinnbildlichung ihres beengten<br />
Aktionsradius, ihrer gesellschaftlichen Isolation und des rigiden Determinismus ihrer sozialen Rolle.<br />
Für das eine wie für das andere lassen sich Belege in den antiken Schriftquellen finden. Nach<br />
modernen Maßstäben sind letztere sicherlich Kriterien, die die Lebensumstände der Frau entscheidend<br />
prägen. Doch wer kann sagen, ob der antike Betrachter die gleichen Maßstäbe angesetzt hätte?<br />
Noch schwieriger gestaltet sich die Interpretation von Bildern, die ganz allgemein dem Bereich der<br />
Geschlechterinteraktion angehören. Hier hat die Vorstellung von der Geschlechterhierarchie und dem<br />
alltäglichen Umgang von Männer und Frauen einen besonders starken Einfluss auf die Auslegung des<br />
S e i t e | 205
Bildinhalts. Wie wiederholt festgestellt, wird solchen Bildern leider großes Misstrauen bekundet.<br />
Allzu schnell ist man bereit, hinter jeder Begegnung von Mann und Frau eine sexuelle Motivation zu<br />
vermuten und das Dargestellte demzufolge in das Umfeld des Gelages einzuordnen. Die Ursache<br />
verbirgt sich hinter der Überzeugung, die griechische Gesellschaft habe in allen Bereichen des Lebens<br />
eine Geschlechterseparation praktiziert. Dass sich das Leben von Männern und Frauen z. T. tatsächlich<br />
in verschiedenen Sphären abgespielt hat, liegt in der Struktur der athenischen Gesellschaft begründet.<br />
Die entscheidende Frage ist nun aber, wie weit diese Geschlechterseparation reichte und inwieweit sie<br />
realisierbar und intendiert war.<br />
Das Haus war der durch die Geschlechterideologie vorgegebene Aufenthaltsort der athenischen Frau.<br />
Die ältere Forschungsmeinung, die sogar so weit ging, ihr jegliche Bewegungsfreiheit außerhalb ihres<br />
"Konklaves" abzusprechen, ist inzwischen erfolgreich widerlegt. Eine Vorstellung, die sich in den<br />
archäologischen Wissenschaften dagegen hartnäckig hält und die Grundlage vieler<br />
Bildinterpretationen ist, ist die einer strikten Trennung der Geschlechter innerhalb des Oikos, die sich<br />
vor allem in der Einrichtung der Gynaikonitis manifestierte. Ein Blick auf die Wohnkultur des<br />
klassischen Griechenlands und des Soziallebens in Athen vermittelt ein komplexes, aber zugleich<br />
unvollständiges Bild. Empfangsräume für Gäste oder Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohner des<br />
Hauses sorgten für die Wahrung der Privatsphäre und des Anstandes. Unterhalb der Hausbewohner<br />
muss es jedoch zwangsläufig zu regelmäßigen Kontakten gekommen sein. So sind sicherlich Bereiche<br />
zu postulieren, die vorzugsweise von Männern oder von Frauen benutzt wurden, was natürlich auch<br />
mit den unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Aufgaben im Haus zusammenhing. Wir können<br />
jedoch davon ausgehen, dass die Auffassung von einer abgelegenen und vom Rest des Hauses<br />
abgeschottenen Gynaikonitis nicht der Realität entsprochen hat. Es wurde überzeugend dargelegt, dass<br />
die griechische Ehefrau in ihrer Funktion als Hausverwalterin und Aufseherin unmöglich auf einen<br />
einzigen Raum oder Bereich des Hauses beschränkt bleiben konnte. Zugleich waren Räume zumeist<br />
nicht nur einer bestimmten Tätigkeit oder Gruppe vorbehalten, sondern wurden multifunktional<br />
genutzt.<br />
Diese Erkenntnis, so nichtig sie auch scheinen mag, ist für die Interpretation der sog.<br />
Frauengemachsszenen von großer Bedeutung. Der Mann im Oikos wurde bisher, um ihn mit der<br />
Vorstellung von der Geschlechtertrennung in Einklang zu bringen, eher als Besucher im Bordell oder<br />
bei der Hetäre denn als Ehemann, Vater oder männliches Oikos- und Familienmitglied interpretiert.<br />
Die Frauen der sog. Frauengemachsszenen werden aber in den meisten Fällen nicht deshalb unter sich<br />
gezeigt, weil Männer nicht in die Frauengemächer eingelassen wurden oder weil Frauen sich im<br />
eigenen Haus nicht unter männliche Familienmitglieder mischten, sondern weil sich der Alltag der<br />
Frauen tatsächlich in einem sozialen Umfeld abspielte, das überwiegend von Geschlechtsgenossinnen<br />
bestimmt wurde. Wenn weiter die Bewohner eines Hauses beiderlei Geschlechts aber nicht strikt<br />
voneinander separiert lebten, kann auch ein solcher Sachverhalt sich in den Vasenbildern<br />
widerspiegeln. Um den Eindruck zu vermeiden, der Begriff „Frauengemachsszene“ umschreibe eine<br />
Situation, die zwingend innerhalb der Gynaikonitis stattfinden und ausschließlich aus Frauen bestehen<br />
müsse, wurde die als wertend empfundene und deshalb irreführende Bezeichnung durch den<br />
neutraleren Begriff „Oikosszene“ ersetzt.<br />
S e i t e | 206
Eine wenn auch geringe Anzahl von Bildern, die wohl den inneren Kreis der Familie mit Vater, Mutter<br />
und Kind darstellen, beweisen eindeutig, dass die Familie und somit auch der athenische Bürger in<br />
seiner Funktion als Ehemann und Vater sehr wohl Eingang in die Ikonographie der attisch-rotfigurigen<br />
Vasenkunst gefunden hat. Diese Familienbilder vermitteln modellhafte Vorstellungen eines idealen<br />
Oikos, wobei die Oikosmitglieder ihren geschlechterspezifischen Rollen gemäß agieren. Der Mann ist<br />
in diesen Familienszenen mit nur einer Ausnahme stets jugendlich dargestellt. In den meisten Fällen<br />
tritt er als etwas abseits stehender Beobachter auf. Daneben kann er selbstverständlich durch eine<br />
Handbewegung oder durch ein Attribut in Kontakt mit der Hausherrin treten. Das Bild der athenischen<br />
Frau setzt sich dabei im Wesentlichen aus den drei Aspekten der Ehefrau, Hausfrau und Mutter<br />
zusammen. Mit zu den populärsten Repräsentationsformen gehört die Figur der fleißigen Spinnerin.<br />
Die zentrale Stellung der Herrin des Hauses und Verwalterin, die ihre Untergebenen beaufsichtigt und<br />
ihnen Pflichten zuweist, kommt am besten in der Figur der würdig thronende Dame des Hauses zur<br />
Geltung und wird des Weiteren durch all die Frauen mit Kalathoi, Kästchen, Bändern und Geschirr<br />
zum Ausdruck gebracht, die den häuslichen Arbeitsalltag im Oikos widerspiegeln. Als liebevolle<br />
Mutter ist die bürgerliche Dame dagegen überraschend selten zu sehen.<br />
Auch die Oikosszenen, die keine Kinderdarstellungen zeigen, sollten, solange es Hinweise auf<br />
häusliche Zusammenhänge gibt, nicht als Darstellungen erotischen Geplänkels abgetan werden. Die<br />
Vorurteile, die dazu führten, dass man bei Darstellungen von Männern und Frauen sofort an Hetäre<br />
und Freier dachte, wurden zur Genüge erläutert. Gerade die Familienszenen sind Beleg dafür, dass<br />
nicht jede Begegnung von Mann und Frau eine sexuell-erotische Motivation haben muss. Das<br />
Aufeinandertreffen der Geschlechter im Rahmen des Oikos wirbt im Gegenteil für bürgerlich-<br />
häusliche Werte, die den Ehemann und die Ehefrau als Mittelpunkt einer funktionalen Institution Ehe<br />
begreifen. Die vorgestellten Vasenbilder vom Männern oder Jünglingen in Oikosszenen waren nur<br />
eine kleine repräsentative Auswahl immer wiederkehrender Bildtypen. In den ausführlicheren Szenen,<br />
in denen die weibliche Person durch die Anwesenheit weiterer Frauen oder häusliche Tätigkeiten als<br />
Haus- und Ehefrau kenntlich gemacht ist, ist eine Zuordnung ins bürgerliche Milieu trotz der<br />
männlichen Figur plausibel. Da diese Bilder nie als direkte Abbilder der Wirklichkeit verstanden<br />
werden dürfen, ist es unerheblich und auch unergiebig zu fragen, was betreffender Mann inmitten der<br />
arbeitenden Frauen zu suchen hat. Er ist gewissermaßen additiv hinzugesetzt, weil eine Beziehung<br />
zwischen ihm und dem Oikos, aber auch zwischen ihm und seiner Gattin besteht.<br />
Vor allem bei Paarbildern, die auf detaillierte szenische Ausschmückungen verzichten, herrscht große<br />
Unsicherheit, wie die dargestellten Personen zu benennen sind. Grundsätzlich sollte man auch hier die<br />
Möglichkeit nicht ausschließen, dass Paare, auch wenn sie nicht durch die typischen Abläufe und<br />
Personen des Oikos definiert sind, dennoch Ehepaare darstellen. Der Fokus liegt hier eben nicht auf<br />
dem Oikos-basierenden Rollenverständnis, sondern tatsächlich auf den Menschen und ihrer<br />
persönlichen Bindung zueinander. Es liegt jedoch in der Natur dieser Bilder, dass sie eher stereotyp<br />
sind und somit in verschiedene Richtungen gedeutet werden können. Während der eine Betrachter sein<br />
tugendhaftes Weib an seiner Seite sah, identifizierte ein anderer die unbekannte Schöne vielleicht mit<br />
einer Hetäre oder mit einer ehemaligen Hetäre, die er sich nun als Pallake hielt. In einzelnen Fällen<br />
sind den Frauen aber auch hier Attribute beigegeben, die eher die soliden und häuslichen Tugenden<br />
einer Hausfrau in Erinnerung rufen. Es soll hier nicht gestritten werden, ob der Kalathos das<br />
S e i t e | 207
Statussymbol der Athenerin ist; er zielt bewusst auf eine Frau, die einem Oikos vorsteht bzw. zur<br />
Verwaltung eines Oikos beiträgt. Dies trifft für die Bürgerin in gleicher Weise zu wie für die Metökin,<br />
für die Ehefrau ebenso wie für die Pallake, die mit einem Mann zusammenlebt und die täglichen<br />
Pflichten der Haushaltsführung übernommen hat. Sie hat dagegen aber kaum mit dem Bild der Hetäre<br />
zu tun, die hier als Frau mit ständig wechselnden Bekanntschaften verstanden wird und die nicht über<br />
hervorstechend häusliche Charakterzüge verfügt. Atturibute wie Alabastra oder Spiegel erzählen von<br />
der Schönheit der dargestellten Frau, verraten aber nichts über ihren Status. Vielleicht könnte man das<br />
hoheitsvolle Sitzen auf dem Klismos selbst als Ausdruck einer gehobenen Position auslegen, womit<br />
weniger ihr tatsächlich sozialer Status als die ihr zugestandene, ehrenvolle Stellung im Oikos<br />
ausgedrückt wird. Doch auch wenn kein Attribut ausdrücklich auf die aus den Oikosszenen bekannte<br />
Rollenverteilung der Hausfrau hinweist, muss im umgekehrten Sinn noch lange keine Hetäre gemeint<br />
sein. Eine Reihe von Darstellungen, die eine bewusste Kennzeichnung der Frau als Hausfrau<br />
vornehmen, zeigen folglich, dass es Paardarstellungen von Eheleuten gegeben hat, so dass darüber<br />
hinaus diese Überlegung theoretisch auch auf manch ambivalentes Bild angewandt werden kann.<br />
Die Grenze zwischen Oikosszene und Werbeszene verwischt, wenn die Männer Attribute mit sich<br />
führen. Diese Gegenstände – seien es Blüten, Kränze, Alabastra, Spiegel, Fleischschenkel oder<br />
Geldbeutel – werden generell als Geschenke für Hetären interpretiert. Doch auch hier gilt, was im<br />
Vorangegangenen konstatiert wurde. Ist ein häuslicher Kontext gewährleistet, wird es sich wohl auch<br />
um eine Haus- oder Ehefrau handeln. Die Geschlechterseparation der griechischen Gesellschaft hat als<br />
zulässiges Argument für die Hetäre-Freier-Theorie ausgedient, und die Historiker- und<br />
Archäologenwelt muss sich wohl oder übel damit abfinden, dass in der Antike auch 'normale' Frauen<br />
umworben wurden. Vielleicht muss sogar in Frage stellt werden, ob die Lesung als Werbeszene<br />
überhaupt korrekt ist. Das Reichen bzw. Halten symbolträchtiger Attribute wie Kränze, Blüten oder<br />
Früchten kann unter Umständen auch als Hilfsmittel zur Charakterisierung von Ehe- oder Brautpaaren<br />
verwendet sein.<br />
Problematischer wird die Deutung der Szene, wenn es sich bei den Attributen oder Gegenständen, die<br />
den männlichen Personen in den Oikossszenen beigegeben sind, nicht um symbolbehaftete, abstrakt zu<br />
deutende Objekte handelt. Dies gilt in besonderem Maße für das Fleischstück und den Geldbeutel. Als<br />
Alternative zur Interpretation, ein Freier bringe seine „Bezahlung“ in Form eines Fleischstücks mit ins<br />
Bordell, wo sich die Hetären nebengewerblich als Weberinnen engagieren, wurde eine symbolisch-<br />
abstrakte Deutung des Fleischschenkels vorgeschlagen. Durch das Fleisch, das nur einem athenischen<br />
Bürger bei öffentlichen Opferfesten zustand, wird der Status der männlichen Person und seines Oikos<br />
unterstrichen.<br />
Die Untersuchung zum Attribut des Geldbeutels erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde die<br />
pauschale Gleichsetzung des Geldbeutels mit dem Kauf von Sex als unzutreffend entlarvt. Er wird in<br />
Kontexten verwendet, in denen er unter diesem Gesichtspunkt keinen Sinn macht. Er ist<br />
kontextunabhängig ein Symbol für Wohlstand und finanzielle Potenz, im übertragenen Sinne für<br />
politischen Einfluss und sozialen Status, erst kontextabhängig kann er auch die Möglichkeit andeuten,<br />
sexuelle Dienste zu erwerben. Im Zusammenhang mit dem Geldbeutel ließ es sich nicht vermeiden,<br />
sich eingehend mit dem Phänomen der 'spinnenden Hetäre' auseinanderzusetzen. Mein Anliegen war<br />
es, Schwachpunkte und Widersprüche offenzulegen und zumindest hinsichtlich einiger ausgewählter<br />
S e i t e | 208
Vasenbilder den Anstoß zur Rückbesinnung und somit zu alternativen Interpretationen zu geben. Das<br />
Spinnen ist und bleibt meiner Ansicht nach das Merkmal der guten und fleißigen Ehefrau bzw.<br />
Hausfrau und Partnerin. Es ist Bestandteil eines normierten Rollenbildes, das nicht nur ihre<br />
Tugendhaftigkeit, sondern auch ihren ökonomischen Beitrag zur Förderung des Oikos versinnbildlicht.<br />
In Kombination mit dem scheu gesenkten Blick, dem transparenten Brautschleier – all dies sind<br />
Merkmale einer keuschen und zurückhaltenden Braut oder jungen Ehefrau – oder eben auch dem<br />
Wollkorb kann der Geldbeutel kein Symbol sexueller Verfügbarkeit sein.<br />
Am Ende ist der These der Vorzug zu geben, dass der Geldbeutel ein männliches Attribut unter vielen<br />
ist, das seine Blütezeit in der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. erlebte, als Handgeld noch die Aura des<br />
Neuen hatte. Eine spinnende Frau kann in der Regel trotz eines vorhandenen Geldbeutels entweder als<br />
Ehefrau oder Lebensgefährtin identifiziert werden, je nachdem ob sie, abhängig von ihrem jeweiligen<br />
Status, legitim miteinander verheiratet sind, oder nur in einer eheähnlichen Gemeinschaft<br />
zusammenleben. Sexuelle Anspielungen irgendeiner Art müssen nicht vorhanden sein.<br />
Ein weiteres und eng mit dem Gegensatzpaar Ehefrau-Hetäre verknüpftes Problem ist in diesem<br />
Zusammenhang das angebliche Fehlen jeglicher Darstellungen von ehelicher Sexualität und Erotik. Es<br />
ist sicherlich richtig, dass man nicht davon ausgehen darf, dass die Sexualität der Ehefrau so<br />
unverblümt dargestellt wurde wie die der Prostituierten. In der Regel werden eher andere Vorzüge der<br />
'bürgerlichen' Frauen in Szene gesetzt als ihre sexuellen Aktivitäten. Davon abgesehen ist auch die<br />
durchschnittliche Frau auf den Vasen ein Blickfang. Denn die idealisierte, jugendliche, schöne und<br />
reich gewandete Frau ist im Grunde nichts anderes als die Verkörperung von Attraktivität. Schönheit<br />
und sexuelle Ausstrahlung, die nicht selten zusätzlich durch Attribute wie Salbölgefäße, Spiegel<br />
Blüten oder einen Eros unterstrichen werden, sind also auch den Oikosbildern immanent.<br />
Obwohl in dieser Arbeit zahlreiche Beispiele für die Darstellungen von Ehepaaren angeführt werden<br />
konnten, verraten uns die Darstellungen nur selten etwas über antike Vorstellungen zum Verhältnis der<br />
Ehepaare. Der cheir-epi-karpo-Gestus hat mehr symbolischen Wert, und andere Gesten wie z. B. die<br />
Hand auf der Schulter sind stark kontextabhängig oder leicht zu missinterpretieren. Wieder andere<br />
Gesten beschreiben allgemein menschliche Interaktionen, die nicht auf den Umgang von Ehepaaren<br />
beschränkt sind. Darunter fällt etwa das Umfassen des Kinns, das nicht, wie auf den ersten Blick hin<br />
vielleicht denkbar, eine Demonstration von Zärtlichkeit und Intimität ist, sondern v. a. bei<br />
Symposiasten und ihren Hetären begegnet. Generell gibt es leider wenige Gebärden, die als<br />
symptomatisch und aufschlussreich für die ehelichen Beziehungen in der Antike interpretiert werden<br />
können.<br />
Anders sieht es meiner Ansicht nach mit der Figur des Eros aus. Bisher wurde kaum beanstandet, dass<br />
Frauen mit Eros angeblich auch Hetären sein können. Keine einzige mir bekannte Darstellung setzt<br />
Eros tatsächlich und unwiderruflich in Beziehung zum Prostituiertengewerbe, vor allem dann wenn<br />
der Geldbeutel nicht mehr als Aushängeschild der Hetärenwerbung verstanden wird. Später, d. h. ab<br />
der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr., wird es besonders in den Hochzeitsszenen evident, dass Eros<br />
nicht nur auf das verführerische Wesen der Braut, sondern auch auf eine idealisierte emotionale<br />
Beziehung zwischen den Eheleuten hinweist.<br />
Im Rahmen der hochzeitlichen Ikonographie galt unser Augenmerk neben Eros zudem der Kline, die<br />
auf einigen Bildern als Vorbote der ersten sexuellen Vereinigung folglich auch den körperlichen<br />
S e i t e | 209
Aspekt der Ehe in den Vordergrund rückt. Man hätte wohl erwartet, dass ihr hochzeitlich-<br />
zeremonieller Bezug der Übernahme in profanen Alltagsszenen vorangeht. Interessanterweise ist die<br />
Kline aber bereits viel früher in Oikosszenen etabliert. In Szenen bunter Geschäftigkeit wird über den<br />
voyeuristischen Blick durch eine offene Thalamostür der eheliche Geschlechtsakt in das<br />
Alltagsgeschehen integriert und Seite an Seite mit den häuslichen Pflichten der Hausfrau gestellt. Dass<br />
die Kline hier etwa als pars pro toto für das Andron gebraucht wird, ist angesichts des häuslichen und<br />
femininen Kontexts wohl auszuschließen. Solche Themen zieren wohlgemerkt nicht nur Frauengefäße,<br />
sondern auch die sog. Symposionskeramik. Gott bewahre, dass ein Athener beim Symposion<br />
angesichts einer neben einer Kline stehenden Dame an seine eigene Frau gedacht haben könnte! Die<br />
Kline allein ist also trotz unleugbarer sexueller Anspielungen ebenso wenig wie der Geldbeutel ein<br />
Argument für die Deutung auf eine Prostituierte oder Hetäre. Bei einer in ein Himation gehüllten<br />
weiblichen Figur mit Wollkorb und Spiegel sollte man stets erst an eine 'anständige' Frau denken.<br />
Sowohl im Rahmen der Hochzeit als auch der Oikosszenen wird die Kline als Alltagsmöbel benutzt,<br />
das mit Sicherheit eine erotisch-sexuelle Symbolik besitzt. Als eventuelle Darstellungen des ehelich-<br />
geschlechtlichen Umgangs selbst können nur wenige Darstellungen herangezogen werden. Eine solch<br />
deutliche Zurschaustellung von Begehren würde sich inmitten des Repertoires an Bildern, die sich<br />
sonst mit dem Alltag der Frauen und Nicht-Hetären auseinandersetzen, tatsächlich ungewöhnlich<br />
ausnehmen. Es handelt sich wohlgemerkt nur um vereinzelte und singuläre Vasenbilder, die zu diesem<br />
Thema befragt werden können, so dass sämtliche Schlussfolgerungen nur einen vorläufigen, am Stand<br />
bekannter Vasenbilder orientierten Charakter haben. Da sich die eheliche Sexualität, die Mann und<br />
Frau miteinbezieht, üblicherweise auf den hochzeitlichen Kontext beschränkt bzw. nur hier als solche<br />
nachgewiesen werden kann, mag man vielleicht ebenfalls bei den sich Umarmenden im Thalamos<br />
einen hochzeitlicher Kontext vermuten, ohne dass es aber letztlich bewiesen werden kann. Auch diese<br />
Art von Bildern bleiben sowohl in ihrer Bedeutung wie in ihrer Auslegung zweideutig.<br />
Zuletzt sei noch knapp die Frage nach den Adressaten der untersuchten Vasenbilder angesprochen.<br />
Vasenbilder, die weibliche Idealvorstellungen thematisieren, richten sich nicht nur ausschließlich an<br />
die Adresse athenischer Bürgerinnen. Der Bürgerstand hat bei Herausbildung gesellschaftlicher<br />
Normen und ihrer Bildfassung die wohl entscheidende Rolle gespielt. Dennoch ist es nicht<br />
auszuschließen, dass sich auch andere Bevölkerungsschichten mit den Bildinhalten identifizieren<br />
konnten. Dies gilt für Metöken ebenso wie für Freigelassene und hier speziell auch für Pallakai, die<br />
Haus und Bett eines Mannes teilten. Auch wenn jene vielleicht nicht über den rechtlichen Status einer<br />
athenischen Bürgerin verfügten, waren ihre Aufgaben und ihre auf den Haushalt bezogene Stellung im<br />
Wesentlichen die Gleichen. Die Oikosbilder sind und bleiben für all die Frauen verständlich und<br />
gültig, die sich athenischen Moralvorstellungen und sozialen Anforderungen unterwerfen.<br />
Dass sich früh auch typische Frauenthemen auf mit dem Symposion assoziierter Keramik befinden,<br />
lässt den Schluss zu, dass entweder auch Frauen Symposionskeramik benutzten oder aber auch<br />
Männer als Rezipienten vorgesehen waren. Man scheint sich von der Vorstellung trennen zu müssen,<br />
dass von Männern benutzte Gefäße ausschließlich Themen für 'echte Kerle' trugen. Sicher mag man<br />
sich im volltrunkenen Zustand eher an hübschen, leicht bekleideten Mädchen erfreuen, das schließt<br />
repräsentativen Dekor aber nicht aus. Wer sagt, dass das Oikosideal sich nicht auch an ein männliches<br />
Zielpublikum richtete?<br />
S e i t e | 210
Die Familienbilder, auch wenn sie nicht sehr zahlreich sind, befinden sich überwiegend auf<br />
Gefäßformen, die von Frauen benutzt wurden, wie Hydrien, Pyxiden und dem Lebes Gamikos. Die<br />
Pelike gilt zwar nicht als typisches Frauengefäß, konnte jedoch zweifelsfrei auch von Frauen benutzt<br />
werden. Darstellungen des Mannes im Oikos bzw. Einzeldarstellungen von Mann und Frau sind als<br />
Bildschmuck dagegen auf den unterschiedlichsten Gefäßformen zu entdecken. Pyxis und Hydria sind<br />
ebenso vertreten wie Alabastron und Schale. Die Kylix wurde bisher strikt als Symposionsgeschirr<br />
und somit als vorzugsweise von Männern benutztes Gefäß definiert. Angesichts zahlreicher<br />
Textquellen, die die weibliche Vorliebe für Wein erwähnen, ist aber nicht auszuschließen, dass<br />
Kylikes auch von Frauen benutzt worden sind. Das Thema selbst ist in keiner Weise<br />
geschlechtsspezifisch. Ein reibungslos funktionierender Oikos, eine fleißige Ehefrau und eine<br />
harmonisches Verhältnis der Eheleute sind Themen, die beide Geschlechter gleichermaßen angehen.<br />
Der Kooperation von Mann und Frau zum Zwecke der Mehrung des Besitzes wird auch in Xenophons<br />
„Oikonomikos“ im 4. Jh. v. Chr. noch ein hoher Stellenwert eingeräumt.<br />
Zeitlich verteilen sich die Familienbilder auf die Jahre zwischen 470 und 420 v. Chr. Dies bedeutet,<br />
dass die Bedeutung eines einträchtigen Familienlebens im Bewusstsein der Menschen bereits<br />
verankert war, noch bevor die Perikleische Gesetzgebung die Position und Würde der verheirateten<br />
Frau stärkte und deutlich bevor diesbezügliche Vorstellungen im „Oikonomikos“ des Xenophon in<br />
schriftlich niedergelegt wurden. Die Rolle der Frau scheint im Hinblick auf ihre Position und ihre<br />
Aufgaben im Oikos das 5. und 4. Jh. v. Chr. hindurch weitgehend unverändert geblieben zu sein, auch<br />
wenn die Krisenzeiten des Peloponnesischen Krieges und die Abwesenheit von Vätern, Ehemännern<br />
und Brüdern den Frauen erzwungenermaßen mehr Eigenverantwortlichkeit abverlangten. Obwohl im<br />
4. Jh. v. Chr. die Oikosbilder weiterhin zu den beliebtesten Themen zählen, hat sich der Grundtenor<br />
gewandelt: sie legen weit weniger Gewicht auf die tatsächlichen häuslichen Arbeiten und zeigen die<br />
Frauen durch eine Zunahme an mythologisch verbrämten Elementen weniger bodenständig. Weshalb<br />
uns aus diesem Jahrhundert zumindest auf den Vasen kein einziges Familienbild mehr überliefert ist,<br />
ist ein Phänomen, das noch der Klärung bedarf. Die Perikleischen Gesetzgebung, die Kinder aus rein<br />
athenischen Familien, also aus legitimer Abkunft, mit dem Bürgerrecht beschenkte, mag durchaus die<br />
Popularität des neuen Bildthemas gefördert haben, den Effekt einer Initialzündung kann ihr aber nicht<br />
zuerkannt werden, da zumindest eines der Bilder bereits vor 450 v. Chr. entstanden ist. Langfristig hat<br />
die Familienpolitik des Perikles keine einschlagende Wirkung erzielt, bereits zu Beginn des<br />
Peloponnesischen Krieges wurden mit dem Rückgang der athenischen Bevölkerung<br />
Gesetzesrevisionen vorgenommen. Dennoch ist dies keine vollends zufriedenstellende Erklärung für<br />
den Mangel an Familienbildern mit Kindern, da die Nachkommenschaft für den Bestand der Familie<br />
und die Erhaltung von Besitzverhältnissen auch im 4. Jh. v. Chr. keinesfalls an Bedeutung verlor.<br />
S e i t e | 211
S e i t e | 212
1. Die Heirat<br />
I/1. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 03.802<br />
Loutrophoros um 430–420 v. Chr.<br />
Taf. 1 Abb. 1–4<br />
Darstellung:<br />
Hochzeitszug: cheir epi karpo; durch eine<br />
doppelflügelige Tür ist die Hochzeitskline sichtbar;<br />
Nympheutria, weibliche Beifiguren mit Fackeln,<br />
Boxen und Gefäßen, Eroten. Engye(?): Handschlag<br />
zwischen einem bärtigen Mannes mit Zepter und<br />
einem Jünglings in Jäger/Ephebenmontur<br />
Literatur:<br />
Keuls 1985, 118 f. Abb. 102; R. F. Sutton Jr.,<br />
Pornography and Persuasion on Attic Pottery, in:<br />
A. Richlin (Hrsg.), Pornography and Representation<br />
in Greece and Rome (Oxford 1992) 26 f.<br />
Abb. 1, 10; Oakley – Sinos 1993, 36. 51 Abb. 1;<br />
109–111 Abb. 105–107; Fantham 1994, 101 f. Abb.<br />
3, 16; Sutton 2004, 329 Abb. 17, 1; Reeder 1995,<br />
165–168 Nr. 24; Mösch-Klingele 2006, 43. 76–79.<br />
82. 231 Nr. 49 Abb. 40, A. B.<br />
I/2. Athen, Nat. Mus. 14790<br />
Taf. 1 Abb. 5<br />
Lebes Gamikos des Washing-Painter; aus Attika<br />
Darstellung:<br />
Brautschmückung: sitzende Braut mit Haarband;<br />
hinter ihr stützt sich eine Frau mit dem Ellbogen<br />
auf ihre Klismoslehne; Eroten, einer davon mit<br />
Kranz/Kette; weibliche Beifiguren mit Kästchen,<br />
Stoffband, Loutrophoros und Kalathos; weitere<br />
Klismoi, Kästchen, Kalathos.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1126,4; Oakley – Sinos 1993, 17. 64 Abb. 23;<br />
Reinsberg 1993, 55 Abb. 10; V. Sabetai, Aspects of<br />
Nuptial Imagery in Fifth-Century Athens: Issues of<br />
Interpretation and Methodology, in: J. H. Oakley –<br />
W. D. E. Coulson – O. Palagia (Hrsg.), Athenian<br />
Potters and Painters. The Conference Proceedings<br />
(Oxford 1997) 329 f. Abb. 13; Mösch-Klingele<br />
2006, 232 Nr. 58 Abb. 9, A. B.<br />
I/3. St. Petersburg, State Hermitage Mus. ST 1809/<br />
KAB 84/P 1840.44<br />
Taf. 1 Abb. 5<br />
Lekanis der Otcet-Gruppe um 370–360 v. Chr.; aus<br />
Kertsch<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit nacktem Oberkörper, Frauen mit<br />
diversen Objekten wie Spiegel, Kästchen, Bändern,<br />
Exaleiptron, Eros kniet vor einer sitzenden Frau mit<br />
Kästchen; Mobiliar, Gefäße, Vögel<br />
Katalog<br />
Literatur:<br />
ARV² 1499,1; K. Schefold, Untersuchungen zu den<br />
Kertscher Vasen (Berlin 1934) 6. 11; Das Gold der<br />
Skythen und Griechen. Aus der archäologischen<br />
Schatzkammer der Eremitage in St. Petersburg.<br />
Ausstellungskatalog Bonn (Bonn 1997) 148 Nr. 59;<br />
Mösch-Klingele 2006, 234 Nr. 82 Abb. 36.<br />
I/4. Berlin, Antikensammlung F 2372<br />
Taf. 2 Abb. 1<br />
Loutrophoros um 430 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Der Bräutigam hebt seine Braut in den Wagen,<br />
weiter rechts die Eltern des Bräutigams; Eros<br />
bekränzt die Braut mit einem Myrthenkranz.<br />
Literatur:<br />
L. Deubner, Dionysos und die Anthesterien, JdI 42,<br />
1927, 178 f. Abb. 10; H. Rühfel, Kinderleben im<br />
klassischen Athen (Mainz 1984) 112 f. Abb. 64;<br />
Oakley – Sinos 1993, 32. 90 Abb. 72. 73; Reinsberg<br />
1993, 61 f. Abb. 16; Reeder 1995, 171 f. Nr. 27;<br />
Mösch-Klingele 2006, Abb. 57.<br />
I/5. Athen, Nat. Mus. 1629/CC 1528<br />
Taf. 2 Abb. 2. 3<br />
Epinetron des Eretria-Malers um 430–420 v. Chr.;<br />
aus Eretria/Euböa<br />
Darstellung:<br />
A: Hochzeit bzw. Epaulia der Alkestis mit Theo,<br />
Charis, Theamo, Asterope, Hippolyte; die Braut<br />
lehnt an ihrem Brautlager, im Hintergrund eine<br />
große doppelflügelige Tür;<br />
B: Hochzeit der Harmonia mit Aphrodite, Eros,<br />
Peitho, Kore, Hebe und Himeros;<br />
C: Ringkampf zwischen Peleus und Thetis in<br />
Anwesenheit ihres Vaters und der Schwester.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1250,34; 1688; Beazley Addenda² 354;<br />
Beazley Para. 469; A. Lezzi-Hafter, Der Eretria-<br />
Maler. Werke und Weggefährten (Mainz 1988)<br />
253–262. 347 f. Nr. 257 Taf. 168. 169; Oakley –<br />
Sinos 1993, 41. 127 f. Abb. 128. 129; Reinsberg<br />
1993, 69 Abb. 24; H. A. Shapiro, Personifications<br />
in Greek Art. The Representation of Abstract<br />
Concepts 600–400 v. Chr. (Zürich 1993) 105 Abb.<br />
58; Fantham 1994, 98. 101 Abb. 3, 15; A. Lezzi-<br />
Hafter, Licht und Schatten. Zu einem Gesamtkunstwerk<br />
des Eretria-Malers, in: H. Froning – T.<br />
Hölscher – H. Mielsch (Hrsg.) Kotinos. Festschrift<br />
für Erika Simon (Mainz 1995) 228–231 Taf. 48; W.<br />
Oenbrink, Ein „Bild im Bild“-Phänomen. Zur<br />
Darstellung figürlich dekorierter Vasen auf<br />
bemalten attischen Tongefäßen, Hephaistos 14,<br />
1996, 89 Abb. 6; O. Cavalier (Hrsg.), Silence et<br />
Fureur. La femme et le marriage en Grece. Les<br />
S e i t e | 213
antiquites grecques du Musée Calvet (Avignon<br />
1997) 231 Abb. 94–94BIS; B. Borg, Der Logos des<br />
Mythos. Allegorien und Personifika-tionen in der<br />
frühen griechischen Kunst (München 2002) 76 ff.;<br />
Badinou 2003, 1. 17 f. 28. 28. 36–38 Nr. E55 Taf.<br />
29; Mösch-Klingele 2006, 67 f. 233 Nr. 68 Abb. 33;<br />
Heinrich 2006, 20 f. 22. 36 f. 87. 106 f. 115–117<br />
Kat. Nr. Rf. 14 Taf. 16, 4; 17, 1–4;<br />
2. Die Ehefrau als Ehefrau, Hausfrau und<br />
Mutter<br />
II/1. Berlin, Antikensammlung F 2395<br />
Taf. 2 Abb. 4<br />
Hydria um 440–430 v. Chr.; aus Attika<br />
Darstellung:<br />
Amphiaraos, Eriphyle, die dem Alkmaion die Brust<br />
gibt, Tochter Demonassa mit Wollkorb und<br />
Spindel, kämpfendes Hahnenpaar.<br />
Literatur:<br />
CVA Berlin (9) 50–52 Abb. 15 Taf. 26, 1–5; LIMC I<br />
(1981) 697 Nr. 27 Taf. 559 s.v. Amphiaraos (I.<br />
Krauskopf); H. Kammerer-Grothaus, Frauenleben,<br />
Frauenalltag im antiken Griechenland (1984) 17;<br />
F. Lissarague, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.),<br />
Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M.<br />
1993) 212 f. Abb. 27; L. Bonafante, Nursing<br />
Mothers in Classical Art, in: A. O. Koloski-Ostrow<br />
– C. L. Lyons (Hrsg.), Naked Truths. Women,<br />
Sexuality, and Gender in Classical Art and<br />
Archeology (London 1997) 174 f. Anm. 7; Sutton<br />
2004, 345f. Abb. 17, 14.<br />
II/2. Athen, Nat. Mus. 1623A<br />
Taf. 3 Abb. 1–4<br />
Pyxis des Leningrad-Malers um 470/60 v. Chr.; aus<br />
Athen<br />
Darstellung:<br />
Jüngling mit Frucht(?), sitzende Frau mit Spindel<br />
und Wollkorb, Frau mit Wollkorb, Mädchen mit<br />
einem Kleinkind auf den Schultern, Frau mit<br />
Wollballen vor einem Wollkorb, Frau, sitzende<br />
Frau hält ihre ausgebreiteten Arme einem am<br />
Boden krabbelnden Kleinkind entgegen.<br />
Literatur:<br />
Beazley Para. 391.88 BIS; H. Rühfel, Ammen und<br />
Kinderfrauen im klassischen Athen, AW 19, 1988,<br />
49 f. Abb. 10; F. Lissarrague, Intrusioni nel<br />
gineceo, in: P. Veyne – F. Lissarague – F. Frontisi-<br />
Ducroux (Hrsg.) I misteri del gineceo (2000) 154–<br />
156 Abb. 17; Lewis 2002, 81 Abb. 2, 25; Sutton<br />
2004, 341 f. Abb. 17, 12.<br />
II/3. Cambridge, Harvard University, Arthur M.<br />
Sackler Mus. 1960.342<br />
Taf. 3Abb. 5<br />
Hydria der Polygnot-Gruppe um 430 v. Chr.; aus<br />
Vari/Attika<br />
S e i t e | 214<br />
Darstellung:<br />
A: Thrakische Amme nimmt ein männliches Kind<br />
aus den Armen seiner auf einem Klismos<br />
sitzenden Mutter entgegen; hinter dieser steht<br />
ein Jüngling mit Bürgerstock; Webstuhl, Kranz<br />
B: Verfolgungsszene<br />
Literatur:<br />
CVA Baltimore (2) 31 f. Taf. 43,1; D. Williams,<br />
Women on Athenian Vases. Problems of<br />
Interpretation, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.),<br />
Images of Women in Antiquity (London 1983) 93 f.<br />
Abb. 7, 2; Keuls 1985, 73 f. Abb. 58; H. Rühfel,<br />
Ammen und Kinderfrauen im klassischen Athen,<br />
AW 19, 1988, 4. 45 Abb. 3; P. Gkeka, Attike<br />
erythromorphe kalpe, Deltion 47/48, 1992/1993,<br />
247–249 Taf. 46; Reeder 1995, 218 f. Nr. 51; H.<br />
Schulze, Ammen und Pädagogen. Sklavinnen und<br />
Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und<br />
Gesellschaft (Mainz 1998) 22 f. Taf. 3, 2; Lewis<br />
2002, 16 f. Abb. 1, 3; Sutton 2004, 340 Abb. 17, 10;<br />
Bundrick 2008, 316 f. Abb. 13.<br />
II/4. München, Antikensammlungen SL 476<br />
Taf. 3 Abb. 6<br />
Hydria aus dem Umfeld des Klio-Malers um 450–<br />
430 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Frau mit Kästchen, nackter Knabe mit Schlagreifen,<br />
sitzende junge Frau mit Wollkorb und Spindel,<br />
Jüngling mit Bürgerstock.<br />
Literatur: CVA München (5) 27 Taf. 232, 1; 233, 1–<br />
3; 234, 9; E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the<br />
Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.),<br />
Ancient Greek Art and Iconography (Wisconsin<br />
1983) 216f. Abb. 14, 17; O. Cavalier (Hrsg.),<br />
Silence et Fureur. La femme et le marriage en<br />
Grece. Les antiquites grecques du Musée Calvet<br />
(Avignon 1997) 104 Abb. 41; Vidale 2002, 425f.<br />
Abb. 120; L. A. Beaumont, The Changing Face of<br />
Childhood, in: Neils – Oakley 2003, 75f. Abb. 12;<br />
Sutton 2004, 340 f. Abb. 17, 11; Bundrick 2008,<br />
284 Abb. 1; 305 f.<br />
II/5. Athen, Nat. Mus. CC 1552/1588<br />
Taf. 3 Abb. 7; 4 Abb. 1. 2<br />
Pyxis des Phiale-Malers um 430 v. Chr.; aus Attika<br />
Darstellung:<br />
Jüngling nähert sich einer sitzenden Frau, die ein<br />
geöffnetes Kästchen neben sich auf dem Boden<br />
stehen hat, Frau mit Kind, Frau mit Wollkorb, Frau<br />
mit Phiale.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1023,144; Beazley Addenda² 316; S. R.<br />
Roberts, The Attic Pyxis (Chicago 1978) Taf. 77, 2;<br />
J. H. Oakley, The Phiale Painter (Mainz 1990) 90<br />
Nr. 144 Taf. 116. 117; Sutton 2004, 343 f. Abb. 17,<br />
13.
II/6. Athen, Nat. Mus. CC 1231/1250<br />
Taf. 4 Abb. 3<br />
Lebes Gamikos aus dem Umkreis des Neapel-<br />
Malers um 450–430 v. Chr.; aus Attika<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau, Frau mit Kästchen; sitzende Frau<br />
hält einen nackten Knaben auf dem Schoß, junger<br />
Mann; von rechts Frau mit Kalathos und Stoffband;<br />
Kranz und Band an der Wand.<br />
Literatur:<br />
A. Brückner, Athenische Hochzeitsgeschenke, AM<br />
32, 1907, Beil. 1; Sutton 2004, 338 Abb. 17, 8.<br />
II/7. London, British Mus. E 396<br />
Taf. 4 Abb. 4<br />
Pelike des Washing-Painter um 440–420 v. Chr.;<br />
aus Kamiros/Rhodos<br />
Darstellung:<br />
Bärtiger Mann mit Bürgerstock, krabbelndes<br />
Kleinkind, Frau mit ausgestreckten Armen.<br />
Literatur: ARV² 1134, 6; I. Jenkins, Greek and<br />
Roman Life (London 1986) 30. 32 f. Abb. 39; L. A.<br />
Beaumont, The Changing Face of Childhood, in:<br />
Neils – Oakley 2003, 71 f. Abb.; 237 Nr. 37; Sutton<br />
2004, 338 f. Abb. 17, 9.<br />
II/8. Münster, Wilhelms-Univ., Arch. Mus. 66<br />
Taf. 4 Abb. 5<br />
Pelike des Eucharides-Malers um 480/470 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Eine sich gürtende Frau, Knabe auf einem Stuhl,<br />
Jüngling mit Bürgerstock.<br />
B: Aulet mit Mundbinde, Diaulos und<br />
Flötenfutteral, Jüngling<br />
Literatur:<br />
K. P. Stähler, Eine unbekannte Pelike des Eucharidesmalers<br />
im Archäologischen Museum der<br />
<strong>Universität</strong> Münster (Köln 1967) 1–16 Taf. 1–3;<br />
B. Korzus (Hrsg.), Griechische Vasen aus westfälischen<br />
Sammlungen (Münster 1984) 59 f. Nr. 6<br />
Abb. 6a. b.<br />
II/9. Providence (RI), Rhode Island School of<br />
Design 25.088<br />
Taf. 4 Abb. 6. 7<br />
Alabastron des Villa Giulia-Malers um 460–50 v.<br />
Chr.; aus Griechenland<br />
Darstellung:<br />
Frau mit Spiegel, sitzender Jüngling mit<br />
Bürgerstock; Frau mit einem schlafenden Kleinkind<br />
auf dem Arm, älterer Knabe hält sich an ihrem<br />
Gewand fest.<br />
Literatur:<br />
ARV² 624,88; Beazley Addenda² 271; CVA<br />
Providence (1) 29 Taf. 22, 3A. B; Neils – Oakley<br />
2003, 236 Nr. 36, a. b; Badinou 2003, 85 f. 340 Nr.<br />
A 257 Taf. 100.<br />
II/10. Cleveland, Mus. of Art 1925.1342<br />
Taf. 5 Abb. 1<br />
Gralekythos der Lysistrate und des Timophon um<br />
400–375 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Lysistrate und Timophon sind in der Dexiosis<br />
verbunden; zwischen ihnen steht ihre ältere<br />
Tochter, die jüngste, noch ein Kleinkind, wird von<br />
einer Amme/Dienerin im Arm getragen.<br />
Literatur:<br />
J. H. Oakley, Death and the Child, in: Neils –<br />
Oakley 2003, 187 Abb. Cat. 111; 296 Nr. 111;<br />
Clairmont CAT. 3.745; J. Bergemann, Demos und<br />
Thanatos. Untersuchungen zum Wertsystem der<br />
Polis im Spiegel der attischen Grabreliefs des 4.<br />
Jahrhunderts v. Chr. und zur Funktion der<br />
gleichzeitigen Grabbauten (München 1997) 210<br />
Taf. 4, 3. B. Schmaltz, Untersuchungen zu den<br />
attischen Marmorlekythen (Berlin 1970) 37. 42. 47.<br />
95. 101. 111. 131 Nr. A 134.<br />
II/11. London, British Mus. E 193<br />
Taf. 5 Abb. 2<br />
Hydria des Kassler-Malers/aus dem Umfeld des<br />
Klio-Malers; aus Nola/Italien<br />
Darstellung:<br />
Frontal sitzende Frau mit Spindel, Rocken und<br />
Wollkorb wird flankiert von einer Frau mit<br />
Kästchen und einem knabenhaften Jüngling mit<br />
Bürgerstock.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1085,30; Beazley Addenda² 327; CVA<br />
London (5) III Ic 15 Taf. 82, 3.<br />
II/12. London, British Mus. E 215<br />
Taf. 5 Abb. 3<br />
Hydria aus dem Umfeld des Klio-Malers/Maler von<br />
BM E 215 um 450–430 v. Chr.; aus Nola/Italien<br />
Darstellung:<br />
Frau mit Kästchen, auf einem Klismos sitzende<br />
Frau mit Spindel, Spinnrocken und Kalathos,<br />
bärtiger, bekränzter Mann mit Stock; Band<br />
Literatur:<br />
ARV² 1082,1; CVA London (6) III Ic 6 Taf. 89, 7;<br />
Vidale 2002, 424 f. Abb. 119; M. Beard, Adopting<br />
an Approach II, in: N. Spivey – T. Rasmussen<br />
(Hrsg.), Looking at Greek Vases (Cambridge 1991)<br />
22 f. Abb. 4; R. E. Leader, In Death not divided:<br />
Gender, Family, and State on Classical Athenian<br />
Grave Stelae, AJA 101, 1997, 686 f. Abb. 1; 695 f.;<br />
E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the Home<br />
Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient<br />
Greek Art and Iconography (Wisconsin 1983) 216 f.<br />
Abb. 14, 16.<br />
II/13. Athen, Nat. Mus. 2383/CC1590<br />
Taf. 5 Abb. 4. 5<br />
Epinetron des Klio-Malers um 440–30 v. Chr.; aus<br />
Eretria/Euböa<br />
S e i t e | 215
Darstellung:<br />
A: Frau mit Polos, sitzende Frau mit Wollstrang<br />
zwischen den Händen und Kalathos, Frau mit<br />
Kästchen, sitzende Frau<br />
B: Frau, sitzende Frau streckt ihre Hände nach dem<br />
Kästchen aus, das eine weitere Frau heranträgt,<br />
bärtiger und bekränzter Mann mit Stock.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1082,21; ARV² 736, 119; Badinou 2003, 19.<br />
21. 24. 39. 48 Nr. E 46 Taf. 23; Mercati 2003, 57 f.<br />
B1 Taf. 23. 24; Heinrich 2006, 19 f. 22. 37 f. 82. 87<br />
f. 98 f. Kat. Nr. Rf. 19 Taf. 19, 1. 2.<br />
II/14. Karlsruhe, Badisches Landesmus. B 3078I<br />
Taf. 6 Abb. 1<br />
Hydria des Neapel-Malers um 440 v. Chr.; aus<br />
Böotien<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzende Frau, Frau mit Kalathos, Jüngling<br />
B: Nike<br />
Literatur:<br />
CVA Karlsruhe (1) 28 Taf. 22, 1. 2.<br />
II/15. Palermo, Mus. Arch. Reg. (o. Inv.)<br />
o. Abb.<br />
Hydria aus dem Umkreis des Leningrad-Malers<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau, Frauen mit Kalathos und Kästchen,<br />
Jüngling.<br />
Literatur:<br />
A. Adriani, Odeon ed altri monumenti archeologici<br />
(Palermo 1971) Taf. 72, A.<br />
II/16. Gotha, Schlossmus. 64<br />
Taf. 6 Abb. 2–4<br />
Pyxis des Karlsruhe-Malers um 450 v. Chr.; aus<br />
Capua<br />
Darstellung:<br />
A/B: Frauen bei der Toilette und der Wollarbeit,<br />
zwei Jünglinge mit Bürgerstock, einer von ihnen<br />
mit Strigilis<br />
D: Sitzende Frau, stehende Frau, zwei auf ihre<br />
Bürgerstöcke gestützte Jünglinge; Wollkörbe.<br />
Literatur:<br />
CVA Gotha (2) 15 f. Taf. 62, 1. 2; 63, 1. 2.<br />
II/17. New York, Metropolitan Mus. of Art<br />
17.230.15<br />
Taf. 6 Abb. 5; 7 Abb. 1. 2<br />
Hydria des Orpheus-Malers um 440–430 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Frau reicht einem Jüngling mit Bürgerstock ein<br />
Exaleiptron, sitzende, spinnende Frau, Frau mit<br />
Wollkorb und Kästchen, Eros mit Nymphides (?),<br />
sitzende Frau wendet sich einem Jüngling um, der<br />
ihr die Hand auf die Schulter legt, junge Frau mit<br />
Kästchen und eine weibliche Mantefigur.<br />
Inschriften: KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 1104,16; Beazley Addenda² 329; G. M. A.<br />
Richter, Red-Figured Athenian Vases in the<br />
S e i t e | 216<br />
Metropolitan Museum of Art (New Haven 1936)<br />
173 f. Nr. 138 Taf. 140. 141. 172, 138; E. C. Keuls,<br />
Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry,<br />
in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and<br />
Iconography (Wisconsin 1983) 224 Abb. 14, 33;<br />
Lewis 2002, 142 f. Abb. 4, 8; Vidale 2002, 427–429<br />
Abb. 122, A. B; Bundrick 2008, 321 f. Abb. 14.<br />
II/18. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 93.108<br />
Taf. 7 Abb. 3<br />
Pyxis; aus Eretria/Italien<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Wollkorb und Kranz, bärtiger<br />
Mann, zweite Frau; Nike bekränzt Jüngling,<br />
weiterer Jüngling.<br />
Literatur:<br />
S. R. Roberts, The Attic Pyxis (Chicago 1978) 48 f.<br />
Nr. 12 Taf. 27.<br />
II/19. San Simeon, Hearst Coll. 9933 o. Abb.<br />
Hydria des Leningrad-Malers<br />
Darstellung:<br />
Sitzender Jüngling, Frau mit Eimer, sitzende Frau<br />
mit Spindel sitzt einer weiteren sitzenden Frau<br />
gegenüber, abgewandt sitzender Jüngling; Säulen<br />
Literatur:<br />
ARV² 571,81.<br />
II/20. Palermo, Mormino Coll. 818<br />
Taf. 7 Abb. 4. 5<br />
Skyphos des Phiale-Malers um 430/20 v. Chr.; aus<br />
Selinunt<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzende Frau mit Brautschleier und<br />
Diadem/Kranz verarbeitet Wolle; Band<br />
B: Jüngling mit Kranz und Bürgerstock; Tür<br />
Literatur:<br />
J. H. Oakley, The Phiale Painter (Mainz 1990) 92<br />
Nr. 154ter Taf. 131, D; 132, C. D; Reeder 1995, 72<br />
Abb. 20.<br />
II/21. Würzburg, Martin-von-Wagner Mus. L 546/<br />
546<br />
Taf. 7 Abb. 6–8<br />
Alabastron um 460 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Bärtiger Mann mit Bürgerstock, eine in den Mantel<br />
gehüllte Frau mit Kalathos, Diphros.<br />
Literatur:<br />
U. Knigge, Ein rotfiguriges Alabastron, AM 79,<br />
1964, 110 f.; I. Scheibler, Griechische Töpferkunst.<br />
Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken<br />
Tongefäße ²(München 1995) 25 Abb. 19; Badinou<br />
2003, A 246 Taf. 96.<br />
II/22. Hannover, Kestner Mus. L 1.1982<br />
Taf. 8 Abb. 1<br />
Schale des Douris um 490–480 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: sich unterhaltende und gestikulierende Männer<br />
und Jünglinge
I: Bärtiger Mann mit Bürgerstock und Frau mit<br />
Spindel; hinter ihr steht auf einem Diphros ein<br />
Kalathos, zweiter Diphros, an der Wand<br />
Athletenutensilien.<br />
Literatur:<br />
ARV² 437,115; D. Buitron-Oliver, Douris. A<br />
Master-Painter of Athenian Red-Figure Vases<br />
(Mainz 1995) 28. 82. Nr. 154 Taf. 90; Vidale 2002,<br />
407 f. Abb. 110.<br />
II/23. Athen, M. Vlasto –<br />
Taf. 8 Abb. 2<br />
Alabastron des Karlsruhe-Malers um 450 v.; aus<br />
Athen<br />
Darstellung:<br />
Jüngling mit Bürgerstock, Frau mit Spiegel, Reiher,<br />
Säule.<br />
Literatur:<br />
ARV² 735,108; Badinou 2003, 92 Nr. A 336 Taf.<br />
119.<br />
II/24. Basel, Antikenmuseum und Sammlung<br />
Ludwig BS 490<br />
Taf. 8 Abb. 3<br />
Schale des Euaion-Malers um 450 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Frau im Gespräch mit einem Jüngling mit Pyxis;<br />
gestikulierende Frau wendet sich um zu einem<br />
bärtigen Mann; Frau mit Exaleiptron<br />
B: Frau mit Spendekanne und Phiale adressiert<br />
einen Jüngling, nach links eilende Frau wendet<br />
sich um zu einem Jüngling, der sie mit der<br />
ausgestreckten Rechten an der Schulter berührt;<br />
Frau ordnet ihr Himation<br />
I: Sitzende Frau mit Sakkos, Blüte und Spiegel,<br />
stehender Jüngling mit Bürgerstock; Band an<br />
der Wand.<br />
Literatur:<br />
ARV² 795,102; Beazley Addenda² 143; CVA Basel,<br />
Antikenmuseum und Sammlung Ludwig (2) 46 f.<br />
Taf. 26, 2; 27, 1–4; 37, 2. 6; 39, 11.<br />
II/25. <strong>Erlangen</strong>, Antikensammlung I 303<br />
Taf. 8 Abb. 4<br />
Nolanische Amphora des Phiale-Malers um<br />
440/430 v. Chr.; aus Nola<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzende Frau; stehender Jüngling mit<br />
Bürgerstock und Kranz; Schreibtafel/Kästchen?<br />
B: nach links gewandte Frau im Mantel<br />
Literatur:<br />
ARV² 1016, 39; W. Grünhagen, Archäologisches<br />
Institut der <strong>Universität</strong> <strong>Erlangen</strong>. Antike Originalarbeiten<br />
in der Kunstsammlung des Instituts (<strong>Nürnberg</strong><br />
1948) 45 Taf. 15; J. H. Oakley, The Phiale<br />
Painter (Mainz 1990) 72 Nr. 39 Taf. 21, B; M. Boss<br />
– P. Kranz – U. Kreilinger (Hrsg.), Antikensammlung<br />
<strong>Erlangen</strong>. Auswahlkatalog (<strong>Erlangen</strong> 2002) 74<br />
f. Nr. 28.<br />
II/26. London, British Mus. E339<br />
Taf. 8 Abb 5. 6<br />
Halsamphora nach Art des Malers von London<br />
E342 um 475–425 v. Chr.; aus Nola<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzende Frau mit Bällen oder Früchten; Vogel<br />
B: Manteljüngling mit Bürgerstock<br />
Literatur:<br />
ARV² 670.11; CVA London, British Mus. (5) III I c<br />
9, Taf. 67, 1A. B.<br />
II/27. Boston, Mus. of Fine Arts 13.84<br />
o. Abb.<br />
Schale des Penthesileia-Malers<br />
Darstellung:<br />
A/B: Satyrn und Mänaden<br />
I: Frau auf Diphros mit zwei Bällen/Früchten;<br />
Jüngling mit Bürgerstock; Kalathos, Band<br />
Literatur:<br />
ARV² 883,61.<br />
II/28. Kopenhagen, Nat. Mus. 149/Chr. VIII 810<br />
Taf. 9 Abb. 1<br />
Pelike des Kleophrades-Malers<br />
Darstellung:<br />
A: Auf einem Hocker mit Löwentatzen sitzender<br />
Jüngling mit Bürgerstock und Phiale, stehende<br />
Frau mit Kanne und Blüte/Zweig; beide<br />
bekränzt<br />
B: Zwei Athleten in der Palästra: der eine lehnt an<br />
einem Pfeiler, der andere legt seinen Mantel ab;<br />
beide bekränzt<br />
Literatur:<br />
ARV² 184,27; Beazley Para. 340; CVA<br />
Kopenhagen, Nat. Mus. (3) 106 Taf. 133.<br />
II/29. Berlin, Antikensammlung 31426<br />
Taf. 9 Abb. 2–4<br />
Schale Schale des Euaion-Malers um 470 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzende Frau mit Spindel in Frontalansicht,<br />
Frau mit Alabastron und Jüngling, Jüngling und<br />
Frau mit Kästchen<br />
B: Frau und Mann, Frau mit eiförmigem<br />
Gegenstand und Jüngling, Frau mit<br />
Spendeschale und Krug<br />
I: Frau und Jüngling mit Stock, Diphros<br />
Literatur:<br />
ARV² 1702; 795,100; Beazley Addenda² 290; CVA<br />
Berlin (2) 40 Taf. 98, 1–4; CVA Berlin (3) 20 Taf.<br />
130, 4. 8; 134, 11; E. C. Keuls, Attic Vase-Painting<br />
and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon<br />
(Hrsg.) (Hrsg.), Ancient Greek Art and Iconography<br />
(Wisconsin 1983) 228 f. Abb. 14, 41; W.-D.<br />
Heilmeyer et al., Antikenmuseum Berlin. Die<br />
ausgestellten Werke (Berlin 1988) 142 f. Nr. 5;<br />
Reinsberg 1993, 122 Abb. 66; F. Frontisi-Ducroux<br />
– J.-P. Vernant, Dans l´oeil du miroir (Paris 1997)<br />
Taf. 29; Davidson 1999, 209 Abb. o.; Bundrick<br />
2008, 297 f. Abb. 6.<br />
S e i t e | 217
II/30. Vatikan, Mus. Gregoriano Etrusco 16581<br />
Taf. 9 Abb. 5<br />
Schale des Makron<br />
Darstellung:<br />
A: Sich verschleiernde Frau, zwei sich unterhaltende<br />
Paare; Würfelhocker, Wollkorb<br />
B: Auf einem Diphros sitzender alter Mann mit<br />
Stirnglatze, flüchtende Frau, bärtiger Mann mit<br />
Knotenstock, Frau mit Diaulos, bärtiger Mann;<br />
Flötenetui, Diphros<br />
I: Sich ver- oder entschleiernde Frau, Jüngling<br />
Literatur:<br />
ARV² 469,154; Sutton 1981, 399 Nr. G 49; Kunisch<br />
1997, 79 f. 117. 196 Nr. 334 Taf. 111, 334.<br />
II/31. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Mus.<br />
AT 263 Taf. 9Abb. 6<br />
Schale des Malers von Brüssel R330 um 475–425<br />
v. Chr.; aus Ephesos (?)<br />
Darstellung:<br />
A: Frau im Mantel zwischen zwei Jünglingen mit<br />
Bürgerstöcken; Schild, Schwertscheide, Sandale<br />
B: Frau mit Fackel zwischen zwei Jünglingen mit<br />
Bürgerstöcken; Sandale<br />
I: Frau im Himation, Jüngling mit Bürgerstock;<br />
Kranz/Binde, Fels/Altar<br />
Literatur:<br />
ARV² 925,6; CVA Braunschweig, Herzog Anton<br />
Ulrich-Museum 27 Taf. 18, 1–5, 19.11.<br />
II/32. Florenz, Mus. Arch. PD266<br />
Taf. 10 Abb. 1<br />
Schale des Splanchnopt-Malers um 460–50 v. Chr.;<br />
Darstellung:<br />
A: Frau mit Alabastron, Frau mit<br />
Gewandraffgestus, zwei Jünglinge; Schild,<br />
Schwertscheide<br />
B: Verhüllte Frau mit Jüngling, Frau mit<br />
Alabastron, Manteljüngling; Sandale<br />
I: Frau und Jüngling mit Bürgerstock; Geldbeutel,<br />
Altar<br />
Literatur:<br />
ARV² 892,11; CVA Florenz, Museo Archeologico<br />
(3) III I 19 Taf. 112, 1–3.<br />
3. Werben und Schenken in der Antike<br />
III/1. Toledo(OH), The Toledo Mus. of Art 72.55/<br />
1972.55<br />
Taf. 10 Abb. 2. 3<br />
Schale des Makron um 490–480 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Jüngling mit Geld und Blüte, Frau auf einem<br />
Klismos mit je einer Blüte in den Händen, Mann<br />
mit Geld, Frau mit Blüte (?); Athletenutensilien,<br />
Flötenetui<br />
B: Frau mit Diaulos und Blüte, Mann mit<br />
Knotenstock, sitzende Frau mit Kranz, Mann<br />
S e i t e | 218<br />
mit Blüte und Knotenstock; Spiegel, Athletenutensilien<br />
I: Frau mit Kanoun gießt Wein aus einer Oinochoe<br />
auf einen brennenden Altar; Weihrauchständer<br />
Literatur:<br />
CVA Toledo (1) 34. 48 Abb. 13 Taf. 53, 1. 2; 54, 1.<br />
2; Keuls 1985, 167 f. Abb. 141. 142. 227 Abb. 204;<br />
Sutton 1981, 291 f. 296. 398 Nr. G 46; E. C. Keuls,<br />
Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry,<br />
in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and<br />
Iconography (Wisconsin 1983) 225 f. Abb. 14, 34;<br />
M. Beard, Adopting an Approach II, in: N. Spivey –<br />
T. Rasmussen (Hrsg.), Looking at Greek Vases<br />
(Cambridge 1991) 28–30 Abb. 7. 8; Kilmer 1993,<br />
AT P. 146, R 630; Reeder 1995, 183–187 Nr. 38; 1;<br />
S. von Reden, Exchange in Ancient Greece (London<br />
1995) Taf. 5, A. B; Kunisch 1997, 11. 30. 32. 67. 43<br />
Ab. 2. 15. 17. 21. 30 Taf. 64. 179; B. Cohen<br />
(Hrsg.), Not the Classical Ideal. Athens and the<br />
Construction of the Other in Greek Art (Leiden<br />
2000) 218 Abb. 8, 7.<br />
III/2. Paris, Cabinet des Médailles 508<br />
Taf. 10 Abb. 4. 5<br />
Alabastron um 480–460 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Auf einem Diphros sitzende Frau mit Kranz und<br />
Kalathos, kleines Mädchen mit Alabastron,<br />
Jüngling mit Bürgerstock und Stoffband.<br />
Inschriften: TIMODEMOS KALOS; HE NYMPHE<br />
KALE<br />
Literatur:<br />
ARV² 1610; M. Reilly, ”Mistress and Maid” on<br />
Athenian Lekythoi, Hesperia 58, 1989, Taf. 80, A F.<br />
Lissarague, Frauenbilder, in: P. Schmitt Pantel<br />
(Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt<br />
a. M. 1993) 195 f. Abb. 12; O. Cavalier (Hrsg.),<br />
Silence et Fureur. La femme et le marriage en<br />
Grece. Les antiquites grecques du Musée Calvet<br />
(Avignon 1997) 259 Abb. 99; Lewis 2002, 29. 32<br />
Abb. 1, 16; Badinou 2003, 89 f. Nr. A 255 Taf. 98.<br />
III/3. Würzburg, Martin-von-Wagner Mus 506/ L<br />
506<br />
Taf. 10 Abb. 6<br />
Loutrophoros des Malers von Würzburg 537<br />
Darstellung:<br />
Brautpaar vor Kline, Frauen mit Fackel und<br />
Kalathos<br />
Literatur:<br />
ARV² 1224,2; Reinsberg 1993, 79 Abb. 31.<br />
III/4. Berlin, Antikensammlung F 2252<br />
Taf. 11 Abb. 1<br />
Weißgrundige Lekythos des Syriskos-Malers; aus<br />
dem Athener Kerameikos<br />
Darstellung:<br />
Auf einem Klismos mit Fußschemel sitzende Frau<br />
reicht einem Mann mit Bürgerstock einen Kranz;<br />
auf ihren Knien sitzt ein Vogel; Kalathos,<br />
Alabastron, Spiegel.
Inschriften: OLYNPICHOS KALOS; KALOS;<br />
Literatur:<br />
ARV² 263,54; 1603; 1641; Beazley Addenda² 205;<br />
Beazley Para. 351; D. C. Kurtz, Ahenian White<br />
Lekythoi. Patterns and Painters (London 1975) 127<br />
f. Taf. 8, 1, A. B; S. von Reden, Exchange in Ancient<br />
Greece (London 1995) Taf. 7, C. D; A. Kauffmann-<br />
Samaras, Des femmes et des oiseaux. La perdrix<br />
dans le gynécée, in: B. Schmaltz – M. Söldner<br />
(Hrsg.), Griechische Keramik im kulturellen Kontext.<br />
Akten des Internationalen Vasen-Symposions<br />
in Kiel vom 24.–28.9.2001 (Münster 2003) 91;<br />
N. Strawczynski, Lecture Anthropologique et/ou<br />
documentaire? Quelches remarques sur un livre de<br />
Panayota Badinou, La Laine et le Parfum, RA<br />
2005, 312 Abb. 1.<br />
III/5. Cambridge (MA), Harvard Univ., Arthur<br />
Sackler Mus. 1972.45<br />
Taf. 11 Abb. 2<br />
Halsamphora des Providence-Malers um 480–470<br />
v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Auf einem Klismos sitzende Frau mit Kalathos<br />
überreicht einem bärtigen Mann mit<br />
Bürgerstock, der zwischen den Fingerspitzen<br />
seines erhobenen Armes eine Blüte(?) hält,<br />
einen Kranz.<br />
B: Bärtiger Mann mit Bürgerstock<br />
Literatur:<br />
ARV² 638,43; Beazley Addenda² 273; Reeder 1995,<br />
182 f. Nr. 37.<br />
III/6. Paris, Cabinet des Medailles 507<br />
Taf. 11 Abb. 3<br />
Alabastron der Gruppe Athen 2025/ des Malers von<br />
Kopenhagen 3830<br />
Darstellung:<br />
Jüngling mit Kranz oder Kette, Frau mit<br />
Granatapfel; Jungfernkranich, Hund, Korb<br />
Literatur:<br />
ARV² 723,2; E. Böhr, Mit Schopf an Brust und<br />
Kopf. Der Jungfernkranich, in: A. J. Clark – J.<br />
Gaunt – B. Gilman (Hrsg.), Essays in Honor of<br />
Dietrich von Bothmer (Amsterdam 2002) 43 Abb. 1.<br />
III/7. Berkeley (CA), University of California<br />
8.923<br />
Taf. 11 Abb. 4. 5<br />
Schale des Klinik-Malers; aus Orvieto<br />
Darstellung:<br />
A: Frau mit Alabastron zwischen zwei Jünglingen<br />
mit Bürgerstöcken<br />
B: Frau mit Spiegel zwischen zwei Jünglingen mit<br />
Bürgerstöcken<br />
I: Frau mit Blüte am Altar<br />
Literatur:<br />
ARV² 808; 810, 22; CVA Univ. of California (1) 41<br />
Taf. 35, 1A–C.<br />
III/8. Florenz, Mus. Arch. 81602<br />
Taf. 11 Abb. 6<br />
Schale aus dem Umfeld des Klinik-Malers um 470–<br />
460 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Frau mit Kalathos und Spindel zwischen zwei<br />
Jünglingen mit Bürgerstöcken, von einer eine<br />
Blüte hält.<br />
B: Frau mit Spiegel oder Spindel zwischen zwei<br />
Jünglingen mit Bürgerstöcken.<br />
I: Jüngling mit Bürgerstock und Kylix.<br />
Literatur:<br />
ARV² 808; 810,24; CVA Florenz (3) 15 f. Taf. 103,<br />
1–3; 116, 21.<br />
III/9. Athen, Nat. Mus. 2180<br />
Taf. 11 Abb. 7. 8<br />
Epinetron des Malers von Berlin 2624 um 420/10 v.<br />
Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Zwei gemischte Paare: Frau mit Alabastron,<br />
Frau mit Band, zwei Jünglinge mit Bürgerstock<br />
B: Jüngling zwischen zwei Frauen, eine mit<br />
Alabastron<br />
Literatur:<br />
ARV² 1225,2; Badinou 2003, 27. 51. 150 Nr. E 49<br />
Taf. 26; Mercati 2003, 139 Nr. B8 Taf. 28.<br />
III/10. Rhodos, Mus. Arch. 13261<br />
Taf. 12 Abb. 1<br />
Hydria des Leningrad-Malers aus der 1. Hälfte<br />
des 5. Jhs. v. Chr.; aus Kamiros/Rhodos<br />
Darstellung:<br />
Frauen bei der Wollarbeit flankiert von zwei<br />
Jünglingen, von denen einer ein Fleischstück trägt.<br />
Literatur:<br />
ARV² 571,82; CVA Rodi (2) III I c 1 Taf. 5, 3; E. C.<br />
Keuls, Attic Vase-Painting and the Home Textile<br />
Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.) (Hrsg.), Ancient<br />
Greek Art and Iconography (Wisconsin 1983) 226 f.<br />
Abb. 14, 37; Vidale 2002, 444–447 Abb. 133;<br />
Mercati 2003, 24.<br />
III/11. Chiusi, Mus. Arch. Naz. 1835<br />
Taf. 12 Abb. 2<br />
Schale des Malers von Brüssel R 330 (Außenseiten)<br />
und des Malers von Orvieto 191A (Innenseite); aus<br />
Chiusi<br />
Darstellung:<br />
A: Frau mit Fleischstück zwischen zwei Jünglingen<br />
mit Bürgerstöcken; Schreibtablett<br />
B: Frau mit Fackel zwischen zwei Jünglingen mit<br />
Bürgerstöcken<br />
I: Zwei Manteljünglinge, Athletenutensilien<br />
Literatur:<br />
ARV² 926,21; 938,14; Beazley Addenda² 306; CVA<br />
Chiusi (2) 14 Taf. 27, 1–4; 28, 1. 2.<br />
S e i t e | 219
III/12. South Hadley (MA), Mount Holyoke<br />
College 1932.BSII5<br />
Taf. 12 Abb. 3<br />
Pyxis des Veji-Malers um 450 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Frau mit Spiegel und Alabastron (?), Frau mit<br />
Kalathos und Wollknäuel, Jüngling mit Wollknäuel<br />
und Fleischstück; Tür<br />
Literatur:<br />
ARV² 906,109; Beazley Addenda² 303; S. R.<br />
Roberts, The Attic Pyxis (Chicago 1978) 49 Nr. 13<br />
Taf. 30, 1; 34, 1; Lewis 2002, 185 f. Abb. 5, 9;<br />
Bundrick 2008, 306 f. Abb. 10.<br />
III/13. Athen, Kerameikos Mus. 2713<br />
Taf. 12 Abb. 4–6<br />
Alabastron um 500–490 v. Chr.; aus dem<br />
Kerameikos/<br />
Athen<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzende Spinnerin, Jüngling mit Hase<br />
B: Frau und Jüngling in Umarmung<br />
Literatur:<br />
Beazley Addenda² 172; Beazley Para. 331; U.<br />
Knigge, Ein rotfiguriges Alabastron, AM 79, 1964,<br />
105–113; Koch-Harnack 1983, 129 f. 132 Abb. 63.<br />
64; Badinou 2003, 5. 93 f. 179 Nr. A 136 Taf. 80.<br />
III/14. Palermo, Mormino Coll. 796<br />
Taf. 13 Abb. 1–3<br />
Weißgrundiges Alabastron des Malers von<br />
Kopenhagen 3830<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau überreicht Hahn/Henne an einen<br />
Jüngling mit Bürgerstock; Hund; Kranich; Band,<br />
Korb an der Wand<br />
Literatur:<br />
CVA Palermo, Collezione Mormino (1) III Y 3 Taf.<br />
1, 1–4.<br />
III/15. Athen, Nat. Mus. 1239/CC1204<br />
Taf. 13 Abb. 4–6<br />
Alabastron der Gruppe der Paidikos Alabastra; aus<br />
Athen<br />
Darstellung:<br />
Jüngling in Begleitung eines Knaben mit Vögeln<br />
und einem Oktopus, spinnende Frau;<br />
Inschrift: PROSAGOREUO<br />
Literatur:<br />
ARV² 101, 3; 103; 16; CVA Athen, Nat. Mus. (1) III<br />
I c 3 Taf. 1, 3–5; A. Brückner, Lebensregeln auf<br />
athenischen Hochzeitsgeschenken, WPrBerl 62,<br />
1902, 3–11; U. Knigge, Ein rotfiguriges Alabastron,<br />
AM 79, 1964, 10 f. Beil. 57, 3. 4; Davidson<br />
1999, 207 Abb. o.<br />
III/16. Baltimore, Johns Hopkins Univ. B 4<br />
Taf. 13 Abb. 7<br />
Schale des Phintias um 510–500 v. Chr.; aus Chiusi<br />
S e i t e | 220<br />
Darstellung:<br />
I: Jüngling mit Geld und Bürgerstock auf dem<br />
Töpfermarkt; Halsampora, Glockenkrater,<br />
Schale, Diphros<br />
Inschriften: PHIN[TI]AS EGRAPHSEN,<br />
CHAIRIAS KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 24,14; Beazley Addenda² 155; CVA Baltimore<br />
(2) 12 f. Taf. 2, 1; 3, 2; Keuls 1985, 260. 263 Abb.<br />
240; Meyer 1988, 114 f. Abb. 28; S. von Reden<br />
Exchange in Ancient Greece (London 1995) 210 f.<br />
Taf. 8, B; I. Scheibler, Griechische Töpferkunst.<br />
Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken<br />
Tongefäße ²(München 1995) 135 Abb.; 137. 143 f.<br />
III/17. Kopenhagen, Nat. Mus. 320/125<br />
Taf: 13 Abb. 8<br />
Amphora des Kopenhagen-Malers; aus Vulci<br />
Darstellung:<br />
A: Mann mit Bürgerstock , kleiner Sklavenknabe<br />
mit negroiden Zügen und geschultertem Korb<br />
B: Jüngling mit Geld vor einer Amphora<br />
Literatur:<br />
ARV² 256,1; Beazley Addenda² 204; I. Scheibler,<br />
Bild und Gefäß, JdI 102, 1987, 74 f. Abb. 9A. B;<br />
Meyer 1988, 114 f. Abb. 29; C. M. Robertson, The<br />
Art of Vase-Painting in Classical Athens<br />
(Cambridge 1992) 139 Abb. 142; S. v. Reden<br />
Exchange in Ancient Greece (London 1995) 210<br />
Taf. 8, A; M. C. Miller, Athens and Persia in the<br />
Fifth Century BC. A Study in Cultural Receptivity<br />
(Cambridge 1997) Taf. 138.<br />
III/18. Paris, Musée du Louvre CA 1852<br />
Taf. 14 Abb. 1. 2<br />
Amphora aus dem Umfeld des Boreas-Malers; aus<br />
Griechenland<br />
Darstellung:<br />
A: Mann mit Bürgerstock und Geld ersteht eine<br />
Amphora von einem bärtigen Verkäufer<br />
B: Manteljüngling mit Amphora, verhüllter Mann<br />
mit Bürgerstock<br />
Literatur:<br />
ARV² 540,4; CVA Paris, Musée du Louvre (8) III I d<br />
26 Taf. 38, 1. 2; J. Bazant, Les citoyens sur les<br />
vases atheniens, Rocnik 95, 1985, 2 Taf. 37, 62; I.<br />
Scheibler, Bild und Gefäß, JdI 102, 1987, 74 f. Abb.<br />
10; S. v. Reden Exchange in Ancient Greece<br />
(London 1995) 211 Taf. 8, C. D.<br />
III/19. Oxford, Privatsammlung (o. Inv.)<br />
Taf. 14 Abb. 3<br />
Schale des Douris; aus Griechenland<br />
Darstellung:<br />
I: Jüngling mit Geldbeutel auf dem Weinmarkt;<br />
Amphora, Zisterne, Oinochoe<br />
Inschrift: TDIKOTYLOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 445,252; Beazley Addenda² 241,1; D.<br />
Buitron-Oliver, Douris. A Master-Painter of
Athenian Red-Figure Vases (Mainz 1995) 27. 44.<br />
71. 81 Nr. 142 Taf. 83; Davidson 1999, 206 Abb. o.<br />
III/20. ehem. Dresden, Kunstgewerbemus.<br />
Taf. 14 Abb. 4<br />
Schale des Douris<br />
Darstellung:<br />
A: Zwei bärtige Männer umwerben Knaben mit<br />
Hasengeschenken, weiterer bärtiger Mann;<br />
Hunde<br />
B: Bärtiger umwirbt einen Knaben mit einem<br />
Hasengeschenk; bärtiger Mann und ein<br />
Jüngling, wohl ein Athlet, mit Siegeskranz,<br />
bärtiger Mann; Athletenutensilien<br />
I. Bärtiger Mann mit Geldbeutel,<br />
Athletenutensilien, Diphros<br />
Inschrift: CHAIRESTRATOS KALOS; DORIS<br />
EGRAPHSEN<br />
Literatur:<br />
ARV² 1569; 430,33; Beazley Addenda² 236;<br />
Reinsberg 1993, 185 Abb. 103; J. Neils, The<br />
Panathenaia and Kleisthenic Ideology, in: W. D. E.<br />
Coulson et al.(Hrsg.), The Archaeology of Athens<br />
and Attica under the Democracy (Oxford 1994) 157<br />
Abb. 10. 11; D. Buitron-Oliver, Douris. A Master-<br />
Painter of Athenian Red-Figure Vases (Mainz<br />
1995) 21. 42. 76. Nr. 56 Taf. 40.<br />
III/21. Newcastle upon Tyne, Shefton Mus. (o. Inv.)<br />
o. Abb.<br />
Schale des Splanchnopt-Malers<br />
Darstellung:<br />
A/B: Frauen und Jünglinge im Gespräch<br />
I: Jüngling mit Bürgerstock und eine junge Frau<br />
neben einem Altar; zwischen beiden hängt ein<br />
Geldsäckchen.<br />
Literatur:<br />
ARV² 892,10BIS; Beazley-Archiv.<br />
III/22. Rom, Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia (o. Inv.)<br />
o. Abb.<br />
Schale des Malers der Pariser Gigantomachie<br />
Darstellung:<br />
I: Jüngling lässt seinen Geldbeutel über einem<br />
Altar baumeln; kugeliger Korb und<br />
Flötenfutteral.<br />
Literatur:<br />
ARV² 423,118; Beazley-Archiv.<br />
III/23. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek<br />
I. N. 2718<br />
Taf. 14 Abb. 5<br />
Skyphos des Splanchnopt-Malers um 460–450 v.<br />
Chr.; aus Orvieto<br />
Darstellung:<br />
Junge fliehende Frau mit abwehrendem<br />
Handgestus(?) und das Gewand raffend blickt sich<br />
nach einem Jüngling mit Bürgerstock um;<br />
Geldbeutel an der Wand.<br />
Inschrift: (etrusk.) cavuthas sexis; Nennung des<br />
Besitzers (?)<br />
Literatur:<br />
CVA Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek (1) 84<br />
f. Abb. 38 Taf. 65, 3. 4; 66, 2; M. Cristofani,<br />
Celeritas solis filia, in: H. Froning – T. Hölscher –<br />
H. Mielsch (Hrsg.) Kotinos. Festschrift für Erika<br />
Simon (Mainz 1995) 348 f. Taf. 77, 2.<br />
III/24. Berlin, Antikensammlung F 2254<br />
Taf. 14 Abb. 6. 7<br />
Alabastron des Pan-Malers; aus Pikrodaphni/Attika<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Spinnrocken und Spindel,<br />
Jüngling mit Bürgerstock und Geldbeutel, Dienerin<br />
mit Wollkorb und Spiegel; Lekythos, Spiegel an der<br />
Wand.<br />
Literatur:<br />
ARV² 557,123; Beazley Para. 387; J. D. Beazley,<br />
Der Pan-Maler (Berlin 1931) 24 f. Nr. 59Taf. 29, 1;<br />
G. Rodenwaldt, Spinnende Hetären, AA 1931, 15<br />
Abb. 3; E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the<br />
Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.)<br />
(Hrsg.), Ancient Greek Art and Iconography<br />
(Wisconsin 1983) 227 Abb. 14, 39; Keuls 1985, 260<br />
f. Abb. 238; Meyer 1988, 110 f. Abb. 23, A. B;<br />
Reinsberg 1993, 121 f. Abb. 65, A. B; S. v. Reden<br />
Exchange in Ancient Greece (London 1995) 207<br />
Taf. 7, C. D; Davidson 1999, 208 Abb. o.; S.<br />
Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen.<br />
Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v. Chr.<br />
(Berlin 2005) 261 Abb. 129; Bundrick 2008, 299 f.<br />
III/25. Athen, Nat. Mus. 1441/CC 1277<br />
Taf. 15 Abb. 1<br />
Pelike des Polygnot; aus Rhodos<br />
Darstellung:<br />
A: Jüngling mit Bürgerstock reicht einer sitzenden,<br />
in ihr Himation eingehüllten Frau einen<br />
Geldbeutel, Frau mit Exaleiptron; Kalatos, Band<br />
B: Jüngling, Knabe<br />
Literatur:<br />
ARV² 1032,56; Beazley Addenda² 318; S. B.<br />
Matheson, Polygnotos and Vase Painting in<br />
Classical Athens (Wisconsin 1995) 61 f. 359 Nr.<br />
P61 Taf. 48.<br />
III/26. Heidelberg, Ruprecht-Karls-<strong>Universität</strong>,<br />
Arch. Institut 64.5<br />
Taf. 15 Abb. 2<br />
Kalpis des Nausikaa-Malers um 440–430 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Bärtiger Mann mit Geldbeutel steht hinter einer<br />
sitzenden Frau mit Spindel, Frau mit Band, Frau<br />
balanciert eine Hydria auf dem Kopf;<br />
Handwebrahmen, Sakkos(?) an der Wand.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1121,14; R. Hampe et al., Neuerwerbungen<br />
1957–70: <strong>Universität</strong> Heidelberg (Mainz 1971) Taf.<br />
57; E. Keuls, “The Hetaira and the Housewife”.<br />
The Splitting of the Female Psyche in Greek Art,<br />
MededRom N.S. 9/10, 1983, 33 f. Taf. 5, 11; Keuls<br />
1985, 262–264. 266 Abb. 244; V. Strocka, Alltag<br />
S e i t e | 221
und Fest in Athen, griechische Vasen zur<br />
Ausstellung (Freiburg 1987) 30 f. Nr. 13; Lewis<br />
2002, 35 f. Abb. 1, 19; Vidale 2002, 419 f. Abb.<br />
116.<br />
III/27. Agrigent, Mus. Arch. Reg. AG 22276<br />
Taf. 15 Abb. 3<br />
Hydria des Hephaistos-Malers um 450 v. Chr.; aus<br />
Agrigent/Pezzino Grab 592<br />
Darstellung:<br />
Verhüllte Frau, zwei Jünglinge, einer mit<br />
Geldbeutel; sitzende Frau mit Handwebrahmen und<br />
Wollkorb, Jüngling; Sakkos, Kranz an der Wand<br />
Literatur:<br />
E. de Miro, Agrigento, la necropoli greca di<br />
Pezzino (Messina 1989) Taf. 57, 2. 3; T. Mannack,<br />
The late Mannerists in Athenian Vase-Painting<br />
(Oxford 2001) 135 Nr. H.56; G. Giudice, Il tornio,<br />
la nave, le terre lontane. Ceramografi attici in<br />
Magna Grecia nella seconda metà del V sec. a. C.<br />
rotte e vie di distribuzione (Rom 2007) 119 Nr. 199<br />
Abb. 117.<br />
III/28. Krakau, Mus. Czartoryski 1473<br />
Taf. 15 Abb. 4<br />
Hydria des Hephaistos-Malers<br />
Darstellung:<br />
Nach links eilender Jüngling, Frau mit Kalathos<br />
und ausgestreckten Armen wendet sich an einen<br />
Jüngling mit Geld, weiterer Jüngling; Säule<br />
Literatur:<br />
CVA Krakau (1) III Id 11 Taf. 12, 2.<br />
III/29. Basel, Kunsthandel, Münzen und Medaillen<br />
A.G.<br />
Taf. 15 Abb. 5. 6<br />
Schale des Telephos-Malers um 470–460 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Bärtiger Mann überreicht einer sitzenden Frau<br />
einen Geldbeutel, Jüngling mit Bürgerstock;<br />
Säule mit Gebälk, Kalathos auf einem Podest.<br />
B: Frau streckt einem Manteljüngling einen<br />
Skyphos entgegen; hinter ihr sitzt auf einem<br />
Klismos ein bärtiger Mann mit Bürgerstock; an<br />
der Wand Sakkos und kugeliger Korb mit<br />
Stoffbändern.<br />
I: Sitzender bärtiger Mann mit Bürgerstock und<br />
Phiale/Teller vor einem Tisch.<br />
Literatur:<br />
MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 26,<br />
5.10.1963 (Basel 1963) 73 f. Nr. 139 Taf. 50; J.<br />
Bazant, Les citoyens sur les vases atheniens, Rocnik<br />
95, 1985, 30 Abb. 7.<br />
III/30. Rom, Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia<br />
1054<br />
Taf. 16 Abb. 1<br />
Kolonettenkrater des Harrow-Malers um 480–460 v.<br />
Chr.; aus Falerii/Italien<br />
S e i t e | 222<br />
Darstellung:<br />
A: Jüngling mit Bürgerstock, Hund und Geldbeutel<br />
und Frau mit Kalathos und Blüte werden von<br />
zwei Eroten flankiert.<br />
B: zwei Jünglinge beim Komos; einer von beiden<br />
mit Bürgerstock und Skyphos.<br />
Literatur:<br />
ARV² 275,50; Beazley Addenda² 207; CVA Rom,<br />
Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia (4) 12 Abb. 3 Taf.<br />
7; Meyer 1988, 109 Abb. 22; Dierichs 1993, 86 f.<br />
Abb. 159; Reinsberg 1993, 124 Abb. 68; A. Schäfer,<br />
Unterhaltung beim Symposium. Darbietungen,<br />
Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis in<br />
spätklassische Zeit (Mainz 1997) Taf. 35, 2; Lewis<br />
2002, 196. 198 Abb. 5, 18.<br />
III/31. Adolphseck, Schloss Fasanerie 41<br />
Taf. 16 Abb. 2. 3<br />
Pelike nach Art des Schweine-Malers um 470 v.<br />
Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Mann mit Geld und Stab, Frau mit Kalathos und<br />
Blüte<br />
B: Mann mit Geld und Bürgerstock, sitzende Frau<br />
mit Blüte<br />
Literatur:<br />
ARV² 566,6; Beazley Addenda² 261; CVA<br />
Adolphseck (1) 20 Taf. 31, 1. 2; E. C. Keuls, Attic<br />
Vase-Painting and the Home Textile Industry, in:<br />
W. G. Moon (Hrsg.) (Hrsg.), Ancient Greek Art and<br />
Iconography (Wisconsin 1983) 228 f. Abb. 14, 43;<br />
S. v. Reden Exchange in Ancient Greece (London<br />
1995) 207 f. Taf. 4, C. D.<br />
III/32. Kopenhagen, Nat. Mus. 153/ChrVIII 520<br />
Taf. 16 Abb. 4<br />
Hydria des Washing-Painters um 440–430 v. Chr.;<br />
aus Nola/Italien<br />
Darstellung:<br />
Nackte Frau mit Spindel und Spinnrocken, sitzende<br />
Frau; Klismos mit abgelegtem Gewand, Band<br />
Literatur:<br />
ARV² 1131,161; 1684; Beazley Addenda² 333; CVA<br />
Kopenhagen, National Museum (4) III I 119 f. Taf.<br />
154, 2; 155, 1; J. L. Sebesta, Visions of Gleaming<br />
Textiles and a Clay Core: Textiles, Greek Women,<br />
and Pandora, in: H. P. Foley (Hrsg.), Reflections of<br />
Women in Antiquity (New York 1981) 125 Abb. 1;<br />
D. Williams, Women on Athenian Vases: Problems<br />
of Interpretation, in A. Cameron – A. Kuhrt, Images<br />
of Women in Antiquity (London 1983) 96 Abb. 7, 4;<br />
M. Beard, Adopting an Approach II, in: N. Spivey –<br />
T. Rasmussen (Hrsg.), Looking at Greek Vases<br />
(Cambridge 1991) 30 f. Abb. 9; Reinsberg 1993,<br />
123 f. Abb. 67; Reeder 1995, 216 f. Nr. 50; Lewis<br />
2002, 104 f. Abb. 3, 10; Vidale 2002, 429 f. Abb.<br />
123; S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen<br />
Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert<br />
v. Chr. (Berlin 2005) 276 f. Abb. 137.
III/33. München, Privatsammlung<br />
Taf. 16 Abb. 5. 6<br />
Schale des Ambrosios-Malers um 510–500 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzender Jüngling mit Hund, sitzende Frau mit<br />
Sakkos bindet sich die Sandale, sitzende Frau<br />
überreicht einem Jüngling einen Kranz,<br />
gestikulierender bärtiger Mann mit Hund;<br />
Diphros, Flötenfutterale<br />
Inschriften:RODO[…]; LI[…]; A[N]TIPHANE;<br />
ARISTOMYMOS<br />
B: Auf einem Block sitzende Frau räumt eine<br />
Wollspindel in den bereits vollen Kalathos einer<br />
stehenden Frau, sitzender, bärtiger Mann mit<br />
Knotenstock, Flötenspielerin, gestikulierender<br />
bärtiger Mann, spinnende Frau mit Spindel und<br />
Spinnrocken<br />
Inschriften: APHRO[D]I[…]; OBOLE<br />
I: Jüngling mit über die Schulter geworfenem<br />
Himation bindet sich die Sandale; seinen Fuß<br />
hat er auf ein stufenartiges Podest gestellt; Stab,<br />
Athletenutensilien.<br />
Inschrift: KALIAS<br />
Literatur:<br />
MuM, Kunstwerke der Antike. Auktion 51, 14.–<br />
15.03.1975 (Basel 1975) 60 f. Taf. 33 Nr. 148; H.<br />
R. Immerwahr, An Inscribed Cup by the Ambrosios<br />
Painter, AK 27, 1984, 10–13 Taf. 2. 3; D. Williams,<br />
Women on Athenian Vases: Problems of Interpretation,<br />
in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.),<br />
Images of Women in Antiquity (London 1993) 96 f.;<br />
N. Hoesch, Hetären, in: K. Vierneisel – B. Kaeser<br />
(Hrsg.), Kunst der Schale. Kultur des Trinkens.<br />
Ausstellungskatalog München (München 1990) 234<br />
Abb. 37, 8; Davidson 1999, 111.<br />
III/34. Kopenhagen, Thorvaldsen Mus. H 114<br />
Taf. 17 Abb. 1<br />
Schale des Penthesilea-Malers 470–50 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
I: Jüngling mit Geld und Bürgerstock greift nach<br />
der Hand einer Frau; Diphros, Alabastron, Band<br />
Literatur:<br />
Meyer 1988, 111 Abb. 24.<br />
III/35. London, British Mus. 1914.5-12.1<br />
Taf. 17 Abb. 2<br />
Weißgrundige Lekythos des Malers von München<br />
2774<br />
Darstellung:<br />
Jüngling mit Bürgerstock und Geldbeutel, Frau mit<br />
Spiegel und Blüte<br />
Literatur:<br />
ARV² 283,1; Beazley Addenda² 104; Meyer 1988,<br />
108 f. Abb. 18; Lewis 2002, 194 f. Abb. 5, 15.<br />
III/36. San Antonio (TX), San Antonio Mus. of Art<br />
86.134.59<br />
Taf. 17 Abb. 3<br />
Oinochoe des Berliner-Malers um 490–80 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Blütenzweig, Jüngling mit Blüte<br />
und Geldbeutel; Spiegel<br />
Literatur:<br />
Reeder 1995, 181 f. Nr. 36; H. A. Shapiro et al.<br />
(Hrsg.), Greek Vases in the San Antonio Museum of<br />
Art (San Antonio 1995) 138 f. Nr. 70; Dierichs<br />
1993, 85 f. Abb. 157.<br />
III/37. Syrakus, Mus. Arch. Naz. 18426<br />
Taf. 17 Abb. 4<br />
Pelike des Tyszkiewicz Malers um 460 v. Chr.; aus<br />
Gela<br />
Darstellung:<br />
A: Jüngling mit Geldbeutel reicht einer auf einem<br />
Klismos sitzenden Frau einen Spiegel;<br />
Jungfernkranich<br />
B: Manteljünglinge<br />
Literatur:<br />
CVA Syrakus (1) III I 5 Taf. 7,4. S. von Reden,<br />
Exchange in Ancient Greece (London 1995) 206<br />
Taf. 7, B.<br />
III/38. Berlin, Antikensammlung F 2624<br />
Taf. 17 Abb. 5<br />
Epinetron des Malers von Berlin 2624 um 420/10 v.<br />
Chr.; aus Athen<br />
Darstellung:<br />
A: Sitzende Frau mit Alabastron zwischen zwei<br />
Jünglingen mit Bürgerstock; einer hält einen<br />
Geldbeutel oder Beutel;<br />
B: Frau zwischen zwei Jünglingen mit Bürgerstock<br />
Literatur:<br />
ARV² 1225,1; Beazley Addenda² 350; Meyer 1988,<br />
106 f. Abb. 15; Badinou 2003, 27. 29. 31–33. 51.<br />
150 Nr. E 48 Taf. 25; Mercati 2003, 58. 138 f. Nr.<br />
B7 Taf. 27; Heinrich 2006, 34 f. 81 f. 84. 92 Nr. Rf.<br />
22 Taf. 20, 1–3.<br />
III/39. Tampa (FL), Mus. of Art 86.70<br />
Taf. 17 Abb. 6<br />
Hydria des Harrow-Malers um 480–60 v. Chr.; aus<br />
Vulci<br />
Darstellung:<br />
Schulterfries: Kampfszene<br />
Bauchfries: Eine auf einem Diphros sitzende in<br />
ihren Mantel gehüllte Frau mit Spiegel und ein<br />
ebenso verhüllter Knabe in einer imposanten<br />
Hausarchitektur, außerhalb nähern sich ein<br />
Mann mit Knotenstock und Geld und ein<br />
Manteljüngling; im Hintergrund Alabastron und<br />
Athletenutensilien<br />
Literatur:<br />
ARV² 276,70; Beazley Addenda² 207; E. C. Keuls,<br />
Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry,<br />
in: W. G. Moon (Hrsg.) (Hrsg.), Ancient Greek Art<br />
and Iconography (Wisconsin 1983) 228 f. Abb. 14,<br />
42; Meyer 1988, 88–103. 90 Abb. 1; J. Neils,<br />
Others within the Other: An Intimate Look at<br />
Hetairai and Maenads, in: B. Cohen (Hrsg.), Not<br />
S e i t e | 223
the Classical Ideal. Athens and the Construction of<br />
the Other in Greek Art (Leiden 2000) 211 f. Abb. 8,<br />
4; H. A. Shapiro, Fathers and Sons, Men and Boys,<br />
in: Neils – Oakley 2003, 98 f. Abb.; 267 f. Nr. 62.<br />
III/40. Kopenhagen, Nat. Mus. 124<br />
Taf. 18 Abb. 1–3<br />
Stamnos des Eucharides-Malers um 480/70 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Frau mit Spiegel und das Gewand raffend,<br />
Hund, auf einem Diphros sitzender Jüngling mit<br />
Knotenstock und Geldbeutel, eine sich eine das<br />
Haar mit einem Band richtende Frau.<br />
B: sitzende Frau mit Kranz (?), Jüngling mit<br />
Knotenstock und Geld, sitzende Frau mit<br />
Wollfaden (?); unter den Henkeln jeweils ein<br />
Tisch mit einem Skyphos, darüber ein<br />
fliegender Eros.<br />
Inschrift: EUCHARIDES KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 1580; 229, 35; Beazley Para. 347; K. P.<br />
Stähler, Eine unbekannte Pelike des Eucharidesmalers<br />
im Archäologischen Museum der <strong>Universität</strong><br />
Münster (Köln 1967) 17–21 Taf. 4, B; 6; 7, A;<br />
Meyer 1988, 106 Abb. 11. 12; A. Schäfer, Unterhaltung<br />
beim griechischen Symposium. Darbietungen,<br />
Spiele und Wettkämpfe von homerischer bis<br />
in spätklassische Zeit (Mainz 1997) Taf. 36, 2–4.<br />
III/41. Univ. of Chicago, D. & A. Smart Gall.<br />
16.140<br />
o. Abb.<br />
Stamnos des Kopenhagen-Malers um 480-460 v.<br />
Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Stehende Frauen, eine mit Spiegel, eine mit<br />
Spindel; Nymphenkranich, Klismos<br />
B: Mann mit Bürgerstock und Geld zwischen zwei<br />
Frauen; Diphros, Alabastron<br />
Literatur:<br />
ARV² 258,18; 1640; Beazley-Archiv.<br />
III/42. San Antonio (TX), Art Mus. 86.34.2<br />
Taf. 18 Abb. 4<br />
Schale des Penthesilea-Maler/ des Malers von<br />
Brüssel R 330<br />
Darstellung:<br />
A: Frau mit ausgestrecktem Geldbeutel zwischen<br />
zwei Jünglingen mit Bürgerstöcken; Schild und<br />
Schwert, Sandale und Kranz an der Wand.<br />
B: Frau mit Kranz/Kette zwischen zwei Jünglingen<br />
mit Bürgerstöcken; Band, Sandale an der Wand.<br />
I: Zwei Jünglinge, einer vermummt, einer mit<br />
Bürgerstock.<br />
Literatur:<br />
H. A. Shapiro et al. (Hrsg.), Greek Vases in the San<br />
Antonio Museum of Art (San Antonio 1995) 172 f.<br />
Nr. 87.<br />
S e i t e | 224<br />
III/43. Berlin, Antikensammlung F 2261<br />
Taf. 18 Abb. 5–7<br />
Weißgrundige Pyxis des Veji-Malers um 460–450<br />
v. Chr.; aus Athen<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau, forteilende Frau mit ausgestreckter<br />
Hand, große doppelflügelige Tür, Frau mit Spiegel,<br />
Frau mit Wollknäuel vor einem Kalathos mit<br />
Spindel und Spinnrocken, forteilende Frau mit<br />
Wollkranz/Kette; an der Wand Sandalen, Bänder,<br />
Binde/Kranz, Geldbeutel, Alabastron.<br />
Literatur:<br />
ARV² 906,116; Beazley Addenda² 303; CVA Berlin<br />
(3) 21 f. Taf. 136, 1–4; E. C. Keuls, Attic Vase-<br />
Painting and the Home Textile Industry, in: W. G.<br />
Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art and Iconography<br />
(Wisconsin 1983), 216 Abb. 14, 13; W.-D.<br />
Heilmeyer et al., Antikenmuseum Berlin. Die<br />
ausgestellten Werke (Berlin 1988) 146 f. Nr. 7;<br />
Vidale 2002, 465–467 Abb. 142, A–C.<br />
4. Die Ehefrau als Sexualpartnerin und<br />
Gefährtin<br />
IV/1. Buffalo, Mus. of Science C 23262<br />
Taf. 19 Abb. 1<br />
Loutrophoros; spätes 5./ frühes 4. Jh. v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Brautpaar hält sich an der Hand; Frau mit Kästchen<br />
und Band, geflügelte Frau mit Fackel und Band;<br />
Diphros.<br />
Literatur:<br />
Oakley – Sinos 1993, 39. 122 Abb. 122.<br />
IV/2. München, Mus. für antike Kleinkunst 2427/J<br />
347<br />
Taf. 19 Abb. 2<br />
Hydria des Kleophrades-Malers um 480 v. Chr.;<br />
aus Vulci<br />
Darstellung:<br />
Junge Frau mit gelösten Haaren und Griff ins<br />
Gewand legt einem sitzenden Jüngling die Hand<br />
auf die Schulter, Dienerin mit Alabastron und<br />
Wollkorb, Mann reicht einer sitzenden Frau<br />
ebenfalls mit losen Haaren einen Astragal, diese<br />
greift ihn um den Oberarm<br />
Inschrift: KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 189,72; 1632; Beazley Addenda² 188; CVA<br />
München (5) 22 f. Taf. 227, 3; 228, 3; 234, 3; N.<br />
Hoesch, Hetären, in: K. Vierneisel – B. Kaeser<br />
(Hrsg.), Kunst der Schale. Kultur des Trinkens.<br />
Ausstellungskatalog München (München 1990) 233<br />
Abb. 37, 7; Reinsberg 1993, 125 f. Abb. 69.<br />
IV/3. Paris, Musée du Louvre G 143<br />
Taf. 19 Abb. 3<br />
Schale des Makron um 490–480 v. Chr.; aus Vulci
Darstellung:<br />
A/B: Werbeszenen<br />
I: Mann und Frau in Umarmung<br />
Inschrift: HIERON EPOESEN<br />
Literatur:<br />
ARV² 469,148; 482; Beazley Addenda² 245; Meyer<br />
1988, 104 f. Abb. 7; Dierichs 1993, 67 f. Abb. 119;<br />
Kilmer 1993, AT P. 146, R630; Kunisch 1997, 7. 8<br />
Anm. 37; 24. 35. 45 Abb. 12; 50; 78. 80. 94. 117 f.<br />
201 f. Nr. 381 Taf. 131, 381.<br />
IV/4. Berlin, Antikensammlung F 2269<br />
Taf. 19 Abb. 4<br />
Schale um 520 v . Chr.<br />
Darstellung:<br />
I: Bekränzter Jüngling und ein junges Mädchen in<br />
Umarmung<br />
Literatur:<br />
Dierichs 1993, 113 f. Abb. 197.<br />
IV/5. New York, Metropolitan Mus. of Art<br />
07.286.50<br />
Taf. 19 Abb. 5<br />
Schalenfragment des Kuss-Malers um 510–500 v.<br />
Chr.; aus Arezzo<br />
Darstellung:<br />
A/B: Komos oder Kampf (?)<br />
I: sich umarmendes heterogeschlechtliches Paar<br />
Literatur:<br />
ARV² 177,2; Reeder 1995, 192 f. Nr. 41; Dierichs<br />
1993, 113 f. Abb. 199.<br />
IV/6. Luzern, Kunsthandel Ars Antiqua<br />
o. Abb.<br />
Schale des Epidromos-Malers<br />
Darstellung:<br />
I: Jüngling umarmt ein um einen Kopf kleineres<br />
Mädchen; Bürgerstock, Athletenutensilien,<br />
Kranich.<br />
Inschrift: EPIDROMOS KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 118,14; 1577; Beazley-Archiv<br />
IV/7. Athen, Nat. Mus., Acropolis Coll. 1.2277<br />
Taf. 19 Abb. 6<br />
Schwarzfiguriges Alabastron; aus Athen/Akropolis<br />
Darstellung:<br />
Sich umarmendes und küssendes Paar; Beifiguren.<br />
Literatur:<br />
B. Graef – E. Langlotz, Die antiken Vasen von der<br />
Akropolis zu Athen 4 (Berlin 1925) Taf. 96, 2277;<br />
Badinou 2003, Nr. A 79 Taf. 64.<br />
IV/8. Chicago (IL), Art Institut 1911.456<br />
Taf. 20 Abb. 1<br />
Hydria des Leningrad-Malers um 460–450 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Sich küssendes Paar wird flankiert von einem<br />
verhüllten Jüngling und zwei Frauen, von denen die<br />
am rechten Rand einen Handwebrahmen in der<br />
Hand hält; Sakkos, Lekythos an der Wand<br />
Literatur:<br />
ARV² 572,88; Beazley Addenda² 261; W. G. Moon<br />
(Hrsg.), Greek Vase-Painting in Midwestern<br />
Collections. Ausstellungskatalog Chicago<br />
²(Chicago 1981) 170 f. Nr. 97; Dierichs 1993, 70 f.<br />
Abb. 123; Bundrick 2008, 298 f. Abb. 7.<br />
IV/9. London, British Mus. E 44/1836.2-24.25<br />
Taf. 20 Abb. 2<br />
Schale des Onesimos; aus Vulci<br />
Darstellung:<br />
A: Herakles mit dem erymanthische Eber bei<br />
Eurystheus<br />
Inschrift: KALE<br />
B: Pferdegespann, Hermes<br />
Inschrift: [K]ALOS<br />
I: am Boden hockender Mann mit Stirnglatze, sich<br />
entkleidende oder gürtende Frau; Korb,<br />
Barbiton<br />
Inschrift: [K]ALOS PANAITOS KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 1604; 318,2; 313; Beazley Addenda² 214;<br />
CVA London (9) 20 f. Nr. 6 Abb. 3, E. H; 4, F Taf.<br />
9, A. B; 10, A–D; Keuls 1985, 189 f. Abb. 172; I.<br />
Peschel, Die Hetäre bei Symposium und Komos in<br />
der attisch rotfigurigen Malerei des 6.–4. Jhs. v.<br />
Chr. (Frankfurt 1987) 170 f. Taf. 132; J. Christiansen<br />
– T. Melander (Hrsg.), Proceedings of the 3 rd<br />
Symposium on Ancient Greek and Related Pottery,<br />
Kopenhagen 28.8.–4.9.1987 (Kopenhagen 1988)<br />
251 Abb. 6; M. Maas – J. M. Snyder, Stringed<br />
Instruments of Ancient Greece (New Haven 1989)<br />
134 Abb. 12; Kilmer 1993, AT P.146, R445.<br />
IV/10. Würzburg, Martin-von-Wagner Mus. 541/<br />
L 541/H 4455 Taf. 20 Abb. 3. 4<br />
Pyxis des Washing-Painter um 420 v. Chr.; aus<br />
Athen<br />
Darstellung:<br />
Eine auf einer Kline sitzende Braut frisiert sich<br />
unter Mithilfe von Eros; ringendes Erotenpaar (Eros<br />
und Anteros?), sitzende und stehende Beobachterin,<br />
weibliche Beifiguren mit Loutrophoros, Kästchen,<br />
Harfenspielerin.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1133,196; 1684; Beazley Addenda² 333; CVA<br />
Würzburg (2) 48 f. Abb. 37 Taf. 33, 4; LIMC VI<br />
(1992) 642 Nr. 31 Taf. 376, 31 s. v. Morai (S. de<br />
Angeli); E. Simon, Aphrodite und Adonis. Eine<br />
neuerworbene Pyxis in Würzburg, AntK 15, 1972,<br />
25 f. Taf. 6, 1–3; Oakley – Sinos 1993, 17 f. 65 Abb.<br />
24–27; 34, 1–5, 35, 1–8; Mösch-Klingele 2006, 55.<br />
234 Nr. 77 Abb. 12, A–D; Heinrich 2006, 107.<br />
IV/11. Athen, Nat. Mus. 1619/CC 1239<br />
Taf. 20 Abb. 5<br />
Hydriafragment der 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Braut sitzt mit verhülltem Haupt auf der<br />
Hochzeitskline, neben ihr Aphrodite (?), weibliche<br />
Beifiguren mit Bändern, Kalathos<br />
S e i t e | 225
Literatur:<br />
A. Brückner, Athenische Hochzeitsgeschenke, AM<br />
32, 1907, 92–94 Abb. 5 Taf. 6; L. D. Caskey, The<br />
Ludovisi and Boston Reliefs, AJA 22, 1918, 134 f.<br />
Abb. 12; Reinsberg 1993, 62. 65 Abb. 19.<br />
IV/12. London, British Mus. E 51/1843.11-3.94<br />
Taf. 20 Abb. 6<br />
Schale des Douris um 480–470 v. Chr.; aus Vulci<br />
Darstellung:<br />
A: Bärtiger Mann mit Geld und eine Frau mit<br />
Alabastron (?), Mann und Frau in Konversation,<br />
bärtiger Mann mit Geld ohne Bezugsperson.<br />
B: Jüngling und eine Frau mit Alabastron, Jüngling<br />
und Frau in Konversation, Jüngling ohne<br />
Bezugsperson; Spiegel an der Wand.<br />
I: An einer Blüte riechende Frau neben einer Kline<br />
und einem Kalathos; Spiegel an der Wand<br />
Inschrift: HE PAIS KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 449,4; 1653; Beazley Para. 376; CVA<br />
London (9) 41 f. Abb. 1, C; 2, F; 8, C Taf. 37, A. B;<br />
38, A. B; Meyer 1988, 104 Abb. 8; 105 f.<br />
IV/13. Paris, Musée du Louvre CA 587<br />
Taf. 20 Abb. 7<br />
Pyxis des Malers der Kentauromachie Louvre um<br />
430 v. Chr.; aus Griechenland<br />
Darstellung:<br />
Auf einem Klismos sitzende Frau mit Spiegel; Frau<br />
mit Handwebrahmen; Tür mit geöffnetem<br />
Türflügel, der den Blick auf eine Kline frei gibt.<br />
Sitzende Frau überwacht das Zusammenlegen eines<br />
Himation, Frau mit Kästchen; Vogel, Gefäß, Säule.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1094,104; 1682; Beazley Addenda² 328;<br />
Beazley Para. 449; E. C. Keuls, Attic Vase-Painting<br />
and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon<br />
(Hrsg.), Ancient Greek Art and Iconography<br />
(Wisconsin 1983) 222 f. Abb. 14, 31; J. B.<br />
Connelly, Parthenon and Parthenoi, AJA 100,<br />
1996, 65 Abb. 10; F. Frontisi-Ducroux – J.-P.<br />
Vernant, Dans l´oeil du miroir (Paris 1997) Taf.<br />
28; Bundrick 2008, 301 f.<br />
IV/14. Athen, Agora Mus. P 18283<br />
Taf. 20 Abb. 8<br />
Epinetronfragment um 440–410 v. Chr.; von der<br />
Agora/Athen<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Alabastron und Blüte, weibliche<br />
Beifigur, Kline<br />
Literatur:<br />
R. S. Young, An Industrial District of Ancient<br />
Athens, Hesperia 20, 1951, Taf. 79, 1; M. B.<br />
Moore, Attic red-figured and white-ground Pottery,<br />
Agora 30 (Princeton 1997)351 Nr. 1642 Taf. 154,<br />
1642; Badinou 2003, 39. 51. 152 Nr. E 60 Taf. 32;<br />
S. I. Rotroff – R. D. Lamberton, Women in the<br />
Athenian Agora (Athen 2006) 30 Abb. 32.<br />
S e i t e | 226<br />
IV/15. Athen, Benaki Mus. Inv. 31138<br />
Taf. 21 Abb. 1. 2<br />
Kalpis des Dinos-Malers um 425–420 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Schulterfries: Frau auf Diphros mit Kalathos, Frau<br />
mit Band und Kästchen, Frau mit Diphros und<br />
Spiegel (?), Bräutigam mit Bürgerstock auf<br />
Klismos, Braut auf Diphros, Frau mit Fächer,<br />
Jüngling, Frau, weiterer Jüngling auf Klismos;<br />
Tür des Thalamos mit Blick auf Kline, Kranz,<br />
Vogel.<br />
A: Auf Klismos sitzende Frau mit Kalathos, Frauen<br />
mit Bändern, Kästchen und Spiegel<br />
B: Auf Klismos sitzende Frau, Frauen mit<br />
Bändern, Kästchen und Spiegel.<br />
Literatur:<br />
CVA Athen, Benaki Mus. (1) 25–28 Abb. 46. 47 Taf.<br />
12–16.<br />
IV/16. Christchurch (N. Z.), Canterbury Mus. AR<br />
430<br />
Taf. 21 Abb. 3<br />
Schalenfragment des Douris/des Malers von<br />
London E 55 um 480 v. Chr.; aus Orvieto<br />
Darstellung:<br />
A/B: Symposion: lagernde Symposiasten, lagernde<br />
Hetären, Musikantinnen.<br />
I: Frau schlingt ihre Arme um den Hals eines<br />
Jünglings, der mit einem Handgestus auf eine<br />
Kline verweist, Tür; Außenseite: Symposion.<br />
Inschrift: HIKET[ES] KALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 438,138; Peschel 1987, 219 f. Taf. 157. 158;<br />
D. Buitron-Oliver, Douris. A Master-Painter of<br />
Athenian Red-Figure Vases (Mainz 1995 ) Nr. E 12<br />
Taf. 126; Lewis 2002, 121 f. Abb. 3, 23; Badinou<br />
2003, 64. 67 Taf. 135. 136.<br />
IV/17. Sydney, Nicholson Mus. 98.42<br />
Taf. 21 Abb. 4<br />
Apulischer Glockenkrater des Dioskuren-Malers<br />
um 390–380 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Ein fliegender Eros führt eine Frau an der Hand auf<br />
eine Tür zu; sie umarmt und wird umarmt von<br />
einem nackten Jüngling; Säule<br />
Literatur:<br />
LIMC III (1986) 906 Nr. 642 Taf. 646 s. v. Eros<br />
(Ch. Augé – P. Lonant de Bellefonds).<br />
IV/18. St. Petersburg, State Hermitage Mus. 1602/<br />
ST 1723/B 637<br />
Taf. 21 Abb. 5<br />
Kelchkrater des Triptolemos-Malers um 490–480 v.<br />
Chr.; aus Cerveteri<br />
Darstellung:<br />
A: Danae sitzt auf einer Kline, die Füße auf einen<br />
Schemel gestellt und knüpft sich ein Band ins<br />
Haar; sie blickt nach oben zum Goldregen, der<br />
auf ihren Schoß herabregnet.<br />
Inschrift: DANAE
B: Danae und Perseus werden in die Kiste gesetzt;<br />
Handwerker, Akrisios.<br />
Literatur:<br />
ARV² 360,1; 1648; Beazley Addenda² 222; LIMC<br />
III (1986) 327 Taf. 243, 1 s. v. Danae (J. J. Maffre);<br />
M. d´Abruzzo, Una pasta vitrea da Altino e il mito<br />
di Danae, RdA 17, 1993, 18. 24 Nr. 2 Taf.<br />
D´ABRUZZO Abb. 2; Reeder 1995, 269–271 Nr.<br />
74.<br />
IV/19. Paris, Musée du Louvre CA 925<br />
Taf. 21 Abb. 6<br />
Böotischer Glockenkrater um 410–400 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Danae sitzt halb zurückgelehnt und mit entblößtem<br />
Oberkörper auf einer Kline und empfängt Zeus in<br />
Form eines Goldregens; Skyphos (?), Hydria.<br />
Literatur:<br />
LIMC III (1986) 328 Taf. 244, 9 s. v. Danae (J. J.<br />
Maffre); M. d´Abruzzo, Una pasta vitrea da Altino<br />
e il mito di Danae, RdA 17, 1993, 25 Nr. 10 Taf.<br />
D´ABRUZZO Abb. 7.<br />
IV/20. Brüssel, Musées Royaux d´Art et d´Histoire<br />
R 351<br />
Taf. 21 Abb. 7<br />
Hydria des Dikaios-Maler; aus Eretria<br />
Darstellung:<br />
Zwei Symposiasten beim Liebespiel mit Hetären<br />
Inschriften: POLYLA[OS]; HEGIL[L]A;<br />
KLEOKRATE[S]; SEK[Y]LINE<br />
Literatur:<br />
ARV² 31,7; Beazley Addenda² 157; Peschel 1987,<br />
28 f. Taf. 2; Kilmer 1993, 48 f. 70 Taf. AT P. 146 R<br />
62; Reinsberg 1993, 99 Abb. 48; Dierichs 1997, 68<br />
f. Abb. 121, A–C.<br />
IV/21. Paris, Musée du Louvre G 13<br />
Taf. 22 Abb. 1<br />
Schale des Pedieus-Malers um 510–500 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Sexsszenen beim Symposium: auf einem<br />
Diphros liegende Hetäre wird von einem Mann<br />
penetriert und gleichzeitig mit einer Sandale<br />
geschlagen bzw. bedroht, während sie einen vor<br />
ihr stehenden Jüngling oral befriedigt; zweite,<br />
diesmal auf dem Boden auf allen Vieren<br />
knieende Hetäre bekommt gerade den Penis des<br />
Jünglings in den Mund geschoben.<br />
B: (stark beschädigt) Gruppe bestehend aus drei<br />
Männern und einer ihre Glutäen in die Höhe<br />
reckenden Hetären; einer der Männer mit<br />
Dreizack und einem erigierten Penis von der<br />
Größe eines Kurzschwertes reicht seinem<br />
Nachbarn ein Öllämpchen (zur Depilation?);<br />
Hund, Reste mehrer Figuren.<br />
I: Jüngling mit Schale und Bürgerstock hat den<br />
Arm um eine Unterhalterin mit Lyra gelegt.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1578,16; Beazley Addenda² 170; CVA Paris,<br />
Musée du Louvre (19) 44 f. Taf. 68, 1. 2; 69, 1–3;<br />
Keuls 1985, 184 Abb. 166; Peschel 1987, Taf. 37,<br />
40; Kilmer 1993, Taf. AT P. 146 R 156; Reinsberg<br />
1993, 94. 101 Abb. 36. 50, A–C; Reeder 1995, 109<br />
Abb. 10; A. Schäfer, Unterhaltung beim<br />
Symposium. Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe<br />
von homerischer bis in spätklassische Zeit (Mainz<br />
1997) Taf. 33, 3; A. Stewart, Art, Desire, and the<br />
Body in Ancient Greece (Cambridge 1997) 9 Abb.<br />
5.<br />
IV/22. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 1970.233<br />
Taf. 22 Abb. 2<br />
Schale des Douris<br />
Darstellung:<br />
I: Kopulierendes Paar; sie stützt sich mit beiden<br />
Armen auf einem niedrigen Schemel mit<br />
Löwenfüßen ab, auf dem ein Kleiderbündel<br />
abgelegt ist; Strigilis und Alabastron, Kline mit<br />
Kissen.<br />
Inschrift: HE PAI[S] K[AL]E, HECHE<br />
HESY[CH]OS<br />
Literatur:<br />
ARV² 444,241; Beazley Addenda² 240; Peschel<br />
1987, 236 f. Taf. 180; R. F. Sutton Jr.,<br />
Pornography and Persuasion on Attic Pottery, in:<br />
A. Richlin (Hrsg.), Pornography and<br />
Representation in Greece and Rome (Oxford 1992)<br />
11f. Abb. 1, 2; Dierichs 1993, 74 Abb. 133; Kilmer<br />
1993, 34. 39. 83 f. 88. 127. 188 AT P.146, R577; D.<br />
Buitron-Oliver, Douris. A Master-Painter of<br />
Athenian Red-Figure Vases (Mainz 1995) 40. 44.<br />
85 Nr. 233 Taf. 111; A. Stewart, Art, Desire and the<br />
Body in Ancient Greece (Cambridge 1997) 163<br />
Abb. 104.<br />
IV/23. München, ehem. Sammlung Arndt<br />
Taf. 22 Abb. 3<br />
Schale des Hochzeits-Malers<br />
Darstellung:<br />
Kopulierendes Paar; Geldbeutel<br />
Literatur:<br />
ARV² 923,29; Beazley Addenda² 305; Dierichs<br />
1993, 73 Abb. 129; Kilmer 1993, 34. 39. 84 Anm.<br />
11; 94 Anm. 37; 182 f. 188 Anm. 7 Taf. AT P. 147,<br />
R864; S. von Reden, Exchange in Ancient Greece<br />
(London 1995) Taf. 6, C.<br />
IV/24. Malibu, John Paul Getty Mus. 83.AE.321<br />
Taf. 22 Abb. 4<br />
Schale um 480–70 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Kopulierendes Paar; eine Frau sitzt rittlings und mit<br />
gespreizten Beinen auf einem Mann, der auf einem<br />
Klismos sitzt; er umfasst ihre Brust mit der rechten<br />
Hand, sie hält seinen Bürgerstock<br />
Literatur:<br />
Dierichs 1993, 78 Abb. 145; Kilmer 1993, 38. 52 f.<br />
Anm. 51. 52; 86 Anm. 15 AT P. 147, R814;<br />
Reinsberg 1993, 111 Abb. 60.<br />
S e i t e | 227
IV/25. Berlin, Antikensammlung F 2414<br />
Taf. 22 Abb. 5<br />
Oinochoe des Shuvalow-Malers um 430–420 v.<br />
Chr.; aus Lokri/Italien<br />
Darstellung:<br />
Junge Frau steigt einem auf einem Klismos<br />
sitzenden Jüngling auf den Schoß; sein Penis ist<br />
erigiert; beide blicken sich tief in die Augen, wobei<br />
sich ihrer beider Stirn berühren.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1208,41; 1704; Beazley Addenda² 346; CVA<br />
Berlin (3) 27 Taf. 145, 2; Peschel 1987, 311 f. Taf.<br />
249; W.-D. Heilmeyer et al., Antikenmuseum<br />
Berlin. Die ausgestellten Werke (Berlin 1988) 154<br />
Nr. 10; Dierichs 1993, 75 f. Abb. 140; 146, 1. 2;<br />
Kilmer 1993, 45. 52. 153 f. Anm. 60; 163 f. 168.<br />
183. 189–191. 214 Anm. 46 AT P.147, R970;<br />
Reinsberg 1993, 133 Abb. 77; A. Stewart, Art,<br />
Desire and the Body in Ancient Greece (Cambridge<br />
1997) 163 Abb. 193 Taf. 2, B.<br />
5. Zur Figur des Eros<br />
V/1. Tübingen, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst.<br />
5439<br />
Taf. 23 Abb. 1<br />
Kelchkraters der Polygnot-Gruppe; aus Tarent<br />
Darstellung:<br />
Satyr mit Kantharos und Oinochoe, Dionysos,<br />
langgewandet mit Thyrsos, Ariadne auf<br />
gepolstertem Felslager, Himeros mit Phiale.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1057,97; Beazley Addenda² 322; Beazley<br />
Para. 445; CVA Tübingen (4) 46–48, Taf. 18, 1–7;<br />
LIMC III (1986) Addenda s. v. Ariadne 1061 Nr.<br />
111 Taf. 733, 111 (J. Jurgeit); E. Simon, Ausgewählte<br />
Schriften I. Griechische Kunst (Mainz 1998)<br />
146 Abb. 12, 6; H. A. Shapiro, Personifications in<br />
Greek Art. The Representation of Abstract Concepts<br />
600–400 v. Chr. (Zürich 1993) 115 Abb. 66.<br />
V/2. Paris, Musée du Louvre G 424<br />
Taf. 23 Abb. 2<br />
Glockenkrater des Menelaos-Malers um 450 v.<br />
Chr.; aus Egnatia/Italien<br />
Darstellung:<br />
A: Menelaos verfolgt Helena, Aphrodite, Eros mit<br />
Spendeschale (?)<br />
B: In ihren Mantel eingehüllte Frau, bärtiger Mann,<br />
Manteljüngling<br />
Literatur:<br />
ARV² 1077,5; CVA Paris, Musée du Louvre (4) III I<br />
d 15 Taf. 23, 4–6; LIMC II (1984) 140 f. Nr. 1474<br />
Taf. 144 s. v. Aphrodite (A. Delivorrias).<br />
V/3. Florenz, Mus. Arch. 81948<br />
Taf. 23 Abb. 3<br />
Hydria des Meidias-Malers; aus Populonia/Italien<br />
S e i t e | 228<br />
Darstellung:<br />
Adonis mit Lyra liegt in den Armen der Aphrodie,<br />
Eros spielt die Junx, zahllose Personifikationen und<br />
Allegorien wie Paidia, Hygeia, Eudaimonia,<br />
Pannychis etc.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1312,1; Beazley Addenda² 361; H. A.<br />
Shapiro, Personifications in Greek Art. The Representation<br />
of Abstract Concepts 600–400 v. Chr.<br />
(Zürich 1993) 63 Abb. 16; 86 Abb. 39; 118 Abb.<br />
70; 129 Abb. 81; E. Böhr, A Rare Bird on Greek<br />
Vases, in: J. H. Oakley (Hrsg.), Athenian Potters<br />
and Painters. The Conference Proceedings (Oxford<br />
1997) 118 Abb. 15.<br />
V/4. Tarquinia, Mus. Naz. Tarquiniense RC 5291<br />
Taf. 23 Abb. 4<br />
Schale aus dem Umfeld des Brygos-Malers; aus<br />
Tarquinia<br />
Darstellung:<br />
A: Menelaos verfolgt Helena; sie flüchtet sich in<br />
ein Aphrodite-Heiligtum mit Altar; Aphrodite<br />
selbst sitzt mit verhülltem Haupt unter der<br />
Tempelarchitektur<br />
B: Theseus verlässt die unter einem Rebstock<br />
schlafende Ariadne; Eros bekränzt/schmückt<br />
die Schlafende; Hermes<br />
I: Krieger (Mann mit Lanze) führt seine Braut<br />
heim<br />
Literatur:<br />
ARV² 405,1; 1651; Beazley Addenda² 231; Beazley<br />
Para. 370.23BIS,371; CVA Tarquinia (2) III I 4 f.<br />
Taf. 18, 1–3; LIMC III Addenda (1986) 1057 Nr. 53<br />
Taf. 730, 53 s. v. Ariadne (J. Jurgeit); H. A.<br />
Shapiro, Personifications in Greek Art. The<br />
Representation of Abstract Concepts 600–400 v.<br />
Chr. (Zürich 1993) 156 Abb. 120.<br />
V/5. Rom, Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia 20846<br />
Taf. 23 Abb. 5<br />
Pelike des Malers der Geburt der Athena um 450 v.<br />
Chr.; aus Cerveteri<br />
Darstellung:<br />
A: Poseidon mit Dreizack und Amymone mit<br />
Hydria, Eros, Beifiguren: zwei Frauen, Mann<br />
mit Zepter.<br />
B: Bärtiger Mann mit Zepter verfolgt eine Frau, die<br />
ihn mit der Hand abzuwehren versucht;<br />
weibliche Beifiguren.<br />
Inschrift: POSEIDON; AMYMONE<br />
Literatur:<br />
ARV² 494,2; Beazley Addenda² 250; Reeder 1995,<br />
358 f. Nr. 114.<br />
V/6. Berlin, Antikensammlung F 2373<br />
Taf. 23 Abb. 6<br />
Loutrophoros des Meidias-Malers um 420–410 v.<br />
Chr.; aus Sunion<br />
Darstellung:<br />
Brautpaar steht sich gegenüber, zwischen ihnen ein<br />
Eros, der die Braut mit einer Kette oder einem
Kranz schmückt; flankiert von zwei Frauenfiguren,<br />
von denen eine den Brautschleier richtet, die andere<br />
zwei Fackeln hält.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1322,20; W.-D. Heilmeyer et al.,<br />
Antikenmuseum Berlin. Die ausgestellten Werke<br />
(Berlin 1988) 138 Abb. rechts; Mösch-Klingele<br />
2006, Abb. 58.<br />
V/7. London, British Mus. 96.12-17.11/1896.12-<br />
17.11<br />
o. Abb.<br />
Fragment einer Loutrophoros des Washing-Painter<br />
Darstellung:<br />
Brautpaar mit Eros, Frauen mit Fackeln<br />
Literatur:<br />
ARV² 1127,10; Sutton 1997, 35 Abb. 12.<br />
V/8. Oxford, Ashmolean Mus. 1966.888<br />
Taf. 24 Abb. 1<br />
Loutrophorosfragment um 420 v. Chr.; aus<br />
Griechenland<br />
Darstellung:<br />
Bräutigam hält seine Braut am Handgelenk, Eros<br />
mit miniaturhafter Loutrophoros-Hydria und<br />
Loutrophoros-Amphora, weibliche Beifiguren mit<br />
Kästchen, Exaleiptron und Fackeln.<br />
Literatur:<br />
E. Brümmer, Griechische Truhenbehälter, JdI 100,<br />
1985, 145, Abb. 36, A; Reeder 1995, 168 f. Nr. 25;<br />
W. Oenbrink, Ein „Bild im Bild“-Phänomen. Zur<br />
Darstellung figürlich dekorierter Vasen auf<br />
bemalten attischen Tongefäßen, Hephaistos 14,<br />
1996, 88 Abb. 1; Mösch-Klingele 2006, 42 f. 76–81.<br />
231 Nr. 50 Abb. 41, A. B; M. S. Venit, Point and<br />
Counterpoint. Painted Vases on Attic Painted Vases,<br />
AntK 49, 2006, 36 Taf. 9, 1.<br />
V/9. Athen, Nat. Mus. 16279<br />
Taf. 24 Abb. 2<br />
Loutrophoros des Washing-Painters; aus Athen<br />
Darstellung:<br />
Bräutigam hält das Handgelenk seiner Braut, Flöte<br />
spielender Eros, Frau mit Fackel, Nympheutria<br />
richtet den Brautschleier.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1127,14; Beazley Para. 453; Oakley – Sinos<br />
1993, 32. 97 Abb. 85; O. Cavalier (Hrsg.), Silence<br />
et Fureur. La femme et le marriage en Grece. Les<br />
antiquites grecques du Musée Calvet (Avignon<br />
1997) 445 Abb. 138; Mösch-Klingele 2006, 232 Nr.<br />
64 mit Anm. 10 Abb. 56.<br />
V/10. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 10.223<br />
Taf. 24 Abb. 3<br />
Fragment einer Loutrophoros des Phiale-Malers<br />
Darstellung:<br />
Die Nympheutria legt der sitzenden Braut soeben<br />
den Schleier über das Diadem bekrönte Haupt bzw.<br />
nimmt ihn ab, Eros bringt ein (Haar-) Band; der der<br />
Braut gegenübersitzende Jüngling ist wohl der<br />
Bräutigam; zwischen dem Brautpaar steht ein<br />
Knabe (Pais amphitales?), fragmentarisch erhalten<br />
Frauen mit Körben, darunter ein großer, flacher<br />
Korb (mit Feigen und Nüssen?), bzw. einem<br />
Kästchen; Band, Lekythos und Sakkos an der<br />
Wand.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1017,44; J. Reilly,” Mistress and Maid” on<br />
Athenian Lekythoi, Hesperia 58, 1989, 418 Taf.<br />
78A; Reeder 1995, 169–171 Nr. 26; Oakley – Sinos<br />
1993, 25 f. 83 Abb. 60. 61; Reinsberg 1993, 58 Abb.<br />
12, A. B.<br />
V/11. Oxford, Ashmolean Mus. 1927.4067<br />
Taf. 24 Abb. 4<br />
Fragment einer Loutrophoros aus dem Umfeld des<br />
Malers von Athen 1454 um 420 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Braut mit einem Eros auf der Schulter; dieser hat<br />
den Blick auf den Bräutigam gerichtet; von links<br />
nähert sich der Zug der Epaulia, von der allerdings<br />
nur eine einzelne weibliche Person mit Exaleiptron,<br />
Kästchen und Band erhalten ist; Kranz, Sakkoi,<br />
Band an der Wand.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1179; CVA Oxford (2) 112 f. Taf. 59, 3. 4;<br />
Oakley – Sinos 1993, 39. 120. 121 Abb. 120. 121.<br />
V/12. Berlin, Antikensammlung F 2520<br />
Taf. 24 Abb. 5<br />
Pyxis; aus Attika<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau, Eros mit Kette; Frauen mit<br />
Kästchen, Bändern, Spiegel<br />
Literatur:<br />
CVA Berlin (3) 24 Taf. 139, 5–7; S. Roberts, The<br />
Attic Pyxis (Chicago 1978) Taf. 74, 1.<br />
V/13. Giessen, Justus-Liebig-Univ.,<br />
Antikensammlung KIII 44<br />
Taf. 24 Abb. 6<br />
Lekythos der 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Kranz, Eros mit Band / Kranz<br />
Literatur:<br />
CVA Giessen (1) 52 Beil. 7,3 Taf. 36, 1–3.<br />
V/14. London, British Mus. E 187<br />
Taf. 25 Abb. 1<br />
Hydria des Kensington-Malers; aus Rhodos<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Kalathos, Eros mit Band (?)<br />
Literatur:<br />
ARV² 1071,2; CVA London (5) III I c 14, Taf. 82, 2.<br />
V/15. Berlin, Antikensammlung F 2393<br />
Taf. 25 Abb. 2<br />
Hydria aus dem Umfeld des Klio-Malers; aus<br />
Theben/Böotien<br />
S e i t e | 229
Darstellung:<br />
Sich gürtende Frau, Frau mit Kästchen, Eros mit<br />
Himation und Spindel, Klismos<br />
Literatur:<br />
CVA Berlin (9) 43 f. Beil. 6,1 Taf. 20, 4; 21, 1–3;<br />
W.-D. Heilmeyer et al., Antikenmuseum Berlin. Die<br />
ausgestellten Werke (Berlin 1988) 142 Nr. 2; J. H.<br />
Oakley (Hrsg.), Athenian Potters and Painters. The<br />
Conference Proceedings (Oxford 1997) 323 Abb. 7.<br />
V/16. University, Univ. of Mississippi, Univ. Mus.<br />
77.3.196<br />
Taf. 25 Abb. 3<br />
Pelike des Washing-Painter<br />
Darstellung:<br />
A: Nackte Frau mit Kalathos, Sakkos, Box in<br />
Begleitung von Eros<br />
B: Jüngling mit Phiale<br />
Literatur:<br />
H. A. Shapiro (Hrsg.), Art, Myth and Culture.<br />
Greek Vases from Southern Collections (Tulane<br />
1981) 27 Nr. 6.<br />
V/17. Agrigent, Mus, Arch. Regionale (o. Inv.)<br />
Taf. 25 Abb. 4<br />
Kelchkrater um 440–430 v. Chr.; aus Agrigent<br />
Darstellung:<br />
A: Eros kniet vor einer auf einem Klismos<br />
sitzenden Frau und zieht ihr das Schuhwerk an;<br />
im Rücken der Sitzenden steht als Beobachter<br />
ein Jüngling auf seinen Bürgerstock gestützt;<br />
Lyra an der Wand.<br />
B: Manteljüngling zwischen zwei Frauen<br />
Literatur:<br />
P. O. Vassallaggi, Scavi 1961. I. La necropoli<br />
meridionale, NSc 1971, Suppl., 129–132 Abb. 206.<br />
207; P. Griffo, Il Museo Archeologico Regionale di<br />
Agrigento (Rom 1987) 269 Nr. 228.<br />
V/18. Athen, Nat. Mus. 2179/CC1589<br />
Taf. 25 Abb. 5. 6<br />
Epinetron, 2. Hälfte 5. Jh. v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
A: Frau am Webstuhl, sitzende Frau mit Epinetron<br />
auf dem Knie und Wollkorb, Eros, Frau mit<br />
Flöten, Jüngling mit Wollkorb, Tür;<br />
B: Frau mit Alabastron, Frau mit Wollbinden vor<br />
einem Klismos, Frau mit einem Eimer/Korb,<br />
aus dem vielleicht Wollknäuel herausragen,<br />
Wollkorb am Boden.<br />
Literatur:<br />
S. A. Xanthudides, Epinetron, AM 35, 1910, 324 f.<br />
Abb. 1. 2; Badinou 2003, 8. 13. 15. 18 f. 25. 25. 40.<br />
48 Nr. E 57 Taf. 30; Mercati 2003, 26–28 Nr. B 17<br />
Taf. 36. 37; Sutton 2004, 336 f. Abb. 17, 7;<br />
Heinrich 2006, 39. 88 f. 99. 106. 108 Kat. Nr. 15<br />
Taf. 18, 1–4; Bundrick 2008, 307 f. Abb. 11.<br />
S e i t e | 230<br />
V/19. San Simeon (CA), Hearst Historical State<br />
Monument 10004<br />
Taf. 26 Abb. 1<br />
Hydria aus dem Umfeld des Klio-Malers; aus<br />
Capua<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau, das Knie zwischen den<br />
verschränkten Fingern, Jüngling mit Bürgerstock,<br />
Eros mit Band, Frau mit Kalathos<br />
Literatur:<br />
ARV² 1083,3; Bundrick 2008, 287 Abb. 4; 308 f.<br />
V/20. Ehem. Stettin, Mus. (o. Inv.)<br />
Taf. 26 Abb. 2<br />
Hydria des Hephaistos-Malers<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Kalathos, Eros mit<br />
Handwebrahmen und Flötenfutteral, Jüngling mit<br />
Geldbeutel und Bürgerstock<br />
Literatur:<br />
ARV² 1116, 47; Bundrick 2008, 323 f. Abb. 15.<br />
V/21. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 10.205<br />
o. Abb.<br />
Fragment einer Schale in der Art des Onesimos; aus<br />
Capua<br />
Darstellung:<br />
Frau mit Spindel, Jüngling mit Stock, Flügel eines<br />
Eros<br />
Literatur:<br />
ARV² 331,11; Beazley-Archiv.<br />
V/22. London, British Mus. E 189<br />
Taf. 26 Abb. 3<br />
Hydria aus dem Umfeld der Polygnot-Gruppe; aus<br />
Rhodos<br />
Darstellung:<br />
Eine stehende und eine sitzende Frau musizieren<br />
gemeinsam auf Flöte und Lyra, Eros schweb mit<br />
einem Kranz auf die Sitzende zu. Publikum ist eine<br />
Frau mit Lyra und Kästchen und eine in ihr<br />
Himation eingehüllte Frau.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1060,147; CVA London (6) III Ic 4 Taf. 86, 1;<br />
Götte 1957, 56.<br />
V/23. London, British Mus. E 191<br />
Taf. 26 Abb. 4<br />
Hydria des Duomo-Painters um 450–440 v. Chr.;<br />
aus Kamiros/Rhodos.<br />
Darstellung:<br />
Flötenspielende Frau sitzt auf einem Klismos mit<br />
Fußschemel; Jüngling mit Bürgerstock legt ihr die<br />
Hand auf die Schulter; Eros mit Lyra, Frau mit<br />
Kästchen; Sakkos an der Wand.<br />
Inschrift: IKALOS<br />
Literatur:<br />
ARV² 1119,29; CVA London (6) III Ic 4 Taf. 86, 2;<br />
Bundrick 2005, 41 Abb. 26.
V/24. Kassel, Antikensammlung der Staatl.<br />
Kunstsammlungen T 435<br />
Taf. 26 Abb. 5<br />
Glockenkrater des Kassel-Malers um 430 v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau mit Plektron spielt das Barbiton, Eros<br />
stützt den rechten Fuß auf einen quadratischen<br />
Block, Jüngling mit Stab; Beutel, Schreibtafel<br />
Literatur:<br />
ARV² 1083,1; Beazley Addenda² 160; CVA Kassel<br />
(1) 55 f. Taf. 35, 3. 4; 36, 10.<br />
V/25. Sorrent, Mus. Correale di Terranova (o. Inv.)<br />
o. Abb.<br />
Hydria des Kassel-Malers um 440–430 v. Chr.; aus<br />
Sorrent/Italien<br />
Darstellung:<br />
Junge nackte Frau tanzt mit Helm, Schild und<br />
Lanze zur Flötenmusik einer sitzenden Frau die<br />
Pyrriche, fliegender Eros, Jüngling mit Bürgerstock<br />
Literatur:<br />
ARV² 1085,35; M.-H. Delavaud-Roux, Les Danses<br />
Armees en Grece Antique (Aix-en-Provence 1993)<br />
134 Nr. 34; P. Ceccarelli, La pirrica nell´ antichità<br />
greco romana. Studi sulla danza armata (Pisa 1998)<br />
Taf. 9, 2.<br />
V/26. Brauron, Arch. Mus. (o. Inv.)<br />
Taf. 27 Abb. 1<br />
Schwarzfiguriges Alabastron um 490–470 v. Chr.;<br />
aus dem sog. Heroon der Iphigenie<br />
Darstellung:<br />
Vermummter Jüngling mit Hund wird von einem<br />
Eros bekränzt, weiterer Jüngling mit Hase, Hahn.<br />
Literatur:<br />
Beazley Para. 249; Badinou 2003, 107. 159 Nr. A<br />
23 Taf. 45.<br />
V/27. Paris, Cabinet des Medailles 303<br />
Taf. 27 Abb. 2–4<br />
Schwarzfigurige, weißgrundige Lekythos des<br />
Emporion-Malers<br />
Darstellung:<br />
Sitzende Frau, Jüngling, Eros mit Kranz; Frau und<br />
Jüngling in vertrauter, intimer Haltung<br />
Inschrift: KALOS<br />
Literatur:<br />
ABV 584,27; Beazley Para. 291; CVA Paris,<br />
Bibliotheque Nationale (2) 67 Taf. 87, 10. 11. 15–<br />
17; C. Haspels, Attic Black-figured Lekythoi (Paris<br />
1936) 264 Nr. 27.<br />
V/28. Paris, Musée du Louvre G 521<br />
Taf. 27 Abb. 5<br />
Glockenkrater des Malers von Louvre G521<br />
Darstellung:<br />
Lagernde, trinkende und Kottabos spielende<br />
Männer, Eros mit Tympanon<br />
Literatur:<br />
ARV² 1441,1; CVA Paris, Musée du Louvre (5) III I<br />
e 6 f. Taf. 5, 6–8.<br />
V/29. Neapel, Nat. Mus. H 2202/82924/M 2735<br />
Taf. 27 Abb. 6<br />
Glockenkrater des 4. Jhs. v. Chr.<br />
Darstellung:<br />
Symposiasten und Hetären auf einer Kline, Eroten<br />
Literatur:<br />
Peschel 1987, 268; A. Schäfer, Unterhaltung beim<br />
Symposium. Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe<br />
von homerischer bis in spätklassische Zeit (Mainz<br />
1997) Taf. 51,2.<br />
V/30. Paris, Cabinet des Medailles 433<br />
Taf. 27 Abb. 7<br />
Glockenkrater der Peralta Reverse Group<br />
Darstellung:<br />
Eine Hetäre in den Armen eines Symposiasten wird<br />
von Eros mit einem Band / Kranz geschmückt,<br />
weitere Gelageteilnehmer mit Kylix, Schild (?);<br />
Weinrebe; Speisetische.<br />
Literatur:<br />
ARV² 1443,2; M. C. Miller, Athens and Persia in<br />
the Fifth Century B. C. A Study in Cultural<br />
Receptivity (Cambridge 1997) Taf. 74.<br />
S e i t e | 231
I/1. Boston (MA), Museum of Fine Arts 03.802<br />
Taf. 1 Abb. 1–4<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 51 Abb. 1; 109–<br />
111 Abb. 105–107<br />
I/2. Athen, Nat. Mus. 14790<br />
Taf. 1 Abb. 5<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 64 Abb. 23.<br />
I/3. St. Petersburg, St. Hermitage Mus. St. 1809<br />
Taf. 2 Abb. 6<br />
Abb. nach Mösch-Klingele 2006, Abb. 36.<br />
I/4. Berlin, Antikensammlung F 2372<br />
Taf. 2 Abb. 1<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 90 Abb. 73.<br />
I/5. Athen, Nat. Mus. 1629<br />
Taf. 2 Abb. 2. 3<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 127f. Abb. 128–<br />
129.<br />
II/1. Berlin, Antikensammlung F 2395<br />
Taf. 3 Abb. 4<br />
Abb. nach CVA Berlin (9) Taf. 26, 5.<br />
II/2. Athen, Nat. Mus. 1623A<br />
Taf. 3 Abb. 1–4<br />
Abb. nach R. F. Sutton Jr., The Oikos on Attic Red-<br />
Figure Pottery, in: A. P. Chapin (Hrsg.), Charis.<br />
Essays in Honor of Sara A. Immerwahr, Hesperia<br />
Suppl. 33 (Athen 2004) 341 f. Abb. 17, 12.<br />
II/3. Cambridge, Harvard University, Arthur M.<br />
Sackler Mus. 1960.342<br />
Taf. 4 Abb. 5<br />
Abb. nach Lewis 2002, 16 Abb. 1, 3.<br />
II/4. München, Antikensammlungen SL 476<br />
Taf. 4 Abb. 6<br />
Abb. nach Neils – Oakley 2003, 76 Abb. 12.<br />
II/5. Athen, Nat. Mus. CC 1552 bzw. 1588<br />
Taf. 3 Abb. 7; 4 Abb. 1. 2<br />
Abb. nach J. H. Oakley, The Phiale Painter (Mainz<br />
1990) Nr. 144 Taf. 116. 117.<br />
II/6. Athen, Nat. Mus. CC 1231 bzw. 1250<br />
Taf. 4 Abb. 3<br />
Abb. nach A. Brückner, Athenische Hochzeitsgeschenke,<br />
AM 32, 1907, Beil. 1.<br />
II/7. London, British Mus. E 396<br />
Taf. 4 Abb. 4<br />
Abb. nach I. Jenkins, Greek and Roman Life<br />
(London 1986) 33 Abb. 39.<br />
S e i t e | 232<br />
Abbildungsnachweis<br />
II/8. Münster, Wilhelms-Univ., Archäologisches<br />
Mus. 66<br />
Taf. 4 Abb. 5<br />
Abb. nach K. P. Stähler, Eine unbekannte Pelike<br />
des Eucharidesmalers im Archäologischen Museum<br />
der <strong>Universität</strong> Münster (Köln 1967) Taf. 2.<br />
II/9. Providence (RI), Rhode Island School of<br />
Design 25.088<br />
Taf. 4 Abb. 6. 7<br />
Abb. nach Neils – Oakley 2003, 236 Nr. 36, a–b.<br />
II/10. Cleveland, Mus. of Art 1925.1342<br />
Taf. 5 Abb. 1<br />
Abb. nach J. H. Oakley, Death and the Child, in:<br />
Neils – Oakley 2003, 187 Abb. Cat. 111.<br />
II/11. London, British Mus. E 193<br />
Taf. 5 Abb. 2<br />
Abb. nach CVA London (5) III Ic Taf. 82, 3.<br />
II/12. London, Britisch Mus. E 215<br />
Taf. 5 Abb. 3<br />
Abb. nach R. E. Leader, In Death not divided:<br />
Gender, Family, and State on Classical Athenian<br />
Grave Stelae, AJA 101, 1997, 687 Abb. 1.<br />
II/13. Athen, Nat. Mus. 2383 bzw. CC1590<br />
Taf. 5 Abb. 4. 5<br />
Abb. nach Badinou 2003, Nr. E 46 Taf. 23.<br />
II/14. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum B<br />
3078I<br />
Taf. 6 Abb. 1<br />
Abb. nach CVA Karlsruhe (1) 28 Taf. 22, 1–2.<br />
II/16. Gotha, Schlossmuseum 64<br />
Taf. 6 Abb. 2–4<br />
Abb. nach CVA Gotha (2) Taf. 62, 2; 63, 1–2.<br />
II/17. New York, Metropolitan Museum of Art<br />
17.230.15<br />
Taf. 6 Abb. 5; 7 Abb. 1. 2<br />
Abb. nach Lewis 2002, 143 Abb. 4, 8; G. M. A.<br />
Richter, Red-Figured Athenian Vases in the<br />
Metropolitan Museum of Art (New Haven 1936)<br />
Nr. 138 Taf. 141.<br />
II/18. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 93<br />
Taf. 7 Abb. 3<br />
Abb. nach S. R. Roberts, The Attic Pyxis (Chicago<br />
1978) Taf. 27.<br />
II/20. Palermo, Mormino Coll. 818<br />
Taf. 7 Abb. 4. 5
Abb. nach J. H. Oakley, The Phiale Painter (Mainz<br />
1990) Nr. 154ter Taf. 132, C. D;<br />
II/21. Würzburg, Martin-von-Wagner Museum<br />
L546 bzw. 546<br />
Taf. 7 Abb. 6–8<br />
Abb. nach Badinou 2003, A 246 Taf. 96.<br />
II/22. Hannover, Kestner Museum L 1.1982<br />
Taf. 8 Abb. 1<br />
Abb. nach D. Buitron-Oliver, Douris. A Master-<br />
Painter of Athenian Red-Figure Vases (Mainz<br />
1995) Taf. 90.<br />
II/23. Athen, M. Vlasto<br />
Taf. 8 Abb. 2<br />
Abb. nach Badinou 2003, Nr. A 336 Taf. 119.<br />
II/24. Basel, Antikenmuseum und Sammlung<br />
Ludwig BS 490<br />
Abb. nach CVA Basel, Antikenmuseum und<br />
Sammlung Ludwig (2) Taf. 26, 2.<br />
II/25. <strong>Erlangen</strong>, Antikensammlung I 303<br />
Taf. 8 Abb. 4<br />
Abb. nach M. Boss – P. Kranz – U. Kreilinger<br />
(Hrsg.), Antikensammlung <strong>Erlangen</strong>.<br />
Auswahlkatalog (<strong>Erlangen</strong> 2002) 74 f. Nr. 28.<br />
II/26. London, British Mus. E339<br />
Taf. 8 Abb 5. 6<br />
Abb. nach CVA London, British Mus. (5) III I c<br />
Taf. 67, 1A. B.<br />
II/28. Kopenhagen, Nat. Mus. 149/Chr. VIII 810<br />
Taf. 9 Abb. 1<br />
Abb. nach CVA Kopenhagen, Nat. Mus. (3) Taf.<br />
133.<br />
II/29. Berlin, Antikensammlung 31426<br />
Taf. 9 Abb. 2–4<br />
Abb. nach CVA Berlin (2) Taf. 98, 1–3.<br />
II/30. Vatikan, Mus. Gregoriano Etrusco 16581<br />
Taf. 9 Abb. 5<br />
Abb. nach Kunisch 1997, Taf. 111, 334.<br />
II/31. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Mus.<br />
AT 263<br />
Taf. 9 Abb. 6<br />
Abb. nach CVA Braunschweig, Herzog Anton<br />
Ulrich-Museum Taf. 18, 4.<br />
II/32. Florenz, Mus. Arch. PD266<br />
Taf. 10 Abb. 1<br />
CVA Florenz, Museo Archeologico (3) Taf. 112, 2.<br />
III/1. Toledo(OH), The Toledo Museum of Art<br />
72.55 bzw. 1972.55<br />
Taf. 10 Abb. 2. 3<br />
Abb. nach Kunisch 1997, Taf. 64. 179.<br />
III/2. Paris, Cabinet des Médailles 508<br />
Taf. 10 Abb. 4. 5<br />
Abb. nach P. Schmitt-Pantel 1993, 195 Abb. 12.<br />
III/3. Würzburg, Martin-von-Wagner Museum 506<br />
bzw. L 506<br />
Taf. 10 Abb. 6<br />
Abb. nach Reinsberg 1993, 79 Abb. 31.<br />
III/4. Berlin, Antikensammlung F 2252<br />
Taf. 11 Abb. 1<br />
Abb. nach N. Strawczynski, Lecture<br />
Anthropologique et/ou documentaire? Quelches<br />
remarques sur un livre de Panayota Badinou, La<br />
Laine et le Parfum, RA 2005, 312 Abb. 1.<br />
III/5. Cambridge (MA), Harvard Univ., Arthur<br />
Sackler Mus. 1972.45<br />
Taf. 11 Abb. 2<br />
Abb. nach Reeder 1995, 183 Nr. 37.<br />
III/6. Paris, Cabinet des Medailles 507<br />
Taf. 11 Abb. 3<br />
Abb. nach E. Böhr, Mit Schopf an Brust und Kopf.<br />
Der Jungfernkranich, in: A. J. Clark – J. Gaunt – B.<br />
Gilman (Hrsg.), Essays in Honor of Dietrich von<br />
Bothmer (Amsterdam 2002) 43 Abb. 1.<br />
III/7. Berkeley (CA), University of California<br />
8.923 Taf. 11 Abb. 4. 5<br />
Abb. nach CVA University of California (1) Taf.<br />
35, 1A. C.<br />
III/8. Florenz, Mus. Arch. Etrusco 81602<br />
Taf. 11 Abb. 6<br />
Abb. nach CVA Florenz (3) Taf. 103, 3.<br />
III/9. Athen, Nat. Mus. 2180<br />
Taf. 11 Abb. 7. 8<br />
Abb. nach Mercati 2003, Nr. B8 Taf. 28.<br />
III/10. Rhodos, Mus. Arch. 13261<br />
Taf. 12 Abb. 1<br />
Abb. nach CVA Rodi (2) Taf. 5, 3.<br />
III/11. Chiusi, Mus. Arch. Naz. 1835<br />
Taf. 12 Abb. 2<br />
Abb. nach CVA Chiusi (2) Taf. 28, 2.<br />
III/12. South Hadley (MA), Mount Holyoke<br />
College 1932 BSII5<br />
Taf. 12 Abb. 3<br />
Abb. nach Lewis 2002, 186 Abb. 5, 9.<br />
III/13. Athen, Kerameikos Mus. 2713<br />
Taf. 12 Abb. 4–6<br />
Abb. nach Badinou 2003, Nr. A 136 Taf. 80.<br />
III/14. Palermo, Mormino Coll. 796<br />
Taf. 13 Abb. 1–3<br />
Abb. nach CVA Palermo, Collezione Mormino (1)<br />
III Y Taf. 1, 2–4.<br />
S e i t e | 233
III/15. Athen, Nat. Mus. 1239 bzw. CC1204<br />
Taf. 13 Abb. 4–6<br />
Abb. nach U. Knigge, Ein rotfiguriges Alabastron,<br />
AM 79, 1964, Beil. 57, 3–4.<br />
III/16. Baltimore, Johns Hopkins Univ. B4<br />
Taf. 13 Abb. 7<br />
Abb. nach CVA Baltimore (2) 12 f. Taf. 3, 2.<br />
III/17. Kopenhagen, Nat. Mus. 320 bzw. 125<br />
Taf. 13 Abb. 8<br />
Abb. nach Meyer 1988, 115 Abb. 29.<br />
III/18. Paris, Musée du Louvre CA 1852<br />
Taf. 14 Abb. 1. 2<br />
Abb. nach S. v. Reden Exchange in Ancient Greece<br />
(London 1995) 211 Taf. 8, C. D.<br />
III/19. Oxford, Privat<br />
Taf. 14 Abb. 3<br />
Abb. nach D. Buitron-Oliver, Douris. A Master-<br />
Painter of Athenian Red-Figure Vases (Mainz<br />
1995) Taf. 83, 141.<br />
III/20. Ehem. Dresden, Kunstgewerbemus.<br />
Taf. 14 Abb. 4<br />
Abb. nach D. Buitron-Oliver, Douris. A Master-<br />
Painter of Athenian Red-Figure Vases (Mainz<br />
1995) Taf. 40, 56.<br />
III/23. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek I. N.<br />
2718<br />
Taf. 14 Abb. 5<br />
Abb. nach CVA Kopenhagen, Ny Carlsberg<br />
Glyptothek (1) Taf. 65, 3.<br />
III/24. Berlin, Antikensammlung F 2254<br />
Taf. 14 Abb. 6. 7<br />
Abb. nach Badinou 2006, A 253 Taf. 97.<br />
III/25. Athen, Nat. Mus. 1441 bzw. CC 1277<br />
Taf. 15 Abb. 1<br />
Abb. nach S. B. Matheson, Polygnotos and Vase<br />
Painting in Classical Athens (Wisconsin 1995) Kat.<br />
Nr. P 61 Taf. 48.<br />
III/26. Heidelberg, Ruprecht-Karls-<strong>Universität</strong>,<br />
Archäologisches Institut 64.5<br />
Taf. 15 Abb. 2<br />
Abb. nach Lewis 2002, 36 Abb. 1, 19.<br />
III/27. Agrigent, Mus. Arch. Reg. AG 22276<br />
Taf. 15 Abb. 3<br />
Abb. nach G. Giudice, Il tornio, la nave, le terre<br />
lontane. Ceramografi attici in Magna Grecia nella<br />
seconda metà del V sec. a. C. rotte e vie di<br />
distribuzione (Rom 2007) Nr. 199 Abb. 117.<br />
III/28. Krakau, Mus. Czartoryski 1473<br />
Taf. 15 Abb. 4<br />
Abb. nach CVA Krakau (1) Taf. 12, 2.<br />
S e i t e | 234<br />
III/29. Basel, Kunsthandel, Münzen und Medaillen<br />
A.G.<br />
Taf. 15 Abb. 5. 6<br />
Abb. nach MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion<br />
26, 5.10.1963 (Basel 1963) Taf. 50, 139.<br />
III/30. Rom, Museo Nazionale di Villa Giulia 1054<br />
Taf. 16 Abb. 1<br />
Abb. nach Lewis 2002, 198 Abb. 5, 18.<br />
III/31. Adolphseck, Schloss Fasanerie 41<br />
Taf. 16 Abb. 2. 3<br />
Abb. nach S. v. Reden, Exchange in Ancient<br />
Greece (London 1995) Taf. 4, C-D.<br />
II/32. Kopenhagen, Nat. Mus. 153 bzw. ChrVIII<br />
520<br />
Taf. 16 Abb. 4<br />
Abb. nach Lewis 2002, 105 Abb. 3, 10.<br />
III/33. München, privat<br />
Taf. 16 Abb. 5. 6<br />
Abb. nach MuM, Kunstwerke der Antike. Auktion<br />
51, 14.-15.03.1975 (Basel 1975) Taf. 33, 148.<br />
III/34. Kopenhagen, Thorvaldsen Museum H114<br />
Taf. 17 Abb. 1<br />
Abb. nach Meyer 1988, 111 Abb. 24.<br />
III/35. London, British Mus. 1914.5-12.1<br />
Taf. 17 Abb. 2<br />
Abb. nach Lewis 2002, 195 Abb. 5, 15.<br />
III/36. San Antonio (TX), San Antonio Mus. of Art<br />
86.134.59<br />
Taf. 17 Abb. 3<br />
Abb. nach Reeder 1995, 181 Nr. 36.<br />
II/37. Syrakus, Mus. Arch. Naz. 18426<br />
Taf. 17 Abb. 4<br />
Abb. nach S. von Reden, Exchange in Ancient<br />
Greece (London 1995) Taf. 7, B.<br />
III/38. Berlin, Antikensammlung F 2624<br />
Taf. 17 Abb. 5<br />
Abb. nach Badinou 2003, E 48 Taf. 25.<br />
III/39. Tampa (FL), Mus. Of Art 86.70<br />
Taf. 17 Abb. 6<br />
Abb. nach H. A. Shapiro, Fathers and Sons, Men<br />
and Boys, in: Neils – Oakley 2003, 99 Abb.<br />
III/40. Kopenhagen, Nat. Mus. 124<br />
Taf. 18 Abb. 1–3<br />
Abb. nach A. Schäfer, Unterhaltung beim<br />
griechischen Symposium. Darbietungen, Spiele und<br />
Wettkämpfe von homerischer bis in spätklassische<br />
Zeit (Mainz 1997) Taf. 36, 2–4.<br />
III/42. San Antonio (TX), Art Mus. 86.34.2<br />
Taf. 18 Abb. 4
Abb. nach H. A. Shapiro u. a. (Hrsg.), Greek Vases<br />
in the San Antonio Museum of Art (San Antonio<br />
1995) 173 Nr. 87.<br />
III/43. Berlin, Antikensammlung F 2261<br />
Taf. 18 Abb. 5–7<br />
Abb. nach CVA Berlin (3) Taf. 136, 1. 3–4;<br />
IV/1. Buffalo, Museum of Science C 23262<br />
Taf. 19 Abb. 1<br />
Abb. nach Sinos-Oakley 1993, 122 Abb. 122.<br />
IV/2. München, Museum antiker Kleinkunst 2427<br />
bzw. J 347<br />
Taf. 19 Abb. 2<br />
Abb. nach N. Hoesch, Hetären, in: K. Vierneisel –<br />
B. Kaeser (Hrsg.), Kunst der Schale. Kultur des<br />
Trinkens. Ausstellungskatalog München (München<br />
1990) 233 Abb. 37, 7.<br />
IV/3. Paris, Musée du Louvre G 143<br />
Taf. 19 Abb. 3<br />
Abb. nach Kunisch 1997, Taf. 131, 381.<br />
IV/4. Berlin, Antikensammlung F 2269<br />
Taf. 19 Abb. 4<br />
Abb. nach Dierichs 1993, 113 Abb. 197.<br />
IV/5. New York, Metropolitan Museum 07.286.50<br />
Taf. 19 Abb. 5<br />
Abb. nach Reeder 1995, 193 Nr. 41.<br />
IV/7. Athen, Nat. Mus., Acropolis Collection<br />
1.2277<br />
Taf. 19 Abb. 6<br />
Abb. nach Badinou 2003, A 79 Taf. 64.<br />
IV/8. Chicago (IL), Art Institut 1911.456<br />
Taf. 20 Abb. 1<br />
Abb. nach W. G. Moon (Hrsg.), Greek Vase-<br />
Painting in Midwestern Collections.<br />
Ausstellungskatalog Chicago ²(Chicago 1981) 171<br />
Nr. 97 rechts.<br />
IV/9. London, British Mus. E 44 bzw. 1836.2-24.25<br />
Taf. 20 Abb. 2<br />
Abb. nach CVA London (9) Taf. 9, B.<br />
IV/10. Würzburg, Martin-von-Wagner Museum<br />
541 bzw. L 541 bzw. H 4455<br />
Taf. 20 Abb. 3. 4<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 65 Abb. 24–25.<br />
IV/11. Athen, Nat. Mus. 1619 bzw. CC 1239<br />
Taf. 20 Abb. 5<br />
Abb. nach A. Brückner, Athenische Hochzeitsgeschenke,<br />
AM 32, 1907, 93 Abb. 5.<br />
IV/12. London, British Mus. E 51 bzw. 1843.11-<br />
3.94<br />
Taf. 20 Abb. 6<br />
Abb. nach CVA London (9) Taf. 37, B.<br />
IV/13. Paris, Musée du Louvre CA 587<br />
Taf. 20 Abb. 7<br />
Abb. nach E. C. Keuls, Attic Vase-Painting and the<br />
Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.),<br />
Ancient Greek Art and Iconography (Wisconsin<br />
1983) 223 Abb. 14, 31.<br />
IV/14. Athen, Agora Mus. P 18283<br />
Taf. 20 Abb. 8<br />
Abb. nach Badinou 2003, Nr. E 60 Taf. 32.<br />
IV/15. Athen, Benaki-Mus. 31117<br />
Taf. 21 Abb. 1. 2<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 63 Abb. 22.<br />
IV/16. Christchurch (N. Z.), Canterbury Mus. AR<br />
430<br />
Taf. 21 Abb. 3<br />
Abb. nach Lewis 2002, 122 Abb. 3, 23.<br />
IV/17. Syndey, Nicholson Mus. 98.42 (M66)<br />
Taf. 21 Abb. 4<br />
Abb. nach LIMC III (1986) 906 Nr. 642 Taf. 646 s.<br />
v. Eros (Ch. Augé – P. Lonant de Bellefonds)<br />
IV/18. St. Petersburg, St. Hermitage Mus. ST 1723<br />
bzw. B637 bzw. 1602<br />
Taf. 21 Abb. 5<br />
Abb. nach M. d´Abruzzo, Una pasta vitrea da<br />
Altino e il mito di Danae, RdA 17, 1993, Taf.<br />
D´ABRUZZO Abb. 2.<br />
III/19. Paris, Musée du Louvre CA 925<br />
Taf. 21 Abb. 6<br />
Abb. nach M. d´Abruzzo, Una pasta vitrea da<br />
Altino e il mito di Danae, RdA 17, 1993, Taf.<br />
D´ABRUZZO Abb.7.<br />
IV/20. Brüssel, Musées Royaux d´Art et d´Histoire<br />
R 351<br />
Taf. 21 Abb. 7<br />
Abb. nach Kilmer 1993, Taf. R 62.<br />
IV/21. Paris, Musée du Louvre G 13<br />
Taf. 22 Abb. 1<br />
Abb. nach Reeder 1995, 109 Abb. 10.<br />
IV/22. Boston (MA), Museum of Fine Arts<br />
1970.233 Taf. 22 Abb. 2<br />
Abb. nach D. Buitron-Oliver, Douris. A Master-<br />
Painter of Athenian Red-Figure Vases (Mainz<br />
1995) Taf. 111, 233.<br />
IV/23. München, ehem. Sammlung Arndt<br />
Taf. 22 Abb. 3<br />
Abb. nach Dierichs 1993, 73 Abb. 129.<br />
IV/24. Malibu, J. Paul Getty Mus. 83.AE.321<br />
Taf. 22 Abb. 4<br />
S e i t e | 235
Abb. nach Dierichs 1993, 78 Abb. 145.<br />
IV/25. Berlin, Antikensammlung F 2414<br />
Taf. 22 Abb. 5<br />
Abb. nach Dierichs 1993, 76 Abb. 140.<br />
V/1. Tübingen, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst.<br />
5439<br />
Taf. 23 Abb. 1<br />
Abb. nach CVA Tübingen (4) Taf. 18, 1.<br />
V/2. Paris, Musée du Louvre G 424<br />
Taf. 23 Abb. 2<br />
Abb. nach LIMC II (1984) Taf. 144, 1474.<br />
V/3. Florenz, Museo Archeologico Nazionale<br />
81948<br />
Taf. 23 Abb. 3<br />
Abb. nach H. A. Shapiro, Personifications in Greek<br />
Art. The Representation of Abstract Concepts 600-<br />
400 v. Chr. (Zürich 1993) 118 Abb. 70.<br />
V/4. Tarquinia, Mus. Naz. Tarquiniense RC 5291<br />
Taf. 23 Abb. 4<br />
Abb. nach CVA Tarquinia (2) III I Taf. 18, 3.<br />
V/5. Rom, Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia 20846<br />
Taf. 23 Abb. 5<br />
Abb. nach Reeder 1995, 358 Nr. 114.<br />
V/6. Berlin, Antikensammlung F 2373<br />
Taf. 23 Abb. 6<br />
Abb. nach Mösch-Klingele 2006, Abb. 58.<br />
V/8. Oxford, Ashmolean Mus. 1966.888<br />
Taf. 24 Abb. 1<br />
Abb. nach R. Mösch-Klingele, Die loutrophoros im<br />
Hochzeits- und Begräbnisritual des 5. Jahrhunderts<br />
v. Chr. in Athen (Bern 2006) Abb. 41, A.<br />
V/9. Athen, Nat. Mus. 16279<br />
Taf. 24 Abb. 2<br />
Abb. nach Mösch-Klingele 2006, Abb. 56.<br />
V/10. Boston (MA), Mus. of Fine Arts 10.223<br />
Taf. 24 Abb. 3<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 83 Abb. 60.<br />
V/11. Oxford, Ashmolean Mus. 1927.4067<br />
Taf. 24 Abb. 4<br />
Abb. nach Oakley – Sinos 1993, 121 Abb. 121.<br />
V/12. Berlin, Antikensammlung F 2520<br />
Taf. 24 Abb. 5<br />
Abb. nach CVA Berlin (3) Taf. 139, 5-6.<br />
V/13. Giessen, Justus-Liebig-Univ., Antikensammlung<br />
KIII44 bzw. 44<br />
Taf. 24 Abb. 6<br />
Abb. nach CVA Giessen (1) Taf. 36, 3.<br />
S e i t e | 236<br />
V/14. London, British Mus. E 187<br />
Taf. 25 Abb. 1<br />
Abb. nach CVA London (5) III Ic Taf. 82, 2.<br />
V/15. Berlin, Antikensammlung F 2393<br />
Taf. 25 Abb. 2<br />
Abb. nach CVA Berlin (9) Taf. 21, 3.<br />
V/16. University, Univ. of Mississippi, Univ.<br />
Museums 77.3.196<br />
Taf. 25 Abb. 3<br />
Abb. nach H. A. Shapiro (Hrsg.), Art, Myth and<br />
Culture. Greek Vases from Southern Collections<br />
(Tulane 1981) 27 Nr. 6.<br />
V/17. Agrigent, Mus, Arch. Regionale (o. Inv.)<br />
Taf. 25 Abb. 4<br />
Abb. nach P. Griffo, Il Museo Archeologico<br />
Regionale di Agrigento (Rom 1987) 269 Nr. 228.<br />
V/18. Athen, Nat. Mus. 2179 bzw. CC1589<br />
Taf. 25 Abb. 5. 6<br />
Abb. nach Badinou 2003, Nr. E 57 Taf. 30.<br />
V/19. San Simeon (CA), Hearst Historical State<br />
Monument 10004<br />
Taf. 26 Abb. 1<br />
Abb. nach Beazley-Archiv.<br />
V/20. Ehem. Stettin, Mus. (o. Inv.)<br />
Taf. 26 Abb. 2<br />
Abb. nach Bundrick 2008, 323 Abb. 15.<br />
V/22. London, British Mus. E 189<br />
Taf. 26 Abb. 3<br />
Abb. nach CVA London (6) III Ic Taf. 86, 1.<br />
V/23. London, British Mus. E 191<br />
Taf. 26 Abb. 4<br />
Abb. nach CVA London (6) III Ic Taf. 86, 2.<br />
V/24. Kassel, Antikensammlung der Staatlichen<br />
Kunstsammlungen T 435<br />
Taf. 26 Abb. 5<br />
Abb. nach CVA Kassel (1) Taf. 35, 3.<br />
V/26. Brauron, Arch. Mus. (o. Inv.)<br />
Taf. 27 Abb. 1. 2<br />
Abb. nach Badinou 2003, Nr. A 23 Taf. 45.<br />
V/27. Paris, Cabinet des Medailles 303<br />
Taf. 27 Abb. 2–4<br />
Abb. nach CVA Paris, Bibliotheque Nationale (2)<br />
Taf. 87, 15–17.<br />
V/28. Paris, Musée du Louvre G 521<br />
Taf. 27 Abb. 5<br />
Abb. nach CVA Paris, Musée du Louvre (5) III Ie<br />
Taf. 5, 6.
V/29. Neapel, Nat. Mus. H 2202 bzw. 82924 bzw.<br />
M 2735<br />
Taf. 27 Abb. 5<br />
Abb. nach A. Schäfer, Unterhaltung beim<br />
griechischen Symposium. Darbietungen, Spiele und<br />
Wettkämpfe von homerischer bis in spätklassische<br />
Zeit (Mainz 1997) Taf. 51, 2.<br />
V/30. Paris, Cabinet des Medailles 433<br />
Taf. 27 Abb. 6<br />
Abb. nach M. C. Miller, Athens and Persia in the<br />
Fifth Century B. C. A Study in Cultural Receptivity<br />
(Cambridge 1997) Taf. 74.<br />
S e i t e | 237
S e i t e | 238<br />
Literaturliste<br />
(Es liegen die seit dem 1. Aug. 2006 gültigen Zitierrichtlinien des DAI zugrunde)<br />
ARISTOPHANES, Sämtliche Komödien I. II, übers. von L. Seeger (Zürich 1952/53).<br />
ARISTOTELES, Oikonomika. Schriften zu Hauswirtschaft und Finanzwesen, übers. und erl. von R. Zoepffel<br />
(Berlin 2006).<br />
ARISTOTELES, Nikomachische Ethik, Philosophische Schriften 3, übers. von E. Rolfes, bearbeitet von G. Bien<br />
(Hamburg 1995).<br />
ARISTOTELES, Politik, Philosophische Schriften 4, übers. von E. Rolfes (Hamburg 1995).<br />
ARISTOTELES, The Art of Rhetorik, griech.-engl., übers. von J. H. Freese (London 1991).<br />
ATHENAIOS, Das Gelehrtenmahl, übers. von C. <strong>Friedrich</strong> (Stuttgart 1998/2001).<br />
CORNELIUS NEPOS, Berühmte Männer, übers. von G. Wirth ³(München 1978)<br />
DEMOSTHENES IV. Private Orations XXVII-XL, übers. von A. T. Murray (London 1958).<br />
EURIPIDES, Sämtliche Tragödien und Fragmente I–V, hrsg. von G. A. Seeck, übers. von E. Buschor (München<br />
1972/77).<br />
HERODOT, Geschichten und Geschichte I–II, übers. von W. Marg (Zürich 1973/1983).<br />
HESIOD, Theogonie. Werke und Tage, hrsg. und übers. von A. von Schirnding (München 1991).<br />
ISOKRATES, Sämtliche Werke I–II, übers. von C. Ley-Hutton (Stuttgart 1993/1997).<br />
LYSIAS, übers. von S. C. Todd (Austin 2000).<br />
MENANDER, Herondas. Werke in einem Band, übers. von K. und U. Treu (Berlin 1980).<br />
MENANDER, Der Menschenfeind. Das Schiedsgericht, bearb. von O. Vicenzi – W. Schadewaldt (1962).<br />
MENANDER, Dyskolos, hrsg. von M. Treu (München 1960).<br />
PLATON, Phaidon, übers. von F. Schleiermacher (Stuttgart 1987).<br />
PLATON, Nomoi, Werke 8, 1-2, übers. und bearb. von K. Schöpsdau (Darmstadt 1990).<br />
PLATON, Das Gastmahl, übers. Von K. Hildebrandt (Stuttgart 1979)<br />
PLUTARCH, Fünf Doppelbiographien I. II., übers. von K. <strong>Ziegler</strong> – W. Wuhrmann (Darmstadt 1994).<br />
PLUTARCH´s Moralia II, griech.-engl., übers. von F. C. Babbit (London 1971).<br />
SOPHOKLES, Tragödien und Fragmente, griech.-dt., hrsg. und übers. von W. Willige (1966).<br />
THEOPHRAST, Charaktere, griech.-dt., hrsg. von D. Klose (Stuttgart 1970).<br />
XENOPHON, Erinnerungen an Sokrates, griech.-dt., hrsg. von P. Jaerison (München 1962).<br />
XENOPHON, Ökonomische Schriften, griech.-dt., hrsg. von G. Audring (Berlin 1992).<br />
M. D´ABRUZZO, Una pasta vitrea da Altino e il mito di Danae. Osservazioni sull´ iconografia RdA 17, 1993,<br />
17–33.<br />
P. ARIÈS, Liebe in der Ehe, in: P. Ariès – A. Béjin (Hrsg.), Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen<br />
der Sinnlichkeit. Zur Geschichte der Sexualität im Abendland ³(Frankfurt a. M. 1984) 165–175.<br />
P. ARIÈS, Liebe in der Ehe, in: P. Ariès – A. Béjin (Hrsg.), Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen<br />
der Sinnlichkeit. Zur Geschichte der Sexualität im Abendland ³(Frankfurt a. M. 1984) 165–175.<br />
P. BADINOU, La laine et le parfum. Épinetra et Alabastres. Forme, Iconographie et Fonction. Recherche de<br />
céramique attique féminine (Louvain 2003).<br />
J. BARBERA – E. SANMARTI, Arte Griego en Espana (Barcelona 1987).<br />
M. BEARD, Adopting an Approach II, in T. Rasmussen – N. Spivey (Hrsg.), Looking at Greek<br />
Vases (Cambridge 1991) 12–36.<br />
J. D. BEAZLEY, Der Pan-Maler (Berlin 1931).<br />
L. A. BEAUMONT, The Changing Face of Childhood, in J. Neils, J. H. Oakley (Hrsg.), Coming of Age in<br />
Ancient Greece. Images of Childhood from the Classical Past. Ausstellungskatalog Hanover (New Haven<br />
2003) 59–83.<br />
L. A. BEAUMONT, Changing Childhoods? The Representation of Children in Attic Figured Vase Painting, in:<br />
B. Schmaltz – M. Söldner (Hrsg.), Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des<br />
Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom 24. bis 28.9.2001 (Münster 2003) 108–110.<br />
F. A. G. BECK, Album of Greek Education. The Greeks at School and Play (Sydney 1975).<br />
C. BÉRARD – J.-P. VERNANT (Hrsg.), Die Bilderwelt der Griechen (Mainz 1985).<br />
C. BÉRARD, The Order of Women, in: C. Bérard et al. (Hrsg.), A City of Images. Iconography and Society in<br />
Ancient Greece (1989) 89–108.<br />
J. BERGEMANN, Demos und Thanatos. Untersuchungen zum Wertsystem der Polis im Spiegel der attischen<br />
Grabreliefs des 4. Jahrhunderts v. Chr. und zur Funktion der gleichzeitigen Grabbauten (München 1997).<br />
H. BLANCK, Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer ²(Darmstadt 1996).
M. BLECH, Studien zum Kranz bei den Griechen (Berlin 1982).y<br />
S. BLUNDELL, Women in Ancient Greece (Cambridge 1995).<br />
S. BLUNDELL, Women in Classical Athens (London 1998).<br />
S. BLUNDELL – M. WILLIAMSON (Hrsg.), The Sacred and the Feminine in Ancient Greece (London 1998).<br />
J. BOARDMAN – E. LA ROCCA (Hrsg.), Eros in Grecia (Mailand 1975).<br />
J. BOARDMAN, Schwarzfigurige Vasen aus Athen 4( Mainz 1994).<br />
J. BOARDMAN, Rotfigurige Vasen aus Athen. Die archaische Zeit 4( Mainz 1994).<br />
J. BOARDMAN, Rotfigurige Vasen aus Athen. Die klassische Zeit 2( Mainz 1996).<br />
S. BÖHM, Rez. zu S. Lewis, Athenian Woman. An Iconographic Handbook (London 2002), Gnomon 77, 2005,<br />
50–54.<br />
S. BÖHM, Rez. zu G. Ferrari, Figures of Speech. Men and Maidens in Ancient Greece (Chicago 2002), Gnomon<br />
77, 2005, 347–350.<br />
S. BÖHM, Griechische Heroinnen. „Girl Power“ und andere Frauenideale im antiken Griechenland, in: E.<br />
Klinger – S. Böhm – T. Seidl (Hrsg.), Der Körper und die Religion. Das Problem der Konstruktion von<br />
Geschlechterrollen (Würzburg 2000) 67–91.<br />
E. BÖHR, Mit Schopf an Brust und Kopf. Der Jungfernkranich, in: A. J. Clark – J. Gaunt – B. Gilman (Hrsg.),<br />
Essays in Honor of Dietrich von Bothmer (Amsterdam 2002) 37–47.<br />
E. BÖHR, A Rare Bird on Greek Vases: The Wryneck, in: J.H. Oakley – W. D. E. Coulson – O. Palagia (Hrsg.),<br />
Athenian Potters and Painters. The Conference Proceedings (Oxford 1997) 109–123.<br />
L. BONAFANTE, Nursing Mothers in Classical Art, in: A. O. Koloski-Ostrow – C. L. Lyons (Hrsg.), Naked<br />
Truths. Women, Sexuality, and Gender in Classical Art and Archeology (London 1997) 174–196.<br />
B. BORG, Der Logos des Mythos. Allegorien und Personifikationen in der frühen griechischen Kunst (München<br />
2002).<br />
N. BOYMEL KAMPEN (Hrsg.), Sexuality in Ancient Art. Near East, Egypt, Greece, and Italy (Cambridge<br />
1996).<br />
C. BREUER, Reliefs und Epigramme griechischer Privatgrabmäler. Zeugnisse bürgerlichen Selbstverständnisses<br />
vom 4. bis 2. Jahrhundert v. Chr. (Köln 1995).<br />
R. BROCK, The Labour of Women in Classical Athens, ClQ 44, 1994, 336–346.<br />
A. BRÜCKNER, Lebensregeln auf athenischen Hochzeitsgeschenken, WPrBerl 62, 1902, 3–18.<br />
A. BRÜCKNER, Anakalypteria, WPrBerl 64, 1904, 3–19.<br />
P. BRULÉ, Women of Ancient Greece (Edinburgh 2003).<br />
E. BRÜMMER, Griechische Truhenbehälter, JdI 100, 1985, 1–168.<br />
D. BUITRON-OLIVER, Douris. A Master-Painter of Athenian Red-Figure Vases (Mainz 1995).<br />
S. D. BUNDRICK, Expressions of Harmony: Representations of Female Musicians in Fifth-Century Athenian<br />
Vase-Painting (Diss. Emory Univ. 1998).<br />
S. D. BUNDRICK, Music and Image in Classical Athens (Cambridge 2005).<br />
S. D. BUNDRICK, The Fabrik of the City. Imaging Textile Production in Classical Athens, Hesperia 77, 2008,<br />
283-334.<br />
N. CAHILL, Household and City Organization at Olynthus (New Haven 2002).<br />
D. L. CAIRNS, The Meaning of the Veil in Ancient Greek Culture, in: L. Llewellyn-Jones (Hrsg.), Women´s<br />
Dress in the Ancient Greek World (London 2002) 73–93.<br />
C. CALAME, I Greci e l´ Eros. Simboli, pratiche e luoghi (Rom 1992).<br />
C. CALAME, Choruses of Young Women in Ancient Greece. Their Morphology, Religious Role, and Social<br />
Functions (Oxford 2001).<br />
R. S. CALDWELL, The Misogyny of Eteocles, Arethusa 6, 1973, 197–231.<br />
A. CAMERON, The Exposure of Children and Greek Ethics, Classical Review 46 (1932) 105–114.<br />
E. CANTARELLA, Pandora´s Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity<br />
(Baltimore 1987).<br />
L. D. CASKEY, The Ludovisi and Boston Reliefs, AJA 22, 1918, 101–145.<br />
O. CAVALIER (Hrsg.), Silence et Fureur. La femme et le marriage en Grece. Les antiquites grecques du Musée<br />
Calvet (Avignon 1997).<br />
P. CECCARELLI, La pirrica nell´ antichità greco romana. Studi sulla danza armata (Pisa 1998).<br />
J. CHAMAY, La Frappe de la Monnaie, in: A. J. Clark – J. Gaunt – B. Gilman (Hrsg.), Essays in Honor of<br />
Dietrich von Bothmer (Amsterdam 2002) 69–72.<br />
H. CANCIK-LINDEMAIER, Ehe und Liebe, Entwürfe griechischer Philosophen und römischer Dichter, in:<br />
A.K. Siems (Hrsg.), Sexualität und Erotik in der Antike. Wege der Forschung 605 (Darmstadt 1988) 233–<br />
263.<br />
M.-T. CHARLIER – G. RAEPSET, Etude d´un comportement social. Les relations entre parents et enfants dans<br />
la societé athénienne à l´époche classique, AntCl 40, 1971, 589–606.<br />
L. CLARK, Notes on Small Textile Frames Pictured on Greek Vases, AJA 87, 1983, 91-96.<br />
S e i t e | 239
J. R. CLARKE, Representations of Male-to-Female Lovemaking, in: M. Golden – P. Toohey (Hrsg.), Sex and<br />
Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 221–238.<br />
D. COHEN, Law, Society, and Homosexuality in Classical Athens, in: M. Golden – P. Toohey (Hrsg.), Sex and<br />
Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 151–166.<br />
C. A. COX, Household Interests (Princeton 1998).<br />
J. N. DAVIDSON, Kurtisanen und Meeresfrüchte. Die verzehrenden Leidenschaften im klassischen Athen<br />
(Darmstadt 1999).<br />
L. DEAN-JONES, The Cultural Construct of the Female Body in Classical Greek Science, in: M. Golden, P.<br />
Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 183–201.<br />
M.-H. DELAVAUD-ROUX, Les Danses Armees en Grece Antique (Aix-en-Provence 1993).<br />
A. DELIVORRIAS, Das Original der sitzenden „Aphrodite-Olympias“, AM 93, 1979, 1–23.<br />
N. DEMAND, Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece (Baltimore 1994).<br />
N. DEMAND, The Attitudes of the Polis to Childbirth: Putting Women to the Grid, in: M. Golden – P. Toohey<br />
(Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 253–263.<br />
L. DEUBNER, Hochzeit und Opferkorb, JdI 40, 1925, 210–223.<br />
L. DEUBNER, Attische Feste (Berlin 1956).<br />
L. DEUBNER, Dionysos und die Anthesterien, JdI 42, 1927, 172–192.<br />
J.-A. DICKMANN, Das Kind am Rande, in: R. von den Hoff – S. Schmidt (Hrsg.), Konstruktionen von<br />
Wirklichkeit. Bilder im Griechenland des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. Interdisziplinäres Kolloquium<br />
vom 27.9.–1.10.1999 in Schloss Reisensburg bei Günzburg (Stuttgart 2001) 173–181.<br />
J.-A. DICKMANN, Bilder vom Kind im Klassischen Athen, in: W. D. Heilmeyer – M. Maischberger (Hrsg.),<br />
Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Ausstellungskatalog Berlin – Bonn (Berlin 2002) 310–<br />
320.<br />
A. DIERICHS, Erotik in der Kunst Griechenlands (Mainz 1993).<br />
A. DIERICHS, Pandora ist schuld, AW 3, 2006, 16–22.<br />
K. J. DOVER, Homosexualität in der griechischen Antike (München 1983).<br />
K. J. DOVER, Classical Greek Attitudes to sexual Behaviour, Arethusa 6, 1973, 59–73.<br />
K. J. DOVER, Greek Attitudes to Sexual Behaviour, in: M. Golden, P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in<br />
Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 114–128.<br />
K. DOWDEN, Approaching Women through Myth: Vital Tool or Self-Delusion? in: R. Hawley – B. Levick<br />
(Hrsg.), Women in Antiquity. New Assessments (London 1995) 44–57.<br />
E. FANTHAM et al. (Hrsg.), Women in the Classical World. Image and Text (New York 1994).<br />
G. FERRARI, Figures of Speech. The Picture of aidos, Métis 5, 1990, 185–204.<br />
G. FERRARI, Figures of Speech. Men and Maidens in Ancient Greece (Chicago 2002).<br />
F. F. FINK, Hochzeitsszenen auf attischen schwarz- und rotfigurigen Vasen (Diss. Wien 1974).<br />
N. FISHER, Violence, Masculinity and the Law in classical Athens, in: L. Foxhall – J. Salomon (Hrsg.), When<br />
Men were Men. Masculinity, Power and Identity in Classical Antiquity (London 1998) 68–97.<br />
R. FLACELIÈRE, Griechenland. Leben und Kultur in klassischer Zeit (Stuttgart 1977).<br />
J.-L. FLANDRIN, Das Geschlechtsleben der Eheleute in der alten Gesellschaft: Von der kirchlichen Lehre zum<br />
realen Verhalten, in: P. Ariès – A. Béjin (Hrsg.), Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der<br />
Sinnlichkeit . Zur Geschichte der Sexualität im Abendland ³(London 1984) 147–164.<br />
H. FOLEY, Mothers and Daughters, in: J. Neils – J. H. Oakley (Hrsg.), Coming of Age in Ancient Greece.<br />
Images of Childhood from the Classical Past. Ausstellungskatalog Hanover (New Haven 2003) 113–137.<br />
H. P. FOLEY, Reflections of Women in Antiquity (New York 1981).<br />
A.-B. FOLLMAN, Der Pan-Maler (Bonn 1968).<br />
L. FOXHALL, Household, Gender and Property in Classical Athens, CQ 39, 1989, 22–44.<br />
L. FOXHALL, Pandora Unbound: A Feminin Critique of Foucault´s History of Sexuality, in: M. Golden – P.<br />
Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 167–182.<br />
F. FRONTISI-DUCROUX, Eros, Desire and the Gaze, in: N. Boymel Kampen (Hrsg.) Sexuality in Ancient Art.<br />
Near East, Egypt, Greece, and Italy (Cambridge 1996) 81–100.<br />
A. FURTWÄNGLER, Eros in der Vasenmalerei, in: J. Sieveking – L. Curtius (Hrsg.) Kleine Schriften von<br />
Adolf Furtwängler 1 (München 1912).<br />
J. F. GARDNER, Aristophanes and Male Anxiety. The Defence of the Oikos, GaR 36, 1989, 51–62.<br />
J. GEBAUER, Pompe und Thysia. Attische Tieropferdarstellungen auf schwarz- und rotfigurigen Vasen<br />
(Münster 2002).<br />
D. E. GERBER, The Female Breast in Greek Erotic Literature, Arethusa 11, 1978, 203–212.<br />
E. GÖTTE, Frauengemachbilder in den Vasenbildern des 5. Jhs. (Diss. Ludwig-Maximilians-<strong>Universität</strong><br />
München 1957).<br />
M. GOLDEN, Children and Childhood in Classical Athens (Baltimore 1990).<br />
M. GOLDEN – P. TOOHEY (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003).<br />
A. W. GOMME, The Position of Women in Athens in the fifth and fourth Centuries, CP 20, 1925, 1–25.<br />
S e i t e | 240
J. GOULD, Law, Custom and Myth. Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens, JHS 100,<br />
1980, 38–59.<br />
B. GRAEF – E. LANGLOTZ, Die antiken Vasen von der Akropolis zu Athen IV (Berlin 1925).<br />
J. W. GRAHAM, The Houses of Classical Athens, Phoenix 28, 1974, 45–54.<br />
A. GREIFENHAGEN, Griechische Eroten (Berlin 1957).<br />
P. GRIFFO, Il Museo Archeologico Regionale di Agrigento (Rom 1987).<br />
W. GRÜNHAGEN, Archäologisches Institut der <strong>Universität</strong> <strong>Erlangen</strong>. Antike Originalarbeiten in der<br />
Kunstsammlung des Instituts (<strong>Nürnberg</strong> 1948).<br />
L.-M. GÜNTHER, Aspasia und Perikles. Rufmord im klassischen Athen, in: M. H. Dettenhöfer (Hrsg.), Reine<br />
Männersache? Frauen in Männerdomänen der antiken Welt (München 1996) 41–67.<br />
S. GUETTEL COLE, Could Greek women read and write?, in: H.P. Foley (Hrsg.), Reflections of Women in<br />
Antiquity (New York 1981) 219–245.<br />
E. K. GUHL – W. D. KONER (Hrsg.), Leben der Griechen und Römer. Nach antiken Bildwerken 6 (Berlin<br />
1893).<br />
D. HAMEL, Der Fall Neaira. Die wahre Geschichte einer Hetäre im antiken Griechenland (Darmstadt 2004).<br />
R. HAMPE et al., Neuerwerbungen 1957–70: <strong>Universität</strong> Heidelberg (Mainz 1971).<br />
A. R. W. HARRISON, The Laws of Athens I. The Family and Property (Oxford 1968).<br />
E. HARTMANN, Heirat und Bürgerstatus in Athen, in: T. Späth – B. Wagner-Hasel (Hrsg.), Frauenwelten in<br />
der Antike (Stuttgart 2000) 16–31.<br />
E. HARTMANN, Hetären im klassischen Athen, in: T. Späth – B. Wagner-Hasel (Hrsg.), Frauenwelten in der<br />
Antike (Stuttgart 2000) 377–354.<br />
E. HARTMANN, Heirat, Hetärentum und Konkubinat im klassischen Athen (Frankfurt a. M. 2002).<br />
E. HARTMANN, Geschlechterdefinitionen im attischen Recht. Bemerkungen zur kyrieia, in: E. Hartmann – K.<br />
Pietner – U. Hartmann (Hrsg.), Geschlechterdefinitionen und Geschlechtergrenzen in der Antike<br />
(Stuttgart 2007) ?.<br />
D. HARVEY, Painted Ladies: Fact, Fiction and Fantasy, in: J. Christiansen – T. Melander (Hrsg.), Proceedings<br />
of the 3 rd Symposium on Ancient Greek and Related Pottery, Kopenhagen August 31 – September 4 1987<br />
(Kopenhagen 1988) 242–254.<br />
W.-D. HEILMEYER et al., Antikenmuseum Berlin. Die ausgestellten Werke (Berlin 1988).<br />
F. HEINRICH, Das Epinetron. Aspekte der weiblichen Lebenswelt im Spiegel eines Arbeitsgeräts (Rahden<br />
2006).<br />
W. HOEPFNER – E. L. SCHWANDNER, Haus und Stadt im klassischen Griechenland. Wohnen in der<br />
Klassischen Polis 1 (München 1986).<br />
W. HOEPFNER (Hrsg.), Geschichte des Wohnens 1. 5000 v. Chr. – 500 v. Chr.: Vorgeschichte, Frühgeschichte,<br />
Antike (Stuttgart 1999).<br />
S. HOUBY-NIELSEN, Grave Gifts, Women, and Conventional Values of the Hellenistic Greeks, in: P. Bilde et<br />
al. (Hrsg.), Conventional Values oft he Hellenistic Greeks (Aahus 1997) 220–262.<br />
L. HUCHTHAUSEN, Die Frau in der Antike (Einleitungsreferat), in: M. Kunze (Hrsg.), Die Frau in der Antike.<br />
Kolloquium der Winckelmann-Gesellschaft Stendal 1985 (Stendal 1988) 7–14.<br />
S. C. HUMPHREYS, The Family, Women and Death. Comparative Studies (London 1983).<br />
V. J. HUNTER, Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420–320 v. Chr. (Princeton 1994).<br />
M. JAMESON, The Asexuality of Dionysos, in: M. Golden, P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient<br />
Greece and Rome (Edinburgh 2003) 319–333.<br />
I. JENKINS, Greek and Roman Life (London 1986)<br />
C. JOHNS, Sex or Symbol. Erotic Images of Greece and Rome (London 1982).<br />
J. E. JONES – L. H. SACKETT – A. J. GRAHAM, The Dema House in Attica, BSA 57, 1962, 75–114.<br />
J. E. JONES, Town and Country Houses of Attica in Classical Times, MIGRA 1, 1975, 63–136.<br />
R. JUST, Women in Athenian Law and Life (London 1989).<br />
H. KAMMERER-GROTHAUS, Frauenleben, Frauenalltag im antiken Griechenland (Berlin 1984).<br />
M. A. KATZ, Ideology and "The status of Women" in Ancient Greece, in: R. Hawley – B. Levick (Hrsg.),<br />
Women in Antiquity. New Assessments (London 1995) 21–43.<br />
M. KATZ, Ideology and "the Status of Women" in Ancient Greece, in: M. Golden, P. Toohey (Hrsg.), Sex and<br />
Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 30–43.<br />
A. KAUFFMANN-SAMARAS, Des femmes et des oiseaux. La perdrix dans le gynécée, in: B. Schmaltz – M.<br />
Söldner (Hrsg.), Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-<br />
Symposions in Kiel vom 24. bis 28.9.2001 (Münster 2003) 90–92.<br />
E. C. KEULS, “The Hetaira and the Housewife”. The Splitting of the Female Psyche in Greek Art, MededRom<br />
N. S. 9/10, 1983, 23–40.<br />
E. C. KEULS, The Reign of the Phallus. Sexual Politics in Ancient Athens (New York 1985).<br />
E. C. KEULS, Attic Vase-Painting and the Home Textile Industry, in: W. G. Moon (Hrsg.), Ancient Greek Art<br />
and Iconography (Wisconsin 1983) 209–230.<br />
S e i t e | 241
H. KILLET, Zur Ikonographie der Frau auf attischen Vasen archaischer und klassischer Zeit (Berlin 1994).<br />
M. F. KILMER, Greek Erotica on Attic Red-Figure Vases (London 1993).<br />
A. D. F. KITTO, Athenian Woman, in: M. Golden, P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece<br />
and Rome (Edinburgh 2003) 44–56.<br />
A. KLÖCKNER, Mordende Mütter. Medea, Prokne und das Motiv der furchtbaren Rache im klassischen Athen,<br />
in: G. Fischer – S. Moraw (Hrsg.), Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.<br />
Kulturgeschichtliches Kolloquium Bonn 11.–13.7.2002 (Stuttgart 2005) 247–263.<br />
U. KNIGGE, Ein rotfiguriges Alabastron, AM 79, 1964, 105–113.<br />
U. KNIGGE, Der Bau Z, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen 17 (München 2005)<br />
G. KOCH-HARNACK, Knabenliebe und Tiergeschenke. Ihre Bedeutung im päderastischen Erziehungswesen<br />
Athens (Berlin 1983).<br />
D. KONSTAN, Premarital Sex, Illegitimacy, and Male Anxiety in Menander and Athens, in: A. L. Boegehold –<br />
A. C. Scafuro (Hrsg.), Athenian Identity and Civic Ideology (Baltimore 1994) 217–233.<br />
B. KORZUS (Hrsg.), Griechische Vasen aus westfälischen Sammlungen (Münster 1984).<br />
A. KOSMOPOULOU, Female Professionals on Calssical Attic Gravestones, BSA 96, 2001, 281–319.<br />
P. KRANZ, Die Frau in der Bildkunst der griechischen Klassik, in: P. Neukam (Hrsg.), Antike Literatur –<br />
Mensch, Sprache, Welt, Klassische Sprachen und Literaturen 34 (München 2000) 59–79.<br />
U. KREILINGER, Anständige Nacktheit. Körperpflege, Reinigungsriten und das Phänomen weiblicher<br />
Nacktheit im klassischen Athen. Tübinger Archäologische Forschungen 2 (Tübingen 2007).<br />
N. KUNISCH, Makron (Mainz 1997).<br />
W. K. LACEY, Die Familie im antiken Griechenland (Mainz 1983).<br />
J. LACATZ (Hrsg.), Die griechische Literatur in Text und Darstellung I. Archaische Periode (Stuttgart 1991).<br />
H. LAUTER-BUFE – H. LAUTER, Wohnhäuser und Stadtviertel des klassischen Athen, AM 86, 1971, 109–<br />
124.<br />
R. E. LEADER, In Death not divided: Gender, Family, and State on Classical Athenian Grave Stelae, AJA 101,<br />
1997, 683–699.<br />
M. R. LEFKOWITZ – M. B. FANT, Women´s Life in Greece and Rome. A Source Book in Translation<br />
²(Baltimore 1992).<br />
M. LEFKOWITZ, Wives and Husbands, in: I. McAuslan, P. Walcot (Hrsg.), Women in Antiquity (Oxford 1996)<br />
67–82.<br />
S. LEWIS, The Athenian Woman. An Iconographic Handbook (London 2002).<br />
A. LEZZI-HAFTER, Der Eretria-Maler. Werke und Weggefährten (Mainz 1988).<br />
H. LICHT, Sittengeschichte Griechenlands 1. 2 (Dresden 1925/1926).<br />
H. LICHT, Ehe und Liebe in Griechenland (Berlin 1925).<br />
R. LINDNER, Im Tode gleich? Geschlechts- und altersspezifische Grabausstattungen im antiken Griechenland,<br />
in: E. Klinger et al. (Hrsg.), Der Körper und die Religion. Das Problem der Konstruktion von<br />
Geschlechterrollen (Würzburg 2000) 93–127.<br />
F. LISSARAGUE, Frauenbilder, in: P. Schmitt-Pantel (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M.<br />
1993) 177–254.<br />
F. LISSARRAGUE, Vases Grecs. Les Athéniens et leurs images (Paris 1999).<br />
V. LIVENTHAL, What goes on among the Women? The Setting of Some Attic Vase Paintings of the Fifth<br />
Century B. C., AnalRom14, 1985, 37–52.<br />
L. LLEWELLYN-JONES, A Woman´ s View? Dress, Eroticism, and the Ideal Female Body in Athenian Art, in:<br />
H.P. Foley (Hrsg.), Reflections of Women in Antiquity (London 1981) 171–202.<br />
L. LLEWELLYN-JONES, Aphrodite´s Tortoise. The Veiled Woman of Ancient Greece (Swansea 2003).<br />
D. LÜBKE, Platon über Frauen, Liebe und Ehe, in: M. Kunze (Hrsg.), Die Frau in der Antike. Kolloquium der<br />
Winckelmann-Gesellschaft Stendal 1985 (Stendal 1988) 50–60.<br />
M. MAUSS, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften (Frankfurt a. M.<br />
1968).<br />
L. K. MCCLURE (Hrsg.) Sexuality and Gender in the Classical World. Readings and Source (Oxford 2002).<br />
D. M. MACDOWELL, The “Oikos” in Athenian Law, CQ N. S. 39, 1989, 10–21.<br />
B. MACLACHLAN, The Age of Grace. Charis in Early Greek Poetry (Princeton 1993).<br />
S. B. MATHESON, Polygnotos and Vase Painting in Classical Athens (Wisconsin 1995).<br />
C. MEIER, Politik und Anmut. Eine wenig zeitgemäße Betrachtung (Stuttgart 2000).<br />
C. MERCATI, Epinetron. Storia di una forma ceramica fra archeologia e cultura (Città di Castello 2003).<br />
H. METZGER, Les représentations dans la céramique attique du IV e siècle (Paris 1951).<br />
M. MEYER, Gesten der Zusammengehörigkeit und Zuwendung. Zum Sinngehalt attischer Grabreliefs in<br />
klassischer Zeit, Thetis 5/6, 1999, 115–132.<br />
M. MEYER, Männer mit Geld, JdI 103, 1988, 87–125.<br />
M. C. MILLER, Athens and Persia in the Fifth Century BC. A Study in Cultural Receptivity (Cambridge 1997).<br />
S e i t e | 242
R. MISDRACHI-CAPON (Hrsg.), Eros Grec. Amour des Dieux et des Hommes. Ausstellungskatalog Paris –<br />
Athen (Athen 1989).<br />
P. VON MÖLLENDORFF, Aristophanes (Darmstadt 2002).<br />
W. G. MOON (Hrsg.), Greek Vase-Painting in Midwestern Collections. Ausstellungskatalog Chicago ²(Chicago<br />
1981).<br />
R. MÖSCH-KLINGELE, Die loutrophoros im Hochzeits- und Begräbnisritual des 5. Jahrhunderts v. Chr. in<br />
Athen (Bern 2006).<br />
S. MORAW, Unvereinbare Gegensätze? Frauengemachbilder des 4. Jhs. v. Chr. und das Ideal der bürgerlichen<br />
Frau, in: R. von den Hoff – S. Schmidt (hrsg.), Konstruktionen von Wirklichkeit. Bilder im Griechenland<br />
des 5. und 4. Jhs. v. Chr. Interdisziplinäres Kolloquium vom 27.9. bis 1.10.1999 in Schloss Reisensburg<br />
bei Günzburg (Stuttgart 2001) 211–223.<br />
S. MORAW, Was sind Frauen? Bilder bürgerlicher Frauen im klassischen Athen, in: W.D. Heilmeyer – M.<br />
Maischberger (Hrsg.), Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Ausstellungskatalog Berlin –<br />
Bonn. Staatliche Museen in Berlin (Berlin 2002) 300–309.<br />
S. MORAW, Bilder, die lügen: Hochzeit, Tieropfer und Sklaverei in der klassischen Kunst, in: G. Fischer – S.<br />
Moraw (Hrsg.), Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jh. v. Chr. Kulturgeschichtliches<br />
Kolloquium Bonn 11.–13.7.2002 (Stuttgart 2005) 73–88.<br />
I. MORRIS, Archeology and Gender Ideologies in Early Archaic Greece, in: M. Golden, P. Toohey (Hrsg.), Sex<br />
and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 264–275.<br />
C. MOSSÉ, La Femme dans la Grèce antique (Paris 1983).<br />
J. NEILS, The Panathenaia and Kleisthenic Ideology, in: W.D.E. Coulson u.a. (Hrsg.), The Archaeology of<br />
Athens and Attica under the Democracy (Oxford 1994).<br />
J. NEILS, Others within the Other: An Intimate Look at Hetairai and Maenads, in: B. Cohen (Hrsg.), Not the<br />
Classical Ideal. Athens and the Construction of the Other in Greek Art (Leiden 2000) 203–226.<br />
J. NEILS – J. H. OAKLEY (Hrsg.), Coming of Age in Ancient Greece. Images of Childhood from the Classical<br />
Past. Ausstellungskatalog Hanover (New Haven 2003).<br />
P. NEILS BOULTER, The Akroteria of the Nike Temple, Hesperia 38, 1969, 133–140.<br />
G. NEUMANN, Gesten und Gebärden in der griechischen Kunst (Berlin 1965).<br />
L. C. NEVETT, Gender Relations in the Classical Greek World, BSA 90, 1995, 363–381.<br />
L. C. NEVETT, Separation or Seclusion? Towards an archaeological Approach to Investigating Women in the<br />
Greek Household in the fifth to third Centuries BC, in: M. Parker Pearson – C. Richards (Hrsg.),<br />
Architecture and Order. Approaches to Social Space (London 1994) 98–112.<br />
L. C. NEVETT, House and Society in the Ancient Greek World (Cambridge 1999).<br />
J. H. OAKLEY, The Phiale Painter (Mainz 1990).<br />
J. H. OAKLEY, Zwei alte Vasen – Zwei neue Danaebilder, AA 1990, 65–70.<br />
J. H. OAKLEY – R. H. SINOS, The Wedding in Ancient Athens (Madison 1993).<br />
J. H. OAKLEY, Hochzeitliche Nuancen: Hochzeitliche Bildelemente in nicht-hochzeitlichen mythologischen<br />
Szenen, in: E. D. Reeder (Hrsg.), Pandora. Frauen im klassischen Griechenland. Ausstellungskatalog<br />
Baltimore – Dallas – Basel (Baltimore 1995) 63–73.<br />
J. H. OAKLEY – W. D. E. COULSON – O. PALAGIA (Hrsg.), Athenian Potters and Painters. The Conference<br />
Proceedings (Oxford 1997).<br />
J. H. OAKLEY, Death and the Child, in: J. Neils – J. H. Oakley (Hrsg.), Coming of Age in Ancient Greece.<br />
Images of Childhood from the Classical Past. Ausstellungskatalog Hanover (New Haven 2003) 163–194.<br />
W. OENBRINK, Ein „Bild im Bild“-Phänomen. Zur Darstellung figürlich dekorierter Vasen auf bemalten<br />
attischen Tongefäßen, Hephaistos 14, 1996, 81–134.<br />
A. OHNESORG – E. WALTER-KARYDI, Die Mittelakrotere des Peripteraltempels in Karthaia. Zur<br />
Rekonstruktion der Mittelakroterbasen, AA 1994, 349–364.<br />
R. OSBORNE, Desiring women on Athenian Pottery, in: N. Boymel Kampen (Hrsg.), Sexuality in Ancient Art.<br />
Near East, Egypt, Greece, and Italy (Cambridge 1996) 65–80.<br />
R. OSBORNE, Law, the Democratic Citizen and the Representation of Women in Classical Athens, in: R.<br />
Osborne (Hrsg.), Studies in Ancient Greek and Roman Society (Cambridge 2004) 38–60.<br />
C. B. PATTERSON, Marriage and the Married Woman in Athenian Law, in: S. B. Pomeroy (Hrsg.), Women´s<br />
History and Ancient History (Chapel Hill 1991) 48–72.<br />
C. B. PATTERSON, The Case against Neaira and the Public Ideology of the Athenian Family, in: A. L.<br />
Boegehold – A. C. Scafuro (Hrsg.), Athenian Identity and Civic Ideology (Baltimore 1994) 199–216.<br />
C. B. PATTERSON, The Family in Greek History (Cambridge 1998).<br />
W. PEEK, Griechische Versinschriften I. Grabepigramme (Berlin 1955).<br />
I. PESCHEL, Die Hetäre bei Symposion und Komos in der attisch-rotfigurigen Vasenmalerei des 6. – 4. Jahrh.<br />
v. Chr. (Frankfurt a. M. 1987).<br />
S e i t e | 243
S. PFISTERER-HAAS, Mädchen und Frau im Obstgarten und beim Ballspiel. Untersuchungen zu zwei<br />
vorhochzeitlichen Motiven und zur Liebessymbolik des Apfels auf Vasen archaischer und klassischer<br />
Zeit, AM 118, 2003, 139–177.<br />
S. PFISTERER-HAAS, Mädchen und Frauen am Wasser. Brunnenhaus und Louterion als Orte der<br />
Frauengemeinschaft und der möglichen Begegnung mit einem Mann, JdI 117, 2002, 1–79.<br />
S. PFISTERER-HAAS, Attische Vasenbilder als Zeugnisse für die Rolle griechischer Frauen in Ritual und<br />
Erziehung, in: E. Klinger – S. Böhm – T. Franz (Hrsg.), Haushalt, Hauskult, Hauskirche. Zur<br />
Arbeitsteilung der Geschlechter in Wirtschaft und Religion (Würzburg 2004) 35–59.<br />
S. B. POMEROY, Selected Bibliography on Women in Antiquity, Arethusa 6, 1973, 127–157.<br />
S. B. POMEROY, Frauenleben im Klassischen Altertum (Stuttgart 1985).<br />
S. B. POMEROY, Xenophon. Oeconomikus. A Social and Historical Commentary (Oxford 1994).<br />
S. B. POMEROY, Women´s Identity and the Family in the Classical Polis, in: R. Hawley – B. Levick (Hrsg.),<br />
Women in Antiquity. New Assessments (London 1995) 111–121.<br />
J. RAEDER, Vitruv, de architectura VI 7 (aedificia Graecorum) und die hellenistische Wohnhaus- und<br />
Palastarchitektur, Gymnasium 95, 1988, 316–368.<br />
S. VON REDEN, Exchange in Ancient Greece (London 1995).<br />
E. D. REEDER (Hrsg.), Pandora. Frauen im klassischen Griechenland. Ausstellungskatalog Baltimore – Dallas –<br />
Basel (Baltimore 1995).<br />
J. REILLY, Many Brides. „Mistress and Maid“ on Athenian Lekythoi, Hesperia 58, 1989, 411–444.<br />
C. REINSBERG, Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland ²(München 1993).<br />
C. REINSBERG, Frauenbilder – Männerbilder. Zur Genese des Frauenbildes in der griechischen Kunst, in: B.<br />
Miemitz (Hrsg.), Blickpunkt: Frauen- und Geschlechterstudien (St. Ingbert 2004) 217–237.<br />
R. REUTHNER, Wer webte Athenes Gewänder? Die Arbeit von Frauen im antiken Griechenland (Frankfurt a.<br />
M. 2006).<br />
D. C. RICHTER, The Position of Women in Classical Athens, ClJ 67, 1971, 1–8.<br />
G. M. A. RICHTER, Red-Figured Athenian Vases in the Metropolitan Museum of Art (New Haven 1936).<br />
S. RITTER, Eros und Gewalt: Menelaos und Helena in der attischen Vasenmalerei des 5. Jhs. v. Chr., in: G.<br />
Fischer – S. Moraw (Hrsg.), Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.<br />
Kulturgeschichtliches Kolloquium Bonn 11.–13.7.2002 (Stuttgart 2005) 265–285.<br />
S. R. ROBERTS, The Attic Pyxis (Chicago 1978).<br />
H. RÜDIGER (Hrsg.), Griechische Gedichte. Mit Übertragungen deutscher Dichter 4 (1972).<br />
S. R. RUTHERFORD, The Attic Pyxis (Chicago 1978).<br />
L. JONES ROCCOS, The Kanephoros and her Festival Mantle in Greek Art, AJA 99, 1995, 641–666.<br />
G. RODENWALDT, Spinnende Hetären, AA 1932, 7–22.<br />
S. I. ROTROFF – R. D. LAMBERTON, Women in the Athenian Agora (Athen 2006).<br />
H. RÜHFEL, Kinderleben im Klassischen Athen. Bilder auf klassischen Vasen. Kulturgeschichte der Antiken<br />
Welt 19 (Mainz 1984).<br />
H. RÜHFEL, Das Kind in der griechischen Kunst. Von der minoisch-mykenischen Zeit bis zum Hellenismus<br />
(Mainz 1984).<br />
H. RÜHFEL, Ammen und Kinderfrauen im klassischen Athen, AW 4, 1988, 43–57.<br />
V. SABETAI, Aspects of Nuptial and Genre Imagery in Fifth-Century Athens: Issues of Interpretation and<br />
Methodology, in: J. H. Oakley – W. D. E. Coulson – O. Palagia, Athenian Potters and Painters. The<br />
Conference Proceedings (Oxford 1997) 319–335.<br />
N. SALOMON, Making a World of Difference. Gender, Asymmetry, and the Greek Nude, in: A. O. Koloski-<br />
Ostrow – C. L. Lyons (Hrsg.), Naked Truths. Women, Sexuality, and Gender in Classical Art and<br />
Archeology (London 1997) 197–219.<br />
A. SCHÄFER, Unterhaltung beim griechischen Symposion. Darbietungen, Spiele und Wettkämpfe von<br />
homerischer bis in spätklassische Zeit (Mainz 1997).<br />
L. SCHEAR, Semonides Frg. 9: Wives and their Husbands, EchosCl N.S. 3, 1984, 39–49.<br />
T. SCHEER, Forschungen über die Frau in der Antike. Ziele, Methoden, Perspektiven, Gymnasium 107, 2000,<br />
143–172.<br />
W. SCHEIDEL, Frau und Landarbeit in der Alten Geschichte, in: E. Specht (Hrsg.), Nachrichten aus der Zeit.<br />
Ein Streifzug durch die Frauengeschichte des Altertums (Wien 1992) 195–235.<br />
B. SCHMALTZ, Untersuchungen zu den attischen Marmorlekythen (Berlin 1970).<br />
B. SCHMALTZ, Griechische Grabreliefs ²(Darmstadt 1993).<br />
S. SCHMIDT, Zur Funktion der Bilder auf weißgrundigen Lekythen, in: B. Schmaltz – M. Söldner (Hrsg.),<br />
Griechische Keramik im kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom<br />
24.–28.9.2001 (Münster 2003) 179–181.<br />
S. SCHMIDT, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen. Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v. Chr.<br />
(Berlin 2005).<br />
P. SCHMITT-PANTEL (Hrsg.), Geschichte der Frauen I. Antike (Frankfurt a. M. 1993).<br />
S e i t e | 244
P. SCHMITT-PANTEL, Du symposion au sanctuaire, in: H. Harich-Schwarzbauer – T. Späth (Hrsg.), Gender<br />
Studies in den Altertumswissenschaften. Räume und Geschlechter in der Antike (Trier 2005) 1–14.<br />
W. SCHMITZ, Gewalt in Haus und Familie, in: G. Fischer – S. Moraw (Hrsg.), Die andere Seite der Klassik.<br />
Gewalt im 5. und 4. Jh. v. Chr. Kulturgeschichtliches Kolloquium Bonn 11.–13.7.2002 (Stuttgart 2005)<br />
103–128.<br />
C. SCHNEIDER, Herr und Hund auf archaischen Grabstelen, JdI 115, 2000, 1–36.<br />
CH. SCHNURR-REDFORD, Frauen im klassischen Athen. Sozialer Raum und reale Bewegungsfreiheit (Berlin<br />
1996).<br />
CHR. SCHNURR-REDFORD, Women in Classical Athens. Their Social Space: Ideal and Reality, in: M.<br />
Golden, P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 23–29.<br />
C. SCHUBERT – U. HUTTNER (Hrsg.), Frauenmedizin in der Antike (Düsseldorf 1999).<br />
W. SCHULLER, Haushalt, in: W. Hoepfner (Hrsg.), Geschichte des Wohnens I. 5000 v. Chr. – 500 n. Chr.<br />
Vorgeschichte. Frühgeschichte. Antike (Stuttgart 1999) 545–560.<br />
W. SCHULLER, Die Welt der Hetären. Berühmte Frauen zwischen Legende und Wirklichkeit (Stuttgart 2008).<br />
H. SCHULZE, Ammen und Pädagogen. Sklavinnen und Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und<br />
Gesellschaft (Mainz 1998).<br />
R. A. S. SEAFORD, Reciprocity and Ritual. Homer and Tragedy in the Developing City-State (Oxford 1994).<br />
J. L. SEBESTA, Visions of Gleaming Textiles and a Clay Core: Textiles, Greek Women, and Pandora, in: H.P.<br />
Foley (Hrsg.), Reflections of Women in Antiquity (New York 1981) 125–142.<br />
C. T. SELTMAN, Women in Antiquity (London 1956).<br />
C. T. SELTMAN, Eros: in early attic Legend and Art, BSA 26, 1923/25, ?.<br />
H. A. SHAPIRO, Courtship Scenes in Attic Vase-Painting, AJA 85, 1981, 133–143.<br />
H. A. SHAPIRO, Eros in Love: Pederasty and Pornography in Greece, in: A. Richlin (Hrsg.), Pornography and<br />
Representation in Greece and Rome (Oxford 1992) 53–72.<br />
H. A. SHAPIRO U.A. (Hrsg.), Greek Vases in the San Antonio Museum of Art (San Antonio 1995).<br />
H. A. SHAPIRO, Father and Sons, Men and Boys, in: J. Neils, J. H. Oakley (Hrsg.), Coming of Age in Ancient<br />
Greece. Images of Childhood from the Classical Past. Ausstellungskatalog Hanover (New Haven 2003)<br />
5–111.<br />
T. L. SHEAR, Jr., The Athenian Agora. Excavations of 1971, Hesperia 42, 1973, 121–179.<br />
E. SIMON, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary (Wisconsin 1983).<br />
E. SIMON, Aphrodite und Adonis. Eine neuerworbene Pyxis in Würzburg, AntK 15, 1972, 20–26.<br />
V. SIURLA-THEODORIDOU, Die Familie in der griechischen Kunst und Literatur des 8. bis 6. Jahrhunderts v.<br />
Chr. (München 1989).<br />
P. E. SLATER, The Greek Family in History and Myth, Arethusa 7, 1974, 9–44.<br />
P. E. SLATER, The Glory of Hera. Greek Mythology and the Greek Family (Princeton 1992).<br />
N. SOJC, Trauer auf attischen Grabreliefs. Frauendarstellung zwischen Ideal und Wirklichkeit (Berlin 2005).<br />
C. SOURVINOU-INWOOD, Studies in Girls Transitions. Aspects of the Arkteia and Age Representation in<br />
Attic Iconography (Athen 1988).<br />
C. SOURVINOU-INWOOD, “Reading” Greek Culture. Texts and Images, Rituals and Myths (Oxford 1991).<br />
C. SOURVINOU-INWOOD, Männlich und Weiblich, Öffentlich und Privat, Antik und Modern, in: E. D.<br />
Reeder (Hrsg.), Pandora. Frauen im klassischen Griechenland. Ausstellungskatalog Baltimore – Dallas –<br />
Basel (Baltimore 1995) 111–120.<br />
T. SPÄTH – B. WAGNER-HASEL (Hrsg.), Frauenwelten in der Antike (Stuttgart 2000).<br />
E. SPECHT, Schön zu sein und gut zu sein. Mädchenbildung und Frauensozialisation im antiken Griechenland<br />
(Wien 1989).<br />
K. P. STÄHLER, Eine unbekannte Pelike des Eucharidesmalers im Archäologischen Museum der <strong>Universität</strong><br />
Münster (Köln 1967).<br />
A. STÄHLI, Der Körper, das Begehren, die Bilder, in: R. von denn Hoff – S. Schmidt (Hrsg.), Konstruktionen<br />
von Wirklichkeit. Bilder im Griechenland des 5. und 4. Jhs. v. Chr. Interdisziplinäres Kolloquium vom<br />
27.9.–1.10.1999 in Schloss Reisensburg bei Günzburg (Stuttgart 2001) 197–209.<br />
A. STÄHLI, Die Konstruktion sozialer Räume von Frauen und Männern in Bildern, in: H. Harich-Schwarzbauer<br />
– T. Späth (Hrsg.), Gender Studies in den Altertumswissenschaften. Räume und Geschlechter in der<br />
Antike (Trier 2005) 83–110.<br />
P. STENGEL, Die griechischen Kulturaltertümer. Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft V, 3<br />
(München 1920).<br />
I. C. STOREY, Domestic Disharmony in Euripides´ Andromache, GaR 36, 1989, 16–27.<br />
N. STRAWCZYNSKI, Lecture Anthropologique et/ou documentaire? Quelches remarques sur un livre de<br />
Panayota Badinou, La Laine et le Parfum, RA 2005, 307–314.<br />
V. STROCKA, Alltag und Fest in Athen. Griechische Vasen zur Ausstellung (Freiburg 1987).<br />
A. STRÖMBERG, Private in life – Public in Death: The Presence of Women on Attic Classical Funerary<br />
Monuments, in: L. Larsson Lovén – A. Strömberg (Hrsg.), Gender, Cult, and Culture in the Ancient<br />
S e i t e | 245
World from Mycenae to Byzantium. Proceedings of the Second Nordic Symposium on Gender and<br />
Women´s History in Antiquity, Helsinki 20.–22.10.2000 (Sävedalen 2003), 28–37.<br />
R. F. SUTTON JR., The Interaction between Men and Women portrayed on Attic red-figured Pottery (Chapel<br />
Hill 1981).<br />
R. F. SUTTON JR., Pornography and Persuasion on Attic Pottery, in: A. Richlin (Hrsg.), Pornography and<br />
Representation in Greece and Rome (Oxford 1992) 3–35.<br />
R. F. SUTTON JR., Nuptial Eros: The Visual Discourse of Marriage in Classical Athens, JWaltersArtGal 55/56,<br />
1997/98, 27–48.<br />
R. F. SUTTON JR., The Oikos on Attic Red-Figure Pottery, in: A. P. Chapin (Hrsg.), Charis. Essays in Honor of<br />
Sara A. Immerwahr, Hesperia Suppl. 33 (Athen 2004) 327–350.<br />
L. K. TAAFFE, Aristophanes and Women (London 1993).<br />
H. A. THOMPSON, Activities in the Athenian Agora, Hesperia 28, 1959, 91–108.<br />
G. TSOMIS, Zusammenschau der frühgriechischen monodischen Melik (Alkaios, Sappho, Anakreon),<br />
Palingenesia LXX (Stuttgart 2001).<br />
A. VAZAKI, Mousike Gyne. Die musisch-literarische Erziehung und Bildung von Frauen im Athen der<br />
klassischen Zeit (Möhnesee 2003).<br />
A. VAZAKI, “Gute” Schülerinnen. Mädchenunterricht in attischen Vasenbildern der klassischen Zeit, in: B.<br />
Miemitz (Hrsg.), Blickpunkt: Frauen- und Geschlechterstudien (St. Ingbert 2004) 249–263.<br />
G. VAN HOORN, Choes and Anthesteria (Leiden 1951).<br />
M. S. VENIT, Point and Counterpoint. Painted Vases on Attic Painted Vases, AntK 49, 2006, 29–41.<br />
A.-M. VÉRILHAC – C. VIAL, Le mariage grec du VIe siècle av. J.–C. à l´epoche d´Auguste (Athen 1998).<br />
J.-P. VERNANT, Myth and Thoughts among the Greeks (London 1983).<br />
J.-P. VERNANT, Mythos und Gesellschaft im antiken Griechenland (Frankfurt a. M. 1987).<br />
P. VEYNE – F. LISSARAGUE – F. FRONTISI-DUCROUX (Hrsg.), I misteri del gineceo (Bari 2000).<br />
M. VIDALE, L´idea di un lavoro lieve. Il lavoro artificianale nelle immagini della ceramica greca tra VI e IV<br />
secolo A.C. (Padua 2002).<br />
K. VIERNEISEL – B. KAESER (Hrsg.), Kunst der Schale. Kultur des Trinkens. Ausstellungskatalog München<br />
(München 1990).<br />
J. VOGT, Von der Gleichwertigkeit der Geschlechter in der bürgerlichen Gesellschaft der Griechen, in: A. K.<br />
Siems (Hrsg.), Sexualität und Erotik in der Antike (Darmstadt 1988) 118–167.<br />
B. WAGNER-HASEL, Geschlecht und Gabe, Zsav 105, 1988, 32–72.<br />
B. WAGNER-HASEL, Wissenschaftsmythen und Antike: Zur Funktion von Gegenbildern der Moderne am<br />
Beispiel der Gabentauschdebatte, in: W. Schmale, A. Völker-Rasor (Hrsg.), Mythenmächte. Mythen als<br />
Argument (Berlin 1998) 33–63.<br />
B. WAGNER-HASEL, Stoff der Gaben. Kultur und Politik des Schenkens und Tauschens im archaischen<br />
Griechenland (Frankfurt a. M. 2000).<br />
B. WAGNER-HASEL, Arbeit und Kommunikation, in: T. Späth – B. Wagner-Hasel (Hrsg.), Frauenwelten in<br />
der Antike (Stuttgart 2000) 311–335.<br />
B. WAGNER-HASEL, Women´s Life in Oriental Seclusion? On the History and Use of a Topos, in: M. Golden,<br />
P. Toohey (Hrsg.), Sex and Difference in Ancient Greece and Rome (Edinburgh 2003) 241–252.<br />
S. WALKER, Women and Housing in Classical Greece, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.), Images of Women<br />
in Antiquity ²(London 1993) 81–91.<br />
K. WALDNER, Kulträume von Frauen in Athen: Das Beispiel der Artemis Brauronia, in: T. Späth – B.<br />
Wagner-Hasel (Hrsg.), Frauenwelten in der Antike (Stuttgart 2000) 53–81.<br />
M. WEGNER, Musikgeschichte in Bildern II. Griechenland (Leipzig 1963).<br />
I. WEHGARTNER, Attisch Weissgrundige Keramik. Maltechniken, Werkstätten, Formen, Verwendung (Mainz<br />
1983).<br />
C. WEIß, Zur Typologie und Bedeutung attischer Schuh- und Sandalengefäße, Nikephoros 8, 1995, 19–40.<br />
G. WICKERT-MICKNAT, Die Frau, in: F. Matz – H. Buchholz (Hrsg.), Archaeologia Homerica. Die<br />
Denkmäler und das frühgriechische Epos 3 (Göttingen 1988) R1–147.<br />
H.-U. WIEMER, Die gute Ehefrau im Wandel der Zeiten. Von Xenophon zu Plutarch, Hermes 133, 2005, 424–<br />
446.<br />
H. WINKLER, Loutrophorie. Ein Hochzeitskult auf attischen Vasen (Freiburg 1999).<br />
D. WILLIAMS, Women on Athenian Vases. Problems of Interpretation, in: A. Cameron – A. Kuhrt (Hrsg.),<br />
Images of Women in Antiquity ²(London 1993) 92–106.<br />
R. ZAHN, Das Kind in der Antiken Kunst, FuB 12, 1970, 21–31.<br />
S. A. XANTHUDIDES, Epinetron, AM 35, 1910, 323–334.<br />
F. I. ZEITLIN, Arethusa 11, 1978, 149–184.<br />
F. I. ZEITLIN, Eros, in: S. Settis (Hrsg.), I Greci. Storia, cultura, arte, società 1. Noi e i Greci (Turin 1996) 369–<br />
430.<br />
V. PAUL-ZINSERLING, Die Frau in Hellas und Rom (Stuttgart 1972).<br />
S e i t e | 246
R. ZOEPFFEL, Aufgaben, Rollen und Räume von Frau und Mann im archaischen und klassischen Griechenland,<br />
in: J. M. Martin, R. Zoepffel (Hrsg.), Aufgaben, Rollen und Räume von Frau und Mann (Freiburg 1989)<br />
443–500.<br />
S e i t e | 247
S e i t e | 248
Abb. 1–3: Boston (MA), Museum of Fine Arts 03.802<br />
(Kat. Nr. I/1)<br />
Abb. 4: Boston (MA), Mus. of Fine Abb. 5: Athen, Nat. Mus. 14790<br />
Arts 03.802 (Kat. Nr. I/1) (Kat. Nr. I/2)<br />
Abb. 6: St. Petersburg, State Hermitage Mus. ST 1809<br />
(Kat. Nr. I/3)<br />
T a f . | 1
T a f . | 2<br />
Abb. 1: Berlin, Antikensammlung F 2372<br />
(Kat. Nr. I/4)<br />
Abb. 2. 3: Athen, Nat. Mus. 1629 (Kat. Nr. I/5)<br />
Abb. 4: Berlin, Antikensammlung F 2395 (Kat. Nr. II/1)
Abb. 1–4: Athen, Nat. Mus. 1623A (Kat. Nr. II/2)<br />
Abb. 5: Cambridge, Harvard UniversityArthur M. Sackler Mus. 1960.342<br />
(Kat. Nr. II/3)<br />
Abb. 6: München, Antikensammlungen SL 476 Abb. 7: Athen, Nat. Mus. CC 1552/1588<br />
(Kat. Nr. II/4) (Kat. Nr. II/5)<br />
T a f . | 3
T a f . | 4<br />
Abb. 1. 2: Athen, Nat. Mus. CC 1552/1588 (Kat. Nr. II/5)<br />
Abb. 3: Athen, Nat. Mus. CC 1231/1250 Abb. 4: London, British Mus. E 396<br />
(Kat. Nr. II/6) (Kat. Nr. II/7)<br />
Abb. 5: Münster, Wilhelms-Univ., Arch. Mus. 66 Abb. 6. 7: Providence (RI), Rhode Island<br />
(Kat. Nr. II/8) School of Design 25.088 (Kat. Nr. II/9)
Abb. 1: Cleveland, Mus. of Art 1925. 134 Abb. 2: London, British Mus. E 193<br />
(Kat. Nr. II/10) (Kat. Nr. II/11)<br />
Abb. 3: London, British Mus. E 215 (Kat. Nr. II/12)<br />
Abb. 4. 5: Athen, Nat. Mus. 2383 bzw. CC1590 (Kat. Nr. II/13)<br />
T a f . | 5
T a f . | 6<br />
Abb. 1: Karlsruhe, Badisches Landesmus. B 3078I<br />
(Kat. Nr. II/14)<br />
Abb. 2–4: Gotha, Schlossmuseum 64 (Kat. Nr. II/16)<br />
Abb. 5: New York, Metropolitan Museum of Art 17.230.15 (Kat. Nr. II/17)
Abb. 1. 2: New York, Metropolitan Mus. 17.230.15 (Kat. Nr. II/17)<br />
Abb. 3: Boston (MA), Mus. of Fine Arts 93 (Kat. Nr. II/18)<br />
Abb. 4. 5: Palermo, Mormino Coll. 818 (Kat. Nr. II/20)<br />
Abb. 6–8: Würzburg, Martin-von-Wagner Museum L546/546 (Kat. Nr. II/21)<br />
T a f . | 7
T a f . | 8<br />
Abb. 1: Hannover, Kestner Museum L 1.1982 Abb. 2: Athen, M. Vlasto (o. Inv.)<br />
(Kat. Nr. II/22) (Kat. Nr. II/23)<br />
Abb. 3: Basel, Antikenmuseum und Sammlung Abb. 4: <strong>Erlangen</strong>, Antikensammlung I 303<br />
Ludwig BS490 (Kat. Nr. II/24) (Kat. Nr. II/25)<br />
Abb. 5. 6: London, British Mus. E 339 (Kat. Nr. II/26)
Abb. 1: Kopenhagen, Nat. Mus. 149 Abb. 2: Berlin, Antikensammlung 31426<br />
(Kat. Nr. II/28) (Kat. Nr. II/29)<br />
Abb. 3. 4: Berlin, Antikensammlung 31426 (Kat. Nr. II/29)<br />
T a f . | 9<br />
Abb. 5: Vatikan, Mus. Gregoriano Etrusco 16581 Abb. 6: Braunschweig, Herzog Anton Ulrich<br />
(Kat. Nr. II/30) Mus. AT.263 (Kat. Nr. II/31)
T a f . | 10<br />
Abb.1: Florenz, Mus. Arch. PD 266 Abb.2: Toledo, Mus. of Art 72.55 (Kat. Nr. III/1)<br />
(Kat. Nr. II/32)<br />
Abb. 3: Toledo, Mus. of Art 72.55 (Kat. Nr. III/1)<br />
Abb. 4. 5: Paris, Cabinet des Medailles 508 Abb. 6: Würzburg, Martin-von-Wagner Mus.<br />
(Kat. Nr. III/2) 506 (Kat. Nr. III/3)
Abb. 1: Berlin, Antikensammlung F 2252 Abb. 2: Cambridge, Arthur Sackler Mus.<br />
(Kat. Nr. III/4) 1972.45 (Kat. Nr. III/5)<br />
Abb. 3: Paris, Cabinet des Medailles 507 Abb. 4: Berkeley (CA), University of<br />
(Kat. Nr. III/6) California 8.923 (Kat. Nr. III/7)<br />
Abb. 5: Berkeley (CA), University of California Abb. 6: Florenz, Mus. Arch. 81602<br />
8.923 (Kat. Nr. III/7) (Kat. Nr. III/8)<br />
Abb. 7. 8: Athen, Nat. Mus. 2180 (Kat. Nr. III/9)<br />
T a f . | 11
T a f . | 12<br />
Abb. 1: Rhodos, Mus. Arch. 13261 (Kat. Nr. III/10)<br />
Abb. 2: Chiusi, Mus. Arch. Naz. 1835 (Kat. Nr. III/11)<br />
Abb. 3: South Hadley (MA), Mount Holyoke College 1932 BSII5 (Kat. Nr. III/12)<br />
Abb. 4–6:Athen, Kerameikos Mus. 2713 (Kat. Nr. III/13)
Abb. 1–3: Palermo, Mormino Coll. 796 (Kat. Nr. III/14)<br />
Abb. 4–6: Athen, Nat. Mus. 1239 (Kat. Nr. III/15)<br />
Abb. 7: Baltimore, Johns Hopkins Univ. B 4 Abb. 8: Kopenhagen, Nat. Mus. 320<br />
(Kat. Nr. III/ 16) (Kat. Nr. III/17)<br />
T a f . | 13
T a f . | 14<br />
Abb. 1. 2: Paris, Musée du Louvre CA 1852 (Kat. Nr. III/18)<br />
Abb. 3: Oxford, privat (Kat. Nr. III/19) Abb. 4: Ehem. Dresden, Kunstgewerbemus.<br />
(Kat. Nr. III/20)<br />
Abb. 5: Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek 2718 Abb. 6. 7: Berlin, Antikensammlung F 2254<br />
(Kat. Nr. III/23) (Kat. Nr. III/24)
Abb. 1: Athen, Nat. Mus. 1441 Abb. 2: Heidelberg, <strong>Universität</strong>, Arch. Inst. 64.5<br />
(Kat. Nr. III/25) (Kat. Nr. III/26)<br />
Abb. 3: Agrigent, Mus. Arch. Reg. AG 22276 (Kat. Nr. III/27)<br />
Abb. 4: Krakau, Mus. Czartoryski 1473 (Kat. Nr. III/28)<br />
Abb. 5. 6: Basel, Kunsthandel (Kat. Nr. III/29)<br />
T a f . | 15
T a f . | 16<br />
Abb. 1: Rom, Mus. Etrusco die VillaGiulia 1054 Abb. 2: Adolphseck, Schloss Fasanerie 41<br />
(Kat. Nr. III/30) (Kat. Nr. III/31)<br />
Abb 3: Adolphseck, Schloss Fasanerie 41 Abb. 4: Kopenhagen, Nat. Mus. 153<br />
(Kat. Nr. III/31) (Kat. Nr. III/32)<br />
Abb. 5. 6: München, privat (Kat. Nr. III/33)
Abb. 1: Kopenhagen, Thorvaldsen Mus. H 114 Abb. 2: London, British Mus. 1914. 5-12.1<br />
(Kat. Nr. III/34) (Kat. Nr. III/35)<br />
Abb. 3: San Antonio (TX), San Antonio Mus. Abb. 4: Syrakus, Mus. Arch. Naz. 18426<br />
of Art 86.134.59 (Kat. Nr. III/36) (Kat. Nr. III/37)<br />
Abb. 5: Berlin, Antikensammlung F 2624 Abb. 6: Tampa (FL), Mus. of Art 86.70<br />
(Kat. Nr. III/38) (Kat. Nr. III/39)<br />
T a f . | 17
T a f . | 18<br />
Abb. 1–3: Kopenhagen, Nat. Mus. 124 (Kat. Nr.III/40)<br />
Abb. 4: San Antonio (TX), Art Mus. 86.34.2 Abb. 5: Berlin, Antikensammlungen F 2261<br />
(Kat. Nr. III/42) (Kat. Nr. III/43)<br />
Abb. 6. 7: Berlin, Antikensammlungen F 2261 (Kat. Nr. III/43)
Abb. 1: Buffalo, Museum of Science Abb. 2: München, Mus. für antike Kleinkunst 2427<br />
C23262 (Kat. Nr. IV/1) (Kat. Nr. IV/2)<br />
Abb. 3: Paris, Musée du Louvre G 143 Abb. 4: Berlin, Antikensammlung F 2269<br />
(Kat. Nr. IV/3) (Kat. Nr. IV/4)<br />
T a f . | 19<br />
Abb. 5: New York, Metropolitan Mus. 07.286.50 Abb. 6: Athen, Nat. Mus. Acropoliscoll. 1.2277<br />
(Kat. Nr. IV/5) (Kat. Nr. IV/7)
T a f . | 20<br />
Abb. 1: Chicago, Art Institut 1911.456 (Kat. Nr. IV/8) Abb. 2: London, British Mus. E 44 (Kat. Nr. IV/9)<br />
Abb. 3. 4: Würzburg, Martin-von-Wagner Mus. 451 (Kat. Nr. IV/10)<br />
Abb. 5:Athen, Nat. Mus. 1619 (Kat. Nr. IV/11) Abb. 6:. London, British Mus. E 51<br />
(Kat. Nr. IV/12)<br />
Abb. 7: Paris, Musée du Louvre CA 587 (Kat. Nr. IV/13) Abb. 8: Athen, Agora-Mus. P 18283<br />
(Kat. Nr. IV/14)
Abb. 1. 2: Athen, Benaki Mus. 31138 (Kat. Nr. IV/15)<br />
Abb. 3: Christchurch (N. Z.), Canterbury Mus. Abb. 4: Sydney, Nicholson Mus. 98.42<br />
AR 430 (Kat. Nr. IV/16) (Kat. Nr. IV/17)<br />
Abb. 5: St. Petersburg, St. Hermitage Mus. Abb. 6: Paris, Musée du Louvre CA 925<br />
ST 1723/B637/1602 (Kat. Nr. IV/18) (Kat. Nr. IV/19)<br />
Abb. 7: Brüssel, Musées Royaux d´Art et d´Histoire R 351 (Kat. Nr. IV/20)<br />
T a f . | 21
T a f . | 22<br />
Abb. 1: Paris, Musée du Louvre G 13 (Kat. Nr. IV/21)<br />
Abb. 2: Boston (MA), Mus. of Fine Arts 1970.233 Abb. 3: Ehem. München, Sammlung Arndt<br />
(Kat. Nr. IV/22) (Kat. Nr. IV/23)<br />
Abb. 4: Malibu, John Paul Getty Mus. 83.AE.321 Abb. 5: Berlin, Antikensammlung F 2414<br />
(Kat. Nr. IV/24) (Kat. Nr. IV/25)
Abb. 1: Tübingen, Eberhard-Karls-Univ., Abb. 2: Paris, Musée du Louvre G 424<br />
Arch. Inst. 5439 (Kat. Nr. V/1) (Kat. Nr. V/2)<br />
T a f . | 23<br />
Abb. 3: Florenz, Mus. Arch. Naz. 81948 Abb. 4: Tarquinia, Mus. Naz. Tarquiniense RC 5291<br />
(Kat. Nr. V/3) (Kat. Nr. V/4)<br />
Abb. 5: Rom, Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia 20846 Abb. 6: Berlin, Antikensammlung F 2373<br />
(Kat. Nr. V/5) (Kat. Nr. V/6)
T a f . | 24<br />
Abb. 1: Oxford, Ashmolean Mus. 1966.888 Abb. 2: Athen, Nat. Mus. 16279<br />
(Kat. Nr. V/8) (Kat. Nr. V/9)<br />
Abb. 3: Boston, Mus. of Fine Arts 10.223 Abb. 4: Oxford, Ashmolean Mus. 1927. 4067<br />
(Kat. Nr. V/10) (Kat. Nr. V/11)<br />
Abb. 5: Berlin, Antikensammlung F2520 Abb. 6: Gießen, Justus-Liebig-Univ.,<br />
(Kat. Nr. V/12) Antikensammlung KIII44 (Kat. Nr. V/13)
Abb. 1: London, British Mus. E 187 Abb. 2: Berlin, Antikensammlung F 2393<br />
(Kat. Nr. V/14) (Kat. Nr. V/15)<br />
Abb. 3: : Univ. of Mississippi, Univ. Museums Abb. 4: Agrigent, Mus. Arch. Regionale (o. Inv.)<br />
7.3.196 (Kat. Nr. V/16) (Kat. Nr. V/17)<br />
Abb. 5. 6: Athen, Nat. Mus. 2179/CC1589 (Kat. Nr. V/18)<br />
T a f . | 25
T a f . | 26<br />
Abb. 1: San Simeon (CA), Hearst Historical St. Monument<br />
10004 (Kat. Nr. V/19)<br />
Abb. 2: Ehem. Stettin, Museum (Kat. Nr. V/20)<br />
Abb. 3: London, British Mus. E 189 (Kat. Nr. V/22) Abb. 4: London, British Mus. E 191 (Kat. Nr. V/23)<br />
Abb. 5: Kassel, Antikensammlung der Staatl.<br />
Kunstsammlungen T 435 (Kat. Nr. V/24)
Abb. 1: Brauron, Arch. Mus. (o. Inv.) Abb. 2. 3: Paris, Cabinet des Medailles 303<br />
(Kat. Nr. V/26) (Kat. Nr. V/27)<br />
Abb. 4: Paris, Cabinet des Medailles 303 Abb. 5: Paris, Musée du Louvre G 521<br />
(Kat. Nr. V/27) (Kat. Nr. V/28)<br />
Abb. 6: Neapel, Nat. Mus. H2202/82924/M 2735 Abb. 7: Paris, Cabinet des Medailles 433<br />
(Kat. Nr. V/29) Kat. Nr. V/30)<br />
T a f . | 27