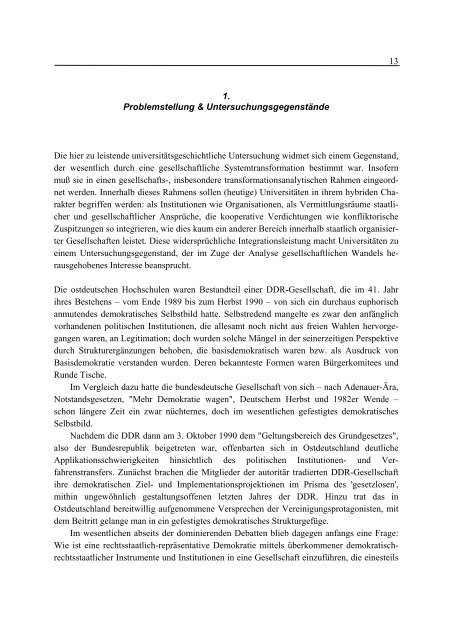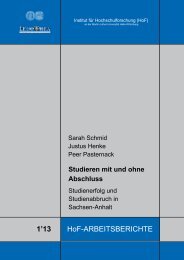- Seite 1 und 2: Peer Pasternack „Demokratische Er
- Seite 3 und 4: Inhalt Peer Pasternack „Demokrati
- Seite 5 und 6: Inhalt Inhalt Verzeichnis der Grafi
- Seite 7 und 8: Inhalt 3. Die Abwicklungen 244 Der
- Seite 9: I. Problemfeld & Untersuchungsdesig
- Seite 13 und 14: Bearbeitet werden sollen die hier e
- Seite 15 und 16: schaft ständig neu universitär vo
- Seite 17 und 18: Die Untersuchung greift aus dem gro
- Seite 19 und 20: zu finden, das einen personellen Ne
- Seite 21 und 22: oder auch "politisch-moralischen" I
- Seite 23 und 24: ostdeutscher Hochschulumbau Herbst
- Seite 25 und 26: genannten Textsorten können inhalt
- Seite 27 und 28: gische Arbeiten, quantitativ wie qu
- Seite 29 und 30: isch fundierte Arbeiten zur Mittelb
- Seite 31 und 32: (6) Mehrere umfänglich angelegte,
- Seite 33 und 34: (Ebd., 501) In seiner Abschlußbila
- Seite 35 und 36: Damit zur Fallgruppe A., also den F
- Seite 37 und 38: (A.4.) In der akademischen Medizin
- Seite 39 und 40: dalitäten des Umbaus der Disziplin
- Seite 41 und 42: Gauck-Überprüfung geregelt. Disku
- Seite 43 und 44: 3. Methoden & Quellen Die Untersuch
- Seite 45 und 46: Einigungsvertrag; doch der darauffo
- Seite 47 und 48: wurde technisch durch eine aus fün
- Seite 49: Mißerfolgsanalysen usw. verzichtet
- Seite 53 und 54: 1. Ostdeutsche Systemtransformation
- Seite 55 und 56: "daß die Strukturen einer - nicht
- Seite 57 und 58: Auch die ostdeutschen Hochschulen w
- Seite 59 und 60: lichen Entscheidungen bedeute jedoc
- Seite 61 und 62:
2. Demokratie & Hochschule Der beso
- Seite 63 und 64:
cher Subjektivität abgrenzen läß
- Seite 65 und 66:
auf Wissensbestände und ist an der
- Seite 67 und 68:
Sollen diese Anforderungen von den
- Seite 69 und 70:
Nun liegen im Hochschulsektor die z
- Seite 71 und 72:
tors in entwickelten marktwirtschaf
- Seite 73 und 74:
Kennziffernsteuerung der Hochschule
- Seite 75 und 76:
men für selbstbestimmte Entwicklun
- Seite 77:
limentation öffentlicher Aufgaben
- Seite 80 und 81:
82 � zu den vorangegangenen Demok
- Seite 82 und 83:
84 � die Beteiligungsformen, -str
- Seite 85 und 86:
Der Personalumbau an der Leipziger
- Seite 87 und 88:
1. Der Herbst 1989 und die Karl-Mar
- Seite 89 und 90:
Die seinerzeitige Stimmung war nich
- Seite 91 und 92:
Ich muß davon ausgehen, daß es...
- Seite 93 und 94:
skizziert. 110 Die Universitätszei
- Seite 95 und 96:
2. Die Neubesetzungen der Entscheid
- Seite 97 und 98:
ungsprozeß müsse "von unten nach
- Seite 99 und 100:
Zwar waren die Gruppenparitäten, s
- Seite 101 und 102:
fen: "Damit wird zum Ausdruck gebra
- Seite 103 und 104:
kommen, um mit der eigentlichen Arb
- Seite 105 und 106:
seine Mitglieder als Verhandlungspa
- Seite 107 und 108:
Fakultät bestehe. (Ebd.) Daraufhin
- Seite 109 und 110:
stimmen mit der Auffassung des Mini
- Seite 111 und 112:
Es ist aufschlußreich, diese Retro
- Seite 113 und 114:
Rektorwahl noch einmal Ausdruck der
- Seite 115 und 116:
weitere Vorhaltungen am Leben der U
- Seite 117 und 118:
demischen Selbstverwaltungsgremien.
- Seite 119 und 120:
Aufzählung in einer erkennbaren Sy
- Seite 121 und 122:
Ab April 1995 änderte sich schlie
- Seite 123 und 124:
der Sanierung des Hochhauses den Ne
- Seite 125 und 126:
schaftsvermögen der Universität h
- Seite 127 und 128:
die Entscheidung zum Hochhaus als G
- Seite 129 und 130:
der Beitrag einer Mitarbeiterin Kos
- Seite 131 und 132:
Augenmerk ziehen dabei die Begründ
- Seite 133 und 134:
Nun sollte diese 'Wertschätzung' n
- Seite 135 und 136:
Daß die Regelung intentional auf d
- Seite 137 und 138:
werber muß vor der Kandidatur mind
- Seite 139 und 140:
gung eingereicht werden, "damit sie
- Seite 141 und 142:
Betroffen waren von der Abwicklung
- Seite 143 und 144:
für "alle" Lehrkräfte einsetzen.
- Seite 145 und 146:
schen Hochschulverbandes) Martin Ol
- Seite 147 und 148:
gestrige Entscheidung gebunden zu f
- Seite 149 und 150:
senschaftstheoretischen Background;
- Seite 151 und 152:
Die Reaktion von Dirk Behr: "Das He
- Seite 153 und 154:
sich über den Stil der Gründungsk
- Seite 155 und 156:
4. Die Integritätsüberprüfungen
- Seite 157 und 158:
gend um Maßnahmen nicht nur für d
- Seite 159 und 160:
In dieser Kommission sollten nach A
- Seite 161 und 162:
Die oben erwähnten "zwölf Hochsch
- Seite 163 und 164:
Staatssicherheitsdienst verpflichte
- Seite 165 und 166:
einhalten müsse, sich ebenso künf
- Seite 167 und 168:
öffentlichen Lebens von früheren
- Seite 169 und 170:
ein, die auf Grundlage des SHEG geb
- Seite 171 und 172:
Im Mai 1991 meldeten sich vier Wiss
- Seite 173 und 174:
Der Vertrauensausschuß der Univers
- Seite 175 und 176:
Am 24. Mai hatte man im Ministerium
- Seite 177 und 178:
und 43 durch Vergleich mit Abfindun
- Seite 179 und 180:
chen "Defizite durch eine großzüg
- Seite 181 und 182:
zig geäußert zu haben; bekundete
- Seite 183 und 184:
185 "Ich kann... Ihr Verhalten nur
- Seite 185 und 186:
sie eigentlich kleine idiotische Ar
- Seite 187 und 188:
Damit war ein in der Tat bestehende
- Seite 189 und 190:
weis auf eine Anwendung dieser Mög
- Seite 191 und 192:
IV. Empirische Probe aufs demokrati
- Seite 193 und 194:
Der Personalumbau an der Humboldt-U
- Seite 195 und 196:
1. Der Herbst 1989 und die Humboldt
- Seite 197 und 198:
Die Universität nahm dies offenkun
- Seite 199 und 200:
Vorrangig indessen waren in dieser
- Seite 201 und 202:
(2) Rektor und Universitätsleitung
- Seite 203 und 204:
Bald indes geriet Hass in den - sei
- Seite 205 und 206:
wie Professorenherren" darzustellen
- Seite 207 und 208:
sowie einem weiteren, vom Akademisc
- Seite 209 und 210:
Prozeß der Neubesinnung zum Stills
- Seite 211 und 212:
icht damit befassen sollen. Das hat
- Seite 213 und 214:
echt zu machen. Wir erwarten, daß
- Seite 215 und 216:
217 schön für ihn', kommentiert S
- Seite 217 und 218:
ten. Der Senator wäre der einzige
- Seite 219 und 220:
nicht hinreichend gedeckt. Die Quel
- Seite 221 und 222:
Richard Schröder, als SPD-Politike
- Seite 223 und 224:
Am 6. und 7. Januar 1992 kam eine "
- Seite 225 und 226:
en/Erklärungen/Vermerke von den je
- Seite 227 und 228:
Am 22. Januar 1993 fand für Fink i
- Seite 229 und 230:
daraus gespeisten publizistischen D
- Seite 231 und 232:
"Es könnte... anders kommen, wenn
- Seite 233 und 234:
Permanent hatte die Präsidentin K
- Seite 235 und 236:
tung wurde von der Leitung sehr ern
- Seite 237 und 238:
Die Frankfurter Rundschau dagegen s
- Seite 239 und 240:
241 "Und auch die lapidare Haltung,
- Seite 241 und 242:
Präsidentin Dürkop bedauerte in d
- Seite 243 und 244:
gen lediglich "zugeordnet" worden.
- Seite 245 und 246:
"Teileinrichtungen", daß diese "ih
- Seite 247 und 248:
Auflösung war nach J. Eckert (1991
- Seite 249 und 250:
"Der Studentenrat wird eine Abstimm
- Seite 251 und 252:
Diese Initiative war offenkundig vo
- Seite 253 und 254:
Maßgeblich sei nicht, so das BVerf
- Seite 255 und 256:
4. Die Integritätsüberprüfungen
- Seite 257 und 258:
ihre Mitglieder gewählt. Am 24.10.
- Seite 259 und 260:
einschließlich einer Begründung s
- Seite 261 und 262:
zu machen, daß sich alle Bewerber
- Seite 263 und 264:
die Universitätsleitung vom jeweil
- Seite 265 und 266:
267 nem MfS-Mitarbeiter in seinen D
- Seite 267 und 268:
sich auch nicht anhand eines Protok
- Seite 269 und 270:
lautete: "Hatten Sie bewußten und
- Seite 271 und 272:
Bald tauchte beim Umgang mit den Fr
- Seite 273 und 274:
Am 3.5.1991 meldete Die Welt, drei
- Seite 275 und 276:
Brie hatte seine langjährige IM-Ve
- Seite 277 und 278:
So hatte sich im Sommer 1991 eine s
- Seite 279 und 280:
Bezug nehmen konnte Rosemarie Stein
- Seite 281 und 282:
Bei der genannten Zahl seien auch s
- Seite 283 und 284:
politische, sondern auch wissenscha
- Seite 285 und 286:
auch für ehrenamtliche Parteifunkt
- Seite 287 und 288:
Das am 11.6.1992 verabschiedete Hoc
- Seite 289 und 290:
291 "Angesichts des Zeitdrucks und
- Seite 291 und 292:
Universität haben freilich davon s
- Seite 293 und 294:
Der Umgang der einzelnen Personalst
- Seite 295 und 296:
tenzbedrohenden Auseinandersetzunge
- Seite 297 und 298:
4 FB Rehabilitationswissenschaften
- Seite 299 und 300:
tätsangehörige zu befragen, die i
- Seite 301 und 302:
Bries IM-Tätigkeit habe, so wurde
- Seite 303 und 304:
305 gegeben. Diese Richtlinien wurd
- Seite 305 und 306:
V. Die demokratische Qualität des
- Seite 307 und 308:
Der ostdeutsche Hochschulumbau lä
- Seite 309 und 310:
Der Gesamtprozeß vollzog sich in m
- Seite 311 und 312:
1. Partizipation und Repräsentatio
- Seite 313 und 314:
Studierenden mit dem System bereits
- Seite 315 und 316:
Expertentums besonders deutlich emp
- Seite 317 und 318:
Universitäten in dem 'gesetzlosen'
- Seite 319 und 320:
Selbstreinigung hat, bitten wir Sie
- Seite 321 und 322:
lich mit anderen Vorgängen war. Fe
- Seite 323 und 324:
Im Laufe der Umgestaltung waren an
- Seite 325 und 326:
waren gruppenspezifisch signifikant
- Seite 327 und 328:
oder Entwicklungen nur über Angeh
- Seite 329 und 330:
denten meinte später, "daß mit de
- Seite 331 und 332:
dungsabläufe. Neidhardt macht auf
- Seite 333 und 334:
Der Abberufungsvorgang selbst war,
- Seite 335 und 336:
"große und kleine Lichter, Idealis
- Seite 337 und 338:
In demokratietheoretischer Betracht
- Seite 339 und 340:
Zunächst waren jedoch auf zwischen
- Seite 341 und 342:
vitäten der Selbsterneuerung, sond
- Seite 343 und 344:
MfS kooperiert hatte. Insbesondere
- Seite 345 und 346:
liche Inkorporation vollziehende os
- Seite 347 und 348:
aushielt. Er wurde zum Stadtgesprä
- Seite 349 und 350:
351 Erschienen war der Band mit die
- Seite 351 und 352:
sofern Gegenteiliges nicht bekannt
- Seite 353 und 354:
lischen Akteure, die den Überprüf
- Seite 355 und 356:
3. Zusammenfassende Gegenüberstell
- Seite 357 und 358:
(Karl-Marx-)Universität Leipzig Hu
- Seite 359 und 360:
(Karl-Marx-)Universität Leipzig Hu
- Seite 361 und 362:
(Karl-Marx-)Universität Leipzig Hu
- Seite 363 und 364:
(Karl-Marx-)Universität Leipzig Hu
- Seite 365 und 366:
keiten ging von einer Exekutive aus
- Seite 367 und 368:
Verordnungen wie von autoritativen
- Seite 369 und 370:
versität Leipzig, sondern für das
- Seite 371 und 372:
untersagt hatte: Aus dem Schnoor-Sa
- Seite 373 und 374:
Dieser Sedimentierung war auch durc
- Seite 375 und 376:
ein gemeinsames Merkmal aus: Flexib
- Seite 377 und 378:
Entsprechungen zu dieser Struktur d
- Seite 379 und 380:
schen Verfahren zu erreichen, trotz
- Seite 381 und 382:
A. Gedruckte Literatur 830 Literatu
- Seite 383 und 384:
Bayerisches Staatsinstitut für Hoc
- Seite 385 und 386:
Buck-Bechler, Gertraude/Schaefer, H
- Seite 387 und 388:
Dudek, Peter/Tenorth, H.-Elmar (199
- Seite 389 und 390:
Feess-Dörr, E. (1991): Mikroökono
- Seite 391 und 392:
Geissler, Erich E. (1991): "Erfahru
- Seite 393 und 394:
Hass, Dieter (1989) (Iv.): Die Univ
- Seite 395 und 396:
Hubig, Christoph (1994): Schwankend
- Seite 397 und 398:
Kluge, Gerhard/Meinel, Reinhard (19
- Seite 399 und 400:
Lansnicker, Frank/Schwirtzek, Thoma
- Seite 401 und 402:
Meissner (1990): Vertrauensausschu
- Seite 403 und 404:
Nitsch, Wolfgang (1992): Hochschule
- Seite 405 und 406:
PDS/Linke Liste im Deutschen Bundes
- Seite 407 und 408:
Rosenbaum, Wolf (1994): Umbrüche,
- Seite 409 und 410:
Schrade, Annette (1991): Robert Hav
- Seite 411 und 412:
Stadler, Siegfried (1994): Der Weis
- Seite 413 und 414:
Topfstedt, Thomas (1998): Vom Weish
- Seite 415 und 416:
— (1994c): Falscher Eindruck. Zum
- Seite 417 und 418:
B. Unveröffentlichte Quellen 831 A
- Seite 419 und 420:
Hoffmann, Franz-Albert/Kubel, Marti
- Seite 421 und 422:
Kurzprotokoll der Sitzung der Unive
- Seite 423 und 424:
Stäber, Peter: Erklärung zur Arbe
- Seite 425:
Danksagung Die vorliegende Arbeit i