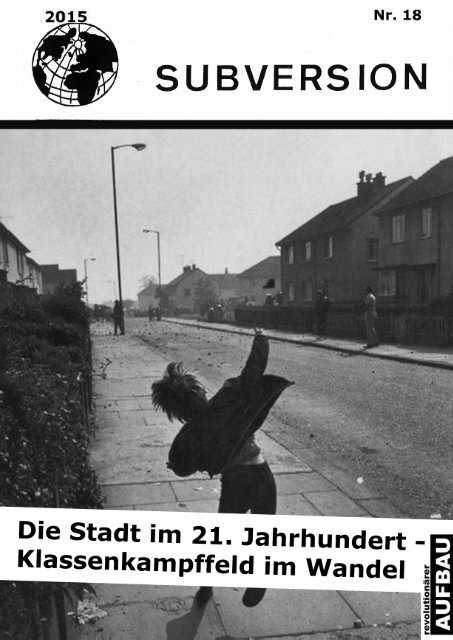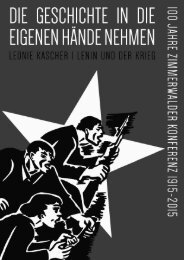Die Stadt im 21. Jahrhundert - Klassenkampffeld im Wandel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhaltsverzeichis<br />
<strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>im</strong> <strong>21.</strong> <strong>Jahrhundert</strong> – <strong>Klassenkampffeld</strong> <strong>im</strong> <strong>Wandel</strong><br />
1. Vorwort 5<br />
2. Ökonomische Ausgangssituation: Revolution der Produktivkräfte 6<br />
a) Deindustrialisierung, Tertiarisierung, Globalisierung 6<br />
b) Kapitalakkumulation durch Urbanisierung 8<br />
c) Klassenlage 10<br />
3. Politische Rahmenbedingungen 15<br />
a) Standortpolitik 15<br />
b) Kommerzialisierung von Raum 15<br />
c) <strong>Stadt</strong>entwicklung der <strong>Stadt</strong> Zürich 16<br />
4. Klassenkampf von oben 21<br />
a) Disziplinierung von öffentlichem Raum 21<br />
b) Sicherheitswahn 21<br />
c) Verdrängung 22<br />
d) Annäherung an die Videoüberwachung in der Schweiz 24<br />
5. Handlungstheorie – Klassenkampfanalyse 33<br />
a) Für eine revolutionäre Klassenposition 33<br />
b) Widerspruchserfahrungen 34<br />
c) Das urbane Kampffeld – Revolutionäre Gegenmacht 35<br />
Revolutionärer Aufbau Zürich <strong>im</strong> April 2014<br />
Postfach 8663, 8036 Zürich<br />
Email: info@aufbau.org / Internet: www.aufbau.org<br />
Aufbau Vertrieb: Zürich An- und Verkauf proletarischer und kommunistischer Literatur Kanonengasse 35<br />
(<strong>im</strong> Hinterhaus, Eisentreppe) jeden Samstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet<br />
Zur Illustration dieser Broschüre:<br />
<strong>Die</strong> Illustration der vorliegenden Broschüre folgt der Idee, dass die <strong>Stadt</strong> in ihrer historischen <strong>Wandel</strong>barkeit<br />
nicht nur Verdrängung, Kämpfe und Erinnerungen produziert, sondern ebenso eine vielschichtige Ästhetik<br />
mitkonstituiert. Das heisst, sie produziert auch Zeichen, die mehr als nur der reinen Informationsvermittlung<br />
dienen. So beispielsweise bei der Verdrängung, die durch ihren Leerstand, ihre grauen Betonflächen und<br />
Neubauten ebenso einen ästhetischen Eigenwert kreiert. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> ist jedoch nicht nur Ort der Verdrängung,<br />
sie ist ebenso Ort des Widerstandes und des Kampfes und dies eben nicht nur historisch, sondern auch aufgrund<br />
ihrer Funktion in der gegenwärtigen Gesellschaft. Auch hier entsteht eine ganz eigene Bilder produzierende<br />
Ästhetik. Der Widerstand hinterlässt Spuren an den Wänden und der Kampf solche auf den Strassen.<br />
Doch die <strong>Stadt</strong> ist mehr, sie ist auch Ort der sozialen Exper<strong>im</strong>ente, wo verschiedene Lebensformen ausprobiert,<br />
mit Architektur exper<strong>im</strong>entiert und Freiräume geschaffen werden. Was entsteht, wenn man zumindest den<br />
Versuch wagt, die <strong>Stadt</strong> nach anderen Interessen umzuformen, ist eine Ästhetik der Utopie, wo das Denkbare<br />
möglich wird. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> ist zuletzt auch Erinnerung, in ihr sammeln sich Erfahrungen vergangener Kämpfe,<br />
Widerstände und historischen Epochen. Eine solche, die wie eine Auswahl von Bildern mit Denkmälern für<br />
den Zweiten Weltkrieg aus dem ehemaligen Jugoslawien zeigt, sich auch über die Mauern ihrer selbst manifestieren<br />
kann.<br />
2 3
Ästhetik der Verdrängung<br />
1. Vorwort<br />
Paris 2005, London 2011, Istanbul 2013. In verschiedenen<br />
Städten weltweit kommt und kam es in<br />
den letzten zehn Jahren <strong>im</strong>mer wieder zu Aufständen,<br />
Revolten, militanten Protesten. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>im</strong> <strong>21.</strong><br />
<strong>Jahrhundert</strong> ist zu dem Ballungszentrum der sozialen<br />
und ökonomischen Widersprüche geworden<br />
und damit auch zu einem Ort der Klassenkämpfe.<br />
Denn durch die kapitalistische Urbanisierung verändern<br />
sich die sozialdemographischen Strukturen der<br />
Städte: Teure Neubauten als Investitionsobjekte fürs<br />
Kapital und eine zahlungskräftige Bewohnerklientel<br />
verdrängen mehr und mehr proletarische MieterInnen<br />
und Familien in die Peripherie.<br />
In dieser Broschüre versuchen wir aufzuzeigen,<br />
wie sich die ökonomische Situation durch Deindustrialisierungs-<br />
und Tertiarisierungsprozesse verändert<br />
hat und wie sich diese Veränderungen auf den<br />
urbanen Raum auswirken. Danach wird auf die politischen<br />
Rahmenbedingungen der Aufwertungs- und<br />
Verdrängungsprozesse (insbesondere an Beispielen<br />
aus Quartieren der <strong>Stadt</strong> Zürich) sowie die Seite der<br />
Repression mit ihren Möglichkeiten der Überwachung<br />
und ihren Sicherheitswahn eingegangen.<br />
Schliesslich geht es darum, auch in reaktionären<br />
Zeiten eine Kontinuität in den revolutionären Prozess<br />
hineinzubringen und eine Handlungstheorie zur<br />
Verfügung zu haben, welche den neuen Bedingungen<br />
entspricht und eine Klassenposition sichtbar macht.<br />
<strong>Die</strong> Frage nach dem revolutionären Subjekt kann nur<br />
mit einer Klassenkampfanalyse beantwortet werden.<br />
Also nicht nur mit einer blossen Strukturanalyse<br />
sondern einer Miteinbeziehung der real stattfindenden<br />
Kämpfe, welche nun mehr und mehr <strong>im</strong> öffentlichen<br />
Raum stattfinden. Denn <strong>im</strong> Kampf um den<br />
öffentlichen Raum, dem Kampf um die Strasse, geht<br />
es schliesslich um den Kampf zum Aufbau revolutionärer<br />
Gegenmacht.<br />
4 5
2. Ökonomische Ausgangssituation: Revolution der Produktivkräft<br />
a) Deindustrialisierung, Tertiarisierung, Globalisierung<br />
Materielle Produktion und das menschliche<br />
Arbeitsvermögen sind <strong>im</strong>mer noch die Basis der<br />
Ökonomie. Es ist die bürgerliche Ideologie, die versucht,<br />
die reale Bedeutung der Arbeit und damit<br />
die Ausbeutung zu negieren. Mit der Betonung der<br />
„Wissensgesellschaft“ oder der „Informationsgesellschaft“,<br />
quasi einer virtuellen Wirtschaft, ist <strong>im</strong>mer<br />
die Intention verknüpft, auch die Klassen und Klassenwidersprüche<br />
zum „Verschwinden“ zu bringen.<br />
Zwar haben sich insbesondere in den Metropolen<br />
die Formen der Widerspruchslinien verändert und<br />
damit die Wahrnehmung der Ausbeutung unklarer<br />
werden lassen, die Klassenfrage hat aber nichts von<br />
ihrer Bedeutung verloren.<br />
Was wir antreffen ist allerdings eine ungemein differenzierte<br />
und daher schwierig zu durchdringende<br />
Klassensituation. <strong>Die</strong> „Synchronität“ zwischen Arbeit,<br />
Ausbeutung, revolutionärem Subjekt, Klassenkampf,<br />
der entsprechenden Theoriebildung und dem<br />
Aufstandskonzept hat sich definitiv verschoben. In<br />
der marxistischen Revolutionstheorie wurde bezüglich<br />
dem Kampf der ArbeiterInnenbewegung zwischen<br />
den Akteuren bzw. dem revolutionären Subjekt<br />
(ArbeiterInnenklasse), dem gesellschaftlichen Hauptwiderspruch<br />
(Ausbeutung), der Handlungsmacht<br />
(ArbeiterInnen als Produzenten des gesellschaftlichen<br />
Reichtums) und der Zielsetzung (Klassenlose<br />
Gesellschaft) von einer hohen Einheit ausgegangen.<br />
<strong>Die</strong> aktuelle Situation ist mit dieser Zeit einer starken,<br />
revolutionären ArbeiterInnenbewegung nicht<br />
mehr zu vergleichen. <strong>Die</strong> Zunahme der sozialen Heterogenität<br />
widerspiegelt sich in einer Vielfalt der<br />
Kämpfe, Bewegungen und Revolten. Klassenlagen,<br />
Zielsetzungen und politische Reichweite sind analytisch<br />
für den revolutionären Prozess oft sehr schwierig<br />
zu ermitteln. <strong>Die</strong> historische Funktion der revolutionären<br />
ArbeiterInnenbewegung in den Metropolen<br />
als „Totengräber des Kapitalismus“ muss neu durchdacht<br />
werden. Der emanzipatorische Anspruch der<br />
ArbeiterInnenbewegung als die entscheidende revolutionäre<br />
Kraft ist teilweise erodiert. Zur Diskussion<br />
stehen die Ursachen dieser Entwicklung: Welche geschichtliche<br />
Rolle kommt dem Proletariat aktuell zu?<br />
Welche theoretischen und strategischen Konsequenzen<br />
ergeben sich daraus? Welche neuen Ansätze von<br />
Klassenbewusstsein sind vorhanden, um eine sozialistische<br />
alternative Gesellschaft zu erkämpfen? Wir<br />
müssen uns vom falschen Verständnis der „naturgesetzlichen“<br />
Entwicklung der ArbeiterInnenklasse zu<br />
einer kämpfenden Klasse verabschieden. Der quasi<br />
determinierte „revolutionäre Gegenprozess“ zum<br />
objektiv bedingten Gesamtprozess des Kapitalismus<br />
existiert definitiv nicht. In den letzten Jahrzehnten<br />
haben sich fundamentale Veränderungen in der kapitalistischen<br />
Produktionsweise und damit neue Differenzierungsprozesse<br />
in der Klassenzusammensetzung<br />
ergeben. Der „Industriekapitalismus“ ist nicht<br />
verschwunden, sondern reproduziert sich in modifizierten<br />
Formen durch den Widerspruch zwischen<br />
den kapitalistischen Zentren und der Peripherie in<br />
globalem Massstab. „Globalisierung“ ist jedoch kein<br />
neues Phänomen, sondern in der Tendenz von Anfang<br />
an charakteristisch für den Kapitalismus. Durch<br />
die Entwicklung neuer Technologien haben sich in<br />
der Umsetzung der internationalen Arbeitsteilung<br />
die Geschwindigkeit und der Grad der Vernetzung<br />
radikal verändert. Durch die mikroelektronischen,<br />
biogenetischen und nanotechnologischen Entwicklungen<br />
der Produktivkräfte befinden wir uns in einer<br />
gesellschaftlichen Umbruchsituation, die durch eine<br />
ausserordentliche Revolution der Produktivkräfte<br />
geprägt ist. In der Auseinandersetzung über die kapitalistischen<br />
Produktionsverhältnisse existiert eine<br />
verkürzte „Produktivkraftideologie“, die von unbegrenzten<br />
technologischen Möglichkeiten ausgeht,<br />
quasi einem „naturgesetzlichen“ Technikdeterminismus.<br />
<strong>Die</strong>sen unveränderlichen Konstanten „könne<br />
allenfalls mit Umschulungen und Sozialplänen<br />
begegnet werden, fundamental angreifen liessen sie<br />
sich allerdings nicht“. Damit verbunden ist ein historischer<br />
Fatalismus, der nur den Herrschenden dienen<br />
kann. Als ob in der Technologie das objektiv treibend<br />
und letztlich entscheidende Prinzip der Entwicklung<br />
der Produktivkräfte liegen würde.<br />
Alle gesellschaftlichen Bereiche werden von Menschen<br />
mit best<strong>im</strong>mten Klasseninteressen gemacht.<br />
Auch Technik muss als sozialer Prozess verstanden<br />
werden, der sich dialektisch vollzieht. Technische<br />
Entwicklungen best<strong>im</strong>men die kapitalistischen Möglichkeiten<br />
nur insofern, als es wiederum letztlich kapitalistische<br />
Erfordernisse sind, die best<strong>im</strong>mte technische<br />
Entwicklungen nach sich ziehen.<br />
In der aktuellen Produktivkräfteentwicklung<br />
n<strong>im</strong>mt die Computertechnologie die zentrale Stellung<br />
ein. Sie ist für die kapitalistische Reproduktion<br />
überlebenswichtig, weil die zunehmende Komplexität<br />
der Arbeitsteilung ein grosses Koordinationsbedürfnis<br />
erzeugt, das nur noch digitalisiert zu leisten<br />
ist. <strong>Die</strong> Industrieproduktion wird nicht ersetzt, sondern<br />
verlagert, und die neuen Technologien dienen<br />
ihr funktional zu. Eine historische D<strong>im</strong>ension bekommt<br />
diese digitale Technologie vielleicht dadurch,<br />
dass Wissen eines Tages nur noch in elektronischer<br />
Form vorhanden sein wird und daher von den Herrschenden<br />
zentral kontrolliert werden kann.<br />
Bezüglich Klassenstruktur, ihrer Zusammensetzung<br />
und auf das Klassenbewusstsein hat dieser<br />
Vergesellschaftungsprozess fundamentale Verschiebungen<br />
zur Folge: Differenzierungen und Segmentierungen<br />
<strong>im</strong> Proletariat, einschliesslich <strong>im</strong>mer krasser<br />
werdender Lohnunterschiede, Abnahme der Bedeutung<br />
des kapitalistischen Grossbetriebs in den Metropolen,<br />
eine Verschärfung der Diskr<strong>im</strong>inierung der<br />
Frauen, eine neue Qualität unsicherer Arbeitsverhältnisse<br />
bzw. der Proletarisierung, eine veränderte<br />
Rolle der Intellektuellen usw. Auch der Zusammenhang<br />
der nationalen Klassensituation und der Internationalisierung<br />
der kapitalistischen Ökonomie wird<br />
durch einen Konkurrenzkampf um die schlechtesten<br />
Arbeits- und Sozialverhältnisse geprägt.<br />
<strong>Die</strong>se Situation bewirkte tiefgreifende Veränderungen<br />
der Klassenzusammensetzung in der<br />
Schweiz. <strong>Die</strong> Automatisierung der Produktion und<br />
die Auslagerung der Fabrikation in Billiglohnländer<br />
haben zur Folge, dass der Industriesektor, der in den<br />
60er Jahren noch fast die Hälfte der Lohnabhängigen<br />
beschäftigte, zunehmend an Bedeutung verliert.<br />
Heute arbeiten über 70% <strong>im</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsbereich.<br />
Im Industriesektor sind es noch etwa 25%. Ausdruck<br />
dieser Entwicklung ist eine Industrieproduktion, die<br />
insgesamt trotz Abbau der Arbeitskräfte gesteigert<br />
werden konnte. <strong>Die</strong>se ökonomische Entwicklung<br />
der letzten Jahrzehnte ist städtebaulich <strong>im</strong> Kreis 5<br />
in Zürich und in Zürich-Oerlikon sehr ausgeprägt<br />
sichtbar! <strong>Die</strong> Formen der politischen Sozialisierung,<br />
bzw. die Möglichkeiten der Manipulierung, haben<br />
sich entsprechend dieser ökonomisch-sozialen Lage<br />
stark verändert. Der Widerspruch zwischen der Realität<br />
der Klassengesellschaft und dem Bewusstsein<br />
über diese Realität hat sich enorm vertieft. <strong>Die</strong> gesellschaftlichen<br />
Probleme und politischen Verwerfungen<br />
werden kaum noch als Klassengegensätze<br />
wahrgenommen. <strong>Die</strong> Struktur von Herrschaft bleibt<br />
<strong>im</strong> Dunkeln. Daraus folgt allerdings keinesfalls, dass<br />
es keine Klassen und keine Klassenkonflikte mehr<br />
gibt, sondern die Klassenkämpfe finden nicht den<br />
politischen Ausdruck, welcher in Zeiten einer engen<br />
Verbindung von kämpfender ArbeiterInnenbewegung<br />
und Sozialismus vorherrschend war. Eine Klassenanalyse<br />
ist keine blosse Strukturanalyse, sondern<br />
insbesondere eine Analyse der Voraussetzungen und<br />
Bedingungen der politischen Klassenbildung. Ihr revolutionäres<br />
Potential schöpft sie aus der Erkenntnis<br />
über konkretes gesellschaftliches Handeln der kollektiven<br />
Subjekte. Eben Klassenkampfanalyse. Sie<br />
beantwortet die Frage, wie der Prozess zwischen der<br />
objektiven ökonomisch begründeten Klassenanalyse<br />
und der kollektiv handelnden potentiell revolutionären<br />
Subjekte verläuft. Nicht die marxistische Theorie,<br />
nach dem Motto „Abschied vom Proletariat“,<br />
ist gescheitert, sondern die Klassenbildung bzw. die<br />
Entstehung von revolutionärem Klassenbewusstsein<br />
sind Veränderungen unterworfen, deren Ursachen<br />
zuerst genau untersucht werden müssen - insbesondere<br />
bezüglich neuer Klassenkämpfe. <strong>Die</strong>ser Lernprozess<br />
kann allerdings nur über die Praxis auf der<br />
Strasse, <strong>im</strong> Kampf für den Aufbau ideologischer und<br />
organisatorischer Gegenmacht gegen die Macht des<br />
Kapitals bewerkstelligt werden.<br />
6 7
) Kapitalakkumulation durch Urbanisierung<br />
Linear zur krisenbedingt veränderten ökonomischen<br />
Ausgangslage des Proletariats und der damit<br />
zusammenhängenden räumlichen Verschiebung entwickeln<br />
sich auch unsere Städte. <strong>Die</strong> Bedeutung der<br />
<strong>Stadt</strong> hat für die menschliche Existenz, insbesondere<br />
seit der Industrialisierung und angesichts einer laufend<br />
wachsenden Weltbevölkerung, stetig zugenommen.<br />
Seit 2008 leben erstmals mehr Menschen in der<br />
<strong>Stadt</strong> als auf dem Land.<br />
Langfristig dem Gesetz der sinkenden Profitrate<br />
unterworfen, besitzt das Kapital trotzdem noch <strong>im</strong>mer<br />
die Fähigkeit, veränderte ökonomische Rahmenbedingungen<br />
zu seinen Gunsten auszunutzen oder<br />
sogar explizit zu schaffen. <strong>Die</strong> herrschende Klasse hat<br />
die Urbanisierung längst als Feld entdeckt, in dem<br />
sich lukrative Investitions- und Spekulationsgebiete<br />
eröffnen. Um das Bestehen des Kapitalismus zu<br />
sichern, muss überakkumuliertes Kapital zwingend<br />
eine neue Anlage finden. Während klassische Lösungen<br />
(z.B. die Ausweitung der Produktion zu Lasten<br />
der Umwelt, die Ausweitung der Produktion durch<br />
Immigration oder auch die Disziplinierung der ArbeiterInnen)<br />
die Kapitalakkumulation kontinuierlich<br />
voranzutreiben regelmässig an system<strong>im</strong>manente<br />
Grenzen gestossen sind, zeigte sich, dass die Investition<br />
in die <strong>Stadt</strong>, konkret in Immobilien und Grundstücke,<br />
genau diese Grenzen ein Stück weit überspringen<br />
kann. Urbanisierung kann zwar Krisen auslösen aber<br />
sie ist vor allem ein Weg, um Krisen zu vermindern<br />
oder herauszuzögern. In den vielen verschiedenen<br />
Bauprojekten findet das Kapital eine scheinbar sichere<br />
und vor allem langfristige Anlage, während die<br />
Preisspirale des Immobiliensektors weitere lukrative<br />
Gewinne verspricht. <strong>Die</strong> Menschen werden so über<br />
steigende Mieten, Transport- und Unterhaltskosten<br />
ein zweites Mal ausgebeutet.<br />
Es lässt sich historisch betrachten, dass ein grosser<br />
Teil des Überschusskapitals jeweils durch den Bau<br />
von Infrastruktur, wie beispielsweise Strassen, oder<br />
von Eigentum absorbiert wurde. <strong>Die</strong>s lohnt sich, weil<br />
die jeweiligen Prozeduren langlebig sind. Oftmals<br />
vergehen Jahre, bis ein Projekt fertiggestellt und in<br />
Betrieb genommen wird. Inzwischen können Banken<br />
gleichzeitig Kredite an beide Parteien vergeben:<br />
An die Bauwirtschaft und die künftigen KäuferInnen.<br />
Das erste einschneidende Beispiel dafür ist die Entwicklung<br />
nach dem zweiten Weltkrieg: Der Bau von<br />
Vorstädten und die Schuldenfinanzierung von neuen<br />
Häusern trug damals massgeblich zur Wiederbelebung<br />
der Wirtschaft bei- und an dieser Strategie wurde<br />
auch später die ganze neoliberale Ära hindurch<br />
festgehalten.<br />
<strong>Die</strong> bauliche Entwicklung, vor allem in weltwirtschaftlich<br />
bedeutsamen Städten, ist abhängig von<br />
den globalen Finanzmärkten. Immobilien als etwas<br />
„Dingfestes“ waren schon <strong>im</strong>mer eine Ware. Verändert<br />
hat sich allerdings, dass durch die totale Abkopplung<br />
von realen (Markt-)Bedürfnissen die Spekulation<br />
um Boden in einer Unverhältnismässigkeit<br />
praktiziert wird, die <strong>im</strong>mer mehr zum Problem wird.<br />
Denn die Ressource Raum wird zunehmend knapp.<br />
<strong>Die</strong> Planung und Gestaltung des öffentlichen Raumes<br />
geschieht demnach keineswegs zufällig.<br />
<strong>Die</strong> Kriterien der <strong>Stadt</strong>strategInnen richten sich<br />
nicht nach den Bedürfnissen derer, die <strong>Stadt</strong> produzieren<br />
und reproduzieren, sondern nach der Bedeutsamkeit<br />
des jeweiligen Ortes für den internationalen<br />
Markt. <strong>Die</strong> unternehmerische Städtepolitik,<br />
den Sachzwängen des Kapitalismus unterworfen, orientiert<br />
sich also vor allem am Konkurrenzverhältnis<br />
zu anderen Ortschaften und am Kampf um Standortvorteile.<br />
Städteplanerische Massnahmen gehören<br />
zu einer gut durchdachten Strategie, die den urbanen<br />
Raum einerseits für Profitgenerierung und -Max<strong>im</strong>ierung<br />
nutzt und andererseits, kohärent dazu, den<br />
generierten Profit mit allen Mitteln zu schützen versucht.<br />
Im Zuge der kapitalistischen Verwertungslogik<br />
wird Raum so entsprechend der Interessen der Herrschenden<br />
funktional gemacht. <strong>Die</strong> Gestaltung des öffentlichen<br />
Raums schafft oder verhindert also geplant<br />
Möglichkeiten.<br />
Dass sich (verschärfte) Klassenwidersprüche gerade<br />
<strong>im</strong> öffentlichen Raum verdeutlichen, ist den<br />
Herrschenden schmerzlich bewusst. Das Ziel von<br />
städteplanerischen Massnahmen ist also auch, zu<br />
verhindern, dass sich in der <strong>Stadt</strong> politische Oppositionen<br />
oder ähnliche progressive Ansätze bilden<br />
können. Das bedeutet, dass die städtische Aufwertung<br />
in der Form, in der sie von beinahe allen Seiten<br />
thematisiert wird, vor allem eine Auswirkung vom<br />
allgegenwärtigen Streben nach Standortattraktivität,<br />
insbesondere für internationale Multis und Grossinvestoren,<br />
ist und gleichzeitig und gerade deswegen,<br />
der Aufstandsbekämpfung in der <strong>Stadt</strong> dient.<br />
<strong>Die</strong> gezielte <strong>Stadt</strong>aufwertung ist wie bereits erwähnt<br />
keine Neuerscheinung: Seit es kapitalistische<br />
Städte gibt, werden „Arme“ stadtplanerisch umgesiedelt<br />
und kontrolliert. Neu ist allerdings, dass<br />
mittlerweile viele städtische Verwaltungen ganz bewusst<br />
auf Gentrifizierung als Strategie zur <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
setzten. Selbst in akademischen Debatten<br />
unter <strong>Stadt</strong>soziologen vermehren sich die St<strong>im</strong>men,<br />
die sie als geeignetes Mittel darstellt, um Innenstädte<br />
wiederzubeleben. Urbanisierung dient als Kanal, um<br />
überschüssiges Kapital <strong>im</strong> Fluss zu halten und unsere<br />
Städte <strong>im</strong> Interesse der Bourgeoisie neu zu bauen und<br />
zu gestalten. <strong>Die</strong> Wertsteigerung <strong>im</strong> urbanen Raum<br />
bedingt den qualitativen Schritt von Investitionen in<br />
Immobilien und Grundstücke hin zur Spekulation<br />
mit ebendiesem Gut. Da kommt die Gentrifizierung<br />
ins Spiel. Es geht nicht mehr darum, in etwas Entstehendes<br />
zu investieren, sondern dies möglichst langfristig<br />
gewinnbringend zu nutzen und zu vermarkten.<br />
Dass dieser Prozess zwangsläufig mit der personellen<br />
Umgestaltung ganzer Quartiere einhergeht,<br />
weckt natürlich auch Widerstand. Dazu zählen beispielsweise<br />
MieterInnen-Kämpfe, das Verteidigen<br />
von besetzten Liegenschaften, die Präsenz <strong>im</strong> öffentlichen<br />
Raum mit revolutionärer Propaganda oder gezielte<br />
„<strong>Stadt</strong>abwertung“ durch Angriffe auf Gebäude<br />
und andere Sachbeschädigungen, wie sie zum Beispiel<br />
in Deutschland aktiv betrieben wird; aber auch<br />
durch die Menschen, die in den Augen der Bourgeoisie<br />
durch ihre blosse Anwesenheit den Wert einer Gegend<br />
senken.<br />
Damit die Gentrifizierung klappt, wird unter dem<br />
Vorwand von Sicherheit, Sauberkeit und der Opt<strong>im</strong>ierung<br />
von Raum die Umstrukturierung hin zur<br />
komplett kontrollierbaren <strong>Stadt</strong> gerechtfertigt. Ganze<br />
Quartiere werden videoüberwacht und beeindrucken<br />
durch eine enorme Polizeipräsenz.<br />
Öffentliche Plätze bieten längst kaum mehr Sitzgelegenheiten,<br />
um den „Pöbel“ fernzuhalten und<br />
Wegweisungen, rassistische Schikane und Repression<br />
sind an der Tagesordnung. Strassen werden so<br />
gestaltet, dass sie gut überschaubar und schnell und<br />
effizient zu erreichen sind. Es ist längst klar definiert,<br />
wer sich wo aufzuhalten hat. Gleichzeitig ist auch<br />
das Mittel der Befriedung beliebt. Sozial und ökonomisch<br />
„Schwächere“ werden so unter dem Deckmantel<br />
der Integration zum Stillhalten bewegt, damit<br />
erst gar kein Widerstand entsteht. Oder aber es werde<br />
Möglichkeiten des Widerstandes und der Aneignung<br />
verhindert, wie in Zürich gerade sehr aktuell,<br />
beispielsweise durch Zwischennutzungen bei leer stehenden<br />
Häusern. Gezielt wird so einerseits Profit aus<br />
sonst temporär wertlosem Grund geschlagen, andererseits<br />
werden eigentlich „private Räume“ dadurch<br />
opt<strong>im</strong>al kontrollierbar, während vordergründig ein<br />
sozialer Gedanke vorgegaukelt wird. Auch hier wird<br />
also die Kontrolle, wer wo, wie zu leben hat, elegant<br />
verschärft. Wer die vorgegebenen Rahmenbedingungen<br />
nicht einhält, hat mit Repression zu rechnen. Der<br />
Aspekt der Spaltung ist hier nicht zu unterschätzen.<br />
Ein anderes Beispiel sind Grossprojekte, welche<br />
als „sozialer Wohnungsbau“ bezeichnet werden, obwohl<br />
sie die dafür notwendigen Kriterien längst nicht<br />
mehr erfüllen. Konkret meint das die Art von Wohnungsbau,<br />
die zwar unter der Flagge der städtischen<br />
oder genossenschaftlichen Idee gehandhabt wird,<br />
die sich aber in der Realität kein „durchschnittlich<br />
Verdienender” mehr leisten kann. Dass dafür bereits<br />
genutzte Flächen erst einmal „freigeräumt“ werden<br />
müssen, was in den meisten Fällen mit der Vertrei-<br />
8 9
ung von Ansässigen und Kleingewerbe einher geht,<br />
ist aufgrund der Perspektive legit<strong>im</strong>. <strong>Die</strong> zukünftigen<br />
BewohnerInnen eines Quartiers definieren, wer als<br />
nächstes hinzuzieht, welche Sicherheitsmassnahmen<br />
gerechtfertigt sind und dementsprechend auch, für<br />
welche Konzerne der Standort attraktiv ist.<br />
Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen<br />
den Veränderungen unserer Städte und des <strong>im</strong>perialistischen<br />
Kapitalismus, zeigt sich also deutlich,<br />
dass <strong>Stadt</strong>aufwertung nicht einfach ein „eigenständiger,<br />
natürlicher Vorgang <strong>im</strong> Zeichen der Zeit“ ist,<br />
sondern einer der vielen Notwendigkeiten, um den<br />
Kapitalismus am Leben zu erhalten. Der profunde<br />
Widerspruch zwischen kollektiver Produktion und<br />
privater Aneignung reproduziert sich also auch in<br />
den Städten.<br />
Das Kapital braucht zwar die gesellschaftliche<br />
Produktion, um Mehrwert zu generieren und diesen<br />
dann privat anzueignen, sichtbar aber will es die Produzierenden<br />
an sich lieber nicht. <strong>Die</strong> kapitalistische<br />
Entwicklung beeinflusst die Veränderung und Entstehung<br />
von Städten und umgekehrt - international.<br />
Urbanisierung lässt sich also nur <strong>im</strong> Gesamtkontext<br />
vom vorherrschenden kapitalistischen Akkumulationsreg<strong>im</strong>e<br />
analysieren und verstehen und ist keineswegs<br />
losgelöst von den vorherrschenden Produktionsverhältnissen<br />
und dem bestehenden bürgerlichen<br />
Verständnis von Eigentumsrecht.<br />
c) Klassenlage<br />
Vor gut 50 Jahren war die Hälfte aller Erwerbstätigen<br />
in der Schweiz in der Industrie beschäftigt; heute<br />
sind es noch knapp 26%. In der Schweiz und in<br />
anderen Industrieländern ist ein deutlicher <strong>Wandel</strong><br />
vom starken Industriesektor zum starken <strong>Die</strong>nstleistungssektor<br />
auszumachen. <strong>Die</strong>s hat einerseits mit der<br />
vorher beschriebenen Globalisierung zu tun, welche<br />
tiefgreifende Veränderungen in der kapitalistischen<br />
Produktionsweise auslöste: Industrielle Produktion<br />
wird in die Peripherie verlagert, meist also in Billiglohnländer.<br />
Kleinere Produktionsstätten verlagern<br />
ihre Einrichtung von der <strong>Stadt</strong> aufs Land, da dort<br />
der Raum günstiger ist. Weiter hat der technische<br />
Fortschritt Einfluss darauf, dass der Industriesektor<br />
auf weniger Personen zugreifen muss, gleichzeitig<br />
aber rentabler produziert. <strong>Die</strong>se Entwicklung ist der<br />
momentane Stand der sich permanent in Bewegung<br />
befindlichen Form der Mehrwertproduktion, die<br />
auch die jeweilige Zusammensetzung der ArbeiterInnenklasse<br />
best<strong>im</strong>mt. Um dies genau zu erklären, ein<br />
Blick zurück: In der Frühphase des Kapitalismus dominierten<br />
die Manufakturen, die sich durch eine geringe<br />
bis keine Arbeitsteilung charakterisierten. <strong>Die</strong><br />
Qualifikation der ArbeiterInnen war relativ hoch,<br />
ihre Austauschbarkeit begrenzt. Ebenso die Mobilität<br />
des Manufakturkapitals. <strong>Die</strong>se vor allem handwerkliche<br />
Produktionsweise best<strong>im</strong>mte über die Zusammensetzung<br />
der Klasse, vor allem FacharbeiterInnen,<br />
und somit über das Klassenbewusstsein der damaligen<br />
Zeit. <strong>Die</strong>se erste Form der Mehrwertproduktion<br />
basierte auf Ausdehnung der absoluten Arbeitszeit<br />
als auch auf deren Intensivierung. Allerdings waren<br />
der notwendigen Erhöhung der Profitmasse in diesen<br />
Formen Grenzen gesetzt.<br />
<strong>Die</strong> Profitrate konnte nur noch über die Steigerung<br />
der Produktivität vergrössert oder zumindest<br />
erhalten werden. <strong>Die</strong>s führte zwangsläufig zu einer<br />
Veränderung der Arbeitsformen und damit auch zu<br />
einer anderen Klassenzusammensetzung. <strong>Die</strong> nun<br />
vorgenommene Aufteilung des Arbeitsprozesses, beziehungsweise<br />
seine Mechanisierung, bewirkte einen<br />
technologischen Schub und eine Neuorganisation<br />
der Arbeit mit dem Ziel, die Kapitalakkumulation<br />
vorwärts zu treiben. Der <strong>im</strong> Kapitalismus angelegte<br />
Zwang zu fortlaufender technologischer Erneuerung<br />
entwickelte sich in der damaligen Phase zu einer Tendenz,<br />
die „abstrakte Arbeit“ genannt werden kann,<br />
wenn auch in der Schweiz der Anteil der eigentlichen<br />
Fliessbandarbeit <strong>im</strong>mer einen kleinen Anteil an den<br />
verschiedenen Produktionsformen hatte. Doch der<br />
handwerklich geprägte Facharbeiter wurde auch hier,<br />
sowohl durch technisch ausgebildete ArbeiterInnen<br />
als auch durch ungelernte MassenarbeiterInnen abgelöst.<br />
Von 1941 bis 1970 sank der Anteil der „alten“<br />
FacharbeiterInnen von 40% auf 26%. Der Arbeitsprozess<br />
wurde weiter differenziert, Wissen und Ausführung,<br />
Vorbereitung und Kontrolle der Arbeit aufgeteilt,<br />
das Leistungsprinzip zum alleinigen praktischen<br />
und auch ideologischen Massstab ernannt. Schon<br />
damals fiel der relative Anteil der ArbeiterInnen am<br />
Total der Mehrwertproduktion, die gesamthaft zugenommen<br />
hat, nämlich von 82% auf 57%. Das heisst,<br />
die Stellung der mit organisatorischen und planerischen<br />
Aufgaben Beschäftigen nahm laufend zu. <strong>Die</strong><br />
Zusammensetzung der Lohnabhängigen in der Industrie<br />
veränderte sich Richtung „Büro“, gemeinsame<br />
Klasseninteressen waren weniger vorhanden, Klassenkämpfe<br />
schwieriger.<br />
<strong>Die</strong> Arbeitsteilung ermöglichte die angestrebte<br />
Produktivitätssteigerung, die den Akkumulationsprozess<br />
enorm steigerte. Kleinbetriebe wurden zu<br />
grösseren Betrieben, das Kapital zunehmend zentralisiert<br />
und konzentriert, multinationale Konzerne<br />
entstanden. Es nahm die Tendenz ihren Anfang,<br />
welche bis heute andauert: Es bildete sich eine enorme<br />
Heterogenität der ArbeiterInnenklasse und eine<br />
<strong>im</strong>mer komplexer werdende Gesellschaftsstruktur.<br />
Zurück zur aktuellen Situation. <strong>Die</strong> oben beschriebene<br />
Neukonzipierung des Verwertungsprozesses der<br />
letzten Jahrzehnte verschärfte diese Differenzierung,<br />
Komplexität, Globalisierung und Parzellierung der<br />
Produktion noch und hatte auf die Klassenzusammensetzung<br />
in der Schweiz grosse Auswirkungen.<br />
Der industrielle Anteil der Mehrwertproduktion der<br />
Schweiz findet vor allem <strong>im</strong> Ausland statt. <strong>Die</strong>ser<br />
Umbruch hat auch einen enormen Einfluss auf die<br />
Struktur der Städte als Ballungszentren: Einst waren<br />
sie Hauptstätte industrieller Produktion, heute sind<br />
sie Knotenpunkt von <strong>Die</strong>nstleistung und Konsum.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> ist als Teil des <strong>Die</strong>nstleistungsbetriebs<br />
zu verstehen. Wie aufgezeigt wurde, wird in sie investiert<br />
wie in andere Unternehmungen. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong><br />
ist nicht mehr einfach ein bauliches Gefilde, sondern<br />
vielmehr eine Marke, gar ein Label. Dass in den letzten<br />
Jahren vermehrt Kapital in die Städte floss, zeigt<br />
sich auch am Wachstum der Arbeitsplätze in der<br />
Immobilienbranche. Allein in den Jahren zwischen<br />
2001 und 2006 wurden 12% mehr Personen <strong>im</strong> Immobiliensektor<br />
beschäftigt als vorher. Das sind rund<br />
2400 Arbeitsplätze, welche neu geschaffen wurden.<br />
In der so genannten Immobilienwirtschaft sind über<br />
500’000 Personen in 17 Berufsgruppen beschäftigt<br />
Das sind 14% aller Beschäftigten in der Schweiz. Mit<br />
99 Mrd. Fr. beträgt nur schon dieser Teil der Urbanisierung<br />
18 % des Bruttoinlandprodukts. Auch <strong>im</strong> Gesundheits-<br />
und <strong>im</strong> Sozialwesen ist bezüglich der Arbeitsplätze<br />
markantes Wachstum festzustellen, dicht<br />
gefolgt von Beratungsstellen aller Art, vom Anwaltsbis<br />
zum Grafikerbüro. Weiter expansiv zeigt sich<br />
das Erziehungswesen und die schulischen Betriebe.<br />
Im anderen Extrem steht die Textilindustrie, welche<br />
ehemals als das „Rückgrat der Schweizer Wirtschaft“<br />
bezeichnet wurde. In keiner anderen Branche ist der<br />
wirtschaftliche Druck so gross; kurz nach der Jahrtausendwende<br />
gingen über 5300 Stellen verloren.<br />
Auch Verlage und Druckereien sind vom Schrumpfen<br />
des industriellen Sektors stark betroffen.<br />
10 11
Ästhetik des Widerstandes<br />
<strong>Die</strong> Stellung der ArbeiterInnen <strong>im</strong> Betrieb und<br />
<strong>im</strong> Büro hatte – respektive hat – auf ihr Klassenbewusstsein<br />
einen wesentlichen Einfluss. Das Produktionswissen,<br />
insbesondere dasjenige der FacharbeiterInnen,<br />
war die materielle Grundlage für die,<br />
<strong>im</strong> revolutionären Prozess erhobene Forderung der<br />
Übernahme der Produktionsmittel, die Selbstverwaltung<br />
und Enteignung der KapitalistInnen. Wenn<br />
Wissen und Ausführung zusammen kommen und<br />
daher überblickbar sind, und das waren die realen Erfahrungen<br />
des revolutionären Subjekts, dann entsteht<br />
auch Bewusstsein darüber, wie eine revolutionäre Alternative<br />
aussehen kann. Nämlich die in der Betriebsrealität<br />
angelegten Möglichkeiten einer Übernahme<br />
der Produktion und die Machtübernahme durch das<br />
Proletariat. Auch quantitativ war der Anteil der in der<br />
Industrie beschäftigten ArbeiterInnen am Proletariat<br />
gross. So gross, dass sie auch Träger einer eigenen<br />
ArbeiterInnenkultur und Lebensweise waren, die ihr<br />
Selbstbewusstsein als Klasse weiter festigte. <strong>Die</strong>ses<br />
revolutionäre Selbstverständnis der ArbeiterInnenklasse<br />
fand in der Räterepublik ihren politischen<br />
Ausdruck.<br />
Verändern sich die Formen der Mehrwertproduktion,<br />
verändert sich die Zusammensetzung der<br />
Klasse und ihr Selbstverständnis. <strong>Die</strong> Widerspruchserfahrung<br />
wird anders geprägt, Klassenbewusstsein<br />
dementsprechend strukturiert, die Fronten der Klassenkämpfe<br />
verbreitert. Denn das verschärfte System<br />
der Kapitalverwertung hat den Drang, in alle gesellschaftlichen<br />
Nischen einzudringen und alle individuellen<br />
wie kollektiven Äusserungsformen nach dem<br />
Bedürfnis der Kapitalakkumulation zu best<strong>im</strong>men.<br />
<strong>Die</strong> Tertiarisierung, also das stetige Wachsen des<br />
<strong>Die</strong>nstleistungssektors, hat vehementen Einfluss auf<br />
die demographische und soziale Struktur der <strong>Stadt</strong>.<br />
Weniger gut Betuchte oder jene, welche <strong>im</strong> industriellen<br />
Sektor arbeiten, können sich den Wohnort <strong>Stadt</strong><br />
kaum mehr leisten und werden an den <strong>Stadt</strong>rand oder<br />
in die Agglomeration gedrängt. <strong>Die</strong>s zeigt sich auch<br />
in den Pendlerströmen, welche auf einen markanten<br />
Anstieg der Reisenden vom Land in die <strong>Stadt</strong> verweisen.<br />
Es zeigt sich also, die <strong>Stadt</strong> als Wohnort ist rar<br />
geworden. Wo gearbeitet wird, wird nicht mehr gewohnt.<br />
Nur noch wenig erinnert an das fordistische<br />
Modell, in dem Wohn- und Arbeitsort identisch waren<br />
und sich ganze quartierähnliche Gemeinschaften<br />
bildeten, die demselben Unternehmen angeschlossen<br />
waren. Nicht, dass dies zu verherrlichen wäre, jedoch<br />
führt der neue Querschnitt der <strong>Stadt</strong>bewohnerInnen<br />
zur Frage, wo denn das revolutionäre Subjekt <strong>im</strong><br />
Sinne der ArbeiterInnenklasse zu finden ist, wenn<br />
es sich offenbar nicht mehr in gewissen städtischen<br />
Quartieren ballt.<br />
12 13
Ästhetik des Kampfes I<br />
3. Politische Rahmenbedingungen<br />
a) Standortpolitik<br />
b) Kommerzialisierung von Raum<br />
Weder die arbeitende noch die besitzende Klasse<br />
wählen den Ort ihres Seins und Arbeitens ganz freiwillig<br />
aus. <strong>Die</strong> Wahl von beispielsweise einem Investitions-<br />
und Produktionsstandort oder des Wohnorts<br />
ist abhängig von verschiedenen (Standort-) Faktoren.<br />
Um den geeigneten Standort für die Investition, die<br />
Produktion oder den Wohnort zu finden, wird eine<br />
Standortanalyse durchgeführt. Mit dieser Analyse<br />
werden die verschiedenen Standortfaktoren so gut es<br />
geht gemessen und bewertet, um anhand von Vorund<br />
Nachteilen einen best<strong>im</strong>mten Standort zu wählen.<br />
Gewisse Standortfaktoren wie Steuern, gesetzliche<br />
Reglementierungen, Rechtssicherheit, Zugang zu<br />
Kapital, Ressourcen und Arbeit, verkehrstechnische<br />
Anbindung etc. sind gut messbar, sie werden auch<br />
„harte“ Standortfaktoren genannt. Demgegenüber<br />
stehen Standortfaktoren, die schwieriger zu fassen<br />
sind – die „weichen“ Standortfaktoren - wie zum Beispiel<br />
die Kreativität der Anwohner oder das kulturelle<br />
und bildungstechnische Angebot.<br />
<strong>Die</strong> Standortpolitik ist die eigene Vermarktung<br />
und Positionierung eines Landes, einer Region oder<br />
einer <strong>Stadt</strong>. Sie beinhaltet eine Opt<strong>im</strong>ierung der<br />
Standortfaktoren, denn zwischen den vielen Standorten<br />
herrscht grosse Konkurrenz. Im Kapitalismus<br />
müssen sich sich Länder, Regionen und Städte als<br />
profitable Standorte positionieren, damit sie Unternehmen<br />
und gutverdienende BewohnerInnen anziehen<br />
und somit eine bessere Position <strong>im</strong> standortbedingten<br />
Konkurrenzkampf einnehmen. Als Beispiel<br />
dient hier ein Bedeutungsplan der <strong>Stadt</strong> Zürich aus<br />
dem Jahr 2006. <strong>Die</strong> städtischen RaumplanerInnen<br />
versuchen sich hier einer Hierarchisierung des<br />
<strong>Stadt</strong>raumes und einer Unterteilung in international/stadtweit/quartierweit/nachbarschaftlich<br />
wichtige<br />
Zonen. Dahinter steht die Idee, dass öffentlicher<br />
Raum als „Wettbewerbsfaktor“ deklariert und nutzbar<br />
gemacht wird, was demnach heisst, dass hierfür<br />
„störende“ Elemente auch vertrieben und verdrängt<br />
werden müssen. Wenn etwa die Zone rund um den<br />
See von gesellschaftlich Marginalisierten, Randständigen,<br />
Obdachlosen und AlkoholikerInnen geprägt<br />
ist, stört dies das Image und die touristische Verwertung<br />
der Zone. Durch solche Imagedeklarierungen<br />
steigen auch die Boden- und Immobilienpreise; der<br />
Verdrängungsprozess wird in Gang gesetzt.<br />
In diesem Teil wollen wir uns der Kommerzialisierung<br />
der <strong>Stadt</strong> bzw. der Kommerzialisierung des<br />
öffentlichen Raumes widmen. Wie so oft wird auch<br />
dieses Bestreben von Verdrängung dominiert. Im<br />
kapitalistischen System wird der Raum zur Ware.<br />
<strong>Die</strong>sen gilt es möglichst Gewinn bringend auszunutzen.<br />
Der Immobilienmarkt gilt als sicherer und<br />
renditebringender Markt für Kapitalanlagen. Gerade<br />
in Zeiten der Wirtschaftskrise flüchten die Kapitalisten<br />
in diesen sicheren Hafen. Ganze Quartiere<br />
werden mit diesem Prozess vereinnahmt, wie das<br />
Beispiel „Zürich West“ zeigt. Der öffentliche Raum,<br />
wo das soziale Leben der <strong>Stadt</strong>bevölkerung stattfindet,<br />
verschwindet vermehrt in riesigen Konsumtempeln.<br />
Gerade in Nord- und Südamerika sind einfach<br />
zu kontrollierende „Malls“, riesige Shoppingcenter,<br />
sehr verbreitet. Weil der Raum für soziales und kulturelles<br />
Leben in der <strong>Stadt</strong> fehlt, verlagert sich die<br />
Freizeitgestaltung vieler Jugendlicher in die „Malls“,<br />
doch der blosse Aufenthalt in den Prunkbauten generiert<br />
keinen Umsatz. In der kapitalistischen Verwertungslogik<br />
haben derartige Aktivitäten jedoch keinen<br />
Platz Am Beispiel Brasilien können wir beobachten<br />
wie die Reaktion ausfällt. Mit Repression und Ausgrenzung<br />
wurde auf sogenannte „rolezinhos“, wie<br />
die Treffen von Jugendlichen Gruppen in den Shoppingcentern<br />
genannt werden, geantwortet. <strong>Die</strong> Teilnehmer<br />
der „rolezinhos“ kommen aus den ärmeren<br />
Vororten und sind meist dunkelhäutig. Rassistische<br />
Sicherheitskräfte, bestehend aus Polizei und privaten<br />
Sicherheitsfirmen, schikanieren die Jugendlichen mit<br />
Gewalt, grundlosen Verhaftungen und Platzverweisen.<br />
<strong>Die</strong> „Rolezinho-Bewegung“ antwortete in Form<br />
von Massenprotesten mit bis zu 10‘000 Teilnehmern,<br />
vor und in den Kaufhäusern, was teilweise zur vorübergehenden<br />
Schliessung ebendieser führte. <strong>Die</strong>se<br />
Form von kontrolliertem Raum findet auch in Zürich<br />
Anwendung. <strong>Die</strong> „Sihlcity“ ist nach einem ähnlichen<br />
architektonischen Konzept gestaltet. Durch die helle<br />
und offene Gestaltung des Areals kann <strong>im</strong> Aussenbereich<br />
alles einfach kontrolliert und überwacht werden.<br />
<strong>Die</strong> grösste flächendeckende Kommerzialisierung<br />
stellen wir an Grossevents in der <strong>Stadt</strong> fest. Den Gipfel<br />
der Perversion bildete dabei wohl die Ausrichtung<br />
der Europameisterschaft 2008. <strong>Die</strong> Kommerzialisierung<br />
ging dabei weit über die Stadiontore hinaus. In<br />
14 15
entsprechenden Fanzonen wurde ein Teil der <strong>Stadt</strong><br />
vorübergehend privatisiert. In eingezäunten Bereichen<br />
kann also ein privater Veranstalter best<strong>im</strong>men,<br />
was erlaubt und verboten sein soll. Im Falle der<br />
EURO 08 wurden beispielsweise Kleidungsvorschriften<br />
oder ein Konsumationszwang eines best<strong>im</strong>mten<br />
Getränkeherstellers verhängt. Bevölkerungsteile, die<br />
diesen Vorstellungen nicht entsprechen, stören in<br />
diesem Bild. Pauschal wird man einer Rechenschaftspflicht<br />
unterstellt und verdrängt. Spontane kollektive<br />
Versammlungen rund um Sportanlässe werden verboten<br />
und verhindert, da der Sponsor dabei nichts<br />
verdient. Unter dem Deckmantel solcher Grossanlässe,<br />
wie der EM oder der Street Parade, werden seitens<br />
der Politik längerfristige stadtentwicklungstechnische<br />
Veränderungen <strong>im</strong> Bereich Überwachung und<br />
Repression vollzogen. So wurde die einst temporäre<br />
grossflächige Überwachung des Seebeckens um<br />
Bellevue und Bürkliplatz während der Street Parade<br />
und dem „Züri Fäscht“, zur festen Einrichtung umgebaut.<br />
Das <strong>Stadt</strong>bild ist mittlerweile geprägt von einer<br />
Flut an Werbung und Vermarktung für Konsumgüter.<br />
Ob auf der Strasse, in der Schule, <strong>im</strong> Tram, in<br />
Krankenhäusern, auf Mülle<strong>im</strong>er oder auf dem WC,<br />
wir werden jeden Tag mit diesen Botschaften bombardiert.<br />
Dabei überbieten sich die Werber ins Unermessliche.<br />
Noch grösser, noch moderner, noch mehr<br />
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist das erklärte Ziel<br />
der Werbeindustrie. <strong>Die</strong> Macht der Werbenden reicht<br />
in alle gesellschaftlich relevanten Bereiche. <strong>Die</strong> Medien<br />
sind, durch finanzielle Abhängigkeit, der Zensur<br />
und der Interessen der Wirtschaft unterworfen.<br />
<strong>Die</strong>se Omnipräsenz zieht für die <strong>Stadt</strong> weitreichende<br />
ästhetische und politische Konsequenzen nach sich.<br />
<strong>Die</strong> Kommerzialisierung des Raumes ist <strong>im</strong> alltäglichen<br />
Leben erfahrbar. Der Ausbau der Infrastruktur<br />
wird vor allem dort vorangetrieben, wo sich auch<br />
Kapital generieren lässt. Der öffentliche Verkehrsbetrieb<br />
in die Banlieues in Frankreich steht beispielsweise<br />
in keinem Verhältnis zur Notwendigkeit. <strong>Die</strong><br />
Probleme aus den Banlieues werden möglichst weit<br />
weg vom öffentlichen Leben ausgetragen. Sicherheit<br />
ist der wichtigste Standortfaktor einer kommerzialisierten<br />
<strong>Stadt</strong>. Kr<strong>im</strong>inalität und Armut schreckt kaufkräftiges,<br />
konsumfreudiges Klientel ab und vermindert<br />
somit die Verwertbarkeit des Raumes. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong><br />
verkauft sich an allen Ecken und Enden. Jeder Quadratmeter<br />
wird gewinnbringend nutzbar gemacht.<br />
Unkommerzielle, authentische Kultur hat in diesem<br />
<strong>Stadt</strong>bild keinen Platz. Mit Repression und Überwachung<br />
wird ein „sauberes“ Bild verkauft und das Feld<br />
für die Bonzen vorgeackert. Für uns gilt es, den öffentlichen<br />
Raum zu verteidigen, mit unserer Kultur<br />
und unseren Inhalten zu füllen. Denn, den Kampf<br />
um die Strasse gewinnen diejenigen, die sich auf der<br />
Strasse bewegen.<br />
c) <strong>Stadt</strong>entwicklung der <strong>Stadt</strong> Zürich<br />
Zur Veranschaulichung der massiven Umstrukturierungsmassnahmen<br />
<strong>im</strong> urbanen Raum werden<br />
nun einige Beispiele aus der <strong>Stadt</strong> Zürich- unter Berücksichtigung<br />
der Entwicklung der letzten 20 Jahre<br />
- genannt. Hierbei ist insbesondere interessant,<br />
in welcher Weise die von der städtischen Regierung<br />
vorgegebenen politischen Rahmenbedingungen den<br />
Interessen des Kapitals in die Hände spielen. <strong>Die</strong>s<br />
zeigt sich besonders gut in folgenden Gebieten oder<br />
Gegenden der <strong>Stadt</strong> Zürich: Seefeld, Zürich-West,<br />
Langstrasse, Weststrasse und - als jüngstes Projekt die<br />
Europa-Allee.<br />
Das Zürcher Seefeld gilt als Paradebeispiel für die<br />
Gentrifizierung eines Quartiers, sie wurde geprägt<br />
durch den Ausdruck„ Seefeldisierung“. Bereits in den<br />
1980er Jahren kaufte der Investor und Immobilienhai<br />
Urs Ledermann Haus für Haus <strong>im</strong> Seefeld auf –<br />
meist zu billigsten Konditionen, nur um sie Zug für<br />
Zug zu Luxuswohnungen umzubauen und die alten<br />
MieterInnen raus zu werfen. Sein Portfolio „besserte“<br />
Ledermann in der Zeit auf rund 50 Liegenschaften<br />
allein <strong>im</strong> Seefeldquartier auf; sein Immobilienkapital<br />
beträgt mehr als eine halbe Milliarde Schweizer Franken.<br />
Das Quartier wird bereits seit einigen Jahren von<br />
MieterInnen bewohnt, die sich eine 3.5 Z<strong>im</strong>merwohnung<br />
für 6250 Franken - wie etwa <strong>im</strong> Ledermann-<br />
Haus an der Mainaustrasse 34 – leisten können.<br />
Doch das Seefeld war bis in die 1980er Jahre nicht<br />
unbedingt ein Quartier mit hohem Investitionspotential<br />
für KapitalbesitzerInnen. Denn seit der Legalisierung<br />
der Prostitution in der Schweiz 1942 war<br />
<strong>im</strong> Seefeld ein grosser Strassenstrich. Erst Anfang der<br />
1980er Jahre verdrängte die Polizei die oftmals drogenabhängigen<br />
Prostituierten aus dem Seefeld – in<br />
die Kreise 4 und 5. <strong>Die</strong> „Standortattraktivität“ stieg<br />
durch die Vertreibung der unerwünschten Prostitution-<br />
zumindest der sichtbaren, so will es die bürgerliche<br />
Doppelmoral. Das Feld war offen für die<br />
Verdrängung der „A-Bevölkerung“ (Arme, ArbeiterInnen,<br />
Alte, AusländerInnen, Abhängige und „Andere“)<br />
und eine Neubewohnung durch Yuppies und<br />
Bonzen.<br />
In Zürich-West, dem klassischen Industriequartier<br />
seit Mitte/Ende des 19. <strong>Jahrhundert</strong>, vollzog sich<br />
eine riesige Umstrukturierung. <strong>Die</strong> alten Industrieareale<br />
von Steinfels, Maag und Sulzer-Escher-Wyss<br />
verschwanden bis in die 1990er aufgrund der Globalisierung.<br />
<strong>Die</strong> Produktionsstätten des Industriesektors<br />
wanderten ab in die Peripherie oder ins Ausland,<br />
wo die Arbeitskräfte günstiger sind. In die leeren<br />
Industriehallen zogen schliesslich Architekturbüros,<br />
Kulturschaffende und <strong>Die</strong>nstleistungsbetriebe.<br />
Auf Ersuchen der <strong>Stadt</strong> Zürich bzw. dedesm damaligen<br />
<strong>Stadt</strong>präsidenten Estermann, wurde 1996<br />
das <strong>Stadt</strong>forum eröffnet, eine Plattform mit hauptsächlich<br />
VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft,<br />
um Zürich-West „aufzuwerten“. In einem Bericht von<br />
August 1997 wird schliesslich moniert, dass es eine<br />
„ausgeprägte Konzentration an sozioökonomisch<br />
schwachen und schwächsten Bevölkerungsgruppen“<br />
<strong>im</strong> Quartier gibt und diese „soziale Destabilisierung<br />
[...] die Attraktivität auch für Arbeitsplätze [vermindert]“.<br />
Der Auftrag der städtischen Behörden war also<br />
klar: Zürich-West musste umgebaut werden- zu einem<br />
für den tertiären Sektor attraktiven Standort<br />
(Pr<strong>im</strong>e Tower, Swisscom Tower, u.a.) und luxuriösen<br />
Eigentumswohnungen als Investitionsmöglichkeit<br />
für das Kapital (Mob<strong>im</strong>o Tower u.a.) oder zu Mietwohnungen,<br />
wie etwa in den Escher-Terrassen auf<br />
dem Löwenbräu- Areal für Preise zwischen 4000 bis<br />
rund 13000.- monatlich.<br />
Das Quartier rund um die Langstrasse (Kreis 4<br />
und Teile des Kreises 5) war seit Ende des 19. <strong>Jahrhundert</strong>s<br />
ein Wohnviertel der ArbeiterInnen, aufgrund<br />
der Nähe zu den Industrien <strong>im</strong> Kreis 5 (z.B.<br />
Escher, Wyss & Cie). So wurden zahlreiche Siedlungen<br />
gebaut und ab den 1920er Jahren auch der genossenschaftliche<br />
Wohnungsbau stark gefördert. Ab den<br />
1950er und 60er Jahren wuchs das Quartier durch die<br />
Zunahme von migrantischen ArbeiterInnen aus Italien<br />
und Spanien.<br />
<strong>Die</strong> Nähe der Wohnviertel der ArbeiterInnen zu<br />
ihren Betrieben war für die Bourgeoisie eine Notwendigkeit:<br />
<strong>Die</strong> Mobilität der Menschen war noch<br />
nicht sehr hoch, öffentlicher Verkehr schlecht ausgebaut.<br />
Doch die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage<br />
stellt es keine Notwendigkeit mehr dar, dass<br />
die ArbeiterInnen zentral wohnen, <strong>im</strong> Gegenteil. <strong>Die</strong><br />
Zentren des urbanen Raumes sollen nicht mehr zur<br />
Verfügung stehen für Schlechtverdienende, da Immobilien<br />
und Boden wichtige Investitionsmöglichkeiten<br />
für das Kapital darstellen.<br />
In diesem Zusammenhang muss auch das Anfang<br />
der 2000er Jahre gestartete Projekt „Langstrasse Plus“<br />
gesehen werden. Unter der Führung der sozialdemokratischen<br />
Polizeivorsteherin Esther Maurer und des<br />
Gesamtprojektleiters Rolf Vieli wurde ein sogenanntes<br />
„4-Säulen-Modell“ mit folgenden vier Zielen formuliert:<br />
1. Mehr Sicherheit <strong>im</strong> öffentlichen Raum, 2.<br />
Besseres Leben <strong>im</strong> Quartier, 3. Förderung der Investitionsbereitschaft<br />
und 4. Gesamthafte Aufwertung des<br />
Gebietes. Was mit diesen vier euphemistischen Formulierungen<br />
genau gemeint war, zeigte sich in den<br />
letzten rund 10 Jahren: 1. Gewaltige Zunahme der<br />
Repression <strong>im</strong> Quartier (ständige Polizeikontrollen,<br />
insbesondere bei migrantischen Personen; enorme<br />
16 17
Ästhetik des Kampfes II<br />
Aufgebote bei Demonstrationen, um jeglichen Widerstand<br />
<strong>im</strong> Ke<strong>im</strong> zu ersticken versuchen [z.B. Militarisierung<br />
des Kreis 4 am 1. Mai]. 2. Verdrängung<br />
alter MieterInnen, Abreissen der Häuser, und Neubauten<br />
für Yuppies und Bonzen (z.B. Neufrankengasse).<br />
3. Immobilien <strong>im</strong> Langstrassenquartier sollen<br />
von Investoren gekauft werden (städtisch gefördert<br />
durch Langstrasse Plus – Projekt) um die Umstrukturierung<br />
des Quartiers voranzutreiben (abhängig<br />
von Punkt 1). 4. Verschiedenste Massnahmen, auch<br />
<strong>im</strong> Kleinsten: Abmontieren von Tischen in der Bäckeranlage,<br />
Abschrägung von möglichen Sitzgelegenheiten,<br />
Eindämmung von Freiräumen etc.<br />
Projekte wie „Langstrasse Plus“ sind also exemplarisch<br />
für die politischen Rahmenbedingungen, welche<br />
die <strong>Stadt</strong> Zürich plant und umsetzt.<br />
<strong>Die</strong> Zürcher Weststrasse war seit den 1960er Jahren<br />
ein Provisorium für den Durchgangsverkehr,<br />
obwohl sie eine zwar lange, aber relativ kleine Quartierstrasse<br />
ist. Rund 1000 Personenwagen und 100<br />
Lastwagen fuhren pro Stunde durch und erzeugten<br />
enormen Lärm und Abgase. <strong>Die</strong> Quartierbevölkerung<br />
bestand, aufgrund des schlechten Zustandes<br />
und den damit einhergehenden tiefen Mieten, mehrheitlich<br />
aus migrantische Familien. 2010 machte die<br />
<strong>Stadt</strong> Zürich die Strasse dicht für den Verkehr; doch<br />
Aufatmen in der emissionsverminderten Weststrasse<br />
war für die rund 1200 BewohnerInnen nicht angesagt.<br />
Denn die HauseigentümerInnen verschickten<br />
massenweise Kündigungen, um die Häuser zu luxuriösen<br />
Behausungen umbauen zu können und neue<br />
besserverdienende MieterInnen einziehen zu lassen.<br />
<strong>Die</strong> städtische Verwaltung – insbesondere das<br />
Amt für <strong>Stadt</strong>entwicklung – lud bereits 2006 die<br />
GrundeigentümerInnen zu einem Treffen ein, um die<br />
Umstrukturierung zu diskutieren. 2011 schliesslich,<br />
als sich auch Widerstand abzeichnete gegen die massive<br />
Kündigungswelle, verschickte jenes Amt einen<br />
Brief an die EigentümerInnen, mit der Bitte, „doch<br />
möglichst sozialverträgliche Kündigungen vorzunehmen“.<br />
<strong>Die</strong>s war nichts mehr als ein Lippenbekenntnis<br />
und zeigt klar auf, dass die städtische Regierung<br />
nicht etwa überrascht war von den „Folgen“ der<br />
Aufwertung. <strong>Die</strong> Entwicklung des Quartiers durch<br />
Verdrängung proletarischer, migrantischer Familien<br />
und einer Neubewohnung durch die Besserverdienenden<br />
war Kalkül: <strong>Die</strong> Verdrängung <strong>im</strong> städtischen<br />
„Aufwertungsprozess“ ist kein unschönes Nebenprodukt<br />
einer ansonst gutgemeinten oder wohlwollenden<br />
städteplanerischen Entwicklung, sondern deren<br />
Ziel.<br />
Als jüngstes Beispiel für die Umstrukturierung<br />
und <strong>Stadt</strong>entwicklung in Zürich gilt die Europa-<br />
Allee. Das Gebiet hinter dem Hauptbahnhof Zürich<br />
und in Angrenzung an die Kreise 4 und 5 soll die<br />
Verbindung werden zum luxuriösen Geschäftsviertel<br />
des Kreis 1 – quasi als Pfeil und Wegweiser ins<br />
„aufgewertete“ Langstrassenquartier. Der Umbau <strong>im</strong><br />
Gebiet der SBB wurde 2006 in einer städtischen Abst<strong>im</strong>mung<br />
als „<strong>Stadt</strong>raum HB“ beschlossen und sah<br />
rund 500 Wohnungen vor; nun werden davon 373<br />
gebaut (115 Eigentumswohnungen zu Preisen von<br />
1.5 bis 2.5. Millionen Franken, 72 Apartments einer<br />
Senioren-Residenz „für gehobene Ansprüche“ und<br />
186 Mietwohnungen mit 3.5 und 4.5-Z<strong>im</strong>mer-Wohnungen<br />
für 4900 bis 5900 Franken). Daneben gibt<br />
es hauptsächlich Büroflächen für Grossbanken und<br />
andere Betriebe – und als kulturelles „Gewissen“ ein<br />
Kino, betrieben vom Filmemacher und AL-Politiker<br />
Samir. <strong>Die</strong> Europa-Allee ist also auch ein Ausdruck<br />
dessen, was Andrej Holm die „Ökonomisierung der<br />
kulturellen und symbolischen Aufwertung des Viertels“<br />
nennt; „subkulturelle“ Vorreiterprojekte auf dem<br />
Areal des Europa-Allee-Komplexes – wie die Remise<br />
und das Max<strong>im</strong>-Theater in den Räumlichkeiten der<br />
SBB – sind allerdings nur eine Einbindung in den<br />
Aufwertungs- und Verdrängungsprozess; ob bewusst<br />
oder nicht.<br />
18 19
Ästhetik der Kontrollgesellschaft<br />
3. Klassenkampf von oben<br />
a) Disziplinierung von öffentlichem Raum<br />
Auf den ersten Blick nehmen wir Architektur<br />
als etwas rein ästhetisches und unpolitisches wahr.<br />
In der Konzipierung und Gestaltung des Raumes<br />
werden jedoch <strong>im</strong>mer auch Entscheidungen getroffen,<br />
die von wirtschaftlichen oder auch repressiven<br />
Faktoren abhängig sind. Im Zuge der Aufwertung<br />
werden die Interessen der herrschenden Klasse also<br />
vermehrt auch in der Architektur sichtbar. <strong>Die</strong> Gestaltung<br />
und Planung des öffentlichen Raumes kann<br />
einerseits zwar Möglichkeiten schaffen, andererseits<br />
auch Grenzen setzen. Oftmals verbergen sich hinter<br />
Neugestaltungen <strong>im</strong> öffentlichen Raum, die wir<br />
vorerst als positiv wahrnehmen, Effekte der Disziplinierung.<br />
Ein anschauliches Beispiel dafür ist der<br />
Zürcher L<strong>im</strong>matplatz. Im Zuge der Neugestaltung<br />
wurde ein Dach über die Traminsel gebaut, welches<br />
vor Niederschlägen schützen soll. Im selben Atemzug<br />
wurden moderne Kameras installiert, die nun<br />
jeden Winkel überwachen sollen. Zusätzlich wirken<br />
die neuen grellen Lichtsäulen ausleuchtend und steril<br />
auf den Platz.<br />
Architektur kann die zukünftigen Möglichkeiten<br />
eines Raumes best<strong>im</strong>men. Wo keine einladenden<br />
Sitzgelegenheiten vorhanden sind, kann nur schwer<br />
ein Treffpunkt zum Verweilen entstehen. Auf einigen<br />
Stromkästen an der Langstrasse wurden kleine<br />
Schrägen installiert um zu verhindern, dass diese<br />
als Abstellfläche für Bierdosen oder Esswaren genutzt<br />
werden. An diesem Beispiel wird verdeutlicht,<br />
wie best<strong>im</strong>mte Personengruppen verdrängt werden<br />
sollen. Mit dieser Massnahme oder z.B. auch dem<br />
Entfernen von Bänken auf der Bäckeranlage soll das<br />
„trendige“ Langstrassenquartier, in dem sich nun<br />
vermehrt auch zahlungskräftige Leute bewegen, von<br />
randständigen und zahlungsschwachen Menschen<br />
gesäubert werden.<br />
<strong>Die</strong> einzige Berechtigung, sich an einem Ort aufzuhalten,<br />
bleibt in vielen Fällen der Konsum in Restaurants<br />
oder Boutiquen. <strong>Die</strong> Architektur rund um<br />
die Gentrifizierung hat zum Zweck, möglichst direkte<br />
Konsummöglichkeiten für die neuen zahlungsstarken<br />
BewohnerInnen eines Quartiers zu gewährleisten.<br />
Das kollektive Leben <strong>im</strong> Quartier, sich zu treffen<br />
und ungezwungen auf öffentlichen Plätzen zu verweilen,<br />
wird <strong>im</strong>mer mehr verunmöglicht.<br />
Nebst der Fokussierung der modernen Raumplanung<br />
auf das Konsumverhalten, spielen auch Faktoren<br />
der Repression eine Rolle. <strong>Die</strong> Gestaltung von<br />
öffentlichem Raum und Parkanlagen kann so konzipiert<br />
werden, dass Versammlungen nicht möglich<br />
sind oder allfällige Aufstände leichter von der Polizei<br />
unterbunden werden können. Um eine möglichst<br />
starke Kontrolle über die Menschen durch den Staat<br />
zu ermöglichen, müssen öffentliche Plätze übersichtlich<br />
und ohne Verstecke und Nischen gestaltet werden.<br />
Was als Schutz für die Bewohner des aufgewerteten<br />
Quartiers verkauft wird, soll in erster Linie zum<br />
Schutz der bürgerlichen Ordnung und der kapitalistischen<br />
Produktion dienen.<br />
b) Sicherheitswahn<br />
Mit der Aufwertung der Quartiere, der Beruhigung<br />
von Strassen und der meist darauffolgenden Renovation<br />
von ganzen Strassenzügen, werden die Mieten<br />
kontinuierlich höher. <strong>Die</strong> Folge davon ist, dass<br />
sich die „normalen Büezerfamilien“ die Wohnungen<br />
nicht mehr leisten können und dann wegziehen müssen.<br />
<strong>Die</strong> neuen, wohl verdienenden Zuzüger haben<br />
andere Bedürfnisse und auch andere Ansprüche an<br />
Sicherheit. So entstehen beispielsweise neue Wohnhäuser,<br />
an deren Fassaden mehrere Kameras angebracht<br />
sind und neue, breite und übersichtliche, gut<br />
ausgeleuchtete Strassen ohne Ecken und Nischen.<br />
Dadurch, dass die Menschen <strong>im</strong> öffentlichen<br />
Raum durch ebendiese Massnahmen <strong>im</strong>mer mehr<br />
dazu gezwungen werden, sich weg von den Strassen<br />
und Plätzen zu bewegen, kommt es oft zu einer «Ausweitung»<br />
des öffentlichen Raumes: Anlagen wie das<br />
Sihlcity oder das Glattzentrum können den Bahnhof<br />
und den Park ersetzen. <strong>Die</strong>se Anlagen sind privat<br />
und die beauftragten Securityfirmen haben dadurch<br />
erstaunlich grosse Möglichkeiten zur Überwachung.<br />
<strong>Die</strong> Jugendlichen, die ihre Freizeit in diesen konsumorientierten<br />
Oasen verbringen, sind noch grösserer<br />
Überwachung ausgesetzt als draussen <strong>im</strong> „wirklich“<br />
öffentlichen Raum.<br />
Oft kann man gerade an diesen Orten auf Schildern<br />
lesen: „Zu Ihrer Sicherheit wird dieser Bereich<br />
videoüberwacht“. Der eigentliche Zweck der Kameras<br />
ist aber nicht die Sicherheit der Personen, die sich<br />
dort bewegen, sondern schlicht die Überwachung;<br />
um <strong>Die</strong>bstähle vorzubeugen oder diese aufzuklären.<br />
20 21
Wer nicht Laden- oder Einkaufszentrumsbesitzer ist,<br />
zieht also keinen Nutzen aus den Kameras in diesen<br />
halböffentlichen Räumen. Es muss also einen Grund<br />
dafür geben, dass sich die „normalen Leute“ nicht<br />
dagegen wehren, wenn sie von irgendwelchen privaten<br />
Sicherheitsfirmen regelrecht verfolgt werden.<br />
Meistens hört man Aussagen wie „man gewöhnt sich<br />
daran» und «wer nichts zu verstecken hat, der hat<br />
auch nichts zu befürchten“. Obwohl Ersteres zwar <strong>im</strong><br />
ersten Augenblick erstaunlich sein mag, so erkennt<br />
man, dass sie relativ unspektakulär ein vermeintlich<br />
natürliches Phänomen beschreibt. Überrascht ist<br />
man nur, wenn Erscheinungen wie Überwachung<br />
lange fern waren und wieder als etwas altbekannt<br />
Neues auftreten. <strong>Die</strong> zweite Aussage hingegen beinhaltet<br />
die Ideologie der herrschenden Klasse. Ganz<br />
allgemein bedeutet Überwachung auch Macht und<br />
die Sicherung von Macht und wenn mulmige Gefühle<br />
bei solchen, die sich nicht zu den Staatsfeinden<br />
zählen, auftreten, dann ist das ein Ausdruck von<br />
Zweifeln, ob die Überwachungsstrukturen in unserer<br />
Gesellschaft tolerierbar sind. <strong>Die</strong> Überwachung ist<br />
ein Teil des Repressionsapparates. Wenn man aber<br />
die Repression analysiert und die Gründe, wofür die<br />
massive Überwachung <strong>im</strong> urbanen Raum eingesetzt<br />
wird, dann ist auch der politische Charakter leicht ersichtlich.<br />
Als Beispiele sollen hier die Zivilbullen, der<br />
Filmdienst und das krankhaft irrsinnige Abfotografieren<br />
am ersten Mai genannt werden.<br />
c) Verdrängung<br />
Wenn Häuser saniert und Plätze umgestaltet, Verkehrsführungen<br />
verändert und sowieso alles etwas<br />
aufgeräumt und optisch erneuert wird, dann stehen<br />
wir mitten in einem aufgewerteten Quartier. Das<br />
sieht bis jetzt alles schön und gut aus, der Lebensstandard<br />
scheint zu steigen, doch einen Haken hat<br />
das Ganze: Menschen werden dabei benachteiligt.<br />
Während all diese Veränderungen durchgesetzt werden,<br />
verändert sich die Zusammensetzung der QuartierbewohnerInnen.<br />
<strong>Die</strong> Quartiere, die aufgewertet<br />
werden, sind multikulturelle ArbeiterInnenquartiere.<br />
<strong>Die</strong> Menschen, die das Quartier geprägt haben, werden<br />
verdrängt. Das sind oftmals Familien mit migrantischem<br />
und proletarischem Hintergrund.<br />
<strong>Die</strong> Verdrängung hat zwei unterschiedliche Faktoren;<br />
einen ökonomischen Faktor und einen, der<br />
sozusagen eine Folge davon ist, der sozialräumliche<br />
Faktor. Der ökonomische Faktor beinhaltet die steigenden<br />
Immobilienpreise und Mieten, die vorherige<br />
BewohnerInnen zum Umzug in andere Quartiere<br />
zwingt. Natürlich ändert sich dabei auch das Gewerbe,<br />
die das Quartier mitprägen. Kleine funktionelle<br />
Läden, die halt das anbieten was man so braucht <strong>im</strong><br />
Alltag, werden ausgetauscht durch Boutiquen oder<br />
Ladenketten. Eben Läden, die das anbieten, was sich<br />
nicht jeder leisten kann. Kneipen werden ausgetauscht<br />
durch teure Restaurants, Lounge-Bars und<br />
kommerzielle Kulturstätten. Zusammenfassend geht<br />
es darum, dass sich gewisse Menschen nicht mehr<br />
leisten können, an diesem Ort zu wohnen und so verdrängt<br />
werden.<br />
<strong>Die</strong> Verdrängung durch den sozialräumlichen<br />
Faktor ist viel weniger fassbar und offensichtlich,<br />
aber trotzdem auch <strong>im</strong>mer präsent. Damit ist die Art<br />
von Verdrängung gemeint, welche die ökonomische<br />
Verdrängung mit sich zieht, denn der sozialräumliche<br />
Faktor ist tief verstrickt mit dem ökonomischen.<br />
Neben den privaten Räumen, sprich den Wohnungen<br />
und Häusern, wird der öffentliche Raum ebenfalls<br />
zum Tatort der Verdrängung. <strong>Die</strong> Menschen, die den<br />
öffentlichen Raum nutzen und prägen, werden durch<br />
verschiedene Mittel verdrängt. Das kommt davon,<br />
dass sich durch die Aufwertung in einem Quartier<br />
logischerweise die Zusammensetzung der Bevölkerung<br />
verändert. Wo früher vor allem Arbeitende oder<br />
Erwerbslose gelebt haben, kommen <strong>im</strong>mer mehr<br />
selbstständige oder Arbeitgebende dazu, die ersteren<br />
werden dabei verdrängt. Durch die neuen BewohnerInnen<br />
verändern sich auch die Ansprüche, die diese<br />
stellen. Durch die höheren Mieten werden umfassendere<br />
Qualitäten beansprucht, die den Lebensstandard<br />
steigern sollen. Das Quartier soll ruhiger werden,<br />
Autos sollen nicht mehr rund um die Uhr am Fenster<br />
vorbei rasen, wie früher an der Weststrasse in Zürich,<br />
und die Jugendlichen <strong>im</strong> Park lösen Unbehagen aus.<br />
An diesem Punkt kommt dann auch der Staat oder<br />
eben die <strong>Stadt</strong> wieder ins Spiel. Öffentlicher Raum ist<br />
umkämpfter Raum. <strong>Die</strong> Aufwertung von <strong>Stadt</strong>teilen<br />
verschafft neue Zugänge für zahlungskräftige Kunden<br />
und kapitalstarke Firmen. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> vertritt also ihre<br />
eigenen Interessen <strong>im</strong> kapitalistischen Wettbewerb.<br />
Dafür muss sie auf Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit<br />
achten. Das offensichtlichste Mittel der (sozial)<br />
räumlichen Verdrängung ist die Repression, die meist<br />
durch die Polizei ausgeübt wird. Doch weitere Mittel<br />
stehen zur Verfügung, zum Beispiel bautechnische<br />
Massnahmen und Überwachung. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> kommt<br />
also durchaus nicht erst als Folge der Erwartungen der<br />
neuen BewohnerInnen ins Spiel. Wenn ein Quartier<br />
aufgewertet wird, kann die <strong>Stadt</strong> so einen Standortvorteil<br />
gewinnen, was sie sich natürlich auf keinen Fall<br />
entgehen lassen kann. Durch die Aufwertung werden<br />
dann auch nationale und internationale Konzerne auf<br />
die opt<strong>im</strong>ierte Lage angesprochen und setzen sich<br />
dann vielleicht dort ab, was der <strong>Stadt</strong> dann Steuer- und<br />
Image-Vorteile verspricht. Zusammenfassend kann<br />
man also sagen, dass ein Teil der Aufwertungsstrategie<br />
die Verdrängung ist. <strong>Die</strong> Leidtragenden dieser<br />
Entwicklung sind die BewohnerInnen der noch nicht<br />
aufgewerteten Quartiere. <strong>Die</strong> Akteure sind zum einen<br />
die, die <strong>im</strong> Immobilienmarkt mitspielen und zum anderen<br />
der Staat oder die <strong>Stadt</strong>, die wiederum ihre Mittel<br />
haben, wie Polizei, die SIP, aber auch Architekten,<br />
die staatliche Bauvorhaben wunschgerecht ausführen.<br />
Da das Aufeinanderprallen verschiedener Interessen<br />
(zwischen Kapital und Proletariat) in urbanen Räumen<br />
zur Verschärfung der Widersprüche führt, ist der<br />
Ausbau der Sicherheit und die Kontrolle der Räume<br />
für die Herrschenden notwendig. <strong>Die</strong> Verschärfung<br />
der Widersprüche führt logischerweise leichter zu sozialer<br />
Unruhe und Widerstand.<br />
Auf die repressiven Mittel, welche die <strong>Stadt</strong> für<br />
die Verdrängung zur Verfügung hat, soll an dieser<br />
Stelle noch weiter eingegangen werden, da dies ein<br />
unmittelbarer Akt ist, den man <strong>im</strong> Alltag zu spüren<br />
bekommt. Das nächstliegendste Mittel ist die Polizei.<br />
Mit ihr kann die <strong>Stadt</strong> ihre Anliegen <strong>im</strong> Interesse<br />
des Kapitals durchsetzen. <strong>Die</strong> Polizei übern<strong>im</strong>mt<br />
die direkte Machtausübung in Vertretung der Interessen<br />
des Staates und des Kapitals. Während der<br />
Aufwertung eines Gebietes wird meistens generell<br />
von einem konstruierten „(Un-)Sicherheitsdiskurs“<br />
ausgegangen. Somit wird der Bevölkerung versucht<br />
weiszumachen, dass die Kontrolle lediglich zur Bekämpfung<br />
der Kr<strong>im</strong>inalität gebraucht wird. Tatsächlich<br />
ist <strong>Stadt</strong>raum jedoch exklusiver Raum, worin die<br />
saubere Repräsentation kommerzialisierter Angebote<br />
und kapitalstarker Firmen innerhalb der kapitalistischen<br />
Logik Vorrang hat. Ein verbreitetes repressives<br />
Mittel <strong>im</strong> öffentlichen Raum ist die Wegweisungspraxis.<br />
<strong>Die</strong>s ist ein Disziplinierungs- und Ausschlussverfahren,<br />
welches störende Personen für eine gewisse<br />
Zeitdauer von Plätzen/Orten entfernen kann.<br />
Zur Veranschaulichung der repressiven Mittel hier<br />
einige Beispiele aus der <strong>Stadt</strong> Zürich: <strong>Die</strong> Präsenz der<br />
<strong>Stadt</strong>polizei Zürich in den Kreisen 4 und 5 ist in den<br />
letzten Jahren stetig gestiegen. <strong>Die</strong> unnötigen, ständigen<br />
Kontrollen von Junkies, aufmüpfig aussehenden<br />
Jugendlichen und MigrantInnen sind normaler<br />
Alltag. Mit diesen Kontrollen wird versucht, für die<br />
Aufwertung ungewünschte Personen zu schikanieren<br />
und zu vertreiben. Das Bild der Quartiere soll sich<br />
verändern, damit es den finanziell bessergestellten<br />
Leuten gerecht wird. <strong>Die</strong> Kreise 4 und 5, die bis heute<br />
neben proletarischem Wohnquartier auch noch Rot-<br />
Licht-Milieu und Wohnstätte für viele MigrantInnen<br />
sind, sollen jetzt sicherer und aufgeräumter werden.<br />
Um dies umzusetzen patrouilliert die Polizei <strong>im</strong> 1-2<br />
Minuten Takt und führt würdeverletzende Kontrollen<br />
durch. Schon klar, überlegt man sich als Betroffene<br />
zwei Mal, ob man jetzt wirklich die Langstrasse<br />
hinauf oder hinunter spazieren will. Ebenfalls ersichtlich<br />
ist die Zunahme der verteilten Rayonverbote<br />
(Wegweisungen). Personen können somit schnell<br />
von Plätzen und Gebieten verwiesen werden und erhalten<br />
bei Nichtbeachtung eine Busse. <strong>Die</strong> Wegweisungspraxis<br />
wird oft mit der „Bekämpfung der Drogen-Szene“<br />
gerechtfertigt. Jedoch ist die polizeiliche<br />
Handhabung sehr willkürlich. Weitere Einsatzgebiete<br />
der Wegweisungspraxis sind Demos, Fussballevents<br />
22 23
Interview zu Verdrängung<br />
und pöbelnde Jugendliche. Hier stellt sich somit die<br />
Machtfrage und auch hier müssen die herrschenden<br />
Verhältnisse „geschützt“ werden. Auch bei politischen<br />
Aktionen gegen die Aufwertung von Quartieren<br />
und Vertreibung der proletarischen Bevölkerung<br />
wird nicht z<strong>im</strong>perlich vorgegangen. <strong>Die</strong>s wundert<br />
jedoch nicht, da die Bullen doch genau Funktionsträger<br />
der <strong>Stadt</strong> und des Kapitals sind und Widerstand<br />
unterdrücken sollen.<br />
Ein weiteres Mittel des Repressionsapparates ist<br />
die SIP, welche ein Beispiel für Vertreibung von Menschen<br />
auf eine „sozialere“ Art darstellt. <strong>Die</strong> SIP stellt<br />
ein Organ dar, das vor allem Jugendliche zu spüren<br />
bekommen. <strong>Die</strong> SIP Zürich (Sicherheit, Intervention,<br />
Prävention) versteht sich als sozialdienstliche Stelle<br />
mit ordnungspolitischen Aufgaben. <strong>Die</strong> SIP agiert<br />
in verschiedenen Städten, unter anderem in Luzern,<br />
St. Gallen und Zürich. In Bern gibt es einen ähnlichen<br />
<strong>Die</strong>nst namens PINTO. <strong>Die</strong> Funktion dieser<br />
Ordnungsdienste ist in diesen Städten, trotz eigener<br />
Besonderheiten, etwa dieselbe. Der Fokus liegt dabei<br />
laut SIP Zürich auf dem Wohl der Gesamtbevölkerung.<br />
Ihr Ziel ist die Attraktivität und Sicherheit der<br />
<strong>Stadt</strong> und der öffentlichen Plätze, mit besonderem<br />
Augenmerk auf mögliche Konflikte mit Jugendgruppen<br />
und „Randständigen“ <strong>im</strong> öffentlichen Raum. In<br />
kritischen Situationen arbeitet die SIP mit der <strong>Stadt</strong>polizei<br />
zusammen. D.h. mit anderen Worten: die SIP<br />
patrouilliert in Quartieren mit sogenannten „sozialen<br />
Brennpunkten“ und geht dabei gegen jegliche Gruppen<br />
vor, welche das „schöne“ <strong>Stadt</strong>bild stören könnten.<br />
Sie verscheucht beispielsweise Alkoholabhängige<br />
von öffentlichen Plätzen, damit sich Personen, die<br />
in den aufzuwertenden Quartieren gewünscht sind,<br />
wohler fühlen. <strong>Die</strong> Farce an dem Ganzen ist, dass die<br />
SIP sich dabei als Helferin ausgibt. Wenn man sich ihr<br />
Konzept jedoch genauer ansieht, merkt man schnell,<br />
dass die Aufgaben deutlich in die oben erwähnte<br />
Richtung gehen. So steht darin geschrieben, dass „die<br />
betroffene Person selber entscheiden kann: -ob sie<br />
sich der Repression aussetzten will oder sich entfernt,<br />
-ob sie ihr Verhalten anpasst oder -ob sie sich kooperativ<br />
verhält und sich konstruktiv beteiligt.“ Dass mit<br />
Repression der Einsatz der Bullen und deren Mittel<br />
gemeint ist, liegt auf der Hand. <strong>Die</strong> SIP positioniert<br />
sich klar auf der Seite des Staates, mit dem Auftrag<br />
zur Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit und<br />
verzichtet dabei sogar gänzlich auf klientenorientierte<br />
Elemente einer eigentlichen Sozialen Arbeit. Es<br />
geht nur darum „störende Personen oder Gruppen“<br />
zu verdrängen. <strong>Die</strong> SIP ist in ihrer Rolle also ähnlich<br />
wie die polizeiliche Verdrängung zu verstehen, nur<br />
dass sie sich mit dem Wort „sozial“ schmückt. Sie<br />
versucht die Aufwertung mit kommunikationstechnischen<br />
Methoden durchzusetzen, während die Polizei<br />
Rayonverbote verteilt. „<strong>Die</strong> SIP-Mitarbeitenden<br />
weisen die betreffenden Personen darauf hin, welches<br />
Verhalten die <strong>Stadt</strong> Zürich von ihnen erwartet.“<br />
Zudem erhält die SIP Zürich vermehrt Aufträge auf<br />
Kosten von privaten Sicherheitsfirmen. Als Beispiele<br />
sind hier der neue Strichplatz in Altstetten und das<br />
neue Asylzentrum Juchhof zu nennen.<br />
Ein weiteres sehr umstrittenes Mittel der Verdrängung<br />
<strong>im</strong> sozialräumlichen Kontext sind Überwachungskameras.<br />
Sie dienen einerseits der Überwachung,<br />
sie können also zur Aufklärung von Delikten<br />
führen, doch sie dienen auch der Abschreckung,<br />
damit haben sie einen präventiven Charakter. Schön<br />
zu sehen ist dies auf all den Pausenplätzen, die neuerdings<br />
überwacht werden. Anders als bei Flughäfen<br />
geht es auf Schularealen sicherlich nicht um die<br />
Klärung verübter Delikte, da diese ja an den Schulen<br />
nicht an der Tagesordnung sind. Hier werden die<br />
Kinder präventiv vom Rumhängen und „Scheiss- Machen“<br />
abgehalten. Sie sollen gar nicht erst auf die Idee<br />
kommen, dass man draussen ungestört irgendwo auf<br />
einer Treppe sitzen kann und machen kann wozu<br />
man gerade Lust hat. Gleich sieht es <strong>im</strong> sonstigen öffentlichen<br />
Raum aus. Wo Kameras installiert werden,<br />
kann man sich sicher sein, dass man sich nicht am<br />
Anblick herumhängender Jugendlichen stören muss.<br />
d) Annäherung an die Videoüberwachung<br />
in der Schweiz<br />
<strong>Die</strong> Überwachung des öffentlichen Raumes, insbesondere<br />
in den <strong>im</strong>perialistischen Metropolen,<br />
mittels Video Kameras (kurz CCTV = Closed Circuit<br />
Television) reicht bis in die 1970er und 1980er<br />
Jahre zurück. Damals war diese Form von sozialer<br />
Kontrolle allerdings weitgehend noch inakzeptiert.<br />
<strong>Die</strong> bürgerliche „Freiheit“ hatte noch einen gewissen<br />
gesellschaftlichen Stellenwert. <strong>Die</strong>s hat sich seit<br />
der Verschiebung von einer Disziplinargesellschaft<br />
hin zur Kontrollgesellschaft radikal geändert. In der<br />
Disziplinargesellschaft wurden die Individuen in<br />
der Schule, der Kaserne, der Familie, <strong>im</strong> Gefängnis<br />
und in der Psychiatrie systemkonform geformt. Der<br />
24<br />
<strong>Stadt</strong>aufwertung in Zürich heisst auch Vertreibung der Sexarbeiterinnen. Wir sprachen mit Marisol, die seit 2000<br />
<strong>im</strong> Kreis 4 lebt und arbeitet, über heuchlerische Schutzbehauptungen der Polizei und die Ohnmacht der Sexarbeiterinnen.<br />
Du wohnst seit bald 15 Jahren in diesem Quartier,<br />
dass lange für die Toleranz gegenüber der Prostitution<br />
bekannt war. Wenn du die Situation von heute<br />
mit damals vergleichst, was hat sich geändert?<br />
Marisol: Schau, der Kreis 4 ist heute tot. Oder zumindest<br />
auf dem Weg ins Grab. Früher war das hier ein<br />
le- bendiges Quartier, die Frauen konnten arbeiten,<br />
auf der Strasse und in den Bars. Sie hatten Arbeitsund<br />
Le- bensräume <strong>im</strong> Quartier. Heute ist davon wenig<br />
übrig. Wenn man jetzt durch den Kreis läuft, dann<br />
hat es kaum mehr Leute, die man kennt. Früher war<br />
das anders, es gab Tage, da kamen <strong>im</strong>mer wieder die<br />
selben Freier in das Quartier, sie liefen rum, gingen in<br />
die Bars. Dort konnten die Chicas mit ihnen Kontakt<br />
aufnehmen und danach in der Nähe in ein Z<strong>im</strong>mer.<br />
Das ist heute nicht mehr möglich, alles ist schwieriger.<br />
Wenn man die Aufwertung <strong>im</strong> Quartier anschaut,<br />
dann muss man sich doch eh fragen, ob<br />
die Prostitution auch ohne Repression aus diesem<br />
Quartier gedrängt worden wäre. Zahlbar sind die<br />
Räume zu arbeiten schon lange nicht mehr.<br />
Sicher. So Sachen wie die Europaallee, da ist es klar,<br />
was die <strong>Stadt</strong> in diesem Kreis will. Wir haben dadrin<br />
schlicht keinen Platz mehr, die Polizei verstärkt die<br />
Vertreibung aber natürlich. Aber man muss auch sehen,<br />
dass dieses Quartier bald nicht mehr attraktiv<br />
ist. Wer braucht schon eine Europaallee, wer ist dort?<br />
Niemand, der/die hier lebt. Letzthin hab ich <strong>im</strong> Zug<br />
gehört, wie zwei mit einander sprachen und sagten<br />
«Ja, heute war echt nichts los an der Langstrasse. Das<br />
ist langweilig.» Ich sag dir, die machen das Quartier<br />
kaputt, auch wenn dann noch so viele Millionarios<br />
hier wohnen. Das einzige, was noch funktioniert, sind<br />
die Klubs.<br />
Warum ist das so?<br />
Es gibt zwei Sachen: Erstens haben die Leute Angst.<br />
Wegen der Repression, die seit 2010 zun<strong>im</strong>mt, getrauen<br />
sich die Leute nicht mehr ins Quartier. Heute müssen<br />
sie <strong>im</strong>mer Angst haben, dass sie gebüsst werden,<br />
wenn sie schon nur mit uns reden. Viele Kunden rufen<br />
an und sagen «Ich kann nicht mehr zu dir kommen,<br />
ich getrau mich nicht.» Niemand will gebüsst werden,<br />
weil er gegen das Prostitutionsgesetz verstösst und<br />
dann ein Brief zuhause reinflattert. Zweitens wird uns<br />
der Raum genommen, zum Leben und zum Arbeiten.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> kauft Häuser auf und ver- weigert die Bewilligung<br />
für Bordelle <strong>im</strong> Kreis 4. Wo sollen wir hin? Es<br />
gibt darauf keine Antwort. Sie wollen uns am Strichplatz<br />
in Altstetten. Dort draussen, in der Kälte, in<br />
einem Auto? Das sind unwürdige Arbeitsbe- dingungen,<br />
das ist kr<strong>im</strong>inell. Dort geh ich niemals arbeiten.
Staatsapparat des Kapitals zwang die Menschen sich<br />
der Logik der Verwertung anzupassen. Ziel waren<br />
„normierte“ Subjekte, die widerstandslos die Widersprüche<br />
des Kapitalismus hinnehmen. Doch diese<br />
Allmachtsphantasien der Herrschenden wurden spätestens<br />
durch die revolutionären Klassenkämpfe nach<br />
1968 zerschlagen. <strong>Die</strong> Krise verschärfte die gesellschaftlichen<br />
Widersprüche laufend, Repression und<br />
Disziplinierung wurden <strong>im</strong>mer weiter nach „vorne“,<br />
in Richtung präventive Kontrolle verschoben. Das gesamte<br />
Leben von für das System potentiell „gefährlichen“<br />
Individuen sollte mit einem umfassenden Netz<br />
der Überwachung überzogen werden. „Potentiell<br />
gefährliche Individuen“ heisst konkret: Das gesamte<br />
Proletariat. Bürgerliche Politiker sprachen unverblümt<br />
Klartext, es gäbe kein Recht unerkannt durch<br />
die <strong>Stadt</strong> zu gehen.<br />
<strong>Die</strong> neuen digitalen Technologien erleichterten<br />
den Repressionsapparaten ihre Aufgaben sowohl<br />
qualitativ als auch quantitativ. Eine Vorreiterrolle bei<br />
der Videoüberwachung nahm und n<strong>im</strong>mt Grossbritannien<br />
ein. Zur „positiven“ Veränderung der Wahrnehmung<br />
von Überwachungsmassnahmen <strong>im</strong> öffentlichen<br />
Raum diente den Massenmedien die Hetze<br />
gegen die sogenannten „Hooligans“ in den 1980er<br />
Jahren. Es waren aber Klassenkämpfe und Revolten<br />
wie in Brixton <strong>im</strong> Jahre 1981, der grosse Minenarbeiterstreik<br />
(1984) und der bewaffnete Kampf der IRA<br />
auf englischem Territorium, die zu einer massiven<br />
Überwachung des öffentlichen Raumes führten. Der<br />
Einsatz der flächendeckenden Video Observation<br />
wurde als Schutz vor rebellierenden ArbeiterInnen<br />
und „gefährlichen“ Personen legit<strong>im</strong>iert. Während<br />
„spektakuläre“ Einzelfälle, wie zum Beispiel Kindesentführungen,<br />
bzw. die Identifizierung der Täter,<br />
argumentativ ins Feld geführt wurden, um die Akzeptanz<br />
der Kontrolle des städtischen Raumes in der<br />
Bevölkerung voran zu treiben, sind die Ursachen des<br />
CCTV Einsatzes gesellschaftlich bedingt. <strong>Die</strong> Verschärfung<br />
der ökonomischen und politischen Krise,<br />
tatsächliche und potentielle Klassenkämpfe und die<br />
Bekämpfung der „Unordnung“ in den aufgewerteten<br />
Städten macht die omnipräsente visuelle Überwachung<br />
des öffentlichen Raumes zur notwendigen Voraussetzung<br />
für den kapitalistischen Machtapparat.<br />
Technische Aspekte<br />
Unter Video-, oder CCTV Überwachung versteht<br />
der Staatsapparat die Beobachtung von „Zuständen<br />
oder Vorgängen durch optisch-elektronische Anlagen<br />
(Kameras)“. Bei der aktiven oder direkten Überwachung<br />
können die gewonnenen Daten in Echtzeit<br />
unmittelbar auf einem Bildschirm verfolgt werden.<br />
Angesichts der anfallenden Datenmengen, besonders<br />
be<strong>im</strong> Einsatz mehrerer Kameras, werden Daten<br />
jedoch häufig aufgezeichnet, also sogenannte passive<br />
oder indirekte Überwachung. <strong>Die</strong> Aufzeichnung erfolgt<br />
auf analoge (Videoband, Film) oder vor allem<br />
digitale Dateiträger (Chip, Harddisk etc.). Einfache<br />
Videoüberwachungsanlagen können aus einzelnen<br />
Kameras, komplexe Anlagen aus einem Netzwerk<br />
untereinander verbundener Kameras bestehen. Bei<br />
komplexeren Anlagen kann ein Computersystem die<br />
aufgenommenen Daten fortlaufend und automatisch<br />
analysieren. So können Bewegungen, abgestellte Gegenstände,<br />
Menschenansammlungen oder gegenläufige<br />
Bewegungsrichtungen erkannt werden. Derartige<br />
Systeme können ebenso eine Überwachungsperson<br />
alarmieren.<br />
<strong>Die</strong> operativen Ebenen der Überwachung<br />
Der Einsatz von CCTV kann unterschiedliche<br />
Zielsetzungen aufweisen. <strong>Die</strong> dissuasive Videoüberwachung<br />
bezweckt die Verhinderung menschlich<br />
verursachter „Gefährdungen“ und „Störungen“ <strong>im</strong><br />
öffentlichen Raum durch Abschreckung. Sie erfolgt<br />
in aller Regel permanent und ist nach aussen hin erkennbar.<br />
Für die dissuasive Überwachung werden<br />
üblicherweise Videotechnologien eingesetzt, welche<br />
die Bildsignale aufzeichnen und eine Identifikation<br />
von aufgenommenen Einzelpersonen ermöglichen.<br />
<strong>Die</strong> observative Videoüberwachung bezweckt die<br />
Gewährleistung von Abläufen und Zuständen und<br />
die Verhinderung technischer Störungen (z.B. Steuerung<br />
von Verkehrs, - und Personenströmen). Bei der<br />
observativen Überwachung gelangen in der Regel<br />
Videotechnologien zum Einsatz, welche keine Identifikation<br />
von aufgenommenen Einzelpersonen zulassen.<br />
<strong>Die</strong> invasive Videoüberwachung hat die gezielte<br />
Beschattung eines best<strong>im</strong>mten inneren Feindes („Störer“)<br />
zum Ziel. Zur Erfüllung dieses Überwachungszwecks<br />
können best<strong>im</strong>mte Orte (Hauseingänge etc.)<br />
überwacht werden. <strong>Die</strong> invasive Videoüberwachung<br />
erfolgt, <strong>im</strong> Gegensatz zur dissuasiven Überwachung,<br />
nicht permanent und offen, sondern vorübergehend<br />
und verdeckt. Derartige Systeme können eine Überwachungsperson<br />
alarmieren, welche in die beobachtete<br />
Situation hineinzoomt oder die Aufzeichnung<br />
des Geschehens durch Erhöhung der Aufnahmerate<br />
intensiviert. <strong>Die</strong> Möglichkeiten zur Weiterbearbeitung<br />
von Bildaufnahmen sind vielfältig, so sind etwa<br />
die automatische Nummernschilderkennung <strong>im</strong><br />
Straßenverkehr, die Gesichtserkennung oder der Vergleich<br />
mit bereits gespeicherten biometrischen Daten<br />
möglich. <strong>Die</strong> Beobachtung von „Unbeteiligten“ und<br />
„Unverdächtigen“ ist gewollt und deren Verhalten<br />
wird zur Herstellung von Bewegungsprofilen aufgezeichnet.<br />
Der bürgerliche pro Forma „Datenschutz“ soll gewährleistet<br />
werden. Es kann auf einen sogenannten<br />
Privacy Filter zurückgegriffen werden. Bei dessen<br />
Einsatz werden die aufgenommen Objekte und Personen<br />
vor der Speicherung des Bildes automatisch bis<br />
zur Unkenntlichkeit verwischt. Unbewegliche Räume<br />
und Gegenstände bleiben scharf. Das Bild wird dann<br />
mit den unkenntlichen Elementen gespeichert. Mit<br />
einem Software-Schlüssel können aber der Staatsschutz<br />
und Konsorten die unkenntlichen Bereiche<br />
nachträglich, z.B. <strong>im</strong> Rahmen einer Strafermittlung,<br />
wiederherstellen.<br />
Wie erwähnt, stehen in der Alltagspraxis der Videoüberwachung<br />
auch in der Schweiz die Eindämmung<br />
von „Vandalenakten“ und der „Störung der<br />
öffentlichen Ordnung“, bis hin zu Revolten und Aufständen<br />
<strong>im</strong> Vordergrund. In den letzten Jahren wurde<br />
der Terror der reaktionären Kleriker als Begründung<br />
für den massiven Ausbau der Überwachung des<br />
öffentlichen Raumes herangezogen.<br />
Besonders „gefährdete“ Orte und Zonen<br />
Unter dem Deckmantel der „Terrorbekämpfung“<br />
sind die zu überwachenden Orte beliebig auszuweiten.<br />
Der Schweizer Repressionsapparat will einiges<br />
in den Blickwinkel der Kameras stellen: Öffentliche<br />
Verkehrsmittel, insbesondere Züge auf Zuglinien mit<br />
hohem Personenaufkommen, aber auch Busse, Trams<br />
oder Kursschiffe; Bahnhöfe der grossen Schweizer<br />
Städte (mit besonderem Augenmerk auf Plätze, an<br />
denen sich viele Menschen gleichzeitig aufhalten, wie<br />
Treffpunkte oder Bahnsteige); Flughäfen mit grossem<br />
Publikumsverkehr (sowohl der frei zugängliche<br />
Bereich, wie auch der Bereich nach der Passkontrolle);<br />
Grosse Sport-, oder Konzertveranstaltungen<br />
und die dazugehörigen öffentlichen Vorplätze sowie<br />
Public Viewing- Bereiche bei Grossanlässen; Öffentliche<br />
Plätze, auf denen regelmässig Veranstaltungen<br />
mit hohem Publikumsverkehr stattfinden (wie z.B.<br />
Demonstrationen, Messen, Feste oder Konzerte);<br />
Einkaufszentren; Lehranstalten und Krankenhäuser,<br />
sowie die Postämter. Um den „Vandalismus“ zu bekämpfen<br />
wurden in letzter Zeit die meisten Schulhäuser<br />
in der <strong>Stadt</strong> Zürich massiv mit Videoüberwachungsanlagen<br />
aufgerüstet.<br />
<strong>Die</strong> genannten Orte seien auch in der Schweiz einer<br />
erhöhten Intensität an unterschiedlichster „Alltagskr<strong>im</strong>inalität“<br />
ausgesetzt, was zum schon erwähnten<br />
Umstand geführt hat, dass dort Videotechnologie<br />
bereits verbreitet zum Einsatz gelangt. Im Oktober<br />
2014 startete die Genfer Polizei <strong>im</strong> „Problemquartier“<br />
Paquis eine neue Offensive. An „neuralgischen“<br />
Punkten sollten 29 Kameras in Stellung gebracht<br />
werden, die rund um die Uhr in Echtzeit Aufnahmen<br />
an eine digitale Wand projizieren. <strong>Die</strong>se wird ununterbrochen<br />
beobachtet und allenfalls wird Alarm<br />
geschlagen, bzw. eine Patrouille dirigiert. Das Ganze<br />
wird von der Uni Neuenburg „wissenschaftlich“ begleitet.<br />
26 27
Im speziellen Fokus des inneren Feindes seien<br />
Personen, Institutionen und Organisationen, welche<br />
„hoheitliche“ oder wirtschaftliche Macht auf nationalem,<br />
internationalem oder supranationalem Niveau<br />
repräsentieren. Mit Blick auf diese strategischen<br />
Angriffsziele müssen die folgenden Orte besonders<br />
gut überwacht werden: Justiz-, Verwaltungs-, Regierungs-<br />
und Parlamentsgebäude; Infrastrukturen von<br />
Polizei- und Kontrollorganen (wie Grenzübergänge,<br />
Zollfreilager oder Personenkontrollräumlichkeiten);<br />
Botschaften; Hauptsitze von bedeutenden Konzernen<br />
und Organisationen; Handels-, Finanzzentren<br />
und Messen. Aufgrund der „erhöhten Gefährdung“<br />
gelangt auch an diesen Orten Videotechnologie heute<br />
verbreitet zum Einsatz.<br />
gesteuerte Kameras ein, so dass das Aufzeichnen der<br />
menschenleeren Haltestellen vermieden wird.<br />
Am Flughafen Zürich Kloten erfolgt die Kameraüberwachung<br />
ab der Vorfahrt der Flugzeuge für den<br />
Abflug oder die Ankunft (inkl. der Taxiwarteräume)<br />
bis hin zum Ankunfts-, und Abflugbereich für die<br />
Fluggäste. Zudem werden neben den Check-Ins der<br />
ganze Bereich des Airside Centers, sowie die Unterführungen,<br />
die Gepäckförderbänder und der Bahnhofterminal<br />
überwacht. <strong>Die</strong> Überwachung wird teils<br />
mittels Hinweisen erkennbar gemacht. <strong>Die</strong> Daten<br />
werden digital aufgezeichnet und nach 24 Stunden,<br />
bei vier Kameras für die Vorfahrten nach 72 Stunden,<br />
gelöscht.<br />
Dazu kommt die Infrastruktur. Zu denken ist an<br />
Staudämme, Kraftwerke und Leitanlagen oder sensible<br />
Verkehrseinrichtungen wie Tunnels oder Brücken,<br />
die heute mittels Videotechnologie überwacht<br />
werden. Einem besonderen „terroristischen“ Anschlagsrisiko<br />
ausgesetzt seien zudem Objekte, von<br />
denen eine besondere symbolische Wirkung ausgeht,<br />
wie Synagogen, Kirchen, Moscheen oder Denkmäler.<br />
Überwachung der Grenzen des Nationalstaates<br />
An der „Landesgrenze“, <strong>im</strong> grenznahen Raum,<br />
auf Flughäfen und an Grenzbahnhöfen findet bereits<br />
heute ein verbreiteter Einsatz von Videotechnologie<br />
statt. <strong>Die</strong>se Gebiete seien wegen „Zolldelikten“ und<br />
der „illegalen“ Ein- und Ausreise von Personen unterschiedlichster<br />
„Gefährlichkeit“ einer erhöhten Intensität<br />
an „Alltagskr<strong>im</strong>inalität“ bis hin zu „terroristischer<br />
Gewalt“ ausgesetzt. So das EJPD schon 2007.<br />
Videoüberwachung in der Zuständigkeit der SBB<br />
<strong>Die</strong> SBB setzen die Videoüberwachung <strong>im</strong> öffentlich<br />
zugänglichen Raum heute massiv ein. Sie erfolgt<br />
vorab zur Verhinderung von „ungebührlichem<br />
Verhalten“ und „Alltagskr<strong>im</strong>inalität” und wird der<br />
Öffentlichkeit mittels Schildern und Piktogrammen<br />
angezeigt. Überwacht werden Perrons, Wartehallen,<br />
Schalterhallen, Zugänge (Drehkreuzdurchgänge),<br />
Ticketautomaten und Liftzugänge. Soweit die SBB<br />
Videosignale aufzeichnen und diese Aufzeichnungen<br />
Personendaten enthalten, müssen sie nach der<br />
Auswertung durch die Bahnbullen innerhalb von 24<br />
Stunden vernichtet werden. <strong>Die</strong> SBB überwachen ihre<br />
Anlagen nicht nur dissuasiv, sondern auch observativ.<br />
Solche Aufnahmen erfolgen ohne Aufzeichnung<br />
und beschränken sich auf die sichere betriebliche Abwicklung<br />
des Zugverkehrs und der Passagierströme.<br />
<strong>Die</strong> Konsumtempel in den sieben Grossbahnhöfen<br />
der Schweiz werden seit Herbst 2007 rund um<br />
die Uhr mit Videokameras überwacht. <strong>Die</strong> Signale<br />
werden aufgezeichnet und <strong>im</strong> Bedarfsfall ausgewertet.<br />
Neun grössere bediente SBB Bahnhöfe (sog.<br />
„Bahnhöfe plus“) werden heute ohne Aufzeichnung<br />
videoüberwacht. In über hundert nicht bedienten<br />
Regionalbahnhöfen der SBB werden die Ticket- und<br />
Warenverkaufsautomaten videoüberwacht. <strong>Die</strong> Aufnahmen<br />
werden rund um die Uhr aufgezeichnet.<br />
Das SBB Rollmaterial des gesamten Regionalverkehrs<br />
ist mit Videoüberwachung ausgerüstet. <strong>Die</strong><br />
Aufnahmen werden in jedem Wagen lokal aufgezeichnet.<br />
Im Ereignisfall können die über die Überwachung<br />
informierten Fahrgäste über eine SOS<br />
Gratisnummer direkt mit der Einsatzzentrale der Securitrans<br />
in Kontakt treten.<br />
<strong>Die</strong> permanente dissuasive und observative Videoüberwachung<br />
ist heute auch bei den regionalen<br />
Verkehrsbetrieben verbreitet. Eine „Arbeitsgruppe<br />
Security” der Sicherheitschefs der städtischen Verkehrsbetriebe<br />
in der Schweiz erarbeiteten 2006 einen<br />
Leitfaden zum Thema Videoüberwachung. Ebenfalls<br />
mit CCTV observiert werden in der Regel die Bergund<br />
Talstationen von Bergbahnen, vereinzelt auch<br />
Parkhäuser bei Eisenbahnbetrieben, Barrieren, Kassen<br />
sowie die Parkflächen.<br />
In städtischen Agglomerationen werden die Fahrgasträume<br />
auch in Bussen videoüberwacht. In der<br />
Regel wird der Businnenraum, insbesondere der Eingangsbereich,<br />
mit zwei bis fünf Kameras überwacht.<br />
Teilweise ist be<strong>im</strong> Fahrer ein Monitor installiert.<br />
Dort, wo Videoüberwachung eingesetzt wird, sind<br />
heute vor allem die in der Nacht eingesetzten Busse<br />
mit entsprechenden Anlagen ausgerüstet. <strong>Die</strong> aufgenommenen<br />
Daten werden in der Regel <strong>im</strong> Bus digital<br />
gespeichert. Bei grösseren Betrieben erfolgt vor der<br />
Speicherung eine Verschlüsselung. <strong>Die</strong> Aufbewahrungsfristen<br />
betragen meist 24 oder 72 Stunden. Bei<br />
den Trams sind die neuen Triebwagen mit Videoüberwachungsanlagen<br />
ausgerüstet. Wie bei den Bussen<br />
werden besonders die Eingangsbereiche der Wagen<br />
überwacht. Auch Tramhaltestellen (z.B. am L<strong>im</strong>matplatz<br />
in Zürich) werden <strong>im</strong>mer öfters überwacht Ein<br />
Verkehrsbetrieb setzte <strong>im</strong> Pilotversuch bewegungs-<br />
<strong>Die</strong> Überwachungsanlage des Flughafen Zürich<br />
Kloten ist gemäss Erhebung die einzige, welche - örtlich<br />
sehr begrenzt - Privacy Filter einsetzt. Einzelne<br />
Kameras können ferngesteuert werden. Zugriff auf<br />
die Daten haben <strong>im</strong> Ereignisfall die Flughafenbetreiberin<br />
Unique, die Kapo Zürich und das Zollinspektorat.<br />
<strong>Die</strong> Flughafenbullen führen seit 2003 bei ausgewählten<br />
Flügen/Flugrouten sogenannte „vorgelagerte<br />
Grenzkontrollen zur Erkennung illegaler Migration“<br />
durch. Zu diesem Zweck wird direkt bei den Gates<br />
das Videoüberwachungs- und Gesichtserkennungssystem<br />
FAREC (Face Recognition) zur biometrischen<br />
Identifikation betrieben. <strong>Die</strong> biometrische Erfassung<br />
der Gesichter erfolgt mittels Einzelfotografien und ist<br />
nur bei guten Lichtverhältnissen möglich. <strong>Die</strong> Erfassung<br />
aus einer grösseren Zahl von Personen heraus<br />
ist aufgrund von Qualitätsmängeln noch fehlerhaft.<br />
Bei späteren Personenkontrollen auf dem Flughafengelände<br />
innerhalb der Aufbewahrungsdauer von 60<br />
Tagen, wird ein Bildvergleich vorgenommen, um illegal<br />
anwesende MigrantInnen zu erkennen und zu<br />
verhaften.<br />
Videoüberwachung der Verwaltungs-, Parlaments-<br />
und Regierungsgebäude des Bundes<br />
<strong>Die</strong> Videoüberwachung der Verwaltungs-, Parlaments-<br />
und Regierungsgebäude wird in der vom<br />
Bundessicherheitsdienst (BSD) betriebenen Alarmzentrale<br />
der Bundesverwaltung wahrgenommen. Der<br />
BSD kann an den genannten Orten Bildaufnahmeund<br />
Bildaufzeichnungsgeräte auch zur Aufzeichnung<br />
und Auswertung von präventiv beschafften Perso-<br />
28 29
Ästhetik der Utopie I<br />
nenbilddaten nutzen. <strong>Die</strong> Videoüberwachung durch<br />
den BSD wird den Betroffenen nicht erkennbar gemacht.<br />
<strong>Die</strong> Bilddaten werden in der Regel digital auf<br />
Festplatten gespeichert und wahrend 24 Stunden aufbewahrt.<br />
Das Landesmuseum Zürich, die Asylempfangsstellen<br />
des Bundes sowie einzelne Verwaltungsgebäude<br />
des VBS werden durch die jeweiligen Stellen<br />
selbst videoüberwacht.<br />
<strong>Die</strong> eidgenössische Zollverwaltung setzt automatische<br />
Bildaufnahme- und Bildaufzeichnungsgeräte,<br />
sowie andere Überwachungsgeräte ein, worunter insbesondere<br />
der grenznahe Einsatz von videobestückten<br />
Drohnen fällt. Der Einsatz der Überwachungstechnik<br />
erfolgt um „unerlaubte“ Grenzübertritte oder<br />
„Gefahren für die Sicherheit“ <strong>im</strong> grenzüberschreitenden<br />
Verkehr frühzeitig zu erkennen. <strong>Die</strong>s geschieht<br />
namentlich zur Fahndung, sowie zur Überwachung<br />
von Räumen mit Wertsachen, von Räumen mit verhafteten<br />
Personen und von Zollfreilagern.<br />
<strong>Die</strong> vom Grenzwach Korps (GWK) verdeckt betriebenen<br />
Anlagen <strong>im</strong> Gelände stellen „illegale“<br />
Grenzübertritte fest. An neuralgischen Punkten der<br />
grünen Grenze sind bewegungsgesteuerte und teilweise<br />
zoombare Kameras <strong>im</strong> Einsatz. <strong>Die</strong> Aufnahmen<br />
werden an eine Überwachungszentrale übermittelt.<br />
Sobald <strong>im</strong> Gelände Bewegungen registriert werden,<br />
löst dies in der Überwachungszentrale Alarm aus,<br />
worauf die übermittelten Bilder von dem dortigen<br />
Pikettpersonal in Echtzeit betrachtet werden, ohne<br />
dass eine Aufzeichnung erfolgt. An mindestens elf<br />
Grenzposten sind Videokameras mit automatischer<br />
Autonummererkennung installiert. <strong>Die</strong> Zollfahndung<br />
erstreckt sich übrigens über das ganze Gebiet<br />
der Schweiz.<br />
Videoüberwachung in den Kantonen und Gemeinden<br />
Bei der Videoüberwachung durch den kantonalen<br />
und kommunalen Apparat wird der öffentliche Raum<br />
observiert. Es gibt Kantone, die das Mittel der Videoüberwachung<br />
intensiv nutzen, während andere dieses<br />
Mittel kaum zum Einsatz bringen. Einzelne Kantone,<br />
wie Zürich, betreiben unter der Bezeichnung „automatische<br />
Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung“<br />
(AFV) Anlagen, welche die Kennzeichen<br />
vorbeifahrender Autos mit Kameras erkennen und<br />
selbstständig mit der Fahndungsdatenbank RIPOL<br />
vergleichen. <strong>Die</strong> Daten werden verschlüsselt transportiert<br />
und die Bullen werden <strong>im</strong> Falle eines Treffers<br />
be<strong>im</strong> Datenbankvergleich informiert.<br />
Unterschiedliche Orte, Verkehrsmittel, <strong>Stadt</strong>viertel<br />
und auch „private“ Zonen sind also Objekte von<br />
Videoüberwachung. <strong>Die</strong> Zielsetzungen sind so unterschiedlich<br />
wie die verwendete Technologie. Quantitativ<br />
stehen allerdings die aufgewerteten Innenstädte<br />
und Geschäftsviertel <strong>im</strong> Zentrum des CCTV Einsatzes.<br />
Während soziale Kontrolle schon <strong>im</strong>mer zum Arsenal<br />
der Konterrevolution gehörte, ist der Einsatz<br />
von Technik zur Kontrolle des öffentlichen Raumes<br />
in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Technik<br />
ist jedoch auch verletzungsanfällig und wie die letzten<br />
Revolten und Klassenkämpfe zeigen, kein wirkliches<br />
Hindernis für eine revolutionäre Veränderung.<br />
Videoüberwachung von Armeeeinrichtungen<br />
<strong>Die</strong> meisten vom VBS betriebenen Einrichtungen,<br />
bei denen Videoüberwachung eingesetzt wird, sind<br />
nicht öffentlich zugänglich. Videoüberwachungssysteme<br />
werden etwa bei Eingangs- und Einfahrtbereichen<br />
zu Arealen oder Objekten wie Verwaltungsgebäuden,<br />
Waffenplätzen, Logistikcentern, Labors oder<br />
Anlagen eingesetzt. Vereinzelt sind videogestützte<br />
Zaunüberwachungssysteme <strong>im</strong> Einsatz, die aber nur<br />
sehr begrenzt auf den Bereich ausserhalb des Areals<br />
wirken.<br />
30 31
Ästhetik der Utopie II<br />
5. Handlungstheorie – Klassenkampfanalyse<br />
a) Für eine revolutionäre Klassenposition<br />
<strong>Die</strong> Debatte über das revolutionäre Subjekt ist vorgängig<br />
<strong>im</strong>mer auch die Auseinandersetzung über die<br />
Best<strong>im</strong>mung der aktuellen Gesellschaftsformation.<br />
Wo stecken wir <strong>im</strong> Fahrplan zum Kommunismus?<br />
Gerade die umfassende und tief greifende Restauration<br />
des Kapitalismus macht eine Einschätzung alles<br />
andere als einfach. In der Stufenfolge der Gesellschaftsformationen,<br />
die grundsätzlich progressiv gedacht<br />
ist, und der historischen Wirklichkeit klafft <strong>im</strong><br />
Moment wahrlich eine riesige Lücke. Vielleicht setzt<br />
gerade die Best<strong>im</strong>mung eines progressiven Bewegungsprozesses<br />
der Gesellschaft eine Differenzierung<br />
in der historischen Dialektik voraus. Historischer<br />
Prozess ist nicht gleich historischer Prozess. <strong>Die</strong> Geschichte<br />
der Gesamtheit aller sozialen Prozesse ist<br />
nicht gleich zu setzen mit der Geschichte jener konkret-historischen<br />
Gesellschaften, die zur Entfaltung<br />
progressiver Entwicklungen wesentlich beitragen.<br />
Ist in diesem Sinne zwischen pr<strong>im</strong>ären, progressivprägenden<br />
Prozessen und sekundären, reaktionären<br />
Entwicklungen von Weltgeschichte zu unterscheiden?<br />
Vom Charakter der jeweiligen Epoche, die sich<br />
wiederum in unterschiedliche Phasen aufteilt, hängt<br />
auch der Verlauf des revolutionären Prozesses als<br />
Epoche der sozialen Revolution oder eben als strategisches<br />
Rückzuggefecht, als Widerstand, als Aufbauprozess<br />
etc. ab. In der Epoche des Imperialismus hat<br />
der revolutionäre Prozess schon die verschiedensten<br />
Formen angenommen – 1917 in der Oktoberrevolution,<br />
1918 in der Novemberrevolution, 1933 <strong>im</strong> antifaschistischen<br />
Widerstand, 1936 <strong>im</strong> Spanischen Bürgerkrieg,<br />
1945 in der Befreiung Deutschlands, 1949<br />
in der Chinesischen Revolution, 1966 in der proletarischen<br />
Kulturrevolution und in den Bewegungen<br />
von 1968 und 1980.<br />
Auf was fusst eine progressiv Epoche? Wie oben<br />
ersichtlich, gehen wir bei der Erfassung des historischen<br />
Prozesses von der Entwicklung und Abfolge<br />
ökonomischer Gesellschaftsformationen und der<br />
darauf basierenden Wechselwirkung mit der Entwicklung<br />
der materiellen Produktivkräfte aus. Der<br />
progressive Kern einer fortschrittlichen Entwicklung<br />
bildet daher die produzierende Auseinandersetzung<br />
zwischen „Mensch“ und „Natur“, Naturaneignung<br />
und Vergesellschaftung. (Wie es aktuell darum steht?<br />
Barbarei ist der richtige Begriff dafür.) Daraus folgt,<br />
dass die produzierenden und ausgebeuteten Klassen<br />
das Zentrum dieses progressiven, manchmal revolutionären,<br />
Potentials bilden und ebenso die Ausbeuter<br />
die reaktionäre Entwicklung prägen. <strong>Die</strong> handelnden<br />
und gestaltenden Kräfte des historischen Prozesses<br />
sind und bleiben die Klassen, trotz allen Schwierigkeiten,<br />
diese heute zu definieren. „Geschichte… ist<br />
eine Geschichte von Klassenkämpfen“. Eine Klassenposition<br />
bleibt die Orientierung auch in Zeiten, in<br />
denen die verschiedenen Imperialismen übereinander<br />
herfallen.<br />
<strong>Die</strong> Gesellschaft ist einem permanenten Prozess<br />
unterworfen, was gerade auch die tief greifenden<br />
Auswirkungen der aktuellen wissenschaftlich-technologischen<br />
Entwicklung und der daraus hervorgehenden<br />
komplizierten Klassenzusammensetzung<br />
sehr deutlich aufzeigen. <strong>Die</strong> Analyse der Bedingungen,<br />
der Formen und des Charakters sozialer Bewegungen<br />
ist objektiv schwierig geworden. <strong>Die</strong>s ändert<br />
allerdings nichts daran, dass - solange es antagonistische<br />
Klassen gibt - die soziale Revolution ein notwendiges<br />
Element der historischen Entwicklung bleibt.<br />
<strong>Die</strong> Restauration des Kapitalismus und die Zerschlagung<br />
aller vorhandenen sozialistischen Elemente, die,<br />
wie gesagt, wahrlich keine progressive Abfolge in der<br />
Entwicklung der Gesellschaftsformationen darstellt,<br />
zeigt deutlich eines auf: Wie widersprüchlich sich der<br />
Geschichtsprozess und damit die jeweiligen revolutionären<br />
Möglichkeiten entwickeln.<br />
Nur soviel dazu. Der revolutionäre Prozess vollzieht<br />
sich in Konvulsionen, Sprüngen, Stabilisierungsphasen,<br />
Zyklen revolutionärer Umbrüche und Rückschläge<br />
in einer zeitlichen D<strong>im</strong>ension, die so nicht<br />
erwartet wurde. <strong>Die</strong> Einschätzung der revolutionären<br />
Möglichkeiten und die Definition des revolutionären<br />
Subjekts sollten in diesem Sinne an formationstheoretische<br />
Überlegungen gebunden werden. Der Kampf<br />
für eine „andere Welt“ muss zwingend ein Kampf für<br />
eine andere, sozialistische Gesellschaftsformation<br />
sein. Daran hat sich der revolutionäre Prozess auch<br />
in einer reaktionären Zeit zu orientieren. Erst nach<br />
der Bezugnahme auf diese übergeordnete D<strong>im</strong>ension<br />
verliert der Klassenbegriff seinen klassifikatorischen<br />
Charakter nach empirischen Merkmalen und es kann<br />
in den Kämpfen zwischen progressivem und reaktionärem<br />
Potential unterschieden werden. Klassenkampfanalyse:<br />
Eben der Versuch einer Verbindung<br />
32 33
zwischen der allgemeinen Dialektik des historischen<br />
Prozesses mit der konkreten Erfassung des Besonderen<br />
und des Einzelnen. Krise des revolutionären Subjekts?<br />
Eher „Krise“ der „objektiven“ Epoche.<br />
b) Widerspruchserfahrungen<br />
Politischer Widerspruch zum herrschenden Kapitalismus<br />
beruht zwar auf den oben erwähnten objektiven<br />
sozial-ökonomischen Voraussetzungen, die<br />
entsprechend der aktuellen Gesellschaftsformation<br />
gegeben sind. Das marxistische Verständnis von<br />
Klassenkampf ist allerdings nie davon ausgegangen,<br />
dass sich aus gesellschaftlicher Benachteiligung<br />
„automatisch“ progressives Bewusstsein, bzw. revolutionäres<br />
Handeln ergibt. Soziale Widerspruchserfahrungen,<br />
so tief sie auch heute sind, produzieren<br />
beides: Revolutionäre und reaktionäre Denk- und<br />
Handlungsoptionen. <strong>Die</strong>se beinhalten zwar eine<br />
dichotomische Struktur, also die Gesellschaft in ein<br />
Oben und Unten gespalten, die vom Interessenwiderspruch<br />
zwischen Arbeit und Kapital geprägt ist.<br />
Doch welche Ursachen wo und wie wirken, liegt<br />
unter den herrschenden reaktionären ideologischen<br />
Verzerrungen und den individualistischen „Lösungen“<br />
verborgen.<br />
<strong>Die</strong> Klassenwidersprüche sind enorm vielfältig<br />
geworden und in den Revolten und Aufständen<br />
nicht <strong>im</strong>mer einfach zu lokalisieren. <strong>Die</strong> Analyse<br />
der sozialen Konflikte und darin die Best<strong>im</strong>mung<br />
der jeweiligen Klasseninteressen und schliesslich<br />
eine daraus folgende revolutionäre Intervention,<br />
lässt sich nur über die Auseinandersetzung mit den<br />
unmittelbaren Lebensinteressen leisten. Dort sind<br />
die Bereiche verortet, wo Klassenkonfrontation in<br />
der gesellschaftlichen Realität entsteht. Erst aus subjektiv<br />
erfahrbaren, konkret sinnlichen Klassenwidersprüchen<br />
lassen sich Klasseninteressen ableiten.<br />
Und die umfassen das betriebliche,- wie ausserbetriebliche<br />
Kampffeld; als auch den Widerstand gegen<br />
die kapitalistische Urbanisierung. Zusammen<br />
mit dem Bedürfnis von Widerstand, Rebellion und<br />
Auflehnung kann Klassenbewusstsein entstehen,<br />
das revolutionär handlungsfähig ist. Klassenkampfanalyse<br />
ist <strong>im</strong>mer auch die Analyse des revolutionären<br />
Potentials, oder wie Brecht sagt, „Realität<br />
ist nicht nur alles, was ist, sondern auch alles was<br />
wird. Sie ist ein Prozess“. Freilich lässt sich diese Art<br />
von Theorie und Praxis, die über den betrieblichen<br />
Rahmen weit hinaus geht, nur <strong>im</strong> Kontext eines politisch-organisatorischen<br />
Rahmens leisten, der eine<br />
best<strong>im</strong>mte kontinuierliche Praxis, wie sie die politische<br />
Widerstandsbewegung bietet, zulässt. Dort<br />
besteht die Möglichkeit einer Verbindung zwischen<br />
revolutionärer Veränderungsperspektive und praktisch<br />
erfahrbaren gesellschaftlichen Widersprüchen.<br />
Aus den unterschiedlichsten Widerspruchsfeldern<br />
kann sich eine grundsätzliche Bereitschaft zur Abschaffung<br />
des Kapitalismus generieren und eine gesellschaftsverändernde<br />
Wirkung und Dynamik entfalten.<br />
Doch ist dieses revolutionäre Subjekt gesellschaftlich<br />
nicht zu peripher positioniert um den revolutionären<br />
Prozess zu beeinflussen? Wo sind die<br />
„Massen“? Wir definieren „Masse“ als qualitativen<br />
Begriff, der nicht absolut zu verstehen ist, sondern<br />
sich aufgrund der jeweiligen konkreten Situation<br />
best<strong>im</strong>mt. Der Begriff „Masse“ ändert sich, je nachdem<br />
wie sich der Charakter des Kampfes ändert. Zu<br />
Beginn des Kampfes genügten schon einige tausend<br />
wirklich revolutionäre ArbeiterInnen, damit man<br />
von der Masse sprechen konnte. „Wenn einige tausend<br />
parteilose Arbeiter, die gewöhnlich ein Spiesserleben<br />
führen und ein klägliches Dasein fristen,<br />
die niemals von Politik gehört haben, revolutionär<br />
zu handeln beginnen, so ist das die Masse. Ist die<br />
Revolution schon genügend vorbereitet, so ändert<br />
sich der Begriff der „Masse“: Einige tausend Arbeiter<br />
stellen keine Masse mehr dar.“ (Lenin).<br />
Sind die aktuellen städtischen Klassenkämpfe<br />
und Revolten eine revolutionäre Möglichkeit?<br />
Teilweise schon, wie Beispiele in den letzten Jahren<br />
aufzeigen. Während es <strong>im</strong> 19. <strong>Jahrhundert</strong> eine<br />
Vielzahl bäuerlicher Revolten, aber kaum städtische<br />
Aufstände gab, sich der revolutionäre Prozess mit<br />
der Industrialisierung schliesslich in die europäischen<br />
Städte verschob, um danach <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Entkolonialisierung und der nationalen Befreiung<br />
durch Volkskriege Jahrzehnte <strong>im</strong> Trikont zu verweilen,<br />
scheint sich der revolutionäre „Ort“ Richtung<br />
moderne Metropolen aller Kontinente zu verlagern.<br />
<strong>Die</strong> Gründe hierfür sind hauptsächlich ökonomischer,<br />
sozialer und politischer Natur. Doch wie oben<br />
ausgeführt, interessieren uns besonders auch die<br />
Merkmale urbaner Entwicklungen, die den revolutionären<br />
Kampf potentiell beeinflussen.<br />
Wie sich die Gegenseite die<br />
verschiedenen Phasen und<br />
Möglichkeiten von Widerstand<br />
vorstellt.<br />
c) Das urbane Kampffeld – Revolutionäre<br />
Gegenmacht<br />
Revolutionen entstehen aus politischen Situationen<br />
und nicht, weil einige Städte ihrer Struktur nach<br />
für Strassenkampf und Aufstand geeignet sind. Doch<br />
in Städten konzentrieren sich politische Macht, wirtschaftlicher<br />
Reichtum und gleichzeitig Armut und<br />
Ausgrenzung. Klassenwidersprüche sind sichtbar,<br />
die Auseinandersetzung mit Macht und Herrschaft<br />
des Kapitals unausweichlich. <strong>Die</strong> bekannte „andere“<br />
Welt ist, ohne die Machtfrage zu stellen, nicht möglich.<br />
<strong>Die</strong> historischen Defizite, dass auch emanzipatorische<br />
Ansätze von revolutionärer Macht zu neuen<br />
Herrschaftsverhältnissen geführt haben, sollen uns<br />
eine Lehre sein, uns jedoch nicht davon abhalten, <strong>im</strong><br />
revolutionären Prozess die richtigen Konsequenzen<br />
zu ziehen. Ein „zivilisierter Kapitalismus“ ist nicht zu<br />
haben.<br />
Urbane Zentren sind Orte, wo sich die Macht des<br />
internationalen Finanzkapitals und seine Apparate<br />
auf der einen, das urbane Leben produzierende<br />
34 35
und reproduzierende Proletariat auf der anderen Seite,<br />
konzentrieren. Ein zentrales Austragungsfeld der<br />
wichtigsten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.<br />
Damit kommt ihm potentielle strategische Bedeutung<br />
zu.<br />
Städtischen Eigenschaften, wie die gebaute Umwelt<br />
garantieren billige und schnelle Kommunikationsmöglichkeiten<br />
und eine hohe Mobilität. <strong>Die</strong> technische<br />
Überlegenheit der Repressionskräfte muss<br />
wegen der <strong>im</strong>mensen Komplexität von Städten keineswegs<br />
einen entscheidenden Vorteil bedeuten.<br />
Es müssen die Protagonisten der herrschenden<br />
Macht benannt, ihre Kontroll- und Gewaltapparate<br />
identifiziert und die Funktionsweise moderner bürgerlichen<br />
Herrschaft analysiert werden. Ein zentrales<br />
Merkmal der heutigen Metropolen ist das zahlenmäßige<br />
Anwachsen der Gebäude, die sich lohnen, angegriffen<br />
oder besetzt zu werden. Während sich die<br />
Sitze der eigentlichen Kapitalisten und ihrer Manager<br />
<strong>im</strong>mer mehr von den „unsicheren“ Vierteln entfernt<br />
haben (allerdings geht eine Tendenz Richtung städtische<br />
Appartements, denn die sind anonymer und daher<br />
weniger angreifbar), ballen sich die tatsächlichen<br />
Hauptquartiere der Herrschenden oft in unmittelbarer<br />
Nähe von potentiell aufrührerischen Quartieren.<br />
Das Zentrum einer <strong>Stadt</strong> des späten <strong>21.</strong> <strong>Jahrhundert</strong>s<br />
wird nicht nur durch die Symbole, sondern auch<br />
durch die Wirklichkeit der <strong>im</strong>perialistischen Macht,<br />
der Massivbauten aus Spiegelglas der Banken und<br />
großen Konzerne, geprägt. Entscheidend für das System<br />
ist heute allerdings die Infrastruktur der Energie,<br />
Kommunikation und Medien!<br />
die Schließung der Banken, das Büropersonal, das<br />
nicht zur Arbeit erscheinen kann oder will, die Geschäftsleute,<br />
die in Hotels festgehalten sind oder ihren<br />
Best<strong>im</strong>mungsort nicht erreichen können - dies<br />
alles kann das ökonomische Leben einer <strong>Stadt</strong> sehr<br />
empfindlich stören. Revolutionäre Gegenmacht!<br />
<strong>Die</strong> Besetzung von öffentlichem Territorium in<br />
Form von Demonstrationen und Kundgebungen gehören<br />
zu den wichtigsten Aktionsformen der revolutionären<br />
Opposition. Revolutionäre Präsenz auf der<br />
Strasse, neben Demos und Kundgebungen auch die<br />
Plakatierung und Beschriftung der Mauern etc., soll<br />
der <strong>Stadt</strong> ein revolutionäres Gepräge aufdrücken - als<br />
Kontrast zur bürgerlichen Normalität. Eine demonstrative<br />
Wirkung auf „Freund und Feind“ : <strong>Die</strong> Herrschaft<br />
des Kapitalismus wird hier in Frage gestellt, für<br />
eine revolutionäre Alternative gekämpft und diese<br />
sichtbar gemacht.<br />
Durch die erfolgreiche Besetzung von öffentlichen<br />
Terrain realisiert sich exemplarisch der punktuelle<br />
„Sieg“ über den Kapitalismus – eine Wirkung die zumindest<br />
tendenziell von den DemoteilnehmerInnen<br />
auch so wahrgenommen wird. Aber nicht nur das.<br />
Mit der Auswahl der Aktionsformen, mit der Ausgestaltung<br />
der Demostruktur, und mit der Wahl der Demonstrationsroute<br />
kann eine Brücke zwischen dem<br />
jeweiligen Anlass/Thematik und der verallgemeinerten<br />
Kritik des Kapitalismus hergestellt werden. Denn<br />
neben der Öffentlichkeit gibt es <strong>im</strong>mer auch einen<br />
konkreten Adressat von Demos, an dessen Formierung<br />
des politischen Bewusstseins die Kämpfenden<br />
spezielles Interesse haben.<br />
zeitschriften etc. werden seitenlang „Urbane Konflikte“<br />
(vom Krieg in Grosny/Tschetschenien 1994-1996,<br />
über den Libanon, über Carlos Merhigella’s <strong>Stadt</strong>guerilla<br />
in Brasilien, bis hin zu Aufständen in Nordirland<br />
und <strong>im</strong> Irak) abgehandelt. Als wahrscheinlichstes<br />
„Gefechtsfeld des <strong>21.</strong> <strong>Jahrhundert</strong>“ wird der „Kampf<br />
in überbautem Gelände“ angenommen.<br />
In der Schweiz lebt heute nahezu drei Viertel der<br />
Bevölkerung in städtischem Gebiet. Pro Sekunde<br />
werden 0.86m2 überbaut und diese Tendenz wird<br />
sich fortsetzen. Eine Folge ist, wie wir an verschiedenen<br />
Beispielen gesehen haben, die Verhärtung der<br />
sozialen Polarisation, bzw. eine grösser werdende soziale<br />
Ungleichheit. <strong>Die</strong> Klassenauseinandersetzung<br />
wird noch verstärkter auf der Strasse stattfinden, die<br />
Kontrolle des urbanen Terrains zur strategischen<br />
Aufgabe der <strong>im</strong>perialistischen Aufstandsbekämpfung.<br />
Eine Entwicklung, die zwangsläufig auch hier<br />
das ganze <strong>im</strong>perialistische „Krisenmanagement“ und<br />
damit den gesamten Repressionsapparat entscheidend<br />
prägt.<br />
Der öffentliche Raum,wie er sich<br />
aufteilen, denken und analysieren lässt.<br />
Selbstverständlich hat die innere Sicherheit <strong>im</strong><br />
Vorfeld eines Armee-Einsatzes noch ein ganzes Arsenal<br />
von Handlungsmöglichkeiten. Damit sind wir<br />
<strong>im</strong> Moment konfrontiert. Wir können, trotz unterschiedlicher<br />
Realitäten in den Städten, von einer<br />
Tendenz zur räumlichen Bearbeitung der Klassenkonfrontation<br />
sprechen. Davon ist nicht nur die<br />
städtische Architektur betroffen, sondern auch die<br />
Formen der Unterdrückung wie Ausgrenzung, Ausschliessung<br />
und Überwachung mittels Hochleistungstechnologie.<br />
Auch wenn Unterschiede in Form und Intensität<br />
der Unterdrückung auszumachen sind, ob Afroamerikaner<br />
in New York, Deutscher türkischer Abstammung<br />
in Berlin oder Jugendliche aus dem Balkan etc.<br />
in Zürich, alle sind betroffen. Der schlichte Aufenthalt<br />
best<strong>im</strong>mter Kategorien der Klasse, an der Langstrasse<br />
in Zürich beispielsweise, wird schon mit arm,<br />
randständig = gefährlich, = negativ für die kapitalistische<br />
Aufwertung assoziiert und mit einem Wegweisungsbefehl<br />
sanktioniert. Wohlgemerkt, vor ein<br />
paar Jahren noch brauchte es zur Legit<strong>im</strong>ation von<br />
Während früher Rathäuser und Regierungssitze<br />
zentrale Angriffsziele waren, haben sich mittlerweile<br />
die Angriffsmöglichkeiten breit aufgefächert, bis<br />
hin zu den politisch und wirtschaftlich unwichtigen<br />
Symbole der kapitalistischer Lebensweise. Besonders<br />
nach der „Finanzkrise“ sind sich die Banken<br />
ihrer Angreifbarkeit bewusst, was architektonisch<br />
als scheinbar uneinnehmbare Festung sichtbar wird.<br />
Ähnlich jenen <strong>Stadt</strong>burgen, in denen sich Lehnsherren<br />
und. Lehnsträger <strong>im</strong> Mittelalter verschanzten.<br />
<strong>Die</strong> Gebäude großer Konzerne können direkt das<br />
Ziel von Demonstrationen sein. Sie sind angreifbar.<br />
Ein paar zerbrochene Spiegelglasfenster oder die Besetzung<br />
von wenigen Quadratmetern Büroraumes<br />
können die Operationen eines modernen Multis allenfalls<br />
unterbrechen. <strong>Die</strong> Blockierung des Verkehrs,<br />
<strong>Die</strong> Wirksamkeit der jüngsten Aufstände in westlichen<br />
Städten wie Paris, London und São Paulo ergibt<br />
sich vor allem aus ihrem Zusammenhang mit<br />
der politischen Gesamtsituation. Es hat sich gezeigt,<br />
dass die unterdrückte und ausgegrenzte Bevölkerung<br />
nicht länger bereit ist, ihr Schicksal passiv hinzunehmen.<br />
Defizite in der Entwicklung des politischen<br />
Bewusstseins und die Schwäche der revolutionären<br />
Linken verhinderten, dass diese Bewegungen eine<br />
unmittelbare ernsthafte Bedrohung für die örtliche<br />
Machtstruktur wurden.<br />
Das <strong>im</strong>perialistische Bedrohungsszenario „Kriegerische<br />
Auseinandersetzungen in urbanen Gebieten“<br />
prägt auch in der Schweiz die sogenannte<br />
aktuelle „Sicherheitsdebatte“. In den hiesigen Militär-<br />
36 37
Ästhetik der Erfahrung<br />
Repression in diesem Kontext noch so genannte „Regelverstösse“.<br />
Spielsaloons, Prostitution, Fixerräume<br />
aber auch Hausbesetzungen „locken“ ein „Publikum“<br />
an, das sich mit dem Image der kapitalistischen Aufwertung<br />
ganz und gar nicht verträgt. Entsprechende<br />
Infrastruktur wird verdrängt. Armut, Elend und Unterdrückung<br />
die nicht gesehen wird, existiert nicht –<br />
besonders in Zürich. Auf die Verschärfung der Klassenkonfrontation<br />
wird mit räumlicher „Verbannung“<br />
reagiert.<br />
Von dieser Tendenz zur „Sicherheit“, „Ordnung“<br />
und „Sauberkeit“ sind natürlich die Interventionen<br />
der revolutionären Linken <strong>im</strong> öffentlichen Raum besonders<br />
betroffen, nicht zuletzt, weil dadurch auch<br />
die kapitalistische Kommerzialisierung von Raum<br />
betroffen ist. <strong>Die</strong> Strassen der Städte haben für den<br />
revolutionären Kampf einen zentralen Stellenwert,<br />
sie bedeuten den Zugang zu den Klassenkämpfen,<br />
zum revolutionären Subjekt und zur sogenannten<br />
„Öffentlichkeit“. Mit der El<strong>im</strong>inierung der revolutionären<br />
Präsenz <strong>im</strong> öffentlichen Raum, an der die lokalen<br />
Repressionskräfte ganz konkret arbeiten, soll<br />
gerade das verhindert werden.<br />
Der Kampf um die Strasse ist ein Kampf um revolutionäre<br />
Gegenmacht, um den zentralen Ort, wo<br />
verschiedene Stränge des Klassenkampfes zusammen<br />
kommen. Das Kapital und sein Staat sind mächtig,<br />
zugleich aber auch angreifbar. Im langfristigen Aufbau<br />
von revolutionärer Gegenmacht soll das Wesen<br />
des revolutionären Prozesses konkret fassbar werden:<br />
Sein revolutionärer, emanzipatorischer Charakter,<br />
der Bruch mit dem kapitalistischen System, die Infragestellung<br />
des bürgerlichen Macht- und Gewaltmonopols.<br />
38 39