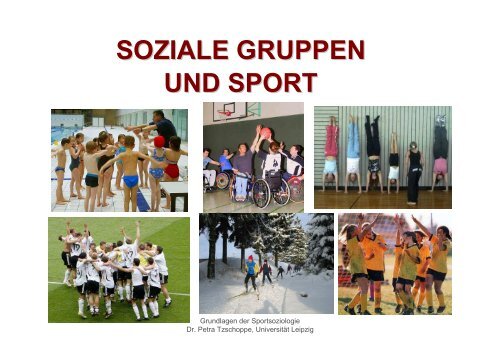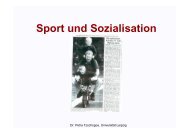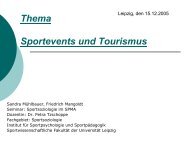Soziale Gruppen im Sport
Soziale Gruppen im Sport
Soziale Gruppen im Sport
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SOZIALE GRUPPEN<br />
UND SPORT<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Literaturauswahl<br />
⇒ Bahrdt, H. P. (1994). Schlüsselbegriffe der Soziologie. München<br />
⇒ Conzelmann, A. (Hg.) (1996). <strong>Soziale</strong> Interaktionen und <strong>Gruppen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Sport</strong>. Köln.<br />
⇒ Heinemann, K. (2007) Einführung in die Soziologie des <strong>Sport</strong>s.<br />
Schorndorf.<br />
⇒ Hug, O. (1996). Menschenführung und <strong>Gruppen</strong>prozesse.<br />
Schorndorf. Situative Führung für Trainer. S. 78 - 92.<br />
⇒ Schäfers, B. (2002). Einführung in die <strong>Gruppen</strong>soziologie.<br />
Stuttgart.<br />
⇒ Voigt, D. (1992). <strong>Sport</strong>soziologie - Soziologie des <strong>Sport</strong>s.<br />
Frankfurt a.M. S. 202 - 215.<br />
⇒ Weiß; O. (1999) Einführung in die <strong>Sport</strong>soziologie. Wien. S.<br />
109 - 122.
Gliederung<br />
1. Begriffe, Klassifikationen<br />
2. Methodisches Vorgehen<br />
3. <strong>Gruppen</strong>größe und -zusammensetzung<br />
4. <strong>Gruppen</strong>kohäsion und Leistung<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
1. BEGRIFFE, KLASSIFIKATIONEN<br />
Masse<br />
Typologie sozialer Gebilde (vgl. SCHÄFERS)<br />
Menge<br />
(Ansammlung,<br />
Aggregat)<br />
Gesamtheit von Personen ohne Verabredung<br />
(i.d.R. ohne intensive Kommunikation) an einem Ort;<br />
Kriterium: räumliche Nähe<br />
Bsp.: Fahrgäste eines Busses, Publikum in einem<br />
Kino, Schlange an einer Kasse...<br />
kann übergehen in interagierende Masse bzw. sich herausbildende Gruppe<br />
dichtgedrängte Menge von Menschen, die sich <strong>im</strong><br />
Hinblick auf ein sehr reduziertes Ziel verständigt und<br />
interagiert<br />
Bsp.: Groß-Demonstration, Stadion-Besucher;<br />
Einzelner geht in “Anonymität der Masse” unter, damit<br />
können unkalkulierbare, irrationale Aktionen entstehen<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Institution<br />
Organisation<br />
BEGRIFFE, KLASSIFIKATIONEN (2)<br />
seit Herbert Spencer (1820 – 1903) u. Emile Durkhe<strong>im</strong> (1858 –<br />
1917) einer der wichtigsten Begriffe der Soziologie –<br />
bezeichnet meist „Grund-Einrichtungen der menschlichen<br />
Existenz und Daseins-Fürsorge“;<br />
Institutionen sichern („regulieren“) u.a. Sozialisation des<br />
Nachwuchses (Familie), Schutz (Justiz), Weitergabe von<br />
Normen und Werten, Fähigkeiten und Wissen einer Kultur und<br />
Gesellschaft (Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen)...<br />
ein- und dasselbe soziale Gebilde (z.B. Familie) kann also<br />
sowohl vorrangig als Gruppe wie auch als Institution analysiert<br />
werden)<br />
Sozialgebilde mit hohem Grad an Formalisierung von Zielen<br />
und Mitteln; klar strukturierte Anordnungs- und<br />
Kompetenzstruktur, meist streng hierarchisch aufgebautes<br />
Rollendifferential und klare Abgrenzung nach außen<br />
Bsp.: Verwaltung, Militär, Krankenhaus<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Assoziation<br />
Gesellschaft<br />
BEGRIFFE, KLASSIFIKATIONEN (3)<br />
Zusammenfassung mehrerer Organisationen, Institutionen,<br />
<strong>Gruppen</strong> zu Zweckverbänden, nicht Einzelpersonen als<br />
Mitglieder, sondern als Vertreter, <strong>im</strong> Auftrag ihrer<br />
Gruppierungen<br />
Bsp.: Genossenschaften, Verbände<br />
Seit Entwicklung der bgl. Gesellschaft i.d.R. identisch mit der<br />
Gesamtheit der Institutionen, Organisationen, Assoziationen,<br />
<strong>Gruppen</strong> in ihrem Bezug zueinander in einem best<strong>im</strong>mten<br />
Territorium (Nation, Staat);<br />
Gesellschaft ist als soziales Gebilde nicht unmittelbar<br />
handlungsrelevant, wirkt aber auf die konkreten<br />
Handlungsbedingungen in allen anderen sozialen Gebilden<br />
strukturierend ein (Niklas Luhmann)<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
“Zweier-<br />
Gruppe”<br />
(Paar, Dyade)<br />
Kleingruppe<br />
(Definition s.u.)<br />
Großgruppe<br />
BEGRIFFE, KLASSIFIKATIONEN (4)<br />
<strong>Gruppen</strong><br />
kleinste soziale Einheit mit sehr komplexen sozialen und<br />
psychischen Wechselbeziehungen (Leopold von Wiese, 1933)<br />
Bsp.: typische Paare: Liebespaar, Freundespaar, Ehepaar<br />
Atypische Paare: Vorgesetzter - Untergebener, Trainer -<br />
<strong>Sport</strong>lerin<br />
Bsp.: Familie, Freundesgruppe (auch Clique, Bande),<br />
<strong>Sport</strong>gruppe...<br />
soziale Formationen der Größe<br />
von über 25 bis ca. 500 – 1000 Personen<br />
Bsp.: Colleges, He<strong>im</strong>e u. andere “Anstalten, Gemeinden<br />
dieser Größe (Claessens, 1977)<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Soziologie der Gruppe ist vorrangig<br />
Soziologie der Kleingruppe<br />
Definition:<br />
Eine soziale Gruppe umfasst eine best<strong>im</strong>mte Zahl von<br />
Mitgliedern (<strong>Gruppen</strong>mitglieder), die zur Erreichung eines<br />
best<strong>im</strong>mten Ziels (<strong>Gruppen</strong>ziel) über längere Zeit in einem<br />
relativ kontinuierlichen Kommunikations- und<br />
Interaktionsprozeß stehen und ein Gefühl der<br />
Zusammengehörigkeit (Wir-Gefühl) entwickeln.<br />
Zur Erreichung des <strong>Gruppen</strong>ziels und zur Stabilisierung der<br />
<strong>Gruppen</strong>identität ist ein System gemeinsamer Normen und<br />
eine Verteilung der Aufgaben über ein gruppenspezifisches<br />
Rollendifferential erforderlich.<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
SCHÄFERS, 1995
Definitionselemente:<br />
⇒ best<strong>im</strong>mte Zahl von Mitgliedern (bei Kleingruppe zwischen drei<br />
und ca. 25 Personen)<br />
⇒ längerfristiges ngerfristiges Zusammenwirken<br />
⇒ gemeinsames <strong>Gruppen</strong>ziel (für Gruppe insgesamt wie für jedes<br />
einzelne Mitglied)<br />
⇒ “Wir Wir-Gef Gefühl hl” der <strong>Gruppen</strong>zugehörigkeit und des <strong>Gruppen</strong>zusammenhalts<br />
(führt zu Unterscheidung der Eigengruppe von<br />
Fremdgruppen - <strong>Gruppen</strong>-Solidarität innerhalb der Eigengruppe,<br />
Fremdgruppen können als Bezugsgruppen ebenfalls großen<br />
Einfluss auf Verhalten ausüben – Abgrenzung)<br />
⇒ System gemeinsamer Normen und Werte als Grundlage der<br />
Kommunikations- und Interaktionsprozesse;<br />
gemeinsame Sprache, oft mit gruppenspezifischen Zügen (auch<br />
“<strong>Gruppen</strong>jargon”)<br />
⇒ Geflecht aufeinander bezogener sozialer Rollen (Rollendifferential)<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Weitere Klassifizierungsmerkmale<br />
Merkmal<br />
Anzahl<br />
Sozialisation<br />
Formalisierungs-<br />
grad<br />
Zugehörigkeit<br />
Zugehörigkeits-<br />
modus<br />
Kleingruppe<br />
Pr<strong>im</strong>ärgruppe<br />
Formelle Gruppe<br />
Eigengruppe<br />
Freiwillige Gruppe<br />
Begriffspaar<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
Großgruppe<br />
Sekundärgruppe<br />
Informelle Gruppe<br />
Fremdgruppe<br />
Zwangsgruppe
2. METHODISCHES VORGEHEN<br />
Als Methode zur Analyse von Kleingruppen findet<br />
(neben <strong>Gruppen</strong>diskussionen) vorrangig die SOZIOMETRIE Anwendung,<br />
( von MORENO 1934 erstmals vorgestellt)<br />
Sie dient der Messung von gruppeninternen Beziehungsstrukturen und<br />
liefert recht präzise Auskünfte über:<br />
1. die Struktur einer Gruppe, z.B. der Grad ihrer Integration und<br />
Offenheit nach außen<br />
2. die Stellung Einzelner in der Gruppe, z.B. ihren Status oder den<br />
Grad ihrer Isolation<br />
3. die informelle Struktur von <strong>Gruppen</strong><br />
Voraussetzungen:<br />
nicht zu große Gruppe, Mitglieder müssen durch einige Interaktionen<br />
miteinander bekannt sein;<br />
Mehrd<strong>im</strong>ensionalität der Beziehung erfordert genaue Ableitung der zu<br />
untersuchenden Kriterien,<br />
Zu- oder Abneigung bezieht sich jeweils nur auf die gestellte Frage<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Aktive Wahl<br />
Namen<br />
Michael<br />
Philipp<br />
Torsten<br />
Bastian<br />
Gerald<br />
Jens<br />
Oliver<br />
Erhaltene<br />
Wahlen<br />
Michael<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
5<br />
Philipp<br />
+<br />
+<br />
+<br />
3<br />
Soziomatrix<br />
Passive Wahlen<br />
Torsten<br />
+<br />
-<br />
-<br />
+<br />
+<br />
3<br />
Bastian<br />
+<br />
1<br />
Gerald<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
+<br />
+<br />
-<br />
2<br />
Jens<br />
-<br />
0<br />
Oliver<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0<br />
Abgegebene<br />
negative<br />
Wahlen<br />
0<br />
0<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2
Säulendiagramm zur Matrix<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
Michael Philipp Torsten Bastian Gerald Jens Oliver<br />
erhaltene Wahl 5 3 3 1 2 0 0<br />
erhaltene Ablehnung 0 0 -2 0 -1 -1 -4<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
D<br />
E<br />
A<br />
C<br />
F<br />
Soziogramm<br />
B<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
A bis F: <strong>Gruppen</strong>mitglieder<br />
Wahl<br />
Gegenseitige Wahl<br />
Ablehnung<br />
Gegenseitige Ablehnung
3. <strong>Gruppen</strong>größe und Zusammensetzung<br />
- Größe einer Gruppe verändert Interaktionen und<br />
Effizienz<br />
- Mit steigender Anzahl von <strong>Gruppen</strong>mitgliedern<br />
steigender Grad an Organisiertheit und Strukturiertheit<br />
In Diskussions- und Problemlösegruppen reduziert sich<br />
die Zahl der Redebeiträge auf <strong>im</strong>mer weniger Personen,<br />
die dafür um so aktiver sind<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
<strong>Gruppen</strong>größe und Leistung<br />
In <strong>Gruppen</strong> mit motorischer Aufgabenstellung Phänomen,<br />
dass individuelle Leistung um so kleiner wird,<br />
je größer die Gruppe ist<br />
Beispiel Tauziehen:<br />
bei acht <strong>Gruppen</strong>mitgliedern nur<br />
noch knapp 50 Prozent der<br />
möglichen Einzelleistung<br />
� Leistung steigt, je kleiner die<br />
Gruppe = Ringelmann-Effekt)<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
Olympische Spiele, Antwerpen 1920
Effekt des relativ sinkenden Beitrages des<br />
einzelnen <strong>Gruppen</strong>mitgliedes wird<br />
zurückgeführt auf :<br />
1. fehlende Koordination der Interaktionen und Handlungen der<br />
einzelnen <strong>Gruppen</strong>mitglieder – kommt um so stärker zum<br />
Tragen, um so wichtiger Abst<strong>im</strong>mung ist<br />
2. Motivationsverlust, da der individuelle Beitrag des einzelnen<br />
<strong>im</strong>mer weniger erkennbar und relativ unwichtiger wird, je mehr<br />
beteiligt sind; Gefühl “Rädchen <strong>im</strong> Getriebe” zu sein, daraus<br />
resultierender Trittbrettfahrer-Effekt,<br />
hinzu kommt oft ungleich verteilte Leistungszuschreibung (bes.<br />
in Ballsportarten, auch Radsport)<br />
⇒ Für Gelingen in einer <strong>Sport</strong>gruppe ist somit wichtig, dass jeder<br />
Einzelne sich dafür verantwortlich fühlen kann und entsprechend<br />
anerkannt und belohnt wird<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
4. GRUPPENKOHÄSION GRUPPENKOH SION UND LEISTUNG<br />
Definition:<br />
Unter <strong>Gruppen</strong>kohäsion (<strong>Gruppen</strong>zusammenhalt) versteht man die<br />
Stärke des Wunsches aller Mitglieder in der Gruppe zu bleiben.<br />
Sie repräsentiert somit das Ausmaß, in dem die Mitglieder eine<br />
soziale Bindung an die Gruppe entwickeln.<br />
Zu unterteilen in:<br />
→ aufgabenorientierte Kohäsion (<strong>im</strong> Zusammenhang mit den<br />
sportlichen Zielen)<br />
→ Beziehungsorientierte Kohäsion (Entwicklung und<br />
Aufrechterhaltung harmonischer interpersoneller Beziehungen)<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
„Elf Freunde müsst ihr sein“?<br />
Wirkung von Kohäsion auf Leistung<br />
Kohäsion (aufgabenbezogen) wirkt positiv auf Mannschaftsleistung,<br />
wo es sich um Mannschaften mit interdependenter<br />
Aufgabenstruktur handelt (d.h. gegenseitige Abst<strong>im</strong>mung und<br />
Koordination der Handlungen, hohes Maß an Interaktion erforderlich<br />
wie etwa Ballsportarten, Eiskunstlauf-Paare, Tanzen).<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
„Elf Freunde müsst ihr sein“?<br />
Wirkung von Kohäsion auf Leistung<br />
Bei Mannschaften mit independenter Aufgabenstruktur<br />
(wenn Mitglieder kaum voneinander abhängig sind und mehr oder<br />
weniger nebeneinander agieren - koagierende <strong>Gruppen</strong>)<br />
steht Kohäsion nicht notwendig mit Leistung <strong>im</strong> Zusammenhang,<br />
es zeigt sich kein oder ein negativer Zusammenhang<br />
(z.B. Mannschaftswettbewerbe in Individualsportarten).<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Einflussfaktoren auf Kohäsion<br />
Kohäsionsfördernd<br />
Häufigkeit der Interaktion<br />
Erfolg und Anerkennung<br />
Attraktivität u. Homogenität<br />
Intergruppen- Wettbewerb<br />
Einigkeit über <strong>Gruppen</strong>ziel<br />
nach STAEHLE 1990<br />
<strong>Gruppen</strong>größe<br />
Einzelkämpfer<br />
Zielkonflikte<br />
Misserfolge<br />
Grundlagen der <strong>Sport</strong>soziologie<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
Kohäsionshemmend<br />
Individuelle<br />
Leistungsbewertung<br />
Intragruppen- Wettbewerb