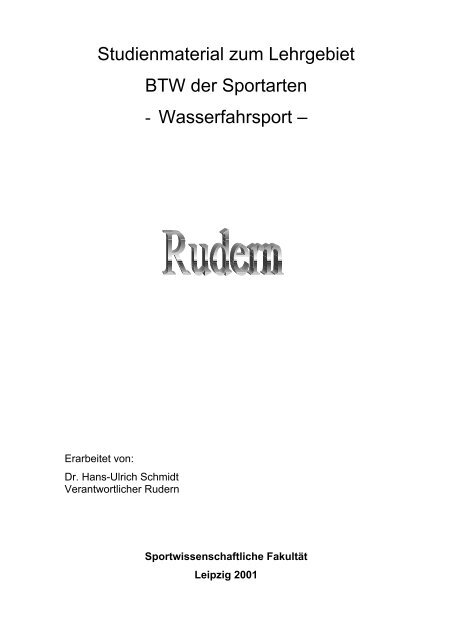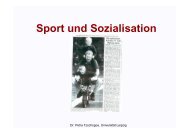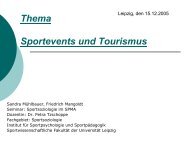Studienmaterial zum Lehrgebiet - Sportwissenschaftliche Fakultät ...
Studienmaterial zum Lehrgebiet - Sportwissenschaftliche Fakultät ...
Studienmaterial zum Lehrgebiet - Sportwissenschaftliche Fakultät ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Studienmaterial</strong> <strong>zum</strong> <strong>Lehrgebiet</strong><br />
Erarbeitet von:<br />
Dr. Hans-Ulrich Schmidt<br />
Verantwortlicher Rudern<br />
BTW der Sportarten<br />
- Wasserfahrsport –<br />
<strong>Sportwissenschaftliche</strong> <strong>Fakultät</strong><br />
Leipzig 2001
2<br />
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
1. Gerätekunde .................................................................................. 4<br />
1.1 Bootsarten und Bootsgattungen ..................................................... 4<br />
1.2 Ruderwerk ...................................................................................... 6<br />
1.3 Steuer und Steuerplatz .................................................................. 7<br />
1.4 Riemen und Skull ........................................................................... 8<br />
2. Trimmen ......................................................................................... 9<br />
2.1 Eintauchtiefe .................................................................................. 9<br />
2.2 Stemmbretteinstellung .................................................................... 10<br />
2.3 Dollenhöhe ..................................................................................... 10<br />
2.4 Anlage ............................................................................................. 11<br />
2.5 Übersetzungsverhältnis ................................................................... 11<br />
3. Rudertechnik ................................................................................... 12<br />
3.1 Struktur der Ruderbewegung .......................................................... 12<br />
3.2 Technik des Skullens ...................................................................... 13<br />
3.2.1 Grifffassung und Skullführung ......................................................... 13<br />
3.2.2 Technisches Leitbild ........................................................................ 14<br />
3.2.3 Elementare Merkmale des Ruderschlages ..................................... 16<br />
3.2.4 Kurshalten ....................................................................................... 16<br />
4. Ruderkommandos ........................................................................... 17<br />
5. Methodik .......................................................................................... 18<br />
5.1 Zielstellung der Ausbildung ............................................................. 18<br />
5.2 Methodische Schritte ....................................................................... 19<br />
5.2.1 Bekanntmachen mit dem Gerät ...................................................... 19<br />
5.2.2 Handhabung und Zu-Wasser-Bringen des Bootes ......................... 20<br />
5.2.3 Ein- und Aussteigen und vorbereitende Tätigkeiten ....................... 20<br />
5.2.4 Bootsgewöhnungsübungen ............................................................ 22<br />
5.2.5 Skullen mit aufrechten Blättern ....................................................... 23<br />
5.2.6 Skullen mit Blattdrehung ................................................................. 23<br />
5.2.7 Fehler, Ursachen und Abhilfe ......................................................... 24<br />
5.2.8 Erlernen der Bootsmanöver ............................................................ 27<br />
6. Wanderrudern ................................................................................. 29<br />
6.1 Material und Zubehör ...................................................................... 29<br />
6.1.1 Boote .............................................................................................. 29<br />
6.1.2 Zubehör und andere wichtige Ausrüstungsgegenstände ............... 30
6.2 Vorbereitung der Wanderfahrt ........................................................ 30<br />
6.3 Fahrtdurchführung .......................................................................... 30<br />
6.3.1 Bootsobmann und Mannschaften .................................................. 30<br />
6.3.2 Gepäck und Beladen der Boote ..................................................... 31<br />
6.3.3 Fahrtordnung .................................................................................. 31<br />
6.3.4 Tageseinteilung und Rast ............................................................... 31<br />
6.3.5 Schleusen ....................................................................................... 32<br />
6.3.6 Verhalten bei Wind und Wellen ...................................................... 32<br />
6.3.7 Verhalten bei Kenterung und Vollschlagen .................................... 33<br />
6.4 Einige grundsätzliche Hinweise ...................................................... 33<br />
7. Wettkampfrudern ............................................................................ 33<br />
8. Zur historischen Entwicklung des Rudersports ............................... 34<br />
8.1 Zur Entwicklung des Frauenruderns ............................................... 36<br />
8.2 Zur Entwicklung des Rennruderns .................................................. 36<br />
9. Literatur ........................................................................................... 40<br />
3
1. Gerätekunde<br />
1.1 Bootsarten und Bootsgattungen<br />
4<br />
Nach der Bauweise und dem Zweck unterscheidet man zwei Arten von Ruderbooten.<br />
Rennboote und Gigs (Übungsboote)<br />
Entsprechend der Antriebsweise trennt man innerhalb jeder Art in Skullboote<br />
und Riemenboote.<br />
Ruderboote<br />
Skullboote Riemenboote<br />
Antrieb doppelseitig Antrieb einseitig durch<br />
Durch zwei Ruder (Skull) ein Ruder (Riemen)<br />
Kombinierte Boote<br />
- für Übungszwecke mit Doppeldolle –<br />
Für die Bezeichnung der einzelnen Boote wird der Begriff Bootsgattungen ver-<br />
wendet.<br />
Bei den Renbooten werden folgende Bootsgattungen gefahren:<br />
Frauen Männer<br />
Skullboots- Einer (1 x) Einer (1 x) 1)<br />
gattungen Doppelzweier (2 x) Doppelzweier (2 x)<br />
Doppelvierer (4 x) Doppelvierer (4 x)<br />
o. Stfr. o. Stm.<br />
Riemenboots- Zweier o. Stfr. (2 -) Zweier o. Stm. (2 -)<br />
gattungen Vierer o. Stfr. (4 -) Zweier m. Stm. (2 +)<br />
Achter (8 +) Vierer o. Stm. (4 -)<br />
Vierer m. Stm. (4 +)<br />
Achter (8 +)<br />
_________<br />
1)<br />
Kürzel für die Bootsgattungen
5<br />
Nach den Bestimmungen der Internationalen Vereinigung der Ruderverbände<br />
(FISA) sind für Rennboote keinerlei bestimmte Abmessungen jedoch Mindestgewichte<br />
vorgeschrieben.<br />
Abmessung und Bootsmassen der Rennboote<br />
Bootsgattung Länge (m) 1) Breite (m) 1) Bootsgattung Bootsmassen (kg)<br />
Mindestgewicht<br />
1 x 8.00 0.29 1 x 14.0<br />
2 x und 2 - 9.90 0.35 2 x 26.0<br />
2 + 10.00 0.35 2 - 27.0<br />
2 – und 4 x 12.50 0.49 2 + 32.0<br />
4 + 13.25 0.49 4 x 52.0<br />
8 + 17.00 0.57 4 - 50.0<br />
4 + 51.0<br />
8 + 93.0<br />
1) Bei Länge und Breite handelt es sich um Orientierungswerte, die nicht eingehalten<br />
werden müssen!<br />
Rennboote und Gigs unterscheiden sich durch folgende wesentliche Merkmale:<br />
- Breiter, kürzer, schwerer<br />
- Außen und Innenkiel<br />
- Durchgehende Dollbordplanke<br />
- Offener Bootsraum<br />
(oder teilweise Verdeck)<br />
- Decksprung<br />
- Hecksteuer<br />
Gig Rennboot<br />
- Schmaler, länger, leichter<br />
- Innenkiel und Flosse<br />
- Waschbord und Wellenbrecher<br />
- Luftkästen Bug und Heck<br />
- Kielsprung<br />
- Flossensteuer<br />
Die Gigs sind genormt und unterliegen festgelegten Bauvorschriften. Nach den<br />
Konstruktionsmerkmalen und festgelegten Mustern werden die Gigs in die Arten<br />
A, B, C, D und E unterteilt.
6<br />
Bauarten der Übungsboote<br />
A B C D E<br />
geklinkert o,78 m breit glatte Außenhaut 0,90 m breit<br />
(Schalenbauweise) - parallele Bordwände<br />
- glatte Außenhaut<br />
1 m breit<br />
Die angegebenen Maße sind für Zweier und Vierer zutreffend. Bei den geklinkerten<br />
Booten (A,B) sind Planken dachziegelförmig übereinandergesetzt und an<br />
den Spanten befestigt. Diese Boote sind sehr materialaufwendig und sehr<br />
schwer. Sie werden in Deutschland nicht mehr gebaut.<br />
Bei den Schalenbooten wird die Außenhaut aus Sperrholz oder Kunststoff gefertigt.<br />
1.2 Ruderwerk<br />
Die Ruderplätze im Boot sind vom Bug <strong>zum</strong> Heck hin durchnumeriert, d. h.,<br />
Platz 1 ist der Bugplatz. Der gesamte Ruderplatz hat eine Länge von 1,30 m in<br />
der Gig und 1,40 m im Rennboot. Er setzt sich zu gleichen Teilen aus dem Fußraum<br />
und dem Rollraum zusammen.<br />
Als Ruderwerk werden alle Teile am Ruderplatz bezeichnet, die zur Bewegungsausführung<br />
notwendig sind.<br />
Zum Ruderwerk gehören:<br />
- Rollbahn<br />
- Rollsitz<br />
- Stemmbrett<br />
- Ausleger<br />
- Dollen<br />
Am Rollsitz angebrachte Sicherungswinkel greifen unter die Rollbahnen und<br />
verhindern das Herausfallen beim Drehen des Bootes oder beim Kentern. Das<br />
Stemmbrett kann entsprechend der Beinlänge des Ruderers verstellt werden.
7<br />
Bei den Auslegern gibt es sehr unterschiedliche Formen, die auch verschiedenartig<br />
am Boot befestigt sind. Sie werden überwiegend aus Leichtmetallrohr oder<br />
bei Rennbooten auch aus hochfesten Kunststoffen gefertigt.<br />
Bei den Dollen unterscheidet man:<br />
- Skulldollen<br />
- Riemendollen<br />
- Doppeldollen<br />
Skull- und Riemendollen bei Rennbooten haben immer einen Sicherungsbügel,<br />
mit dem die Dollen geschlossen werden. Doppeldollen gibt es nur bei den Gigs.<br />
Sie haben den Vorteil, dass damit geriemt und geskullt werden kann.<br />
1.3 Steuer und Steuerplatz<br />
Bei den Steuern unterscheidet man zwischen Hecksteuer und Flossensteuer.<br />
Die Hecksteuer werden durch entsprechende Halterungen am Boot befestigt.<br />
Da sie nur mit einem kleinen Teil der Fläche im Wasser sind, haben sie einen<br />
ungünstigen Wirkungsgrad.<br />
Bei Rennbooten werden ausschließlich<br />
Flossensteuer (Abb. 1) verwendet.<br />
Dieses Steuer ist voll vom Wasser umgeben,<br />
und dadurch erhöht sich der<br />
Wirkungsgrad bei Steurerausschlägen<br />
erheblich.<br />
Der Sitz des Steuerplatzes im Rennboot<br />
soll so tief wie möglich sein, damit<br />
eine günstige Schwerpunktlage des<br />
Bootes erreicht und der Luftwiderstand<br />
des Steuermanns verringert wird.<br />
Abb. 1: Heckwärts versetztes<br />
Flossensteuer<br />
Deshalb ist die liegende Unterbringung des Steuermannes im vorderen Luftkasten<br />
des 2 + und des 4 + am günstigsten.
1.4 Riemen und Skull<br />
Der Ausdruck „Riemen“ stammt aus dem Lateinischen:<br />
remus = Ruder, remigo = ich rudere.<br />
8<br />
Dagegen ist „Skull“ dem Englischen shell = Muschel entlehnt.<br />
Für Riemen und Skull verwenden wir den Begriff „Ruder“. Im Gegensatz dazu<br />
werden im Segelsport und in der Schifffahrt ausschließlich die Steuer als „Ruder“<br />
bezeichnet.<br />
Abb. 2: Bezeichnungen der Teile von Riemen und Skull (a),<br />
Querschnitte durch den hohlen Schaft (b),<br />
Neuere Ruder aus Kohlefaser (c)
9<br />
Die Bezeichnungen der Teile des Ruders sind in Abb. 2 angegeben. Für den<br />
Klemmring, früher aus Aluminium, wird heute nur noch Kunststoff verwendet.<br />
Die Manschette unter dem Klemmring schützt das Ruder bei der Ruderbewegung.<br />
Die Länge der Riemen liegt zwischen 3.78 und 3.85 m, die der Skull zwischen<br />
2.94 und 3.00 m je nach Altersklasse (Jugend und Senioren) und Geschlecht.<br />
Kinderskull sind 2.85 m lang. Die Abmessungen der Blätter sind für Schüler,<br />
Jugendliche, Männer und Frauen unterschiedlich.<br />
2. Trimmen<br />
Der Begriff Trimmen entstammt der Seefahrt. Im Rudersport versteht man unter<br />
Trimmen die Anpassung des Ruderplatzes an die individuellen Besonderheiten<br />
des einzelnen Sportlers. Er soll sich auf seinem Platz wohlfühlen und seine<br />
Kraft voll <strong>zum</strong> Antrieb des Bootes einsetzen können.<br />
Die Haupttätigkeiten beim Trimmen sind:<br />
- Ausmessen der Eintauchtiefe des Bootes bei voller Besatzung (Dollenhöhe<br />
über Wasser)<br />
- Einrichten der Stemmbretteinstellung nach der Beinlänge<br />
- Kontrolle der Dollenhöhe über Sitz<br />
- Überprüfung der Anlage des Blattes<br />
- Einstellen des Übersetzungsverhältnisses entsprechend der Konstitution<br />
und des Trainingszustandes des Ruderers sowie der äußeren Bedingungen<br />
2.1 Eintauchtiefe<br />
Jedes Boot hat dann den geringsten Wasserwiderstand, wenn es genau bis zur<br />
berechneten Konstruktionswasserlinie (KWL) eintaucht. Deshalb werden Boote,<br />
vor allen Dingen Rennboote, für bestimmte Mannschaftsmassen konstruiert.<br />
Damit ist dann auch gewährleistet, dass ein entsprechender Abstand zwischen<br />
Eintauchtiefe/Wasserlinie und der Auflage der Ruder in der Dolle vorhanden ist.
10<br />
Um einen einwandfreien Durchzug zu ermöglichen, muss dieser Abstand beim<br />
Skullen 20,5 cm und beim Riemenrudern 22 cm betragen.<br />
Diese Maße lassen sich leicht mit einem Messstreifen von der Wasseroberfläche<br />
bis zur Oberkante der Dollenauflage kontrollieren.<br />
2.2 Stemmbretteinstellung<br />
Das Stemmbrett nimmt den Beinstoß auf. Je weiter das Stemmbrett von der<br />
Rollbahn entfernt eingestellt ist, um so größer ist der Arbeitssektor vor (bugwärts)<br />
der Dolle. Der Endzug dagegen wird kürzer. Umgekehrt wird der Endzug<br />
länger, wenn das Stemmbrett näher <strong>zum</strong> Rollbahngerüst eingestellt wird. Die<br />
Stemmbretteinstellung beim Skullen ist dann richtig, wenn man in der Rücklage<br />
mit abgespreizten Daumen am Körper vorbeiziehen kann.<br />
2.3 Dollenhöhe<br />
Als Dollenhöhe wird der vertikale Abstand der Dolle über der Rollsitzebene bezeichnet.<br />
Der Normalwert der Dollenhöhe über Rollsitz beträgt<br />
- bei Riemenbooten 15,0 cm,<br />
- bei Skullbooten 13,5 cm (80 kg ∅ Masse) bzw. 15,5 cm (über 80 kg ∅ Mas-<br />
se)<br />
Die Messpunkte sind einmal der tiefste Punkt der Rollsitzfläche, <strong>zum</strong> anderen<br />
die für das Ruder bestimmte Auflagefläche der Dolle. Beim Messen muss der<br />
Rollsitz am heckwärtigen Ende der Rollbahn stehen.<br />
Zum Messen der Dollenhöhe verwendet<br />
man in der einfachen Form eine<br />
gerade Leiste mit einem rechten Winkel<br />
an einem Ende (Abb. 3).<br />
Der Abstand Bordwand bis zur Dolle<br />
wird am rechten Winkel gemessen.<br />
Der Abstand Rollsitz bis Unterkante<br />
der Leiste muss zusätzlich an einem<br />
Maßstab abgelesen werden.<br />
Abb. 3: Messen der Dollenhöhe über<br />
Rollsitz Die beiden Höhen a<br />
und b ergeben die Dollenhöhe.
2.4 Anlage<br />
11<br />
Bekanntlich steht das Blatt nicht senkrecht im Wasser. Die Abweichung von der<br />
Senkrechten wird mit dem Begriff Anlage bezeichnet. Mit Hilfe dieser Schrägstellung<br />
(die obere Kante ist dabei heckwärts geneigt) wird eine optimale Führung<br />
des Blattes im Wasser erreicht, so dass das Blatt sich immer prarallel zur<br />
Wasseroberfläche bewegen kann. Der Normalwert wird mit 8° (Dolle 4°, Ruder<br />
4°) angegeben. Das Nachmessen der Anlage erfolgt an Land mit Hilfe einer<br />
Anlagenlehre oder eines Lotes. Wird mit einem Lot gearbeitet, muss das Boot<br />
waagerecht auf den Böcken liegen. Ein Sportler drückt den Riemen oder das<br />
Skull gegen die Dolle, ein zweiter misst mit Hilfe eines von der oberen Blattkante<br />
herabhängenden Lotes und eines Maßes, das an der unteren Blattkante<br />
waagerecht angelegt wird, die Abweichung von der Senkrechten.<br />
Diese Abweichung hängt von der Blattbreite ab und soll bei normal breitem Blatt<br />
folgende Werte haben:<br />
Skullen 1,8 – 2,2 cm<br />
Riemenrudern 2,5 – 3,0 cm<br />
2.5 Übersetzungsverhältnis<br />
Der Dollenabstand (Mitte Boot bis Mitte Dollenstift) beträgt im Skullboot 78 cm.<br />
Für die einzelnen Riemenbootsgattungen gibt es unterschiedliche Werte (83,0<br />
cm – 85,5 cm).<br />
Der Dollenstift ist am Ausleger vertikal angebracht und trägt den Dollenkörper.<br />
Auf Grund des festgelegten Dollenabstandes ergibt sich ein entsprechendes<br />
Übersetzungsverhältnis (Innenhebel zu Außenhebel). Um eine störungsfreie<br />
Ruderbewegung zu gewährleisten müssen Innenhebel und Dollenabstand in<br />
einem direkten Verhältnis zueinander stehen. Die Länge des Innenhebels muss<br />
stets um folgende Werte größer sein als der Dollenabstand:<br />
Skullen 8 cm<br />
Riemenrudern 30 cm
3. Rudertechnik<br />
3.1 Struktur der Ruderbewegung<br />
12<br />
Rudern gehört zu den zyklischen Sportarten, d. h. es gehen gleichartige Bewegungen<br />
im fließenden Wechsel zwischen Spannung und Entspannung ineinander<br />
über.<br />
- Schlag oder Schlagzyklus nennt man den aus zwei Phasen, Haupt- und<br />
Zwischenphase (auch Antriebs- und Freilaufphase genannt), bestehenden<br />
Bewegungsablauf mit je einer bug- und heckwärts gerichteten Bewegung<br />
des Ruderers und des Ruders (Abb. 4).<br />
- Durchzug = Haupthase/Antriebsphase<br />
- Freilauf = Zwischenphase/antriebsfreie Phase<br />
- Das Wasserfassen / vordere Bewegungsumkehr und das Ausheben der<br />
Blätter / hintere Bewegungsumkehr sind die beiden Phasen verbindenden<br />
Übergänge, die man zur Zwischenphase rechnet. Diese Umkehrpunkte der<br />
Ruderbewegung sind fließend und harmonisch zu gestalten, weil der zügige<br />
Lauf des Bootes davon abhängt.<br />
Abb. 4: Phasenstruktur der Ruderbewegung:<br />
A – Hauptphase (Antrieb), Z – Zwischenphase<br />
(a – Ausheben, F – Freilauf, b – Wasserfassen),<br />
B – Bewegungsrichtungen des Ruderers
13<br />
- Rhythmus nennt man beim Rudern den ständigen Wechsel von Spannung<br />
und Entspannung, von Durchzug und Freilauf, die stets in einem bestimmten<br />
zeitlichen Verhältnis zueinander stehen. Rationell ist das Verhältnis dann,<br />
wenn die hohe Geschwindigkeit in der Freilaufphase voll zur Entfaltung<br />
kommen kann und der neue Antrieb jeweils erfolgt, bevor die Geschwindigkeit<br />
zu weit absinkt. In jedem Fall muss jedoch der Durchzug (Spannung)<br />
kürzer sein als der Freilauf (Entspannung), wenn der Bewegungsablauf<br />
ökonomisch sein soll.<br />
3.2 Technik des Skullens<br />
Die wesentlichen Merkmale der Rudertechnik werden am Beispiel des Skullens<br />
dargestellt, da die Anfängerausbildung stets mit dem Skullen beginnt.<br />
Sie gelten gleichermaßen für das Riemenrudern.<br />
3.2.1 Griffassung und Skullführung<br />
Beide Hände fassen die Skulls am äußersten<br />
Ende der Innenhebel (Griff). Die<br />
Daumen drücken gegen das Griffende<br />
(Hirnholz). Sie bewirken und kontrollieren<br />
ständig das sichere Anliegen des<br />
Klemmringes an der Dolle (Abb. 5).<br />
Bei aufgedrehtem Blatt (Durchzug) wird<br />
der Griff nur locker mit den Fingern umfasst.<br />
Dabei bilden Handrücken und<br />
Unterarm eine Ebene, das Handgelenk<br />
ist gerade, nicht abgewinkelt.<br />
Abb. 5: Grifffassen am Skull<br />
a - falsch<br />
b – richtig<br />
- Da sich die Griffe der Skulls im Mittelzug überlappen, wird die rechte Hand<br />
etwas vor und unter der linken Hand geführt, d. h. die rechte Hand ist dem<br />
Körper näher. Diese Handführung gilt auch für die Freilaufphase.
14<br />
3.2.2 Rudertechnik/Technisches Leitbild<br />
Vordere Bewegungsumkehr<br />
- weite, leicht vorgespannte Körpervorlage<br />
- volle Nutzung der Rollbahn, Unterschenkel senkrecht<br />
- natürlich gestreckte Arme und leicht vorgeschobene Schultern<br />
- durch leichtes Anheben der Arme völlig aufgedrehte Blätter nahe<br />
ans Wasser bringen<br />
- schnelles, spritzerarmes Eintauchen der Blätter<br />
Vorderzug<br />
- ganzkörperliche Einspannung zwischen Stemmbrett<br />
und Innenhebel<br />
- sofortige Druckaufnahme durch gleichzeitiges Strecken von Knie und Hüfte<br />
- Übertragung der Bein- und Rumpfkräfte über die gestreckten Arme auf den<br />
Innenhebel<br />
- achsengerechte Kopfhaltung<br />
Mittelzug<br />
- Weiterführung der Beinstreckung<br />
mit zunehmenden Rumpfeinsatz<br />
- Beginn des Armzuges, wenn Hände etwa auf Kniehöhe (Orthogonalstellung)<br />
- rechte Hand zieht unter und etwas vor der linken Hand<br />
- achsengerechte Kopfhaltung<br />
Endzug<br />
- weitere Rücknahme des Oberkörpers bis<br />
etwa 115°<br />
- volle Beugung der Arme und Zurücknahme der Schultern<br />
- Zugrichtung <strong>zum</strong> unteren Rippenbogen<br />
- Fixierung des Oberkörpers in der Rücklage
Hintere Bewegungsumkehr<br />
15<br />
- Fixierung des Oberkörpers in der Rücklage<br />
- Herunterdrücken der Innenhebel und Abkippen der Hände<br />
(beide Bewegungen gehen ineinander über)<br />
- Sofortiges Weiterführen der Hände über die Knie<br />
(Hände weg – so schnell wie sie herangezogen wurden)<br />
Vorrollen<br />
- Oberkörper folgt der Bewegung<br />
der Hände (Handführung wie beim Durchzug)<br />
- Rollbeginn, wenn Oberkörper senkrecht<br />
- gleichmäßiges und gleichzeitiges Beugen von Knie und Hüfte<br />
- freies Führen der Blätter über dem Wasser<br />
- gleichmäßiges Strecken der Handgelenke (Aufdrehen)<br />
- weiches Abbremsen der Rollbewegung
16<br />
3.2.3 Elementare Merkmale des Ruderschlages<br />
1. Langer Ruderschlag<br />
Vordere Bewegungsumkehr gleich Einsatz des Blattes; Blatt bleibt bis zur<br />
hinteren Bewegungsumkehr voll untergetaucht<br />
2. Schnelles Wasserfassen und sofortige Druckaufnahme<br />
3. Aufsteigende Übertragung hoher Muskelzugspannung bei vollgetauchtem<br />
Blatt (Knie-Hüftstreckung, Rumpf-, Arm- und Schultereinsatz); die Bewegung<br />
des Blattes im Wasser- und die Schwallbildung vor dem Blatt geben<br />
Orientierungen für die aufsteigende Kraftübertragung<br />
4. Wenig Vertikalbewegung von Oberkörper und Armen während der gesamten<br />
Ruderbewegung<br />
5. Einhaltung eines effektiven Bewegungsrhythmus. Dies betrifft sowohl das<br />
Verhältnis von Schlagfrequenz und Vortrieb, Durchzug und Freilauf sowie<br />
„Hände weg“ und Rollen.<br />
6. Widerstandsarme Ausführung der Umkehrphasen und des Freilaufs<br />
7. Gestaltung der gesamten Ruderbewegung im Durchzug und Freilauf mit<br />
gleichförmiger Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung. Große Geschwindigkeitsspitzen<br />
sind zu vermeiden.<br />
8. Gute mannschaftsinterne Koordination bei der Wasser- und Körperarbeit<br />
3.2.4 Kurshalten<br />
- Es ist Bestandteil einer optimalen Rudertechnik. Bei normalen äußeren Bedingungen<br />
wird es durch gleichmäßiges Ziehen auf beiden Bootsseiten erzielt.<br />
- Besatzungen steuermannsloser Boote orientieren sich nach ihrem Kielwasser,<br />
nach dem Ufer und auf Seen über 2 Fixpunkte. Auf verkehrsreichen<br />
Gewässern ist das Umsehen unumgänglich, zweckmäßigerweise kurz vor<br />
dem Ausheben der Blätter<br />
- Kurskorrektur erfolgt durch kräftiges Ziehen auf einer Bordseite, bzw. durch<br />
die Betätigung des Steuers.
4. Ruderkommandos<br />
17<br />
Die folgenden Kommandos sollten einheitlich von allen Ruderern angewandt<br />
werden und verbindlich für die Steuerleute sein.<br />
Auszuführende Tätigkeit<br />
Ankündigungskommando<br />
Tragen des Bootes Boot hebt<br />
zu Wasser<br />
in die Halle<br />
in die Lager<br />
Drehen des Bootes Mannschaft<br />
Boot zur Brust<br />
Kiel<br />
Ausführungskommando<br />
- hoch!<br />
- marsch!<br />
- marsch!<br />
- ab!<br />
- halt!<br />
- hoch!<br />
(Bezeichnung der Seite, nach<br />
der der Kiel bewegt wird)<br />
- dreht zur Brücke!<br />
(o.dgl.)<br />
Anordnung<br />
Auf Ausleger achten<br />
Oberschenkel unter<br />
das Boot<br />
Einsetzen des Bootes setzt - ab! Auf Kiel halten!<br />
Ein- und Aussteigen fertigmachen <strong>zum</strong><br />
Einsteigen<br />
fertigmachen <strong>zum</strong><br />
Aussteigen<br />
- steigt ein!<br />
- steigt aus!<br />
Vorwärtsrudern alles vorwärts - los! Fertigmeldung abwarten!<br />
Rudern beenden Ruder<br />
- halt!<br />
Blätter<br />
- ab!<br />
Stoppen im Anschluss<br />
an „Ruder halt!“<br />
stoppen - stoppt! Bei einseitigem<br />
Stoppen: Bordseite<br />
angeben!<br />
Rückwärtsrudern alles rückwärts - los!<br />
Wenden Wende über Steuerbord<br />
(Backbord)<br />
- los!
Auszuführende Tätigkeit<br />
Ruder parallel <strong>zum</strong><br />
Boot legen<br />
Ruder wieder vor den<br />
Körper führen<br />
18<br />
Ankündigungskommando<br />
Riemen (Skull)<br />
Riemen (Skull)<br />
Ausführungskommando<br />
- lang!<br />
- vor!<br />
Bei Wellen (Dampfer) Achtung, Wellen - hochscheren!<br />
Überziehen einer<br />
Seite<br />
z. B.: Backbord<br />
stärker, Steuerbord<br />
halbe Kraft!<br />
Weiterfahrt frei - weg!<br />
Verlangsamung der<br />
Fahrt<br />
- halbe Kraft!<br />
5. Methodik<br />
Anordnung<br />
Beim einseitigen<br />
Ausführen Bordseite<br />
angeben!<br />
Beim Erlernen der Rudertechnik gibt es verschiedene Möglichkeiten des methodischen<br />
Vorgehens. Die Zielstellung, die Voraussetzungen der Anfänger und<br />
die örtlichen Gegebenheiten sind dabei zu berücksichtigen.<br />
Kinder und Kugendliche sollten das Rudern so erlernen, dass sie künftig in verschiedenen<br />
Rennbootsgattungen das Skullen und Riemerudern beherrschen.<br />
Deshalb wird bei ihnen die Anfängerausbildung, bei günstigen örtlichen Voraussetzungen<br />
und entsprechenden Witterungsbedingungen, sofort im altersgemäßen<br />
Renneiner durchgeführt. Damit sind sie von Anfang an mit einem lagelabilen<br />
System vertraut.<br />
Bei Erwachsenen und ungünstigen örtlichen Bedingungen (Strömung, Schiffsverkehr,<br />
Wellen u. a.) wird die Anfängerausbildung in lagestabilen Gigs durchgeführt.<br />
Dieser Weg wird auch bei unserer Ausbildung beschritten.<br />
5.1 Zielstellung der Ausbildung<br />
Die Ruderausbildung erfolgt in Gig-Vierern mit Steuermann unter folgender<br />
Zielstellung:<br />
- Vertrautmachen mit Boot und Zubehör sowie Handhabung des Materials<br />
- stabile Rudertechnik bei mittlerem Krafteinsatz
19<br />
- Ausführung sämtlicher Bootsmanöver<br />
- Beherrschen der Ruderkommandos<br />
- Einführung in das Steuern<br />
- methodisches Vorgehen bei der Anfängerausbildung<br />
5.2 Methodische Schritte<br />
(1) Bekanntmachen mit dem Gerät<br />
(2) Handhabung und Zu-Wasser-Bringen des Bootes<br />
(3) Ein- und Aussteigen und vorbereitende Tätigkeiten<br />
(4) Bootsgewöhnungsübungen<br />
(5) Skullen mit aufrechten Blättern<br />
(6) Skullen mit Blattdrehung<br />
(7) Erlernen der Bootsmanöver<br />
5.2.1 Bekanntmachen mit dem Gerät<br />
- Erfassen der Hauptmerkmale zur Unterscheidung von Bootsarten und –<br />
gattungen (siehe Kap. 1)<br />
- Hinweise <strong>zum</strong> Wert des Bootsmaterials und <strong>zum</strong> sorgsamen Umgang<br />
- Erklären der Begriffe: Bug, Heck, Backbord, Steuerbord, Ausleger, Dolle,<br />
Stemmbrett, Rollsitz, Einsteigbrett<br />
- Erklären der Teile eines Skulls; Innen- und Außenhebel, Blatt, Blattrücken,<br />
Hals, Klemmring, Manschette mit darunterliegendem Keil, Griff<br />
- Hinweis zu Backbord- und Steuerbordskull und entsprechender Kennzeich-<br />
nung (Backbord – rot; Steuerbord – grün)<br />
- Fetten der Manschetten: gefettet wird an der Stelle, wo der Keil am dünsten<br />
ist und die Skulls beim Durchzug in der Dolle aufliegen<br />
- Tragen der Skulls: am Schwerpunkt, Blätter zeigen nach vorne<br />
- Ablegen der Skull am Steg mit dem Blattrücken nach oben; Manschetten<br />
dürfen nicht mit Sand in Berührung kommen.
20<br />
5.2.2 Handhabung und Zu-Wasser-Bringen des Bootes<br />
- Einteilen der Mannschaft: Jeder Ruderer erhält eine Nummer, beim Bug-<br />
mann mit 1 beginnend.<br />
- Tragen des Bootes: Nummer 3 und 4 tragen am Achterschiff, Nummer 1 und<br />
2 am Vorderschiff, der Steuermann oder Ausbilder am Bug. Auf das Kommando<br />
„Boot hebt – hoch“ wird das Boot aus dem Lager abgehoben und<br />
dann weggetragen.<br />
- Forderung beim Tragen: Gegenseitige Hilfe und Rücksichtnahme<br />
- Drehen des Bootes muss vor dem Einsetzen ins Wasser auf das Komman-<br />
do des Steuermanns erfolgen (vgl. Kap. 4)<br />
- Forderung beim Drehen des Bootes:<br />
� Genügend hochheben, damit die Dollen den Boden nicht berühren!<br />
� Zur Absicherung des Bootes Oberschenkel unterschieben!<br />
- Das Boot wird an der Gondelleiste getragen und über Kiel mit dem Heck<br />
zuerst ins Wasser geschoben. Dabei Boot auf Kiel halten, nicht seitlich abkippen<br />
lassen, damit die Bootshaut nicht beschädigt wird!<br />
- Einlegen der Skulls: freier Schenkel der Dolle muss <strong>zum</strong> Heck gedreht werden<br />
� Zuerst die landseitigen Skulls einlegen!<br />
� Skull mit flachgedrehtem Blatt am Hals in die Dolle einlegen, durchschieben<br />
bis der Klemmring an der Dolle anliegt; dann Blatt mit Rücken nach<br />
oben drehen, um Lackschicht zu schonen.<br />
� Die wasserseitigen Skulls werden nicht vollständig bis <strong>zum</strong> Klemmring an<br />
die Dolle geschoben, damit die Innenhebel auf dem stegseitigen Waschbord<br />
aufliegen können; Blattrücken nach unten!<br />
� Herausnehmen der Skulls erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.<br />
5.2.3 Ein- und Aussteigen und vorbereitende Tätigkeiten<br />
- Demonstrieren und Üben des Ein- und Aussteigens. Dabei Klemmringe bis<br />
an die Dolle schieben, äußere (wasserseitige) Hand fasst beide Griffe, innere<br />
(land- oder stegseitige) Hand ergreift den Waschbord. Der dem Boot nähere<br />
Fuß wird auf das Einsteigbrettchen gestellt. Dabei muss der Rollsitz
21<br />
bugwärts stehen (Abb. 6). Während das Körpergewicht über die Bootsmitte<br />
verlagert wird und der Ruderer sich behutsam über das Standbein auf den<br />
Sitz niederlässt, wird erst der stegseitige Fuß auf das Stemmbrett gesetzt,<br />
dann der andere (vgl. Abb. 7).<br />
Abb. 6: Beginn des Einsteigens Abb. 7: Niederlassen auf den Sitz<br />
- Verstellen der Stemmbretter. Vor dem Einstellen der Stemmbretter ist die<br />
Grundstellung zu erklären. Dabei sind die Beine und Arme fast gestreckt,<br />
der Oberkörper aufrecht in bequemer Haltung, die Hände mit den Griffen<br />
liegen dicht beieinander, die Blätter flach auf dem Wasser, lockere Grifffassung.<br />
Rechte Hand ist dem Körper näher als die linke und etwas unterhalb der linken.<br />
Diese Handführung gilt für Durchzug und Freilauf!<br />
� Die Kontrolle der Stemmbretteinstellung wird in der Endzugstellung bei<br />
senkrechtem Blatt durchgeführt.<br />
� Die Entfernung des Stemmbrettes ist entsprechend der Beinlänge so<br />
einzustellen, dass die am Griffende liegenden leicht abgespreizten Daumen<br />
den Körper in der Rücklage seitlich gerade berühren, wenn die<br />
Blätter völlig im Wasser sind.<br />
� Beim Verstellen liegen die Blätter flach auf dem Wasser und bewirken<br />
eine stabile Bootslage, wenn die Innenhebel zwischen Oberschenkel und<br />
Körper Halt finden. Die Füße werden auf das Dollbord gelegt.
22<br />
� Nach dem Einstellen werden die Füße mit den Lederriemen auf dem<br />
Stemmbrett befestigt. Die Ruderer nehmen die Grundstellung ein, geben<br />
die Fertigmeldung und erwarten die weiteren Anweisungen.<br />
5.2.4 Bootsgewöhnungsübungen<br />
Sie sollen dem Anfänger die Erkenntnis vermitteln, dass ein Ruderboot bei richtiger<br />
Handhabung der Skulls nicht kentern kann.<br />
- Wechselseitiges Senken und Heben der Innenhebel bringt Erfahrungen über<br />
die Reaktion des Bootes bei veränderter Hebelführung (Abb. 8).<br />
Abb. 8: Bootsgewöhnung: Heben und Senken der Innenhebel im Wechsel<br />
- Beide Griffe sind in der Grundstellung fest zusammenzuhalten. Der Steuermann<br />
versucht, das Boot durch Gewichtsverlagerung <strong>zum</strong> Schaukeln zu<br />
bringen.<br />
- Beide Griffe werden in der Grundstellung so weit wie möglich ins Boot gedrückt.<br />
Jetzt ist ein Schaukeln des Bootes möglich, da die Blattabstützung<br />
fehlt. Zu einer Kenterung kann es auch dabei nicht kommen, weil die flachen<br />
Blätter verhindern, dass das Boot weiter kippt als bis zur Schräglage.
5.2.5 Skullen mit aufrechten Blättern<br />
23<br />
- In den ersten Ausbildungseinheiten ist generell mit sehr wenig Krafteinsatz<br />
zu rudern.<br />
- Beginnen mit einseitigem Vorwärtsrudern ohne Rollen. Dabei wird der Griff<br />
der anderen Bordseite an der Hüfte festgehalten, das Blatt liegt flach auf<br />
dem Wasser.<br />
- Darauf folgt einseitiges Rudern im Wechsel ohne Rollen. Durch lockere<br />
Griffhaltung ist die Schwimmlage des Blattes im Wasser zu erfüllen.<br />
- Beidseitiges Vorwärtsrudern ohne Rollen folgt, sobald der Bewegungsablauf<br />
des einseitigen Ruderns in der Grobform beherrscht wird. Handführung beachten!<br />
- Beidseitiges Vorwärtsrudern mit Rollen wird eingeführt, wenn die Anfänger<br />
den Schlag lang ausziehen, die Handführung stimmt und das Boot ausbalanciert<br />
wird. Aus der Rücklage beginnen und sofort die gesamte Rollbahn<br />
nutzen.<br />
5.2.6 Skullen mit Blattdrehung<br />
Demonstrieren und Erklären der Bewegung am Steg.<br />
Erste Vorübung: Blattdrehung in der Grundstellung<br />
Die Blätter werden annähernd in 90°-Stellung frei über dem Wasser gehalten,<br />
die Handgelenke sind gestreckt. Durch ein Abwinkeln der Handgelenke nach<br />
unten, verbunden mit einem Lockern der Hände, drehen sich die Skulls über die<br />
abgerundete Kante. Der Anfänger beobachtet und erfühlt, wie die gerade Seite<br />
des Ruderschaftes auf die Dollenauflage aufgleitet. Diese Teilbewegung wird<br />
mehrfach wiederholt.<br />
Zweite Vorübung: Kombination des Aushebens mit der Blattdrehung<br />
In Endzugstellung werden die Innenhebel nach unten gedrückt, gedreht und bis<br />
zu den Knien geführt. Das ist wichtig, damit sich der Anfänger von vornherein<br />
daran gewöhnt, ohne Pause die Innenhebel vom Körper weg heckwärts zu füh-
24<br />
ren. Wenn die ganze Mannschaft die Vorübung einheitlich und richtig ausführt,<br />
kann man mit der Blattdrehung rudern lassen. Die Blätter sind allmählich aufzudrehen,<br />
sobald die Innenhebel über die Knie geführt wurden. Auf dieser Forderung<br />
sollte man zunächst bestehen, da die Kombination Blattdrehung/Einsatz<br />
vorerst schwierig ist. Stehen jedoch die Blätter etwa zu Beginn der zweiten<br />
Hälfte des Luftweges aufrecht, so kann sich der Anfänger voll auf den Einsatz<br />
konzentrieren. Nach einigen Übungsstunden drehen die Anfänger die Blätter<br />
meist ganz von selbst später auf.<br />
5.2.7 Fehler, Ursachen und Abhilfe<br />
Beim Erlernen der Grobform treten häufig folgende Fehler auf:<br />
1. Fehler in der Wasserarbeit<br />
Zu tiefer Durchzug<br />
Ursache a): Das Blatt wird nicht voll aufgedreht ins Wasser gebracht<br />
(Einschneiden).<br />
Abhilfe: Griffe locker fassen! Zeitiger aufdrehen! Blatt beobachten!<br />
Ursache b): In Zeitlupentempo parallele Schwimmlage des Blattes zur<br />
Wasseroberfläche einhalten! Wenig Kraft einsetzen!<br />
Hängenbleiben beim Ausheben (Krebsen)<br />
Ursache: Das Blatt wird vor dem Ausheben schon im Wasser gedreht.<br />
Abhilfe: Zweite Vorübung wiederholen lassen!<br />
Zu kurzer Schlag<br />
Ursache a): die Innenhebel werden nicht bis an den Körper geführt,<br />
Schultern nicht zurückgenommen.<br />
Abhilfe: Selbstkontrolle, dass die Daumen im Endzug den Körper<br />
berühren!
25<br />
Ursache b): Auswaschen beim Endzug, Innenhebel werden an den<br />
Bauch oder gar zu den Oberschenkeln geführt (Abb. 9).<br />
Abb. 9: Auswaschen im Endzug<br />
Abhilfe: Mit den Augen kontrollieren, ob das Blatt im Endzug voll im<br />
Wasser ist. In dieser Lage Stellung der Innenhebel am Körper<br />
merken!<br />
Ursache c): Ungenügende Vorlage.<br />
Abhilfe: Aufforderung zur maximalen Ausnutzung der Rollbahn. Anstoß<br />
an Heckstopper einige Male spüren lassen! Beugestellung<br />
der Beine kontrollieren! Arme strecken!<br />
Ursache d): Zu geringe Rücklage.<br />
Abhilfe: Rücklage übertreiben lassen!<br />
Ursache e): Skulls werden bei Vor- oder Rücklage aus der Dolle gezogen.<br />
Abhilfe: Mit dem Daumen den Griff gegen die Dolle drücken, damit<br />
der Klemmring immer dicht anliegt.
2. Fehler der Körperbewegung<br />
26<br />
Kisteschieben (Abb. 10)<br />
Ursache: Die Beine werden zu früh – extrem sogar vor dem Wasserfassen<br />
gestreckt oder der Oberkörper gibt im Durchzug nach.<br />
Abhilfe: Erst Oberkörper aufrichten, dann Beinstoß!<br />
Abb. 10: Kisteschieben<br />
Festhalten des Rollsitzes<br />
Ursache: Der Oberkörper wird aufgerichtet, die Arme ziehen, aber die Beine<br />
verbleiben zu lange in der Beugestellung und leisten somit keine<br />
Arbeit.<br />
Abhilfe: Den Ruderer hinter einen Sportler setzen, der den Beinstoß richtig<br />
ausführt. Den Rollsitz des Vordermanns beobachten und gleichmäßig<br />
mitrollen!<br />
Oberkörper fällt im Endzug über die Innenhebel<br />
Ursache: Ruderer meint einen schnellen Endzug auszuführen. Arme und<br />
Oberkörper führen eine gegenläufige Bewegung aus. Oder: zu<br />
schwache Bauchmuskulatur.<br />
Abhilfe: Zur Kontrolle, ob genügend Rücklage vorhanden ist, den Schlag<br />
nach dem Ausheben mehrfach abbrechen und in Rücklage verbleiben.<br />
Kopf hoch – Schultern zurück!
27<br />
Abducken des Oberkörpers vor dem Einsatz<br />
Ursache: Der Anfänger versucht, durch Vorwippen eine besonders weite<br />
Vorlage einzunehmen.<br />
Abhilfe: Dem Vordermann in den Nacken schauen, Rückenmuskulatur<br />
straffen!<br />
5.2.8 Erlernen der Bootsmanöver<br />
Folgende Bootsmanöver gibt es, die in unserer Ausbildung in der genannten<br />
Reihenfolge gelehrt werden:<br />
- Stoppen<br />
- Rückwärtsrudern<br />
- Lange Wende<br />
- Skull lang – Skull vor<br />
- An- oder Abpaddeln<br />
- Stoppen lehrt man als erstes und wichtigstes Bootsmanöver. Nach den<br />
Kommandos „Ruder halt“ und „Blätter ab“ liegen die Blätter in ihrer Grundstellung<br />
flach auf dem Wasser. Auf das Kommando „Stoppen“ werden beide<br />
Innenhebel angehoben. Dadurch tauchen die flachen Blätter und ein Teil der<br />
Schäfte ins Wasser ein und bewirken ein erstes Abstoppen der Bootsgeschwindigkeit.<br />
Bei „Stoppt“ werden die Blätter mit dem Blattrücken <strong>zum</strong><br />
Heck aufrecht gestellt, so dass das Boot völlig <strong>zum</strong> Stillstand kommt. In<br />
Gefahrenmomenten wird das aufrechte Blatt sofort eingetaucht. Arme sind<br />
dabei gestreckt.<br />
- Rückwärtsrudern<br />
� Vorübung: Schleifen der Blätter auf dem Wasser vom Bug <strong>zum</strong> Heck.<br />
Dabei muss die heckwärtige Blattkante etwas angehoben werden, da<br />
das Blatt sonst unterschneidet.<br />
� Erst einseitig im Wechsel üben, ohne zu rollen, dann beidseitig.
� Ausgangsstellung: Rücklage<br />
28<br />
Die Griffe liegen am Körper, die Blätter sind voll im Wasser, die Blattrükken<br />
zeigen heckwärts. Diese Stellung nimmt man auf das Kommando<br />
„Alles rückwärts“ ein.<br />
� Auf das Kommando „Los“ schiebt man die Griffe mit lockerer Handfassung<br />
bis in die Vorlagestellung. Dann dreht man die Blätter aus dem<br />
Wasser heraus und schleift sie wieder auf dem Wasser zurück in die<br />
Ausgangsstellung <strong>zum</strong> Rückwärtsrudern.<br />
- Lange Wende<br />
� Ausgangsstellung: Rücklage<br />
Bei der Wende über Backbord rudern die Backbordruder rückwärts, wäh-<br />
rend die Steuerbordblätter auf dem Wasser schleifen (bugwärts). Dabei<br />
schiebt man beide Griffe gleichzeitig vom Körper weg und rollt heckwärts.<br />
Danach stellt man in der Vorlage die Steuerbordblätter aufrecht,<br />
die Backbordblätter dagegen liegen flach auf dem Wasser. Während<br />
man auf Steuerbord vorwärts rudert, schleift man die Blätter backbords<br />
auf dem Wasser.<br />
� Methodische Vereinfachung: Beide Skulls werden in der Vorlage gleichzeitig<br />
vom Körper weg gedreht! In der Rücklage <strong>zum</strong> Körper hin!<br />
� Anfangs sehr langsam üben, bis sich der Bewergungsablauf automatisiert<br />
hat.<br />
- Skull lang – Skull vor<br />
� Auf das Kommando „Skull lang“ werden die Innenhebel am Körper vorbeigeführt,<br />
so dass die Skulls parallel zur Bordwand schwimmen. Dabei<br />
liegen die Blätter flach auf dem Wasser, und die Griffe werden mit Ristgriff<br />
in gleicher Höhe festgehalten (Handrücken zeigt dabei nach oben).<br />
� Auf das Kommando „Skull vor“ werden die Innenhebel wieder vor den<br />
Körper geführt.<br />
� Beim Erlernen des Manövers übt man zunächst „Skull lang“ einseitig.<br />
Dabei bleiben die Blätter der anderen Seite flach auf dem Wasser liegen,<br />
um Balanceschwierigkeiten auf diese Weise ausgleichen zu können.<br />
� Sinn dieses Manövers ist ein „Schmalmachen“ bei Fahrten durch Hindernisse<br />
oder direkt am Ufer entlang.
- An- oder Abpaddeln<br />
29<br />
Es ist erforderlich, wenn man an einem bewachsenen Ufer anlegen bzw.<br />
ablegen will.<br />
� Als Ausgangsstellung für das Anpaddeln nimmt man „Skull lang“ auf einer<br />
Bordseite. Dabei werden die Blätter aufrecht gestellt, Blattrücken ist<br />
dem Boot abgekehrt. So führt der Ruderer kleine Schläge <strong>zum</strong> Boot hin<br />
durch.<br />
� Beim Abpaddeln ist der Blattrücken dem Boot zugekehrt. Der Ruderer<br />
macht kleine Schläge vom Boot weg.<br />
6. Wanderrudern<br />
Das Wanderrudern ist dadurch charakterisiert, dass längere Strecken gefahren<br />
werden und dabei das „Hausrevier“ verlassen wird. Sehr häufig dient das Wanderrudern<br />
auch <strong>zum</strong> Befahren und Erkunden völlig anderer und neuer Ruderreviere.<br />
Das Wanderrudern geht bis in die Anfänge des Ruderns in Deutschland zurück.<br />
Es gab sogar ausgesprochene Wanderrudervereine. Nicht Meister und Medaillen<br />
sind das Ziel, sondern in erster Linie die Auffrischung und Wiederherstellung<br />
der physischen und psychischen Kräfte und eventuell die Vorbereitung auf das<br />
Wettkampfrudern. Das Wanderrudern ist außerdem ein vorzügliches Mittel zur<br />
Aneignung wertvoller Charaktereigenschaften und Willensqualitäten. Darüber<br />
hinaus bietet das Wanderrudern allen Altersklassen Gelegenheit, sich sportlich<br />
zu betätigen.<br />
6.1. Material und Zubehör<br />
6.1.1 Boote<br />
Für das Wander- oder Fahrtenrudern sind grundsätzlich alle Arten der Übungsboote<br />
gut geeignet. Ihre Geräumigkeit ermöglicht auch noch den Transport des<br />
persönlichen Gepäcks. Manche Ruderreviere (Boddengewässer und offene<br />
See) sind aber nur mit speziellen Booten zu befahren, die durch ihre besondere<br />
Bauweise weniger wind- und wellenanfällig sind.
30<br />
6.1.2 Zubehör und andere wichtige Ausrüstungsgegenstände<br />
- 1-2 Fangleinen und 2 Bootshaken (davon wenigstens einer mit Paddelblatt)<br />
gehören in jedes Boot.<br />
- Wasserdichte Folien <strong>zum</strong> Abdecken des Gepäcks am Bug und Heck sowie<br />
wasserundurchlässige Säcke oder schwimmfähige Spezialbeutel zur Aufnahme<br />
von Wertgegenständen.<br />
- Reparaturtasche, die alles enthält, was zu einer provisorischen Reparatur<br />
notwendig ist.<br />
- Kleine „Bordapotheke“.<br />
- Wasserwanderkarten in einer wasserdichten Schutzhülle.<br />
6.2 Vorbereitung der Wanderfahrt<br />
Rechtzeitig zu planen bzw. zu organisieren sind:<br />
- Ausgangspunkt und Ziel der Fahrt, Dauer, Gesamtstrecke und Tagesetappen<br />
(ca. 30 km/Tag), Rasttage, annähernde Tageseinteilung und notwendige<br />
Pausen<br />
- Ort und Art der Übernachtungen (Zelt oder Quartiere)<br />
- Verpflegung<br />
- Beschaffung von Booten und Zubehör sowie Geräte und Mittel zur Repara-<br />
tur und Reinigung<br />
- Prüfen und evtl. Überholen des gesamten Materials, wie Bootskörper, Aus-<br />
leger, Skulls oder Riemen, Manschetten<br />
- Verladen und Bootstransport<br />
6.3 Fahrtdurchführung<br />
6.3.1 Bootsobmann und Mannschaften<br />
Unmittelbar vor Antritt der Fahrt werden vom Fahrtenleiter die Bootsplätze verteilt,<br />
die Mannschaften eingeteilt und die Steuerleute ausgewählt und benannt.<br />
- Die im Rudern und Steuern Erfahrensten sollten auch als Bootsobmann<br />
bzw. Steuerleute eingesetzt werden.
31<br />
- Den Anordnungen und Befehlen des Bootsobmannes ist unbedingt Folge zu<br />
leisten.<br />
- Es ist günstig, die Mannschaften kräfte- und leistungsmäßig so einzuteilen,<br />
dass kein Boot übermäßig schnell oder langsam ist.<br />
- Bei unkompletter Mannschaft achte man auf gleichmäßige Gewichtsverteilung<br />
(Beispiel: Beim Doppelvierer bleibt günstigerweise der Ruderplatz Nr. 3<br />
frei).<br />
6.3.2 Gepäck und Beladen der Boote<br />
Man soll niemals übermäßig viel Gepäck mitnehmen. Als Anhaltspunkt gilt:<br />
- Zelt, Schlafsack, Luftmatratze, Kocher, Taschenlampe<br />
- Trainingsanzug, Pullover, Regenbekleidung, Ruderbekleidung sowie ein<br />
äußerstes Minimum an weiteren persönlichen Dingen<br />
- Proviant für höchstens zwei Tage<br />
- Das Beladen und Entladen der Boote geschieht stets auf dem Wasser.<br />
- Hecklastige Boote lassen sich leichter steuern.<br />
- Im Bug- und Heckteil eines jeden Bootes hat je ein Bootshaken griffbereit zu<br />
liegen.<br />
6.3.3 Fahrtordnung<br />
Der Fahrtenleiter übernimmt im schnellsten Boot auf der Fahrt die Führung und<br />
fährt demzufolge an der Spitze. Sein Stellvertreter fährt dagegen im letzten<br />
Boot und hat Bordapotheke und Reparaturtasche bei sich.<br />
6.3.4 Tageseinteilung und Rast<br />
In der Regel werden vormittags zwei Drittel der Tagesstrecke zurückgelegt.<br />
Nach einer längeren Mittagspause wird dann am Spätnachmittag der Rest bewältigt.<br />
Bei längerer Rast oder Übernachtung sollte das Boot stets aus dem Wasser<br />
genommen werden. Dabei wird das Boot über Kiel aus dem Wasser gezogen<br />
und entweder kielunten abgestellt oder kieloben auf zwei Böcke oder Hölzer<br />
gelagert. Muss das Boot aus bestimmten Gründen im Wasser verbleiben
32<br />
(z. B. Uferbeschaffenheit) und ist kein Steg vorhanden, dann soll es etwas vom<br />
Ufer entfernt an Bug und Heck so festgelegt werden (notfalls durch Einschlagen<br />
von Stöcken), dass es nicht ans Ufer geworfen werden kann und die Ausleger<br />
frei bleiben.<br />
Ist ein Steg vorhanden, dann wird es an dessen Leeseite mit Bug- und Heckleine<br />
festgemacht.<br />
Die Riemen oder Skulls werden aus den Dollen genommen, ins Boot gelegt<br />
oder an Land abgestellt.<br />
6.3.5 Schleusen<br />
Schleusen sind Staustufen, die den unmittelbaren Übergang eines Wasserfahrzeuges<br />
von einem tieferen auf einen höheren Wasserspiegel oder umgekehrt<br />
ermöglichen.<br />
- Den eventuellen Anweisungen des Schleusenpersonals ist unbedingt nach-<br />
zukommen!<br />
- Berufsschifffahrt hat beim Schleusen immer Vorfahrt!<br />
Für das Befahren von Schleusen gilt es folgendes zu beachten:<br />
Vor den Schleusen:<br />
- Nicht zu dicht an das Schleusentor heranfahren<br />
- Paddelhaken griffbereit legen<br />
- Langsam und vorsichtig an der rechten Uferseite heranfahren<br />
In den Schleusen:<br />
- Nicht unmittelbar vor oder hinter dem Schleusentor und nicht in der Nähe<br />
größerer Dampfer und Schleppkähne liegenbleiben<br />
- Möglichst an einer Leiter oder Gleitstange anlegen und das Boot mit dem<br />
Bootshaken so festhalten, dass kein Ausleger hängenbleibt<br />
Hinter den Schleusen:<br />
- Schleusenanlagen unverzüglich verlassen<br />
6.3.6 Verhalten bei Wind und Wellen<br />
Bei stärkerem Wind soll man so fahren, dass die Wellen möglichst von vorn<br />
kommen. Man hält Kurs direkt gegen den Wind und versucht auf diese Weise,
33<br />
bis in Ufernähe zu gelangen. Unter Landschutz wird dann parallel <strong>zum</strong> Ufer<br />
gefahren. Werden die Wellen höher, so dass sie sich an den Auslegern brechen,<br />
ist parallel zu den Wellen zu fahren und das im Windschatten nächstgelegene<br />
Ufer anzusteuern. Besondere Aufmerksamkeit ist beim Befahren eines<br />
Sees mit achterlichen Wind (Schiebewind) erforderlich, da die Höhe der Wellen<br />
zunächst nicht erkennbar ist und sie mit größerer Entfernung vom Ufer zunimmt.<br />
6.3.7 Verhalten bei Kenterung und Vollschlagen<br />
Die Mannschaft bleibt grundsätzlich am Boot (ein vollgeschlagenes Boot oder<br />
ein gekentertes Boot trägt immer noch die gesamte Mannschaft) und schwimmt<br />
mit dem Bootskörper und mit Windunterstützung (!) die nächste Uferstelle an.<br />
Selbstverständlich versucht man, die Kleinteile, wie Bug- und Heckbretter, Rollsitze,<br />
Skulls u. a. zu bergen.<br />
6.4 Einige grundsätzliche Hinweise<br />
- Auf fließenden Gewässern wird immer gegen die Strömung angelegt!<br />
- Bevor man auf Wanderfahrt geht, ist die Kenntnis der Binnenschifffahrtsord-<br />
nung unbedingt erforderlich.<br />
- Über Besonderheiten des zu befahrenden Reviers (Strömung, Windanfälligkeit,<br />
besondere Gefahrenmomente u. a.) sind vorab Informationen einzuholen.<br />
- Auf dem Wasser ist die Gefahr eines Sonnenbrandes noch viel größer als<br />
anderswo. Schütze deshalb besonders gefährdete Stellen (Nacken, Gesicht,<br />
Beine, Arme) und passe dich langsam an die intensivere Strahlung an!<br />
7. Wettkampfrudern<br />
Bei Internationalen Meisterschaften werden folgende Streckenlängen gefahren:<br />
2000 m Männer, Frauen, Junioren, Juniorinnen<br />
1000 m Männer und Frauen der Altersklasse ab dem 27. Lebensjahr<br />
(Masters)
34<br />
Die Regattastrecke muss 6 Bahnen haben, die vom Start bis <strong>zum</strong> Ziel durch<br />
Bojenketten gekennzeichnet sind (Albaner-System). Über die gesamte Länge<br />
und Breite der Regattastrecke ist eine Mindestwassertiefe vorgeschrieben, damit<br />
auf allen Bahnen gleiche Bedingungen vorhanden sind.<br />
International ausgeschriebene Rennen dürfen nur von festen Startplätzen ge-<br />
startet werden.<br />
Das Ausscheidungssystem geht je nach Anzahl der gemeldeten Boote über<br />
Vorläufe, Hoffnungsläufe, Semifinale und Finale.<br />
National werden neben den Normalstrecken (siehe oben) auch Langstrecken-<br />
Rennen (mindestens 4000 m) und Kurzstrecken-Rennen (500 m) gefahren.<br />
8. Zur historischen Entwicklung des Rudersports<br />
Altertum<br />
(bis 476 u. Z.)<br />
10 000 v. u. Z.<br />
(Steinzeit<br />
600 000 – 1 800<br />
v. u. Z.)<br />
Ältester Fund eines Ruders<br />
aus dem Moorboden bei Duvensee<br />
in Holstein<br />
7 000 v. u. Z. Erster Nachweis des Ruderns<br />
in Ägypten in Form<br />
von Reliefs<br />
Auf den Südseeinseln bereits<br />
große Kriegsschiffe mit<br />
144 Ruderern<br />
3 666 v. u. Z. Grababbildungen auf Kreta<br />
zeigen weit entwickelten<br />
Schiffstyp<br />
Bootsbau entsprach den Gegebenheiten<br />
des jeweiligen<br />
Gebiets:<br />
- Südseeinseln: Einbäume,<br />
Flöße aus Bambus oder<br />
Schilf, Boote aus großen<br />
Kürbisschalen, Baumrinden<br />
oder Flechtwerk<br />
- Nordmeergebiet: Boote aus<br />
aufgeblasenen Tierfellen<br />
und Häuten<br />
- Marshall-Inseln: Einbäume,<br />
später mit Planken erhöht<br />
Benutzung des Ruders als Hebel<br />
mit festem Drehpunkt<br />
Ausgerüstet mit: Steuer, Ruder,<br />
Segel;<br />
zeigte altnordische Formen:<br />
Hohen Bug und Fisch als<br />
Schiffszeichen und Flagge
35<br />
2 560 v. u. Z. Ägypten: Nachen aus Papyrus<br />
auf dem Nil als Prunkboote<br />
der Pharaonen<br />
2 000 v. u. Z. Felszeichnungen von Wasserfahrzeugen<br />
des Urvolkes<br />
der Germanen in Bohuslän<br />
an der Westseite des Kattegat<br />
1 000 v. u. Z.<br />
(Bronzezeit<br />
1 800 – 600<br />
v. u. Z.)<br />
480 v. u. Z.<br />
(Eisenzeit -<br />
600 v. u. Z.)<br />
Mittelalter<br />
(476 – 16. Jh.)<br />
1 000<br />
Neuzeit<br />
(ab 16. Jh.)<br />
1824<br />
HOMER berichtet in der<br />
„Odyssee“ von den Schiffen<br />
der Phäaken!<br />
Attische Triere; entwickelte<br />
sich aus kleinen, flachen<br />
Ruderbooten der Griechen<br />
Wikinger (Normannen) fuhren<br />
Drachenboote aus geklinkerten<br />
Eichenplanken<br />
Galeerensklaven auf Kriegsgaleeren<br />
der italienischen<br />
Küstenstädte<br />
England: Erstes Sportruderboot<br />
Darstellung von Flößen mit<br />
tafelförmigem Aufsatz<br />
Mit 52 Ruderern und Masten<br />
150 Ruderer, in drei Reihen<br />
übereinander sitzend; Schiffsvorbauten<br />
der oberen Reihen<br />
deuten auf die heutigen Ausleger<br />
hin.<br />
Antrieb beidseitig von je 16<br />
Ruderern; mit Mast <strong>zum</strong> Segeln;<br />
Steuer war in Fahrtrichtung<br />
rechts, daher „Steuerbord“<br />
1. Studentenachter:<br />
Das „Weiße Boot des Exester-<br />
College“; geklinkerte Gig ohne<br />
Ausleger<br />
1828/29 1. Auslegerboot in England Von Bootsbauer „RIDLEY“ mit<br />
hölzernen Auslegern gebaut<br />
1844 1. Reneiner in Putney<br />
(England) gebaut<br />
1857 Nachdem man zunächst auf<br />
festem Sitz ruderte und danach<br />
zwecks geringer Gleitmöglichkeit<br />
auf eingefettetem<br />
Lederschutz, konstruierte<br />
der Amerikaner<br />
BABCOCK den Gleitsitz<br />
Aus nur einer Planke aus Furnierholz<br />
mit Auslegern und<br />
Innenkiel<br />
Gleitsitz (slidding side), ein mit<br />
Leder bespannter Holzrahmen,<br />
dessen ausgekehlte Kufen auf<br />
eingefetteten Messingschienen<br />
liefen
36<br />
1868 R4 o entstand auf der Henley-Regatta;<br />
Steuermann<br />
sprang nach dem Start ins<br />
Wasser<br />
1871 England: Drehdollen Alle Skullboote sind mit Drehdollen<br />
versehen<br />
1883 Rudertag in Berlin SCHILLER führte einen auf vier<br />
Rädern laufenden Rollsitz vor<br />
8.1. Zur Entwicklung des Frauenruderns (Fr)<br />
1884 Erste Anfänge des Frauenruderns in Berlin; bisher Entwicklung des<br />
Ruderns nur durch die Männer bestimmt<br />
1885 Berlin: Erstes Erteilen von Damenruderunterricht durch ERNST<br />
SAALBACH erregte öffentliches Ärgernis.<br />
1894 Berlin: Gründung des ersten Damenruderclubs „Deutsche Amazonenflotte“<br />
durch WEDEKIND– war nicht von Dauer<br />
1901 Berlin: Gründung des Friedrichshagener Frauenruderbundes<br />
1919 Berlin: Gründung des Deutschen Damen-Ruderverbandes durch<br />
Prof. Dr. HERMANN ALTROCK<br />
Die weitere Entwicklung des Rudersports ist eng mit der Entwicklung<br />
des Rennruderns verbunden (siehe: Entwicklung des Rennruderns).<br />
8.2 Zur Entwicklung des Rennruderns<br />
Altertum<br />
(bis 476 u. Z.)<br />
7 000 v. u. Z. Mikronesien und Polynesien: Strenge nautische Ertische Erziehung<br />
der Jugend mit festlichen Wettfahrten; Urform der Regatta<br />
40 v. u. Z. VERGIL gab im Versepos „Äneis“ spannenden Bericht von Ruderregatta<br />
bereits vor der Gründung Roms; bei festlichen Gelegenheiten<br />
wurden in der See Bootsrennen mit Wende ausgefahren.<br />
Mittelalter<br />
(476 – 16. Jh.<br />
1315 Venedig: Wettfahrten auf dem Canale Grande<br />
Erstmalig Wort „Regatta“ gebraucht; bedeutet: Programm, weil<br />
dabei Programme verkauft wurden, nach denen der Wettkampf<br />
ablief.
37<br />
Neuzeit<br />
(ab 16. Jh.)<br />
1715 England: Usprungsland des sportlichen Ruderns; Rennen der<br />
Fährleute auf der Themse<br />
1791 Jährliches Rennrudern der Fährleute um „Doggets coats and<br />
badge“ auf der Themse<br />
1824 Erstes Sportruderboot in England<br />
1829 1. Studentenrennen zwischen Oxford und Cambridge – populärste<br />
und älteste Regatta der Welt im modernen sportlichen<br />
Rudern<br />
1831 England: Auf der Themse finden die 1. Weltmeisterschaften im<br />
Berufsrudern (Henley-Kurs) statt.<br />
1836 Hamburg: Gründung des „Englisch-Rowing-Club“ durch englische<br />
Kaufleute<br />
1839 Henley-Regatta wird regelmäßig durchgeführt; Volksfest; nur<br />
zwei Startbahnen; KO-System<br />
1844 Erster Renneiner in England gebaut<br />
Hamburg: Erste Regatta in Deutschland auf einem 4 000 –m-<br />
Dreieck-Kurs<br />
1850 Kanada: Am Ontariosee entwickelte sich das sportliche Rudern.<br />
1856 Beginn des sportlichen Ruderns in Leipzig<br />
1867 1. Start deutscher Ruderer im Ausland anlässlich der Weltausstellung<br />
in Paris<br />
1868 Erster R4 bei Henley-Regatta; Steuermann sprang nach dem<br />
Start ins Wasser<br />
1873 In England bereits 242 Regatten<br />
1874 1. Amateurparagraph schloss kleinbürgerliche Schichten und<br />
Proletariat vom Wettkampfrudern aus<br />
1876 Kanada: HANLAN wurde Sieger im D1. Einziger weltbekannter<br />
Ruderer, dem in Toronto ein Denkmal aus Erz gesetzt wurde.<br />
1876 Berlin: Anfänge des sportlichen Ruderns im heutigen Wassersportzentrum<br />
1878 In Deutschland wurde vom Norddeutschen Regattaverein die<br />
gerade Strecke von 2 000 m eingeführt.
1880 1. Regatta in Grünau mit Ziel am Gesellschaftshaus<br />
38<br />
1882 1. Deutsche Meisterschaft im D1 in Frankfurt a. M.; Sieger<br />
ACHILLES WILD. Seither jährlich Deutsche Meisterschaften im<br />
D1<br />
1883 Gründung des DRV in Köln; Herausgabe der Fachzeitschrift<br />
„Wassersport“;<br />
47 Rudervereine in Deutschland<br />
1884 1. Regatta in Leipzig in schweren Tourengigs<br />
1892 Gründung FISA<br />
1893 1. Europameisterschaften (EM) in Orta (Italien)<br />
1895 1. Schülerregatta und Einführung des Schülerruderns aufgrund<br />
eines Erlasses des Kaisers<br />
1896 Erste Olympische Spiele in Athen: Ruderwettkämpfe mussten<br />
ausfallen wegen Sturm in Piräus.<br />
1900 Bei den 2. Olympischen Spielen in Paris erkämpften deutsche<br />
Ruderer eine Goldmedaille im R4m. Wettkämpfe erfolgten in<br />
den Bootsgattungen: D1; R2m; R2; R4m; R8m.<br />
1904 Beitritt des DRV zur FISA – Austritt zu Beginn des ersten Weltkriegs<br />
1906 (Fr) 1. Start einer Damenmannschaft bei Regatta in Hamburg<br />
1919 (Fr) Gründung des Deutschen Damen-Ruderverbandes durch<br />
PROF. DR. HERMANN ALTROCK<br />
1. selbständige Frauenregatta in Grünau<br />
1924 Bei den 7. Olympischen Spielen in Paris erstmalig Start in sieben<br />
olympischen Bootsgattungen (D1, D2, R2, R2m, R4, R4m,<br />
R8m)<br />
1927 (Fr) Aufnahme des Damen-Ruderverbandes in den DRV<br />
1934 Erneuter Beitritt des DRV in die FISA<br />
1935 1. Männer-EM in Deutschland (Berlin-Grünau)<br />
1936 (Fr) 1. Damenmeisterschaft im D1 und jährlich selbständige Frauenregatta<br />
1936 Bei den Olympischen Spielen in Berlin errang der DRV fünf<br />
von sieben möglichen Goldmedaillen
39<br />
1939 (Fr) 1. Deutsche Meisterschaften der Frauen in Leipzig im D1, D2<br />
und D4.<br />
1953 (Fr) 1. Frauen-EM in Kopenhagen<br />
1954 (Fr) Amsterdam: 2. Frauen-EM; 13 Nationen mit 134 Ruderinnen<br />
beteiligt<br />
1970 1. FISA-Juniorenregatta in Joannina (Griechenland), DDR errang<br />
sieben Goldmedaillen; ab 1971 in Bled (Jugoslawien) als<br />
FISA-Juniorenmeisterschaften bezeichnet<br />
1973 (Fr) Aufnahme der Frauen-Ruderwettbewerbe in das olympische<br />
Programm, beschlossen auf der 73. Tagung des IOC in München<br />
1974 Erstmals R2 für Frauen und D4 für Männer im internationalen<br />
Wettkampfprogramm der FISA<br />
1976 (Fr) Ruderinnen erstmalig bei Olympischen Spielen vertreten<br />
1978 (Fr) 1. FISA-Weltmeisterschaften für Junioren in Belgrad (Jugoslawien)<br />
1985 1. Weltmeisterschaften für Junioren und Juniorinnen in Brandenburg<br />
1985 Wettkampfstrecke Frauen 2 000 m; Juniorinnen 1 500 m<br />
1985 1. Weltmeisterschaften für Leichtgewichte<br />
1985 (Fr) D4 für Frauen wird ohne Steuerfrau gefahren<br />
1985 Finalrennen bei WM und OS gemischt<br />
Frauen und Männer an 2 Tagen<br />
1992 (Fr) R4 für Frauen wird ohne Steuerfrau gefahren<br />
1996 Erstmals Leichtgewichtsrennen im Olympischen Ruderprogramm<br />
Männer: R4m und R2m gestrichen, dafür R4 und D2 als<br />
Leichtgewichtsrennen<br />
Frauen: R4 gestrichen, dafür D2 als Leichtgewichtsrennen
9. Literatur<br />
Bootsobleute und Steuerleute, Deutscher Ruderverband 2000<br />
FRITSCH, W.: Handbuch für den Rudersport. Aachen 1988.<br />
Hanbuch für das Wanderrudern/Hrsg.: Deutscher Ruderverband 1995ff.<br />
HERBERGER, E.: Rudern. Berlin 1977<br />
40<br />
KÖRNER, TH.; SCHWANITZ, P.: Rudern. Berlin 1987<br />
Wanderrudern: Fahrtleiter und Wanderruderwart/Hrsg.: Deutscher<br />
Ruderverband 2000