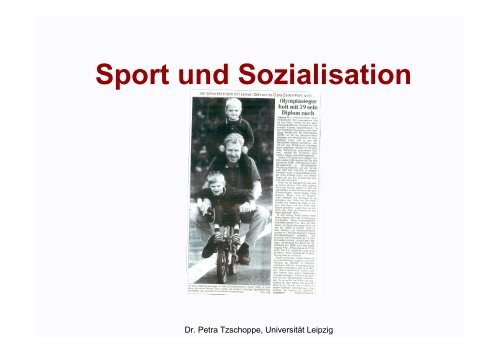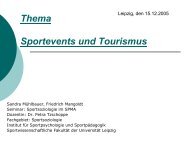Sport und Sozialisation
Sport und Sozialisation
Sport und Sozialisation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Sport</strong> <strong>und</strong> <strong>Sozialisation</strong><br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Gliederung<br />
1. <strong>Sozialisation</strong> - wesentliche Theorien <strong>und</strong> Begriffe<br />
2. <strong>Sozialisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Sport</strong><br />
2.1. Phasen des Verhältnisses von <strong>Sozialisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Sport</strong><br />
2.2. <strong>Sozialisation</strong> in den <strong>Sport</strong><br />
2.3. <strong>Sport</strong> als <strong>Sozialisation</strong>sfeld - <strong>Sozialisation</strong> im <strong>Sport</strong><br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Literaturauswahl (1):<br />
→ BRETTSCHNEIDER, W.D. (Hg.) DSB Sprint-Studie: <strong>Sport</strong>unterricht<br />
in Deutschland. Eine Untersuchung zur Situation des Schulsports in<br />
Deutschland (2005). Aachen.<br />
→ BRINKHOFF, K.-P. (1998). <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> <strong>Sozialisation</strong> im Jugendalter.<br />
Weinheim; München.<br />
→ BRETTSCHNEIDER, W.D. / GERLACH, E. (2004).<br />
<strong>Sport</strong>engagement <strong>und</strong> Entwicklung im Kindesalter. Aachen.<br />
→ HEINEMANN, K. (2007). Einführung in die Soziologie des<br />
<strong>Sport</strong>s. Schorndorf. Kap. 6.1.<br />
→ HURRELMANN, K. (2006). Einführung in die <strong>Sozialisation</strong>stheorie.<br />
9. Aufl. Weinheim / Basel.<br />
→ PÜHSE, U. (Hg.) (2004) Soziales Handeln im <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> im<br />
<strong>Sport</strong>unterricht. Schorndorf.<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Literaturauswahl <strong>und</strong> Links (2):<br />
→ Schmidt, W./ Hartmann-Tews, I. /Brettschneider, W.-D. (Hg.) (2003),<br />
Erster Deutscher Kinder- <strong>und</strong> Jugendsportbericht . Schorndorf.<br />
→ TZSCHOPPE, P. (1997). <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> <strong>Sozialisation</strong>. In: HARTMANN /<br />
SENF (Hg.) <strong>Sport</strong> verstehen - <strong>Sport</strong> erleben. Dresden.<br />
→ WEIß, O. (1999) Einführung in die <strong>Sport</strong>soziologie. Wien. S. 65 –75.<br />
→ ZIMMERMANN, P. (2006). Gr<strong>und</strong>wissen <strong>Sozialisation</strong>. 3. üa. Aufl.<br />
Opladen.<br />
→ Deutscher <strong>Sport</strong>lehrerverband unter: http://www.dslv.de/<br />
→ http://www.sportunterricht.de/news/<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Begriff SOZIALISATION<br />
seit Beginn des 20. Jh. in wissenschaftlicher Diskussion verwendet<br />
(erstmals bei Emile DURKHEIM, 1912)<br />
SOZIALISATION als der Prozess,<br />
durch den der Mensch zur sozialen,<br />
gesellschaftlich handlungsfähigen Persönlichkeit wird,<br />
indem er in gesellschaftliche Struktur- <strong>und</strong><br />
Interaktionszusammenhänge hineinwächst<br />
( ⇒ „zweite“ soziokulturelle Geburt).<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Bezugstheorien<br />
⇒ spiegeln unterschiedliche Betrachtungsansätze<br />
Soziologisch orientierte Theorien, bes. kultursoziologische Ansätze:<br />
→ konzentrieren sich auf Einfluss sozialer Lebensbedingungen auf die<br />
Persönlichkeitsentwicklung<br />
(Systemtheorien, z.B.: struktur-funktionale Theorie - PARSONS, soziale<br />
Systemtheorie – LUHMANN,<br />
Handlungstheorien, Symbolischer Interaktionismus – MEAD u.a.,<br />
Gesellschaftstheorien - HABERMAS, Habitualisierungskonzept – BOURDIEU,<br />
Individualisierungstheorie – BECK)<br />
Psychologische Theorien:<br />
→ konzentrieren sich auf Art <strong>und</strong> Weise der Verarbeitung von<br />
Lebensbedingungen durch Individuum <strong>und</strong> psychische Regelmäßigkeiten<br />
der Persönlichkeitsentwicklung<br />
(z.B.: psychoanalytische Theorien - FREUD, ERIKSON, Lerntheorien u.a.<br />
BANDURA, Entwicklungspsychologie von PIAGET, ökologische Theorie –<br />
BRONFENBRENNER)<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Verbindung von Basistheorien<br />
Psychologische<br />
Basistheorien<br />
mit Aussagen zur<br />
inneren Realität<br />
<strong>Sozialisation</strong>stheorien<br />
mit Aussagen zur<br />
Verschränkung von<br />
innerer <strong>und</strong> äußerer<br />
Realität<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
Soziologische<br />
Basistheorien<br />
mit Aussagen zur<br />
äußeren Realität<br />
nach Hurrelmann, 2002
Interdisziplinärer <strong>Sozialisation</strong>sbegriff<br />
Beinhaltet die Abgrenzung von:<br />
a) einseitig biologistischen Auffassungen menschlicher Entwicklung<br />
<strong>und</strong> damit angenommener Determinierung durch “Anlage” <strong>und</strong><br />
“Reifung”;<br />
b) idealistischen Auffassungen des Subjektes – gibt kein “freies“<br />
Individuum, das sich gesellschaftlichen Einflüssen entzieht<br />
c) einer pädagogisch reduzierten Perspektive, die allein den<br />
intentionalen Einfluss des Erziehers auf den jungen Menschen<br />
in den Mittelpunkt stellt.<br />
<strong>Sozialisation</strong> heißt, zu werden wie jeder andere,<br />
<strong>und</strong> zugleich, zu werden wie kein anderer.<br />
Goffman
Interdisziplinäre Perspektive:<br />
⇒ SOZIALISATION<br />
= Prozess der Entstehung <strong>und</strong> Entwicklung der<br />
Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der<br />
gesellschaftlich vermittelten sozialen <strong>und</strong> dinglichmateriellen<br />
Umwelt einerseits <strong>und</strong> der biophysischen<br />
Struktur des Organismus andererseits.<br />
= Gesamtheit der Erfahrungsprozesse mittels derer<br />
sich der Mensch im Laufe seines Lebens sowohl<br />
zu einer individuell einzigartigen als auch<br />
sozial anpassungsfähigen Persönlichkeit entwickelt.<br />
(Hurrelmann)<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
PERSÖNLICHKEIT<br />
bezeichnet die soziokulturell geprägte <strong>und</strong> zu sozialem Handeln fähige<br />
<strong>und</strong> bereite Person<br />
= das einem Menschen spezifische organisierte Gefüge von Merkmalen,<br />
Eigenschaften, Einstellungen <strong>und</strong> Handlungskompetenzen, das sich auf<br />
der Gr<strong>und</strong>lage der biologischen Ausstattung als Ergebnis der Bewältigung<br />
von Lebensaufgaben jeweils lebensgeschichtlich ergibt<br />
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG<br />
die überdauernde <strong>und</strong> langfristige Veränderung wesentlicher Elemente<br />
dieses Gefüges im Verlauf des Lebens<br />
(nach HURRELMANN)<br />
ERZIEHUNG<br />
(begriffslogisch dem Begriff der <strong>Sozialisation</strong> untergeordnet)<br />
Handlungen <strong>und</strong> Maßnahmen , durch die Menschen versuchen, auf die<br />
Persönlichkeitsentwicklung anderer Menschen Einfluss zu nehmen, um sie nach<br />
bestimmten Wertmaßstäben zu fördern.<br />
Erziehung bezeichnet die bewussten <strong>und</strong> geplanten Einflussnahmen im<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozess. (=„methodische <strong>Sozialisation</strong>“ – DURKHEIM)<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
<strong>Sozialisation</strong> als produktive Verarbeitung<br />
der äußeren <strong>und</strong> inneren Realität<br />
äußere ere Realität Realit t - Gesellschaft<br />
(soziale <strong>und</strong> materielle Lebensbedingungen/<br />
gesellsch. gesellsch.<br />
Sozial- Sozial <strong>und</strong> Wertstrukturen)<br />
Persönlichkeit<br />
Kommunikation, Interaktion, Tätigkeiten<br />
innere Realität Realit<br />
(psycho psycho-physiolog physiolog. .<br />
Gr<strong>und</strong>strukturen, genet. genet.<br />
Disposition)<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
nach Hurrelmann
2. <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> <strong>Sozialisation</strong><br />
Leistet <strong>Sport</strong> einen Beitrag zur<br />
Persönlichkeitsentwicklung?<br />
Vermittelt <strong>Sport</strong> spezifische Einstellungen<br />
<strong>und</strong> Verhaltensweisen?<br />
Kann <strong>Sport</strong> gesellschaftliche <strong>und</strong> individuelle<br />
Fehlentwicklungen kompensieren?<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
Vorgängige <strong>Sozialisation</strong><br />
<strong>Sozialisation</strong> in den <strong>Sport</strong><br />
<strong>Sozialisation</strong> im <strong>Sport</strong><br />
2.1 Phasen des Verhältnisses von<br />
<strong>Sport</strong> <strong>und</strong> <strong>Sozialisation</strong><br />
Entw. von Kompetenzen, um sich in soziale Gruppen zu<br />
integrieren <strong>und</strong> Anforderungen des <strong>Sport</strong>s zu entsprechen<br />
Bedingungen <strong>und</strong> Einflussfaktoren, um Handlungspotential<br />
aus Vorsozialisation in den <strong>Sport</strong> einzubringen<br />
<strong>Sozialisation</strong>seffekte<br />
Normative Konformität, Ich-Identität, Ich-Stärke, Solidarität<br />
<strong>Sozialisation</strong> durch <strong>Sport</strong> Transfer von <strong>Sozialisation</strong>swirkungen<br />
De-<strong>Sozialisation</strong><br />
Veränderungen der Persönlichkeit<br />
nach Abschluss der <strong>Sport</strong>lerkarriere<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
2.2 Einflussfaktoren <strong>und</strong> Instanzen der<br />
<strong>Sozialisation</strong> in den <strong>Sport</strong><br />
Kultur/ Gesellschaft Geschlecht<br />
Soziale Schicht<br />
Materiell-dingliche Voraussetzungen<br />
(Landschaft, Klima, Region, <strong>Sport</strong>stätten, <strong>Sport</strong>angebot<br />
Persönlichkeit<br />
mit Bereitschaft <strong>Sport</strong> bzw.<br />
bestimmte Art von <strong>Sport</strong><br />
zu betreiben<br />
<strong>Sozialisation</strong>sinstanzen:<br />
•Familie<br />
•Gleichaltrigengruppe (peer-group)<br />
•Schule<br />
•Massenmedien<br />
•Vereine u.a. <strong>Sport</strong>anbieter (Talentsichtung / „ESA“)<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
<strong>Sozialisation</strong>sinstanzen<br />
(auch <strong>Sozialisation</strong>sagenten, <strong>Sozialisation</strong>smedien):<br />
⇒ alle gesellschaftlichen Einrichtungen, die die<br />
Lernprozesse von Kindern, aber auch Erwachsenen<br />
steuern; die die geltenden Werte, Normen, Ziele <strong>und</strong><br />
Wissensbestände vermitteln (Familie, Kindergarten,<br />
Schule, Gleichaltrige, Beruf, Massenmedien)
Abschnitte der <strong>Sozialisation</strong><br />
Primäre <strong>Sozialisation</strong> : Herausbildung der gr<strong>und</strong>legenden<br />
Persönlichkeitsmerkmale, Sprach- <strong>und</strong> Handlungskapazitäten in<br />
den ersten Lebensjahren<br />
(geleistet von Familie als primärer <strong>Sozialisation</strong>sinstanz)<br />
Sek<strong>und</strong>äre <strong>Sozialisation</strong> (Schule, Medien <strong>und</strong> peer-group):<br />
Sek<strong>und</strong>äre <strong>Sozialisation</strong>sinstanzen überlagern den Elterneinfluß.<br />
Erwerb neuer Rollen, Ausdifferenzierung der Fähigkeit der<br />
Rollenübernahme in den Jahren danach<br />
Die primäre <strong>Sozialisation</strong> ist zwar rahmengebend für die<br />
Zugangschancen zu sek<strong>und</strong>ären Instanzen; die Schule hat jedoch<br />
nicht nur selektierende, sondern auch kompensierende Wirkung.<br />
���� für <strong>Sozialisation</strong> zum <strong>Sport</strong> beide Phasen maßgeblich;<br />
Familie jedoch nicht nur zeitlich, sondern auch betreffs<br />
Bedeutung primär !
Ort des ersten Interesses am <strong>Sport</strong>treiben (%)<br />
Geschlecht<br />
„Ort“<br />
männlich weiblich<br />
Familie<br />
Schule<br />
<strong>Sport</strong>verein<br />
Nachbarschaft<br />
anderes<br />
20<br />
53<br />
13<br />
10<br />
(Projekt „Socialisation into <strong>Sport</strong> Involvement“,<br />
Ergebnisse für die BRD 1983)<br />
4<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
21<br />
63<br />
5<br />
6<br />
5
Alter des ersten Interesses am <strong>Sport</strong>treiben (%)<br />
Alter<br />
bis 5 Jahre<br />
5 -8 Jahre<br />
9 - 12 Jahre<br />
13 - 16 Jahre<br />
nie<br />
Geschlecht männlich weiblich<br />
(Projekt „Socialisation into <strong>Sport</strong> Involvement“,<br />
Ergebnisse für die BRD 1983)<br />
9<br />
45<br />
35<br />
7<br />
4<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
5<br />
37<br />
27<br />
10<br />
21
Die Bedeutung des Schulsports für lebenslanges <strong>Sport</strong>treiben<br />
Gemeinsame Erklärung der Präsidentin der Kultusministerkonferenz,<br />
des Präsidenten des Deutschen <strong>Sport</strong>b<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> des Vorsitzenden der <strong>Sport</strong>ministerkonferenz<br />
„Der Schulsport ist ein unverzichtbarer Bestandteil umfassender Bildung <strong>und</strong><br />
Erziehung. Er soll bei allen Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen die Freude an der<br />
Bewegung <strong>und</strong> am gemeinschaftlichen <strong>Sport</strong>treiben wecken <strong>und</strong> die<br />
Einsicht vermitteln, dass kontinuierliches <strong>Sport</strong>treiben, verb<strong>und</strong>en mit einer<br />
ges<strong>und</strong>en Lebensführung, sich positiv auf ihre körperliche, soziale,<br />
emotionale <strong>und</strong> geistige Entwicklung auswirkt. Gleichzeitig soll <strong>Sport</strong> in der<br />
Schule Fähigkeiten wie Fairness, Toleranz, Teamgeist, Mitverantwortung<br />
<strong>und</strong> Leistungsbereitschaft fördern <strong>und</strong> festigen. Als einziges Bewegungsfach<br />
leistet der <strong>Sport</strong>unterricht seinen spezifischen Beitrag für eine ganzheitliche<br />
Persönlichkeitserziehung.<br />
So wie die Schule insgesamt die Aufgabe hat, die Bereitschaft <strong>und</strong> Fähigkeit<br />
zum lebenslangen Lernen zu fördern, so hat der Schulsport die Aufgabe,<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendliche anzuregen <strong>und</strong> zu befähigen, bis ins hohe Alter ihre<br />
körperliche <strong>und</strong> geistige Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> ihre Ges<strong>und</strong>heit durch<br />
regelmäßiges <strong>Sport</strong>treiben zu erhalten. ...<br />
12.12.2005
Die Bedeutung des Schulsports für lebenslanges <strong>Sport</strong>treiben<br />
Gemeinsame Erklärung der Präsidentin der Kultusministerkonferenz,<br />
des Präsidenten des Deutschen <strong>Sport</strong>b<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> des Vorsitzenden der <strong>Sport</strong>ministerkonferenz<br />
„...der <strong>Sport</strong>unterricht...<br />
– muss inhaltlich, methodisch <strong>und</strong> vom Umfang her so aufgebaut sein,<br />
dass er gr<strong>und</strong>sätzlich alle Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler erreicht <strong>und</strong><br />
motiviert ...<br />
– muss Interesse bei denjenigen wecken, die dem <strong>Sport</strong> distanziert<br />
gegenüber stehen.<br />
– hat die Verpflichtung sportlich besonders interessierte <strong>und</strong> talentierte<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendliche zu fördern <strong>und</strong> zu fordern.<br />
– kann einen besonderen Beitrag zur Erfüllung wichtiger überfachlicher<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsaufgaben der Schule (z. B. zur<br />
Ges<strong>und</strong>heitsforderung, zum sozialen Lernen, zur Erziehung zur<br />
Leistungsbereitschaft, zur Werteerziehung) leisten.<br />
...<br />
Ein wichtiger Partner des Schulsports ist der Vereinssport. Der<br />
außerunterrichtliche Schulsport bildet die Brücke vom <strong>Sport</strong>unterricht<br />
zum ges<strong>und</strong>heitsorientierten <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> zum Breiten- <strong>und</strong> Leistungssport.
<strong>Sport</strong>unterricht in Deutschland<br />
(„Sprint-Studie“)- Ausgewählte Ergebnisse<br />
- jede 3. bzw. 4. vorgesehene <strong>Sport</strong>st<strong>und</strong>e findet nicht statt:<br />
Im Sek<strong>und</strong>arbereich werden von den zumeist 3 vorgesehenen St<strong>und</strong>en<br />
<strong>Sport</strong>unterricht durchschnittlich 2,2 St<strong>und</strong>en erteilt (besonders betroffen:<br />
Hauptschüler - sind auch beim <strong>Sport</strong>treiben außerhalb der Schule<br />
deutlich unterrepräsentiert!)<br />
- Häufig fachfremd erteilter Unterricht:<br />
besonders in der Gr<strong>und</strong>schule <strong>und</strong> in der Hauptschule, d.h. wo<br />
qualifizierter <strong>Sport</strong>unterricht am nötigsten ist, sind die wenigsten Lehrer<br />
entsprechend ausgebildet!<br />
- Durchschnittsalter der <strong>Sport</strong>lehrkräfte:<br />
45,4 Jahre, d.h. die <strong>Sport</strong>lehrerschaft ist überaltert.<br />
- Qualitätsbeeinträchtigenden Faktoren:<br />
die (unzumutbare) Größe der Lerngruppe<br />
räumliche Verhältnisse (z. B. durch Teilung bzw. Mehrfachnutzung von<br />
gedeckten <strong>Sport</strong>stätten)
Entfernung zu einer <strong>Sport</strong>anlage in der Kindheit (%)<br />
Entfernung<br />
0 - 1 km<br />
1 - 5 km<br />
6 km u. mehr<br />
Befragte Jugendliche Erwachsene<br />
männlich weiblich männlich weiblich<br />
48<br />
45<br />
7<br />
39<br />
55<br />
6<br />
(Projekt „Socialisation into <strong>Sport</strong> Involvement“,<br />
Ergebnisse für die BRD 1983)<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig<br />
33<br />
61<br />
6<br />
25<br />
68<br />
7
2.3. <strong>Sport</strong> als <strong>Sozialisation</strong>sfeld -<br />
<strong>Sozialisation</strong> im <strong>Sport</strong><br />
Mögliche <strong>Sozialisation</strong>seffekte auf:<br />
• Normative Konformität<br />
• Ich-Identität<br />
• Ich-Stärke<br />
• Solidarität<br />
Abhängig von <strong>Sport</strong>art, Einbindung, Organisationskultur u.a.<br />
Dr. Petra Tzschoppe, Universität Leipzig
<strong>Sozialisation</strong>spotential des <strong>Sport</strong>s<br />
Normative Konformität: die in einer Gesellschaft<br />
bestimmenden Normen, Werte, Symbole <strong>und</strong> Techniken<br />
werden vermittelt, verbindlich gemacht <strong>und</strong> als richtig erkannt<br />
(„Internalisierung“) – <strong>Sport</strong> bietet ideales Feld zum Einüben<br />
Ich-Identität: der sozialen Identität (d.h. normativ geprägten<br />
Erwartungen anderer an die eigene Person) muss Individuum<br />
mit persönlichem Selbstverständnis gegenüberstehen<br />
Ich-Stärke: Fähigkeit zu autonomem Handeln, Distanzieren<br />
von sozial-normativen Zwängen, Entwicklung von<br />
Eigenständigkeit – stark abhängig von Organisation <strong>und</strong><br />
Intention<br />
Solidarität: Verbindung von Ich-Stärke <strong>und</strong> Identität mit<br />
sozialer Verpflichtung gegenüber anderen (im <strong>Sport</strong> oft<br />
gruppenbezogen)