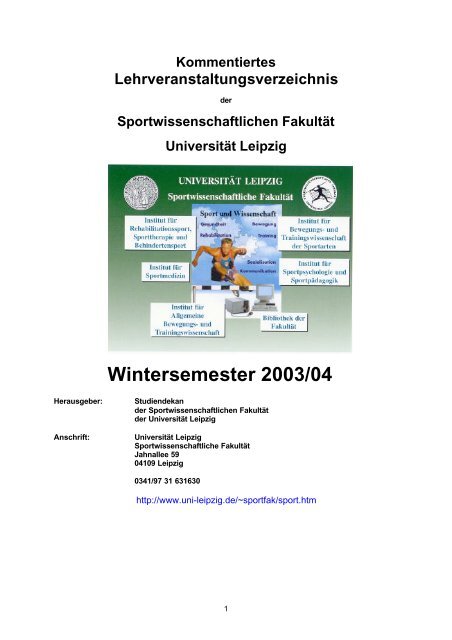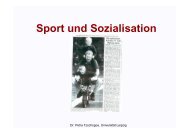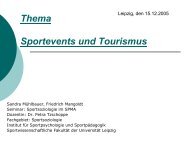Wintersemester 2003/04 - Sportwissenschaftliche Fakultät der ...
Wintersemester 2003/04 - Sportwissenschaftliche Fakultät der ...
Wintersemester 2003/04 - Sportwissenschaftliche Fakultät der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kommentiertes<br />
Lehrveranstaltungsverzeichnis<br />
<strong>der</strong><br />
<strong>Sportwissenschaftliche</strong>n <strong>Fakultät</strong><br />
Universität Leipzig<br />
<strong>Wintersemester</strong> <strong>2003</strong>/<strong>04</strong><br />
Herausgeber: Studiendekan<br />
<strong>der</strong> <strong>Sportwissenschaftliche</strong>n <strong>Fakultät</strong><br />
<strong>der</strong> Universität Leipzig<br />
Anschrift: Universität Leipzig<br />
<strong>Sportwissenschaftliche</strong> <strong>Fakultät</strong><br />
Jahnallee 59<br />
<strong>04</strong>109 Leipzig<br />
0341/97 31 631630<br />
http://www.uni-leipzig.de/~sportfak/sport.htm<br />
1
<strong>Sportwissenschaftliche</strong> <strong>Fakultät</strong> Leipzig, den 16.06.<strong>2003</strong><br />
Studiendekan<br />
Studienjahresablaufplan <strong>2003</strong>/20<strong>04</strong><br />
vom <strong>Fakultät</strong>srat beschlossen am 27.05.<strong>2003</strong><br />
<strong>Wintersemester</strong> <strong>2003</strong>/20<strong>04</strong> 01.10.<strong>2003</strong> - 31.03.20<strong>04</strong> (15 Wochen)<br />
___________________________________________________________________<br />
Semesterbeginn: 01.10.<strong>2003</strong><br />
Vorlesungsbeginn: Mo 13.10.<strong>2003</strong><br />
Vorlesungsende: Sa 07.02.20<strong>04</strong><br />
Lehrkräfteversammlung: Di 07.10.<strong>2003</strong>, 15.00 Uhr<br />
Eintragung in die Lehrgebiete:<br />
(Lehrangebote u. diff. Ablaufplan siehe Aushang ab September!)<br />
7. (8./9. ...) Semester Do 09.10.<strong>2003</strong> 07.30 - 12.00 Uhr<br />
5. (6.) Semester Do 09.10.<strong>2003</strong> 13.00 - 18.30 Uhr<br />
3. (4./2.) Semester Fr 10.10.<strong>2003</strong> 07.30 - 14.30 Uhr<br />
1. (2.) Semester Fr 10.10.<strong>2003</strong> 13.00 - 19.00 Uhr<br />
Begrüßung/Einweisung 1. Semester Do 09.10.<strong>2003</strong> 10.00 Uhr HSN<br />
(siehe dazu auch Aushang!)<br />
Zentrale Immatrikulationsfeier: Do 16.10.<strong>2003</strong><br />
Diplom- u. Zwischenprüfungen: Mo 01.03.20<strong>04</strong> bis Fr 26.03.20<strong>04</strong><br />
Anmeldung zu diesen Prüfungen:<br />
- im Prüfungsamt: Mo 26.01.20<strong>04</strong> bis Fr 27.02.20<strong>04</strong><br />
- in den Fachgebieten: siehe Aushänge <strong>der</strong> Fachgebiete!<br />
Exmatrikulationsfeier: Di 20.<strong>04</strong>.20<strong>04</strong> 18:00 Uhr<br />
dies academicus: Di 02.12.<strong>2003</strong> Projekttag<br />
Lehrgänge Skisport:<br />
GAB - 1. Kurs 09.02.20<strong>04</strong> - 20.02.20<strong>04</strong><br />
- 1./2. Kurs 21.02.20<strong>04</strong> - 03.03.20<strong>04</strong> St. Jacob<br />
- 1. Kurs 08.03.20<strong>04</strong> - 19.03.20<strong>04</strong> (Österreich)<br />
GSP/KSP 09.02.20<strong>04</strong> - 20.02.20<strong>04</strong><br />
08.03.20<strong>04</strong> - 19.03.20<strong>04</strong><br />
Tag <strong>der</strong> offenen Tür: Do 08.01.20<strong>04</strong><br />
Rückmeldung zum Sommersemester 20<strong>04</strong>: 01.12.<strong>2003</strong> - 15.02.20<strong>04</strong><br />
Unterbrechungen:<br />
Reformationstag Fr 31.10.<strong>2003</strong> (vorlesungsfrei)<br />
Bußtag Mi 19.11.<strong>2003</strong> (vorlesungsfrei)<br />
dies academicus Di 02.12.<strong>2003</strong> (Projekttag)<br />
Weihnachten/Neujahr (vorlesungsfrei) Mo 22.12.<strong>2003</strong> - <strong>04</strong>.01.20<strong>04</strong><br />
Semesterende: 31.03.20<strong>04</strong><br />
Professor Dr. Alfred Richartz<br />
2
Sprechzeiten <strong>der</strong> Lehrkräfte<br />
Name Funktion/Bereich Sprechzeit Telefon E-Mail<br />
Albert, Dr. Katrin Wiss. Mitarbeiterin<br />
Sportpädagogik<br />
Di 13.00 - 14.00 Uhr 31632 albert@rz.uni-leipzig.de<br />
Alfermann, Prof. Dr.<br />
Dorothee<br />
Leiterin des Instituts für<br />
Sportpsychologie und<br />
Sportpädagogik und<br />
Verantwortliche des FG<br />
Sportps ychologie<br />
Do 9.00 - 11.00 Uhr 97-31633 alferman@rz.uni-leipzig.de<br />
Bartel, Dr. Wolfgang Verantwortlicher FG Freizeit-,<br />
Präventions- und Fitnesssport<br />
Do 13.30 - 15.30 Uhr 97-31676 barthel@rz.uni-leipzig.de<br />
Beise, Dr. Detlef FG Schwimmsport Di 15.00 – 16.00 Uhr<br />
Mi 15.00 – 16.00 Uhr<br />
97-31722 beise@rz.uni-leipzig.de<br />
Busse, Prof. Dr.<br />
Martin<br />
Leiter des Instituts für<br />
Sportmedizin und<br />
Verantwortlicher des FG Sportund<br />
Leistungsmedizin,<br />
präventive und rehabilitative<br />
Medizin<br />
nach Vereinbarung 97-31661 busse@rz.uni-leipzig.de<br />
Dietze, Dr. Jürgen Verantwortlicher FG<br />
Schwimmsport<br />
Mi 14.45 - 15.45 Uhr 97-31721 dietze@rz.uni-leipzig.de<br />
Dubois, Karina FG Sportpädagogik 97-31646 dubois@rz.uni-leipzig.de<br />
Fritsch, Andreas Computerpool nach Vereinbarung 97-31698 fritsch@rz.uni-leipzig.de<br />
Graf, Silke FG Gymnastik/Tanz nach Vereinbarung 97-31743 sgraf@rz.uni-leipzig.de<br />
Härtig, Dr. Roswitha FG Gerätturnen/<br />
Gymnastik/Tanz (Gerätturnen)<br />
nach Vereinbarung 97-31710 haertig@rz.uni-leipzig.de<br />
Hartmann, Dr.<br />
Christian<br />
Verantwortlicher FG<br />
Sportmotorik<br />
Mo 14.15 - 15.10 Uhr<br />
Mi 11.00 - 12.00 Uhr<br />
97-31672 chart@rz.uni-leipzig.de<br />
Herrmann, Doz. Dr.<br />
Hartmut<br />
Verantwortlicher FG<br />
Sportbiomechanik/<br />
-informatik<br />
Mo 14.00 - 15.00 Uhr 97-31754 hherman@rz.uni-leipzig.de<br />
Hobusch, Dr. Peter FG Sportspiele (Tennis) nach Vereinbarung 97-31703 hobusch@rz.uni-leipzig.de<br />
Hoffmann, Dr. Bernd Verantwortlicher FG<br />
Leistungssport<br />
Di 11.00 - 12.00 Uhr 97-31675 bhoff@rz.uni-leipzig.de<br />
Hofmann, Dr.<br />
FG Schulsport Mo 14.00 - 15.00 Uhr 97-31643 shoff@rz.uni-leipzig.de<br />
Sieghart<br />
Mi 14.00 - 15.00 Uhr<br />
Innemoser, Prof. Dr.<br />
Jürgen<br />
Leiter des Instituts für<br />
Rehabilitationssport,<br />
Sporttherapie und<br />
Behin<strong>der</strong>tensport<br />
Di 11.30 - 12.30 Uhr<br />
Do 13.30 - 14.30 Uhr<br />
97-31651 jinnen@rz.uni-leipzig.de<br />
Jahn, Dr. Hans-<br />
Dieter<br />
Institut für Rehabilitationssport,<br />
Sporttherapie und<br />
Behin<strong>der</strong>tensport<br />
Fr 10.00 - 11.00 Uhr 97-31652 jahn@rz.uni-leipzig.de<br />
Jaitner, Dr. Thomas FG Leichtathletik nach Vereinbarung 97-31711 jaitner@rz.uni-leipzig.de<br />
Kaeubler, Wolf-Dieter<br />
3<br />
Verantwortlicher<br />
Sportmotoriklabor<br />
Di 11.00 - 12.00 Uhr 97-31673 kaeubler@rz.uni-leipzig.de<br />
Keine, Dr. Steffen FG Kraftsport nach Vereinbarung 97-31706 keine@rz.uni-leipzig.de<br />
Kirchgässner, Prof.<br />
Dr. Helmut<br />
Leiter des Instituts für<br />
Bewegungs- und<br />
Trainingswissenschaft <strong>der</strong><br />
Sportarten<br />
nach Vereinbarung 97-31701 kirchg@rz.uni-leipzig.de<br />
Kirchgässner, Prof.<br />
Dr. Helmut<br />
Verantwortlicher FG Kampf- und<br />
Kraftsport<br />
nach Vereinbarung 97-31701 kirchg@rz.uni-leipzig.de<br />
Kleinschmidt, Nadine Wiss. Hilfskraft FG<br />
Sportpsychologie<br />
97-31638 stiller@rz.uni-leipzig.de<br />
Köthe, Dr. Regine Sport- und Leistungsmedizin,<br />
präventive und rehabilitative<br />
Medizin<br />
Di 9.30 - 10.30 Uhr 97-318921 koethe@rz.uni-leipzig.de<br />
Krug, Prof. Dr.<br />
Jürgen<br />
Leiter des Instituts für<br />
Allgemeine Bewegungs- und<br />
Trainingswissenschaft<br />
Mo 14.30 - 15.30 Uhr 97-31671 krug@rz.uni-leipzig.de<br />
Kuntoff, Dr. Rüdiger Verantwortlicher FG<br />
Leichtathletik<br />
nach Vereinbarung 97-31715 kuntoff@rz.uni-leipzig.de<br />
Kutschke, Dr. Frank Verantwortlicher FG<br />
Sportmanagement<br />
Mi 13.00 - 14.00 Uhr 97-31642 kutschke@rz.uni-leipzig.de<br />
Leske, Dr. Reinhard Verantwortlicher FG<br />
Gerätturnen/Gymnastik/ Tanz<br />
(Gerätturnen)<br />
nach Vereinbarung 97-31710 rleske@rz.uni-leipzig.de<br />
List, Frauke Gymnastik nach Vereinbarung 97-31709<br />
Luppa, Prof. Dr.<br />
Dietmar<br />
Verantwortlicher FG<br />
Sportbiochemie,<br />
Leistungsphysiologie und<br />
Sportanatomie<br />
Mi 9.00 - 11.00 Uhr 97-31665 luppa@rz.uni-leipzig.de<br />
Meier, Hans-Werner FG Sportspiele (Fußball) Mo 8.30 - 9.00 Uhr 97-31702 hwmeier@rz.uni-leipzig.de<br />
Minow, Dr. Hans-<br />
Joachim<br />
Verantwortlicher FG<br />
Trainingslehre<br />
Mo 14.15 - 14.45 Uhr 97-31674 minow@rz.uni-leipzig.de<br />
Müller, Prof. Dr. Verantwortliche FG Schulsport Do 10.00 - 11.00 Uhr 97-31641 chrismue@rz.uni-leipzig.de<br />
Christina<br />
nach Vereinbarung<br />
Neiling, Wolf-Dietrich FG Sportspiele (Kleine Spiele) nach Vereinbarung 97-317<strong>04</strong>
Nicklas, Ingrid FG Gymnastik/Tanz nach Vereinbarung 97-31760<br />
Nitzsche, Prof. Dr. Verantwortlicher FG Skisport Mo 9.15 - 10.15 Uhr 97-31731 klaus.nitzsche@rz.uni-<br />
Klaus<br />
Mo 13.15 - 14.15 Uhr<br />
leipzig.de<br />
Panzer, Dr. Stefan Institut ABTW nach Vereinbarung 97-31681 panzer@rz.uni-leipzig.de<br />
Radon, Dr. Manfred FG Sportbiochemie,<br />
Leistungsphysiologie und<br />
Sportanatomie<br />
Di 10.00-11.00 97-31667 radon@rz.uni-leipzig.de<br />
Rauchmaul, Dr.<br />
Heiko<br />
FG Sportspiele (Basketball) nach Vereinbarung 97-31773 hrauch@rz.uni-leipzig.de<br />
Rauscher, Dr.<br />
Monika<br />
FG Sportbiomechanik/<br />
-informatik<br />
Mo 13.00 - 14.00 Uhr<br />
Do 15.00 - 15.30 Uhr<br />
97-31678 mrausche@rz.uni-leipzig.de<br />
Richartz, Prof. Dr.<br />
Alfred<br />
Verantwortlicher FG<br />
Sportpädagogik<br />
Di 14.00 - 15.00 Uhr 97-31631 arichartz@rz.uni-leipzig.de<br />
Saborowski, Dr. FG Schwimmsport Di 10.00 - 11.00 Uhr 97-31726 saborows@rz.uni-leipzig.de<br />
Cathleen<br />
Do 14.00 - 15.00 Uhr<br />
Schega, Dr. Lutz Institut für Rehabilitationssport,<br />
Sporttherapie und<br />
Behin<strong>der</strong>tensport<br />
nach Vereinbarung 97-31653 schega@rz.uni-leipzig.de<br />
Schlegel, Dr. Norbert Leiter des FG Sportspiele<br />
(Handball)<br />
nach Vereinbarung 97-31705 nschleg@rz.uni-leipzig.de<br />
Schmidt, Dr. Hans-<br />
Ulrich<br />
FG Wasserfahrsport (Ru<strong>der</strong>n) Mi 13.30 - 14.30 Uhr 97-31732 uschmidt@rz.uni-leipzig.de<br />
Schmidt, Dr. Karl-<br />
Heinz<br />
Verantwortlicher FG<br />
Wasserfahrsport (Touristik)<br />
SS nach Vereinbarung<br />
WS Mo 13.30-15.00 Uhr<br />
Di 13.30-15.00 Uhr<br />
97-31733 khsch@rz.uni-leipzig.de<br />
Schumann, Rudi FG Sportspiele (Volleyball) nach Vereinbarung 97-31773 rschuh@rz.uni-leipzig.de<br />
Schürmann, PD Dr.<br />
Volker<br />
Verantwortlicher FG<br />
Sportgeschichte/<br />
Sportphilosophie<br />
Mi 12.00 - 13.00 Uhr<br />
und nach Vereinbarung<br />
97-31625 vschuer@rz.uni-leipzig.de<br />
Sperling, Dr. Wolfram FG Sportpädagogik Do 9.00 - 10.00 Uhr 97-31646 sperling@rz.uni-leipzig.de<br />
Stiller, Jeannine Wiss. Hilfskraft FG<br />
Sportpsychologie<br />
97-31655 stiller@rz.uni-leipzig.de<br />
Streicher, Heike FG Freizeit, Präventions- und<br />
Fitnesssport<br />
Di 11.00 - 12.00 Uhr 97-31680 hstreich@rz.uni-leipzig.de<br />
Tiedtke, Manfred FG Leichtathletik nach Vereinbarung 97-31714 tiedtke@rz.uni-leipzig.de<br />
Tzschoppe, Dr. Petra Verantwortliche FG<br />
Sportsoziologie<br />
Mi 10.00 - 11.30 Uhr 97-31637 tzschopp@rz.uni-leipzig.de<br />
Ulbricht, Dr. Hans-<br />
Jürgen<br />
FG Kampfsport nach Vereinbarung 97-31708 ulbricht@rz.uni-leipzig.de<br />
Würth, Dr. Sabine FG Sportps ychologie Do 10.00 - 11.00 Uhr 97-31636 wuerth@rz.uni-leipzig.de<br />
Zehl, Dr. Uwe FG Sportps ychologie Mo - Do<br />
97-31647 zehl@rz.uni-leipzig.de<br />
Carsten<br />
9.00 - 10.00 Uhr<br />
Zimmermann, S.<br />
Dipl.-Sportl.)<br />
Institut für Rehabilitationssport,<br />
Sporttherapie und<br />
Behin<strong>der</strong>tensport<br />
nach Vereinbarung 97-31659 szimmer@rz.uni-leipzig.de<br />
Sprechzeiten <strong>der</strong> Studienfachberatung<br />
Diplom Doz. Dr. Jürgen Dietze Schwimmhalle, Raum<br />
108<br />
Mi 15.30 – 16.30 Uhr<br />
Magister Dr. Christian Hartmann B 209/l,<br />
Mo 14.15 - 15.10 Uhr<br />
Lehramt Prof. Dr. Christina Müller A 302/1 (über<br />
Schärttnerhalle)<br />
Do 11.00 - 12.00 Uhr<br />
und nach<br />
Vereinbarung<br />
4<br />
97-31721 dietze@rz.uni-leipzig.de<br />
97-31672 chart@rz.uni-leipzig.de<br />
97-31641 chrismue@rz.uni-leipzig.de<br />
Sprechzeiten für ein Teilstudium im Ausland (SOKRATES/ERASMUS)<br />
Dr. Sabine Würth<br />
Raum A210c (Mentalstudio)<br />
Donnerstag, 10:00 bis 11:00<br />
Tel. 97 31 636<br />
wuerth@rz.uni-leipzig.de
Sprechzeiten <strong>der</strong> Sekretariate<br />
Name, Vorname Institut Sprechzeit Telefon E-Mail<br />
Edelmann, Karla Institut für Bewegungs- und<br />
Trainingswissenschaft <strong>der</strong><br />
Sportarten<br />
siehe Aushang 97-31700 edelmann@rz.unileipzig.de<br />
Gerlach, Ulla Institut für Sportmedizin Mo – Fr 9.30 – 10.30 97-31660 gerlach@rz.unileipzig.de<br />
Raabe, Petra Institut für Sportpsychologie und<br />
Sportpädagogik<br />
Mo - Fr 9.00 - 11.00 Uhr 97-31630 praabe@rz.uni-leipzig.de<br />
Radszat, Ellen Institut für Rehabilitationssport,<br />
Sporttherapie und<br />
Behin<strong>der</strong>tensport<br />
Mo/Di/Do jeweils<br />
8.00 - 10.00 Uhr<br />
Mi 13.00 - 15.00 Uhr<br />
97-31650 radszat@rz.unileipzig.de<br />
Rother, Birgit Institut für Bewegungs- und<br />
Trainingswissenschaft <strong>der</strong><br />
Sportarten (Wasserfahrsport/<br />
Wintersport/Schwimmsport)<br />
Bootshaus<br />
Mo-Do 13.30-15.00 Uhr<br />
Schwimmhalle<br />
Mo/Di u. Do/Fr<br />
10.00 - 11.00 Uhr<br />
97-31720 rother@rz.uni-leipzig.de<br />
Schicke, Helga Institut für Bewegungs- und<br />
Trainingswissenschaft <strong>der</strong><br />
Sportarten (Kampfsport)<br />
nach Vereinbarung 97-31707 hschicke@rz.unileipzig.de<br />
Wolfsdorf, Evelyn Institut für Allgemeine Bewegungsund<br />
Trainingswissenschaft<br />
Di 10.00 - 11.00 Uhr<br />
Do 10.00 - 11.00 Uhr<br />
97-31670 wolfsdorf@rz.unileipzig.de<br />
Institut für Sportpsychologie und Sportpädagogik<br />
Name Funktion Tel. Nr. e- mail Sprechzeit<br />
Prof. Dr. Dorothee<br />
Alfermann<br />
Prodekanin<br />
Institutsleiterin/ Leiterin<br />
FG Sportpsychologie<br />
0341/ 9731633 alferman@rz.unileipzig.de<br />
5<br />
Donnerstag,9.00-10.00 Uhr<br />
nach Vereinbarung<br />
Dr. Sabine Würth Wiss. Assistent 0341/9731636 wuerth@rz.unileipzig.de<br />
Donnerstag,9.00-10.00Uhr<br />
Dr. Uwe Carsten Techn. Angestellter für 0341/9731647 zehl@rz.uni- Montag- Donnerstag,<br />
Zehl<br />
Lehre und Forschung<br />
leipzig.de 9.00-10.00Uhr<br />
Petra Raabe Sekretärin<br />
0341/9731630 praabe@rz.uni- Montag- Freitag,<br />
Sportpsychologie und<br />
Sportpädagogik<br />
leipzig.de 9.00-11.00Uhr<br />
Prof. Dr. Christina Leiterin FG Schulsport 0341/9731641 chrismue@rz.uni- Donnerstag,11.00-12.00<br />
Müller<br />
leipzig.de Uhr<br />
Dr. Sieghart Wissenschaftl. Mitarbeiter 0341/9731643 shoff@rz.uni- Montag, 14.00-15.00 Uhr<br />
Hofmann<br />
leipzig.de Mittwoch,14.00-16.00Uhr<br />
Karla Edelmann Sekretärin FG Schulsport 0341/9731640 edelmann@rz.unileipzig.de<br />
Prof.Dr.Alfred Leiter FG Sportpädagogik 0341/9731631 arichartz@uni- Nach Vereinbarung<br />
Richartz<br />
leipzig.de<br />
Katrin Albert Wissenschaftl.<br />
0341/9731632 albert@rz.uni- Dienstag,11.00-13.00 Uhr<br />
Mitarbeiterin<br />
leipzig.de<br />
Dr. Wolfram Sperling Wissenschaftl. Mitarbeiter 0341/9731646 sperling@rz.uni- Donnerstag, 10.00-12.00<br />
leipzig.de Uhr<br />
Dr. Petra Tzschoppe Leiterin FG Sportsoziologie 0341/9731637 tzschopp@rz.unileipzig.de<br />
Mittwoch,10.00-12.00 Uhr<br />
Dr. Frank Kutschke Leiter FG<br />
0341/9731642 kutschke@rz.uni- Mittwoch,13.00-14.00Uhr<br />
Sportmanagement<br />
leipzig.de<br />
Nadine Kleinschmidt Wissenschaftl. Hilfskraft 0341/9731632 kleinsch@rz.unileipzig.de<br />
Ines Pfeffer Wissenschaftl. Hilfskraft 0341/9731656 pfeffer@rz.unileipzig.de<br />
nach Vereinbarung<br />
HD Dr. Volker Leiter FG Sportphilosophie/ 0341/9731625 vschuer@rz.uni- Mittwoch, 12.00-13.00Uhr<br />
Schürmann Sportgeschichte<br />
leipzig.de<br />
Jeannine Stiller Wissenschaftl. Hilfskraft 0341/9731655 stiller@rz.unileipzig.de<br />
Nach Vereinbarung
Wichtige Informationen:<br />
Öffnungszeiten Prüfungsamt (Herr Dr. H. Schicke):<br />
Dienstag und Donnerstag jeweils von 9.00 bis 11.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr<br />
Bibliotheken:<br />
Universitätsbibliothek Leipzig - Zweigstelle Sportwissenschaft<br />
Jahnallee 59, <strong>04</strong>109 Leipzig<br />
Tel.: (0341) 97-31624 (Ausleihe) Fax: (0341) 97-31628<br />
(0341) 97-30635 Mail: zbspowi@ub.uni-leipzig.de<br />
Öffnungszeiten: Ausleihe: Montag bis Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr<br />
Freitag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr<br />
Lesesäle: Montag bis Donnerstag 10.00 - 18.00 Uhr<br />
Freitag 10.00 - 16.00 Uhr<br />
Universitätsbibliothek Leipzig - Zweigstelle Erziehungswissenschaft (Reha-Studies)<br />
Karl-Heine-Straße 22 b, <strong>04</strong>229 Leipzig<br />
Tel.: (0341) 341 97-30674 Mail: zberz@ub.uni-leipzig.de<br />
Fax: (0341) 341 97-30689<br />
Öffnungszeiten: Ausleihe: Montag bis Freitag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr<br />
Lesesaal: Montag bis Donnerstag 10.00 - 18.00 Uhr<br />
Freitag 10.00 - 16.00 Uhr<br />
Bibliothek des Institutes für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT)<br />
(spezielle sportwissenschaftliche Literatur)<br />
Karl-Heine-Straße 22 b, <strong>04</strong>229 Leipzig<br />
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr<br />
Freitag 10.00 - 12.00 Uhr<br />
Deutsche Bücherei Leipzig - Präsenzbibliothek. Nutzung <strong>der</strong> Beständen nur in den Lesesälen<br />
(deutschsprachige Literatur)<br />
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 Uhr - 22.00 Uhr<br />
Samstag 9.00 Uhr - 18.00 Uhr<br />
Veranstaltungen/Kolloquien an <strong>der</strong> <strong>Fakultät</strong>:<br />
Monatlich werden an <strong>der</strong> <strong>Sportwissenschaftliche</strong>n <strong>Fakultät</strong> wissenschaftliche Veranstaltungen durchgeführt.<br />
Diese finden in Form von <strong>Fakultät</strong>s- und Institutskolloquien, jeweils am 1. und 3. Dienstag des Monats<br />
(<strong>Fakultät</strong>skolloquium.) und am 1., 2. o<strong>der</strong> 4. Montag des Monats (Institutskolloquium) statt.<br />
Genaue Termine und Themen entnimmt man am „Aushang des Dekanats“ (erster Schaukasten, links neben 1.<br />
Studienjahr) o<strong>der</strong> an den Institutsaushängen. Kolloquien werden zu allgemeinen Themen des Sports ebenso<br />
gehalten, wie zu speziellen, es kommen auch Gastdozenten zu Wort.<br />
Beachtet werden sollten auch Hinweise dazu im Internet, die Aushänge überregionaler Veranstaltungen und das<br />
„Studium universale“ an <strong>der</strong> Uni Leipzig.<br />
För<strong>der</strong>verein „Gesellschaft <strong>der</strong> Freunde <strong>der</strong> Sporthochschule Leipzig e.V.“<br />
Der För<strong>der</strong>verein „Gesellschaft <strong>der</strong> Freunde <strong>der</strong> Sporthochschule Leipzig e.V.“ ist durch seine Satzungen auf<br />
Aufgabenstellungen zur Unterstützung <strong>der</strong> Aus- und Weiterbildung, <strong>der</strong> Forschung und Wissenschaftsentwicklung<br />
sowie die För<strong>der</strong>ung des wissenschaftlichen Nachwuchses an <strong>der</strong> <strong>Sportwissenschaftliche</strong>n <strong>Fakultät</strong> <strong>der</strong><br />
Universität Leipzig orientiert.<br />
Im September 1991 wurde <strong>der</strong> Verein gegründet und hat seit seinem Bestehen die Entwicklung <strong>der</strong><br />
<strong>Sportwissenschaftliche</strong>n <strong>Fakultät</strong> durch vielfältige Aktivitäten geför<strong>der</strong>t (z. B. Imagebroschüre <strong>der</strong> <strong>Fakultät</strong>,<br />
Studentenwettstreit, „Meinel-Symposium 1998“, „75 Jahre Sportwissenschaft 2000“).<br />
Die Einbeziehung von Studierenden in die Vereinstätigkeit ist wesentliches Anliegen. Informationen zur<br />
Mitgliedschaft und Mitarbeit sind bei Professor Dr. Riecken (Vorsitzen<strong>der</strong>) und Dr. Kutschke (Schatzmeister) zu<br />
erhalten.<br />
6
Auslandsstudium/Erasmus/Sokrates-Beratung:<br />
Im Rahmen des ERASMUS/SOKRATES-Programms <strong>der</strong> EU können Studierende unserer Universität ein<br />
Teilstudium im Ausland – in <strong>der</strong> Regel ein o<strong>der</strong> zwei Semester –absolvieren. Die <strong>Sportwissenschaftliche</strong> <strong>Fakultät</strong><br />
unterhält zur Zeit zu sieben europäischen Partneruniversitäten Beziehungen mit ERASMUS-Verträgen. Für<br />
Interessenten an einer sportpsychologischen Weiterbildung besteht die Möglichkeit zur Erlangung des „European<br />
Masters Degree in Exercise and Sport Psychology“, das ebenfalls mit mind. einem Auslandssemester verbunden<br />
ist. ERASMUS-Koordinatorin an <strong>der</strong> <strong>Sportwissenschaftliche</strong>n <strong>Fakultät</strong> ist Frau Dr. Sabine Würth. Bei ihr erhalten<br />
Sie alle notwendigen Informationen zu Bedingungen und Bewerbungsmodalitäten für ein ERASMUS-Teilstudium<br />
im Ausland. Es lohnt sich aber auch, mal bei an<strong>der</strong>en <strong>Fakultät</strong>en vorbeizuschauen, da diese ebenfalls<br />
Austauschprogramme vermitteln. Interessenten an einem Studienaufenthalt in außereuropäischen Län<strong>der</strong>n bzw.<br />
Län<strong>der</strong>n, die nicht in das genannte EU-För<strong>der</strong>programm eingeglie<strong>der</strong>t sind, können sich auch direkt an das<br />
Akademische Auslandsamt <strong>der</strong> Universität Leipzig wenden.<br />
Fachschaft Sportwissenschaft<br />
Die Fachschaft Sportwissenschaft besteht aus StudentInnen. Wir stehen euch bei allen Fragen und Problemen<br />
zur Seite, die im Laufe des Studiums anfallen und helfen vor allem bei Fragen, die das Studium betreffen.<br />
Natürlich können wir euch auch Hilfe vermitteln, wenn größere Probleme auftreten<br />
(Rechtsberatung/Sozialberatung usw.). Da die meisten von uns schon etwas älteren Semesters sind, suchen wir<br />
dringend Studierende, die interessiert sind, sich an <strong>der</strong> <strong>Fakultät</strong> zu engagieren und den Einflussbereich von<br />
StudentInnen auszuschöpfen.<br />
Unsere Organisationsstruktur könnt Ihr <strong>der</strong> folgenden Übersicht entnehmen.<br />
Eure Vertretung in<br />
Studienkommission,<br />
<strong>Fakultät</strong>srat und<br />
StudentInnenrat<br />
Kultur<br />
7<br />
Verbindung<br />
zwischen Studis und<br />
<strong>Fakultät</strong><br />
Information<br />
Hilfe bei UniProblemen<br />
Und: Je<strong>der</strong> kann sich in seiner Kreativität voll entfalten und seine Interessen wahren. Wer also <strong>der</strong> Meinung ist,<br />
die <strong>Sportwissenschaftliche</strong> <strong>Fakultät</strong> braucht Semesteranfangs-, Semesterabschluss-, Semestermittendrinpartys,<br />
Weihnachtsvorlesungen, Fußball-, Volleyball-, Tennisturniere, Jahrgangsturniere, Radwan<strong>der</strong>ungen, einen<br />
Lehrenden-Studierenden-Stammtisch, Praktikumbörsen usw. kann sich in <strong>der</strong> Fachschaft voll einbringen.<br />
Die Fachschaft finanziert sich übrigens aus Beiträgen von EUCH (€ 1,50 pro StudentIn, pro Semester), die durch<br />
den STURA-Beitrag jedes Semester erhoben werden (€ 7,50).<br />
Nun wisst Ihr alles, kommt doch einfach mal vorbei (H 097, nahe Kopierern in Richtung C-Halle), o<strong>der</strong> mailt<br />
einfach an: fsr-sport@gmx.net<br />
DER ELFERRAT DER „DHfK“<br />
Entgegen aller Gerüchte feiern die nicht nur, manchmal arbeiten sie auch (meist Montags ab 21.00 Uhr). Unter<br />
diese Arbeit fallen:<br />
gastronomische, technische, sportliche und kreative Vorbereitung des (größten) Studentenfaschings Leipzigs<br />
Mithilfe und Organisation diverser studentischer Veranstaltungen<br />
Darüber hinaus könnt Ihr Euch im Filmen, Schneiden und Vertonen, Tanzen und kreativen Verbiegen<br />
ausprobieren !!! Neue Ideen werden immer gesucht ... !!!
StudentInnenrat <strong>der</strong> Uni Leipzig<br />
Der StudentInnenrat (STURA) <strong>der</strong> Uni ist die Studierenden-Vertretung aller Studierenden <strong>der</strong> UNI Leipzig (Tel:<br />
0341/9737850, Sitz: Hauptgebäude Augustusplatz).<br />
In ihm sind Studierende aller Fachrichtungen vertreten, das Parlament des STURA‘s nennt sich STURA-Plenum<br />
und tagt 14-tägig Dienstags (öffentlich, Felix-Klein-Hörsaal). In diesem Plenum sind Vertreter von Fachschaften<br />
und Referenten Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Referent/Referentin (Kultur; Soziales; Frauen/Lesben; Ökologie/Verkehr; Finanzen; Hochschulpolitik;<br />
Öffentlichkeit; Sport; ausländische Studierende) kann je<strong>der</strong> Student werden und <strong>der</strong> Job wird in <strong>der</strong> Regel<br />
vergütet. Des weiteren gibt es noch STURA-Sprecher, die sozusagen unsere Repräsentanten sind und vor allem<br />
mit Gesprächen an wichtigen Stellen beschäftigt sind.<br />
Das STURA-Plenum behandelt zum größten Teil Probleme uniweit (Fremdsprachenzentrum, Nachwuchsarbeit,<br />
Sächsisches Hochschulgesetz, Evaluation, Finanzen usw.), unterstützt studentische Initiativen (AK Foto, AK<br />
Hochschwul, Kino) und studentische Basisarbeit. Vor allem ist es aber auch ein reger Austausch mit an<strong>der</strong>en<br />
Fachbereichen nach dem Motto: „Wie funktioniert es bei Euch?“<br />
Der STURA hat akute „Nachwuchsprobleme“ und freut sich über jede Mitarbeit.<br />
Neben dem STURA sind Gremien an <strong>der</strong> Universität durch studentische Vertreter zu besetzten, so in Senat<br />
(höchstes Gremium), Bibliothekskommission, Semesterticketausschuss usw. Wenn Ihr daran interessiert seid,<br />
wendet Euch an die SprecherInnen des STURAS o<strong>der</strong> an die Fachschaft.<br />
8
Studienplanung und Prüfungen<br />
Diplomstudium<br />
Studienablaufplan (Grundstudium)<br />
Semester<br />
Lehrgebiete Vermittlungsform 1. 2. 3. 4. Nachweis/<br />
Prüfungsleistungen<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Sportpädagogik<br />
<strong>der</strong><br />
Grundlagen <strong>der</strong> Sportpsychologie<br />
V/S<br />
V/S<br />
V/S<br />
2<br />
-<br />
2<br />
2<br />
9<br />
-<br />
2<br />
-<br />
-<br />
1 LN/EN<br />
1 LN/EN<br />
Sportsoziologie V/S 2 - - - 1 LN<br />
Sportphilosophie V/S 2 - - - 1 LN<br />
Sportgeschichte V/S 2 - - - 1 LN<br />
Sportrecht und Verwaltungslehre V/S - - - 2 1 LN<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Sportmedizin<br />
Grundlagen <strong>der</strong><br />
- Anatomie V/S 3 - - - 1 LN<br />
- Physiologie V/S - - 2 - 1 LN<br />
- Sportmedizin V/S - - 2 - 1 ZN<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Bewegungs- und<br />
Trainingswissenschaft<br />
- Sportbiomechanik V/S/Ü - - 2 2 1 EN<br />
- Sportmotorik V/S - 2 - - 1 EN<br />
Trainingswissenschaft V/S/Ü - - 4 - 1 EN<br />
Sportstatistik/-informatik V/S - - 2 - 1 LN<br />
Forschungsmethodik S/Ü - - - 2 1 LN<br />
Sportdidaktik V/S - - - 2 1 ZN<br />
Bewegungs- und Trainingswissenschaft<br />
<strong>der</strong> Sportarten<br />
Gerätturnen Ü/S 2 2 - - 1 LN/EN<br />
Gymnastik/Tanz Ü/S - 2 2 - 1 LN/EN<br />
Leichtathletik Ü/S 2 2 - - 1 LN/EN<br />
Schwimmen Ü/S 2 2 - - 1 LN/EN<br />
1. Mannschaftssportspiel Ü/S 2 2 - - 1 LN/EN<br />
2. Mannschaftssportspiel<br />
(Volleyball o<strong>der</strong> Handball o<strong>der</strong><br />
Fußball o<strong>der</strong> Hockey o<strong>der</strong><br />
Basketball)<br />
Ü/S - - 2 2 1 LN/EN<br />
Rückschlagspiel<br />
(Tennis o<strong>der</strong> Tischtennis o<strong>der</strong><br />
Badminton)<br />
Prüfung<br />
1. Fachprüfung<br />
Grundlagen<br />
Sportpsychologie o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Sportpädagogik<br />
2. Fachprüfung<br />
Sportmedizin<br />
3. Fachprüfung<br />
Grundlagen <strong>der</strong><br />
Bewegungs- und<br />
Trainingswissenschaft<br />
4. Fachprüfung<br />
Gerätturnen o<strong>der</strong><br />
Gymnastik/Tanz<br />
o<strong>der</strong> Schwimmen<br />
Leichtathletik<br />
5. Fachprüfung<br />
ein Mannschaftssportspiel<br />
Ü/S - - 2 2 1 LN/EN 6. Fachprüfung<br />
Rückschlagspiel o<strong>der</strong><br />
Wahlsportart<br />
1. Wahlsportart Ü/S 2 2 - - 1 LN/EN<br />
2. Wahlsportart Ü/S - - 2 2 1 LN/EN<br />
Kleine Spiele Ü/S 1 - - - 1 LN<br />
Hinzu kommen außerhalb <strong>der</strong> bilanzierten Semesterwochenstunden:<br />
1 Skisportlehrgang V/Ü/S<br />
1 Wasserfahrsportlehrgang V/S/Ü<br />
1 Berufsorientiertes Praktikum<br />
LN = Leistungsnachweis<br />
EN = Endnachweis<br />
ZN = Zwischennachweis<br />
22 22 20 16
Studienschwerpunkt Leistungssport (Hauptstudium)<br />
Stundenverteilung <strong>der</strong> Lehrgebiete im Studienschwerpunkt<br />
Studienschwerpunktübergreifende Lehrveranstaltungen (13 SWS)<br />
Pflicht Wahlpflicht<br />
Sportpsychologie 2 SWS<br />
Sportsoziologie 1 SWS<br />
Sportmedizin 1 SWS<br />
Trainingswissenschaft IIa und IIb 3 SWS<br />
Bewegungswiss./Sportbiomechanik 2 SWS<br />
Angewandte Sportstatistik/-informatik 2 SWS<br />
Sportdidaktik 2 SWS<br />
Studienschwerpunktbezogene Lehrveranstaltungen (48 SWS + 8 Wochen)<br />
Sportpädagogik des LS 4 SWS<br />
Sportpsychologie des LS 2 SWS<br />
Sportmedizin des LS 4 SWS<br />
Theorie und Methodik des Trainings im LS 2 SWS<br />
Große Spezialisierung: 20 SWS<br />
1. KSP (8 SWS)<br />
2. KSP (8 SWS)<br />
FV (4 SWS)<br />
Kleine Spezialisierung<br />
Projekt/Forschungsmethodik 4 SWS<br />
Berufseinführendes Praktikum 4 SWS<br />
Fachpraktikum 8 Wochen<br />
10<br />
33 SWS 28 SWS
Studienschwerpunkt Leistungssport (Hauptstudium)<br />
Empfehlungen zur Semesterverteilung <strong>der</strong> Lehrgebiete (Stundenplanung)<br />
Studienschwerpunktübergreifende Lehrveranstaltungen<br />
Vermittlungsform 5. 6. 7. 8. Nachweis Prüfung<br />
Sportpsychologie V/S 2 1 EN 3. FP: Sportpsychologie<br />
Sportsoziologie S 1 1 LN<br />
Sportmedizin S 1 1 EN 1. FP: Sportmedizin<br />
Trainingswissenschaft IIa und IIb V/S 2 1 2 LN 2. FP: Bewegungs- und Trainingswiss.<br />
Bewegungswiss./Sportbiomechanik V/S 2 1 EN<br />
Angewandte Sportstatistik/<br />
-informatik<br />
V/S 2 1 LN<br />
Sportdidaktik V/S 2 1 LN<br />
Studienschwerpunktbezogene Lehrveranstaltungen<br />
Sportpädagogik des LS V/S 4 1 EN 4. FP: Sportpädagogik<br />
Sportpsychologie des LS V/S 2 1 EN<br />
Sportmedizin des LS V/S 4 1 EN<br />
Theorie und Methodik des Trainings<br />
im LS V/S 2 1 EN<br />
Große Spezialisierung V/S/Ü<br />
1. KSP 8<br />
2. KSP 8<br />
FV 4 1 EN 5. FP<br />
Kleine Spezialisierung 8 1 EN 6. FP<br />
Projekt/Forschungsmethodik 2 2 1 EN<br />
Berufseinführendes Praktikum 2 2 1 LN<br />
11
Studienschwerpunkt Freizeitsport, Präventions- und Fitnesssport (Hauptstudium)<br />
Empfehlungen zur Semesterverteilung <strong>der</strong> Lehrgebiete (Stundenplan)<br />
Lehrkomplexe SWS 5. 6. 7. 8.<br />
1. Studienschwerpunktübergreifend<br />
12<br />
- Sportmedizin<br />
1 x<br />
- Sportmotorik 1 x<br />
- Sportbiomechanik 1 x<br />
- Sportpsychologie 2 x<br />
- Sportsoziologie 1 x<br />
- Sportinformatik<br />
2. Generelle Studien<br />
2 x<br />
(fachwissenschaftliche und spez.-theor. Grundlagen) 16<br />
- Sportpädagogik des FPF 2 x<br />
- Sprecherziehung 1 x<br />
- Sportmedizinische Grundlagen des FPF 2 x<br />
- Didaktik/Methodik I des FPF 2 x<br />
- Management im FPF 2 x<br />
- Sportpädagogik/-didaktik des FPF 1 x<br />
- Sportmedizinische Aspekte des FPF 2 x<br />
- Psychologische Aspekte des FPF 2 x<br />
- Didaktik/Methodik II des FPF<br />
3. Einführende Studien<br />
2 x<br />
(theoriegeleitete Praxis, Methodik) 8<br />
- Präventionstraining HKL/SBS 2 x<br />
- Fitnesstraining 2 x<br />
- Sportarten/Trendsportangebote 2 x<br />
- New Games - Freizeitspiele<br />
4. Spezielle Studien<br />
2 x<br />
(wahlobligatorisches Profil) 8<br />
- Präventives Profil 8 x<br />
- Fitnessprofil 8 (x) x x x<br />
- Sportartenprofil 8 (x) x x x<br />
5. Berufseinführendes Praktikum 4 x x (x)<br />
6. Forschungsmethodik II/Projekt 2/2 x x (x)<br />
7. Kleine Spezialisierung (KSP) 8 x x x<br />
8. Weitere Aufgaben<br />
gesamt<br />
- Diplomarbeit (6 Monate)<br />
60<br />
x<br />
- Fachpraktikum (8 Wochen)<br />
x x<br />
- Wettkampfsport (TL II) 1 x<br />
- Didaktik des Schulsports 2 x<br />
- Nachwuchsleistungssport 1 x<br />
Diplomprüfungen<br />
a) Sportmedizin<br />
b) Bewegungs- und Trainingswissenschaft<br />
c) Sportpsychologie<br />
d) Sportpädagogik<br />
e) Große Spezialisierung<br />
f) Kleine Spezialisierung<br />
13
Empfehlungen zur Semesterverteilung <strong>der</strong> Lehrgebiete im GSP Sportmanagement<br />
Lehrgebiet Semester und SWS Nachweise Prüfung<br />
5. 6. 7. 8.<br />
Bewegungs- und Trainingswissenschaft<br />
1.Fachprüfung<br />
- Sportmotorik/Sportbiomechanik II 1 - - - EN (Wahl)<br />
- Trainingswissenschaft II - 2 - - EN<br />
- Trainingswissenschaft III - - 1 - EN<br />
Sportpsychologie 2 - 2 - EN<br />
1.Fachprüfung<br />
Sportsoziologie o<strong>der</strong> Sportgeschichte - 2 - - LN (Wahl)<br />
Pflichtfach Betriebswirtschaftslehre<br />
- Technik des Rechnungswesens 4 - - - LN<br />
- Einführung in die BWL 2 - - - TN<br />
- Unternehmensführung/Einführung - 2 - - LN<br />
Wahl von 2 Lehrgebieten aus:<br />
- Externes Rechnungswesen - (4) - - (LN)<br />
- Internes Rechnungswesen - - (4) - (LN)<br />
- Marketing I (4) - - - (LN)<br />
- Finanzierung und Investition - (4) - - (LN)<br />
- Organisation und Entscheidung - (4) - - (LN)<br />
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2. Fachprüfung<br />
Wahl von 3 Lehrgebieten aus:<br />
- Marketing II - (2) - - (EN)<br />
- Personalwirtschaftslehre - (2) - - (EN)<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Besteuerung - - (2) - (EN)<br />
- Unternehmensführung - Planung und Org. - - (2) - (EN)<br />
- Finanzierung und Investition II - - (2) - (EN)<br />
- Dienstleistungsmanagement - - (2) - (EN)<br />
Öffentliches und privates Recht für<br />
Wirtschaftswissenschaftler 3. Fachprüfung<br />
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 2 - - - LN<br />
- Handels- und Gesellschaftsrecht - 2 - - LN<br />
- Öffentliches Recht - 2 - - LN<br />
- Arbeitsrecht - - 2 - LN<br />
Organisations- und Verwaltungsmanagement<br />
im Sport 4. Fachprüfung<br />
- Organisationslehre/Vereinsmanag. 2 - - - EN<br />
- Managementprozess/Veranstalt.manag. - 2 - - EN<br />
- Angewandte Informatik i. d. Sportverwalt. - 2 - - EN<br />
Sportmarketingmanagement 5. Fachprüfung<br />
- Sportmarketing 2 - - - EN<br />
- Kommunikat.politik/Sportsponsoring - 2 - - EN<br />
- Führ.lehre/Personalmanag. im Sport - - 2 - EN<br />
Berufspraktisches Handeln 6. Fachprüfung<br />
- Forschungsmethodik II/Projektarbeit 1 2 1 - EN<br />
- Berufseinführendes Praktikum - - 4 - EN<br />
- Fachpraktikum - - - 8 Wo. EN<br />
Gesamt je nach Wahl <strong>der</strong> Lehrgebiete 20 18-20 18-20 8 Wo<br />
14
Aufbau des Hauptstudiums B<br />
(nichtpädagogischer Bereich)<br />
Pflicht Wahlpflicht<br />
Studienschwerpunktübergreifende Lehrveranstaltungen (10 SWS)<br />
- Sportmotorik/Sportbiomechanik II 1 SWS<br />
- Trainingswissenschaft II 2 SWS<br />
- Trainingswissenschaft III 1 SWS<br />
- Sportpsychologie 4 SWS<br />
- Sportsoziologie o<strong>der</strong> 2 SWS<br />
- Sportgeschichte 2 SWS<br />
Lehrveranstaltungen im gewählten Studienschwerpunkt (50 SWS)<br />
Wahlpflichtfach Betriebswirtschaftslehre (30 SWS)<br />
Propädeutikum: Technik des Rechnungswesen 4 SWS<br />
- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 2 SWS<br />
- Unternehmensführung/Einführung 2 SWS<br />
Wahl von 2 Lehrgebieten aus:<br />
- Externes Rechnungswesen 4 SWS<br />
- Internes Rechnungswesen 4 SWS<br />
- Finanzierung und Investition 4 SWS<br />
- Marketing I 4 SWS<br />
- Organisation/Entscheidung 4 SWS<br />
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre<br />
Wahl von 3 Lehrgebieten aus:<br />
- Finanzierung und Investition II 2 SWS<br />
- Marketing II 2 SWS<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Besteuerung 2 SWS<br />
- Personalwirtschaftslehre 2 SWS<br />
- Unternehmensführung, -planung und -org. 2 SWS<br />
- Dienstleistungsmanagement 2 SWS<br />
Öffentliches und privates Recht für Wirtschaftswissenschaftler<br />
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 2 SWS<br />
- Handels- und Gesellschaftsrecht 2 SWS<br />
- Öffentliches Recht 2 SWS<br />
- Arbeitsrecht 2 SWS<br />
Sportmanagement (20 SWS)<br />
- Organisationslehre/Vereinsmanagement 2 SWS<br />
- Managementprozess/Veranstalt.manag. 2 SWS<br />
- Angewandte Informatik in <strong>der</strong> Sportverwaltung 2 SWS<br />
- Sportmarketing 2 SWS<br />
- Kommunikationspolitik/Sportsponsoring 2 SWS<br />
- Führungslehre/Personalmanagement im Sport2 SWS<br />
- Forschungsmethodik II/Projektarbeit 4 SWS<br />
- Berufseinführendes Praktikum 4 SWS<br />
Gesamt 44 SWS 16 SWS<br />
- achtwöchiges Fachpraktikum im Berufsfeld des Studienschwerpunktes im 8. Semester<br />
- Wahlpflichtfach als kleinen Studienschwerpunkt Sportmanagement 8 SWS<br />
15
Studienschwerpunkt Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport<br />
(Hauptstudium im Studiengang Diplom-Sportlehrer Sportwissenschaft)<br />
1. Medizinische Veranstaltungen<br />
(verantwortlich: Institut für Sportmedizin <strong>der</strong> <strong>Fakultät</strong>)<br />
1.1 Medizinische Rehabilitation Kurs 1 und 2 (aufbauend) = 3 SWS<br />
(Vorlesungen) SP 2a und 2b (Schein 1.10 und 1.1.1)<br />
1.2 Medizinische Schadens- und Erkrankungslehre spezieller Behin<strong>der</strong>ungen und chronischer<br />
Erkrankungen (Kleine Spezialisierung) = je 1 SWS, SP 8.1, 9.1 (Schein 1.2.0)<br />
1.3 Medizinische Schadens- und Erkrankungslehre spezieller Behin<strong>der</strong>ungen und chronischer<br />
Erkrankungen (Große Spezialisierung, z. Z. Körperbehin<strong>der</strong>ungen (1) und Chronische<br />
Erkrankungen <strong>der</strong> inneren Organe (2) = je 1 SWS (Vorlesungen), SP 10.1 (Schein 1.3)<br />
1.4 (fakultativ) Medizinische Diagnostik im Rehabilitationssport und in <strong>der</strong> Sporttherapie<br />
(Seminar) = 2 SWS<br />
2. Didaktische, pädagogische und methodische Veranstaltungen<br />
2.1 Pädagogische und son<strong>der</strong>pädagogische Aspekte des Sports in Rehabilitation,<br />
Son<strong>der</strong>pädagogik und Therapie (Vorlesung/Seminar) = 2 SWS SP 1a (Schein 1.2)<br />
2.2 Didaktik und Methodik des Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports<br />
(Vorlesung) = 2 SWS, SP 1b (Schein 2.2)<br />
2.3 Spezielle Didaktik und Methodik des Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des<br />
Behin<strong>der</strong>tensports incl. Unterrichtslehre (Große Spezialisierung) = 5 SWS (in 2 Semestern<br />
aufbauend), SP 10.2.1 bis 10.2.3 (Scheine 2.3.0; 2.3.1)<br />
2.4 Spezielle Didaktik und Methodik des Rehabilitationssports, des Behin<strong>der</strong>tensports und <strong>der</strong><br />
Sporttherapie incl. Hospitationen (Kleine Spezialisierungen, zu wählen sind mindestens zwei<br />
Behin<strong>der</strong>ungsgruppen) = je 3 SWS, SP 8.1, 8.2 und 9.1, 9.2) (Scheine 2.4.0; 2.4.1; 6.2.0; 6.2.1)<br />
2.5 Spezielle Didaktik <strong>der</strong> Sportarten und ihre Anwendung im Rehabilitationssport, Sporttherapie<br />
und Behin<strong>der</strong>ungssport mit ausgewählten Behin<strong>der</strong>ungsgruppen (Teil <strong>der</strong> Studien <strong>der</strong> Großen<br />
Spezialisierung); Seminar = 2 SWS, SP 10.5 (Schein 2.3.2)<br />
3 Psychologische und soziologische Veranstaltungen<br />
3.1 Psychologische Aspekte <strong>der</strong> Rehabilitation, des Rehabilitationssports, des Behin<strong>der</strong>tensports<br />
und <strong>der</strong> Sporttherapie (Vorlesung/Seminar) = 2 SWS; (hier verantwortlich: Institut für<br />
Sportpsychologie und Sportpädagogik), SP 4 (Schein 3.1)<br />
3.2 (fakultativ) Spezielle psychologische Methoden in Rehabilitation/Prävention und Rehabilitationssport<br />
(Seminar) = 2 SWS<br />
3.3 (fakultativ) Spezielle psychologische Diagnostik in Rehabilitation/Prävention und Rehabilitationssport<br />
(Seminar) = 2 SWS<br />
3.4 Soziologische Aspekte <strong>der</strong> Rehabilitation, des Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des<br />
Behin<strong>der</strong>tensports (Vorlesung) = 1 SWS, SP 3 (Schein 3.4)<br />
4 Methodenlehre des Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports<br />
4.1 Allgemeine (behin<strong>der</strong>ungs-/erkrankungsübergreifende) Methoden<br />
Seminare mit theoriegeleiteter Praxis = 4 SWS, Teilgebiete: z. B. Mototherapie, Motopädagogik,<br />
Lehrer-/Therapeutenverhalten, Psychologische Regulation (Verhaltensmodifikation, Integrative/<br />
Kommunikative Bewegungstherapie) Einführung in die Medizinische Trainingstherapie, Spezielle<br />
Trainingsmethoden, Entwicklungsneurologische Bewegungstherapie. SP 6 (Schein 4.1.0; 4.1.1)<br />
4.2 Spezielle (behin<strong>der</strong>ungs-/erkrankungsspezifische) Methoden innerhalb <strong>der</strong> Großen<br />
Spezialisierung verbindlich = 2 SWS; Teilgebiete je nach gewählter Behin<strong>der</strong>ungsgruppe:<br />
Mobilitätstraining und -therapie; Hilfsmitteltraining; Methoden <strong>der</strong> Intensitätssteuerung, Atem-/<br />
Sprechtherapie, Spezielle Methoden <strong>der</strong> entwicklungsneurologischen Bewegungstherapie...<br />
SP 10.3 (Schein 4.2)<br />
4.3 Spezielle, behin<strong>der</strong>ungsspezifische Trainings- und Bewegungslehre<br />
Seminare = 4 SWS, verbindliche, aufbauende Veranstaltung mit kleiner Hausarbeit und<br />
Abschlussklausur, SP 7 (Schein 4.3.0; 4.3.1)<br />
5 Diagnostische Verfahren des Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des<br />
Behin<strong>der</strong>tensports<br />
5.1 Allgemeine (behin<strong>der</strong>ungs-/erkrankungsübergreifende) diagnostische Verfahren und ihre<br />
Anwendung; Seminar mit Praxis = 2 SWS<br />
Teilgebiete: Leistungsdiagnostik, Motodiagnostik, Medizinische Diagnostik, Psychologische<br />
Diagnostik SP 5 (Schein 5.1)<br />
5.2 Spezielle (behin<strong>der</strong>ungs-/erkrankungsspezifische) diagnostische Verfahren und ihre<br />
Anwendung (im Rahmen <strong>der</strong> Großen Spezialisierung, behin<strong>der</strong>ungsgruppenspezifisch)<br />
= 2 SWS, SP 10.4 (Schein 5.2)<br />
16
6 Lehrpraxis, Praktika und Projektstudien<br />
6.1 Hospitationen und Lehrübungen (innerhalb <strong>der</strong> Großen Spezialisierung)<br />
= 2 SWS (1-jährig); Anleitung durch hauptamtliches Personal. Notwendig zur Zulassung zur<br />
Examenslehrprobe sind mindestens 3 bis 4 vollständig und selbstständig ausgeführte<br />
Lehrübungen (incl. schriftliche Ausarbeitungen zu den Stundenteilen). Abschluss Examenslehrprobe,<br />
SP 10.6 (Schein 6.1)<br />
6.2 Didaktisch-methodische Fragen <strong>der</strong> Praxis im Rehabilitationssport, Behin<strong>der</strong>tensport und<br />
in <strong>der</strong> Sporttherapie (innerhalb <strong>der</strong> Kleinen Spezialisierungen, angeleitete Hospitationen)<br />
= je 1 SWS, SP 8.3 (9.3), (Scheine 6.2.0; 6.2.1)<br />
6.3 Fachpraktikum in Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport<br />
(zugeordnet <strong>der</strong> Großen Spezialisierung); 210 Stunden, SP 12 (Schein 6.4.0, 6.4.1)<br />
6.4 Projektstudien nach Angebot (zugeordnet zum Schwerpunkt und in Abstimmung mit<br />
„Forschungsmethodik II“ SP 12 (Schein 6.4.0, 6.4.1)<br />
7 Diplomarbeitsstudien<br />
fakultativ: 2 - 6 SWS, SP 13<br />
7.1 Diplomarbeit: Bearbeitungszeit = 6 Monate<br />
17
Regelstudienplan Studienschwerpunkt Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport (Hauptstudium)<br />
Grundstudium<br />
Hauptstudium<br />
5. Semester 6. Semester 7. Semester 8. Semester<br />
(1) (2) schwerpunktübergreifende Veranstaltungen siehe Studienordnung<br />
* Kleiner Schwerpunkt/Wahlbereich<br />
= 8 SWS aus an<strong>der</strong>en SP (SPK 1)<br />
= 12 SWS = I bis VIII Soziologie (3.5)<br />
(2.6/2.6.1/6.2.0)<br />
Veranstaltungen des Studienschwerpunktes „Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport“ = 48 SWS<br />
Behin<strong>der</strong>ungsübergreifende Studien<br />
# - Sportdidaktik und -methodik von Rehabilitations- und Behin<strong>der</strong>tensport und Sporttherapie*(2) (SP 1b/2.2). (2)..............<br />
# - Medizinische Rehabilitation (2)*(SP2a/1.1.0) - Medizinische Rehabilitation (1) (SP 2b/1.1.1)<br />
- Rehabilitationssoziologie (1) (SP 3/3.4) - Psychologie in <strong>der</strong> Rehabilitation (SP 4/3.1 ...................(2)...................<br />
- Spezielle Diagnostik in RSB (behin<strong>der</strong>ungsübergreifend) (SP 5/5.1) ..........................................................(2)...................<br />
- Spezielle Sportpädagogik in RSB (2) (SP1a/2.1) ............................................................................. (2)......... ....................<br />
# Spezielle Methoden in RSB (behin<strong>der</strong>ungsübergreifend) (SP 6.4.1.0/4.1.1)...............................................(2 + 2).............<br />
# Spezielle Trainings- und Bewegungswissenschaft (SP 7/4.3.0/4.3.1) .........................................(2 + 2).............................<br />
Behin<strong>der</strong>ungsorientierende<br />
Studien<br />
Erste Kleine Spezialisierung (4) (2.4.0)<br />
- Med. Schadenslehre (1) (SP 8.1/ 1.2.0)<br />
- Didaktik/Methodik (2) (SP 8.2/2.4.0)<br />
- Did./Meth. Fragen d. Praxis (1) (SP 8.3/6.2.0)<br />
Forschungsmethodik II (2) (6.4.0)<br />
Große Spezialisierung (14) (SP 10), davon: .........................................................<br />
- Spezielle medizinische Schadenslehre (SP 10.1/1.3) .................(1).............<br />
- Spezielle Didaktik (SP 10.2.1/2.3.0) ....Kurs 1..............................(2).............<br />
- Unterrichtslehre (SP 10.2.2/2.3.1) ...............................................(1)..............<br />
- Spezielle Didaktik (SP 10.2.3/2.3.1) ....... Kurs 2 .........................(2)..............<br />
- Spezielle Methoden (SP 10.3/4.2) ...............................................(2) .............<br />
- Spezielle Diagnostik (SP 10.4/5.2) ..............................................(2) .............<br />
- Spezielle Sportarten (SP 10.5/2.3.2) ...........................................(2)..............<br />
- Hospitationen und Lehrübungen (SP 10.6/6.1) ...........................(2)...............<br />
ab 6. Sem. FACHPRAKTIKUM<br />
(vorlesungsfreie Zeit, SP 11/6.3<br />
PROJEKT (2) (SP 12/6.4.1)<br />
(1) Vorbereitungspraktikum in Rehabilitation und Son<strong>der</strong>pädagogik<br />
(2) Prüfungen nach Diplomprüfungsordnung sind möglich ab 5. Semester, jeweils nach Leistungsnachweis<br />
Bezeichnungen:<br />
(1 = 1 SWS) (SP 1a = Bezeichnung lt. Aushang u. Prüfungsbedingungen)<br />
(2.1 = Fettgedruckte Zahlen: Nummern <strong>der</strong> Einschreibungsscheine/gelber Block)<br />
# = je 1 Seminarveranstaltung = Voraussetzung für die Belegung <strong>der</strong> Großen Spezialisierung<br />
* = Kleiner Wahlbereich (für Studierende an<strong>der</strong>er Studienschwerpunkte = 8 SWS, zu belegen im 6. o<strong>der</strong> 7. Semester)<br />
2 SWS Medizinische Rehabilitation (SP 2 a), 2 SWS Sportdidaktik (SP 1 b)<br />
4 SWS Kleine Spezialisierung = 1 SWS Medizin + 2 SWS Didaktik + 1 SWS Hospitationen/Praxis<br />
18<br />
*Zweite Kleine Spezialisi erung<br />
(4) (SP 9/2.4.1)<br />
(Plan wie bei 1. KSP)<br />
(9.1 - 9.3/1.2.1/6.2.1)<br />
Diplomandenseminar<br />
Diplomarbeit<br />
und<br />
(Haupt-) Prüfungen
Lehramtsstudium<br />
Lehramt an Gymnasien<br />
Lehramt Sport an Grund-, Mittel- und För<strong>der</strong>schulen<br />
In jedem Semester sind ca. 9 Semesterwochenstunden (SWS) mit Lehrveranstaltungen zu belegen. In<br />
den Spalten des Grund- und Hauptstudiums sind die Fachsemester durch Kreuze (X) hervorgehoben,<br />
die für die Belegung <strong>der</strong> Lehrveranstaltungen empfohlen werden. Punkte ( ) deuten weitere<br />
Möglichkeiten an. Das Grundstudium wird mit einer Zwischenprüfung (ZP) und das Hauptstudium mit<br />
<strong>der</strong> Ersten Staatsprüfung (St) abgeschlossen. Leistungsnachweise (LN) für den erfolgreichen<br />
Abschluss <strong>der</strong> Lehrveranstaltungen sind dafür zu erbringen.<br />
G r u n d s t u d i u m H a u p t s t u d i u m<br />
Lehrgebiete Form SWS 1. 2. 3. 4. ZP 5. 6. 7. 8. 9. St<br />
Sportbiologie I (Anatomie) s 2 X LNZP<br />
Sportbiologie II (Physiolgie) s 2 X LNZP<br />
Sportbiologie III (Biochemie) v,s 2 X<br />
Sportmedizin d. Schulsports v,s 2 X<br />
19<br />
LN<br />
LNSt<br />
Sportmotorik v,s 2 X LN<br />
Sportbiomechanik v,s 2 X LN<br />
Trainingslehre v,s 2 X LNSt<br />
Sportpädagogik I v,s 2 X LN<br />
Sportpsychologie I<br />
Sportpäd. II./-psychologie II<br />
v<br />
s<br />
2<br />
1/1<br />
X LN<br />
X LNSt<br />
Sportgeschichte o<strong>der</strong> -sozio- V,s 2 X LN<br />
logie o<strong>der</strong> – philosophie V,s 2 X LN<br />
Didaktik des Schulsports I V,s 2 X LNZP<br />
Didaktik des Schulsports II s 2 X LNSt<br />
Sportför<strong>der</strong>unterricht S/ü 4 X X LN<br />
Schulpraktische Übungen S/ü 2 X LN<br />
Anzahl 34 16 SWS 18 SWS<br />
Ausbildung im Bereich <strong>der</strong> Theorie und Praxis <strong>der</strong> Sportarten Zwischen- Erste<br />
38 SWS<br />
prüfung Staatsprüfung<br />
Kleine Spiele (zählt nicht als Sportart) 2 LN<br />
Gymnastik/Tanz<br />
1<br />
Gerätturnen<br />
Leichtathletik<br />
Schwimmen<br />
zwei Ballspiele aus dem Bereich<br />
Basketball, Handball, Volleyball, Fußball<br />
Kampf-/Kraftsport<br />
2<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
4<br />
2<br />
2<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
zwei bis sechs Wahlsportarten aus dem Bereich<br />
Badminton, Tennis, Tischtennis<br />
o<strong>der</strong> dem Angebot <strong>der</strong> <strong>Fakultät</strong>3 2<br />
2<br />
4x24 LN<br />
in<br />
vier<br />
Sportarten<br />
LN<br />
in<br />
weiteren<br />
fünf<br />
Sportarten<br />
LN<br />
LN<br />
In <strong>der</strong> vorlesungsfreien Zeit sind ein Skisportlehrgang, ein Wasserfahrsportlehrgang und ein<br />
Blockpraktikum zu absolvieren. Weiterhin sind für den Studienabschluss <strong>der</strong> Nachweis <strong>der</strong> 1. Hilfe und<br />
das Rettungsschwimmabzeichen vorzulegen.<br />
Für die Prüfungen sind Nachweise zu den Lehrveranstaltungen zu erbringen.<br />
1 Gymnastik/Tanz bestehend aus drei Pflichtkursen Funktionsgymnastik, Rhythmik und Gymnastik<br />
mit Handgeräten sowie einem Wahlkurs aus dem Bereich <strong>der</strong> Fitnessgymnastik o<strong>der</strong> des Tanzes<br />
mit je 1 SWS.<br />
2 Wahlmöglichkeiten: Einführung Kraftsport, Judo, Taekwondo, Einführung in das Fitnesstraining.<br />
3 Zum Beispiel das dritte und vierte Ballspiel, Inline-Skating, Radsport.<br />
4 O<strong>der</strong> Erweiterung <strong>der</strong> Ausbildung in Sportarten mit 2 SWS auf 4 SWS bzw. auch Vertiefung <strong>der</strong><br />
Ausbildung in einer Sportart mit 4 SWS als Schwerpunktsportart auf 8 SWS (z.B. „Teil I“ <strong>der</strong><br />
„Kleinen Spezialisierung“).
Zwischenprüfung Erste Staatsprüfung<br />
Sportbiologie I (Anatomie) Sportbiologie III (Biochemie)<br />
Sportbiologie II (Physiologie) Sportmedizin<br />
Sportmotorik Trainingslehre<br />
Sportbiomechanik<br />
Sportpädagogik I Sportpädagogik II<br />
Sportpsychologie I Sportpsychologie II<br />
Sportgeschichte o<strong>der</strong> Sportsoziologie o<strong>der</strong> Sportgeschichte o<strong>der</strong> Sportsoziologie o<strong>der</strong><br />
Sportphilosophie (ein Gebiet)<br />
Sportphilosophie (ein zweites Gebiet)<br />
Didaktik des Schulsports I Didaktik des Schulsports II<br />
Schulpraktische Übungen<br />
Kleine Spiele Sportför<strong>der</strong>unterricht<br />
Sprecherziehung Blockpraktikum<br />
Theorie und Praxis in vier Sportarten Theorie und Praxis in neun Sportarten<br />
(insgesamt sind 38 SWS nachzuweisen)<br />
Gerätturnen<br />
Gymnastik/Tanz<br />
Leichtathletik<br />
Schwimmen<br />
Kampf-/Kraftsport<br />
1. Ballspiel<br />
2. Ballspiel<br />
1. Wahlsportart<br />
2. Wahlsportart<br />
Skisportlehrgang<br />
Wasserfahrsportlehrgang<br />
Erste Hilfe<br />
Rettungsschwimmabzeichen<br />
20
Lehramt an Gymnasien<br />
In jedem Semester sind ca. 8 Semesterwochenstunden (SWS) mit Lehrveranstaltungen zu belegen. In<br />
den Spalten für das Grund- und Hauptstudium sind die Semester ausgewiesen, die dafür empfohlen<br />
werden. Das Grundstudium wird mit einer Zwischenprüfung (ZP) und das Hauptstudium mit <strong>der</strong> Ersten<br />
Staatsprüfung (St) abgeschlossen. Leistungsnachweise (LN) für den erfolgreichen Abschluss <strong>der</strong><br />
Lehrveranstaltungen sind dafür zu erbringen.<br />
In jedem Semester sind ca. 8 Semesterwochenstunden (SWS) mit Lehrveranstaltungen zu belegen. In<br />
den Spalten für das Grund- und Hauptstudium sind die Semester ausgewiesen, die dafür empfohlen<br />
werden. Das Grundstudium wird mit einer Zwischenprüfung (ZP) und das Hauptstudium mit <strong>der</strong> Ersten<br />
Staatsprüfung (St) abgeschlossen. Leistungsnachweise (LN) für den erfolgreichen Abschluss <strong>der</strong><br />
Lehrveranstaltungen sind dafür zu erbringen.<br />
Grundschulen = Gs = 7 Semester (50 SWS)<br />
Mittelschulen = Ms = 8 Semester (58 SWS)<br />
För<strong>der</strong>schulen = Fs = 9 Semester (50 SWS)<br />
G r u n d s t u d i u m H a u p t s t u d i u m<br />
Lehramt an Lehramt an<br />
Gs Ms Fs Gs Ms Fs<br />
1.- 3. 1.- 4. 1.- 4. ZP 4.- 7. 5.- 8. 5.- 9. St<br />
Lehrgebiete Form SWS<br />
Sportbiologie I (Anatomie) s 2 2. 2. 2. LN<br />
Sportbiologie II<br />
s 2 2. 2. 2. LNZP<br />
(Physiologie/Biochemie)<br />
LNSt<br />
Sportmedizin d. Schulsports v,s 2 3. 4. 4.<br />
Sportmotorik v,s 2 3. 3. 3. LN<br />
Trainingslehre v,s 2 4. 6. 6. LNSt<br />
Sportpädagogik I v,s 2 1. 1. 1. LN<br />
Sportpsychologie I v 2 1. 1. 1. LN<br />
Sportpäd.II /-psychologie II v,s 1/1 4. 5. 5. LNSt<br />
Sportgeschichte o<strong>der</strong> -soziologie<br />
o<strong>der</strong> –philosophie<br />
v,s 2 1. 3. 3. LN<br />
Didaktik des Schulsports I v,s 2 3. 4. 4. LNZP<br />
Didaktik des Schulsports II s 2 5. 6. 7. LNSt<br />
Sportför<strong>der</strong>unterricht s,ü 4 5./ 6. 6./ 7. 6./ 7. LN<br />
Schulpraktische Übungen s,ü 2 6. 7. 8. LN<br />
Anzahl 28 16 SWS 12 SWS<br />
Ausbildung im Bereich<br />
Grund- und Mittelschulen<br />
<strong>der</strong> Theorie und Praxis <strong>der</strong> Sportarten<br />
För<strong>der</strong>schulen<br />
Prüfungen<br />
22 SWS 30 SWS ZP St.<br />
Kleine Spiele (zählt nicht als Sportart) 2 2 LN<br />
Gymnastik/Tanz<br />
1<br />
Gerätturnen<br />
Leichtathletik<br />
Schwimmen<br />
zwei Ballspiele aus dem Bereich<br />
Basketball, Handball, Volleyball, Fußball<br />
Kampf-/Kraftsport<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2 / 4<br />
2 / 4*<br />
2 / 4*<br />
2 / 4*<br />
4<br />
2<br />
2<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
LN<br />
zwei bis vier Wahlsportarten aus dem Bereich<br />
Badminton, Tennis, Tischtennis<br />
o<strong>der</strong> dem Angebot <strong>der</strong> <strong>Fakultät</strong> 3<br />
2<br />
2<br />
2 4<br />
2<br />
2<br />
2x2 4<br />
LN<br />
in<br />
vier<br />
Sportarten<br />
LN<br />
in<br />
weitere<br />
n<br />
fünf<br />
Sportarten<br />
LN<br />
LN<br />
In <strong>der</strong> vorlesungsfreien Zeit sind ein Skisportlehrgang, ein Wasserfahrsportlehrgang und ein<br />
Blockpraktikum zu absolvieren. Weiterhin sind bis zum Studienabschluss <strong>der</strong> Nachweis <strong>der</strong> 1. Hilfe<br />
und <strong>der</strong> Nachweis des Rettungsschwimmabzeichens zu erbringen.<br />
Für die Prüfungen sind Nachweise zu den Lehrveranstaltungen zu erbringen:<br />
1 Gymnastik/Tanz mit den Pflichtkursen Funktionsgymnastik und Rhythmik mit je 1 SWS; bei 4 SWS Ausbildung Erweiterung<br />
durch den Kurs Gymnastik mit Handgerät und einem Wahlkurs aus dem Bereich Fitnessgymnastik o<strong>der</strong> des Tanzes.<br />
In zwei <strong>der</strong> vier Sportarten ist eine Ausbildung mit 4 SWS verbindlich.<br />
2 Wahlmöglichkeiten: Einführung Kraftsport, Judo, Taekwondo, Einführung in das Fitnesstraining.<br />
3 Zum Beispiel auch weitere Ballspiele, Inline-Skating<br />
4 O<strong>der</strong> Erweiterung <strong>der</strong> Ausbildung in Sportarten mit 2 SWS auf 4 SWS.<br />
21
Zwischenprüfung Erste Staatsprüfung<br />
Sportbiologie I (Anatomie) Sportmedizin<br />
Sportbiologie II (Physiologie/Biochemie)<br />
Sportmotorik Trainingslehre<br />
Sportpädagogik I Sportpädagogik II<br />
Sportpsychologie I Sportpsychologie II<br />
Didaktik des Schulsports I Didaktik des Schulsports II<br />
Schulpraktische Übungen<br />
Sportför<strong>der</strong>unterricht<br />
22<br />
Blockpraktikum<br />
Kleine Spiele<br />
Sportgeschichte o<strong>der</strong> Sportsoziologie o<strong>der</strong><br />
Sprecherziehung<br />
Sportphilosophie (ein Gebiet)<br />
Theorie und Praxis in vier Sportarten Theorie und Praxis in neun Sportarten<br />
Gerätturnen<br />
Gymnastik/Tanz<br />
Leichtathletik<br />
Schwimmen<br />
Kampf-/Kraftsport<br />
1. Ballspiel<br />
2. Ballspiel<br />
1. Wahlsportart<br />
2. Wahlsportart<br />
Skisportlehrgang<br />
Wasserfahrsportlehrgang<br />
Erste Hilfe<br />
Rettungsschwimmabzeichen
Magisterstudiengänge Hauptfach Sport<br />
Nachweise für die Magister-Zwischenprüfung im 1. und 2. Hauptfach Sportwissenschaft<br />
Fachgebiet SWS (Org.F.) Leistungsnach<br />
-weis/LN 0<br />
Einführung in Sportwissenschaft 2 (V/S) - -<br />
Forschungsmethodik I 2 (V) LN -<br />
Forschungsmethodik II (Statistik) 2 (S/Ü) - -<br />
Sportpädagogik 2 (V/S) 1 LN<br />
Sportpsychologie 2 (V/S)<br />
Sportsoziologie 2 (V/S)<br />
1<br />
Bewegungswissenschaft/Sportmotorik 2 (V/S) -<br />
Bewegungswissenschaft/Sportbiomechanik 2 (V/S) -<br />
Trainingswissenschaft 2 (V/S) -<br />
Sportbiologie I/II 4 (V/S) 1 LN<br />
Theorie u. Praxis sportlicher Bewegungen<br />
ohne Bindung an eine Sportart<br />
Teil I a<br />
Teil I b<br />
6<br />
(1S/2Ü)<br />
(1S/2Ü)<br />
Theorie und Praxis zweier Sportarten 8<br />
(2x2Ü/S,4S)<br />
Summe 36 4 LN<br />
23<br />
M Z P 1<br />
(schr. 120‘)<br />
M Z P<br />
1<br />
(mdl. 30‘)<br />
1 LN -<br />
- M Z P<br />
1<br />
Außerdem hat <strong>der</strong> Studierende im Hauptfach Sportwissenschaft folgende Nachweise zu erbringen:<br />
1. Hilfe<br />
Rettungsschwimmabzeichen (Bronze)<br />
Legende:<br />
SWS Angaben in Semesterwochenstunden<br />
V Vorlesung<br />
S Seminar<br />
Ü Übung<br />
Pro Projekt<br />
Org.F Organisationsform<br />
MZP Magisterzwischenprüfung<br />
MP Magisterprüfung<br />
LN Leistungsnachweis<br />
schr. schriftlich<br />
mdl. mündlich<br />
KSP kleiner Schwerpunkt<br />
0 Leistungsnachweise sind in den Fächern/Teilgebieten zu erbringen, die nicht Gegenstand <strong>der</strong><br />
Prüfungen sind<br />
1 Wahlweise in einem Lehrgebiet bzw. einer Sportart
Nachweise für die Magister-Prüfung im 1. und 2. Hauptfach Sportwissenschaft<br />
Fachgebiet SWS (Org.F.) Leistungsnachweis/LN0<br />
Forschungsmethodik III (Informatik, wenn im<br />
Angebot, sonst Pro)<br />
2 - -<br />
Forschungsmethodik IV 2 (Pro) - -<br />
Forschungsmethodik V<br />
(Kolloquium)<br />
4 (Pro) - -<br />
Sportphilosophie<br />
Sportgeschichte<br />
Vertiefung Geistes- u. Sozialwissenschaft3 Sportpsychologie<br />
Sportpädagogik<br />
Sportsoziologie<br />
Theorie u. Praxis sportlicher Bewegungen<br />
ohne Bindung an eine Sportart<br />
Teil II a<br />
Teil II b (Winter- o<strong>der</strong> Wasserfahrsportarten)<br />
4<br />
2 (V/S)<br />
(wahlweise 1<br />
24<br />
Gebiet)<br />
4 (V/S)<br />
(wahlweise 2<br />
Gebiete)<br />
6<br />
(1S)<br />
(5S/Ü)<br />
1 LN<br />
-<br />
-<br />
M P 2<br />
(mdl. 45‘)<br />
1 LN -<br />
Theorie und Praxis <strong>der</strong> Sportarten 5 8 (S/Ü) 1 LN M P 6<br />
1 übergreifendes Themenfeld <strong>der</strong><br />
Sport und Freizeit<br />
Sport und Leistung<br />
Sport und Rehabilitation 7<br />
Sportwissen<br />
schaft<br />
(wahlweise<br />
aus dem<br />
Angebot):<br />
8 (V/S) L N M P<br />
(schr. 240‘)<br />
Sport und Management8 Sport und Schule<br />
Sport und Medien 7<br />
Summe 36 4 L N<br />
Außerdem hat <strong>der</strong> Studierende im Hauptfach Sportwissenschaft in seiner Regelstudienzeit<br />
zu absolvieren:<br />
1. Hauptfach: Zweitägige Exkursion an sportwissenschaftliche Einrichtungen,<br />
1. Hauptfach: 2x4 Wochen, 2. Hauptfach: 30 Stdn. Praktikum (außerhalb <strong>der</strong> Vorlesungszeit)<br />
0 Leistungsnachweise sind in den Fächern/Teilgebieten zu erbringen, die nicht Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungen sind<br />
2 In beiden vertieften Lehrgebieten, dürfen nicht Gegenstand <strong>der</strong> MZP gewesen sein<br />
3 Lehrinhalte dürfen nicht identisch mit gewählten Lehrgebieten im übergreifenden Themenfeld sein<br />
4 Absolvierung eines kompletten Lehrganges<br />
5 Nach Wahl: Variante 1: KSP (8 SWS) zu einer Sportart, die im Grundstudium belegt wurde<br />
Variante 2: Absolvierung zweier weiterer Sportarten (je 4 SWS) aus dem <strong>Fakultät</strong>sangebot<br />
6 In einer Sportart, darf nicht Gegenstand <strong>der</strong> MZP gewesen sein<br />
7 Voraussetzungen für Teilnahme am Themenfeld beachten<br />
8 Voraussetzungen für Teilnahme am Themenfeld beachten: Abschluss in Sportrecht und –verwaltung<br />
(2 SWS)
Nachweise für die Magister-Zwischenprüfung im 1. und 2. Hauptfach Sportwissenschaft<br />
Fachgebiet SWS (Org.F.) Leistungsnachweis/LN<br />
0<br />
Einführung in Sportwissenschaft 2 (V/S) - -<br />
Forschungsmethodik I 2 (V) LN -<br />
Forschungsmethodik II (Statistik) 2 (S/Ü) - -<br />
Sportpädagogik 2 (V/S) 1 LN<br />
Sportpsychologie 2 (V/S)<br />
Sportsoziologie 2 (V/S)<br />
1<br />
Bewegungswissenschaft/Sportmotorik 2 (V/S) -<br />
Bewegungswissenschaft/Sportbiomechanik 2 (V/S) -<br />
Trainingswissenschaft 2 (V/S) -<br />
Sportbiologie I/II 4 (V/S) 1 LN<br />
Theorie u. Praxis sportlicher Bewegungen<br />
ohne Bindung an eine Sportart<br />
Teil I a<br />
Teil I b<br />
25<br />
6<br />
(1S/2Ü)<br />
(1S/2Ü)<br />
Theorie und Praxis zweier Sportarten 8<br />
(2x2Ü/S,4S)<br />
Summe 36 4 LN<br />
MZP9<br />
(schr.<br />
120‘)<br />
MZP 1<br />
(mdl.<br />
30‘)<br />
1 LN -<br />
- MZP 1<br />
Außerdem hat <strong>der</strong> Studierende im Hauptfach Sportwissenschaft folgende Nachweise zu erbringen:<br />
1. Hilfe<br />
Rettungsschwimmabzeichen (Bronze)<br />
Legende:<br />
SWS Angaben in Semesterwochenstunden<br />
V Vorlesung<br />
S Seminar<br />
Ü Übung<br />
Pro Projekt<br />
Org.F Organisationsform<br />
MZP Magisterzwischenprüfung<br />
MP Magisterprüfung<br />
LN Leistungsnachweis<br />
schr. schriftlich<br />
mdli. mündlich<br />
KSP kleiner Schwerpunkt<br />
0 Leistungsnachweise sind in den Fächern/Teilgebieten zu erbringen, die nicht Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungen sind<br />
9 Wahlweise in einem Lehrgebiet bzw. einer Sportart
Nachweise für die Magister-Prüfung im 1. und 2. Hauptfach Sportwissenschaft<br />
Fachgebiet SWS (Org.F.) Leistungsnach<br />
weis/LN0 Forschungsmethodik III (Informatik, wenn im<br />
Angebot, sonst Pro)<br />
2 - -<br />
Forschungsmethodik IV 2 (Pro) - -<br />
Forschungsmethodik V<br />
(Kolloquium)<br />
4 (Pro) - -<br />
Sportphilosophie<br />
2 (V/S) 1 LN<br />
Sportgeschichte<br />
(wahlweise 1<br />
Gebiet)<br />
Vertiefung Geistes- u. Sozialwissenschaft11 -<br />
Sportpsychologie<br />
Sportpädagogik<br />
Sportsoziologie<br />
4 (V/S)<br />
(wahlweise 2<br />
Gebiete)<br />
- M P 10<br />
Theorie u. Praxis sportlicher Bewegungen<br />
(mdl. 45‘)<br />
ohne Bindung an eine Sportart<br />
Teil II a<br />
Teil II b (Winter- o<strong>der</strong><br />
Wasserfahrsportarten) 12<br />
6<br />
1 LN -<br />
(1S)<br />
(5S/Ü)<br />
Theorie und Praxis <strong>der</strong> Sportarten 13 8 (S/Ü) 1 LN M P 14<br />
1 übergreifendes Themenfeld <strong>der</strong><br />
Sport und Freizeit<br />
Sport und Leistung<br />
Sport und Rehabilitation 15<br />
Sportwissen<br />
schaft<br />
(wahlweise<br />
aus dem<br />
Angebot):<br />
Sport und Management16 Sport und Schule<br />
Sport und Medien 7<br />
Summe 36 4 LN<br />
26<br />
8 (V/S) L N M P<br />
(schr. 240‘)<br />
Außerdem hat <strong>der</strong> Studierende im Hauptfach Sportwissenschaft in seiner Regelstudienzeit<br />
zu absolvieren:<br />
1. Hauptfach: Zweitägige Exkursion an sportwissenschaftliche Einrichtungen,<br />
1. Hauptfach: 2x4 Wochen, 2. Hauptfach: 30 Stdn. Praktikum (außerhalb <strong>der</strong> Vorlesungszeit)<br />
0 Leistungsnachweise sind in den Fächern/Teilgebieten zu erbringen, die nicht Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungen sind<br />
10 In beiden vertieften Lehrgebieten, dürfen nicht Gegenstand <strong>der</strong> MZP gewesen sein<br />
11 Lehrinhalte dürfen nicht identisch mit gewählten Lehrgebieten im übergreifenden Themenfeld sein<br />
12 Absolvierung eines kompletten Lehrganges<br />
13 Nach Wahl: Variante 1: KSP (8 SWS) zu einer Sportart, die im Grundstudium belegt wurde<br />
Variante 2: Absolvierung zweier weiterer Sportarten (je 4 SWS) aus dem <strong>Fakultät</strong>sangebot<br />
14 In einer Sportart, darf nicht Gegenstand <strong>der</strong> MZP gewesen sein<br />
15 Voraussetzungen für Teilnahme am Themenfeld beachten<br />
16 Voraussetzungen für Teilnahme am Themenfeld beachten: Abschluss in Sportrecht und –verwaltung<br />
(2 SWS)
Nachweise für die Magister-Zwischenprüfung im Nebenfach Sportwissenschaft<br />
Fachgebiet SWS (Org.F.) Leistungsnach<br />
-weis/LN0 Einführung in Sportwissenschaft/<br />
Ausgewählte Forschungsmethodiken<br />
2 (V/S) - -<br />
Geistes- und Sozialwissenschaften des<br />
Sports17 Sportpädagogik<br />
Sportpsychologie<br />
Sportsoziologie<br />
Sportgeschichte o<strong>der</strong> -philosophie<br />
Bewegungswissenschaft/<br />
Sportmotorik<br />
Trainingswissenschaft<br />
27<br />
2 (V/S)<br />
2 (V/S)<br />
2 (V/S)<br />
2 (V/S)<br />
1 LN 10<br />
M Z P<br />
18<br />
(schr. 120‘)<br />
- MZP 19<br />
(mdl. 30‘)<br />
Sportbiologie 2 (V/S) 1 LN -<br />
Theorie u. Praxis sportlicher Bewegungen<br />
ohne Bindung an eine Sportart<br />
Teil I a<br />
Teil I b<br />
6<br />
(1S/2Ü)<br />
(1S/2Ü)<br />
- -<br />
Summe 18 2 LN 2 MZP<br />
Außerdem hat <strong>der</strong> Studierende im Nebenfach Sportwissenschaft folgende Nachweise zu erbringen:<br />
1. Hilfe<br />
Rettungsschwimmabzeichen (Bronze)<br />
0 Leistungsnachweise sind in den Fächern/Teilgebieten zu erbringen, die nicht Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungen sind<br />
17 Wahlweise zwei Lehrgebiete<br />
18 Wahlweise in einem Lehrgebiet; LN o<strong>der</strong> MZP sind entwe<strong>der</strong> im Fach Sportpsychologie o<strong>der</strong> -pädagogik zu erbringen<br />
19 Wahlweise in einem Lehrgebiet
Nachweise für die Magister-Prüfung im Nebenfach Sportwissenschaft<br />
Fachgebiet SWS (Org.F.) Leistungsnachweis/LN<br />
0<br />
Vertiefung in Geistes- und<br />
Sozialwissenschaften des Sports o<strong>der</strong> in<br />
Sportbiologie20 Sportpsychologie<br />
Sportpädagogik<br />
Sportsoziologie<br />
Sportbiologie<br />
Theorie und Praxis zweier Sportarten 8<br />
(2x2Ü/S,4S)<br />
1 übergreifendes Themenfeld <strong>der</strong><br />
Sportwissenschaft, einschließlich Projekt<br />
(wahlweise aus dem Angebot):<br />
Sport und Freizeit<br />
Sport und Management24 Sport und Leistung<br />
Sport und Schule<br />
Sport und Medien25 6<br />
(V/S/Pro)<br />
4 (V/S) 21 1<br />
LN22 M P<br />
4<br />
28<br />
(mdl. 30‘)<br />
M P 23<br />
L N M P<br />
(schr. 120‘)<br />
Summe 18 2 LN 3 MP<br />
Außerdem hat <strong>der</strong> Studierende im Nebenfach Sportwissenschaft in seiner Regelstudienzeit<br />
zu absolvieren:<br />
Ein 30stündiges Praktikum (außerhalb <strong>der</strong> Vorlesungszeit<br />
0 Leistungsnachweise sind in den Fächern/Teilgebieten zu erbringen, die nicht Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungen sind<br />
20 Lehrinhalte dürfen nicht identisch mit gewählten Lehrgebieten im übergreifenden Themenfeld sein<br />
21 Wahlweise in zwei Lehrgebieten<br />
22 Wahlweise in einem Lehrgebiet; LN o<strong>der</strong> MP sind entwe<strong>der</strong> im Fach Sportpsychologie o<strong>der</strong> –pädagogik zu erbringen<br />
23 Wahlweise in einer Sportart<br />
24 Voraussetzungen für Teilnahme am Themenfeld beachten: Abschluss in Sportrecht und -verwaltung<br />
(2 SWS)<br />
25 Voraussetzungen für Teilnahme am Themenfeld beachten
ALLGEMEINE BEWEGUNGS- und TRAININGSWISSENSCHAFT<br />
Veranstaltung: Einführung in die Sportwissenschaft<br />
Lehrkräfte: Dr. C. Hartmann und Gäste<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Magister Haupt- und Nebenfach/Journalistik – Grundstudium/<br />
1. Semester<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmebeleg ohne Note<br />
Inhalte:<br />
Mit <strong>der</strong> Lehrveranstaltungsreihe „Einführung in die Sportwissenschaft“ wird ein Überblick über die<br />
sportwissenschaftlichen Disziplinen/Fachgebiete/Institute <strong>der</strong> <strong>Fakultät</strong>, die übergreifenden<br />
Themenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Sportwissenschaft und die gültigen Studien- und Prüfungsordnungen gegeben.<br />
Dadurch werden erste wissenschaftssystematische Einsichten vermittelt, Wahlentscheidungen für die<br />
Themenfel<strong>der</strong> im Hauptstudium erleichtert sowie Einblicke in später nicht gewählte<br />
sportwissenschaftliche Disziplinen gewährt. Außerdem vermittelt diese Lehrveranstaltungsreihe die<br />
Grundlagen für wesentliche Fachbegriffe und zeigt vereinzelt die Verwendung verschiedener<br />
Forschungsmethoden auf.<br />
Themen sind u.a. :<br />
Ziele, Anfor<strong>der</strong>ungen, Inhalte eines Magisterstudiums/HF; NF, Journalistik<br />
Studien- und Prüfungsordnungen zum Studiengang<br />
Sportwissenschaft als Komplexwissenschaft und ihre Beziehungen zu den<br />
Mutterwissenschaften<br />
Aufgaben des Leistungssports und seine För<strong>der</strong>ung in Deutschland<br />
Aufgaben des Freizeitsports und seine Entwicklungstrends<br />
Aufgaben des Rehabilitations- und Behin<strong>der</strong>tensports und <strong>der</strong> Sporttherapie<br />
Besuch einer ambulanten Rehabilitationseinrichtung<br />
Besuch einer Leistungssportför<strong>der</strong>einrichtung<br />
Sportwissenschaft und Management, Umwelt, Medien und Schule<br />
Sportwissenschaft in Leipzig- Tradition und Zukunft<br />
29
SPORTMOTORIK/TRAININGSLEHRE<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen <strong>der</strong> Sportmotorik<br />
Lehrkräfte: Professor Dr. Krug, Dr. Hartmann, Dr. Minow, Dr. Hoffmann,<br />
Dr. Panzer<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/Seminar<br />
Stundenumfang: Diplom: 3 SWS; Magister HF/NF: 2 SWS; Lehramt: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: StudentInnen ab 3. Semester aller Studiengänge<br />
Bemerkung: Der erfolgreiche Abschluss ist Voraussetzung für die<br />
Teilnahme am Fach Trainingswissenschaft im (4. Semester)<br />
Inhalte:<br />
Kennzeichnung des Erscheinungsbildes von Bewegungen und <strong>der</strong>en zu Grunde liegenden Prozesse<br />
und Funktionen sowie <strong>der</strong>en Verän<strong>der</strong>ungen unter verschiedenen Realisierungs- und<br />
Entwicklungsprozessen des Leistungs-, Freizeit-, Schul-, Rehabilitations- und Behin<strong>der</strong>tensport. Beim<br />
Vermitteln von sportmotorischen Grundlagen versteht sich das Fach als Integrativdisziplin, die sich<br />
mit dem Objektbereich Verhalten - Handlung - Bewegung und Lernen im Sport auseinan<strong>der</strong>setzt.<br />
Außer <strong>der</strong> Entwicklung und Lehre von eigenen Themenfel<strong>der</strong>n und Theorien soll über das<br />
Zusammenführen von Erkenntnissen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen wie z. B. <strong>der</strong><br />
Physiologie, Psychologie, Mechanik/Biomechanik, Pädagogik und Didaktik des Sports ein<br />
entscheiden<strong>der</strong> Beitrag zum Grundverständnis <strong>der</strong> sportlichen Tätigkeit als Bewegungstätigkeit<br />
geleistet werden. Dies schafft Voraussetzungen und ist damit ebenfalls Zielstellung des Lehrgebietes<br />
für jegliche allgemeine und/o<strong>der</strong> spezifische Trainingsmethodik in den verschiedenen<br />
Tätigkeitsbereichen des Sports.<br />
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaft;<br />
Informationell und energetisch determinierte Prozesse und Leistungsvoraussetzungen in <strong>der</strong><br />
sportlichen Tätigkeit;<br />
Motorischer Lernprozess, Techniklernen, Bewegungslernen;<br />
Motorische Ontogenese;<br />
Merkmale <strong>der</strong> Bewegungskoordination und Verhaltensregulation, einschließlich <strong>der</strong><br />
Bewegungsbeobachtung, -wahrnehmung, -analyse und -beurteilung mit Hilfe relevanter Merkmale<br />
<strong>der</strong> Bewegungskoordination<br />
Körper-, Sozial- und Materialerfahrung<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Meinel, K./Schnabel, G.: Bewegungslehre-Sportmotorik. Berlin 1998.<br />
(eine umfangreiche Literaturliste wird im 1. Seminar ausgegeben)<br />
Leistungsnachweis: Diplom (3 SWS; V und S, wöchentlich): LS (ohne Note);<br />
Magister (2 SWS; V und S, 14tgl.): Beleg (ohne Note);<br />
Lehramt (2 SWS; S wöchentlich): LS (ohne Note)<br />
30
Veranstaltung: Theorie und Praxis sportlicher Bewegungen ohne<br />
Bindung an eine Sportart, Teil I a<br />
Lehrkräfte: Theorie: Dr. Hartmann, Dr. Minow<br />
Praxis: Dr. Bartel, Dr. Minow, H. Streicher<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/Seminare/Übungen<br />
Stundenumfang: 3 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Erfolgreicher Abschluss Sportmotorik bzw. paralleler Besuch<br />
im 3. Semester<br />
Zielgruppe: Magister Haupt- und Nebenfach ab 3. Semester<br />
Leistungsnachweis: Beleg ohne Note<br />
Inhalte:<br />
Der Lehrkomplex „Theorie und Praxis sportlicher Bewegungen ohne Bindung an eine Sportart“ baut<br />
auf die Grundlagen <strong>der</strong> Sportmotorik auf und vertieft bzw. erweitert insbeson<strong>der</strong>e in den<br />
Theorieveranstaltungen das bewegungs-wissenschaftliche Grundlagenwissen.<br />
In den dazugehörigen Praxisveranstaltungen (Übungen), die eine Einheit mit den Theoriethemen<br />
bilden, wird ein breiter Überblick über das vielfältige Spektrum von Bewegung, Spiel und Sport<br />
vermittelt und die eigenen körperlichen Betätigungen sind auf gesundheitsorientierte Aktivitäten<br />
ausgerichtet. Ein so ausgerichteter Lehrkomplex bietet Raum für die Vermittlung tiefergehen<strong>der</strong><br />
Theorien, Theoriemodelle bzw. -ansätze und neuerer Tendenzen und Entwicklungslinien im<br />
gesundheits- und fitnessorientierten Bereich von Bewegung, Spiel und Sport.<br />
Darüber hinaus haben auch Aspekte <strong>der</strong> Körperwahrnehmung und <strong>der</strong> Entspannung ihren Platz im<br />
Konzept gefunden. Sie besitzen Voraussetzungscharakter für ein effektives motorisches Lernen und<br />
beim Ausprägen <strong>der</strong> energetisch und informationell determinierten Leistungsvoraussetzungen. In <strong>der</strong><br />
sportpraktischen Ausbildung wird weiterhin darauf geachtet, dass <strong>der</strong> Gesundheitsaspekt mit seinen<br />
motorischen, psychischen und sozialen Komponenten berücksichtigt und bewusst geför<strong>der</strong>t wird.<br />
Theorie und theoriegeleitete Praxisveranstaltungen werden inhaltlich aufeinan<strong>der</strong> abgestimmt<br />
durchgeführt.<br />
Übergreifend bzw. in Komplexen zusammengefasst werden folgende Themen abgehandelt:<br />
Regulation sportlicher Bewegungen/Handlungen<br />
Tätigkeits- und Handlungskonzept<br />
Motorische Ontogenese<br />
Kraftfähigkeiten/ Beweglichkeit<br />
Ausdauerfähigkeiten<br />
Körperwahrnehmung/Entspannung<br />
Grundlagenliteratur: Eine Literaturliste wird im ersten Seminar ausgegeben<br />
Bemerkung: Im Sommersemester <strong>04</strong> wird <strong>der</strong> Teil I b angeboten<br />
31
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportmotorik/Sportbiomechanik II (III)<br />
Lehrkräfte: Vorlesungen: Professor Dr. Krug, Dr. Hartmann<br />
Lab.-Übungen: Dr. Hartmann, , Dr.<br />
Minow, Dr. Rauscher, Doz. Herrmann<br />
Veranstaltungsform: Vorlesungen/Übungen<br />
Stundenumfang: 1 SWS WS 03/<strong>04</strong>, 1 SWS SS <strong>04</strong><br />
(Sportmanagement nur 1 SWS im WS)<br />
Zulassungsbedingungen: Vordiplom Sportbiomechanik/Sportmotorik/<br />
Trainingswissenschaft<br />
Zielgruppe: DiplomstudentInnen ab 5. Semester<br />
Leistungsnachweis: Beleg ohne Note<br />
Inhalte:<br />
Teilgebiet Sportmotorik (Vorlesungen):<br />
Motorisches Verhalten älterer und alter Menschen (in Fortsetzung <strong>der</strong> Thematik „Motorische<br />
Ontogenese“ aus dem Grundstudium)<br />
Motorisches Phänomen „Lateralität“<br />
„Neuere“ Ansätze und Theorien auf den Gebieten des motorischen Lernens und <strong>der</strong> koordinativen<br />
Fähigkeiten<br />
Bewegung und Training (integrativ aus biomechanischer und sportmotorischer Sicht betrachtet).<br />
Darüber hinaus finden Laborübungen statt, die nach einem geson<strong>der</strong>ten Plan von den Studierenden<br />
zu realisieren sind. Ziel <strong>der</strong> Laborübungen ist es, dass sich die Studierenden im<br />
Bewegungssehen und -beobachten,<br />
Bewegungsanalysieren mit Hilfe morphologischer Bewegungsmerkmale und im<br />
Bewegungsbeschreiben üben.<br />
An ausgewählten Videobeispielen (unterschiedliche azyklische, zyklische Bewegungen und<br />
Bewegungskombinationen) werden technisch richtige und noch „fehlerhafte“ Bewegungen<br />
gegenübergestellt, Ursachen für die Fehlerentstehung sind herauszufinden und richtige<br />
trainingsmethodische Ableitungen zu treffen. Die Laborübungen sollen dazu beitragen, dass sich die<br />
Studierenden in ihrer didaktisch-methodischen Befähigung schulen.<br />
An den Vorlesungen <strong>der</strong> Sportmotorik nehmen StudentInnen aller Studienrichtungen teil. Für<br />
Studierende <strong>der</strong> Spezialisierungsrichtung Sportmanagement gilt darüber hinaus folgendes:<br />
Die Studierenden nehmen in <strong>der</strong> Sportbiomechanik an den Vorlesungen zu einem<br />
Spezialisierungsgebiet teil (die Einteilung wird in <strong>der</strong> ersten Vorlesung vorgenommen). Die<br />
Laborübungen entfallen für StudentInnen dieser Spezialisierungsrichtung, wenn sie am Ende mit <strong>der</strong><br />
Klausur abschließen wollen. Realisieren sie die für alle an<strong>der</strong>en Spezialisierungsrichtungen<br />
obligatorischen Laborübungen (d.h. auch die <strong>der</strong> Sportmotorik) ebenfalls erfolgreich, entfällt für sie die<br />
Abschlussklausur.<br />
Grundlagenliteratur: Eine Literaturübersicht wird in den Vorlesungen ausgegeben<br />
32
Veranstaltung: Wettkampfsport - Trainingslehre IIa<br />
Lehrkräfte: Prof. Krug/Dr. Hoffmann/Dr. Minow<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/14 tägl. Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Vordiplom Bewegungs- und Trainingswissenschaft<br />
Zielgruppe: Diplom-Hauptstudiengang: LS; FPF; RSBS; SPMA;<br />
Diplom Journalistik, ergä. Hauptfach Sport und<br />
Magister/HF,NF:Übergreifendes Themenfeld „Sport und<br />
Leistung“;<br />
Leistungsnachweis: Leistungsnachweis ohne Note<br />
Inhalte:<br />
Entwicklungstendenzen internationaler und nationaler Trainings- und Wettkampfsysteme;<br />
Leistungs- und trainingsstrukturelle Grundlagen:<br />
o Leistungsstruktur,<br />
o Trainingsstruktur<br />
Langfristiger Leistungs- und Trainingsaufbaus:<br />
o Modelle,<br />
o Bestimmungsfaktoren,<br />
o Etappen und <strong>der</strong>en Ziele;<br />
Spezielle Aspekte <strong>der</strong> Belastungsgestaltung:<br />
o Belastbarkeit, Belastungsverträglichkeit,<br />
o Ausbildung spezieller konditioneller Leistungsvoraussetzungen;<br />
Spezielle Aspekte des Fertigkeitstrainings im Wettkampfsport:<br />
o Modelle zum Fertigkeitstraining im Wettkampfsport,<br />
o Phänomene im Fertigkeitstraining,<br />
o Methodische Grundsätze;<br />
Aspekte <strong>der</strong> Leistungs- und Trainingssteuerung im WK-Sport:<br />
o Modellansatz,<br />
o Elemente und <strong>der</strong>en Wechselbeziehungen,<br />
o Planungsgrundsätze und Planarten,<br />
o Leistungsdiagnostik,<br />
o Trainingsdiagnostik;<br />
Theorie des sportlichen Wettkampfes:<br />
o Grundlagen,<br />
o Arten,<br />
o Entwicklungstendenzen,<br />
o Wettkämpfe im Nachwuchstraining.<br />
Grundlagenliteratur:<br />
o BUDINGER, H./HAHN, E. (1990): Bedingungen des sportlichen Wettkampfes. Schorndorf<br />
1990. Studienbrief <strong>der</strong> Trainerakademie Köln:16<br />
o CARL, K.; SCHLICHT, W.; JANSEN, J.-P. (1988): Steuerung und Regelung des Trainings.<br />
Dokumentation eines Workshops. Köln, 1988.<br />
o GROSSER, M.; BRÜGGEMANN, P.; ZINTL, F. (1986): Leistungssteuerung im Training und<br />
Wettkampf. München, Wien, Zürich, 1986.<br />
o HOHMANN, A.; LAMES, M.; LETZELTER, M. (2002): Einführung in die Trainingswissenschaft.<br />
Wiebelsheim 2002<br />
o KUHLMANN; D. (1998): Wettkampfsport: Domäne in <strong>der</strong> Defensive. Schorndorf. 1998<br />
o MARTIN, D./CARL, K./LEHNERTZ, K. (1991): Handbuch Trainingslehre. Schorndorf 1991<br />
o SCHELLENBERGER, H. (1991): Psychologische Wettkampfvorbereitung. In: Kunath,<br />
P./Schellenberger, H.: Tätigkeitsorientierte Sportpsychologie. Frankfurt/M. 1991, S. 290 - 312.<br />
o SCHNABEL, G./HARRE, D./BORDE, A. (1991): Trainingswissenschaft. Berlin 1996<br />
o STARK, G. (1991): Leistungssteuerung als integrierter praxisbezogener Aspekt. In:<br />
Leistungssport. Frankfurt/M. 21(1991) 1. S. 8-14.<br />
o THIESS, G./TSCHIENE, P. (1999): Handbuch zur Wettkampflehre. Aachen. 1999<br />
o WEINECK, J. (2000): Optimales Training. Balingen 2000<br />
33
o FUCHS, M.; REISS, M. (1990): Höhentraining. Trainerbibliothek. Schorndorf<br />
o Hagedorn, G. (2000): Sportspiele: Training und Wettkampf. Reinbeck bei Hamburg<br />
o Hartmann, U.; Ma<strong>der</strong>, A. (1999): Grundlegende Aspekte zu Trainingsanpassungen und zum<br />
Training in mittlerer Höhe In: Zeitschrift für Angewandte Trainingswissenschaft. Leipzig (1)<br />
o HOHMANN, A.; BRACK, R. (1995): Wissenschaftliche Trainingsberatung. Sportwissenschaft<br />
25(2), S. 137-156<br />
o MARTIN, D.:KRUG, J.:REISS, M.: ROST, K. (1997): Entwicklungstendenzen <strong>der</strong> Trainings- und<br />
Wettkampfsysteme im Spitzensport mit Folgerungen für den Olympiazyklus 1996/2000.<br />
Leistungssport 27(1), S.25-31<br />
o Olympische Winterspiele 2002(2002): Zu ausgewählten Spitzensportkonzepten und <strong>der</strong>en<br />
Umsetzung in Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City. Institut für<br />
Angewandte Trainingswissenschaft. Leipzig<br />
o SCHNABEL, G./HARRE, D./BORDE, A. (1996): Trainingswissenschaft. Berlin<br />
34
Veranstaltung: Theorie und Praxis sportlicher Bewegungen ohne Bindung<br />
an eine Sportart, Teil II b – Lehrgang Wintersport<br />
Lehrkräfte: Dr. Bartel u. a.<br />
Veranstaltungsform: Übungen/Seminar<br />
Stundenumfang: 4 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Magister Hauptfach<br />
Leistungsnachweis: Leistungsnachweis mit o<strong>der</strong> ohne Note<br />
Inhalte:<br />
Zur erfolgreichen Absolvierung des gewählten Lehrgangs (im Sommersemester kann auch wahlweise<br />
an <strong>der</strong> Wasserfahrsportausbildung teilgenommen werden) realisieren die MagisterstudentInnen die<br />
gleichen Anfor<strong>der</strong>ungen wie die DiplomstudentInnen und erhalten dafür einen Leistungsnachweis. Sie<br />
können entscheiden, ob sie sich die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang (mindestens Note „4“) o<strong>der</strong><br />
die Teilnahme mit Note bestätigen lassen.<br />
Schwerpunkte: Vgl. Angaben zum „Winterlager in St. Anton/A“ vom FG Wintersport<br />
Bemerkung: Die Theorieveranstaltung zum Fachgebiet (2 SWS, Teil II a) für<br />
MagisterstudentInnen im Hauptfach findet in unregelmäßigen<br />
Abständen am Hochschulort in Form von Vorlesungen/Seminaren<br />
statt.<br />
35
SPORTBIOMECHANIK<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportbiomechanik I<br />
Lehrkräfte: Doz. Dr. H. Herrmann, Dr. M. Rauscher<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung, Seminar, Übung<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: GL <strong>der</strong> LG Sportanatomie und -physiologie empfohlen<br />
Zielgruppe: GRUNDSTUDIUM (Lehramt, 3. FS)<br />
Leistungsnachweis: Leistungsnachweis mit Note (Klausur)<br />
Inhalte:<br />
· Einführung in die Sportbiomechanik/mechanische Gesetzmäßigkeiten bei sportlichen<br />
Bewegungen<br />
- Gegenstand/Aufgaben <strong>der</strong> Sportbiomechanik<br />
- Kinematische und dynamische Grundbegriffe in ihren gesetzmäßigen Zusammenhängen am<br />
Beispiel einfacher sportlicher Bewegungen<br />
· Biomechanische Voraussetzungen des menschlichen Bewegungsapparates als eine<br />
Grundlage <strong>der</strong> Bewegungstätigkeit<br />
- Biomechanische Eigenschaften <strong>der</strong> Knochen und Gelenke und ihr Zusammenspiel in Form von<br />
kinematischen Ketten<br />
- Biomechanische Eigenschaften <strong>der</strong> Muskeln und das Entstehen von Muskelkraftmomenten an<br />
ausgewählten Beispielen<br />
- Beson<strong>der</strong>heiten des biomechanischen Bewegungssystems und <strong>der</strong> Vergleich zu einem<br />
mechanischen Bewegungssystems<br />
· Biomechanische Untersuchungsmethoden – ausgewählte Verfahren<br />
- Hauptanfor<strong>der</strong>ungen an biomechanische Objektivierungsverfahren<br />
- Verfahren <strong>der</strong> Erfassung von kinem. u. dynam. Parametern bei sportl. Bewegungen<br />
· Objektivierung sportl. Bew. anhand kinemat. und dyn. Bewegungsparameter<br />
- Theoretische Vorbetrachtungen (Kraft-/Momentansätze)<br />
- Kinematische Bewegungsbeschreibung/Zusammenhang zwischen Weg, Geschwindigkeit und<br />
Beschleunigung bzw. Winkel<br />
- Dynamische Bewegungsbeschreibung/Zusammenhang zwischen Kraft und Geschwindigkeit<br />
bzw., Drehmoment und Winkelgeschwindigkeit<br />
· Biomechanische Aspekte <strong>der</strong> sporttechnischen Fertigkeitsentwicklung als eine<br />
Voraussetzung für sportliche Bewegungshandlungen<br />
- Die sportliche Technik – ihre Darstellung und Objektivierung<br />
- Zweckmäßigkeitskriterien sportlicher Techniken<br />
- Ausgew. biomech. Prinzipien (für die Aufgabeklassen Abdruck/Abstoß vom starren Wi<strong>der</strong>lager)<br />
Grundlagenliteratur:<br />
° BALLREICH, R.; BAUMANN, W. (1996): Grundlagen <strong>der</strong> Biomechanik des Sports: Probleme, Methoden,<br />
Modelle. - Stuttgart: Enke.<br />
° BALLREICH, R.; KUHLOW-BALLREICH, A. (1992): Biomechanik <strong>der</strong> Sportarten. - Band 3: Biomechanik <strong>der</strong><br />
Sportspiele Teil I und II.- Stuttgart: Enke.<br />
° GROSSER, M. u.a. (1987): Die sportliche Bewegung: Anatomische und biomechanische Grundlagen. –<br />
München, Wien, Zürich: BLV Verlagsgesellschaft.<br />
° HOCHMUTH, G. (1982): Biomechanik sportlicher Bewegungen. - Berlin: Sportverlag.<br />
° SCHEWE, H. (2000): Biomechanik – Wie geht das? – Stuttgart, New York: Thieme.<br />
° WILLIMCZIK, K. (1989): Biomechanik <strong>der</strong> Sportarten. Grundlagen – Methoden – Analysen. -<br />
Reinbeck: Rowohlt.<br />
36
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportbiomechanik II<br />
Lehrkräfte: Doz. Dr. H. Herrmann, Dr. M. Rauscher<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung, Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Zwischennachweis Sportbiomechanik I<br />
Zielgruppe: GRUNDSTUDIUM (Diplom, 4. FS)<br />
Leistungsnachweis: Endnachweis ohne Note (Zulassung zur mündlichen VD-<br />
Prüfung gemeinsam mit LG Sportmotorik und TL I )<br />
Inhalte:<br />
� Beitrag <strong>der</strong> Sportbiomechanik zur Entwicklung motorischer Fähigkeiten<br />
- Biomechanische Grundpositionen zur sportmotorischen Fähigkeitsentwicklung<br />
- Kraftfähigkeiten und Indikatoren aus biomechanischer Sicht<br />
- Biomechanisch begründete Einflüsse auf Konditionstestergebnisse<br />
- Beson<strong>der</strong>heiten des allgemeinen und des an eine spezielle Bewegung gebundene<br />
Konditionstests<br />
- Konditionstestergebnisse und nachlassende bzw. zunehmende Bewegungseffektivität<br />
- Biomechanische Gesichtspunkte zu allgemeinen und speziellen Kraftübungs- und<br />
Trainingsgeräten<br />
· Beitrag <strong>der</strong> Sportbiom. im Prozess <strong>der</strong> sporttechnischen Vervollkommnung<br />
- Zum Begriff <strong>der</strong> „sportlichen Technik“ und ihren biomechanischen Aspekten<br />
- Die sportliche Technik und ihre Darstellung / Wi<strong>der</strong>spiegelung<br />
- Zur Entwicklung und zur Erstellung sportlicher Techniken als Vorgabemodell für den<br />
sporttechnischen Ausbildungsprozess<br />
- Aspekte des Techniktrainings/Messplatztrainings<br />
- Kriterien <strong>der</strong> Zweckmäßigkeit sportlicher Techniken<br />
· Biomechanische Prinzipien und ihre Anwendung bei <strong>der</strong> „Technikanalyse“<br />
- Biomechanische Prinzipien als Kriterien <strong>der</strong> Zweckmäßigkeit einer Technik<br />
- Biomechanisches Prinzip <strong>der</strong> Gegenwirkung<br />
- Biomechanisches Prinzip <strong>der</strong> Drehimpulserhaltung<br />
- Biomechanisches Prinzip <strong>der</strong> optimalen Anfangskraft<br />
- Biomechanisches Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges<br />
- Biomechanisches Prinzip <strong>der</strong> optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlaufs<br />
- Biomechanisches Prinzip <strong>der</strong> zeitlichen Koordination von Einzelimpulsen<br />
Grundlagenliteratur:<br />
° BÜHRLE (1985). Grundlagen des Maximal- u. Schnellkrafttraining. – Schriftenreihe des Bundesinstitutes für<br />
Sportwissenschaft Band 56.- Schorndorf: Hoffmann.<br />
° MÜLLER (1987): Statistische und dynamische Muskelkraft. - Beiträge zur Sportwissenschaft , Band 7.-<br />
Frankfurt a.M.: Harri Deutsch.<br />
° SCHMIDTBLEICHER (1980): Maximalkraft und Bewegungsschnelligkeit. - Beiträge zur Bewegungsforschung<br />
im Sport, Band 3.- Bad Homburg.<br />
� WERSCHOSHANSKI (1978): Grundlagen des speziellen Krafttrainings. In: Mo<strong>der</strong>nes Krafttrainings im Sport.<br />
- Trainerbibliothek, Band 4.- Bartels und Wernitz.<br />
° HOCHMUTH (1982): Biomechanik sportlicher Bewegungen .- Berlin: Sportverlag.<br />
° WILLIMCZIK (1989): Biomechanik <strong>der</strong> Sportarten. Grundlagen-Methoden-Analysen .- Reinbek. Rowohlt.<br />
° BALLREICH; BAUMANN (1996): Grundlagen <strong>der</strong> Biomechanik des Sports. Probleme, Methoden, Modelle. -<br />
Stuttgart: Enke.<br />
� BALLREICH; KUHLOW-BALLREICH (1992): Biomechanik <strong>der</strong> Sportarten. - Band3: Biomechanik <strong>der</strong><br />
Sportspiele Teil I und II.- Stuttgart: Enke.<br />
° HERRMANN, H. (.1997): Sportliche Technik. In: HARTMANN,C.& SENF,G. Sport erleben – Sport verstehen,<br />
Cormenius – Institut Dresden.<br />
37
SPORTSTATISTIK/-INFORMATIK<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportstatistik - Grundlagen<br />
Lehrkräfte: Dr. Rohland<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung / Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Diplom-Studiengang, 3. Semester<br />
Leistungsnachweis: 2-stündige Klausur<br />
Inhalt:<br />
Erläuterung grundlegen<strong>der</strong> Begriffe und Verfahren <strong>der</strong> Statistik:<br />
- Datentypen, Häufigkeitsverteilung, Lageparameter<br />
- Maßzahlen für die Verteilung<br />
- Zusammenhangsmaße bei Nominal- und Ordinaldaten<br />
- Korrelation und Regression<br />
- Normalverteilung<br />
- Stichprobe, Schätzungen, Tests<br />
- Spezielle Signifikanztests<br />
Literatur:<br />
BORTZ,J. (1999): Statistik. Berlin: Springer<br />
ROHLAND, U. (2000): Statistik. Aachen: Shaker<br />
WILLIMCZIK, K. (1993): Statistik im Sport. Hamburg: Czwalina<br />
Veranstaltung: Sportstatistik/-informatik<br />
Lehrkräfte: Dr. Panzer<br />
Veranstaltungsform: Arbeit am Computer<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Sportstatistik - Grundlagen<br />
Zielgruppe: Magister, 3. Semester<br />
Leistungsnachweis: Beleg ohne Note<br />
Ziele <strong>der</strong> Veranstaltung: Überblick über grundlegende Verfahren <strong>der</strong> Statistik. Fragen die behandelt<br />
werden sind die Wahrscheinlichkeitstheorie, die deskriptive Statistik und die Inferenz-Statistik. Anhand<br />
von eigenen Beispielen, die im Unterricht erarbeitet werden, sollen die „Logik“ <strong>der</strong> statistischen<br />
Verfahren und <strong>der</strong>en Aussagegehalt dargestellt werden. In Übungen sollen die angeeigneten<br />
Kenntnisse an <strong>der</strong> Statistiksoftware SPSS umgesetzt werden.<br />
Kriterien für den Scheinerwerb: Neben <strong>der</strong> regelmäßigen Teilnahme (2 Fehltermine; je<strong>der</strong> Fehltermin<br />
muss durch ein ärztliches Attest belegt werden) wird das Seminar als bestanden gewertet, wenn die<br />
Teilnehmer/innen mir bis zum Ende des Seminars zwei kleine Hausarbeiten (Statistikaufgaben) per Email<br />
(panzer@rz.uni-leipzig.de) zugeschickt haben. Die Aufgaben werden nur bei <strong>der</strong> richtigen Lösung<br />
gewertet. Sie erhalten von mir Rückmeldung über das Ergebnis Ihrer Bearbeitung.<br />
Literatur:<br />
Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler. Springer, Berlin<br />
Bortz, J. & Döring, N. (1995). Forschungsmethoden und Evaluation. Springer, Berlin.<br />
Rogge, K. (1995). Methodenatlas. Springer. Berlin.<br />
Siegel, S. & Castellan, J. (1988). Non parametric statistics for behavioral sciences. McGrawHill, New York.<br />
New View of Statistics: URL: http://sportsci.org/resource/stats/index.html<br />
Jacobs: URL: http://www.phil.uni-sb.de/~jakobs/seminar/vpl/index.htm<br />
38
DIDAKTIK DES SCHULSPORTS<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportdidaktik/Didaktik des Schulsports I<br />
Lehrkräfte: Prof. Dr. Christina Müller, Dr. Sieghart Hofmann<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Grundstudium, 3./4. Semester<br />
Zielgruppe: Lehramt, Diplom<br />
Inhalt:<br />
- Fachdidaktische Konzepte<br />
- Ziele des Schulsports, Stufenspezifik<br />
- Bewegungserziehung/Bewegte Schule, sportliches Klima<br />
- Vollzugsformen des Sports: Erkunden, Wettkämpfen, Spielen, Üben (motorischer Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten)<br />
- Entwicklungstendenzen des Schulsports, Lehrplanfragen<br />
- Planen, Durchführen und Auswerten vom Sportunterricht<br />
Leistungsnachweis:<br />
Abschluss Lehramt: Testat<br />
(Belegarbeit, Arbeitsblätter) als notwendige Vorleistung<br />
für die Akademische Zwischenprüfung<br />
Abschluss Diplom: Testat<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Zeuner, A. (1994): Erziehung zum Sporttreiben - eine Allgemeine Schulsportmethodik. Zwickau. (3 Teile).<br />
Zeuner, A. & SENF, G. & HOFMANN, S. (Hrsg.) (1995): Sport unterrichten - Anspruch und Wirklichkeit.<br />
Kongressbericht. Sankt Augustin.<br />
Müller, Chr. (1999): Bewegte Grundschule. Sankt Augustin.<br />
Müller, Chr. (2000): Schulsport in den Klassen 1 bis 4. Sankt Augustin.<br />
Themenspezifische Beiträge in den Zeitschriften Körpererziehung, Sportpädagogik, Sportunterricht.<br />
Bielefel<strong>der</strong> Sportpädagogen (1993): Methoden im Sportunterricht. Schorndorf.<br />
39
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportdidaktik/Didaktik des Schulsports II<br />
Lehrkraft: Dr. Sieghart Hofmann<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang: 1 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss Schulsportdidaktik I<br />
Zielgruppe: Diplom<br />
Inhalt:<br />
- Zum Inhalt des Sportunterrichts; Methodenvielfalt<br />
- Aspekte offenen Unterrichts<br />
- Differenzierung; Soziales Lernen<br />
- Leistung; Bewertung und Zensierung<br />
- Körpererfahrung; Beson<strong>der</strong>heiten für Mädchen<br />
- Umgang mit Unterrichtsstörungen<br />
- Vermittlung von Wissen; selbstständiges Üben<br />
Leistungsnachweis: Testat<br />
Grundlagenliteratur: Vgl. Schulsportdidaktik I<br />
Veranstaltung: Sportdidaktik/Didaktik des Schulsports II<br />
Lehrkraft: Professorin Dr. Christina Müller<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss Schulsportdidaktik II,<br />
Akademische Zwischenprüfung<br />
Zielgruppe: Lehramt<br />
Inhalt:<br />
Schülerorientierte Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen<br />
- offener und problemorientierter Sportunterricht<br />
- Differenzierung/Wahlmöglichkeiten<br />
- soziales Lernen<br />
- Bewertung und Zensierung<br />
- Bewegungs- und Körpererfahrungen<br />
- Beson<strong>der</strong>heiten von Mädchen und Jungen<br />
- Wissensvermittlung, Medieneinsatz<br />
- Fachübergreifend unterrichten, Projekte<br />
Außerunterrichtlicher Schulsport<br />
Unfallverhütung und Sicherheitserziehung<br />
Leistungsnachweis: Testat (Belegarbeit, Arbeitsblätter)<br />
als notwendige Vorleistung für die 1. Staatsprüfung<br />
Grundlagenliteratur: vgl. Schulsportdidaktik I<br />
Weiterführende Literatur in <strong>der</strong> Studienanleitung<br />
40
Veranstaltung: Sportför<strong>der</strong>unterricht, Teil 1<br />
Lehrkraft: Frau Professorin Dr. Christina Müller<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/Seminar,<br />
didaktisch-methodische Übungen<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Hauptstudium<br />
Zielgruppe: Lehramt<br />
Inhalt:<br />
- Anliegen, Ziele und Inhalte des Sportför<strong>der</strong>unterrichtes<br />
- Kennzeichnung und Ursachen von Haltungsschwächen<br />
- Maßnahmen zum Ausgleich <strong>der</strong> Haltungsschwächen<br />
- Kennzeichnung und Ursachen von Organleistungsschwächen<br />
- Maßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong> Organleistungsfähigkeit<br />
- Kennzeichen und Ursachen von Koordinationsschwächen<br />
- Maßnahmen zur Verbesserung des koordinativen Fähigkeitsniveaus<br />
Leistungsnachweis:<br />
- Klausur von 90 Minuten<br />
- Erarbeitung eines Beispiels für Planarbeit für eine Haltungsschwäche<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Rusch, H. & Weineck, J. (1998): Sportför<strong>der</strong>unterricht. 5. Aufl. Schorndorf.<br />
Rusch, H. (1989): Arbeitskarten für den Sportunterricht. 3. Aufl. Schorndorf.<br />
Zmmer, R. & Cicurs, H. (1993): Psychomotorik. 3. Aufl. Schorndorf.<br />
Hirtz, P. (1985): Koordinative Fähigkeiten im Schulsport. Berlin.<br />
Müller, Chr. (1999): Bewegte Grundschule. Sankt Augustin.<br />
Müller, Chr. (2000): Schulsport in den Klassen 1 bis 4. Sankt Augustin.<br />
41
Veranstaltung: Sportför<strong>der</strong>unterricht, Teil 2<br />
Lehrkraft: Dr. Sieghart Hofmann<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
didaktisch-methodische Übungen<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Hauptstudium<br />
Zielgruppe: Lehramt<br />
Inhalt:<br />
- Möglichkeiten und Grenzen <strong>der</strong> Wahrnehmung<br />
- Unterrichtsbeispiele zur Wahrnehmungsför<strong>der</strong>ung und motorischen För<strong>der</strong>ung<br />
- emotional-soziale Aspekte des Sporttreibens<br />
- Unterrichtsbeispiele zur sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklungsför<strong>der</strong>ung über<br />
Bewegung, Spiel und Sport<br />
- Tests- und Auswahlverfahren<br />
Leistungsnachweis: Klausur von 90 Minuten<br />
Grundlagenliteratur:<br />
RUSCH, H. & WEINECK, J. (1998): Sportför<strong>der</strong>unterricht. 5. Aufl. Schorndorf.<br />
Zimmer, R. & Cicurs, H. (1993): Psychomotorik. 3. Aufl. Schorndorf.<br />
Müller, Chr. (2000): Schulsport in den Klassen 1 bis 4. Sankt Augustin.<br />
Kipphard, E.J. (1990): Motopädagogik. Dortmund.<br />
Schwaag, M. & Jansen, W. (1991): Geräte und Materialien in <strong>der</strong> Bewegungserziehung. Schorndorf.<br />
Veranstaltung: Schulpraktische Übungen<br />
Lehrkraft: Dr. Hofmann<br />
Veranstaltungsform: Hospitationen/Unterrichtsversuche<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Hauptstudium (Didaktik I und II)<br />
Zielgruppe: Lehramt<br />
42
FORSCHUNGSMETHODIK IM SPORT<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Forschungsmethodik I<br />
Lehrkraft: Doz. Dr. Herrmann (Organisation)<br />
Veranstaltungsform: Ringvorlesung <strong>der</strong> Institute<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Studierende 3. Semester<br />
Leistungsnachweis: mehrere Testate<br />
Veranstaltung: Forschungsmethodik II/III und Projektarbeit<br />
Lehrkraft: Lehrkräfte <strong>der</strong> Institute<br />
Veranstaltungsform: Seminare und eigenständige Projektarbeit<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Forschungsmethodik I<br />
Zielgruppe: Diplom-Studierende des Hauptstudiums und Magister-<br />
Studierende im Grund- und Hauptstudium<br />
43
GERÄTTURNEN<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Gerätturnen Teil I + II<br />
Lehrkräfte: Dr. R. Härtig, Dr. R. Leske<br />
Veranstaltungsform: Seminare und Übungen<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Studierende aller Studienrichtungen/Grundstudium<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Teil I: Theoretische Leistungsnachweise: schriftliche Kontrollen; Grundkenntnisse zur Terminologie;<br />
Grundkenntnisse über Formen des Helfens und Sicherns<br />
Praktischer Leistungsnachweis: Nachweis <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit ausgewählter Elemente<br />
- Teil II: Theoretische Leistungsnachweise: schriftliche Kontrollen - siehe Grundlagen des Gerätturnens<br />
Teil I; Grundkenntnisse zur Fehleranalyse und -korrektur; Grundkenntnisse zur Lehr- und<br />
Lernmethodik im Gerätturnen; Abschlussarbeit (30') zu Schwerpunkten <strong>der</strong> Ausbildung - Teil I<br />
und Teil II<br />
- Praktische Leistungsnachweise: Vorbereitung und Durchführung einer lehrmethodischen Aufgabe;<br />
Nachweis <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit ausgewählter Elemente in Kürübungen mit Pflichtanfor<strong>der</strong>ungen<br />
an 4 Geräten<br />
Inhalt:<br />
- Technik und Methodik grundlegen<strong>der</strong> Elemente<br />
- Terminologie<br />
- Hin<strong>der</strong>nisturnen und Gruppenturnen<br />
- Technik und Struktur von Turnelementen<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Lehr- und Lernmethodik<br />
- Fehleranalyse und -korrektur<br />
- Helfen und Sichern<br />
- vielseitiges Turnen an, auf und mit Geräten<br />
Grundlagenliteratur: s. Kleiner Schwerpunkt Gerätturnen<br />
44
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Gerätturnen, Teil II<br />
Lehrkraft: Dr. R. Leske<br />
Veranstaltungsform: Seminar und Übung<br />
Zulassungsbedingungen: mit Erfolg abgeschlossenes Grundstudium<br />
Zielgruppe: Studierende aller Studienrichtungen/ Hauptstudium<br />
Leistungsnachweise:<br />
Fachprüfung mit den Prüfungsteilen:<br />
- Klausur (60 Minuten)<br />
- Nachweis <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit ausgewählter Elemente und Helferfertigkeiten<br />
- Lehrprobe (30 - 45 Minuten)<br />
Inhalt:<br />
- Lehr- und Lernmethodik am Beispiel ausgewählter grundlegen<strong>der</strong> Elemente an den Geräten<br />
Reck, Stufenbarren, Boden, Sprung, Barren, Ringe, Pauschenpferd, Schwebebalken in Verbindung<br />
mit eigener Fertigkeitsentwicklung<br />
- grundlegendes Kampfrichterwissen<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Autorenkollektiv (1987). Gerätturnen - Anleitung für den Übungsleiter. Berlin: Sportverlag.<br />
- Autorenkollektiv (1989). Lehrheft Gerätturnen - Themen <strong>der</strong> Grundausbildung. Deutsche Hochschule für<br />
Körperkultur. Leipzig.<br />
- Autorenkollektiv (1989). Gerätturnen - Grundausbildung. Wissensspeicherheft. Deutsche Hochschule für<br />
Körperkultur. Leipzig.<br />
- Arndt, J. (1987). Gerätturnen - Anleitung für den Übungsleiter. Berlin: Sportverlag.<br />
- Bruckmann, M. (1990). Wir turnen miteinan<strong>der</strong>. För<strong>der</strong>gesellschaft des Schwäbischen Turnerbundes.<br />
Stuttgart.<br />
- Bucher, W. (1989). 1008 Spiel- und Übungsformen im Gerätturnen. Schorndorf: Verlag Hofmann.<br />
- Härtig, R. & Buchmann, G. (1988). Gerätturnen - Trainingsmethodik. Berlin: Sportverlag.<br />
- Knirsch, K. (1983). Lehrbuch des Gerät- und Kunstturnens - Band 1 und 2: Technik und Methodik in Theorie<br />
und Praxis für Schule und Verein. Böblingen.<br />
- Kundisch, K. (1983). Lehrbuch des Gerät- und Kunstturnens. Band 1 und 2: Technik und Methodik in Theorie<br />
und Praxis für Schule und Verein. Böblingen.<br />
- Lehrplan Deutscher Turnerbund Band 1 - 7. München; Wien; Zürich. BLV Verlagsgesellschaft (Breitensport)<br />
- Rahmentrainingskonzeptionen für Kin<strong>der</strong> und Jugendliche im Leistungssport (1992). Landessportbund<br />
Nordrhein-Westfalen e.V.<br />
- Technisches Komitee <strong>der</strong> FIG. Wertungsvorschriften Kunstturnen Frauen bzw. Männer.<br />
Studienhefte:<br />
- Ausgewählte Probleme zur Trainingsmethodik im Leistungsgerätturnen. Leipzig. DHfK.<br />
- Übungen an den Geräten (Reck, Stufenbarren, Sprungpferd, Boden, Ringe, Barren).<br />
- Zu Fragen <strong>der</strong> Entwicklung konditioneller Fähigkeiten im Gerätturnen.<br />
- Zur technischen Ausbildung im Gerätturnen.<br />
45
GYMNASTIK/TANZ<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Gymnastik/Tanz<br />
Lehrkräfte: Frau Nicklas, Frau Graf, Frau List, Frau Wolff, Frau Göhler,<br />
Frau Rö<strong>der</strong><br />
Veranstaltungsform: Kurse (Theorie- und Praxiseinheiten)<br />
Stundenumfang: 60 Stunden, die in vier Kursen (2 Pflichtkurse sowie 2 wahlobligatorische<br />
Kurse) zu absolvieren sind; die Ausbildung kann in jedem Semester<br />
begonnen und optimal in zwei Semestern bewältigt werden<br />
Zulassungsbedingungen: für einzelne Kurse werden Funktionsgymnastik/Rhythmik vorausgesetzt<br />
Zielgruppe: Grundstudium (Diplom/Lehramt/Magister)<br />
Leistungsnachweise:<br />
Endnachweis als Voraussetzung für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung <strong>der</strong> Sportartengruppe A<br />
Inhalt:<br />
Aneignen grundlegen<strong>der</strong> gymnastischer und tänzerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Anwendung<br />
in den verschiedenen Bereichen des Sports (Vereine, Schulen, Freizeit- und Fitnesszentren).<br />
Pflichtkurse: Funktionsgymnastik (1 SWS) und<br />
Rhythmik (1 SWS)<br />
wahlobligatorische Kurse: Diplomstudenten müssen einen Kurs aus dem Bereich Fitnessgymnastik<br />
und einen Kurs aus dem Bereich tänzerische Grundlagen<br />
belegen.<br />
Angebot <strong>der</strong> wahlobligatorischen Kurse:<br />
Fitnessgymnastik (1 SWS): Bodyshaping<br />
Stretching<br />
Gymnastik zur Prävention und Rehabilitation<br />
Aerobic<br />
Step-Aerobic<br />
(Die Kurse Aerobic und Step-Aerobic sind Zulassungsbedingungen für<br />
die Wahlsportart Sport-Aerobic. Der nächste Kurs Sport-Aerobic ist für<br />
SS 2005 geplant!)<br />
Yoga<br />
Gymnastik mit Handgeräten (Seil/Ball/Keulen) – Pflichtkurs für Lehramt!<br />
Tänzerische Grundlagen (1 SWS): Hip Hop<br />
Rock´n Roll<br />
Körpertechniken für Gymnastik/Tanz/Gerätturnen<br />
Klassischer Tanz I<br />
Jazztanz I<br />
Steptanz<br />
Volkstanz<br />
Improvisation/Showübungen für Kin<strong>der</strong> und Jugendliche<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Literaturübersichten werden in den Seminarveranstaltungen <strong>der</strong> einzelnen Kurse gegeben.<br />
46
RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Rhythmische Sportgymnastik I<br />
Lehrkraft: Frau List<br />
Veranstaltungsform: Übungen/Seminar<br />
Stundenumfang: 60 Stunden; 2 SWS über zwei Semester<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: StudentInnen im Grundstudium (Diplom/Lehramt/Magister)<br />
Leistungsnachweise:<br />
Endnachweis als Voraussetzung für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung bzw. Fachprüfung zum<br />
Vordiplom: Demonstration von 2 Kürübungen mit Handgeräten (freie Wahl) und Klausur (2 h) zu<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Technik und Trainingsmethodik<br />
Hinweis:<br />
RSG, Teil II, findet im SS 20<strong>04</strong> statt. Der Kurs Wahlsportart RSG wird nur durchgeführt, wenn sich<br />
mind. 8 Studenten einschreiben. Die nächste Ausbildung ist für WS 2005/06 geplant.<br />
Inhalt:<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Technik und Methodik <strong>der</strong> Rhythmischen Sportgymnastik mit den Handgeräten<br />
Seil, Reifen, Ball, Keulen und Band<br />
- Gestalten von Wettkampf- und Showübungen als Einzel- o<strong>der</strong> Gruppenübung<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Schwabowski & Brzank & Nicklas (1998). Rhythmische Sportgymnastik. Aachen: Meyer & Meyer.<br />
- T.S. Lissizkaja (1986). Rhythmische Sportgymnastik. Berlin: Sportverlag.<br />
- Gienger (1988). Rhythmische Sportgymnastik. Reinbeck/Hamburg.<br />
- Heinß & Brzank (1981): Gymnastik. Berlin: Sportverlag.<br />
- Wendt & Heß & Nicklas & Schwabowski (1983). Terminologie – Rhythmische Sportgymnastik. Berlin:<br />
Sportverlag.<br />
- Lehrhefte <strong>der</strong> DHfK. Trainingsanleitungen zur technischen Ausbildung in <strong>der</strong> Gymnastik - Übungskataloge<br />
zu den Handgeräten. Lehrheft <strong>der</strong> DHfK: „Übungen zur Entwicklung von Kraft und Beweglichkeit“.<br />
47
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltungen: KSP Gymnastik/Tanz<br />
Lehrkräfte: siehe Grundstudium Gymnastik/Tanz<br />
Veranstaltungsform: Kurse (Theorie- und Praxiseinheiten)<br />
Stundenumfang: 120 Stunden, einschließlich einer zusammenfassenden Seminarreihe<br />
(Schwerpunkt: Methodik)<br />
Zulassungsbedingungen: abgeschlossenes Grundstudium Gymnastik/Tanz<br />
Zielgruppe: Diplom/Lehramt/Magister<br />
Leistungsnachweise:<br />
Fachprüfung in Gymnastik/Tanz als Teil <strong>der</strong> Diplomprüfung – diese setzt sich aus einer Lehrprobe und<br />
einer mündlichen Prüfung zusammen (entspricht <strong>der</strong> Ausbildung zum Fachübungsleiter – C-Lizenz)<br />
Inhalt:<br />
Pflichtkurse: Gymnastik mit Handgeräten (1 SWS)<br />
Körpertechniken für Gymnastik/Tanz/Gerätturnen (1 SWS), Musik<br />
und Bewegung (1 SWS) und zusammenfassende Seminarreihe<br />
(1 SWS)<br />
Wahlkurse: Aus den Gruppen Fitnessgymnastik und Tänzerische Grundlagen sind<br />
jeweils mindestens zwei Kurse zu belegen. Der Kursumfang beträgt<br />
im allgemeinen 15 Wochen á 45 Minuten; die tänzerischen Kurse II<br />
werden über 15 Wochen á 90 Minuten (2 SWS) geführt.<br />
Die Seminarreihe wird im WS <strong>04</strong>/05 nur durchgeführt, wenn mind. 6 Studenten/Studentinnen hierfür<br />
die Zulassungsbedingungen erfüllen: abgeschlossene Grundausbildung und Nachweis von 90 Std. (6<br />
SWS) im Fachgebiet Gymn./Tanz.<br />
Kursangebot:<br />
Fitnessgymnastik: Bodyshaping<br />
Stretching<br />
Gymnastik zur Prävention und Rehabilitation<br />
Aerobic<br />
Step-Aerobic<br />
Yoga<br />
Gymnastik mit Handgeräten (Seil/Ball/Keulen)<br />
Tänzerische Grundlagen: Hip Hop<br />
Rock´n´ Roll<br />
Körpertechniken für Gymnastik/Tanz/Gerätturnen<br />
Klassischer Tanz I<br />
Jazztanz I<br />
Mo<strong>der</strong>n Dance<br />
Steptanz<br />
Volkstanz<br />
Improvisation<br />
Musik und Bewegung<br />
Grundlagenliteratur: Literaturübersichten werden in den Seminarveranstaltungen <strong>der</strong> einzelnen Kurse gegeben.<br />
48
INLINE-SKATING<br />
Veranstaltung: Inline-Skating Teil I und II<br />
Lehrkräfte: Dr. Minow/Steffen Hoffmann<br />
Veranstaltungsform: Übung/Seminar<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM, Studenten aller Studiengänge, die die<br />
Voraussetzungen erfüllen<br />
Stundenumfang: je 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Teil I: keine; Teil II: Abschluss Inline-Skating Teil I<br />
Inhalt:<br />
Zielstellung ist zum einen, die Ausbildung und Vervollkommnung grundlegen<strong>der</strong> Fertigkeiten und<br />
Fähigkeiten des Inline-Skatens für den Fitnessbereich durch Erlernen <strong>der</strong> verschiedenen Einsteigerund<br />
Fortgeschrittentechniken und zum an<strong>der</strong>en, die theoretische Vermittlung des sportartspezifischen<br />
Wissens sowie die Darstellung <strong>der</strong> Möglichkeiten des Inline-Skatens als Trainingsmittel für an<strong>der</strong>e<br />
Sportarten.<br />
Mit ausgewählten Aufgabenstellungen zur Methodik <strong>der</strong> Ausbildung soll die Lehr- und<br />
Vermittlungskompetenz <strong>der</strong> Studenten geför<strong>der</strong>t werden. Die Studenten werden so vorbereitet, dass<br />
sie am Ende <strong>der</strong> Ausbildung an einer C-Lizenz-Ausbildung teilnehmen können (Voraussetzung, um<br />
selbständig Kurse durchführen zu können).<br />
Themengruppen und Schwerpunkte:<br />
1. Erlernen <strong>der</strong> Einsteigertechniken des Inline-Skatens (Fallschulung, Heelstop, vorwärts fahren,<br />
Kurven fahren, vorwärts übersetzen)<br />
2. Theoretische Grundlagen des Inline-Skatens<br />
3. Vervollkommnung <strong>der</strong> Einsteigertechniken, Erlernen neuer und anspruchsvoller Techniken des<br />
Inline.Skatings (rückwärts übersetzen, Sprünge und Drehungen, Freestyle-Figuren)<br />
4. Spiel- und Übungsformen wie Inline-Hockey, Inline-Basketball, Inline-Handball).<br />
5. Vermittlung von Grundlagen zur methodische Befähigung als Inline-Instructor<br />
Leistungsnachweis:<br />
Praxis/Technikeinschätzung: 50 %<br />
Lehrprobe: 25 %<br />
Theorie/Klausur: 25 %<br />
Literatur:<br />
HÄNSEL, F.; PFEIFER, K.; WOLL, A. (HRSG.) (1999): Lifetime-Sport Inline-Skating, Beiträge zur Lehre und<br />
Forschung im Sport.- Schorndorf.<br />
NAGEL, V.; HATJE, T. (1997): Inline-Skating - das Handbuch. - Berlin: Sportverlag.<br />
SAUTER, U. (1966): Inline-Skating - Ausrüstung, Techniken, Fahrpraxis. - Nie<strong>der</strong>hausen/Ts.: Falken-Verlag.<br />
49
KAMPF- UND KRAFTSPORTARTEN<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen Judo Teil I<br />
Lehrkraft: Dr. Ulbricht<br />
Lehrformen: Vorlesung/Übungen (je 2 SWS im WS 02/03 und SS 03)<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Grundstudium alle Studienrichtungen<br />
Leistungsnachweise: Schriftliche o<strong>der</strong> mündliche Abschlussprüfung, Regeltestat,<br />
Sportpraktische Nachweise<br />
Inhalt:<br />
- Grundlegende Elemente und Techniken<br />
- Fachterminologie<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Lehr- und Lernmethodik<br />
- Fehleranalyse und Fehlerkorrektur<br />
- Wesentliche Wettkampfregeln<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Lehmann, G.; Ulbricht. H.-J. (1994): Große Judo - Wurfschule. Berlin – Ullstein-Verlag<br />
- Müller-Deck, H.; Michelmann, M. (1994): Große Judo – Bodenkampfschule. Berlin – Ullstein – Verlag<br />
- Klocke, U. (1997): Judo lernen. Bonn – Verlag Dieter Born<br />
Veranstaltung: Grundlagen Taekwondo Teil I<br />
Lehrkräfte: Ingo Friedrich<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/Übungen<br />
Stundenumfang: 4 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Grundstudium alle Studienrichtungen<br />
Leistungsnachweise:<br />
- schriftliche Abschlussprüfung<br />
- Regeltestat<br />
- sportpraktische Nachweise<br />
Inhalt:<br />
- grundlegende Bewegungsformen und Techniken<br />
- spezielle Trainingsmethoden<br />
- Fehleranalyse und Fehlerkorrektur<br />
- wesentliche Wettkampfregeln<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Pieter, W. (1994). Taekwondo. Köln: Meyer & Meyer Verlag<br />
Streif, G.(1994). Mo<strong>der</strong>nes Taekwondo. Weinheim: Sportbuch-Verlag Velte.<br />
50
Veranstaltung: Grundlagen Boxen Teil II<br />
Lehrkraft: Professor Dr. Kirchgässner<br />
Veranstaltungsformen: Vorlesung/Übungen<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Grundstudium alle Studienrichtungen<br />
Leistungsnachweise:<br />
- schriftliche Abschlussprüfung<br />
- Regeltestat<br />
- sportpraktische Nachweise<br />
Inhalt:<br />
- grundlegende Bewegungsformen und Techniken<br />
- spezielle Trainingsmethoden<br />
- Fehleranalyse und Fehlerkorrektur<br />
- wesentliche Wettkampfregeln<br />
Grundlagenliteratur: Fiedler, H. & Kirchgässner, H. (1984). Boxsport. Berlin: Sportverlag.<br />
Veranstaltung: Einführung in den Kraftsport<br />
Lehrkraft: Sven Zeißler<br />
Veranstaltungsform: Seminare, Übungen<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: nur Lehramt<br />
Leistungsnachweis: Endnachweis mit Note; sportpraktischer Test<br />
Inhalt:<br />
- Grundlegende Merkmale funktioneller Übungen<br />
- Grundübungen zur Entwicklung <strong>der</strong> Kraft mit und ohne Geräte<br />
- Altersspezifik Kin<strong>der</strong> und Jugendlicher<br />
- Methodische Differenzierung <strong>der</strong> Kraftentwicklung<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Grosser/Starischka: Das neue Konditionstraining, BLV 1998<br />
- Hartmann/Tünnemann: Mo<strong>der</strong>nes Krafttraining, Sportverlag 1986<br />
51
Veranstaltung: Grundausbildung Kraftsport I und II<br />
Lehrkraft: Sven Zeißler<br />
Veranstaltungsform: Seminar, Übungen<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Grundstudium<br />
Leistungsnachweise: schriftliche Abschlussprüfung o<strong>der</strong> mündliche Vordiplomprüfung,<br />
sportpraktischer Test<br />
Inhalt:<br />
- Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen des Krafttrainings<br />
- Krafttrainingsübungen zur differenzierten Entwicklung <strong>der</strong> Kraft unter Berücksichtigung funktionellanatomischer<br />
Gesichtspunkte<br />
- Übungsanalysen<br />
- Grundmethoden und Organisationsformen des Krafttrainings<br />
- Spezielle Aspekte des Muskelaufbautrainings<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Grosser/Starischka: Das neue Konditionstraining, BLV 1998<br />
- Hartmann/Tünnemann: Mo<strong>der</strong>nes Krafttraining, Sportverlag 1986<br />
- Delavier: Muskel-Guide, BLV 2000<br />
- Bredenkamp/Hamm :Trainieren im Sportstudio, Fitness-Contur 1990<br />
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Judo Teil I<br />
Lehrkraft: Dr. Ulbricht<br />
Lehrformen: Vorlesung/Seminar/Übung (über 2 Sem. je 4 SWS)<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss Judo - Grundausbildung o<strong>der</strong> Trainings- und<br />
Wettkampferfahrungen<br />
Zielgruppe: Hauptstudium Diplom, Magister, Lehramt<br />
Leistungsnachweise: Schriftliche Abschlussprüfung, Referate, Lehrproben,<br />
Sportpraktische Nachweise<br />
Inhalt:<br />
- Techniken und Elemente des Ausbildungs- und Prüfungsprogramms des DJB<br />
- Wirkungsweise von Wurf- und Griffprinzipien<br />
- Judospezifische Trainingsmittel<br />
- Gestaltung des langfristigen Leistungsaufbaus<br />
- Methoden <strong>der</strong> Analyse und Leistungsdiagnostik<br />
- Spezielle Aspekte des Breiten- und Schulsportes im Judo<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Lehmann, G.; Ulbricht. H.-J. (1994): Große Judo - Wurfschule. Berlin – Ullstein-Verlag<br />
- Müller-Deck, H.; Michelmann, M. (1994): Große Judo – Bodenkampfschule. Berlin – Ullstein – Verlag<br />
- Klocke, U. (1997): Judo lernen. Bonn – Verlag Dieter Born<br />
- Klocke, U. (1997): Judo anwenden. Bonn – Verlag Dieter Born<br />
52
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Taekwondo<br />
Lehrkraft: Ingo Friedrich<br />
Lehrformen: Vorlesung/Seminar/Übung (über 2 Sem. je 4 SWS)<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss Taekwondo - Grundausbildung o<strong>der</strong> Trainings- und<br />
Wettkampferfahrungen<br />
Zielgruppe: Hauptstudium Diplom, Magister, Lehramt<br />
Leistungsnachweise: Schriftliche Abschlussprüfung, Referate, Lehrproben,<br />
Sportpraktische Nachweise<br />
Inhalt:<br />
- Techniken und Elemente des Ausbildungs- und Prüfungsprogramms <strong>der</strong> DTU<br />
- Wirkungsweise von Tritt- und Schlagtechniken<br />
- Taekwondospezifische spezifische Trainingsmittel<br />
- Gestaltung des langfristigen Leistungsaufbaus<br />
- Methoden <strong>der</strong> Analyse und Leistungsdiagnostik<br />
- Spezielle Aspekte des Breiten- und Profilsportes im Judo<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Ko, E.M.: Tae-Kwon-Do. Dachau: Schramm-Sport-GmbH, 1990<br />
- Lehmann, G.: Ausdauertraining in Kampfsportarten. Münster: Philippka-Verlag, 2000<br />
- Pieter, W.; Heijmans, J.: Taekwondo. Aachen: Meyer und Meyer, 1995<br />
- Schnabel, G./HARRE; D./Borde, A. (Hrsg.): Trainingswissenschaft. Berlin:<br />
- Sportverlag (1974, 1994)<br />
- Streif, G.: Taekwondo Mo<strong>der</strong>n. Köln: Sensei-Verlag, 1997<br />
Veranstaltung: Theorie und Praxis Kraftsport (Kleine Spezialisierung)<br />
Lehrkraft: Dr. Keine<br />
Veranstaltungsform: Seminare, Übungen, Lehrproben<br />
Zulassungsbedingungen: Grundausbildung Kraftsport o<strong>der</strong> Kraftsporterfahrung<br />
Zielgruppe: Hauptstudium<br />
Leistungsnachweis: Mündliche Diplomprüfung o<strong>der</strong> schriftliche Abschlussklausur;<br />
sportpraktische Tests, Lehrproben/Referate<br />
Inhalte:<br />
- Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten des Krafttrainings - Zielgruppenspezifik<br />
- Differenzierte Übungsanalysen unter Berücksichtigung von Wirksamkeit und Funktionalität<br />
- Methodik des Kraft- und Fitnesstrainings unter Berücksichtigung spezieller Zielaspekte<br />
- Krafttrainingskonzepte im kommerziellen Sport<br />
- Ernährung und Supplementierung im Krafttraining<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Boeckh-Behrens/Buskies: Fitness-Krafttraining, Rowohlt 2000<br />
- Zatsiorsky: Krafttraining - Praxis und Wissenschaft, Meyer & Meyer 1996<br />
- Grosser/Starischka: Das neue Konditionstraining, BLV 1998<br />
- Hartmann/Tünnemann: Mo<strong>der</strong>nes Krafttraining, Sportverlag 1986<br />
- Delavier: Muskel-Guide, BLV 2000<br />
- Bredenkamp/Hamm: Trainieren im Sportstudio, Fitness-Contur 1990<br />
- Geiger: Überlastungsschäden im Sport, BLV 1997<br />
- Gottlob: Differenziertes Krafttraining. Urban & Fischer 2001<br />
53
KLETTERN<br />
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen Klettern<br />
Lehrkraft: Kaj Kinzel<br />
Veranstaltungsform: Übung/Seminar<br />
Zielgruppe: Grund- und Hauptstudium (Wahlsport, Teil KSP<br />
Abenteuer- und Erlebnissport)<br />
Voraussetzungen: Keine, beachte: für Nutzung <strong>der</strong> Kletteranlagen,<br />
Materialleihe, Spezialversicherung und Fahrtkosten wird ein<br />
Unkostenbeitrag erhoben.<br />
Inhalt:<br />
Ziel <strong>der</strong> Ausbildung soll sein, dass die Teilnehmer sich selbständig in einfachen<br />
Kletterwegen o<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Kunstwand bewegen können. Schwerpunkt <strong>der</strong> Ausbildung ist das Erlernen<br />
und Festigen <strong>der</strong> Sicherungstechniken beim Klettern. Grundlegende Klettertechniken werden an <strong>der</strong><br />
Kunstwand sowie im Rahmen einer eintägigen Exkursion in einen Steinbruch bei Leipzig erlernt.<br />
Weitere Techniken werden beim Felsklettern erarbeitet.<br />
Mit einer Einführung in das Vorsteigen und Führen einer Seilschaft schließt <strong>der</strong> Kurs.<br />
Weitere Themen sind trainingswissenschaftliche Aspekte beim Klettertraining, einfache<br />
Bergrettungsmaßnahmen sowie Seminare zu Methodik, Sicherungstheorie und Materialkunde.<br />
Beson<strong>der</strong>heit <strong>der</strong> Lehrveranstaltung:<br />
Bearbeitung einer praxisorientierten Projektarbeit mit einem Arbeitsumfang von 10 - 20 Stunden (z.B.<br />
"Organisation eines Klettertages für Studenten", "Organisation eines Schnupperkletterns für Blinde",<br />
"Herzfrequenzen beim Klettern" u.v.m.)<br />
Für Fortgeschrittenen bieten wir in diesem Rahmen eine mehrtägige Exkursion in die<br />
Sächsische Schweiz an (nur im Sommersemester). Ziel ist hier, aufbauend auf den Teil I+II, eine<br />
Festigung des Erlernten und dessen Vervollkommnung im Sandstein (neue Kletter- und<br />
Sicherungstechniken im Fels) zu erreichen.<br />
Leistungsnachweis:<br />
Praxis: Technikeinschätzung und Schwierigkeitsklettern: 33,3 %<br />
Semesterarbeit 33,3 %<br />
Theorie: Klausur: 33,3 %<br />
Literatur:<br />
Schubert, P (1995 ). Sicherheit und Risiko in Fels und Eis (3. Auflage). München: Rother.<br />
Schraag, K. (1991). Bergwan<strong>der</strong>n Alpin-Lehrplan 1. München: BLV<br />
Hoffmann, M.; Pohl, W. (1996). Felsklettern, Sportklettern Alpin-Lehrplan 2. München: BLV<br />
Gyer, P.; Dick, A. (2001). Hochtouren, Eiskletten Alpin-Lehrplan 3. München: BLV<br />
Gyer, P.; Pohl,W. (1998). Skibergsteigen, Variantenfahren Alpin-Lehrplan 4. München: BLV<br />
Schubert, P.; Stückl,P. (1999). Sicherheit am Berg Alpin-Lehrplan 5. München: BLV<br />
Schubert, P.;Stückl, P. (1991). Ausrüstung, Sicherung, Sicherheit Alpin-Lehrplan 6. München: BLV<br />
Har<strong>der</strong>,G.; Elsner,D (1990). Bergsport-Handbuch. Reitsch bei Hamburg: Rowohlt<br />
54
LEICHTATHLETIK<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Leichtathletik Grundkurs I<br />
Lehrkräfte: Dr. R. Kuntoff, M. Tiedtke<br />
Veranstaltungsform: Übung / Seminar<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: alle Studiengänge, Grundstudium<br />
Leistungsnachweise:<br />
- 80 % Teilnahme<br />
- sportpraktischer Leistungsnachweis (Demonstration einzelner Bewegungstechniken)<br />
- methodische Übungen und Mehrkampf<br />
- theoretischer Leistungsnachweis (Semesterabschlussklausur o<strong>der</strong> Hausarbeit o<strong>der</strong> Protokoll sowie<br />
Kurzarbeiten und Referate)<br />
Inhalt:<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Leichtathletik Teil I:<br />
praktische, theoretische, didaktisch-methodisch Grundlagen <strong>der</strong> Techniken Start, Sprint; Speer;<br />
Hochsprung; Kugelstoßen; Fähigkeitsentwicklung<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Leichtathletik Teil II:<br />
praktische, theoretische, methodisch-didaktische Grundlagen <strong>der</strong> Techniken<br />
Diskuswurf, Hürdenlauf, Weitsprung, Fähigkeitsentwicklung<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Bauersfeld, K.-H. & Schröter G (1990). Grundlagen <strong>der</strong> Leichtathletik. Hochschullehrbuch (HLB). Berlin:<br />
Sportverlag.<br />
- Gundlach, H. (Hrsg) (1991). Technik <strong>der</strong> Top Athleten. Buchreihe zu den Disziplinblöcken in <strong>der</strong><br />
Leichtathletik. Berlin: Sportverlag.<br />
- Haberkorn C. & Plaß R. (1992). Leichtathletik 1 + 2. Spezielle Didaktik <strong>der</strong> Sportarten. Frankfurt: Diesterweg.<br />
- Jonath, U. & Krempel, R. & Haag, E. & Müller, H. (1995). Leichtathletik 1, 2 und 3. Reinbek: Rowohlt.<br />
- Schöllhorn,W.I. (1995). Schnelligkeitstraining. Eine Laufschule für alle Sportarten. Reinbek: Rowohlt<br />
55
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Kleiner Schwerpunkt Leichtathletik<br />
Lehrkräfte: Dr. R. Kuntoff, Dr. Th. Jaitner, M. Tiedtke<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/ Übung / Seminar<br />
Zulassungsbedingungen: Grundkurse I und II Leichtathletik<br />
Zielgruppe: alle Studiengänge (Magister, Lehramt, Diplom) Hauptstudium<br />
Leistungsnachweise:<br />
- mind. 80 % Teilnahme<br />
- sportpraktischer Leistungsnachweis (Demonstration einzelner Bewegungstechniken), methodische<br />
Übungen und Mehrkampf<br />
- theoretischer Leistungsnachweis (Semesterabschlussklausur o<strong>der</strong> Hausarbeit o<strong>der</strong> Protokoll sowie<br />
Referate und Diskussionsbeiträge n. B.)<br />
Inhalt:<br />
praktische und theoretische Vertiefung in Unterrichts und Trainingsformen sowie Struktur und Organisation<br />
<strong>der</strong> Verbände <strong>der</strong> Leichtathletik<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Ballreich, R. (1986). Biomechanik <strong>der</strong> Leichtathletik. Stuttgart: Enke.<br />
- DLV (Hrsg.). Rahmentrainingsplan für das Grundlagentraining. Achen: Meyer & Meyer.<br />
- DLV (Hrsg.). Rahmentrainingspläne <strong>der</strong> einzelnen Disziplinen. Aachen: Meyer & Meyer.<br />
- Gundlach, H. (Hrsg.) 1991). Technik <strong>der</strong> Top Athleten. Buchreihe zu den Disziplinblöcken in <strong>der</strong><br />
Leichtathletik. Berlin: Sportverlag.<br />
- Zeitschriften: Leichtathletik, Leistungssport, Leichtathletik Training.<br />
RADSPORT<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen des Radsports, Teil 1<br />
Lehrkräfte: St. Cramer (Leipzig)<br />
Veranstaltungsform:<br />
Stundenumfang:<br />
Zulassungsbedingungen:<br />
Zielgruppe:<br />
Leistungsnachweis:<br />
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Radsport<br />
Lehrkräfte: St. Cramer (Leipzig)<br />
Veranstaltungsform:<br />
Stundenumfang:<br />
Zulassungsbedingungen:<br />
Zielgruppe:<br />
Leistungsnachweis:<br />
56
SCHWIMMSPORT<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen des Schwimmsports, Teil I und II<br />
Lehrkräfte: Herr Doz. Dr. J. Dietze, Frau Dr. C. Saborowski, Herr Dr. D. Beise<br />
Veranstaltungsform: Seminare und Übungen<br />
Zulassungsbedingungen: Schwimmen I – ohne Zulassungsbedingungen<br />
Schwimmen II – erfolgreicher Abschluss Schwimmen I<br />
Zielgruppe: alle Studiengänge (Diplom, Magister, Lehramt) Grundstudium<br />
Leistungsnachweis:<br />
Teil I:<br />
Schriftliche Leistungskontrolle (Theorie); Leistungsüberprüfung im Zeitschwimmen über jeweils 50 m<br />
Rückenkraul-, Brust- und Kraulschwimmen (Praxis). Die Erfüllung <strong>der</strong> zeitlichen Mindestanfor<strong>der</strong>ungen<br />
(Note „4“ des Endnachweises Grundstudium) ist Bedingung für die Teilnahme an <strong>der</strong> schriftlichen<br />
Leistungskontrolle. Der Abschluss gilt als „Bestanden“, wenn beide Leistungsüberprüfungen (Theorie<br />
und Praxis) bestanden wurden.<br />
Teil II:<br />
Abschlussarbeit über 45‘ (Theorie); Leistungsüberprüfung im Zeitschwimmen über 50 m und 100 m in<br />
zwei Schwimmarten (eine Wechsel- und eine Gleichschlagschwimmart). Nachweis <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit<br />
<strong>der</strong> nicht leistungsmäßig geprüften Schwimmarten über jeweils 50 m sowie <strong>der</strong> Starts und<br />
Wenden.<br />
Das Erreichen <strong>der</strong> Mindestanfor<strong>der</strong>ungen beim Zeitschwimmen und <strong>der</strong> Nachweis <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit<br />
sind Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussarbeit.<br />
Theorie und Praxis gehen in die Abschlussbewertung jeweils zu gleichen Teilen ein.<br />
o<strong>der</strong> (Wahlmöglichkeit):<br />
Vordiplom: mündliche Prüfung über 45‘, Leistungs- und Demonstrationsnachweis.<br />
Theorie und Praxis gehen zu gleichen Teilen in die Vordiplomnote ein.<br />
Inhalt:<br />
Teil I:<br />
In 10 Seminaren und 20 Übungen (2 SWS) sollen wesentliche Grundlagen des Schwimmens vermittelt<br />
und angeeignet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ziele, Inhalte und didaktisch-methodische<br />
Übungen <strong>der</strong> 1. Etappe <strong>der</strong> schwimmerischen Grundausbildung sowie die Technik und Methodik des<br />
Rückenkraul-, Kraul- und Brustschwimmens, einschließlich <strong>der</strong> Starts. Ausgehend von <strong>der</strong> Vermittlung<br />
des Leitmodells <strong>der</strong> jeweiligen Technik <strong>der</strong> Schwimmarten sollen die SeminarteilnehmerInnen ihr<br />
eigenes schwimmerisches Leistungsniveau vervollkommnen.<br />
Teil II<br />
In 6 Seminaren und 24 Übungen (2 SWS) stehen die weitere Entwicklung und Vervollkommnung <strong>der</strong><br />
schwimmerischen Leistungs- und Demonstrationsfähigkeit sowie die Vermittlung und Aneignung <strong>der</strong><br />
Techniken und Methodik des Schmetterlingschwimmens, <strong>der</strong> Starts und Wenden im Mittelpunkt.<br />
Darüber hinaus werden ausgewählte bereichs- und fachgebietsspezifische Aspekte des Schwimmsports<br />
sowie die Belastungsgestaltung gelehrt.<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Studienanleitung des Fachgebiets Schwimmsport für das Grundstudium Schwimmen.<br />
- Dietze, J. & Renner, W. & Müller, C. (1987). Schwimmen – Anleitung für den Übungsleiter. Berlin.<br />
- Dietze, J. (Hrsg.) (1998). Grundlagentraining Sportschwimmen. Leipzig.<br />
- Schramm, E. u. A. (1987). Sportschwimmen. Berlin.<br />
- Wilke, K. (1997). Anfängerschwimmen. Training, Technik, Taktik. Hamburg.<br />
57
Veranstaltung: Grundausbildung Skisport I (obligatorisch)<br />
Lehrkräfte: Prof. K. Nitzsche u.a.<br />
Lehrform: 66 Std./Lehrgänge 09.02.-20.02.20<strong>04</strong>/<br />
21.02.-03.03.20<strong>04</strong> / 08.03.-19.03.20<strong>04</strong><br />
Zulassungsbedingungen: ohne<br />
Zielgruppe: alle Studienrichtungen<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Abschlussklausur<br />
- Überprüfung <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit ausgewählter Skitechniken<br />
- Skilanglaufwettkampf<br />
Inhalt Theorie:<br />
- Skigeschichte<br />
- Technik <strong>der</strong> Alpinen Skidisziplinen und Skilanglauf<br />
- Lehrweise <strong>der</strong> alpinen Skidisziplinen und Skilanglauf<br />
- Gerät und Ausrüstung<br />
- Schnee und Wachs<br />
- Lawinenkunde<br />
- Skisport und Umwelt<br />
- Touristischer Skilauf<br />
- Skiwettkämpfe/Regeln/Organisation<br />
- Planung und Gestaltung von Skikursen<br />
Inhalt Praxis:<br />
- Technik und Lehrweise ausgewählter Techniken des Skilanglaufs und alpinen Skilaufs<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Studienmaterial Skisport. <strong>Sportwissenschaftliche</strong> <strong>Fakultät</strong>/Universität Leipzig. 2001. 229 S.<br />
Veranstaltung: Grundausbildung Skisport II (Wahlsportart)<br />
Lehrkräfte: Prof. K. Nitzsche u. a.<br />
Lehrform: 66 Std./Ausbildungskurs 21.02.-03.03.20<strong>04</strong> in Österreich<br />
Zulassungsbedingungen: bei Bewerberzahl über 24 Teilnehmer – Notenmittelwert Praxis < 2,5<br />
Zielgruppe: alle Studienrichtungen<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Abschlussklausur<br />
- Lehrprobe<br />
- Überprüfung <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit ausgewählter Skitechniken Skilanglauf/alpiner Skilauf<br />
- Wettkampf Skilanglauf<br />
Inhalt Theorie:<br />
- Vertiefung und Erweiterung <strong>der</strong> Lehrweise und Techniken des Alpinen Skilaufs und Skilanglaufs<br />
- Einführung in die Skisportarten Biathlon, Skisprung und Snowboard<br />
- Biomechanische Betrachtungen zu ausgewählten Skitechniken<br />
- Rechtsfragen im Skisport<br />
Inhalt Praxis:<br />
- Technik und Lehrweise ausgewählter Techniken von Skilanglauf/Alpiner Skilauf/Snowboard/ Biathlon/Skisprung<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Studienmaterial Skisport. <strong>Sportwissenschaftliche</strong> <strong>Fakultät</strong>/Universität Leipzig. 200. 229 S.<br />
58
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Skisport (KSP)<br />
Lehrkraft: Prof. K. Nitzsche<br />
Zielgruppe: alle Studienrichtungen<br />
Zulassungsbedingungen: erfolgreicher Leistungsabschluss im 2. Skikurs (mind. Note 2,5)<br />
Zielgruppe: alle Studienrichtungen<br />
Teil I<br />
Veranstaltungsform/Umfang: Komplexseminare – 4 SWS<br />
Leistungsnachweise: zwei Klausuren<br />
Theorieinhalt:<br />
- Komplexe Wettkampf-/Leistungs- und Trainingsstruktur <strong>der</strong> Sportarten Skilanglauf, Biathlon, Alpiner<br />
Skisport, Nordische Kombination, Skisprung<br />
- Technik und Lehrweise im Snowboard<br />
- Periodisierung im Skisport (Grundstandpunkte)<br />
- Leistungsdiagnostik in Skisportarten<br />
Teil II<br />
Veranstaltungsform: 12-tägiger Ausbildungslehrgang in Österreich 08.03.-19.03.20<strong>04</strong><br />
Leistungsnachweise:<br />
- Nachweis <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit in folgenden Skitechniken:<br />
� Diagonalschritt<br />
� Doppelstockschub m. Zwischenschritt<br />
� Skating Eintakt und Zweitakt<br />
� Geländeangepasstes Laufen<br />
� Geländeangepasstes Fahren (Buckelpiste)<br />
� Carven<br />
� Scherumsteigeschwünge<br />
� Parallelgrundschwünge mit unterschiedlicher Einleitung<br />
� Kurzschwingen<br />
� Beugedrehschwungfolge Snowboard<br />
� Wettkampf Skilanglauf/Biathlon/Riesenslalom<br />
- Lehrprobe über 30 Minuten<br />
Inhalt:<br />
- Vervollkommnung <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit ausgewählter Techniken im Skilanglauf, Snowboard,<br />
Alpiner Skilauf (s. o.)<br />
- Einführung in die Sportarten Biathlon und Skisprung - Aneignung bzw. Vertiefung<br />
lehrmethodischer und trainingsmethodischer Befähigung<br />
- Kenntnisvertiefung in Lawinenkunde, Gerät und Wachs<br />
Teil III<br />
Veranstaltungsform/Umfang: Übungen – 2 SWS<br />
Leistungsnachweise: Nachweis <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit in ausgewählten Lauftechniken<br />
(Skiroller) und Techniken des Inlineskatens<br />
Inhalt:<br />
- Lehrweise/Technikvervollkommnung Inlineskating<br />
- Lehrweise/Technikvervollkommnung Skiroller<br />
Leistungsnachweise: Abschluss KSP: Mündl. Abschlussprüfung<br />
Grundlagenliteratur<br />
- Informationsbroschüre <strong>der</strong> FG Wintersport. 2001. 238 S.<br />
- Snowboard-Lehrplan. DSV. 1995.<br />
- weitere Literaturangaben – s. GSP Skisport<br />
59
Veranstaltung: Große Spezialisierung Skisport<br />
Lehrkraft: Prof. K. Nitzsche<br />
Veranstaltungsform: Komplexseminare/Übungen<br />
Stundenumfang: 5 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: KSP-Abschluss<br />
Zielgruppe: Leistungssport<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Praxisprüfung – Sommertrainingsmittel + Ski<br />
- Wettkampftätigkeit<br />
- Kampfrichternachweis<br />
- mündliche Abschlussprüfung<br />
Ablauf:<br />
Teil I<br />
- KSP Skisport<br />
Teil II<br />
- Oberseminare zu folgenden Komplexthemen:<br />
� För<strong>der</strong>konzepte/langfristiger Leistungsaufbau im Skisport (Spezialdisziplinen)<br />
� Wettkampf-/Leistungs- und Trainingsstruktur <strong>der</strong> Spezialdisziplinen im Skisport (vertiefende<br />
Studien)<br />
� Trainingsplanung<br />
� Trainingsdokumentation<br />
� Trainingssteuerung<br />
� Leistungsdiagnostik<br />
� Hypoxietraining<br />
� Coaching des Wettkampfes<br />
� Wettkampfanalytik als Forschungsmethode<br />
� Aktuelle Forschungsinhalte in den Spezialdisziplinen<br />
Teil III<br />
- Lehrmethodischer Ausbildungseinsatz (Skilehrertätigkeit im Rahmen <strong>der</strong> Studentenausbildung)<br />
Teil IV<br />
- Sommertrainingsmittel/Konditionelle Fähigkeiten/Wettkämpfe<br />
Teil V<br />
- Kampfrichternachweis<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Aktuelle Rahmentrainingspläne <strong>der</strong> Skidisziplinen.<br />
- Nitzsche, K. (1998). Biathlon. Limpert-Verlag.<br />
- Deutscher Verband für Skilehrwesen (1994). Ski alpin. München: BLV-Verlagsgesellschaft.<br />
- Deutscher Verband für Skilehrwesen (1996). Skilanglauf, München: BLV-Verlagsgesellschaft.<br />
- Schnabel, G. & Harre, D. & Borde, A. (1994). Trainingswissenschaft. Berlin: Sportverlag.<br />
- Neumann, G. & Pfützner, A. & Hotterott, K. (2000). Alles unter Kontrolle. Meyer + Meyer Verlag.<br />
60
SPORTGESCHICHTE<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen <strong>der</strong> Sportgeschichte<br />
Lehrkraft: Doz. Dr. Volker Schürmann<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung (wöchentlich 45 min)<br />
Seminar (14-täglich 90 min)<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine (Limitierung durch Zahl d. Seminarteilnehmer)<br />
Zielgruppe: Diplom, Magister, Lehramt<br />
Inhalt:<br />
Nach einer Einführung in die Lehrveranstaltung werden Grundkenntnisse zur abendländischen<br />
Geschichte des Sports von <strong>der</strong> griechischen Antike bis zur Gegenwart vermittelt. Dazu gehören auch<br />
Grundkenntnisse zur Geschichte von Körper- und Bewegungskonzeptionen sowie zur Theorie <strong>der</strong><br />
Geschichtswissenschaft.<br />
Schwerpunkte:<br />
Ursprungstheorien des Sports<br />
Gymnastik und Agonistik in <strong>der</strong> Antike<br />
Sport im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Neugründung <strong>der</strong> Olympischen Spiele<br />
Sport im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Was ist Kulturgeschichte?<br />
Leistungsnachweis:<br />
Grundlagenliteratur:<br />
� regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und<br />
� Klausur über 60 min zur Vorlesungszeit am Ende des Semesters<br />
- Alkemeyer, Th., 1996, Körper, Kult und Politik. Von <strong>der</strong> 'Muskelreligion' Pierre de Coubertins zur<br />
Inszenierung von Macht in den Olympischen Spielen von 1936. Frankfurt a.M./ New York.<br />
- Daniel, U., 2001, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter. Frankfurt a.M.<br />
- Eichel, W. u.a. (Hg.), 1967ff., Geschichte <strong>der</strong> Körperkultur in Deutschland, Bd. 1-4. Berlin.<br />
- Krüger, M., 1993, Einführung in die Geschichte <strong>der</strong> Leibeserziehung und des Sports. Teil 2 und Teil 3.<br />
Schorndorf.<br />
- Ueberhorst, H. (Hg.), 1972ff., Geschichte <strong>der</strong> Leibesübungen. Berlin u.a.<br />
61
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportwissenschaft als Teil <strong>der</strong> Olympischen Idee, <strong>der</strong> Olympischen<br />
Bewegung und <strong>der</strong> Olympischen Spiele <strong>der</strong> Neuzeit<br />
Lehren<strong>der</strong>: Prof. Dr. Dr. h.c. H. Haag, M.S.<br />
Veranstaltungsform: Kompaktseminar<br />
Zielgruppe: Studenten im Hauptstudium<br />
Leistungsnachweis: Laufende Mitarbeit, Erledigung von Arbeitsaufträgen, Klausur<br />
Inhalte (Themenblöcke):<br />
- Zum Zusammenhang von Olympischer Idee (01), Olympischer Bewegung (OB) und<br />
Olympischen Spielen (OS)<br />
- Organisationsstruktur <strong>der</strong> OB<br />
- Organisationsstruktur von Sport, Sporterziehung und Sportwissenschaft 1.<br />
- Olympische Wissenschaftskongresse 1900 - 2000 1.<br />
- Beispiele für Olympische Wissenschaftskongresse<br />
- Olympische Kongresse 1984 – 1994<br />
Literaturhinweise werden in zu Beginn <strong>der</strong> Veranstaltung gegeben.<br />
Veranstaltungstermine bitte dem geson<strong>der</strong>ten Aushang entnehmen!<br />
62
SPORTMEDIZIN<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Anatomische Grundlagen <strong>der</strong> Sportmedizin<br />
Lehren<strong>der</strong>: Dr. M. Radon<br />
Veranstaltungsform: 1 SWS Vorlesung, 2 SWS Seminar<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: GRUNDSTUDIUM Diplom (1. Fachsemester)<br />
Inhalte:<br />
- Zytologie<br />
- Histologie (Muskulatur, Knochen, Knorpel, straffes Bindegewebe)<br />
- Belastungsinduzierte Gewebereaktionen (Hypertrophie, Atrophie, Hyperplasie)<br />
- Bau und Funktion <strong>der</strong> Wirbelsäule unter dem Aspekt statischer und dynamischer<br />
Rumpfbeanspruchungen<br />
- Bau und Funktion des Schultergürtels und <strong>der</strong> oberen Extremität (Gelenkstruktur,<br />
Bandapparat, gelenkspezifische Muskulatur)<br />
- Bau und Funktion des Beckengürtels und <strong>der</strong> unteren Extremität (Gelenkstruktur,<br />
Bandapparat, gelenkspezifische Muskulatur)<br />
- Analyse von Bewegungsabläufen aus funktionell-anatomischer Sicht<br />
Abschluss: Leistungsnachweis (2stündige Klausur)<br />
Literatur:<br />
Tittel, K.: Beschreibende und funktionelle Anatomie des Menschen, Urban & Fischer,<br />
München-Jena, 1999<br />
Weineck, J.: Sportanatomie, Balingen Perimed-spitta, 1995<br />
Appel, H-J. und Stang-Voss, Chr.: Funktionelle Anatomie, Springer 1990<br />
63
Veranstaltung: Biochemische Grundlagen <strong>der</strong> Sportmedizin<br />
Lehrkraft: Prof. Dr. D. Luppa<br />
Veranstaltungsform: 1 SWS Vorlesung, 1 SWS Seminar<br />
Zulassungsbedingungen: Keine (empfohlen wird: Anatomische und<br />
Physiologische Grundlagen)<br />
Zielgruppe: GRUNDSTUDIUM Diplom (3. Fachsemester)<br />
Inhalte:<br />
Die energetischen und kinetischen Prinzipien des Stoffwechsels<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Bioenergetik<br />
Enzymatische Katalyse, Fließgleichgewicht, Membrantransport<br />
Epigenetische und metabolische Stoffwechselregulation<br />
Überblick über den zellulären Stoffwechsel und seine Regulationsprinzipien<br />
Stoffwechsel <strong>der</strong> Kohlenhydrate, Fette und Proteine in Muskel, Leber und Fettgewebe<br />
Anpassung des Stoffwechsels des Skelettmuskels an sportliche Belastungen (ATP-<br />
Resynthesemechanismen, Nutzung <strong>der</strong> Nährstoffe, Limitierungen <strong>der</strong> Leistungsfähigkeit,<br />
metabolische und epigenetische Trainingseffekte)<br />
Das Blut und die Prinzipien <strong>der</strong> Koordination des Stoffwechsels <strong>der</strong> Organe bei sportlichen<br />
Belastungen<br />
Rolle des Blutes und Transport von Nährstoffen und Stoffwechselprodukten<br />
Hormonelle Regulation <strong>der</strong> zellulären Energiebereitstellung und <strong>der</strong> Koordination des<br />
Stoffwechsels <strong>der</strong> einzelnen Organe<br />
Einfluss körperlicher Belastungen auf den Stoffwechsel zur Senkung des Risikos für Herz-<br />
Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen<br />
Grundlagen <strong>der</strong> biochemischen Funktions- und Leistungsdiagnostik<br />
Lactat-Leistungsbeziehung, Creatinkinase, Harnstoff u. a.<br />
Leistungsnachweis: Klausur (2 Stunden)<br />
Literatur:<br />
KARLSON, P., DOENECKE, D., KOOLMAN, J. (1994): Kurzes Lehrbuch <strong>der</strong> Biochemie. Thieme<br />
LÖFFLER, G. (1999): Basiswissen Biochemie. Springer<br />
LÖFFLER, G., PETRIDES, P. E. (1998): Biochemie und Pathobiochemie. Springer<br />
VOET, D., VOET, J. G. (1992): Biochemie. VCH<br />
LEHNINGER, A. L., NELSON, D. L., COX, M.,M. (1994): Prinzipien <strong>der</strong> Biochemie. Spektrum<br />
64
GRUND- und HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportmedizinische Grundlagen<br />
Lehrende: Prof. Dr. M. Busse/Dr. M. Radon<br />
Veranstaltungsform: 1 SWS Vorlesung, 1 SWS Seminar<br />
Zulassungsbedingungen: Vordiplom Sportmedizin<br />
Zielgruppe: GRUND- UND HAUPTSTUDIUM Diplom (4. bis 6. Fachsemester)<br />
Inhalte:<br />
- Grundprinzipien trainingsinduzierter Anpassungsreaktionen<br />
- Merkmale adaptiver Verän<strong>der</strong>ungen am Bewegungs- und Stützsystem<br />
- Merkmale adaptiver Verän<strong>der</strong>ungen am Herz-Kreislaufsystem<br />
- Kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik<br />
- Merkmale adaptiver Verän<strong>der</strong>ungen am Atmungssystem<br />
- Pulmonale Funktionsdiagnostik<br />
- Merkmale trainingsinduzierter Verän<strong>der</strong>ungen des Blutes<br />
- Klinisch-chemische Funktionsdiagnostik<br />
Endnachweis: studienbegleitend<br />
Literatur:<br />
- De Marees, H.: Sportphysiologie, Tropon 1992<br />
- Badtke, G. : Lehrbuch <strong>der</strong> Sportmedizin, J.A. Bahrt, Heidelberg-Leipzig 1995<br />
65
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportbiologie III - Biochemie<br />
Lehrkraft: Prof. Dr. D. Luppa<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung, Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Sportbiologie I und Sportbiologie II<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM Lehramt Gymnasium<br />
(5.-7. Fachsemester)<br />
Inhalte:<br />
Die energetischen und kinetischen Prinzipien des Stoffwechsels<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Bioenergetik<br />
Enzymatische Katalyse, Fließgleichgewicht, Membrantransport<br />
Epigenetische und metabolische Stoffwechselregulation<br />
Überblick über den zellulären Stoffwechsel und seine Regulationsprinzipien<br />
Stoffwechsel <strong>der</strong> Kohlenhydrate, Fette und Proteine in Muskel, Leber und Fettgewebe<br />
Anpassung des Stoffwechsels des Skelettmuskels an sportliche Belastungen (ATP-<br />
Resynthesemechanismen, Nutzung <strong>der</strong> Nährstoffe, Limitierungen <strong>der</strong><br />
Leistungsfähigkeit, metabolische und epigenetische Trainingseffekte)<br />
Das Blut und die Prinzipien <strong>der</strong> Koordination des Stoffwechsels <strong>der</strong> Organe bei sportlichen<br />
Belastungen<br />
Rolle des Blutes und Transport von Nährstoffen und Stoffwechselprodukten<br />
Hormonelle Regulation <strong>der</strong> zellulären Energiebereitstellung und <strong>der</strong> Koordination des<br />
Stoffwechsels <strong>der</strong> einzelnen Organe<br />
Einfluss körperlicher Belastungen auf den Stoffwechsel zur Senkung des Risikos für Herz-<br />
Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen<br />
Grundlagen <strong>der</strong> biochemischen Funktions- und Leistungsdiagnostik<br />
Lactat-Leistungsbeziehung, Creatinkinase, Harnstoff u. a.<br />
Leistungsnachweis: Klausur (2 Stunden)<br />
Literatur:<br />
KARLSON, P., DOENECKE, D., KOOLMAN, J. (1994): Kurzes Lehrbuch <strong>der</strong> Biochemie. Thieme<br />
LÖFFLER, G. (1999): Basiswissen Biochemie. Springer<br />
LÖFFLER, G., PETRIDES, P. E. (1998): Biochemie und Pathobiochemie. Springer<br />
VOET, D., VOET, J. G. (1992): Biochemie. VCH<br />
LEHNINGER, A. L., NELSON, D. L., COX, M.,M. (1994): Prinzipien <strong>der</strong> Biochemie. Spektrum<br />
66
Veranstaltung: Sportmedizinische Grundlagen des Schulsports<br />
Lehren<strong>der</strong>: N.N.<br />
Veranstaltungsform: 2 SWS Vorlesung<br />
Zulassungsbedingungen: Akademische Zwischenprüfung - Anatomie und Physiologie<br />
Zielgruppe: Lehramtsanwärter - Gymnasium<br />
Inhalte:<br />
- Organentwicklung/Fähigkeitsentwicklung<br />
- Haltungsfehler/Skoliosen<br />
- Chondropathie/Spondylolyse/Listhese<br />
- asept. Nekrosen/Hüftdysplasie<br />
- Asthma/Belastbarkeit<br />
- Herzfehler/Belastbarkeit<br />
- Diabetes/Belastbarkeit<br />
- Infektionskr./Belastbarkeit<br />
- Verletzungen; Schock; SHT<br />
- Epilepsie/Belastbarkeit/Biolog. Alter<br />
- Adipositas/Magersucht - Belastbarkeit<br />
- Schulsportuntersuchung/-Befreiung<br />
Abschluss: Klausur 60 Min.<br />
Literatur:<br />
- Klimt, F.: Sportmedizin im Kindes- und Jugendalter. Thieme, Stuttgart.<br />
1992<br />
- Bar-Or, Oded: Die Praxis <strong>der</strong> SM in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>heilkunde, Springer.<br />
Berlin/Heidelberg. 1986<br />
- v. Harnack, G.A. u. G. Heimann: Kin<strong>der</strong>heilkunde, Springer. Berlin-<br />
Heidelberg, 1990.<br />
67
Veranstaltung: Ernährung im Sport<br />
Lehrkraft: Prof. Dr. D. Luppa<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung<br />
Stundenumfang: 1 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Biochemische Grundlagen<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM Diplom, Studienschwerpunkte:<br />
LS, FPF, RSB (5. Fachsemester)<br />
Inhalte:<br />
Generelle Bedeutung <strong>der</strong> Ernährung für die sportliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit sowie<br />
für die Gesundheit (Sinn und Risiken von Ernährungsrezepten, Schwachpunkte unserer<br />
Ernährung)<br />
Qualitative und quantitative Aspekte einer bedarfsgerechten Nährstoff-, Vitamin-, Mineralstoffund<br />
Flüssigkeitszufuhr in unterschiedlichen Sportarten im Leistungssport<br />
Rolle <strong>der</strong> Ernährung im Freizeitsport, Präventions- und Fitnesssport sowie in <strong>der</strong> Rehabilitation<br />
und Therapie<br />
Spezielle Themen:<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen an die Nahrungsmenge (Energiebilanz, Probleme <strong>der</strong> Überernährung,<br />
Thermogenese und Regulation <strong>der</strong> Körpermasse, Einfluss sportlichen Trainings auf die Effizienz<br />
<strong>der</strong> Nahrungsenergieverwertung)<br />
Anteiligkeit <strong>der</strong> Hauptnährstoffe in <strong>der</strong> Nahrung (gegenseitige Ersetzbarkeit und essentielle<br />
Nahrungsbestandteile, Zusammensetzung <strong>der</strong> Kohlenhydrate, Fette und Proteine in <strong>der</strong> Nahrung,<br />
sportartspezifische Empfehlungen für Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinzufuhr)<br />
Vitaminbilanz (Wirkungen einzelner Vitamine, Vorkommen in <strong>der</strong> Nahrung, Über- und<br />
Unterversorgung, sportartspezifischer Mehrbedarf)<br />
Mineralstoffbilanz (Bedeutung <strong>der</strong> Mengen- und Spurenelemente, spezifischer Bedarf und<br />
Verluste im Training und Möglichkeiten des Bilanzausgleichs)<br />
Flüssigkeitsbilanz (Einfluss des Trainings auf den Flüssigkeitshaushalt und seine Regulation,<br />
Auswahl von Getränken und Trinkverhalten im Training)<br />
Abschluss: Zwischennachweis (einstündige Klausur)<br />
Literatur:<br />
GEISS, K.-R., HAMM, M. (1996): Handbuch Sportlerernährung. Rowolth<br />
BIESALSKI, H.-K. u.a. (1999): Ernährungsmedizin. Thieme<br />
WILLIAMS, M. H. (1997): Ernährung, Fitness und Sport. Ullstein Mosby<br />
KONOPKA, P. (1998): Sporternährung. BLV Sportwissen<br />
BIESALSKI, H.-K., GRIMM, P. (1999): Taschenatlas <strong>der</strong> Ernährung. Thieme<br />
WOLINSKY I. (1998): Nutrition in Exercise and Sport. CRC Press<br />
REMKE, H. (1998): Krankheitsprävention durch Ernährung. Wiss. Verl.-Ges.<br />
BROWN, J. E. (1998): Nutrition Now. International Thomson Publ.<br />
WHITNEY, E. N., ROLFES, S. R. (1999): Un<strong>der</strong>standing Nutrition. International Thomson Publ.<br />
68
SPORTPÄDAGOGIK<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen <strong>der</strong> Sportpädagogik II / Allgemeine Sportdidaktik<br />
Lehrkräfte: Prof. Dr. Alfred Richartz, PD Dr. Wolfram Sperling, Frau K. Albert<br />
Veranstaltungsform: 1 h Vorlesung (wö) und 2 h Seminar (14tägl.)<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: erfolgreicher Abschluß des Teils I Sportpädagogik und des<br />
Orientierungspraktikums<br />
Zielgruppe: Diplom und Magister / Hauptstudium ab 5. Sem.<br />
Leistungsnachweis: regelmäßíge und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen<br />
Abschlußklausur (45 min.)<br />
Inhalt:<br />
Die Vorlesung wird grundlegende Fragestellungen des Lehrens und Lernens im Sport thematisieren.<br />
Als Ausgangspunkt dienen neuere Ansätze <strong>der</strong> Allgemeinen Didaktik (z.B. das "eigenverantwortliche<br />
Lernen und Arbeiten" von H. Klippert) und ihr Bezug zur aktuellen Kritik einer "veralteten Lernkultur" in<br />
allen Lehrsituationen (vgl. z.B. PISA 2000). In <strong>der</strong> Generaltendenz for<strong>der</strong>n diese didaktischen<br />
Konzepte - im Einklang mit Befunden <strong>der</strong> Expertenforschung, <strong>der</strong> Lern-, Kompetenz- und<br />
Motivationsforschung - eine Akzentuierung <strong>der</strong> Rolle von Lehrenden in Richtung auf die Mo<strong>der</strong>ation<br />
und Rahmung eigentätiger und selbstverantworteter Lernprozesse. Konsequenzen für zeitgemäßes<br />
Lehren und Lernen in sportbezogenen Situationen werden diskutiert.<br />
In den begleitenden Seminaren sollen die didaktischen Theorien im Sinne des exemplarischen<br />
Lernens an geeigneten Stoffen aus <strong>der</strong> Vorlesung und wissenschaftlichen Studienanfor<strong>der</strong>ungen in<br />
entsprechenden Lernszenarien praktisch umgesetzt werden.<br />
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Forschungsmethoden (II-V)<br />
Problembewältigung bei jugendlichen Leistungssportlern.<br />
Einführung in qualitative Forschungsmethoden<br />
Lehrkraft: Prof.Dr. A.Richartz<br />
Veranstaltungsform: Projektseminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungbedingungen: Hauptstudium, Testat Forschungsmethoden I<br />
Zielgruppe: Diplom, Magister<br />
Leistungsnachweis: Hausarbeit<br />
Inhalt:<br />
Das Projektseminar verfolgt mehrere Ziele:<br />
Eine Einfühung in Methodologie und Methoden qualitativer Sozialforschung<br />
Die exemplarische Erarbeitung von Befunden zu pädagogischen Fragestellungen des<br />
Leistungssports im Kindes- und Jugendalter<br />
Qualitative Methoden werden immer häufiger v.a. in den sozialwissenschaftlichen Disziplinen <strong>der</strong><br />
Sportwissenschaft verwandt. Dieses Projektseminar soll <strong>der</strong> Einführung in qualitative<br />
Forschungsmethoden dienen. In diesem Semester soll ein Schwerpunkt auf die Erhebung qualitativer<br />
Daten gelegt werden (z.B. Interviewführung)<br />
Das Projektseminar eignet sich als Vorbereitung und Begleitung eigenständiger Arbeiten zum<br />
Studienabschluß, bei denen qualitative Methoden im Mittelpunkt stehen. Es empfiehlt sich beson<strong>der</strong>s<br />
für Studentinnen und Studenten, die eine Studienabschlussarbeit im Bereich Sportpädagogik planen.<br />
69
Veranstaltung: Kolloquium für Staatsexamenskandidaten<br />
Lehrkraft: Prof. Dr. Alfred Richartz<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang: 1 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Hauptstudium<br />
Zielgruppe: Lehramt<br />
Leistungsnachweis: -<br />
Inhalt:<br />
Das Kolloquium dient <strong>der</strong> Orientierung über das Prüfungsverfahren und <strong>der</strong> Reflexion von<br />
prüfungsrelevanten Themen und Literaturbeispielen<br />
Veranstaltung: Sprechkommunikation<br />
Lehrkraft: Thomas Buchmann<br />
Veranstaltungsform: Seminar/Übung<br />
Stundenumfang: 1 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: abgeschlossenes Grundstudium im Fach Sportpädagogik<br />
Abschlüsse: Beleg (ohne Note) bei vollständiger aktiver Teilnahme am<br />
Kompaktseminar<br />
Inhalte (mit Absolutstunden):<br />
- Sprechkommunikative Diagnostik 5 h<br />
(Differenzierte Einschätzung verbaler und nonverbaler Kommunikationsfertigkeiten,<br />
gemeinsame Aufdeckung individueller Stärken und Schwächen<br />
des stimmlichen, artikulatorischen, intonatorischen, rhetorischen sowie<br />
gestisch-mimischen Leistungs- und Überzeugungsvermögens)<br />
- Stimm- und Sprechbildung 10 h<br />
(Physiologische und kommunikationstheoretische Grundlagen,<br />
Gesun<strong>der</strong>haltung und Leistungssteigerung <strong>der</strong> Stimme unter dem Aspekt<br />
erhöhter beruflicher Belastung, auditive und visuelle Wahrnehmung,<br />
sprechsprachliche Gestaltungsmittel <strong>der</strong> mündlichen Kommunikation,<br />
Körperausdruck und Stimme)<br />
Literatur:<br />
- Allhoff, D.;Allhoff, W.: Rhetorik & Kommunikation. Regensburg, 1994<br />
- Schulz von Thun, Friedemann: Miteinan<strong>der</strong> reden. Teil 1 und 2. Hamburg, 1991<br />
SPORTPHILOSOPHIE<br />
70
SPORTPHILOSOPHIE<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen <strong>der</strong> Sportphilosophie<br />
Lehrkraft: Doz. Dr. Volker Schürmann<br />
Veranstaltungsform: Seminar (wöchentlich 90 min)<br />
Zulassungsbedingungen: 5. Sem. und höher (auch geöffnet für Philosophie-Studierende)<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zielgruppe: alle Studiengänge<br />
Inhalt:<br />
Anliegen des Seminars ist zu klären, was Freundschaft und fair play überhaupt miteinan<strong>der</strong> zu tun<br />
haben. Bereits <strong>der</strong> erste Blick ist hier zwiespältig. Man sieht offenkundige Gemeinsamkeiten – geht es<br />
nicht ‚irgendwie‘ in beiden Fällen um (moralische?) Qualitäten menschlicher Beziehungen? ; man<br />
sieht aber genauso wichtige Unterschiede o<strong>der</strong> gar Unvereinbarkeiten. Der sportliche Gegner ist<br />
gerade nicht ein Freund; Freundschaft scheint eine Beziehungssorte im Privaten, fair play dagegen im<br />
Öffentlichen zu sein; fair play ist mindestens auch an ein explizites Regelwerk gebunden,<br />
Freundschaft im heutigen Sinne scheint dagegen allerhöchstens ungeschriebenen Gesetzen zu<br />
folgen. Auch <strong>der</strong> zweite Blick trägt nicht notwendigerweise zur Klarheit bei. Nimmt man sich Bücher<br />
zur Hand, stößt man z.B. auf Derridas Politik <strong>der</strong> Freundschaft; dort ist schon programmatisch im Titel<br />
die Klarheit <strong>der</strong> Unterscheidung privat/ öffentlich getrübt. Bei Carl Schmitt ist das Politische gar an die<br />
Unterscheidung Freund/ Feind gebunden.<br />
Gegenstand des Seminars werden daher die Beziehungen zwischen den vielfältigen Phänomenen<br />
und Begriffen sein, die sich in diesem Theoriefeld kreuzen, begegnen, miteinan<strong>der</strong> konkurrieren. Eine<br />
kleine Liste: Privatheit/ Öffentlichkeit, Regel und Regularitäten, das Politische, Gerechtigkeit und<br />
Chancengleichheit – polis, Sympathie, Interessengemeinschaft, Solidarität, Liebe,<br />
Rechtsbeziehungen, Tauschbeziehungen – Achtung, Anerkennung, Respekt.<br />
Das Verfahren wird im wesentlichen das <strong>der</strong> Textlektüre und gemeinsamen Diskussion sein.<br />
Leistungsnachweis:<br />
Grundlagenliteratur:<br />
� regelmäßige und aktive Teilnahme an <strong>der</strong> Lehrveranstaltung und<br />
� Hausarbeit/ Referat<br />
� Es ist keine Klausur vorgesehen<br />
� LN wird anerkannt als Nachweis <strong>der</strong> „GL <strong>der</strong> Sportphilosophie“<br />
EICHLER, K.-D. (Hrsg.) (1999). Philosophie <strong>der</strong> Freundschaft. Leipzig: reclam.<br />
GABLER, H. (1998). ‚Fairneß/ Fair play‘. In O GRUPE & O MIETH, D. (Hrsg.), Lexikon <strong>der</strong> Ethik im Sport.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
LESSING, G.E. [1778/ 1780], Ernst und Falk. Gespräche für Freimäurer I-V (in beliebiger Ausgabe).<br />
71
Veranstaltung: Sozialwissenschaftlich - philosophisches Kolloquium (1 SWS)<br />
Lehrkraft: Prof.Dr. Alfred Richartz, Dr. Volker Schürmann<br />
Veranstaltungsform: Kolloquium<br />
Zulassungsbedingungen: Diskussionsbereitschaft<br />
Zielgruppe: Diplom, Magister, Lehramt<br />
Inhalt:<br />
Das Kolloquium dient <strong>der</strong> Vorstellung und Diskussion neuerer o<strong>der</strong> im Entstehen begriffener, kleinerer<br />
o<strong>der</strong> größerer Arbeiten aus <strong>der</strong> Forschung.<br />
Es richtet sich an alle, die an (sport-) philosophischen und/ o<strong>der</strong> pädagogischen und/ o<strong>der</strong><br />
sozialwissenschaftlichen Fragestellungen Interesse und Diskussionsbereitschaft haben. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
(also nicht ausschließlich!) richtet es sich an diejenigen, die in diesen Fächern eine Dissertation,<br />
Abschluß- o<strong>der</strong> Hausarbeit schreiben.<br />
72
PSYCHOLOGIE<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Sportpsychologie Teil I<br />
Lehrkraft: Dr. Sabine Würth<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingen: keine<br />
Zielgruppe: Dipl., Mag., Lehramt<br />
Leistungsnachweis: Teilnahme an einem Experiment (Zulassungsvoraussetzung und<br />
Vorleistung für die Abschlussklausur)<br />
Klausur über 90 min. zur Vorlesungszeit am Ende des Semesters.<br />
Teilnahmenachweis (Magister): Anwesenheitsquote 80% per Eintrag in die Anwesenheitsliste<br />
Inhalte:<br />
Diese Veranstaltung will Grundlagen <strong>der</strong> Sportpsychologie vermitteln. Sie beschäftigt sich daher auch<br />
vorwiegend mit Grundthemen, weniger mit Fragen <strong>der</strong> Anwendung, wie Diagnostik, Beratung und<br />
Intervention. Darauf wird stärker im zweiten Teil (Sportpsychologie II im Sommersemester)<br />
eingegangen.<br />
Die untenstehende Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Vorlesung leitet ihren roten Faden aus <strong>der</strong> Tatsache ab, daß<br />
Sportpsychologische Erkenntnisse aus vier Perspektiven gewonnen werden können:<br />
- <strong>der</strong> allgemeinpsychologischen<br />
- <strong>der</strong> entwicklungspsychologischen<br />
- <strong>der</strong> sozialpsychologischen und <strong>der</strong><br />
- differentialpsychologischen.<br />
Diese vier Perspektiven lassen sich in Einführungslehrbüchern zur Sportpsychologie mühelos<br />
wie<strong>der</strong>finden Die Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Vorlesung orientiert sich an dieser Einteilung. Nach einer Einführung<br />
in Gegenstand und Aufgaben <strong>der</strong> Sportpsychologie und grundlegenden Modellvorstellungen wird<br />
sportliches und Bewegungshandeln unter den genannten vier Perspektiven analysiert. Dabei bedeutet<br />
eine psychologische Betrachtungsweise sportlichen Handeln, egal unter welcher <strong>der</strong> vier<br />
Perspektiven, stets, dass menschliches Handeln, also auch sportliches Handeln, erst begreifbar wird,<br />
wenn man die subjektive Seite menschlichen Handelns berücksichtigt. Objektive Erfahrungen,<br />
Situationen usw. werden dadurch wirksam, daß je<strong>der</strong> Mensch sie subjektiv wahrnimmt, auffasst,<br />
interpretiert. Diese grundlegende Sichtweise <strong>der</strong> Psychologie von menschlichem Handeln und <strong>der</strong><br />
Sportpsychologie von sportlichem Handeln wird in <strong>der</strong> Vorlesung zugrundegelegt und anhand <strong>der</strong><br />
gewählten Themen verdeutlicht.<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Gabler, H., Nitsch, J. & Singer, R. (2000). Einführung in die Sportpsychologie. Teil 1: Grundthemen. Schorndorf:<br />
Hofmann.<br />
Gabler, H., Nitsch, J. & Singer, R. (Hrsg.). (2001). Einführung in die Sportpsychologie. Teil 2: Anwendungsfel<strong>der</strong>.<br />
Schorndorf: Hofmann. (nur Kap. II und III). (2.Auflage).<br />
Weinberg, R.S. & Gould, D. (1999, 2 nd ed.). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL:<br />
Human Kinetics.<br />
73
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Diagnostik und Entwicklung kognitiver<br />
Leistungsvoraussetzungen (LV) im Sport<br />
Lehrkraft: Dr. Uwe-C. Zehl<br />
Veranstaltungsform: Kurs<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: abgeschlossenes Grundstudium<br />
Zielgruppe: Hauptstudium (Diplom, Magister, Lehramt)<br />
Leistungsnachweis: Referat und Belegarbeiten<br />
Inhalte:<br />
Vermittluing grundlegen<strong>der</strong> theoretischer und methodologischer Kenntnisse zur „Tätigkeitsorientierten<br />
Sportpsychologie“ sowie Darstellung und Diskussion von Ergebnissen sportpsychologischer<br />
Forschung. Schwerpunktmäßig werden folgende Inhalte bearbeitet:<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> tätigkeitsorientierten Sportpsychologie<br />
- Funktonsbereiche des Psychischen<br />
- Tätigkeits- und Handlungsregulation im Sport<br />
- Psychische Komponenten <strong>der</strong> Leistungsstruktur<br />
- Leistungs- und Anfor<strong>der</strong>ungsstruktur von Sportarten<br />
- Psychische Belastung und Belastbarkeit im Sport<br />
- Sportliche Leistungsvoraussetzungen<br />
- Psychologische Trainingsverfahren<br />
- Diagnostik ausgewählter LV<br />
- Allgemeines und spezielles Training ausgewählter LV<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Kunath, P. & Schellenberger, H. (1991).Tätigkeitsorientierte Sportpsychologie.<br />
- Verlag Harri Deutsch.<br />
- Gabler, H.; Nitsch, J. u. Singer, R. (2001) Einführung in die Sportpsychologie-Bd. 1 und 2. Verlag Karl<br />
Hofmann.<br />
- Frester, R. (1999). Mentale Fitness für junge Sportler. Vandenhoeck & Ruprecht.<br />
- Kunath, P. (2001). Sportpsychologie für alle. Meyer & Meyer Verlag.<br />
- Kratzer, H. (1998). Das Test- und Trainingsprogramm – Senso Control-... In Teipel, D. et al:<br />
„Sportpsychologische Diagnostik, Prognostik, Interventon“. Bps-Verlag Köln<br />
- Hartmann, Chr. Und Senf, G. (1997). Sport verstehen – Sport erleben. Teil 1. Studienmaterial für den<br />
Leistungskurs Sport an Gymnasien. Staba-Druck Lampertswalde.<br />
- Kent, M. (1998). Wörterbuch Sportwissenschaft und Sportmedizin. Limpert Verlag Wiesbaden.<br />
74
SPORTSOZIOLOGIE<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen <strong>der</strong> Sportsoziologie<br />
Lehrkraft: Dr. Petra Tzschoppe<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung (wöchentlich 45 min) / Seminar (14-täglich 90 min)<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine (Limitierung durch Zahl <strong>der</strong> Seminarteilnehmer)<br />
Zielgruppe: GRUNDSTUDIUM (Diplom, Magister, Lehramt, Journalistik)<br />
Leistungsnachweis:<br />
a) regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und<br />
b) abschließende Klausur (sehr gute Seminarleistungen in Verbindung mit einem Referat können statt<br />
dessen ebenfalls Anerkennung finden)<br />
Er ist Voraussetzung für die Lehrveranstaltungen „Soziologie des Sports“ im Hauptstudium.<br />
Inhalt:<br />
Vermittlung grundlegen<strong>der</strong> theoretischer und methodologischer Kenntnisse zur Soziologie des Sports<br />
Darstellung und Diskussion von Ergebnissen sportsoziologischer Forschung<br />
Schwerpunkte:<br />
Verhältnis von Soziologie, Sportsoziologie und Sportwissenschaft; Entwicklung <strong>der</strong> Sportsoziologie<br />
als Theoriefeld <strong>der</strong> Sportwissenschaft, Bestimmung des Gegenstandsbereiches<br />
Der Körper als soziales Phänomen - Tendenzen von Körperaufwertung und Körperabwertung<br />
Sport und Sozialisation<br />
Soziale Ungleichheit und Sportaktivität<br />
Sport und Geschlecht<br />
Sportzuschauer und ihre Rolle im Sport<br />
Medien und indirekte Teilnahme am Sport<br />
Sport und Gewalt<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- CACHAY / THIEL (2000). Soziologie des Sports. Weinheim, München.<br />
- HEINEMANN, K. (1998). Einführung in die Soziologie des Sports. Schorndorf.<br />
- VOIGT, D. (1992). Sportsoziologie - Soziologie des Sports. Frankfurt a.M.<br />
- WEIß, O. (1999). Einführung in die Sportsoziologie. Wien.<br />
Eine ausführlichere Übersicht zu Themen und Literatur erhalten die TeilnehmerInnen im ersten Seminar.<br />
75
SPORTSPIELE<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen Badminton Teil I und II<br />
Lehrkräfte: Dr. P. Hobusch, W. Gawin<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium aller Studiengänge<br />
Zulassungsbedingungen: Studienschein „Rückschlagspiele“ o<strong>der</strong> „Wahlsportart“<br />
(frei Studienscheine nur bei Restplätzen)<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Regeltestat Beleg (80 % richtig)<br />
- Stundenmitschrift (Basic-Paper) 1x<br />
- schriftliche Leistungskontrolle 60´(40 %) Note o<strong>der</strong> Vordiplomsklausur 90´ Note<br />
- praktische Leistungskontrollen Noten<br />
Lehrprobe (30´) (25 %) ; Spielfähigkeit (15 %); 4 Techniken (20 %)<br />
Inhalt:<br />
Kursteilnehmer sollen nach <strong>der</strong> Ausbildung folgende Befähigungen nachweisen:<br />
Die Schläge Aufschlag (hoch-weit), Vorhand-Überkopf-Clear, Vorhand-Überkopf-Smash, Rückhand-<br />
Unterhand-Clear, mit stabiler Grobform angemessen demonstrieren, analysieren, Hauptfehler korrigieren<br />
und für Anfänger adressatengerecht methodisch vermitteln können, und Gleiches mit niedrigerem<br />
Anfor<strong>der</strong>ungsniveau mit Variationen dieser Techniken, auch im Rückhandbereich. Des weiteren Spielfähigkeit<br />
im Einzelspiel nachweisen und methodisch nach ausgewählten Schwerpunkten entwickeln<br />
können. Badminton in kleineren und größeren Gruppen didaktisch effektiv unterrichten können. Sowie<br />
grundlegende Kenntnisse über: Regeln, Badmintongeschichte, Terminologie, Leistungsstruktur,<br />
einfache Bewegungsbeschreibungen, taktische Grundregeln für Einzel und Doppel, grundlegende<br />
Materialkenntnisse, Turnierorganisation<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Boeckh-Behrens, W.-U. (1989). Badminton heute. Krefeld.<br />
- Niesner, H.-W. & Ranzmayer, J. (1980). Badminton-Training, Technik, Taktik. Hamburg.<br />
- Knupp, M. (1983). 1011 Spiel- und Übungsformen im Badminton. Schorndorf.<br />
- Meyners, E. (1983). Badminton in <strong>der</strong> Schule. Schorndorf.<br />
- Maywald & Zwiebler. Badminton in Schule und Verein.<br />
- Lemke, K.-D. & Meseck, U. (1996). Badminton-Training. Aachen.<br />
- Lemke, K.-D. & Meseck, U. (1997). Mini-Badminton. Aachen<br />
76
Veranstaltung: Grundausbildung Basketball Teil I und II<br />
Lehrkraft: Dr. H. Rauchmaul<br />
Veranstaltungsform: Übung/Seminar<br />
Leistungsvoraussetzungen:<br />
Zielgruppe: alle Studiengänge, Grundstudium<br />
Stundenumfang: 4 SWS<br />
Leistungsnachweise: Teil I: Regeltestat<br />
Teil II: Praxis (Spielleistung, Kontrollformen, Lehrprobe), Theorie<br />
(Klausur - 60 min)<br />
Inhalt:<br />
Theorie: - Regelkunde<br />
- Geschichte<br />
- Ausbildungsmethodik, Trainingsmittel<br />
- Systematik <strong>der</strong> Technik und Taktik<br />
- takt. Aspekte <strong>der</strong> Anwendung techn. Basiselemente<br />
Praxis: - Ausbildung grundlegen<strong>der</strong> technischer Fertigkeiten<br />
- Schiedsrichtertätigkeit<br />
- Entwicklung <strong>der</strong> Spielfähigkeit<br />
- Entwicklung von Lehrkompetenz<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Stiehler & Konzag & Döbler. Sportspiele..<br />
- Schrö<strong>der</strong> & Bauer. Basketball trainieren und spielen.<br />
- Steinhöfer. Basketball in <strong>der</strong> Schule.<br />
Veranstaltung: Grundlagen Fußball (Teil I)<br />
Lehrkraft: Hans - Werner Meier<br />
Veranstaltungsform: Seminar/Übungen<br />
Zielgruppe: Studierende aus dem Grundstudium, alle Studienrichtungen<br />
Zulassungsbedingungen: ohne (Kleine Spiele wird empfohlen)<br />
Leistungsnachweise:<br />
Fußball I: regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme am Unterricht, Leistungskontrolle zu internationalen<br />
Spielregeln<br />
Fußball II: regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme am Unterricht, erfolgreicher Abschluss <strong>der</strong> Lehrproben,<br />
erfolgreiche Praxisprüfungen (Spielleistung und Demonstrationsfähigkeit), erfolgreicher theoretischer<br />
Abschluss (Klausur)<br />
Inhalt:<br />
Theorie<br />
Fußball I: - Internationale Spielregeln<br />
- Grundzüge <strong>der</strong> Leistungsstruktur im Fußballsport<br />
- Theorie und Methodik ausgewählter Spielhandlungen<br />
(Dribbling, Zuspiel mit Fuß und Kopf, Ballannahme)<br />
Fußball II - Prinzipien und Methodik zum Torschuss<br />
- Methodische Aspekte bei Spielformen<br />
Praxis<br />
Fußball I + II: Anwendung <strong>der</strong> Technikelemente in spielnahen Situationen und Spielformen<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Stiehler, G. & Konzag, I. & Döbler, H.(1988). Sportspiele. Berlin.<br />
- Bisanz, G. & Gerisch, G. (1994). Fußball. Hamburg.<br />
- DFB (1999/2000). Fußballregeln. Frankfurt/M .<br />
- Koch, W. u. A.(1990). Fußball. Spielformen für das Vereinstraining. Leipzig.<br />
77
Veranstaltung: Grundlagen Handball<br />
Lehrkräfte: Dr. N. Schlegel, Handball I + I/II<br />
W.-D. Neiling, Handball II<br />
Veranstaltungsform: Theorieseminare und Praxisübungen<br />
Zielgruppe: Diplom, Lehramt, Magister, Wirtschaftspädagogik<br />
Zulassungsbedingungen: keine fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen<br />
Leistungsnachweise: Handball I: bestandenes Regeltestat, regelmäßige Teilnahme<br />
Handball II: Praxisprüfung in 4 Kontrollformen (Angriff), Einschätzung<br />
<strong>der</strong> Spielleistung, Lehrprobe über 30 Minuten, Klausur (in<br />
Abhängigkeit von <strong>der</strong> Abschlussform 60 – 90 Minuten)<br />
Inhalt:<br />
Handball I: vermittelt die Grundlagen <strong>der</strong> Sportart in Theorie und Praxis; Elemente des Einzelspielers<br />
im Angriff sind Schwerpunkt; ergänzt wird durch ausgewählte Elemente des Abwehrspielers und erste<br />
gruppentaktische Einblicke; Teile <strong>der</strong> Theorie werden an die sportpraktische Realisierung gekoppelt<br />
und vermittelt. In <strong>der</strong> Theorie stehen Regelkunde, leistungsstrukturelle und geschichtliche Aspekte,<br />
Trainingsorganisation, Technikbeschreibung, Fehlererkennung und Korrektur sowie erste gruppenund<br />
mannschaftstaktische Diskussionen im Mittelpunkt.<br />
Handball II: ist auf die pädagogisch- methodische Befähigung <strong>der</strong> Studenten ausgerichtet; neben <strong>der</strong><br />
eigenen Lehrprobe, <strong>der</strong>en Vorbereitung und Auswertung mit dem Lehrenden, werden sportpraktische<br />
Fertigkeiten weiter vervollkommnet und ergänzende Theoriepositionen vermittelt.<br />
Handball I/II: ist lediglich eine an<strong>der</strong>e Organisationsform; inhaltliche Ausrichtung und Stoffverteilung<br />
sind identisch mit <strong>der</strong> Kombination Handball I + Handball II<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Stiehler & Konzag & Döbler. Hochschullehrbuch Sportspiele.<br />
- Stein & Fe<strong>der</strong>hoff. Handball.<br />
- Regelheft <strong>der</strong> IHF 1997.<br />
Veranstaltung: Grundlagen Hockey I und II<br />
Lehrkraft: Herr Dieter Schmidt<br />
Veranstaltungsform: Seminare/Übungen<br />
Zulassungsbedingungen: Studienschein Mannschaftsspiele<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium aller Studiengänge<br />
Leistungsnachweise: Regeltestat Beleg<br />
- Studienmitschrift<br />
- Anwesenheitsnachweis<br />
- schriftliche Leistungskontrolle<br />
- Endnachweis 60´ 50 %<br />
- Vordiplom 90´ 50 %<br />
- Lehrprobe 20´ 25 %<br />
- Spielfähigkeit/Technik 25 %<br />
Inhalt:<br />
Die Ausbildung erstreckt sich über zwei Semester (60 Stunden). Die Grundausbildung soll die Studenten<br />
in die Lage versetzen, Hockey als Sportspiel im Schulsport, im Breitensport o<strong>der</strong> im Verein<br />
weiter vermitteln zu können. Es werden folgende Ziele mit <strong>der</strong> Grundausbildung angestrebt:<br />
- Ausprägung einer stabilen Grobform in den Grundtechniken Ballannahme<br />
- Ballabgabe und Ballführung, um dadurch die Entwicklung ihrer Handlungskompetenz (Hockey<br />
spielen zu können) sowie eine zweckmäßige Demonstrationsfähigkeit in den Grundtechniken, als<br />
auch eine entsprechende lehrmethodische Befähigung zu gewährleisten.<br />
Grundlagenliteratur: Video: - Hockey – ein Kin<strong>der</strong>spiel<br />
- Hockey - Regeln Halle und Feld - Jugendhockey – Dynamik und Spielwitz<br />
- Spielordnung des DHB - Hockeytechnik<br />
78
Veranstaltung: Grundlagen Tennis<br />
Lehrkraft: Dr. P. Hobusch, Dr. Kirchgässner<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium aller Studiengänge<br />
Zulassungsbedingungen: Studienschein „Rückschlagspiele“ o<strong>der</strong> „Wahlsportart“<br />
Stundenumfang: 4 SWS<br />
(frei Studienscheine nur bei Restplätzen)<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Regeltestat-Beleg (80 % richtig), Stundenmitschrift<br />
- schriftliche Leistungskontrolle 60´ (40 %) Note o<strong>der</strong> Vordiplomsklausur 90´ Note<br />
- Praktische Leistungskontrollen Noten: Lehrprobe (20´) (25 %); Spielfähigkeit (15 %); 3 Techniken<br />
(20 %)<br />
Inhalt:<br />
Kursteilnehmer sollen nach <strong>der</strong> Ausbildung folgende Befähigungen nachweisen:<br />
Die Grundschläge Vorhand, Rückhand und Aufschlag mit stabiler Grobform angemessen demonstrieren,<br />
analysieren, Hauptfehler korrigieren und für Anfänger adressatengerecht methodisch vermitteln<br />
können. Des weiteren Spielfähigkeit im Einzelspiel nachweisen und methodisch nach ausgewählten<br />
Schwerpunkten entwickeln können. Tennis in kleineren und größeren Gruppen didaktisch<br />
effektiv unterrichten können. Sowie grundlegende Kenntnisse über: Regeln, Tennisgeschichte, Terminologie,<br />
gesundheitlicher Wert des Tennisspiels, einfache Bewegungsbeschreibungen, prinzipielle<br />
Technikmerkmale, Lehr- und Lernmittel sowie Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche, Taktische Grundregeln, Grundlegende<br />
Materialkenntnisse<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Deutscher Tennis Bund (1995). Tennis-Lehrplan. Band 1. Technik und Taktik. 7. völlig neu bearb. Auflage.<br />
- Deutscher Tennis Bund (1996). Tennis-Lehrplan. Band 2. Unterricht und Training. 7. völlig neu bearb.<br />
Auflage.<br />
- Heinzel & Koch & Strakerjahn. „Koordinationstraining im Tennis“ In Trainerbibliothek - DTB, Band 3.<br />
- Hlavka & Klippel: „Bewegungs- und Gerätehilfen“. In Trainerbibliothek - DTB, Band 5.<br />
Video:<br />
- Die Tennisschule - Teil 1: Der Schlag, Bein- und Körperarbeit<br />
- Die Tennisschule - Teil 2: Vorhand, Rückhand<br />
- Die Tennisschule - Teil 3: Flugball, Aufschlag, Schmetterball<br />
- Die Tennisschule - Teil 4: Schlagvarianten, leistungsbeeinflussende Faktoren<br />
- Vorhandschlag – Das Spiel <strong>der</strong> Champion<br />
- Rückhandschlag – Das Spiel <strong>der</strong> Champion<br />
79
Veranstaltung: Grundlagen Tennis Lehramt<br />
Lehrkraft: Dr. P. Hobusch<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium <strong>der</strong> Lehramtsstudiengänge<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Studienschein „Rückschlagspiele“ o<strong>der</strong> „Wahlsportart“<br />
(frei Studienscheine nur bei Restplätzen)<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Regeltestat-Beleg (80 % richtig), Stundenmitschrift<br />
- schriftliche Leistungskontrolle 45´ (50 %) Note<br />
- praktische Leistungskontrollen Noten: 4 Techniken (25 %); Spielfähigkeit (25 %)<br />
Inhalt:<br />
Kursteilnehmer sollen nach <strong>der</strong> Ausbildung folgende Befähigungen nachweisen:<br />
Tennis mit Großgruppen nach spielgemäßem Konzept unterrichten können. Dabei die Grundschläge<br />
Vorhand, Rückhand, Aufschlag und Flugschlag in <strong>der</strong> Grobform angemessen unter erleichterten Bedingungen<br />
demonstrieren, Hauptfehler analysieren und korrigieren, Spielfähigkeit im Einzel- und Doppelspiel<br />
im ¾ Feld nachweisen und vermitteln können.<br />
Sowie grundlegende Kenntnisse über: Regeln, Terminologie, prinzipielle Technikmerkmale, Lehr- und<br />
Lernmittel, Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche, Taktische Grundregeln, praktische Materialkenntnisse.<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Deutscher Tennis Bund (1995). Tennis-Lehrplan. Band 1. Technik und Taktik. 7. völlig neu bearb. Auflage.<br />
- Deutscher Tennis Bund (1996). Tennis-Lehrplan. Band 2. Unterricht und Training. 7. völlig neu bearb.<br />
Auflage.<br />
- Heinzel; Koch & Strakerjahn: „Koordinationstraining im Tennis“. In Trainerbibliothek - DTB, Band 3.<br />
- Hlavka & Klippel. „Bewegungs- und Gerätehilfen“. In Trainerbibliothek - DTB, Band 5.<br />
Video:<br />
- Die Tennisschule - Teil 1: Der Schlag, Bein- und Körperarbeit<br />
- Die Tennisschule - Teil 2: Vorhand, Rückhand<br />
- Die Tennisschule - Teil 3: Flugball, Aufschlag, Schmetterball<br />
- Die Tennisschule - Teil 4: Schlagvarianten, leistungsbeeinflussende Faktoren<br />
- Vorhandschlag – Das Spiel <strong>der</strong> Champion<br />
- Rückhandschlag – Das Spiel <strong>der</strong> Champion<br />
Veranstaltung: Grundlagen Tischtennis<br />
Lehrkräfte: M Pfeifer, M. Fehl<br />
Veranstaltungsform: Seminar und Übung<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium aller Studiengänge<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Leistungsnachweise: Abschlussklausur, Regeltestat, Demonstrationsfähigkeit in den<br />
Grundschlagarten, Lehrprobe<br />
Inhalt:<br />
Theorie: - Regelkunde<br />
- Materialkunde<br />
- Technik / individuelle Taktik<br />
- Methodik <strong>der</strong> Anfängerausbildung<br />
Praxis: - Fertigkeitsentwicklung in den Grundschlagarten<br />
- allgemeine taktische Verhaltensmuster in Angriff u. Abwehr<br />
- pädagogisch-methodische Befähigung<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Gross, B.-U. Tischtennis – Praxis.<br />
- Perger, M. Tischtennistechnik.<br />
- Bucher, W. 1014 Spiel- und Übungsformen im Tischtennis“.<br />
80
Veranstaltung: Grundlagen Volleyball - Teil 1 und 2<br />
Lehrkraft : R. Schumann<br />
Zielgruppe: Diplom/Lehramt/Magister<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Leistungsnachweise:<br />
Theorie: Regeltestat (Abschluss Teil I), EN-Klausur; VD, AZ, MZP-Klausur<br />
Praxis: Demonstrationsfähigkeit (oberes Zuspiel; unteres Zuspiel; obere Aufgabe; untere Aufgabe;<br />
Angriffsschlag; Einschätzung <strong>der</strong> Spielleistung; 25minütige Lehrprobe<br />
Inhalt:<br />
Theorie: -Technik/ individuelle Taktik des Volleyballspiels<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Mannschaftstaktik<br />
- Methodik <strong>der</strong> Anfängerausbildung<br />
- Regelkunde<br />
Praxis: - Fertigkeitsentwicklung in den Grundtechniken<br />
- einfache taktische Verhaltensmuster in Angriff und Abwehr<br />
- pädagogisch methodisch Befähigung<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Hochschullehrbuch Sportspiele. Sportverlag. Berlin 1988<br />
Veranstaltung: Grundlagen Kleine Spiele<br />
Lehrkräfte: Dr. Neiling<br />
Veranstaltungsform:<br />
Stundenumfang:<br />
Zulassungsbedingungen:<br />
Zielgruppe:<br />
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Handball<br />
Lehrkräfte: Dr. N. Schlegel, W.-D. Neiling<br />
Veranstaltungsform: Theorieseminare und Übungen in <strong>der</strong> Praxis<br />
Stundenumfang: 8 SWS (4 SWS Theorie, 4 SWS Praxis)<br />
Zielgruppe: Schwerpunkt ist Diplomstudiengang. Lehramt- und Magisterstudenten<br />
können nach Detailabsprache eingeordnet werden.<br />
Zulassungsbedingungen: erfolgreicher Abschluss <strong>der</strong> Grundausbildung Handball (4 SWS)<br />
Leistungsnachweise:<br />
- Praxisprüfung in 4 Kontrollformen (Technikdemonstationen)<br />
- Einschätzung <strong>der</strong> Spielleistung, Lehrprobe (30 Minuten)<br />
- mündliche o<strong>der</strong> schriftliche Prüfung nach Wahl (30 bzw. 90 Minuten)<br />
- zusätzliche studienbegleitende Aufgaben (Trainingsmittelkatalog, Positionsanfor<strong>der</strong>ungskatalog)<br />
Inhalt:<br />
- Inhalte bauen auf dem Abschlussniveau des Grundstudiums auf<br />
- in <strong>der</strong> Theorie und Praxis werden vor<strong>der</strong>gründig Aspekte des Nachwuchstrainings behandelt<br />
- methodische Befähigung ein zentrales Thema<br />
- weitere Tätigkeitsfel<strong>der</strong> (Handball in <strong>der</strong> Schule, Oldi-Handball, Mini-Handball) werden angerissen<br />
Grundlagenliteratur: Literaturliste (10 Quellen) wird im 1. Seminar ausgegeben.<br />
81
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Fußball<br />
Lehrkraft: Hans-Werner Meier<br />
Veranstaltungsform: Seminar / Übungen<br />
Stundenumfang: KSP I = 4 SWS; KSP II = 4 SWS)<br />
Zielgruppe: Studierende aus dem Hauptstudium, alle Studienrichtungen<br />
Zulassungsbedingungen: abgeschlossenes Grundstudium<br />
erfolgreicher Abschluss Grundstudium Fußball<br />
Leistungsnachweise:<br />
- regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme am Unterricht<br />
- erfolgreicher Abschluss <strong>der</strong> Lehrproben<br />
- erfolgreiche Praxisprüfungen (Spielleistung und Demonstrationsfähigkeit)<br />
- Projektaufgaben / Referate / Analysen<br />
- erfolgreicher theoretischer Abschluss (mündliche Prüfung)<br />
Inhalt:<br />
Theorie<br />
- Geschichtliche Entwicklung des Fußballsports<br />
- Entwicklungstendenzen im Fußballsport<br />
- Analysen zu Wettkampfhöhepunkten<br />
- Der langfristige Leistungsaufbau im Fußballsport<br />
- Die Belastbarkeit von Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen<br />
- Grundpositionen zur Gestaltung des Trainings<br />
- Die Methoden im Fußballtraining<br />
- Der Inhalt und die Methodik <strong>der</strong> individuellen koordinativ – technisch-taktischen Ausbildung<br />
- Der Inhalt und die Methodik <strong>der</strong> kollektiv - taktischen Ausbildung<br />
- Mannschaftsführung und Organisation des Trainings und Wettkampfs<br />
Praxis<br />
- Torschuss in Verbindung mit Dribbling und Zweikampf<br />
- Erlernung und Vervollkommnung verschiedener Finten<br />
- Methodik zur Schulung <strong>der</strong> Finten<br />
- Die Methode nach Coerver<br />
- Technische Kontrollformen<br />
- Kombinationsfolgen ohne und mit Positionswechsel<br />
- Varianten des 3:1<br />
- Freilauf- und Deckungsübungen mit Neutralen und Spielformen mit Neutralen<br />
- Lehrproben zu ausgewählten Themen<br />
Grundlagenliteratur: wird zu Beginn <strong>der</strong> Ausbildung bekannt gegeben<br />
82
Veranstaltung: Theorie und Praxis Volleyball, Kleine Spezialisierung - Teil I<br />
Lehrkraft : R. Schumann<br />
Stundenumfang: 4 SWS<br />
Zugangsbedingungen: Abschluss des Grundkurses mit Note 2,3 o<strong>der</strong> besser<br />
Zielgruppe: Diplom, Magister<br />
Leistungsnachweise:<br />
mündliche Prüfung (45 min); Praxis: Kontrollübungsformen zur Zielgenauigkeit: Aufgabe; Zuspiel; Angriffsschlag,<br />
Anschlagen/Zuwerfen; Spielleistung; Lehrprobe (25 min)<br />
Inhalt:<br />
Theorie:<br />
- Leistungsstruktur des Volleyballspiels<br />
- Organisation/ Steuerung/Auswertung des Trainings - und Wettkampfprozesses<br />
- Methodik <strong>der</strong> Ausbildung im Jugendsport<br />
- Technik - individuelle Taktik - Spielfähigkeit<br />
- Mannschaftstaktik<br />
Praxis:<br />
- Vervollkommnung <strong>der</strong> technischen Fertigkeiten<br />
- Gruppen- und Mannschaftstechnik<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Hochschullehrbuch Sportspiele.<br />
- Christmann & Fago (1991): Volleyball-Handbuch. Rowohlt.<br />
- Herzog & Voigt & Westphal (1987): Volleyball-Training. Schorndorf.<br />
83
STUDIENSCHWERPUNKT:<br />
FREIZEIT-, PRÄVENTIONS- und FITNESSSPORT (FPF)<br />
HAUPTSTUDIUM<br />
5. Semester<br />
Veranstaltung: Pädagogische Probleme im FPF I<br />
Lehrkraft: Frau K. Albert<br />
Veranstaltungsform: Seminar (2 SWS)<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss Grundlagen Sportpädagogik<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM, Diplom F.P.F., Magister<br />
Inhalt:<br />
In <strong>der</strong> Lehrveranstaltung werden pädagogische Momente in ausgewählten Tätigkeitsbereichen des<br />
FPF dargestellt und diskutiert, denn pädagogische Prozesse vollziehen sich nicht nur bei <strong>der</strong><br />
Erziehung von kleinen Kin<strong>der</strong>n, son<strong>der</strong>n beispielsweise auch bei <strong>der</strong> Arbeit mit Touristen, Skinheads,<br />
Magersüchtigen, Jugendlichen mit Lernstörungen, Senioren, Managern.<br />
In kritischer Auseinan<strong>der</strong>setzung wird den Chancen, Problemen und Folgen <strong>der</strong> zunehmenden<br />
„Pädagogisierung“ im Freizeit-, Prävention- und Fitnesssport sowohl für die Klienten als auch für die<br />
Anbieter nachgegangen.<br />
Leistungsnachweis:<br />
regelmäßige Teilnahme und aktive Mitarbeit<br />
Gestaltung und Leitung einer Seminareinheit (ggf. Referat, Exkursion, Diskussionsrunde)<br />
Hausarbeit (Darstellung und Auswertung <strong>der</strong> durchgeführten Seminareinheit)<br />
Grundlagenliteratur:<br />
DIECKERT, J. (Hrsg.): Sportwissenschaft im Dialog: Bewegung – Freizeit – Gesundheit. Aachen, 1993<br />
OERTER, R./ MONTADA, L.: Entwicklungspsychologie. 4. Aufl., Belz, 1998<br />
OPASCHOWSKI, H. W.: Pädagogik <strong>der</strong> freien Lebenszeit. Opladen, 1996<br />
SCHIERZ, M./ HUMMEL, A./ BALZ, E.: Sportpädagogik. Orientierungen-Leitideen-Konzepte. Sankt Augustin, 1994<br />
WOPP, C.: Entwicklungen und Perspektiven des Freizeitsports. Meyer & Meyer, Aachen, 1995<br />
Spezifische Literaturhinweise erfolgen im Seminar.<br />
84
Veranstaltung: Sportmedizin I im FPF<br />
Lehren<strong>der</strong>: N.N.<br />
Veranstaltungsform: 2 SWS Vorlesung<br />
Zulassungsbedingungen: Vordiplom Sportmedizin<br />
Zielgruppe: Diplom - Freizeit-, Präventiv- und Fitnesssport<br />
Inhalte:<br />
- Einführung: Sport und Gesundheit<br />
- Grundsätze <strong>der</strong> Erstellung von Belastungsprogrammen<br />
- Geschlechtsspezifische Fähigkeitsentwicklung<br />
- Frau und Sport / Schwangerschaft und Sport<br />
- Gesundheitswert von Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit<br />
- Adipositas und Sport<br />
- Sport im Kindesalter<br />
- Sport im Alter<br />
- Sport bei Haltungsfehlern und Skoliose<br />
- Belastbarkeit bei aseptischen Nekrosen<br />
- Präventivsport bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Angina pectoris)<br />
- Sport bei Hypertomie<br />
- Sport nach Myokardinfarkt<br />
Abschluss: MC-Klausur 1 Std.<br />
Literatur:<br />
- Bös, K., G. Wydra u. G. Karisch: Gesundheitsför<strong>der</strong>ung durch Bewegung,<br />
Spiel und Sport. Perimed, Erlangen. 1992<br />
- Schauer, J., G. Schleusing u. Helge Voigt: Bewegungstherapie bei Herz-,<br />
Kreislauf- und Lungenerkrankungen. Barth, Leipzig, 1990.<br />
- Klimt, F.: Sportmedizin im Kindes- und Jugendalte. Thieme, Stuttgart,<br />
1992<br />
- Medau, H.-J. und P.E. Nowacki: Frau und Sport. Perimed, Coburg. 1992<br />
- Lenhart, P. u. W. Seibert: funktionelles Bewegungstraining.<br />
Sportinformation-Verlag, Oberhaching, 1991.<br />
85
Veranstaltung: Sportmanagement im FPF<br />
Lehrkraft: Dr. Frank Kutschke<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung und Seminar im Wechsel<br />
Zulassungsbedingungen: Erfolgreicher Abschluss im Lehrgebiet Sportrecht /-verwaltung;<br />
nur für StudentInnen des Studienschwerpunktes FPF!<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM Diplom (Studienschwerpunkt FPF!)<br />
Inhalte:<br />
I. Management im Sportverein<br />
- Vereinsrechtliche Grundlagen und Ableitungen für die Führung und Verwaltung von<br />
Sportvereinen<br />
- Aufgaben und Verantwortung <strong>der</strong> Vereinsführungen<br />
- Satzungsbestimmungen und Ableitungen für den Breitensport<br />
- Grundlagen des Vertragsrechts im Sportverein<br />
- Sport und Steuern<br />
II. Der privatwirtschaftliche Sportmarkt<br />
- Zugangsbedingungen zum privatwirtschaftlichen Sportmarkt<br />
- Unternehmensformen für privatwirtschaftliche Sportanbieter<br />
- Investitionen, Investitionsplanung und Rentabilitätsvorschau unter den Bedingungen <strong>der</strong><br />
Fremdfinanzierung privatwirtschaftlicher Sporteinrichtungen<br />
III. Grundlagen des Sportmarketing<br />
- Analyse und strategische Diagnose des Sportmarktes<br />
- Taktisches Marketing, Marketingmix und Marketingkonzepte für den Bereich des FPF<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> Kommunikationspolitik im Sportmarketing<br />
Leistungsnachweis:<br />
Erfolgreiche Klausur am Ende des Semesters.<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Chaet, M.: Sportstudiomanagement.<br />
Freyer, W.: Handbuch des Sportmarketing<br />
Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre<br />
Kotler,P.: Grundlagen des Marketing<br />
Meffert,H.; Bruhn, M.: Dienstleistungsmarketing<br />
Neufang; Geckle: Der Verein. Organisations- und Musterhandbuch für Vereine.<br />
Trosien, G.: Die Sportbranche.<br />
Ulrich, E.: Freizeit und Rendite.<br />
86
Veranstaltung: Große Spezialisierung FPF-Didaktik und Methodik des FPF, I<br />
Lehrkräfte: Dr. Bartel<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang:<br />
Zulassungsbedingungen:<br />
Zielgruppe: StudentInnen FPF, MagisterstudentInnen<br />
Leistungsnachweis:<br />
Voraussetzungen:<br />
1. Abschluss <strong>der</strong> Grundlagen <strong>der</strong> Sportmedizin bzw. Nachweis über die Teilnahme an den<br />
Lehrveranstaltungen Anatomie, Physiologie, Biochemie, Sportmedizin.<br />
2. Abschluss <strong>der</strong> Grundlagen <strong>der</strong> Bewegungs- und Trainingswissenschaft bzw. Nachweis über die<br />
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen Sportbiomechanik, Sportmotorik, Trainingswissenschaft I<br />
3. Abschluss <strong>der</strong> Grundlagen Sportpädagogik o<strong>der</strong> Sportpsychologie bzw. Nachweis über die<br />
Teilnahme an den genannten Lehrveranstaltungen.<br />
Inhalt:<br />
Die Lehrveranstaltung verfolgt das Ziel, die wesentlichen theoretischen Grundlagen des Freizeitsports,<br />
beson<strong>der</strong>s des Präventionssports und des gesundheitsorientierten Fitnesssports <strong>der</strong> Erwachsenen zu<br />
vermitteln (Ziele, Inhalte, Merkmale, Zielgruppen, Handlungsfel<strong>der</strong>, des Freizeitsports, Modelle und<br />
Theorien im Gesundheits- und Fitnessport) bzw. durch Vergabe von Semesterarbeiten und Referaten<br />
die theoretische Verarbeitung von Problemen und die Lehr- und Vermittlungskompetenz <strong>der</strong><br />
Studenten zu för<strong>der</strong>n.<br />
Themengruppen und Schwerpunkte:<br />
1. Freizeitsport - Abgrenzung und Ziele<br />
2. Merkmale, Handlungsfel<strong>der</strong> und Zielgruppen<br />
3. Gesundheits- und Fitnessmodelle<br />
4. Modelle im Abenteuer- und Erlebnissport<br />
5. Organisatorisch-rechtliche Basis des Sporttreibens (Verein, kommerzielle Sportanbieter).<br />
Leistungsnachweis:<br />
erfolgreiche und regelmäßige Teilnahme<br />
Semesterarbeit o<strong>der</strong> Referat 40%<br />
Klausur 60%<br />
Literatur:<br />
Bös, K.; Brehm, W.(Hrsg.) (1998). Gesundheitssport - Ein Handbuch. - Schorndorf : Hofmann.<br />
Dietrich, K.; Heinemann, K. (1990). Kommerzielle Sportanbieter.- Schorndorf : Hofmann.<br />
Bouchard, C. (Hrsg.) (1996): Körperliche Aktivität, Fitness und Gesundheit. - In: The Club of Cologne:<br />
Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und körperliche Aktivität. Köln: Strauß, S.42 -55.<br />
87
Veranstaltung: Einführung in das Präventionstraining<br />
Lehrkraft: Dr. W. Bartel<br />
Veranstaltungsform: Übung/Seminar<br />
Voraussetzungen:<br />
1. Abschluss <strong>der</strong> Grundlagen <strong>der</strong> Sportmedizin bzw. Nachweis über die Teilnahme an den<br />
Lehrveranstaltungen Anatomie, Physiologie, Biochemie, Sportmedizin.<br />
2. Abschluss <strong>der</strong> Grundlagen <strong>der</strong> Bewegungs- und Trainingswissenschaft bzw. Nachweis über die<br />
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen Sportbiomechanik, Sportmotorik, Trainingswissenschaft<br />
Zielgruppe: : StudentInnen FPF, MagisterstudentInnen<br />
Inhalt:<br />
Zielstellung <strong>der</strong> theoriegeleiteten sportpraktischen und methodischen Ausbildung ist die Befähigung<br />
<strong>der</strong> Studierenden, ein gesundheitsorientiertes Training im Bereich „Herz-Kreislauf-System“ und „Stütz<br />
und Bewegungssystem„ durchzuführen.<br />
Mit ausgewählten Aufgabenstellungen in Form von Lehrübungen soll die pädagogisch-methodische<br />
Kompetenz <strong>der</strong> Studierenden wirkungsvoll geför<strong>der</strong>t werden.<br />
Themengruppen und Schwerpunkte:<br />
1. Theoretische Grundlagen zum Lehrkomplex<br />
2. Grundlagen des Herz-Kreislauf-Trainings (Walking/Laufen/Ergometertraining)<br />
3. Grundlagen des funktionellen Muskeltrainings/<strong>der</strong> Haltungs- und Körperschulung<br />
4. Grundlagen von Körperwahrnehmung und Entspannung in Sportgruppen<br />
5. Tests/Diagnostik im Präventionssport <strong>der</strong> Erwachsenen.<br />
Leistungsnachweis:<br />
- Praxis: Regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme,<br />
erfolgreiches Absolvieren von Lehrübungen 40%<br />
- Theorie: Klausur: 60 %<br />
Literatur:<br />
Reichel, H.-S.; Seibert, W.; Geiger, L. (1995). Präventives Bewegungstraining - Aufbau, Gestaltung und<br />
erfolgreiche Durchführung. - Oberhaching: Gesundheits-Dialog .<br />
Lenhart, P.; Seibert, W (1991). Funktionelles Bewegungstraining - Muskuläre Dysbalancen erkennen, beseitigen<br />
und vermeiden.-Oberhaching: Gesundheits-Dialog .<br />
Boeckh-Behrens, W.-U./Buskies, W. (1995). Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining. Band 1 (Fitnessgrundlagen,<br />
Krafttraining, Beweglichkeitstraining). Lüneburg.<br />
Buskies, W. (1999). Sanftes Krafttraining unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung des subjektiven<br />
Belastungsempfindens. Köln : Strauß.<br />
Boeckh-Behrens, W.-U./Buskies, W. (2001). Fitness-Krafttraining- die besten Übungen und Methoden für Sport<br />
und Gesundheit. Reinbek bei Hamburg: Rohwolt.<br />
88
Veranstaltung: Einführung in das Fitnesstraining<br />
Lehrkraft: Frau Heike Streicher<br />
Veranstaltungsform: Übung / Seminar<br />
Voraussetzungen:<br />
1. Abschluss <strong>der</strong> Grundlagen <strong>der</strong> Sportmedizin bzw. Nachweis über die Teilnahme an den<br />
Lehrveranstaltungen Anatomie, Physiologie, Biochemie und Sportmedizin<br />
2. Abschluss <strong>der</strong> Sportmotorik<br />
Zielgruppe: StudentInnen FPF, MagisterstudentInnen<br />
Inhalt:<br />
Die Lehrveranstaltung verfolgt das Ziel, die wesentlichen Grundlagen des Fitnesstrainings zu<br />
vermitteln. Die StudentInnen werden mit den neuesten Trends des Fitnesstrainings vertraut gemacht.<br />
Mit ausgewählten Lehraufträgen zur aktuellen Thematik wird die Lehrkompetenz jedes einzelnen<br />
StudentInnen geför<strong>der</strong>t.<br />
Themengruppen und Schwerpunkte<br />
1. Einführung in die Aerobic und Stepp-Aerobic sowie <strong>der</strong>en modifizierte Formen<br />
(z. B Slide, Theraerobic, Ballaerobic)<br />
2. Kenntnisvermittlung zum Circeltraining<br />
3. Besuch von Leipziger Fitnessstudios, Kennen lernen von Sequenztrainingsgeräten Handhabung<br />
<strong>der</strong> Durchführung von Probetrainingseinheiten<br />
4. Kenntnisvermittlung über Fitnesstests, welche einerseits in kommerziellen Fitnesseinrichtungen<br />
computergestützt und an<strong>der</strong>erseits in <strong>der</strong> Turnhalle manuell ausführbar sind.<br />
5 Vorstellung von Fitnesstrends (Spinning, Tai Bo)<br />
Leistungsnachweis:<br />
- regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme<br />
- Lehrübung 40%<br />
- Klausur 60%<br />
Literatur:<br />
Bittmann, F. (1995). Körperschule - das Programm für die Gesundheit. Hamburg. Rowohlt.<br />
Boeckh-Behrens,W.-U.; Buskies, W. (1998). Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining. Bd.1.Dr. Loges. Wesen.<br />
Beuker, F. (Hrsg.) (1993). Fitness-Heute. Standortbestimmungen aus Wissenschaft und Praxis. Erkrath.<br />
Deutscher Gesellschaft für Freizeit.<br />
Dvorkis,S. (1996). Extension- Entspannung, Vitalität, Regeneration. Hamburg. Rowohlt<br />
Friebner, A. (1997). Muscle Definition.- Deutscher Aerobic-Verband<br />
Geiger, L..(1992) Training mit dem Fahrra<strong>der</strong>gometer. -sportinform<br />
Kempf,H.-D.; Strack, A. (1999). Krafttraining mit dem Theraband. Hamburg. Rowohlt.<br />
Wade,J.(1996). Training Network.- Handout DFAV<br />
89
Veranstaltung: Einführung in Freizeitspiele<br />
Veranstaltung: New Games - Freizeitspiele (2SWS)<br />
Lehrkraft: Dr. W. Bartel<br />
Veranstaltungsform: Übung/Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Voraussetzungen: Abschluss Kleine Spiele<br />
Zielgruppe: : StudentInnen FPF, MagisterstudentInnen<br />
Inhalt:<br />
Ergänzend zu den Inhalten des Lehrkomplexes „Kleine Spiele“ im Grundstudium werden hier<br />
beson<strong>der</strong>s die Spiele und Spielformen vermittelt, die für das Gesundheitstraining mit Erwachsenen im<br />
mittleren und späteren Erwachsenenalter von Bedeutung sind.<br />
Im päd.-meth. Bereich geht es darum, die StudentInnen zu befähigen, Spiele und Spielformen nach<br />
<strong>der</strong> Philosophie <strong>der</strong> New Games zu vermitteln (kooperativ, konkurrenzfrei, ganzheitlich in ihrer<br />
Gesundheitswirkung).<br />
Themengruppen und Schwerpunkte:<br />
1. Theoretische Grundlagen zum Lehrkomplex, beson<strong>der</strong>s zu den New Games<br />
2. Kennenlern-, Sozial- und Kommunikationsspiele<br />
3. Motopädagogische Angebote<br />
4. Sport, Spiel, Spaß Aktivitäten/New Games<br />
5. Spiele für das gesundheitsorientierte Fitnesstraining<br />
6. Trendspiele (Baseball, Frisbee-Ultimate)<br />
Leistungsnachweis (Beleg):<br />
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme<br />
erfolgreiches Absolvieren von Lehrübungen<br />
Literatur:<br />
Fluegelman, A.; Tembeck, Sh. (1979). New games - die neuen Spiele. Pittenhart-Oberbrunnen: Ahorn.<br />
Fluegelmann, A. (1992). Die Neuen Spiele, Band 2 (10. Auflage). Soyen: Ahorn.<br />
Grupe, O. u.a. (1982). Spiel-Spiele-Spielen.- Schorndorf.: Hoffmann.<br />
Lehrplan DTB (1984). Freizeitspiele. München, Wien, Zürich: BLV.<br />
Brinckmann, A., Treess, U. (1992). Bewegungsspiele. Reinbeck: Rowohlt<br />
90
STUDIENSCHWERPUNKT:<br />
LEISTUNGSSPORT<br />
HAUPTSTUDIUM<br />
5. Semester<br />
Veranstaltung: Sportpädagogische Probleme im Leistungssport, Teil 1<br />
Lehrkraft: Prof. Dr. Alfred Richartz<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: abgeschl. Grundstudium Sportpädagogik<br />
Zielgruppe: Hauptstudium<br />
Leistungsnachweis: reg. aktive Teilnahme; Hausarbeit<br />
Inhalte:<br />
Konzepte <strong>der</strong> Talentför<strong>der</strong>ung<br />
Doppelbelastung von Schule und Leistungstraining<br />
Risiken und Chancen des Leistungssports im Kindes- und Jugendalter aus pädagogischer<br />
Perspektive<br />
Normative Voraussetzungen des Trainerhandelns im Leistungssport von Kin<strong>der</strong>n und<br />
Jugendlichen<br />
Die Trainerrolle im Spannungsfeld von Erfolgszwang und pädagogischer Verantwortung<br />
Die Trainer/in-Athlet/in-Beziehung aus pädagogischer Perspektive: Erwartungen,<br />
Verantwortlichkeiten, Konflikte, Krisen<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Brettschnei<strong>der</strong>, W.D./Klimek, G. (1998): Sportbetonte Schulen. Ein Königsweg zur För<strong>der</strong>ung sportlicher<br />
Talente? Aachen.<br />
- Daugs, R./Emrich, E./Igel, Chr., Hrsg. (1998): Kin<strong>der</strong> und Jugendliche im Leistungssport. Schorndorf.<br />
- Joch, W. (1992): Das sportliche Talent. Aachen.<br />
- Kaminski, G./Mayer, R./Ruoff, G. (1984): Kin<strong>der</strong> und Jugendliche im Hochleistungssport. Schorndorf.<br />
- Richartz, A./Brettschnei<strong>der</strong>, W.D. (1996): Weltmeister werden und die Schule schaffen. Schorndorf.<br />
- Richartz, A. (200): Lebenswege von Leistungssportlern. Aachen.<br />
91
Veranstaltung: Psychologie im Leistungssport<br />
Lehrkraft: Dr. Sabine Würth<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: abgeschlossenes Grundstudium<br />
Zielgruppe: Diplom/Magister<br />
Leistungsnachweis: aktive Mitarbeit, Referat und Klausur<br />
Inhalte:<br />
In dieser Veranstaltung werden differenzierte praxisrelevante Erkenntnisse und bewährte<br />
psychologische Trainingsverfahren vermittelt, die im leistungssportlichen Training und<br />
Wettkampf Anwendung finden. Dabei werden sowohl Möglichkeiten <strong>der</strong> professionellen<br />
sportpsychologischen Beratung für die AthletInnen selbst als auch die spezifische Rolle von<br />
TrainerInnen im Leistungssport diskutiert. Die Seminarthematik lehnt sich in weiten Teilen an<br />
die „Fortbildung Sportpsychologie Leistungssport“ (asp & bdp) an und beinhaltet u.a. folgende<br />
Themenkomplexe:<br />
Führungsverhalten von Trainern im Nachwuchsleistungssport<br />
Kommunikationsprozesse im LS<br />
Psychologisches Training in <strong>der</strong> Wettkampfvorbereitung<br />
Stressmanagementtraining (1992)<br />
Selbstmotivierungstraining<br />
Verletzungsmanagement<br />
Bewältigung des Karriereendes<br />
Grundlagenliteratur:<br />
o Literatur wird in <strong>der</strong> ersten Seminarsitzung bekannt gegeben<br />
Veranstaltung: Sportmedizin des Leistungssports, Teil 1<br />
Lehrkräfte: Prof. Busse<br />
Veranstaltungsform:<br />
Stundenumfang:<br />
Zulassungsbedingungen:<br />
Zielgruppe:<br />
Leistungsnachweis:<br />
7. Semester<br />
92
Veranstaltung: Trainingslehre III (Theorie und Methodik des Trainings im LS)<br />
Lehrkräfte: Prof. Krug, Prof. Kirchgässner, Dr. Hoffmann u. a.<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung und Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Vordiplom, Leistungsnachweise in TL IIa und TL IIb<br />
Zielgruppe: Diplom-Hauptstudiengang: LS<br />
Magister/Hauptfach: Übergreifendes Themenfeld Sport und Leistung<br />
Leistungsnachweis: Leistungsnachweis ohne Note<br />
Inhalte:<br />
Grundsätze <strong>der</strong> Leistungssportför<strong>der</strong>ung in <strong>der</strong> BR Deutschland;<br />
Grundpositionen zur Belastungsgestaltung und Wie<strong>der</strong>herstellung im Spitzensport;<br />
Ausgewählte Probleme des Trainings im Spitzensport:<br />
o Höhentraining,<br />
o UWV,<br />
o Leistungsdiagnostik,<br />
o Organisation <strong>der</strong> Wettkampfleistung;<br />
Struktur und Arbeitsweise eines Olympiastützpunktes (OSP);<br />
Mo<strong>der</strong>ne Software im Leistungssport;<br />
Entwicklungstendenzen und trainingsmethodische Ansätze zur Erhöhung <strong>der</strong> Wirksamkeit des<br />
Trainings in den Sportartengruppen.<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Aktuelle Literatur aus den Sportarten<br />
- Daugs, R. (2000): Evaluation sportmotorischen Messplatztrainings im Spitzensport. Köln: Sport und Buch<br />
Strauß, 2000.- 146<br />
- Dickhuth, H.H., Röcker, K., Mayer, F., Nieß, A., Horstmann, T., Heitkamp, H.C. & Dolezel, P. (1996).<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung bei Ausdauer- und Spielsportarten. Dtsch. Z.<br />
Sportmed., Köln 47(1996)S1, S. 183<br />
- Ferger, K. (1999). Trainingswissenschaftliche Analyse individueller Anpassungsreaktionen auf<br />
Trainingsbelastungen. Leipziger Sportwiss. Beiträge, Sankt Augustin 40(1999)1, S. 84 - 99,<br />
- FÖRDERKONZEPT 2000: DSB Frankfurt/M.,1995<br />
- FUCHS, M.; REISS, M. (1990): Höhentraining. Trainerbibliothek. Schorndorf 1990<br />
- Hagedorn, G. (2000): Sportspiele: Training und Wettkampf. Reinbeck bei Hamburg 2000.- 249 S<br />
- HARTMANN, U.; MADER, A. (1999): Grundlegende Aspekte zu Trainingsanpassungen und zum Training in<br />
mittlerer Höhe In: Zeitschrift für Angewandte Trainingswissenschaft. Leipzig 1999/1<br />
- HOHMANN, A.; BRACK, R. (1995): Wissenschaftliche Trainingsberatung. Sportwissenschaft 25(1995)2, S.<br />
137-156<br />
- MARTIN, D.:KRUG, J.:REISS, M.: ROST, K. (1997): Entwicklungstendenzen <strong>der</strong> Trainings- und<br />
Wettkampfsysteme im Spitzensport mit Folgerungen für den Olympiazyklus 1996/2000. Leistungssport 27<br />
1997)1, S.25-31<br />
- Olympische Winterspiele 2002. Zu ausgewählten Spitzensportkonzepten und <strong>der</strong>en Umsetzung in<br />
Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City. Institut für Angewandte<br />
Trainingswissenschaft. Leipzig 2002<br />
- SCHNABEL, G./HARRE, D./BORDE, A. (1996): Trainingswissenschaft. Berlin 1996<br />
93
STUDIENSCHWERPUNKT:<br />
Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport<br />
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Didaktik und Methodik des Rehabilitationssports, <strong>der</strong><br />
Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports mit Behin<strong>der</strong>ten<br />
und Chronisch Kranken<br />
Lehrkraft: Univ.-Prof. Dr. J. Innenmoser<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Veranstaltungsform: Behin<strong>der</strong>ungsübergreifende, verbindliche Veranstaltung (Vorlesung)<br />
Ziele:<br />
Die Veranstaltung liefert einen Gesamtüberblick über die didaktischen und methodischen Aspekte<br />
des Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports in seinen verschiedenen<br />
Teilbereichen. Sie baut lernsukzessive auf einführenden Aspekten auf und führt zu exemplarischen,<br />
vertiefenden Darstellungen in einzelnen Teilbereichen.<br />
Inhalte:<br />
- Begriffsdefinitionen und Gesamtüberblick zum Themenfeld; Übersicht zum beruflichen<br />
Tätigkeitsfeld und zur allgemeinen und speziellen Didaktik; Fragen des Sportverständnisses, <strong>der</strong><br />
Definition von Bewegung, Spiel und Sport und <strong>der</strong> präventiven Maßnahmen durch Sport;<br />
- Aspekte <strong>der</strong> Rehabilitation (Ausgangspunkt: Medizinische Rehabilitation; Grundauffassungen zu<br />
den Begriffen „Schädigung“, „funktionelle Beeinträchtigung“ und „Behin<strong>der</strong>ung“; Tätigkeiten und<br />
Aufgaben in den engeren und weiteren Teilbereichen <strong>der</strong> Rehabilitation; Finanzierung,<br />
Trägerschaft <strong>der</strong> Rehabilitation; Ziele und Maßnahmen <strong>der</strong> Rehabilitation in verschiedenen Stufen<br />
des rehabilitativen Prozesses;<br />
- Darstellung <strong>der</strong> spezifischen Ziele und Aufgaben von Rehabilitationssport, Sporttherapie und<br />
Behin<strong>der</strong>tensport bei verschiedenen Behin<strong>der</strong>ungsarten; Erläuterung didaktisch-methodischer<br />
Konzepte am Beispiel exemplarisch ausgewählter Behin<strong>der</strong>ungsarten;<br />
- Didaktisch-methodische Aspekte <strong>der</strong> Inhalte des Rehabilitationssports, d.h. <strong>der</strong> B. -aufgaben, B.handlungen<br />
und des Anfor<strong>der</strong>ungsprofils von Bewegungshandlungen;<br />
- Diagnostische Maßnahmen in Zuordnung zu verschiedenen Schädigungen bzw. Behin<strong>der</strong>ungen,<br />
Speziell: Einführung in die Verfahren <strong>der</strong> Motodiagnostik, <strong>der</strong> organisch funktionellen<br />
Verlaufsdiagnostik und <strong>der</strong> psychischen Verlaufsdiagnostik. Das Konzept „Komplexdiagnostik“;<br />
- Methoden (anwendbarer Methodenkatalog) im Rehabilitationssport, in <strong>der</strong> Sporttherapie und im<br />
Behin<strong>der</strong>tensport („Methodenintegration“).<br />
- Methodische Prinzipien und Aspekte <strong>der</strong> Unterrichtslehre und des speziellen Lehrerverhaltens im<br />
Arbeitsgebiet;<br />
- Organisatorische Fragen des Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports,<br />
speziell: Gesetzliche Voraussetzungen und finanzierungstechnische Vorgaben.<br />
- Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens im Tätigkeitsfeld und Aspekte des Selbstmanagements<br />
im Berufsfeld.<br />
Erfolgsnachweis: Die Vorlesung schließt mit einer Klausur ab, <strong>der</strong>en erfolgreiches Bestehen<br />
Voraussetzung ist zur Zulassung zur Fachprüfung <strong>der</strong> Speziellen Pädagogik und Didaktik und<br />
Methodik im Rahmen des Hauptstudiums. Erfolgreicher Abschluß berechtigt zur Bewerbung um eine<br />
Zulassung zu einer Großen Spezialisierung<br />
94
Veranstaltung: Maßnahmen und Verfahren <strong>der</strong> Motopädagogik bei Behin<strong>der</strong>ten<br />
und chronisch Kranken<br />
Lehrende: Lehrbeauftragte Diplomsportlehrerin Simone Zimmermann<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Veranstaltungsform: Wahlobligatorisches, behin<strong>der</strong>ungsübergreifendes Seminar<br />
Inhalte:<br />
Einführung in die theoretischen Grundlagen <strong>der</strong> Motopädagogik, psychomotorische Geräte in <strong>der</strong><br />
Motopädagogik; Hüpf- und Hinkspiele: Spielen wie<strong>der</strong>entdecken und weiterentwickeln; Perzeptive<br />
Entwicklungsför<strong>der</strong>ung: Lernziele im Wahrnehmungsbereich; Körpererfahrung (z. B. Schaukeln,<br />
Schwingen, Springen, Gleichgewicht halten, Zeit erleben, Entspannung, Materialerfahrung);<br />
Improvisation mit Körper und Material; Sozialerfahrung (z. B. gemeinsames Erleben, Kräfte messen,<br />
Kräftevergleich, Rollenspiel); Abenteuer-/Freizeit- und Erlebnispädagogik (Natur erleben);<br />
Rückenschule für Kin<strong>der</strong>.<br />
Als Erfolgsnachweis ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem Seminarschwerpunktthema als<br />
Semesterarbeit erfor<strong>der</strong>lich. Die vorgesehenen Themen werden in Theorie und vor allem in <strong>der</strong> Praxis<br />
umgesetzt und zur Diskussion gestellt; Eigenrealisation <strong>der</strong> Studenten ist unbedingt notwendig.<br />
Schriftliche Informationen in Form einer einseitigen Einführung (Thesenpapier) sind durch die<br />
Studierenden zu erstellen.<br />
Veranstaltung: Maßnahmen <strong>der</strong> psychophysischen Regulation in RSB<br />
Lehren<strong>der</strong>: Dr. H.-D. Jahn<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Veranstaltungsart: Wahlobligatorisches behin<strong>der</strong>ungsübergreifendes Seminar<br />
Inhalte:<br />
In Zuordnung zu den Themen sind die Studierenden aufgefor<strong>der</strong>t, an selbstentwickelten praktischen<br />
Beispielen zu erkennen, wie und durch welche sport- und bewegungsbezogenen Maßnahmen die<br />
psychophysische Regulation das Aktivitätsniveau behin<strong>der</strong>ter und von Behin<strong>der</strong>ung bedrohter<br />
Menschen regulieren kann.<br />
- Grundlagen <strong>der</strong> bewegungsbezogenen psychophysischen Regulation; ganzheitliche Aktivierung und<br />
Entspannung in Sporttherapie und Rehabilitationssport; Spiele und Spielformen zur Aktivierung und<br />
Entspannung. Der Atem als Schlüssel zur psychophysischen Regulation; Aktivierung und<br />
Entspannung durch Rhythmus und Musik; Aktivierung und Entspannung durch Berührung und<br />
Massage; Körperwahrnehmung und Körpererfahrung; Progressive Muskelrelaxation; „die Entdeckung<br />
<strong>der</strong> Langsamkeit“; Qi Gong und Tai Qi; die Feldenkraismethode (Einführung); Praxisdarstellung <strong>der</strong><br />
Feldenkraismethode; Yoga (Einführung), Praxis Yoga; kommunikative Bewegungstherapie nach<br />
Wilda-Kiesel; psychophysische Regulation mit Kin<strong>der</strong>n.<br />
Der Erfolgsnachweis für diese Veranstaltung wird bei regelmäßiger und aktiver Teilnahme erteilt,<br />
wenn zusätzlich eine schriftliche Semesterarbeit vorgelegt wird. Alternativ kann von Studierenden,<br />
denen keine Semesterarbeit ermöglicht werden kann, eine Klausur absolviert werden. Bei nicht<br />
zufriedenstellen<strong>der</strong> Durchführung des Referats/<strong>der</strong> Semesterarbeit in Theorie und Praxis ist zusätzlich<br />
die Absolvierung <strong>der</strong> Klausur notwendig.<br />
95
Veranstaltung: Maßnahmen und Verfahren <strong>der</strong> Mototherapie bei Behin<strong>der</strong>ten<br />
und chronisch Kranken<br />
Lehrende: Lehrbeauftragte Diplomsportlehrerin Simone Zimmermann<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Veranstaltungsform: Wahlobligatorisches behin<strong>der</strong>ungsübergreifendes Seminar<br />
Inhalt:<br />
Einführung in die theoretischen Grundlagen <strong>der</strong> Mototherapie; Verfahren <strong>der</strong> Mototherapie;<br />
Motodiagnostik in <strong>der</strong> Mototherapie; Psychomotorische Therapieprozesse: Von <strong>der</strong> Diagnostik zur<br />
Therapie; Psychomotorische Geräte in <strong>der</strong> Mototherapie; Basale Stimulation in <strong>der</strong> Mototherapie; das<br />
Trampolin in <strong>der</strong> Mototherapie. Mototherapie bei Wahrnehmungsstörungen, bei fein- und<br />
grobmotorischen Bewegungsstörungen, bei Verhaltensstörungen (hyperaktive Kin<strong>der</strong>), bei<br />
psychosomatischen Störungen (Essstörungen), bei Senioren.<br />
Als Erfolgsnachweis ist die schriftliche Ausarbeitung eines Seminarschwerpunktthemas in Form einer<br />
Semesterarbeit erfor<strong>der</strong>lich. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus theoretischen Darstellungen und<br />
praktischer Umsetzung; Eigenrealisation <strong>der</strong> Teilnehmer ist erfor<strong>der</strong>lich. Die Studierenden erhalten<br />
eine Kurzinformation (Thesenpapier) über die Inhalte <strong>der</strong> jeweiligen Referate.<br />
96
Veranstaltung: Spezielle behin<strong>der</strong>ungsspezifische Trainings- und<br />
Bewegungslehre - Teil 1<br />
Lehrkraft: Univ.-Prof. Dr. J. Innenmoser,<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung (2.Semester = Seminar)<br />
Zielgruppe: Diplom, Magister<br />
Die Veranstaltung ist aufbauend konzipiert und liefert grundlegende Kenntnisse zum Verständnis <strong>der</strong><br />
speziellen Trainingsprozesse im koordinativen und im energetisch-konditionellen Bereich von<br />
behin<strong>der</strong>ten und Chronisch Kranken, sowie zum Verständnis <strong>der</strong> speziellen Methoden, speziellen<br />
Diagnostik und <strong>der</strong> unterrichtspraktischen Umsetzung im didaktisch-methodischen Prozess des<br />
Tätigkeitsfelds Rehabilitation.<br />
Kurs 1 ist verbindlich vor Beginn <strong>der</strong> Studien <strong>der</strong> „Großen Spezialisierung“ für das 5. Semester und<br />
findet in Form einer Vorlesung (2 SWS) statt. Als Erfolgsnachweis dieser Veranstaltung dient die<br />
Übernahme einer schriftlichen Hausarbeit über ein zur Verfügung gestelltes Thema (theoretische und<br />
praktische Auseinan<strong>der</strong>setzung mit ausgewählten Teilthemen). Im zweiten Semester werden<br />
ausgewählte Themen <strong>der</strong> schriftlichen Arbeiten als Referate vorgetragen. Für alle Studierenden ist die<br />
Absolvierung einer Klausur am Ende des zweiten Semesters notwendig.<br />
Inhalte:<br />
Behin<strong>der</strong>ungsspezifische Bewegungslehre (Lehre von <strong>der</strong> Motorik des Behin<strong>der</strong>ten):<br />
Bewegungsverhalten von Behin<strong>der</strong>ten; Bewegungsvoraussetzungen für das Bewegungsverhalten;<br />
Organisationsmodelle <strong>der</strong> Motorik; Bewegungslernen von Behin<strong>der</strong>ten; Tests und Therapieverfahren.<br />
Behin<strong>der</strong>ungsspezifische Trainingslehre: Auswirkungen, Wirkungsweisen und Wirkungsorte von<br />
Training bei behin<strong>der</strong>ten Menschen; Belastungs- und Intensitätssteuerung; Kontroll- und<br />
Überwachungsverfahren; Inhalte des Trainings in verschiedenen Abschnitten <strong>der</strong> Rehabilitation und<br />
des Behin<strong>der</strong>tensports; Realisation von Training unter Anwendung von Trainingsprinzipien und<br />
unterrichtsmethodischen / organisatorischen Maßnahmen; Planung und Durchführung <strong>der</strong><br />
Unterrichtsstunden, Trainingseinheiten, Trainingsplänen. Beson<strong>der</strong>e Schwerpunkte liegen auf den<br />
Teilbereichen Entwicklung, Lernen, Grenzen <strong>der</strong> Belastbarkeit.<br />
Leistungsnachweis:<br />
- Schriftliche Hausarbeit im ersten Hauptstudien-Semester. Im zweiten Semester werden<br />
ausgewählte Themen <strong>der</strong> schriftlichen Arbeiten in Form von Referaten vorgetragen.<br />
- Für alle Studierenden ist die Absolvierung einer Klausur am Ende des zweiten Semesters<br />
notwendig.<br />
Hinweis: Das erfolgreiche Absolvieren dieser Veranstaltung ist die Voraussetzung zur Anmeldung für das<br />
Prüfungsfach „Trainings- und Bewegungswissenschaft“ im Rahmen des Hauptstudiums<br />
97
Veranstaltung: Spezielle Didaktik und Methodik des Rehabilitationssports, <strong>der</strong><br />
Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports von und mit<br />
Menschen mit körperlichen Schädigungen und chronischen<br />
Erkrankungen des Nervensystems und des Stütz- und<br />
Bewegungsapparats (Teil 2)<br />
Lehrkraft: Univ.-Prof. Dr. J. Innenmoser<br />
Veranstaltungsform: 2. Teil <strong>der</strong> aufbauenden Veranstaltung als Vorlesung mit<br />
Seminarcharakter; Unterrichtslehre = Seminar (incl.<br />
Videostudien)<br />
Stundenumfang: 2 SWS + 2 SWS Unterrichtslehre<br />
Zulassungsbedingungen: Hauptstudium und erfolgreiche Absolvierung von Teil 1<br />
Zielgruppe: Diplom-Studierende; Magister „Reha und Sport“ und<br />
För<strong>der</strong>pädagogen (fakultativ)<br />
Aufbauende Veranstaltung im zweiten Semester (Zwischenleistungsnachweisen).<br />
Inhalte:<br />
Didaktisch-methodische Konzepte bei den Schädigungen: Gliedmaßenschäden; orthopädische<br />
Schäden; rheumatische Erkrankungen; Lähmungen; frühkindliche Hirnschädigung; erworbene<br />
Hirnschäden; Multiple Sklerose; Muskeldystrophie und -atrophie, Epilepsie; Hirntumore und<br />
Knochentumore.<br />
2. Semester: Abgrenzung therapeutischer und sportpädagogischer Einflussnahmen. Vertiefung <strong>der</strong><br />
Aspekte; Spezielle Fragen <strong>der</strong> Sporttherapie und des Rehabilitationssports; Grundaspekte des<br />
Leistungssports <strong>der</strong> Körperbehin<strong>der</strong>ten. Exkursionen zu Wettkampfveranstaltungen nationaler Art sind<br />
geplant .<br />
Erfolgsnachweise: Klausur; Anwesenheitspflicht.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Unterrichtslehre wird zunächst auf allgemeine Aspekte des Unterrichtens im Sport mit<br />
Körperbehin<strong>der</strong>ten eingegangen; es werden Prinzipien erarbeitet und an Beispielen erläutert und<br />
präzisiert. Je<strong>der</strong> Studierende stellt seine eigenen Unterrichtsversuche zur Diskussion und wird hierbei<br />
von den Teilnehmern <strong>der</strong> Großen Spezialisierung beraten, die Leitung <strong>der</strong> Diskussion führt <strong>der</strong><br />
Lehrende. Die Examenslehrprobe wird erst dann absolviert, wenn diese allgemeine Vorstellung in<br />
Form einer solchen Videodokumentation erbracht worden ist.<br />
98
Veranstaltung: Mobilitätstraining und -therapie bei Körperbehin<strong>der</strong>ten<br />
Lehrkraft: Univ.-Prof. Dr. J.Innenmoser<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Veranstaltungsform: Seminar/Übung (Pflicht für "KB")<br />
Pflichtveranstaltung im Rahmen <strong>der</strong> Großen Spezialisierung KB. Das Seminar ist theorie- und<br />
praxisorientiert; durch Eigenrealisation sollen die spezifischen Probleme <strong>der</strong> Mobilität von<br />
Körperbehin<strong>der</strong>ten nachvollzogen und entsprechende Aspekte erlernt werden.<br />
Ziele und Inhalte: Theorie und Praxis <strong>der</strong> Verfahren des Mobilitätstrainings;<br />
Rollstuhlmobilität (Querschnittsgelähmte), stationäre Rollstuhllernprogramme; Lernprogramme zum<br />
Rollstuhlfahren bei Spina-bifida- und cerebral bewegungsgestörten Kin<strong>der</strong>n; Elektrorollstuhlfahren.<br />
Gehschulen: Gehschule für Beinamputierte, Beinfehlgebildete, für Hemiplegiker, für Spastiker;<br />
Gehtechniken mit technischen Hilfsmitteln (Unterarmstützen, Rollator usw.). Methoden <strong>der</strong><br />
Mobilitätsschulung im Wasser (Aquajogging - Tiefwassermobilität, Gehtraining im Wasser, Aktive<br />
Wassertherapie). Möglichkeiten <strong>der</strong> Mobilitätssteigerung mit Hilfe psychomotorischer Übungsgeräte;<br />
Formen des Mobilitätstrainings bei Rheumapatienten unter Berücksichtigung krankengymnastischer<br />
Verfahren; Verfahren <strong>der</strong> Mobilisation in <strong>der</strong> Physiotherapie unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Gelenke und<br />
<strong>der</strong> Wirbelsäule; physiotherapeutisches Mobilitätstraining bei cerebral Bewegungsgestörten und bei<br />
erworbenen Hirnschäden (Konzepte Bobath, PNF, Vojta).<br />
Der Erfolgsnachweis wird erworben durch eine regelmäßige, aktive Teilnahme und Erstellung einer<br />
schriftlichen Semesterarbeit (inkl. Thesenpapier) und nach entsprechendem Vortrag bzw.<br />
Durchführung <strong>der</strong> Praxis mit den Teilnehmern.<br />
99
Veranstaltung: Große Spezialisierung Spezielle Didaktik und Methodik des<br />
Rehabilitationssports, <strong>der</strong> Sporttherapie und des<br />
Behin<strong>der</strong>tensports bei chronischen inneren Erkrankungen,<br />
Teil 2<br />
Lehrkraft: Dr. H.-D. Jahn<br />
Veranstaltungsform: Aufbauende Veranstaltungen als Vorlesung mit Seminarcharakter;<br />
+ Unterrichtslehre ( 2 SWS) = Seminar (die Studierenden zeigen<br />
Videos Ihrer eigenen Lehrversuche)<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Hauptstudium; Absolvierung <strong>der</strong> ausgewiesenen Lehrveranstaltungen<br />
des 5. und des 6. HS-Semesters <strong>der</strong> Großen Spezialisierung.<br />
Die Lehrübungen werden in Gruppen zu 3 Studierenden abgeleistet<br />
(Abschluss = Examenslehrprobe)<br />
Zielgruppe: Diplom und Magister<br />
Inhalte: Die Veranstaltung baut auf den behin<strong>der</strong>ungsübergreifenden Lehrveranstaltungen des<br />
Studienschwerpunktes und den Lehrveranstaltungen des Grundstudiums auf und stellt gesicherte<br />
Erkenntnisse und bestehende Erfahrungen des Einsatzes von Bewegung, Spiel und Sport im<br />
Rehabilitationssport, in <strong>der</strong> Sporttherapie und im Behin<strong>der</strong>tensport den verschiedenen Phasen <strong>der</strong><br />
Rehabilitation chronisch Kranker gegenüber.<br />
Schwerpunkte:<br />
· Bestimmungsfaktoren und Grundlagen des Erkrankungsgeschehens;<br />
· Bewegung, Sport und Gesundheit, mögliche Zusammenhänge;<br />
· Herzerkrankungen: Stationäre Rehabilitation; ambulante Rehabilitation;<br />
Spezielle Indikationen;<br />
· Periphere, arterielle und venöse Verschlusskrankheiten;<br />
· Bluthochdruck;<br />
· Fettstoffwechselstörungen;<br />
· Diabetes;<br />
· Asthma und Atemwegserkrankungen;<br />
· Immunologische Erkrankungen (Krebs);<br />
· chronische Nierenerkrankungen.<br />
Leistungsnachweis:<br />
- regelmäßige Teilnahme, Klausur<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Unterrichtslehre wird zunächst auf allgemeine Aspekte des Unterrichtens im Sport<br />
eingegangen; es werden Prinzipien erarbeitet und an Beispielen erläutert und präzisiert. Je<strong>der</strong><br />
Studierende stellt seine eigenen Unterrichtsversuche zur Diskussion und wird hierbei von den<br />
Teilnehmern <strong>der</strong> Großen Spezialisierung beraten, die Leitung <strong>der</strong> Diskussion führt <strong>der</strong> Lehrende. Die<br />
Examenslehrprobe wird erst dann absolviert, wenn diese allgemeine Vorstellung in Form einer<br />
solchen Videodokumentation erbracht worden ist.<br />
100
Veranstaltung: Intensitätssteuerung bei Erkrankungen <strong>der</strong> inneren Organe<br />
Lehrkraft: Dr. H.-D. Jahn<br />
Veranstaltungsform: Seminar/Übung<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Theorieseminar mit praxisspezifischen Anteilen im Sinne <strong>der</strong> Eigenrealisation <strong>der</strong> Studierenden,<br />
Pflichtveranstaltung im Rahmen <strong>der</strong> Großen Spezialisierung „Erkrankungen <strong>der</strong> Inneren Organe“. Die<br />
Inhalte dieser Seminarveranstaltung sind Lernvoraussetzungen für die Prüfungsklausur<br />
(Hauptprüfung) im Rahmen <strong>der</strong> Großen Spezialisierung.<br />
Ziele: Unter Berücksichtigung indikationsspezifischer und funktioneller Anfor<strong>der</strong>ungen sollen<br />
biologische und trainingsmethodische Grundlagen und Prinzipien auf differenzierte Ziele und Inhalte<br />
zugeordnet und angewendet werden. Planung <strong>der</strong> Belastung und Erholung in <strong>der</strong> Therapie;<br />
Biologische Grundlagen; trainingsmethodische Grundlagen und Prinzipien; Medikation und<br />
Belastungsgestaltung; Festlegung und Kontrolle <strong>der</strong> Belastungsparameter; Umsetzung <strong>der</strong> Parameter<br />
bei Gehen und Laufen; Belastungsgestaltung und Intensitätssteuerung beim Schwimmen, beim<br />
Radfahren und Skilaufen; Belastungsgestaltung und Intensitätssteuerung in <strong>der</strong> Zweckgymnastik.<br />
Beson<strong>der</strong>heiten: Kräftigen, Dehnen; Belastungsgestaltung und Intensitätssteuerung beim Spielen und<br />
im Spiel; Belastung und Erholung im Stundenverlauf einer ambulanten Herzgruppe (Übungsgruppe,<br />
Trainingsgruppe); Belastung und Erholung im Stundenverlauf einer Asthma-Sportgruppe.<br />
Der Erfolgsnachweis wird erworben durch eine regelmäßige, aktive Teilnahme und Erstellung einer<br />
schriftlichen Semesterarbeit (inkl. Thesenpapier) und nach entsprechendem Vortrag bzw.<br />
Durchführung <strong>der</strong> Praxis mit den Teilnehmern.<br />
Veranstaltung: Maßnahmen <strong>der</strong> Leistungsdiagnostik im Rehabilitationssport, in<br />
<strong>der</strong> Sporttherapie und im Behin<strong>der</strong>tensport (energetischkonditionelle<br />
Funktionen)<br />
Lehrkraft: Dr. L. Schega, J. Pabst<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Veranstaltungsform: Wahlobligatorisches, behin<strong>der</strong>ungsübergreifendes Seminar<br />
Zulassungsbedingungen: Zulassung zum Schwerpunkt<br />
Zielgruppe: Diplom-Hauptstudium (Rehabilitation)<br />
Leistungsnachweis: Regelmäßige und aktive Teilnahme; Seminararbeit mit Thesenpapier<br />
für die Studierenden<br />
Inhalte:<br />
Theoretische Grundlagen <strong>der</strong> Leistungsdiagnostik, Terminologie, Begriffsbestimmungen;<br />
Einweisung in die Gerätetechnik;<br />
Planung und Durchführung einer leistungsdiagnostischen Untersuchung im Grundsatz und am<br />
Beispiel eines speziellen Schadensbildes;<br />
Labordiagnostische Verfahren zur Überprüfung <strong>der</strong> Ausdauerleistungen im Grundsatz und an<br />
einem Beispiel;<br />
Durchführung von Belastungstests im Labor auf dem Fahrra<strong>der</strong>gometer und auf dem Laufband;<br />
Spirometrieeinsatzmöglichkeiten in <strong>der</strong> Sporttherapie (testtheoretische Grundlagen,<br />
Kennzeichnung feld- und labordiagnostischer Parameter, verlaufsdiagnostische Verfahren,<br />
Einsatz in einer Asthmasportgruppe);<br />
Spirometrie in <strong>der</strong> sporttherapeutischen Anwendung im Labor;<br />
Muskelfunktionsdiagnostik in <strong>der</strong> sporttherapeutischen Arbeit (Muskelfunktionstests, Möglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Kraftwertbestimmung, Praxisdemonstrationen);<br />
Isokinetik, Methoden <strong>der</strong> Diagnostik, indikationsspezifischer Einsatz;<br />
Tests im Bereich des Rehabilitationssports (Verfahren zur Bestimmung <strong>der</strong> Herzfrequenz und des<br />
Blutdrucks, Einsatz und Bedeutung <strong>der</strong> manuellen Herzfrequenzmessung, Laktatbestimmungen);<br />
Komplexdiagnostik, Maßnahmen des Sportlehrers und Sporttherapeuten.<br />
101
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Didaktik und Methodik des RSB bei<br />
inneren Erkrankungen und Veranstaltung: Didaktischmethodische<br />
Fragen <strong>der</strong> Praxis im RSB<br />
Lehrkräfte: Dr. Schega, J. Grün<strong>der</strong><br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Zulassungsbedingungen: Zulassung zum Hauptstudium „Reha“<br />
Zielgruppe: Diplom, Magister<br />
Vorgehensweise:<br />
Die kleine Spezialisierung vermitteln einen Überblick zu den sportlichen Möglichkeiten ausgewählter<br />
Behin<strong>der</strong>ungsarten. Die didaktisch-methodischen Veranstaltungen sind jeweils zu ergänzen um die<br />
Veranstaltungen <strong>der</strong> medizinischen Schadenslehre.<br />
Inhalte: Komprimierte Darstellung didaktisch-methodischer Aspekte des Rehabilitationssports, <strong>der</strong><br />
Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports bei chronischen Erkrankungen <strong>der</strong> Inneren Organe.<br />
Das Seminar „Didaktisch-methodische Fragen <strong>der</strong> Praxis des Sports“ bietet angeleitete Hospitationen.<br />
Hinweis:<br />
Im Diplomstudium ist <strong>der</strong> Nachweis eines regulären Studiums durch das Absolvieren eines „Kleinen<br />
Schwerpunktes“ (= Wahlbereich) zu führen. Studierende, welche im Studienschwerpunkt<br />
Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport diesen Kleinen Schwerpunkt durchführen<br />
wollen, müssen hierzu zwei „Kleine Spezialisierungen“ á 4 SWS absolvieren.<br />
Leistungsnachweise:<br />
regelmäßige Teilnahme und Referat / schriftliche Arbeit<br />
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung RSB - Didaktik und Methodik des RSB<br />
bei Geistiger Behin<strong>der</strong>ung und Veranstaltung: Didaktischmethodische<br />
Fragen <strong>der</strong> Praxis im RSB<br />
Kompaktseminar<br />
Lehrkraft: P. Peikert<br />
Veranstaltungsform: Seminare<br />
Zulassungsbedingungen: Zulassung zum Hauptstudium „Reha“<br />
Zielgruppe: Diplom, Magister, Lehramt, För<strong>der</strong>schule<br />
Vorgehensweise:<br />
Die Kleine Spezialisierung vermittelt einen Überblick zu den sportlichen Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
ausgewählten Behin<strong>der</strong>ungsart. Die didaktisch-methodischen Veranstaltungen sind jeweils zu<br />
ergänzen um die Veranstaltungen <strong>der</strong> medizinischen Schadenslehre.<br />
Inhalte: Komprimierte Darstellung didaktisch-methodischer Aspekte des Rehabilitationssports, <strong>der</strong><br />
Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports bei Geistig Behin<strong>der</strong>ten.<br />
Das Seminar „Didaktisch-methodische Fragen <strong>der</strong> Praxis des Sports“ bietet angeleitete Hospitationen.<br />
Hinweis:<br />
Im Diplomstudium ist <strong>der</strong> Nachweis eines regulären Studiums durch das Absolvieren eines „Kleinen<br />
Schwerpunktes“ (= Wahlbereich) zu führen. Studierende, welche im Studienschwerpunkt<br />
Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport diesen Kleinen Schwerpunkt durchführen<br />
wollen, müssen hierzu zwei „Kleine Spezialisierungen“ á 4 SWS absolvieren.<br />
Leistungsnachweise:<br />
regelmäßige Teilnahme und Referat / schriftliche Arbeit<br />
102
Veranstaltung: Didaktik und Methodik des Rollstuhlsports (fakultativ)<br />
Lehrkraft: Diplomsportlehrer K.-H. Kopetz<br />
Veranstaltungsform: Übung<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Hauptstudium<br />
Zielgruppe: alle Studierenden (Diplom, Magister, Lehramt)<br />
Leistungsnachweis: aktive Mitarbeit<br />
Hinweis:<br />
Die Übung ist offen für alle Studierenden vor allem des „Reha-Studienschwerpunktes“. Aus<br />
technischen Gründen können nur maximal 15 Studierende teilnehmen (praxisorientierte<br />
Durchführung). Sie ist wertvoll zur Erfahrung <strong>der</strong> physischen, psychischen und psychosozialen, aber<br />
auch <strong>der</strong> sportlichen Aspekte des Sports <strong>der</strong> Rollstuhlfahrer. Im Vor<strong>der</strong>grund steht die Eigenrealisation<br />
zur sicheren sensomotorischen Beherrschung des Rollstuhls.<br />
Inhalte:<br />
Technische Merkmale des Rollstuhls, Rollstuhltypen,<br />
Verschiedene Fahrtechniken mit dem Rollstuhl,<br />
Kleine Spiele und Sportspiele mit dem Rollstuhl,<br />
Handhabung des Rollstuhls bei verschiedenen Läsionshöhen (Lähmung) und Nutzung <strong>der</strong><br />
Hilfen <strong>der</strong> „Fußgänger“,<br />
Sportliche Disziplinen <strong>der</strong> Rollstuhlfahrer<br />
Veranstaltung: Instituts- und Doktorandenkolloqium/ Graduiertenseminar<br />
Prof. Dr. J. Innenmoser<br />
Donnerstag, 15.30 – 17.00 Uhr, Seminarraum 1a<br />
Themen siehe Aushang<br />
Inhalte: Die Veranstaltung wird im 14-tägigen Wechsel mit dem Graduiertenseminar von ABTW (Prof.<br />
Dr. J. Krug) durchgeführt. Sie bietet Informationen und Lernangebote für Diplomanden und<br />
Wissenschaftler. Alle Kandidaten für eine Graduierung (Diplomarbeiten, Magisterarbeiten,<br />
Dissertationen) sind Vortragende und werden ergänzt um Gastredner aus speziellen<br />
Wissenschaftsbereichen.<br />
103
Veranstaltung: Son<strong>der</strong>pädagogische Aspekte in Rehabilitationssport,<br />
Sporttherapie und Behin<strong>der</strong>tensport<br />
Lehrkraft: PD Dr. Wolfram Sperling<br />
Veranstaltungsform: Vorlesungen/Seminare<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Nachweis <strong>der</strong> abgeschlossenen Lehrveranstaltungen Sportpädagogik<br />
Grundstudium<br />
Zielgruppe: Hauptstudium (Diplom)<br />
Zielstellung: Aufbauend auf den sportpädagogischen Voraussetzungen des Grundstudiums sollen<br />
die Studierenden im Hauptstudium im Diplomstudiengang Rehabilitationssport, Sporttherapie und<br />
Behin<strong>der</strong>tensport vertiefende Einsichten in die erzieherischen Möglichkeiten von Sport, Spiel und<br />
Bewegung bei behin<strong>der</strong>ten und von einer Behin<strong>der</strong>ung bedrohten Menschen in <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
gewinnen<br />
Lehrinhalte:<br />
- Gesellschaftliche und soziale Aspekte von Sport, Spiel und Bewegung bei behin<strong>der</strong>ten und<br />
von einer Behin<strong>der</strong>ung bedrohten Menschen in <strong>der</strong> Gesellschaft und Anfor<strong>der</strong>ungen an<br />
sportpädagogische Handeln<br />
- Erzieherische Aufgabenstellungen bei verschiedenen Zielgruppen im Rehabilitations-,<br />
Behin<strong>der</strong>tensport und in <strong>der</strong> Sporttherapie<br />
- Lernen als Bezugspunkt <strong>der</strong> erzieherischen Bemühungen im Sport und seine Beson<strong>der</strong>heiten<br />
bei behin<strong>der</strong>ten Menschen<br />
Leistungsnachweis:<br />
Seminarschein (B) für regelmäßige Teilnahme und erfolgreiche Erfüllung <strong>der</strong> Aufgabe<br />
Diplomprüfung (Komplexprüfung mit dem LVR Didaktik und Methodik des Rehabilitationssport, <strong>der</strong><br />
Sporttherapie und des Behin<strong>der</strong>tensports)<br />
Literatur:<br />
Größing, St.:<br />
Bewegungserziehung und Sportunterricht mit geistig behin<strong>der</strong>ten Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen. (Handbücher zur<br />
Pädagogik und Didaktik des Sports.) - Limpert Verlag GmbH, Bad Homburg 1981. - 144 S. (1. Auflage)<br />
Erziehung und För<strong>der</strong>ung blin<strong>der</strong> und hochgradig sehbehin<strong>der</strong>ter Kin<strong>der</strong> im Vorschulalter: Erziehungsziele,<br />
son<strong>der</strong>pädagogische Maßnahmen, praktische Anregungen. - Staatsinstitut für Schulpädagogik, Abt.<br />
Son<strong>der</strong>schulen. - München 1989. - 190<br />
S.Guttman, L.:Sport für Körperbehin<strong>der</strong>te. - Urban & Schwarzberg. München - Wien - Baltimore 1979. - 180<br />
Kosel, H.: Behin<strong>der</strong>tensport. Körper- und Sinnesbehin<strong>der</strong>te. - Pflaum Verlag: München 1981<br />
Lehrplan und Materialien für den Unterricht in <strong>der</strong> Schule für geistig Behin<strong>der</strong>te mit Abdruck <strong>der</strong> Allgemeinen<br />
Richtlinien. - Staatsinstitut für Schulpädagogik, Abt. Son<strong>der</strong>schulen. - München 1989. - 352 S.<br />
Rie<strong>der</strong>, H.; Huber, G.; Werk, J.: Sport mit Son<strong>der</strong>gruppen - Ein Handbuch.<br />
In: Beiträge für Lehre und Forschung. - Bd. 108 - Schorndorf 1996<br />
Sandfoß, C.: Die Auswirkungen sportmotorischer För<strong>der</strong>ung auf geistig behin<strong>der</strong>te Schüler. - Carl Marhold<br />
Verlagsbuchhandlung Berlin 1983. - 273 S.<br />
Scheid, V. (Hrsg.): Facetten des Sports behin<strong>der</strong>ter Menschen –Pädagogische und didaktische Grundlagen. –<br />
Meyer & Meyer Verlag, Aachen 2002. –316 S.<br />
Stuffer, G.: Handreichungen für Unterricht in <strong>der</strong> Schule für Geistigbehin<strong>der</strong>te. - München: Staatsinstitut für<br />
Schulpädagogik 1983. - 58 S.<br />
1<strong>04</strong>
Veranstaltung: Aspekte <strong>der</strong> Soziologie in <strong>der</strong> Rehabilitation<br />
Lehrkraft: Dr. Petra Tzschoppe<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung<br />
Stundenumfang: 1 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss GRUNDLAGEN DER SPORTSOZIOLOGIE<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM (Diplom, Studienrichtung B und Magister)<br />
Leistungsnachweis: wird erteilt für die abschließende Klausur.<br />
Inhalte:<br />
Einführung in die Sozialmedizin<br />
Historische Entwicklung<br />
Verhältnis zur Soziologie<br />
Begriffe und Methoden <strong>der</strong> Sozialepidemiologie<br />
Sozialisation und Gesundheit<br />
Soziale Ungleichheiten <strong>der</strong> Bevölkerung und gesundheitliche Lebenschancen<br />
Soziale Aspekte in <strong>der</strong> Rehabilitation<br />
Einstellung und Verhalten zu Behin<strong>der</strong>ung und Behin<strong>der</strong>ten in verschiedenen Kulturen<br />
Verhaltensmuster gegenüber Behin<strong>der</strong>ten im historischen Verlauf<br />
Zur sozialen Situation Behin<strong>der</strong>ter in <strong>der</strong> Gegenwart unter beson<strong>der</strong>er Betrachtung<br />
sozialökonomischer, sozialrechtlicher und integrativer Fragen<br />
Soziale Determinanten des Drogengebrauchs<br />
Sozialepidemiologie<br />
Soziale Ursachen und Folgen<br />
Spezielle Literaturhinweise werden zu je<strong>der</strong> Vorlesung gegeben.<br />
105
Veranstaltung: Spezielle Probleme <strong>der</strong> Soziologie im RSB<br />
Lehrkraft: Dr. Petra Tzschoppe<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang: 1 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss GRUNDLAGEN DER SPORTSOZIOLOGIE<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM (Diplom, Studienrichtung A, Schwerpunkt RSBS)<br />
Leistungsnachweis: wird erteilt für<br />
a) regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und<br />
b) abschließende Klausur (überdurchschnittliche Seminarleistungen in Verbindung mit einem Referat<br />
können statt dessen ebenfalls Anerkennung finden)<br />
Inhalt:<br />
Vermittlung spezieller theoretischer Kenntnisse zu ausgewählten soziologischen Problemen<br />
Darstellung und Diskussion von Ergebnissen sportsoziologischer Forschung<br />
Seminarthemen:<br />
Sport und Gesundheit<br />
Gesundheitsvorstellungen und Sport im gesellschaftlichen Wandel<br />
Zur gesundheitlichen Funktion des Sports<br />
Sport im Alter und seine Bedeutung für die soziale Situation<br />
Bevölkerungssoziologie und demographische Alterung<br />
Soziale Rollen im Alter<br />
Freizeitverhalten und Sport im Alter<br />
Sport und Integration-<br />
Zu Möglichkeiten und Grenzen <strong>der</strong> Integrationsfunktion des Sports<br />
Möglichkeiten und Grenzen des Sports zur Integration Behin<strong>der</strong>ter<br />
Behin<strong>der</strong>tensport aus Sicht <strong>der</strong> Medien<br />
Soziale Möglichkeiten des Sports in <strong>der</strong> Prävention und Therapie von Suchterkrankungen<br />
Berufsfeld Sport - Berufschancen und Einsatzmöglichkeiten in Therapie und Rehabilitation<br />
Literatur:<br />
Eine ausführliche Themen- und Literaturübersicht erhalten die TeilnehmerInnen im ersten Seminar.<br />
106
STUDIENSCHWERPUNKT:<br />
SPORTMANAGEMENT (SPMA)<br />
Veranstaltung: Sportmarketing<br />
Lehrkraft: Dr. Frank Kutschke<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung und Seminar im Wechsel<br />
Zulassungsbedingungen: Nachweis im Lehrgebiet Sportrecht / -verwaltung<br />
Zielgruppe: Hauptstudium (Diplom GSP und KSP, Magister im<br />
„Übergreifenden Themenfeld Sportmanagement“)<br />
Inhalt:<br />
- Grundkonzepte des Allgemeinen Marketing, des Dienstleistungsmarketing und des<br />
Sportmarketing<br />
- Beson<strong>der</strong>heiten des Sportmarketing und des „Produktes“ Sport<br />
- Der Sportmarkt – Angebote und Nachfrage<br />
- Sportmarketing - Management und Sportmarketing - Managementprozess<br />
- Analyse des Makro- und Mikroumfeldes im Sport<br />
- Der Kaufprozess und das Käuferverhalten auf dem Sportmarkt<br />
- Die strategische Diagnose zur Ermittlung von Marktsegmenten und <strong>der</strong> Auswahl von Zielmärkten<br />
im Sport<br />
- Marketingstrategien und Anwendung im Bereich des Sports<br />
- Taktisches Marketing und Marketinginstrumente im Sport<br />
- Marketingkontrolle<br />
- Marketingkonzepte im Sport<br />
Leistungsnachweis:<br />
2 Leistungskontrollen im Verlauf des Semesters<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Kotler, P.; Bliemel, F.: Marketing-Management.<br />
Kotler, P.: Grundlagen des Marketing<br />
Freyer, W.: Handbuch des Sportmarketing.<br />
Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre.<br />
Meffert, H.; Bruhn, M.: Dienstleistungsmarketing<br />
107
Veranstaltung: Organisationslehre/Vereinsmanagement<br />
Lehrkraft: Dr. Frank Kutschke<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung und Seminar im Wechsel<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Nachweis im Lehrgebiet Sportrecht/-verwaltung<br />
Zielgruppe: Hauptstudium (Diplom GSP und KSP, Magister im<br />
„Übergreifenden Themenfeld Sportmanagement“)<br />
Inhalte:<br />
Grundlagen des Management und <strong>der</strong> Organisationslehre<br />
- Traditionelle und mo<strong>der</strong>ne Ansätze des Managementwissens<br />
I. Prinzipien, Gestaltung und Ergebnisse <strong>der</strong> Aufbauorganisation im Bereich des Sports,<br />
speziell in den Sportvereinen<br />
- Analyse- und Synthesekonzept zur aufbauorganisatorischen Gestaltung<br />
- Organisations- und Führungsmodelle im Sport<br />
- Ehrenamtliche Führung und hauptamtliche Verwaltung im Sport<br />
II. Institutionale und funktionale Gestaltung des Management in Sportvereinen und<br />
Sportunternehmen<br />
- Stellung und Aufgaben von Vorständen<br />
- Rechtsprobleme im Sportverein und Sportverband<br />
- Satzungsbestimmungen, Mehrheiten im Vereinsrecht, Vertragsgestaltung im Sportverein<br />
- Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftlicher Betätigung gemeinnütziger Sportvereine<br />
- Die Besteuerung gemeinnütziger Sportvereine und Sportverbände<br />
- Bestimmungen <strong>der</strong> Abgabenordnung<br />
- Tätigkeitsbereiche des Sportvereins<br />
- Kassen- und Buchführung im Sportverein<br />
- Rechtsformen privatwirtschaftlicher Sporteinrichtungen<br />
- Unternehmensgründung privatwirtschaftlicher Sporteinrichtungen<br />
- Investitionen, Investitionsplanung und Rentabilität privatwirtschaftlicher Sportunternehmen<br />
-<br />
VI. Exkursion zu ausgewählten Organisationen des Sports<br />
Leistungsnachweis:<br />
a) 2 Leistungskontrollen im Verlauf des Semesters<br />
b) Teilnahme an <strong>der</strong> Exkursion<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Bürgerliches Gesetzbuch.<br />
Neufang; Geckle: Der Verein; Organisations- und Musterhandbuch für die Vereinsführung.<br />
Stähle: Management.<br />
Strutz, H.: Rechtsfibel für Vereine.<br />
Trosien, G.: Die Sportbranche.<br />
Ulrich, E.: Freizeit und Rendite.<br />
Wagner, S.: Der Vereinsmanager<br />
Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre<br />
Horch u.a. (Hrsg.): Professionalisierung im Sportmanagement<br />
108
Veranstaltung: Forschungsmethodik II/Projektarbeit Sportmanagement<br />
Zeitraum: Beginn im <strong>Wintersemester</strong> und Fortführung im Sommersemester<br />
Lehrkraft: Dr. Frank Kutschke<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung/Seminare für Forschungsmethodik II; Seminare und<br />
Konsultationen für Projektarbeit<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss im Lehrgebiet Sportrecht/-verwaltung sowie<br />
Forschungsmethodik I.<br />
Zielgruppe: Hauptstudium (Diplom GSP Sportmanagement; Magister<br />
im„Übergreifenden Themenfeld Sportmanagement“)<br />
Im WS 15 Std. (1 SWS) Forschungsmethodik II (Marktforschungsmethoden) und<br />
15 Std. (1 SWS) Projektarbeit.<br />
Die Fortsetzung von Forschungsmethodik II und Projektarbeit erfolgt im SS mit 2 SWS.<br />
Inhalte Forschungsmethodik II im WS:<br />
- Ziele und Aufgaben <strong>der</strong> Marktforschung (am Beispiel des Sportmarktes)<br />
- Die methodische Gestaltung des Marktforschungsprozesses<br />
- Techniken zur Problemerkennung und Problemlösung<br />
- Datenerhebung in <strong>der</strong> Primärforschung<br />
- Messtheoretische Grundlagen empirischer Marktforschung<br />
- Gütekriterien<br />
Inhalte Forschungsmethodik II im SS:<br />
- Erhebungsmethoden <strong>der</strong> Primärforschung<br />
- Die Befragung<br />
- Die Beobachtung<br />
- Das Experiment in <strong>der</strong> Marktforschung<br />
- Verfahren <strong>der</strong> Datenauswertung und Orientierungen für Dateninterpretationen<br />
Projektarbeit / Projekte:<br />
Projekteinsatzgebiete werden zu Beginn des WS vorgestellt.<br />
Leistungsnachweis:<br />
a) Leistungskontrolle im Lehrgebiet Forschungsmethodik am Ende des SS<br />
b) Bewertung <strong>der</strong> Projektbearbeitung und <strong>der</strong> abzugebenden Projektdokumentation<br />
c) Projektpräsentation<br />
Grundlagenliteratur Forschungsmethodik II:<br />
Berekoven, L.; Eckert, W.; Ellenrie<strong>der</strong>, P.: Marktforschung (Methodische Grundlagen und praktische<br />
Anwendung). –2001.<br />
Kotler. P.: Grundlagen des Marketing. - 1999<br />
Meffert, H.; Bruhn, M.: Dienstleistungsmarketing. - 1997<br />
109
7. Semester<br />
Veranstaltung: Führungslehre und Personalwesen im Sport<br />
Lehrkraft: Dr. Frank Kutschke<br />
Veranstaltungsform: Vorlesung<br />
Zulassungsbedingungen: Nachweise in den Lehrgebieten Sportrecht/-verwaltung,<br />
Vereinsmanagement und Sportmarketing.<br />
Zielgruppe: Hauptstudium (Diplom 7. Semester GSP und KSP Sportmanagement,<br />
Magister im "„Übergreifenden Themenfeld Sportmanagement“)<br />
Inhalt:<br />
- Wissenschaftliche Aussagen, Bedeutungsvarianten und Auffassungen zur Managementlehre und<br />
Ebenen des organisatorischen Handelns und Verhaltens<br />
- Wissenschaftliche Aussagen zum Verhalten von Individuen und Ableitungen für das im Führungsund<br />
Verwaltungsbereich des Sports tätige Personal<br />
- Verhalten von Individuen in Organisationen<br />
- Anspruchsniveau, Werte, Einstellungen und Qualifikation von Individuen in Organisationen<br />
- Person und Situation in Sportorganisationen<br />
- Diskrepanzen zwischen Person und Situation<br />
- Verhalten von Gruppen in Organisationen<br />
- Bedingungen erfolgreicher Gruppenarbeit<br />
- Gruppeneffektivität und Gruppenkonflikte<br />
- Prozesse in Gruppen (Kommunikation, Interaktion, Führung, Konflikte, Macht)<br />
- Aufgaben des Personalwesens im Sport und Arbeit mit dem Personal<br />
- Anfor<strong>der</strong>ungen an Sportmanager und das Personal<br />
- Stellenplanung und Besetzung (Bewerbung, Einstellung und Bewertung von Personal im Bereich<br />
des Sports)<br />
- Formale und inhaltliche Gestaltung von Arbeitsverträgen und Personalunterlagen<br />
Leistungsnachweis:<br />
2 Leistungskontrollen im Verlaufe des Semesters<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Bea,F. X.; Dichtl, E.; Schweitzer, M.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Bd. 2. –1991.<br />
- Neufang; Gecke: Der Verein. Organisations- und Musterhandbuch für die Vereinsführung<br />
- Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. - 2000.<br />
- Chaet, M.: Sportstudio Management. -1996.<br />
- Führungs- und Verwaltungsakademie des DSB: Managementprofil für VereinsgeschäftsführerInnen. -1996.<br />
- Schminke, M.: Sportrecht. -1996.<br />
- Staehle, H.: Management; Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. - 1991.<br />
110
Veranstaltung: Spezielle Probleme <strong>der</strong> Sportsoziologie im SPMA<br />
Lehrkraft: Dr. Petra Tzschoppe<br />
Veranstaltungsform: Seminar<br />
Stundenumfang: 2 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Abschluss GRUNDLAGEN DER SPORTSOZIOLOGIE<br />
Zielgruppe: HAUPTSTUDIUM (Diplom, Studienrichtung B und Magister)<br />
Leistungsnachweis: wird erteilt für<br />
a) regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen,<br />
b) Referat mit Diskussionsleitung,<br />
c) abschließende Klausur.<br />
Inhalt:<br />
Vermittlung spezieller theoretischer Kenntnisse zu ausgewählten soziologischen Problemen<br />
Darstellung und Diskussion von Ergebnissen sportsoziologischer Forschung<br />
Seminarthemen:<br />
Entwicklungstendenzen <strong>der</strong> Freizeit und des Freizeitverhaltens<br />
- Ausdifferenzierung des Sports in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Gesellschaft<br />
- Sport in <strong>der</strong> Freizeit - Motive und Erscheinungsformen<br />
- Soziodemographische Gruppen im Freizeitsport<br />
Zum Verhältnis von Sport und Gesellschaft<br />
- Soziale Funktionen des Sports<br />
- Wechselwirkungen zwischen Sport und an<strong>der</strong>en Subsystemen <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
- Zur politischen Funktion des Sports<br />
Tendenzen und Grenzen im Leistungssport<br />
- Leistungssport und gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
-<br />
Soziales Handeln im Leistungssport<br />
- Soziale Rollen und Rollenkonflikte im Sport<br />
Organisationen im Sport<br />
- Organisationen als Gegenstand <strong>der</strong> Soziologie<br />
- Das IOC<br />
- Vereine und Verbände im DSB<br />
Sport und Tourismus<br />
- Tendenzen <strong>der</strong> Tourismusentwicklung<br />
- Sport im Urlaub<br />
Berufsfeld Sport<br />
- Sport als Beruf<br />
- Berufschancen und Einsatzmöglichkeiten im Sportmanagement<br />
Eine ausführliche Themen- und Literaturübersicht erhalten die Teilnehmer im ersten Seminar.<br />
111
WASSERFAHRSPORT<br />
GRUNDSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Grundlagen Wasserfahrsport<br />
Lehrkräfte: Dr. K.-H. Schmidt (Kanu/Surfen)<br />
Dr. H.-U. Schmidt (Ru<strong>der</strong>n)<br />
Veranstaltungsform: Seminare/Übungen/Lehrgang<br />
Stundenumfang: 4 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: keine<br />
Zielgruppe: Studierende aller Studienrichtungen/GRUNDSTUDIUM<br />
Leistungsnachweis:<br />
- Theorie: Klausur<br />
- Praxis: Demonstrationsfähigkeit - Ru<strong>der</strong>technik<br />
- Grundtechniken Kanu<br />
- Techniken <strong>der</strong> Grundschule Surfen<br />
Leistungsüberprüfung - Zeitfahren über 500 m<br />
- Zeitfahren über 1000 m<br />
Inhalte:<br />
Teil Ru<strong>der</strong>n<br />
praktische, theoretische, didaktisch-methodische Grundlagen <strong>der</strong> Ru<strong>der</strong>technik<br />
Teil Kanu/Surfen<br />
praktische, theoretische, didaktisch-methodische Grundlagen <strong>der</strong> Techniken:<br />
Geradeausfahrtechnik, Rundschlag vorwärts, Rundschlag rückwärts und Zugschlag im Kajak;<br />
Schotstart, Steuern, Wende und Halse mit dem Surfbrett<br />
Sportarten<br />
Kanu/ Surfen 44 (Unterrichtsstunden)<br />
Ru<strong>der</strong>n 20 (Unterrichtsstunden)<br />
Ausbildungsablaufplan<br />
Studienbegleitend<br />
SS <strong>2003</strong><br />
Teil Ru<strong>der</strong>n<br />
Lehrgänge<br />
SS <strong>2003</strong><br />
Teil Kanu/Surfen<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Ru<strong>der</strong>n<br />
° HERBERGER, E.: Ru<strong>der</strong>n. Berlin 1977<br />
° Studienmaterial Ru<strong>der</strong>sport. Leipzig 2001<br />
Kanu/Surfen<br />
FARKE; MÖHLE; SCHRÖDER (1992): Ich lerne Surfen. Delius Klasing Verlag. Bielefeld<br />
FARKE; MÖHLE; SCHRÖDER (1992): Ich lerne besser Surfen. Delius Klasing Verlag. Bielefeld<br />
SCHMIDT, K.-H. (2000): Studienmaterial Kanusport. Leipzig<br />
VDWS (2000): Windsurfen für Einsteiger. Einsteigerheft Surfen. Neu bearb. Auflage.<br />
° Home Wasserfahrsport: - URL: http://sportfak.uni-leipzig.de/~fg-wasserfahrsport/<br />
Video:<br />
Kanu/Surfen Ru<strong>der</strong>n<br />
Windsurfen für Einsteiger ° Grundausbildung Ru<strong>der</strong>n. Leipzig 1992<br />
112
HAUPTSTUDIUM<br />
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Kanu/Teil 1<br />
Lehrkräfte: Dr. K.-H. Schmidt<br />
Veranstaltungsform: Seminare, Übungen<br />
Stundenumfang: 5 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Erfolgreicher Abschluss <strong>der</strong> Grundausbildung Wasserfahrsport<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium ab 5. Semester<br />
Leistungsnachweis: Theorie: Klausur<br />
Praxis: Überprüfung <strong>der</strong> Demonstrationsfähigkeit<br />
(Grundtechniken; Kanuslalom; Kanupolo, Kenterrolle)<br />
Inhalte:<br />
- Übungs- und Trainingsformen zur Vervollkommnung <strong>der</strong> Grundtechniken<br />
- Spiel- und Übungsformen zur Erlernung <strong>der</strong> Kenterrolle<br />
- Übungs- und Trainingsformen zur Entwicklung <strong>der</strong> sportlichen Technik im Kanuslalom<br />
- Spiel-, Übungs- und grundlegende Trainingsformen zur Entwicklung <strong>der</strong> Spielfähigkeit im<br />
Kanupolo<br />
- Theorie Themenkomplex – LF Technik/Technikentwicklung/Anfängerausbildung<br />
- Theorie Themenkomplex – Leistungsstruktur Kampfsport<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Lenz, J.: Leistungs- und Trainingslehre Kanusport. Landes-Kanu-Verband Sachsen-Anhalt e. V., 1994<br />
- Schmidt, K.-H.: Techniktraining im Kanurennsport. Schriftenreihe des DKV, Bd. 9, 1. Aufl., Duisburg 1992<br />
- Gerlach, J.: Der Kajak – das Lehrbuch des Kanusports. Herford: Busse und Seewaldverlag 1996.<br />
- Bauer, A.: Handbuch für Kanusport. Aachen: Meyer & Meyer Verlag 1997<br />
Veranstaltung: Kleine Spezialisierung Ru<strong>der</strong>n/Teil 1<br />
Lehrkräfte: Dr. H.-U. Schmidt<br />
Veranstaltungsform: Seminare/Lehrmethodische Übungen<br />
Stundenumfang: 4 SWS<br />
Zulassungsbedingungen: Erfolgreicher Abschluss <strong>der</strong> Grundausbildung Ru<strong>der</strong>n<br />
(Wasserfahrsport)<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium, ab 5. Semester<br />
Leistungsnachweis: - Techniküberprüfung im Kleinboot<br />
- Lehrprobe<br />
- Abschlussklausur<br />
Inhalte:<br />
- Materialkunde und Trimmen<br />
- Ru<strong>der</strong>technik<br />
- Lehrweise und Fehlerkorrektur im Ru<strong>der</strong>n<br />
- Trainingsmethodik im Ru<strong>der</strong>n<br />
- Wan<strong>der</strong>ru<strong>der</strong>n/Ru<strong>der</strong>n und Umwelt<br />
- Steuermannausbildung<br />
- Skullen im Mannschaftsboot, im Übungseiner und im Renneiner<br />
- Erlernen des Riemenru<strong>der</strong>ns<br />
Grundlagenliteratur:<br />
- Körner, T.; Schwanitz, P.: Ru<strong>der</strong>n. Berlin 1987<br />
- Herberger, E. (Hrsg.): Ru<strong>der</strong>n. Berlin 1977<br />
- Fritsch, W.: Handbuch für den Ru<strong>der</strong>sport. Aachen 1988<br />
- Fritsch, W.: Handbuch für das Rennru<strong>der</strong>n. Aachen 1990<br />
113