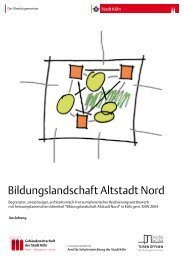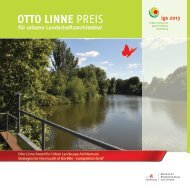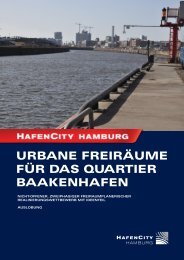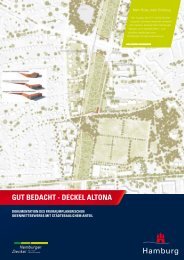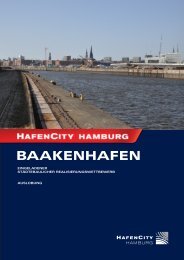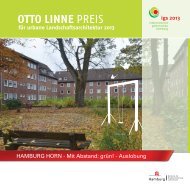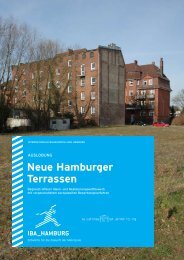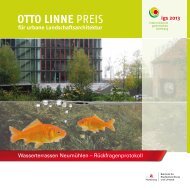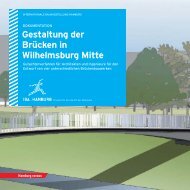Justus-Liebig-Universität Gießen Universitätscampus ... - luchterhandt
Justus-Liebig-Universität Gießen Universitätscampus ... - luchterhandt
Justus-Liebig-Universität Gießen Universitätscampus ... - luchterhandt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong><br />
<strong>Universität</strong>scampus Philosophikum<br />
Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 27.-28. Oktober 2011<br />
h b m<br />
Hessisches Baumanagement
2<br />
Auslober<br />
Land Hessen<br />
vertreten durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden,<br />
vertreten durch Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann<br />
vertreten durch die <strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong><br />
vertreten durch den Präsidenten Herrn Prof. Dr. Joybrato Mukherjee<br />
vertreten durch das Hessische Baumanagement, Regionalniederlassung Mitte,<br />
vertreten durch Herrn Friedhelm Dorndorf<br />
in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen, Wiesbaden<br />
vertreten durch Herrn Staatsminister Dr. Thomas Schäfer<br />
Wettbewerbsbetreuung<br />
büro <strong>luchterhandt</strong><br />
stadtplanung.stadtforschung.stadtreisen<br />
Wrangelstraße 18<br />
20253 Hamburg<br />
T. +49-40-707080-70<br />
F. +49-40-707080-780<br />
buero@<strong>luchterhandt</strong>.de<br />
www.<strong>luchterhandt</strong>.de<br />
Daniel Luchterhandt, Renée Tribble, David Senger<br />
Hamburg, im November 2011
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb „<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong> Campus Philosophikum“<br />
PRotokoLL deR PReiSGeRiChtSSitzUnG<br />
vom 27.-28.10.11<br />
Am 27. Oktober 2011 tritt um 10:30 Uhr das Preisgericht<br />
für den städtebaulichen Realisierungswettbewerb<br />
„Campus Philosophikum“ im Audimax, Phil.<br />
II (Haus A), der <strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong> in<br />
35390 <strong>Gießen</strong> zusammen.<br />
Herr Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Präsident der<br />
<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong>, begrüßt die Anwesenden.<br />
Vom städtebauliche Wettbewerb „Campus<br />
Philosophikum“ erwartet er ein gutes Ergebnis, das<br />
nicht nur der <strong>Universität</strong> sondern darüber hinaus einem<br />
ganzen Stadtteil ein neues Gesicht geben soll.<br />
Dabei ist die enge Zusammenarbeit der <strong>Universität</strong>sstadt<br />
<strong>Gießen</strong> und der <strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> von<br />
besonderer Bedeutung, da die <strong>Universität</strong> und Stadt<br />
räumlich eng miteinander verflochten sind und mit<br />
einem guten Wettbewerbsergebnis die Chance zur<br />
Stärkung dieser historisch gewachsenen Verbindung<br />
besteht.<br />
Den Grußworten des Präsidenten schließt sich Frau<br />
Irene Bauerfeind-Roßmann, Hessisches Ministerium<br />
für Wissenschaft und Kunst, an. Der städtebauliche<br />
Realisierungswettbewerb im Rahmen des HEUREKA<br />
Programms für den Campus Kultur- und Geisteswissenschaften<br />
der <strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> verfolge<br />
die strategisch bauliche Entwicklungsplanung, die<br />
sich aus den Zielen der Consilium Campusentwicklung<br />
<strong>Gießen</strong> zur Herausbildung der Präsenz,<br />
Sichtbarkeit und Vernetzung von konzentrierten<br />
Campusbereichen im Stadtbild herleite. Sie freut<br />
sich, dass mit dem Wettbewerb – nach den Naturwissenschaften<br />
– ein weiterer Schritt zur Entwicklung<br />
eines wesentlichen Standbeins der JLU <strong>Gießen</strong> unternommen<br />
werden kann. Mit dem Wettbewerb werde<br />
an diesem wichtigen Standort die Grundlage für<br />
die städtebauliche Entwicklung und die zukünftigen<br />
Investitionen des Landes Hessens geschaffen. Das<br />
Ministerium erwarte einen Impuls für die synergetische<br />
Entwicklung des Standorts in einer Stadt mit<br />
der höchsten Studierendenrate in Deutschland.<br />
Anschließend richtet Frau Dietlind Grabe-Bolz, Oberbürgermeisterin<br />
der <strong>Universität</strong>sstadt <strong>Gießen</strong>, ihre<br />
Grußworte an die Anwesenden. In diesem Wettbewerb<br />
zeige sich ein neuer Geist in der Zusammenarbeit:<br />
Sie wolle dazu beitragen, dass <strong>Universität</strong> und<br />
Stadt mit dem zu prämierenden Konzept weiter zusammenwachsen.<br />
Sie hoffe auf ein gutes Ergebnis,<br />
welches die Entwicklung der Stadt und der <strong>Universität</strong><br />
voranbringen könne.<br />
Frau Irene Bauerfeind-Roßmann übergibt nach den<br />
Grußworten das Wort an Herrn Daniel Luchterhandt<br />
als Verfahrensbetreuer.<br />
1. Anwesenheit und konstituierung<br />
des Preisgerichts<br />
Um 10:45 Uhr prüft Herr Luchterhandt die Anwesenheit<br />
und Beschlussfähigkeit des Preisgerichts. Aus<br />
dem Kreis der Preisrichter/-innen fehlen entschuldigt<br />
folgende Personen:<br />
Preisrichter/-innen<br />
• Marion Hammer-Frommann,<br />
Hessisches Ministerium der Finanzen,<br />
Wiesbaden<br />
• Thomas Platte, Hessisches Baumanagement,<br />
Frankfurt am Main<br />
Stellvertretende (Fach-) Preisrichterin:<br />
• Erika Ernst, Hessisches Ministerium für<br />
Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden<br />
Damit ergibt sich folgende Zusammensetzung des<br />
Preisgerichts:<br />
Preisrichter/-innen<br />
• Prof. Dr. Franz Pesch, Freier Stadtplaner,<br />
Stuttgart/Herdecke<br />
• Prof. Dr. Michael Koch, Freier Architekt/Stadtplaner,<br />
Hamburg/Zürich<br />
• Prof. Zvonko Turkali‚ Freier Architekt, Frankfurt<br />
am Main/Hannover<br />
• Martin Rein-Cano, Freier Landschaftsarchitekt,<br />
Berlin<br />
• Inge Laste, Hessisches Ministerium der<br />
Finanzen, Wiesbaden<br />
• Guido Brennert, Hessisches Ministerium der<br />
Finanzen, Wiesbaden<br />
• Irene Bauerfeind-Roßmann, Hessisches Ministerium<br />
für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden<br />
• Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Präsident der<br />
<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong><br />
• Prof. Dr. Markus Knauff, <strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong><br />
<strong>Gießen</strong><br />
• Ulrike Berendsen-Manderscheid, Hessisches<br />
Baumanagement, Frankfurt am Main<br />
• Dietlind Grabe-Bolz, Oberbürgermeisterin der<br />
<strong>Universität</strong>sstadt <strong>Gießen</strong><br />
3
4<br />
Protokoll der Preisgerichtssitzung<br />
Stellvertreter Preisgericht<br />
• Em. Prof. Michael Wilkens, Freier Architekt/<br />
Stadtplaner, Kassel<br />
• Juliane Schonauer, Freie Stadtplanerin, Berlin<br />
• Patrick Ostrop, Freier Architekt, Hamburg<br />
• Burkhard Wegener, Freier Landschaftsarchitekt,<br />
Köln<br />
• Monika Bader, Hessisches Ministerium der<br />
Finanzen, Wiesbaden<br />
• Manfred Balg, Hessisches Ministerium für<br />
Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden<br />
• Dr. Michael Breitbach, Kanzler der<br />
<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong><br />
• Prof. Dr. Henning Lobin,<br />
<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong><br />
• Gerda Weigel-Greilich, Bürgermeisterin der<br />
<strong>Universität</strong>sstadt <strong>Gießen</strong><br />
Darüber hinaus sind folgende Sachverständige<br />
anwesend:<br />
• Friedhelm Dorndorf, Hessisches Baumanagement,<br />
<strong>Gießen</strong><br />
• Peter Eichler, Hessisches Baumanagement,<br />
Frankfurt/Main<br />
• Sonja Bergau, Hessisches Baumanagement,<br />
<strong>Gießen</strong><br />
• Marion Kern, Hessisches Baumanagement,<br />
<strong>Gießen</strong><br />
• Katherina Hannemann, JLU, Dezernentin Liegenschaften,<br />
Bau und Technik<br />
• Hans-Jürgen Weiser, JLU, Abteilungsleiter Bau<br />
und Technik<br />
• Rolf Balser, JLU, Abteilungsleiter Liegenschaften<br />
• Ivonne Althen, JLU, Projekt HEUREKA<br />
• Guido Eisfeller, JLU, Projektleiter HEUREKA<br />
• Dr. Markus Labasch, JLU, Stab Planung und<br />
Controlling<br />
• Christian Treppesch, JLU, Stab Lehre, Studium,<br />
Weiterbildung, Qualitätssicherung<br />
• Dr. Peter Reuter, JLU, Direktor der <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
• Martin Hormel, Studentenwerk <strong>Gießen</strong>, Leiter<br />
Facility Management<br />
• Jan Fleischauer, JLU, Mobilität Radverkehr und<br />
FB 07 - Didaktik der Physik<br />
• Marion Oberschelp, JLU, Frauenbeauftragte<br />
• Liane Krieger, JLU, Schwerbehinderten<br />
Vertretung<br />
• Ulrike Wittmann, JLU, Schwerbehinderten<br />
Vertretung<br />
• Magdalena Kaim, JLU, Zentrale Studienberatung<br />
- Behindeterte, Chronisch Kranke<br />
• Michaela Müller, JLU, Queer-Feministischen<br />
Frauenreferat & Schwulen-Trans*-Queer-Referat<br />
• Prof. Dr. Hartmut Topp, Planungsbüro R+T,<br />
Darmstadt<br />
• Hans Dettling, Leiter Stadtplanungsamt, <strong>Universität</strong>sstadt<br />
<strong>Gießen</strong><br />
• Petra Cremer, Stadtplanungsamt, <strong>Universität</strong>sstadt<br />
<strong>Gießen</strong><br />
• Dr. Alexander Fischer, HWP, Stuttgart<br />
Nutzervertreter/-innen Campus‘ Philosophikum<br />
• Dr. G. A. Rackelmann, Fb 03 – Institut für Soziologie<br />
• Martin Gärtner, JLU, FB 03 - Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik<br />
• Dr. Thomas Kailer, JLU, FB 04 - Institut für<br />
Evangelische Theologie<br />
• Björn Mehlig, JLU, FB 05 - Institut für Angewandte<br />
Theaterwissenschaft<br />
• Prof. Dr. Rudolf Stark, JLU, FB 06 - Psychologie<br />
• Dr. Martin Zierold, JLU, GCSC - International<br />
Graduate Centre for the Study of Culture<br />
• Ann van de Veire, JLU, GCSC - International<br />
Graduate Centre for the Study of Culture<br />
• Katarzyna Wisniewieka-Brückner, JLU, GiZO -<br />
<strong>Gießen</strong>er Zentrum Östliches Europa<br />
• Petra Bröckmann, JLU, ZfbK - Zentrum für<br />
fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen<br />
• Jens Blank, JLU, ZfbK - Zentrum für fremdsprachliche<br />
und berufsfeldorientierte Kompetenzen<br />
• Kirsten Schmidt, JLU, Akad. Prüfungsamt Geisteswissenschaften<br />
Vom wettbewerbsbetreuenden Büro sind anwesend:<br />
• Daniel Luchterhandt, Renée Tribble,<br />
Hella Kotschi, Mareike Breimhorst<br />
Darüber hinaus werden einstimmig zwei Gäste zur<br />
Preisgerichtssitzung zugelassen.<br />
• Jonas Kurtscheidt<br />
• Thomas Webler
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb „<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong> Campus Philosophikum“<br />
Frau Bauerfeind-Roßmann schlägt vor, dass aus<br />
dem Kreis der (Fach-) Preisrichter-/innen ein Vorschlag<br />
für den Vorsitz unterbreitet wird. Herr Prof.<br />
Turkali schlägt als Vorsitzenden der Sitzung Herrn<br />
Prof. Dr. Franz Pesch vor. Herr Pesch wird einstimmig<br />
bei einer Enthaltung zum Vorsitzenden gewählt.<br />
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und bedankt<br />
sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.<br />
Der Vorsitzende lässt sich von allen Anwesenden<br />
versichern, dass sie außerhalb vom Kolloquium<br />
• keinen Meinungsaustausch mit<br />
Wettbewerbsteilnehmern über die<br />
Wettbewerbsaufgabe und deren Lösung geführt<br />
haben und während der Dauer des Preisgerichts<br />
nicht führen werden,<br />
• bis zum Preisgericht keine Kenntnis der Wettbewerbsarbeiten<br />
erhalten haben, sofern sie nicht<br />
an der Vorprüfung mitgewirkt haben,<br />
• die vertrauliche Behandlung der Beratung<br />
gewährleistet wird,<br />
• die Anonymität aller Arbeiten gewahrt ist und<br />
• es unterlassen wird, Vermutungen über den<br />
Verfasser einer Arbeit zu äußern.<br />
Der Vorsitzende bittet anschließend das Büro Luchterhandt<br />
um den Bericht der Vorprüfung und um die<br />
Vorstellung der Arbeiten im Informationsrundgang.<br />
2. Bericht der vorprüfung<br />
Um 11:00 Uhr beginnt Herr Luchterhandt mit dem<br />
Bericht der Vorprüfung.<br />
Die Vorprüfung des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs<br />
im Rahmen des HEUREKA Programms<br />
„<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-Universtität <strong>Gießen</strong> - Campus Philosophikum“<br />
erfolgte in der Zeit vom 12.9. bis zum<br />
26.10.2011 im Büro Luchterhandt, Wrangelstraße<br />
18, in Hamburg. Die Sachverständigenprüfung fand<br />
am 5.10. und 6.10.2011 im Georg-Büchner-Saal, Alte<br />
UB, Bismarckstraße 37, in <strong>Gießen</strong> statt.<br />
Insgesamt wurden 23 Wettbewerbsbeiträge eingereicht.<br />
Die von den Verfassern mit einer sechsstelligen<br />
Kennzahl bezeichneten Arbeiten wurden durch<br />
Tarnzahlen mit den Ziffern 1001 bis 1023 ersetzt.<br />
Etwaige Hinweise auf Verfasser wurden durch die<br />
Vorprüfung entfernt. Sämtliche Arbeiten wurden in<br />
gleicher Weise vorgeprüft. Sämtliche Wettbewerbsbeiträge<br />
sind fristgerecht eingegangen bzw. erkennbar<br />
fristgerecht aufgegeben worden. Die geforderten<br />
Unterlagen wurden von allen Verfassern im Wesentlichen<br />
vollständig eingereicht. Im Wesentlichen<br />
stimmen Pläne und Modelle der jeweiligen Beiträge<br />
überein. Teilleistungen fehlen bei folgenden Arbeiten:<br />
Dritter Vertiefungsbereich 1001, 1013; Ideenskizze<br />
1003. Die Beiträge waren jedoch trotz dieser Abweichungen<br />
im Leistungsbild prüfbar.<br />
Das Preisgericht beschließt einstimmig, alle Arbeiten<br />
zur Bewertung zuzulassen.<br />
Anschließend erläutert Herr Luchterhandt den Aufbau<br />
des Vorprüfberichts, der die Ergebnisse der<br />
Vorprüfung vergleichend zusammenfasst. Der vorliegende<br />
Bericht beschränkt sich auf die vergleichende<br />
Darstellung der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.<br />
Jede Arbeit ist auf acht Seiten zusammengefasst.<br />
Sämtliche Angaben der Entwurfsverfasser wurden,<br />
soweit möglich, überprüft. Die Ergebnisse der Vorprüfung<br />
sind analog zu den Beurteilungskriterien der<br />
Auslobung gegliedert.<br />
3. informationsrundgang<br />
Unmittelbar im Anschluss an den allgemeinen Bericht<br />
der Vorprüfung um 11:10 Uhr bittet der Vorsitzende<br />
die Vorprüfung die Arbeiten im Informationsrundgang<br />
vorzustellen.<br />
An den allgemeinen Bericht der Vorprüfung schließt<br />
unmittelbar der Informationsrundgang an, in dem<br />
die den Entwürfen zugrunde liegenden Entwurfsideen<br />
jeweils kurz an den Plänen dargestellt und die<br />
wesentlichen Ergebnisse der Vorprüfung erläutert<br />
werden. Verständnisfragen werden gemeinsam von<br />
der Vorprüfung sowie den anwesenden Sachverständigen<br />
beantwortet. Der Informationsrundgang endet<br />
um 13:30 Uhr. Im Anschluss daran wird die Sitzung<br />
für die Mittagspause bis 14:15 Uhr unterbrochen.<br />
4. erster Wertungsrundgang<br />
Nach der Mittagspause versammelt sich das Preisgericht<br />
um 14:15 Uhr. Auslober, Nutzerin und Stadt<br />
<strong>Gießen</strong> erläutern ihre Erwartungen an das Ergebnis<br />
des Wettbewerbs für die zukünftige Entwicklung des<br />
Campus. Im Preisgericht werden die damit verbunden<br />
wesentlichen Verständnisfragen geklärt.<br />
Anschließend beginnt um 15:00 Uhr der erste Wertungsrundgang<br />
vor den Arbeiten. Zum Verbleib im<br />
Verfahren genügt eine Stimme. Somit bleiben nach<br />
Beendigung des Rundgangs 17 Arbeiten im Verfahren.<br />
5
6<br />
Protokoll der Preisgerichtssitzung<br />
Folgende Arbeiten konnten konzeptionell nicht überzeugen<br />
und scheiden im ersten Rundgang einstimmig<br />
aus:<br />
1003, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1022<br />
Der erste Wertungsrundgang ist um 15:30 Uhr beendet.<br />
Es schließt sich eine 10-minütige Pause an.<br />
5. zweiter Wertungsrundgang<br />
Um 15:40 Uhr beginnt der zweite Wertungsrundgang.<br />
Die verbliebenen Arbeiten werden jeweils ausführlich<br />
besprochen und die unterschiedlichen Aspekte<br />
im Gremium intensiv diskutiert. Hierzu werden<br />
sämtliche Modelle in das Rahmenmodell eingesetzt<br />
und die Arbeiten im Wechsel von einem/einer (Fach-)<br />
Preisrichter/-in vorgestellt und einer kritischen Bewertung<br />
unterzogen. Das Preisgericht würdigt die<br />
sorgfältige Ausarbeitung der Wettbewerbsaufgabe<br />
und die unterschiedlichen konzeptionellen Ansätze<br />
der Campusgestaltung.<br />
Die Abstimmung über den Verbleib der Arbeiten im<br />
Verfahren ergibt folgendes Ergebnis:<br />
1001 3:8 (ausgeschieden)<br />
1002 6:5<br />
1004 4:7 (ausgeschieden)<br />
1005 3:8 (ausgeschieden)<br />
1006 0:11 (ausgeschieden)<br />
1007 9:2<br />
1008 1:10 (ausgeschieden)<br />
1009 2:9 (ausgeschieden)<br />
1010 2:9 (ausgeschieden)<br />
1011 5:6 (ausgeschieden)<br />
1012 0:11 (ausgeschieden)<br />
1013 7:4<br />
1016 7:4<br />
1020 11:0<br />
1021 8:3<br />
1023 7:4<br />
Um 16:30 verlässt Frau Grabe-Bolz die Sitzung.<br />
Frau Weigel-Greilich erhält das Stimmrecht. Der<br />
zweite Wertungsrundgang endet um 18:10 Uhr.<br />
Um 18:20 Uhr versammelt sich das Preisgericht<br />
nach einer kurzen Pause erneut und konstatiert die<br />
Anzahl der Arbeiten in der engeren Wahl. Es befinden<br />
sich sieben Arbeiten in der engeren Wahl:<br />
1002, 1007, 1013, 1016, 1020, 1021, 1023.<br />
Rückholanträge werden nicht gestellt.<br />
Das Preisgericht beschließt, alle Arbeiten einer vergleichenden<br />
schriftlichen Bewertung zu unterziehen.<br />
Für die Besprechung der Beiträge werden kleine<br />
Teams gebildet, die einen Vorschlag zur schriftlichen<br />
Beurteilung der Arbeiten der engeren Wahl ausarbeiten<br />
und dem Preisgericht zur Abstimmung vorzulegen.<br />
Die Preisgerichtssitzung wird um 18:35 Uhr<br />
unterbrochen.<br />
6. engere Wahl und Prämierung der Arbeiten<br />
Am 28. Oktober 2011 nimmt das Preisgericht um<br />
9:10 Uhr die Beratungen im Audimax der JLU <strong>Gießen</strong><br />
wieder auf.<br />
Im anschließenden Rundgang werden die schriftlichen<br />
Beurteilungen der Arbeiten der engeren Wahl<br />
jeweils von einem/einer (Fach-) Preisrichter/-in verlesen<br />
und evtl. vorgebrachte Ergänzungen und Änderungswünsche<br />
im Gremium diskutiert und die Texte<br />
anschließend einstimmig verabschiedet. Es schließt<br />
sich eine Pause von 10:15 bis 10:30 Uhr an.<br />
Unter Berücksichtigung der vorgetragenen Argumente<br />
werden die Arbeiten der engeren Wahl an den<br />
Modellen intensiv diskutiert und in eine Rangfolge<br />
gebracht. Es wird einstimmig entschieden, die Arbeiten<br />
1016, 1021 und 1023 gleichrangig zu werten.<br />
Über die Rangfolge der Arbeiten stimmt das Preisgericht<br />
wie folgt ab:<br />
1. Rang: 1007 (10:1)<br />
2. Rang: 1020 (10:1)<br />
3. Rang: 1002 (11:0)<br />
4. Rang: 1013 (11:0)<br />
5. Rang: 1016, 1021, 1023 (11:0)<br />
Anschließend fasst das Preisgericht einstimmig den<br />
Beschluss, die vorgesehene Preis- und Anerkennungssumme<br />
von 115.000 EUR wie folgt neu aufzuteilen:<br />
1. Preis: 40.000 EUR<br />
2. Preis: 25.000 EUR<br />
3. Preis: 18.500 EUR<br />
4. Preis: 13.500 EUR<br />
Drei Anerkennungen: je 6.000 EUR<br />
Das Preisgericht beschließt einstimmig, die Preise<br />
entsprechend der Rangfolge zu vergeben. Die Diskussion<br />
der Arbeiten in der engeren Wahl und die<br />
Prämierung der Arbeiten enden um 11:45 Uhr.
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb „<strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Gießen</strong> Campus Philosophikum“<br />
7. empfehlungen<br />
Das Preisgericht empfiehlt der Ausloberin einstimmig,<br />
die mit dem ersten Preis ausgezeichnete Arbeit<br />
1007 zur Grundlage der weiteren Planungen heranzuziehen<br />
und die Verfasser mit der Erarbeitung eines<br />
Masterplans zu beauftragen. Ferner verabschiedet<br />
es einstimmig die folgenden Empfehlungen für die<br />
weitere Planung:<br />
• Im Rahmen der städtebaulichen Masterplanung<br />
sind die angestrebten Freiraumqualitäten<br />
zu vertiefen und insbesondere für die erste<br />
Baustufe landschaftsarchitektonisch zu präzisieren.<br />
• Der Übergang zum westlichen Baufeld und<br />
zur Osthalle ist städtebaulich zu überarbeiten<br />
(Ausrichtung und Typologien der Gebäudekörper)<br />
• Die in der schriftlichen Würdigung der Arbeit<br />
1007 genannten Kritikpunkte sind bei der Weiterentwicklung<br />
des Entwurfs zu berücksichtigen.<br />
• Bei Ausarbeitung und Umsetzung der Masterplanung<br />
ist die intensive Kooperation zwischen<br />
dem Land Hessen und der <strong>Universität</strong>sstadt<br />
<strong>Gießen</strong> fortzuführen.<br />
8. Abschluss des verfahrens<br />
Zum Abschluss des Verfahrens dankt der Vorsitzende<br />
allen Teilnehmenden für die konstruktive Zusammenarbeit,<br />
die zu einem sehr guten Ergebnis geführt<br />
habe. Er dankt der Vorprüfung für die aussagefähigen<br />
Unterlagen und die hervorragende Begleitung<br />
des Verfahrens. Die Vorprüfung wird vom Preisgericht<br />
einstimmig entlastet.<br />
Für die Erstellung des Protokolls ermächtigt das<br />
Preisgericht einstimmig Herrn Prof. Dr. Pesch mit<br />
dem Verfassen und der Abstimmung des Protokolls<br />
in Zusammenarbeit mit dem Büro Luchterhandt.<br />
Herr Pesch gibt den Vorsitz mit Dank an die Ausloberin<br />
zurück. Frau Bauerfeind-Roßmann spricht im Namen<br />
des Preisgerichts dem Vorsitzenden ihren herzlichen<br />
Dank für die souveräne Leitung der Sitzung<br />
aus. Sie dankt den Mitgliedern des Preisgerichts,<br />
den Sachverständigen und der Vorprüfung für ihre<br />
engagierte Teilnahme am Verfahren und die im Vorfeld<br />
intensiv geführten Vorbereitungen, insbesondere<br />
auch den anwesenden Vertreter/-innen der verschiedenen<br />
universitären Fachgruppen für ihre geleistete<br />
Unterstützung. Frau Bauerfeind-Roßmann zeigt sich<br />
mit der getroffenen Entscheidung und dem gewählten<br />
Verfahren sehr zufrieden und stellt fest, dass sich<br />
die konstruktive Zusammenarbeit des Landes Hessen,<br />
der <strong>Justus</strong>-<strong>Liebig</strong>-<strong>Universität</strong> und der <strong>Universität</strong>sstadt<br />
<strong>Gießen</strong> bewährt habe. Sie hofft, dass die<br />
Vision der Entwurfsverfasser zügig seine Umsetzung<br />
findet und damit spürbar zu einer Verbesserung des<br />
Lehr- und Forschungsumfeldes an dem Standort führen<br />
kann. Frau Laste schließt sich als Vertreterin des<br />
Finanzministeriums den Dankesworten an. Das Ergebnis<br />
zeige, dass die Wettbewerbskultur in Hessen<br />
auch eine Stärkung der Baukultur bewirke.<br />
Herr Mukherjee dankt dem Vorsitzenden für die<br />
Leitung der Sitzung und dankt den Mitgliedern des<br />
Preisgerichts für ihre engagierte, offene und zielorientierte<br />
Diskussion. Mit diesem Ergebnis könne nun<br />
die nächste wichtige Entwicklungsetappe begonnen<br />
werden.<br />
Die Sitzung ist um 12:15 Uhr beendet.<br />
Für das Protokoll<br />
Prof. Dr. Franz Pesch<br />
Daniel Luchterhandt<br />
<strong>Gießen</strong>, 28.10.2011<br />
Aufhebung der Anonymität<br />
Nach Abschluss des Verfahrens werden die Verfassererklärungen<br />
geöffnet und verlesen (siehe Anhang<br />
Entwurfsverfasser).<br />
7
AnhAnG:<br />
SChRiftLiChe BeURteiLUnG deR enGeRen WAhL<br />
1002<br />
Die Arbeit besticht zunächst durch eine ansprechende<br />
städtebauliche Gesamtkonfiguration, die den Phil.<br />
II-Bereich erhält und über einen neuen zentralen<br />
Platz an der Rathenaustrasse mit dem städtebaulich<br />
neu geordneten Phil. I verbindet. Diese Neuordnung<br />
versucht geometrisch zum Schulzentrum Ost und zur<br />
Otto-Behagel-Straße zu vermitteln. Dadurch entsteht<br />
eine, sich in die Umgebung einordnende Stellung der<br />
Bauten. Dass die Osthalle auf diese Art und Weise<br />
ein vis á vis auf der Campusseite erhält, ist eine interessante<br />
Option dieser städtebaulichen Lösung.<br />
Als ansprechende Ausbaustufe entsteht nach der<br />
Realisierung von Seminargebäude, Bibliothekserweiterung,<br />
einem „Campus Leben und Service“-Gebäude<br />
sowie der Mensa ein ansprechender Stadtraum<br />
auf beiden Seiten der Rathenaustraße. Mit dieser<br />
Entscheidung schaffen die Verfasser schon relativ<br />
früh im Erneuerungsprozess die neue Mitte und den<br />
Ankunftsraum.<br />
Der „Campus Leben und Service“-Neubau vermittelt<br />
durch seine Anlehnung an Körnigkeit und Situierung<br />
der Phil. II-Gebäude zum nordöstlichen Campusbereich.<br />
Im Endausbau wird dieser noch durch eine<br />
ähnliche Gebäudekubatur sinnvoll ergänzt. Leider ist<br />
das kraftvolle Gesamtkonzept abhängig davon, ob in<br />
der Zukunft die optionalen Gebäude zwischen Bibliothek<br />
und Schulzentrum realisiert werden.<br />
Hervorzuheben ist der vollständige Erhalt des Gehölzbestandes<br />
am Rande des Phil. II Bereiches,<br />
wodurch der Campus hier den Charakter einer Lichtung<br />
erhält. Die grafische Darstellung des großen<br />
gemeinsamen Campusbinnenraumes verspricht eine<br />
einheitliche gestalterische Behandlung, ohne dass<br />
diese ausreichend konkretisiert ist. Gleichwohl kann<br />
Barrierefreiheit gewährleistet werden. Auch können<br />
die Gebäudesolitäre im Nordwesten des Campus’<br />
in ihrer Ausrichtung und unterschiedlichen Kubatur<br />
nicht wirklich überzeugen.<br />
9
10<br />
Die Konzentration sämtlicher Seminarräume in einem<br />
Gebäude bringt zwar eine starke Belebung des<br />
zentralen Bereiches, ist jedoch funktional und vom<br />
Unterhalt her problematisch. Weder der Übergang<br />
zur Auenlandschaft noch die Gestaltung der Adresse<br />
entlang des Alten Steinbacher Weges sind befriedigend.<br />
Dazu trägt die Situierung und Ausgestaltung<br />
der Parkplätze bei.<br />
Die Verkehrserschließung folgt weitgehend der Auslobung.<br />
Den Übergang der Hauptcampusachse über<br />
die Rathenaustraße als „Shared Space“ zu gestalten<br />
ist richtig. Jedoch sollte das auf den Bereich begrenzt<br />
werden, wo hauptsächlich gequert wird. Das<br />
zusätzliche Rundstraßenkonzept mit einer Erschließungsstraße<br />
längs des Klingelbaches ist hingegen<br />
nicht nachzuvollziehen.<br />
Das vorgelegte Etappierungskonzept weist erhebliche<br />
Abweichungen von den Vorgaben der Auslobung<br />
auf, die auch im weiteren Planungsprozess unter<br />
Beibehaltung der Planungsidee schwer zu beheben<br />
sein werden.<br />
Der Entwurf nutzt eine Vielzahl bestehender Gebäude<br />
und vermeidet Mehrfachumzüge und Interimsauslagerungen.<br />
Die Kubaturen der neu zu errichteten<br />
Gebäude verbinden gute Nutzbarkeit mit kompakten<br />
Strukturen. Die Problematik der Verschattung durch<br />
Gebäude nahe der Baumpflanzung wäre zu überprüfen.
1007<br />
Die besondere Qualität der räumlichen Konfiguration<br />
liegt in der Schaffung eines vermittelnden Raums an<br />
der Rathenaustraße (Campusplatz), der das Phil. I<br />
und Phil. II sinnfällig miteinander und im Süden mit<br />
dem Auenraum verbindet. Die präzise Platzierung<br />
der Gebäude schafft neue Sichtbezüge, welche in<br />
den verschiedenen Etappen hohe räumliche Qualitäten<br />
erwarten lassen. Insbesondere der Auenplatz<br />
(Campusplatz) erweitert – in Verbindung mit dem<br />
neuen Park und den Wasserelementen – den Auenraum<br />
in den Campus hinein. Als besondere städtebauliche<br />
Qualität kann auch die Anbindung an den<br />
Alten Steinbacher Weg im Bereich der Ostschule<br />
gesehen werden.<br />
Die stadträumlichen Qualitäten des Beitrags entwickeln<br />
sich insbesondere aus der Anknüpfung des<br />
Campus’ an die bestehenden Grünverbindungen<br />
Richtung Innenstadt – Aue – Stadtwald. Die angelegten<br />
Freiräume erscheinen gut nutzbar. Die Gestaltqualität<br />
bedarf weiterer Detaillierung. Barrierefreiheit<br />
ist gegeben.<br />
Die Platzierung, aber insbesondere die Massierung<br />
des Parkens an der Ostschule wird kritisch gesehen.<br />
Der Übergang zwischen dem Campusplatz und dem<br />
linken Flügel (Phil. I) erscheint noch nicht richtig dimensioniert<br />
und gestaltet.<br />
Der Entwurf folgt den im Funktionsprogramm dargestellten<br />
Anforderungen; insbesondere die beiden Seminargebäude<br />
am Campusplatz sind hervorzuheben.<br />
Die Etappierung ist sehr gut überlegt. Bereits in einer<br />
ersten Phase werden die neuen adressbildenden<br />
Qualitäten des Campusplatzes und der Auenanbindung<br />
sichtbar.<br />
Die Verkehrserschließung folgt weitgehend den Vorgaben<br />
der Auslobung. Im zentralen Querungsbereich<br />
von Hauptachse des Campus’ und Rathenaustraße<br />
wären „Querungshilfen“ über die angebotenen Zebrastreifen<br />
hinaus erwünscht. Welchen Gewinn sich<br />
die Verfasser von der Begradigung der Rathenaustraße<br />
versprechen, ist nicht ersichtlich.<br />
11
12<br />
Durch die weitgehende Nutzung von Bestandsgebäuden<br />
aus dem Phil. II werden Mehrfachumzüge<br />
und Interimslösungen vermieden. Insgesamt entwikkeln<br />
die Verfasser eine plausible und wirtschaftlich<br />
wirkende Lösung, deren Neubauten hinsichtlich der<br />
erwarteten Flexibilität noch einige Wünsche offen<br />
lassen.
1013<br />
Die Arbeit zeichnet sich durch eine konsequente Zusammenführung<br />
der voneinander getrennten Campusbereiche<br />
aus. Unter Beibehaltung von drei Bestandsgebäuden<br />
aus der ehemals locker gruppierten<br />
Baustruktur des Phil. II entwickeln die Verfasser in<br />
zwei Ausbauphasen einen neuen zentralen Campus,<br />
der sich ansprechend über die Rathenaustraße auf<br />
das Gelände des Phil. I erstreckt.<br />
Das Herzstück ist ein großzügiger zentraler Freiraum,<br />
um den sich in linearer Anordnung die neuen<br />
Gebäude gruppieren. Durch geschickt gewählte<br />
Vor- und Rücksprünge der Gebäudekanten entstehen<br />
unterschiedliche Vorzonen, die den Gebäuden<br />
Individualität geben. Den Auftakt des Campusplatzes<br />
bilden die zentralen Einrichtungen wie Mensa, Bibliothek<br />
und Seminargebäude, die funktional und städtebaulich<br />
sinnvoll positioniert sind.<br />
Das klare Konzept wird durch eine nicht nachvollziehbare<br />
Erweiterung entlang der Klingelbachaue<br />
geschwächt, die wohl dem Umbaukonzept geschul-<br />
det ist. Die Baukörper sind zwar plausibel dimensioniert<br />
und öffnen sich nachvollziehbar zum Freiraum,<br />
fassen aber nur untergeordnete Freiraumnutzungen<br />
wie Parkplätze oder einen Lehrgarten. Hin zur bestehenden<br />
Stadt tritt der neue Campus über die zentrale<br />
Bibliothek in Erscheinung.<br />
Den angelagerten Nutzungen entsprechend weist<br />
der Campusplatz wechselnd Freiraumqualitäten auf.<br />
Einen attraktiven Auftakt bildet ein urbaner Platz,<br />
um den sich die zentralen Einrichtungen gruppieren.<br />
Dieser wandelt sich – vermittelt über eine Wasserfläche<br />
– zu einer vielfältig nutzbaren Grünfläche. Das<br />
Wechselspiel zwischen dem offen gestalteten Campus-Innenraum<br />
und den waldartigen Eingrünungen<br />
des Campus’ ist spannungsreich, wobei die Gebäudehöhe<br />
im Verhältnis zur Weite des Freiraums etwas<br />
zu gering erscheint.<br />
Die Haupterschließung des neuen Campus’ über<br />
eine begradigte Rathenaustraße wird beibehalten,<br />
obwohl sie den öffentlichen Freiraum überquert. Sie<br />
wird aber gestalterisch durchaus geschickt integriert.<br />
13
14<br />
Die Buswendeschleife ist nicht berücksichtigt.<br />
Die Parkplätze sind konzentriert, ebenerdig und<br />
deutlich überdimensioniert an den beiden Kopfenden<br />
des Geländes angesiedelt. Besonders der Parkplatz<br />
vor der Ostschule wird hinsichtlich seiner Platzierung<br />
und Größenordnung von der Jury kritisch gesehen.<br />
Die Erschließung der Parkplätze erfolgt ausschließlich<br />
über den Alten Steinbacherweg und belastet<br />
dadurch ungewollt den Verkehrsfluss sowohl über<br />
den zentralen Platz als auch über den Steinbacher<br />
Weg. Die Erschließung für den Fuß- und Radverkehr<br />
ist gut gelöst.<br />
Die Umsetzung des Flächenprogramms ist gegeben.<br />
Allerdings weisen die funktionalen Zusammenhänge<br />
Mängel auf – besonders in der Clusterbildung und<br />
der räumlichen Zuordnung der Fachbereiche 03/05<br />
und 07/08. Der Entwurf erhält im Endausbau wenige<br />
der vorhandenen Gebäude. Dennoch werden Mehrfachumzüge<br />
und Interimsauslagerungen vermieden.<br />
Das vorgelegte Etappierungskonzept erscheint in<br />
seinen Grundzügen plausibel und lässt schon früh<br />
die angestrebte städtebauliche Struktur erkennen; es<br />
weist jedoch erhebliche Schwächen in der Funktionalität<br />
der vorhandenen Bibliothek bis zur Realisierung<br />
des 2. Bauabschnitts auf.<br />
Die Neubauten nehmen das Prinzip der Phil. I und<br />
II Bebauung mit kompakten Baukörpern auf, bieten<br />
durch ihr größeres Volumen gute Flexibilität zur<br />
Anpassung an künftige Anforderungen. Insgesamt<br />
könnte auf dieser Grundlage des Entwurfs eine wirtschaftliche<br />
Lösung erreicht werden.<br />
Die vorliegende Arbeit stellt einen diskussionswürdigen<br />
Beitrag mit identitäts- und adressbildender Ausrichtung<br />
des neuen Campus dar; es weist allerdings<br />
Schwächen in der städtebaulichen Figur und der<br />
Erschließung/Parkraum auf.
1016<br />
Das Phil. II wird weitgehend erhalten, das Phil. I aber<br />
völlig neu gestaltet. Beide Teile werden über ein, von<br />
großen Gebäuden mit Zentraleinrichtungen gesäumtes<br />
Forum verbunden. Eines dieser Gebäude – das<br />
höchste der gesamten Anlage – markiert die neue<br />
Mitte. Leider wird die zentrale Anlage erst in der 3.<br />
Etappe erkennbar werden.<br />
Ausgehend von diesem Forum soll zu beiden Seiten<br />
hin eine Folge von Plätzen mit verbindenden<br />
Sichtachsen entstehen. An einigen Stellen gibt es<br />
allerdings weniger gut einsehbare Bereiche, die zu<br />
„Angsträumen“ werden könnten. Eine bessere Anbindung<br />
an die Stadt wird nicht hergestellt.<br />
Die verbindenden Plätze brauchen, um belebt zu<br />
sein, im Erdgeschoss der anliegenden Gebäude frequentierte,<br />
lebendige Einrichtungen („Läden“). Das<br />
schlagen die Verfasser auch textlich vor, setzen es<br />
aber in den Plänen nicht um. Die eingestreuten – im<br />
Plan rot markierten – „Kioske“ jedenfalls dürften für<br />
eine Belebung des Campus nicht ausreichen.<br />
Die Integration von Sportplätzen in die der Aue benachbarten<br />
Freiräume ist prinzipiell erfreulich, doch<br />
in der vorgeschlagenen Verortung – unmittelbar neben<br />
Räumen, in denen gelehrt und gelernt werden<br />
soll, nicht realistisch. Im Alltagsbetrieb könnten sich<br />
aus dieser Nachbarschaft Konflikte ergeben.<br />
Ein spezielles Konzept zur Verbesserung der Nachhaltigkeit,<br />
z.B. durch entsprechende Stadttechnik, ist<br />
in den Plänen nicht erkennbar.<br />
Die Verkehrserschließung folgt weitgehend den Vorgaben<br />
der Auslobung. Wenig überzeugt, dass die<br />
Zufahrten zu den Garagen als Sackgassen enden.<br />
Die (nicht besonders markierte) Bushaltestelle müsste<br />
durch eine Wendeschleife ergänzt werden. In der<br />
Hauptwegeachse des Campus dürfte die vorgeschlagene<br />
Querungsstelle über die Rathenaustrasse nicht<br />
ausreichen.<br />
Die Vorgaben des Funktionsprogramms sind weitgehend<br />
erfüllt, doch die Unterbringung der verschiedenen<br />
Fachgebiete in entsprechend kleinen Gebäuden<br />
15
16<br />
dürfte die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht im<br />
gewünschten Maß fördern. Bezweifelt wird, ob die<br />
Nutzung des zentralen „Turms“ für ein 6-geschossiges<br />
Seminargebäude funktioniert.<br />
Die dargestellte Etappierung entspricht den Planungsabsichten<br />
und der Auslobung.<br />
Die vorgeschlagene Nutzung einer Vielzahl von Bestandsgebäuden<br />
ist sicher wirtschaftlicher als deren<br />
Abriss und Neubau. Soweit aber Neubauten vorgeschlagen<br />
werden, sind diese zwar kompakt und insofern<br />
auch kostengünstig zu erstellen, dürften – aufgrund<br />
ihres relativ geringen Volumens – aber nicht<br />
ohne baulichen Aufwand umgenutzt werden können.<br />
Hier erscheint die Wirtschaftlichkeit auch wegen der<br />
Kleinteiligkeit nicht optimierbar.<br />
Der Entwurf erfüllt viele Anforderungen der Ausschreibung,<br />
kommt aber nicht zu einem städtebaulich<br />
und funktionell überzeugenden Gesamtkonzept.
1020<br />
Die Verfasser entwerfen eine städtebaulich eigenständige<br />
Figur, die – in einer großzügigen Geste –die<br />
bisher getrennten Standorte Phil. I und II vereint. Für<br />
die neue Campusanlage werden die vorhandenen<br />
Landschaftstypen – der dichte Wald und offene Klingelbachaue<br />
– thematisch in den Mittelpunkt gestellt.<br />
Sie werden zu besonderen Standortmerkmalen<br />
qualifiziert und geben somit dem Campus eine eigene<br />
Identität. Gespielt wird spannungsreich mit dem<br />
Wechsel aus geschlossenem Wandsaum, der den<br />
Gebäuden einen rückwärtigen Halt bietet, und einem<br />
weiten Binnenraum inmitten der offenen Auenlandschaft.<br />
Der renaturierte Lauf des Klingelbaches wird<br />
selbstverständlicher Teil der Gesamtanlage.<br />
In der neuen Campusanlage bildet ein langgestreckter<br />
Freiraum, an dem die zentralen Einrichtungen<br />
liegen, die neue Mitte des universitären Lebens. Der<br />
großzügig dimensionierte „Common“ gliedert sich in<br />
einen „weichen“ Wiesenraum und zwei „feste“ Stadtplätze.<br />
Als besondere Qualität schafft der Entwurf<br />
mit einer selbstverständlichen Geste eine Anbindung<br />
an das nördlich angrenzende Stadtquartier und an<br />
die Fakultäten der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften.<br />
Erreicht wird außerdem eine glaubwürdige<br />
direkte Anbindung des Stadtquartiers an den Landschaftsraum.<br />
Baulich-typologisch und stadträumlich dient der<br />
Charakter des Phil. II als Vorbild, wird aber zu etwas<br />
Neuem weiterentwickelt. Bestehende Gebäude<br />
fügen sich wie selbstverständlich in die neue Komposition<br />
ein. Die Modularität der Einheiten verspricht<br />
eine hohe Flexibilität, die klare Formatierung des<br />
Binnenraumes schafft Ordnung und Orientierung.<br />
Eine besondere Stellung besitzt die neue Bibliothek.<br />
Ihr Standort und ihre Größe erfordern eine hohe<br />
Architekturqualität und belebende Nutzungen, da zu<br />
drei Plätzen adäquate Fassaden und Frequenzen<br />
geschaffen werden müssen.<br />
Der introvertierte Charakter des Binnenraumes sowie<br />
die neue Qualität der renaturierten Klingelbachaue<br />
werden durch das Auflassen der Rathenaustraße gewonnen.<br />
Allerdings ist nicht nachzuvollziehen, wieso<br />
17
18<br />
die Verbindung nicht für Fußgänger und Radfahrer<br />
offen bleibt. Die als Ersatz angebotene Straßenverbindung<br />
über Karl-Reuter-Weg und Klingelbachweg<br />
führt dort zu Verkehrsbelastungen – mindestens in<br />
Höhe der heutigen Belastung der Rathenaustraße.<br />
Das bedarf einer Überprüfung der Kapazität der Knoten<br />
mit dem Schiffenberger Weg.<br />
Das Preisgericht versteht die konsequente Haltung<br />
des Entwurfes, hinterfragt aber kritisch, ob eine<br />
Verlagerung des hausgemachten Verkehrs auf die<br />
Nachbarschaft im Sinne der Netzverknüpfung und<br />
der Verträglichkeit verhältnismäßig ist. Ebenso kritisch<br />
wird angemerkt, ob die Ringführung des Busses<br />
praktikabel ist.<br />
Der Entwurf nutzt einige Gebäude des Bestands<br />
Phil. II im Endausbau. Interimsauslagerungen werden<br />
vermieden. Die Gebäudekubaturen sind hinsichtlich<br />
der Größe auf gute Flexibilität optimierbar.<br />
Um eine natürliche Belichtung der Gebäude zu<br />
gewährleisten, müssten die Innenhöfe aufgeweitet<br />
werden.<br />
Das vorgelegte Etappierung weist in einzelnen Punkten<br />
Abweichungen von den Vorgaben der Auslobung<br />
auf, die jedoch die Realisierbarkeit des Entwurfsansatzes<br />
nicht in Frage stellen.<br />
Ein großer Vorzug der Arbeit liegt in der möglichen<br />
Phasierung (Problem Straße) und den baulichräumlichen<br />
Qualitäten auch der Zwischenetappen.<br />
Ingesamt würdigt das Preisgericht den Beitrag als<br />
konsequent und gelungen. Die Frage, ob die großzügige,<br />
zugleich aber geschlossene Anlage dem<br />
Selbstverständnis einer stadtintegrierten <strong>Universität</strong><br />
entspricht wird in der Jury kontrovers diskutiert.
1021<br />
Die Verfasser identifizieren in dem Areal zwei wesentliche<br />
Potenziale: Die städtebauliche Struktur<br />
des bestehenden „Waldcampus“ des Phil. II und die<br />
südwestlich des Areals verlaufende Klingelbachaue.<br />
An zentraler Stelle – direkt an der Rathenaustraße<br />
– schafft der Entwurf mit den Neubauten der <strong>Universität</strong>sbibliothek,<br />
Mensa und einem zentralen Seminargebäudes<br />
ein Entree und somit die gewünschte<br />
„Neue Mitte“ für den Campus. Städtebaulich wird,<br />
ausgehend von der Struktur der Bestandsbauten<br />
des Phil. II, die Struktur aus Solitärgebäuden nach<br />
Nordwesten auf das Gelände des Phil. I ausgeweitet<br />
und um zwei linear gegliederte Freiräume herum organisiert.<br />
Der Entwurf weist nach, dass die bestehenden<br />
Qualitäten des Ortes Ausgangspunkt für eine Entwicklung<br />
eines zukunftsfähigen Campus-Areal sein<br />
können.<br />
Die neue <strong>Universität</strong>sbibliothek wird als „Hort des<br />
Wissens“ zum zentralen Baukörper ausgebildet, der<br />
in Größe, Ausrichtung und Architektursprache den<br />
Campus dominieren soll. Sie soll Orientierungspunkt<br />
im Stadtraum und weithin sichtbares Wahrzeichen<br />
der <strong>Universität</strong> werden. Zusammen mit dem vorgelagerten<br />
Campusforum ist der Bibliotheksneubau<br />
Dreh- und Angelpunkt für die beiden, den Campus<br />
erschließenden Freiraumbänder.<br />
Die Klingelbachaue wird zum naturnahen Auenpark<br />
ausgebaut und zum Campusgelände hin ausgeweitet.<br />
Mit diesem naturnah gestalteten Freiraum, den<br />
beiden Campusparks und dem zentralen Campusplatz<br />
werden Freiräume unterschiedlicher Qualität<br />
und Atmosphäre angeboten, die sowohl in ihrer<br />
Aufenthaltsqualität als auch in ihrer Nutzbarkeit den<br />
Lernenden und Lehrenden vielfältige Möglichkeiten<br />
bieten.<br />
Neben dem zentralen Platz mit der Rathenaustraße<br />
bietet der Entwurf auch im Nordwesten zur Schule<br />
hin eine Anbindung an den angrenzenden Stadtteil.<br />
Die Verkehrserschließung für KFZ erfolgt durch den<br />
19
20<br />
Wegfall der Zufahrt über die Karl-Glöckner-Straße<br />
allein über die Rathenaustraße und den Alten Steinbacher<br />
Weg – mit der Folge einer höheren Belastung<br />
im zentralen Campus-Bereich. Dies wird kritisch gesehen.<br />
Die Überquerbarkeit der Rathenaustraße für<br />
Fußgänger ist aufgrund des Mittelstreifens gegeben.<br />
Die Bushaltestelle ist nicht ausformuliert, die Wendeschleife<br />
fehlt. Kfz-Stellplätze werden in Parkpaletten<br />
an den jeweiligen Enden des Geländes angeboten.<br />
Dies erscheint besonders direkt neben dem <strong>Gießen</strong>er<br />
Ring überzogen.<br />
Grundsätzlich wird die Umsetzung des Funktionsprogramms<br />
positiv gewertet, jedoch sind getrennte<br />
Gebäude für die FB 07, FB 08 und LabD schwierig.<br />
Auch das zentrale Seminargebäude schafft durch<br />
Ballung vieler Seminarräume unter einem Dach und<br />
das damit verbundene Personenaufkommen Probleme.<br />
Das vorgelegte Etappierungskonzept weist erhebliche<br />
Abweichungen von den Vorgaben der<br />
Auslobung auf, die auch im weiteren Planungsprozess<br />
schwer zu beheben sein würden, ohne die Planungsidee<br />
zu verlassen.<br />
Der Entwurf nutzt einige Gebäude (5) des Bestandes<br />
Phil. II im Endausbau. Es sind keine Interimsauslagerungen<br />
erforderlich, Mehrfachumzüge (2) möglich.<br />
Die Kubaturen der Neubauten sind variantenreich<br />
und können nach Erfordernis hinsichtlich Flexibilität<br />
und Belichtung über Innenhöfe angepasst werden.<br />
Eine wirtschaftliche Lösung wäre auf der Grundlage<br />
dieses Konzepts möglich.
1023<br />
Die Arbeit besticht durch ihre konzeptionelle Eigenständigkeit,<br />
in der sie sich formal und stadträumlich<br />
von der Mehrzahl der eingereichten Beiträge absetzt.<br />
Kernidee der Arbeit ist es, den Dualismus von Stadt<br />
und Landschaft durch die städtebauliche Konzeption<br />
zu interpretieren. Das Konzept nimmt Bezug auf die<br />
Philosophie des „Baums des Wissens“ und ordnet<br />
sämtliche Gebäude an einem – als Stamm verstandenen<br />
– zentralen Raumkontinuum an, das sich über<br />
unterschiedlich große Raumsequenzen als zentrales<br />
Campusband formiert. Die vermeintliche Vielseitigkeit<br />
bietet – auf den zweiten Blick – doch nur wiederkehrende<br />
Raumbilder an. Die freie Anordnung der<br />
Kubaturen assoziiert das freie Spiel der Blätter und<br />
orientiert sich ausdrücklich nicht an einem orthogonalen<br />
Ordnungsprinzip.<br />
Der Entwurf versucht mit dem Heranführen des<br />
umgebenden Landschaftsraums in die Fugen der<br />
Gebäudezwischenräume eine Verzahnung von Stadt<br />
und Landschaft zu generieren. Obwohl das Konzept<br />
postuliert, dass sich Stadt und Land „versöhnen“,<br />
erscheint der Campus eher introvertiert. Die Chance,<br />
die vorhandenen Qualitäten des Auenraumes<br />
entlang des Klingelbachs landschaftsplanerisch aufzugreifen,<br />
wird nicht genutzt. Positiv wird die stadtteilverbindende<br />
Ost-West-Verbindung quer durch<br />
den Campus mit Anschluss an Unterführung und<br />
Waldgebiet gesehen.<br />
Innerhalb der Campusanlage könnten bei einer publikumsintensiven<br />
Nutzung der Erdgeschisszone urbane<br />
Qualitäten erzielt werden. Demgegenüber sind<br />
die äußeren Freiflächen – vor allem im nördlichen<br />
Bereich entlang des Alten Steinbacher Wegs – durch<br />
die Stellplatzanlagen stark beeinträchtigt.<br />
Die Verkehrerschließung für den Autoverkehr erfolgt<br />
allein über Rathenaustraße und Alter Steinbacher<br />
Weg; die Karl-Glöckner-Straße wird abgehängt.<br />
Mithin konzentriert sich der Autoverkehr in der<br />
Campusmitte. Mit „Busterminal“ und Kiss-and-Ride<br />
im Übergang über die Rathenaustraße erscheint<br />
dieser wichtige Ort überlastet, zumal die Busse im<br />
Fahrbahnbereich halten. Interessant und abwechs-<br />
21
22<br />
lungsreich ist die Fußwegverbindung längs durch<br />
den Campus mit den zahlreichen Querverbindungen.<br />
Allerdings ist diese Wegeführung unübersichtlich,<br />
was tagsüber interessant sein kann, nachts jedoch<br />
die Frage der sozialen Kontrolle aufwirft. Der Entwurf<br />
kann barrierefrei realisiert werden.<br />
Die Vernetzung der Fachbereiche und Zentren wird<br />
durch die Arbeit weitgehend unterstützt. Insbesondere<br />
die interdisziplinären Zusammenhänge der Fachbereiche<br />
3, 4 und 5 sowie 7 und 8 sind gut realisiert.<br />
Bibliothek und Mensa bilden das Zentrum des Campus’<br />
an der Rathenaustraße, nur der Fachbereich 6<br />
scheint weniger deutlich in die Funktionszusammenhänge<br />
integriert zu sein. Die Seminarräume sind in<br />
mehreren Gebäuden jeweils im Erdgeschoss verteilt.<br />
Die vier Realisierungsetappen entsprechen der Errichtung<br />
von vier Gebäudeclustern, die jeder für sich<br />
die Chance haben, eigenständige räumliche Strukturen<br />
zu bilden. Anerkannt wird das Bemühen, durch<br />
die verteilte Platzierung der Seminarräume in die<br />
Erdgeschosszonen im Sinne der europäischen Stadt<br />
den öffentlichen Raum zu beleben. Dies hat jedoch<br />
zur Konsequenz, dass die geforderten Seminarraumkapazitäten<br />
erst gegen Ende des Bauprozesses vollständig<br />
verfügbar sein können.<br />
Das vorgelegte Etappierungskonzept weist erhebliche<br />
Abweichungen von den Vorgaben der Auslobung<br />
auf und ist in dieser Form nicht realisierbar. Das in<br />
der Auslobung geforderte Seminargebäude wird<br />
nicht realisiert. Der Vorschlag, diese Flächen in den<br />
Erdgeschosszonen anzubieten kompensiert das in<br />
den ersten Phasen erzeugte Flächendefizit nicht.<br />
Der Entwurf nutzt wenig Substanz aus dem Bestand<br />
des Phil. II. Es sind keine Interimsauslagerung und<br />
Mehrfachumzüge erforderlich. Die Neubauten sind in<br />
Bezug auf flexible Nutzungen gut proportioniert, weisen<br />
jedoch große Raumtiefen sowie problematische<br />
Innenhofüberdachungen auf (Belichtungen). Die<br />
geringen Abstandsflächen führen zu gegenseitiger<br />
Verschattung. Die Vielzahl der Parkhäuser ist wirtschaftlich<br />
ungünstig.<br />
In der Arbeit wird ein Nachhaltigkeitskonzepts formuliert,<br />
das sich auf die Nutzung von Regenwasser und<br />
eine energieeffiziente Gebäudekonzeption bezieht.
1001<br />
1002<br />
AnhAnG:<br />
entWURfSveRfASSeR<br />
1001 (tarnzahl: 918273) – 2. Rundgang<br />
nps tchoban voss Gmbh & Co. kG, hamburg<br />
Ekkehard Voss, Alf M. Prasch, Stefan Drese, Anke<br />
Kitel, Mertin Hertel, Axel Neubauer, Frank Buken<br />
JkL - Junker + kollegen Landschaftsarchitektur,<br />
Bramsche<br />
Dirk Junker, David Theidel, Sören Fortmann<br />
1002 (tarnzahl: 030186) – 3. Preis<br />
Léon Wolhage Wernik Architekten, Berlin<br />
Hilde Léon, Siegfried Wernik, Detlef Junkers, Philipp<br />
Jacob, Sven Pilz<br />
Lützow 7 Landschaftsarchitekten Cornelia müller<br />
& Jan Wehberg, Berlin<br />
Cornelia Müller, Jan Wehberg, Michèle Remy, Max<br />
Liebau<br />
1003<br />
1004<br />
1003 (tarnzahl: 151812) – 1. Rundgang<br />
JSWd Architekten/ olaf drehsen, köln<br />
Frederik Jaspert, Mikulasch Adam, Isabelle Diamant,<br />
Til Jäger, Rouja König, Linh Le, Christian Mammel,<br />
Michael Pflüger, Yohanna Vogt<br />
kLA kiparlandschaftsarchitekten, milano,<br />
duisburg<br />
Andreas Kipar, Susanne Günther, Kornelia Keil,<br />
Norbert Amberg<br />
1004 (tarnzahl: 222324) – 2. Rundgang<br />
Gruppe PLAnWeRk, Berlin<br />
Heinz Tibbe, Nicole Schlieker, Anja Seegert<br />
bgmr landschaftsarchitekten - Becker Giseke<br />
mohren Richard, Berlin<br />
Dr. Carlo Wolfgang Becker, Dirk Christiansen, Antje<br />
Herrmann, Helga Krüger, Martin Stokman, Stefan<br />
Wiebersinsky<br />
BLS Energieplan GmbH, Berlin<br />
Monath & Menzel Architektur-Modellbau, Berlin<br />
23
24<br />
1005<br />
1006<br />
1005 (tarnzahl: 688008) – 2. Rundgang<br />
deubzer könig + Rimmel Architekten, münchen<br />
Hannelore Deubzer, Maximilian Rimmel, Jan Pietraszewski,<br />
Julian Dostmann<br />
mahl Gebhard konzepte, münchen<br />
Johannes Mahl-Gebhard, Andrea Gebhard, Rüdiger<br />
Schätzler<br />
1006 (tarnzahl: 164413) – 2. Rundgang<br />
morpho-logic, Architektur + Stadtplanung,<br />
münchen<br />
Prof. Ingrid Burgstaller, Michael Gebhard, Laura<br />
Schmitt, Franziska Kress<br />
Lex kerfers_Landschaftsarchitekturen, Bockhorn<br />
Rita Lex-Kerfers, Michael Grünewald<br />
1007<br />
1008<br />
1007 (tarnzahl: 060393) – 1. Preis<br />
ferdinand heide Architekt BdA, frankfurt<br />
Ferdinand Heide, Lucie Stanclova, Victoria Zander<br />
toPoS Stadtplanung Landschaftsplanung Stadtforschung,<br />
Berlin<br />
Stephan Buddatsch<br />
1008 (tarnzahl: 762701) – 2. Rundgang<br />
numrich Albrecht klumpp Gesellschaft von Architekten<br />
mbh, Berlin<br />
Tiemo Klumpp, Michael Filser, Moritz Müller-Werther,<br />
Daniel Gleißenberg<br />
kubus freiraumplanung GbR, Wetzlar<br />
Rudolf Kaufmann, Maria Pegelow, Till Bacherer
1009<br />
1010<br />
1009 (tarnzahl: 220212) – 2. Rundgang<br />
heinrich Wörner Ramsfjell Architektenpartnerschaft,<br />
dortmund<br />
Fritz Heinrich, Anna Andress, Thorsten Börker<br />
B.S.L. Boyer Schulze Landschaftsarchitekten<br />
und ingenieure , Soest<br />
Klaus Schulze, Frau Cordes-Tölle<br />
1010 (tarnzahl: 601849) – 2. Rundgang<br />
Glass kramer Löbbert Architekten, Berlin<br />
Johann Kramer, Johnnes Löbbert, Lydia Ramakers<br />
BBz Landschaftsarchitekten timo herrmann,<br />
Berlin<br />
Timo Herrmann, Wieschen Sievers<br />
1011<br />
1012<br />
1011 (tarnzahl: 820911) – 2. Rundgang<br />
schneider + schumacher, frankfurt/main<br />
Joachim Wendt, Gordan Dubokovic, Esko Willman,<br />
Nikolai Hemmerich, Aleksandar Tepavcevic<br />
GtL Gnüchtel triebswetter Landschaftsarchitekten<br />
GbR, kassel<br />
Michael Triebswetter, Mingge Yu, Harald Noll, Betty<br />
Fan<br />
1012 (tarnzahl: 201513) – 2. Rundgang<br />
BS+ Städtebau und Architektur, frankfurt/main<br />
Torsten Becker, Henrike Specht, Julia Goldschmidt,<br />
Kerstin Formhals, Thorsten Stelter<br />
Adler & olesch Gmbh, mainz<br />
Stefan Bitter<br />
25
26<br />
1013<br />
1014<br />
1013 (tarnzahl: 861805) – 4. Preis<br />
hinrichs Wilkening Architekten, Berlin<br />
Ralf Wilkening, Sven Hinrichs<br />
A24 LAndSChAft, Berlin<br />
Steffan Robbl, Claudia Alvino, Shyuenwen Shyu,<br />
Francesca Guarascio, Sara Perovic, Ling Ma<br />
1014 (tarnzahl: 620741) – 1. Rundgang<br />
nickl & Partner Architekten, münchen<br />
Prof. Christine Nickl-Weller, Prof. Hans Nickl<br />
lohrer.hochrein landschaftsarchitekten, münchen<br />
Ursula Hochrein<br />
1015<br />
1016<br />
1015 (tarnzahl: 734528) – 1. Rundgang<br />
molestina Architekten, köln<br />
Prof. Pablo Molestina, Thorsten Schmedt,<br />
Mark Aseltine, Julia Siedle, Elisabeth Althoff, Philipp<br />
Hoppe; Modell: Roland Schmitz<br />
fSWLA Landschaftsarchitektur, düsseldorf<br />
Thomas Fenner, Simon Quindel<br />
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Köln<br />
Stahl + Weiß, Büro für Sonnenenergie, Freiburg<br />
1016 (tarnzahl: 385612) – Anerkennung<br />
apd architekten ingenieure, frankfurt/main<br />
Ulf Pauli, Frank Wagenknecht, Prof. Dirk Metzger,<br />
Andreas Schäfer<br />
Landschaftsarchitektur&Ökologie, darmstadt<br />
Angela Bezzenberger, Edda Gaudier
1017<br />
1018<br />
1017 (tarnzahl: 740786) – 1. Rundgang<br />
cs architekten, Berlin/ studio nelke, offenbach<br />
Christoph Sommer, Achim Nelke, Gavin Donahoe,<br />
Leonhard Weiche, Marie Huber<br />
kimberly Caruso, AiLA, Landschaftsarchitekten,<br />
Berlin<br />
Kimberly Caruso<br />
1018 (tarnzahl: 352715) – 1. Rundgang<br />
kleboth Lindinger zt Gmbh, Linz<br />
Andreas Kleboth, Clemens Hochreiter, Sabine Hainberger,<br />
Gerald Troch, Klaus Lindinger, Barbara<br />
Ranetbauer, Martin Scheuchenstuhl<br />
monsberger Gartenarchitektur Gmbh, Graz<br />
Gertraud Monsberger, Herrmann Simnacher<br />
1019<br />
1019 (tarnzahl: 041180) – 1. Rundgang<br />
SWAP architekten, darmstadt<br />
Stefan Wagner, Caroline Schmidt, Iris Kerber<br />
hdk dutt & kist Gmbh, Saarbrücken<br />
Hanno Dutt, Carlos Schmid, Katharina Rößler, Thamayanthini<br />
Mahinthan, Isabelle Morvai, Alexander<br />
Schug<br />
Schweitzer GmbH – Beratende Ingenieure,<br />
Saarbrücken<br />
Artools GmbH, CH-Zürich<br />
27
28<br />
1020<br />
1021<br />
1020 (tarnzahl: 808289) – 2. Preis<br />
kleyer.koblitz.letzel.freivogel gesellschaft von<br />
architekten mbh, Berlin<br />
Timm Kleyer, Alexander E. Koblitz, Ines Fleischer,<br />
Silvia Huth, David Land, Jörg Siegmüller;<br />
Visualisierung: Matthias Grobe<br />
hAhn heRtLinG von hAnteLmAnn Landschaftsarchitekten<br />
Gmbh, Berlin<br />
Inga Hahn, Dana Hucke, Kristian Dahlgaard, Martin<br />
Schmitz<br />
GRI, Gesamtverkehrsplanung, Regionalisierung und<br />
Infrastrukturplanung GmbH, Berlin<br />
1021 (tarnzahl: 425151) – Anerkennung<br />
hjp planer Prof. dipl. ing. Peter Jahnen, Aachen<br />
Prof. Peter Jahnen, Thomas Schweyen, Thomas<br />
Schrode<br />
hjp architekten Prof. dipl.-ing. Jürgen hauck,<br />
<strong>Gießen</strong><br />
Prof. Jürgen Hauck, Nicloas Savic, Bastian Sevilgen,<br />
Maximilian Niggel<br />
1022<br />
1023<br />
heinisch Landschaftsarchitekten, Gotha<br />
Thomas Heinisch, Daniel Rosenbaum<br />
1022 (tarnzahl: 504496) – 1. Rundgang<br />
Architekten BdA Poos isensee, hannover<br />
Wolfgang Poos, Ulrich Isensee, Peter Glaser,<br />
Monika Llobell, Steve Chudzinski<br />
nsp landschaftsarchitekten stadtplaner bdla/dwb<br />
Prof. Christoph Schonhoff, hannover<br />
Prof. Christoph Schonhoff, Anne Rohde<br />
1023 (tarnzahl: 137316) – Anerkennung<br />
PoLYfoRm Arkitekter ApS, dk-kopenhagen<br />
Thomas Kock, Jonas Sangberg, Henrik Fauerskov,<br />
Sofie Andreassen, Anne S. Okkels<br />
Masuch+ Olbrisch, Oststeinbek<br />
DOT2 – Rüter und Zeitnitz Freiraumplanung,<br />
Hamburg