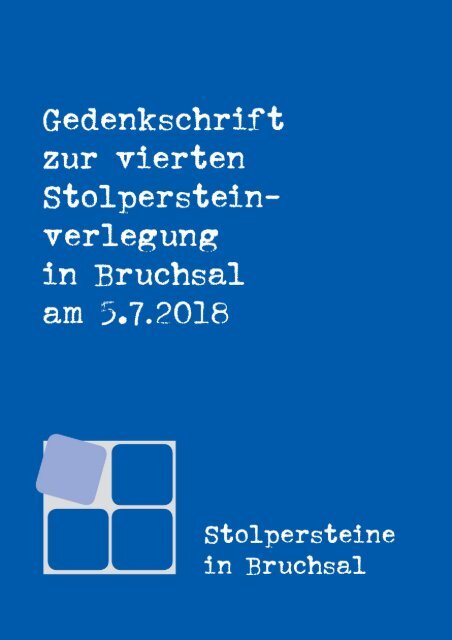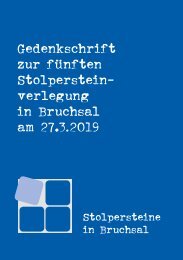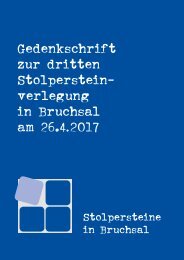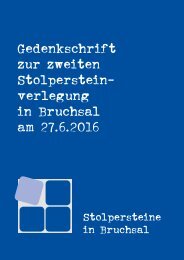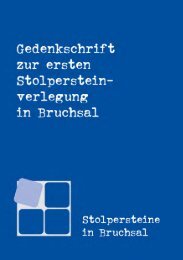Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grußwort<br />
der Oberbürgermeisterin<br />
Zum vierten Mal werden in unserer Stadt am Donnerstag,<br />
5. Juli, durch den Künstler Gunter Demnig<br />
an insgesamt sechs Standorten <strong>Stolpersteine</strong><br />
verlegt. Sie erinnern an Männer, Frauen und Kinder,<br />
die während der Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus<br />
vertrieben und ermordet wurden.<br />
Gunter Demnig selbst sagt über die Idee hinter<br />
seinem Projekt: „Mit den <strong>Stolpersteine</strong>n sind die<br />
Menschen plötzlich wieder gegenwärtig“.<br />
„Wieder gegenwärtig“: Das ist ohne Zweifel die<br />
zentrale Botschaft dieser kleinen, in den Boden<br />
eingelassenen Gedenksteine. Sie können nicht ungeschehen<br />
machen, was den Opfern angetan wurde,<br />
aber sie können die Betroffenen wieder in unser Bewusstsein rücken – als<br />
Warnung und Mahnung, dass Fanatismus und Rassismus immer und überall<br />
zur Bedrohung der Menschenrechte werden können.<br />
Einmal mehr gilt mein Dank allen an der Vorbereitung dieser Aktion Beteiligten<br />
– allen Spendern, allen Organisatoren, allen Ideengebern, namentlich der<br />
BürgerStiftung Bruchsal und der Bruchsaler Friedensinitiative. Herr Florian<br />
Jung, Lehrer am Justus-Knecht-Gymnasium, hat mit seiner Projektgruppe aus<br />
Schülern der 8. Klasse intensiv die Geschichte all jener NS-Opfer recherchiert,<br />
für die im Rahmen der diesjährigen Stolperstein-Aktion eine bleibende Erinnerung<br />
geschaffen wird. Ein besonderer Dank gilt Herrn Rolf Schmitt, dem es<br />
auch diesmal gelungen ist, zahlreiche bisher unbekannte geschichtliche Fakten<br />
aufzuarbeiten und viele familienkundliche Bezüge herzustellen. Und immer<br />
wieder dürfen wir es auch erleben, dass die heutigen Hausbesitzer an den Verlegestellen<br />
sich zustimmend zu der Aktion äußern und selbst aktiv nach dem<br />
Schicksal früherer Bewohner des Gebäudes fragen – eine besondere Form der<br />
Auseinandersetzung mit Geschichte.<br />
<strong>Stolpersteine</strong> sind Schritte hin auf ein dauerhaftes Erinnern, das nicht in geschichtlichem<br />
Rückblick stehen bleibt, sondern immer auch das bürgerschaftliche<br />
Bewusstsein für Ungerechtigkeit und Diskriminierung in der Gegenwart<br />
stärkt.<br />
Cornelia Petzold-Schick<br />
1
Einführung in das Schülerprojekt<br />
von Florian Jung, OStR am Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal<br />
Bereits zum dritten Mal bildete sich am Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal eine Projektgruppe<br />
aus Achtklässlern des G9-Zugs, um ein Schuljahr lang Biographien früherer<br />
jüdischer Mitbürger zu erforschen. Selbstverständlich gehört dazu eine gründliche<br />
Recherche in Büchern zum Thema, seien es die bekannten Werke von Stude oder Haus<br />
zur Geschichte der Juden in Bruchsal, seien es die alten Adressbücher der Stadt. Die<br />
Recherche im Internet wird ergänzt durch den in Kleingruppen durchgeführten Besuch<br />
im Generallandesarchiv Karlsruhe, dort lagern nämlich umfangreiche Akten der<br />
Wiedergutmachungsbehörden zu fast allen, die in diesem Jahr mit einem Stolperstein<br />
geehrt werden. Ganz besonders reizvoll ist für die Jugendlichen allerdings, in Kontakt<br />
zu kommen mit den Nachfahren oder Verwandten, die meist nicht mehr in Deutschland<br />
leben. In diesem Jahr mussten wir allerdings akzeptieren, dass die Enkelin eines<br />
Bruchsaler Holocaustopfers, wohnhaft in Uruguay, nicht mit uns kommunizieren<br />
wollte und Verwandte aus drei verschiedenen Zweigen der Mayer-Sippe kein Interesse<br />
an der Stolpersteinverlegung für Else und Selma Mayer zeigten. Umso mehr wurde uns<br />
aber klar, welche großzügige, wichtige und sehr geschätzte Geste es von den Angehörigen<br />
der Familien Geismar und Baertig/Schlessinger ist, dass gleich mehrere Vertreter<br />
beider Familien aus verschiedenen Teilen der USA und aus der Schweiz anreisen.<br />
Das inzwischen gut eingespielte Stolperstein-Organisationsteam, bestehend aus Rolf<br />
Schmitt, Thomas Adam und Florian Jung, freut sich ganz besonders, bei der diesjährigen<br />
Stolpersteinaktion Alex Calzareth und Michael Simonson aus New York dabei<br />
zu haben, die uns seit Jahren schon bei unseren Recherchen unterstützen. Ebenso gilt<br />
unser besonderer Dank Werner Schönfeld (Flehingen), Marlene Schlitz (Bruchsal),<br />
weiteren privaten Forschern und Mitarbeitern verschiedener Archive.<br />
Projektgruppe „<strong>Stolpersteine</strong>“ der 8. Klassen am Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal:<br />
Hinten von links: Ellen, Charlotte, Lina, Mia, Dominik, Raphael, Lukas<br />
Vorne von links: Jan, Nico, Marius, Volkan. Foto: Florian Jung.<br />
2<br />
Biografie von Ludwig Geismar (1869-1942)<br />
von Isaiah Blumhofer, Klasse 8s<br />
Ludwig Geismar wurde geboren am<br />
22.2.1869 in Bruchsal als Sohn des<br />
Eisenhändlers Leopold Geismar und<br />
dessen Frau Bertha Babette Weil. Diese<br />
stammten aus Breisach und Sulzburg<br />
in Südbaden, hatten sich im April<br />
1866 in Bruchsal niedergelassen und<br />
eine Eisenwarenhandung eröffnet.<br />
Ludwig wuchs zusammen mit zwei älteren<br />
Brüdern, Sigmund und Gustav,<br />
und einer jüngeren Schwester, Mathilde,<br />
auf. Von Ludwig ist im Generallandesarchiv<br />
Karlsruhe eine Personenbeschreibung aus dem Jahre 1893 erhalten: „1,72 bis<br />
1,74 m groß, hellblonde Haare, kleines blondes Schnurrbärtchen, gesunde Gesichtsfarbe.<br />
Beruf: Eisenreisender.“<br />
Ludwig heiratete 1900 in Neckarsteinach die von dort stammende Kaufmannstochter<br />
Ida Ledermann. Das Paar bekam zwischen 1901 und 1909 fünf Kinder, vier Söhne und<br />
eine Tochter.<br />
Über die Größe des Geschäfts gibt es unterschiedliche Angaben.<br />
Geismars Sohn Otto schrieb 1959, dass die Eisenwarengroßhandlung<br />
im Durchschnitt drei Angestellte, vier Arbeiter<br />
und zwei Lehrlinge beschäftigte, außerdem war er selbst seit<br />
1924 im Betrieb tätig. Zusätzlich gab es ein gemietetes Lager<br />
im Holzmarkt 15 (Gastwirt Erchinger) sowie einen gemieteten<br />
Lagerplatz am Güterbahnhof. Verkauft wurden Eisenwaren an<br />
Handwerker, Baugeschäfte, kleine Eisenwarenhandlungen, außerdem<br />
Öfen „en gros et en detail“. Geismar hatte das Alleinverkaufsrecht<br />
der bekannten „Eibelshäuser Hütte“ für Baden und<br />
Württemberg. Weitere Lieferanten waren: Weil und Reinhardt<br />
(Mannheim), Röchling (Saarbrücken), Gebrüder Späth (Mannheim),<br />
Emailfabrik Ullrich (Annweiler/Pf.) . Der Kundenkreis<br />
dehnte sich bis nach Offenburg, Villingen, Stuttgart, Esslingen,<br />
Mosbach und Wiesloch. Entweder Ludwig, Sohn Otto oder<br />
ein Angestellter waren immer als Reisende tätig. Bedeutender<br />
Geschäftspartner war auch das Landesgefängnis Bruchsal mit<br />
Grabstein von Leopold und<br />
Berta Geismar, Jüdischer<br />
Friedhof Bruchsal. F.: Jung.<br />
Feuerwehrübung 1933. Links Eisenhandlung Geismar,<br />
rechts Gasthaus „Zum Einhorn“. Foto: E. Habermann.<br />
bis zu 15.000 RM Umsatz monatlich. Das fiel 1933 <strong>komplett</strong><br />
weg. Otto charakterisierte den Vater als „angesehenen Bürger<br />
in Bruchsal“, der sein Leben lang gut verdiente. Er schrieb: „Der<br />
3
Verfolgte hatten einen bedeutenden Eisenhandel in<br />
Bruchsal. Er hatte Wertpapiere und ein Bankguthaben<br />
bei der Süddeutschen Diskonto-Gesellschaft in<br />
Bruchsal. Infolge der Verfolgungsmaßnahmen hat er<br />
sein gesamtes Vermögen verloren. Infolge des Boykotts<br />
ist auch das Geschäft von 1933 an beträchtlich<br />
zurückgegangen.“<br />
Ein früherer Angestellter erinnerte sich 1959 so:<br />
Im Geschäft arbeiteten Ludwig Geismar und sein<br />
Sohn Otto Siegfried, außerdem sei „ab und zu“<br />
auch seine Tochter als Stenotypistin dort tätig gewesen.<br />
In der Zeit von 1927 bis 1931 habe man<br />
Werbung von Ludwig Geismar im Bruchsaler<br />
Adressbuch, Jahrgang 1920-21. F.: Jung.<br />
zwei Angestellte und ein Arbeiter beschäftigt. Nach 1931 sei das Geschäft immer weiter<br />
zurückgegangen und bereits vor 1933 sei der Betrieb stark verschuldet gewesen.<br />
Das Amt für Wiedergutmachung stellte fest, dass 1932 ein Konkursverfahren über den Betrieb<br />
eröffnet wurde, Ludwig Geismar aber den Betrieb eingeschränkt selbst weiterführen<br />
durfte, und sich das Konkursverfahren bis 1936 erstreckte. Das Haus Holzmarkt 3 sei 1935<br />
zwangsversteigert worden, in den Besitz der Sparkasse Bruchsal übergegangen und Januar<br />
1936 von Architekt Gustav Löffler erworben worden. Der Eintrag ins Handelsregister gibt<br />
Auskunft, dass Ludwig Geismar bis 29. April 1936 Inhaber der Eisenwarenhandlung am<br />
Holzmarkt 3 war, dann erfolgte Schließung oder Verkauf.<br />
Am 22.10.1940 wurde Ludwig zusammen mit seiner Frau Ida nach Gurs deportiert, seine<br />
Schwester Mathilde Lehmann wurde von Mannheim aus ebenfalls nach Gurs deportiert.<br />
Von Gurs kam Ludwig Geismar, wohl schon krank, am 26.1.1942 ins Lager Recebedou. Er<br />
starb am 11.2.1942 in Portet-sur-Garonne, dem Hospital (Krankenhaus) des Lagers Recebedou.<br />
Die Bestattung erfolgte auf dem jüdischen Friedhof in Portet St. Simon.<br />
Biografie von Ida Geismar geb. Ledermann<br />
(1874-1945)<br />
von Volkan Kabay, Klasse 8s<br />
Ida Ledermann wurde am 21. September 1874 in Neckarsteinach geboren. Ihre Eltern waren<br />
Max Ledermann, welcher als Kaufmann in Neckarsteinach arbeitete, und Jeanette Simon.<br />
Ida hatte drei Brüder und zwei Schwestern. Ein Schicksalstag für Ida war sicher der<br />
16.9.1888, denn an diesem Tag starb nachmittags um ca. drei Uhr ihre Mutter im jungen<br />
Alter von 44 Jahren. Am selben Tag abends um „neun einhalb Uhr“ starb auch ihre nur neun<br />
Jahre alte Schwester Berta. Der ältere Bruder Josef (1872-1935) war später mehr als 25 Jahre<br />
Gemeindevorsteher in der Heimatgemeinde Neckarsteinach und hatte dort sieben Kinder,<br />
seine Witwe Emma wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Idas Schwester Sophie (geboren<br />
1876) lebte in Stuttgart und beging 1942 zusammen mit ihrem Mann Max Mayer Suizid,<br />
der Bruder Moritz (1982) lebte in Frankfurt und wurde 1941 mit seiner Frau Minna in Lodz<br />
ermordet. Von Bruder Sigmund Ledermann (geboren 1881) fehlt uns heute jede Spur.<br />
Als Ida am 15.5.1900 nach Bruchsal heiratete, lebte in der Eisenhandlung, die von Idas Ehemann<br />
Ludwig betrieben wurde, noch dessen Mutter Berta Geismar geb. Weil. Diese zog<br />
1911 nach Landau zu ihrer Tochter Mathilde. Dort verstarb sie dann auch 1927, wurde aber<br />
in Bruchsal beerdigt.<br />
Ida und Ludwig Geismar hatten fünf Kinder: Die Namen ihrer<br />
vier Söhne lauteten: Friedrich Leopold (1901), Ernst Josef<br />
(1902), Eugen (1904) und Otto Siegfried (1906). Die Tochter<br />
hieß Lucie Jeanette (1909). Sohn Ernst starb mit acht Monaten<br />
und ist auf dem Bruchsaler Friedhof beerdigt. Alle anderen<br />
Kinder erhielten eine überdurchschnittliche schulische<br />
Ausbildung: Friedrich Leopold, genannt „Fritz“, besuchte die<br />
Oberrealschule von 1910 (Klasse VI) bis 1915/16 (Austritt in<br />
Klasse UIII), Eugen war dort von 1913 (Klasse VI) bis mindestens<br />
1918/19 (Klasse OIII). Otto war von 1916 (Klasse<br />
V) bis mindestens 1918/19 dort. Tochter Lucie besuchte die<br />
Höhere Mädchenschule in Bruchsal. Beides sind Vorgängerschulen<br />
des Justus-Knecht-Gymnasiums.<br />
Grabstein Ernst Geismar. F.: Jung.<br />
Sohn Fritz ist 1921 nach Argentinien ausgewandert. Zuletzt war er 1932 zu Besuch bei seinen<br />
Eltern in Bruchsal. Bis in die 1950er Jahre hatten seine Geschwister keine Idee, was aus<br />
ihm geworden war oder wo er sich befand. Sohn Eugen starb am 22.7.1933, morgens um<br />
ca. 6 Uhr plötzlich in Bruchsal, in der Wohnung seiner Eltern, an einer Sepsis (Blutvergiftung).<br />
Der Vater ging persönlich aufs Standesamt, um dort den Tod zu melden. Otto verließ<br />
Bruchsal ebenfalls 1933 und Lucie Jeanette 1934. Es wird Ida sicher schwer gefallen zu sein,<br />
alle ihre Kinder in so kurzer Zeit gehen lassen zu müssen.<br />
Ida Geismar wohnte bis 1936 im Haus Holzmarkt 3, wo ihr Mann die Eisenwarenhandlung<br />
hatte (Siebenzimmerwohnung). Wann genau sie auszogen, ist unklar. Nach dem Hausverkauf<br />
1935 zogen sie im April 1936, so die Aussage des Käufers, Architekt Löffler, in die Friedrichstraße<br />
29 zum jüdischen Kaufmann Alfred Bär und bewohnten dort eine 4-Zimmer-<br />
Wohnung. Schwiegersohn Lazarus Benjamin de Vries besuchte sie angeblich dort schon im<br />
Februar 1936, und zusammen mit seiner Frau Lucie de Vries nochmals im Sommer 1937.<br />
Diese Wohnung war mit den Möbeln des Holzmarkt 3 sehr gut eingerichtet und hatte ein<br />
Esszimmer, einen Salon, ein Schlafzimmer und ein Fremdenzimmer. Im Adressbuch von<br />
1938 liest man allerdings noch Holzmarkt 3, was höchstwahrscheinlich fehlerhaft ist. Geismars<br />
hatten in ihrem alten Haus Holzmarkt 3 allerdings noch ein Lager mit Restbeständen,<br />
wo auch die restlichen Möbel untergestellt waren (Wohnzimmer, Schlafzimmereinrichtungen<br />
der beiden Brüder). Nach Erinnerung der Hausnachbesitzer der Friedrichstr. 29 (Bohn)<br />
sind Geismars Ende 1938 in die Pfarrstr. 3 zum Ehepaar Simon und Luise Sandler gezogen.<br />
Ida musste wie alle vermögenden Juden Schmuck und Gold 1938/39 abgeben und hatte<br />
4 5
einen Transportkanal über ihren Bruder Moritz Ledermann, wohnhaft in Frankfurt, gefunden,<br />
die Wertsachen illegal nach Holland zur Tochter Lucie zu bringen. Da sich der Schwiegersohn<br />
aber weigerte, einen illegalen Weg zu beschreiten, weil er Schwierigkeiten mit den<br />
holländischen Zollbehörden fürchtete, wurde aus dem Plan nichts. Es war eine goldene Herrenuhr,<br />
eine goldene Damenuhr, mehrere Ringe und Ketten sowie Tafelsilber.<br />
Am 22.10.1940 wurden Ida und ihr Mann nach Gurs deportiert. Die Einrichtungsgegenstände<br />
der Familie Geismar – und vieler anderer – wurden kurz nach der Deportation in den<br />
Saal des Gasthauses „Zum Löwen“ in der Durlacher Straße gebracht und dort von Beamten<br />
der Gerichtsvollzieherei Bruchsal im Auftrag der Oberfinanzdirektion versteigert. Geismars<br />
Einrichtung brachte 1082,05 Reichsmark Erlös.<br />
Ida kam wohl am 26.1.1942 von Gurs nach Recebedou zusammen mit ihrem Mann, der<br />
drei Wochen später im dortigen Krankenhaus verstarb. Sie war dann vom 25.3.1943 bis zum<br />
22.11.1945 im Camp de Masseube. Die Alliierten befreiten das Lager bereits am 25.8.1944<br />
von den Nazis, Ida lebte aber scheinbar weiterhin dort. Sie kam dann Ende 1945 nach Lacaune<br />
bei Toulouse ins Hotel „Fusies“, das von einer jüdischen Hilfsorganisation zur Beherbergung<br />
überlebender Juden als Erholungsheim gemietet worden war. Es waren Briefe<br />
an ihre Kinder erhalten, die von Ida Geismar am 28.6.1945 und am 13.7.1945 in Masseube<br />
noch selbst geschrieben wurden. Ein Brief vom November 1945 aus Lacaune wurde diktiert,<br />
da Idas Krankheit es ihr nicht mehr erlaubte, selbst zu schreiben. Sohn Otto berichtete 1957,<br />
dass er keine Gelegenheit mehr hatte, seine Mutter nochmals wiederzusehen.<br />
Opfer befreundet war, bezeichnete die Tat im Prozess<br />
als Scherz, der Staatsanwalt als Gemeinheit, die<br />
Bruchsaler Zeitung als „riesige Dummheit“. Die Haft<br />
endete also Anfang Oktober, was passen würde zur<br />
Auswanderung Otto Geismars im Oktober 1933.<br />
Einiges dabei bleibt völlig rätselhaft und widersprüchlich:<br />
Der in den Wiedergutmachungsakten erhaltene<br />
polizeiliche Strafregisterauszug des Otto Siegfried<br />
Geismar von 1958 nennt KEINE Vorstrafen. Außerdem<br />
liegt ein Schreiben des damaligen Oberbürgermeisters<br />
Bläsi von 1949 vor, das bestätigt, dass Otto<br />
Geismar in Bruchsal einen untadeligen Ruf hatte: „Es<br />
ist der Stadtverwaltung nicht bekannt, dass Herr Otto<br />
Geismar jemals in polizeilicher Hinsicht in Erscheinung<br />
getreten ist. Nachteiliges ist über ihn nicht bekannt geworden.“<br />
Auch das hätte er nicht geschrieben, wenn<br />
Otto Geismar tatsächlich der Erpresser gewesen wäre.<br />
Fakt ist, dass das Badische Bezirksamt Bruchsal am<br />
5.10.1933 einen Pass für Otto Geismar ausstellte, dass<br />
Otto am 8.10.1933 ein Visum für Frankreich erhielt,<br />
Otto Geismar, 1933. Foto: GLA<br />
Karlsruhe 480 Nr. 13219.<br />
Selbst verfasster Lebenslauf von Otto<br />
Siegfried Geismar aus dem Jahr 1959.<br />
Foto: GLA Karlsruhe, 480 Nr. 30626/1.<br />
Biografie von Otto Geismar (1906- nach 1972)<br />
von Mubarak Naveed, Klasse 8t<br />
Otto Siegfried Geismar wurde als jüngster Sohn von Ludwig und Ida Geismar am 28. April<br />
1906 in Bruchsal geboren. Ab 1912 besuchte er die Grundschule und danach die Oberrealschule<br />
Bruchsal bis zum Einjährigen (von 1916 bis ca. 1920/21). Danach wurde Otto bis<br />
zum Jahr 1922 Lehrling bei der Malzfabrik „Hockenheimer & Hilb“ in Bruchsal. Nachdem<br />
Bruder Fritz 1920 nach Argentinien ausgewandert war, war vorgesehen, dass Otto<br />
das Geschäft des Vaters übernimmt. Daher arbeitete er von 1922 bis 1924 als Volontär bei<br />
der Eisen-Großhandlung „Fa. Gimbel und Neumond“ in Ludwigshafen. 1924 ist er ins väterliche<br />
Geschäft eingetreten und wurde dort mit allen wesentlichen Tätigkeiten vertraut<br />
gemacht: Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, Reisen.<br />
Mehrere Artikel in der Bruchsaler Zeitung und im Führer berichten im Februar 1933 von<br />
einem Erpressungsversuch: Der jüdische Kaufmann Ernst Ludwig Münzesheimer erhielt<br />
am 7.2.1933 einen Erpresserbrief, nach dem er 300 Mark bei der Post hinterlegen solle,<br />
andernfalls drohe Mord. Der Brief war mit „Ein Nationalsozialist“ unterschrieben. Die<br />
Polizei ermittelte aber Otto Geismar als Täter, nachdem ein Bote das Geld bei der Post<br />
abgeholt hatte. Ein Schöffengericht in Karlsruhe verurteilte ihn zu 7 Monaten 15 Tagen<br />
Zuchthaus unter Anrechnung der 6 Wochen Untersuchungshaft. Geismar, der mit dem<br />
6<br />
7
und dass der Grenzübertritt bei Kehl am 20.10.1933 erfolgte. Auch das Arbeitsverbot in<br />
Frankreich ist in den im Original erhaltenen Pass eingestempelt. Übrigens liefert der Pass<br />
auch eine Personenbeschreibung: Gestalt mittel, Gesicht oval, Augenfarbe braun, Haarfarbe<br />
braun. Wie es sich mit den Gründen der Ausreise genau verhielt, wird wohl nie genau<br />
zu klären sein. Otto Geismar gab mehrfach an, dass ihm eine Verhaftung im Oktober<br />
1933 drohte, weil er Mitglied des „Reichsbanners“ war. An anderer Stelle schrieb er, dass<br />
er Bruchsal am 2. April 1933 nachts verlassen musste. Das Betrugsverfahren jedenfalls<br />
erwähnte er an keiner Stelle!<br />
Der von Otto Geismar selbst verfasste Lebenslauf ist noch insoweit zu ergänzen, als dass er<br />
um 1960 persönlich in Bruchsal war und mehrere ehemalige Geschäftspartner seines Vaters<br />
traf, die bereit waren, ihre Geschäftsbeziehungen vor dem Amt für Wiedergutmachung zu<br />
bestätigen. Inzwischen hatte Otto die französische Staatsangehörigkeit angenommen. Über<br />
eine Eheschließung ist nichts bekannt – Otto war wohl zeitlebens unverheiratet. Als das bisher<br />
letzte bekannte „Lebenszeichen“ muss gewertet werden, dass er im Wählerverzeichnis<br />
von Sevres genannt wurde – und dort am 6.11.1972 aus unbekanntem Grund gelöscht wurde:<br />
Er verstarb nicht in Sevres, aber vielleicht anderswo? Oder zog er um? Frankreich kennt<br />
keine Meldebehörden, die dies registrieren würden. Somit ist sein Todesdatum unbekannt.<br />
Biografie von Lucie de Vries geb. Geismar<br />
(1909-2000)<br />
von David Nikolic, Klasse 8v, und Florian Jung<br />
Lucie Jeanette Geismar wurde am 23.4.1909 in Bruchsal geboren. Sie besuchte seit September<br />
1918 die Höhere Mädchenschule Bruchsal (Eintritt in Klasse 7), nachdem sie zuvor auf<br />
einer Privatschule die 4. Klasse besucht hatte. Sehr erfolgreich war sie dort allerdings nicht,<br />
und trat daher zu Ostern 1923 wieder aus. Später besuchte sie eine Abend-Handelsschule<br />
in Bruchsal und war im Geschäft ihrer Eltern gelegentlich als Stenotypistin/Korrespondentin<br />
und Verkäuferin tätig. Dort konnte Lucie nach dem Geschäftsrückgang des Vaters<br />
nicht weiterarbeiten und als Jüdin in Deutschland auch keine andere Anstellung finden.<br />
Bis zu ihrer Auswanderung nach Holland am 24.5.1934 wohnte sie in ihrem Elternhaus<br />
Holzmarkt 3, Bruchsal. In Holland arbeitete sie zunächst als Dienstmädchen, da ihr eine<br />
Arbeitserlaubnis als kaufmännische Angestellte verweigert wurde.<br />
Im Februar 1936 kam ihr Verlobter, der Exportagent Lazarus Benjamin de Vries nach<br />
Bruchsal, um bei Geismars um die Hand der Tochter anzuhalten. Er war geboren am<br />
23.9.1897 in Amsterdam und hatte 1911 bis 1915 die Mittlere Handelsschule in Amsterdam<br />
besucht. Seinen Beruf „Exportagent“ hatte er hauptsächlich in der Praxis gelernt.<br />
Kurz vor der Hochzeit (10.9.1936) wurde von Geismars die <strong>komplett</strong>e Aussteuer nach<br />
Holland übersandt: Wäsche, vollständig eingerichtete Küche, ein Doppelschlafzimmer,<br />
Ess-Service, Silberbestecke usw., alles durchweg neu angeschafft – nach und nach, seitdem<br />
Lucie 12 Jahre alt war. Dazu wurde auch ihr weiß lackiertes Mädchenschlafzimmer nach<br />
Holland übersandt. Im Sommer 1937 kam Lucie mit ihrem Mann nach Bruchsal zu den<br />
Eltern, da sahen sie sich das letzte Mal. Lucie führte eine lebhafte Korrespondenz mit ihren<br />
Eltern bis zu deren Deportation im Oktober 1940 – sie schrieb fast jede Woche.<br />
Lucie und Benjamin de Vries mussten ab Mai 1942 den Judenstern tragen und wenig<br />
später in den Untergrund gehen. Die Eltern ihres Mannes, die Schwestern und Schwäger<br />
wurden alle gefasst und in Sobibor ermordet. Aus dieser Familie gelang es allein Lucie und<br />
Benjamin de Vries, versteckt zu überleben. Nach Beendigung der Verfolgung musste Lucie<br />
wegen sehr schwerer Blutarmut jahrelang Leberspritzen bekommen. Wegen des allgemeinen<br />
Schwächezustands wurde sie Anfang 1947 für sechs Wochen ins Centrale Israelitische<br />
Krankenhaus Amsterdam aufgenommen. Lucies gesundheitliche Schäden, die sie noch<br />
viele Jahre beeinträchtigten, würde man heute als posttraumatische Störungen diagnostizieren.<br />
Damals hieß es im ärztlichen Gutachten: „Es handelt sich um eine nervöse, aber<br />
gesunde, um ihre Gesundheit ängstliche Frau.“ Bei einer Untersuchung 1961 wird außerdem<br />
festgehalten, dass Lucie „164 cm groß ist, 56 kg wiegt, und einen äußerlich gesunden<br />
Eindruck macht. Kinder oder Schwangerschaften gab es keine.“ Entschädigungszahlungen<br />
wurden letztlich vom Amt für Wiedergutmachung in Karlsruhe abgelehnt.<br />
Benjamin de Vries arbeitete in den 1960ern als Exportagent in Amsterdam, wo das Paar<br />
auch bis in ein relativ hohes Alter lebte. Benjamin starb am 13.6.1992 im Alter von 95 Jahren,<br />
Lucie 91-jährig am 22.3.2000.<br />
Aus dem Antrag zur Entschädigung körperlicher<br />
Beeinträchtigungen, eingereicht beim Amt für<br />
Wiedergutmachung Karlsruhe.<br />
Foto: GLA Karlsruhe 480 Nr. 25363/1.<br />
8 9
Familie Leopold und Bertha Geismar<br />
(Eltern von Ludwig Geismar)<br />
Leopold Geismar<br />
* 20.02.1836 Breisach-Altbreisach † 15.12.1897 Bruchsal<br />
(Sohn v. Süßkind Geismar (1799-1880), Breisach, und Johanna Weil (1802-1876))<br />
1866 Bürger in Breisach; seit 04.1866 Kaufmann in Bruchsal (1897: Holzmarkt 3), Eisenwarenhandlg.<br />
verh. um 1865 (nicht in Sulzburg, 1862-1866 nicht in Breisach)<br />
Bertha (Babette) Weil * 05.04.1843 Sulzburg † 16.10.1927 Landau<br />
(Tochter v. Josua Weil (1808-?), Schutzbürger und Kaufmann, und Sarah Rieß (1810-1895))<br />
4 Kinder:<br />
1. Sigmund Geismar * 05.06.1866 Bruchsal † 13.09.1932 New York<br />
1883 Auswanderung in die USA, Waiter, Clerk in New York<br />
verh. 28.11.1889 Manhattan/NY Ida Johnson * 04.08.1865 Schweden † 19.02.1910 New York<br />
(T. v. Svend Johnson und Marie Svendsen)<br />
verh. 18.10.1911 Washington D.C. Helen Stern * ~1870 † um 1950<br />
5 Kinder:<br />
a) Florence Geismar * 03.08.1890 New York † 02.08.1984 Atlanta/GA<br />
verh. James A. Millar * 04.01.1892 Edinburgh/GB † 23.05.1979 Atlanta/GA<br />
2 Kinder: Florence E. Millar (1917-1993); James R Millar (1921-2006)<br />
b) Mathilde Geismar * 19.11.1891 Manh./NY † 1893? bzw. um 1895<br />
c) Gustave Geismar * 12.03.1893 Manh./NY † 23.06.1894 Philadelphia/PA<br />
d) Sigmund John * 11.01.1895 Pensylvania † 18.06.1977 an Bord der SS<br />
= Sydney J. Geismar Kingsholm auf dem Weg nach GB;<br />
verh. 1. Ehe: Anna Elizabeth Allen * um 1898<br />
verh. 2. Ehe: Martha Veyner * 24.12.1909 Tschechien † 18.11.1979 Suffern/NY<br />
3 Kinder (aus 1. Ehe): Margaret Edith Geismar vh. Happe (1920-2007);<br />
Jane Elizabeth Geismar (1929-1993); Mary Geismar vh. McCormick (* um 1938)<br />
1 Kind (aus 2. Ehe): Martha Suzan Geismar (* um 1944) vh. Fitzpatrick<br />
e) Leopold William Geismar * 01.10.1899 New York † 15.04.1975 Pinellas/FL<br />
verh. Margaret M. Innes * 12.07.1897 New York † 28.08.1971 Pinellas/FL<br />
2 Kinder: Leo William Geismar Jr. (1921-2005); Edward Vincent Geismar (1921-1998)<br />
2. Gustav Geismar (Geißmar) * 29.08.1867 Bruchsal † 09.01.1927 Zürich/CH<br />
1899 Kaufmann in Zürich, 1920 eingebürgert in Schweiz<br />
verh. Jenny Weil<br />
* 23.12.1862 Zürich/CH † 10.06.1940 Zürich/CH<br />
(T. v. Leopold Weil (1834-1914, Br. v. Bertha Weil (s.o.)) u. Sophie Sara Arnstein (1833-1881))<br />
1 Kind:<br />
a) Peter Geismar (Geissmar) * 17.05.1909 Zürich/CH † 19.01.1981 Bachenbülach/CH<br />
wohnte 1949 in Zürich, Wehntaler Str. 197c; wohnte seit 1957 in Bachenbülach/CH<br />
verh. 1. Ehe: Madeleine Stump * 19.04.1920 Zürich/CH † 25.08.1996 Zürich/CH<br />
verh. 2. Ehe: Elizabeth Keim * 13.11.1912 Steckborn † 30.03.1988 Bülach/CH<br />
3 Kinder (aus 1. Ehe): Alfred Herbert Geissmar (1941-1995); Eva Geissmar vh. Davi (*1942),<br />
Gabrielle Geissmar vh. Ryf (*1947)<br />
3. Ludwig (Libman) Geismar * 22.02.1869 Bruchsal † 11.02.1942 Portet sur Gne./F<br />
Kaufmann, bis 04.1936 Inhaber Eisenwarenhandlung, Holzmarkt 3, Bruchsal; 22.10.1940 Gurs<br />
verh. 15.05.1900 Neckarsteinach<br />
Ida Ledermann<br />
* 21.09.1874 Neckarstein. † 18.12.1945 Lacaune-Les-Bains/F<br />
(T. v. Max Ledermann (1842-1911), Kaufmann in Neckarsteinach u. Jeanette Simon, (1844-1888))<br />
22.10.1940 nach Gurs, 26.01.1942 nach Recebedou, interniert 03.1943-11.1945 in Maseubes<br />
5 Kinder:<br />
a) Friedrich Leopold Geismar * 15.02.1901 Bruchsal † 22.06.1950 Buenos Aires<br />
1920 Auswanderung nach Buenos Aires, Argentinien, 1932 zuletzt zu Besuch in Bruchsal<br />
vh. 25.02.1943 Manuela Norberta Valdez * 06.06.1903 Cap Fec/Arg. † nach 1963<br />
1963 in Buenos Aires wohnhaft<br />
b) Ernst Josef Geismar * 07.07.1902 Bruchsal † 11.03.1903 Bruchsal<br />
c) Eugen Geismar * 20.12.1904 Bruchsal † 22.07.1933 Bruchsal<br />
Kaufmann in Bruchsal, in der Wohnung der Eltern an Sepsis verstorben, unverheiratet<br />
d) Otto Siegfried Geismar * 28.04.1906 Bruchsal † nach 1972<br />
Einjähriges an Oberrealschule Bruchsal, 1924-1933 Kaufmann im väterl. Geschäft, 10.1933<br />
Flucht nach Straßburg, 1936-1945 sowie 1950-1956 Fremdenlegion Indochina, 1946-1949<br />
Casablanca, seit 1956 bei Citroen in Paris, wohnte 1960/72 in Sevres bei Paris, unverheiratet<br />
e) Lucie Jeanette Geismar * 23.04.1909 Bruchsal † 22.03.2000 Amsterdam<br />
bis 1923 Höhere Mädchenschule Bruchsal, 1927-1934 im väterl. Geschäft, 05.1934 nach Holland,<br />
Dienstmädchen, 09.1942-05.1945 versteckt in Holland, wohnte 1963 in Amsterdam, kinderlos<br />
vh. 10.09.1936 Lazarus Benjamin de Vries * 23.09.1897 Amsterdam † 13.06.1992 Amst.<br />
(S. v. Wolf Benjamin Lazarus de Vries (1864-1943) und Rebecca Mozes (1874-1943))<br />
09.1942-05.1945 versteckt, Patentinhaber, 1965 Export-Agent, wohnhaft in Amsterdam<br />
4. Mathilde Geismar * 12.01.1871 Bruchsal † 25.05.1942 Gurs<br />
Kaffee- und Teehändlerin in Landau, 11.1939 von Landau nach Mannheim (Jüd. Altersheim)<br />
verzogen, 22.10.1940 Gurs<br />
vh. 17.05.1899 Bruchsal Gustav Lehmann * 23.01.1859 Böchingen † 10.06.1922 Landau<br />
(S. v. Samuel Lehmann, Weinhändler, und Barbara Kaufmann, 1. Ehe Sofie Rothschild, geschieden)<br />
Weinkommissionär in Landau, wahrscheinlich keine Kinder – jedenfalls keine, die WK II überlebten.<br />
Von links: Gustav Geismar (1867-1927), Florence Millar geb. Geismar (1890-1984), Sydney J. Geismar<br />
(1895-1977), Leopold William Geismar (1899-1975). Foto 1: Eva Davi, Foto 2-4: Anita Geismar.<br />
10 11
Biografien von Else Mayer (1883-1940)<br />
und Selma Mayer (1887-1942)<br />
von Dominik Stritt, Klasse 8u<br />
Die Geschwister Mayer wurden in<br />
Bruchsal geboren: Else Mayer wurde am<br />
21.11.1883 geboren als das älteste Kind<br />
von Maier Mayer und Jeanette Mayer<br />
geb. Herz. Die Familie hatte noch ein<br />
Mädchen und einen Jungen. Else Mayer<br />
wuchs mit ihrer Schwester Selma Mayer,<br />
geboren am 9.11.1887, und ihrem Bruder<br />
Ludwig Mayer, geboren am 7.5.1890, auf. Friedrichstraße 40, vom Kaufhaus Knopf Richtung<br />
Ludwig starb jedoch schon am 16.8.1896 Friedrichsplatz gesehen. Foto: Stadtarchiv Bruchsal.<br />
im Alter von sechs Jahren und ist auf dem jüdischen Friedhof in Bruchsal bestattet.<br />
Grabstein von Marie und Jeanette Mayer auf<br />
dem Jüdischen Friedhof Bruchsal. Foto: F. Jung.<br />
Der Vater Maier Mayer war der Sohn von Hauptlehrer Leopold Mayer und Rosa Weil. Leopold<br />
war ab 1842 Hauptlehrer in Nonnenweier, Rosa gebar 16 Kinder zwischen 1844 und<br />
1865. Beide starben in Bruchsal 1894 und 1892 und waren in ihren letzten Jahren auch<br />
hier wohnhaft, wahrscheinlich beim Schwiegersohn<br />
Max Flehinger. Maier Mayer war<br />
zum Zeitpunkt seiner Hochzeit 1883 schon<br />
Kaufmann in Bruchsal, ebenso sein Bruder<br />
Emil Mayer, der ab 1883 ein Wäschegeschäft<br />
in Würzburg betrieb. Das Weißwaren- und<br />
Ausstattungsgeschäft von Maier Mayer lag zunächst<br />
in der Friedrichstraße 19 in Bruchsal.<br />
Am 23.5.1889 konnte er das Haus Friedrichstraße<br />
40 von Heinrich Katz erwerben und<br />
Wohnung und Geschäft dorthin verlegen. Das<br />
Haus wurde um 1830 erbaut.<br />
Sicher hatte Maier Mayer engen Kontakt zu<br />
seiner Schwester Emilie Flehinger geb. Mayer,<br />
die 1881 den Hauptlehrer Max Flehinger in<br />
Bruchsal heiratete. Flehinger war 1883 Trauzeuge<br />
bei Maier Mayer, außerdem war Flehinger<br />
Religionslehrer und wohnte 1904 in der<br />
Friedrichstraße 76, neben der Synagoge, und<br />
hatte acht Kinder, zwischen 1882 und 1896 geboren.<br />
Diese waren sicher eng vertraut mit den<br />
Cousinen Else und Selma Mayer.<br />
Werbung von Else Mayer im Adressbuch<br />
Bruchsal 1931-32. Foto: Florian Jung.<br />
Maier Mayer starb 1916 und seine Witwe Jeanette<br />
geb. Herz, aus Kochendorf bei Heilbronn stammend,<br />
wurde Inhaberin des Wäschegeschäfts.<br />
Wahrscheinlich wurde es hauptsächlich von Tochter<br />
Else Mayer geführt, die es nach dem Tod der<br />
Mutter 1925 auch weiterführte. Während die beiden<br />
allerdings 1925 noch alleine im Haus wohnten,<br />
wurde das Geschäft um 1926 ins Obergeschoss verlegt,<br />
und der Laden im Erdgeschoss wurde an die<br />
„Bayerische Schokoladenhaus GmbH“ vermietet.<br />
Selma Mayer verzog am 8.8.1914 nach München,<br />
Bavariaring 24, wo sie im Haushalt ihres Onkels<br />
Isaak Mayer arbeitete. Mit zur Familie gehörte Isaaks Frau Isabella, der Schwiegervater Jakob<br />
Kubitschek und Selmas Cousin Eugen Mayer, damals gerade 18 Jahre alt. Nach der<br />
Verheiratung des Cousins 1928 und dem Tod des Onkels 1930 zog sie zusammen mit der<br />
Tante Isabella im Juli 1934 in die Hermann-Lingg-Straße 16 in München. Nach dem Tod<br />
der Tante im Juli 1937 blieb Selma noch bis 19.2.1938 in München, wahrscheinlich bei ihrem<br />
Cousin Eugen, dann zog sie zurück zu ihrer Schwester Else nach Bruchsal.<br />
Etwa in dieser Zeit musste Else ihr Etagengeschäft schließen, sodass Else und Selma nur<br />
noch die Mieteinnahmen des Ladens zustanden. Davon mussten die beiden unverheirateten<br />
Schwestern leben. Der Besitzer des Schokoladengeschäfts, der Kaufmann Walter Bremer<br />
in Würzburg, hatte den Laden vor seinem Einzug gründlich renovieren lassen, da „den<br />
Vermietern angeblich die flüssigen Mittel fehlten. Der Betrag ist als Hypothek sicher gestellt<br />
und das Vorkaufsrecht für das Haus eingetragen“, so Bremer am 5.12.1938. Im Gutachten des<br />
Architekten Löffler wird bestätigt, dass das zweigeschossige Gebäude „in ziemlich verwohntem,<br />
wenn auch nicht gerade verwahrlosten Zustande“ sei. Mit Kaufvertrag vom 31.1.1939<br />
ging das Haus an Bremer über, wobei er den Schwestern im Kaufvertrag schriftlich zusicherte,<br />
dass sie im Haus für 40 Reichsmark monatlich zur Miete wohnen bleiben können,<br />
bis sie aus Bruchsal wegziehen – auch, wenn eine der beiden Schwestern versterben sollte.<br />
Noch im April 1940 lebten die beiden Schwestern dort.<br />
Am 4.4.1940 starb Else Mayer an Gebärmutterkrebs<br />
im Jüdischen Krankenhaus Mannheim und wurde auf<br />
dem dortigen Jüdischen Friedhof bestattet.<br />
Selma Mayer musste zwischen April und Oktober<br />
1940 ins Haus der Familie Nathan in die Schillerstraße<br />
17 umziehen (Vgl. S. 24f.). Sie wurde von dort am<br />
22.10.1940 mit der Familie Nathan und dem Ehepaar<br />
David und Sofie Kaufmann nach Gurs deportiert. Selma<br />
kam am 10.8.1942 über das Sammellager Drancy<br />
nach Ausschwitz, wo sie zu einem unbekannten Zeitpunkt<br />
ermordet wurde.<br />
Grabstein von Else Mayer. Foto: privat.<br />
12 13
Familie Leopold Mayer<br />
(Großeltern von Else und Selma Mayer)<br />
Leopold Mayer<br />
* 18.06.1813 Wiesloch † 27.02.1894 Bruchsal<br />
(S. v. Veist/Faist Mayer (1773-1846), Händler in Wiesloch, u. Esther Isaak/Liebmann (1773-1855 Bruchsal))<br />
Im Okt. 1842 als Schulkandidat auf die „mit dem Vorsängerdienst vereinigte Lehrstelle an der neuerrichteten<br />
öffentlichen Schule bei der israelitischen Gemeinde Nonnenweier“ berufen. Umzug um 1890<br />
nach Bruchsal (erste Spur nach Bruchsal: 1846 heiratete seine Schwester Rosina Mayer den Gastwirt<br />
Gerson Grün in Bruchsal)<br />
verh. 08.11.1842 Nonnenweier<br />
Rosina Weil<br />
*~ 01.1821 Eichstetten † 13.02.1892 Bruchsal<br />
(Tochter von Josef Weil, Vorsänger in Eichstetten, und Paula geb. Bloch bzw. Blum geb. Weil)<br />
16 Kinder (geboren 1844-1867), darunter:<br />
6) Maier Mayer * 23.12.1851 Nonnenweier † 20.02.1916 Bruchsal<br />
Kaufmann (Wäschegeschäft) in Bruchsal, Friedrichstr. 40<br />
vh. 09.01.1883 Br. Jeanette Herz * 19.08.1859 Kochendorf bei HN † 13.06.1925 Bruchsal<br />
(T. v. Lazarus Herz (1809-1881) Kaufmann, und Karoline Neumann (1822-1913), in Heilbronn)<br />
3 Kinder:<br />
a) Else Mayer * 21.11.1883 Bruchsal † 04.04.1940 Mannh., Krankenhaus<br />
Kauffrau (Wäschegeschäft) in Bruchsal, Friedrichstr. 40<br />
b) Selma Mayer * 09.11.1887 Bruchsal † 10.08.1942 Auschwitz<br />
1914-1938 Hausangestellte bei Onkel Isaak bzw. Cousin Dr. Eugen Mayer in München, 1940 Gurs<br />
c) Ludwig (August Ludwig) Mayer * 07.05.1890 Bruchsal † 16.08.1896 Bruchsal<br />
8) Isaak Mayer * 04.05.1854 Nonnenweier † 26.07.1930 München<br />
schon um 1890 Kaufmann in München<br />
verh. 1. Ehe ~ 08.1891 München Fanny Kubitschek<br />
* 03.09.1872 Thomasville/GA/USA † 30.06.1892 Nördlingen zus. mit einem totgeborenen Kind<br />
verh. 2. Ehe 20.11.1894 München Isabella Kubitschek<br />
* 27.12.1874 Thomasville/GA/USA † 05.07.1937 München (Schwester von Fanny K.)<br />
1 Kind:<br />
a) Dr. med. Eugen Leopold Mayer * 04.03.1896 München † 25.01.1974 Nassau/NY/USA<br />
Chirurg im Jüdischen Hospital München, 12.1939 in USA, lebte in New Hide Park/NY/USA<br />
vh. 1928 Dr. phil. Gertrude Hirsch * 31.07.1902 Coburg † 06.08.1996 Brooklyn Park/USA<br />
1926 Promotion in Straßburg, seit 1932 jüd. Frauenschule Wolfratshausen, 1939 in USA<br />
2 Kinder: Rosemarie Mayer (1930-1940), Autounfall in New York; Dr. Robert J. Mayer (*1943), MD,<br />
Direktor der Gastrointestinal Onkologie-Zentrums in Boston/MA/USA<br />
9) Immanuel (Emanuel, Emil) Mayer * 17.09.1855 Nonnenweier † 09.05.1936 München<br />
Kaufmann, Versicherungsagent, ab 1883 Wäschegeschäft in Würzburg, ab 1890 Versicherungsagent<br />
und 1920er Immobilienagent, 1928 Umzug nach München zu Sohn Arthur<br />
vh. 1885 Heidingsfeld Rosa Schwabacher * 29.11.1861 Heidingsfeld † 31.08.1941 München<br />
3 Kinder (gekürzt)<br />
10) Emilie Mayer * 22.06.1857 Nonnenweier † 27.02.1929 München<br />
vh. 12.07.1881 Bruchsal Max Flehinger * 04.10.1850 Flehingen † 18.07.1910 Bruchsal<br />
1881 Religionslehrer in Konstanz, seit 1882 Religionslehrer in Bruchsal<br />
8 Kinder:<br />
a) Flora Flehinger * 04.04.1882 Bruchsal † 09.04.1954 New York<br />
vh. 25.04.1906 Bruchsal Moses Vogel *08.04.1873 Freudental † 13.07.1921<br />
Bankbeamter in Frankfurt/M.<br />
2 Kinder: Erna Vogel (1907-1991) vh. Hermann Haffner; Gertrude Vogel vh. Herbert Lehman<br />
b) Paula Flehinger *03.05.1883 Bruchsal † 06.06.1892 Bruchsal<br />
c) Dr. Arthur Flehinger * 13.06.1884 Bruchsal † 1961 Bradford GB<br />
1910 Lehramtspraktikant in Baden-Baden, Mannheim, 1927 Baden-Baden, 1938 Dachau, dann GB<br />
verh. 1. Ehe Anna Lipsky * 15.03.1894 Baden-Baden † 01.06.1946 Bradford/GB<br />
verh. 2. Ehe Ingeborg „Inge“ Margarete Bergfeld * 09.10.1918 † 02.03.1994 Bradford/GB<br />
2 Kinder (1. Ehe): Gerhard Flehinger (=Gerald Fleming, 1921-2006, anerkannter Historiker zur<br />
Holocaustforschung in GB); Walter Flehinger (Fleming)<br />
d) Jenny Flehinger * 20.07.1885 Bruchsal † 19.05.1888 Bruchsal<br />
e) Martha Flehinger * 30.07.1887 Bruchsal † 1957 New York, 10.1939 in USA<br />
vh. 30.08.1910 Karlsruhe Carl Leiter * 08.11.1879 Bopfingen † 05.06.1937 München<br />
seit 1910 in München wohnhaft, Kaufhausbesitzer mit bis zu 11 Angestellten<br />
3 Kinder: Helene Leiter (1911-2002) vh. Claus Hilzheimer (= Prof. Claude Hill);<br />
Max „Steven“ Leiter (1914-1979); Alice Leiter (1918-2006) vh. Milton Goldsmith<br />
f) Friedrich „Fritz, Fred“ Flehinger * 09.11.1889 Bruchsal † 17.10.1979 Los Angeles/USA<br />
1916 in München, 1935 in Essen, 1940 in Los Angeles<br />
vh. Edith Mathilde Adler * 06.02.1900 Rottweil † 02.09.1995 Los Angeles/USA<br />
1 Kind: Max Robert Flehinger (* um 1932 Essen)<br />
g) (Knabe) Flehinger *† 24.03.1895 Bruchsal<br />
h) Dr. med. Benno Flehinger * 28.11.1896 Bruchsal † 06.12.1956 New York<br />
1916 Student in München, 1939 Arzt, 02.1939 über GB in USA, 1944 in New York, Kinder?<br />
11) Fanny Mayer * 11.01.1859 Nonnenweier<br />
vh. 01.05.1885 Bruchsal Samuel Günzburger *05.03.1858 Schmieheim<br />
1885 Kaufmann, Kinder?<br />
13) Dr. med. Joseph Mayer * 02.09.1862 Nonnenweier † 07.09.1939 Freiburg<br />
1894 Arzt in Colmar<br />
vh. 26.11.1894 Mannheim Elise Hirsch * 16.02.1875 Mannheim † 11.09.1954<br />
(T.v. Jakob Hirsch jr., Kaufmann in Mannheim, und Justine geb. Grün (*1847 Bruchsal als Tochter<br />
von Gerson Grün u. Rosina Mayer (Schwester von Leopold Mayer (1813-1894), s. oben!)), Kinder?<br />
15) Hannchen „Hanna“ Mayer * 30.10.1865 Nonnenweier † 12.10.1938 Baltimore/USA<br />
vh. 18.06.1890 Bruchsal Max Eichberg * 20.07.1865 Laudenbach † 21.11.1934 Baltimore<br />
1890 Lehrer in Heilbronn-Sontheim, 1900 in USA ausgewandert, 1910 Buchhalter in Baltimore<br />
2 Kinder:<br />
a) Leo Eichberg * 30.04.1894 Deutschland † 12.1980 Miami/FL/USA<br />
1900 in USA emigriert, 1910 „clerk“ in Baltimore, Kinder?<br />
b) Moritz (Morris, Maurice) Eichberg * um 1900 Deutschland † 1946 Baltimore/USA<br />
1900 in USA emigriert, 1910 in Baltimore, vh. Bertha ... * um 1904 † 1963 Baltimore/USA - 1 Sohn<br />
14 15
Biografie von Ludwig Baertig (1884-1954)<br />
von Mia Smale, Klasse 8t<br />
Ludwig Baertig wurde am 27.3.1884 in Herrieden bei Feuchtwangen geboren. Sein Vater<br />
hieß Wolfgang Baertig und kam aus Schopfloch. Seine Mutter Theresia geb. Siegel wurde<br />
in Mingolsheim geboren. Außerdem hatte er drei Brüder namens Hermann, Siegfried und<br />
Max und eine Schwester Namens Klara. Zwischen 1888 und 1894 zog die Familie nach<br />
Bruchsal in die Kaiserstraße 24. Ludwigs Vater war ab 1904 bei der Freiwilligen Feuerwehr<br />
in Bruchsal. Das Geschäft in zentraler Lage lief wohl gut, weshalb Ludwig eine Ausbildung<br />
in Frankfurt machen konnte. Doch da der Vater 1915 schon früh starb, übernahm Ludwig<br />
das Manufaktur- und Tuchgeschäft vom Vater. Der älteste Bruder Hermann zog noch<br />
vor dem ersten Weltkrieg<br />
nach Amerika und Siegfried<br />
fiel sechs Tage nach<br />
dem Tod seines Vaters<br />
in Frankreich. So blieben<br />
nur noch Ludwig<br />
und sein jüngster Bruder<br />
Max, welcher mit ihm<br />
das Geschäft führte. Jedoch<br />
war Ludwig der<br />
Geschäftsinhaber. Dies<br />
beweist die Telefonnummer<br />
124, später 2124,<br />
welche unter seinem Namen<br />
angemeldet waren.<br />
1927 trat auch Ludwig<br />
der Feuerwehr bei.<br />
In dem großen Familienhaus<br />
der Baertigs<br />
lebten Ludwigs verwitwete<br />
Mutter Theresia<br />
bis 1937, anfangs auch<br />
seine Großmutter Elise<br />
Siegel, welche von Mingolsheim<br />
kam und am<br />
13.5.1921 im Alter von<br />
93 Jahren im Haus starb.<br />
Außerdem wohnte noch<br />
seine Schwester Klara im<br />
Werbung von Ludwig Baertig. Foto: „Bruchsaler Wochenblatt“, Jg. 1910.<br />
Haus. Diese starb allerdings am 4.8.1921 mit 43<br />
Jahren. Klara lebte anscheinend schon länger in<br />
der Kaiserstraße, da ihre Tochter Erna Wälder,<br />
geboren in Worms, 1915 bis 1921 die Höhere<br />
Mädchenschule in Bruchsal besuchte. Erna<br />
wohnte noch bis zu ihrer Hochzeit 1928 bei ihrer<br />
Großmutter und ihren Onkeln Ludwig und<br />
Max, welche später ihre Trauzeugen wurden.<br />
Rätselhaft bleibt jedoch, warum Ludwig kurz,<br />
vom 6.1.1924 bis zum 22.1.1924, in Mannheim<br />
gemeldet war.<br />
Ab dem 13.2.1930 war Ludwig mit Recha Thekla<br />
Schlessinger aus Flehingen verheiratet. 1932<br />
bekamen sie eine Tochter namens Beate, welche<br />
in Karlsruhe geboren wurde. 1937 zogen Recha und Beate allerdings zurück nach Flehingen<br />
und am 2.11.1939 haben sie sich scheiden lassen.<br />
Auch die restliche Familie verschwand aus Bruchsal – Ludwigs Mutter Theresia starb am<br />
26.8.1937 im Alter von 81 Jahren, Bruder Max mit Familie flüchtete wohl im Februar/<br />
März 1939 nach Frankreich. Bei der Volkszählung im April 1939 war Siegfried der letzte<br />
der Familie, der in Bruchsal lebte. Am 26.9.1939 zog er nach Mannheim zu seiner Nichte<br />
Erna, die mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen 1942 ermordet wurde.<br />
Bereits am 19.12.1938 wurde Ludwigs Haus zwangsversteigert. Konditormeister Karl<br />
Baumann kaufte es für 20000 Mark, obwohl es laut Aussagen Ludwigs 48000 Mark wert<br />
gewesen wäre. 1948 behauptete Baumann hingegen, dass das Haus stark verschuldet und<br />
stark renovierungsbedürftig war. Am 1.3.1945 wurde es <strong>komplett</strong> zerstört. Danach kam<br />
die Mohren-Apotheke hinein.<br />
Am 11.11.1939 wurde Ludwig in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Als er am<br />
5.12.1939 nach Hause kam, sah er laut Aussagen einer<br />
Nachbarin sehr schwach und elend aus. Er selbst versicherte<br />
immer wieder, dass er sich sein Herzleiden in dieser<br />
Zeit im Konzentrationslager zugezogen hatte.<br />
Vom 24.1.1940 bis 5.2.1940 fuhr er von Rotterdam nach<br />
Amerika. Er kam bei seinem Cousin S. May in Chicago<br />
unter, jedoch hatte er nur noch 10 Dollar in der Tasche.<br />
Zu diesem Zeitpunkt wurde er mit „5 feet 7 inches“ und<br />
grauen Haaren beschrieben. Vom 1.1.1945 bis 1.1.1954<br />
arbeitete er als Angestellter im „Standard Club of Chicago“<br />
als Nachtwächter, Timekeeper und dann im Büro.<br />
Hierbei belief sich sein Einkommen auf 220 Dollar. Er<br />
wohnte in Chicago in der 5111 University Avenue, 1940<br />
bis 1942 im Hyde Park Boulevard 1162, dann in der 4647<br />
16 17<br />
Ludwig Baertig in den USA. Foto: privat.<br />
Todesanzeige von Ludwig Baertig<br />
aus den USA. Foto: Aufbau.
Hochzeitsanzeige von Cornelia „Nelli“ und Ludwig<br />
Baertig, USA. Foto: Aufbau.<br />
Greenwood Ave. Sein letzter Wohnsitz war 817<br />
W Lakeside Place, Apt. 502, Chicago.<br />
Am 27.3.1943 heiratet er „Fräulein“ Cornelia<br />
(Nelli) Jacob in Chicago. Cornelia hatte blaugraue<br />
Augen, braune Haare, war „5 feet 1 inch“<br />
groß und wog „112 Pounds“. Am 8.2.1940 wanderte<br />
sie von St. Nazaire kommend in New York<br />
Biografie von Recha Baertig geb. Schlessinger<br />
(1894-1942)<br />
von Lina Kölbach, Klasse 8t<br />
Cornelia Jacob, Ludwig Baertigs zweite Ehefrau<br />
in den USA. Foto: privat.<br />
ein. Cornelia wurde am 23.8.1891 in Kaiserslautern geboren. Sie hatte allerdings Verwandte<br />
in Saargemünd, der Stadt, aus der Ludwigs Schwägerin Wilhelmine kam. Später gab<br />
Cornelia an, dass sie Ludwig schon seit etwa 1920 kannte. Im Juli 1951 und im August<br />
1954 besuchten sie gemeinsam Europa. Wahrscheinlich waren sie auch wieder in Karlsruhe.<br />
1939 gab es die ersten Anzeichen von einem Herzleiden bei Ludwig, doch er wurde erst<br />
1950 ärztlich behandelt. Ein Nachbar erzählte, wie Ludwig 1941 bis 1943 bei ihm zur Untermiete<br />
wohnte und kaum mehr Kraft hatte. Das Treppensteigen ermüdete ihn sehr, er<br />
rang oft nach Luft und klagte über Herzschmerzen. Er blieb am Wochenende zuhause und<br />
war teilweise bettlägerig, doch er musste arbeiten, um sich zu ernähren. Am 3.11.1954<br />
starb er dann mit 71 Jahren an einem Herzinfarkt in Chicago. Seine zweite Frau Cornelia<br />
und einzige Erbin starb am 11.6.1957 in Chicago.<br />
Recha Thekla Baertig geb. Schlessinger wurde am 11.10.1894 um 10 Uhr vormittags in Flehingen<br />
geboren. Ihre Eltern waren das jüdische Ehepaar Moses Schlessinger (†1935) und<br />
Bertha Schlessinger geb. Bierig (†1929). Moses war Metzger und Viehhändler in Flehingen.<br />
Recha hatte fünf Geschwister: Karolina (1886-1942, verh. Weiler), Leo (1888-1942),<br />
Samuel (1891-1985), Friedrich (1892-1985) und Eda (1896-1941, verh. Barth). Von Rechas<br />
Kindheit und Jugend wissen wir nichts. Recha lebte in Flehingen bei ihren Eltern, bis<br />
sie sich am 13.2.1930 in Flehingen verheiratete mit Ludwig Baertig. Ludwig war von Beruf<br />
Kaufmann und sie lebten in Bruchsal. Recha arbeitete als Hausfrau und hatte eine Tochter:<br />
Beate Baertig, geboren 1932 in Karlsruhe. Recha und Ludwig trennten sich und Recha zog<br />
mit Beate im Februar 1937 aus. Die Ehe wurde am 2.11.1939 geschieden. Recha wohnte<br />
seit der Trennung im Elternhaus in Flehingen, das seit dem Tod des Vaters 1935 wohl leer<br />
stand. Recha hatte engen Kontakt zu ihren Geschwistern und Schlessinger-Verwandten.<br />
Ihre Tochter Beate war anfangs bei ihr und zog um 1939 zu ihrer Schwester Eda Barth<br />
nach Ulm. Als Rechas Bruder Friedrich<br />
Schlessinger im Juni 1939 zu acht Monaten<br />
Haft verurteilt wurde, weil er versucht<br />
hatte, sein Geld ins Ausland zu bringen, besuchte<br />
ihn Recha schon am vierten Hafttag<br />
in Rottenburg am Neckar und weitere drei<br />
Mal. Sie gab an, seine Auswanderung voranbringen<br />
zu wollen, was ihm dann auch<br />
im Februar 1940 gelang.<br />
Im Oktober 1940 wurde Recha zusammen<br />
mit ihrem Cousin Robert Schlessinger und<br />
dessen Frau Fanny von Flehingen aus ins<br />
Lager Gurs in Südfrankreich deportiert. Sie<br />
hatten nur 20 Minuten Zeit zum Packen.<br />
Augenzeugen berichteten, dass Recha laut<br />
nach Beate rief und verzweifelt darum bat,<br />
zu ihr gelassen zu werden. In Gurs hatte sie<br />
den Schlafplatz über die ganze Zeit neben<br />
Fanny Schlessinger, der Frau ihres Cousins.<br />
Rechas Bruder Friedrich bemühte sich von<br />
den USA aus unermüdlich, aber vergeblich,<br />
Recha und Beate zu retten. Auch Bruder<br />
Leo Schlessinger, der in der Gegend um<br />
Gurs in einem Hotel interniert war, wollte<br />
Recha aus Gurs holen, da es in seinem Hotel<br />
in Aulus-les-Bains bessere Lebensbedingungen<br />
gab. Er schrieb mehrere Briefe an<br />
den Kommandanten und den Präfekten.<br />
Auch das scheiterte. Recha Baertig wurde<br />
am 6.8.1942 von Gurs ins Durchgangslager<br />
Drancy gebracht und am 10.8.1942<br />
von dort nach Auschwitz deportiert. Dort<br />
wurde sie gleich nach ihrer Ankunft am<br />
12.8.1942 ermordet.<br />
Von links: Friedrich, Edda und Recha Schlessinger,<br />
1918. Foto: Bea Ross, Newport, Rhode Island, USA.<br />
Häuser der Familien Schlessinger und Ettlinger in<br />
Flehingen, heute Samuel-Friedrich-Sauter-Str. 5<br />
und 7. Foto: Brigitte Kugler, Flehingen.<br />
18 19
Biografie von Beate Baertig (1932-1941)<br />
Beate wurde am 15.3.1932 in Karlsruhe als<br />
einziges Kind von Recha und Ludwig Baertig<br />
geboren. Sie lebte bis kurz vor ihrem<br />
5. Geburtstag in Bruchsal. Dann trennten<br />
sich die Eltern und Beate zog im Februar<br />
1937 zusammen mit ihrer Mutter in deren<br />
Geburtsort Flehingen. Warum Beate dort<br />
nicht blieb, wissen wir nicht. Da viele andere<br />
Juden aus Flehingen auswanderten,<br />
gab es dort keine anderen jüdischen Kinder<br />
mehr und auch keine jüdische Schule. Da<br />
Beate die „normale“ Schule nicht besuchen<br />
durfte, ging sie vielleicht deswegen nach<br />
Ulm zu ihrer Tante Eda Barth geb. Schlessinger.<br />
Es muss wohl im Jahr 1939 gewesen<br />
sein, dass Beate nach Ulm zog. Dort gab es<br />
auch die Cousine Suse (1928-1941). Die<br />
Cousine Lotte Barth (1920-1992) war im<br />
November 1938 in die USA ausgewandert,<br />
von Lina Kölbach, Klasse 8t<br />
vielleicht war deswegen „ein Bett frei“. Die Jüdische Volksschule in Ulm wurde allerdings<br />
auch 1939 geschlossen, sodass Suse von 1939 bis Herbst 1941 die Jüdische Schule in Stuttgart<br />
besuchte und bei Bekannten lebte. Nur am Wochenende war sie bei den Eltern in<br />
Ulm. Ob Beate dabei war oder die ganze Zeit über in Ulm lebte, wissen wir nicht. Familie<br />
Barth wohnte etwa seit Sommer 1939 in<br />
dem „Judenhaus“ Neutorstr. 15 in Ulm. Von<br />
dort wurden Heinrich Barth (54 Jahre), Eda<br />
Barth (46 Jahre), Suse Barth (13 Jahre) und<br />
Beate Baertig (9 Jahre) am 28.11.1941 nach<br />
Stuttgart deportiert. Am 1.12.1941 wurde<br />
die Familie in einem Sammeltransport<br />
von Stuttgart-Killesberg aus zusammen mit<br />
über 1000 anderen württembergischen Juden<br />
ins KZ Riga-Jungfernhof gebracht und<br />
dort ermordet.<br />
Dass sich diese Deportation sogar bis zu<br />
Beates Mutter Recha Baertig im Camp de<br />
Gurs herumgesprochen hatte, wissen wir<br />
aus einem Brief von Rechas Verwandter<br />
Beate Baertig 1935. Foto: Bea Ross.<br />
Links Beate Baertig, rechts Cousine Suze Barth.<br />
Foto: Bea Ross.<br />
Fanny Schlessinger. Sie schrieb am 27.1.1942 an ihren Sohn in Kanada: „Recha ist immer<br />
noch bei mir u. denke dir Eda mit Mann u. Beate kamen nach Polen. u. tut mir Recha sehr<br />
leid daß ihr Kind nicht bei sich hat aber leider ist nichts zu ändern u. kannst es an Vetter<br />
Samuel [Rechas Bruder] berichten er soll mal an Recha schreiben u. solche wäre auch um<br />
eine Gabe sehr dankbar.“<br />
Quellenhinweise:<br />
http://stolpersteine-fuer-ulm.de/familie/familie-h-barth/<br />
Zahlreiche Informationen verdanken wir Wolfgang Schönfeld, Autor des Buches<br />
„Geschichte der jüdischen Familie Schlessinger aus Flehingen“, Eppingen 2017.<br />
Biografie von Max Baertig (1887-1942)<br />
von Ellen Lumpp, Klasse 8t<br />
Max Baertig wurde am 19.2.1887 in Herrieden,<br />
Kreis Ansbach in Bayern geboren. Aufgewachsen<br />
ist er mit seinen vier Geschwistern in dem<br />
seit ca. 1888/1894 von seiner Familie bewohntem<br />
Haus Kaiserstraße 24 in Bruchsal. Sein Vater<br />
Wolfgang Baertig und seine Mutter Theresia<br />
Baertig geb. Siegel lebten ebenfalls in dem Haus,<br />
auch zeitweise seine Oma Elise Siegel geb. Mai.<br />
Zusammen mit seinem Bruder Ludwig besaß<br />
Max ein Textilgeschäft in Bruchsal. Beide waren<br />
wie ihr Vater Kaufmann. Im August 1915<br />
musste Max in einem Landsturm-Bataillon in<br />
den 1. Weltkrieg ziehen. Sein Bruder Ludwig<br />
war von 1914 an Soldat. Der Bruder Siegfried,<br />
der zu Kriegsbeginn als Freiwilliger eingerückt<br />
war, starb im Mai 1915 an der Front.<br />
Max heiratete um 1920 Wilhelmine Mayer, genannt<br />
Minna, aus Saargemünd. Die gemeinsame<br />
Tochter Hannelore Baertig kam am 12.3.1922 in Bruchsal zu Welt.<br />
Während einer Sonderaktion des Kriminalpolizeistellenbezirks Karlsruhe vom 13.6.1938<br />
bis 18.6.1938 wurde Max Baertig mit 123 anderen (40 Juden und 84 „asoziale Personen“)<br />
festgenommen. Die oft rein willkürliche Auswahl der Personen diente dazu, die missliebigen<br />
Personenkreise zu verunsichern. Auf der Haftkarte von Max Baertig wird lediglich<br />
erwähnt: „Eine Vorstrafe wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses – drei Monate Gefängnis“.<br />
Am 11.7.1938 wird er nach Dachau eingeliefert. In das Konzentrationslager in Buchenwald<br />
kommt er am 24.9.1938. Dort muss er als A.Z.R.J. (Arbeitszwang Reich, Jude)<br />
20 21<br />
Bildmitte Haus Kaiserstraße 24, Bruchsal, um<br />
1920. Foto: Stadtarchiv Bruchsal.
wahrscheinlich besonders hart arbeiten. Entlassen wurde er am 8.2.1939. Bald danach<br />
flüchtete er wohl mit Frau und Tochter nach Frankreich. In seinem Wohnort Blois wurde<br />
Max am 13.7.1942 verhaftet und ins Camp Pithivers deportiert. Am 14.7.1942 wurde<br />
ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Nach Auschwitz wurde er am 17.7.1942<br />
gebracht. Seine Gefangenennummer lautete: 49003. Er verstarb im Konzentrationslager<br />
Auschwitz am 18.8.1942 um 7.25 Uhr in der Kasernenstraße. Die Todesursache war laut<br />
KZ-Arzt Kachexie bei Darmkatarrh.<br />
klar, ob die drei direkt nach Blois gegangen sind. Blois wurde im Juni 1940 von deutschen<br />
Truppen erobert und so kamen die Baertigs vermutlich wieder ins Visier der Nationalsozialisten.<br />
Als Wilhelmine am 13.7.1942 verhaftet wurde, war sie in ihrer Wohnung in Blois<br />
in der Rue du Mail 12. Zunächst war sie in Vendome interniert, dann wurde sie zum Lager<br />
Pithiviers überstellt. Doch schon wenige Tage später, am 17.7.1942, wurde sie zusammen<br />
mit ihrem Mann in Richtung Auschwitz deportiert. Der Zug, mit dem die beiden gefahren<br />
sind, verließ den Bahnhof von Pithiviers morgens um 6.15 Uhr und transportierte 928<br />
Juden, davon 119 Frauen, so steht es im SS-Bericht. Wilhelmine wurde nicht in einer Gaskammer<br />
ermordet. Als sie am 27.8.1942 mit 47 Jahren stirbt, liegt dies an den schlechten<br />
Lebensbedingungen im Lager von Auschwitz. Der genaue Zeitpunkt ihres Todes ist der<br />
27.8.1942 um 19.20 Uhr. In ihrer Todesurkunde steht als Todesursache: Allgemeine Körperschwäche.<br />
Häftlingspersonalakte KZ Buchenwald. Foto: ITS Archiv Bad Arolsen, 1.1.5.3/5461496.<br />
Biografie von Wilhelmine Baertig geb. Mayer<br />
(1895-1942)<br />
von Charlotte Völler, Klasse 8s<br />
Wilhelmine Baertig geb. Mayer kam am 1.9.1895 in Saargemünd zur Welt. Es ist nicht bekannt,<br />
ob ihre Eltern Aron Mayer und Jeanette Hirsch, die bis zu ihrem Tod in Saargemünd<br />
gewohnt haben, noch andere Kinder hatten. Selbst die Schreibweise des Geburtsnamens<br />
variiert bis hin zu Maijer oder Meijer. Im Jahr 1925 stand Wilhelmine als Minna Baertig<br />
im Bruchsaler Adressbuch, zusammen mit ihrem Mann Max Baertig. Wann und wo die<br />
beiden geheiratet haben ist unbekannt. Wilhelmine und Max lebten in der Kaiserstraße<br />
24, zusammen mit ihrer Tochter Hannelore, die im Jahr 1922 in Bruchsal geboren wurde.<br />
Es ist unbekannt, ob Wilhelmine und Max noch andere Kinder hatten. Wahrscheinlich<br />
lebten Wilhelmine und Hannelore auch nach der Verhaftung von Max, im Sommer 1938,<br />
noch in Bruchsal. Vermutlich ist die Familie nach der Entlassung von Max aus dem KZ<br />
Buchenwald im Februar 1939 nach Frankreich ausgewandert. Aus einer Karteikarte zur<br />
Aberkennung der Reichsbürgerschaft vom 14.7.1941 geht hervor, dass Wilhelmines letzter<br />
Wohnort in Deutschland in Bruchsal in der Kaiserstraße 24 war. In Frankreich nannte<br />
sich Wilhelmine dann Guillaumine, dies ist ihr Name auf französisch. Allerdings ist nicht<br />
Mahnmal für die Opfer des 2. Weltkriegs in Blois, Frankreich. Foto: https://de.geanet.org/gallery.<br />
Biografie von Hannelore Baertig (1922-1942)<br />
von Charlotte Völler, Klasse 8s<br />
Hannelore Baertig ist am 12.3.1922 in Bruchsal zur Welt gekommen. Sie war wahrscheinlich<br />
die einzige Tochter von Wilhelmine und Max Baertig. Die Familie lebte in Bruchsal, doch<br />
Hannelores Vater Max wurde im Sommer 1938 verhaftet, und als er im Februar des nächsten<br />
Jahres entlassen wurde, floh die Familie nach Frankreich. Dabei ist nicht klar, ob Hannelore<br />
zusammen mit ihren Eltern nach Blois floh oder ob sie alleine dorthin kam. Sicher ist aber,<br />
dass sie dort zusammen mit ihren Eltern in der Rue du Mail 12 gewohnt hat. 1941 wurde<br />
Hannelore, genauso wie ihrer Mutter Wilhelmine, die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen,<br />
da sie nicht in Deutschland lebten. Es scheint, als ob Hannelore schon bei der ersten Razzia<br />
in Blois, am 26.6.1942 ab vier Uhr morgens, von der deutschen Feldgendarmerie verhaftet<br />
wurde. Am 28.6.1942 wurde Hannelore mit Convoi Nummer 5 von Beaune la Rolande nach<br />
Auschwitz gebracht. Wir wissen weder, ob Hannelore eine schulische Ausbildung hatte,<br />
noch ob sie in einem Beruf tätig war. Bei ihrer Deportation aus Blois 1942 wird jedenfalls,<br />
wie bei ihrer Mutter auch, „sans profession“ – ohne Beruf – angegeben. Es ist unbekannt, was<br />
mit der 20-jährigen nach der Fahrt nach Auschwitz passiert ist.<br />
22 23
Familie Wolfgang und Theresia Baertig<br />
(Eltern von Ludwig Baertig und Max Baertig)<br />
Wolfgang Baertig<br />
* 29.05.1851 Schopfloch/By. † 11.05.1915 Bruchsal<br />
(Sohn von David Baertig (1818-1911), Kaufmann in Herrieden, und Bertha Steinreich (1813-1891))<br />
1902 Kaufmann in Bruchsal (Wäschegeschäft), seit 1904 Mitglied der Feuerwehr Bruchsal<br />
verh. 02.03.1878 Petersaurach-Vestenberg<br />
Theresia Siegel<br />
* 25.12.1856 Mingolsheim † 26.08.1937 Bruchsal<br />
(Tochter von Gerson Siegel (1826-1895), Mingolsheim, und Elise May (1828-1921 Bruchsal))<br />
7 Kinder:<br />
1. Klara Baertig * 04.12.1878 Herrieden † 02.10.1921 Bruchsal<br />
vh. 10.11.1902 Bruchsal<br />
Arno (Aron) Wälder * 18.09.1873 Münchweiler/Pfalz † 1944 Theresienstadt<br />
(S. v. Leopold Wälder, Handelsmann, und Marianne Blum)<br />
1901 zus. mit Bruder Josef W. nach Worms, Likörfabrikant in Worms, 09.1942 deportiert<br />
(2. Ehe: 28.03.1923, Selma Strauß * 18.10.1879 Bissersheim † 29.06.1943 Theresienstadt)<br />
1 Kind:<br />
a) Erna Wälder * 17.04.1904 Worms † 1942/45 Auschwitz<br />
Besuch der Höh. Mädchenschule Bruchsal, wohnte bis 1928 in Bruchsal, dann Mannheim<br />
vh. 06.09.1928 Bruchsal Otto Rau * 28.05.1899 Graudenz † 1942/45 Auschwitz<br />
seit 1922 Kaufmann in Mannheim, Deportation 29.09.1942 nach Auschwitz<br />
2 Kinder: Werner Hugo Rau (1933-1942), Hans Herbert Rau (1936-1942) beide nach Auschwitz<br />
vh. (2. Ehe) 29.03.1943 Chicago<br />
Cornelia „Nellie“ Jacob * 23.08.1896 Kaiserslautern † 13.06.1957 Chicago<br />
(T. v. Emanuel Jacob und Bertha Stern)<br />
wohnhaft Düsseldorf, 1940 Blois/F, 05.02.1940 nach USA, 1957 Supervisor<br />
1 Kind (aus 1. Ehe):<br />
a) Beate Baertig * 15.03.1932 Karlsruhe † nach 01.12.1941 (Dep. n. Riga)<br />
Bruchsal, 1937 nach Flehingen, 1939 nach Ulm zur Tante Eda Barth geb. Schlessinger<br />
6. Max Baertig * 19.02.1887 Herrieden † 18.08.1942 Auschwitz<br />
1928, 1937 Kaufmann in Bruchsal, 11.07.-23.09.1938 Dachau und 23.09.1938-08.02.1939<br />
Buchenwald, 1939 Emigration nach Frankr., 17.07.1942 von Blois über Pithiviers n. Auschwitz<br />
vh. Wilhelmine „Minna“ Mayer * 01.09.1895 Saargemünd † 27.08.1942 Auschwitz<br />
(T. v. Aron Mayer und Jeanette Hirsch)<br />
1939 Emigration Frankreich, deportiert 17.07.1942 von Blois über Pithiviers nach Auschwitz<br />
1 Kind:<br />
a) Hannelore Baertig * 12.03.1922 Bruchsal † 1942/45 Auschwitz<br />
~ 1939 Emigration Frankr., dep. 28.06.1942 von Blois über Beaune la Rolande nach Auschwitz<br />
7. (Namenlos – Totgeboren) Baertig *† 01.09.1888 Herrieden<br />
2. Hermann Baertig * 26.09.1880 Herrieden † 13.07.1938 Manhattan/New York<br />
1902 Kaufmann in Bruchsal, 1906, 1909 und 1910 Einreise in USA, 1918 Grocer in NY, unverh.<br />
3. Hedwig Baertig * 25.10.1881 Herrieden † 09.12.1882 Herrieden<br />
4. Siegfried Baertig * 23.11.1882 Herrieden † 17.05.1915 Donai/F<br />
1915 Kaufmann in Bruchsal, 1915 Ersatzreservist im preuß. Füsilier Reg. 40; unverheiratet<br />
unehel. Verbindung Angela Steimel * 28.06.1884 Zeutern † 18.08.1929 Bruchsal<br />
1907 Dienstmädchen in Bruchsal, katholisch<br />
1 Kind:<br />
a) Josef Theodor Steimel * 01.02.1907 Bruchsal † 30.10.1908 Bruchsal, katholisch<br />
Schrift auf dem Kriegerdenkmal<br />
für die Gefallenen<br />
des 1. Weltkrieges<br />
auf dem Friedhof<br />
Bruchsal. Foto: F. Jung.<br />
Siegfried Baertig. Quelle: Münch,<br />
Josef. Bruchsal im Weltkrieg 1920.<br />
5. Ludwig Baertig * 27.03.1884 Herrieden † 03.11.1954 Chicago<br />
1910/1937 Kaufmann in Bruchsal, 1939 nach Mannheim, 1940 nach USA, lebte in Chicago<br />
vh. (1. Ehe) 13.02.1930 Flehingen o/o 02.11.1939 Karlsruhe<br />
Recha Thekla Schlessinger * 11.10.1894 Flehingen † 12.08.1942 Auschwitz<br />
Bruchsal, 02.1937 nach Flehingen, Deportation 22.10.1940 Gurs, 10.08.1942 nach Auschwitz<br />
(T. v. Moses Schleßinger (1855-1935) Metzger in Flehingen, und Bertha Bierig (1860-1929))<br />
Anmerkung: Recha Baertig geb. Schlessinger war die Cousine von Carola Grzymisch geb. Schleßinger<br />
(1891-1944, vgl. 3. Gedenkschrift 2017, S. 7). Sie lebten in Bruchsal nur wenige Schritte voneinander entfernt.<br />
Grab der Familie Baertig in Bruchsal.<br />
Foto: F. Jung.<br />
24 25<br />
Grabstein Clara Wälder auf dem<br />
Bruchsaler Friedhof. Foto: F. Jung.
Biografie von Ernst Nathan (1871-1942)<br />
Ernst Nathan wurde am 3.4.1871 in Lorsch<br />
in Hessen geboren. Er war der Sohn des<br />
Kaufmanns Emanuel Nathan und seiner<br />
zweiten Frau Auguste Ehrmann. Er bekam<br />
den Vornamen Nathan, sodass Vorund<br />
Nachnamen identisch waren. Daher<br />
nannte sich Nathan Nathan später Ernst<br />
Nathan. Noch vor seiner Einschulung ist<br />
die Familie nach Worms umgezogen.<br />
Den im Stadtarchiv Worms archivierten<br />
Jugenderinnerungen von Moritz Nathan,<br />
von Jan Neißl, Klasse 8s<br />
Schillerstraße in Bruchsal, 1920er Jahre. Der Pfeil<br />
zeigt auf das Haus Nr. 17. Foto: Stadtarchiv Bruchsal.<br />
dem jüngeren Bruder von Ernst Nathan, ist es zu verdanken, dass ein wenig bekannt ist<br />
über die Jugendzeit in Worms: „Ich bin im Jahre 1877 in Worms am Rhein geboren, in<br />
einem Hause in der Römerstraße gegenüber der alten 118er Infanteriekaserne. Das Haus<br />
gehörte damals meinem Vater, der ein kleines Kolonialwarengeschäft darin betrieb. Er verlor<br />
Haus und Vermögen durch eine Bürgschaft für einen guten Freund, musste von da an in bescheidensten<br />
Verhältnissen seine Familie durchbringen, und damit ist bereits die Art meiner<br />
Jugendzeit angedeutet. Meine Mutter muss in ihrer Weise eine Künstlerin gewesen sein, mit<br />
den schwachen zur Verfügung stehenden Mitteln ihren Kindern eine anständige Erziehung<br />
und eine gute Schulbildung auf den Weg geben zu können.“ Die Familie scheint sich zu den<br />
eher strenggläubigen Juden gezählt zu haben, und der Vater agierte als Vorbeter im Privatbetsaal<br />
der wohlhabenden Familie Guggenheim.<br />
Ernst Nathan besuchte nach der Volksschule das Gymnasium in Worms. Dort hat er<br />
auch sein Abitur gemacht und wurde Zigarrenfabrikant. Er war als Teilhaber der Firma<br />
„S. Cahnman’s Nachfolger“ in Bischweiler im Elsass zu erheblichem Vermögen gekommen.<br />
Weil alle Deutschen das Elsass 1919 verlassen mussten, lebte Ernst Nathan mit seiner<br />
Familie 1919 bis 1940 in der Schillerstraße 17 in Bruchsal.<br />
Ernst Nathan gründete am 16.1.1920 in Bruchsal die Firma „E. Nathan OHG (Offene<br />
Handelsgesellschaft)“. Es war eine Zigarrenfabrik. Sein Bruder Moritz Nathan war ab dem<br />
5.5.1920 hälftiger Mitinhaber. Dieser hatte nach der Volksschule und dem Besuch des<br />
Gymnasiums in Worms bei der Weinhandlung „Langenbach und Söhne“ eine kaufmännische<br />
Lehre gemacht und trat danach in Bruchsal in die Firma W. Katz ein, wo er 1920<br />
Bürovorstand war. Er wohnte 1911 bis 1936 in Bruchsal, zuletzt zusammen mit seiner Frau<br />
in der Friedrichstraße 62 in einer Sechs-Zimmer-Wohnung.<br />
Im Dezember 1920 kauften die beiden Brüder Nathan das Haus Kegelstraße 15 von der<br />
Witwe Josefine Kretz, die dort eine Wirtschaft mit Kegelbahn und Gartenwirtschaft betrieben<br />
hatte. Es gab nach geringfügigem Umbau dort acht Räume für Büro und Buchhaltung<br />
und etwa zehn weitere Räume für die Herstellung der Zigarrenkisten, für Lagerplatz und<br />
Versandbüro. Neben Ernst und Moritz Nathan waren noch sechs weitere Personen im<br />
Büro beschäftigt. Der Sohn von Moritz, Wilhelm Emanuel Nathan, arbeitete nach seiner<br />
Lehre (1929-1931) bei W. Katz und bis zu seiner Auswanderung 1934 auch noch im Betrieb<br />
als kaufmännischer Angestellter mit Reisetätigkeit. Das Obergeschoss war als Wohnung<br />
vermietet, allerdings eventuell erst in den 1930ern. Es gab eine Zigarrenfabrik in<br />
Stettfeld sowie eine Wein- und Zigarrenfabrik in Zeutern. Dort waren jeweils etwa 50-60<br />
Leute mit der Herstellung der Zigarren beschäftigt. Es gab ein Lohnfuhrwerk, das nur für<br />
die Firma Nathan arbeitete und mehrmals täglich die Zigarren aus Stettfeld und Zeutern<br />
nach Bruchsal brachte, wo sie verpackt und versandt wurden.<br />
Der Cousin Richard Bär („Leder-Bär“) schrieb 1956, Familie Moritz Nathan „habe immer<br />
ein Dienstmädchen gehabt, gingen regelmäßig im Sommer und im Winter in Ferien und<br />
ließen ihrem Sohn die beste Erziehung angedeihen. Die Firma hatte einen ausgezeichneten<br />
Ruf und war sehr angesehen, auch in Bankkreisen“ – so jedenfalls hatte er es von Julius Bär,<br />
dem Direktor der Süddeutschen Bank in Bruchsal, gehört. Bruder Moritz verließ Bruchsal<br />
zusammen mit seiner Frau Paula am 10.12.1936. Sie wanderten nach New York aus. Zuvor<br />
war Moritz am 16.11.1936 aus dem Handelsregister gelöscht worden. Ernst Nathan wurde<br />
Alleineigentümer der Zigarrenfabrik. Die Firma wurde am 18.3.1938 endgültig aus dem<br />
Handelsregister gelöscht. Die Zigarrenfabrik in der Kegelstraße 15 musste an Karl Haas,<br />
Blechnermeister, und seine Frau verkauft werden. Haas schrieb dazu: „Nachfrage wegen<br />
zu vermietender Werkstätte führte dazu,<br />
dass mir Hr. Nathan das Gebäude zum Kauf<br />
anbot.“ Der Kaufvertrag trägt das Datum<br />
23.9.1937. Der Kaufpreis betrug 16500 RM,<br />
9000 RM gingen in bar an Ernst Nathan<br />
und ab da monatliche Raten auf Nathans<br />
Konto, ab 1942 an das Finanzamt direkt.<br />
Ernst Nathan besaß außerdem noch eine<br />
zweistöckige Zigarrenfabrik incl. einstöckigem<br />
Wohngebäude in Hockenheim, Untere<br />
Hauptstr. 20. Diese war im Besitz von Ernst<br />
Nathan seit 1920 und gehörte ihm bis 1942,<br />
dann wurde er enteignet.<br />
Ernst Nathan besaß ein gut gefülltes Bankkonto<br />
und hatte noch 1939/40 ein sehr großes<br />
Wertpapierdepot. Dieses wurde allerdings<br />
vom Staat beschlagnahmt. Zwischen<br />
Dezember 1938 und November 1939 musste<br />
er allein 21.500 RM als „Judenvermögensabgabe“<br />
bezahlen. Ob er zusammen<br />
mit seiner Familie eine Auswanderung anstrebte,<br />
ist nicht bekannt.<br />
Franz-Bläsi-Str. 17, früher Schillerstr. 17. F.: F. Jung<br />
26 27
Ernst Nathan litt an Magengeschwüren, die auch operiert und medikamentös behandelt<br />
wurden. Das Leben in Gurs, wohin er am 22.10.1940 mit Frau und Tochter deportiert<br />
wurde, war wegen der schlechten Nahrung deshalb besonders schwierig. Er litt dort auch<br />
an Schlaflosigkeit und Depressionen.<br />
Ernst Nathan ist am 12.8.1942, dem Ankunftstag in Auschwitz, im Alter von 71 Jahren<br />
ermordet worden.<br />
Biografie von Betty Nathan geb. Bär (1882-1942)<br />
von Nico Falda, Klasse 8s<br />
Betty Nathan wurde als Betty Bär am 6.1.1882 in Heidelsheim geboren als älteste Tochter<br />
des Kaufmannes Bernhard Bär und seiner Frau Thekla Bär. 1883, 1884 und 1889 wurden<br />
noch die jüngeren Schwestern Laura, Else und Paula geboren. Etwa zwischen 1890 und<br />
1900 zog die Familie nach Bruchsal um. Dort kauften oder bauten sie das Haus Schillerstraße<br />
17. Da das Haus sehr groß und repräsentativ ist, kann davon ausgegangen werden,<br />
dass die Familie wohlhabend war. Es hat 3 ½ Stockwerke und beherbergte z. B. 1949 vier<br />
Familien mit jeweils ein bis zwei Untermietern, insgesamt 29 Personen. Schwester Paula<br />
gibt in eidesstattlicher Versicherung 1956 u. a. an: „Ich bin von Hause aus vermögend gewesen“.<br />
Betty verheiratete sich 1903 in Bruchsal mit Ernst Nathan, die Schwestern heirateten<br />
1904, 1908 und 1911 ebenfalls in Bruchsal. Die Schwester Laura, verh. Schorsch, lebte<br />
in Stuttgart, die Schwester Else, verh. Kander, lebte in Heidelberg, die jüngste Schwester<br />
Paula heiratete den jüngeren Bruder von Ernst Nathan und blieb in Bruchsal.<br />
Betty zog zusammen mit ihrem Mann ins Elsass nach Bischweiler, wo sie 1904 die Zwillinge<br />
Marie und Margarete zur Welt brachte. Ernst war Zigarrenfabrikant, musste aber 1919,<br />
als das Elsass französisch wurde, zusammen mit seiner Familie nach Bruchsal umziehen.<br />
Betty bewohnte ab 1920 und bis zur Deportation 1940 zusammen mit ihrer Familie eine<br />
6-Zimmer-Wohnung im Haus ihrer Eltern. Sie bestand aus Herren- und Speisezimmer,<br />
Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern, Fremdenzimmer, Küche und Vorratszimmer und<br />
war sehr gut und teuer eingerichtet (Klavier, Radio, Fotoapparat, teuerstes Porzellan usw.,<br />
Möbel meist 1903 bei der Eheschließung angeschafft). Die Eltern von Betty bewohnten<br />
eine andere Wohnung im Haus, sie waren Hauseigentümer. Es gab beispielsweise 1925<br />
und 1931 zwei Dienstmädchen im Haus. Das Haus Schillerstraße 17 ging nach dem Tod<br />
der Mutter Thekla Bär 1936 in den Besitz der vier Töchter über. Es wurde 1949/50 an die<br />
Familie Bär bzw. die Nachkommen zurückerstattet und später verkauft.<br />
Bei der zwangsweisen Abgabe von Gold und Schmuck musste Betty Nathan 1938/39 ihren<br />
gesamten Schmuck sowie silbernes Essbesteck abgeben. Man sieht an der langen Liste,<br />
dass sie sehr viel Schmuck besaß. Die Deportation nach Gurs erfolgte am 22.10.1940<br />
zusammen mit Mann und Tochter Marie, dort traf sie ihre Schwester Else Kander mit<br />
Mann und Sohn. Der Todeszeitpunkt von Betty Nathan wurde amtlich festgesetzt auf den<br />
12.8.1942, den Ankunftstag in Auschwitz.<br />
28<br />
Postkarte von Betty Nathan an Familie<br />
Moritz Nathan, 515 Raritan Ave,<br />
Highland Park NJ, USA, am 21.5.1941.<br />
Foto: Vincent Sgro.<br />
Meine lieben Alle!<br />
Damit die Pause nicht gar zu groß wird,<br />
schreibe ich Euch heute einmal eine<br />
kurze Karte. Ausführlich schreibe ich<br />
erst wieder, wenn wir Brief von Euch<br />
erhalten haben. Dir, lieber Wilhelm<br />
[Nathan, ihr Neffe] gratulieren wir recht<br />
herzlich zu Deinem Geburtstag, den Du<br />
zum ersten Mal im eigenen Heim verbringen<br />
darfst. Wir wünschen Dir alles<br />
Gute vor allem, dass Ihr gesund bleibt,<br />
dass wir uns recht bald sehen können.<br />
Sorgt doch bitte dafür, dass wir bald die<br />
Papiere von Euch erhalten, damit wir<br />
endlich von hier raus kommen können.<br />
Tante Lina und Robert wurden am 15.<br />
d. M. in Marseilles eingeschifft; sie fahren<br />
über Martinique. Gestern kamen<br />
noch zwei Paketchen von ihr, an Elsa<br />
[Kander, ihre Schwester] und mich adressiert.<br />
Elsa beharrt unbedingt darauf,<br />
dass sie Hälfte davon bekommt, wenn<br />
sie auch jetzt nur zu zweien sind mit<br />
der Begründung, Kurt [Kander, Neffe]<br />
muss sich unbedingt zusetzen: wenn wir<br />
hoffentlich recht bald zu Euch kommen,<br />
kann ich Euch viel erzählen. Ich kann<br />
nicht alles schreiben, wie es hier zugeht;<br />
des Essens wegen könnte ich fast noch<br />
meine Portion nur für Kurt entbehren,<br />
damit er satt werden kann. Hoffentlich<br />
erhalten wir recht bald wieder gute<br />
Berichte von Euch. Empfangt Alle von<br />
uns Allen herzlichste Grüße und Küsse,<br />
Eure Betty.<br />
Absender: Betty Nathan<br />
Camp de Gurs<br />
Ilot I, Baraque 13<br />
29
Biografien von Marie Nathan (1904-1942)<br />
und Margarete Nathan (1904-1940)<br />
von Marius Haag, Klasse 8s<br />
Marie und Margerete, genannt „Gretel“ Nathan waren Zwillingsschwestern, welche am<br />
4.2.1904 in Bischweiler im Elsass geboren waren. Beide besuchten zusammen die Höhere<br />
Mädchenschule in Bischweiler. Da Familie Nathan das Elsass als Deutsche nach dem<br />
1. Weltkrieg verlassen musste, traten beide Schwestern am 19.1.1920 in die vorletzte Klasse<br />
der Höheren Mädchenschule Bruchsal ein – übrigens in die Klasse, die auch von Erna<br />
Wälder, der Nichte der Baertigs (vgl. S. 24), besucht wurde. Wohl fiel ihnen der Wechsel<br />
nach Bruchsal schwer – Margarete wurde am Ende des Jahres nicht versetzt und musste<br />
die Klasse wiederholen, Maries Versetzung war zunächst ebenfalls gefährdet, sie konnte<br />
dann aber doch versetzt werden – besonders Englisch bereitete den beiden Schwestern<br />
wohl Schwierigkeiten. Margarete trat schließlich am 1.2.1921 aus der Schule aus, in<br />
der Klassenliste ist rätselhafter Weise vermerkt „wegen Unglücksfalls“. Marie schloss die<br />
Schule im März 1921 erfolgreich ab und verließ sie mit dem Abschlusszeugnis.<br />
Völlig im Dunkeln liegt, was die beiden in den 1920er Jahren und bis Mitte der 1930er<br />
Jahre taten. In den Adressbüchern Bruchsals wird kein Beruf angegeben – wohl haben<br />
sie keinen erlernt. Warum fand keine Eheschließung statt? Sicher haben sie in Wohlstand<br />
in der großzügigen Wohnung in der Schillerstraße 17 gelebt, da Vater Ernst ein<br />
Deckblatt der Krankenakte von Margarete Nathan aus der Heil- u. Pflegeanstalt<br />
Wiesloch. Quelle: GLA Karlsruhe, 463 Zugang 1983/20 Nr. 36366.<br />
erfolgreicher Zigarrenfabrikant<br />
war. In demselben Haus<br />
lebten auch die Großeltern<br />
Bernhard († 1924) und Thekla<br />
Bär († 1936). Maries weiterer<br />
Werdegang bis zur Deportation<br />
am 22.10.1940 nach Gurs<br />
bleibt völlig unklar. Ob sie die<br />
ganze Zeit in Bruchsal lebte?<br />
Während sie in den Bruchsaler<br />
Adressbüchern von 1931/32<br />
und 1938 erwähnt wird, fehlt<br />
sie 1933/36. Ein Versehen?<br />
Oder wohnte sie außerhalb?<br />
Jedenfalls kam sie, zusammen<br />
mit ihren Eltern, am 12.8.1942<br />
über das Sammellager Drancy<br />
nach Auschwitz, wo sich ihre<br />
Spur verliert.<br />
Über Margarete ist mehr bekannt,<br />
jedenfalls seit Mitte der 1930er Jahre: Margarete Nathan war am 1.12.1935 nach<br />
Worms gezogen, und zwar von Bruchsal kommend. Sie war Hausangestellte, zunächst<br />
bei Bernkopf (vgl. 2. Gedenkschrift 2016, S. 41), Mozartstraße 20, ab dem 19.4.1936 bei<br />
Dr. Kulp, Horst-Wessel-(Rathenau)-Straße 27, ab dem 3.11.1936 bei Oskar Frank (Elias<br />
Hausmann), Kaiser-Wilhelm-Straße 6 (heute Wilhelm-Leuschner-Straße). Familie<br />
Frank verließ Worms im März 1939, vermutlich zog Gretel dann nach Bruchsal zurück.<br />
Bei der Volkszählung im Mai 1939 war auch Margarete in Bruchsal gemeldet, allerdings<br />
kam sie aus ungenannten Gründen bereits am 12.6.1939 in die Heil- und Pflegeanstalt<br />
Wiesloch. Kurzzeitig, vom 27. bis zum 29.8.1939 und vom 15. bis zum 23.5.1940, wurde<br />
sie nach Hause entlassen. Vermerkt ist in den Anstaltsakten, dass sie während ihrem letzten<br />
Aufenthalt, zwischen dem 23.5.1940 und dem 11.7.1940, vier Mal besucht wurde: Am<br />
27. Mai waren es „2 Bekannte“, am 6. und 22. Juni sowie am 9. Juli ihre Eltern Betty und<br />
Ernst Nathan. Sehr aufschlussreich ist der Brief des Vaters nach seinem letzten Besuch.<br />
Zu diesem Zeitpunkt war Margarete bereits tot. Sie wurde am 11.7., zwei Tage nach dem<br />
Besuch der Eltern, im Rahmen der „Aktion T4“ mit einem der grauen Busse in die Tötungsanstalt<br />
Grafeneck verbracht, wo sie noch an demselben Tag ermordet wurde. Sicher<br />
war Margarete Nathans Erregung zwei Tage vor ihrem Tod darauf zurückzuführen, dass<br />
sie die in jener Zeit täglich abgehenden Deportationen richtig zu deuten wusste. Die Anstaltsleitung<br />
Wiesloch übrigens beantwortete den Brief am 25.7.1940 und teilte mit, dass<br />
Margarete Mitte des Monats auf Weisung des Innenministeriums mit anderen Kranken<br />
in eine außerbadische Anstalt verlegt worden sei, und dann wörtlich:<br />
„Die Benachrichtigung der<br />
Angehörigen sollte durch die<br />
Brief von Ernst Nathan an die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch am<br />
18.7.1940. Quelle: GLA Karlsruhe, 463 Zugang 1983/20 Nr. 36366.<br />
30 31<br />
Übernahmeanstalt erfolgen.<br />
Wir nehmen an, dass dies inzwischen<br />
geschehen ist. Im<br />
Übrigen war der Zustand Ihrer<br />
Tochter unverändert ungünstig<br />
gewesen.“ Später wurden<br />
die Eltern vom Tod Margaretes<br />
informiert, und man<br />
sandte ihnen auch eine Urne<br />
zu. Wie Margaretes Cousine<br />
Erna Finkel 1964 niederschrieb,<br />
ist Margaretes Asche<br />
auf dem Bruchsaler Friedhof<br />
im Grabe ihrer Großeltern<br />
Bernhard und Thekla Baer<br />
beigesetzt worden. Einen<br />
Eintrag auf dem Grabstein<br />
gibt es allerdings nicht.
Familie Bernhard und Thekla Bär<br />
(Eltern von Betty Nathan)<br />
Bernhard Bär<br />
* 18.03.1853 Heidelsheim † 21.10.1924 Bruchsal<br />
(Sohn von Josef Bär (1816-1871), Handelsmann in Heidelsheim, und Rosine Dreyfuß (1813-1900))<br />
Kaufmann in Heidelsheim, seit 1890/1900 in Bruchsal, Schillerstraße 17 (heute: Franz-Bläsi-Straße 17)<br />
verh. 23.09.1879 Bruchsal<br />
Thekla Bär<br />
* 14.10.1856 Untergrombach † 26.10.1936 Bruchsal<br />
(Tochter von Raphael Bär (1826-1878) und Johanna „Hannchen“ Bär (1833-1913))<br />
4 Kinder:<br />
1. Betty Bär * 06.01.1882 Heidelsheim † 12.08.1942 Auschwitz<br />
1903 bis 1920 in Bischweiler/Elsass, 1919 bis 1940 Bruchsal, 22.04.1940 Gurs, Auschwitz<br />
verh. 04.06.1903 Bruchsal<br />
Ernst (Nathan) Nathan * 03.04.1871 Lorsch † 12.08.1942 Auschwitz<br />
(Sohn v. Emanuel Nathan (1829-1898), Kaufm. in Worms, u. Auguste Ehrmann (1839-~1920))<br />
1903 Kaufmann in Bischweiler/F, seit 1919 Zigarrenfabrikant in Bruchsal, 22.04.1940 Gurs<br />
2 Kinder:<br />
a) Maria „Marie“ Nathan * 04.02.1904 Bischweiler † 12.08.1942 Auschwitz<br />
22.04.1940 von Bruchsal nach Gurs, später Drancy, Auschwitz, unverheiratet<br />
b) Margarete „Gretel“ Nathan * 04.02.1904 Bischweiler † 11.07.1940 Grafeneck<br />
12.1935-03.1939 Dienstmädchen in Worms, 06.1939-07.1940 Heilanstalt Wiesloch, unverh.<br />
2. Laura Bär * 27.02.1883 Heidelsheim † 01.05.1951 New York/USA<br />
wohnhaft in Stuttgart, 09.1940 über London nach New York emigriert<br />
verh. 21.02.1907 Bruchsal<br />
Max Schorsch<br />
* 05.12.1876 Sindolsheim † 27.09.1949 New York/USA<br />
(Sohn v. Ephraim Schorsch (1836-1925), Schuhhändler, u. Theresia Flegenheimer (1836-1907))<br />
Kaufmann in Stuttgart, 09.1940 über London nach New York emigriert<br />
3 Kinder:<br />
a) Richard Julius Schorsch * 08.12.1907 Stuttgart † 27.05.1991 New York/USA<br />
Stuttgart, 10.1938 Emigration in USA, Buchhalter in New York, kinderlos<br />
vh. 1953 Ingeborg Klein * 18.06.1915 Berlin † 10.1992 New York/USA<br />
b) Erna Schorsch * 17.12.1909 Stuttgart † 18.09.1989 Fairview/NJ/USA<br />
1937 in Birmingham, 09.1940 über London nach New York emigriert<br />
vh. nach 1940 Leo Finkel * 08.03.1904 † 04.1967 USA<br />
1 Kind: Marian Finkel, lebt in USA<br />
c) Alice Schorsch * 22.03.1911 Stuttgart † 16.08.1996 New York/USA<br />
11.1937 von Birmingham nach New York emigriert, kinderlos<br />
Bernhard Kander * 07.07.1876 Heidelberg † 12.04.1941 Gurs/F.<br />
(Sohn von Gustav Kander, Möbelfabrikant in Heidelberg, und Bertha Hanß)<br />
Möbelfabrikant in Heidelberg, 22.10.1940 Gurs<br />
2 Kinder:<br />
a) Kurt Gustav Kander * 21.08.1909 Heidelberg † 24.01.1942 Gurs/F.<br />
wohnhaft in Heidelberg, 22.10.1940 nach Gurs, unverheiratet und kinderlos<br />
b) Herbert Kander * 16.07.1912 Heidelberg † 26.11.1981 Duval/FL/USA<br />
1938 in USA, 1940 in New Brunswick/NJ/USA, unklar, ob verheiratet; kinderlos<br />
4. Paula Josefine Bär *18.05.1889 Heidelsheim † 08.02.1968 Newark/NJ/USA<br />
12.1936 von Hamburg in USA, 1940 in New Brunswick/NJ/USA, 1950,1965 in Highland Park/NJ<br />
verh. 04.08.1911 Bruchsal<br />
Moritz „Morris“ Nathan * 31.03.1877 Worms † 30.09.1953 Franklin/NJ/USA<br />
(Sohn v. Emanuel Nathan (1829-1898), Kaufm. in Worms, u. Auguste Ehrmann (1839-~1920))<br />
1911-1936 Kaufmann/Zigarrenfabrikant in Bruchsal, 1936 in USA, 1940 New Brunswick/NJ<br />
1 Kind:<br />
a) Wilhelm Emanuel „William“ Nathan * 04.06.1912 Bruchsal † 19.05.1992 USA<br />
Kaufmann in Bruchsal, 08.1934 von Hamburg in USA, 1940 in New Brunswick/NJ/USA,<br />
1950,1965 in Highland Park/NJ/USA,<br />
vh. Julie …., kinderlos<br />
Von links: Bernhard, Else und Kurt Kander. Fotos: Yad Vashem.<br />
Max und<br />
Laura<br />
Schorsch.<br />
Foto:<br />
Vincent<br />
Sgro.<br />
3. Else Regina Bär * 27.09.1884 Heidelsheim † 08.1942 Auschwitz<br />
wohnhaft in Heidelberg, 22.10.1940 nach Gurs, interniert in Drancy, 10.08.1942 Auschwitz<br />
verh. 29.10.1908 Bruchsal<br />
32<br />
Grabstein von Bernhard und Thekla<br />
Bär, Friedhof Bruchsal.<br />
Foto: Florian Jung.<br />
Von links: Richard, Erna und Alice Schorsch. F.: Yad Vashem/V. Sgro.<br />
33
Familie Emanuel Nathan<br />
(Eltern von Ernst Nathan)<br />
Emanuel Nathan<br />
* 16.07.1829 Reichelsheim † 06.06.1898 Worms<br />
Kaufmann in Gernsheim, Lorsch und Spezereihändler (1877) in Worms<br />
verh. (1. Ehe) um 1860 (Kind 1 aus dieser Ehe)<br />
A) Mina Weil * † 1863//1871 Gernsheim<br />
verh. (2. Ehe) um 1863//1871 (Kinder 4 und 5 aus dieser Ehe)<br />
B) Auguste Ehrmann * 03.11.1839 Pfungstadt † nach 1911 Offenburg (?)<br />
Umzug im Juni 1899 von Worms nach Offenburg, lebte dort 1903, 1911<br />
5 Kinder:<br />
1. Jonas Nathan * 12.10.1863 Gernsheim † 17.04.1911 Worms<br />
1897, 1911 Handelsmann in Worms, verstorben im Krankenhaus Worms, unverheiratet<br />
2. Dr. med. Josef Nathan * 08.06.1866 Gernsheim † 18.07.1926 Offenburg<br />
um 1900 Arzt in Wallertheim bei Worms, später in Offenburg<br />
verh. um 1897 Wallertheim (?)<br />
Ella (Eleonora Gutella) Mann * 26.02.1878 Wallertheim † nach 1940 USA<br />
wohnhaft in Offenburg, 05.1938 in die USA, lebte 1940 beim Sohn in Holyoke City/Mass./USA<br />
1 Kind:<br />
a) Dr. med. Paul Nathan * 22.05.1898 Wallertheim † 07.03.1971 Holyoke/USA<br />
Arzt in Offenburg, 05.10.1935 nach Northhampshire/USA, lebte in Holyoke/USA, kinderlos<br />
vh. um 1955/60 Elisabeth Ziegler * 14.11.1904 † 29.08.2006 Granby/Mass./USA<br />
(1. Ehe mit Frederick H. Cramer (1906-1954), seit 1938 in USA, Prof. in Holyoke, 5 Kinder)<br />
3. Karoline Nathan * 24.11.1867 Lorsch † 06.12.1936 Frankfurt/M.<br />
15.11.1898 von Worms nach Frankfurt/M., wohnte 1936 in Frankfurt/M., unverheiratet<br />
4. Ernst (Nathan) Nathan * 03.04.1871 Lorsch † 12.08.1942 Auschwitz<br />
1903 Kaufmann in Bischweiler/F, seit 1919 Zigarrenfabrikant in Bruchsal, 22.04.1940 Gurs<br />
verh. 04.06.1903 Bruchsal<br />
Betty Bär<br />
* 06.01.1882 Heidelsheim † 12.08.1942 Auschwitz<br />
(Tochter von Bernhard Bär (1853-1924) und Thekla geb. Bär (1856-1936), siehe Seite 32-33)<br />
5. Moritz „Morris“ Nathan * 31.03.1877 Worms † 30.09.1953 Franklin/NJ/USA<br />
1911-1936 Kaufmann/Zigarrenfabrikant in Bruchsal, 1936 in USA, 1940 New Brunswick/NJ<br />
verh. 04.08.1911 Bruchsal<br />
Paula Josefine Bär<br />
*18.05.1889 Heidelsheim † 08.02.1968 Newark/NJ/USA<br />
(Tochter von Bernhard Bär (1853-1924) und Thekla geb. Bär (1856-1936), siehe Seite 32-33)<br />
Erinnerungen an die Familie Nathan<br />
von Hubert Bläsi<br />
Im Haus Nr. 17 der damaligen Schillerstraße wohnten in meiner Kindheit und frühen Jugend<br />
drei jüdische Familien: Bär, Kaufmann und Nathan. Zu den Familien Bär und Nathan hatten<br />
wir Kinder aus dem Nachbarhaus Nr. 15 Kontakt. Wir besuchten die Familien in ihren Wohnungen.<br />
Ich erinnere mich besonders an die Besuche bei Familie Nathan. Herr Ernst Nathan<br />
war ein mittelgroßer, eher hagerer Mann; er trug eine Brille mit Goldrand, sein Haar war<br />
rötlich-blond, stark angegraut. Frau Betty Nathan war vollschlank, untersetzt; sie hatte dunkelblondes,<br />
angegrautes Haar. Die Töchter Marie und Gretel ähnelten äußerlich ihren Eltern,<br />
Marie mehr der Mutter, Gretel glich im Körperbau ihrem Vater. Die beiden Töchter waren<br />
aus unserer kindlichen Sicht schon „älter“, also zwischen 20 und 30 Jahren. Bei unseren Besuchen<br />
bekamen wir Matzen zu essen, etwas, was für uns damals ganz unbekannt war. Wenn<br />
die Erwachsenen sich über etwas unterhielten, was wir Kinder nicht hören sollten, sagten die<br />
Eltern oder eine der Töchter: „Regardez les enfants!“ Anschließend unterhielten sich Nathans<br />
auf Französisch. Als wir das unseren Eltern erzählten, wurde uns gesagt, was das bedeutet.<br />
Zur Erklärung: Die Familie Nathan kam irgendwann in den 1920er (?) Jahren aus Bischwiller<br />
im Elsass nach Bruchsal. Eines Tages erfuhren wir, dass Nathans Tochter Gretel nach Wiesloch<br />
in die Psychiatrie gebracht worden war. Die Eltern Nathan führten die Gemütserkrankung<br />
der Tochter auf den ständigen psychischen Druck der antijüdischen NS-Propaganda<br />
zurück, die damals schon sehr stark zu spüren war. Unsere Eltern wussten schon von Fällen,<br />
in denen Psychiatriepatienten plötzlich „verstorben“ waren und befürchteten, dass Gretel<br />
Nathan das gleiche Schicksal drohen könnte. So kam es dann auch. Todesursache: „Lungenentzündung“.<br />
Die Euthanasie-Aktion der Nazis war in vollem Gange. Ich erinnere mich<br />
auch daran, dass Herr Nathan und mein Vater sich gelegentlich über den Gartenzaun unterhielten.<br />
Selbst das war angesichts der Tatsache, dass in Haus Nr. 19 ein Politischer Leiter der<br />
NSDAP wohnte, für Herrn Nathan und meinen Vater nicht ungefährlich. Themen der Gartenzaungespräche<br />
waren die Gartenarbeit, Börsenkurse und sicher auch die Politik. Apropos<br />
Börsenkurse: Herr Nathan als Kaufmann beobachtete die Entwicklung an den internationalen<br />
Börsen. Die Börsennachrichten erschienen damals in gebundenen Broschüren auf<br />
gelbem Papier. Diese schenkte Herr Nathan nach Gebrauch uns Kindern, und wir benutzten<br />
sie, wenn wir „Büro“ spielten. Dann kam jener verhängnisvolle Tag im Oktober 1940. Als ich<br />
von der Schule nach Hause kam, sagte meine Mutter tief betroffen: „Heute morgen haben sie<br />
die Nathans unter Polizeibewachung abgeführt“. Wir alle ahnten, dass für die Familie Nathan<br />
Schreckliches bevorstand, obwohl wir damals von Gurs und Auschwitz nichts wussten. Wohl<br />
aber war unseren Eltern bekannt, dass das KZ Dachau existierte. Ein Bekannter meines Vaters<br />
war zu der Zeit Häftling in Dachau. Es ist schwierig, die Empfindungen eines Elfjährigen,<br />
der die Zusammenhänge nicht voll erfasste, nach fast 80 Jahren zu rekonstruieren. Sicher ist<br />
aber, dass die gedrückte Stimmung der Eltern wegen der völligen Wehrlosigkeit gegenüber<br />
dem schreienden Unrecht sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt hat.<br />
34 35
Biografie von Jettchen Bär geb. Elsasser<br />
(1868-1948)<br />
von Lukas Bratan und Raphael Waal, Klasse 8t<br />
Jettchen Bär hatte ein bewegtes Leben, das mit Sicherheit viele Höhen und vor allem<br />
Tiefen hatte. Besonders fällt auch auf, dass sie das Schicksal an viele unterschiedliche<br />
Wohnorte führte. Geboren wurde sie als „Jäntel“ Elsasser am 29.12.1868 in Rohrbach<br />
bei Sinsheim als jüngste Tochter des Essigsieders Aschur Elsasser und seiner Frau Gustel<br />
Emanuel. Sie wuchs mit vier Brüdern und zwei Schwestern auf, zu denen sie wohl zeitlebens<br />
enge Beziehungen hatte. Auch wenn die Familien beider Eltern alteingesessen in<br />
Rohrbach waren und der Vater auch hin und wieder als „Fabrikant“ bezeichnet wurde,<br />
so war der Horizont von Jäntels Jugend in dem kleinen Kraichgauort sicher relativ beschränkt.<br />
Immerhin schien der Vater einigermaßen wohlhabend gewesen zu sein, da<br />
seine Firma 1900 eine Zweigniederlassung in Karlsruhe eröffnen konnte. 1904 wurde die<br />
Firma durch den ältesten Sohn Max ganz nach Karlsruhe verlegt. Jäntel, die später „Jettchen“<br />
genannt wurde, zog zu einem unbekannten Zeitpunkt, wahrscheinlich anlässlich<br />
ihrer Eheschließung, nach Heidelberg.<br />
Der Ehemann Bernhard Bär, geboren 1862 in Rohrbach bei Heidelberg (!), war in doppeltem<br />
Sinne verschwägert, und so kann spekuliert werden, ob sich die beiden bei einem<br />
verwandtschaftlichen Treffen kennen gelernt hatten oder ob die Eheschließung arrangiert<br />
war – in damaliger Zeit nicht unüblich. Am 5.10.1893 heiratete das Paar in Heidelberg<br />
und lebte, gemäß Adressbuch, in der Hauptstraße 188 in Heidelberg. Bernhard war<br />
der Inhaber der Firma „Baer und Hilb, D. Baer Nachfolger, Manufaktur-, Modewarenund<br />
Damenkonfektionsgeschäft, Großhandlung und Kleinverkauf “. Dort wohnten sie<br />
zusammen mit Sophie Bär geb. Elsasser (1837-1912). Diese war – Achtung, kompliziert!<br />
Geburtsurkunde von Jäntel Elsasser in Rohrbach bei Sinsheim. Der jüdische Zwangsname „Sara“ wurde<br />
1939 auf den Rand der Geburtsurkunde eingefügt. Foto: www2.landesarchiv-bw.de.<br />
– einerseits die Schwester von Jettchens Vater Ascher Elsasser (1828-1913) und andererseits<br />
die Stiefmutter von Bernhard Bär, nämlich die dritte Frau von Bernhard Bärs Vater<br />
Daniel Jakob Bär (1816-1877). Etwas vereinfacht: Jettchens Tante war gleichzeitig ihre<br />
Schwiegermutter.<br />
Doch dem nicht genug: Jettchens Bruder Abraham Elsasser, der Medizin studiert und<br />
promoviert hatte, sich Albert nannte und sicher der Stolz der sonst im kaufmännischen<br />
Bereich tätigen Familie war, hatte 1888 seine Cousine Betty Bär geheiratet – sie war nämlich<br />
eine leibliche Tochter dieser besagten Tante Sophie Bär geb. Elsasser und Daniel<br />
Jakob Bär. Dr. Albert Elsasser und seine Frau Betty lebten ebenfalls in Heidelberg, Plöck<br />
2, und bekamen in den Jahren 1889, 1895 und 1898 drei Töchter, die in Heidelberg aufwuchsen.<br />
Dr. Albert Elsasser scheint in Heidelberg anerkannt gewesen zu sein. Als das<br />
Heidelberger „Rote Kreuz“ nämlich im Dezember 1914 in Tournai (Belgien) eine Militärverpflegungs-<br />
und Erfrischungsstation einrichtete, wurde er zum ärztlichen Leiter<br />
ernannt und zum Aufbau der Station entsandt. Auch die alten Eltern Aschur und Gustel<br />
Elsasser hatte Dr. Albert Elsasser betreut: Diese wohnten 1912, als die Mutter starb, in<br />
Heidelberg in der Alten Bergheimer Str. 5. Danach nahm er den alten Vater in seiner<br />
Wohnung auf, wo dieser dann neun Monate später, ebenfalls im Alter von nahezu 85<br />
Jahren, starb.<br />
Als die Eltern starben, war Jettchen selbst bereits verwitwet und lebte schon lange nicht<br />
mehr in Heidelberg. Ihre beiden Söhne Franz Daniel und Max Paul Bär waren 1894 und<br />
1896 noch in Heidelberg zur Welt gekommen. Da Max Paul bereits im Alter von neun<br />
Monaten in Straßburg starb, muss der Umzug der Familie dorthin in der Zwischenzeit<br />
erfolgt sein. 1903 wurde die Tochter Johanna in Mannheim geboren, sodass der Umzug<br />
dorthin zwischen 1897 und 1903 erfolgt sein muss (Adresse: R7, 38). Jettchens Ehemann<br />
Bernhard Bär, in Mannheim Generalvertreter der Bielefelder Leinenfabriken für Baden,<br />
konnte seiner Familie wahrscheinlich ein komfortables<br />
Leben ermöglichen – bis er im November<br />
1910 im Alter von nur 48 Jahren an einem Herzschlag<br />
verstarb.<br />
Jettchen sah sich gezwungen, abermals umzuziehen,<br />
diesmal nach Karlsruhe. Dort betrieben ihr<br />
ältester Bruder Max Elsasser und ihr jüngster Bruder<br />
Ludwig Elsasser gemeinsam eine Firma zum<br />
Handel mit Dünge- und Futtermitteln. Etwa von<br />
1913 bis 1928 wohnte sie zusammen mit ihrem<br />
unverheirateten Bruder Ludwig in Karlsruhe in<br />
der Kaiserallee 52, 1932/33 werden die beiden in<br />
der Viktoriastr. 23 genannt. Jettchens Tochter Johanna<br />
Bär wohnte wohl in den ganzen Jahren bei<br />
ihnen, sie war von 1925 bis zur „betriebsbedingten<br />
Kündigung“ im August 1935 Buchbinderin bei der Grabstein Bernhard Bär. Foto: privat.<br />
36 37
Fa. Gutsch in Karlsruhe. Vom Sohn Franz Daniel wissen wir nicht, ob er 1910/13 mit<br />
nach Karlsruhe gezogen war; er wurde jedenfalls Kaufmann und heiratete 1923 nach<br />
Bruchsal. 1933/34 fehlt von Jettchen Bär, Johanna Bär und Ludwig Elsasser im Karlsruher<br />
Adressbuch jede Spur, obwohl Ludwig Elsasser noch bis zu seinem Tod im Dezember<br />
1936 Geschäftsführer des Düngemittelhandels im Karlsruher Rheinhafen war. Er<br />
sollte der letzte der Familie in Karlsruhe sein. Nach dem Tod des ältesten Bruders Max<br />
Elsasser 1932 hatte dessen Sohn Rudolf Elsasser die Leitung des Betriebs zusammen mit<br />
Ludwig übernommen. Dieser Neffe wanderte aber 1936 nach Israel aus, sodass Jettchen<br />
Bär keine näheren Verwandten mehr in Karlsruhe hatte.<br />
Jettchen und ihre Tochter Johanna mussten abermals umziehen, diesmal nach Bruchsal,<br />
und Jettchen Bär wird im Bruchsaler Adressbuch von 1933/36 im Haus Schillerstr. 10<br />
genannt. Dort wohnte ihr Sohn Franz Daniel Bär, zusammen mit seiner Frau Toni geb.<br />
Ledermann, der 1924 geborenen<br />
Enkelin Ellen Bär und seiner<br />
Schwiegermutter, der verwitweten<br />
Mathilde Ledermann. Die<br />
Wohnung war seit Jahrzehnten<br />
von der Familie Ledermann gemietet.<br />
Franz Daniel wohnte mit<br />
seiner Familie zuvor am Hoheneggerplatz<br />
9, war aber schon<br />
Partie der Bruchsaler Schillerstraße, vom Kino aus gesehen.<br />
Foto: Michael Hofmeister (www.bruchsaler-ansichtskarten.de).<br />
38<br />
1931/32 in der Schillerstr. 10 bei<br />
der Schwiegermutter gemeldet.<br />
Jettchens Tochter Johanna Bär<br />
wohnte auch kurzzeitig in Bruchsal, und sie gab später an, dass der Umzug von Karlsruhe<br />
nach Bruchsal 1935 erfolgte, weil sie aus rassischen Gründen im August 1935 entlassen<br />
worden war, und sie im August 1936 von der Bruchsaler Adresse Kaiserstraße 16<br />
aus nach Argentinien auswanderte. Dass sie dort gemeinsam mit Jettchen Bär und der<br />
ledigen Tante Karoline Elsasser, Jettchens jüngster Schwester, wohnte, geht aus dem<br />
Adressbuch von 1938 hervor – allerdings sind die Jahresangaben so nicht ganz stimmig.<br />
Im Juli 1938 musste Jettchen Bär abermals Abschied nehmen von dem Mann, der sie<br />
ernährte – nach ihrem Ehemann 1910 und ihrem Bruder 1936 war es jetzt der einzige<br />
Sohn: Franz Daniel Bär wanderte zusammen<br />
mit seiner Ehefrau Toni, seiner Tochter<br />
Ellen und seiner Schwiegermutter Mathilde<br />
Ledermann über Luxemburg und Le<br />
Havre nach New York aus und ließ sich in<br />
Los Angeles nieder.<br />
Auch ihre wohl nur kurzzeitig genutzte<br />
Wohnung in der Kaiserstraße 16 mussten<br />
die beiden in Bruchsal zurückgebliebenen<br />
Todesanzeige von Jettchen Bär. Foto: Aufbau.<br />
Von links: Franz Daniel, Toni und Johanna Bär. Foto 1 und 2: privat, Foto 3: GLA KA 480 Nr. 26017.<br />
Schwestern Jettchen Bär und Karoline Elsasser wieder aufgeben – bei der Volkszählung<br />
im Mai 1939 wohnte Jettchen in der Schloßstr. 5, Karoline in der Rheinstr. 26. Vor der<br />
Deportation nach Gurs mussten beide abermals umziehen: Karoline zog 1939 nach<br />
Mannheim ins Jüdische Altersheim, Jettchen wahrscheinlich im Frühjahr 1940 ins Haus<br />
Bismarckstr. 3, in eines der Bruchsaler sog. „Judenhäuser“.<br />
Wie alle anderen Bruchsaler Juden wurde Jettchen Bär, inzwischen 72-jährig, am<br />
22.10.1940 nach Gurs deportiert, wo sie wieder auf ihre Schwester Karoline Elsasser traf.<br />
Wenn die Angaben der Tochter Johanna stimmen, war die Deportation für Jettchen besonders<br />
tragisch, da Jettchen nur drei Wochen gefehlt haben sollen, um nach Argentinien<br />
auszuwandern. Die ganze Habe sei schon verpackt in Hamburg gelagert gewesen.<br />
Am 19. Januar 1942 wurde Jettchen von Gurs ins Camp de Noé überstellt und ist von<br />
dort aus am 20.8.1943 nach Martel in Lothringen gekommen. Dort war sie bis 31. Januar<br />
1946 in einem gewöhnlichen Altersheim untergebracht und entging somit der Deportation<br />
nach Auschwitz. Dann kam sie, zusammen mit ihrer Schwester Karoline, nach<br />
Lourdes ins „Centre d’acceuil international“ und aus gesundheitlichen Gründen am<br />
6.9.1947 in die medizinische Klinik des Hotel Dieu in Rennes. Es wurde Lungenkrebs<br />
diagnostiziert. Jettchen Bärs Zustand verschlimmerte sich immer mehr, sodass sie am<br />
3. Januar 1948 verstarb. Ihren Sohn Franz Daniel, der wohl in regelmäßigem Briefkontakt<br />
mit seiner Mutter und „Tante Karoline“ stand, hatte sie seit 10 Jahren nicht mehr<br />
gesehen. Besonders tragisch ist auch, dass Jettchens Tochter Johanna in Argentinien erst<br />
viele Jahre später erfuhr, dass ihre Mutter den Krieg überlebt hatte.<br />
Todesanzeige von Franz Daniel Bär. Foto: Aufbau.<br />
39<br />
Todesanzeige von Toni Bär. Foto: Aufbau.
Aschur „Ascher“ und Auguste Elsasser<br />
(Eltern von Jettchen Bär)<br />
Aschur „Ascher“ Elsasser * 06.02.1828 Rohrbach bei Sinsh. † 20.01.1913 Heidelberg<br />
(S. v. Maier Elsasser (1793-1848), Handelsmann in Rohrbach/Snh. u. Augustine „Gutel“ Stein (1800-1873))<br />
1855 Schutzbürger und Handelsmann in Rohrbach/Sinsheim; Essigsieder; Fabrikant<br />
verh. 28.08.1855 Rohrbach bei Sinsheim<br />
Auguste „Gustel“ Emanuel * 21.04.1827 Rohrbach/S. † 06.04.1912 Heidelberg<br />
(T. v. Liebmann Jakob Emanuel (~1787-1868) u. Caroline „Gutel“ Rastatter (~1795-1841), Rohrbach/Snh.)<br />
9 Kinder:<br />
1. Maier „Max“ Elsasser * 01.02.1857 Rohrbach/Snh. † 04.08.1932 Karlsruhe<br />
nennt sich seit 1887 „Max“, 1900-1932 Kaufmann in Karlsruhe (Handel mit Dünger- und Futtermitteln)<br />
zusammen mit Schwager Hermann Darnbacher sowie Bruder Ludwig Elsasser<br />
vh. 07.06.1887 Bühl Klothilde Darnbacher * 29.11.1863 Bühl † 28.11.1939 Mannh., beerd. in KA<br />
(T. v. Leopold Darnbacher (1824-1892), Weinhändler in Bühl, und Babette Epstein (1837-1921))<br />
3 Kinder:<br />
a) Alfred Friedrich Elsasser * 25.06.1888 Sinsheim † 07.01.1904 Karlsruhe<br />
b) Robert Elsasser „Ellis“ * 1891 Sinsheim † Adelaide/Australien<br />
1913 Student in Heidelberg, lebte in Mannheim, 1939 Emigration nach Australien<br />
vh. Marcelle Zivi * 1902 Genf/CH † Adelaide/Australien<br />
2 Kinder: Charlotte Ellis (1928-?); Gretel Ellis (1930-2005), vh./gesch. Donald Allan Dunstan<br />
Australischer Politiker, 1967-1979 Premier von South Australia (s. wikipedia!)<br />
c) Rudolf Leopold Elsasser * 17.02.1903 Karlsruhe † 18.05.1978 Kefar Sava/Israel<br />
Inhaber Dünger- und Futtermittelhandlung in Karlsruhe, 09.1936 nach Palästina ausgewandert<br />
vh. Erna Marum<br />
* 14.05.1905 Karlsruhe † 22.03.1962 Ra’anana/Israel<br />
2 Kinder: Ruth Elsasser (1931-2000) vh. Yitzchak Nishri; Meir Eilat (= Max Elsasser) (*1933)<br />
2. Hannchen Elsasser * 17.03.1859 Rohrb./Snh. † 19.03.1934 (beerd. in Waibstadt)<br />
vh. Max Götter * 28.05.1855 Ehrstädt † 19.10.1923 (beerd. in Waibstadt)<br />
wohnhaft in Ehrstädt, Kinder?<br />
c) Elisabeth Klara „Liesel“ Elsasser * 24.05.1898 Heidelberg † nach 1940 Israel<br />
1930 Sekretärin in Heidelb., 02.1936 nach Israel eingew., 1940 eingebürgert, Köchin, unverh., kinderlos<br />
4. Jakob Elsasser * 20.08.1862 Rohrbach/Snh. † 30.01.1885 Rohrbach/Snh.<br />
wohl unverheiratet und kinderlos<br />
5. Moses Hajum Elsasser * 14.12.1863 Rohrbach/Snh. † 26.02.1867 Rohrbach/Snh.<br />
6. Isaak Elsasser * 08.05.1865 Rohrbach/Snh. † 11.09.1865 Rohrbach/Snh.<br />
7. Klara „Karoline“ Elsasser * 26.08.1867 Rohrbach/Snh. † 12.05.1950 Rennes/F. (?)<br />
unklar, wo bis 1936 wohnhaft; 1938-01.1939 in Bruchsal wohnhaft; 1940 von Mannheim (jüd.<br />
Altersheim) nach Gurs deportiert; unverheiratet<br />
8. Jäntel „Jettchen“ Elsasser * 29.12.1868 Rohrbach/Snh. † 03.01.1948 Rennes/F (Kkh.)<br />
Heidelberg, 1910 Mannh., ~1913 Karlsruhe, 1930er nach Bruchsal, 22.10.1940 Gurs, Noé, 1943 Martel<br />
vh. 05.10.1893 HD Bernhard Bär * 24.04.1862 Rohrbach/HD † 11.11.1910 Mannheim<br />
(S. v. Daniel Jakob Bär (1816-1877) und seiner 2. Frau (vh. 1860) Johanna Fuld (1835-1863))<br />
1893 in Heidelberg (Hauptstr. 188), General-Vertreter der Bielefelder Leinenfabriken<br />
3 Kinder<br />
a) Franz Daniel Bär * 21.07.1894 Heidelberg † 03.03.1950 Los Angeles/USA<br />
Kaufmann in Bruchsal (Hoheneggerplatz 9, Schillerstr. 10), 07.1938 über Le Havre nach New York<br />
vh. 16.08.1923 Bruchsal Toni Bertha Ledermann * 26.02.1899 Bruchsal † 20.11.1947 LA<br />
(T. v. Josef Ledermann (1868-1918), Fabrikant in Bruchsal, und Mathilde geb. Westheimer (1874-?))<br />
1 Kind: Ellen Baer * 30.05.1924 Karlsruhe † 15.11.2004 New York<br />
wanderte 07.1938 zusammen mit den Eltern in USA aus, unverheiratet und kinderlos<br />
b) Max Paul Bär * 29.11.1896 Heidelberg † 22.07.1897 Straßburg<br />
c) Johanna Bär * 02.03.1903 Mannh. † 14.01.1978 Montevideo/Uruguay<br />
wohnte 1910-1935 in Karlsruhe, 1925-08.1935 Buchbinderin in Karlsruhe (Fa. Gutsch), 08.1936<br />
von Bruchsal (Kaiserstr. 16) über Hamburg nach Buenos Aires, ca. 1960 nach Montevideo/Uruguay<br />
vh. 02.04.1938 Buenos Aires, Max „Maximo” Borger * 06.10.1906 Berlin † 13.01.1974 Montevi.<br />
(unehel. S. v. jüd. Prof. Max Wolf, Berlin u. Hedwig Köpke, ev., Berlin; Stiefsohn von Heinrich Borger)<br />
wohnhaft in Berlin, 03.1936 nach Buenos Aires ausgewandert, Briefmarkenhändler<br />
1 Kind: Susanna Haydee Borger Baer *11.04.1942 Buenos Aires/Arg., 2017 wohnhaft in Montevideo/<br />
Uruguay, unverheiratet und kinderlos<br />
3. Dr. Abraham „Albert“ Elsasser * 01.12.1860 Rohrbach/Snh. † 08.07.1930 Heidelberg<br />
Arzt in Heidelberg (wohnhaft: Plöck 2, Heidelberg)<br />
vh. 30.07.1888 HD Betty Bär * 16.11.1866 Heidelberg † 16.11.1921 Heidelberg<br />
(T. v. Daniel Jakob Bär (1816-1877) und seiner 3. Frau (vh. 1865) Sophie Elsasser (1837-1912) –<br />
Schwester von Aschur Elsasser (1828-1913), siehe oben!)<br />
3 Kinder:<br />
a) Gertrud Elsasser * 15.05.1889 Sinsheim † nach 1942 Israel<br />
vh. Robert Eichberg * 16.02.1874 Bochum † nach 1942 Israel<br />
Ingenieur in Breslau, 04.1935 nach Palästina emigriert, 04.1942 Einbürgerung in Israel<br />
1 Kind: Lotte Eichberg (1914-1975) vh. Fritz Cohn (1908-1987), aus Gnesen/Polen, später in Israel<br />
b) Hedwig Elsasser * 04.03.1895 Heidelberg † vermutl. 03.1943 Auschwitz<br />
1920 Klavierlehrerin in HD, 1934 Musiklehrerin in Breslau, 04.03.1943 deportiert, unverh., kinderlos<br />
9. Liebmann „Ludwig“ Elsasser * 20.10.1871 Rohrbach/Snh. † 18.12.1936 Karlsruhe<br />
1902-1936 Geschäftsführer der A. Elsasser und der Elsasser & Co. GmbH Karlsruhe, lebte seit<br />
~1913 zusammen mit seiner verwitweten Schwester Jettchen Bär und Fam. in Karlsruhe, unverheiratet<br />
Von links: Klothilde und<br />
Max Elsasser, Gertrud<br />
Eichberg geb. Elsasser,<br />
Liesel Elsasser.<br />
Foto 1: Jüdisches Familienbuch<br />
Bühl, Foto 2+3:<br />
Immigration Palestine.<br />
40 41
Biografie von Josef Heid (1882-1944)<br />
von Rolf Schmitt<br />
„Führer der S.P.D., für die eine persönliche Gefährdung besteht oder zu befürchten ist,<br />
sind in Schutzhaft zu nehmen.“¹<br />
Josef Heid kam am 17. November 1882 in Stühlingen<br />
als Sohn des Grenzaufsehers (Zollbeamten) Wendelin<br />
Heid und dessen Ehefrau Luise, geborene Schneider,<br />
zur Welt. Josef, der evangelisch getauft wurde, verlor<br />
bereits als Kind seinen Vater. Dieser wurde, Josef war<br />
erst sechs oder sieben Jahre alt, auf dem Gelände der<br />
Zuckerfabrik Waghäusel durch eine einstürzende<br />
Halle erschlagen. Danach ging es der Familie finanziell<br />
schlecht. Die ärmlichen Verhältnisse erlaubten es<br />
der Mutter nicht, Josef aufs Gymnasium zu schicken.<br />
Zweimal war Josef Heid verheiratet. Seine erste Ehefrau,<br />
die evangelisch getaufte Sofie Sorn, kam am<br />
7. Juli 1887 in Unteröwisheim zur Welt; dort fand am<br />
10. April 1915 die Hochzeit statt. Sofie verstarb am<br />
14. November 1926 in Villingen. Der gemeinsame<br />
Sohn Werner wurde am 12. März 1916 in Villingen<br />
geboren und in Adelsheim baptistisch getauft. Er<br />
Werner und Margaretha Heid, um 1940. F.: privat.<br />
Josef Heid, um 1930. Foto: privat.<br />
heiratete am 18. Februar 1941 in Mannheim<br />
Margaretha Seltsam.<br />
Mit seiner zweiten Ehefrau, der am 8.<br />
Januar 1907 geborenen Anna Christine<br />
Höpfinger, eine Kusine von Sofie, ging<br />
Josef Heid am 10. April 1928 den Bund<br />
der Ehe ein. Die Hochzeit war wiederum<br />
in Unteröwisheim. Die Eheleute hatten<br />
zwei Kinder. Wilfried kam 1929 in<br />
Villingen zur Welt, der später auch Dieter<br />
genannte Dietrich am 3. September<br />
1933.<br />
Josef Heid schlug die Beamtenlaufbahn ein und war seit 1903 verbeamtet. Ab 1921 war<br />
er als Revisionsinspektor beim Bezirksamt Villingen (entspricht dem heutigen Landratsamt)<br />
beschäftigt. Diese Tätigkeit hatte er bis 1933 inne. Seine letzte Wohnadresse in<br />
Villingen war die Kirnacher Straße 26.<br />
Schon früh war Josef Heid in Villingen für die SPD aktiv. Seit 1922 war er Gemeinde-<br />
bzw. Stadtverordneter, nach der Gemeinderatswahl 1926 im Stadtverordnetenvorstand<br />
und Stellvertreter des Obmanns. Darüber hinaus engagierte er sich im Villinger Mieterschutzverein<br />
und war dort auch Vorsitzender. Er war Vorsitzender der SPD Villingen<br />
und ab 1926 Mitglied des Kreisrates. Daneben hatte er noch weitere Ehrenämter inne.<br />
Bei der Landtagswahl vom 27. Oktober 1929 wurde er für den Wahlkreis Villingen/Wolfach<br />
in den Landtag gewählt. Er war einer von 18<br />
SPD-Abgeordneten im 88 Mitglieder umfassenden<br />
badischen Landtag.<br />
Mit der Machtübertragung im Januar 1933 an<br />
die Nationalsozialisten änderte sich das Leben<br />
von Josef Heid und seiner Familie schlagartig.<br />
Bereits am 10. März 1933 wies die NS-Gauleitung<br />
in einem „dringenden Funkspruch“ unter<br />
anderem an, „Führer der S.P.D., für die eine persönliche<br />
Gefährdung besteht oder zu befürchten<br />
ist, sind in Schutzhaft zu nehmen“¹. Die Villinger<br />
Ortsgruppe der NSDAP schrieb am nächsten<br />
Tag an die örtliche Polizei: „Wir bitten folgende<br />
Persönlichkeiten sofort in Schutzhaft zu nehmen,<br />
da wir für deren persönliche Sicherheit infolge<br />
ihres seitherigen Verhaltens unseren Parteigenossen<br />
gegenüber, keine Garantie mehr übernehmen<br />
können“. In diesem Schreiben waren dann sechs<br />
Personen aufgeführt, darunter „Wilh. Schifferdecker,<br />
Gewerkschaftssekr.“, „Ludwig Uebler, Regierungsrat<br />
beim Arbeitsamt Villingen“ und „Josef Heid, M.d.L. Revisionsinspektor“. Das Schreiben<br />
war unterzeichnet von den Vertretern der Villinger NSDAP-Ortsgruppe sowie<br />
der SS- und der SA-Führung.² In der Nacht vom 16. auf den 17. März 1933 wurden diese<br />
Personen von SA- und SS-Leuten festgenommen, auf dem Weg zur Villinger Polizeiwache<br />
misshandelt und dann der Polizei zur „Inschutzhaftnahme“ übergeben. Die Misshandlungen<br />
waren so gravierend, dass die Inhaftierten für zehn Tage im Krankenhaus<br />
behandelt werden mussten. Danach wurden sie im Villinger Gefängnis arrestiert.<br />
In einem Scheiben vom 13. April 1933 heißt es: „Die Verletzungen […] waren derart, dass<br />
eine Aufnahme in das Amtsgerichtsgefängnis untunlich erschien und daher ihre Unterbringung<br />
in das Städt. Krankenhaus veranlasst werden musste“. Die Misshandelten mussten<br />
die Krankenhauskosten selbst bezahlen. Josef Heid blieb bis zum 29. Mai 1933 im Villinger<br />
Bezirksgefängnis, anschließend kam er ins Konzentrationslager Heuberg und wurde<br />
dort am 27. Juni 1933 entlassen. Auch für den Gefängnis- und KZ-Aufenthalt musste er<br />
selbst aufkommen.<br />
Bereits am 7. April 1933 war Josef Heid eröffnet worden, dass er aufgrund des Gesetzes<br />
zum Schutz des Berufsbeamtentums unter Kürzung seiner Pensionsansprüche auf die<br />
42 43<br />
Anna und Josef Heid mit Sohn Dietrich (?)<br />
im Gartenweg 37, um 1938. Foto: privat.
Anna und Josef Heid bei der Hochzeit von Margaretha und<br />
Werner, 1941. Foto: privat.<br />
Hälfte fristlos seines Amtes enthoben<br />
sei.<br />
Nach der Entlassung aus dem<br />
Konzentrationslager Heuberg<br />
erhielt Josef Heid von der Stadtverwaltung<br />
Villingen am 1. August<br />
1933 einen „Stadtverweis“,<br />
musste also seine Heimatstadt<br />
verlassen. Es war schwierig für<br />
ihn, für seine Familie und sich<br />
selbst eine neue Unterkunft zu<br />
finden. Sein Bruder in Konstanz<br />
weigerte sich die Familie<br />
aufzunehmen, ebenso wie ein<br />
in Öhringen lebender Schulfreund.<br />
Die Ausreise ins schweizerische Kreuzlingen, wo ihn ein Bekannter aufgenommen<br />
hätte, wurde ihm verweigert. Zunächst kam die Familie bei den Schwiegereltern in<br />
Unteröwisheim unter, dan fand sie Zuflucht im Bruchsaler Gartenweg, wo sein Schwiegervater<br />
ein kleines Häuschen auf den Namen von Heids Ehefrau kaufte.<br />
Große Teile des Umzuges musste der 17-jährige Sohn Werner organisieren, war zu dieser<br />
Zeit doch die Mutter Anna zur Entbindung von Dietrich im Krankenhaus und war<br />
doch sein Vater seit 6. September 1933 erneut im Villinger Gefängnis inhaftiert wegen<br />
angeblicher „Provokation der SA“.<br />
Anfang September rottete sich gegen Abend eine „empörte Volksmenge“ vor dem Wohnhaus<br />
Kirnacher Straße 26 in Villingen zusammen. Rufe wurden laut: Holt ihn runter und<br />
schlagt ihn tot und dergl. [...] Die Haltung wurde immer bedrohlicher, es wurde versucht,<br />
eine Leiter anzustellen. Es wurde mit Steinen geworfen. Nach einiger Zeit kamen dann<br />
zwei Polizeibeamte und haben meinen Vater in Schutzhaft genommen. [...] Namen von<br />
Demonstranten zu nennen ist zwecklos, da diese inzwischen alle honorige Demokraten<br />
geworden sind und sich nicht mehr erinnern können.“ Werner Heid, 12.11.1959.<br />
Nach der Entlassung aus dem Gefängnis am 1. Oktober 1933 durfte Josef Heid nicht<br />
mehr in seine Wohnung; er wurde direkt zum Bahnhof zur Abfahrt nach Bruchsal verbracht.<br />
Josef Heid musste sich nun jede seiner Aktivitäten von der Polizei genehmigen lassen.<br />
Kein Besuch bei den Schwiegereltern in Unteröwisheim, keine Fahrt ins Umland von<br />
Bruchsal oder gar in die alte Heimat, ohne dass er vorher bei der Polizei um Erlaubnis<br />
fragen musste.<br />
Josef Heid versuchte zunächst, sich und seine Familie mit einer kleinen Hühnerzucht<br />
finanziell über die Runden zu bringen. Er bildete sich in Fernkursen zum Bilanzbuchhalter<br />
fort und war für Bruchsaler Firmen tätig. 3 1941 wurde er zum Domänenamt in<br />
Bruchsal dienstverpflichtet, erst ab dann erhielt er wieder ein regelmäßiges Gehalt. Doch<br />
auch diese geringe Nebeneinnahme wurde ihm nach 1 ½ Jahren wieder genommen und<br />
ihm wurde zudem noch jede gleichartige Tätigkeit verboten. Mehrmals wurde seine<br />
Bruchsaler Unterkunft von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) durchsucht. Jedesmal<br />
verliefen diese Durchsuchungen ergebnislos.<br />
Nach dem gescheiterten Attentat auf<br />
Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wurden<br />
im ganzen Reichsgebiet die früheren<br />
Mandatsträger der politischen Parteien<br />
im Rahmen der „Aktion Gitter“<br />
von der Gestapo verhaftet und in<br />
Konzentrationslager eingeliefert, darunter<br />
auch Josef Heid.<br />
Der 62-jährige Josef Heid war am<br />
8. August 1944 mit seinem gerade<br />
mal elfjährigen Sohn Dietrich Richtung<br />
Bruchsaler Innenstadt unterwegs.<br />
Dietrich wollte an diesem heißen<br />
Sommertag ins Schwimmbad,<br />
der Vater hatte in der Stadt etwas<br />
zu erledigen. Auf der Kaiserstraße<br />
wurde Josef Heid verhaftet. Dietrich<br />
Josef Heid mit seinen Söhnen Wilfried und Dietrich, um<br />
1941. Foto: privat.<br />
erzählte öfters von diesem Ereignis: „Mein Vater wurde mir buchstäblich aus der Hand<br />
gerissen. Wir haben den Vater nie wieder gesehen“. Die Festnahme seines Vaters prägte<br />
Dieter ein Leben lang.<br />
Josef Heid wurde von Bruchsal aus ins Konzentrationslager Dachau verbracht. Dort ist<br />
er wohl umgebracht worden. Seine Frau Anna erhielt von der Lagerverwaltung am 27.<br />
Januar 1945 die lapidare Mitteilung: „Ihr Ehemann Josef Heid, geb. 17.11.82 zu Stühlingen,<br />
ist am 21. Dezember 44 an den Folgen von Lungenentzündung im hiesigen Krankenhaus<br />
verstorben. Die Leiche wurde am 25.12.44 im staatlichen Krematorium in Dachau<br />
eingeäschert. Der Totenschein ist anliegend beigefügt. Der Lagerkommandant KLD“. Die<br />
tatsächlichen Umstände seines Todes wurden nie bekannt.<br />
Zur Erinnerung an Josef Heid tragen seit März 1952 in Unteröwisheim und seit August<br />
1972 in Bruchsal jeweils eine Straße seinen Namen. In Villingen, dem Ort seines politischen<br />
Wirkens, erinnern seit 1972 der Heid-Platz und seit 1987 eine Gedenktafel am<br />
dortigen Heid-Brunnen an ihn. In Karlsruhe wurde im November 2013 vor dem Ständehaus,<br />
dem ehemaligen Sitz des badischen Landtags, ein Stolperstein für Josef Heid<br />
verlegt. In Bruchsal erinnert vor dem Haus Gartenweg 37 seit dem 5. Juli <strong>2018</strong> ein Stolperstein<br />
an Josef Heid.<br />
¹ , ² Staatsarchiv Freiburg LRA Villingen Nr. 1246<br />
3<br />
Unter anderem war Josef Heid tätiv für die Blechnerei Haas, Farbenfabrik E. Isenmann, G. Haubensak,<br />
Bauunternehmen Konrad Schweikert oder Glasermeister A. Schmiedle.<br />
44 45
Rückblick auf die dritte Bruchsaler<br />
Stolpersteinverlegung am 26. April 2017<br />
von Rolf Schmitt<br />
Bereits zum dritten Male wurden am 26. April 2017<br />
in Bruchsal <strong>Stolpersteine</strong> verlegt. Dieses Mal für insgesamt<br />
16 Menschen, die in das Menschenbild der<br />
Nationalsozialisten nicht passten, hatten sie doch die<br />
falsche Religionszugehörigkeit und wurden daher aus<br />
rassistisch und antisemitisch motivierten Gründen<br />
verfolgt – oder waren behindert und wurden aus diesem<br />
Grund als „lebensunwert“ systematisch ermordet.<br />
Die Angehörigen der Holocaust-Opfer reisten zum<br />
Teil von weither an. Bereits zum zweiten Mal innerhalb<br />
weniger Jahre besuchte Daniel Grzymisch aus<br />
Kanada Bruchsal. Während er 2013 mit seiner Ehefrau<br />
Ana angereist war, wurde er 2017 von seinen<br />
beiden Söhnen Axel und Jonathan begleitet. Daniel<br />
Grzymisch ist der Großneffe des letzten Bruchsaler<br />
Rabbiners, Dr. Siegfried Grzymisch. Dass Daniel<br />
Grzymisch jetzt wieder in Bruchsal war, ist so überraschend<br />
nicht, betonte er doch bereits 2013: „Der heutige Tag bleibt mir sicher unter<br />
den wichtigsten Erinnerungen. Bruchsal hat ab heute einen besonderen Platz in meinem<br />
Leben.“ Für Dr. Siegfried Grzymisch, dessen Ehefrau Carola und die Mitbewohnerin<br />
Charlotte „Lina“ Mayer wurden <strong>Stolpersteine</strong> in der Huttenstraße 2 verlegt.<br />
„Ich schätze sehr, was die Bruchsaler für uns taten. Es war tatsächlich sehr berührend<br />
und interessant, da wir nicht viel über das Schicksal unserer in Deutschland verbliebenen<br />
Familie wussten. Ich bin froh, durch diese Bemühungen etwas mehr über die Geschichte<br />
meiner Familie zu erfahren und dass viele von denen, die in der Vergangenheit leiden<br />
mussten, nun wieder gewertschätzt werden.“<br />
Axel Grzymisch, Kanada<br />
Eine längere Anreise hatte auch die große Reisegruppe<br />
der Angehörigen der Familie Weil/<br />
Löb. Die in Bruchsal geborene Edith Löb,<br />
Jahrgang 1927, konnte aus gesundheitlichen<br />
Gründen nicht in ihre Geburtsstadt kommen,<br />
ansonsten war fast die ganze Familie aus den<br />
Von links: Julie Leuchter Thum mit Ehemann, Amanda<br />
Thum, Debbie Leuchter Stueber mit Ehemann, Kurt Leuchter<br />
und Nathan Yellon. Foto: Martin Stock.<br />
46<br />
Von links: Daniel, Jonathan und Axel<br />
Grzymisch. Foto: F. Jung.<br />
USA angereist. Ediths Ehemann Kurt Leuchter aus Florida<br />
wurde begleitet von den beiden Töchtern Debbie<br />
(Pennsylvania) und Julie (Brooklyn) sowie deren Ehemännern<br />
und den beiden erwachsenen Enkelkindern,<br />
Amanda Thum und Nathan Yellon. Der Stolperstein für<br />
Ediths Großmutter Mathilde Weil wurde vor der Huttenstraße<br />
26 verlegt. Vor der Friedrichstraße 53 liegen nun<br />
<strong>Stolpersteine</strong> für Ediths Eltern, Max und Julie Löb, ihren<br />
Bruder Heinz und für Edith selbst, ist doch auch sie ein<br />
Opfer des Holocaust. Sie wurde nach Gurs deportiert,<br />
konnte aber in Waisenhäusern überleben. Dort lernte sie<br />
auch ihren späteren Ehemann Kurt kennen, den sie 1949<br />
durch einen Zufall in einem New Yorker Museum wieder<br />
traf. Kurz danach heirateten die beiden.<br />
„Ich will mich noch einmal bei Ihnen bedanken für alles, was sie für uns getan haben.<br />
Ich bin sehr froh, Sie kennen gelernt zu haben. Es war eine sehr lange Fahrt für mich, besonders<br />
nach Hause! Bin um 5:30 in der Früh‘ in Frankfurt am Flughafen gewesen und<br />
der Flug war um 8:00. Bis ich nach Hause kam war es nach Mitternacht bei uns. Mit 88<br />
Jahren ist es sehr schwer so eine Reise zu machen. Aber ich war doch sehr froh, dass wir<br />
alle bei euch waren.“<br />
Kurt Leuchter, Florida, USA<br />
„Nach Deutschland zurückzukehren hieß, zu den Wurzeln zurückzukehren. Seit ich<br />
wieder zu Hause bin, hörte ich viele Juden sagen, dies sei ein „Wurzelzug“ gewesen. Für<br />
mich war es tatsächlich jedoch eine Möglichkeit, das Trauma der Ahnen im wörtlichen<br />
wie im übertragenen Sinne zu wiederholen und den Prozess des Erinnerns fortzusetzen.<br />
Rückkehren heißt erinnern. Es endete nicht dort; es geht weiter, genau hier.“<br />
Amanda Thum, Hawaii, USA<br />
Friedrich Molitor, für den ein Stolperstein<br />
in der Durlacher Straße 71 verlegt<br />
wurde, hatte die richtige Religionszugehörigkeit,<br />
wurde er doch 1907 in der Bruchsaler<br />
Pauluskirche katholisch getauft.<br />
Sein Makel war, körperlich und geistig<br />
behindert zu sein. So wurde ihm im Rahmen<br />
der „Aktion T4“ „der Gnadentod<br />
gewährt“. Die Nationalsozialisten fühlten<br />
sich besonders dann stark, wenn sie gegen<br />
wehrlose Menschen vorgingen. Friedrich<br />
Molitors Neffe lebt heute noch mit seiner<br />
Familie in Bruchsal, sie begleiteten die<br />
Recherchen über Friedrich dankbar.<br />
V. li.: Christa Molitor, Cornelia Petzold-Schick, Bernd<br />
Molitor, Jonathan Brütsch u. Rolf Molitor. F.: F. Jung.<br />
47<br />
Edith Leuchters ehem. Klassenkameradin<br />
Maria Thome und Ehemann<br />
im Gespräch mit Kurt Leuchter (re.).
Hinten, von links: Paula Pels, Nico Busch, Valery Pels, Stephen Grosz,<br />
Evangelos Karakas, Serhat Tapan und Vicki Grosz.<br />
Vorne: Edwin und Chantal Baer. Foto: F. Jung.<br />
Weit über die ganze Welt<br />
verstreut leben die Nachfahren<br />
und Familienmitglieder<br />
von Friedrich Sem<br />
Bär und dessen Ehefrau<br />
Franziska sowie deren<br />
1921 geborenen Tochter<br />
Therese „Resi“ Bär, für die<br />
jetzt <strong>Stolpersteine</strong> vor der<br />
Schwimmbadstraße 17 liegen.<br />
Resi Bär verlor nie<br />
ihre Heimatstadt aus der<br />
Erinnerung. Nach dem 2.<br />
Weltkrieg war sie 1949,<br />
1986 und 2002 zu Besuch<br />
in Bruchsal.<br />
Aus Großbritannien reiste<br />
ihr Sohn Stephen Grosz<br />
mit Ehefrau Vicki an, aus<br />
der Schweiz Edwin Baer<br />
und Ehefrau Chantal und aus Frankfurt Valery Pels, allesamt Nachfahren der großen<br />
Untergrombacher Bär-Sippe. Die Großeltern und Eltern von Valery Pels mussten in<br />
den 1930ern nach Argentinien fliehen. Das Treffen in Bruchsal nutzten die Mitglieder<br />
der Bär-Familie, auch den jüdischen Friedhof von Obergrombach zu besuchen. Dort<br />
vereinbarten sie, eine neue Gedenkplatte für Leopold und Therese Bär aus Untergrombach<br />
in der leeren Nische von deren Grabstein anbringen zu lassen. (Siehe auch den Beitrag<br />
von Thomas Adam: „Neuer Grabstein für die Urgroßeltern Bär“, Seite 50.)<br />
„Ich finde nicht genug Worte um ihnen zu danken. Wir werden nie vergessen, was heute<br />
für uns getan wurde. Dadurch wurde unser Leben in mehrfacher Weise geändert. Ich<br />
möchte dies in den Worten unseres 14 Jahre alten Sohnes wiedergeben: Mom, das war ein<br />
wundervoller Tag! Heute habe ich mehr gelernt als in einem Jahr Schulunterricht.“<br />
Valery Pels, Frankfurt<br />
„Die Zeremonie war sehr bewegend und wir haben uns alle sehr gefreut über das herzliche<br />
Willkommen, das uns entgegengebracht wurde. Das große persönliche Interesse der<br />
Oberbürgermeisterin hat uns [...] sehr gefreut. Diese Feierstunde war auch eine Möglichkeit,<br />
um die Verbindungen innerhalb unserer Familie zu erneuern und neue Familienmitglieder<br />
kennen zu lernen, von denen wir zwar wussten, die wir aber bisher nie getroffen<br />
hatten. Das Treffen hat dazu geführt [...], dass wir nun für September <strong>2018</strong> ein großes<br />
Familientreffen in Bruchsal geplant haben.“<br />
Stephen Grosz, London<br />
In der Bismarckstraße 10 wohnten die<br />
Eheleute Simon und Rosalie „Rosa“<br />
Marx, sowie deren Kinder Betty „Liesel“<br />
und Trude. Die Eltern wurden im<br />
Holocaust ermordet, Betty und Trude<br />
konnten noch rechtzeitig in die USA<br />
fliehen. Trude heiratete dort, blieb<br />
aber wie ihre unverheiratete Schwester<br />
Betty kinderlos. Trotz intensiver<br />
Recherchen konnten keine Nachfahren<br />
oder Verwandten gefunden werden,<br />
die hätten an den Stolpersteinverlegungen<br />
teilnehmen können.<br />
Rolf Schmitt rezitiert ein Gedicht des Bruchsaler<br />
Gymnasiallehrers Ludwig Marx bei der Verlegung<br />
in der Bismarckstraße 10. Foto: F. Jung.<br />
Heike und Tobias Scheuer umrahmten die Verlegung am<br />
Haus Schwimmbadstr. 17 musikalisch. Foto: F. Jung.<br />
Nach dem Setzen des letzten <strong>Stolpersteine</strong>s<br />
machten sich die Teilnehmer an den Zeremonien,<br />
die über zwei Stunden den Künstler<br />
Gunter Demnig beim Verlegen begleiteten,<br />
auf den Weg zum Justus-Knecht-Gymnasium.<br />
Bei der nachfolgenden, eindrucksvollen<br />
Gedenkfeier wurden von Schülern der<br />
8. Klassen des JKG die Lebensläufe der Holocaust-Opfer<br />
vorgestellt. Danach erinnerten<br />
die Angehörigen mit ihren eigenen Worten<br />
an ihre Anverwandten.<br />
Nach dieser Zeremonie trafen sich die Familien<br />
zu einem gemeinsamen Mittagessen,<br />
wobei eifrig Telefonnummern und Adressen<br />
ausgetauscht wurden – haben doch alle eine<br />
gemeinsame Wurzel: Bruchsal. Die Stadt, wo<br />
unsere Gäste oder deren Vorfahren zur Welt<br />
kamen, zur Schule gingen, heirateten, Kinder<br />
bekamen. Und die Stadt, aus der die Vorfahren<br />
fliehen mussten – soweit dies überhaupt<br />
noch möglich war.<br />
Bruchsal präsentiert sich erneut als eine weltoffene<br />
Stadt, die Gäste aus aller Herren Länder<br />
gerne bei sich aufnimmt. Die Bruchsaler<br />
Stolpersteinverlegungen sind wunderbare Möglichkeiten zur Verständigung über Ländergrenzen<br />
hinweg. Das zu Zeiten des Faschismus Geschehene wird allerdings nicht<br />
rückgängig zu machen sein.<br />
48 49
Neuer Grabstein für die Urgroßeltern Bär<br />
von Thomas Adam<br />
Die Idee entstand bei der Stolperstein-Verlegung 2017 –<br />
Nachfahren der Familie Bär ersetzen Grabplatte auf dem jüdischen Friedhof:<br />
Fast acht Jahrzehnte nach der Schändung erhalten Bestattete ihre Namen wieder.<br />
Ein Jahrhundert alt ist der Grabstein, doch trägt er nun eine neue, im Oktober 2017 angebrachte<br />
Schrifttafel mit den Namen und Lebensdaten der an dieser Stelle Bestatteten.<br />
Auf den ersten Blick vielleicht eine scheinbar alltägliche Begebenheit, wie sie jederzeit<br />
stattfinden kann auf einem Friedhof, näher betrachtet jedoch eine Geste von höchster<br />
Symbolkraft.<br />
Ort des Geschehens: Der jüdische Friedhof auf dem Eichelberg an der Gemarkungsgrenze<br />
zwischen Obergrombach und Bruchsal. Ende der dreißiger Jahre, kurz vor Entfesselung<br />
des Zweiten Weltkrieges, wurde diese letzte Ruhestätte der jüdischen Bevölkerung im<br />
südwestlichen Kraichgau verwüstet und ein Großteil ihrer Grabsteine geschändet; vom<br />
Friedhof haben die Täter sie damals fortgeführt und zur Befestigung von Wegerändern<br />
verwendet. Etliche geraubte Steine<br />
sind um die Jahrtausendwende geborgen<br />
worden und seither auf das<br />
Gräberfeld zurückgekehrt, manches<br />
aber bleibt verschwunden<br />
und wird wohl nie wieder aufzufinden<br />
sein.<br />
Fortgekommen ist auch die in<br />
einen mächtigen Grabstein eingetiefte<br />
Gedenkplatte für Leopold<br />
und Therese Bär aus Untergrombach,<br />
er gestorben 1898, sie<br />
1919. Wo einst die Platte mit dem<br />
Schriftzug sich befand, verblieb<br />
nur die leere Nische. Erhalten hat<br />
sich jedoch ein Foto, das in den<br />
zwanziger Jahren entstanden ist<br />
und bei der Rekonstruktion durch<br />
einen ortsansässigen Steinmetz die<br />
Von links: Chantal und Edwin Bär (Schweiz), Stephen und<br />
Vicky Grosz (London) vor dem „leeren“ Grabstein der Urgroßeltern<br />
auf dem Jüdischen Friedhof am Eichelberg (siehe dritte<br />
Gedenkschrift vom 26.4.2017, Seite 19) Foto: F. Jung.<br />
entscheidende Rolle spielte. Denn<br />
die damalige Bildqualität ist recht<br />
hoch, die Aufnahme erwies sich<br />
als detailliert genug, um auf ihrer<br />
Grundlage die historische Beschaffenheit und die originalen Schriftzüge bis in kleinste<br />
Einzelheiten nachbilden zu können.<br />
Die Initiative dafür haben die Nachfahren der Familie in privater Federführung ergriffen.<br />
Sie leben heute in Argentinien, Israel, Schweiz, Holland, Großbritannien und in den<br />
Vereinigten Staaten, ein Teil von ihnen aber kam zusammen zur dritten Bruchsaler Stolperstein-Verlegung<br />
im April 2017. Hier, bei dieser Gelegenheit, entstand der gemeinsame<br />
Wunsch, eine exakte Replik der Grabplatte ihrer Vorfahren wieder anbringen zu lassen.<br />
Durch Vermittlung von Florian Jung und Rolf Schmitt, in formalen Belangen unterstützt<br />
durch die Stadt Bruchsal, wurden auch in Absprache mit dem Friedhofsbeauftragten der<br />
Israelitischen Religionsgemeinschaft in Baden die Voraussetzungen für diese symbolhafte<br />
Aktion geschaffen. In Anwesenheit von Valery Pels mit ihren beiden Kindern und der<br />
fünfköpfigen Familie von Aviad Ben Izhak aus Israel erstand nun dieser Erinnerungsort<br />
für die in aller Welt lebenden Bär-Nachfahren neu, an dieser letzte Ruhestätte von<br />
Leopold und Therese, dem „Fundament unserer Familiengeschichte“ – so hat es Edwin<br />
Baer in einem Schreiben formuliert, der krankheitsbedingt nicht aus der Schweiz anreisen<br />
konnte. Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick würdigte die Aktion in einem persönlichen<br />
Gedankenaustausch mit den anwesenden Familienmitgliedern als einen besonderen<br />
Beitrag zur Erinnerung an die jüdischen Anteile in der deutschen Geschichte und<br />
zur Versöhnung in Anbetracht der NS-Gräuel und den Zerstörungen der Friedhofsanlage<br />
auf dem Eichelberg vor bald achtzig Jahren.<br />
Nach der Einfügung der originalgetreu durch die Fa. Stadelwieser nachgestalteten Grabplatte.<br />
Von links: Amir Ben Izhak, Efrat Ben Izhak, Tamar Ben Izhak, Aviad Ben Izhak, Nicolas Busch, Valery<br />
Busch and Meirav Ben Izhak. Vorne: Sofia Busch. Foto: Thomas Adam.<br />
50 51
Preis für Erinnerungsarbeit<br />
Gemeinsam mit den Kommunen und Bundestagsabgeordneten der Region verleiht die<br />
Sparkasse Kraichgau jährlich den mit insgesamt 5250 Euro dotierten Bürgerpreis für vorbildliches<br />
Engagement. Im Jahr 2017 hat die Jury des Bürgerpreises „Für mich. Für uns.<br />
Für alle.“ aus insgesamt 46 Bewerbungen und Vorschlägen mehrere Preisträger für verschiedene<br />
Kategorien (Alltagshelden, Lebenswerk, U21) ausgewählt, darunter die Stolpersteingruppe<br />
am JKG. Die mit einem Preisgeld von 500 Euro dotierte Auszeichnung der<br />
Kategorie „U21“ löste bei den Schülerinnen und Schülern sowie dem betreuenden Lehrer,<br />
OStR Florian Jung, große Freude aus. Eine Abordnung der Projektgruppe des Schuljahrs<br />
2016/17 fuhr am 5. Oktober 2017 zur Eremitage Waghäusel, wo die diesjährige Preisverleihung<br />
unter Beisein der Oberbürgermeister von Bruchsal, Bretten, Sinsheim und Waghäusel,<br />
von Prof. Dr. Castellucci, MdB und dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse<br />
Kraichgau, Norbert Grießhaber, stattfand.<br />
„Die Steine lassen uns innehalten, sie rufen uns zu: Diese genannten Leute lebten mitten<br />
unter uns, sie waren unsere Nachbarn“, machte Prof. Dr. Werner Schnatterbeck, Oberschulamtspräsident<br />
a. D., deutlich, der in der Stolpersteinfunktion die Aufgabe sah, Menschen<br />
aus der Anonymität herauszuholen und vor dem Vergessen zu bewahren. An die<br />
Schüler des Justus-Knecht-Gymnasiums gerichtet erinnerte der Laudator an die Rede des<br />
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Krieges und der nationalsozialistischen<br />
Gewaltherrschaft im Deutschen Bundestag: „Die Jungen sind nicht<br />
verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in<br />
der Geschichte daraus wird.“<br />
Verleihung des Bürgerpreises durch den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Norbert Grießhaber<br />
(links) an Vertreter der Schülergruppe und OStR Florian Jung. Mit dabei Laudator Prof. Dr. Werner<br />
Schnatterbeck (rechts). Foto: Martin Heintzen.<br />
52