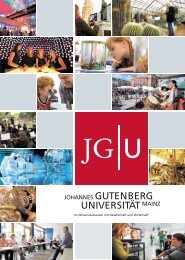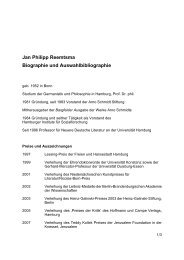1 Biologische Oxidation 1
1 Biologische Oxidation 1
1 Biologische Oxidation 1
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Man sieht, daß Acetyl-CoA (=aktivierte Essigsäure) den Betriebsstoff des Citratcykluses darstellt.<br />
Im Gegensatz zu der Glykolyse fehlen hier phosphoryilierte Zwischenstufen.<br />
Der Citratzyklus ist Umschlagplatz für viele Zwischenverbindungen, er ist damit ein sogenannter<br />
„metabolic pool“. Es werden hier die Vorstufen für verschiedene Syntheseprozesse bereitgestellt.<br />
Ein solcher pool kann nur funktionieren wenn die entnommnen Zwischenverbindungen (zB<br />
Oxalacetat) ständig erneuert werden. Oac wird entweder durch Anlagerung von CO2 an Pyruvat oder<br />
über den Glyoxylatcyclus nachgeliefert. Solche „Auffüll Reaktionen“ nennt man anapleurotische<br />
Reaktionen.<br />
1.5.5 Endoxidation<br />
Die hauptsächliche Energie des dissimilatorischen Abbaus kommt durch die gesteuerte Knallgasreaktion,<br />
wobei in der Endoxidation der Wasserstoff, der nach der Glykolyse und dem Citratcyclus an<br />
Wirkgruppen wie NAD und FAD gebunden ist, auf molekularen Sauerstoff übertragen wird.<br />
Wie gesagt ist die Knakllgasreaktion im Sinne einer biologischen Reaktion aufgeteilt in kleine Teilbeträge.<br />
Die Reaktionenthalpie beträgt �Go = -220 kJ/mol, wobei das Energiegefälle über ein<br />
ADP/ATP System gekoppelt ist. Es kann aus dieser Energie über oxidative Phosphorylierung Energie<br />
gewonnen werden.<br />
Über verschiedene Redoxreaktionen im Laufe einer Elektronentransportkette wird ein pH-Gradient<br />
zwischen Intermembranraum und Matrix erreicht. Dies geschieht dadurch, daß Protonenpumpen (in<br />
der Membran verankerte Proteinsysteme) durch den Elektronentransport angetrieben werden. Diese<br />
nehmen im Rahmen der Elektronentransportkette 2 Elektronen auf, gleichzeitig um die entstandene<br />
negative Ladung zu stabilisieren, auch noch zwei Protonen von der Matrixseite. Bei Abgabe der<br />
Elektronen an das nächste Redoxsystem in der Kette, werden auch die Protonen wieder abgegeben,<br />
aber diesmal in den Intermembranraum. Durch diesen pH-Gradient entsteht ein pmf (=proton motive<br />
force). Die pmf ist mit einem Membranpotential gekoppelt, das durch Ausfließen von Kationen aufrecht<br />
erhalten wird, durch beide Phänomene wird ein arbeitsfähiger Potentialgradient erhalten.<br />
Dies ist eine von mehreren Hypothesen, andere gehen über den Ubichinoncyclus, wo ein Radikal die<br />
Anzahl der gepumpten Protonen verdoppelt 1 , und weiterhin kann der Bohr-Effekt bei Cytochromsystemen<br />
miteinbezogen werden. Bei diesem Effekt handelt sich es um eine durch den<br />
<strong>Oxidation</strong>szustand herforgerufene Konfirmationsänderung, die auch eine Änderung der sauren<br />
Dissoziationskonstante bewirkt - Protonen werden bei einem <strong>Oxidation</strong>szustand viel leichter<br />
abgespalten als bei einem anderen. 2 .<br />
1 Siehe Libbert 5.Aufl. Seite 28<br />
2 Dieser Effekt ist beim Hämoglobin zu beobachten. Siehe Stryer Seite 168