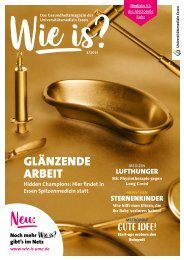U&ME 3/2018
Das Magazin für Beschäftigte der Universitätsmedizin Essen. Ausgabe 3/2018
Das Magazin für Beschäftigte der Universitätsmedizin Essen. Ausgabe 3/2018
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
machen | Hirnschrittmacher<br />
Elektronische Patientenakte<br />
Der<br />
Impulsgeber<br />
Digital ist besser<br />
Prof. Dr. Stephan Klebe<br />
verhilft Patienten mit<br />
einem Hirnschrittmacher<br />
zu neuer Lebensqualität.<br />
Kaffee trinken, Schuhe zubinden,<br />
die Treppe runtersteigen – für<br />
viele Patienten von Prof. Dr.<br />
Stephan Klebe sind schon die alltäglichsten<br />
Dinge unmöglich. Weil der Körper<br />
nicht mitspielt, die Muskeln zittern, die<br />
Glieder versteifen. Seit Klebe seit 2017 die<br />
Spezialambulanz für Bewegungsstörungen<br />
leitet, finden immer mehr Patienten<br />
mit Parkinson, Tremor-Erkrankungen<br />
und Dystonien ihren Weg an die Universitätsmedizin<br />
Essen. Viele von ihnen<br />
erhoffen sich von ihrem Aufenthalt vor<br />
allem eins: mehr Lebensqualität.<br />
Für Parkinson-Patient Werner Hardt<br />
hat sich diese Hoffnung bereits erfüllt.<br />
Seit ein Hirnschrittmacher bestimmte<br />
Areale seines Gehirns dauerhaft stimuliert,<br />
hat der Essener seinen Tremor viel<br />
besser unter Kontrolle. Der Grund dafür<br />
liegt unsichtbar unter Hardts Kopfhaut:<br />
kleine Elektroden, die seit der Operation<br />
das Gehirn mit elektrischen Impulsen stimulieren,<br />
stetig gefüttert von einem Impulsgenerator<br />
in seiner Brust.<br />
„Die sogenannte tiefe Hirnstimulation<br />
(THS) wurde in den 80er-Jahren von Neurologen<br />
im französischen Grenoble entwickelt<br />
und hemmt bestimmte Kerngebiete<br />
des Gehirns“, erklärt Klebe, der das<br />
Therapieverfahren durch seinen Wechsel<br />
von vom Universitätsklinikum Freiburg<br />
mit nach Essen gebracht hat. „Aber der<br />
Hirnschrittmacher kann die Symptome<br />
nur verringern“, betont Klebe. Aufhalten<br />
oder heilen kann er die Patienten nicht.<br />
Bei vollem Bewusstsein<br />
Wer sich wie Hardt für einen Hirnschrittmacher<br />
entscheidet, wird von den Ärzten<br />
an der Universitätsmedizin genau<br />
gecheckt, um zu prüfen, ob der Patient<br />
für das Verfahren geeignet ist, und die Risiken<br />
der Operation zu minimieren. „Damit<br />
der Hirnschrittmacher funktioniert,<br />
muss er genau an der richtigen Stelle<br />
angebracht werden. Deswegen befindet<br />
sich der Patient während der Platzierung<br />
der Elektroden bei vollem Bewusstsein<br />
– aber natürlich ohne Schmerzen zu verspüren“,<br />
erklärt Klebe.<br />
„Anstrengend, aber schmerzlos“<br />
lautet so auch das Fazit der Patienten, die<br />
seit September <strong>2018</strong> einen Hirnschrittmacher<br />
in der Neurochirurgie in Essen<br />
implantiert bekommen haben. Dass<br />
während der sechsstündigen Operation<br />
immer auch ein Team aus Krankengymnasten<br />
dabei ist, steife Glieder lockert<br />
und auch mal über den Rücken reibt,<br />
wenn es juckt, ist für den Leiter der Spezialambulanz<br />
für Bewegungsstörungen<br />
eine große Hilfe.<br />
Sobald alle Elektroden an Ort und<br />
Stelle sitzen, erhält der Patient den eigentlichen<br />
Hirnschrittmacher. Unter<br />
Vollnarkose platzieren die operierenden<br />
Kollegen der Neurochirurgie den kleinen<br />
Kasten im Brustbereich unter der Haut<br />
und legen ein Verbindungskabel zu den<br />
Elektroden. Für die ersten Hirnschrittmacher-Patienten<br />
am Universitätsklinikum<br />
Essen hat sich die aufwendige Operation<br />
und die gute Nachbetreuung gelohnt: Viele<br />
von ihnen müssen zum ersten Mal seit<br />
Jahren keine oder nur wenige Tabletten<br />
nehmen und sind relativ beschwerdefrei.<br />
Und Werner Hardt aus Altenessen? Der<br />
freut sich, seinen Kaffee endlich wieder<br />
zitterfrei genießen zu dürfen.<br />
PROF. DR.<br />
STEPHAN KLEBE<br />
leitet die Spezialambulanz<br />
für<br />
Bewegungsstörungen.<br />
FOTOS: ADOBE STOCK (L.), U<strong>ME</strong> (L. U.)<br />
Seit 2016 arbeitet die Universitätsmedizin mit<br />
der Elektronischen Patientenakte. Ab 2019 werden<br />
alle Standorte digital arbeiten.<br />
Visite in der Unfallchirurgie des Universitätsklinikums,<br />
eine Patientin mit einer großen Wunde am Unterschenkel<br />
wird untersucht. „Das sieht schon gut aus, die Haut<br />
tritt bereits in die letzte Heilungsphase ein“, meint der diensthabende<br />
Oberarzt. Neben ihm steht ein Assistenzarzt an einem mobilen<br />
Computer und tippt mit: „Beginnende Epithelisierung am<br />
Wundgrund.“ Ein Klick und die Wunddokumentation ist in der<br />
Elektronischen Patientenakte (EPA) der Patientin gespeichert.<br />
Was in der Unfallchirurgie seit einiger Zeit praktiziert wird,<br />
ist auch auf vielen anderen Stationen der Universitätsmedizin<br />
inzwischen Alltag. „Rund 70 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen<br />
arbeiten bereits mit der EPA“, erklärt Armin de Greiff, Direktor<br />
der Zentralen IT. 2019 werden alle Standorte in der stationären<br />
Versorgung zur elektronischen Dokumentation wechseln.<br />
Dafür werden sie in den kommenden Wochen von Delia Meike<br />
und den sieben anderen EPA-Trainern geschult. Damit der Rollout<br />
reibungslos klappt, sind die gelernte Gesundheits- und<br />
Krankenpflegerin und ihre Kollegen während der ersten Tage<br />
im Schichtdienst abwechselnd vor Ort. Und auch später sind sie<br />
über die EPA-Hotline immer für Rückfragen erreichbar.<br />
Schluss mit der Zettelwirtschaft<br />
Auch in der Unfallchirurgie schauen die Trainer noch regelmäßig<br />
vorbei. „Irgendeine Kleinigkeit ist immer – sei es, dass ein neuer<br />
Mitarbeiter geschult werden muss, oder, dass ein Dokument<br />
nicht richtig angewendet werden kann“, erklärt Meike. Yasmin<br />
Hoffmann, Leiterin der Stationen UC II, III und IV, freut sich über<br />
den anhaltenden Support: „Am Anfang waren wir natürlich alle<br />
skeptisch und hatten Angst davor, dass die Arbeitsbelastung<br />
durch die EPA steigt. Aber in der achtwöchigen Eingewöhnungsphase<br />
habe ich schnell gemerkt, dass das Gegenteil der Fall ist.“<br />
Vor allem bei der morgendlichen Visite sei die E-Akte eine echte<br />
Arbeitserleichterung, so die leitende Gesundheits- und Krankenpflegerin:<br />
„Mit der EPA können wir alle Vorerkrankungen und<br />
aktuellen Werte auf einen Blick abrufen, ohne lange suchen zu<br />
müssen.“ Fehlende Unterlagen oder unleserliche Handschriften –<br />
seit die Papierakten in der Unfallchirurgie abgeschafft wurden,<br />
ist das kein Problem mehr.<br />
Und noch etwas hat sich durch die Digitalisierung der Patientenunterlagen<br />
verbessert: die Kommunikation zwischen den<br />
Kliniken. Zum ersten Mal können Ärzte von unterschiedlichen<br />
Standorten aus zeitgleich in eine Akte schauen. „Praktisch, wenn<br />
ein besonders schwieriger Fall die Kompetenz und das Knowhow<br />
verschiedener Experten benötigt“, meint Armin de Greiff.<br />
Seine Vision für die neue Patientenakte geht aber noch weiter:<br />
Wie ein Musik-Streamingdienst, der Vorschläge für eine Playlist<br />
generiert, soll die EPA zukünftig auch Patienten mit ähnlichen<br />
Symptomen anzeigen. „So können wir die gespeicherten Daten<br />
nutzen, um allen Patienten zu helfen“, sagt de Greiff.<br />
EPA-HOTLINE<br />
0201 723199946<br />
Mo – Do: 8 – 17 Uhr<br />
Fr: 8 – 15 Uhr<br />
16<br />
17