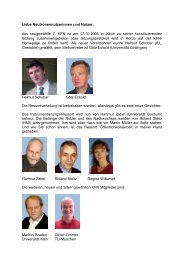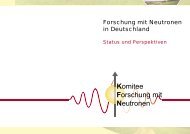Quellen für Neutronenstrahlung: Forschungsreaktoren - SNI-Portal
Quellen für Neutronenstrahlung: Forschungsreaktoren - SNI-Portal
Quellen für Neutronenstrahlung: Forschungsreaktoren - SNI-Portal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FRM-II<br />
Der FRM-II hat ein einziges zylinderförmiges Brennelement<br />
mit ca. 8 kg hochangereichertem Uran und<br />
gestaffelter Urandichte von 1,5 – 3 g/cm 3 . Mit 20 MW<br />
thermischer Leistung und einem ungestörten Fluss<br />
thermischer Neutronen von 8 ∙ 10 14 n/cm 2 s bietet er das<br />
weltweit beste Verhältnis von thermischer Leistung zu<br />
Neutronenfluss. Die Kühlung des Brennelements erfolgt<br />
durch H 2 O, die Moderation durch einen D 2 O Moderator.<br />
Ein Brennelementzyklus beträgt 52 Tage, max. fünf<br />
Zyklen pro Jahr = 260 Tage können betrieben werden.<br />
Die untermoderierte Kalte D 2 O-Quelle, die 2000 °C<br />
warme Heiße Quelle und eine Konverteranlage <strong>für</strong><br />
unmoderierte schnelle Neutronen verschieben das<br />
thermische Wellenlängenspektrum ins Optimum der<br />
gewünschten Nutzung. 10 horizontale und 2 schräge<br />
Strahlrohre ermöglichen den Austritt der Neutronen<br />
zu den Experimentiereinrichtungen. Aus einem der<br />
schrägen Strahlrohre wird mittels intensiver Gammastrahlung<br />
und spontaner Paarbildung ein intensiver<br />
thermischer Positronenstrahl mit einem Fluss von<br />
10 8 - 10 9 p/cm 2 s extrahiert. Die Instrumente sind in der<br />
Experimentierhalle rund um den Reaktorkern und in<br />
einer Halle mit Neutronenleitern <strong>für</strong> kalte Neutronen<br />
untergebracht.<br />
Breites Spektrum<br />
Die Strahlrohrinstrumente des FRM-II werden von<br />
externen Expertengruppen betrieben, wobei 2/3 der<br />
Strahlzeit durch ein unabhängiges Gutachtergremium<br />
an allgemeine Nutzer vergeben werden. Für die Probenumgebung<br />
stehen Kryostaten und Öfen <strong>für</strong> Temperaturen<br />
zwischen 50 mK und 2000 °C und Magnetfelder bis<br />
zu 14,5 Tesla zur Verfügung. Druckapparaturen sind<br />
im Aufbau. Die Nutzung polarisierter Neutronen wird<br />
durch HELIOS, einer leistungsfähigen Anlage zur Polarisation<br />
von 3 He <strong>für</strong> annähernd alle Instrumente ermöglicht.<br />
Ein industrielles Anwenderzentrum innerhalb des<br />
FRM-II-Geländes fördert die industrielle Nutzung des<br />
FRM-II, es werden sowohl Büro- als auch Laborflächen<br />
zum Umgang mit Radioaktiva zur Verfügung gestellt.<br />
Zukunft<br />
Das Forschungszentrum Jülich wird zum Mai 2006<br />
seine Neutronenquelle schließen, seine leistungsfähigsten<br />
Neutronenstreuinstrumente zum FRM-II transferieren<br />
und sich mit einer Außenstelle am Nutzerbetrieb<br />
des FRM-II beteiligen. Mit der später vorgesehenen<br />
Schließung der Geesthachter Neutronenquelle wird<br />
ebenfalls die GKSS den Nutzerbetrieb durch weitere<br />
Instrumente zur Materialforschung unterstützen. Bis<br />
Ende 2006 wird hierzu an der Ostseite des FRM-II eine<br />
weitere Neutronenleiterhalle in Kombination mit Büro-<br />
und Laborräumen errichtet.<br />
76 FRM-II / ILL<br />
77<br />
ILL<br />
Das Institut Laue-Langevin wurde 1967 gegründet; sein<br />
57 MW-Reaktor, der 1971 kritisch wurde, liefert mit ca.<br />
1,5 ∙ 10 15 n/cm -2 s -1 den weltweit höchsten Fluss thermischer<br />
Neutronen. Eine heiße Quelle, zwei kalte <strong>Quellen</strong><br />
mit 12 Neutronenleitern sowie ultrakalte Neutronen<br />
erweitern das Spektrum zu hohen und niedrigen Energien<br />
hin deutlich. Die Erneuerung des Reaktortanks in<br />
den 90er Jahren und die gegenwärtigen umfassenden<br />
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit (REFIT-Programm<br />
bis 2006), insbesondere der Erdbebensicherheit,<br />
versprechen eine hohe Zuverlässigkeit des Reaktors <strong>für</strong><br />
die kommenden Jahre.<br />
Breites Spektrum<br />
Für die Versorgung mit Neutronen ist ein ausgeklügeltes<br />
System von Neutronenleitern, die Instrumente<br />
in zwei großen Neutronenleiterhallen bedienen, von<br />
zentraler Bedeutung. Derzeit stehen insgesamt 25 vom<br />
ILL betriebene „öffentliche“ Instrumente zur Verfügung,<br />
demnächst möglicherweise 30. Die Nutzung ist<br />
über ein Proposalsystem geregelt. Zirka 750 Nutzerexperimente<br />
werden in den 4½ 50-tägigen Reaktorzyklen<br />
pro Jahr durchgeführt (bis Ende 2006 ausnahmsweise<br />
nur 3 Zyklen). Zusätzlich zu den 25 öffentlichen<br />
Instrumenten stehen 11 von externen Forschergruppen<br />
betriebene Instrumente zur Verfügung.<br />
Eine breit angelegte Modernisierung von Instrumenten<br />
und Neutronenleitern - das im Jahr 2000 gestartete<br />
Millenniumprogramm - führt bereits heute zu einem<br />
mittleren Intensitätsgewinn von einem Faktor 5; ein<br />
Faktor 15 wird angestrebt. Dabei sind auch andere<br />
Qualitäten wie Auflösung, dynamischer Bereich, Polarisation<br />
und Zuverlässigkeit Gegenstand der Verbesserungen.<br />
Über 10 Millenniumsprojekte sind bereits zum<br />
Vorteil der Nutzer erfolgreich abgeschlossen. Damit<br />
dürfte sich die Attraktivität der Einrichtungen des ILL<br />
auch in Zukunft weiter steigern. Wesentliche Basis<br />
<strong>für</strong> diese moderne Instrumentierung sind ILL-eigene<br />
Entwicklungen auf dem Gebiet der Detektoren, Monochromatoren,<br />
Neutronenpolarisation, Probenumgebung<br />
und Instrumentesteuerung. Auf vielen dieser Gebiete<br />
hat das ILL eine führende Rolle erworben. Die Wissenschaftsdisziplinen<br />
am ILL umfassen die Festkörper-<br />
und Materialforschung, Biologie und weiche Materie,<br />
Chemie und Ingenieurswesen, Kern- und Teilchenphysik.<br />
Auf allen Gebieten liefert das ILL Beiträge von<br />
Weltklasse, die auch <strong>für</strong> die Forschung mit Neutronen<br />
in Deutschland nicht wegzudenken sind.<br />
Das ILL wird getragen von drei Gesellschafterländern<br />
- von Frankreich, dem Vereinigten Königreich und<br />
Deutschland - von denen der Hauptanteil der Finanzierung<br />
erbracht wird. Sieben sogenannte „wissenschaftliche<br />
Partner“ ergänzen das internationale Spektrum der<br />
Partnerländer, dessen Erweiterung derzeit aktiv betrieben<br />
wird.<br />
Zukunft<br />
Gegenwärtig läuft der ILL-Vertrag bis zum Jahr<br />
2014. Der internationale Erfolg des ILL, die steigende<br />
Nachfrage nach Neutronen am ILL und die vielen<br />
Erneuerungsmaßnahmen sollten der Garant einer<br />
Verlängerung um weitere 10 Jahre sein. Gemeinsam<br />
mit ESRF und EMBL ist der Ausbau des gemeinsamen<br />
Geländes zu einem großen multidisziplinären Campus<br />
geplant. Den Nutzern wird mit der „Partnership for<br />
Structural Biology“ und der „Facility for Materials<br />
Engineering“ neuartige Unterstützung gegeben. Von<br />
einem Flugzeitinstrument mit viel größerem Detektor<br />
bis hin zur zeitaufgelösten Neutronentomographie sind<br />
neue Instrumente im Bau. Kürzlich wurde eine neue<br />
Dreidimensionale Polarisationsanalyse <strong>für</strong> inelastische<br />
thermische Instrumente erfolgreich getestet. Diskutiert<br />
wird eine generelle Verstärkung der Aktivitäten<br />
des ILL auf dem Gebiet der kalten und ultrakalten<br />
Neutronen.