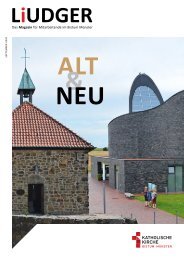Liudger Ausgabe Mai 2020
In dieser Ausgabe des Magazins für Mitarbeitende dreht sich alles um das Thema "Nur Mut!! Viel Spaß beim lesen!
In dieser Ausgabe des Magazins für Mitarbeitende dreht sich alles um das Thema "Nur Mut!! Viel Spaß beim lesen!
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
LiUDGER<br />
Das Magazin für Mitarbeitende im Bistum Münster<br />
MAI <strong>2020</strong><br />
ERFAHRUNGSBERICHT<br />
Nur Mut!<br />
Kolleginnen und Kollegen lassen sich auf das<br />
Abenteuer Wüstenexerzitien ein<br />
MUT GEFASST<br />
ZEIT FÜR MUT<br />
ERMUTIGEND<br />
Birgit Klöckner trifft<br />
eine Lebensentscheidung<br />
Maria Bubenitschek stellt<br />
sich Herausforderungen<br />
Berufskolleg ist Schule<br />
mit Courage
Inhalt und Vorwort<br />
INHALT<br />
EDITORIAL<br />
NUR MUT!<br />
AB SEITE 6<br />
„Es braucht Mut, dem Ruf Gottes zu folgen“<br />
Birgit Klöckner und ihre Lebensentscheidung<br />
AUS DEN REGIONEN<br />
Ist es ein Vogel? Ist es ein Ufo? 4<br />
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,<br />
IMPRESSUM<br />
12. <strong>Ausgabe</strong><br />
HERAUSGEBER<br />
Bischöfliches Generalvikariat<br />
Domplatz 27, 48143 Münster<br />
VERANTWORTLICHE REDAKTEURIN<br />
Anke Lucht<br />
REDAKTIONSTEAM<br />
Mathias Albracht (MA), Christian Breuer (CB),<br />
Julia Geppert (JG), Ludger Heuer (LH),<br />
Michaela Kiepe (MEK), Stephan Kronenburg (SK),<br />
Ann-Christin Ladermann (ACL), Anke Lucht (AL),<br />
Tina Moorkamp (TIM), Gudrun Niewöhner (GN)<br />
GESTALTUNG<br />
goldmarie design, Münster<br />
DRUCK<br />
Druckerei Joh. Burlage, Münster, www.burlage.de<br />
FOTOS<br />
Bischöfliche Pressestelle, pixabay.com, unsplash.com,<br />
Privat, Andreas Lee<br />
KONTAKT<br />
liudger@bistum-muenster.de<br />
www.liudger-magazin.de<br />
PORTRAIT<br />
Es braucht Mut, dem Ruf Gottes zu folgen 6<br />
TRAU DICH, LUI<br />
Mut zur Heiterkeit 10<br />
ZU MEINER FREUDE<br />
Es ist Frühling 11<br />
ERFAHRUNGSBERICHT<br />
Ich wurde reich beschenkt 12<br />
MUT IM ALLTAG<br />
Beispiele aus dem Bistum 16<br />
DAFÜR / DAGEGEN<br />
Home-Office 20<br />
NACHGEFRAGT<br />
Wo ist Ihr Mut als Christin<br />
oder Christ gefragt? 22<br />
INTERVIEW<br />
Zeit, mutig zu sein 26<br />
„Nur Mut!“ ist unsere aktuelle <strong>Ausgabe</strong> des <strong>Liudger</strong> überschrieben.<br />
Ein wenig Mut erfordert es in gewisser Hinsicht in dieser corona-infizierten Zeit auch, ein Mitarbeitendenmagazin<br />
zu gestalten. Denn bewusst widmen wir uns nicht nur dem Thema, das derzeit alle umtreibt –<br />
Corona – , sondern setzen auch andere Akzente.<br />
Dabei hat Corona durchaus mit Mut zu tun. Als Mitarbeitende des Bistums Münster haben wir das in<br />
jüngster Zeit individuell erlebt: Mitarbeitende haben kreative, spannende Seelsorgeformate entwickelt,<br />
die für den normalen Alltag womöglich zu mutig gewesen wären. Mitarbeitende haben Mut gefasst und<br />
sich zwar anders, aber eben konsequent weiter den Menschen, für die sie Tag für Tag da sind – seien<br />
es Kranke, Kinder, Alte, Hilfsbedürftige – liebevoll zugewandt. Mitarbeitende haben neue Arbeits-,<br />
Besprechungs- und Abstimmungsmethoden und -techniken ausprobiert, zu denen vielleicht vorher neben<br />
dem technischen Know-how auch der Mut gefehlt hat.<br />
Dieser Mut hat uns die vergangenen Wochen meistern lassen, auch und gerade als Dienstgemeinschaft,<br />
als Kolleginnen und Kollegen.<br />
Ich wünsche Ihnen, dass die in dieser <strong>Ausgabe</strong> des <strong>Liudger</strong> zu lesenden Geschichten über Mut im Alltag<br />
und darüber hinaus Sie unterhalten, aber Ihnen eben auch ein bisschen Mut machen für die kommende<br />
Zeit. Und vor allem: dass Sie und Ihre Lieben gesund bleiben!<br />
Anke Lucht<br />
NACHGEFRAGT<br />
Schule mit Courage 30<br />
Das verwendete Papier ist aus<br />
100 % Altpapier hergestellt.<br />
LESETIPPS<br />
Bücher zum Thema Mut 32<br />
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Senden Sie uns eine E-<strong>Mai</strong>l an liudger@bistum-muenster.de.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Weitere Infos finden Sie unter www.liudger-magazin.de<br />
2 3
Aus den Regionen<br />
IST ES EIN VOGEL?<br />
IST ES EIN UFO?<br />
Nein, es ist SpaceX<br />
NIEDERRHEIN<br />
Die ersten etwas wärmeren Frühlingsabende<br />
lockten am Niederrhein viele Leute in die Gärten<br />
oder auf die Balkone. Bei einem Kaltgetränk und<br />
Gegrilltem ließen sie den Blick über den sternenklaren<br />
Himmel gleiten. Bis plötzlich ein schwacher<br />
Lichtpunkt am Horizont auftauchte. Und wenige<br />
Sekunden später noch einer. Und noch einer.<br />
Und noch einer. Wie an einer Perlenschnur zogen<br />
sie quer über den Nachthimmel, bis zu 60 Punkte<br />
sollen es gewesen sein. Sofort schossen die<br />
Spekulationen ins Kraut. War da ein geheimes<br />
Flugmanöver in Gang? Oder stand eine Invasion<br />
der Außerirdischen bevor?<br />
In einer Facebook-Gruppe kam die Entwarnung.<br />
Bei den Punkten handelte es sich um Starlink-<br />
Satelliten auf ihrer Umlaufbahn, die von Elon<br />
Musks Unternehmen „SpaceX“ in den Orbit<br />
geschossen wurden, um irgendwann weltweiten<br />
Internetempfang zu ermöglichen.<br />
(CB)<br />
RECKLINGHAUSEN<br />
Vielerorts gibt es hilfsbereite Menschen. So wie<br />
die Aktiven der „Anti-Rost-Initiativen“ beispielsweise<br />
in Haltern, Herten oder Recklinghausen.<br />
Es sind Senioren, die handwerklich geschickt sind<br />
und anderen Senioren bei kleinen Reparaturen<br />
helfen. Sie schrauben Toilettendeckel an, wechseln<br />
flackernde Glühbirnen aus, machen klemmende<br />
Schranktüren wieder gängig oder kümmern sich<br />
um den tropfenden Wasserhahn. Alles ehrenamtlich,<br />
alles mit viel Enthusiasmus und Herz. Sie<br />
kommen für Kleinstreparaturen, wenn es sich nicht<br />
lohnt, einen Handwerker zu rufen. Für die Hilfe sind<br />
die Senioren dann auch gern bereit, eine Servicegebühr<br />
von fünf Euro zu zahlen.<br />
Doch nicht immer ist es leicht, zu entscheiden,<br />
wer wirklich Hilfe braucht. Denn die richtet sich<br />
vornehmlich an Menschen, die sich keinen Handwerker<br />
leisten können oder niemanden finden,<br />
der sich um die Kleinigkeiten kümmert.<br />
Das mussten die Anti-Rostler in Recklinghausen<br />
erfahren. Als ein Ehrenamtlicher zu einem Einsatz<br />
kam, war er nicht gerade begeistert. Eine Frau hatte<br />
ihn gerufen, weil sie den Wasserhahn an der Hauswand<br />
nicht aufbekam. Der Grund: Der Gärtner<br />
hatte ihn zu fest zugedreht …<br />
(MEK)<br />
STEINFURT<br />
Kaum jemand konnte sich noch vor kurzem<br />
diese Situation vorstellen: Kindertageseinrichtungen<br />
und Schulen außerhalb der Ferien<br />
geschlossen, Geschäfte verkaufen nur im Lieferdienst,<br />
Kontaktverbot für alle, Home-Office für<br />
viele, Toilettenpapier für niemanden, keine<br />
öffentlichen Gottesdienste … Stillstand.<br />
Zumindest weitestgehend. Und dann die allabendlichen<br />
Sondersendungen und Talkshows<br />
zum Corona-Ausnahmezustand … Brauchen wir<br />
weitere Verbote? Wie sehr wird die Wirtschaft<br />
unter der Krise leiden? Wie kann jeder sich<br />
und die anderen schützen?<br />
Die Kombination aus all dem bringt selbst<br />
gelassene Gemüter irgendwann aus der Ruhe.<br />
Wenn einen nicht der Toilettenpapierbestand<br />
umtreibt, so zumindest die Anschaffung von angeratenen<br />
Einweghandschuhen und Mundschutz.<br />
Einweghandschuhe? Als der Vorrat verbraucht<br />
ist und in den Drogeriemärkten so schnell kein<br />
Nachschub ankommt, bringt die nette Kollegin<br />
ohne zu zögern ein 100-er-Paket aus ihrem<br />
Vorrat von zu Hause mit.<br />
Mundschutz? Die medizinischen Masken<br />
müssen ohne Zweifel dem Personal in den<br />
Krankenhäusern und Pflegeheimen vorbehalten<br />
sein. Da klingelt es nachmittags an der Tür. Die<br />
Nachbarin von gegenüber, gelernte Schneiderin.<br />
Auf zwei Meter Abstand streckt sie am langen<br />
Arm zwei waschbare Masken entgegen. Danke!<br />
Kaum jemand konnte sich noch vor kurzem<br />
den Corona-Ausnahmezustand vorstellen. Und<br />
vielleicht konnte sich auch kaum jemand so viel<br />
Solidarität und Mitmenschlichkeit vorstellen …<br />
(GN)<br />
MÜNSTER<br />
Veränderungen im Leben halten uns auf Trab,<br />
und – wie das so ist – wenn das Leben in den<br />
nächsten Gang schaltet, ruckelt es ordentlich.<br />
Das ist nicht immer einfach. Umso besser, wenn<br />
man im Falle eines besonders heftigen Schlaglochs<br />
Freunde und Familie hat, die nicht nur zuhören und<br />
trösten, sondern praktisch helfen. Wenn sie da sind,<br />
ohne dass man viel sagen muss, weil einem am<br />
Telefon die Worte fehlen, und auch keine Erklärungen<br />
möchten oder Patentlösungen anbieten, sondern<br />
einen einfach nur in den Arm nehmen. Wenn sie<br />
helfen, die halbleere Wohnung mit einem Fernseher<br />
auszustatten, den sie nicht mehr benötigen, und die<br />
Antwort auf die Frage, wieviel Geld sie dafür haben<br />
möchten, lediglich ist: „Nichts. Du hilfst uns auch so<br />
viel. Behalt ihn, solange du ihn brauchst.“ Oder wenn<br />
zwei Stühle nebst einer gefüllten Brötchentüte vor<br />
der Wohnungstür stehen, dazu ein Hinweiszettel:<br />
„Die leihe ich dir. Du kannst nicht nur auf dem Sofa<br />
sitzen, vor allem nicht zum Frühstücken.“ Oder wenn<br />
das Handy piepst und folgende Nachricht eintrudelt:<br />
„Komm rüber, wann immer du möchtest. Die Tür ist<br />
immer offen und ein Kaffee immer vorrätig.“<br />
Mit einer solchen Unterstützung ist das Schalten<br />
in den nächsten Gang zwar immer noch ruckelig,<br />
aber Freunde füllen die tiefen Schlaglöcher ungefragt<br />
und wie selbstverständlich soweit aus, dass<br />
man sie zwar noch spürt, aber sie einen nicht mehr<br />
aus der Bahn werfen oder vom Weg abbringen<br />
können. Dafür ein großes Dankeschön. Von<br />
ganzem Herzen.<br />
(JG)<br />
4<br />
5
Portrait<br />
„ES BRAUCHT<br />
MUT, DEM<br />
RUF GOTTES<br />
ZU FOLGEN“<br />
BIRGIT KLÖCKNER ERZÄHLT VON IHRER<br />
LEBENSENTSCHEIDUNG, EINE NEUE<br />
GEISTLICHE GEMEINSCHAFT ZU VERLASSEN<br />
Von Birgit Klöckner, aufgezeichnet von Anke Lucht<br />
Nur Mut: Kann ich zu diesem Thema etwas beitragen?<br />
An und für sich bin ich ein eher ängstlicher<br />
Mensch, und es braucht nicht viel, damit ich Herzklopfen<br />
bekomme. Wenn derzeit tagtäglich vom<br />
Coronavirus berichtet wird und im Fernsehen<br />
Bilder von leeren Regalen und Hamsterkäufen<br />
übertragen werden, dann ertappe ich<br />
mich dabei, beim nächsten Einkauf<br />
sicherheitshalber ein paar<br />
Konserven in meinen<br />
Einkaufskorb zu legen.<br />
Ja, wie ist das mit<br />
meinem Mut und<br />
meinen Ängsten?<br />
An erster Stelle kommt mir in den Sinn: Mutlosigkeit,<br />
Ängste und Sorgen, das sind nicht allein<br />
Probleme unserer Zeit. Die Bibel wird jedenfalls<br />
nicht müde zu ermutigen: Fürchtet Euch nicht!<br />
Habt Mut!<br />
Aber was bedeutet es überhaupt, Mut zu haben?<br />
Der Duden umschreibt es als Fähigkeit, Angst<br />
zu überwinden, und als Bereitschaft, angesichts zu<br />
erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für<br />
richtig hält. Es geht also gar nicht darum, furchtlos<br />
zu sein und sorglos durchs Leben zu gehen, sondern<br />
sich von seinen Ängsten nicht unterkriegen oder<br />
überwältigen zu lassen sowie die Zuversicht nicht<br />
zu verlieren.<br />
Wenn ich diese Definition betrachte, ja, dann<br />
gibt es mutige Schritte in meinem Leben. Vor fast<br />
30 Jahren war mein Eintritt in eine Neue Geistliche<br />
Gemeinschaft für meine Familie und auch für einige<br />
meiner Freunde unbegreiflich. Keine althergebrachte<br />
Gemeinschaft, sondern eine junge Gemeinschaft,<br />
die zudem kaum jemand kannte. Eine Portion Mut<br />
lag darin, Gottes Ruf zu folgen, doch vor allem Begeisterung<br />
angesichts einer faszinierenden und<br />
spannenden Lebensperspektive:<br />
6 7
Portrait<br />
die Berufung und Sendung der ersten Apostel als<br />
gemeinschaftliches Lebensprogramm, das heißt,<br />
Gemeinden gründen, aufbauen, begleiten und das<br />
Wort Gottes in aller Welt verkünden. Als Frau in<br />
der Nachfolge der Apostel zu stehen, zudem noch<br />
päpstlich anerkannt (!), da soll mal einer sagen,<br />
Kirche sei fade, langweilig und verstaubt. Ich hatte<br />
einen Nachfolgeweg gefunden, der nicht hinter<br />
Klostermauern führte, sondern in die weite Welt<br />
hinaus. Bei mir ging es nach Mexiko, Spanien,<br />
Peru, Argentinien – das sind Erfahrungen, die<br />
mich bis heute prägen.<br />
Doch dann kamen Jahre, in denen plötzlich und<br />
unerwartet alles aus den Fugen geriet. In der<br />
Gemeinschaft brach ein heftiger Streit aus. Entgegengesetzte<br />
spirituelle Positionen wurden leidenschaftlich<br />
bis aufs Blut ausgefochten, es wurde um<br />
Macht und Einfluss gekämpft. In einer geistlichen<br />
Gemeinschaft lassen sich mühelos Schlachtfelder<br />
finden, um Wortgefechte auszutragen, um Druck<br />
auf die Gegenseite auszuüben und Einfluss geltend<br />
zu machen: die Predigt beim morgendlichen<br />
Impuls, das Gespräch beim Mittagstisch, ja sogar<br />
die geistliche Begleitung und nicht zu vergessen<br />
das Gehorsamsgelübde und so weiter …<br />
„Ich bin wagemutig<br />
der Sehnsucht<br />
gefolgt, in meiner<br />
Berufung einfach<br />
ich selber sein zu<br />
dürfen.“<br />
Zurück blieben in mir schließlich ein Trümmerfeld,<br />
um mich herum zahllose Verwundete und<br />
Splittergemeinschaften: die zahlenmäßig größere<br />
Gruppe päpstlich anerkannt, andere bischöflich,<br />
die einen in Madrid, andere in Avignon und wieder<br />
andere in Münster. Für mich war es eine heftige<br />
Erfahrung, mit einem Mal war nichts mehr so,<br />
wie es vorher war. Aufgrund meiner Tätigkeit<br />
als Ordensreferentin weiß ich heute, dass viele<br />
Ordensgemeinschaften in der Zeit ihrer Gründung<br />
solche Spaltungen erleben mussten und dass so<br />
manche junge Gemeinschaft in unserem Bistum<br />
Ähnliches durchlebt hat.<br />
Erschütternde Lebenserfahrungen gehen nicht<br />
spurlos an einem Menschen vorbei, selbst wenn<br />
Wunden vernarben. Manchmal kam es mir vor,<br />
als ob ich mich selbst und den Zugang zu meinen<br />
Gefühlen verloren hätte. Eine solche Trümmererfahrung<br />
ist existenzbedrohend, und wenn man<br />
dann zudem noch, wie ich, die Lebensmitte erreicht<br />
hat, klopfen bohrende Fragen an deine Tür: Wie<br />
geht es weiter? Was möchte ich anders leben als<br />
bisher? Wie kann ein gemeinsames geistliches<br />
Lebensprojekt überhaupt gelingen?<br />
Nach einer derartigen Trümmererfahrung<br />
habe ich Freiraum gebraucht, einfach nur da<br />
sein dürfen und neu Zutrauen gewinnen in das,<br />
was ich sehe, glaube, ahne und denke. Auch<br />
der Schutzraum einer Begleitung außerhalb der<br />
Gemeinschaft war wichtig, denn allein schon das<br />
innere Betrachten von Trümmerfotos oder das<br />
Aufsuchen ehemaliger Kriegsschauplätze wühlt<br />
auf. Ich hatte nie vor auszutreten, doch ich bin<br />
wagemutig der Sehnsucht gefolgt, in meiner Berufung<br />
einfach ich selber sein zu dürfen. Darüber<br />
hinaus erwachte in mir ein tiefes Bedürfnis, achtsamer<br />
zu sein für die eigenen Begabungen – aber<br />
auch für meine Grenzen. Dies hat mich fragen lassen:<br />
Ist meine Berufung, so wie ich sie lebe, ein<br />
Geschenk für die Kirche? Wie kann meine ganz<br />
persönliche Lebenserfahrung fruchtbar werden<br />
in der Kirche? Meine Fragen und meine Sehnsucht<br />
haben mich auf einen Weg geführt, den<br />
der Rahmen meiner ehemaligen Gemeinschaft in<br />
dieser Weise nicht vorsah. Motor war die Suche<br />
nach dem Sinn – selbst für die Brüche und die<br />
schmerzlichen Erfahrungen – meines Lebens.<br />
Seit fünf Jahren arbeite ich nun im Bistum<br />
Münster in der Fachstelle Orden, Säkularinstitute<br />
und Geistliche Gemeinschaften. Meine geistliche<br />
Prägung kann ich nicht einfach abstreifen wie einen<br />
alten Mantel, der nicht mehr passt. Auch wenn es<br />
vielleicht ein wenig verrückt klingt: Wenn ich im<br />
Rahmen meiner Tätigkeit Gemeinschaften besuche<br />
und dort Gespräche führe, Genehmigungen im<br />
Auftrag unseres Bischofs erteile oder eine Stellungnahme<br />
für den Bischof verfasse, bedeutet das für<br />
mich Teilhabe am Apostelamt. Eine Predigt übernehme<br />
ich nur noch selten, doch bin ich überzeugt:<br />
Ein Mensch kann mit seiner Lebenserfahrung zum<br />
lebendigen Wort Gottes werden. Für mich ist es<br />
kein Zufall, sondern Gottes liebevolle Vorsehung,<br />
dass mir diese und keine andere Aufgabe im Bistum<br />
Münster anvertraut wurde. Gesandt bin ich<br />
zwar nicht in die weite Welt, sondern in die Welt<br />
der Orden und Geistlichen Gemeinschaften des<br />
Bistums Münster, doch hierfür sind alle Erfahrungen<br />
meines Lebens, ohne Ausnahme, hilfreich.<br />
Im Markusevangelium gibt es die Geschichte<br />
vom blinden Bartimäus. Dem war zum Schreien<br />
zumute, und die Apostel sagen zu ihm: Hab nur<br />
Mut, steh auf, er ruft dich. Aufgrund meiner<br />
Lebenserfahrung würde ich sagen: Ja, es ist<br />
mutig und braucht Mut, dem Ruf Gottes zu<br />
folgen, aus Schutt und Asche aufzustehen und<br />
nach vorne zu gehen, auch dann, wenn du<br />
nicht weißt, wohin der Weg dich führen wird.<br />
8 9
Luis Gedanken<br />
Zu meiner Freude<br />
„TRAU DICH, LUI“<br />
MUT ZUR HEITERKEIT<br />
Zwischen den Polen heldenhafte Tapferkeit und<br />
hasenfüßige Beklommenheit hätte sich Lui spontan<br />
eher in letztgenannter Kategorie verortet. Entsprechend<br />
holprig fließt eine Kolumne zum Thema Mut<br />
aus der Feder beziehungsweise der Tastatur.<br />
Ungleich mehr hätte Lui zum Thema Mutlosigkeit<br />
zu schreiben: Über die ermüdende<br />
Mutlosigkeit, die Lui bevorzugt an Montagvormittagen<br />
im November befällt, wenn die draußen<br />
herrschende graue Finsternis von einem nicht nachlassenden<br />
Nieselregen abgerundet wird. Über die<br />
demotivierende Mutlosigkeit, wenn die Kollegin<br />
vom am Wochenende absolvierten Marathon<br />
berichtet, während Lui selbst auf der deutlich<br />
weniger anspruchsvollen Strecke zwischen Sofa<br />
und Kühlschrank von einem spontan auftretenden<br />
Mittagsschlafbedürfnis niedergestreckt wurde.<br />
Und dann gibt es noch tiefergehende Mutlosigkeiten<br />
in Luis Leben: Die entsetzte Mutlosigkeit<br />
angesichts der Tatsache, dass eine nennenswerte<br />
Zahl von Deutschen tatsächlich wieder braun wählt.<br />
Die fassungslose Mutlosigkeit darüber, dass<br />
polternde Unmenschlichkeit, ein erschreckend<br />
schlichtes Gemüt und ein nicht minder erschreckend<br />
oranger Haut- und Haarton keine Hinderungsgründe<br />
sind, zum mächtigsten Mann der Welt gewählt zu<br />
werden. Und – natürlich – die ratlose Mutlosigkeit<br />
angesichts eines mikroskopisch winzigen Virus,<br />
das innerhalb weniger Wochen die ganze Welt in<br />
den Würgegriff genommen hat. Mit dem Tempo<br />
kommt nicht mal das orangefarbene schlichte<br />
Gemüt mit.<br />
Schwimmbecken stürzen noch den Himalaya<br />
ohne Sauerstoffgerät durchwandern, um Mut<br />
zu beweisen.<br />
Mut meint heute ganz andere und viel menschlichere<br />
Herausforderungen: sich eben nicht in<br />
die Schlacht um die letzte Packung Klopapier zu<br />
werfen, sondern tapfer zu vertrauen, dass es auch<br />
morgen noch welches in den Geschäften geben<br />
wird. Anzurufen, wen man lange nicht mehr angerufen<br />
hat, um nachzufragen, ob alles gut und<br />
gesund ist. Dem Nachbarn das letzte Päckchen<br />
Hefe zu geben und sich am Folgetag an ein Brotrezept<br />
ohne Hefe zu wagen.<br />
Und nicht zuletzt: Mut zur Heiterkeit. Mit dieser<br />
Heiterkeit freut sich Lui schon heute auf den Tag,<br />
an dem nicht mehr Hefe und Klopapier ausgehen,<br />
sondern Lui und die beste Hälfte von allen.<br />
(AL)<br />
Es ist wieder Frühling. Die<br />
Temperaturen und die Lage unseres Zuhauses<br />
lassen zu, das Schlafzimmerfenster über<br />
Nacht geöffnet zu lassen. Es ist ruhig, vereinzelt ist das<br />
Röhren eines Motorrades oder das Knattern eines Treckers<br />
zu hören.<br />
Das Einschlafen fällt nicht schwer. Auch das Aufwachen nicht. Im<br />
Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem von einem stillen Frühling<br />
gesprochen wurde, ist es mit Sonnenaufgang bei uns alles andere als<br />
still. Die ersten Vögel melden sich zu Wort, und nach und nach fallen alle<br />
anderen in das Konzert in der Morgendämmerung ein: Fröhlich trällern<br />
Meisen, Rotkehlchen, Amseln, Singdrosseln und ihre gefiederten<br />
Freunde in unserem Garten. Welch ein Genuss. Mut zur Offenheit<br />
wird eben belohnt!<br />
Auch wenn ich zugeben muss, dass ich irgendwann das Fenster<br />
schließe, um noch ein bisschen zu schlafen. Morgenstund<br />
hat zwar Gold im Mund, doch man muss es ja<br />
nicht übertreiben.<br />
(MEK)<br />
Dass Lui trotz all dem über Mut schreibt, ist –<br />
paradox genug – ebenfalls Corona zu verdanken.<br />
Denn in diesen viralen Zeiten muss man sich weder<br />
mit dem Kopf voran vom Zehnmeterturm ins<br />
10 11
Erfahrungsbericht<br />
„ICH WURDE<br />
REICH BESCHENKT“<br />
DREI MITARBEITERINNEN UND<br />
MITARBEITER MACHEN EINE<br />
BESONDERE GOTTESERFAHRUNG<br />
IN DER WÜSTE<br />
Von Ann-Christin Ladermann<br />
Kein Handy, keine Uhr, keine Dusche, dafür Temperaturunterschiede<br />
von 30 Grad. Bei Wüstenexerzitien<br />
begeben sich die Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer in einem einzigartigen Umfeld auf<br />
Gottessuche. Zwei Wochen verbringen sie in der<br />
jordanischen Wüste – einem scheinbar leblosen<br />
Ort, der doch so viel Leben zu bieten hat.<br />
Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem<br />
Bistum Münster haben Mut bewiesen und sich<br />
auf dieses Abenteuer mit Gott eingelassen.<br />
Mit Bauchschmerzen hat sich Claudia John<br />
im Frühjahr 2018 auf den Weg zum Frankfurter<br />
Flughafen gemacht. „Ich wusste nicht, was mich<br />
erwartet, kannte die Gruppe nicht und glaubte,<br />
dass zwei Wochen in der Wüste unendlich lang<br />
werden würden“, erinnert sich die Mitarbeiterin,<br />
die im Bischöflichen Generalvikariat (BGV) für<br />
das Liegenschaftsmanagement zuständig ist. Es<br />
sollte anders kommen. Beinahe täglich denkt die<br />
57-Jährige heute an die Zeit in der Wüste zurück,<br />
zehrt von den intensiven Erfahrungen, die sie dort<br />
gemacht hat: „Ich war von einer inneren Ruhe<br />
erfüllt, die ich vorher nicht gekannt habe. Jetzt<br />
trägt sie mich durch meinen Alltag.“<br />
Seit vielen Jahren organisiert die charismatische<br />
Gemeinschaft Emmanuel Wanderexerzitien in der<br />
Wüste. Stundenlanges Gehen in Stille – unterbrochenvon<br />
geistlichen Impulsen, Gesprächsgruppen,<br />
Bibellesen, Gottesdiensten und Lobpreisgebeten.<br />
Unter einfachsten Bedingungen hat sich<br />
Claudia John auf dieses Programm eingelassen,<br />
das sie in die Stille und somit in eine Begegnung<br />
mit Gott geführt hat. 14 Tage lang wanderte sie<br />
mit rund 30 Menschen aus ganz Deutschland,<br />
Österreich und der Schweiz durch den Sand,<br />
Georg Schoofs<br />
Claudia John und Johannes Heimbach<br />
übernachtete im Schlafsack unter freiem Himmel,<br />
verzichtete auf gewohnten sanitären Luxus.<br />
Reich beschenkt statt viel vermisst<br />
Wüste heißt, alles Überflüssige weglassen – materiell<br />
wie mental. „Ich hatte gedacht, ich vermisse<br />
viel: die Dusche, ein richtiges Bett, ein Gläschen<br />
Wein am Abend. Aber nichts davon habe ich vermisst.<br />
Im Gegenteil: Ich wurde reich beschenkt“,<br />
sagt John. So sehr habe sie sich öffnen können,<br />
habe Gott zu ihrem Herzen sprechen lassen. Die<br />
beständige Stille habe lautstark in ihr und den<br />
Mitpilgern gearbeitet, habe Lebensfragen in den<br />
Mittelpunkt gerückt, seelische Verkrustungen<br />
aufgebrochen und Tränen fließen lassen, die<br />
scheinbar längst getrocknet waren. „Gott hat in<br />
jedem von uns intensiv gewirkt“, ist sich die<br />
Münsteranerin sicher.<br />
Von der Begeisterung seiner Kollegin ließ sich<br />
Georg Schoofs anstecken und meldete sich ein<br />
Jahr später an. Für den exerzitienerfahrenen Leiter<br />
der Gruppe Liegenschaften im BGV war es eine<br />
Herausforderung, für zwei Wochen den Kontakt<br />
nach Hause abzubrechen, alles hinter sich zu<br />
lassen. „Man hat sich schon sehr daran gewöhnt,<br />
immer erreichbar zu sein, das war eine neue Erfahrung<br />
für mich.“ Und noch etwas erforderte Mut<br />
von ihm: Geht der 58-Jährige sonst beim Wandern<br />
und Spazieren gerne vorneweg, lief er jetzt hinterher<br />
– vertraute sich fremden Menschen blind an.<br />
„Ich wurde buchstäblich in die Wüste geführt, am<br />
dritten Tag habe ich nicht mehr gewusst, wie ich<br />
herauskomme“, schildert Schoofs. Sich in dieser<br />
Intensität auf andere einzulassen, sei ungewohnt<br />
gewesen: „Aber man braucht dieses Vertrauen,<br />
denn Wüstenexerzitien sind Grenzerfahrungen –<br />
mit sich selbst und mit Gott.“<br />
12<br />
13
Erfahrungsbericht<br />
Oft werde die Wüste als ein toter Ort bezeichnet.<br />
„Dabei lebt dort so viel“, hat Schoofs erfahren.<br />
Fasziniert war er von der Schönheit der Natur.<br />
„Sie lehrt einen das Staunen neu“, blickt er<br />
dankbar zurück. Er erinnert sich an einen Satz des<br />
muslimischen Beduinen, der die Gruppe durch die<br />
Wüste führte: „Jemand muss seine Hände im Spiel<br />
gehabt haben, als dieser kostbare Flecken Erde<br />
geschaffen wurde.“ Schoofs hatte Glück: Er war in<br />
den beiden Wochen im Frühjahr dort, als ein bunter<br />
Teppich wilder Blumen den Wüstensand zum<br />
Leuchten brachte und die gängige Vorstellung von<br />
Wüste regelrecht übermalte. „Eine tiefe Ehrfurcht<br />
vor der Schöpfung hat sich in mir breit gemacht“,<br />
blickt er zurück. „Wir haben schweigend gestaunt<br />
und uns nicht getraut, darüber zu laufen.“<br />
Ganz frisch sind die Eindrücke noch bei Johannes<br />
Heimbach. Begeistert und erfüllt blickt er auf die<br />
Wüstenexerzitien im März <strong>2020</strong> zurück – und<br />
das, obwohl es statt nach zwei schon nach einer<br />
Woche nach Hause ging. Das Coronavirus und die<br />
damit verbundenen Grenzschließungen zwangen<br />
die Gruppe zum Abbruch. Doch die intensiven Erfahrungen<br />
dieser einen Woche kann dem Profi in<br />
Sachen Exerzitien niemand mehr nehmen. „Obwohl<br />
wir in der Gruppe unterwegs waren, war es vor<br />
allem ein Weg mit mir selbst“, beschreibt der<br />
56-Jährige, der als Geistlicher Begleiter und<br />
Exerzitienbegleiter im Priesterseminar Borromaeum<br />
und im Institut für Diakonat und pastorale Dienste<br />
(IDP) des Bistums tätig ist.<br />
Vertrauen ist die zentrale Botschaft<br />
„In der Wüste kann man nichts und niemandem<br />
ausweichen“, musste Heimbach feststellen, „auch<br />
Gott nicht.“ Es sei ihm leicht gefallen, sich auf die<br />
Leitung und die Gruppe einzulassen. „Ich hatte<br />
von Anfang an ein gutes Gefühl“, erinnert er.<br />
Vertrauen lautet deshalb die zentrale Botschaft,<br />
die er aus der Wüste mitnimmt – Vertrauen in<br />
die Entscheidung der Leitung, bei ungewöhnlich<br />
schweren Unwettern im Camp der Beduinen zu<br />
übernachten und schließlich angesichts des Coronavirus<br />
das „Abenteuer mit Gott“ abzubrechen.<br />
Vertrauen aber auch und besonders in Gott: „Auf<br />
meine Frage, ob da wirklich jemand ist, der es gut<br />
mit mir meint, habe ich immer erfahren dürfen:<br />
Ja, ich gehe mit als ‚Ich bin der ,Ich bin da‘.“<br />
Kein Extremsport, sondern Gottessuche<br />
Mut haben die jüngsten Wüstenexerzitien auch<br />
Claudia John noch mal abverlangt. Ist die Teilnahme<br />
eigentlich auf einmal beschränkt, wurde<br />
sie Ende vergangenen Jahres gefragt, ob sie im<br />
Leitungsteam dabei sein und die Teilnehmerinnen<br />
betreuen möchte. Lange habe sie überlegt, ob sie<br />
dieser Herausforderung gewachsen sein würde;<br />
jetzt ist sie froh, sich getraut zu haben. „Ich habe<br />
wieder so viel für mich persönlich mitgenommen“,<br />
sagt sie. Mit jeder Teilnehmerin<br />
habe sie vorab ein Gespräch geführt. Dabei wird<br />
geklärt, ob die Exerzitien für diejenige das Richtige<br />
sind. „Dabei geht es nicht darum, Extremsportlerin<br />
zu sein, sondern ob man wirklich auf der Suche<br />
nach Gott ist“, fasst John zusammen.<br />
Obwohl es besonders bei diesen Wüstenexerzitien<br />
viele Entscheidungen für sie und ihre Kollegen<br />
im Leitungsteam zu treffen gab: Das<br />
Gefühl von tiefer Ruhe und innerem<br />
Frieden hat sich auch dieses<br />
Mal wieder in ihr ausgebreitet –<br />
und wirkt hoffentlich<br />
noch lange nach.<br />
14<br />
15
Mut im Alltag<br />
DAS EVANGELIUM<br />
GIBT IHM MUT<br />
PFARRER KOSSEN PRANGERT LEIHARBEIT IN<br />
FLEISCHINDUSTRIE ALS „SKLAVEREI“ AN<br />
Von Gudrun Niewöhner<br />
„Man muss so weit gehen, wie man kann“, sagt<br />
Pfarrer Peter Kossen und fügt gleich an: „Es geht<br />
hier um Menschen.“ Dass seine Hartnäckigkeit<br />
Mut erfordert, dessen ist er sich bewusst, aber<br />
der Pfarrer der Lengericher Pfarrei Seliger Niels<br />
Stensen bleibt bescheiden. Seit 2012 prangert er<br />
die Arbeits- und Lebensbedingungen vor allem<br />
der osteuropäischen Leiharbeiter in der Fleischindustrie<br />
an, bezeichnet diese als „moderne<br />
Sklaverei“. Sie sind jedoch nur ein Beispiel,<br />
ähnliche Zustände gebe es inzwischen auch<br />
bei Gebäudereinigern und Paketdiensten.<br />
Das Bemühen um Wahrheit und Gerechtigkeit<br />
sieht Kossen als zentrale Herausforderung eines<br />
jeden Christen und findet Ermutigung für sein<br />
Handeln an vielen Stellen im Evangelium: „Wir<br />
dürfen dabei nicht im Allgemeinen verharren,<br />
sondern müssen konkret werden.“ Während<br />
seiner Zeit als Ständiger Vertreter des Offizials in<br />
Vechta hatte Kossen engen<br />
Kontakt zum Caritasverband<br />
und zum<br />
Sozialdienst<br />
katholischer<br />
Frauen. Durch deren Berichte und seine eigenen<br />
Beobachtungen stieg in dem 52-Jährigen die Wut<br />
über die Zustände. Nachdem er die Strukturen der<br />
Fleischindustrie erstmals öffentlich als „mafiaähnlich“<br />
kritisiert hatte, entstand ein mediales<br />
Interesse, dessen Dynamik Kossen überraschte.<br />
„Viele haben mit dieser Position von einem Vertreter<br />
der Kirche nicht gerechnet“, weiß der Pfarrer<br />
aus Diskussionen.<br />
Dass seine Gegner wenig zimperlich sind,<br />
verschreckt Kossen nicht. Unbekannte legten<br />
ihm einmal nachts einen Kaninchenkopf vor die<br />
Haustür, als „Gruß aus der Fleischbranche“. Tags<br />
zuvor hatte er die Arbeitsbedingungen in manchen<br />
Schlachthöfen angeprangert. Ruhe gegeben<br />
hat er trotz der nächtlichen Drohung nicht. Fast<br />
kein Monat vergeht, ohne dass sich der Pfarrer zu<br />
Wort meldet. Die Medien nutzt er seitdem, um<br />
sein Anliegen publik zu machen.<br />
Doch geht es Kossen nicht allein um Aufmerksamkeit.<br />
Er möchte, dass sich etwas ändert.<br />
Und deshalb nennt er bewusst die Namen der<br />
Firmen. Dass ihm dadurch Unterlassungsklagen<br />
drohen, nimmt der Lengericher Pfarrer in Kauf:<br />
„Durch die Namensnennung ist der öffentliche<br />
Druck auf jeden Fall größer.“ Nur so werde deutlich,<br />
dass Unrecht geschehe.<br />
Einer der aufgeführten Unternehmer hat ihn<br />
im vergangenen Jahr zu einem Gespräch zu sich<br />
bestellen wollen. Kossens Bedingung: „Ich komme<br />
nur, wenn Sie uns sagen, was Sie ändern wollen.“<br />
Das Treffen kam nicht zustande. „Ich gehe nicht<br />
dorthin, um mir anzuhören, wie Dinge gerechtfertigt<br />
werden, die es nicht zu rechtfertigen gibt“,<br />
hat Kossen eine klare Position. Unterstützt wird er<br />
übrigens von seinem Bruder, einem Arzt, der viele<br />
der Leiharbeiter als Patienten in seiner Hausarztpraxis<br />
behandelt.<br />
MUT KANN LEBEN RETTEN<br />
JURIST DR. CHRISTIAN HÖRSTRUP IST MITGLIED DER<br />
FREIWILLIGEN FEUERWEHR<br />
Von Ann-Christin Ladermann<br />
Mut kann Leben retten. Dr. Christian Hörstrup<br />
weiß das aus eigener Erfahrung. Seit 18 Jahren<br />
ist der Jurist, der im Bischöflichen Generalvikariat<br />
stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung und<br />
inhaltlich vor allem für das Stiftungs- und Vereinsrecht<br />
sowie das Schulrecht zuständig ist,<br />
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Mutig sein<br />
für andere – das liegt bei dem 35-Jährigen aus<br />
Cappenberg in der Familie. „Mein Opa war schon<br />
bei der Freiwilligen Feuerwehr, mein Vater und<br />
mehrere Onkel sind es auch, und ich hoffe natürlich,<br />
dass ich diesen Einsatz auch an meine Söhne<br />
Jakob und Julius weitergeben kann.“<br />
Längst bedeute Feuerwehrmannsein nicht<br />
mehr nur, Brände zu löschen. „Durch den vorbeugenden<br />
Brandschutz ist die Anzahl von Brandeinsätzen<br />
in den letzten Jahrzehnten deutlich<br />
zurückgegangen, die technischen Hilfeleistungen<br />
dagegen nehmen zu“, erklärt Hörstrup, „das<br />
kann die Tür sein, die wir für den Rettungsdienst<br />
öffnen, das Öl, das bei einem Verkehrsunfall ausgelaufen<br />
ist und beseitigt werden muss, oder die<br />
berühmte Katze, die wir aus dem Baum retten.“<br />
Seit einigen Jahren ist die Feuerwehr zudem in<br />
feste Strukturen eingebunden und wird beispielsweise<br />
im Katastrophenschutz eingesetzt.<br />
Jedes Mal, wenn der Piepser losgeht oder die<br />
Sirene heult, steigt Hörstrups Adrenalinspiegel:<br />
„Man weiß nie, was einen erwartet, aber der unbedingte<br />
Wunsch zu helfen lässt einen alles stehen<br />
und liegen lassen.“ Mutig sein, weitermachen –<br />
der Cappenberger erinnert sich an mehrere solcher<br />
Einsätze: „Da gab es den Suizid, bei dem wir die<br />
ersten am Einsatzort waren, oder den Verkehrsunfall,<br />
bei dem der Arzt nur noch den Tod des<br />
Opfers feststellen konnte und wir den Verstorbenen<br />
aus dem Autowrack befreien mussten.“<br />
Mut sei vor allem gefragt, wenn die eigene<br />
Gesundheit oder das eigene Leben in Gefahr ist.<br />
Heikel seien Einsätze, bei denen Gas oder giftige<br />
Substanzen austreten und die Feuerwehrleute<br />
Atemschutzgeräte tragen. „Wenn andere rausrennen,<br />
rennen wir rein“, bringt es Hörstrup auf den<br />
Punkt und ergänzt: „Drei Atemzüge von Brandrauch<br />
führen bei einem normalen Menschen zur<br />
Bewusstlosigkeit, da braucht es schon Mut, das<br />
brennende Haus oder den Keller zu betreten.“<br />
Der Jurist, der für seine Doktorarbeit Beruf und<br />
Hobby zusammengebracht hat, indem er die Organisation<br />
der gemeindlichen Feuerwehr in<br />
Nordrhein-Westfalen untersucht hat, ist<br />
Oberbrandmeister und Gruppenführer<br />
seines Löschzugs. Er darf<br />
das mit neun Personen besetzte<br />
Einsatzfahrzeug taktisch führen<br />
und Einsätze leiten, bis der Zugführer<br />
eintrifft. „Besonders bei<br />
schwereren Einsätzen versucht<br />
man, jüngere Kameradinnen und<br />
Kameraden zurückzuhalten“, gibt<br />
Hörstrup ein Beispiel für die Verantwortung,<br />
die damit einhergeht.<br />
Vor allem die Kameradschaft ist es, die<br />
den 35-Jährigen an dem Engagement<br />
reizt. „Manche Situationen können<br />
hart sein, aber man ist nie alleine<br />
bei einem Einsatz. Die anderen<br />
erleben das Ganze<br />
genauso, und darüber<br />
nachher miteinander<br />
zu sprechen,<br />
macht es leichter.<br />
Mir persönlich<br />
hilft dabei auch<br />
mein Glaube.“<br />
16 17
Mut im Alltag<br />
MUT<br />
Michaela Kiepe hat einen<br />
Freund im Sterben begleitet<br />
BIS ZULETZT<br />
vielen Medikamenten. Also machten wir uns<br />
auf den Weg in das Badezimmer. Abduschen war<br />
immer eine große Hilfe. Auf dem Weg trafen wir<br />
die Ärztin, die ihn fragte, wie es ihm gehe. Und<br />
Kurt antwortete trocken: „Mein Stuhl ist ganz<br />
blau.“ Irritiert schaute ihn die Ärztin an. Und verschmitzt<br />
setzte er hinterher: „Ja, gucken Sie hier:<br />
ganz blau“, sagte er und zeigte auf den Toilettenstuhl,<br />
mit dem wir unterwegs waren. Lachend ging<br />
die Ärztin weiter.<br />
„JEMANDEN ZU<br />
ERMUTIGEN IST EINE<br />
WICHTIGE AUFGABE IN<br />
DER SEELSORGE“<br />
Von Michaela Kiepe<br />
Kurt hieß eigentlich Jürgen. Doch irgendwie war er<br />
für alle Kurt. Warum? Das habe ich nie erfahren.<br />
Wir waren Freunde und Kabarettkollegen. Er<br />
jonglierte mit Sprache, hielt Menschen den Spiegel<br />
vor, hatte Humor. Kurt hatte seine eigene Sicht<br />
auf die Dinge und spielte mit gesellschaftlichen<br />
Konventionen. Er hatte ein großes Herz. Zahlreiche<br />
Kabarettnummern sind aus seiner Feder entstanden.<br />
Bei den Proben haben wir viel gelacht.<br />
Dass wir diesen stattlichen Mann einmal beerdigen<br />
müssen, damit hatte niemand in unserer<br />
Gruppe gerechnet. Zunächst meinte der Hausarzt,<br />
dass der aufgeblähte Bauch sich durch Fruchtsäfte<br />
und eine ordentliche Verdauung wieder in Form<br />
bringen ließe. Doch dann die Diagnose: Krebs. Das<br />
riss uns allen den Boden unter den Füßen weg.<br />
Schließlich war Kurt erst 33 Jahre alt.<br />
Doch Kurt nahm auch diese Situation mit Humor<br />
und Optimismus. Er begab sich in Behandlung,<br />
ich begleitete ihn. Allerdings schlug die Behandlung<br />
nicht wie gewünscht an. Zahlreiche Bilder<br />
habe ich noch im Kopf, vor allem von den beiden<br />
letzten Tagen.<br />
Die Schwestern im Krankenhaus hatten mir<br />
schon gesagt, dass es nicht gut stehe um Kurt.<br />
Doch das wollten wir nicht wahrhaben.<br />
Mit einem Schmunzeln erinnere ich mich an<br />
unseren letzten Abend. Seine Haut juckte von den<br />
Das war sein Humor: unverhofft und um die<br />
Ecke gedacht. Auch unter der Dusche drehte er<br />
noch einmal auf. Wir haben viel gelacht, und nach<br />
dem Duschen war meine Kleidung mindestens so<br />
nass wie er. Aber das störte mich nicht. Ich hatte<br />
Hoffnung, Hoffnung auf weitere gemeinsame Zeit.<br />
Gutgelaunt fuhr ich heim. Am nächsten Morgen<br />
erreichte mich jedoch der Anruf eines Freundes,<br />
der mir sagte, ich solle auf dem schnellsten Weg<br />
ins Krankenhaus kommen. Dort traf ich erstmals auf<br />
Kurts Eltern, die sich vom Sauerland aus auf den<br />
Weg nach Münster gemacht hatten. Ich ging in sein<br />
Zimmer. Dort lag Kurt im Bett. An der Wand hing<br />
das Kreuz, das er eigentlich abgenommen hatte,<br />
denn Kirche und Glauben waren nicht sein Ding.<br />
Am Abend hatte er es offenbar wieder aufgehängt.<br />
Seine sonore Stimme war nur noch ein Flüstern.<br />
Seine Familie hatte sich auf den Flur zurückgezogen.<br />
Mit einer Ordensfrau saß ich am Bett. Ich<br />
streichelte seinen Bart, seine Hände. Und plötzlich<br />
begann die Schwester, das Vaterunser zu beten.<br />
Ich hielt seine Hand, und er schlief für immer ein.<br />
Hätte mir jemand vorher gesagt, dass ich bei<br />
einem Sterbenden am Bett sitzen solle, hätte ich<br />
sicher gesagt, dass ich das nicht kann, nicht die<br />
Kraft dazu habe, es mir nicht zutraue. Doch in<br />
dem Moment ging es. Woher die Kraft kam, keine<br />
Ahnung. Aber diese Erfahrung hat mir gezeigt,<br />
dass in dem Moment, in dem ich Kraft brauche,<br />
diese da ist. Von irgendwo her geschenkt.<br />
Es ist viele Jahre her, und ich erinnere mich gern<br />
an Kurt. Er hat mich mit seinem Humor beschenkt,<br />
und er hat uns das Abschiednehmen leicht gemacht.<br />
Ob er das wusste? Ich habe keine Ahnung.<br />
Von Christian Breuer<br />
Schwester Marlies Mauer ist Seelsorgerin im Krankenhaus<br />
Wenn Schwester Marlies Mauer eine der Türen in<br />
dem langen Flur öffnet, braucht sie dafür schon<br />
manches Mal Mut. „Ich weiß oft nie, was mich<br />
hinter dieser Tür erwartet“, sagt sie. Schwester<br />
Marlies betreut als Seelsorgerin im Gelderner<br />
St.-Clemens-Hospital kranke Menschen, Angehörige<br />
und auch das Klinikpersonal. Eine Aufgabe, die<br />
ihr im Alltag immer wieder Mut abverlangt. „Bei<br />
manchen Gesprächen würde auch ich lieber davon<br />
laufen und ihnen aus dem Weg gehen, dann muss<br />
ich meinen Mut zusammennehmen und weiter zuhören“,<br />
weiß sie und fügt lächelnd hinzu: „Manchmal<br />
bin ich selbst überrascht und weiß am Ende gar<br />
nicht, woher ich die Kraft genommen habe“.<br />
Zu Zeiten der Corona-Krise im Krankenhaus zu<br />
arbeiten erfordere hingegen keinen Mut, sagt sie:<br />
„Man macht sich schon seine Gedanken, aber ich<br />
bin nicht von Angst erfüllt. Ich kann mich nur an<br />
die Hygieneregeln halten und hoffen, dass es mich<br />
nicht erwischt und ich noch lange für die Kranken<br />
da sein kann.“ Bei allem Handeln, betont sie, „vertraue<br />
ich auf die Führung des Heiligen Geistes.“<br />
Zu ihrem Alltag im Krankenhaus gehören immer<br />
wieder auch Treffen mit Menschen, die längst<br />
jeglicher Mut verlassen hat, die an unterschiedlichen<br />
Ängsten und Sorgen zu scheitern drohen.<br />
„Einigen von ihnen kann man einen Teil der Zuversicht<br />
zurückgeben“, betont Schwester Marlies.<br />
Ihnen zuzuhören, sie zu bestärken und sich Zeit für<br />
diese Menschen zu nehmen, sei besonders wichtig.<br />
Wenn die Zuwendung dann Erfolg zeigt und die<br />
Menschen wieder einen Weg aus ihrer Perspektivlosigkeit<br />
sehen, das sei auch für sie immer wieder<br />
ein Geschenk, sagt die Ordensschwester. Vielen<br />
fehle schon der Mut für die kleinen, alltäglichen<br />
Dinge, etwa nach dem Krankenhausaufenthalt auf<br />
andere Menschen oder auch die Pfarrei zuzugehen<br />
und um Hilfe oder seelsorgliche Begleitung zu<br />
bitten. „Jemanden zu ermutigen, diese Schritte zu<br />
gehen, ist eine wichtige Aufgabe in der Seelsorge“,<br />
sagt Schwester Marlies.<br />
18 19
Dafür / Dagegen<br />
HOME-OFFICE:<br />
„EIN DAUERHAFTES ARBEITSMODELL ÜBER<br />
CORONA-ZEITEN HINAUS?“<br />
Von Christian Breuer<br />
1,3 Tonnen Kohlendioxid – das ist, konservativ gerechnet, die Menge an klimaschädlichem Treibhausgas,<br />
die mein Auto jährlich ausstößt. Und zwar allein für die tägliche Fahrt zum Büro und<br />
zurück. Dafür sitze ich, wieder aufs Jahr gerechnet, mindestens fünfeinhalb volle Tage hinter dem<br />
Steuer. Im Winter läuft im Büro die Heizung, der Kühlschrank brummt 365 Tage im Jahr vor sich<br />
hin. Ökologisch gesehen also nicht gerade ein Beitrag zu der geforderten Schöpfungsbewahrung.<br />
Ökonomisch betrachtet kostet das Büro Miete, die Steuerrückerstattung über die Pendlerpauschale<br />
geht zu Lasten der Staatskasse – also von uns allen. Und ich wohne 20 Kilometer von meinem<br />
Büro entfernt, es gibt in unserem Flächenbistum sicherlich noch andere Beispiele für Pendlerstrecken.<br />
Da muss die Frage erlaubt sein: Ist das wirklich vertretbar? Ich sage: Nein! Die vergangenen<br />
Wochen im Home-Office haben gezeigt, wie gut man sich innerhalb kürzester Zeit in den eigenen<br />
vier Wänden organisieren kann, und wie groß – selbst trotz der Ausgangsbeschränkungen – der<br />
Gewinn an Lebensqualität ist. Täglich 40 Minuten mehr Zeit für Sport, Spaziergänge, Telefonate<br />
mit Freunden oder, ja, Netflix. Die gesparten Sprit- und Verschleißkosten für das Auto sind noch<br />
ein angenehmer Nebenaspekt.<br />
Sicher: Die Videokonferenz ersetzt nicht den Plausch in der Teeküche oder die schnelle Abstimmung<br />
„über den Flur“. Andererseits kann kaum ein Weg kürzer sein als der zur Kurzwahltaste<br />
des Telefons, wenn es schnell ein Problem zu lösen gilt. Und der Smalltalk mit Kolleginnen und<br />
Kollegen muss nicht ausfallen, wenn man zu Hause ist. Auch das haben die vergangenen Wochen<br />
bewiesen. Sicherlich ist Home-Office nicht für alle Mitarbeitenden sinnvoll, für einige aufgrund<br />
der häuslichen Wohnsituation erst gar nicht möglich. Da, wo es machbar und gewünscht ist,<br />
muss über das dauerhafte Home-Office aber durchaus als attraktives, umwelt- und kostenschonendes<br />
Arbeitsmodell nachgedacht werden.<br />
Von Ann-Christin Ladermann<br />
Die Corona-Krise hat Millionen Menschen zu Heimarbeitern gemacht. Wer kein Arbeitszimmer<br />
zur Verfügung hat, muss seinen Laptop am Küchentisch zwischen schmutzigem Geschirr und<br />
Tageszeitung, noch schlimmer am Wohnzimmertisch mit Blick auf den Fernseher aufbauen.<br />
Sicherlich – das sind Umstände, die man nach Corona optimieren könnte. Doch reichen die technische<br />
Ausstattung und das richtige Setting aus, damit sich Kolleginnen und Kollegen im Home-<br />
Office dauerhaft wohlfühlen? Ich denke nicht.<br />
Es ist nicht nur die Disziplin, die das Arbeiten zu Hause erfordert – und die nicht jeder hat. Es<br />
fehlt nicht nur die klare Trennlinie zwischen Arbeit, Pause und Feierabend, die die Mitarbeitenden<br />
hindert, auch räumlich „abzuschalten“. Es ist auch nicht nur die Kommunikation, die – trotz aller<br />
technischen Hilfsmittel, die in diesen Tagen Hochkonjunktur haben – erschwert wird, weil für<br />
jede Kleinigkeit zum Telefon gegriffen oder eine E-<strong>Mai</strong>l formuliert werden muss.<br />
Nein, es fehlen ganz zentrale Dinge, die sich erheblich auf die Arbeitszufriedenheit auswirken:<br />
der kurze Gruß am Morgen, der den Kollegen in den offenstehenden Büros gilt, der Plausch in der<br />
Teeküche, bei dem Vieles zur Sprache kommt, was einen bewegt, die gemeinsame Mittagspause,<br />
die Raum lässt für Themen jenseits der Arbeit. Wer sein Büro dauerhaft in die eigenen vier Wände<br />
verlagert, dem fehlen diese zwischenmenschlichen Begegnungen – trotz digitaler Konferenzprogramme<br />
wie Teams. Gerade für uns als Mitarbeitende der katholischen Kirche im Bistum<br />
Münster, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, Beziehungen aufzubauen und zu fördern, ist<br />
Home-Office als dauerhaftes Arbeitsmodell darum keine echte Alternative zum gemeinsamen<br />
Alltag in den Büros und Einrichtungen.<br />
20 21
Nachgefragt<br />
„WO IST IHR MUT ALS CHRISTIN ODER CHRIST GEFRAGT?“<br />
Robert Luttikhuis<br />
Pastoralassistent, St. Peter und Paul Cappeln<br />
„Für mich gilt es, dem oftmals gesellschaftlichen<br />
Karussell der Verdrehung prüfend und besonders<br />
aufmerksam gegenüberzustehen. Das erfordert,<br />
mich kritisch zu überdenken, um gegebenenfalls<br />
neue Erkenntnisse in die Zukunft hineinzutragen.<br />
Mein Glaube ermutigt mich dazu!“<br />
Yvonne Ahlers<br />
Schulseelsorgerin, Oldenburg<br />
„Das Leid der Menschen weltweit zu sehen und<br />
auszuhalten und dennoch die Hoffnung nicht<br />
zu verlieren, dass Gott uns Menschen liebt –<br />
da ist mein Mut als Christin gefragt und herausgefordert.“<br />
Mechtild Sicking<br />
Pastoralreferentin, Heilig Kreuz Heek<br />
„Was ist Mut? Ich glaube, dass von mir in meiner<br />
privilegierten Stelle als Pastoralreferentin in<br />
Deutschland kein besonderer Mut gefordert ist.<br />
Vielleicht ecke ich mit meiner Meinung an,<br />
wenn ich absichtlich provoziere und zum Beispiel<br />
Traditionen in Frage stelle. Das ist in meinen<br />
Augen kein Mut. Mutig sind die Christen, die trotz<br />
massiver Christenverfolgung in ihrer Heimat ihrem<br />
Glauben treu bleiben. Mutig sind in meinen Augen<br />
aber auch die 14- bis 15-jährigen Firmbewerberinnen<br />
und -bewerber, die sich entgegen dem<br />
Trend entscheiden, die Firmvorbereitung ernst<br />
zu nehmen und regelmäßig teilnehmen, sogar<br />
Gottesdienste vorbereiten und besuchen. Sie<br />
nehmen dafür mutig den Spott ihrer Mitschülerinnen<br />
und Mitschüler in Kauf.“<br />
Tobias Busche<br />
Pastoralreferent, St. Martinus Greven<br />
„Ich bin überzeugt, dass jede und jeder einzelne<br />
von uns – egal ob Christin oder Christ oder nicht –<br />
gefragt ist, wenn Menschen anderen Menschen<br />
das Recht auf ein gleichberechtigtes, würdiges<br />
Leben aberkennen. Sei es aufgrund von Herkunft,<br />
Geschlecht, Sexualität, Religiosität oder politischer<br />
Gesinnung. Ich glaube fest, dass alle Menschen<br />
Kinder Gottes sind und entsprechend behandelt<br />
werden müssen. Dafür nicht nur in Gesellschaft,<br />
sondern auch im kirchlichen System einzustehen,<br />
kann Mut erfordern.“<br />
22 23
Nachgefragt<br />
Sabine Grimpe<br />
Pastoralreferentin, St. Jakobus Ennigerloh<br />
„Mut zeigen heißt, zu meinen Überzeugungen<br />
stehen, wenn Angehörige im Trauergespräch<br />
signalisieren, dass sie keine persönlichen Worte<br />
und kein Glaubenszeugnis für notwendig erachten.<br />
Mir ist es ein Anliegen, von meiner Hoffnung zu<br />
sprechen, die ich im Herzen spüre.“<br />
Ulla Büssing-Markert<br />
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Coesfeld<br />
und Pastoralreferentin, St. Laurentius Senden<br />
„Mut braucht es, in Gesprächen mit existenziellen<br />
und zutiefst menschlichen Fragen und Themen<br />
nicht auszuweichen, sondern sich selbst<br />
behutsam anzubieten.“<br />
Peter Fendel<br />
Pastoralreferent, St. Peter Duisburg-Rheinhausen<br />
„Mut ist gefragt, wenn ich als Christ aus meiner<br />
Komfortzone ausbreche. Wenn ich herrschende<br />
Logiken und Plausibilitäten in Kirche und Welt<br />
durchbreche. Wenn ich Mechanismen der Macht,<br />
der Abwertung und Ausgrenzung unterbreche.<br />
Wenn ich zu neuen Wegen aufbreche.“<br />
Florian Kübber<br />
Lehrer, Erich-Klausener-Schule, Herten<br />
„Mein Mut als Christ ist gefragt, wenn ich mich<br />
noch mehr für sozial schwächere, unterdrückte<br />
oder verfolgte Menschen einsetze und dabei auch<br />
meine eigenen Interessen zurückstelle – auch wenn<br />
es Kompromisse oder persönliche Einschränkungen<br />
bedeutet. Aufeinander zugehen (was manchmal<br />
schwerfällt), Hemmschwellen abbauen und überwinden<br />
bedeutet Mut, ebenso das Einlassen auf<br />
fremde und unbekannte Kulturen. Dieser Mut kann<br />
aber auch das eigene Leben sehr bereichern, wie<br />
ich in vielen Situation im Schulalltag mit meinen<br />
internationalen Schülern feststellen darf.“<br />
24 25
Interview<br />
„ZEIT, MUTIG ZU SEIN!“<br />
Maria Bubenitschek leitet seit dem 1. Februar<br />
die Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen<br />
Generalvikariat. Wie die erste Hauptabteilungsleiterin<br />
im Bistum Münster die Corona-Krise<br />
erlebt, welchen Herausforderungen sie sich mutig<br />
stellen möchte und warum sie Pippi Langstrumpf<br />
für eine besondere junge Frau hält, darüber<br />
hat sie mit Stephan Kronenburg für den<br />
<strong>Liudger</strong> gesprochen.<br />
Frau Bubenitschek, die Corona-Krise hat vieles<br />
auf den Kopf gestellt. Wird die Krise mittelfristig<br />
Auswirkungen auf die Seelsorge im Bistum<br />
Münster haben?<br />
Bubenitschek: Das hat sie nach meiner Einschätzung<br />
auf jeden Fall. Positiv betrifft das vor allem<br />
die Art und Weise der Kommunikation und der<br />
Vernetzung. Es gibt jetzt Vernetzungen, die vor der<br />
Krise undenkbar gewesen wären: Das wird bleiben.<br />
Negativ ist, dass es jetzt eine große Vorsicht im<br />
Umgang miteinander gibt.<br />
Die Krise kann uns zudem sehr deutlich vor Augen<br />
führen: Was wird vermisst in dieser Zeit? Auch<br />
an Angeboten, die wir ansonsten mit scheinbarer<br />
Selbstverständlichkeit machen. Und was bedeutet<br />
das für die Zukunft? Positiv gewendet: Wo können<br />
wir künftig als Hauptabteilung wirklich hilfreich sein<br />
für Pfarreien und Einrichtungen?<br />
Aktuell machen wir uns viele Gedanken über die<br />
‚Nach-Corona-Zeit‘. Aus meiner Sicht kann nach<br />
der Corona-Krise die Pastoral nicht einfach wieder<br />
hochgefahren werden. Es wird nicht alles so sein<br />
wie früher, also wie vorher. Ich denke, das würde<br />
nicht funktionieren und wäre nicht gut.<br />
Meine Wahrnehmung ist die, dass es in der Krise<br />
sehr viele kreative seelsorgliche Angebote gibt.<br />
Nehme ich diese im Alltag ansonsten einfach<br />
nicht so wahr, oder ist es schon so, dass die Krise<br />
zeigt, dass viel mehr Potenzial da ist, als das im<br />
Alltag oft scheint?<br />
Bubenitschek: Da gilt sicher beides. Ich glaube in<br />
der Tat, dass man im Alltag – und damit bezeichnen<br />
wir ja jetzt die „Vor-Corona-Zeit“ – manches nicht<br />
wahrnimmt. Und ich bin auch davon überzeugt,<br />
dass Menschen nun auf eine Art und Weise kreativ<br />
werden, die vorher so nicht gefragt war. Wir erleben<br />
eine besondere Zeit, die besondere Kräfte<br />
und Charismen fordert und freisetzt. Das sieht man<br />
etwa daran, wie leicht und kurzfristig in der Krise<br />
Vernetzungen möglich sind. Videokonferenzen<br />
schienen noch vor kurzem kaum möglich, nun<br />
bestimmen sie plötzlich den Alltag von vielen,<br />
und es funktioniert.<br />
Die Krise stellt uns alle, Sie haben es angedeutet,<br />
vor neue Herausforderungen. Würden Sie von<br />
sich selbst – auch in einer derart besonderen Situation<br />
– sagen, dass Sie ein mutiger Mensch sind<br />
und wenn ja, wo verlässt Sie dann doch der Mut?<br />
Bubenitschek: Grundsätzlich bin ich ein mutiger<br />
Mensch. Als ich die Leitung der Hauptabteilung<br />
Seelsorge übernahm, bekam ich von meiner<br />
Familie verschiedene Postkarten geschenkt. Auf<br />
einer steht, und die hängt in meinem Büro auf<br />
Augenhöhe: „Zeit, mutig zu sein!“ Ich finde, dass<br />
besonders in dieser Zeit Mut gefragt ist. Wir sollten<br />
den Mut haben, neue Wege in der Pastoral zu<br />
gehen. Das ist jetzt dran.<br />
Was mich in der Krise ohnmächtig stimmt und<br />
traurig macht, ist die Tatsache, dass in meinem<br />
persönlichen Bekanntenkreis die existenzielle Situation<br />
von vielen auf Messers Schneide steht. Das<br />
lässt mich fast verzweifeln und macht mich sehr<br />
betroffen.<br />
Ohnmächtig bin ich angesichts der Gewalt, die in<br />
Familien zunimmt, die auf engem Raum zusammenleben<br />
und sich nicht aus dem Weg gehen können,<br />
und auch angesichts der Situation vieler älterer<br />
Menschen, die sehr einsam sind.<br />
Sie nehmen an vielen Leitungssitzungen im<br />
Bistum Münster teil. Braucht es da manchmal<br />
Mut, das zu sagen, was Ihnen wichtig ist?<br />
Bubenitschek: Grundsätzlich versuche ich auch<br />
hier immer authentisch und ehrlich zu sein. Vielleicht<br />
ist das manchmal ein bisschen unbequem.<br />
Für mich heißt das aber, Position zu beziehen und<br />
für das einzustehen, was mir wichtig ist. Das tue<br />
ich und versuche, es strategisch klug zu tun, gerne<br />
und hoffentlich nett und charmant, aber bestimmt<br />
in der Sache. So erscheint es mir etwa unerlässlich,<br />
dass wir im Generalvikariat stärker querschnittsmäßig<br />
denken und arbeiten. Wir müssen raus aus<br />
der Versäulung. Das erfordert Mut, Mut zur Veränderung.<br />
Ich glaube, dass wir vor einem Change-<br />
Prozess stehen beziehungsweise schon mitten in<br />
diesem drin sind. In einem solchen Prozess ist<br />
Mut gefragt. Denn wir müssen bereit sein, manches<br />
aufzugeben, was vielleicht lange galt. Zugleich<br />
müssen wir offen sein für Neues. Ich sehe es<br />
dabei für mich als großes Glück an, dass ich<br />
noch relativ neu im Bistum und noch neuer in<br />
der Hauptabteilung Seelsorge bin. Deshalb bin<br />
ich nicht so verwoben mit alten Strukturen.<br />
Apropos Hauptabteilung Seelsorge. Seit dem<br />
1. Februar leiten Sie diese. Mussten Sie sich selbst<br />
Mut machen, um diese Aufgabe zu übernehmen?<br />
Bubenitschek: Ja, das war eine mutige Entscheidung.<br />
Mich reizte die Aufgabe von Anfang an; von<br />
daher war mir schnell klar, dass ich ‚Ja‘ sage, als der<br />
Bischof und der Generalvikar mich gefragt haben.<br />
Mut und Lust hängen bei dieser Aufgabe für mich<br />
eng miteinander zusammen. Mut braucht es, weil<br />
klar ist: Es stehen deutliche Veränderungen an, und<br />
als Hauptabteilungsleiterin werde ich diese Veränderungen<br />
mitgestalten. Diese Herausforderung<br />
nehme ich gerne lustvoll an.<br />
26 27
Interview<br />
Woran liegt es, dass unser Blick auf Frauen in<br />
solchen Führungspositionen oft ein anderer ist<br />
als der auf Männer?<br />
Bubenitschek: Wenn ich ein Mann wäre, hätten<br />
Sie mir die Frage natürlich so nicht gestellt. Das<br />
liegt vielleicht daran, dass Frauen in solchen<br />
Positionen leider noch immer etwas exotisch<br />
wirken oder wahrgenommen werden. In meiner<br />
Berufsbiografie bin ich oft die erste oder die einzige<br />
Frau gewesen, die eine bestimmte Aufgabe<br />
übernommen hat. Und jetzt bin ich eben die erste<br />
Hauptabteilungsleiterin. Die Herausforderung<br />
ist da, unabhängig davon, ob eine Frau oder ein<br />
Mann die Leitung inne hat.<br />
Warum gelingt es aber der Kirche nicht, mehr mutige<br />
Frauen für Führungspositionen zu gewinnen?<br />
Bubenitschek: Was ich fatal fände, wäre, wenn<br />
man Frauen nur deshalb für Führungspositionen<br />
aussucht, weil sie Frauen sind. Es muss um Qualifikation<br />
gehen. Daher bin ich auch gegen eine<br />
Quote und damit gegen Quotenfrauen. Vielleicht<br />
hat die geringe Präsens von Frauen in Führungspositionen<br />
mit damit zu tun, dass sich manche<br />
Frauen Führung und Leitung nicht zutrauen<br />
oder sich für Positionen und Aufgaben für nicht<br />
geeignet halten. Bei mir war das schon immer<br />
anders. Schon in meiner Schulzeit – ich habe auf<br />
einem Mädchengymnasium Abitur gemacht –<br />
hatte ich die Wahrnehmung, dass Mädchen die<br />
Welt offen steht. Ich hatte viele Mitschülerinnen,<br />
die in Fächern wie Mathematik oder Physik, die<br />
jungendominiert sind, tolle Leistungen erbracht<br />
haben. Ich selbst habe dann Religionspädagogik<br />
studiert und mich damit auf den Weg gemacht<br />
zu einem Arbeitgeber, der männerdominiert ist.<br />
Für mich habe ich das immer als Herausforderung<br />
und damit als Chance gesehen, mich als Frau<br />
einzubringen und zu zeigen, welche Möglichkeiten<br />
Frauen in dieser Kirche haben.<br />
Sie haben in Ihrer neuen Position viele Möglichkeiten,<br />
Dinge insbesondere in der Pastoral zu<br />
verändern und neu anzugehen. Sind Sie mutig<br />
genug, sich der Wirklichkeit tatsächlich und<br />
ungeschminkt zu stellen und grundlegende<br />
Veränderungen anzustoßen?<br />
Bubenitschek: Ich habe den Mut dazu. Und ich ermutige<br />
die Mitarbeitenden in der Hauptabteilung<br />
Seelsorge, unkonventionell<br />
zu denken und<br />
alte Zöpfe abzuschneiden.<br />
Wir müssen sehr<br />
genau schauen, was<br />
läuft gut und was nicht.<br />
Dann müssen wir<br />
mutig genug sein, zu<br />
sagen: Das machen wir<br />
nicht mehr. Das gilt in<br />
gleicher Weise für die<br />
Seelsorge vor Ort.<br />
Mit einem Gottesdienst auf Instagram hat<br />
Pastor Christian Olding aus Geldern die<br />
Online-Gemeinde auf Ostern eingestimmt.<br />
Ein Beispiel von vor Ort. In Münster werden an<br />
einem normalen Wochenende 90 Vorabendmessen<br />
und Messen am Sonntag gefeiert.<br />
Das klingt jetzt noch nicht nach einer<br />
grundlegenden Veränderung.<br />
Bubenitschek: Zum einen ist das in Münster sicher<br />
noch einmal anders als vielleicht in einem kleinen<br />
Ort am Niederrhein. Im Bistum Aachen, in dem<br />
ich 28 Jahre gearbeitet habe, sind die pastoralen<br />
Bedingungen und Eucharistieangebote schon lange<br />
völlig anders. Ich habe in einem Pastoralteam mit<br />
‚zweieinhalb Priestern‘ gearbeitet – einer von dreien<br />
war krank, daher ‚zweieinhalb‘ – und wir waren für<br />
zwölf Kirchengemeinden zuständig. Da war nur alle<br />
drei Wochen in jeder Pfarrkirche eine Eucharistiefeier<br />
möglich. In der Zeit „dazwischen“ waren<br />
Ehren- und Hauptamtliche dafür verantwortlich,<br />
Formen zu finden, in denen die Menschen Leben<br />
und Glauben feiern können.<br />
Auch im Bistum Münster wird sich sehr viel verändern.<br />
Hierzu wird auch die Corona-Krise beitragen,<br />
macht sie doch manches sehr offensichtlich. Es<br />
werden auf einmal Gottesdienste gefeiert, die fast<br />
an urchristliche Formen anknüpfen. Wenn wir das<br />
ernst nehmen, dann wird sich unser liturgisches<br />
Vollziehen verändern und verändern müssen.<br />
Von Münster einmal kurz der Blick in die Weltkirche:<br />
Welche Entscheidung des Papstes fänden<br />
Sie mutig?<br />
Bubenitschek: Ich fände es mutig, wenn die<br />
Verantwortung für die einzelnen Bistümer wirklich<br />
den jeweiligen Ortsbischöfen zugesprochen würde.<br />
Die Bischöfe hätten dann mehr Verantwortung<br />
für das, was sich gerade auch pastoral in ihren<br />
Bistümern entwickelt.<br />
Sie heißen mit Vornamen Maria. Inwieweit ist<br />
die Gottesmutter für Sie Vorbild … auch im Blick<br />
auf ein mutiges Verhalten?<br />
Bubenitschek: Ja, die ‚Magnificat Maria‘, die finde<br />
ich richtig klasse. Sie singt ein großes Loblied, auf<br />
den, der sich ihr und allen Machtlosen, Hungernden<br />
und Geringen zuwendet und der aufruft,<br />
die Mächtigen vom Thron zu stoßen. Was mich<br />
darüber hinaus an Maria beeindruckt, ist, dass<br />
sie „Ja“ gesagt hat und sich so auf etwas völlig<br />
Unvorstellbares wie das Gebären von Gottes Sohn<br />
eingelassen hat.<br />
Gegen Ende unseres Gesprächs würde ich Sie<br />
bitten, zu sagen, ob Sie bei den folgenden<br />
Ereignissen eher mutig oder ängstlich wären:<br />
Mit dem Fallschirm springen:<br />
Würde mich total reizen. Finde ich spannend.<br />
Heuschrecken in Mexiko essen:<br />
Da wäre ich eher ängstlich.<br />
„Maria 2.0 -Button“ im Bischöflichen Rat tragen:<br />
Würde ich tun.<br />
Live-Übertragung an Ostern aus dem fast menschenleeren Dom.<br />
Eingreifen, wenn Schwächere angegriffen werden:<br />
Habe ich schon gemacht.<br />
Radikal nachhaltig und klimabewusst leben:<br />
Da könnte ich noch mutiger sein.<br />
Und zum Schluss gebe ich Ihnen Halbsätze vor<br />
und bitte Sie, diese zu ergänzen:<br />
Wenn ich einmal all meinen Mut zusammennehme,<br />
dann würde ich etwas ganz Verrücktes<br />
tun, zum Beispiel einen Trip durch die Wüste.<br />
Wenn ich mutlos bin, dann hilft es mir,<br />
einen Milchkaffee zu trinken und mit<br />
jemandem zu sprechen.<br />
Die mutigste Frau in der Geschichte ist für mich<br />
eine erdachte, fiktive junge Frau oder besser ein<br />
Mädchen, nämlich Pippi Langstrumpf, weil sie<br />
völlig unkonventionell ist.<br />
Der mutigste Mann in der Geschichte ist für<br />
mich – neben Jesus – aufgrund seines gesamten<br />
Lebenszeugnisses Mahatma Gandhi.<br />
28 29
Schule mit Courage<br />
IM EINSATZ<br />
FÜR DEN<br />
NÄCHSTEN<br />
Tanja Lamsieh-Köhl<br />
ALEXANDRINE-HEGEMANN-BERUFSKOLLEG<br />
IST „SCHULE MIT COURAGE“<br />
Seit 2003 trägt das Alexandrine-Hegemann-Berufskolleg mit den Schwerpunkten Gesundheit und<br />
Soziales in Recklinghausen das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Was das für die<br />
Schulgemeinschaft bedeutet, wie aus Worten Taten werden und was das alles mit Mut zu tun hat,<br />
erläutert Tanja Lamsieh-Köhl im Interview mit Michaela Kiepe. Sie betreut, zusammen mit zwei<br />
Kolleginnen, das Projekt in dem Berufskolleg des Bistums Münster.<br />
Braucht es in der heutigen Zeit Mut, sich zu engagieren?<br />
Lamsieh-Köhl: Mut ist insofern erforderlich, als dass es insbesondere in diesen Zeiten gilt, rechtsextreme<br />
Hetze zu durchbrechen und sich populistischen Aussagen entgegen zu stellen. Sie fließen wie ein schleichendes<br />
Gift in die Köpfe der Menschen. Mut ist erforderlich, um nein zu sagen, wenn Vorurteile geschürt<br />
werden, und Mut ist auch gefragt, um sich selbst kritisch zu hinterfragen. Es erfordert ebenso Mut, sich<br />
auf Menschen zuzubewegen, Kulturen kennenzulernen, die mir vielleicht fremd erscheinen, um am Ende<br />
festzustellen: „Alle Menschen sind gleich, wir sind alle auf der Suche nach Liebe, Sicherheit, Geborgenheit.“<br />
Als Lehrerin empfinde ich es als besondere Verantwortung, das kritische Denken der Schülerinnen und<br />
Schüler anzuregen und sie anzuhalten, beherzt und mutig gegen alle Formen von Rassismus und<br />
Diskriminierung einzutreten.<br />
Sie sind auch Schulseelsorgerin. Welche Rolle spielt im Kampf gegen den Rechtsextremismus<br />
die Schulpastoral?<br />
Lamsieh-Köhl: Schulpastoral will „helfen und heilen aus dem Glauben an den Gott des Lebens und seine in<br />
Jesus Christus offenbar gewordene Menschenfreundlichkeit. Menschen aller Altersstufen und Lebenslagen<br />
im Lebensraum Schule soll geholfen werden, die im christlichen Glauben liegenden Lebenschancen zu<br />
verstehen und zu ergreifen“. So umschreibt die Deutsche Bischofskonferenz allgemein einen Grundsatz<br />
der Schulpastoral.<br />
Was bedeutet das konkret für das Alexandrine-Hegemann-Berufskolleg?<br />
Lamsieh-Köhl: Auf unsere Schule bezogen bedeutet dies Parteinahme und Zuwendung für die Schwächeren<br />
der Schulgemeinde und Einsatz, aus einer christlichen Grundhaltung heraus, für die Schwachen und<br />
Benachteiligten dieser Welt. Konkretisiert beziehungsweise erweitert wird diese Haltung an unserer Schule<br />
durch die Projektarbeit im Rahmen der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Dieses Projekt hat<br />
viele Facetten.<br />
So pflegen wir seit 25 Jahren einen jüdischen Friedhof in Miroslav / Tschechien, gestalten das Schulleben aktiv<br />
durch sogenannte Zeitzeichen unter anderem zur Reichsprogromnacht, begehen mit der Schulgemeinde<br />
die Gedenkveranstaltung zum Holocaust Gedenktag, laden zu Gesprächen mit Zeitzeugen ein, organisieren<br />
Ausstellungen und Aktionen. Seit dem Schuljahr 2015 / 16 wird das Projekt durch das Projekt „Begegnungen“<br />
erweitert, das für und mit Flüchtlingen durch Schülerinnen und Schüler unserer Schule durchgeführt wird.<br />
Schülerinnen und Schüler des bischöflichen Alexandrine-Hegemann-Berufskolleg setzten sich dafür ein, dass die Familie ihrer<br />
Mitschülerin Milena Cela (Mitte) nicht abgeschoben wird. Sie durfte zwar bleiben, ihre Eltern und der jüngere Bruder mussten<br />
aber zurück in ihr Heimatland Albanien.<br />
Was verbirgt sich hinter dem Projekt?<br />
Lamsieh-Köhl: Die Flüchtlingsströme vor knapp fünf Jahren und das damit verbundene Schicksal der<br />
Betroffenen wirken auch in unsere Schulgemeinde hinein. So ist das Thema immer wieder präsent in<br />
Unterrichtsgesprächen, Atempausen und Pausengesprächen. Durch unseren Kontakt mit dem Sozialdienst<br />
katholischer Frauen (SkF) Recklinghausen entstand die Idee, Ressourcen unserer Schülerinnen und Schüler<br />
für Flüchtlingskinder zu nutzen und in Zusammenarbeit mit dem SkF Recklinghausen Angebote in der<br />
Flüchtlingsunterkunft an der Herner Straße einzurichten. Die Projektidee stieß auf großes Interesse in<br />
der Schülerschaft. Die Schülerinnen und Schüler besuchten zunächst die Unterkünfte und die Bewohner,<br />
entwickelten dann eigene Ideen für Angebote und führten diese in der Unterkunft eigenständig und in<br />
ihrer Freizeit durch.<br />
Wie sieht das konkret aus?<br />
Lamsieh-Köhl: Die Angebotspalette ist sehr vielfältig und reicht von Bewegungsangeboten über gestalterisches<br />
Arbeiten bis hin zur Hausaufgabenhilfe. Einige Schülerinnen und Schüler haben auch eine Patenschaft für ein<br />
Flüchtlingskind übernommen und verbringen mit diesem seine Freizeit, um eine Abwechslung vom tristen<br />
Alltag im Flüchtlingsheim zu schaffen und das neue Umfeld besser kennenzulernen.<br />
In unregelmäßigen Abständen finden Besprechungen zwischen dem SkF und unserer Schule statt. Außerdem<br />
nehmen unsere Schülerinnen und Schüler an Festen in der Unterkunft teil, gestalten dort das Rahmenprogramm<br />
mit oder zeigen Präsenz am Weltflüchtlingstag in Kooperation mit UNICEF. Integration bedeutet<br />
nachhaltiges Arbeiten. Daher wird das Projekt in den kommenden Schuljahren fortgesetzt und somit fester<br />
Bestandteil unserer Schulkultur. Das Engagement unserer Schülerschaft zeigte sich auch bei der drohenden<br />
Abschiebung einer Mitschülerin. Die Klassenkameraden starteten eine Petition, und die Schülerschaft<br />
sammelte in der Projektwoche Geld für die Familie, um die Anwaltskosten zum Teil zu decken.<br />
Was treibt Sie an?<br />
Lamsieh-Köhl: Den katholischen Schulen kommt eine besondere Verantwortung zu, das Gebot der<br />
Nächstenliebe praktisch umzusetzen, indem man sich um seine Nächsten kümmert, offen und tolerant<br />
durchs Leben geht und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, wo die Gesellschaft droht, auseinanderzudriften.<br />
Es bedarf mutiger Menschen, die sich einsetzen für die Schwächsten unserer Gesellschaft.<br />
Dies beweisen unsere SchülerInnen und Schüler an vielen Stellen durch ihr Engagement. Das macht mich<br />
stolz und treibt mich jeden Tag auf‘s Neue an.<br />
30 31
Lesetipps<br />
LESETIPPS!<br />
Die Kolleginnen der Fachstelle Büchereien kennen und empfehlen spannende Bücher, in denen es um Mut geht.<br />
Victor Dalmau , ein junger Medizinstudent, geht<br />
1938 in den Wirren des spanischen Bürgerkriegs an<br />
die Front, um die dortigen Ärzte zu unterstützen –<br />
auf Seiten der Revolutionäre, die gegen Franco<br />
kämpfen. Dort erwirbt er „Nervenstärke und<br />
medizinische Kenntnisse, die keine Universität der<br />
Welt ihm hätte vermitteln können“.<br />
Roser Bruguera ist eine junge Pianistin, die von<br />
Victors Bruder ein Kind erwartet. Der Bruder hat<br />
sich den Revolutionstruppen angeschlossen und<br />
gilt als verschollen. Victor will sich um Roser und<br />
das Kind kümmern, da er befürchtet, dass sein<br />
Bruder tot ist.<br />
Als sich der Sieg von Francos Truppen abzeichnet,<br />
fliehen beide auf unterschiedlichen Wegen nach<br />
Frankreich und sind nacheinander im Flüchtlingslager<br />
interniert. Über eine Schweizer Ärztin gelingt<br />
die Kontaktaufnahme.<br />
Victor bekommt auf dem Schiff, das Pablo Neruda<br />
mit finanzstarken Chilenen 1939 zur Rettung spanischer<br />
Flüchtlinge organisiert hat, einen Platz für<br />
Roser, ihren Säugling Marcel und sich selbst. Vorab<br />
muss geheiratet werden. Die Ehe gilt beiden als<br />
Zweckgemeinschaft, und so tritt die kleine Familie<br />
Allende, Isabel<br />
Dieser weite Weg<br />
die Überfahrt nach Chile an. Dort stellen sich neue<br />
Herausforderungen: die Arbeits- und Wohnungssuche<br />
als Flüchtlinge, das Ankommen in einer neuen<br />
Gesellschaft, deren Regeln man nicht kennt, und<br />
die Trauer um die Menschen in der alten Heimat<br />
und um die alte Heimat selbst.<br />
Weitere Umbrüche müssen bewältigt werden:<br />
Pinochets Militärdiktatur mit einem elfmonatigen<br />
Gefängnisaufenthalt Victors, ein Neuanfang in<br />
Venezuela für die mittlerweile 60-jährigen Eheleute<br />
und die Rückkehr nach Chile 1983.<br />
Wieviel Mut braucht es, sich solchen Brüchen<br />
im Leben immer wieder zu stellen und sie zu<br />
meistern? Woher nimmt man die Hoffnung,<br />
dass es dieses Mal besser enden wird? Einfache<br />
Antworten gibt es nicht, aber eine spannend<br />
erzählte Geschichte mit gut recherchierten<br />
geschichtlichen Hintergründen und dazu eine<br />
komplizierte Liebesgeschichte, die den Wandel<br />
von Gefühlen zulässt und aushält.<br />
ISBN 978-3-518-42880-1<br />
24 Euro<br />
Was hat Mut mit dem Bewahren von Geheimnissen<br />
zu tun? Eine ganze Menge! Denn: Darf<br />
man sich trauen, ein Geheimnis zu verraten? In<br />
dieser Zwickmühle steckt der kleine Ramin. Er soll<br />
seinem Kindergartenfreund nicht vorher sagen,<br />
welches Geburtstagsgeschenk er für ihn gekauft<br />
hat. „Ein Geheimnis darf man nicht verraten“, sagt<br />
seine Mama. Versprochen ist versprochen und<br />
wird nicht gebrochen. Das ist für Ramin ganz klar.<br />
Und damit fühlt er sich gut, denn er hat etwas<br />
Schönes für seinen Freund ausgesucht.<br />
Dann passiert am nächsten Tag aber etwas<br />
Dummes. Ein größerer Junge schießt beim Spiel<br />
den Fußball in eine Fensterscheibe, die zerbricht.<br />
Aber statt zum Nachbarn zu gehen und um Entschuldigung<br />
zu bitten, laufen er und seine Freunde<br />
weg – unter der Drohung, dass dieses Geheimnis<br />
nicht verraten werden darf, denn dann werde<br />
etwas ganz Schlimmes passieren.<br />
Ramin ist verunsichert, weil ihm dieses zweite<br />
Geheimnis irgendwie Angst macht. Seine Eltern<br />
fragen ihn danach, doch er verrät nichts. Seine<br />
Mama hat ja gesagt, dass Geheimnisse nicht<br />
verraten werden dürfen.<br />
Fabian, Clemens und Zels, Mirjam<br />
Soll ich es sagen?<br />
Eine Geschichte über Geheimnisse<br />
Zum Glück gibt es zwei Erwachsene, die ihm erklären,<br />
dass es gute und schlechte Geheimnisse<br />
gibt. Bei guten, wie dem Geschenk für seinen<br />
Freund, fühle man sich auch gut. Wenn man sich<br />
aber schlecht fühle, sei es ein schlechtes Geheimnis.<br />
Und das darf man mit jemandem teilen,<br />
wenn man unsicher ist. „Jeder Mensch sollte eine<br />
Person haben, der er solche Geheimnisse erzählen<br />
kann. Eine Person, der man alles anvertrauen kann“,<br />
sagt sein Onkel zu ihm. Ramin ist erleichtert, denn<br />
das ist bei ihm seine Mutter. Ihr kann er sich anvertrauen,<br />
und sie hört ihm zu.<br />
Eine Geschichte für kleinere Kinder, die im<br />
weitesten Sinne helfen kann, Gut und Böse zu<br />
unterscheiden und Hilfe in schwierigen Situationen<br />
zu geben. Gut einsetzbar ist sie auch in der Präventionsarbeit.<br />
ISBN 978-3-944442-78-5<br />
16 Euro<br />
32 33
Lesetipps<br />
Ironmonger, John<br />
Der Wal und das Ende der Welt<br />
Roman<br />
Kinnear, Nicola<br />
Henri, der mutige<br />
Angsthase<br />
St. Piran ist ein kleines Fischerdorf irgendwo an<br />
der englischen Küste in Cornwall. Es liegt sehr<br />
idyllisch und abgeschieden am Ende einer Landspitze,<br />
erreichbar nur über eine einzige Straße.<br />
Hier geschehen ungewöhnliche Dinge: Ein<br />
großer Wal wird nah am Strand gesichtet, gleichzeitig<br />
wird ein junger Mann entdeckt, den das<br />
Meer angespült hat. Er ist nicht tot und wird von<br />
der Dorfgemeinschaft liebevoll aufgenommen und<br />
aufgepäppelt. Nach und nach wird klar, wie er in<br />
diese Situation gekommen ist. Joe Haak war<br />
Mitarbeiter einer großen Bank in London und<br />
dort an der Programmierung eines Computerprogramms,<br />
Cassie, beteiligt, das für Börsenspekulationen<br />
Preisbewegungen der weltweiten<br />
Märkte für einige Dutzend Stunden im voraus<br />
vorhersagen konnte.<br />
Als sich Cassie allerdings verrechnet und in<br />
der Bank falsche Entscheidungen getroffen<br />
werden, droht das ganze wirtschaftliche System<br />
zu kollabieren. Joe weiß durch seinen Job, wie<br />
instabil unsere Gesellschaft durch ihre Komplexität<br />
ist. Er gibt in London fluchtartig alles auf und<br />
landet durch glückliche Umstände in dem kleinen<br />
Fischerdorf.<br />
Er gibt alles dafür, St. Piran und seine Bevölkerung<br />
in den Zeiten der Ungewissheit zu schützen.<br />
Durch die Abgeschiedenheit des Dorfes bleibt es<br />
tatsächlich von den extremen Auswirkungen der<br />
gesellschaftlichen Krise relativ verschont.<br />
Eine berührende Geschichte mit vielen interessanten<br />
und liebevoll beschriebenen Charakteren.<br />
Eine Geschichte, die Mut macht, weil sie<br />
an das Gute im Menschen glauben lässt. Und<br />
eine Geschichte, die derzeit an Aktualität nicht<br />
zu überbieten ist.<br />
Und was wird aus dem Wal? Nun, er hat Joe<br />
gerettet, strandet selbst und wird auf Initiative von<br />
Joe in einem Gemeinschaftsakt vom ganzen Dorf<br />
gerettet. Am Ende trägt er dazu bei, dass es allen<br />
gut geht.<br />
ISBN 978-3-10-397427-0<br />
22 Euro<br />
Die Hasen Henri und Luna sind dicke Freunde,<br />
aber ganz unterschiedliche Charaktere. Luna ist<br />
eine Draufgängerin, die immer etwas erleben und<br />
deshalb nach draußen will. Henri dagegen ist ein<br />
echter Höhlenhocker, der am liebsten auf seinem<br />
Lieblingssessel sitzt und zu Hause bleibt. Luna<br />
fordert ihn zu allem Möglichen auf, aber ihm ist<br />
das alles zu gefährlich.<br />
Sie beschimpft ihn als Angsthasen und verlässt<br />
wutentbrannt die gemeinsame Höhle. Und weil<br />
er sie vermisst und sich unbedingt wieder mit ihr<br />
vertragen will, muss er wohl oder übel nach draußen.<br />
Er traut sich wirklich und präpariert sich für<br />
alle Fälle mit Taucherbrille, Taschenlampe, Schal<br />
und Keksen. Er trifft draußen im Wald viele andere<br />
Tiere, die er nach Luna fragt. Sie ist anscheinend<br />
als die mutigste Häsin der Welt bekannt, denn<br />
sie taucht im Fluss, reitet auf einem Hirsch oder<br />
erforscht dunkle Höhlen.<br />
Wenn Henri sie finden will, muss er sich überwinden<br />
und das Gleiche tun. Und dann entdeckt<br />
er sie tatsächlich, allerdings in einer Notsituation,<br />
bedroht von einem bösen Wolf. Natürlich kann<br />
er sie retten! Und will erstmal nicht nach Hause,<br />
sondern noch mehr Abenteuer erleben.<br />
Eine schön illustrierte und spannende<br />
Geschichte über einen kleinen ängstlichen<br />
Hasen, der über sich hinaus wächst und zum<br />
Helden wird. Für Kinder ab vier Jahren.<br />
ISBN 978-3-7891-1054-2<br />
14 Euro<br />
34 35
Es ist die Zeit zu beten,<br />
egal zu wem, und wie.<br />
Es ist die Zeit zu hoffen,<br />
der Glaube an Magie,<br />
die Gutheit überträgt,<br />
wenn wir zusammen stehen,<br />
macht Hoffnung,<br />
man muss aufrecht gehen.<br />
Wer das in diesen Zeiten nicht,<br />
versteht und registriert,<br />
hat Weisheit nicht, kein Hoffnungslicht.<br />
Es ist so spät,<br />
kapiert doch alle,<br />
die schöne Welt steht dort,<br />
wo Leben und der Tod nun trennt,<br />
jetzt braucht es uns,<br />
in einem fort.<br />
Wir haben viel zu lang gepennt.<br />
Schürt keinen Hass,<br />
und habt euch lieb,<br />
auch wenn es schwierig wird.<br />
Auf Tag folgt Nacht.<br />
Der Tod kommt immer wie ein Dieb,<br />
in ach so viele Häuser.<br />
Die sind bekannt und unbekannt.<br />
Wer kennt und weiß,<br />
um all die Namen.<br />
Wenn jetzt nicht „Friede“ Sieger ist,<br />
dann gute Nacht und Amen.<br />
Von Theo Gertsen<br />
(Mitarbeiter Zentralrendantur Emmerich-Kleve)