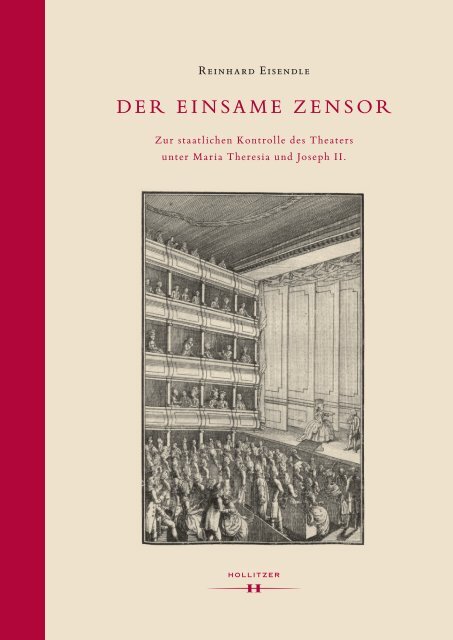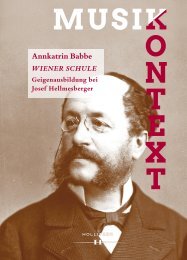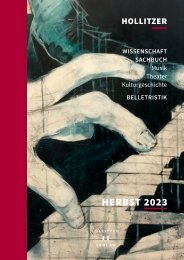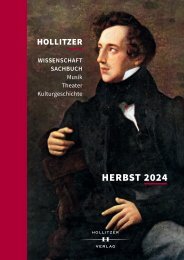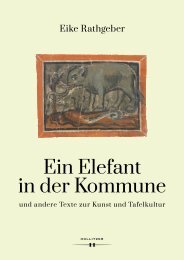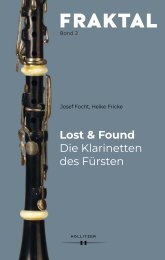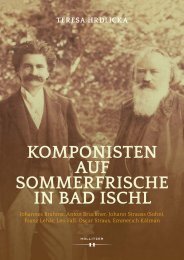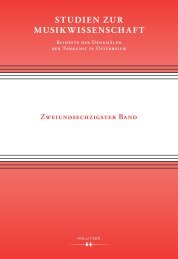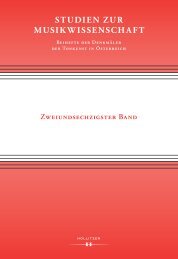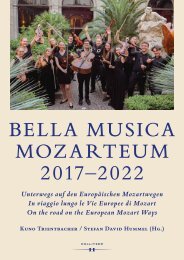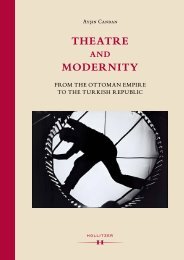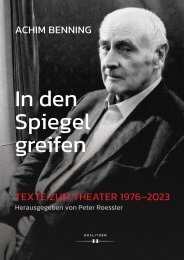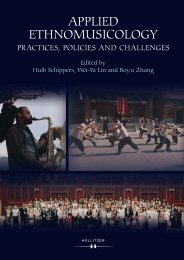Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
R einhard Eisendle<br />
DER EINSAME ZENSOR<br />
Zur staatlichen Kontrolle des Theaters<br />
unter Maria Theresia und Joseph II.
DON JUAN ARCHIV WIEN<br />
SPECULA SPECTACULA<br />
8<br />
Reihe herausgegeben von<br />
Michael Hüttler<br />
Matthias Johannes Pernerstorfer<br />
Hans Ernst Weidinger
Reinhard Eisendle<br />
DER EINSAME ZENSOR<br />
Zur staatlichen Kontrolle des Theaters<br />
unter Maria Theresia und Joseph II.
Publiziert mit freundlicher Unterstützung durch:<br />
Don Juan Archiv Wien – Forschungsverein für Theater- und Kulturgeschichte<br />
Gefördert von der Kulturabteilung der Stadt Wien,<br />
Wissenschafts- und Forschungsförderung<br />
Kultur<br />
Reinhard Eisendle:<br />
<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> <strong>Zensor</strong>.<br />
Zur staatlichen Kontrolle des Theaters unter Maria Theresia und Joseph II.<br />
Wien: HOLLITZER Verlag 2020<br />
(= Specula Spectacula 8)<br />
Titelbild:<br />
Allegorischer Kupferstich aus Bildergalerie weltlicher Misbräuche:<br />
ein Gegenstück zur Bildergalerie katholischer und klösterlicher Misbräuche.<br />
Von Pater Hilarion, Erzkapuzinern [= Joseph Richter].<br />
Frankfurt und Leipzig [= Wien] 1785, Neunzehntes Kapitel:<br />
Uiber öffentliche Schauspiele, S. 248.<br />
Österreichische Nationalbibliothek,<br />
Sammlung von Handschriften und alten Drucken,<br />
Signatur: 59426-A.3<br />
Marion Linhardt (Lektorat)<br />
Gabriel Fischer (Layout)<br />
© HOLLITZER Verlag, Wien 2020<br />
HOLLITZER Verlag<br />
der HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH<br />
www.hollitzer.at<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
ISSN 2616-9037<br />
ISBN 978-3-99012-586-1
Dem Gedenken an Alison J. Dunlop<br />
(1985–2013)
INHALT<br />
EINLEITUNG<br />
3<br />
6<br />
17<br />
17<br />
18<br />
19<br />
21<br />
22<br />
Einleitung<br />
Zum Begriff „Zensur“<br />
Zur Gliederung der Studie<br />
Die Formierung der Theatralzensur<br />
Instruktionen. Zur paradoxalen Logik von Theatralzensur<br />
Kultureller Stau gegen Ende der theresianischen Zeit<br />
Theatralzensur unter Joseph II.<br />
Die Zensurreform in der frühen theresianischen Zeit 1748–1759<br />
DIE FORMIERUNG DER THEATRALZENSUR<br />
27<br />
28<br />
30<br />
33<br />
34<br />
35<br />
37<br />
39<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
49<br />
51<br />
52<br />
56<br />
59<br />
60<br />
62<br />
Zensur, Geschmack, Sitte<br />
Verehrer des guten Geschmacks und der guten Sitten<br />
<strong>Der</strong> gute Geschmack als Verbindung des „Angenehmen“<br />
mit dem „Nützlichen“<br />
Schauspielkunst als Gelehrsamkeit<br />
Das Theater als ideales Medium der Sittenlehre<br />
Bernardon und die lasterhaften Bürger<br />
Soziale und ökonomische Strategien kultureller Diffusion<br />
Zur geeigneten Aufsicht über das Theater<br />
Theater und Polizeywissenschaft<br />
Das gemeinschaftliche Beste<br />
Bildung und Wissenschaft<br />
In der dunklen Kammer.<br />
Religion als gesellschaftliche Steuerungsinstanz<br />
Politischer Katechismus<br />
Ergötzungen als instrumentalisiertes Medium<br />
Das Trauerspiel im Brennspiegel des Kameralismus<br />
Abschaffung des extemporierten Spiels<br />
Frühkameralistische Betrachtungen zur Funktion des Theaters<br />
Zensur der Bücher: eine defensive Strategie<br />
<strong>Der</strong> Kameralist als Objekt der Zensur
67<br />
70<br />
71<br />
75<br />
82<br />
84<br />
86<br />
88<br />
93<br />
101<br />
107<br />
107<br />
111<br />
115<br />
122<br />
128<br />
135<br />
138<br />
143<br />
143<br />
148<br />
154<br />
160<br />
162<br />
166<br />
173<br />
Diskurs und Theatralität.<br />
Strategische Dramaturgie im Mann ohne Vorurteil des Joseph von Sonnenfels<br />
Anstößigkeit der himmlischen Polizey<br />
„Leserbriefe“<br />
Adel im Visier<br />
Pose der Distanz<br />
Ist das Theater als Sittenschule eine Grille?<br />
Drei Schritte zurück: die „gesittete“ Schaubühne<br />
Zensurale Analyse: vom Zweideutigen zum Eindeutigen<br />
Das Eine Wort.<br />
Zur Unsittlichkeit der extemporierten Bühne<br />
Grande Finale. Theater als Schule der Sitten<br />
Das Theatralzensur-Dekret des Jahres 1770<br />
Das Theater nächst dem Kärntnerthor als „regelmäßige“ deutsche Bühne<br />
Rückkehr des Kurz-Bernardon<br />
Wien als „Zufluchtsort der Unanständigkeit“.<br />
Zum letzten Kampf gegen das extemporierte Theater<br />
Einer Haupt- und Residenzstadt würdige Stücke.<br />
Das Dekret Josephs II.<br />
Eine mißachtete allerhöchste Weisung?<br />
Zwei Schreiben Maria Theresias zur Untersagung der Bernardoniaden<br />
Jenseits der Residenz?<br />
Scheitern der Ausdehnung des Extemporierverbots<br />
Resümee<br />
Sonnenfels’ rascher Abgang.<br />
Neubesetzung der Theatralzensur<br />
<strong>Der</strong> mächtigste Mann im Theaterwesen?<br />
Theatralzensor Sonnenfels<br />
Abgang im Zeichen struktureller Konflikte<br />
Ästhetik des Witwenschleiers<br />
Franz Karl Hägelin<br />
Agent der Schulreform<br />
<strong>Der</strong> Weg in die Theatralzensur<br />
<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> <strong>Zensor</strong>
INSTRUKTIONEN.<br />
ZUR PARADOXALEN LOGIK VON THEATRALZENSUR<br />
181<br />
183<br />
190<br />
191<br />
193<br />
197<br />
202<br />
211<br />
214<br />
218<br />
225<br />
231<br />
234<br />
238<br />
241<br />
241<br />
250<br />
250<br />
254<br />
258<br />
259<br />
260<br />
262<br />
263<br />
263<br />
265<br />
267<br />
273<br />
274<br />
276<br />
Die Entblößung des <strong>Zensor</strong>s.<br />
Franz Karl Hägelins „Denkschrift“ zur Theatralzensur<br />
Die Entstehungsgeschichte von Hägelins Vademecum<br />
Das Theater als Schule der Zensur<br />
Hauptregel: Theater als Schule der Sitten und des Geschmacks<br />
Stoff und Moral<br />
Gebrechen des Stoffes in Absicht auf die Sitten<br />
Gebrechen des Stoffes in politischer Hinsicht oder wider den Staat<br />
Selbstmord auf der Bühne<br />
Gebrechen des Stoffes wider die Religion<br />
Gebrechen des Dialogs.<br />
Zur ,magischen‘ Transponibilität zensurieller Logik<br />
Bemerkungen für die jetzigen Zeitumstände<br />
„Epikureismus“<br />
Blumen des Bösen<br />
Kurzer Epilog<br />
Im Spiegel der Zensur.<br />
Zur Begutachtungspraxis am Burgtheater im Jahre 1779<br />
Dramatische Censoren<br />
Verstöße wider die Sitten<br />
Tugendspiegel im Bordell<br />
Die bestrafte Brutalität<br />
Die abscheulichste Kreatur<br />
Empfindsamkeit und Frivolität<br />
Illegitime Schwangerschaft<br />
Viehische Brunst<br />
Verstöße wider den Staat<br />
<strong>Der</strong> weibische König<br />
Shakespear’scher Geschmack<br />
Nicht mehr als sechs Schüsseln, oder die Welt auf dem Monde<br />
Politische Anspielungen<br />
Verstöße wider die Religion<br />
Die Neuheit des Stoffes
KULTURELLER STAU GEGEN ENDE DER THERESIANISCHEN ZEIT<br />
281<br />
283<br />
284<br />
287<br />
293<br />
298<br />
302<br />
306<br />
310<br />
312<br />
317<br />
321<br />
331<br />
331<br />
339<br />
343<br />
345<br />
348<br />
352<br />
357<br />
Neue verbotene Dramen<br />
Dramen im Katalog verbotener Bücher: gedruckt vor 1770<br />
Dramen im Katalog verbotener Bücher: 1770–1776<br />
Dramen im Katalog verbotener Bücher: 1777–1780<br />
Eulalia.<br />
Märtyrerin am Hofe<br />
Düval und Charmille.<br />
Tödliche Triangulation<br />
Lina von Waller.<br />
Virtualität und Ehebruch<br />
Jenny.<br />
Empfindsamkeit und Destruktion<br />
Ottilie.<br />
<strong>Der</strong> zensurierte <strong>Zensor</strong>?<br />
Hofbäcker, Gift überzuckernd.<br />
Paul Weidmanns Komödie <strong>Der</strong> Mißbrauch der Gewalt<br />
Obszönität der Unschuld.<br />
„Hohes“ Unverständnis gegenüber einem allerhöchsten Verbot<br />
Anhang<br />
Liste der verbotenen Schauspieldrucke bis 1770 im<br />
Catalogus librorum a commissione caes. reg. Aulica prohibitorum 1776<br />
„Erkünstelt Gefahr“.<br />
Zensur im öffentlichen Diskurs<br />
Ueber den Buchhandel in den kaiserl. königl. Erblanden.<br />
Vorschläge zur Reform des Zensursystems<br />
„Die höchst nachtheiligen Veranstaltungen der Censur,<br />
die gemeiniglich in Schikanen ausarten“<br />
Das Verbot der Allgemeinen deutschen Bibliothek<br />
Summarische Antwort.<br />
Eine Verteidigung der theresianischen Zensur<br />
Ode zum Lobe der Bücherzensur.<br />
Enigmatischer Hymnus als öffentlicher Widerstand<br />
Streitsache zwischen dem Passauer Ordinariate, und dem Exjesuiten Heinze<br />
<strong>Der</strong> deutsche Satyriker vor der lateinischen Inquisizion.<br />
Wenzel Sigmund Heinzes Zensurverhandlung als dramatischer Stoff
366<br />
370<br />
„Odiosa aus meinem Geblüt und Hertzen wegwaschen“.<br />
Ein Brief Hägelins aus dem Jahre 1780<br />
Kurzer Epilog.<br />
Hägelin Befürworter der Aufhebung des Verbots der<br />
Allgemeinen deutschen Bibliothek zu Beginn der Alleinregierung Josephs II.<br />
THEATRALZENSUR UNTER JOSEPH II.<br />
373<br />
374<br />
381<br />
386<br />
390<br />
392<br />
397<br />
397<br />
403<br />
409<br />
414<br />
423<br />
429<br />
435<br />
437<br />
439<br />
441<br />
454<br />
458<br />
Josephinische Zensurreform<br />
„Grundregeln zur Bestimmung einer ordentlichen zukünftigen<br />
Bücher Censur“<br />
<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> josephinische Bücherzensor<br />
Irritationen.<br />
Das Lernen des <strong>Zensor</strong>s<br />
<strong>Der</strong> Fall Stahel.<br />
Soziopsychogramm der josephinischen Zensur<br />
„Non meretur“.<br />
Subtiler Widerstand des Zensurpräses<br />
„Man soll den <strong>Zensor</strong> nicht furchtsam machen“<br />
Zentralisierung der Theatralzensur?<br />
<strong>Der</strong> entrümpelte Index<br />
Hägelin – ein „josephinischer“ <strong>Zensor</strong><br />
„Etwas von der Zahlenlotterie“.<br />
<strong>Der</strong> erste josephinische Fall von Theatralzensur<br />
<strong>Der</strong> argwöhnische Ehemann.<br />
Kritik der Zensur als Lob des <strong>Zensor</strong>s<br />
Theater überall.<br />
„Censurirte Stücke“ von Baden bis Zistersdorf<br />
Vom Index auf die Bühne.<br />
Julius von Tarent am Wiener Nationaltheater<br />
Die Zwillinge<br />
Herrschaft am Ende<br />
„Klosteraufhebung“ im theatralen Raum<br />
Paradoxe Transformation archaischer Gewalt<br />
Prinz Seiden-Wurm der Reformator oder die Kron-Kompetenten
465<br />
467<br />
469<br />
472<br />
474<br />
476<br />
481<br />
483<br />
485<br />
486<br />
488<br />
489<br />
493<br />
497<br />
499<br />
503<br />
Figaro, oder das Spitzentuch der Königin<br />
Intervention Josephs II.<br />
Angebliche Anspielungen auf die französische Königin<br />
Die Patin und der Knabe<br />
Unfertige Bühnenfassung<br />
<strong>Der</strong> <strong>Zensor</strong> im Dialog. Szenario<br />
Kurzer Epilog.<br />
Die Wiener Erstaufführung von Beaumarchais’ Figaro unter Franz II.<br />
„Vernichtet sei das Gesetz.“<br />
Zur Zensur der vestalischen Dramen<br />
Die Neuen Vestallinnen.<br />
Ein Agitationsstück<br />
Julus und Rhea.<br />
Geschlechtsakt in göttlicher Wolke<br />
<strong>Der</strong> Frömmler.<br />
Sexualität und Andacht<br />
Die Nonne, oder der ertappte Mönch.<br />
Die Geburt des Papstes als obszöner Traum<br />
Meine Grille von den katholischen Vestalinnen.<br />
Kritische Gedanken eines Zensuraktuars<br />
<strong>Der</strong> Baum der Diana<br />
Heilige Schleier im Staube.<br />
Das vestalische Thema auf dem Prager Tanztheater<br />
Die Sonnenjungfrau.<br />
Szenographie der Revolte<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
521<br />
521<br />
526<br />
530<br />
532<br />
Zusammenfassung<br />
Die Formierung der Theatralzensur<br />
Instruktionen.<br />
Zur paradoxalen Logik von Theatralzensur<br />
Kultureller Stau gegen Ende der theresianischen Zeit<br />
Theatralzensur unter Joseph II.
QUELLEN UND LITERATURVERZEICHNIS<br />
541<br />
541<br />
541<br />
542<br />
542<br />
542<br />
550<br />
555<br />
Archivquellen<br />
Österreichisches Staatsarchiv – Allgemeines Verwaltungsarchiv<br />
Österreichisches Staatsarchiv – Haus-, Hof- und Staatsarchiv<br />
Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von Handschriften<br />
und alten Drucken<br />
Wienbibliothek<br />
Dramen des 18. Jahrhunderts<br />
(Drucke und Handschriften in chronologischer Folge)<br />
Sonstige Druckschriften des 18. und frühen 19. Jahrhunderts<br />
(in chronologischer Folge)<br />
Forschungsliteratur des 19., 20. und 21. Jahrhunderts<br />
REGISTER<br />
571<br />
577<br />
583<br />
585<br />
587<br />
Personen<br />
Bühnenwerke, Oratorien, Instrumentalkomposition<br />
Drucke des 18. und frühen 19. Jahrhunderts<br />
ohne Berücksichtigung von Schauspiel- und Libretto-Drucken<br />
Ungedruckte Zensurschriften (in chronologischer Folge)<br />
Orte unter Berücksichtigung der Erscheinungsorte der Schauspieldrucke
DANK<br />
Die vorliegende Studie über die Theatralzensur zur Zeit Maria Theresias und<br />
Josephs II. fand wesentliche Anregung durch die Dissertation von Hans Ernst<br />
Weidinger: IL DISSOLUTO PUNITO. Untersuchungen zur äußeren und inneren<br />
Entstehungs geschichte von Lorenzo da Pontes & Wolfgang Amadeus Mozarts DON GIO-<br />
VANNI (Wien 2002). Diese Arbeit, welche die entscheidende Grundlage für eine<br />
neue Entstehungsgeschichte von Mozarts und Da Pontes Oper bildet, machte nicht<br />
zuletzt klar, dass etliche potentiell zensurrelevante Details dieser Geschichte kaum<br />
beantwortbar waren, weil eine systematische Analyse der Theatralzensur unter<br />
Joseph II. nicht existierte. Aus langjähriger Beschäftigung mit dem Thema erwuchs<br />
der Plan einer Dissertation, wofür ich ideale Bedingungen in einem Doktorandenkolleg<br />
der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF) der Universität<br />
Klagenfurt fand, die auch über Standorte in Wien und Graz verfügte.<br />
Wilhelm Berger und Gabriele Sorgo, Begutachter meiner Dissertation, sowie Werner<br />
Lenz, Leiter des Dissertantenkollegs, sei für die in hohem Maße ermunternde wie<br />
konstruktive Betreuung in allen Phasen meiner Arbeit herzlich gedankt. Besonderer<br />
Dank gilt meinen Kollegen vom Don Juan Archiv Wien: Hans Ernst Weidinger, der<br />
meine Arbeit von Anbeginn durch zahlreiche Gespräche begleitet hat, sowie Michael<br />
Hüttler, Tatjana Marković, Marcel L. Molnár, Matthias J. Pernerstorfer und Suna<br />
Suner, mit denen ich anregende Diskussionen zu einzelnen Aspekten führen konnte.<br />
Das Don Juan Archiv Wien hat es mir ermöglicht, meine Ansätze zur Zensur bei internationalen<br />
wissenschaftlichen Tagungen in Europa und Nordamerika zu präsentieren<br />
– für die bei diesen Anlässen geführten Gespräche danke ich im Besonderen<br />
Bruce Alan Brown (Los Angeles), Lisa De Alwis (Colorado), Ted Emery (Columbus/<br />
Ohio), Edmund Goehring (London/Ontario), Beatrix Müller-Kampel (Graz), John<br />
A. Rice (Princeton), Tomislav Volek (Prag) und Ian Woodfield (Belfast).<br />
Die Dissertation wurde unter dem Titel Zensur und kulturelle Dynamik. Zum Wandel<br />
der Theatralzensur unter Maria Theresia und Joseph II. im Jahre 2015 approbiert. Für die<br />
Aufnahme in die Reihe SPECULA SPECTACULA des Don Juan Archivs habe ich den<br />
Text überarbeitet wie auch einen neuen Titel gewählt, der spezifische Paradoxien der<br />
Theatralzensur zur Zeit Maria Theresias und Josephs II. auf den Punkt bringen soll:<br />
<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> <strong>Zensor</strong>. Zur staatlichen Kontrolle des Theaters unter Maria Theresia und<br />
Joseph II. Für die Fertigstellung dieses Bandes gilt mein herzlicher Dank den Reihenherausgebern<br />
Matthias J. Pernerstorfer und Hans Ernst Weidinger sowie Marion<br />
Linhardt, die meinen Text mit großer stilistischer Feinfühligkeit und fach licher<br />
Akkuratesse lektorierte.<br />
XV
Dank<br />
Die Arbeit an meiner Dissertation wurde von einem tragischen Ereignis überschattet:<br />
Alison J. Dunlop, Kollegin am Don Juan Archiv Wien und großartige Musikwissenschaftlerin,<br />
die ein Standardwerk über den Komponisten Gottlieb Muffat verfasst<br />
hat (The Life and Works of Gottlieb Muffat. Wien: Hollitzer 2013), ist in sehr jungen<br />
Jahren tragisch verunglückt. Mein letztes Gespräch mit ihr anlässlich einer Studienreise<br />
des Don Juan Archivs nach Brünn – auch über Fragen der Zensur – wird mir<br />
unvergessen bleiben. Ihr sei die Arbeit zugeeignet.<br />
XVI
Einleitung<br />
EINLEITUNG<br />
1
2<br />
Einleitung
EINLEITUNG<br />
Im Kontext des Entstehens neuer sozialer und kultureller Räume in der ersten Hälfte<br />
des 18. Jahrhunderts weist ein nunmehr kontinuierlich fortlaufender Diskurs dem<br />
Theater eine dezidierte Bildungsfunktion zu – als einem Ort, der neben der Kanzel<br />
und dem sich schrittweise parallel dazu etablierenden Schulsystem geradezu paradigmatisch<br />
geeignet wäre, auf die Sitten wie die Sprachformen einzuwirken. Das<br />
Theater wird Gegenstand der Kameralistik bzw. der „Polizeywissenschaft“, wird<br />
somit potentiell Gegenstand von politischer Planung und Eingriffen auf einem neuen<br />
Niveau, zumindest im Sinne einer gesellschaftlichen Option. Es sind vor allem die<br />
aufklärerischen Reformer, die diese Funktion des Theaters betonen – mit der Konsequenz<br />
der Forderung einer effektiven Zensur als staatlichem Steuerungsinstrument<br />
auf Basis einer textzentrierten Dramenproduktion, welche das extemporierte Theater<br />
zum Verschwinden bringen sollte.<br />
Zensur als ambivalentes Medium der Steuerung öffentlicher Kommunikation ist<br />
zur Zeit Maria Theresias und Josephs II. einem grundlegenden Wandel unterworfen:<br />
auf dem radikalen Wege der Eindämmung der von kirchlichen Funktionsträgern<br />
ausgeübten Zensur hin zu einer staatlichen Zensurinstitution, welche schließlich im<br />
josephinischen Jahrzehnt (1780–1790) die im Kontext der Kirche entstandenen<br />
Schriften selbst der Zensur unterwerfen und gegebenenfalls mit Verbot belegen sollte.<br />
Zensurpolitik im Sinne erweiterter Zensurreform zählt zu den ersten politischen<br />
Agenden Josephs II. nach dem Tode seiner Mutter im November 1780, ermöglicht<br />
einen neuen Kommunikationsmarkt und führt u. a. zu einer damals sogenannten<br />
„Broschürenflut“. Zensurpolitik im Spannungsfeld von Liberalisierung und Kontrolle<br />
wird von den „Zensurakteuren“ als Motor einer kulturellen Dynamik begriffen,<br />
deren Folgen sie allerdings immer weniger kontrollieren können, was schließlich<br />
gegen Ende des Josephinismus zu neuen Verschärfungen führen sollte.<br />
Das Thema der Zensur hat im wissenschaftlichen Diskurs der letzten Jahrzehnte<br />
unter Heranziehung unterschiedlicher Paradigmen erneutes Interesse gefunden –<br />
von der historischen Forschung bis zur Analyse gegenwärtiger Gesellschaften. Dieses<br />
Interesse erstreckt sich auch auf das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der „Aufklärung“,<br />
wobei gerade für die Untersuchung der Dynamik der Zensur neue vielschichtige<br />
Analysemodelle gefordert werden, welche eine komplexe theoretische<br />
Einbettung des analysierten historischen Materials ermöglichen sollen.1 Was die<br />
Bücherzensur in den k. k. Erbländern betrifft, liegen mittlerweile einige grund-<br />
1 Wilhelm Haefs: „Zensur im Alten Reich des 18. Jahrhunderts. Konzepte, Perspektiven und<br />
Desiderata der Forschung“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung. Geschichte, Theorie, Praxis, hg.<br />
von Wilhelm Haefs und York-Gothart Mix. Göttingen 2007 (= Das achtzehnte Jahrhundert.<br />
Supplementa 12), S. 389–422.<br />
3
Einleitung<br />
legende Arbeiten vor.2 Die Theatralzensur unter Maria Theresia und Joseph II. – als<br />
historisch wie theoretisch äußerst lohnende Aufgabe – ist mit Ausnahme eines Aufsatzes<br />
aus dem 19. Jahrhundert3 und Studien über den sogenannten „Hanswurststreit“<br />
der 1760er Jahre noch keiner systematischen Untersuchung unterzogen worden<br />
– eine solche wird im Zentrum meiner Arbeit stehen. Die Analyse speziell der<br />
Entwicklung der Wiener Theaterkultur ist auch unter theoretischen Gesichtspunkten<br />
besonders vielversprechend, weil hier – bedingt durch im Vergleich mit Westeuropa<br />
kulturelle und politische „Retardierungen“ – gewisse Prozesse geradezu<br />
„labormäßig“ ablaufen, wie in der „Inszenierung“ des „Hanswurststreits“ oder im<br />
gedrängten Reformprogramm des Josephinismus.<br />
Drei Forschungsfragen stehen dabei im Vordergrund:<br />
1. Inwieweit ist Zensur und Zensurpolitik im 18. Jahrhundert ein Instrument gesellschaftlicher<br />
Transformation und kultureller Dynamik?<br />
2. Welche Paradoxien, welche gegenläufigen Prozesse lösen Zensurprozesse aus<br />
und in welcher Weise werden diese Paradoxien Teil der institutionellen Praxis?<br />
3. Welche spezifischen Steuerungskontexte charakterisieren das Feld der Theaterzensur,<br />
wie verschränken sich „politische“ und ästhetische Zensur?<br />
Ad 1: Zensurpolitik und Zensurpraxis werden im 18. Jahrhundert zunehmend eingesetzt,<br />
um politische, soziale und ökonomische Reformen unter den strukturellen Bedingungen<br />
eines „aufgeklärten“ Absolutismus zu unterstützen. Dabei geht es nicht<br />
mehr vorrangig um die Aufrechterhaltung spezifischer kultureller Ausdrucksformen,<br />
sondern auch um die Etablierung neuer kultureller Modelle, bis hin zur systematischen<br />
Destruktion überlieferter Modelle, wie beispielsweise des traditionellen<br />
extemporierten Theaters oder bestimmter Formen barocker Volksfrömmigkeit, deren<br />
literarische Produkte Eingang in einen liberalisierten Index der verbotenen<br />
Bücher fanden. Die <strong>Zensor</strong>en sahen sich selbst als Teil dieser Dynamik und arbeiteten<br />
an mehreren Fronten, entlang mehrerer Konfliktlinien. <strong>Der</strong> Prozess führte dazu,<br />
dass sich in zunehmendem Maße das Bewusstsein von der Kontingenz der getroffe-<br />
2 Adolph Wiesner: Denkwürdigkeiten der Oesterreichischen Zensur vom Zeitalter der Reformazion bis auf<br />
die Gegenwart. Stuttgart 1847; Hermann Gnau: Die Zensur unter Joseph II. Straßburg, Leipzig 1911;<br />
Grete Klingenstein: Staatsverwaltung und kirchliche Autorität im 18. Jahrhundert. Das Problem der<br />
Zensur in der theresianischen Reform. Wien 1970; Oskar Sashegyi: Zensur und Geistesfreiheit unter<br />
Joseph II. Beitrag zur Kulturgeschichte der Habsburgischen Länder. Budapest 1958 (= Studia Historica<br />
Academiae Scientiarum Hungaricae 16); Jean-Pierre Lavandier: Le Livre au temps de Marie- Thérèse.<br />
Code des lois de censure du livre pour les pays austro-bohémiens (1740–1780). Bern, Wien 1993; Jean-Pierre<br />
Lavandier: Le Livre au temps de Joseph II. et de Leopold II. Code des lois de censure du livre pour les pays<br />
austro-bohémiens (1780–1792). Bern, Wien 1995.<br />
3 Carl Glossy: „Zur Geschichte der Wiener Theatercensur“. In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft<br />
7 (1897), S. 238–340.<br />
4
Einleitung<br />
nen Zensurentscheidungen erhöhte, verbunden mit einer Entkriminalisierung des<br />
Autors wie des Publikums. Steuerungsobjekt wurde vor allem der Vertrieb, die Zirkulation.<br />
Zensurpolitik wurde darüber hinaus auch ein ökonomisches Steuerungsinstrument,<br />
da der sich rapide ausbreitende Buchhandel als bedeutender wirtschaftlicher<br />
Faktor begriffen und gefördert wurde: dessen Beschleunigung sollte durch<br />
umständliche Zensurmaßnahmen nicht über Gebühr behindert werden, und zwar<br />
weder inhaltlich noch organisatorisch.<br />
Ad 2: Wie schon die Zeitgenossen registriert haben, erzeugt die Zensur ihre eigenen<br />
Paradoxien, gerade auch dort, wo sie zentralisiert erfolgen soll, wobei gerade die<br />
Zentralisierung, wie sie der Josephinismus vorangetrieben hat, Ausdruck der Kontingenz<br />
der Zensur war, da die alten „Länderkommissionen“ zu sehr unterschiedlichen<br />
Zensurpraktiken geführt hatten. Die Zensur musste schließlich auf eine Dynamik<br />
reagieren, die sie selbst mitproduziert hatte; dementsprechend konnte sie nur<br />
sehr ambivalent und scheinbar uneinheitlich handeln, was der zeitgenössischen Kritik<br />
nicht verborgen blieb. So war die Zensur einerseits eine administrative Instanz<br />
mit nachvollziehbaren Effekten in der literarischen Produktion und Zirkulation, sie<br />
war aber gleichzeitig auch eine symbolische Instanz, die eine Steuerung, eine Kontrolle<br />
suggerierte und inszenierte, die bei erhöhter Mobilität nicht mehr einzulösen<br />
war. Gerade die Zensur, wie liberalisiert auch immer, hatte auch einen regen Untergrundbuchhandel<br />
zur Folge und schärfte den Sinn für das „Verbotene“ als exzeptionelles<br />
Bildungsmedium. Das Verbotene erhöhte auch am Markt den Wert der Güter,<br />
und die Buchhändler und Buchdrucker waren darauf spezialisiert, an der Verbotsgrenze<br />
zu agieren bzw. sie zu unterlaufen.<br />
Eine besondere Bedingung für viele ambivalente Entscheidungssituationen speziell<br />
des Josephinismus ist darin zu sehen, dass der „Markt“ zweigeteilt gesehen wurde:<br />
auf der einen Seite der gebildete, aufgeklärte Teil der Leser und Zuschauer, dem<br />
man einiges zumuten wollte, auf der anderen Seite der „Pöbel“, der angeleitet und<br />
nicht mit Informationen versehen werden sollte, die „falsch“ ausgelegt werden<br />
könnten – dies ist auch von zentraler Bedeutung für die Theaterkultur, die sich in<br />
bestimmten Segmenten an ein noch nicht alphabetisiertes Publikum wandte.<br />
Ad 3: Die konsequente Institutionalisierung einer Theatralzensur war eine zentrale<br />
Forderung der österreichischen „bürgerlichen“ Aufklärer der 1760er Jahre, welche an<br />
Stelle der extemporierten Komödie ein deutsches „Nationalschauspiel“ etablieren<br />
wollten, das als „gereinigtes Theater“ eine zentrale Bildungsfunktion übernehmen<br />
sollte. Es ging zunächst weniger darum, das Theater von allem freizuhalten, was<br />
Sitte, Religion und Staat gefährden könnte, als um die Durchsetzung bestimmter<br />
ästhetischer Konzepte – die ästhetische Konzeption wurde gleichsam zur kulturpolitischen.<br />
Davon ausgehend soll untersucht werden, wie sich das Ästhetische und Poli-<br />
5
Einleitung<br />
tische gleichsam überkreuzten, aber auch, wie sich ein genuin ästhetisches Feld auszudifferenzieren<br />
begann.<br />
Als Joseph II., der das alte Burgtheater 1776 nicht zuletzt wegen organisatorischer<br />
Zwänge zum „Nationaltheater“ erhoben hatte, zu Beginn seiner Regierungszeit<br />
in den Grundregeln zur Bestimmung einer ordentlichen zukünftigen Bücher Censur die<br />
Richtlinien für die neue Zensurpolitik festlegte – Zentralisierung, kein Verbot von<br />
Büchern und periodischen Zeitschriften wegen einzelner anstößiger Sätze, Revision<br />
des Katalogs der verbotenen Bücher, freie kritische Äußerung über Amtsträger bis<br />
hin zur kaiserlichen Person –, hielt er auch fest, dass das Theater als besonders wirksames<br />
Medium einer Zentralisierung der Zensur bedürfe, ein, wie zu zeigen sein<br />
wird, letztlich nicht mit letzter Konsequenz ausgeführtes Vorhaben, welches eine<br />
trotz der Einsicht in die hohe Bedeutung des Theaters als Bildungsmedium gespaltene<br />
Vorgangsweise gegenüber der Realität des Theaters zum Ausdruck bringt.<br />
Das Theater als öffentlich kontrolliertes Medium konnte die Verbote nicht so<br />
direkt umgehen wie der Buchhandel – daher stellt sich die Frage, welche spezifischen<br />
Ausdrucks- und Darstellungsformen das Theater generierte, um das auf der Bühne<br />
nicht Zeig- und Sagbare dennoch auf die Bühne bringen zu können, bzw. wie sich<br />
ein Rezeptionsmodus herauskristallisierte, der auf die Dechiffrierung eines mehrdeutigen<br />
Sprechens und Agierens hin konzipiert war.<br />
ZUM BEGRIFF „ZENSUR“<br />
Bevor ich zur vielschichtigen Problematik einer Definition von Zensur komme, zum<br />
Einstieg zwei nicht unbekannte Bonmots zu Fragen der Zensur aus dem 18. Jahrhundert,<br />
die ohne den Anspruch einer „Definition“ eine Gegenläufigkeit der Wirksamkeit<br />
von Zensur eindrucksvoll zeigen, was letztlich von erheblicher Relevanz für die<br />
Analyse und die Politik der Zensur des 18. Jahrhunderts sein sollte. Zu Beginn des<br />
Jahres 1766, kurz nach seiner Wahl zum deutschen Kaiser, äußerte sich Joseph II. in<br />
einer „Denkschrift“ auch zu Fragen der Bücherzensur und konstatierte, „daß trotz<br />
der Strenge, die man zeigt, kein verbotenes, schlechtes Buch existiert, das es in Wien<br />
nicht gibt, und jedermann, noch zusätzlich durch das Verbot angezogen, kann es für<br />
den doppelten Preis bekommen und lesen.“4 Und 15 Jahre später, zu Beginn der josephinischen<br />
Alleinregierung und der damit sich abzeichnenden Zensurreformen,<br />
blickte Friedrich Nicolai, als Herausgeber der renommierten Allgemeinen deutschen<br />
4 Denkschrift Josephs II. vom 2. Januar 1766, zitiert in: Harm Klueting: <strong>Der</strong> Josephinismus. Ausgewählte<br />
Quellen zur Geschichte der theresianisch-josephinischen Reformen. Darmstadt 1995, S. 102. Dies<br />
ist eine Übersetzung des im Original in französischer Sprache geschriebenen Textes (Alfred von<br />
Arneth: Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammet Briefen Joseph’s an seinen Bruder<br />
Leopold. 3 Bde. Wien 1867–1868, Bd. 3, S. 335–361).<br />
6
Einleitung<br />
Bibliothek selbst Zensurgeschädigter und auf den theresianischen Index der verbotenen<br />
Bücher gesetzt, auf die vormaligen Praktiken zurück: „Ja endlich gieng es so<br />
weit, daß man im Jahre 1777 diesen Catalogum librorum prohibitorum selbst<br />
unter die verbotenen Bücher setzte, damit die schlechten Leute nicht die schlechten,<br />
und die klugen Leute nicht die klugen Bücher aus demselben möchten kennen lernen,<br />
und sich, durch die Bücherschwärzer, besonders die schmutzigen Bücher für<br />
zehnfachen Preis möchten kommen lassen.“5 Gemäß dieser markanten Anmerkungen<br />
verfehle die „Zensur“ nicht nur ihr Ziel, sondern bewirke geradezu das Gegenteil,<br />
indem sie das Interesse gerade auf die verbotenen Objekte lenke, eine Sichtweise,<br />
wie sie in deutschen Landen im kritischen öffentlichen Diskurs der 1770er Jahre<br />
verstärkt wahrgenommen wurde.<br />
Gegenüber der „traditionellen Zensurforschung“, welche im 19. Jahrhundert einsetzte,<br />
hat der Begriff der Zensur mittlerweile eine wesentliche Erweiterung erfahren,<br />
speziell auch in der im angloamerikanischen Raum geführten Diskussion um die<br />
„New Censorship“ im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts. In dem vielbeachteten<br />
Band Censorship and Silencing. Practises of Cultural Regulation6 geht Frederick<br />
Schauer7 auf die Frage nach einer Ontologie der Zensur ein und meint, eine solche<br />
heutzutage nicht mehr klar verorten zu können.8 Auf ihn bezugnehmend stellt Stephan<br />
Packard fest, dass Zensur immer mehr zu einem pragmatischen Begriff werde,<br />
der „mediale Kontrolle“ und die Frage nach ihrer Legitimität zum Gegenstand habe.9<br />
Gemäß der Ausdifferenzierung im wissenschaftlichen Diskurs und in Abhängigkeit<br />
von den jeweils damit befassten Disziplinen kann man von einem engen und<br />
einem sehr ausgedehnten Begriff von Zensur sprechen. Die im 19. Jahrhundert entstandene<br />
Zensurforschung hat sich auf jene Einrichtungen, welche, von staatlichen<br />
Autoritäten legitimiert, eine Kommunikationskontrolle vornahmen, sowie auf<br />
Objekte öffentlicher medialer Vervielfältigung konzentriert. Eine der knappsten<br />
Definitionen zieht Edgar Mass10 in einem Beitrag heran, der sehr unterschiedliche<br />
Erscheinungsformen von Zensur zu fassen versucht: „La censure est une critique<br />
officielle des ecrits accompagnées de sanctions materielles.“11 Auch wenn der Begriff<br />
5 Friedrich Nicolai: Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. Nebst<br />
Anmerkungen über die Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und Sitten. Vierter Bd. Berlin, Stettin 1784,<br />
S. 858.<br />
6 Censorship and Silencing. Practises of Cultural Regulation, hg. von Robert C. Post. Los Angeles 1998.<br />
7 Frederick Schauer: „The Ontology of Censorship“. In: Censorship and Silencing, S. 147–168.<br />
8 Ebenda, S. 164.<br />
9 Stephan Packard: Draußen und Überall. Zwei heuristische Begriffe zur Diskursanalyse medialer Kontrolle,<br />
www.medialekontrolle.de (Dezember 2012), S. 8.<br />
10 Edgar Mass: „Kirchliche und weltliche Zensur in Frankreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts<br />
zur Zeit Benedikt XIV.“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung, S. 331–356, hier S. 334.<br />
11 Paul Otlet: Traité de documentation: le livre sur le livre. Théorie et pratique. Bruxelles 1934. Neu hg.<br />
von Robert Estival und André Canonne. Bruxelles 1989, S. 256.<br />
7
Einleitung<br />
der „ecrits“ mittlerweile zu eng gefasst erscheint, da es sich um öffentliche Äußerungen<br />
diverser Art (etwa Theateraufführungen, Schaustellungen, ausgestellte und vervielfältigte<br />
Bilder und dergleichen) handelt, so hält er im Hinblick auf die öffentliche<br />
Äußerungsform zwei strukturelle Komponenten von „Zensur“ fest: die „offizielle“,<br />
somit in staatlichem Auftrag durchgeführte wie legitimierte institutionelle Begutachtung<br />
dieser Äußerungen sowie die damit verbundene Sanktionsmacht, solche zu<br />
unterbinden oder zu gestatten. Diese Komponenten finden sich in den meisten Begriffsdefinitionen<br />
wieder, etwa in Ulla Ottos grundlegendem Werk zur literarischen<br />
Zensur als „die autoritäre Kontrolle aller menschlichen Äußerungen, die innerhalb<br />
eines bestehenden gesellschaftlichen Systems mit der Bemühung um sprachliche<br />
Form geschrieben werden“.12 Oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, bei Armin<br />
Biermann:13 Zensur sei „die Gesamtheit institutionell vollzogener und strukturell<br />
manifestierter Versuche […], durch legale – oder unrechtmäßige – Anwendung von<br />
Zwang oder physischer Gewalt gegen Personen oder Sachen schriftliche Kommunikation<br />
zu kontrollieren, zu verhindern oder fremdzubestimmen.“14 Dies wird teilweise<br />
ergänzt um die Funktionsbestimmungen, die zensorische Akte als Mittel<br />
sehen, bestimmte soziokulturelle Verhaltensmuster aufrechtzuerhalten oder neu zu<br />
etablieren, „die als anvisiertes oder bereits realisiertes Ziel von konfliktfähigen ‚Trägern<br />
der Zensur zum Maßstab‘15 für Text- und Bildzeugnisse und deren Medialisierung<br />
oder öffentlicher Rezeption konkretisiert, aber nicht unbedingt präzise definiert<br />
worden sind. Zensur dient demnach der Durchsetzung oder dem Schutz religiöser,<br />
politischer, sozialer und kultureller Normen.“16<br />
Die „traditionelle“ Zensurforschung befasst sich mit Institutionen, welche „Zensur“,<br />
häufig unter ebendieser Bezeichnung, offiziell ausüben. „Zensur“, respektive<br />
die ihr zuordenbaren Operationen, ist in diesem Fall auch Teil der „Selbstbeobachtung“<br />
der Gesellschaft. Doch bezeichnet jede abstrakte Definition, welche diesen<br />
12 Ulla Otto: Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik. Stuttgart 1968 (= Bonner Beiträge<br />
zur Soziologie 3), S. 6.<br />
13 Armin Biermann: „,Gefährliche Literatur‘ – Skizze einer Theorie der literarischen Zensur“. In:<br />
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 13 (1988), S. 1–28. Zu Paradigmen der Zensur forschung<br />
siehe weiters: Dieter Breuer: „Stand und Aufgaben der Zensurforschung“. In: „Unmoralisch an<br />
sich …“ Zensur im 18. und 19. Jahrhundert, hg. von Herbert G. Göpfert und Erdmann Weyrauch.<br />
Wiesbaden 1988, S. 37–60; Reinhard Aulich: „Elemente einer funktionalen Differenzierung der<br />
literarischen Zensur. Überlegungen zu Form und Wirksamkeit von Zensur als einer intentional<br />
adäquaten Reaktion gegenüber literarischer Kommunikation“. In: „Unmoralisch an sich …“,<br />
S. 177–230; Bodo Plachta: Zensur. Stuttgart 2006; Beate Müller: „Zensurforschung, Konzepte,<br />
Paradigmen, Theorien“. In: Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch. Bd. 1: Theorie und Forschung,<br />
hg. von Ursula Rautenberg. Berlin 2010, S. 321–360.<br />
14 Biermann: „,Gefährliche Literatur‘“, S. 3.<br />
15 Aulich: „Elemente einer funktionalen Differenzierung der literarischen Zensur“, S. 180.<br />
16 York-Gothart Mix: „Zensur im 18. Jahrhundert. Prämissen und Probleme der Forschung“. In:<br />
Zensur im Jahrhundert der Aufklärung, S. 11–23, hier S. 14.<br />
8
Einleitung<br />
Vorgang zu beschreiben versucht, notwendigerweise mehr, als eine historische Institution<br />
jemals wahrzunehmen imstande ist, und eröffnet hiermit auch die Frage, in<br />
welcher Weise die allgemein unterstellten Funktionszusammenhänge auch in anderer<br />
Form wahrgenommen wurden. Insofern ist es strategisch sinnvoll, zwischen<br />
Zensur als grundsätzlichem Phänomen, als Operationsmodus, und den je spezifisch<br />
historisch auskristallisierten Institutionalisierungszusammenhängen zu unterscheiden,<br />
welche im Hinblick auf den jeweiligen Stand der Formalisierung, der praktischen<br />
Ausformung wie Aufgabenzuteilung ständigen Veränderungen unterworfen<br />
waren. Das, was einst von verschiedensten Funktionsträgern wahrgenommen wurde,<br />
findet gelegentlich eine konzentrierte Institutionalisierung. Dies gilt im besonderen<br />
Maße für das Feld der „Theatralzensur“, um die es in dieser Arbeit gehen soll:<br />
bevor es gegen Ende der 1760er Jahre in den k. k. Erbländern zu einer eigenständigen<br />
Institutionalisierung der Theatralzensur kam, wurden zensurielle Operationen von<br />
unterschiedlichen Instanzen wahrgenommen, so jenen, welche eine Spielerlaubnis<br />
für fahrende Truppen gewähren konnten, so von einer Bücherzensurkommission,<br />
welche Drucke inspizierte, was allerdings sehr unsystematisch erfolgte, so von einem<br />
„Generalspektakeldirektor“ unter Mitwirkung von Personen des Hofes wie seines<br />
ausländischen Agenten, so von beauftragten Schauspielern und Dichtern des Theaters,<br />
so von Inspizienten, welche die Vertreter des naturgemäß eine Vorzensur ausschließenden<br />
Stegreifspiels observierten und diese bei Bedarf abmahnten, etc.<br />
Viele waren mit „Zensur“, mit der Kontrolle des Schauspiels befasst, ohne dass<br />
sie den Titel eines „<strong>Zensor</strong>s“ führten. Und auch später, in nunmehr institutionalisierter<br />
Form, wird der <strong>Zensor</strong> oft nur marginale Teile einer potentiellen „zensorischen“<br />
Tätigkeit wahrnehmen. So wird der Theatralausschuss des Wiener Burgtheaters<br />
im Jahre 1779 etwa 250 eingereichte Stücke dramaturgisch begutachten, auch<br />
unter Berücksichtigung von „zensorischen“ Aspekten im engeren Sinne; lediglich<br />
zwei davon wird der offizielle Theatralzensor zu Gesicht bekommen, und er wird<br />
ihnen seine Zustimmung nicht verweigern. <strong>Der</strong> Rest der begutachteten Stücke wird<br />
„verworfen“, was allerdings andere „rechtliche“ Konsequenzen hat als die „Verwerfung“<br />
durch den Theatralzensor, und so manche der „verworfenen Stücke“ werden<br />
zur Zeit der Alleinregierung Josephs II. aufgeführt werden. So zählt es zu den<br />
grundlegenden Erfahrungen eines <strong>Zensor</strong>s, speziell im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts,<br />
dass Zensur sowohl in ihrer organisatorischen Gestalt wie in ihrer inhaltlichen<br />
Ausrichtung einem ständigen Wandel unterliegt.<br />
„Formelle“ zensurielle Akte, von denen bis jetzt die Rede war, unterliegen einer<br />
besonders im 18. Jahrhundert vermehrt zu beobachtenden Paradoxie: das mit einem<br />
allfälligen Verbot verhängte „Schweigen“ erzeugt notwendigerweise das „Sprechen“,<br />
welches sich nicht an die Logik des Verbots hält, ja, wie es zensurkritische Schriften<br />
des 18. Jahrhunderts als inverse Logik unterstellen, fungiere das Verbot vielmehr als<br />
indirekter Wahrheitsbeweis. Und mit einiger Konsequenz wird der Katalog der ver-<br />
9
Einleitung<br />
botenen Bücher selbst zu den gefährlichsten Produkten zählen, wie eingangs mit<br />
Verweis auf Friedrich Nicolai erwähnt. In zunehmendem Maße wird sich auch die<br />
Zensur ihrer paradoxen Entscheidungen bewusst, und speziell zur Zeit der Alleinregierung<br />
Josephs II. hatten etliche zensurielle Maßnahmen die Aufhebung eines beantragten<br />
Verbots zum Gegenstand, um durch die Umgehung des Verbots das sicherer<br />
zu erreichen, was man ursprünglich mit dem Verbot bewirken wollte.<br />
Was die formelle Zensur betrifft, so wird zwischen unterschiedlichen Stufen unterschieden:<br />
zwischen der Vorzensur, der Nachzensur und der Rezensur, der neuerlichen<br />
Begutachtung schon genehmigter Texte. Für das 18. Jahrhundert gilt weitgehend,<br />
dass im Prinzip keine für die Öffentlichkeit bestimmte mediale Äußerung<br />
ohne das Durchlaufen eines Zensurprozesses distribuiert werden konnte – die „Zensur“<br />
war integraler Bestandteil des Kommunikationsprozesses; ebenso selbstverständlich<br />
entwickelten sich vielfältige Strategien, die Zensur zu umgehen, wozu<br />
gerade auch die offiziellen zensuriellen Institutionen mannigfache Hilfestellungen<br />
boten, um ihrerseits gewissen Legitimationsproblemen zu entgehen.17 Die formelle<br />
Zensur ist immer ein doppelter Akt: sie genehmigt ein Werk (gegebenenfalls mit der<br />
Auflage bestimmter Abänderungen) oder sie verbietet es. Beides sind zensurielle<br />
Akte, wenn auch der Großteil der bisherigen Zensurforschung sich auf das Verbot<br />
konzentrierte. Beides sind Akte, welche ein zunächst indifferentes Objekt neu bestimmen<br />
und klassifizieren, als etwas Zugelassenes oder etwas Verbotenes. Die Restriktion<br />
auf die Beobachtung des „Verbotenen“ führte – was bislang kaum gesehen<br />
wurde – auch zu falschen Vorstellungen von der „Logik“ der Zensur, welche immer<br />
vielfältiger und variabler reagierte, als es einzelne Verbote, samt den damit implizit<br />
vorgenommenen Generalisierungen, nahelegen. Das „Zugelassene“ als ein zugegebenermaßen<br />
unerschöpfliches Gebiet ist noch ein Desiderat der Zensurforschung,<br />
und ich werde in dieser Arbeit einige Versuche in dieser Richtung unternehmen.<br />
Jedenfalls verändert eine Auseinandersetzung mit dem Zugelassenen auch den Blick<br />
auf das Verbotene.<br />
17 Bezogen auf die potentiellen Felder zensurieller Maßnahmen hat Reinhard Aulich drei analytisch<br />
relevante Bezugsebenen unterschieden: das Feld der literarischen Produktion, das Feld der Distribution<br />
sowie das Feld der Diffusion, wobei der Rezipient der Literatur zum Gegenstand von potentiellen<br />
Zensurmaßnahmen wird (Aulich: „Elemente einer funktionalen Differenzierung der<br />
literarischen Zensur“, S. 215–218). Zur Zeit der Alleinregierung Josephs II. konzentrierten sich<br />
potentielle Sanktionen auf das Feld der Distribution. Und es galt die Straffreiheit des Individuums,<br />
dem es auch offenstand, verbotene Bücher einzuführen, sofern nicht der Verdacht bestand,<br />
dass diese einer weiteren Distribution zugeführt werden sollten. Dies stellt einen Unterschied zu<br />
den „peinlichen Leibesvisiten“ der theresianischen Zeit dar, in welcher dem Einreisenden suspekte<br />
Bücher abgenommen wurden, ein Sachverhalt, den auch der junge Joseph II. in oben erwähnter<br />
Denkschrift kritisiert hatte.<br />
10
Einleitung<br />
Gegenüber dem Begriff einer staatlich respektive kirchlich institutionalisierten Zensur<br />
mit ersichtlicher wie im Endeffekt auch immer paradoxer Sanktionsgewalt wurden<br />
seit den 1960er Jahren Begriffe von Kontrollmechanismen ausgebildet, in denen<br />
das „Subjekt“ eines identifizierbaren „<strong>Zensor</strong>s“ nicht mehr gegenwärtig ist, so bei<br />
Michel Foucault, dessen Begriff des „Diskurses“ diesen im Hinblick auf die in ihm<br />
enthaltenen Kontrollsysteme und Ordnungsschemata strukturell beschreibt, die ihn<br />
möglich machen. Das Unsagbare bestimmt sich nicht durch die Interventionen einer<br />
institutionellen Zensur, welche bestimmte Aussagen einem Verbot unterwirft, sondern<br />
durch die Operationen des Diskurses selbst, der in distinkter Form seinen Gegenstand<br />
konstituiert.18 Für Pierre Bourdieu ist es das „soziale Feld“, welches die<br />
möglichen Operationen innerhalb dieses Feldes konstituiert und welches, feldimmanent,<br />
über die Form des Sagbaren sowie Unsagbaren „entscheidet“, ohne dass den<br />
Akteuren die jeweiligen Selektionsleistungen (voll) bewusst wären:<br />
„Jeder Ausdruck stellt einen Kompromiß zwischen einem Ausdrucksinteresse<br />
und einer Zensur dar, die in der Struktur des Felds besteht, in dem dieser<br />
Ausdruck angeboten wird, und dieser Kompromiß ist das Produkt einer<br />
Euphemisierungsarbeit, die bis zum Schweigen gehen kann, dem Grenzfall<br />
des zensierten Diskurses. Mit dieser Euphemisierungsarbeit wird dann etwas<br />
produziert, was eine Kompromißbildung ist, eine Verbindung aus dem, was<br />
gesagt werden sollte oder wollte, und dem, was bei einer gegebenen, für ein<br />
bestimmtes Feld konstitutiven Struktur gesagt werden konnte. Mit anderen<br />
Worten, das in einem bestimmten Feld Sagbare ist das Ergebnis von etwas,<br />
was man Formgebung nennen könnte: Sprechen heißt Form geben.“19<br />
Auch die Erforschung der „formellen“ Zensur hat, teilweise in Bezug auf die genannten<br />
Ansätze, durch eine Differenzierung des begrifflichen Instrumentariums<br />
reagiert und versucht – wenn auch mit unterschiedlicher Perspektivierung – zensurielle<br />
Formen zu identifizieren, die als wirkungsvolle Praktiken neben der „formellen“<br />
Zensur bestehen. Ulla Otto hat der formellen Zensur eine informelle Zensur an<br />
die Seite gestellt und damit alle über die formelle Zensur hinausgehenden Praktiken<br />
gemeint, welche im Hinblick auf bestimmte Gegenstandsbereiche die Wirkung einer<br />
Kommunikationskontrolle ausüben: „gewöhnlich solche Zensurmaßnahmen, die<br />
nicht auf Grund legaler Mechanismen, sondern mit Hilfe psychologischen, ökono-<br />
18 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt am Main 1979 (deutsche Übersetzung der<br />
Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. Dezember 1970).<br />
19 Pierre Bourdieu: „Die Zensur“ (1974). In: Pierre Bourdieu: Soziologische Fragen. Frankfurt am<br />
Main 1993, S. 131f. Siehe dazu auch: Pierre Bourdieu: Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen<br />
Tausches. Übersetzt von Hella Beister. Hg. von Georg Kremnitz. Wien 1990.<br />
11
Einleitung<br />
mischen, politischen oder sonstigen sozialen Drucks erfolgen“,20 teilweise auch vorgenommen<br />
von Gruppen und Institutionen, die einen „unsichtbaren Terror auf die<br />
Meinungsbildung der Gesellschaft ausüben“21 – ein problematischer, aber zum Verständnis<br />
der kulturellen Dynamik der Zensur sinnvoll weiter zu operationalisierender<br />
Begriff. Dazu zählen auch symbolische „Kampfhandlungen“, wie etwa die 1772<br />
vorgenommene Verbrennung der Werke von Christoph Martin Wieland durch die<br />
„Göttinger Hainbündler“, die demonstrativ in Szene gesetzte Verbrennung der Werke<br />
des Antipoden des „großen“ Mentors, Friedrich Gottlieb Klopstock.22 Dazu zählt,<br />
wenn auch nicht so spektakulär, in erster Linie der „ästhetische“ Diskurs samt den in<br />
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstehenden vielfältigen Theaterperiodika.23<br />
Dieser ästhetische Diskurs war teilweise wirksamer und nachhaltiger als die<br />
formelle Zensur, welche wiederum von diesem Diskurs beeinflusst wurde. Dazu<br />
zählt das komplexe institutionelle Umfeld der Zensur, im Falle der Theatralzensur<br />
die Theater selbst, die auch Druck auf die formelle Zensur auszuüben versuchten,<br />
wie sie auch mit modifizierten Perspektivierungen selbst „Zensur“ ausübten, bis hin<br />
zum Publikum, dessen potentielle Erwartungen in theatrale wie theatralzensurielle<br />
Entscheidungen miteinflossen – der Theatralzensor war also ein „Knotenpunkt“ in<br />
einem vielfältig verwobenen Netz.<br />
Eine andere Differenzierung betrifft die Unterscheidung von „regulativer“ und<br />
„konstitutiver Zensur“, ein Ansatz, der auch von Foucault geprägt ist, eine Zensur,<br />
„die nicht vom Staat generiert“ wird.24 Simone Zurbuchen diskutiert diese Unterscheidung,<br />
bei welcher sie sich auf einen Ansatz von Sophia Rosenfeld25 bezieht, anhand<br />
der „Philosophes“ des 18. Jahrhunderts, die teilweise die traditionelle formelle<br />
Zensur ablehnten, aber die „Freiheit“ ihres Diskurses, der auch ein elitärer Diskurs<br />
war, unter bestimmte verbindliche konstitutive Prinzipien stellten, wie sie sich auch<br />
einer „Selbstzensur“ verschrieben, die von ihnen erkannten „Wahrheiten“ in wohldosierter<br />
Form zu kommunizieren. Laut Zurbuchen geht es hier um neue Normierungen<br />
der Öffentlichkeit, welche anstelle der staatlichen Zensur das Verhalten und<br />
20 Otto: Die literarische Zensur, S. 119.<br />
21 Ebenda, S. 120.<br />
22 Siehe dazu Hans-Edwin Friedrich: „,Volksverführer, Franzosennachäffer, Weisheitsgaukler‘ –<br />
Zensur als ästhetischer Akt. Wieland und der Göttinger Hain“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung,<br />
S. 189–202.<br />
23 Siehe dazu Peter Hesselmann: Gereinigtes Theater? Dramaturgie und Schaubühne im Spiegel deutschsprachiger<br />
Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts (1750–1800). Frankfurt am Main 2002.<br />
24 Simone Zurbuchen: „Aufklärung ,von oben herunter‘ oder ,von unten herauf‘? Die Berliner<br />
Preisfrage über den Volksbetrug (1780)“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung, S. 157–188, hier<br />
S. 166.<br />
25 Sophia Rosenfeld: „Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment“. In: Postmodernism<br />
and the Enlightenment. New Perspectives in Eighteenth Century French Intellectual History, hg.<br />
von Daniel Gordon. New York, London 2001, S. 117–145.<br />
12
Einleitung<br />
Denken regulieren sollten.26 Damit liegt ein Ansatz vor, der von Interesse ist, weil<br />
hier die Ersetzung von expliziten regulativen Mechanismen durch internalisierte<br />
Selektionsleistungen thematisiert wird, was in höchst ambivalenter Form seinen<br />
Niederschlag in der Zensurdiskussion des 18. Jahrhunderts findet – ein Ansatz auch,<br />
der aus systemtheoretischer Perspektive die Frage nach den „funktionalen Äquivalenten“<br />
regulativer Zensur ermöglicht.<br />
Eine weitere, in Anschluss an Foucault und Bourdieu vorgenommene Differenzierung<br />
trifft Judith Butler, indem sie zwischen expliziter und impliziter Zensur unterscheidet.<br />
Erstere entspricht der formellen Zensur oder ihr vergleichbaren Ausdrucksformen,<br />
Zweitere ist Bestandteil jedes Sprechaktes, im Unterschied zur ersten<br />
„vorgängig“ und konstitutiver Bestandteil desselben, somit auch Bestandteil der Bildung<br />
des „Subjekts“.<br />
„The latter [the implicite] censorship refers to implicit operations of power<br />
that rule out in unspoken ways what will remain unspeakable. In such cases,<br />
no explicit regulation is needed in which to articulate this constraint. The<br />
operation of implicit and powerful forms of censorship suggests that the<br />
power of the censor is not exhausted by explicit state policy or regulation.<br />
Such implicit forms of censorship may be, in fact, more efficacious than explicit<br />
forms in enforcing a limit on speakability.“27<br />
Ein weiterer den wissenschaftlichen Diskurs bereichender Ansatz versucht Homologien<br />
zwischen Kanon und Zensur herzustellen.28 Die Analogie wird vor allem in den<br />
wenn auch in unterschiedlicher Weise vorgenommenen Selektionen, Normierungen<br />
und Ausschließungen gesehen. Das Konzept des Kanons ist jedenfalls unter „zensu-<br />
26 Zurbuchen: „Aufklärung ,von oben herunter‘“, S. 167.<br />
27 Judith Butler: „Implicite Censorship and Discursive Agency“. In: Judith Butler: Exitable Speech.<br />
A Politics of the Performative. New York 1997, S. 130f. Im Hinblick auf die oben erwähnte Feststellung<br />
von Frederick Schauer, dass eine Ontologie der Zensur sich schwer ausmachen lasse, versucht<br />
Kenji Yoshino ein eklektisches Modell der Zensur zu entwickeln. Sie konstruiert eine Phänomenologie<br />
der Zensur anhand eines Diagramms, gebildet aus der Achse der „Zensuragenten“:<br />
den staatlichen Akteuren, den „privaten“ Akteuren (Institutionen, Organisationen) sowie dem<br />
subjektunabhängigen Begriff der Norm, und der Achse der mit Zensur verbundenen Sprechakte:<br />
die beiden ersten Kategorien sind der Sprechakttheorie von John Langshaw Austin entnommen,<br />
die dritte ist wiederum als Norm klassifiziert: Illocutionary, Perlocutionary, Norm. So gewinnt<br />
die Autorin neun Felder, an deren diametralen Enden das klassische Zensurmodell einerseits und<br />
das Foucaultsche Modell andererseits stehen. Es handelt sich hier um einen Versuch, differente<br />
Ontologien zu gewinnen (Kenji Yoshino: „The Eclectic Model of Censorship“. In: California Law<br />
Review 88 [October 2000], S. 1635–1655, hier S. 1654).<br />
28 Aleida Assmann und Jan Assmann: „Kanon und Zensur als kultursoziologische Kategorien“. In:<br />
Kanon und Zensur. Archäologie der literarischen Kommunikation II, hg. von Aleida Assmann und Jan<br />
Assmann. München 1987, S. 7–27.<br />
13
Einleitung<br />
riellen“ Gesichtspunkten auch für das Theater des 18. Jahrhunderts von Interesse,<br />
weil der Bezug auf einen Kanon im weitesten Sinne auch mitdefiniert, was auf der<br />
Bühne gesagt oder gezeigt werden konnte, und dies gerade im Hinblick auf Themen,<br />
welche sonst tendenziell einer Tabuisierung anheimgefallen wären.<br />
In einer programmatischen Schrift zur Erforschung der Theatralzensur nimmt<br />
Peter Höyng eine diesbezügliche Erweiterung des Begriffs der „formellen“ Zensur<br />
vor.29 Bezugnehmend auf die Schrift von Carl Glossy zur Wiener Theatralzensur im<br />
18. Jahrhundert30 ortet er das Prinzip der „Theatralzensur“ als spezifisches Konzept<br />
der „Aufklärung“ und führt damit im theatralen Bereich den Begriff der „subventionierenden<br />
Zensur“ ein:<br />
„Für die am Reformprojekt eines Nationaltheaters Beteiligten war die Zensur<br />
kein repressives sondern ein subventionierendes Mittel, und daher notwendig<br />
und auch selbstverständlich.“31<br />
Und zu solchen „subventionierenden“ personellen Faktoren zählen für ihn „u. a.<br />
Johann Christoph Gottsched, Joseph von Sonnenfels, und Franz [Karl] Hägelin“32.<br />
Nach Höyngs Ansicht verweist der Begriff der „subventionierenden Zensur“ auf den<br />
ursprünglichen Sinn des Begriffes:<br />
„[…] das Zensieren ist ein Vorgang des kritischen Vergleichens, Prüfens,<br />
Einschätzens, der ein Be- oder Verurteilen als sanktionierendes Handeln<br />
zum Resultat hat. Demnach ist der Begriff der Zensur seiner Qualität nach<br />
an den der Kritik gekoppelt. Das aber wiederum bedeutet, daß die Zensur<br />
wesentlich zu einem der zentralen Begriffe der Aufklärung gehört. Die subventionierende<br />
Zensur ist die Sanktionierung einer rational nachvollziehbaren<br />
Kritik“33.<br />
Damit löst sich allerdings der operative Modus der Theatralzensur in einem Nebelfeld<br />
auf, das „rational nachvollziehbare Kritik“ zum Medium der „Zensur“ macht,<br />
gebunden an den Begriff der „Sanktionierung“, der operativ gleichfalls unklar bleibt.<br />
In weiterer Folge meint Höyng damit den Diskurs um das literarisierte „Nationaltheater“.<br />
„Die subventionierende Zensur intendierte mit ihren kritischen Urteilen,<br />
29 Peter Höyng: „Die Geburt der Theaterzensur aus dem Geiste bürgerlicher Moral. Unwillkommene<br />
Thesen zur Theaterzensur im 18. Jahrhundert“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung,<br />
S. 99–122.<br />
30 Glossy: „Zur Geschichte der Wiener Theatercensur“.<br />
31 Höyng: „Die Geburt der Theaterzensur“, S. 103.<br />
32 Ebenda.<br />
33 Ebenda.<br />
14
Einleitung<br />
die vorhandenen Dramen zu bewerten oder aber die Aufführungen zu beurteilen,<br />
um auf diese Weise ihre Qualitäten zu verbessern.“34 Und weiter: „Die Zensur als<br />
ästhetisch legitimierendes Ausschlußverfahren verhalf dazu, ein literarisches,<br />
deutschsprachiges und stehendes Theater als ein nationales, d. h. kulturpolitisches<br />
Projekt für ein politisch entmündigtes Bürgertum zu reklamieren und zu forcieren.“35<br />
Zu den „Textsorten“ der „subventionierenden Zensur“ zählt der Autor allseits bekannte<br />
Schriften wie Gottscheds Critische Dichtkunst vor die Deutschen, Sonnenfels’<br />
Schriften zum Theater wie Lessings Hamburgische Dramaturgie, aber auch die vielfältigen<br />
kurzlebigen Theaterzeitschriften. Ihre „subventionierende Zensur“ machte<br />
Gottsched, Sonnenfels, Lessing und Goethe – so Höyng – zu „Geburtshelfern, um<br />
die Nation mit einem deutschsprachigen, literarisch und schauspielerisch wertvollen<br />
Theater zu beglücken“. Dieser beglückenden „subventionierenden Zensur“ stellt<br />
Höyng die „formell-geregelte oder repressiv intendierte Theaterzensur im Sinne eines<br />
Verbots“36 gegenüber, eine Zensur, für deren radikale Verschärfung sich der<br />
„subventionierende <strong>Zensor</strong>“ Sonnenfels sehr massiv eingesetzt hat.<br />
So bleibt in hohem Maße unbestimmt, ob die formell geregelte Zensur im unterstellten<br />
Paradigma der „repressiv intendierten Theaterzensur“ aktiv war, denn zu<br />
den Protagonisten der Theaterzensur, der formellen Zensur, zählten Sonnenfels und<br />
Hägelin, nach Höyngs Ansicht exemplarische Repräsentanten einer „subventionierenden<br />
Zensur“. Als analytische Hülse bezieht sich der Autor auf eine angebliche<br />
Differenz zwischen dieser „formell geregelten Zensur“ und einer „angewandten und<br />
ausgeübten Zensur“37, welche davon abgewichen wäre. Diese Differenz besteht allerdings<br />
allein in der Vorstellung des Autors, denn die Regelungen der Theatralzensur<br />
waren stets in einer solchen Abstraktheit abgefasst, dass sie die konkret zu erfassenden<br />
Schritte nicht vorgeben konnten.<br />
Um der Höyng’schen Diktion von „Geburt“ und „Beglückung“ zu entgehen, seien<br />
jene analytischen Kategorien genannt, die in weiterführender Form seiner programmatischen<br />
Schrift zugrunde liegen – dies vor allem auch mit Referenz auf „alte“<br />
Befunde, welche er allerdings nicht systematisch erörtert. <strong>Der</strong> Diskurs über das Theater,<br />
wie er seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts geführt wurde, gibt entscheidende<br />
Maßstäbe für das Denken über die Theatralzensur vor, und dieser Diskurs hatte praktische<br />
Macht, wenn auch, wie ich im Rahmen meiner Arbeit darlegen werde, in sehr<br />
unterschiedlicher Weise. Eine Erörterung der Theatralzensur kann ohne Berücksichtigung<br />
dieses „Diskurses“ nicht geleistet werden, wobei man Discourse nicht mit Histoire<br />
gleichsetzen sollte, was gerade in diesem Feld sehr verbreitet ist.<br />
34 Ebenda, S. 104.<br />
35 Ebenda.<br />
36 Ebenda, S. 113.<br />
37 Ebenda.<br />
15
Einleitung<br />
Gleichwohl ist die Semantik einer „repressiven“ und „subventionierenden“ Zensur<br />
eine naive Semantik des „Nehmens“ und „Gebens“. <strong>Der</strong> Diskurs um die Reform des<br />
deutschen Theaters enthält auch Elemente der Repression und Destruktion, besonders<br />
in den „subventionierenden“ Schriften eines Sonnenfels, wo Menschen jenseits<br />
des eigenen Lagers nur mehr als „Schweine im Unflathe“ charakterisiert werden. Die<br />
sogenannte „subventionierende Zensur“ ist auch eine Kultur, welche im Sinne ihrer<br />
Ziele Repression und Vernichtung zum Gegenstand hat; ausgestattet mit der Macht<br />
des Diskurses kann sie repressive Funktionen entwickeln, welche die traditionellen<br />
zensuriellen Praktiken in dieser Form nie zu entfalten imstande waren.<br />
Doch verbergen sich hinter diesen Begriffen auch zentrale Ebenen für eine Analyse<br />
der Zensur im 18. Jahrhundert. Denn bei den Kategorien „repressiv/subventionierend“<br />
geht es auch um neue Qualitäten von Zensur, zumindest von deren Imagination.<br />
Dem reinen „Verbot“, Indikator der „alten“ Zensur, wird ein „produktives“<br />
Element gegenübergestellt, welches als Anleitung und Beförderung kultureller Produktion<br />
imaginiert wird, ein Diskurs, welcher nicht mehr von „staatlichen“ Stellen<br />
geführt wird und wohl auch nicht mehr geführt werden kann, auch wenn in ambivalenter<br />
Form dem ideal konzipierten Staat – wie in Sonnenfels’ Kameralismus – die<br />
zentrale Lenkungsrolle zugesprochen wird und allein der Staat als Garant für das<br />
Modell des Theaters als Sittenschule erscheint, welcher die rein subjektiven Interessen<br />
und Energien von Zuschauern, Theaterunternehmern und Schauspielern im Sinne<br />
des neuen Paradigmas fokussieren könnte.<br />
Diese komplexe Konstellation führt mich dazu, den Begriff der „Theatralzensur“<br />
in dem eingeschränkten Sinne der sich institutionalisierenden Zensur zu verwenden,<br />
um eine klare Positionierung im sozialen Raum vornehmen und sinnvolle<br />
„Subjekt“-Aussagen im Hinblick auf ein komplexes soziales und kulturelles Umfeld<br />
treffen zu können. Das heißt aber im Sinne des bislang Explizierten notwendigerweise<br />
auch, wahrzunehmen, dass es neben der „Theatralzensur“ viele andere zensurrelevante<br />
Instanzen gab, ja mehr noch, dass der Theatralzensor selbst einer vielfachen<br />
und oft diffusen Zensur unterlag. Im Begriff der Höyng’schen Theatralzensur ist –<br />
um es auf den Punkt zu bringen – das Verbot von Schillers Die Räuber wie von<br />
Schillers Schriften zum Theater oder eine etwaige Apologetik des genannten Schauspiels<br />
in ein- und denselben Begriff der „Theatralzensur“ gefasst. Hier liegt eine vielleicht<br />
produktive Paradoxie, aber letztlich ein Begriffs-Amalgam vor, das kaum<br />
mehr Aussagen über „die“ Theatralzensur zulässt, denn zwischen der sogenannten<br />
„subventionierenden Zensur“ (letztlich Operationen, die sich als ein Teilbereich einer<br />
informellen Zensur verstehen lassen) und der formellen Zensur ergaben sich im<br />
Verlaufe des 18. Jahrhunderts sehr unterschiedliche Berührungspunkte, teils Synergien,<br />
teils gegenläufige Wirkungen.<br />
Theatralzensur ist eine der komplexesten Zensurarten, jedenfalls so „geschichtet“,<br />
dass sie Staatsrat Hatzfeld, so eine Anekdote aus der Anfangszeit der Allein-<br />
16
Einleitung<br />
regierung Josephs II., selbst für 10.000 Gulden nicht hätte ausüben wollen, für die<br />
damalige Zeit fast das dreifache Gehalt des Präses der Zensurkommission. Sie baut in<br />
einem hohen Maße auf einem „impliziten Wissen“ auf Basis minimal strukturierender,<br />
stets auslegungsbedürftiger und immer wieder neu auszulegender Prämissen<br />
auf, dabei auf Diskurse wie Praktiken unterschiedlichster Art Bezug nehmend: Bezug<br />
zur „Konversation“ und den dort vorfindlichen Sprachformierungen, Bezug<br />
zum ästhetischen Diskurs, Bezug zu Formen der Kanonbildung, zur neuen Entwicklung<br />
des Theaters, zum Diskurs der innen- wie außenpolitischen Entwicklungen,<br />
zur Transformation der kulturellen Codes etc. <strong>Der</strong> Theaterzensor bewegte sich, um<br />
ein Wort von vorhin aufzugreifen, gleichzeitig in vielen Ontologien der Zensur.<br />
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile.<br />
ZUR GLIEDERUNG DER STUDIE<br />
Die Formierung der Theatralzensur<br />
<strong>Der</strong> erste Teil befasst sich mit der Formierung der Theatralzensur zu Beginn der<br />
1770er Jahre als Ergebnis eines langdauernden und komplexen Prozesses, in welchen<br />
vielfältige soziale Akteure verwoben waren. Die Formierung erfolgte im Kontext<br />
eines Diskurses um die Reform der deutschen Bühne, welcher die Einführung einer<br />
stringenten Theatralzensur als wirkungsvolles Steuerungsmedium ansah, als Garant,<br />
unerwünschte Entwicklungen zu unterbinden und wünschenswerte Entwicklungen<br />
zu befördern, reformerische Ansätze, die auch stets im Bewusstsein einer qualifizierten<br />
Minderheit formuliert wurden. Damit entstanden strategische Planungen, welche<br />
sozialen Mechanismen in Gang gesetzt werden müssten, um dem gewünschten<br />
Modell im Sinne einer kulturellen Diffusion zum Durchbruch zu verhelfen. In Anknüpfung<br />
wie Weiterentwicklung früherer kameralistischer Schriften wird das<br />
Thea ter in Sonnenfels’ Polizeywissenschaft vornehmlich als eine Schule der Sitten und<br />
des Geschmacks verstanden und Theaterzensur als eine „produktive“ Form konzipiert,<br />
im Unterschied zur „defensiven“ Rolle der Bücherzensur. Die prätendierte<br />
Rolle des Theaters wird in dieser Arbeit im Kontext der kameralistisch entworfenen<br />
staatlichen Steuerungsoptionen diskutiert und dabei der Frage nachgegangen, welche<br />
normpoetischen Konsequenzen der kameralistische Diskurs mit sich brachte.<br />
Als „Gegenpol“ zur systematisch kameralistischen Abhandlung wird Sonnenfels’<br />
Rolle als anonymer Wochenschriftsteller diskutiert, welche es ihm ermöglichte, unterschiedliche<br />
Identitäten anzunehmen und damit seine Wirkung zu potenzieren,<br />
und zwar anhand der verschachtelten, auf Publikumswirkung abzielenden Inszenierung<br />
des Diskurses um die Reform des deutschen Theaters in der Wochenschrift <strong>Der</strong><br />
Mann ohne Vorurtheil. Dies eröffnet neue Perspektiven hinsichtlich der Logik des<br />
17
Einleitung<br />
Diskurses, vor allem auch im Hinblick auf die Bedrohungsbilder, die wirkungsvoll<br />
in Szene gesetzt werden sollten.<br />
<strong>Der</strong> nach einer kurzen Reformphase des deutschen Theaters erneut und verschärft<br />
aufbrechende Kampf gegen das extemporierte Theater, die „symbolische<br />
Kampfkarte“ des Diskurses, hatte ein politisches Dekret zur Folge, welches die Einführung<br />
einer eigenständigen Theatralzensur vorsah und Sonnenfels mit der Position<br />
eines Theatralzensors versah. Ziel war eine Theatralzensur als Bündelung bisher<br />
multipel wahrgenommener Aktivitäten: neben der Begutachtung von nunmehr obligatorisch<br />
einzureichenden Schauspieltexten war auch eine Beobachtung der Bühne<br />
vorgesehen. Die zensorische Kompetenz erweiterte sich auch auf bestimmte Fragen<br />
des „Geschmacks“. Die neue Regelung umfasste somit das definitive Verbot des extemporierten<br />
Theaters, allerdings beschränkt auf die Residenzstadt Wien – der von<br />
Sonnenfels eingebrachte Vorschlag eines landesweiten Verbots des Extemporierens<br />
wurde hingegen zurückgewiesen. In Auseinandersetzung mit den Legenden, welche<br />
in diesem Zensur-Dekret die Erfüllung der Sonnenfels’schen Programmatik feiern,<br />
wird der Frage nachgegangen, in welcher Weise dieser „politische Entscheid“, Ergebnis<br />
komplexer kultureller und sozialer Interaktionen sowie Verknüpfung diverser<br />
Diskursebenen, einen spezifischen Kompromiss darstellt, welcher durch den Diskurs<br />
erzeugt wurde, aber dennoch auch „jenseits“ der zentralen Diskurslinien angesiedelt<br />
war.<br />
Daran knüpft auch das abschließende Kapitel des ersten Teils an, in dem es um<br />
die rasche Abberufung von Sonnenfels als Theatralzensor und die Installierung von<br />
Franz Karl Hägelin als sein Nachfolger geht, eine, wie ich darzulegen versuche,<br />
strukturell logische Folge, die sich aus der vorgängigen Diskursdynamik und den<br />
dadurch entstandenen persönlichen, sozialen, kulturellen und politischen Reibungsflächen<br />
ergab.<br />
Instruktionen. Zur paradoxalen Logik von Theatralzensur<br />
<strong>Der</strong> zweite Teil der Arbeit trägt den Titel: „Instructionen. Zur paradoxalen Logik<br />
theatraler Zensur“. Methodisch bedingt wird hier ein Zeitsprung vorgenommen,<br />
und zwar zu Hägelins Mitte der 1790er Jahre verfasster Schrift, welche sich mit dem<br />
Thema von detaillierten theatralzensuriellen Instruktionen befasst, welche in vergleichbarer<br />
Form bislang nicht vorlagen. Diese Schrift ist in gewisser Hinsicht auch<br />
Resümee von Hägelins bisheriger Tätigkeit als Theatralzensor, wenn auch in besonderer<br />
Form den „jetzigen Zeitumständen“, der Zeit der Französischen Revolution,<br />
verpflichtet. Es handelt sich um eine Schrift, welche bereits Carl Glossy, als eine Art<br />
Anhang, seiner Arbeit über die Wiener Theatralzensur hinzugefügt hat, allerdings<br />
in einer Variante, welche viele Ausführungen dieser Schrift eliminierte. Durch das<br />
Auffinden bislang unbekannter Abschriften kann nunmehr die vollständige Schrift<br />
studiert werden, eine Schrift, welche in der von Glossy überlieferten Variante auch<br />
18
Einleitung<br />
das Bild der theresianischen wie josephinischen Zensur, teilweise sehr unkritisch und<br />
irreführend, geprägt hat. Damit erklärt sich der erwähnte Zeitsprung, der unumgänglich<br />
ist.<br />
Es wurde bislang angenommen, dass Hägelins Gutachten im Jahre 1795 verfasst<br />
worden sei und dass es ungarischen Theatralzensoren zur Direktive gedient hätte,<br />
darüberhinaus, dass es eine allseits rezipierte Schrift gewesen sei, welche sich bis Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts im Umlauf befunden hätte. Ich werde in meiner Arbeit diese<br />
Befunde revidieren. Aufgrund von verstreuten Abschriften der Wienbibliothek konnte<br />
ich den Anlass dieser Schrift rekonstruieren; dieser Anlass lag bereits im Jahr 1793<br />
und hatte zur Folge, dass „detaillierte Instruktionen“ eingeholt wurden, um solche<br />
im Sinne einer zensuriellen „Einförmigkeit“ nach Ungarn weiterzuleiten. Doch<br />
Hägelin hielt das Vorhaben einer „detaillierten Instruktion“ für unmöglich und<br />
kontraproduktiv. So entstand eine Schrift, die der <strong>Zensor</strong>, versehen mit Akten der<br />
Verweigerung, mit großer Verspätung einreichte. Hägelin hatte diese Schrift nicht<br />
verfassen wollen und war der Ansicht, dass es eigentlich unmöglich sei, sie zu schreiben.<br />
Diese aufgedrungene „Selbstentblößung“ des <strong>Zensor</strong>s ist eines der bedeutendsten<br />
Dokumente zur Theatralzensur des 18. Jahrhunderts, welches – bislang noch<br />
nicht systematisch analysiert – die spezifische Paradoxie theatraler Zensur offenlegt.<br />
Das zweite Kapitel des zweiten Teils „Im Spiegel der Zensur“ kehrt zurück zur<br />
späten theresianischen Zeit, zu einer anderen „Zensur“ und zu Personen, mit denen<br />
Hägelin beruflich vielfach zu tun hatte – zum Gremium der Begutachter des Burgtheaters,<br />
das 1776 zur Nationalbühne erhoben wurde, lang erhofftes Ziel eines historischen<br />
Kulturprojekts. Mittlerweile waren die Schauspieler zu Garanten des „gereinigten“<br />
Geschmacks und des „regelmäßigen“ Schauspiels geworden. Analysiert wird<br />
die Begutachtungspraxis von Dramentexten, welche 1779 von überall her eingereicht<br />
wurden: mehr als 250 Stücke, wovon letztlich zwei ausgewählt wurden. Es war also<br />
bereits ein sehr selektives Angebot, das das Theater dem <strong>Zensor</strong> vorlegte. Damit<br />
liegt eine wertvolle Quelle zur Rezeption des Verhaltens der Theatralzensur vor, da<br />
die Schauspieler, die dramatischen Censoren, bei ihrer Gesamtbeurteilung auch<br />
„zensurielle“ Gesichtspunkte einbrachten. Diese Dokumente geben Aufschluss über<br />
die Vielfalt von Erwartungen im Hinblick auf das „Aufführbare“ zur damaligen<br />
Zeit, nicht nur vonseiten der Schauspieler, sondern auch vonseiten der Schriftsteller.<br />
Sie lassen auch erkennen, wie Zensurgesichtspunkte im Kontext einer dramatischen<br />
„Zensur“ verwendet wurden, teilweise eingesetzt aus strategischen Gründen. Sie<br />
zeigen gleichermaßen Nähe wie Distanz zur Theatralzensur.<br />
Kultureller Stau gegen Ende der theresianischen Zeit<br />
<strong>Der</strong> dritte Teil der Arbeit widmet sich den „Perturbationen“ der Zensur gegen Ende<br />
der theresianischen Zeit, dem in aller Eile die Zensurreform Josephs II. folgte, Turbulenzen,<br />
die sich auch in vielfältigen Akten des Widerstands manifestierten, Turbu-<br />
19
Einleitung<br />
lenzen, von denen auch der Theatralzensor nicht unbehelligt blieb. Das erste Kapitel<br />
befasst sich mit den neuen verbotenen Theaterstücken in den letzten vier Jahren der<br />
theresianischen Zeit. Eine diesbezügliche Auswertung des Catalogus librorum prohibitorum<br />
lässt spezifische Entwicklungstendenzen erkennen. Nicht die „derbe“ Komödie,<br />
sondern das deutsche Trauerspiel, vor allem auch die bürgerliche Tragödie, löst<br />
Zensurreaktionen aus, welche zum Verbot des Druckes führen, davon betroffen auch<br />
zahlreiche Musenalmanache und Poesien. Hier wird deutlich, dass sich offensichtlich<br />
neue Unsicherheitsfaktoren im Zuge einer immer schwerer zu kontrollierenden Informationsmenge<br />
ergeben haben. Vier der verbotenen Stücke werden näher analysiert,<br />
eine lohnenswerte Aufgabe, da diese Stücke kurze Zeit später – im Zuge der<br />
Zensurreform Josephs II. – wieder freigegeben wurden; die Gründe für das Verbot<br />
wie für das Nicht-Verbot lagen nah beieinander. Ebenso analysiert werden Stücke,<br />
welche nach einmaliger Aufführung wieder abgesetzt wurden, in den untersuchten<br />
Fällen Indiz für ein nachträglich ausgesprochenes Verbot, gewissermaßen auch eine<br />
Zensur des <strong>Zensor</strong>s, der seine Zustimmung zur Aufführung gegeben hatte. Es wird<br />
nachvollziehbar, dass solche nachträglichen Eingriffe auch zu einer Verunsicherung<br />
der Theatralzensur führten wie zu dezenten Akten des Widerstands der mit der<br />
Sache befassten Behörde.<br />
Das zweite Kapitel des dritten Teils befasst sich mit dem in den 1770er Jahren sich<br />
verstärkenden Diskurs um eine Reform der Zensur wie auch mit jenen strategisch<br />
geführten Debatten, welche einzelne Zensurmaßnahmen begleiteten – die Verteidigung<br />
der von der Zensur Betroffenen wurde in die Öffentlichkeit getragen und auf<br />
verschiedene Weise inszeniert. Die Debatten mehrten sich, in denen Kritik an den<br />
bestehenden Zensurinstitutionen geübt wurde – vor allem unter zwei Perspektiven:<br />
Zensur in der bisher ausgeübten Form sei dysfunktional und erreiche das Gegenteil<br />
dessen, was eigentlich erreicht werden soll – durchaus auch im Sinne neuer Dispositive<br />
der Macht; und die bestehende Zensur sei ökonomisch destruktiv, indem sie<br />
einen aufstrebenden Wirtschaftszweig behindere.<br />
Eine der einschneidendsten Maßnahmen einer sich verschärfenden Zensur gegen<br />
Ende der theresianischen Zeit war das Verbot der von Friedrich Nicolai herausgegebenen<br />
Allgemeinen deutschen Bibliothek, anerkanntes Medium für die Präsentation der<br />
neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Literatur, welches<br />
auch zu deutlicher Kritik im Ausland wie zu einer Verteidigungsschrift in Österreich<br />
führte, deren Autor Benedikt Dominik Anton Cremeri seine Abhandlung mit einem<br />
in Linz publizierten Hymnus an die Zensur beschloss. Dies gibt Gelegenheit, sich mit<br />
dem Zensurfall „Wenzel Heinze“, Linzer Gymnasiallehrer und Schrift steller, zu befassen,<br />
dessen Vermischte Schriften verboten wurden und der diesen „Hymnus“ als stilistisch<br />
raffinierten Protestakt publiziert hat – Ausgangspunkt für eine vielgestaltige<br />
öffentliche Strategie des Widerstands, darunter die Publikation eines anonym herausgegebenen<br />
Theaterstückes, welches in aller Detailliertheit die Zensurverhandlung<br />
20
Einleitung<br />
über Heinzes poetische Schriften zum Gegenstand hat – ein Fall, in den auch Franz<br />
Karl Hägelin vielfältig und ambivalent verwoben war.<br />
Theatralzensur unter Joseph II.<br />
<strong>Der</strong> vierte und abschließende Teil der Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Theatralzensur<br />
im Jahrzehnt der Alleinregierung Josephs II., ein Aspekt, der bislang noch<br />
in keiner Weise systematisch untersucht wurde. Einer der Indikatoren des veränderten<br />
kulturellen Klimas wird dabei die Freisetzung bisher verbotener theatraler Literatur<br />
sein, wenngleich für die Aufführung nach wie vor strengere Verhaltensvorschriften<br />
galten. In diesem josephinischen Jahrzehnt wurde die Theaterzensur von einem<br />
Zentralisierungsprozess erfasst, allerdings mit Verzögerung und für nur kurze Zeit.<br />
Auf vier Theaterthemen werde ich sehr detailliert eingehen, Theaterthemen,<br />
welche die spezifische josephinische Paradoxie im Umgang mit der Zensur zum Ausdruck<br />
bringen: Dabei handelt es sich erstens um das von der staatlichen Lottopachtung<br />
beantragte Verbot eines ländlichen Sittenstückes über die Spielsucht, der erste<br />
von ökonomischen Interessen geleitete theatrale Verbotsfall unter der Alleinregierung<br />
Josephs II., welcher gleichzeitig mit einer Aufforderung zu gesteigerter Liberalität<br />
verbunden war (man soll den <strong>Zensor</strong> nicht furchtsam machen). Zweitens geht es<br />
um ein Stück, welches, in der theresianischen Zeit sogar als Text verboten, nunmehr<br />
– in Bearbeitung – auch aufgeführt werden konnte, nämlich um Julius von Tarent von<br />
Johann Anton Leisewitz, eines der bedeutendsten Dramen der 1770er Jahre, an dessen<br />
Wiener Version die „Wegrationalisierung“ des Religiösen auf der Bühne eindrucksvoll<br />
studiert werden kann, nebst einer, ebenfalls dem Thema der Erstgeburt<br />
gewidmeten theatralen Satire von Friedrich Maximilian Klinger: Prinz Seiden-Wurm<br />
der Reformator, einem der Theatertexte, welche in den josephinischen Index aufgenommen<br />
wurden.<br />
Drittens wird ein besonderes Augenmerk auf Beaumarchais’ Lustspiel Die Hochzeit<br />
des Figaro gerichtet, das trotz Aufführungsverbots in vielfältigen Medien zirkulierte,<br />
eine geradezu paradigmatische Erscheinung der josephinischen Ära. Die Zensurgeschichte<br />
von Beaumarchais’ Komödie wird anhand bislang unbeachteter Dokumente<br />
von neuer Warte aus geschrieben: als nahezu „josephinisch-theatraler Unfall“<br />
und nicht als Inbegriff josephinischer Theatralzensur. Das vierte und letzte Stück ist<br />
Die Sonnenjungfrau von August Friedrich Ferdinand von Kotzebue, ein Schauspiel,<br />
welches Hägelin in seinen detaillierten Instruktionen als Musterbeispiel eines Stückes<br />
genannt hat, dessen Stoff gegen Sitte, Religion und Staat verstoße – ein Verdikt,<br />
das allerdings nach weiterer Bearbeitung des Stücks einer Aufführung nicht im Wege<br />
stand. Hier liegt ein exemplarischer Zensurfall vor, gleichsam auch eine Ermöglichung<br />
des Unmöglichen, der in der Tradition von „vestalischen“ Dramen steht, welche<br />
in den 1780er Jahren in einer stark reduzierten Verbotsliste von Dramendrucken<br />
nach wie vor aufgeführt waren.<br />
21