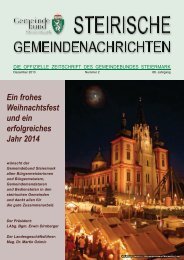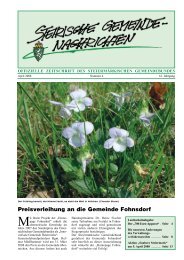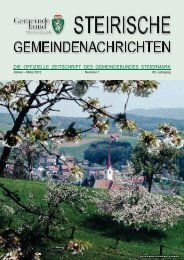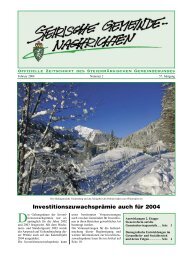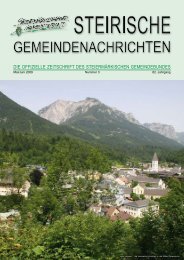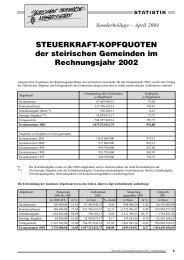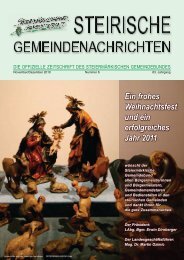steuern & finanzen - Steiermärkischer Gemeindebund - Steiermark
steuern & finanzen - Steiermärkischer Gemeindebund - Steiermark
steuern & finanzen - Steiermärkischer Gemeindebund - Steiermark
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
OFFIZIELLE ZEITSCHRIFT DES STEIERMÄRKISCHEN GEMEINDEBUNDES<br />
Juli 2006 Nummer 7 59. Jahrgang<br />
Die Stadtgemeinde Eisenerz mit dem Erzberg – Zentrum der „Steirischen Eisenstraße“ Foto: Petra Loitzl<br />
ICNW-Tagung „Kommunale Infrastruktur in<br />
ländlichen Gemeinden“<br />
Am 22. und 23. Juni 2006 fand<br />
in Gleisdorf eine internationale<br />
Konferenz des International<br />
Communal Network (ICNW) statt.<br />
Dieses Netzwerk ländlicher Gemeinden<br />
zum Austausch von Erfahrungen<br />
und Know-how aus der kommunalen<br />
Praxis wurde im Jahre 2004 als Interreg<br />
III C Projekt über Initiative des Österreichischen<br />
<strong>Gemeindebund</strong>es gestartet,<br />
der auch die leitende Partnerschaft in<br />
diesem Projekt übernahm.<br />
In Gleisdorf trafen sich nun über 70<br />
Repräsentanten aus den 13 europäischen<br />
ICNW-Partnerländern zu einer<br />
Konferenz, an der auch zahlreiche<br />
Gemeindevertreter aus der <strong>Steiermark</strong><br />
teilnahmen. Diese Tagung ist das Thema<br />
des Präsidentenwortes auf Seite 2, ein<br />
ausführlicher Bericht folgt in der nächs-<br />
ten Ausgabe der „Steirischen Gemeindenachrichten“.<br />
Sind die Einheitswerte des<br />
Grundvermögens noch<br />
verfassungskonform? ......... Seite 4<br />
20 Jahre<br />
Steirische Eisenstraße ......... Seite 14
DER PRÄSIDENT<br />
Liebe Bürgermeisterinnen<br />
und Bürgermeister!<br />
Geschätzte Gemeindemandatare<br />
und Mitarbeiter!<br />
Verehrte Freunde der<br />
steirischen Gemeinden!<br />
Am 22. und 23. Juni 2006 fand im<br />
forumKloster in Gleisdorf eine internationale<br />
Konferenz des ICNW zum<br />
Thema „Kommunale Infrastruktur in<br />
ländlichen Gemeinden“ statt. Veranstalter<br />
dieser Tagung war der Österreichische<br />
<strong>Gemeindebund</strong> in Zusammenarbeit<br />
mit unserem Landesverband. In<br />
Vertretung von <strong>Gemeindebund</strong>präsident<br />
Bgm. Mödlhammer konnte ich zahlreiche<br />
Ehrengäste und Kommunalvertreter<br />
aus den steirischen Gemeinden begrüßen,<br />
allein über 70 Repräsentanten aus<br />
den ICNW-Partnerländern waren nach<br />
Gleisdorf gekommen.<br />
Eine europaweit einzigartige<br />
Initiative des Österreichischen<br />
<strong>Gemeindebund</strong>es<br />
Das International Communal Network<br />
(ICNW) ist ein Interreg III C Projekt<br />
und wurde vom Österreichischen <strong>Gemeindebund</strong><br />
initiiert. Damit entstand<br />
erstmals in Europa ein Netzwerk ländlicher<br />
Gemeinden zum Austausch von<br />
Erfahrungen und Know-how aus der<br />
kommunalen Praxis. 2004 wurde das<br />
ICNW erfolgreich gestartet und der<br />
Österreichische <strong>Gemeindebund</strong> übernahm<br />
die federführende Partnerschaft.<br />
Als Schwerpunktthemen hatte man die<br />
2 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
Das „Internationale Kommunale<br />
Netzwerk“ (ICNW)<br />
Herausforderung unserer Zeit und Chance für die Zukunft<br />
Bereiche Raumordnung, kommunale<br />
Infrastruktur, Gemeinden und Wirtschaft<br />
(KMUs) im ländlichen Raum<br />
festgelegt.<br />
Das Projekt umfasst 21 Partner aus 10<br />
EU-Staaten und 3 EU-Beitrittskandidaten<br />
– neben Österreich sind die Länder<br />
Bulgarien, Deutschland, Griechenland,<br />
Italien, Kroatien, Lettland, Polen, Rumänien,<br />
Slowakei, Slowenien, Spanien<br />
und Ungarn vertreten. Durch diese<br />
Partner erreicht das Netzwerk etwa<br />
9.600 Mitgliedsgemeinden mit einer<br />
Bevölkerung von rund 100 Millionen<br />
Menschen. Die Partner kommunizieren<br />
direkt durch ein Internet-Portal – die<br />
Projektwebsite www.icnw.org und das<br />
datenbankgestützte Wissensmanagement-System<br />
ICNWeb – sowie durch<br />
insgesamt 34 Projektveranstaltungen.<br />
Praxisbeispiele zur kommunalen<br />
Infrastruktur in ländlichen<br />
Gemeinden<br />
Die Infrastruktur in ländlichen Gemeinden<br />
und die damit zusammenhängende<br />
Zukunft des ländlichen Raumes überhaupt<br />
beschäftigt die österreichischen<br />
Gemeinden und ihre Interessenvertretungen<br />
bereits seit geraumer Zeit.<br />
Dieses Thema steht daher auch im<br />
Mittelpunkt des diesjährigen Österreichischen<br />
Gemeindetages und wird in<br />
dessen Vorfeld in Bundesländerkonferenzen<br />
aufbereitet. So befasste sich die<br />
steirische Landeskonferenz Ende März<br />
in Lannach mit dem Problemkreis der<br />
Arbeitsplätze im ländlichen Raum.<br />
Die Stärkung der Infrastruktur in den<br />
ländlichen Regionen ist aber nicht nur<br />
in Österreich, sondern auch in Europa<br />
allgemein ein höchst aktuelles Thema.<br />
Dies zeigte das große Interesse an der<br />
Konferenz in Gleisdorf sehr deutlich.<br />
Ziel der Konferenz war es daher, Vorzeigebeispiele<br />
und Ansätze betreffend<br />
die kommunale Infrastruktur in ländlichen<br />
Gemeinden auf Basis von internationalen<br />
Fachbeiträgen zu präsentieren<br />
und dadurch eine länderübergreifende<br />
Betrachtung der jeweiligen Projektrealisierungen<br />
zu ermöglichen. Anhand<br />
konkreter Beispiele berichteten die<br />
Projektpartner aus ihren Regionen<br />
über Umsetzungen im Abfall-, Wasser-<br />
und Abwasser- sowie Energiebereich<br />
und deren Herausforderungen für die<br />
Zukunft. Von österreichischer Seite<br />
wurden unter anderem die umfassenden<br />
Solar-Projekte der Stadt Gleisdorf und<br />
die „Energievision Murau“ mit erneuerbarer<br />
Energie, die Marktgemeinde Lannach<br />
mit ihrem Abfallsystem und der<br />
Mürzverband mit seinem Entsorgungsmodell<br />
sowie die Gemeindekooperation<br />
in der steirischen Wasserversorgung und<br />
Abwasserbeseitigung und die Abwasserbeseitigung<br />
am Projekt Pöllauer Tal<br />
präsentiert. Begleitet wurde die Konferenz<br />
von einem Wirtschaftssymposion,<br />
bei dem sich 10 steirische, international<br />
ausgerichtete Unternehmen mit Informationsständen<br />
den Tagungsteilnehmern<br />
präsentierten.<br />
Gemeindebünde und Regionen Europas<br />
boten somit an den beiden Konferenztagen<br />
ein breit gefächertes Programm<br />
aus der kommunalen Praxis und zeigten<br />
einmal mehr, dass der Fundus an „Best<br />
Practise Beispielen“ in den Gemeinden<br />
der ICNW-Partnerländer enorm ist.<br />
In persönlichen Gesprächen konnten<br />
Erfahrungen ausgetauscht, Kontakte<br />
geknüpft und vielleicht sogar künftige<br />
Kooperationen und Projekte initiiert<br />
werden.<br />
Das Internationale Kommunale Netzwerk<br />
kann daher einer der gangbaren<br />
Wege sein, den immer größer werdenden<br />
Herausforderungen gemeinsam<br />
– auch über Staatsgrenzen hinweg<br />
– zu begegnen und Lösungsansätze<br />
zu finden. Im Kleinen wie im Großen<br />
– ob von Gemeinde zu Gemeinde, von<br />
Region zu Region oder von Staat zu<br />
Staat – liegt also einmal mehr die Zukunft<br />
in verstärkter Zusammenarbeit.<br />
Von diesem Blickwinkel aus werden<br />
wir auch künftig unsere gemeinsamen<br />
Bemühungen sehen müssen.<br />
Euer<br />
Bürgermeister a. D. Hermann Kröll, NRAbg. a. D.,<br />
Präsident des Steiermärkischen <strong>Gemeindebund</strong>es<br />
1.Vizepräsident des Österreichischen <strong>Gemeindebund</strong>es
Die „Innovativste Gemeinde Österreichs“<br />
wird gesucht<br />
Bereits zum dritten Mal veranstalten<br />
der Österreichische <strong>Gemeindebund</strong><br />
und die Kommunalkredit<br />
Austria zusammen mit dem<br />
WirtschaftsBlatt diesen Wettbewerb.<br />
Zahlreiche Gemeinden haben schon ihre<br />
Projekte zum Wettbewerb der „Innovativsten<br />
Gemeinde Österreichs 2006“<br />
eingereicht. Die Einreichfrist für diesen<br />
größten kommunalen Wettbewerb Österreichs<br />
läuft noch, die Sieger werden<br />
vor großem Publikum am Gemeindetag<br />
2006 in Wien ausgezeichnet.<br />
„Die Anforderungen an eine gut funktionierende<br />
Gemeinde werden nicht<br />
nur quantitativ größer, sie werden<br />
auch immer mehr zu einer inhaltlichen<br />
Herausforderung für die heimischen<br />
Gemeinden“, weiß Helmut Mödlhammer,<br />
Präsident des Österreichischen <strong>Gemeindebund</strong>es<br />
und Bürgermeister der<br />
Gemeinde Hallwang in Salzburg. „Im<br />
oft zu führenden Konkurrenzkampf und<br />
Standortwettbewerb mit anderen Gemeinden<br />
haben Kommunen mit hoher<br />
Innovationskraft meist die Nase vorn.“<br />
Um erfolgreich zu sein, braucht es weit<br />
mehr als nur als kommunale Verwaltungseinheit<br />
zu agieren. Erfolgreiche<br />
Gemeinden müssen heute handeln wie<br />
Unternehmen. Ideen sind gefragt. Und<br />
daran mangelt es in den Gemeinden<br />
nicht. Was alles an Know-how in den<br />
Gemeinden steckt, soll mit dem Wettbewerb<br />
zur Suche der innovativsten<br />
Gemeinden in Österreich aufgezeigt<br />
werden.<br />
Betriebe mit dabei<br />
Erstmals können die Gemeinden beim<br />
Wettbewerb auch ihre Projekte in Kooperation<br />
mit der lokalen Wirtschaft nominieren,<br />
wobei jedoch die Einreichung<br />
über den Bürgermeister laufen muss.<br />
Durch den Wettbewerb werden nicht nur<br />
innovative Projekte vor den Vorhang geholt,<br />
vielmehr kommt es dadurch auch<br />
zu einem Know-how-Transfer, der anderen<br />
Gemeinden gangbare Lösungsansätze<br />
aufzeigt. Man kann von den Ideen<br />
der anderen lernen.<br />
Die Bewertungskriterien<br />
Über die besten Ideen und Konzepte<br />
entscheidet eine hochkarätige Fach-<br />
Jury, der neben den Veranstaltern auch<br />
zwei Minister und ein wissenschaftlicher<br />
KMU-Experte angehören. Die<br />
eingereichten Projekte werden nach<br />
folgenden fünf Kriterien von der Jury<br />
bewertet:<br />
Der Innovationsgrad:<br />
Also das Besondere am Projekt, das<br />
über das Pflichtversorgungs-Programm<br />
der Gemeinden hinausgeht.<br />
Der volkswirtschaftliche Nutzen:<br />
Das heißt die Auswirkungen auf Jobs<br />
und Wertschöpfung.<br />
Die Effizienz:<br />
Wirtschaftlichkeit und Verwaltungsvereinfachung<br />
werden hier berücksichtigt.<br />
Die regionalen Impulse:<br />
Was bringt das Projekt der Bevölkerung<br />
und der Umwelt?<br />
Der ökologische und soziale Wert:<br />
Dabei wird beurteilt, wie das Konzept<br />
von der Bevölkerung mitgetragen wird.<br />
Einreichfrist: 31. Juli 2006<br />
Eingereicht werden können ab sofort<br />
innovative Projekte aus allen Sparten,<br />
die Anmeldung ist bis 31. Juli 2006<br />
auf www.kommunalnet.at/innovation<br />
möglich. Jede Gemeinde kann bis zu<br />
drei Projekte nominieren. Wie auch in<br />
den vergangenen zwei Jahren können<br />
Index der Verbraucherpreise<br />
1966 1976 1986 1996 2000 2005<br />
März 2006 419,4 239,0 153,7 117,6 111,7 101,0<br />
April 2006 421,4 240,1 154,5 118,1 112,3 101,5<br />
Mai 2006 (vorläufig) 421,8 240,4 154,6 118,3 112,4 101,6<br />
ÖSTERREICH<br />
Kommunen auch grenzübergreifend<br />
partnerschaftlich auftreten, wobei eine<br />
Gemeinde die Leitstelle sein muss.<br />
Machen Sie mit und zeigen Sie, welche<br />
Innovationskraft in Ihrer Gemeinde<br />
steckt. Die Gewinner werden im Rahmen<br />
des Österreichischen Gemeindetages im<br />
September in Wien ausgezeichnet.<br />
Alle Unterlagen und Informationen<br />
zum Wettbewerb finden Sie unter<br />
www.kommunalnet.at/innovation.<br />
Inhalt<br />
Steuern & Finanzen<br />
Sind die Einheitswerte des<br />
Grundvermögens noch<br />
verfassungskonform?................... 4<br />
Wirtschaftsentwicklung lässt<br />
höhere Steuereinnahmen<br />
bis 2008 erwarten ........................ 5<br />
Recht & Gesetz<br />
Bauabgabe für eine Tiefgarage?...7<br />
Arbeitsrecht für Arbeitgeber........ 8<br />
Ausgliederung und<br />
öffentlicher Dienst ....................... 8<br />
Termine<br />
Berufsorientierungsprojekt<br />
„Freiwilliges Soziales Jahr“<br />
für steirische Jugendliche ............ 9<br />
RAINBOWS-Feriencamps<br />
für Kinder und Jugendliche ......... 9<br />
Vortrag „Wer hat an der<br />
Uhr gedreht“ ................................ 9<br />
53. Österreichischer<br />
Gemeindetag.............................. 16<br />
Europa<br />
Neues zu Europa........................ 10<br />
Umwelt<br />
Mehr „Murerleben“ durch<br />
LIFE Natur Projekt ................... 12<br />
Stille Wasser .............................. 13<br />
Österreichische Umweltauszeichnung<br />
für Weiz............... 13<br />
Land & Gemeinden<br />
20 Jahre Steirische Eisenstraße... 14<br />
Das Vulkanland als<br />
Gesundheitsregion ..................... 14<br />
Kurzmeldungen ......................... 15<br />
Impressum ................................. 16<br />
Steirische Gemeindenachrichten 7/06 3
STEUERN & FINANZEN<br />
Sind die Einheitswerte des Grundvermögens noch<br />
verfassungskonform?<br />
In regelmäßigen Zeitabständen<br />
wird die Frage aufgeworfen, ob<br />
die Einheitswerte (EW) für das<br />
Grundvermögen noch verfassungskonform<br />
sind – vor allem seit das<br />
Deutsche Bundesverfassungsgericht<br />
im Jahr 1995 die EW (die letzte<br />
Hauptfeststellung wurde in der BRD<br />
im Jahr 1964 durchgeführt) wegen<br />
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes<br />
als verfassungswidrig erklärt hat (Vergleich<br />
der Entwicklungen der Wertrelationen<br />
der EW des Grundvermögens<br />
zum Wert des Geldkapitals).<br />
In Österreich ist die Ausgangslage<br />
– zumindest was die per 1. 1. 1973<br />
ebenfalls bereits lang zurückliegende<br />
letzte Hauptfeststellung der EW anlangt<br />
– eine ähnliche.<br />
Aufgrund des Verfassungsgerichtshof-Beschlusses<br />
im Verfahren B<br />
3391/05 vom 15. März 2006 leitet das<br />
Höchstgericht amtswegig ein Gesetzesprüfungsverfahren<br />
hinsichtlich der<br />
Verfassungskonformität des § 19 Abs. 2<br />
und Abs. 3 des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes<br />
1955 ein. Für die<br />
in Prüfung gezogene Norm wird für<br />
die Wertermittlung zur Erbschafts- oder<br />
Schenkungssteuer das Dreifache des<br />
EW herangezogen.<br />
Eine Auswirkung auf die EW des<br />
Grundvermögens und somit auf die Bemessungsgrundlage<br />
für die Grundsteuer<br />
ist somit nicht auszuschließen.<br />
Ist-Zustand<br />
Die Grundsteuer gehört zu den ältesten<br />
Formen der direkten Besteuerung und<br />
entstammt in ihrer derzeitigen Ausformung<br />
dem deutschen Grundsteuerrecht<br />
aus dem Jahre 1936.<br />
Nach dem Finanzausgleichsgesetz<br />
gehört sie zum Katalog der ausschließlichen<br />
Gemeindeabgaben und wird in<br />
einem mehrstufigen Verfahren bemessen<br />
bzw. erhoben:<br />
• Das örtlich zuständige Finanzamt<br />
stellt die EW und die Grundsteuermessbeträge<br />
fest.<br />
• Die Gemeinde wendet den vom Gemeinderat<br />
beschlossenen Hebesatz<br />
auf den Steuermessbetrag an und<br />
setzt die Grundsteuer durch Grundsteuerbescheide<br />
fest.<br />
4 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
Die Hebesätze für die Grundsteuer<br />
werden in den jeweiligen Finanzausgleichsgesetzen<br />
mit einer Obergrenze<br />
festgesetzt. Diese betragen seit dem<br />
Jahre 1992 sowohl für das land- und<br />
forstwirtschaftliche Vermögen als auch<br />
für das Grundvermögen 500 v. H. des<br />
jeweiligen Steuermessbetrages.<br />
Das zuletzt festgestellte Grundsteueraufkommen<br />
(2004) ergab<br />
• für das land- und forstwirtschaftliche<br />
Vermögen einen Ertrag von<br />
26,3 Mio. Euro und<br />
• für das Grundvermögen einen Ertrag<br />
von 496,4 Mio. Euro.<br />
Besteuerungsgegenstand der<br />
Grundsteuer<br />
Besteuert wird der inländische Grundbesitz.<br />
Zum Grundvermögen gehört der<br />
Grund und Boden einschließlich der Bestandteile<br />
(insbesondere Gebäude) und<br />
des Zubehörs (§ 51 Bewertungsgesetz<br />
1955 – BewG 1955).<br />
Das Grundvermögen wird in Grundstückshauptgruppen<br />
gegliedert. Mit<br />
Stichtag 1. Juni 2006 werden in den<br />
Finanzämtern in Österreich 2.212.810<br />
EW-Akte wie folgt verwaltet:<br />
Grundstückshauptgruppen<br />
Letzte Hauptfeststellung<br />
per 1. 1. 1973<br />
LGF-Stellvertreter Prof. Dietmar Pilz,<br />
<strong>Steiermärkischer</strong> <strong>Gemeindebund</strong><br />
Die letzte Hauptfeststellung der EW<br />
des Grundvermögens hat zum Stichtag<br />
1. 1. 1972 mit Wirksamkeit 1. 1. 1973<br />
stattgefunden. In Etappen wurden diese<br />
Werte um insgesamt 35 % linear im<br />
Zeitraum 1977 bis 1983 angehoben.<br />
Seit dieser Zeit hat es der Bundesgesetzgeber<br />
verabsäumt, die gesetzlich<br />
vorgesehene Hauptfeststellung der EW<br />
durchzuführen.<br />
Wohl wurde ab 1. 1. 1992 der im Finanzausgleichsgesetz<br />
geregelte Hebesatz der<br />
Grundsteuer (freies Beschlussrecht der<br />
Gemeinden) von 420 % auf 500 % angehoben,<br />
im Gegenzug wurde aber der<br />
Getränkesteuer-Hebesatz für alkoholfreie<br />
Getränke von 10 % auf 5 % (aufkommensneutrale<br />
Maßnahme) gesenkt.<br />
EW-Feststellung<br />
Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken<br />
wird der Gebäudewert aus dem<br />
Neuherstellungswert abgeleitet, der sich<br />
– z. B. bei Einfamilienhäusern – je nach<br />
Bauweise und Ausstattung der Gebäude<br />
(Bauklasse) und nach Durchschnittspreisen<br />
je Kubikmeter des umbauten<br />
Raumes ergibt; zum Teil werden bei den<br />
Grundstückshauptgruppen auch Durchschnittspreise<br />
je Quadratmeter Nutzfläche<br />
herangezogen. Die Bauklasseneinteilung<br />
und die Durchschnittspreise sind<br />
in der Anlage zu § 53a BewG 1955 enthalten.<br />
Diese Durchschnittspreise bilden<br />
– unverändert seit 1. 1. 1973! – die<br />
Grundlage für die EW-Ermittlung.<br />
fertig bebaute<br />
Grundstücke<br />
im Zustand<br />
der Bebauung<br />
unbebaute Grundstücke 462.592 ---<br />
Mietwohngrundstücke 327.889 6.369<br />
Geschäftsgrundstücke 122.994 1.177<br />
Fabriksgrundstücke 7.065 37<br />
Gemischt genutzte Grundstücke 115.694 1.610<br />
Einfamilienhäuser 1.037.018 10.508<br />
sonstige bebaute Grundstücke 139.558 273<br />
Summe 2.212.810 19.974<br />
Die Bewertung von unbebauten Grundstücken<br />
erfolgt gemäß § 55 BewG 1955<br />
mit dem gemeinen Wert – ebenfalls<br />
mit Grundstückspreisen zum Stichtag<br />
1. 1. 1973.<br />
Die Höhe der Einheitswerte des gesamten<br />
inländischen Grundvermögens beruht<br />
demnach auf Werten, welche zum<br />
1. 1. 1973 rückgerechnet werden.
Grundsteuerdynamik<br />
Die Aufkommenszuwächse, also die<br />
Dynamik der Grundsteuer, ist seit 1973<br />
– mit Ausnahme der linearen Erhöhung<br />
der EW um 35 % Anfang der 80er-Jahre<br />
– nur durch Neubauten, Umbauten und<br />
das Auslaufen der zeitlichen Grundsteuerbefreiung<br />
bestimmt. Die landesgesetzlich<br />
geregelten Grundsteuerbefreiungen<br />
selbst sind wohl als anachronistisch zu<br />
bezeichnen, zumal sie die ohnehin niedrige<br />
Grundsteuerlast zum Teil noch erheblich<br />
schmälern – einigen Gemeinden<br />
entgehen durch die Grundsteuerbefreiung<br />
bis zu 50 % ihres bereits ohnehin<br />
schwachen Grundsteueraufkommens.<br />
Zudem enthält das BewG 1955 selbst<br />
noch mehrere Abzüge bei der EW-Ermittlung,<br />
so z. B. bei der Bewertung<br />
von Einfamilienhäusern: Hier wird vom<br />
(per 1. 1. 1973 festgestellten) Bodenwert<br />
nur ein Anteil von 75 % angesetzt. Aber<br />
auch vom Gebäude und dem „gekürzten“<br />
Bodenwert erfolgt nochmals eine<br />
Kürzung um 30 %. Es erfolgen also noch<br />
im BewG 1955 geregelte Kürzungen der<br />
Gebäude und der Grundstückswerte, die<br />
ohnehin auf Werten des Jahres 1973 beruhen.<br />
Nachdem als Wertermittlung des<br />
Grundvermögens der Stichtag 1. 1. 1973<br />
gilt, hat sich das Grundsteueraufkommen<br />
seit diesem Zeitraum faktisch nur um<br />
die lineare Erhöhung der Einheitswerte<br />
um 35 % verändert. Die jährlichen Zuwachsraten<br />
des Grundsteueraufkommens<br />
beruhen somit, wie bereits ausgeführt,<br />
zum größten Teil auf Neu-, Zu- und Umbauten<br />
und dem Auslaufen der zeitlichen<br />
Grundsteuerbefreiung.<br />
Mit dem innerösterreichischen<br />
Stabilitätspakt 2005 haben<br />
die Finanzausgleichspartner<br />
bis zum Jahr 2008 einen gesamtstaatlichen<br />
Haushaltsausgleich vereinbart.<br />
Die österreichischen Gemeinden<br />
haben sich dabei verpflichtet, diesen<br />
Haushaltsausgleich (Null-Defizit)<br />
jährlich in die Defizitquote einzubringen.<br />
Zur mittelfristigen Prognose<br />
hat der Bund die Eckdaten für die<br />
Prognose der Ertragsanteile für die<br />
Länder und Gemeinden zu liefern.<br />
Dieser Informationspflicht ist der<br />
Bund mit seiner Mai-Prognose 2006<br />
nachgekommen. Mittelfristig ist<br />
durch die Konjunkturentwicklung<br />
mit steigenden Ertragsanteilen ab<br />
dem Jahr 2007 zu rechnen.<br />
Durch das starre Festhalten am Stichtag<br />
1. 1. 1973 weist das Besteuerungssystem<br />
des Grundvermögens fast Züge<br />
einer „Mengensteuer“ auf. Ohne eine<br />
Indizierung der Mengensteuersätze wird<br />
das Aufkommen der Mengensteuer ausschließlich<br />
an der umgesetzten Menge<br />
bemessen. Wertsteigerungen der Menge<br />
(hier sind die EW gemeint) bleiben ohne<br />
Auswirkung auf das Aufkommen.<br />
Der Baukostenindex für Hochbauten<br />
(Basis 1945 = 100) als Indikator für<br />
Wertsteigerungen von Gebäuden hat<br />
seit 1973 eine Steigerung von 561 % erfahren.<br />
Eine diesem Index annähernde<br />
EW-Anpassung ist bisher unterblieben.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Durch die lange Säumnis einer neuen<br />
Hauptfeststellung in Österreich haben<br />
die maßgeblichen Bestimmungsgrößen<br />
der letzten Hauptfeststellung zum<br />
1. 1. 1973 (Verkehrswerte für Grund<br />
und Boden, fiktive Neuherstellungswerte<br />
für Gebäude etc.) durch die regional<br />
sehr unterschiedlichen strukturellen<br />
Entwicklungen (Beispiel: Gebiete mit<br />
„Industrieruinen“) ihren Zusammenhalt<br />
verloren, was möglicherweise zu verfassungsrechtlichen<br />
Bedenken wegen<br />
ungleicher Behandlung gleicher Sachverhalte<br />
Anlass geben könnte.<br />
Eine behutsame Wiederherstellung<br />
gerechter Wertrelationen, d. h. eine<br />
möglichst realistische Festsetzung der<br />
Einheitswerte – somit eine Verringerung<br />
des Abstandes der Einheitswerte zu den<br />
realen Werten auf ein erträgliches Maß<br />
– sollte angestrebt werden.<br />
Wirtschaftsentwicklung lässt höhere<br />
Steuereinnahmen bis 2008 erwarten<br />
Grundlage für die vom Bundesministerium<br />
für Finanzen (BMF) erstellte<br />
Prognose, welche bereits im Stabilitätsprogramm<br />
des Bundes vom Dezember<br />
2005 (Fortschreibung für die Jahre<br />
2005 bis 2008) enthalten ist, ist die Erwartung<br />
in eine positive wirtschaftliche<br />
Entwicklung. Das Stabilitätsprogramm<br />
führt dazu aus:<br />
„Aufgrund des schwächeren Welthandels<br />
und vor allem aufgrund der stark<br />
gestiegenen Energiepreise verläuft<br />
der Wirtschaftaufschwung 2005 und<br />
2006 gedämpft. Nicht zuletzt aufgrund<br />
der sich weiter verbessernden Wettbewerbsfähigkeit<br />
der österreichischen<br />
Exportwirtschaft sollte sich jedoch<br />
spätestens 2007 wieder ein typisches<br />
STEUERN & FINANZEN<br />
Sollte das Ziel eine gesamtösterreichische<br />
Aufkommensneutralität sein,<br />
könnten die bereits derzeit vorgesehenen<br />
Instrumente für die Feinabstimmung<br />
(Abschläge, Zuschläge, Hebesätze, Steuersätze)<br />
entsprechend angepasst werden,<br />
was aber zur Folge hätte, dass Gemeinden<br />
mit zunehmender Wirtschaftskraft zu<br />
Lasten von Gemeinden in finanzschwachen<br />
Regionen gestärkt würden.<br />
Im Übrigen haben die Einheitswerte<br />
des Grundvermögens nicht nur für die<br />
Grundsteuer, sondern auch für die Erbschafts-<br />
und Schenkungssteuer (VfGH-<br />
Prüfungsverfahren), für die Grunderwerbsteuer,<br />
für die Rechtsgeschäftsgebühren,<br />
für die Gerichtsgebühren und<br />
für die Bodenwertabgabe Bedeutung.<br />
(Anmerkung: Die EW des land- und<br />
forstwirtschaftlichen Vermögens<br />
– die letzte Hauptfeststellung hat per<br />
1. 1. 1998 stattgefunden – bilden u. a.<br />
die Grundlage für die Buchführungspflicht<br />
von land- und forstwirtschaftlichen<br />
Betrieben, für die Einkommensteuer<br />
von pauschalierten Landwirten,<br />
für verschiedene Abgaben und Beiträge<br />
von land- und forstwirtschaftlichen<br />
Betrieben, für das bäuerliche Sozialversicherungsrecht<br />
und für diverse Gesetze<br />
zur Ermittlung der Einkommensgrenze<br />
für allfällige soziale Unterstützungen.)<br />
Vorerst bleibt aber das Ergebnis des<br />
eingangs erwähnten Prüfungsverfahrens<br />
vor dem Verfassungsgerichtshof<br />
abzuwarten, ob auch das BewG 1955<br />
– insbesondere die darin enthaltenen<br />
Normen für die EW-Ermittlung – auf<br />
verfassungsrechtliche Bedenken des<br />
VfGH stoßen.<br />
Wachstumsimpulse zuerst von stärkeren<br />
Investitionen ausgehen und sich 2008<br />
auf den Konsum der privaten Haushalte<br />
übertragen. Unterstützt wird der Aufschwung<br />
von einer abklingenden Preisentwicklung,<br />
nachdem sich die Energiepreise<br />
auf hohem Niveau stabilisiert<br />
haben. Die Nettoexporte liefern unter<br />
der Annahme eines mittleren Wachstums<br />
der österreichischen Exportmärkte<br />
positive Wachstumsbeiträge.“<br />
Daraus leiten sich die vom BMF bekannt<br />
gegebenen Rahmenbedingungen<br />
ab. Diese in der Zeitreihe 2005 bis<br />
2008 nachstehend angegebenen Daten<br />
sind Teil der Informationsverpflichtung<br />
des Bundes gemäß Artikel 7 des<br />
Konjunkturmuster etablieren, indem die Fortsetzung nächste Seite<br />
Steirische Gemeindenachrichten 7/06 5
STEUERN & FINANZEN<br />
Fortsetzung von Seite 5<br />
Österreichischen Stabilitätspaktes an<br />
die Länder (für deren Landesbudgets)<br />
und an die Aufsichtsbehörden der Länder<br />
(für die Prognose der Ertragsanteile<br />
der Gemeinden).<br />
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2005 bis 2008<br />
Entwicklung der<br />
Gemeindeertragsanteile<br />
Die Vorschau auf die Ertragsanteilentwicklung<br />
geht von einer aktuellen<br />
Steuerschätzung des BMF vom Mai<br />
2006 auf Basis der wirtschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen aus.<br />
Nach einem zu erwartenden leichten<br />
Einbruch der Ertragsanteile der Gemeinden<br />
im Jahr 2006 (zu den Ursachen<br />
siehe Beitrag „Rückgänge wie<br />
6 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
erwartet eingetroffen“ in Kommunal<br />
3/2006, Seite 19 f) sollte die Talsohle<br />
überschritten sein.<br />
Ob die Ertragsanteile für 2007 und 2008<br />
die Gemeindehaushalte wirklich in der<br />
2005 2006 2007 2008<br />
(in Mrd. Euro) Veränderungen gegenüber Vorjahr in %<br />
1. BIP, real 1) 226,8 + 2,4 + 2,0 + 2,0<br />
2. BIP, nominell 2) 246,5 + 4,3 + 4,0 + 3,6<br />
3. Lohn- und<br />
Gehaltssumme<br />
120,6 + 4,0 + 3,5 + 3,2<br />
4. VPI<br />
(Jahr 2000 = 100)<br />
110,6 + 1,7 + 1,9 + 1,6<br />
1) zu Vorjahrspreisen (Referenzjahr 2000)<br />
2) brutto, ohne Arbeitgeberbeiträge<br />
prognostizierten Höhe stärken werden,<br />
bleibt aber abzuwarten.<br />
Entwicklung<br />
Getränkeabgabeausgleich<br />
Zum Unterschied der Ertragsanteilentwicklung,<br />
deren Zuwächse vom<br />
Aufkommen aller im FAG 2005 geregelten<br />
verbundenen Abgaben abhängt,<br />
ist der Getränkeabgabeausgleich ausschließlich<br />
an die Dynamik des Um-<br />
Vorschau Ertragsanteile 2005 bis 2008 1) in Mio. Euro<br />
satzsteueraufkommens gekoppelt. Ist<br />
das Aufkommen der direkten Steuern<br />
(Einkommensteuer, Körperschaftsteuer<br />
etc.) durch Steuerreformen, Strukturverbesserungsgesetze,Budgetbegleitgesetze<br />
etc. tendenziell rückläufig, so verzeichnet<br />
die Umsatzsteuer als indirekte<br />
Abgabe jährlich zufrieden stellende<br />
Steigerungen, die auch den Getränkeabgabeausgleich<br />
positiv beeinflussen, wie<br />
dies untenstehende Tabelle zeigt.<br />
Trotz der Schwankungen und teilweisen<br />
Rückgänge in den Überweisungen der<br />
Gemeindeertragsanteile haben bisher<br />
die österreichischen Gemeinden bisher<br />
als einziger Finanzausgleichspartner<br />
den vereinbarten Beitrag zum gesamtstaatlichen<br />
Haushaltsausgleich erreicht.<br />
So weist die Statistik Austria in ihrer<br />
Notifikation (Meldung an die EU) am<br />
31. 3. 2006 in der Maastricht-Statistik<br />
für die Gemeinden ohne Wien für die<br />
Jahre 2005 und 2006 (auf Basis der Voranschläge)<br />
jeweils geringfügige Überschüsse<br />
aus, die dem gesamtstaatlichen<br />
Haushaltsergebnis zugute kommen.<br />
Mit den geschätzten Einnahmen aus<br />
den Ertragsanteilen für die Jahre 2007<br />
und 2008 dürfte sich am Beitrag der<br />
österreichischen Gemeinden im Rahmen<br />
des Stabilitätspaktes zur Einhaltung des<br />
Haushaltsziels wenig ändern.<br />
2005 2006 2007 2008<br />
Burgenland 170,93 169,30 176,58 185,27<br />
Kärnten 419,13 413,14 430,86 452,77<br />
Niederösterreich 1.058,84 1.042,76 1.089,21 1.145,09<br />
Oberösterreich 1.022,56 1.004,56 1.050,14 1.102,59<br />
Salzburg 446,74 440,56 459,73 482,31<br />
<strong>Steiermark</strong> 825,03 820,90 851,76 897,27<br />
Tirol 554,68 551,35 572,99 602,72<br />
Vorarlberg 297,46 292,46 305,80 321,79<br />
Wien 1.647,36 1.642,39 1.708,24 1.796,01<br />
Summe 6.442,72 6.377,42 6.645,31 6.985,82<br />
1) inkl. Zwischenabrechnung Vorjahre, Getränkeabgabeausgleich, Werbeabgabeausgleich, ohne Spielbankenabgabe<br />
Entwicklung Getränkesteuerausgleich 2005 bis 2008 in Mio. Euro<br />
2005 2006 2007 2008<br />
Burgenland 8,49 8,79 8,93 9,24<br />
Kärnten 28,80 29,81 30,30 31,32<br />
Niederösterreich 51,47 53,28 54,15 55,99<br />
Oberösterreich 49,44 51,18 52,02 53,78<br />
Salzburg 31,95 33,07 33,62 34,75<br />
<strong>Steiermark</strong> 44,35 45,91 46,67 48,25<br />
Tirol 49,19 50,92 51,75 53,50<br />
Vorarlberg 16,31 16,88 17,16 17,74<br />
Wien 58,95 61,02 62,02 64,12<br />
Summe 338,95 350,86 356,62 368,69
Im Erkenntnis vom 8. 9. 2005, Zl.<br />
2005/17/3005, hat der Verwaltungsgerichtshof<br />
im Zusammenhang mit<br />
der Vorschreibung der Bauabgabe für<br />
eine Tiefgarage mit oberirdischen Stiegenaufgängen<br />
und einem Kassenhäuschen<br />
folgende für die Praxis wichtige<br />
Aussagen getroffen:<br />
1. Bewirkt der Verkauf einer<br />
Liegenschaft einen Übergang der<br />
Abgabenschuld?<br />
Der Beschwerdeführer bringt vor dem<br />
Verwaltungsgerichtshof zunächst vor, er<br />
habe mit Kaufvertrag vom 11. Juni 2002<br />
seine Parkplatzfläche mit dem begonnenen<br />
Tiefgaragenbauwerk veräußert;<br />
nur kleine Teile der Baufläche, welche<br />
näher angeführt werden, seien in seinem<br />
Eigentum verblieben. Er leitet daraus<br />
rechtlich ab, dass die Vorschreibung<br />
der Bauabgabe zum größten Teil nicht<br />
an ihn hätte gerichtet werden dürfen,<br />
sondern an den (die) neuen Grundeigentümer.<br />
Der Verwaltungsgerichtshof hat in<br />
seinem Erkenntnis vom 17. Mai 2004,<br />
Zl. 2003/17/0246, im Zusammenhang<br />
mit einer nach der Erteilung der Baubewilligung<br />
erfolgten Veräußerung ausgeführt<br />
wie folgt:<br />
„Wie der Verwaltungsgerichtshof in<br />
seiner Rechtsprechung bereits mehrfach<br />
ausgesprochen hat (vgl. etwa den<br />
hg. Beschluss vom 20. März 2003,<br />
Zl. 98/17/0319, mwN), bedürfte es für<br />
den Eintritt eines Schuldnerwechsels<br />
im Falle eines Eigentumsüberganges<br />
an einem Grundstück, auf das sich ein<br />
Vorhaben bezieht, für welches eine<br />
Abgabe vorgeschrieben worden ist,<br />
oder für welches der Abgabenanspruch<br />
entstanden ist, einer ausdrücklichen gesetzlichen<br />
Anordnung.<br />
Für das vorliegende Abgabenschuldverhältnis<br />
ist eine solche „dingliche Wirkung“<br />
in der Steiermärkischen Bauordnung<br />
nicht vorgesehen. Die Anordnung<br />
des § 15 Abs. 1 zweiter Satz leg. cit.<br />
(Anm.: des Stmk. BauG), wonach für<br />
Dr. Karin Wielinger,<br />
<strong>Steiermärkischer</strong> <strong>Gemeindebund</strong><br />
Bauabgabe für eine Tiefgarage?<br />
Verfüge nie über Geld, ehe Du es hast.<br />
die Bauabgabe auf dem Grundstück ein<br />
gesetzliches Pfandrecht haftet, enthält<br />
gerade keine ausdrückliche Regelung<br />
für einen Schuldnerwechsel hinsichtlich<br />
der bereits entstandenen Abgabenverbindlichkeit;<br />
die Anordnung einer<br />
(bloßen) Pfandhaftung macht einen<br />
allfälligen neuen Eigentümer der Liegenschaft<br />
nicht zum Abgabenschuldner,<br />
sondern beschränkt vielmehr dessen<br />
Haftung auf den Pfandgegenstand,<br />
somit die Liegenschaft. Einer solchen<br />
ausdrücklichen Regelung betreffend<br />
den Schuldnerwechsel (oder allenfalls<br />
eines Schuldnerbeitritts) hätte es allerdings<br />
bedurft, um in dem nach § 15<br />
Abs. 1 Stmk BauG in Verbindung mit<br />
§ 3 Abs. 1 Stmk LAO entstandenen<br />
(und im Beschwerdefall auch bescheidmäßig<br />
konkretisierten) Abgabenschuldverhältnis<br />
einen Schuldnerwechsel bei<br />
einem Eigentümerwechsel bzw. einem<br />
Wechsel in der Stellung als Bauwerber<br />
nach der Bescheiderlassung annehmen<br />
zu können.<br />
Damit ist auch für den hier zu beurteilenden<br />
Beschwerdefall – die Beschwerdeausführungen<br />
geben keinen Anlass,<br />
von der zitierten Rechtsprechung abzugehen<br />
– klargestellt, dass der<br />
Beschwerdeführer, dem unbestritten die<br />
Baubewilligung erteilt wurde und der<br />
damit den Abgabentatbestand des § 15<br />
Abs. 1 erster Satz Stmk BauG 1995 erfüllt<br />
hat, auch nach Veräußerung (eines<br />
Teiles) der Grundstücke Abgabepflichtiger<br />
geblieben ist.“<br />
2. Entfällt die Bauabgabe bei<br />
Wiedererrichtung?<br />
Der Beschwerdeführer wendet sich weiters<br />
dagegen, dass ihm zu Unrecht eine<br />
Fläche im Ausmaß von 1.424,30 m²<br />
nicht von der zu Grunde gelegten Bemessungsfläche<br />
abgerechnet worden<br />
sei, für die insoweit die Vorschreibung<br />
einer Bauabgabe gemäß § 15 Abs. 8<br />
Z. 1 Stmk. BauG 1995 zu entfallen<br />
habe; in diesem Ausmaß seien Gebäude<br />
wieder errichtet worden.<br />
Thomas Jefferson<br />
RECHT & GESETZ<br />
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass<br />
sich der Beschwerdeführer schon deshalb<br />
nicht auf § 15 Abs. 8 Z. 1 Stmk.<br />
BauG 1995 berufen kann, weil diese<br />
Bestimmung in verfassungskonformer<br />
Interpretation dahingehend zu verstehen<br />
ist, dass sie nur zum Tragen kommt,<br />
wenn für das Gebäude, an dessen Stelle<br />
das neue Gebäude wieder errichtet<br />
wurde, bereits eine Aufschließungsabgabe<br />
entrichtet wurde (vgl. die hg. Erkenntnisse<br />
vom 26. April 1999, Zl. 99/<br />
17/0142, und vom 20. November 2002,<br />
Zl. 97/17/0499). Die belangte Behörde<br />
hat aber ausdrücklich festgestellt,<br />
dass es nicht zu einer Vorschreibung<br />
einer Bauabgabe bzw. eines Aufschließungsbeitrages<br />
in der Vergangenheit<br />
gekommen ist. Soweit dem Beschwerdevorbringen<br />
in diesem Zusammenhang<br />
der Vorwurf einer mangelhaften Tatsachenfeststellung<br />
durch die Abgabenbehörden<br />
zu entnehmen ist, übersieht der<br />
Beschwerdeführer, dass die Abgabenbehörden<br />
auf Grund des durchgeführten<br />
Ermittlungsverfahrens zu dem Ergebnis<br />
gekommen sind, ein anzurechnender<br />
Beitrag sei nicht gezahlt worden. Hiezu<br />
wurde dem Beschwerdeführer auch<br />
die Möglichkeit einer Stellungnahme<br />
eingeräumt. Der Umstand, dass der<br />
Beschwerdeführer nicht in der Lage<br />
war, zweckdienliche Beweisanträge<br />
zu stellen, spricht nicht gegen das von<br />
den Abgabenbehörden vorgenommene<br />
Ermittlungsverfahren; eine Rechtswidrigkeit<br />
des bekämpften Bescheides kann<br />
auf Grund des Beschwerdevorbringens<br />
insoweit jedenfalls nicht erkannt<br />
werden (vgl. das hg. Erkenntnis vom<br />
15. Mai 2000, Zl. 99/17/0446).<br />
3. Ist eine Tiefgarage mit<br />
oberirdischen Stiegenaufgängen<br />
und einem Kassenhäuschen als<br />
Gebäude im Sinne des<br />
Stmk. BauG zu qualifizieren?<br />
Der Beschwerdeführer bestreitet, dass<br />
die Tiefgarage ein Gebäude im Sinne<br />
des Stmk. BauG 1995 bilde.<br />
Der Verwaltungsgerichtshof hat in<br />
seiner Rechtsprechung (vgl. das<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
Steirische Gemeindenachrichten 7/06 7
RECHT & GESETZ<br />
Fortsetzung von Seite 7<br />
hg. Erkenntnis vom 12. August 2002,<br />
Zl. 97/17/0332) ausgeführt, aus der<br />
Verwendung des Begriffes „Bruttogeschoßfläche“<br />
im § 15 Abs. 3 Stmk<br />
BauG 1995 ergebe sich, dass ein „Geschoß“<br />
vorliegen müsse; dieses werde<br />
im § 4 Z. 33 als näher umschriebener<br />
Gebäudeabschnitt bezeichnet. Daraus<br />
werde ersichtlich, dass es sich<br />
bei dem Vorhaben, für welches die<br />
im § 15 Abs. 1 erster Satz leg. cit.<br />
angesprochene Baubewilligung erteilt<br />
werden müsse, an die die Entstehung<br />
der Abgabe anknüpfe, um ein „Gebäude“<br />
handeln müsse.<br />
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers<br />
liegt jedoch ein solches<br />
„Gebäude“ vor. Die belangte Behörde<br />
hat bereits im angefochtenen Bescheid<br />
zutreffend auf die drei oberirdisch<br />
gelegenen Stiegenhäuser und<br />
das Kassenhäuschen verwiesen; dabei<br />
handelt es sich jedenfalls um ein<br />
„Gebäude“ im Sinne des Gebäudebegriffes<br />
des Stmk BauG 1995. Wenn<br />
der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang<br />
vor dem Verwaltungsgerichtshof<br />
darauf verweist, es lägen<br />
hier nur „Nebengebäude“ im Sinne<br />
des § 4 Z. 43 Stmk. BauG 1995 vor<br />
(danach sind Nebengebäude in der<br />
hier anzuwendenden Stammfassung<br />
vor der Novelle LGBl. Nr. 78/2003<br />
eingeschoßige, ebenerdige, unbewohnbare<br />
Bauten von untergeordneter<br />
Bedeutung mit einer Geschoßhöhe<br />
bis 3,00 m und bis zu einer bebauten<br />
Fläche von 30 m²), dann übersieht<br />
der Beschwerdeführer, dass auch<br />
Nebengebäude Gebäude im Sinne<br />
des Stmk. BauG 1995 sind (dadurch<br />
unterscheidet sich der vorliegende<br />
Fall von demjenigen, der dem hg.<br />
Erkenntnis vom 21. Februar 2004,<br />
Zl. 2002/06/0029, zu Grunde lag, bei<br />
dem die dort verfahrensgegenständliche<br />
Tiefgarage eines oberirdischen<br />
Raumes ermangelte).<br />
Im hier zu beurteilenden Beschwerdefall<br />
liegen jedoch nicht nur „Nebengebäude“,<br />
sondern „Gebäude“<br />
im Sinne der eben wiedergegebenen<br />
Definition vor, weil sie nicht von „untergeordneter<br />
Bedeutung“ sind, haben<br />
doch Stiegenhäuser, die erst die Benützung<br />
der Tiefgarage ermöglichen,<br />
für den Zweck einer solchen baulichen<br />
Anlage, wie sie hier vorliegt,<br />
keine untergeordnete Bedeutung,<br />
worauf schon die belangte Behörde<br />
zutreffend verwiesen hat.<br />
8 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
Arbeitsrecht für Arbeitgeber<br />
Dr. Thomas Rauch<br />
5. überarbeitete Auflage 2006<br />
720 Seiten, kart. inkl. CD-Rom<br />
€ 78,--<br />
ISBN 3-7073-0976-2<br />
Linde Verlag<br />
Dieses Buch stellt in verständlicher<br />
und kompakter Weise<br />
die in der Praxis wichtigsten<br />
Bereiche des Arbeitsrechts dar und gibt<br />
zahlreiche Tipps, wie der Arbeitgeber<br />
typische bzw. häufig kostspielige Fehler<br />
und Mängel vermeiden kann. Darüber<br />
hinaus wird durch zahlreiche Muster<br />
ein möglichst einfacher und rascher<br />
Zugang zu geeigneten Formulierungen<br />
für Erklärungen und Vereinbarungen ermöglicht,<br />
welche die Rechtsposition des<br />
Arbeitgebers entsprechend stärken und<br />
sichern. Sämtliche Muster sind auch auf<br />
der beiliegenden CD enthalten.<br />
Etliche Zitate aus Entscheidungen und<br />
die Angabe zahlreicher Geschäftszahlen<br />
ermöglichen dem Arbeitgeber, seine<br />
Ausgliederung und<br />
öffentlicher Dienst<br />
Gerhard Baumgartner<br />
2006. XXIII, 578 Seiten<br />
Broschiert € 118,--<br />
ISBN 3-211-31115-7<br />
Forschungen aus Staat und Recht,<br />
Band 149<br />
Springer Verlag Wien New York<br />
Die vorliegende Untersuchung<br />
widmet sich der Ausgliederung<br />
von Staatsaufgaben und deren<br />
Auswirkungen auf den öffentlichen<br />
Dienst. Im Vordergrund stehen Fragen<br />
des Verfassungsrechts hinsichtlich Bedingungen,<br />
Grenzen und Folgen. Aber auch<br />
dem europäischen Gemeinschaftsrecht<br />
als wichtiger Impulsgeber wird breiter<br />
Raum eingeräumt. Darüber hinaus wird<br />
die mit einer Ausgliederung regelmäßig<br />
einhergehende Überleitung öffentlich<br />
Bediensteter auf den ausgegliederten<br />
Rechtsträger näher unter die Lupe genommen.<br />
Es werden die verschiedenen<br />
Varianten der Personalüberleitung untersucht<br />
und deren Konsequenzen für<br />
die dienstrechtliche Situation der von der<br />
Ausgliederung betroffenen Bediensteten<br />
veranschaulicht. Besonderes Augenmerk<br />
wird auf die Analyse der verfassungs-<br />
Rechtsauffassung in Diskussionen mit<br />
Mitarbeitern und dem Betriebsrat konkret<br />
zu belegen.<br />
In die 5. Auflage wurden neben den<br />
aktuellen Gerichtsentscheidungen insbesondere<br />
die neuen Regelungen zur<br />
Ausländerbeschäftigung (Fremdenrechtspaket<br />
2005), zum Dienstleistungsscheck,<br />
zur Behindertengleichstellung,<br />
zur Lohnpfändung (EO-Novelle 2005)<br />
und zur neuen Lehrlingsförderung aufgenommen.<br />
Autor:<br />
Dr. Thomas Rauch, Jurist, seit 1992<br />
im arbeitsrechtlichen Bereich der Wirtschaftskammer<br />
Wien (WKW) tätig.<br />
Seine Aufgaben sind u. a. die Beratung<br />
von Arbeitgebern (Mitgliedern der<br />
WKW) in arbeits- und sozialrechtlichen<br />
Angelegenheiten, Vertretung der<br />
Mitglieder der WKW in arbeitsgerichtlichen<br />
Verfahren, Gesetzesbegutachtungen<br />
etc.; Verfasser zahlreicher Artikel,<br />
laufende Vortragstätigkeit.<br />
und gemeinschaftsrechtlichen Determinanten<br />
der Personalüberleitung gelegt,<br />
wobei auch grundsätzliche Fragen, wie<br />
etwa die verfassungsrechtliche Verankerung<br />
des Berufsbeamtentums, eingehend<br />
erörtert werden.<br />
Aus dem Inhalt:<br />
• Vorwort<br />
• Einleitung<br />
• Ausgliederung von Staatsaufgaben<br />
• Verfassungs- und gemeinschaftsrechtliche<br />
Fragen der Personalüberleitung<br />
• Zusammenfassung und Ausblick<br />
• Literaturverzeichnis<br />
• Stichwortverzeichnis
Berufsorientierungsprojekt<br />
„Freiwilliges Soziales Jahr“<br />
für steirische Jugendliche<br />
Derzeit werden noch Jugendliche<br />
aus den Bundesländern<br />
<strong>Steiermark</strong>, Kärnten und<br />
Burgenland für die Teilnahme am<br />
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) aufgenommen.<br />
Ab sofort können sich Jugendliche ab<br />
18 Jahren für das Berufsorientierungsprojekt<br />
„Freiwilliges Soziales Jahr“<br />
anmelden. Ziel des FSJ ist es, jungen<br />
Erwachsenen ein begleitetes Praxisjahr<br />
in ausgesuchten Sozialprojekten<br />
anzubieten. Das FSJ gilt somit als<br />
optimale Vorbereitung für Ausbildungen<br />
im Sozialbereich – etwa für die<br />
Fachhochschulstudiengänge für Soziale<br />
Arbeit und Sozialmanagement, Kolleg<br />
für Sozialpädagogik, die Akademien für<br />
Physiotherapie und Ergotherapie usw.<br />
Das FSJ bietet jungen Erwachsenen ab<br />
18 Jahren die Möglichkeit,<br />
- ihre Eignung für einen Sozialberuf<br />
praktisch zu testen,<br />
- sich in einem neuen Umfeld persönlich<br />
weiterzuentwickeln,<br />
- sich beruflich zu verändern,<br />
- ein Wartejahr sinnvoll zu überbrücken<br />
Einsatzmöglichkeiten gibt es in der<br />
Arbeit mit<br />
- behinderten Menschen<br />
- alten Menschen<br />
- Kindern, Jugendlichen<br />
- Obdachlosen und Flüchtlingen.<br />
Der Einsatz dauert 10 Monate und<br />
findet in einer sozialen Einrichtung<br />
in Österreich statt. Während des Einsatzjahres<br />
gibt es begleitende pädagogische<br />
Seminare.<br />
- Vorbereitungsseminar: Selbsterfahrung<br />
und Facheinführung, 12 Tage<br />
- 1. Seminar: Vertiefung von fachlichen<br />
Erfahrungen, Berufsorientierung,<br />
3 Tage<br />
- 2. Seminar: Supervision in Gruppen,<br />
Berufsorientierung, Bewerbungstraining,<br />
3 Tage<br />
- 3. Seminar: Auswertung und Abschluss,<br />
2 Tage<br />
Start des FSJ:<br />
1. Oktober 2006 – 31. Juli 2007<br />
(Vorbereitungskurs: 17. September bis<br />
28. September 2006)<br />
Anmeldung und Information:<br />
Verein zur Förderung Freiwilliger Sozialer<br />
Dienste, Regionalstelle Stmk., Ktn.,<br />
Bgld. (Mag. Elfriede Biegl-Lippitz),<br />
8010 Graz, Raubergasse 16/HP,<br />
Tel: 0316/812486<br />
E-Mail: office.graz@fsj.at, www.fsj.at<br />
RAINBOWS-Feriencamps für<br />
Kinder und Jugendliche<br />
Die Ferien stehen vor der Tür<br />
und für viele von Trennung/<br />
Scheidung der Eltern oder Tod<br />
eines geliebten Menschen betroffene<br />
Kinder verändert selbst die schönste<br />
Zeit im Jahr nichts an ihrer Lebenssituation.<br />
Der Verein RAINBOWS hat sich<br />
zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen<br />
in dieser schwierigen Lebensphase<br />
mit professioneller Hilfe zur Seite zu<br />
stehen. Er hat aus diesem Grund vor<br />
einigen Jahren auch Feriencamps ins<br />
Leben gerufen, in denen versucht wird,<br />
auch für diese Kinder die Ferien zu<br />
einem schönen Erlebnis zu machen und<br />
dem Gefühl des „Sich-allein-fühlens“<br />
entgegenzuwirken.<br />
Bewegung, Spaß und Erholung durch<br />
Spielen, Malen, Baden und viele andere<br />
Gruppenaktivitäten gemeinsam mit<br />
anderen Betroffenen machen auch für<br />
diese Kinder die Ferien zu einem Erlebnis.<br />
Sie sollen neue Kraft tanken, um<br />
gestärkt aus dem Sommer zu kommen<br />
– das ist auch heuer wieder das Ziel von<br />
RAINBOWS.<br />
Folgende Feriencamps werden heuer<br />
von RAINBOWS angeboten:<br />
9. – 15. 7. 2006: Naturpark Grebenzen/<br />
Trattenhof (<strong>Steiermark</strong>)<br />
20. – 26. 8. 2006: Ebensee/Jutel<br />
(Oberösterreich)<br />
27. 8. – 2. 9. 2006: Innsbruck/Haus der<br />
Kinderfreunde – Hungerburg (Tirol)<br />
Weitere Informationen und Anmeldungen<br />
ab sofort beim<br />
Bundesverein RAINBOWS, 8010 Graz,<br />
Theodor-Körner Straße 182,<br />
Telefon 0316/68 86 70, Fax 68 86 70-21,<br />
E-Mail office@rainbows.at,<br />
Internet: www.rainbows.at.<br />
TERMINE<br />
Vortrag „Wer hat<br />
an der Uhr gedreht“<br />
von Sepp Loibner<br />
(ORF <strong>Steiermark</strong>)<br />
Ein erster Vortrag dieser Art, in<br />
dem es um die Zeitwahrnehmung<br />
geht, fand mit großem Erfolg Ende<br />
Mai in St. Martin im Sulmtal statt.<br />
Themen dieses Vortrages sind<br />
unter anderem:<br />
• Alles geht schneller – warum<br />
haben wir trotzdem keine Zeit?<br />
• Warum hat derjenige Macht und<br />
Gewinn, der die Zeit bestimmt?<br />
(Öffnungszeiten, Sonntagsarbeit)<br />
• Warum vergeht das Leben schneller,<br />
wenn man älter wird?<br />
• Warum will beim Warten keine<br />
Zeit vergehen?<br />
• Wie lange können wir das Tempo<br />
der heutigen Arbeitswelt noch aushalten?<br />
• Stimmt der Satz „Zeit ist Geld“?<br />
• Wer sind gogo‘s, slowgo‘s und<br />
nogo‘s?<br />
• Ist der Herzinfarkt ein Zeitinfarkt?<br />
• Warum kommt uns heute das langsam<br />
vor, was uns früher schnell<br />
vorkam?<br />
• Warum ist der Kindergarten eine<br />
andere „Zeitzone“ als der Haushalt?<br />
Diese und viele andere Fragen zum<br />
Thema „Zeit“ werden in dem etwas<br />
mehr als eine Stunde dauernden Vortrag<br />
behandelt und beantwortet – nicht<br />
kompliziert und wissenschaftlich,<br />
sondern für alle Zuhörer verständlich<br />
und mit praktischen und unterhaltsamen<br />
Beispielen versehen.<br />
Sepp Loibner kennt man als Nachrichtensprecher<br />
und Reporter im ORF<br />
<strong>Steiermark</strong>. In seiner Bildungskarenz<br />
hat er sich mit dem Thema „Zeit“<br />
näher beschäftigt und diesen Vortrag<br />
gestaltet.<br />
Herr Loibner bietet diesen interessanten<br />
und unterhaltenden Vortrag<br />
nun gern auch den Gemeinden an.<br />
Die Veranstaltung könnte für einen<br />
bestimmten Personenkreis oder für<br />
alle Interessierten aus der Bevölkerung<br />
organisiert werden.<br />
Interessierte Gemeinden werden<br />
gebeten, sich für weitere Informationen<br />
direkt mit Herrn Loibner unter<br />
Tel. 0664/5310041 in Verbindung zu<br />
setzen.<br />
Steirische Gemeindenachrichten 7/06 9
EUROPA<br />
Neues zu Europa<br />
Polnischer Landgemeindebund<br />
besucht <strong>Gemeindebund</strong>büro<br />
Ende April besuchte eine Delegation<br />
des polnischen Landgemeindebundes<br />
unter der Leitung von Präsident<br />
Mariusz Poznanski Brüssel und bei<br />
dieser Gelegenheit auch das Büro des<br />
Österreichischen <strong>Gemeindebund</strong>es.<br />
Dabei informierte sich die 16köpfige<br />
Delegation u. a. über Aufbau und Finanzierung<br />
eines Büros in Brüssel und<br />
erkundigte sich über potentielle Möglichkeiten<br />
der Zusammenarbeit zwischen<br />
beiden Verbänden. Man zeigte Interesse<br />
an der Idee, der ländlichen Dimension<br />
auch in Brüssel verstärkt Gehör zu verschaffen<br />
und dazu die Zusammenarbeit<br />
zwischen gleichgesinnten Verbänden zu<br />
verstärken.<br />
Der polnische Landgemeindebund ist<br />
auch Mitglied des ICNW, über welches<br />
sich die Präsidiumsmitglieder ungeteilt<br />
positiv äußerten. Auf eine Fortsetzung<br />
des Netzwerks und engere Kontakte zu<br />
österreichischen Gemeinden wird auch<br />
von polnischer Seite viel Wert gelegt.<br />
Regionalpolitik neu 2007-2013 –<br />
Countdown bis zum Inkrafttreten<br />
Am 5. Mai kam es im Rat im Hinblick<br />
auf das Verordnungspaket Regionalpolitik<br />
zu einer politischen Einigung. Dabei<br />
wurde fixiert, dass alle 5 Verordnungen<br />
gemeinsam angenommen werden. Nach<br />
der formellen Annahme durch den Rat<br />
am 12. Juni müssen die Verordnungen<br />
auch noch vom Europäischen Parlament<br />
abgesegnet werden. Durch die von<br />
der österreichischen Präsidentschaft<br />
vorgegebene Paketlösung wird eine<br />
Sonderbehandlung der EVTZ-VO ausgeschlossen.<br />
Der Europäische Verbund<br />
für territoriale Zusammenarbeit war<br />
in den Verhandlungen unter Beschuss<br />
geraten, da viele Mitgliedstaaten darin<br />
einen Eingriff in nationales Verfassungsrecht<br />
sahen und eine von ihnen<br />
nicht gewollte Stärkung der Regionen<br />
befürchteten. Insbesondere Deutschland<br />
und Österreich setzten sich – nicht zuletzt<br />
aufgrund des massiven Drucks aus<br />
den Bundesländern – für diese Verordnung<br />
ein.<br />
Nach Annahme der Verordnungen<br />
durch die Plenarversammlung des EU-<br />
Parlaments und der Veröffentlichung<br />
im Amtsblatt muss die Kommission<br />
die Strategischen Leitlinien veröffent-<br />
10 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
lichen, die im Zustimmungsverfahren<br />
von Europäischem Parlament und Rat<br />
beschlossen werden. Dieser Vorgang<br />
beginnt nach Inkrafttreten der Verordnungen<br />
und wird voraussichtlich Anfang<br />
Oktober abgeschlossen sein. Erst nachdem<br />
auch die Strategischen Leitlinien<br />
im Amtsblatt veröffentlicht sind, können<br />
die Mitgliedstaaten ihre nationalen strategischen<br />
und operationellen Programme<br />
der Kommission übermitteln. Dies wird<br />
frühestens Mitte Oktober/Anfang November<br />
erfolgen – jedoch nur, wenn die<br />
Mitgliedstaaten ihre Programme bereits<br />
in der Schublade haben und sich diese<br />
weitgehend mit den Gemeinschaftlichen<br />
Leitlinien der Kommission decken. Da<br />
die Vorschläge der Kommission ab Ende<br />
Juli bekannt sein werden (informell natürlich<br />
schon davor), wird den Mitgliedstaaten<br />
diese Vorgehensweise wärmstens<br />
ans Herz gelegt.<br />
Um zu große Verzögerungen beim<br />
Programmstart zu vermeiden, wurde<br />
eine rückwirkende Förderfähigkeit<br />
beschlossen: Selbst wenn die nationalen<br />
Programme erst im Laufe des Jahres<br />
2007 genehmigt werden, sind Projekt-<br />
und Programmkosten ab dem Tag der<br />
Einreichung des nationalen Programms<br />
durch den Mitgliedstaat förderfähig.<br />
Das bedeutet, dass Rechnungsbelege,<br />
die vor der Einreichung des nationalen<br />
Programms datieren, nicht rückerstattungsfähig<br />
sind; Projektkosten, die<br />
zwischen Einreichung und tatsächlicher<br />
Genehmigung anfallen, sehr wohl.<br />
Vergaberecht<br />
Und wieder geht es ums Vergaberecht.<br />
Am 11. Mai hat die EU-Kommission<br />
einen neuen Vorschlag für die<br />
Rechtsmittelrichtlinie vorgelegt, die<br />
unterlegenen oder nicht zum Zug gekommenen<br />
Bietern in Vergabeverfahren<br />
Einspruchsmöglichkeiten zusichert. Die<br />
einzelstaatlichen Nachprüfungsverfahren<br />
sollen dadurch verbessert werden,<br />
nicht zum Zug gekommene Bieter<br />
sollen möglichst schnell ein Nachprüfungsverfahren<br />
anstrengen können.<br />
Dies gilt übrigens nicht nur für klassische<br />
Vergabeverfahren, sondern auch<br />
für freihändige Vergaben.<br />
Demnach muss ein Auftraggeber bei<br />
einem förmlichen Vergabeverfahren,<br />
das unter die Vergaberichtlinien fällt,<br />
eine Stillhaltefrist von 10 Kalender-<br />
tagen zwischen Auswahl des Partners<br />
und Vertragsabschluss einhalten. Die<br />
Frist beginnt einen Tag nach dem den<br />
Teilnehmern des Vergabeverfahrens<br />
die begründete Zuschlagsentscheidung<br />
mitgeteilt wurde. Freihändige Vergaben<br />
über den EU-Schwellenwerten sind im<br />
Wege einer vereinfachten Bekanntmachung<br />
angemessen zu veröffentlichen,<br />
auch hier ist nach der Veröffentlichung<br />
eine Wartefrist von 10 Tagen bis zum<br />
Vertragsabschluss einzuhalten. Rechtswidrige<br />
Vertragsabschlüsse während<br />
der Stillhaltefrist führen zur Nichtigkeit<br />
des Vertrags, sofern die zuständige<br />
Nachprüfungsinstanz dies auf Betreiben<br />
eines Wirtschaftsteilnehmers innerhalb<br />
von 6 Monaten feststellt.<br />
Die Kommission erwartet durch diese<br />
Richtlinie einen Anstieg grenzüberschreitender<br />
Tätigkeiten und vermehrte<br />
Teilnahme ausländischer Firmen an<br />
Ausschreibungen. Dies scheint eine aus<br />
kommunaler Sicht nicht nachvollziehbare<br />
Einschätzung, selbst in Grenzgebieten<br />
machen grenzüberschreitende<br />
Aufträge nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens<br />
aus – sprachliche und<br />
rechtliche Barrieren, insbesondere für<br />
KMU, wird auch die Rechtsmittelrichtlinie<br />
nicht aus der Welt schaffen.<br />
http://ec.europa.eu/internal_market/<br />
publicprocurement/remedies/remedies_<br />
de.htm<br />
Ebenfalls am 11. Mai sprach der Europäische<br />
Gerichtshof sein Urteil in der<br />
Sache Carbothermo. Es ging um die<br />
freihändige Auftragsvergabe einer italienischen<br />
Gemeinde an einen Betrieb,<br />
der als Aktiengesellschaft mittelbar zu<br />
99,98 % im Gemeindeeigentum stand,<br />
die restlichen Teile wurden von benachbarten<br />
Kommunen gehalten. Der EuGH<br />
nutzte die Gelegenheit, auf diesen Fall<br />
die mittlerweile berühmten Teckal-Kriterien<br />
anzuwenden.<br />
Dabei führte er zum ersten Teckal-<br />
Kriterium aus, dass eine Kontrolle wie<br />
über eine eigene Dienststelle bei einer<br />
Aktiengesellschaft, deren Verwaltungsrat<br />
über weite, autonom auszuübende<br />
Befugnisse verfügt, nicht anzunehmen<br />
sei. Im Hinblick auf das zweite Teckal-<br />
Kriterium bezüglich der Beurteilung,<br />
ob ein Unternehmen seine Tätigkeit im<br />
Wesentlichen für die Körperschaft verrichtet,<br />
die seine Anteile besitzt, vertrat<br />
der EuGH den Standpunkt, dass zur Be-
urteilung der Wesentlichkeit alle Tätigkeiten,<br />
die das Unternehmen aufgrund<br />
der Vergabe durch den öffentlichen<br />
Auftraggeber verrichtet, zu berücksichtigen<br />
sind. Dabei kommt es nicht darauf<br />
an, ob der öffentliche Auftraggeber oder<br />
die Konsumenten diese Tätigkeit vergüten<br />
und auch nicht darauf, in welchem<br />
Gebiet das Unternehmen für den Auftraggeber<br />
tätig ist.<br />
Damit hat der Gerichtshof zu einer weiteren<br />
Auslegung der Vergaberichtlinien<br />
beigetragen und die beiden Teckal-Kriterien,<br />
die zunehmend als Entscheidungsgrundlage<br />
bei freihändigen Auftragsvergaben<br />
herangezogen werden,<br />
verfeinert. Obwohl die Auslegung des<br />
Wesentlichkeitskriteriums von kommunaler<br />
Seite durchaus zu begrüßen<br />
ist, muss man grundsätzlich anmerken,<br />
dass der Gerichtshof nicht dauerhaft die<br />
Rolle des Pseudo-Gesetzgebers übernehmen<br />
kann. Für eine abschließende<br />
rechtliche Klärung der Inhouse-Frage<br />
sowie der Ausnahmebestimmungen für<br />
interkommunale Zusammenarbeit ist<br />
der europäische Gesetzgeber zuständig,<br />
der bei dieser Gelegenheit aufgefordert<br />
wird, möglichst rasch tätig zu werden.<br />
Das Urteil sowie die Schlussanträge von<br />
Generalanwältin Stix-Hackl sind unter<br />
Eingabe der Nummer C-340/04 in der<br />
Suchmaske des EuGH abzurufen.<br />
http://www.curia.eu.int/de/content/juris/<br />
index_form.htm<br />
Einigung über Batterierichtlinie<br />
Anfang Mai einigte sich der Vermittlungsausschuss<br />
zwischen Europäischem<br />
Parlament und Rat über die Inhalte<br />
der neuen Batterierichtlinie, welche<br />
die alte Richtlinie aus dem Jahr 1991<br />
ablösen wird. Eine Neuerung war u. a.<br />
deshalb nötig, weil die alte Richtlinie<br />
91/157/EWG keine Verpflichtung zur<br />
Sammlung enthielt und lediglich fünf<br />
Mitgliedstaaten – darunter Österreich<br />
– nationale Ziele festgelegt hatten.<br />
Die neue Richtlinie schreibt Sammelziele<br />
von 25 % der jährlichen Verkaufsmenge<br />
vier Jahre nach Inkrafttreten der<br />
Richtlinie und 45 % der Verkaufsmenge<br />
acht Jahre nach Inkrafttreten vor. Neben<br />
den Sammelzielen sind auch Recyclingziele<br />
festgeschrieben: Kadmiumhaltige<br />
Batterien müssen zu 75 % wieder verwendet<br />
werden, bleihältige Batterien<br />
zu 65 %. Auf alle übrigen Batterien<br />
kommt eine Recyclingquote von 50 %<br />
zur Anwendung. Die Richtlinie schreibt<br />
auch die Herstellerverantwortung für<br />
die Abfallbewirtschaftung von Batterien<br />
fest. Die Hersteller werden zudem<br />
verpflichtet, Produkte so zu gestalten,<br />
dass Batterien leicht vom Gerät entfernt<br />
werden können.<br />
http://www.europa.eu.int/rapid/pressRel<br />
easesAction.do?reference=IP/06/561&f<br />
ormat=HTML&aged=0&language=DE<br />
&guiLanguage=en<br />
IhreGemeinde.GV.AT<br />
Die kostenlose Internetadresse Ihrer Gemeinde<br />
EDV-Dienstleistungs GmbH<br />
Wielandgasse 14-16/B11, 8010 Graz<br />
Tel.: 0316 / 817896 www.abaton.at<br />
Einmalige Gebühr EUR 26,-* für<br />
Registrierung der Adresse (oder Übernahme)<br />
+ Weiterleitung auf Ihre Gemeinde-Homepage<br />
+ 10 E-Mail Adressen<br />
* Preis exkl. USt<br />
René Zwarg, Gemeinde-Experte<br />
Politische Einigung zur<br />
Dienstleistungsrichtlinie<br />
EUROPA<br />
Am 29. Mai nahm die Dienstleistungsrichtlinie<br />
eine weitere Hürde auf dem<br />
Weg zum europäischen Gesetz: Unter<br />
österreichischer Verhandlungsführung<br />
erzielte der Rat der Wettbewerbsminister<br />
eine politische Einigung in diesem<br />
umstrittenen Dossier – just am Jahrestag<br />
des französischen Neins zur EU-Verfassung.<br />
Nach dieser politischen Einigung<br />
muss die formelle Beschlussfassung des<br />
gemeinsamen Standpunkts erfolgen,<br />
danach wird der Text dem Europäischen<br />
Parlament zur zweiten Lesung übermittelt.<br />
Die Minister einigten sich auf einen<br />
Kompromisstext, der im Wesentlichen<br />
die Vorschläge des Europäischen<br />
Parlaments bzw. den geänderten<br />
Richtlinienentwurf der Kommission<br />
von Anfang April übernimmt. Die im<br />
Parlaments- und später auch im Kommissionstext<br />
vorgeschlagenen Ausnahmen<br />
vom Anwendungsbereich<br />
der Richtlinie werden weitgehend<br />
übernommen:<br />
• Nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
• Finanzdienstleistungen<br />
• Verkehrsdienstleistungen, die bereits<br />
im EG-V geregelt sind, sowie Hafendienste<br />
• Dienste von Personalleasingfirmen<br />
• Gesundheitsdienste<br />
• Audiovisuelle Dienstleistungen und<br />
Radio<br />
• Gewinnspiele<br />
• Soziale Dienstleistungen (geändert<br />
- die Ausnahmeregelung für soziale<br />
Dienstleistungen umfasst nunmehr<br />
auch staatlich anerkannte gemeinnützige<br />
Einrichtungen)<br />
• Notare (neu)<br />
Bei Zustimmung des Europäischen Parlaments<br />
ist noch in diesem Jahr mit dem<br />
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens<br />
und der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt<br />
zu rechnen. Danach ist die Richtlinie<br />
innerhalb von 3 Jahren in nationales<br />
Recht umzusetzen, d. h. der tatsächlich<br />
freie Dienstleistungsverkehr könnte im<br />
Jahr 2010 Wirklichkeit werden.<br />
http://www.consilium.europa.eu/<br />
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/<br />
misc/89786.pdf<br />
Steirische Gemeindenachrichten 7/06 11
UMWELT<br />
Mehr „Murerleben“ durch LIFE Natur Projekt<br />
Mehr Raum für unsere Mur<br />
gibt es dank des umfassenden<br />
LIFE Natur Projektes<br />
„Murerleben“. Mit der Eröffnung<br />
der Muraufweitung Weyern-Au ist<br />
ein weiterer Meilenstein – diesmal<br />
im Bezirk Knittelfeld – gesetzt<br />
worden.<br />
„Jetzt sieht alles noch nach einer riesigen<br />
Großbaustelle aus, aber schon<br />
bald wird hier eine wunderschöne<br />
Flusslandschaft entstehen“, so DI<br />
Rudolf Hornich, von der Fachabteilung<br />
für Schutzwasserwirtschaft und<br />
Bodenwasserhaushalt des Landes<br />
<strong>Steiermark</strong>. Er betonte in seinen Ausführungen<br />
vor allem die hohe Fachkompetenz<br />
der Baubezirksleitung<br />
Judenburg, die als regionaler Partner<br />
vor Ort von Beginn an mit den Umsetzungen<br />
betraut ist.<br />
Landesrat Johann Seitinger betonte<br />
in seinen Ausführungen die natürliche<br />
Hochwasser-Schutzfunktion, die<br />
durch die Reaktivierung von zusätzlichem<br />
Überflutungsraum wieder gegeben<br />
ist. Gleichzeitig appellierte er an<br />
die Bürgermeister, die im Bereich der<br />
Raumordnung bei der Umwidmung<br />
in Bauland und Gewerbegebiete<br />
sensibel darauf achten sollten, dass<br />
auch Gewässer den Raum erhalten,<br />
den sie brauchen. Abschließend<br />
meinte der zuständige Landesrat des<br />
Lebensressorts, dass die <strong>Steiermark</strong><br />
nicht nur ein Land der Wirtschaft, der<br />
Arbeit und der Innovation, sondern<br />
vor allem ein „lebenswertes“ Land<br />
bleiben sollte.<br />
Überrascht von den fortgeschrittenen<br />
Maßnahmen des LIFE Projektes<br />
„Murerleben“ war der zuständige<br />
EU Programm Manager, Dr. Federico<br />
Nogara, der im Rahmen einer<br />
viertägigen Bereisung bei der Eröffnung<br />
der Muraufweitung Weyern-Au<br />
dabei sein konnte. „Aufgrund der<br />
LIFE Projekte ist es möglich, Flusslandschaften<br />
und Auwäldern wieder<br />
jenen Stellenwert zu geben, der ihnen<br />
gebührt“, so Nogara.<br />
12 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
Schließlich kamen auch die Kleinsten<br />
unserer Gesellschaft – die Kinder – zu<br />
ihrem Einsatz: Sie setzten ihre selbst<br />
gebastelten „Murerleben“-Flöße in die<br />
Mur und hatten schon jetzt riesigen<br />
Spaß an dem neu geschaffenen Platz<br />
„Natur“.<br />
Das LIFE Natur Projekt<br />
„Obere Mur“<br />
Das LIFE Natur Projekt „Inneralpines<br />
Flussraummanagement Obere Mur“<br />
mit dem Projekttitel „Mur[er]leben“ ist<br />
eines der von der EU geförderten LIFE<br />
Programme zum Schutz von Lebensräumen<br />
und deren Tier- und Pflanzenwelt.<br />
Den geographischen Rahmen für dieses<br />
LIFE Natur Projekt bildet das 1.243 ha<br />
große Natura 2000-Gebiet „Ober- und<br />
Mittellauf der Mur mit Puxer Auwald,<br />
Puxer Wand und Gulsen“. Das generelle<br />
Projektziel ist die Wiederherstellung,<br />
Verbesserung und langfristige Sicherung<br />
der typischen Flusslandschaft<br />
als Voraussetzung für den Erhalt von<br />
seltenen und gefährdeten Tier- und<br />
Pflanzenarten.<br />
Während der 4-jährigen Projektlaufzeit<br />
werden in den drei Bezirken (Murau,<br />
Judenburg und Knittelfeld) mehr als 90<br />
Flusskilometer fischpassierbar gemacht.<br />
Sechs Altarme und Nebengewässer<br />
werden revitalisiert bzw. neu geschaffen<br />
und an die Mur angebunden. Der<br />
Ankauf von ca. 17 ha Grundflächen gewährleistet<br />
weiters, dass wieder Flächen<br />
als Hochwasser-Überflutungsgebiet<br />
reaktiviert werden können. Somit kann<br />
„passiver Hochwasserschutz“ – eines<br />
der Ziele der Schutzwasserwirtschaft<br />
– realisiert werden.<br />
Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft<br />
sich auf rund 2,2 Mio. Euro, wovon<br />
Die ganze Mannigfaltigkeit,<br />
der ganze Reiz und die ganze Schönheit des Lebens<br />
setzen sich aus Licht und Schatten zusammen.<br />
Leo Tolstoi<br />
50 % der Kosten von der EU gefördert<br />
und finanziert werden. Der nationale<br />
Anteil wird durch das Lebensministerium,<br />
das Land <strong>Steiermark</strong>, die Murauer<br />
Stadtwerke und die betroffenen Fischereiberechtigten<br />
aufgebracht.<br />
Die Muraufweitung Weyern-Au<br />
Durch Regulierungsmaßnahmen um die<br />
Jahrhundertwende wurde die Mur u.a.<br />
auch im Bereich der Weyern-Au (flussabwärts<br />
des Mursteges zwischen Weyern<br />
und Großlobming) in ihr Gewässerbett<br />
gezwängt. Durch die Eintiefung<br />
der Mur wurden Nebengewässer wie<br />
Altarme, Grabensysteme und Auweiher<br />
vom Hauptgewässer abgetrennt und<br />
waren nur noch als verlandete Relikte<br />
vorhanden. Dies zog naturgemäß einen<br />
Rückgang bzw. Verlust von charakteristischen<br />
Flusslebensräumen (Abbruchufer,<br />
Totholzanreicherung, Sand- und<br />
Kiesbänke) nach sich. Die Ufer- und<br />
Böschungssicherungen bewirkten eine<br />
starke Einschränkung der Flussdynamik<br />
bzw. der Dynamik der Auwaldstandorte.<br />
Außerdem war der ehemalige Auwald<br />
zum Großteil in einen Fichtenforst umgewandelt<br />
worden.<br />
Im Rahmen des LIFE-Natur Projektes<br />
„Murerleben“ wurden der Mur auf<br />
einer Länge von rund 1,2 km wieder<br />
Platz für die Entwicklung natürlicher<br />
Flusslebensräume gegeben. Ermöglicht<br />
wurde dies durch eine abschnittsweise<br />
Verbreiterung des Gewässerbettes auf<br />
eine Breite von bis zu 50 m, was mehr<br />
als einer Verdoppelung des ursprünglichen<br />
Gewässerbettes entspricht. Durch<br />
das Belassen einiger Schotterinseln und<br />
das Einbringen von Totholz wurde das<br />
Entstehen von Nebenarmen gefördert.<br />
Im Hinterland wurden Autümpel mit<br />
großen Flachwasserzonen als Amphibienlaichgewässer<br />
angelegt. Und sogar<br />
ein Teil der Fichtenforste kann durch<br />
den im Dezember 2005 durchgeführten<br />
Flächenerwerb und Überführung<br />
ins Öffentliche Wassergut wieder in<br />
einen natürlichen Auwald umgewandelt<br />
werden. Zudem wurde für die Bevölkerung<br />
die Zugänglichkeit zum Gewässer<br />
verbessert und mit Baumstämmen und<br />
großen Steinen Sitzgelegenheiten als<br />
Erholungsplätze geschaffen, die zum<br />
Verweilen einladen.<br />
Nähere Informationen finden Sie auf<br />
der Projekthomepage<br />
www.murerleben.at.
Stille Wasser<br />
Vom Sonnenlicht durchflutetes<br />
Wasser - dieses Merkmal haben<br />
aufgrund der geringen Tiefe<br />
kleine Stillgewässer gemeinsam, ob<br />
natürlich entstandene Weiher, Pfützen<br />
und Tümpel oder künstlich angelegter<br />
Teich. Gerade ein Weiher weckt in den<br />
meisten Menschen die Vorstellung von<br />
unberührter Natur. Kaum ein anderes<br />
Gewässer bietet eine so große Artenvielfalt<br />
auf engem Raum – im Wasser,<br />
aber auch an den ökologisch wichtigen<br />
Übergangszonen vom Land ins Wasser.<br />
Mit der Vernichtung unzähliger kleiner<br />
Stillgewässer in den letzten Jahrzehnten<br />
durch Zuschüttung, Einleitung von Abwässern,<br />
Missbrauch als Mülldeponie,<br />
intensive Fischereinutzung etc. gingen<br />
Laichgewässer für Amphibien und<br />
Libellen, Brutgebiete für Schilfbrüter<br />
– allgemein Lebensraum für Pflanzen<br />
und Tiere – verloren. Kein Wunder also,<br />
dass ihre Bewohner auf der Roten Liste<br />
für gefährdete Arten ganz oben stehen.<br />
Maßnahmen und Projektideen<br />
Feuchtbiotope anlegen: Im Idealfall<br />
sollten verschiedene Stillgewässer - größere<br />
und kleinere, tiefere und flachere -<br />
in einem Verbund angelegt werden, um<br />
Tieren Rast- und Nahrungsstationen zu<br />
schaffen und damit eine Wanderung zu<br />
ermöglichen. Damit Amphibien sie als<br />
Laichgewässer nutzen können, sollten<br />
sie zwischen Mai und August Wasser<br />
führend sein. Tiefere Stellen von mehr<br />
als 70 Zentimeter Tiefe gewähren vielen<br />
Amphibien ein sicheres Überwintern, da<br />
Gewässer dieser Tiefe selten bis zum<br />
Grund durchfrieren. Langgezogene und<br />
vielgestaltige Uferlinien verlängern die<br />
wertvolle Kontaktzone Land-Wasser.<br />
Nach Möglichkeit sollten Uferbereiche<br />
nicht bepflanzt, sondern eine sich natürlich<br />
ansiedelnde Pflanzendecke zugelassen<br />
werden.<br />
Die in den Orten meist zentral angelegten<br />
Löschteiche wurden im Laufe der<br />
Zeit zu einem typischen Teil des Ortsbildes.<br />
Mit der zentralen Wasserversorgung<br />
verschwanden sie nach und nach.<br />
Die Revitalisierung noch bestehender,<br />
vielleicht auch schon ausgetrockneter<br />
Feuerlöschteiche könnte neue Lebensräume<br />
für seltene Tier- und Pflanzenarten<br />
schaffen.<br />
Die Errichtung von Hochwasser-Rückhaltebecken<br />
als Teil des<br />
Hochwasserschutzes ist in der Regel<br />
mit Eingriffen und Zerstörungen des<br />
vorhandenen Ökosystems verbunden.<br />
Daher ist hier eine ökologische Baubegleitung<br />
unbedingt notwendig. In den<br />
neu gebildeten Stauräumen könnten<br />
z. B. Weiher, Feuchtwiesen und auwaldartige<br />
Bereiche angelegt werden.<br />
Bei Weihern, die als Erholungsgebiet<br />
genutzt werden, müssen besonders<br />
sensible Bereiche geschützt werden.<br />
Erholung Suchende mit ihren vielfältigen<br />
Freizeitaktivitäten richten zum Teil<br />
nicht wieder gutzumachende Schäden<br />
gerade in den sensiblen Uferzonen an.<br />
Bewusstseinsbildung: Ob beim „Tümpeln“<br />
oder auf Exkursionen: Kinder<br />
lernen auf spielerische Art das Leben in<br />
und an wassergeprägten Lebensräumen<br />
kennen und entwickeln so schon früh<br />
ein Verständnis für notwendige Schutzmaßnahmen.<br />
Auch die Gestaltung von<br />
„Schul- Biotopen“ ist eine gute Möglichkeit,<br />
Kindern die Bedeutung von<br />
Wasserlebensräumen anschaulich näher<br />
zu bringen. Bürger sollten zum Anlegen<br />
von Gartenteichen ermutigt werden. Im<br />
Siedlungsbereich kann eine Vielzahl<br />
kleiner, naturnaher Gewässer als Ersatzbiotop<br />
für zerstörte Lebensräume dienen.<br />
Wenn wandernde Arten genügend<br />
„Trittsteine“ haben, können sie bis in<br />
die Städte hinein erfolgreich siedeln.<br />
Die Anbringung von mehr als 150<br />
Nistkästen für Singvögel im Stadtgebiet<br />
überzeugte die Jury der<br />
Kampagne „Natur findet Stadt“<br />
des Naturschutzbundes Österreich.<br />
Weiz gewann damit einen Sonderpreis<br />
und gehört nun zu den<br />
naturfreundlichsten Gemeinden<br />
Österreichs<br />
Der Naturschutzbund Österreich hatte<br />
im Rahmen seiner Kampagne „Natur<br />
findet Stadt“ gemeinsam mit dem<br />
Lebensministerium und den Bundesforsten<br />
zum „Gemeinderanking“<br />
aufgerufen. Über 100 Einsendungen<br />
hatten die Veranstalter erreicht. Die<br />
verschiedensten Projekte zeigten,<br />
dass auch in den Städten Naturschutz<br />
möglich ist.<br />
Im Stadtgebiet von Weiz wurden<br />
beispielsweise mehr als 150 Nistkästen<br />
für Singvögel angebracht. Die<br />
Schüler der Volksschule hatten den<br />
UMWELT<br />
Für Fragen zu den Themen Naturschutz<br />
und Stadtökologie oder zur Kampagne<br />
NATUR findet Stadt wenden Sie sich<br />
bitte an den Naturschutzbund <strong>Steiermark</strong>,<br />
Dr. Axel Piswanger, Naturschutzbund<br />
<strong>Steiermark</strong>, Heinrichstraße<br />
5/II, 8010 Graz, Tel.: 0316/322377-<br />
2, Fax: DW 4 oder die Homepage<br />
www.naturschutzbund.at.<br />
Teichfrosch © Foto: Wimmer<br />
Österreichische<br />
Umweltauszeichnung für Weiz<br />
Großteil der Nistkästen selbst gebaut<br />
und auch gemeinsam mit der Berg- und<br />
Naturwacht in den Bäumen befestigt.<br />
Der so über das ganze Stadtgebiet entstandene<br />
Singvogelweg bietet der Weizer<br />
Bevölkerung und den Besuchern<br />
interessante Informationen über die<br />
heimische Singvogelwelt. Auf Grund<br />
dieser zusätzlichen Nistkästen haben<br />
sich in Weiz nun viel mehr Singvögel<br />
niedergelassen, die mehr Natur und<br />
somit mehr Erlebnis und Umweltqualität<br />
in die Stadt bringen.<br />
Für die Stadt Weiz ist Naturschutz im<br />
Siedlungsraum schon seit langem ein<br />
Thema. Zur Palette der vielfältigen Aktivitäten<br />
gehörte in den letzten Jahren unter<br />
anderem die Schaffung eines Kräutergartens<br />
und eines Waldkindergartens.<br />
Wir gratulieren der Stadt Weiz zu dieser<br />
Auszeichnung und wünschen ihr auch<br />
in Zukunft viele Ideen zur weiteren Gestaltung<br />
des „Naturerlebnisses Weiz“!<br />
Steirische Gemeindenachrichten 7/06 13
LAND & GEMEINDEN<br />
20 Jahre Steirische Eisenstraße<br />
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten<br />
vermittelt der Verein „Steirische<br />
Eisenstraße“ eine spannende<br />
Zeitreise durch Vergangenheit<br />
und Gegenwart des Erzabbaues und<br />
sorgt für neue kulturelle und wirtschaftliche<br />
Impulse.<br />
Über Jahrhunderte waren der Erzberg<br />
und die Eisenstraße eine wichtige Einnahmequelle<br />
nicht nur für die Region,<br />
sondern für das ganze Land. Seit Jahrzehnten<br />
ist diese Region jedoch einem<br />
enormen Wandel ausgesetzt. Der gemeinnützige<br />
Verein „Steirische Eisenstraße“<br />
griff diese neue Entwicklung<br />
auf und etablierte sich vor 20 Jahren,<br />
um die Neustrukturierung der Region<br />
tatkräftig zu unterstützen. Mit den<br />
Vereinsgemeinden Altenmarkt bei St.<br />
Gallen, Eisenerz, Gai, Gams bei Hieflau,<br />
Gußwerk, Hafning bei Trofaiach,<br />
Hieflau, Landl, Leoben, Niklasdorf,<br />
Palfau, Proleb, Radmer, St. Gallen,<br />
St. Peter-Freienstein, Trofaiach, Vordernberg,<br />
Weißenbach an der Enns und<br />
Wildalpen konnten bereits zahlreiche<br />
Infrastrukturprojekte höchst erfolgreich<br />
realisiert werden. Dazu gehören<br />
beispielsweise das Schaubergwerk<br />
Eisenerz, die Wassermühlen Gams,<br />
der Paradeisstollen Radmer oder die<br />
Themenwege in Trofaiach und Leoben<br />
sowie der Museumsverbund Steirische<br />
Eisenstraße. Der Verein unterstützt<br />
jährlich auch zwei Veranstaltungsreihen<br />
– das Sommerfestival „Kultur an<br />
der Eisenstraße“ und die Brauchtumsveranstaltungen<br />
im Dezember rund um<br />
das Barbarafest der Bergleute.<br />
Aufgrund der Ergebnisse<br />
aus Klimatologie, Geologie,<br />
Gesundheitssoziologie,<br />
Raumplanung und Geomantie steht<br />
fest: Die vulkanisch-geomantische<br />
Gesundheitsregion hat eine heilende<br />
Wirkung.<br />
Am Rosenberg in der Oststeiermark<br />
konnten Vulkanlandobmann LAbg. Ing.<br />
Josef Ober und sein Stellvertreter Anton<br />
Gangl die Ergebnisse zur vulkanischgeomantischen<br />
Gesundheitsregion<br />
präsentieren. Gemeindevertreter und<br />
Projektmitarbeiter waren gleichermaßen<br />
begeistert.<br />
14 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
Diese Verdienste des Vereins wurden<br />
nun mit einem Jubiläumsfest am 17.<br />
Mai im Innerberger Gewerkschaftshaus<br />
in Eisenerz gebührend gefeiert.<br />
Erzherzog Johann, verkörpert vom<br />
Schauspieler Wolfgang Dobrowsky,<br />
nahm zunächst die Festgäste auf eine<br />
Zeitreise durch die Geschichte der Region<br />
mit. „Gemeinsam sind wir stark“<br />
– in Anlehnung an das Schlusswort<br />
dieser Schauspielzeitreise – versprach<br />
Landeshauptmann Mag. Voves im<br />
Rahmen der Initiative „<strong>Steiermark</strong><br />
der Regionen“ den Gemeinden der<br />
Eisenstraße entsprechende Unterstützung<br />
und bezeichnete ihre nun bereits<br />
Der Grazer Geologie-Professor Dr. Ingomar<br />
Fritz attestierte der Region eine<br />
geologische Einzigartigkeit und Klimatologe<br />
Dr. Reinhold Lazar untermauerte<br />
die klimatische Besonderheit der Region,<br />
in der Schonklima und eine tiefe<br />
geomantische Qualität vorherrschend<br />
seien.<br />
Dr. Erwin Frohmann wanderte mit den<br />
Bürgermeistern und Gemeindevertretern<br />
der zwölf Gemeinden der vulkanischgeomantischen<br />
Gesundheitsregion<br />
zum Steinkreuz, dessen Standort eine<br />
„Energiekreuzung“ darstellt. Die feinstofflichen<br />
Kräfte von Feuer (es stünde<br />
20 Jahre währende Zusammenarbeit<br />
als erfolgreiches Konzept, das schon<br />
viel bewirkt hat. Der langjährige Obmann<br />
des Eisenstraßen-Vereins, Albin<br />
Zwanz, freute sich, dass es gelungen<br />
ist, das einzigartige montanhistorische<br />
Erbe der Region für künftige Generationen<br />
zu erhalten.<br />
Wir gratulieren dem Verein zum Jubiläum<br />
und zu seinen bisherigen Leistungen<br />
und wünschen der „Steirischen<br />
Eisenstraße“ auch weiterhin viel Erfolg<br />
auf dem gemeinsamen Weg in eine<br />
neue Zukunft der Region!<br />
Schichtturm Foto: Petra Loitzl<br />
Das Vulkanland als Gesundheitsregion<br />
für Mut und Offenheit) und Wasser (es<br />
symbolisiere die Hingabe) treffen sich<br />
am Rosenberger Steinkreuz. Frohmann<br />
sprach auch die Bründel an, deren<br />
heilende Wirkung nicht von ungefähr<br />
käme. So sei etwa der Johannisbrunn<br />
Quell eines einzigartigen Heilwassers.<br />
Die Fachleute bezeichnen diese Region<br />
daher als einen enormen Schatz für die<br />
Bevölkerung. Sie sei eine wahre Gesundheitsregion<br />
und keine oberflächliche<br />
Wellness-Destination. Die Gesundheitsregion<br />
kann damit Wegweiser in<br />
eine neue Zukunft sein.
• Aigen im Ennstal. – Im Mai war<br />
Spatenstich für das Projekt mit dem<br />
Titel „Lebendiges Zentrum“, das dem<br />
Hauptplatz neues Leben einhauchen<br />
wird. Wasserspiele, Steinvariationen<br />
und Holztreppen zum Bach werden<br />
hinkünftig ein Treffpunkt zur Förderung<br />
der Kommunikation sein.<br />
Weiters geplant sind zwei Gebäude,<br />
in denen Wohnungen, die Post, ein<br />
Blumengeschäft, ein Friseur, ein Café<br />
und ein Solarium untergebracht werden.<br />
Auch der Weg zum Putterersee<br />
wird ausgebaut und verschönert. Bis<br />
Frühjahr 2007 sollen die Vorhaben<br />
fertig gestellt sein.<br />
• Edelschrott. – Der Betrieb im neuen<br />
Kindergarten wurde zwar schon im<br />
Jänner aufgenommen, feierlich eröffnet,<br />
kirchlich gesegnet und offiziell<br />
seiner Bestimmung übergeben hat<br />
man das Gebäude aber erst im Mai im<br />
Rahmen eines Festaktes, der von der<br />
Marktmusikkapelle musikalisch umrahmt<br />
wurde. Beim anschließenden<br />
„Tag der offenen Tür“ konnten sich<br />
die Festgäste sowie Eltern, Großeltern<br />
und selbstverständlich die Kinder<br />
im neuen Gebäude umschauen.<br />
• Kammern im Liesingtal. – Am<br />
20. Mai fand ein Tag der Einsatzorganisationen<br />
statt, der von der<br />
Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam<br />
mit der Katastrophenschutzabteilung<br />
des Landes <strong>Steiermark</strong> veranstaltet<br />
wurde. Den zahlreichen Besuchern<br />
wurde eine Fahrzeug- und Gerätepräsentation<br />
samt umfangreichem<br />
Rahmenprogramm geboten, an<br />
dem das Einsatzkommando Cobra<br />
Süd, die Rettungshundebrigade, der<br />
Steirische Zivilschutzverband, die<br />
Flugeinsatzstelle Graz des Bundesministeriums<br />
für Inneres, die AUVA,<br />
das Österreichische Bundesheer,<br />
die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die<br />
Polizei, der Bergrettungsdienst, die<br />
Wasserrettung sowie der ÖAMTC<br />
mitgewirkt haben. Einsatzübungen,<br />
Bekämpfungen von Bränden und<br />
Explosionen und eine groß angelegte<br />
Katastrophenschutzübung rundeten<br />
das Programm ab. Den Abschluss des<br />
Tages bildete ein Konzert der Militärmusik<br />
Burgenland.<br />
• Leoben. – Bereits zum zehnten Mal<br />
wurde die Montanstadt Ende Juni<br />
in eine üppige Klangwolke gehüllt.<br />
Das Fest der Jugend und Musik<br />
fand jedoch heuer zum letzten Mal<br />
statt. Zum Abschied wurden die Höhepunkte<br />
der vergangenen Auftritte<br />
nochmals präsentiert und neben dem<br />
gesamtsteirischen Jugendorchester<br />
wurde ein Chor in den Mittelpunkt<br />
gestellt, der Stücke aus Musicals<br />
sang.<br />
• Ligist. – Als sechste steirische Gemeinde<br />
beteiligt sich der weststeirische<br />
Schilchermarkt an der Aktion<br />
„Fairer Handel“ vom Welthaus der<br />
Diözese Graz-Seckau. Fairer Handel<br />
bedeutet gerechte Löhne für die<br />
Produzenten, keine ausbeuterische<br />
Kinderarbeit und hohe Qualität durch<br />
naturnahe Landwirtschaft. Als „Fair-<br />
Trade-Gemeinde“ wird Ligist eine<br />
Vorbildfunktion übernehmen und<br />
künftig bei Einkäufen darauf achten,<br />
dass mindestens 25 Prozent der Produkte<br />
aus dem rechtmäßigen Handel<br />
stammen.<br />
• Mitterberg. – Ihr 40-jähriges Bestehen<br />
feierte die Österreichische<br />
Rettungshundebrigade Ende April<br />
mit einem großen Festakt und einem<br />
internationalen Rettungshunde-Turnier.<br />
Die freiwillige Einsatzorganisation,<br />
deren Aufgabe die Suche von<br />
verschütteten, verirrten oder verletzten<br />
Personen mit speziell für diese<br />
Aufgaben ausgebildeten Hunden ist,<br />
verfügt allein in der <strong>Steiermark</strong> über<br />
16 Staffeln und hat 180 Mitglieder.<br />
• Mürzhofen. – In einem Festakt<br />
wurde ein Gemeindewappen überreicht<br />
und gleichzeitig die Gemeindechronik<br />
„Mürzhofen einst und jetzt“<br />
präsentiert. Die Ehrengäste würdigten<br />
die bisherigen kommunalen<br />
Aufbauleistungen und sagten auch<br />
für zukünftige Erfolg versprechende<br />
Projekte ihre Unterstützung zu.<br />
• Mürzzuschlag. – Der Südbahn-<br />
Kulturbahnhof, der die Geschichte<br />
der Südbahn zeigt, geht nun in sein<br />
drittes Jahr. 2004 wurde das Museum,<br />
das in der ehemaligen Montierung<br />
am Bahnhof angesiedelt ist,<br />
eröffnet. Am Staatsfeiertag wurde<br />
mit einem Frühschoppen der Auftakt<br />
der Saison gefeiert, dann ging es mit<br />
dem „Erlebniszug Zauberberge“ zum<br />
Bahnhof Semmering und von dort<br />
gab es eine geführte Wanderung auf<br />
dem steirischen Bahnwanderweg.<br />
• Ottendorf an der Rittschein.<br />
– „Iku“ ist ein Wort aus der Edo-Spra-<br />
KURZMELDUNGEN<br />
che und steht für „spielend erleben“.<br />
Das taten 92 Kinder der Volksschule<br />
und des Kindergartens eine Woche<br />
lang, indem ihnen eine Begegnung<br />
mit Afrika im ganzheitlichen Sinn<br />
ermöglicht wurde. Ziel des Projekts<br />
war es, Schülern, Eltern und Lehrern<br />
eine angstfreie Begegnung mit fremden<br />
Kulturen zu bieten.<br />
• Sankt Johann bei Herberstein.<br />
– Mit einem Dorffest feierte die<br />
Gemeinde den Bauabschluss des<br />
Gemeindehauses und die Neugestaltung<br />
des Dorfplatzes. Beim Umbau<br />
des Rathauses wurde großer Wert auf<br />
Übersichtlichkeit und Zweckmäßigkeit<br />
sowie den barrierefreien Zugang<br />
gelegt. Der neu gestaltete Dorfplatz<br />
mit dem begehbaren Gemeindewappen<br />
und dem Kneippbrunnen soll im<br />
Ort eine Stätte der Begegnung für<br />
Jung und Alt sein.<br />
• Sankt Michael in Obersteiermark.<br />
– Nach der Errichtung des Dorfbrunnens<br />
vor 15 Jahren sollte nun ein weiterer<br />
Brunnen für die Wohnsiedlung<br />
in der 12. Februarstraße angeschafft<br />
werden. Bei einem Steinbildhauersymposium<br />
fand man ein Werk eines<br />
in der Gemeinde ansässigen Künstlers.<br />
Dabei handelt es sich um einen<br />
Marmorblock mit dem Titel „Hoffnung“,<br />
auf dem viele verschiedene<br />
Gesichter gezeigt werden.<br />
• Schönegg bei Pöllau. – Mit Trommel-<br />
und Tanzeinlagen der Kindergartenkinder<br />
wurde das zehnjährige<br />
Jubiläum des Kindergartens gefeiert.<br />
Begonnen hatte alles mit 17 Kindern<br />
in einem kleinen Klassenzimmer<br />
in der alten Volksschule. Nachdem<br />
immer mehr Unterbringungsplätze<br />
benötigt wurden, begann man mit<br />
tatkräftiger Unterstützung der Bevölkerung<br />
mit dem Bau eines neuen<br />
Kindergartens. Seit 1998 werden nun<br />
dort bis zu 38 Kinder betreut. Auf<br />
eine interkulturelle Erziehung sowie<br />
das Erlernen der ersten Englischvokabeln<br />
wird besonderer Wert gelegt.<br />
• Stainz. – Ab Juni gibt es in der Marktgemeinde<br />
ein eigenes kleines Kulturprogramm<br />
für Kinder von vier bis<br />
elf Jahren. In dieser Saison sind vier<br />
Theateraufführungen und ein Kreativprogramm<br />
geplant. Zur Eröffnung<br />
Mitte Juni war das „Theater Asou“ zu<br />
Gast und viele Besucher konnten im<br />
Dachbodentheater begrüßt werden.<br />
Steirische Gemeindenachrichten 7/06 15
TERMINE<br />
53. ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG<br />
21. und 22. September 2006 in WIEN<br />
Die Beschäftigungssituation ist eine wesentliche Grundlage für die Zukunft der österreichischen Gemeinden. Um die Zukunft<br />
der Menschen und die Entwicklung der Gemeinden im ländlichen Raum zu sichern, müssen Rahmenbedingungen<br />
geschaffen werden, die die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen begünstigen. Arbeit ist für die Menschen nicht nur<br />
Broterwerb, sondern schafft auch ein gutes Lebensgefühl.<br />
Der Österreichische <strong>Gemeindebund</strong> stellt daher den Gemeindetag 2006 unter das Motto „Arbeit sichern, Zukunft leben,<br />
Gemeinde stärken“, um nach innen und nach außen darzustellen, welch große Bedeutung die Frage der Arbeitsplätze im<br />
ländlichen Raum hat.<br />
Tagungsprogramm:<br />
Donnerstag, 21. September:<br />
ab 09.00 Uhr: Registrierung im Foyer D, Messezentrum<br />
11.00 Uhr: Eröffnung des Gemeindetages 2006 mit Ansprachen von Bgm. Dr. Michael Häupl und<br />
<strong>Gemeindebund</strong>präsident Bgm Helmut Mödlhammer<br />
13.30 Uhr: Start der nationalen Schwerpunktveranstaltung „Arbeitsplätze im ländlichen Raum“ mit Präsentation<br />
der KMU-Studie von Prof. Dr. Josef Mugler;<br />
Auszeichnung der „Innovativsten Gemeinde Österreichs 2006“<br />
18.00 Uhr: Sondervorstellung des Circus Roncalli am Rathausplatz<br />
20.00 Uhr: Galadinner im Wiener Rathaus<br />
Freitag, 22. September:<br />
9.00 Uhr: Empfang des Bundespräsidenten im Messezentrum<br />
9.30 Uhr: HAUPTTAGUNG des Gemeindetages<br />
mit<br />
Bundespräsident Dr. Heinz FISCHER<br />
Bundeskanzler Dr. Wolfgang SCHÜSSEL<br />
Bgm. Dr. Michael HÄUPL<br />
Präsident des Österreichischen <strong>Gemeindebund</strong>es Bgm. Helmut MÖDLHAMMER<br />
Mittagsimbiss<br />
Weitere Informationen zur Tagung finden Sie auf www.gemeindetag.at<br />
Anmeldungen und Hotelreservierungen zum Gemeindetag sind nur online über diese Homepage möglich.<br />
P.b.b. – Verlagspostamt 8020 Graz – Erscheinungsort Graz – GZ 02Z031348 M<br />
16 Steirische Gemeindenachrichten 7/06<br />
Impressum<br />
Herausgeber, Verleger und Redaktion:<br />
<strong>Steiermärkischer</strong> <strong>Gemeindebund</strong>,<br />
8010 Graz, Burgring 18;<br />
www.gemeindebund.steiermark.at<br />
Schriftleitung und für den Inhalt<br />
verantwortlich:<br />
Dr. Klaus Wenger;<br />
Produktion:<br />
Ing. Robert Möhner – Public Relations,<br />
8052 Graz, Krottendorfer Straße 5;<br />
Druck:<br />
Universitätsdruckerei Klampfer GmbH,<br />
Barbara-Klampfer-Straße 347,<br />
8181 St. Ruprecht/Raab