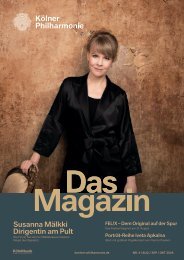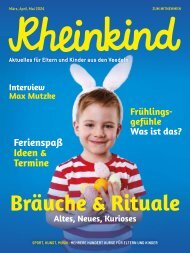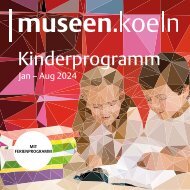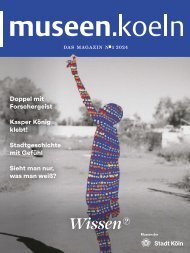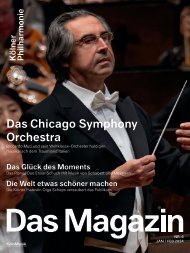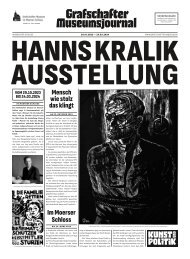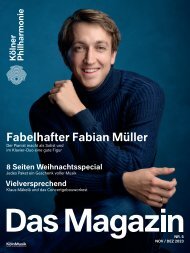Rheinkind 02/2021
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10 10<br />
11<br />
NACHHALTIGKEIT<br />
NACHHALTIGKEIT<br />
ADAC-Umfrage<br />
44%<br />
der 25- bis 34-Jährigen würden sich<br />
ein ein E-Auto kaufen (2<strong>02</strong>0)<br />
Alles Mist<br />
Problem im 19. Jahrhundert<br />
Unterwegs sein<br />
1889 fand in New York eine internationale Ministerkonferenz<br />
statt. Thema: Das allgemeine<br />
Pferdemist-Problem. Die Zahl der Pferde<br />
in den Metropolen der westlichen Welt war<br />
aufgrund der Nachfrage im Transportwesen<br />
unglaublich gewachsen, die Städte drohten<br />
im Pferdemist unterzugehen. Kommunale<br />
Dienste enstorgten die »Äpfel« meist vor<br />
der Stadt, wo stinkende Kotgruben immer<br />
mehr Fläche einnahmen. New York machte<br />
den Pferdemist für jährlich 20.000 Tote verantwortlich.<br />
Ändere sich nichts, rechnete die<br />
Times, wären Londons Straßen 1950 drei Meter<br />
hoch mit Pferdekot bedeckt. Die Minister<br />
fanden keine Lösung und brachen die Konferenz<br />
nach drei Tagen ab.<br />
Es kam anders, weil die Pferde – durchaus<br />
unerwartet – nur wenige Jahre später von<br />
Autos mit Verbrennungsmotoren abgelöst<br />
wurden. Eine Mobilitätsrevolution.<br />
Warum wir unterwegs<br />
sind – und wohin<br />
Der Weg ist nicht das Ziel<br />
Wenn wir unterwegs sind, geht es nur selten darum,<br />
unterwegs zu sein. Zumeist geht es darum,<br />
woanders zu sein. Den Weg dorthin nehmen wir<br />
lediglich in Kauf. Gelänge es uns, mit einem Fingerschnipsen<br />
von jetzt auf gleich den gewünschten<br />
Ort zu erreichen, würden die meisten wohl<br />
diese Methode bevorzugen.<br />
Warum wir Wege zurücklegen, lässt sich in vier<br />
Punkten zusammenfassen: aus Gründen der Arbeit,<br />
der Versorgung, der sozialen Gemeinschaft<br />
und der Freizeit. Wir pendeln zur Arbeitsstelle,<br />
kaufen im Supermarkt ein, bringen Kinder zur<br />
Schule, müssen zum Arzt, treffen Freunde, treiben<br />
Sport und besuchen Konzerte etc. Distanzen<br />
müssen überwunden werden. Dies wäre nachhaltiger<br />
gestaltet, wenn die meisten der Ziele<br />
nahe beieinander, am besten nahe am Wohnort,<br />
lägen. Das kann man selten selbst bestimmen.<br />
Auf welches System<br />
wir setzen<br />
Effektivität bestimmt die Wahl<br />
Welche technischen Systeme wir nutzen – und<br />
ob überhaupt – um Wege zurückzulegen, richtet<br />
sich vor allem danach, was uns zur Verfügung<br />
steht und wie effektiv es uns ans Ziel bringt. Für<br />
alles in unmittelbarer Nähe ist das Zufußgehen<br />
das Mittel der Wahl. Für nahe bis mittlere Distanzen<br />
eignet sich das Fahrrad hervorragend,<br />
auch in seiner Form als Lastenrad für Einkäufe<br />
und kleinere Transporte. Danach kommen Bus,<br />
Bahn und das Auto in Betracht sowie für Fernziele<br />
Zug und Flugzeug. In der Wahl des richtigen<br />
Mobilitäts werkzeugs steckt großes Potenzial<br />
für Nachhaltigkeit. Kommen motorisierte Fahrzeuge<br />
zum Einsatz, sollten sie möglichst viele<br />
Menschen gleichzeitig transportieren und dabei<br />
Strom als Antriebsenergie nutzen. Leihsysteme<br />
können erhebliche Ressourcen einsparen, Fliegen<br />
verbraucht die meisten.<br />
Welche Energie<br />
uns antreibt<br />
Stromer oder Verbrenner<br />
Die Nutzung kohlebasierter Treibstoffe wie Benzin<br />
und Diesel sind verantwortlich für große Teile<br />
der jährlich freigesetzten CO2-Mengen. Zukünftig<br />
müssen wir auf Antriebsysteme setzen, die<br />
erneuerbare Energien verwenden. In Frage kommen<br />
Elektro- und Wasserstoffmotoren. Zur Herstellung<br />
von Wasserstoff wird ebenfalls Strom<br />
benötigt. Entscheidend ist also, wie unser Strom<br />
produziert wird. Kommt er aus Kohlekraftwerken,<br />
ist nichts gewonnen.<br />
Die Zukunft der Mobilität hängt also nicht nur davon<br />
ab, mit welchen Fahrzeugen wir selbst fahren<br />
und Dinge transportieren lassen, sondern<br />
wesentlich auch davon, dass zum Beispiel vor der<br />
Küste Windkraftanlagen entstehen, deren Strom<br />
dann mit Überlandleitungen verteilt wird.<br />
Ältere sehen noch eher die Schwierigkeit der Umrüstung,<br />
Jüngere setzen schon stark aufs E-Auto.<br />
Länger gut gekleidet<br />
Mehr Qualität shoppen<br />
SELBSTVERSTÄNDLICH KLEIDEN WIR uns, um uns vor Umwelteinflüssen zu schützen. Die maßgebliche<br />
Funktion unserer Kleidung ist heute jedoch ihre kommunikative Wirkung. Kleidung ist Kommunikation.<br />
Über Kleidung vermitteln wir zum Beispiel, welcher sozialen Gruppe wir uns zugehörig<br />
fühlen (möchten). Weil das so ist, tun wir uns so schwer damit, sie nach nur wirtschaftlichen oder<br />
gar ökologischen Kriterien auszuwählen. Vor dem Spiegel stehend fragen wir »Wie sehe ich aus?«<br />
und nicht »Wie nachhaltig wirke ich?« Oder doch? Erleben wir vielleicht gerade, dass einflussreiche<br />
Gruppen wie Fridays for Future einen Wechsel des Einkaufsverhaltens bewirken?<br />
Tatsächlich sehen wir wohl gerade einen Höhepunkt der sich seit Jahren intensivierenden Fast fashion-<br />
Entwicklung. Vormals gab es zwei Kollektionen im Jahr, deren Wechsel jeweils vom Sommer- oder Winterschlussverkauf<br />
angekündigt wurde, dann vier, die sich an den Jahreszeiten orientierten. Mittlerweile arbeitet<br />
man in der Modeindustrie mit 12 Kollektionen oder mehr. Der schnelle Wechsel soll dazu anhalten,<br />
beständig Neues zu kaufen. Damit man sich das häufige Shoppen leisten kann, muss das Angebot so<br />
preiswert wie möglich sein. Deshalb sparen Hersteller am Material, an der Verarbeitung und an den Lohnkosten.<br />
Häufig produziert man in Schwellenländern bei Partnerunternehmen, die ihren Arbeitern kaum<br />
Mindestlöhne zahlen und Umweltstandards nicht ernst nehmen. Jeder Deutsche kauft heute durchschnittlich<br />
60 neue Kleidungsstücke jährlich – trägt sie aber nur halb so lange wie noch vor 15 Jahren.<br />
Strom vor Benzin<br />
Der erste Pkw fuhr mit Batterie<br />
Das Elektrofahrzeug ist eine Erfindung des<br />
19. Jahrhunderts. Der Schotte Robert Anderson<br />
entwickelte es wohl zwischen 1832 und<br />
1839. Als weltweit erster elektrisch angetriebener<br />
Personenkraftwagen gilt der Flocken-<br />
Elektrowagen von 1888, gefertigt in der Maschinenfabrik<br />
Andreas Flocken in Coburg.<br />
Nach den Dampfkraftwagen und noch vor<br />
den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor waren<br />
die Elektrofahrzeuge ihren Konkurrenten<br />
technisch überlegen.<br />
Ab ca. 1910 übernahmen dann die Benziner<br />
die Führung und verbannten die »Stromer«<br />
zum Dasein in einer kaum beachteten<br />
Nische, aus der sie nun kraftvoller denn je<br />
wieder hervortreten.<br />
Welche Infrastruktur<br />
nötig ist<br />
Weniger Asphalt, mehr Digitales<br />
Viele Autos brauchen viel Platz – zum Fahren und<br />
vor allem zum Herumstehen: Das beim Fahren<br />
Meistgesuchte sind wohl Parkplätze. Versiegelte<br />
Flächen schaden allerdings den Böden und begünstigen<br />
Hochwasser. Für Autos reservierte Flächen<br />
können nicht mehr für Wohnhäuser oder für<br />
die Landwirtschaft genutzt werden. Auch Busse,<br />
Straßenbahnen oder Züge benötigen Raum zum<br />
Fahren, verbrauchen aber deutlich weniger Fläche<br />
pro transportierter Person. Es ist nachhaltiger<br />
ihren Flächenanteil auszubauen und den des<br />
Individualverkehrs zu reduzieren.<br />
Unbedingt auszubauen ist die digitale Verkehrsinfrastruktur.<br />
Je enger sich einzelne Verkehrsteilnehmer<br />
miteinander vernetzen, desto effektiver<br />
können Flächen und Einrichtungen genutzt<br />
werden. Neu einzurichten sind Ladestationen für<br />
nachhaltig strombetriebene Fahrzeuge.<br />
Die Zukunft der<br />
Mobilität<br />
Forscher entwerfen das Morgen<br />
Das wichtigste Mobilitätssystem der Zukuft wird<br />
wohl das Handy sein. Ihm nennen wir unser Ziel<br />
sowie unsere Präferenzen und erhalten in Sekunden<br />
einen effektiven Mobilitätsvorschlag. Unser<br />
Transportmittel holt uns da ab, wo wir gerade<br />
sind und bringt uns autonom genau dort hin, wo<br />
wir hinwollen. Dabei sind wir, je nach Wunsch und<br />
Geldbeutel, der einzige Fahrgast oder kutschieren<br />
zusammen mit anderen. Kleine Fahrmodule<br />
schließen sich zu größeren Antriebseinheiten zusammen,<br />
um ferne Ziele nachhaltiger anzusteuern.<br />
Stau- und Parkprobleme gibt es nicht, weil<br />
alle Module miteinander vernetzt sind. Die Fahrzeit<br />
lässt sich schon zur Arbeit oder für soziale<br />
Kontakte nutzen. Abgerechnet wird automatisch<br />
nach dem gebuchten Tarif. So braucht es wenig<br />
Fahrzeuge und nur ein Mindestmaß an versiegelter<br />
Fläche zum Fahren.<br />
Tipps für nachhaltige<br />
Mobilität<br />
Was jeder selbst machen kann<br />
#1 Mehr zu Fuß gehen<br />
Alle kurzen Distanzen lassen sich im Grunde zu<br />
Fuß zurücklegen. Das ist nachhaltig und gesund.<br />
#2 Aufs Rad setzen<br />
Bei allen Wegen, die man nicht zu Fuß gehen<br />
möchte, zuerst ans Rad denken.<br />
#3 Ein freies Lastenrad benutzen<br />
Man muss auch mal etwas transportieren. Lastenräder<br />
lassen sich übers Internet ausleihen.<br />
#4 Das Auto mit anderen teilen<br />
Mit Fahrgemeinschaften hat man oft eine bessere<br />
CO2-Bilanz, als im öffentlichen Nahverkehr.<br />
#5 Straßenbahn, Bus und Bahn nutzen<br />
Je mehr gemeinsam fahren, desto besser. Das<br />
spart Treibstoff und Raum für Infrastruktur.<br />
#6 Kurzstreckenflüge meiden<br />
Flugzeuge setzen im Betrieb eine Menge CO2- frei.<br />
Fliegen sollte durch Bahnfahren ersetzt werden.<br />
Die weltweite Textilproduktion sorgt jährlich für den Ausstoß von mehr Kohlendioxid als alle internationalen<br />
Flüge und die Seeschifffahrt zusammen. Die Produktion von zehn Jeans verursacht fast genau<br />
so viel CO2 wie ein Flug von Berlin nach München. Insgesamt verbraucht die Modeindustrie etwa<br />
10 Prozent des industriell genutzten Wassers. Für die Verarbeitung von einem Kilogramm Baumwolle<br />
kommt fast ein Kilogramm Chemikalien zum Einsatz. Der Kleidung sieht man das leztlich nicht an.<br />
Geht es auch anders? Was kann man tun? Das Einfachste: Fashion bleibt okay, wenn man zumindest<br />
das »fast« herausnimmt. Kleidung sollte schlicht länger getragen werden und so qualitätvoll<br />
sein, dass sie das auch aushält. Möchte man sie selbst nicht mehr anziehen, kann man sie an Second-Hand-Läden<br />
weitergeben und sich dort gleich selbst<br />
Neues aussuchen – auch dafür muss die Qualität<br />
stimmen. Da zunehmend übers Internet gekauft<br />
wird, kann man seine Suchkriterien um Stichworte<br />
wie ökologisch oder Biobaumwolle erweiten. Die<br />
Unternehmen werden es registrieren und entsprechend<br />
reagieren. Zudem kann man auf Siegel wie<br />
den Grünen Knopf achten (mehr auf www.siegelklarheit.de).<br />
Einer der einfachsten Tipps: Den eigenen Kleiderschrank<br />
zweimal im Jahr durchforsten und so feststellen,<br />
was man gar nicht oder nur wenig getragen<br />
hat – auf solche Kleidung dann verzichten. Das spart<br />
auch Geld für qualitativ hochwertigeres Shoppen.